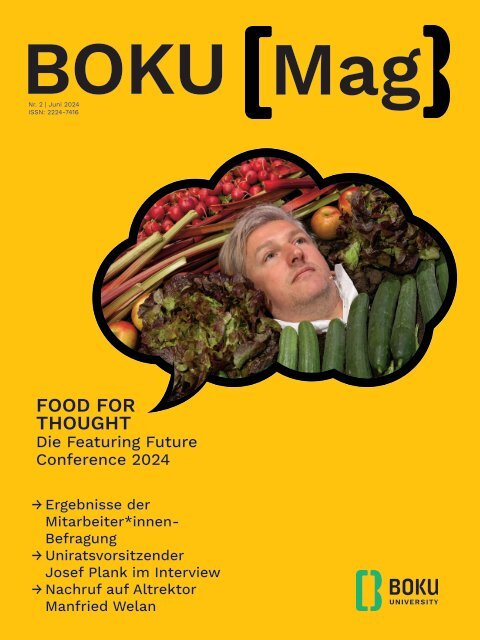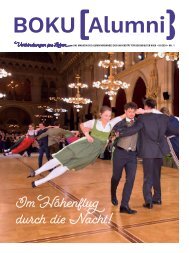BOKU Magazin 2/2024
Inhalt 3 Editorial 5 Featuring Future Conference 2024: Nachhaltige Landwirtschaft: Zwischen Gentechnik, Pestiziden und Umweltschutz 6 Erträge, Konflikte und Chancen 9 Der Geschmack der Zukunft: Zwischen Real Omnivores und pflanzenbasierter Ernährung 10 Die Erbse als Sympathieträgerin 13 Warum die Ernährungszukunft außerhalb unserer Komfortzone liegt 14 Auf dem Teller der Welt 17 Die Featuring Future Conference 2024 in Bildern 19 Interview Universitätsratsvorsitzender Josef Plank 21 Warum eine neue Marke für die BOKU? 24 Ergebnisse der Mitarbeiter*innenbefragung 28 Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe feiert 25-jähriges Bestehen 32 Spring School EPICUR und BOKU:BASE 33 Eine Zukunft ohne Schokolade? 35 Die BOKU FoodCoop 36 Empowering Youth as Bioeconomy Changemakers 38 Fünf Jahre Zentrum für Bioökonomie 40 Einreichung für den BOKU-Nachhaltigkeitspreis 41 Citizen Science 42 Ergebnisse Studierendenumfrage zu Inklusion 44 Der erste BOKU-Diversity Day 45 Der Töchtertag 2024 an der BOKU 46 Die Bedeutung von KI in der forschungsgeleiteten Lehre 51 Wie steht es um „Ethik“ in der Lehre an der BOKU? 53 Das Tutor*innen-Zertifikat 56 Mikrobiologie für Agrarwissenschaften und für das tägliche Leben 58 Connecting Time 60 Splitter 62 Die BOKU trauert um Manfried Welan 64 Studentische Start-ups 66 Submitting a grant 67 Pre-check Ideenformular 68 Das neue „FIS3+“
Inhalt
3 Editorial
5 Featuring Future Conference 2024: Nachhaltige Landwirtschaft: Zwischen Gentechnik, Pestiziden und Umweltschutz
6 Erträge, Konflikte und Chancen
9 Der Geschmack der Zukunft: Zwischen Real Omnivores und pflanzenbasierter Ernährung
10 Die Erbse als Sympathieträgerin
13 Warum die Ernährungszukunft außerhalb unserer Komfortzone liegt
14 Auf dem Teller der Welt
17 Die Featuring Future Conference 2024 in Bildern
19 Interview Universitätsratsvorsitzender Josef Plank
21 Warum eine neue Marke für die BOKU?
24 Ergebnisse der Mitarbeiter*innenbefragung
28 Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe feiert 25-jähriges Bestehen
32 Spring School EPICUR und BOKU:BASE
33 Eine Zukunft ohne Schokolade?
35 Die BOKU FoodCoop
36 Empowering Youth as Bioeconomy Changemakers
38 Fünf Jahre Zentrum für Bioökonomie
40 Einreichung für den BOKU-Nachhaltigkeitspreis
41 Citizen Science
42 Ergebnisse Studierendenumfrage zu Inklusion
44 Der erste BOKU-Diversity Day
45 Der Töchtertag 2024 an der BOKU
46 Die Bedeutung von KI in der
forschungsgeleiteten Lehre
51 Wie steht es um „Ethik“ in der Lehre an der BOKU?
53 Das Tutor*innen-Zertifikat
56 Mikrobiologie für Agrarwissenschaften und für das tägliche Leben
58 Connecting Time
60 Splitter
62 Die BOKU trauert um Manfried Welan
64 Studentische Start-ups
66 Submitting a grant
67 Pre-check Ideenformular
68 Das neue „FIS3+“
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
Nr. 2 | Juni <strong>2024</strong><br />
ISSN: 2224-7416<br />
FOOD FOR<br />
THOUGHT<br />
Die Featuring Future<br />
Conference <strong>2024</strong><br />
→ Ergebnisse der<br />
Mitarbeiter*innen-<br />
Befragung<br />
→ Uniratsvorsitzender<br />
Josef Plank im Interview<br />
→ Nachruf auf Altrektor<br />
Manfried Welan
INHALT<br />
3 Editorial<br />
4 Featuring Future Conference <strong>2024</strong>:<br />
Nachhaltige Landwirtschaft:<br />
Zwischen Gentechnik, Pestiziden<br />
und Umweltschutz<br />
6 Erträge, Konflikte und Chancen<br />
8 Der Geschmack der Zukunft:<br />
Zwischen Real Omnivores und<br />
pflanzenbasierter Ernährung<br />
10 Die Erbse als Sympathieträgerin<br />
12 Warum die Ernährungszukunft<br />
außerhalb unserer Komfortzone liegt<br />
14 Auf dem Teller der Welt<br />
16 Die Featuring Future Conference<br />
<strong>2024</strong> in Bildern<br />
19 Interview Universitätsratsvorsitzender<br />
Josef Plank<br />
20 Warum eine neue Marke<br />
für die <strong>BOKU</strong>?<br />
24 Ergebnisse der Mitarbeiter*innenbefragung<br />
28 Institut für Chemie nachwachsender<br />
Rohstoffe feiert 25-jähriges Bestehen<br />
32 Spring School EPICUR und <strong>BOKU</strong>:BASE<br />
33 Eine Zukunft ohne Schokolade?<br />
35 Die <strong>BOKU</strong> FoodCoop<br />
36 Empowering Youth as<br />
Bioeconomy Changemakers<br />
38 Fünf Jahre Zentrum für Bioökonomie<br />
40 <strong>BOKU</strong>-Nachhaltigkeitspreis <strong>2024</strong><br />
41 Citizen Science<br />
42 Ergebnisse Studierendenumfrage zu<br />
Inklusion<br />
44 Der erste <strong>BOKU</strong>-Diversity Day<br />
45 Der Töchtertag <strong>2024</strong> an der <strong>BOKU</strong><br />
46 Die Bedeutung von KI in der<br />
forschungsgeleiteten Lehre<br />
51 Wie steht es um „Ethik“ in der<br />
Lehre an der <strong>BOKU</strong>?<br />
53 Das Tutor*innen-Zertifikat<br />
56 Mikrobiologie für Agrarwissenschaften<br />
und für das tägliche Leben<br />
58 Heritage Science Austria & ICOMO<br />
60 Splitter<br />
62 Die <strong>BOKU</strong> trauert um Manfried Welan<br />
64 Studentische Start-ups<br />
66 Submitting a grant<br />
67 Pre-check Ideenformular<br />
68 Das neue „FIS3+“<br />
70 Forschung FAQ<br />
Strategische Kooperation <strong>BOKU</strong>-<br />
Umweltbundesamt<br />
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
4<br />
8 24<br />
35<br />
45<br />
46<br />
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
GERHARD RAINER
EDITORIAL<br />
<strong>BOKU</strong>/GEORG WILKE<br />
O DIE <strong>BOKU</strong> UNIVERSITY BLICKT<br />
ÜBER DEN TELLERRAND<br />
EVA SCHULEV-STEINDL<br />
Rektorin<br />
Sehr geehrte Leser*innen, liebe Studierende und Kolleg*innen!<br />
Wie weit können und wollen wir als Konsument*innen<br />
beeinflussen, was auf unseren<br />
Tellern liegt und wie die Lebensmittel hergestellt<br />
werden? Unter welchen Bedingungen müssen<br />
und können Landwirt*innen bei uns, aber auch weltweit,<br />
produzieren – heute und in der Zukunft? Diese Fragen<br />
diskutierten die Keynote Speaker*innen und Podiumsgäste<br />
am 22. Mai gemeinsam mit dem Publikum bei der <strong>BOKU</strong><br />
Featuring Future Conference <strong>2024</strong> „Farm.Food.Future“.<br />
Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass es für vielfältige<br />
Herausforderungen nicht die Lösung gibt und dass wir<br />
hier an der <strong>BOKU</strong> University genau die richtige Forschung<br />
betreiben, um der Komplexität dieser Zukunftsfragen gerecht<br />
werden zu können und nachhaltige Lösungen zu<br />
entwickeln. Diese reichen von den Agrarwissenschaften<br />
bis zur Lebensmitteltechnologie, von der Biotechnologie in<br />
der Pflanzenproduktion bis zu den Nutztierwissenschaften.<br />
Unsere Studierenden erhalten nicht nur eine ausgezeichnete<br />
fachliche Ausbildung, an der <strong>BOKU</strong> lernen sie<br />
auch, dass der eigene Horizont nicht am Tellerrand endet.<br />
An dieser Stelle möchte ich allen herzlich danken, die<br />
geholfen haben, dass die <strong>BOKU</strong> Featuring Future Conference<br />
auch heuer wieder erfolgreich war und wir den Besucher*innen<br />
food for thought mitgeben konnten: Herrn<br />
Bundesminister Norbert Totschnig für die Eröffnungsrede,<br />
unseren Sponsoren, den Keynote Speaker*innen,<br />
Diskutant*innen, der Öffentlichkeitsarbeit und allen, die<br />
an der Organisation der Tagung mitgewirkt haben. Ganz<br />
besonders gilt mein Dank auch Barbara Stöckl, die heuer<br />
bereits zum dritten Mal die Moderation übernommen hat.<br />
Leider mussten wir im Mai von Altrektor Manfried Welan<br />
Abschied nehmen, der im 86. Lebensjahr verstorben ist,<br />
und der die <strong>BOKU</strong> mit seinem intellektuellen Weitblick<br />
geprägt hat wie nur wenige. Sein Tod hinterlässt eine Lücke<br />
in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und bei all<br />
jenen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, mit ihm zu<br />
arbeiten oder von ihm zu lernen. Wir werden ihn in allerbester<br />
Erinnerung behalten.<br />
Ich möchte mich abschließend wieder aufs Herzlichste<br />
bei den Autor*innen dieser Ausgabe bedanken.<br />
Ihnen, liebe Leser*innen, wünsche ich eine angenehme,<br />
anregende Lektüre und einen erholsamen Sommer.<br />
Eva Schulev-Steindl<br />
IMPRESSUM: Medieninhaberin und Herausgeberin: <strong>BOKU</strong> University, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien Chefredaktion: Bettina Fernsebner-Kokert<br />
Redaktion: Hermine Roth Autor*innen: AG Öffentlichkeitsarbeit der <strong>BOKU</strong> FoodCoop, Michael Ambros, Manfred Bardy-Durchhalter, Marco Beaumont,<br />
Florian Borgwardt, Johanna Burtscher, Damiano Cilio, Daniel Dörler, Katrin Euller, Mary Carolina García Lino, Olivier Guillaume, Philip Guttenbrunner,<br />
Gertrud Haidvogl, Caroline Hammer, Sophie Hanak, Florian Heigl, Benedikt Huber, Vanessa Kaiser, Ulrike Krippner, Caroline Kunesch, Andrea Lamprecht,<br />
Anika Leodolter, Wolfgang Liebert, Zacharias Lumerding, Gerhard Mannsberger, Horst Mayr, Harald Pauli, Lena Peterstorfer, Leon Ploszczanski, Ela Posch,<br />
Harald Rennhofer, Marie-Thérèse Salcher-Konrad, Ruth Scheiber-Herzog, Alexandra Strauss-Sieberth, Sabina Tandari, Verena Vlajo, Stefan Vogel, Eva<br />
Wagner, Johann Werfring, Manuela Winkler, Andreas Zitek Lektorat: Michaela Kolb Grafik: Patricio Handl Coverfoto: <strong>BOKU</strong> University/APA-Fotoservice/<br />
Juhasz Druck: Druckerei Berger Auflage: 5.500 Erscheinungsweise: 4-mal jährlich Blattlinie: Das <strong>BOKU</strong> Mag versteht sich als Informationsmedium für<br />
Angehörige, Absolvent*innen, Freund*innen der <strong>BOKU</strong> University und soll die interne und externe Kommunikation<br />
fördern. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autorin oder des Autors wieder und müssen<br />
mit der Auffassung der Redaktion nicht übereinstimmen. Redaktionelle Bearbeitung und Kürzung von Beiträgen<br />
aus Platzgründen vorbehalten. Beiträge senden Sie bitte an: public.relations@boku.ac.at Bei Adressänderung<br />
wenden Sie sich bitte an: alumni@boku.ac.at<br />
UZ24<br />
„Schadstoffarme<br />
Druckerzeugnisse“<br />
UW 734<br />
Dieses Produkt<br />
stammt aus nachhaltig<br />
bewirtschafteten<br />
Wäldern und<br />
kontrollierten Quellen<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
3
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
CHEMIE & GENTECHNIK.<br />
WARUM NICHT?<br />
4 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Nachhaltige Landwirtschaft: Zwischen<br />
Gentechnik, Pestiziden und Umweltschutz<br />
Der Journalist und „Diplombauer“ Timo Küntzle beleuchtet die Herausforderungen<br />
der heutigen Landwirtschaft und der Ernährung unserer wachsenden<br />
Weltbevölkerung. Ein realistischer Blick auf die Rolle der Gentechnik und<br />
Pestizide ist dabei unerlässlich.<br />
Von Sophie Hanak<br />
Kann man die Natur lieben, auf<br />
nahrhafte Lebensmittel Wert<br />
legen und gleichzeitig für den<br />
Einsatz von Pestiziden und Gentechnik<br />
sein? Ich bin der Meinung, dass<br />
man das sein muss, wenn man die<br />
Ernährung der Weltbevölkerung ernst<br />
nimmt“, hält Timo Küntzle gleich zu<br />
Beginn seiner Keynote fest.<br />
Selbst in der ökologischen Landwirtschaft<br />
kommen Pflanzenschutzmittel<br />
zum Einsatz, allerdings meist natürlichen<br />
Ursprungs wie Kupfer, das Insektizid<br />
Spinosad oder Pyrethrum.<br />
Auch die Natur selbst produziert chemische<br />
Verbindungen, die Schädlinge<br />
abwehren. „Ein bekanntes Beispiel<br />
ist Koffein im Kaffee, ein Nervengift,<br />
das Insekten fernhält“, sagt Küntzle.<br />
Studien zeigen, dass wir täglich etwa<br />
1,5 Gramm solcher natürlicher Pestizide<br />
zu uns nehmen – das Zehntausendfache<br />
der Menge, die wir über<br />
chemische Pflanzenschutzmittel aufnehmen.<br />
„Warum werden wir dennoch<br />
alle immer älter, obwohl wir sowohl<br />
synthetische als auch natürliche Pestizide<br />
zu uns nehmen? Das liegt am<br />
Grundgesetz der Toxikologie: Die Dosis<br />
macht das Gift. Daher ist ein umsichtiger<br />
Einsatz notwendig und wir<br />
sollten Pflanzenschutzmittel auf ein<br />
Minimum beschränken, um unsere<br />
Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.“<br />
Diesbezüglich biete die Biolandwirtschaft<br />
einige Vorteile, so Küntzle.<br />
Dort werden deutlich weniger Pflanzenschutzmittel<br />
eingesetzt, weniger<br />
Treibhausgase und Stickstoffemissionen<br />
verursacht und zudem wird<br />
den Nutztieren mehr Platz geboten.<br />
Allerdings sind die Erträge geringer,<br />
was bedeutet, dass mehr Anbaufläche<br />
benötigt wird. Dies kann wiederum zu<br />
einem Anstieg der absoluten Emissionen<br />
durch den größeren Flächenbedarf<br />
führen. „Nicht alles, was für<br />
die Biodiversität gut ist, eignet sich<br />
zur Bekämpfung des Klimawandels<br />
und nicht alles, was für das Tierwohl<br />
optimal ist, eignet sich zur Produktion<br />
der klimaeffizientesten Lebensmittel“,<br />
erklärt Küntzle.<br />
Doch wie steht es mit der Gentechnik?<br />
Hier sei ein realistischer Blick<br />
notwendig. „Österreich ist nicht gentechnikfrei,<br />
auch nicht die Biolandwirtschaft“,<br />
betont Küntzle, denn<br />
„viele Sorten, die bei uns im Umlauf<br />
sind, wurden mit Hilfe der Mutagenese<br />
gezüchtet.“ Dabei wird das Saatgut<br />
radioaktiver Strahlung oder chemischer<br />
Behandlung ausgesetzt und so<br />
die Mutationsrate in diesen Pflanzen<br />
künstlich erhöht. Auf diese Weise produziert<br />
man zufällige Veränderungen<br />
ILLUSTRATION: ANIKA LEODOLTER<br />
und schaut dann, ob eine davon möglicherweise<br />
einen Nutzen bringt. Bei<br />
der neuesten Methode werden mittels<br />
der Genschere CRISPR präzise<br />
gentechnisch veränderte Organismen<br />
hergestellt. „Wir benötigen diese Methoden,<br />
um den Pflanzen zu helfen,<br />
sich an den Klimawandel anzupassen“,<br />
sagt Küntzle. „Die Gentechnik ist<br />
kein Allheilmittel, kann aber definitiv<br />
helfen, Pflanzenschutzmittel einzusparen,<br />
Erträge zu steigern und Landflächen<br />
wieder freizugeben.“<br />
Abschließend, so Küntzle, lasse sich<br />
sagen, dass ein ausgewogener, ehrlicher<br />
Blick auf das gesamte Ernährungssystem<br />
notwendig sei. „Es ist<br />
entscheidend, die Schattenseiten zu<br />
erkennen und Lösungen zu entwickeln,<br />
die sowohl die Ernährungssicherheit<br />
gewährleisten als auch den<br />
Umweltschutz fördern. Nachhaltige<br />
Intensivierung und der kluge Einsatz<br />
von Technologien wie Gentechnik<br />
können dabei eine wichtige Rolle<br />
spielen.“<br />
■<br />
Timo Küntzle ist Journalist und Autor. Besonders<br />
interessiert er sich für die Zielkonflikte<br />
zwischen Landwirtschaft und<br />
Umweltschutz. Sein 2022 erschienenes<br />
Buch „Landverstand“ befasst sich mit den<br />
zahlreichen Zusammenhängen zwischen<br />
Lebensmittelproduktion, Klima, Biodiversität<br />
und anderen Nachhaltigkeitsaspekten.<br />
Mit einem Agrar-Diplom in der Tasche<br />
verschlug es ihn in den Journalismus. Seit<br />
Herbst 2021 arbeitet er für den Verein Land<br />
schafft Leben an Hintergrundrecherchen<br />
zum Themenkomplex Landwirtschaft und<br />
Nachhaltigkeit.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
5
Die Zukunft der Landwirtschaft:<br />
Erträge,<br />
Konflikte und Chancen<br />
FOTOS: CHRISTOPH GRUBER<br />
Von Sophie Hanak<br />
Die Diskussion um die Zukunft der Landwirtschaft wirft<br />
komplexe Fragen auf: Können biologische Anbauverfahren den<br />
Hunger bekämpfen? Wie lassen sich Zielkonflikte zwischen<br />
Klimaschutz und Landwirtschaft lösen? Und welche Rolle soll<br />
Gentechnik in der Pflanzenzucht und Tierhaltung spielen?<br />
»Ich denke, dass eine<br />
ehrliche Darstellung der<br />
Vor- und Nachteile der<br />
Gentechnik noch fehlt.«<br />
Christine Leeb<br />
Zu Beginn der Diskussion zum<br />
Topic „Chemie & Gentechnik.<br />
Warum nicht?“ geht Christian<br />
Vogl vom Institut für Ökologischen<br />
Landbau der <strong>BOKU</strong> auf die Vorteile<br />
der biologischen Landwirtschaft ein,<br />
wie etwa den positiven Effekt auf die<br />
Biodiversität, auf den Boden und der<br />
Reduktion der Treibhausgase. „Bezüglich<br />
der negativen Folgen wird immer<br />
wieder erwähnt, dass die biologische<br />
Landwirtschaft weniger Ertrag bringt.<br />
Ich glaube aber, dass die Lebensmittelsicherheit<br />
und damit der Hunger<br />
auf der Welt nur in gewissem Maße<br />
vom Ertrag abhängig ist. Meist sind<br />
dafür Konflikte, Krisen und der Zugang<br />
zu Land verantwortlich“, so Vogl.<br />
„Wenn wir den Fleischkonsum und<br />
die Lebensmittelabfälle reduzieren<br />
würden, dann werden ziemlich große<br />
Flächenanteile frei werden und darauf<br />
könnten wir dann mehr Biolandwirtschaft<br />
betreiben.“ Dem entgegnet<br />
Timo Küntzle: „Der Weltklimarat<br />
sagt, dass wir auf den frei verfügbaren<br />
Flächen Wälder pflanzen und Moore<br />
wachsen lassen sollen. Ein biologisches<br />
Feld speichert nur einen geringen<br />
Anteil des Kohlenstoffs, den ein<br />
Moor oder ein Wald speichern kann.“<br />
V. l.: Timo Küntzle, Christian Vogl, Christine Leeb, Siegrid Steinkellner, Hermann<br />
Bürstmayr und Moderatorin Barbara Stöckl<br />
liche Folge abschätzen“, sagt Siegrid<br />
Steinkellner vom Institut für Pflanzenschutz.<br />
„Gentechnik ist eine sinnvolle<br />
Methode, aber es wird nicht alle<br />
Probleme lösen. Beim Pflanzenschutz<br />
kombinieren wir viele verschiedene<br />
Bausteine und Gentechnik wird einer<br />
davon sein.“<br />
GENTECHNIK, EIN<br />
WERKZEUG UNTER VIELEN<br />
Dem stimmt Hermann Bürstmayr<br />
vom Institut für Biotechnologie in<br />
der Pflanzenproduktion zu: „Die neuen<br />
genomischen Methoden sind ein<br />
weiteres tolles Werkzeug in unserem<br />
bereits vorhandenen Werkzeugkoffer<br />
in der Pflanzenzüchtung. Die<br />
klassische Züchtung wird die Hauptarbeit<br />
leisten, aber für das eine oder<br />
andere Merkmal, wie etwa Schädlingsresistenzen,<br />
wird die Gentechnik<br />
nützliche Lösungen liefern.“ Es gebe<br />
bereits zahlreiche Anwendungen, bei<br />
denen Gentechnik sinnvoll sei und so<br />
»Die neuen genomischen<br />
Methoden sind ein tolles<br />
Werkzeug zu unserem<br />
bereits vorhandenen<br />
Werkzeugkoffer in der<br />
Pflanzenzüchtung.«<br />
Hermann Bürstmayr<br />
Moderatorin Barbara Stöckl greift daraufhin<br />
das Thema Gentechnik auf,<br />
über das aktuell wieder diskutiert<br />
wird: „Was ist über die Folgen und das<br />
Risiko bekannt?“ „Mittlerweile sind die<br />
Verfahren sehr gut untersucht. Wir<br />
können diese aber nicht bis ins letzte<br />
Detail prüfen und nicht jede mögder<br />
Einsatz von Pestiziden reduziert<br />
werden könne. Diese Technologien<br />
könnten dazu beitragen, die Umweltbelastung<br />
zu verringern und gleichzeitig<br />
die landwirtschaftlichen Erträge<br />
zu steigern. „Hier können wir als <strong>BOKU</strong><br />
6 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
»Gentechnik ist eine<br />
sinnvolle Methode, aber<br />
es wird nicht alle<br />
Probleme lösen.«<br />
Siegrid Steinkellner<br />
mit all unserer Expertise gemeinsam<br />
Antworten finden“, so Bürstmayr.<br />
EHRLICHE DARSTELLUNG<br />
DER VOR- UND NACHTEILE<br />
Trotz der teils emotionalen Debatte<br />
rund um Gentechnik sollten die<br />
Ängste und Sorgen der Bevölkerung<br />
von der Wissenschaft und der Politik<br />
gehört werden und ein öffentlicher<br />
Diskurs stattfinden. „Ich denke, dass<br />
eine ehrliche Darstellung der Vor- und<br />
Nachteile der Gentechnik noch fehlt,“<br />
betont Christine Leeb vom Institut für<br />
Nutztierwissenschaften. In der Nutztierhaltung<br />
ist die Gentechnik noch<br />
nicht so stark vertreten wie bei den<br />
Pflanzen. „Es gibt bereits verschiedenste<br />
gentechnische Ansätze, wie<br />
etwa der Einsatz von Wachstumsgenen<br />
in Lachsen. Wichtig ist dabei ein<br />
sinnvoller und durchdachter Umgang.<br />
Beispielsweise wurde eine Zeit lang<br />
so gezüchtet, dass möglichst viele<br />
Ferkel geboren werden, bis man dann<br />
irgendwann erkannt hat, dass damit<br />
die Ferkelsterblichkeit steigt – eine<br />
Sau hat nun mal nur 14 Zitzen“, erklärt<br />
Leeb.<br />
Wer sind nun die Gewinner? „Leider<br />
beobachten wir in den letzten Jahren,<br />
dass immer mehr Bäuerinnen<br />
und Bauern aus der Landwirtschaft<br />
aussteigen, denn diese sind sicherlich<br />
nicht die Gewinner*innen. Doch<br />
es sollte unser Ziel sein, diese in der<br />
Landwirtschaft zu halten und dafür<br />
brauchen wir Strategien“, sagt Vogl.<br />
»Unser Ziel muss es sein,<br />
Bäuerinnen und Bauern<br />
in der Landwirtschaft zu<br />
halten und dafür brauchen<br />
wir Strategien.«<br />
Christian Vogl<br />
KLEINE LÖSUNGEN<br />
ZUSAMMENFÜGEN<br />
Die Podiumsteilnehmer*innen sind<br />
sich jedenfalls einig, dass wir unseren<br />
Blick auf das große Ganze richten und<br />
umsichtige Maßnahmen setzen müssen.<br />
Timo Küntzle erwähnte bereits in<br />
seiner vorangegangenen Keynote Zielkonflikte,<br />
auf welche wir eindeutige<br />
Antworten brauchen. „In der Landwirtschaft<br />
wird es immer Zielkonflikte<br />
geben und wir müssen uns mit diesen<br />
auseinandersetzen und versuchen,<br />
individuelle Lösungen zu finden. Für<br />
jedes einzelne Problem wird es kleine<br />
Lösungen geben, die wir dann zusammenfügen<br />
müssen“, stimmt Steinkellner<br />
zu. Derzeit wird besonders die<br />
Genschere CRISPR als neue gentechnische<br />
Methode diskutiert und auch<br />
die Frage, ob Lebensmittel, die mit<br />
CRISPR behandelt wurden, für den<br />
Menschen gefährlich seien. Bisherige<br />
Studien und Untersuchungen zeigen,<br />
dass CRISPR-gezüchtete Pflanzen in<br />
der Regel genauso sicher sind wie<br />
herkömmlich gezüchtete Pflanzen.<br />
Wir müssen uns bewusst machen,<br />
dass alles, was mittels der Genschere<br />
erzeugt werden kann, genauso in der<br />
Natur entstanden sein könnte. „Es ist<br />
wichtig zu betonen, dass die Methode,<br />
wie eine Pflanze verändert wurde,<br />
keine Bedeutung hat. Ich möchte hier<br />
gerne das Beispiel des „Golden Rice“<br />
erwähnen. Dieser hat einen höheren<br />
Pro-Vitamin-A-Gehalt und hat ernährungsphysiologisch<br />
große Bedeutung.<br />
Er wurde gentechnisch hergestellt<br />
»Wir müssen vom<br />
Schubladendenken<br />
wegkommen, umfassend<br />
recherchieren und<br />
aufklären.«<br />
Timo Küntzle<br />
und deswegen verteufelt. Aber hätte<br />
eine Bäuerin in Tibet diesen Reis zufällig<br />
in ihrem Garten gefunden – was<br />
möglich wäre – gäbe es dafür den<br />
Alternativnobelpreis. Damit möchte<br />
ich sagen, dass wir Acht geben müssen,<br />
wie wir über die Dinge sprechen:<br />
Das gleiche Produkt kann einmal so<br />
und einmal so hergestellt werden und<br />
einmal wird es in den Medien zerfetzt<br />
und das andere Mal würde es gelobt<br />
werden“, warnt Bürstmayr.<br />
WEG VOM SCHUBLADENDENKEN<br />
Ein ausgewogener und differenzierter<br />
Diskurs über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln<br />
und Gentechnik in<br />
der Landwirtschaft ist also dringend<br />
notwendig. „Mein Appell an die Medien<br />
und alle, die in der Öffentlichkeit<br />
kommunizieren, lautet: Wir müssen<br />
vom Schubladendenken wegkommen,<br />
umfassend recherchieren und aufklären.<br />
Es wird beispielsweise oft gesagt,<br />
dass Pflanzenschutzmittel und Gentechnik<br />
ausschließlich interessant für<br />
große Agrarbetriebe wären. Doch auch<br />
Kleinbauern haben Bedarf an diesen<br />
Technologien und profitieren von deren<br />
Einsatz“, so Küntzle abschließend. ■<br />
Zum Nachsehen<br />
Topic 1<br />
Chemie & Gentechnik.<br />
Warum nicht?<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
7
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
ANGEBOT UND NACHFRAGE.<br />
WER LENKT HIER WEN?<br />
8 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Der Geschmack der Zukunft:<br />
Zwischen Real Omnivores und<br />
pflanzenbasierter Ernährung<br />
In ihrer Keynote zum Topic „Angebot und Nachfrage. Wer lenkt hier wen?“<br />
erläutert Hanni Rützler, warum Food Trends Antworten auf aktuelle Probleme,<br />
Wünsche und Sehnsüchte sind. Aus Sicht der Foodtrend-Forscherin<br />
geht es eben nicht nur um Angebot und Nachfrage.<br />
Von Sophie Hanak<br />
Unsere Geschichte und die<br />
Entwicklung unseres Gehirns<br />
sind stark mit der Geschichte<br />
unserer Esskultur verbunden. Das<br />
Feuer und damit das Kochen haben<br />
uns den Zugang zu einer Vielzahl von<br />
Nährstoffen ermöglicht“, erklärt Hanni<br />
Rützler. Heute haben wir einen großen<br />
Einfluss auf unsere Umwelt und<br />
ein Wandel zu einem nachhaltigen<br />
Ess- und Einkaufsverhalten von uns<br />
allen ist notwendig. Aber auch unser<br />
Ernährungssystem muss geändert<br />
werden. Dazu müssen auch die Akteur*innen<br />
unseres Ernährungssystems,<br />
die Lebensmittelproduktion,<br />
die Lebensmittelverarbeitung, der Lebensmittelhandel,<br />
die Gastronomie,<br />
der Tourismus, die Hotellerie und die<br />
Politik beitragen.<br />
In ihrem Future Food Studio analysiert<br />
Rützler mit ihrem Team seit 25 Jahren<br />
Veränderungen in unserer Esskultur<br />
und in der Food & Beverage-Branche.<br />
Sie helfen Kunden entlang der gesamten<br />
Lebensmittelkette, Trends frühzeitig<br />
zu verstehen und für das eigene<br />
Unternehmen nutzbar zu machen. „Wir<br />
haben Food Trends definiert als Entwicklungstendenzen,<br />
die aufzeigen, in<br />
welche Richtung sich unsere Esskultur<br />
entwickeln kann. Food Trends sind Antworten<br />
auf aktuelle Probleme, Wünsche<br />
und Sehnsüchte“, sagt Rützler.<br />
WENIGER FLEISCH,<br />
WENIGER LEBENSMITTELABFÄLLE<br />
Zwei Themen sind besonders relevant,<br />
wenn es darum geht, wie wir uns<br />
zukünftig nachhaltiger ernähren: die<br />
Reduktion des Fleischkonsums und<br />
der Lebensmittelabfälle. Es zeigt sich<br />
eine große Entwicklungstendenz hin<br />
zu einer pflanzenbasierten Ernährung.<br />
Diese Entwicklungen wurden durch<br />
eine intensive ethische Debatte angestoßen.<br />
Ihnen gegenüber stehen beispielsweise<br />
die Flexitarier, die weniger<br />
Fleisch essen, aber nicht vollständig<br />
darauf verzichten wollen. Der Trend<br />
der Real Omnivores zeigt wiederum<br />
eine Offenheit für neue Lösungen, wie<br />
beispielsweise das Essen von Insekten.<br />
Im Umgang mit Lebensmittelabfällen<br />
hat sich in den vergangenen Jahren<br />
noch zu wenig getan. „Wir werfen ein<br />
Drittel unserer Lebensmittel weg, wir<br />
benötigen eine größere Wertschätzung<br />
gegenüber diesen“, betont Rützler. Ein<br />
ILLUSTRATION: ANIKA LEODOLTER<br />
bereits gut etabliertes Programm seien<br />
etwa die Plattform „Too Good to<br />
Go“, die dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung<br />
zu reduzieren, oder<br />
ein Unternehmen in der Wachau, das<br />
Marillenkerne zur Herstellung neuer<br />
Produkte wie Pudding und Milchersatz<br />
verarbeitet.<br />
„Wir müssen aus der Ambivalenz he r-<br />
auskommen und klare Zukunftsbilder<br />
entwickeln, inspiriert von Trends von<br />
außen. Schlussendlich geht es nicht<br />
nur um Angebot und Nachfrage, sondern<br />
darum, dass wir unsere Werte<br />
ernst nehmen“, so Rützler. „Erinnern<br />
Sie sich: Es sind nicht die Größten und<br />
nicht die Intelligentesten, die überleben,<br />
sondern jene, die auf den Wandel<br />
reagieren“, so Rützler abschließend.■<br />
Hanni Rützler Die Gründerin und Leiterin<br />
des futurefoodstudios ist eine der führenden<br />
Foodtrend-Forscher*innen Europas. Als<br />
ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin<br />
und Gesundheitspsychologin bewegt sie<br />
sich professionell zwischen den Disziplinen<br />
und versteht es, verschiedene Erkenntnisse<br />
zusammenzuführen und auf überraschende<br />
Weise fruchtbar zu machen. In ihren Studien<br />
zur Zukunft der Ernährung sowie ihrem<br />
jährlich erscheinenden Foodreport spürt<br />
sie dem Wandel der Konsumkultur nach<br />
und versteht nachhaltige Foodtrends von<br />
kurzfristigen Moden und Medien-Hypes zu<br />
unterscheiden.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
9
Ernährung im Wandel:<br />
Die Erbse als<br />
Sympathieträgerin<br />
Von Sophie Hanak<br />
Die Podiumsgäste beim Topic 2<br />
„Angebot & Nachfrage. Wer lenkt<br />
hier wen?“ diskutierten über die<br />
Bereitschaft zu alternativen Proteinquellen,<br />
wie wir Lebensmittelabfälle<br />
verringern können und<br />
warum Insekten für die meisten<br />
(noch) gar nicht gehen.<br />
<strong>BOKU</strong> UNIVERSITY/APA-FOTOSERVICE/JUHASZ<br />
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
V. l.: Hanni Rützler, Klaus Dürrschmid, Henry Jäger, Gudrun Obersteiner, Petra Riefler<br />
und Moderatorin Barbara Stöckl<br />
Unsere Ernährung ist äußerst<br />
komplex geworden und betrifft<br />
zahlreiche Bereiche wie Soziales,<br />
Ethik, Gesundheit und Nachhaltigkeit.<br />
Doch kann es am Ende<br />
nicht doch einfacher sein, indem wir<br />
uns darauf konzentrieren, was uns<br />
schmeckt? Klaus Dürrschmid vom<br />
Institut für Lebensmittelwissenschaften<br />
meint dazu: „Der Mensch ist ein<br />
schmeckendes Tier, das zwischen gut<br />
und schlecht unterscheiden kann.<br />
Die Beurteilung unserer Nahrung ist<br />
teilweise angeboren oder durch die<br />
Erziehung entstanden und beginnt<br />
bereits im Mutterleib. Ich denke, dass<br />
es wichtig ist, bereits werdende Mütter<br />
auf eine gute Ernährung hinzuweisen,<br />
um das Bewertungssystem<br />
des zukünftigen Kindes positiv zu<br />
beeinflussen. Auch sollte bereits in<br />
Schulen und Kindergärten mit sensorischen<br />
Ernährungsschulungen begonnen<br />
werden. Das ist viel Arbeit und<br />
nimmt viel Zeit in Anspruch, aber so<br />
können beispielsweise Neophobien<br />
aufgehoben werden, was heutzutage<br />
für eine Änderung des Ernährungssystems<br />
wichtig ist.“<br />
Ein aktueller Trend ist die Reduktion<br />
des Fleischkonsums, um die Umwelt<br />
zu schonen. Aber wie reagieren Konsumenten<br />
darauf, und was erwarten<br />
sie? „Anstatt Fleisch können wir als<br />
Eiweißquelle Hülsenfrüchte nutzen,<br />
doch oft haben wir noch Probleme,<br />
uns neue Arten der Zubereitung zu<br />
überlegen. Auch sind die Menschen<br />
von Fleisch gewisse sensorische Gewohnheiten<br />
und Texturen gewohnt<br />
und wollen diese nicht missen. Hier<br />
kann die Technologie einspringen,<br />
indem aus pflanzlichen Rohstoffen<br />
Fleischimitate hergestellt werden.<br />
Auf diese Weise können wir den Verbrauchern<br />
helfen, sich vom Fleisch<br />
etwas wegzubewegen, ohne sofort<br />
auf den sensorischen Eindruck verzichten<br />
zu müssen“, erklärt Henry<br />
Jäger vom Institut für Lebensmitteltechnologie.<br />
Ein weiterer Schritt ist die Herstellung<br />
von Fleisch im Labor. Hanni Rützler<br />
war 2013 eine der ersten, die es<br />
probiert haben: „Das waren damals<br />
reine Muskelzellen, gefärbt mit Rote-<br />
Bete-Saft. Zu Anfang hatte ich Angst<br />
vor der Konsistenz, diese war dann<br />
ein bisschen knuspriger als normal,<br />
aber überraschend nahe am Original.<br />
Diese Nachahmung war schon damals<br />
sehr beeindruckend, und in der<br />
»Laborfleisch ist eine<br />
ernstzunehmende<br />
Alternative, die die<br />
Ernährung der Zukunft<br />
mitgestalten wird.«<br />
Hanni Rützler<br />
»Die Haushalte sind in<br />
der EU diejenigen, die<br />
mit Abstand die meisten<br />
Lebensmittelabfälle<br />
verursachen.«<br />
Gudrun Obersteiner<br />
Zwischenzeit hat sich sehr viel getan.<br />
Ich glaube, dass Laborfleisch eine Zukunft<br />
hat und neben den pflanzlichen<br />
Produkten eine ernstzunehmende Alternative<br />
ist, allerdings gibt es zuvor<br />
noch einige Hürden zu bewältigen.“<br />
10 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
<strong>BOKU</strong> UNIVERSITY/APA-FOTOSERVICE/JUHASZ<br />
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
»Es sollte bereits in<br />
Schulen und Kindergärten<br />
mit einer Ernährungsschulung<br />
begonnen<br />
werden, um Präferenzen<br />
positiv zu beeinflussen.«<br />
Klaus Dürrschmid<br />
»Viele Menschen sind<br />
bereit, ihre Ernährungsgewohnheiten<br />
zu ändern,<br />
aber nur ein Teil kann<br />
sich Insekten als eine<br />
potenzielle alternative<br />
Proteinquelle vorstellen.«<br />
Petra Riefler<br />
»Haltbarmachungsverfahren<br />
tragen zur<br />
Reduzierung von Lebensmittelabfällen<br />
bei und<br />
verbessern die Effizienz<br />
der Lebensmittelverarbeitung.«<br />
Henry Jäger<br />
LEBENSMITTEL-<br />
WEGWERFGESELLSCHAFT<br />
Wenn wir über Ernährung sprechen,<br />
müssen wir auch über Lebensmittelabfälle<br />
reden. „In den letzten Jahren<br />
hat sich bezüglich der Lebensmittelabfälle<br />
sehr viel getan. Es haben sich<br />
einige Programme entwickelt, die zur<br />
Abfallvermeidung beitragen. In Österreich<br />
kennen mittlerweile zwei Drittel<br />
der Konsument*innen die Initiative<br />
„Too Good to Go“. Ein Drittel nutzt es<br />
zumindest ab und zu und acht Prozent<br />
nutzen es regelmäßig“, berichtet<br />
Gudrun Obersteiner vom Institut für<br />
Abfall- und Kreislaufwirtschaft. „Die<br />
Haushalte sind in der EU diejenigen,<br />
die mit Abstand die meisten Lebensmittelabfälle<br />
verursachen. Das wird oft<br />
angezweifelt, aber es ist so: Auch wenn<br />
wir alle immer nur wenig wegwerfen<br />
– wir sind viele, und so kommen am<br />
Ende des Tages enorm große Mengen<br />
zusammen“, warnt Ober steiner. Letztendlich<br />
können Haltbarmachungsverfahren<br />
helfen, Lebensmittelabfälle zu<br />
reduzieren. „Wenn die Dauer der Haltbarkeit<br />
von Lebensmitteln erhöht wird,<br />
wird damit mehr Flexibilität in der Logistik<br />
und auch beim Konsumenten im<br />
Haushalt geschaffen. So können sich<br />
das gesamte Einkaufsmanagement<br />
und die Lagerung zuhause entsprechend<br />
entspannen, “ erläutert Jäger.<br />
ABFÄLLE IN DER<br />
PRODUKTIONSKETTE BELASSEN<br />
Wenn trotzdem Abfälle entstehen,<br />
sollte versucht werden, diese zu verwerten.<br />
„Abfälle werden als Nebenströme<br />
in der Lebensmittelverarbeitung<br />
angesehen. Die Technologie hat<br />
hier eine entscheidende Rolle, wenn<br />
es darum geht, diese Nebenströme<br />
nicht aus der Lebensmittelkette fallen<br />
zu lassen, sondern zu versuchen,<br />
sie wieder in die Lebensmittelverarbeitung<br />
einzubringen,“ erklärt Jäger.<br />
An der Publikumsumfrage zum Thema,<br />
wie wir uns zukünftig ernähren<br />
werden, haben knapp über 100 Personen<br />
teilgenommen, wobei das Publikum<br />
an der <strong>BOKU</strong> vermutlich nicht<br />
repräsentativ für die österreichische<br />
Gesamtbevölkerung ist. „Vegetarier*innen<br />
und Veganer*innen sind<br />
stark repräsentiert, es gibt sehr viele<br />
Flexitarier*innen und der unterrepräsentierte<br />
Anteil an Personen sind<br />
die der Fleischesser*innen“, erläutert<br />
Petra Riefler vom Institut für Marketing<br />
und Innovation. Auf die Frage,<br />
wie bereit die Teilnehmer*innen sind,<br />
ihre Ernährung zu verändern, gaben<br />
fast die Hälfte an, dass sie sich in<br />
einer Neuorientierung befänden und<br />
sich gerne regionaler und saisonaler<br />
ernähren möchten.<br />
PRINZESSINNEN AUF DER ERBSE<br />
„Wenn wir kein Fleisch essen, hat die<br />
Erbse das beste Image, gefolgt von<br />
Pilzen und Soja. Allerdings kann sich<br />
nur ein Teil der Personen Insekten<br />
als eine potenzielle alternative Proteinquelle<br />
vorstellen und rund vier<br />
von zehn Personen sagen, dass sie<br />
sich Fleisch aus dem Labor vorstellen<br />
können, während eine große Gruppe<br />
dem nicht zustimmt“, so Riefler zu<br />
den Ergebnissen.<br />
Doch egal, welche Ernährungsform<br />
wir gewählt haben, auch zu viel des<br />
Guten ist zu viel. Auf die Frage von<br />
Barbara Stöckl, ob wir in Mitteleuropa<br />
zu viel essen, antwortet Dürrschmid<br />
eindeutig mit Ja: „Wenn wir uns die<br />
Adipositasrate unserer Gesellschaft<br />
anschauen, dann ist diese exorbitant<br />
hoch.“<br />
■<br />
Zum Nachsehen<br />
Topic 2<br />
Angebot & Nachfrage.<br />
Wer lenkt hier wen?<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
11
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
KALKÜL & COURAGE.<br />
WER SITZT MIT AM TISCH?<br />
12 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Warum die Ernährungszukunft<br />
außerhalb unserer<br />
Komfortzone liegt<br />
In ihrer Keynote zum Topic „Kalkül & Courage. Wer sitzt mit am Tisch?“ stellt<br />
die Soziologin Auma Obama ihre Stiftung „Sauti Kuu“ in Kenia vor und spricht<br />
über ihre Vision, wie der afrikanische Kontinent zu einem globalen Vorreiter<br />
in Sachen Ernährung und Nachhaltigkeit werden könnte.<br />
Von Sophie Hanak<br />
Zukunftsfähige Landwirtschaft<br />
und nachhaltige Ernährung<br />
sind nur möglich, wenn bestimmte<br />
Faktoren berücksichtigt<br />
werden, wie beispielsweise ein ökologischer<br />
Anbau im Einklang mit der<br />
Natur. „Wir müssen darauf achten, was<br />
wir essen und wie dies unsere Natur<br />
beeinflusst. Dafür ist es nötig, aus<br />
unserer Komfortzone herauszukommen“,<br />
fordert Obama. „Die Bio-Landwirtschaft<br />
ist in Österreich ziemlich<br />
weit fortgeschritten und ich hatte das<br />
Glück, hier einige Bauernhöfe zu besuchen.<br />
Auf einem davon sah ich acht<br />
verschiedene Sorten Karotten – solch<br />
eine Vielfalt müssen wir unbedingt<br />
nützen“, so Obama.<br />
DIE JUGEND VON HEUTE:<br />
HOFFNUNG FÜR MORGEN<br />
Diese Werte vermittelt Obama in Kenia<br />
in ihrer Stiftung „Sauti Kuu“, was so<br />
viel bedeutet wie „starke Stimmen“.<br />
Sie arbeitet dort mit Kindern und jungen<br />
Menschen im Alter von vier bis<br />
25 Jahren zu ökologischer Landwirtschaft,<br />
nachhaltigen Methoden und<br />
vor allem dazu, „dass Armut keine<br />
Ausrede ist“. Die Stiftung baut energiesparende<br />
Küchen, legt Küchengärten<br />
an, pflanzt Bäume und fängt<br />
Regenwasser auf.<br />
Die jungen Menschen, mit denen<br />
„Sauti Kuu“ arbeitet, sind die Hoffnungsträger*innen,<br />
denn „sie sind<br />
aufmerksam, informiert und wissen,<br />
was sie wollen“, sagt Obama. Die Soziologin<br />
glaubt fest an eine vielversprechende<br />
Zukunft Afrikas. 70 Prozent<br />
der Afrikaner*innen leben auf<br />
dem Land und betreiben Landwirtschaft.<br />
Afrika könnte zum „Food Basket<br />
of the World“ werden, aber dafür<br />
müssten faire und wettbewerbsfähige<br />
Bedingungen geschaffen werden.<br />
„Wenn es uns in Afrika schlecht geht,<br />
wird es euch auch schlecht gehen“,<br />
mahnt sie.<br />
ERNÄHRUNGSGERECHTIGKEIT:<br />
EINE GLOBALE VERANTWORTUNG<br />
Ein weiteres Thema, das Obama an-<br />
ILLUSTRATION: ANIKA LEODOLTER<br />
spricht, ist der enorme Abfall, den<br />
wir täglich produzieren. Unsere Meere<br />
sind voll mit Plastik, und das Problem<br />
wird oft unterschätzt. „In Europa<br />
sieht alles so ordentlich aus, dass<br />
man leicht den falschen Eindruck bekommt,<br />
alles sei in Ordnung. Bei uns<br />
in Afrika sieht man das sofort, wenn<br />
man aus dem Flugzeug aussteigt -<br />
den Dreck und die Unordnung“, gibt<br />
sie zu bedenken.<br />
Auma Obama verweist weiters auf<br />
die Ernährungsgerechtigkeit. Während<br />
Afrika Lebensmittel exportiert, leiden<br />
viele Menschen dort unter Nahrungsmangel.<br />
„Afrika und Europa müssen<br />
zusammenarbeiten, aber nicht in<br />
Form von Entwicklungshilfe, sondern<br />
als Partner*innen“, fordert sie.<br />
Denn, betont Auma Obama abschließend,<br />
nur ein Miteinander und nicht<br />
ein Gegeneinander könne zu einer<br />
besseren Zukunft führen. ■<br />
Auma Obama ist Germanistin, Soziologin,<br />
Keynote Speakerin, Bestsellerautorin und<br />
Vorsitzende ihrer Stiftung Sauti Kuu und<br />
lebt heute in Nairobi. Sie ist Vorsitzende der<br />
Kinder- und Jugendlichen-Kommission des<br />
„World Future Council“ und Schirmherrin<br />
des größten afrikanischen Bücherfestivals<br />
„Storymoja“. Ihre Autobiografie „Das Leben<br />
kommt immer dazwischen: Stationen einer<br />
Reise“ erschien 2010 in deutscher Sprache.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
13
Auf dem Teller der Welt<br />
Von Sophie Hanak<br />
Beim 3. Topic „Kalkül & Courage.<br />
Wer sitzt mit am Tisch?“ beleuchten<br />
die Podiumsgäste globale<br />
Herausforderungen und lokale<br />
Lösungen für unser Ernährungssystem.<br />
<strong>BOKU</strong> UNIVERSITY/APA-FOTOSERVICE/JUHASZ<br />
V. l.: Auma Obama, Marianne Penker, Karlheinz Erb, Stefanie Lemke, Charlotte Kottusch und Moderatorin Barbara<br />
Stöckl<br />
Die Frage, wie wir uns ernähren,<br />
ist nicht nur eine persönliche<br />
Entscheidung, sondern auch<br />
ein Thema von globaler Bedeutung.<br />
Trotz unseres Wissens über notwendige<br />
Maßnahmen, um Probleme in<br />
der Ernährung zu lösen, bleiben viele<br />
Herausforderungen bestehen.<br />
Stefanie Lemke vom Institut für Entwicklungsforschung<br />
betont: „Wir haben<br />
weltweit eine sehr ungleiche Verteilung.<br />
Die Zahl der unterernährten<br />
Menschen steigt stetig und gleichzeitig<br />
haben wir ein sehr hohes Ausmaß<br />
an Überernährung, das global 40<br />
Prozent beträgt.“<br />
In den Welternährungsgipfel der Vereinten<br />
Nationen 2021 wurden große<br />
Hoffnungen gesetzt. Hier kam es zu<br />
einer Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum<br />
zur Transformation<br />
unserer Ernährungssysteme. Die Expert*innen<br />
der Zivilgesellschaft wurden<br />
jedoch ausgeschlossen, was laut<br />
Lemke ein großes Hindernis darstellt.<br />
»Die Zahl der<br />
unterernährten Menschen<br />
steigt stetig und<br />
gleichzeitig haben wir ein<br />
sehr hohes Ausmaß an<br />
Überernährung.«<br />
Stefanie Lemke<br />
„Wir wissen, was wir tun müssten,<br />
um die Probleme hinsichtlich unserer<br />
Ernährung zu lösen, wir tun es aber<br />
nicht.“ Die Beteiligung der Zivilgesellschaft<br />
sei jedoch entscheidend.<br />
ERNÄHRUNGSSTRATEGIE<br />
Charlotte Kottusch möchte mit dem<br />
Wiener Ernährungsrat genau das tun<br />
»Unsere Ernährung ist<br />
sehr fragmentiert, und<br />
wir brauchen eine<br />
zusammenhängende<br />
Ernährungspolitik.«<br />
Charlotte Kottusch<br />
und erklärt: „Der Ernährungsrat ist<br />
eine Initiative, die unter anderem<br />
das Ziel verfolgt, in der Stadt gutes<br />
Essen für alle bereitzustellen. Unsere<br />
Ernährung ist sehr fragmentiert<br />
und wir brauchen eine zusammenhängende<br />
Ernährungspolitik. So haben<br />
wir uns Bürger*innen zusammengeschlossen<br />
und sind in einen<br />
14 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
»Wir müssen die<br />
Warenketten so gestalten,<br />
dass sie unseren<br />
Ansprüchen an eine gute<br />
Ernährung in der Zukunft<br />
entsprechen.«<br />
Marianne Penker<br />
»Wenn es so läuft wie<br />
bisher, dann wird das<br />
Ernährungssystem<br />
bis ins Jahr 2050 das<br />
globale Emissionsbudget<br />
aufgebraucht haben.«<br />
Karlheinz Erb<br />
»Wir müssen zurück<br />
zur Basis, auch hier in<br />
Europa. Jeder Mensch<br />
muss mitverantworten,<br />
was er isst.«<br />
Auma Obama<br />
Dialog mit der Stadtverwaltung getreten,<br />
um eine Ernährungsstrategie<br />
voranzutreiben.“<br />
Dem lokalen Blick steht der globale<br />
gegenüber. Beide Perspektiven müssen<br />
berücksichtigt werden, um nachhaltige<br />
und gerechte Ernährungssysteme<br />
zu schaffen. „Denn wir leben<br />
auf einem gemeinsamen Planeten,<br />
in einer globalen Wirtschaft und die<br />
Warenketten verbinden verschiedene<br />
Kontinente. Wir müssen die Warenketten<br />
so gestalten, dass sie unseren<br />
Ansprüchen an eine gute Ernährung<br />
in der Zukunft entsprechen,“ betont<br />
Marianne Penker vom Institut für<br />
Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung.<br />
Sie hebt ebenfalls die Bedeutung der<br />
Zusammenarbeit zwischen Landwirt*innen,<br />
Bürger*innen und Regierungen<br />
hervor.<br />
NUR NOCH WENIG LAND ÜBRIG<br />
Karlheinz Erb vom Institut für Soziale<br />
Ökologie sieht die Rolle des<br />
Ernährungssystems hinsichtlich der<br />
Landnutzung und des Klimawandels<br />
kritisch und betont die Notwendigkeit,<br />
innovative Lösungen zu finden,<br />
die international akzeptiert werden.<br />
„Wir nutzen ungefähr drei Viertel der<br />
Landoberfläche. Es ist nur noch wenig<br />
Land übrig und dieses ist entweder<br />
zu heiß, zu kalt oder zu weit<br />
weg.“ Er warnt: „Wenn es so läuft wie<br />
bisher, dann wird das Ernährungssystem<br />
bis ins Jahr 2050 das globale<br />
Emissionsbudget aufgebraucht<br />
haben.“ Innovationen seien dringend<br />
notwendig, um international akzeptierte<br />
Lösungen zu finden.<br />
Wie schon in ihrer Keynote zuvor<br />
plädiert Auma Obama für eine Vereinfachung<br />
des Ernährungssystems:<br />
„Wir müssen zurück zur Basis, auch<br />
hier in Europa. Wir sollten versuchen,<br />
unsere regionalen Produkte<br />
zu nutzen. Jeder Mensch muss mitverantworten,<br />
was er isst.“ Penker<br />
ergänzt: „Essen kann als Menschenrecht<br />
gesehen werden und als unsere<br />
Beziehung zur Natur. Hinsichtlich<br />
unserer Vorstellung von Mensch-Natur-Beziehung<br />
können wir sehr viel<br />
von Afrika lernen.“<br />
Lemke stimmt zu, dass die Ernährung<br />
heute zu kompliziert geworden<br />
ist und betont: „Wir könnten viel<br />
ändern, wenn wir bewusster essen<br />
würden. In meiner früheren Arbeit als<br />
Ernährungsberaterin habe ich immer<br />
wieder beobachtet, dass Menschen<br />
ihre Probleme oftmals über das Essen<br />
ausdrücken, in Form von Essstörungen<br />
oder anderen Formen der<br />
Fehlernährung. Das ist in mehreren<br />
Hinsichten ein großes Problem.“<br />
PROBLEM LAND GRABBING<br />
Stefanie Lemke bringt abschließend<br />
noch einen wichtigen Aspekt<br />
zum Thema land grabbing in Afrika<br />
zur Sprache und verdeutlicht die geschlechtsspezifischen<br />
Ungleichheiten,<br />
die damit einhergehen. „In Afrika<br />
können Frauen kein Land erben, das<br />
heißt, das Land wird nur an männliche<br />
Familienmitglieder weitergegeben.“ Im<br />
Zuge der Klimazertifikate werde dies<br />
noch weiter zunehmen. „Deshalb ist<br />
es wichtig, dass Frauen mehr Mitspracherecht<br />
bekommen, aber auch die<br />
Männer müssen empowert werden,<br />
damit nicht die gesamte unbezahlte<br />
Care-Arbeit auf die Frauen abgeladen<br />
wird,“ so Lemke anschließend. ■<br />
Zum Nachsehen<br />
Topic 3<br />
Kalkül & Courage.<br />
Wer sitzt mit am Tisch?“<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
15
Impressionen<br />
Fotos von <strong>BOKU</strong> University/APA-Fotoservice/Juhasz<br />
und <strong>BOKU</strong>/Christoph Gruber<br />
Doris Schmidauer war ebenfalls unter den<br />
Zuhörer*innen.<br />
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig bei der Eröffnung<br />
Christoph Metzker, Vorstandsdirektor RWA<br />
Knapp 500 Besucher*innen<br />
kamen zur Featuring Future<br />
Conference <strong>2024</strong><br />
Rektorin Eva Schulev-Steindl und Vizerektor Christian Obinger (li)<br />
Leonhard Gollegger, Geschäftsführer der<br />
Goodmills Group im Talk mit Barbara Stöckl<br />
16 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Schnell eine letzte Insta-Story vor dem Start: Moderatorin<br />
Barbara Stöckl mit <strong>BOKU</strong>-Social Media Manager Jakob Vegh<br />
Rektorin Eva Schulev-Steindl im „Seitenblicke“-Interview<br />
Markus Wagner, CEO AGRANA Fruit, auf der Bühne mit Barbara<br />
Stöckl<br />
Selfie Time: Robert Pichler vom Österreichischen Raiffeisenverband<br />
mit Auma Obama<br />
Uniratsvorsitzender Josef Plank und ÖH <strong>BOKU</strong>-Vorsitzender<br />
Christian Malecki<br />
Doris Schmidauer und Auma Obama im Gespräch mit den<br />
„Seitenblicken“<br />
Honey & Bunny, Interdisziplinäres Designatelier Martin Hablesreiter und Sonja Stummer, bei ihrer Eröffnungs-Performance<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
17
FOTOS: <strong>BOKU</strong> / PETER ZESCHITZ<br />
Die <strong>BOKU</strong> ist die Nachhaltigkeitsuniversität<br />
in Österreich. In den vergangenen<br />
Jahren versuchen auch andere<br />
Unis und Fachhochschulen dieses<br />
Thema zu besetzen. Was ist denn der<br />
Unique Selling Point (USP) der <strong>BOKU</strong>?<br />
Plank: Nachhaltigkeit ist wichtig und<br />
es ist ja auch gut, dass jetzt andere<br />
dieses Thema aufnehmen und in die<br />
Breite tragen. Die <strong>BOKU</strong> ist etwas Besonderes<br />
und soll es auch in Zukunft<br />
bleiben. Durch die vielen Kompetenzen,<br />
die die <strong>BOKU</strong> hat, geht es eben<br />
nicht nur darum, über Nachhaltigkeit<br />
zu diskutieren, sondern neben dem<br />
Blick aufs Ganze auch die nachhaltigen<br />
Lösungen zu liefern. Das ist der<br />
USP der <strong>BOKU</strong>, wo wir auch weiterhin<br />
ganz vorne bleiben können: gesellschaftlich<br />
relevant, gleichzeitig<br />
attraktiv für die Studierenden sein<br />
und das sollte bis in den Weiterbildungsbereich<br />
reichen.<br />
Die <strong>BOKU</strong> scheint damit genau die<br />
Interessen und Anliegen der Studierenden<br />
und Studieninteressierten zu<br />
treffen – Stichwort später einen Beruf<br />
auszuüben, der als sinnstiftend und<br />
gesellschaftlich relevant empfunden<br />
wird. Das zeigt sich auch in den beachtlichen<br />
17 Prozent Zuwachs bei<br />
Universitätsratsvorsitzender<br />
Josef Plank<br />
zieht nach einem Jahr im<br />
Amt eine positive Bilanz.<br />
Mit Bettina Fernsebner-<br />
Kokert sprach er über<br />
künftige Herausforderungen,<br />
aktuelle<br />
Diskussionen und was<br />
die <strong>BOKU</strong> schon immer<br />
ausgemacht hat.<br />
den Erstsemestrigen. Was ist erforderlich,<br />
damit das so bleibt?<br />
Plank: Das ist gleichzeitig auch eine<br />
riesige Herausforderung für die Universität.<br />
Denn es reicht ja nicht, für<br />
die Anfängerinnen und Anfänger attraktiv<br />
zu sein, es ist entscheidend,<br />
diesen Faden nicht nur durchs Studium<br />
zu ziehen, sondern bis ins Berufsleben<br />
hinein. Das gilt es künftig<br />
weiter zu stärken. Die <strong>BOKU</strong> muss<br />
also während des Studiums inhaltlich<br />
und organisatorisch ansprechend<br />
bleiben, weil die Universitäten nach<br />
den prüfungsaktiven Studierenden<br />
bemessen werden. Dasselbe gilt für<br />
die Rolle der Uni als Arbeitgeberin<br />
für das wissenschaftliche Personal.<br />
Vor Kurzem hat die <strong>BOKU</strong> einen<br />
Marken-Relaunch durchgeführt, mit<br />
neuem Logo und dem Markennamen<br />
„<strong>BOKU</strong> University“. Welche Rolle spielt<br />
Ihrer Ansicht nach ein moderner Markenauftritt<br />
für eine Uviversität?<br />
Plank: Die Marke ist ein wichtiges Zeichen<br />
nach außen, das die Breite und<br />
die Modernität der <strong>BOKU</strong> abbilden<br />
muss. Ich möchte hier dem Rektorat<br />
und allen, die daran mitgewirkt haben,<br />
gratulieren – zum Ergebnis, aber<br />
auch dazu, wie es erarbeitet wurde.<br />
Der neue Markenauftritt ist aus meiner<br />
Sicht wirklich sehr gelungen, weil<br />
dadurch die Kompetenzen der <strong>BOKU</strong><br />
und der einzelnen Institute noch viel<br />
sichtbarer werden können. Wenn sich<br />
etwas ändert, verursacht es natürlich<br />
auch hier und da etwas Emotionalität,<br />
aber wir verlangen von anderen<br />
ja manchmal auch große Veränderungen,<br />
wenn es um Nachhaltigkeit<br />
geht. Kurz: Es ist ein richtiger Schritt<br />
in die richtige Richtung, den der Universitätsrat<br />
unterstützt und begrüßt.<br />
Eine Strukturreform der <strong>BOKU</strong>-Departments<br />
wurde ebenfalls gestartet,<br />
die Anfang 2025 abgeschlossen sein<br />
soll. Welche Vorteile bringt eine Reduzierung<br />
der Anzahl der Departments?<br />
18 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
„Die <strong>BOKU</strong> ist<br />
etwas Besonderes<br />
und soll es auch<br />
in Zukunft bleiben“<br />
Plank: Das hat natürlich schnell<br />
zu Diskussionen geführt, aber man<br />
muss auch die interne Organisation<br />
weiterentwickeln. Die Kommunikation<br />
mit den Betroffenen ist in<br />
diesem Prozess extrem wichtig und<br />
entscheidend. Mit der neuen Department-Struktur<br />
und den damit einhergehenden<br />
administrativen Vereinfachungen<br />
können wir effizienter und<br />
besser agieren, etwa beim Lukrieren<br />
von Forschungsmitteln für internationale<br />
Projekte. Wir sind da aber<br />
auf einem guten Weg, niemand muss<br />
sich fürchten und wir können unsere<br />
Potenziale künftig besser nutzen.<br />
Die Leistungsvereinbarungen 2025-<br />
2027 werden gerade verhandelt. Welche<br />
strategischen Ziele stehen dabei<br />
im Fokus?<br />
Plank: Unser Entwicklungsplan 2030<br />
legt ja die Eckpunkte fest. Dazu gehört<br />
als ganz entscheidender Punkt,<br />
weiterhin eine führende Nachhaltigkeits-<br />
und Life-Sciences-Universität<br />
in Europa zu sein. Ein stärkerer<br />
Fokus liegt auf der Internationalisierung<br />
wie auch auf der Kommunikation<br />
mit der Gesellschaft, der<br />
Third Mission und, Forschung, Lehre<br />
und Attraktivität für Studierende auf<br />
einem sehr hohen Niveau zu halten<br />
und zu sichern.<br />
Wie sieht Ihre persönliche Bilanz nach<br />
einem Jahr als Uniratsvorsitzender aus?<br />
Plank: Sehr positiv, es ist eine riesige<br />
Freude, die Uni noch besser kennenzulernen.<br />
Im Unirat selbst und in der<br />
Zusammenarbeit mit dem Rektorat<br />
läuft es sehr gut, wir diskutieren offen,<br />
wertschätzend und können die<br />
Dinge gut ausreden. Der Unirat fasst<br />
seine Beschlüsse in der Regel einvernehmlich,<br />
das Team ist gut zusammengeschweißt<br />
und ich bin sehr<br />
motiviert für die weitere Zeit als Uniratsvorsitzender<br />
der <strong>BOKU</strong>.<br />
Wenn Sie heute nochmals zu studieren<br />
beginnen würden, würden Sie sich<br />
wieder für die <strong>BOKU</strong> entscheiden und<br />
neuerlich für Agrarwissenschaften?<br />
Plank: Ich würde mich voraussichtlich<br />
wieder dafür entscheiden. Ich habe<br />
mein Studium in sehr guter Erinnerung,<br />
habe hier an der <strong>BOKU</strong> eine sehr<br />
breite Basis bekommen und gleichzeitig<br />
konnte ich mich während des<br />
Studiums auch thematisch vertiefen.<br />
Das war vor 40 Jahren wichtig und ist<br />
es im heutigen dynamischen Berufsleben<br />
noch genauso.<br />
ZUR PERSON<br />
DI Josef Plank war nach seinem<br />
Studium der Landwirtschaft<br />
an der <strong>BOKU</strong> zunächst in der<br />
niederösterreichischen Landwirtschaftskammer<br />
und als<br />
Vorstandsvorsitzender der Agrarmarkt<br />
Austria (AMA) tätig. Im<br />
Anschluss führte ihn sein Weg in<br />
die Politik – Plank war von 2000<br />
bis 2009 Landesrat für Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Naturschutz,<br />
Katastrophenschutz und Energie<br />
mit besonderem Schwerpunkt<br />
Erneuerbare Energie in Niederösterreich.<br />
Nach beruflichen Stationen<br />
u. a. als Geschäftsführer<br />
bei RENERGIE (heute Contour-<br />
Global) und als Generalsekretär<br />
der Landwirtschaftskammer<br />
Österreich wurde der gebürtige<br />
Mostviertler 2016 Generalsekretär<br />
im damaligen Bundesministerium<br />
für Nachhaltigkeit und<br />
Tourismus. Ab 2019 leitete er die<br />
Abteilung Wirtschafts-, Agrarund<br />
Europafragen des Österreichischen<br />
Raiffeisenverbandes.<br />
Seit Mai <strong>2024</strong> ist Plank Obmann<br />
der IG Windkraft.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
19
CHRISTOPH GRUBER | <strong>BOKU</strong> UNIVERSITY<br />
V. l.: Uniratsmitglied Hans Sünkel, Uniratsvorsitzender Josef Plank, Rektorin Eva Schulev-Steindl, Senatsvorsitzender Roland Ludwig<br />
und die Vizerektor*innen Doris Damyanovic, Nora Sikora-Wentenschuh und Christian Obinger<br />
Im 152. Jahr ihres Bestehens hat die<br />
<strong>BOKU</strong> einen bedeutenden Schritt<br />
in ihrer strategischen Entwicklung<br />
vollzogen. Nach einem zwölfmonatigen<br />
Markenprozess positioniert sich<br />
die Universität als eine führende Life-<br />
Sciences-Universität in Europa. Der<br />
Fokus liegt klar auf Zukunftsthemen<br />
„am Puls der Zeit“, wie Klimaschutz,<br />
Bioökonomie, Ernährung und Gesundheit,<br />
Biopharmazeutika und biobasierte<br />
Materialien, Lebensräume und<br />
Infrastrukturen sowie Biodiversität.<br />
Im Zuge dieser Neuausrichtung wurde<br />
auch ein vollständig neuer Außenauftritt<br />
konzipiert. Unter dem neuen Markennamen<br />
„<strong>BOKU</strong> University“ setzt<br />
die Universität ein Zeichen für ihre<br />
zunehmende Internationalität und<br />
ihr Engagement in der globalen Forschungs-<br />
und Bildungsgemeinschaft.<br />
VERSCHÄRFTER WETTBEWERB<br />
ERFORDERT EIN EINZIGARTIGES<br />
PROFIL<br />
Aufgrund der demografischen Entwicklungen<br />
stehen alle Universitäten<br />
in einem sich zunehmend verschärfenden<br />
Wettbewerb um Studierende,<br />
herausragende Wissenschaftler*innen<br />
sowie hochqualifiziertes allgemeines<br />
Personal. „Die <strong>BOKU</strong> strebt danach, als<br />
führende Universität im Bereich Life<br />
Sciences wahrgenommen zu werden,<br />
die sich durch ihre inter- und transdisziplinäre<br />
Forschung und Lehre auszeichnet<br />
und dank ihres einzigartigen<br />
Profils Studierende, Forschende sowie<br />
Stakeholder gleichermaßen anspricht“,<br />
betont Rektorin Eva Schulev-Steindl.<br />
Der neue Markenauftritt geht Hand in<br />
Hand mit dem neuen Entwicklungsplan<br />
der Universität und trägt dazu<br />
bei, die Identität und Bekanntheit der<br />
<strong>BOKU</strong> zu stärken und für die relevanten<br />
Zielgruppen attraktiv zu bleiben.<br />
DAS NEUE CORPORATE DESIGN:<br />
VIEL MEHR ALS NUR EIN LOGO<br />
Das neue Erscheinungsbild der <strong>BOKU</strong><br />
ist einprägsam, frisch und zeitgemäß.<br />
Das moderne Branding spiegelt die<br />
strategische Neuausrichtung der Universität<br />
wider und ist ein Gesamtkonzept<br />
aus Logo, Farben, Schriften,<br />
einem Gestaltungselement sowie<br />
einer neuen Bildsprache. Das neue<br />
Corporate Design erfüllt die gestiegenen<br />
Anforderungen an die Barrierefreiheit<br />
und die digitalen Medien. Mit<br />
dem neuen Branding hat die <strong>BOKU</strong><br />
ein umfassendes visuelles System zur<br />
Verfügung, das viele Einsatzmöglichkeiten<br />
eröffnet.<br />
20 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Warum eine neue<br />
Marke für die <strong>BOKU</strong>?<br />
Neuer Außenauftritt im Zuge<br />
der strategischen Neuausrichtung<br />
Von Sabina Tandari<br />
Einige Umsetzungsbeispiele für das<br />
B-Symbol als Gestaltungselement.<br />
Das neue <strong>BOKU</strong> Logo und die<br />
neue Corporate Farbe der <strong>BOKU</strong>.<br />
DIE MARKENELEMENTE<br />
Das neue Logo ist eine Wort-Bild-Marke.<br />
Es besteht aus einem markanten<br />
B-Symbol in Grün, dem Namen<br />
„<strong>BOKU</strong>“, das mit einer eigens entwickelten<br />
Schrift gestaltet wurde und<br />
dem Logo Einzigartigkeit verleiht, sowie<br />
dem Namenszusatz „University“.<br />
Die Farbwelt, geprägt von einem modernen<br />
„<strong>BOKU</strong> Cool Green“ mit ergänzenden<br />
Farben wie „Grape Purple“<br />
und „Apricot Orange“, reflektiert die<br />
zentralen Themen der Universität:<br />
Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit.<br />
Die neue Markenschrift Work Sans ist<br />
eine zeitgenössische Schrift, die die<br />
Formensprache des Logos und des<br />
B-Symbols aufgreift. Als Standardschrift<br />
für die Verwendung in Micro-<br />
soft Office-Programmen (Word, PowerPoint<br />
etc.) kommt Aptos zum Einsatz.<br />
Erstmals wurde für die <strong>BOKU</strong><br />
eine Bildsprache als wichtiges Markenelement<br />
festgelegt, um Botschaften<br />
auch mit Bildern konsistent über<br />
alle Kanäle transportieren zu können.<br />
Im Mittelpunkt der neuen Bildsprache<br />
stehen authentische und natürliche<br />
Bilder - wie direkt aus dem Leben<br />
gegriffen und auf Augenhöhe.<br />
Besonderes Kennzeichen der neuen<br />
Marke bildet das B-Symbol, das<br />
ein markantes Gestaltungselement<br />
mit hohem Wiedererkennungswert<br />
darstellt und sowohl im Printbereich<br />
als auch in der digitalen Umsetzung<br />
viele Spielarten ermöglicht. Das<br />
B-Symbol aus dem neuen <strong>BOKU</strong>-Logo<br />
öffnet sich zu einem Fenster, einem<br />
Raum für Inspiration oder einer Leinwand,<br />
in dem alles Platz findet, was<br />
die <strong>BOKU</strong> ausmacht. Der geöffnete<br />
Rahmen kann Wörter in Titeln oder<br />
Headlines hervorheben, Elemente in<br />
Bildern markieren oder als Bildrahmen<br />
selbst dienen.<br />
DER MARKENPROZESS<br />
Die neue Marke entstand durch die<br />
aktive Einbindung interuniversitärer<br />
Fokusgruppen. Begleitet wurde<br />
der einjährige Markenprozess von<br />
der Agentur BRAINDS. In Workshops,<br />
Fokusgruppen und Feedbackrunden<br />
wurden die Werte der <strong>BOKU</strong> definiert,<br />
das Nutzenversprechen der<br />
Marke erarbeitet sowie die Mission,<br />
die Vision, die Positionierung und<br />
das Markenversprechen. Ziel war es<br />
dann, aus der Strategie ein stimmiges<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
21
CHRISTOPH GRUBER | <strong>BOKU</strong> UNIVERSITY<br />
Dialogrunde mit <strong>BOKU</strong>-Studierenden aus den Fokusgruppen zum Markenprozess<br />
V. l.: Oliver Heiss, Agentur BRAINDS, <strong>BOKU</strong>-Rektorin Eva Schulev-Steindl, Key Note<br />
Speaker Christoph Burmann, Uni Bremen<br />
Infokasten von Kurt Renner,<br />
Projektmanager Web-Relaunch<br />
und zeitgemäßes Erscheinungsbild<br />
zu entwickeln, das wiedergibt, was<br />
die <strong>BOKU</strong> ausmacht, wofür sie steht<br />
und welches Ziel sie anstrebt. „Mit<br />
einem professionellen und konsistenten<br />
Außenauftritt wollen wir als<br />
DIE innovative Zukunftsuniversität<br />
wahrgenommen werden, die einen<br />
maßgeblichen Beitrag zur Bewältigung<br />
globaler He rausforderungen leistet“,<br />
so Rektorin Schulev-Steindl.<br />
Der Marken-Launch<br />
Am 5. März <strong>2024</strong> wurde die neue Marke<br />
<strong>BOKU</strong> offiziell im Rahmen einer<br />
zweistündigen Veranstaltung präsentiert.<br />
Das Programm eröffneten Rektorin<br />
Eva Schulev-Steindl, der Vorsitzende<br />
des Universitätsrates Josef<br />
Plank sowie der Senatsvorsitzende der<br />
<strong>BOKU</strong>, Roland Ludwig. Im Anschluss<br />
erläuterte Rektorin Schulev-Steindl<br />
die strategischen Grundüberlegungen<br />
zur neuen Marke. Ein besonderes<br />
Highlight war der Vortrag zum<br />
Konzept der identitätsbasierenden<br />
Markenführung vom renommierten<br />
Markenexperten Christoph Burmann<br />
von der Universität Bremen sowie die<br />
Dialogrunden mit Mitwirkenden aus<br />
den Fokusgruppen.<br />
■<br />
VIDEOS<br />
Marken-Launch-Event<br />
Neue Marke<br />
Stimmen zur<br />
neuen Marke<br />
Mag. a Sabina Tandari ist Marketing- und<br />
Brandmanagerin.<br />
22 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
23
Ergebnisse der Mitarbeiter*innenbefragung<br />
und der Evaluierung der psychischen<br />
Belastung am Arbeitsplatz<br />
Von Gerhard Mannsberger<br />
Die Mitarbeiter*innen-Befragung<br />
2023, die im Auftrag<br />
des Rektorats der<br />
<strong>BOKU</strong> University online von<br />
Waltraut Sawczak (new level) durchgeführt<br />
wurde, gliedert sich in zwei<br />
Teile:<br />
Teil 1 erfasst und beurteilt die psychische<br />
Belastung am Arbeitsplatz<br />
im Rahmen des Arbeitnehmer*innenschutzgesetzes<br />
mit dem standardisierten<br />
Messverfahren IMPULS-Test|2<br />
Professional.<br />
Teil 2 der Mitarbeiter*innen-Befragung<br />
2023 beleuchtet die Themenbereiche<br />
der Arbeitszufriedenheit,<br />
Arbeitsbedingungen, Information<br />
und Kommunikation, der betrieblichen<br />
und digitalen Gesundheitsförderung<br />
und der Arbeitssituation<br />
von Menschen mit Behinderung oder<br />
gesundheitlichen Beeinträchtigungen<br />
mit einem Fragenkatalog.<br />
Um die Erhebung, Auswertung und<br />
Ergebnisverwendung im Hinblick auf<br />
den Datenschutz auf gesicherte Beine<br />
zu stellen, wurde – neben den<br />
ohnehin geltenden gesetzlichen Bestimmungen<br />
– eine eigene Betriebsvereinbarung<br />
mit beiden Betriebsratsgremien<br />
abgeschlossen.<br />
Befragungszeitraum:<br />
19. 09.-17. 10. 2023<br />
Teilnahmequote / Rücklauf:<br />
988 Teilnehmer*innen ≈ 40 % (Teil 1)<br />
sowie 808 Teilnehmer*innen ≈ 33 %<br />
(Teil 2). Insgesamt wurden 2.463 Personen<br />
zur Befragung eingeladen.<br />
TEIL 1: DIE PSYCHISCHE<br />
BELASTUNG AM ARBEITSPLATZ:<br />
SEHR GUTES ERGEBNIS, ABER …<br />
Psychische Belastung am Arbeitsplatz<br />
nach ÖNORM EN 10075-1 „... ist die<br />
Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse,<br />
die von außen auf den Menschen<br />
zukommen und psychisch auf ihn<br />
einwirken“. Dabei werden vier Belas-<br />
24 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Ergebnis Universität gesamt<br />
Das Gesamtergebnis zeigt, dass bei<br />
allen Belastungsbereichen die Werte<br />
unter PR = 50 %, also im Bereich<br />
der unkritischen beziehungsweise<br />
durchschnittlichen Belastungsausprägung<br />
liegen und damit kein bis<br />
eher wenig Handlungsbedarf gegeben<br />
ist.<br />
Das soll und darf allerdings nicht<br />
darüber hinwegtäuschen, dass bei<br />
einzelnen Einheiten, zumindest in<br />
einigen Bereichen, ein tendenziell<br />
steigender beziehungsweise sogar<br />
hoher Handlungsbedarf festgestellt<br />
wurde.<br />
tungsdimensionen der Arbeitssituation<br />
systematisch erfasst und beurteilt:<br />
▶ Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten<br />
▶ Arbeitsabläufe<br />
▶ Arbeitsumgebung<br />
▶ Arbeitsorganisation<br />
Der Prozess wurde bereits nach der<br />
Befragung 2020 begonnen und die gesetzten<br />
Maßnahmen evaluiert, sodass<br />
die Ergebnisse der Befragung 2023<br />
die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse<br />
weiter vorantreiben können.<br />
Auf Basis von Normwerten (repräsentative<br />
Gesamtnorm) erfolgt die<br />
Darstellung der errechneten Merkmalsausprägungen<br />
in den jeweiligen<br />
Belastungsdimensionen in Prozenträngen<br />
(PR). Vereinfacht bedeutet<br />
das: je höher die Werte, desto höher<br />
die Belastung in der jeweiligen Skala.<br />
Zur Einschätzung der Ergebnisse beziehungsweise<br />
zur Beurteilung der<br />
Belastungssituation wird die gesamte<br />
Skala in vier Teile gegliedert:<br />
PR 0 bis 25 unkritische Merkmalsausprägung<br />
– kein Handlungsbedarf<br />
/ Ressource<br />
PR 26 bis 50 tendenziell unkritische<br />
Merkmalsausprägung<br />
– kein bis eher wenig<br />
Handlungsbedarf<br />
PR 51 bis 75 tendenziell kritische<br />
Merkmalsausprägung –<br />
tendenziell steigender<br />
Handlungsbedarf<br />
PR 76 bis 100 sehr kritische<br />
Merkmalsausprägung – sehr<br />
hoher Handlungsbedarf<br />
Zusätzlich zu den Bewertungen durch<br />
die Teilnehmenden wurden 2.926 (!)<br />
Kommentare abgegeben. Diese liefern<br />
wiederum wertvolle Hinweise über die<br />
Art der Belastungen sowie mögliche<br />
Maßnahmen. An dieser Stelle möchte<br />
ich daher im Namen des Rektorates<br />
allen für die Teilnahme danken!<br />
Weitere Vorgangsweise: wir sind gut,<br />
wollen aber noch besser werden!<br />
Auch wenn das <strong>BOKU</strong>-weite Ergebnis<br />
als sehr zufriedenstellend bezeichnet<br />
werden kann, sind weitere Maßnahmen<br />
zu setzten:<br />
▶ Die Auswertungen der jeweiligen<br />
Einheiten werden den Leiter*innen<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
▶ Erfolgreiche Maßnahmen sind weiterzuführen.<br />
▶ Leiter*innen von Einheiten mit<br />
hohen Werten werden vom Team<br />
der Stabstelle für Arbeitssicherheit<br />
und Gesundheit kontaktiert, die<br />
Werte analysiert und Maßnahmenpläne<br />
ausgearbeitet.<br />
▶ Dort, wo dies möglich ist, sind<br />
diese umzusetzen (bei baulichen<br />
Maßnahmen ist dies oft nicht möglich).<br />
▶ Die Umsetzung wird dokumentiert<br />
und an das Rektorat berichtet.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
25
Übersicht Kommentare <strong>BOKU</strong> gesamt<br />
TEIL 2:<br />
MITARBEITER*INNEN-BEFRAGUNG<br />
Fragenkatalog 2023<br />
Der individuell auf die Themenbereiche<br />
der Arbeitszufriedenheit, Information<br />
und Kommunikation, betrieblichen<br />
Gesundheitsförderung und<br />
digitalen Gesundheitsförderung sowie<br />
der Arbeitssituation von Menschen<br />
mit Behinderung oder gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen zusammengestellte<br />
Fragenkatalog beinhaltet<br />
einerseits Fragen aus vorherigen Befragungen<br />
und neue Fragestellungen,<br />
die den Erfordernissen und Interessen<br />
der <strong>BOKU</strong> entsprechen. Die befragten<br />
Personen bewerten aus ihrer<br />
Perspektive den Grad des Zutreffens /<br />
der Zustimmung zu bestimmten Fragestellungen<br />
(vier bzw. fünf-stufiges<br />
Item-Format - geschlossenes Antwortformat).<br />
Offene Fragestellungen<br />
ergänzen die geschlossenen Fragestellungen.<br />
Alle Frage sind als „freiwillige<br />
Fragen“ konzipiert.<br />
Zusätzlich zu den Bewertungen wurden<br />
insgesamt 905 (!), zum Teil sehr<br />
umfangreiche Anmerkungen/Kommentare<br />
beigefügt, die wiederum –<br />
wie im Teil 1 – wichtige Informationen<br />
für weitere Maßnahmen beinhalten.<br />
Beurteilungsgrundlage für Mittelwerte:<br />
MW 3,5 kritische Merkmalsausprägung<br />
– vertiefende Analyse und<br />
Bearbeitung empfehlenswert<br />
Erfreulich ist, dass beim Gesamtergebnis<br />
<strong>BOKU</strong>-weit kein einziger<br />
Themenbereich über dem Mittelwert<br />
von 2,5 liegt. Es gibt aber einzelne<br />
Einheiten und Themenbereiche, bei<br />
denen dieser Mittelwert – wenn auch<br />
nur geringfügig – überschritten wird.<br />
DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE<br />
2023 IM ÜBERBLICK FÜR DIE<br />
GESAMTORGANISATION<br />
Die <strong>BOKU</strong> als Dienstgeberin<br />
und Arbeitszufriedenheit<br />
Die Mittelwerte der einzelnen Skalen<br />
zur Arbeitszufriedenheit zeigen sehr<br />
hohe Zufriedenheitswerte und finden<br />
sich alle im unkritischen Merkmalsbereich:<br />
MW 1,84 bis 2,29 (Wertebereich<br />
1=sehr zufrieden bis 5=unzufrieden).<br />
Die Zufriedenheit mit der <strong>BOKU</strong> als<br />
Dienstgeberin ist mit einem MW =<br />
1,89 (Wertebereich 1=sehr zufrieden<br />
bis 4=nicht zufrieden) sehr hoch.<br />
Knapp 9 von 10 Personen (87,5 %<br />
der Teilnehmer*innen) sind mit der<br />
<strong>BOKU</strong> als Dienstgeberin sehr zufrieden<br />
/ zufrieden. 4 von 5 Personen<br />
(82,9 % der Teilnehmer*innen) würde<br />
die <strong>BOKU</strong> aufgrund ihrer Erfahrungen<br />
Freunden und Bekannten bestimmt<br />
/ wahrscheinlich ja als Dienstgeberin<br />
weiterempfehlen und sich bestimmt<br />
/ wahrscheinlich ja wieder an der<br />
<strong>BOKU</strong> bewerben (85,4 %). 93,9 % der<br />
Teilnehmer*innen beurteilen das Ansehen<br />
der <strong>BOKU</strong> in der Öffentlichkeit<br />
als sehr gut / gut. Als Mittelwert (Wertebereich<br />
1=sehr gut bis 4=schlecht)<br />
zeigt sich für das Ansehen der <strong>BOKU</strong><br />
in der Öffentlichkeit ein Wert von 1,65.<br />
INFORMATION UND<br />
KOMMUNIKATION<br />
Etwa Zwei Drittel der Teilnehmer*innen<br />
(63,1 %, MW=2,29) sind mit der Information<br />
und Kommunikation in der<br />
eigenen Organisationseinheit / Serviceeinrichtung<br />
sehr zufrieden / zufrieden.<br />
Etwa 4 von 5 Teilnehmer*innen<br />
beurteilen mit sehr zufrieden /<br />
zufrieden in den Skalen „Zufriedenheit<br />
mit der Herausforderung der Arbeit“<br />
(82,09 %, MW=1,91), „Zufriedenheit<br />
26 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
mit dem Entscheidungsspielraum“<br />
(80,16 %, MW=1,90) und „Zufriedenheit<br />
mit dem Umgang mit den direkten<br />
Kolleg*innen (79,89 %, MW=1,84).<br />
Etwa 7 von 10 Teilnehmer*innen<br />
(68,45 %, MW=2,09) sind mit der Beziehung<br />
zum / zur direkten Vorgesetzten<br />
sehr zufrieden / zufrieden. 9 von<br />
10 Teilnehmer*innen (90,4 %) bewerten<br />
die Information und Kommunikation<br />
über die Ziele ihres Departments<br />
/ ihrer Organisationseinheit als sehr<br />
wichtig / wichtig und 6 von 10 Teilnehmer*innen<br />
(60,6 %) sehen dies als<br />
sehr gut / gut erfüllt.<br />
9 von 10 Teilnehmer*innen (95,1 % –<br />
91 %) beurteilen die Information und<br />
Kommunikation durch die direkte<br />
Führungskraft, durch die Kolleg*innen<br />
und durch interne Besprechungen als<br />
sehr wichtig / wichtig. 8 von 10 Teilnehmer*innen<br />
(79,2 %) bewerten die<br />
Kommunikation durch die Kolleg*innen<br />
als sehr gut / gut erfüllt, 7 von<br />
10 der Teilnehmer*innen (71,4 % bzw.<br />
71,3 %) beurteilen dies auch für die<br />
direkte Führungskraft und die internen<br />
Besprechungen.<br />
Die Informationen und Kommunikation<br />
durch das Rektorat werden von<br />
4 von 5 Teilnehmer*innen (78,9 %) als<br />
sehr wichtig / wichtig bewertet, als<br />
sehr gut / gut erfüllt bewerten dies<br />
3 von 5 Teilnehmer*innen (63,3 %).<br />
BETRIEBLICHE GESUNDHEITS-<br />
FÖRDERUNG UND <strong>BOKU</strong> 4.0 –<br />
„GESUNDHEIT IN DER DIGITALEN<br />
ARBEITSWELT 4.0“<br />
3 von 5 Teilnehmer*innen (62,7 %)<br />
sind mit den Angeboten der Gesunden<br />
<strong>BOKU</strong> sehr zufrieden / zufrieden.<br />
Etwa 30 % ist das Beratungsangebot<br />
der Gesunden <strong>BOKU</strong> bekannt. Die Zufriedenheit<br />
wird im Mittelwert mit<br />
MW=2,16 beurteilt. Knapp 20 % nehmen<br />
an den Bewegungsangeboten der<br />
Gesunden <strong>BOKU</strong> teil, etwa 46 % der<br />
Teilnehmer*innen insgesamt wünschen<br />
Angebote dazu, 2 von 5 Teilnehmer*innen<br />
äußern den Wunsch<br />
nach Maßnahmen zum Themenbereich<br />
psychische Gesundheit. Beratungsangebote<br />
kennen oder nutzen<br />
etwa ein Drittel der Teilnehmer*innen.<br />
<strong>BOKU</strong> 4.0 ist 16,3 % der Teilnehmer*innen<br />
bekannt, 2 von 5 Teilnehmer*innen<br />
(41,3 %) möchten mehr<br />
Informationen über Gesundheitsförderung<br />
im digitalen Raum, v. a. zu<br />
den Themenbereichen „Psychosoziale<br />
Gesundheit“und „Home-Office“.<br />
ARBEITSSITUATION VON<br />
MITARBEITER*INNEN MIT BEHINDE-<br />
RUNGEN ODER GESUNDHEITLICHEN<br />
BEEINTRÄCHTIGUNGEN<br />
89 Teilnehmer*innen (11 %) geben an,<br />
eine Behinderung / Beeinträchtigung<br />
zu haben. 11,2 % der Teilnehmer*innen<br />
geben an, dass ihre Behinderung<br />
/ Beeinträchtigung für andere Menschen<br />
sichtbar ist.<br />
Etwa die Hälfte (49,4 %) hat sich aufgrund<br />
ihrer Behinderung /Beeinträchtigung<br />
an entsprechende Anlaufstellen<br />
oder Vorgesetzte / Kolleg*innen<br />
gewandt, um darüber zu sprechen<br />
oder Unterstützung zu erhalten. 2 von<br />
5 betroffenen Teilnehmer*innen ist es<br />
lieber, wenn möglichst wenig Personen<br />
von der Behinderung / Beeinträchtigung<br />
wissen und geben an, dass an<br />
der <strong>BOKU</strong> das Thema „Arbeiten mit<br />
Behinderung“ zu wenig präsent ist.<br />
16,9 % meinen, dass Vorgesetzte und<br />
Kolleg*innen oft nicht wissen, wie<br />
diese mit der Behinderung / Beeinträchtigung<br />
umgehen sollen. 1 von 10<br />
Teilnehmer*innen gibt an, Diskriminierung<br />
/ Benachteiligung erfahren<br />
zu haben.<br />
WEITERE VORGANGSWEISE<br />
Die Ableitung von Maßnahmen auf<br />
Basis der Ergebnisse der Befragung<br />
ist, nicht zuletzt auf Grund der unterschiedlichen<br />
Themenbereiche, sehr<br />
komplex. Alleine die Auswertung der<br />
Anmerkungen braucht nicht nur Zeit,<br />
sondern ist – nicht zuletzt auf Grund<br />
fehlender Standardisierung – nicht<br />
ganz einfach.<br />
In einem ersten Schritt werden gemeinsamen<br />
mit den verschiedenen<br />
<strong>BOKU</strong>-Gremien Themen identifiziert,<br />
die die <strong>BOKU</strong> als ganzes betreffen, um<br />
in der Folge geeignete Maßnahmen<br />
zu entwickeln. Für die Erarbeitung<br />
von Maßnahmenkatalogen in den einzelnen<br />
Einheiten wird eine ähnliche<br />
Vorgangsweise, wie bei der Evaluierung<br />
der psychischen Belastung am<br />
Arbeitsplatz gewählt.<br />
Zusammenfassend können wir mit<br />
den Ergebnissen sehr zufrieden sein,<br />
vor allem auch im Lichte dessen, dass<br />
Universitätsangehörige bei den gewählten<br />
Fragestellungen immer kritischer<br />
sind als die Vergleichsgruppen.<br />
Das darf uns aber nicht dazu verleiten,<br />
die Bereiche, in denen Mängel<br />
aufgetreten sind beziehungsweise<br />
Handlungsbedarf gegeben ist, zu vernachlässigen.<br />
Im Gegenteil: die Maßnahmen,<br />
die bisher zur Verbesserung<br />
beigetragen haben, sind weiter zu<br />
stärken, dort, wo Maßnahmen benötigt<br />
werden, sind diese konsequent<br />
umzusetzen. Es gibt also viel zu tun,<br />
damit bei der nächsten Befragung<br />
2027/28 noch bessere Ergebnisse<br />
erzielt, die Zufriedenheit weiter gesteigert<br />
und die <strong>BOKU</strong> als attraktive<br />
Arbeitgeberin weiter gestärkt werden<br />
kann.<br />
■<br />
DI Gerhard Mannsberger ist Vizerektor<br />
für Personal, Organisation und Digitalisierung.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
27
Chemie nachwachsender<br />
Rohstoffe: Der Schlüssel<br />
zur nachhaltigen Zukunft<br />
Der Fachbereich Chemie nachwachsender Rohstoffe der<br />
<strong>BOKU</strong> University feierte Anfang Juni sein 25-jähriges Jubiläum.<br />
Anlass, um zurückzublicken und auch einen Ausblick auf eine<br />
umweltfreundliche und nachhaltige Welt zu werfen.<br />
Von Marco Beaumont und Bettina Fernsebner-Kokert<br />
Cellulose ist bereits in zahlreichen<br />
Produkten wie Papier,<br />
Textilfasern und Cellulosederivaten<br />
fest etabliert. In der Zukunft<br />
wird Lignin, ein Bestandteil der<br />
Lignocellulose, als nachwachsender<br />
Rohstoff eine zentrale Rolle im Kampf<br />
gegen den Klimawandel spielen. Lignin<br />
soll die Basis der zukünftigen chemischen<br />
Industrie bilden und fossile<br />
Rohstoffe ersetzen. „Das Problem ist<br />
seine hohe Komplexität“, so Institutsleiter<br />
Thomas Rosenau. „Wir arbeiten<br />
intensiv an grundlegenden analytischen<br />
Fragestellungen, um Lignin<br />
besser zu charakterisieren und die<br />
Struktur mit den Eigenschaften sowie<br />
der Eignung für spezifische Anwendungen<br />
wie Klebstoffe, Bindemittel<br />
und Grundchemikalien zu korrelieren.“<br />
Ziel sei es, Lignin so zu modifizieren,<br />
dass es für industrielle Anwendungen<br />
nutzbar wird. „Und dies ist eine große<br />
Herausforderung, da es derzeit noch<br />
keine großtechnischen Anwendungen<br />
gibt.“ Diese Forschung am Institut für<br />
Chemie nachwachsender Rohstoffe<br />
wird neben den Gruppen der Institutsleitung<br />
und den langjährig etablierten<br />
Bereichen „Biomaterialchemie“ (Falk<br />
Liebner) und „Bioraffinerie-Analytik“<br />
(Stefan Böhmdorfer) vor allem auch<br />
durch die drei Juniorgruppen „Hybridmaterialien<br />
und Grüne Chemie“ (Hubert<br />
Hettegger), „Erneuerbare Nanomaterialien“<br />
(Marco Beaumont) und<br />
„Ligninanalytik“ (Oliver Musl) getragen.<br />
PIONIERIN IN DER FORSCHUNG ZU<br />
NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN<br />
Die <strong>BOKU</strong> war die erste österreichische<br />
Universität, die die Bedeutung<br />
nachwachsender Rohstoffe erkannte<br />
und entsprechende Forschungsbereiche<br />
institutionalisierte. Mit der Gründung<br />
des Christian-Doppler-Labors<br />
für Zellstoffreaktivität unter Leitung<br />
von Paul Kosma im Jahr 1998 wurde<br />
der Grundstein gelegt, die Ansiedlung<br />
des von der Lenzing AG und den<br />
Österreichischen Bundesforsten geförderten<br />
Labors an der <strong>BOKU</strong> war<br />
dem damaligen Rektor Leopold März<br />
zu verdanken.<br />
In den Jahren 2004 und 2005 wurden<br />
drei „Vorziehprofessuren“ eingerichtet,<br />
um die Themen Chemie<br />
nachwachsender Rohstoffe, Holzwerkstoffe<br />
und Nachhaltigkeit in den<br />
Mittelpunkt von Forschung und Lehre<br />
zu rücken – zehn bis 15 Jahre, bevor<br />
andere heimische Universitäten die<br />
Bedeutung dieser Gebiete erkannten<br />
und dem sich abzeichnenden Trend<br />
folgten. 2005 wurde die Professur für<br />
Holz-, Zellstoff- und Faserchemie mit<br />
Thomas Rosenau besetzt und dem<br />
Department für Chemie zugeordnet.<br />
In den folgenden Jahren entwickelte<br />
sich dieser Bereich rasant zur größten<br />
Gruppe innerhalb des Departments.<br />
Dieser Bereich war auch einer der<br />
ersten, der 2011 vom <strong>BOKU</strong>-Standort<br />
Muthgasse nach Tulln in das damals<br />
neue Universitäts- und Forschungszentrum<br />
umzog. 2013 wurde schließlich<br />
das Institut für Chemie nachwachsender<br />
Rohstoffe gegründet,<br />
das bis dahin Teil des Instituts für<br />
Organische Chemie war. 2018 wurde<br />
eine weitere Professur für „Chemie<br />
lignocellulosischer Materialien“ am<br />
Institut mit Antje Potthast besetzt.<br />
Zentral an der Koordination der Bioökonomie-Evaluierung<br />
der <strong>BOKU</strong> in<br />
den Jahren 2015/2016 beteiligt, spielte<br />
das Institut auch eine wichtige<br />
Rolle bei der Gründung des <strong>BOKU</strong>-<br />
Bioökonomiezentrums. Mit der Gründung<br />
der <strong>BOKU</strong> Core Facility ALICE<br />
(„Analysis of Lignocellulosics“) wurde<br />
österreichweit das erste Analyselabor<br />
geschaffen, das seinen Schwerpunkt<br />
auf der Entwicklung von analytischen<br />
28 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
FOTOS: SEBASTIAN ROSENAU<br />
Die Gruppen- und Juniorgruppenleiter*innen des Instituts (v. li.): Hubert Hettegger, Stefan Böhmdorfer,<br />
Antje Potthast, Jan Janesch (Institut für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe), Irina Sulaeva,<br />
Oliver Musl, Thomas Rosenau, Falk Liebner und Marco Beaumont.<br />
Methoden für lignocellulosische Materialien<br />
legt und diese Techniken<br />
als Service internen und externen<br />
Forschenden anbietet.<br />
WISSENSCHAFTLICHER OUTPUT<br />
AUF HÖCHSTEM NIVEAU<br />
Das Institut für Chemie nachwachsender<br />
Rohstoffe zeichnet sich durch<br />
einen außergewöhnlich hohen wissenschaftlichen<br />
Output aus. Mit mehr als<br />
720 SCI-Publikationen und über 240<br />
Plenar- und Keynote-Vorträgen (d. h.<br />
durchschnittlich etwa zehn pro Jahr)<br />
setzt das Institut Maßstäbe. Zudem<br />
verzeichnet es eine beeindruckende<br />
Anzahl an Begutachtungen wissenschaftlicher<br />
Manuskripte, mit über<br />
300 in jedem der letzten drei Jahre.<br />
Hervorzuheben ist auch, dass an<br />
diesem Institut der erste <strong>BOKU</strong>-Wissenschaftler<br />
tätig ist, der die Grenze<br />
von 500 SCI-Publikationen überschritt.<br />
PROJEKTAKQUISITIONSVOLUMEN<br />
VON ÜBER 33 MILLIONEN EURO<br />
Der Fachbereich beherbergte drei<br />
Christian-Doppler-Labors, darunter<br />
das derzeit laufende CD-Labor „Cellulose-Hightech-Materialien“,<br />
das von<br />
Hubert Hettegger geleitet wird. In zwei<br />
Großprojekten, FLIPPR (Future Lignin<br />
and Pulp Processing Research), ist es<br />
etwa gelungen, die größten österreichischen<br />
Zellstoff- und Papierhersteller<br />
– eigentlich Konkurrenten – zur<br />
Zusammenarbeit in der Grundlagenforschung<br />
in den Bereichen Cellulose,<br />
Lignin und insbesondere Analytik zu<br />
vereinen. Und im Austrian Biorefinery<br />
Center Tulln (ABCT), das von Thomas<br />
Rosenau und Antje Potthast wissenschaftlich<br />
geleitet wird, arbeitet man<br />
intensiv daran, die Nationale Österreichische<br />
Bioökonomie-Strategie zu<br />
unterstützen. Bis 2029 werden hier<br />
mit zehn Unternehmenspartner*innen<br />
sowohl Grundlagen- als auch angewandte<br />
Forschung betrieben, um<br />
die Bioökonomie voranzutreiben.<br />
GRÜNE CHEMIE IN DER LEHRE<br />
AN UNIVERSITÄT UND SCHULEN<br />
Die Ausbildung der Bioökonomie-Expert*innen<br />
von morgen wird am Institut<br />
für Chemie nachwachsender<br />
Rohstoffe als zentrale Aufgabe betrachtet.<br />
Bisher haben über 80 Doktorand*innen<br />
ihren Abschluss gemacht,<br />
und aktuell werden 17 neue Doktorand*innen<br />
betreut. Zudem wurde<br />
hier das neue, englischsprachige Masterstudium<br />
Green Chemistry initiiert,<br />
das ab 2022 als trilaterales Programm<br />
gemeinsam mit der TU Wien und der<br />
Universität Wien angeboten wird. In<br />
Kooperation mit der Universität Wien<br />
wird derzeit auch der Lehrplan für<br />
Chemie an Gymnasien überarbeitet.<br />
Dabei werden Prinzipien der Grünen<br />
Chemie, Recycling und die Chemie<br />
nachwachsender Rohstoffe integriert,<br />
um eine zeitgemäße und zukunftsorientierte<br />
Ausbildung zu gewährleisten.<br />
In der Doktoratsschule<br />
„Advanced Biorefineries – Chemistry<br />
and Materials“, die von Antje Potthast<br />
koordiniert wird, werden die zukünftigen<br />
österreichischen Bioraffinerie-<br />
Expert*innen ausgebildet. Mit einem<br />
maßgeschneiderten Curriculum, das<br />
sich durch besondere Spezialisierung<br />
auszeichnet, tragen sie den zentralen<br />
Nachhaltigkeitsgedanken der <strong>BOKU</strong><br />
in akademische und industrielle Forschung,<br />
Beratung und Gesellschaft<br />
weiter.<br />
AUSSERGEWÖHNLICH AKTIV<br />
IN DER INTERNATIONALEN<br />
ZUSAMMENARBEIT<br />
Das Institut ist auch ein bedeutender<br />
Anlaufpunkt für Gastwissenschaftler*innen<br />
und Gastprofessor*innen,<br />
die ein Sabbatical absolvieren. In den<br />
vergangenen 30 Jahren wurden hier<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
29
Antje Potthast und Thomas Rosenau ließen es bei der 25-Jahr-Feier<br />
krachen: Finale der Chemieshow während der Jubiläumsfeier, das<br />
so genannte Saunaexperiment. Kochendes Wasser (100° C) wird in<br />
flüssigen Stickstoff (-196° C) gegossen, was zu einer explosionsartigen<br />
Bildung von Wasserdampf und Stickstoffnebel führt.<br />
Feuer und Flamme für das Institut für Chemie nachwachsender<br />
Rohstoffe: Fein verteilter Staub (Bärlappsporen) wird in<br />
einem geschlossenen Behälter entzündet, was zu einer eindrucksvollen<br />
Staubexplosion führt.<br />
über 280 Gastwissenschaftler*innen<br />
aus 36 verschiedenen Ländern begrüßt.<br />
Besonders enge Verbindungen<br />
bestehen zu Finnland (Åbo Akademi<br />
Turku und Aalto Universität Helsinki)<br />
und Japan (Shinshu Universität, Kyoto<br />
Universität, Tokio Universität).<br />
Am 7. Juni hatte das Institut zur Jubiläumsveranstaltung<br />
unter dem Motto<br />
„R5 – Recurring Renewable Resource<br />
Researcher Reunion” an den <strong>BOKU</strong>-<br />
Standort in Tulln geladen. Dazu wurden<br />
120 Gäste begrüßt, die aus insgesamt<br />
21 verschiedenen Nationalitäten<br />
stammen, darunter auch „Ehemalige“<br />
des Instituts, die heute als Professor*innen<br />
in Japan, Deutschland oder<br />
Serbien tätig sind.<br />
BEISPIEL AUS DER<br />
AKTUELLEN FORSCHUNG<br />
In den 25 Jahren der Forschung zur<br />
ChemieNawaros wurden die zwei<br />
weltweit größten Datenbanken zu<br />
Cellulosen sowie zu Ligninen aufgebaut.<br />
Derzeit zirka 1.000 komplett<br />
charakterisierte technische Lignine in<br />
der Lignindatenbank und über 21.000<br />
Einträge für Messungen in der Cellulose-Datenbank.<br />
Die Zahl der zu<br />
untersuchenden Proben steigt exponentiell<br />
mit der Entwicklung von<br />
Bioraffinerien und der Bedeutung von<br />
Bioökonomie. Klassische chemische<br />
Analysemethoden dauern Stunden<br />
oder Tage und können solche Probenmengen<br />
niemals bewältigen. Aufbauend<br />
auf die Datenbanken wurden<br />
chemometrische Modelle entwickelt,<br />
die aufgrund der sehr hohen Probenzahl<br />
eine extrem gute statistische<br />
Sicherheit aufweisen. Durch einfache<br />
Messungen (Infrarot-Spektroskopie)<br />
können basierend auf den chemometrischen<br />
Modellen die wichtigsten<br />
chemischen Parameter jetzt in<br />
Sekundenschnelle ermittelt werden.<br />
Dadurch wird erstmals eine „Hochdurchsatz-“Lignocellulose-Analytik<br />
möglich, die sowohl die ausreichende<br />
Genauigkeit besitzt als auch mit den<br />
Anforderungen extrem hoher Probenzahlen<br />
mithalten kann (Veröffentlichung<br />
in ChemSusChem).<br />
„Am Institut für Chemie nachwachsender<br />
Rohstoffe erforschen wir den<br />
Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft“,<br />
so die Institutsleiter*in Thomas<br />
Rosenau und Antje Potthast abschließend.<br />
„Mit einem starken Fokus<br />
auf Lignocellulosen und Biomasse,<br />
Bioraffinerien, innovativen Analyseund<br />
Trennverfahren sowie modernen<br />
Methoden und Reaktionen der grünen<br />
Chemie versuchen wir, den Weg für<br />
eine umweltfreundliche und nachhaltige<br />
Welt zu ebnen.“<br />
■<br />
Dr. Marco Beaumont leitet am Institut<br />
für Chemie nachwachsender Rohstoffe<br />
die Arbeitsgruppe „Erneuerbare Nanomaterialien“.<br />
30 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
31
EPICUR und <strong>BOKU</strong>:BASE fördern<br />
internationale Innovation im<br />
Rahmen von Agro Food Challenges<br />
Von Zacharias Lumerding und Lena Peterstorfer<br />
LENA PETERSTORFER<br />
Gruppenfoto der Spring School an der <strong>BOKU</strong>.<br />
Seit 2019 arbeiten neun europäische<br />
Hochschulen aus sieben<br />
Ländern zusammen, um<br />
ein grenzüberschreitendes Bildungsangebot<br />
bereitzustellen. Dadurch<br />
sollen der akademische Austausch<br />
und die Mobilität der Studierenden,<br />
Forschenden und Lehrenden erleichtert<br />
und gefördert werden. Ein neues<br />
Kursangebot von EPICUR ist die<br />
Spring School „Sustainable Entrepreneurship“<br />
in Kooperation mit der<br />
<strong>BOKU</strong>:BASE, die im April zum ersten<br />
Mal an der <strong>BOKU</strong> stattfand.<br />
SPRING SCHOOL<br />
SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP<br />
Eine Woche lang haben 37 Studierende<br />
von neun Universitäten zusammengearbeitet,<br />
um Lösungen für<br />
Challenges von Partner-Organisationen<br />
zu entwickeln. Mit an Bord waren<br />
Viva con Agua, Protect our Winters<br />
und Beetles4tech.<br />
Dieses Jahr eröffnete das EPICUR<br />
Teaching und Learning Centre. Das<br />
Zentrum bietet einen virtuellen<br />
Raum, der darauf ausgerichtet ist,<br />
Lehr- und Lernmethoden kontinuierlich<br />
zu verbessern und zu innovieren.<br />
Es verbindet Fachkräfte<br />
aus Bildung und Lehre mit modernen<br />
pädagogischen Techniken,<br />
unterstützt durch fortschrittliche<br />
Technologie und Forschung. Durch<br />
Workshops, Seminare und Online-<br />
Kurse fördert es den Austausch von<br />
Wissen und Best Practices. Dies<br />
ermöglicht den Lehrenden und<br />
Studierenden, sich den Herausforderungen<br />
und Veränderungen<br />
der modernen Bildungslandschaft<br />
anzupassen und fördert lebenslanges<br />
Lernen.<br />
https://learn.epicur.education<br />
Lehrende der <strong>BOKU</strong>, der Uni Basel<br />
und der Uni Straßburg unterstützten<br />
die Teams die ganze Woche hindurch<br />
mit inhaltlichem Input und individuellem<br />
Coaching bei ihrem Prozess.<br />
Am Samstag fanden dann die finalen<br />
Pitches statt, wo jedes Team im<br />
Beisein der Partner-Organisationen<br />
seine Lösung präsentiert hat, bevor<br />
die erste Edition der Spring School<br />
mit einem informellen Ausklang ihr<br />
Ende fand.<br />
Die interdisziplinären Hintergründe<br />
und die verschiedenen Perspektiven<br />
führten nicht nur zu großartigen Ergebnissen,<br />
sondern machten die Woche<br />
auch zu einer wertvollen Erfahrung<br />
und Erinnerung für die Studierenden.<br />
Als kleine Unterstützung für eine<br />
nachhaltigere Welt, aber großartiges<br />
Erlebnis für alle Teilnehmenden war<br />
die Woche ein wertvoller Beitrag für<br />
kulturellen Austausch und die Stärkung<br />
für interuniversitäre Zusammenarbeit<br />
an der <strong>BOKU</strong>. Zwei der Teams<br />
haben sich besonders mit dem Thema<br />
Ernährung beschäftigt (mehr dazu im<br />
Beitrag auf der nächsten Seite). ■<br />
Zacharias Lumerding und Lena Peterstorfer<br />
sind Mitarbeiter*innen der <strong>BOKU</strong>:BASE.<br />
32 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
CAROLINE KUNESCH<br />
Crowdsourcing zur Gewinnung von In-situ-Daten mithilfe einer Smartphone App<br />
Eine Zukunft<br />
ohne Schokolade?<br />
Von Caroline Kunesch<br />
Eine Zukunft ohne Schokolade?<br />
Für viele unvorstellbar – auch<br />
für Paul und sein Team, die<br />
im Rahmen der <strong>BOKU</strong>:BASE Spring<br />
School zum Thema „Sustainable<br />
Entrepreneurship“ damit ihre finale<br />
Präsentation einleiteten. Gemeinsam<br />
mit zwei weiteren Gruppen hat das<br />
junge, interdisziplinäre und internationale<br />
Team die fünf Tage in Wien damit<br />
verbracht, die Herausforderungen<br />
und Chancen der Kakaoproduktion<br />
zu verstehen und an Lösungen zu<br />
arbeiten. Vorgestellt wurden die beiden<br />
Challenges, an denen die Teams<br />
arbeiteten, von Forscher*innen innerhalb<br />
des Forschungsprojektes „De-<br />
Free“ am Beispiel der Kakaoproduktion<br />
in Côte d’Ivoire.<br />
Wir wechseln also die Szenerie vom<br />
<strong>BOKU</strong>-Seminarraum, sonnigem Frühlingswetter<br />
und Kaffee in der Pause<br />
zu 35 Grad Celsius und über 80<br />
Prozent Luftfeuchtigkeit unter den<br />
schattenbietenden Kakaobäumen in<br />
Mankono, Côte d’Ivoire, dem Land,<br />
in dem weltweit der meiste Kakao<br />
produziert wird.<br />
Während sich wahrscheinlich viele<br />
keine Zukunft ohne Schokolade<br />
vorstellen wollen, so steht die Kakaoproduktion<br />
hier vor unzähligen<br />
Herausforderungen. Von Abholzung<br />
primärer Wälder und fortbestehender<br />
Kinderarbeit über vom Klimawandel<br />
beeinträchtigte Ernten bis hin zum<br />
Preisdruck und der Armut, der sich<br />
viele kleinstrukturierte Kakaobauern<br />
und -bäuerinnen ausgesetzt sehen:<br />
In der Welt des Kakaos stehen einer<br />
nachhaltigen Bewirtschaftung noch<br />
entscheidende Hürden bevor.<br />
Der Fokus der Spring School Challenges<br />
sowie des Forschungsprojektes<br />
lag auf der Abholzung von Waldflächen,<br />
insbesondere durch den Anbau<br />
von Kakao, Kaffee, Holz und Kautschuk.<br />
Während die Entwaldung eine<br />
der Hauptursachen für den weltweiten<br />
Verlust an biologischer Vielfalt<br />
darstellt, ist die Erhaltung der Wälder<br />
darüber hinaus von entscheidender<br />
Bedeutung für die Abschwächung des<br />
Klimawandels, da Wälder (neben anderen<br />
klimarelevanten Effekten) als<br />
Kohlenstoffsenken fungieren, indem<br />
sie mehr als die Hälfte des weltweiten<br />
Kohlenstoffbestands in Vegetation<br />
und Böden speichern (FAO, 2022; Richardson<br />
et al., 2023).<br />
Die Entwaldungsrate betrug von 2015<br />
bis 2020 etwa zehn Millionen Hektar<br />
pro Jahr, wobei die landwirtschaftliche<br />
Expansion für etwa 90 Prozent<br />
der weltweiten Entwaldung verantwortlich<br />
ist (FAO, 2022). Um das Problem<br />
der Entwaldung zu bewältigen,<br />
hat die Europäische Union (EU) die<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
33
CAROLINE KUNESCH<br />
Geerntete, bunte Kakaofrüchte, Côte d'Ivoire<br />
Die Kakaoproduktion in Côte d'Ivoire steht vor unzähligen<br />
Herausforderungen.<br />
Verordnung über entwaldungsfreie<br />
Produkte (EUDR) in Kraft gesetzt,<br />
die Produkte, die von kürzlich abgeholzten<br />
oder degradierten Flächen<br />
stammen, durch die Umsetzung eines<br />
strengen Sorgfaltsprüfungssystems<br />
vom EU-Markt verbannt (Europäische<br />
Kommission, <strong>2024</strong>). Die EU bekennt<br />
sich damit zu ihrer Verantwortung,<br />
die sie durch den Konsum potenziell<br />
entwaldender Rohstoffe hat und will<br />
nun zur Lösung des Problems beitragen<br />
(Europäische Kommission, <strong>2024</strong>).<br />
Unter anderem deshalb hat sich das<br />
Forschungsteam „DeFree“ rund um<br />
das Start-up Beetle ForTech, das Institut<br />
für Marketing und Innovation an<br />
der <strong>BOKU</strong> (C. Garaus, C. Kunesch) und<br />
das Forschungsinstitut Joanneum<br />
Research (M. Hirschmugl, N. Cepirlo)<br />
zusammengetan. Das von der österreichischen<br />
Forschungsförderungsgesellschaft<br />
finanzierte Projekt beschäftigt<br />
sich mit den Möglichkeiten<br />
einer zielführenden, sozial verträglichen<br />
und nachhaltigen Umsetzung<br />
der EUDR. Dabei werden Erkenntnisse<br />
aus globalem Produkttracking zur<br />
Rückverfolgbarkeit, der Fernerkundung<br />
im Rahmen der Satellitendatenanalyse<br />
und des Crowdsourcings zur<br />
Gewinnung von In-situ-Daten vereint.<br />
Und damit zurück zu den Lösungen,<br />
die im Rahmen der Spring School<br />
entstanden sind: Während Paul mit<br />
seinen Teamkolleg*innen mit dem<br />
automatisierten Einsatz von Drohnen<br />
eine detaillierte Waldüberwachung<br />
bearbeitete, beschäftigte sich ein<br />
weiteres Team mit den Chancen der<br />
Agroforst-Bewirtschaftung für Kakao.<br />
Das Team Cocoasafe entwickelte in<br />
kürzester Zeit den Prototypen eines<br />
Chatbots, welcher kleinen Kakaoproduzent*innen<br />
dabei helfen soll, einfach<br />
und unkompliziert an Informationen<br />
und Hilfestellungen zu kommen.<br />
Die jungen Teams haben damit nicht<br />
nur vielversprechende Lösungen entwickelt,<br />
sondern durch den Austausch<br />
und ihre neugierigen Gedankenanstöße<br />
für wesentliche Erkenntnisse im<br />
Forschungsteam gesorgt.<br />
Einige der Teilnehmer*innen werden<br />
auch weiterhin mit „DeFree“ zusammenarbeiten,<br />
um ihre Lösungen weiterzuentwickeln<br />
und schlussendlich<br />
über eine Zukunft der Schokolade<br />
aus nachhaltiger Kakaoproduktion zu<br />
reflektieren. Die Spring School setzt<br />
damit ein erfolgreiches Exempel für<br />
die Relevanz und die Bedeutsamkeit<br />
von inter- und transdisziplinären Kooperationen<br />
an der <strong>BOKU</strong>. ■<br />
LITERATUR<br />
European Comission. (<strong>2024</strong>). Regulation<br />
on Deforestation-free products—European<br />
Commission. https://environment.<br />
ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en<br />
FAO. (2022). The State of the World’s<br />
Forests 2022: Forest pathways for green<br />
recovery and building inclusive, resilient<br />
and sustainable economies. FAO.<br />
https://doi.org/10.4060/cb9360en<br />
Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W.,<br />
Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F.,<br />
Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., von Bloh,<br />
W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D.,<br />
Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W.,<br />
Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo,<br />
D., … Rockström, J. (2023). Earth beyond<br />
six of nine planetary boundaries. Science<br />
Advances, 9(37), eadh2458.<br />
https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458<br />
Caroline Kunesch, BSc., MSc. ist wissenschaftliche<br />
Projektmitarbeiterin am<br />
Institut für Marketing und Innovation.<br />
34 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Selbstorganisierte<br />
Lebensmittelversorgung:<br />
die <strong>BOKU</strong> FoodCoop<br />
Von AG Öffentlichkeitsarbeit der <strong>BOKU</strong> FoodCoop<br />
<strong>BOKU</strong> FOODCOOP<br />
Die <strong>BOKU</strong> FoodCoop am Standort Türkenschanze.<br />
Seit über zehn Jahren organisiert<br />
die <strong>BOKU</strong> FoodCoop<br />
eine faire, ökologische, transparente<br />
und überwiegend regionale<br />
Lebensmittelverteilung am Standort<br />
Türkenschanze.<br />
Mit vielen Studierenden und <strong>BOKU</strong>-<br />
Angehörigen als Mitglieder setzen wir<br />
ein starkes Zeichen bei der Produktion<br />
regionaler, ökologischer und sozial verträglicher<br />
Produkte. Teils gemeinsam<br />
mit anderen FoodCoops organisieren<br />
wir Bestellungen bei kleinen Landwirtschaftsbetrieben<br />
zugunsten kurzer<br />
und einfacher Transportwege und der<br />
Stärkung von Klein- und Kleinstbetrieben.<br />
Dabei gilt auch Mehrweg vor<br />
Einweg beziehungsweise die Wiederverwendung<br />
von Verpackungsmaterial.<br />
Der Kontakt zu Produzent*innen ist<br />
mehr als nur passives Konsumieren<br />
über konventionelle Vermarktungswege.<br />
Im Rahmen von Speisereisen<br />
überzeugen wir uns selbst von den<br />
Produktionsverhältnissen vor Ort.<br />
Durch die Bereitschaft, die Versorgung<br />
mit Lebensmitteln selbst in die<br />
Hand zu nehmen, entsteht Verantwortung<br />
gegenüber Produzierenden<br />
und Produktionsprozessen. Ergebnis<br />
sind hohe Produktqualität, soziale und<br />
nachhaltige Produktionsbedingungen<br />
und eine faire Preisgestaltung.<br />
Als eigenverantwortliche Gruppe innerhalb<br />
der <strong>BOKU</strong> arbeiten wir mit an<br />
einem ressourcenschonenden Umgang<br />
mit wertvollen Lebensmitteln<br />
und Ressourcen.<br />
Haben wir dein Interesse geweckt?<br />
Dann komm vorbei – virtuell oder real!<br />
https://foodcoop.boku.ac.at<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
35
FOTOS: <strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
Empowering Youth as<br />
Bioeconomy Changemakers<br />
By Damiano Cilio<br />
In a satellite event to the Bioeconomy<br />
Changemakers Festival<br />
<strong>2024</strong> – a festival organized<br />
by the European Commission<br />
DG Research and Innovation’s<br />
Bioeconomy Team in cooperation<br />
with the Bioeconomy Youth Ambassadors<br />
– the BCF<strong>2024</strong>-Vienna Edition<br />
brought youth empowerment<br />
and strategic collaboration to centre<br />
stage. The event, organised by<br />
the Centre for Bioeconomy of <strong>BOKU</strong><br />
University and dedicated to inspiring<br />
young people as bioeconomy changemakers,<br />
brought together key youth<br />
organizations to enhance their impact<br />
on the bioeconomy discourse.<br />
EVENT HIGHLIGHTS<br />
Overall, the BCF<strong>2024</strong>-Vienna Edition<br />
saw the participation of 19 young<br />
participants representing 17 youth<br />
organizations actively involved in the<br />
bioeconomy and related fields, either<br />
from an industry, policy, forestry,<br />
agriculture, or environmental related<br />
point of view. The participants,<br />
spanning from 17 to 32 years old,<br />
showcased a strong commitment to<br />
fostering youth participation in the<br />
bioeconomy sector.<br />
OPENING SESSION: CIRCULAR<br />
BIOECONOMY AS A SOLUTION?<br />
The event began with an engaging<br />
opening session titled ”Circular Bioeconomy<br />
as a Solution?“, kicked<br />
off by the welcoming words of Eva<br />
Schulev-Steindl – Rector of <strong>BOKU</strong><br />
University, Claudia Plakolm – State<br />
Secretary for Youth & Civilian Service<br />
of the Austrian Federal Government,<br />
Martin Greimel – Head of the Centre<br />
for Bioeconomy of <strong>BOKU</strong> University,<br />
and Camilla Werl – European Bioeconomy<br />
Youth Ambassador.<br />
Bernhard Kastner – Senior Scientist<br />
at the Centre for Bioeconomy<br />
of <strong>BOKU</strong>, articulated the core aim<br />
of bioeconomy: ”Bioeconomy is designed<br />
to reduce the entropic degradation<br />
of natural resources by a consumption-minimised<br />
and circular<br />
utilisation of feedstock.“ Following<br />
up on this bioeconomy vision, Karin<br />
Huber-Heim – Executive Director of<br />
the Circular Economy Forum, stressed<br />
the significance of partnerships for<br />
promoting the transformative bioeconomy<br />
and influencing the European<br />
policy landscape. ”Collaboration<br />
between public, private, and civil<br />
society stakeholders is essential for<br />
scaling up circular bioeconomy initiatives“,<br />
she noted.<br />
WORKSHOPS AND NETWORKING<br />
The event's dynamic agenda continued<br />
with a lively networking session,<br />
providing participants the opportunity<br />
to connect and share ideas. This<br />
was followed by two insightful workshops<br />
organized together with the<br />
Centre for Social Innovation. These<br />
workshops aimed to deepen understanding,<br />
foster new visions, and enhance<br />
communication strategies related<br />
to the transformative potential<br />
of bioeconomy. Participants actively<br />
engaged in discussions, sharing new<br />
36 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Participants actively engaged in discussions, sharing new perspectives and best practices for achieving a sustainable future<br />
perspectives and best practices for<br />
achieving a sustainable future, highlighting<br />
the role of youth in driving<br />
the bioeconomy forward.<br />
REFLECTIVE CLOSING SESSION<br />
The event concluded with a reflective<br />
closing session, where speakers<br />
reiterated the importance of collaborative<br />
efforts in advancing circular<br />
bioeconomy. The final remarks underscored<br />
the urgency of collective<br />
action in pushing the transformation<br />
forward, emphasizing the pivotal role<br />
of a united front among youth organizations.<br />
The success of this event demonstrates<br />
the power of youth organisations<br />
in addressing global challenges.<br />
By contributing to empowering young<br />
people to become changemakers and<br />
supporting them to strengthen strategic<br />
partnerships and synergies, the<br />
BCF<strong>2024</strong>-Vienna Edition has sent a<br />
promising signal for future bioeconomy<br />
initiatives.<br />
BUILDING THE FUTURE OF<br />
THE EUROPEAN BIOECONOMY<br />
The European Bioeconomy Changemakers<br />
Festival <strong>2024</strong> took place from<br />
11 to 17 March <strong>2024</strong>, with a high-level<br />
event held in Brussels on 13 and 14<br />
March <strong>2024</strong>. In addition to the main<br />
event, the festival comprised more<br />
than 30 satellite events held in different<br />
formats across Europe – among<br />
which the BCF<strong>2024</strong>-Vienna Edition.<br />
This very successful series of events<br />
managed to establish European cooperation<br />
and marked an important<br />
milestone for the future of the European<br />
bioeconomy. Indeed, the festival<br />
helped the European Commission<br />
gather insights to lay the foundation<br />
for a new European Bioeconomy<br />
Strategy and Action Plan, expected<br />
to be released in 2025.<br />
With the European Commission acknowledging<br />
the pivotal role of the<br />
European Bioeconomy University<br />
Alliance – EBU in bioeconomy education,<br />
the EBU Alliance is poised<br />
to engage in ongoing dialogues with<br />
the Commission. <strong>BOKU</strong> University,<br />
through its active involvement in<br />
EBU, participated in the main event in<br />
Brussels and is also now in key connection<br />
with the European Commission<br />
for the development of this new<br />
EU Bioeconomy strategy, advancing<br />
bioeconomy education on a European<br />
level.<br />
■<br />
For more information on<br />
BCF<strong>2024</strong>-Vienna Edition<br />
https://short.boku.ac.at/bcf<strong>2024</strong>-<br />
viennaedition<br />
For more information on EBU’s<br />
contribution to the BCF<strong>2024</strong> https://<br />
european-bioeconomyuniversity.<br />
eu/youth-aschangemakersfor-thetransformation/<br />
Damiano Cilio, MSc., is coordinator<br />
of the Presidency of the European<br />
Bioeconomy University Alliance at<br />
<strong>BOKU</strong> University.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
37
Bioökonomie an der <strong>BOKU</strong>: Fünf Jahre<br />
Pionierarbeit im Dienst des Klimaschutzes<br />
FOTOS: <strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
Die <strong>BOKU</strong> University hat sich in den<br />
vergangenen Jahren intensiv auf die<br />
Forschung zu biogenen Rohstoffen<br />
und bioökonomischen Prozessen<br />
konzentriert und dabei bedeutende<br />
Fortschritte erzielt. Zahlreiche<br />
Initiativen wurden ins Leben gerufen,<br />
um die Bioökonomie sowohl national<br />
als auch international zu fördern.<br />
Ein Rückblick und Ausblick.<br />
Martin Greimel leitet das Zentrum für Bioökonomie der <strong>BOKU</strong> seit seiner<br />
Gründung vor fünf Jahren.<br />
Am 7. Mai <strong>2024</strong> feierte das<br />
Zentrum für Bioökonomie<br />
sein fünfjähriges Bestehen<br />
und lud dazu ins<br />
Ilse-Wallentin-Haus. Neben <strong>BOKU</strong>-<br />
Mitarbeiter*innen und zahlreichen<br />
Expert*innen aus dem umfangreichen<br />
externen Netzwerk waren auch Vertreter*innen<br />
aus dem Wissenschafts-,<br />
Klima- sowie Landwirtschaftsministerium<br />
mit dabei. Wissenschaftsminister<br />
Martin Polaschek und Klimaschutzministerin<br />
Leonore Gewessler<br />
sendeten jeweils Videobotschaften,<br />
während Sektionsleiter Reinhard<br />
Mang aus dem Landwirtschaftsministerium<br />
persönlich seine und die<br />
Glückwünsche von Bundesminister<br />
Totschnig überbrachte.<br />
Nach Begrüßungsworten von Rektorin<br />
Eva Schulev-Steindl gewährte<br />
zunächst Altrektor Martin Gerzabek<br />
Einblicke in die Ursprungsidee einer<br />
Etablierung eines Bioökonomiezentrums<br />
an der <strong>BOKU</strong>, basierend auf<br />
den internationalen Entwicklungen auf<br />
EU-Ebene. Altrektor Hubert Hasenauer<br />
berichtete dann über die tatsächliche<br />
Umsetzung dieser Idee während<br />
seiner Amtszeit. Nachdem Rektorin<br />
Eva Schulev-Steindl bereits die vielen<br />
Tätigkeiten und Highlights in den<br />
vergangenen fünf Jahren in ihrer Einleitung<br />
dargestellt hatte, fokussierte<br />
Martin Greimel – Leiter des Zentrums<br />
für Bioökonomie an der <strong>BOKU</strong> – auf<br />
die zukünftigen Tätigkeiten, Herausforderungen<br />
und Visionen.<br />
VORREITERROLLE DER <strong>BOKU</strong><br />
Die Umstellung der Wirtschaft von<br />
nicht nachwachsenden Rohstoffen<br />
auf nachwachsende stellt eine der<br />
effektivsten Maßnahmen gegen den<br />
Klimawandel dar. Seit die Europäische<br />
Kommission in Brüssel 2005 die<br />
„wissensbasierte Bioökonomie“ - die<br />
Wissenschaft, die den Weg zu einer<br />
biobasierten Wirtschaft und Gesellschaft<br />
ermöglicht – aus der Taufe<br />
gehoben hat, nimmt die <strong>BOKU</strong> University<br />
eine Vorreiterinnenrolle in diesem<br />
Bereich ein. „Mehr als 80 Prozent<br />
unserer Institute widmen sich der<br />
Forschung in den Bereichen biogener<br />
Rohstoffgewinnung, bioökonomischer<br />
Verarbeitungsprozesse sowie deren<br />
umwelt- und sozialwissenschaftlichen<br />
Prozessen“, betont Rektorin Eva<br />
Schulev-Steindl. Die <strong>BOKU</strong> zeichnet<br />
sich international durch die umfassende<br />
Abdeckung aller Forschungsebenen<br />
aus.<br />
Mit dem Ziel, eine koordinierte Herangehensweise<br />
an dieses breit gefächerte<br />
Forschungsfeld sicherzustellen,<br />
wurde 2019 das Zentrum für<br />
Bioökonomie an der <strong>BOKU</strong> unter der<br />
Leitung von Martin Greimel etabliert.<br />
Das Zentrum strebt danach, die Kommunikation,<br />
Zusammenarbeit und Koordination<br />
aller relevanten bioökonomischen<br />
Aktivitäten innerhalb der<br />
Universität sowie mit nationalen und<br />
internationalen Institutionen zu fördern<br />
und zu intensivieren. Seit seiner<br />
Gründung hat das Zentrum bedeutende<br />
Fortschritte erzielt:<br />
▶ Die <strong>BOKU</strong> hat eine federführende<br />
Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung<br />
des nationalen Bioökonomie-Aktionsplans<br />
im Rahmen der<br />
Österreichischen Bioökonomiestrategie<br />
übernommen.<br />
38 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Applaus für das Zentrum für Bioökonomie und sein Team bei der Feier am 7. Mai.<br />
▶ Es wurden Expert*innenforen zur<br />
Biomasseverfügbarkeit und -verwendung<br />
in Österreich durchgeführt,<br />
um einen faktenbasierten<br />
Einsatz von Rohstoffen in der Bioökonomie<br />
zu fördern.<br />
▶ Seit Dezember 2022 hat die <strong>BOKU</strong><br />
den Vorsitz der European Bioeconomy<br />
University Alliance (EBU)<br />
inne. Die EBU ist ein Zusammenschluss<br />
von acht führenden EU-<br />
Universitäten im Bereich Bioökonomie.<br />
Sie entwickelt kontinuierlich<br />
neue, länderübergreifende<br />
Bildungsangebote und koordiniert<br />
internationale Forschungsprojekte<br />
im Bereich der Bioökonomie.<br />
▶ Die <strong>BOKU</strong> spielt eine wichtige beratende<br />
Rolle bei der Entwicklung<br />
der neuen Europäischen Bioökonomie-Strategie.<br />
ZWISCHEN INNOVATION<br />
UND NACHHALTIGKEIT<br />
„Wir befinden uns heute in einem Stadium,<br />
in dem sowohl bei der biogenen<br />
Rohstofferzeugung als auch bei den<br />
biogenen Verarbeitungsprozessen<br />
bereits vielversprechende Lösungsansätze<br />
vorhanden sind“, erklärt Greimel.<br />
„Ein Großteil der Produkte, die<br />
bisher aus Erdöl hergestellt wurden,<br />
kann bereits durch solche aus nachwachsender<br />
Biomasse ersetzt werden.“<br />
Doch nicht alles, was technisch<br />
möglich ist, ist auch ökonomisch oder<br />
ökologisch sinnvoll – dies gilt auch für<br />
die Bioökonomie. An der <strong>BOKU</strong> wird<br />
daher die entsprechende Ökobilanz<br />
eingehend untersucht.<br />
Einen weiteren Schwerpunkt der<br />
<strong>BOKU</strong> im Bereich Bioökonomie beschreibt<br />
der Leiter des Zentrums für<br />
Bioökonomie so: „Wenn wir in Österreich<br />
alles auf nachwachsende Rohstoffe<br />
umstellen würden, bräuchten<br />
wir 50 Prozent mehr an Anbaufläche,<br />
daher spielen in der Bioökonomie<br />
auch sozialwissenschaftliche Aspekte<br />
wie Konsumverhalten oder Politikberatung<br />
eine wesentliche Rolle.“<br />
AKTUELLE PROJEKTE<br />
UND HERAUSFORDERUNGEN<br />
▶ Entwicklung eines Konzepts für<br />
eine „Transformative Bioökonomie“.<br />
Dieses Konzept beschreibt, wie ein<br />
ganzheitlicher Übergang von der<br />
aktuellen linearen Wirtschaftsweise<br />
hin zu einer Bioökonomie<br />
gestaltet werden kann.<br />
▶ Aufbau eines Netzwerks im Rahmen<br />
des österreichischen Bioökonomie-Clusters<br />
im Rahmen<br />
des Waldfondsprojekts Bioeconomy<br />
Austria. Das Zentrum fungiert<br />
als Berater auf regionaler<br />
(z. B. Bioökonomie-Modelregion<br />
Vulkanland, Fachbeirat Zukunft.<br />
Wirtschaft.Niederösterreich), nationaler<br />
(z. B. Ko-Vorsitz in der §8<br />
Task Force Circular Economy, eingerichtet<br />
vom BMK und BMAW) und<br />
internationaler Ebene (z. B. Beratung<br />
osteuropäischer Länder und<br />
Westbalkanländer im Rahmen des<br />
Beaming-Projekts zur Gestaltung<br />
ihrer Bioökonomie).<br />
▶ In Zusammenarbeit mit dem Verein<br />
BIOS Science Austria organisiert<br />
das Zentrum den Studierendenwettbewerb<br />
BISC-E 2025. Dieser<br />
Wettbewerb richtet sich an Bachelor-<br />
und Masterstudierende, die<br />
im Team ein neues bio-basiertes<br />
Produkt oder Verfahren entwickeln<br />
sollen. Das Gewinnerteam wird<br />
Österreich beim europäischen<br />
Wettbewerb vertreten.<br />
GESELLSCHAFTLICHER UND<br />
WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ<br />
Wenn es darum geht, das vorhandene<br />
Know-how der Bioökonomie in die<br />
Praxis umzusetzen, bedarf es eines<br />
Wandels: „Die Gesellschaft sollte von<br />
der Politik mehr Engagement einfordern,<br />
während die Wirtschaft aktiv<br />
teilnehmen muss – dafür verlangt<br />
sie langfristige politische Zusicherungen“,<br />
so Martin Greimel abschließend.<br />
Ein Engagement wie „Fridays<br />
for Bioeconomy“ wäre daher sehr<br />
begrüßenswert.<br />
W<br />
Das Zentrum für Bioökonomie an der<br />
<strong>BOKU</strong> University koordiniert alle bioökonomie-relevanten<br />
Themen innerhalb der<br />
<strong>BOKU</strong> im Bereich Forschung, Bildung und<br />
Innovation und vernetzt die <strong>BOKU</strong>-Forscher*innen<br />
mit nationalen und internationalen<br />
Kolleg*innen. Im Herbst 2022<br />
übernahm die <strong>BOKU</strong> die Präsidentschaft<br />
der renommierten European Bioeconomy<br />
University Alliance (EBU).<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
39
Jetzt einreichen<br />
beim <strong>BOKU</strong><br />
Nachhaltigkeitspreis <strong>2024</strong>!<br />
<strong>BOKU</strong>/CHRISTOPH GRUBER<br />
Die Preisträger*innen des vorjährigen Nachhaltigkeitspreises .<br />
Wie im vergangenen Jahr gibt es in<br />
der Kategorie „Soziale und ökologische<br />
Verantwortung im Universitätsbetrieb“<br />
eine thematische Eingrenzung.<br />
Das Thema dieser Kategorie<br />
lautet erneut: „Nachhaltige und vermiedene<br />
Dienst- und Studienreisen“!<br />
Wenn du also eine Studienreise (z. B.<br />
Erasmussemester oder Forschungsaufenthalte)<br />
oder Dienstreise ohne<br />
Flugzeug oder andere emissionsin-<br />
Wie jedes Jahr haben <strong>BOKU</strong>-<br />
Angehörige auch <strong>2024</strong><br />
wieder die Möglichkeit,<br />
nachhaltigkeitsrelevante Projekte und<br />
Arbeiten in den vier Kategorien „Bildung<br />
für Nachhaltige Entwicklung“,<br />
„Nachhaltigkeitsbezogene Forschung<br />
– Masterarbeiten“, „Nachhaltigkeitsbezogene<br />
Forschung - Dissertationen/Publikationen“<br />
und „Soziale und<br />
ökologische Verantwortung im Universitätsbetrieb“<br />
für den <strong>BOKU</strong> Nachhaltigkeitspreis<br />
<strong>2024</strong> einzureichen.<br />
weiligen Kategorien, begutachtet im<br />
Herbst die Einreichungen und wählt<br />
einen ersten Platz sowie zwei weitere<br />
Nominierte aus. Die drei herausragenden<br />
Projekte/Arbeiten werden<br />
je Kategorie prämiert und die<br />
Preise am <strong>BOKU</strong> Nachhaltigkeitstag<br />
(20. 11. <strong>2024</strong>) verliehen.<br />
Die <strong>BOKU</strong> möchte im Rahmen der<br />
Nachhaltigkeitspreise nachhaltigkeitsbezogene<br />
Arbeiten und Projekte<br />
hervorheben und sichtbar machen.<br />
Eine Jury, bestehend aus passenden<br />
<strong>BOKU</strong>-Vertreter*innen in den jetensive<br />
Verkehrsmittel hinter dir oder<br />
eine Reise aus Nachhaltigkeitsgründen<br />
nicht durchgeführt hast, aber<br />
die erwarteten positiven Effekte der<br />
Reise auf andere Art erreichen konntest,<br />
dann reiche dieses Jahr für den<br />
<strong>BOKU</strong> Nachhaltigkeitspreis <strong>2024</strong> in<br />
dieser Kategorie ein und überzeuge<br />
die Jury von der nachhaltig durchgeführten<br />
oder vermiedenen Reise.<br />
Eine Einreichung ist bis zum 29. September<br />
für den <strong>BOKU</strong> Nachhaltigkeitspreis<br />
<strong>2024</strong> möglich! ■<br />
Preise und Einreichung<br />
https://short.boku.ac.at/<br />
boku-nachhaltigkeitspreis<br />
40 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
CITIZEN SCIENCE<br />
<strong>BOKU</strong>/NHM | OURIEL MORGENSZTERN<br />
Team-Foto (von links): Katrin<br />
Vohland (Direktorin Naturhistorisches<br />
Museum Wien), Daniel Dörler<br />
(<strong>BOKU</strong>-Forscher und Koordinator<br />
Österreich forscht), Florian Heigl<br />
(<strong>BOKU</strong>-Forscher und Koordinator<br />
Österreich forscht), Barbara Weitgruber<br />
(Sektionschefin Bundesministerium<br />
für Bildung, Wissenschaft<br />
und Forschung), Susanne Hecker<br />
(Chair European Citizen Science<br />
Association), Dorte Riemenschneider<br />
(Managing Director European Citizen<br />
Science Association)<br />
Citizen Science<br />
Doppelkonferenz <strong>2024</strong><br />
an der <strong>BOKU</strong> University<br />
Von Daniel Dörler und Florian Heigl<br />
Vom 3. bis zum 6. April<br />
<strong>2024</strong> fand an der <strong>BOKU</strong><br />
University und im Naturhistorischen<br />
Museum<br />
Wien die bislang größte Citizen Science<br />
Konferenz in Europa statt. Die<br />
Doppelkonferenz, bestehend aus<br />
der jährlich stattfindenden Österreichischen<br />
Citizen Science Konferenz<br />
(ÖCSK) und der alle zwei Jahre<br />
stattfindenden Europäischen Citizen<br />
Science Konferenz (ECSA), lud<br />
Forscher*innen, Praktiker*innen,<br />
Entscheidungsträger*innen und<br />
Förderorganisationen dazu ein, die<br />
Entwicklung von Citizen Science,<br />
also der aktiven Beteiligung von<br />
Bürger*innen in wissenschaftlichen<br />
Projekten, in den vergangenen zehn<br />
Jahren zu reflektieren. Hintergrund<br />
war der 10. Geburtstag der European<br />
Citizen Science Association und der<br />
österreichischen Plattform Österreich<br />
forscht, die von der <strong>BOKU</strong> koordiniert<br />
wird.<br />
Mehr als 120 hybride Vorträge, 80<br />
Poster und 50 interaktive Workshops<br />
sowie eine Podiumsdiskussion und<br />
zwei hochkarätige Keynote-Vorträge<br />
boten viel Gesprächsstoff und Austauschmöglichkeiten<br />
für die mehr als<br />
500 Teilnehmenden aus der ganzen<br />
Welt – vor Ort und online. Die angeregten<br />
Diskussionen wurden auch<br />
am Abend beim Heurigenbesuch<br />
oder bei der großen Geburtstagsparty<br />
für ECSA und Österreich forscht<br />
im Naturhistorischen Museum Wien<br />
unter Teilnahme von Generaldirektorin<br />
Katrin Vohland und des Bundesministers<br />
für Bildung, Wissenschaft<br />
und Forschung Martin Polaschek<br />
fortgesetzt.<br />
Die Konferenz konnte eindrucksvoll<br />
zeigen, dass sich Citizen Science in<br />
den vergangenen zehn Jahren sowohl<br />
in Österreich als auch auf europäischer<br />
Ebene stark weiterentwickelt<br />
hat. Vor allem die Vernetzung zwischen<br />
Forschenden beziehungsweise<br />
Citizen Science-Projektkoordinator*innen<br />
und Entscheidungsträger*innen<br />
wurde in den letzten<br />
Jahren ausgebaut und konnte mittlerweile<br />
auch einige Erfolge verzeichnen.<br />
So wird Citizen Science auf regionaler,<br />
nationaler und europäischer<br />
Ebene immer öfter auch zur Findung<br />
forschungsbasierter Lösungen von<br />
gesellschaftlichen Fragen verwendet.<br />
Es wird spannend zu beobachten<br />
sein, welche Entwicklungen sich in<br />
den nächsten zehn Jahren ergeben<br />
werden.<br />
■<br />
LINK<br />
Österreich forscht<br />
www.citizen-science.at<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
41
GENDER & DIVERSITY<br />
Wie barrierefrei, inklusiv und<br />
vielfältig ist die <strong>BOKU</strong>?<br />
Ergebnisse der Studierenden-Umfrage 2023<br />
Von Ruth Scheiber-Herzog<br />
Nach den beiden Erhebungen zur Situation von Studierenden<br />
mit Behinderungen und/oder gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen im Studienalltag in<br />
den Jahren 2010 und 2012 führte die Koordinationsstelle<br />
für Gleichstellung, Diversität und Behinderung 2023 erneut<br />
eine Online-Umfrage zum Thema „Wie barrierefrei,<br />
inklusiv und vielfältig ist die <strong>BOKU</strong>? / How barrier-free,<br />
inclusiv and diverse is <strong>BOKU</strong>?“ mit dem primären Ziel<br />
durch, mehr darüber zu erfahren, wie die Studierenden<br />
der <strong>BOKU</strong> Chancengerechtigkeit, Diversität und Inklusion<br />
im Studienalltag wahrnehmen. Die Umfrage wurde zweisprachig<br />
(deutsch und englisch) durchgeführt und in drei<br />
Fragegruppen aufgeteilt, die auch einzeln beantwortet<br />
werden konnten. An der Umfrage nahmen 518 Studierende<br />
von insgesamt 10.042 Studierenden aller Studienrichtungen<br />
teil (Stichtag 6. 1. 2023). Zur Auswertung wurden 351<br />
vollständig ausgefüllte Antworten herangezogen.<br />
DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE<br />
KURZ ZUSAMMENGEFASST<br />
Im ersten Teil der Umfrage wurden personenbezogene<br />
Daten erhoben, wie Geschlechter- und Alterskategorien,<br />
Tabelle 1: Angaben zu den Geschlechterkategorien<br />
Geschlechtskategorien / Gender Identity<br />
Anteil<br />
Divers | diverse 0 %<br />
Keine Angabe zum Geschlecht | no record 1 %<br />
Männlich | male 35 %<br />
Nicht binär | non binary 3 %<br />
Offen | open 0 %<br />
Sonstiges 1 %<br />
Weiblich | female 60 %<br />
Gesamt 100 %<br />
Studienrichtung, Nationalität / regionale Herkunft, Erwerbstätigkeit,<br />
Care-Verantwortung / Sorgepflichten oder<br />
der Bildungshintergrund der Eltern. Bei der Abfrage zur<br />
Geschlechterkategorie beispielsweise hat sich ein Großteil<br />
der Befragten (85 Prozent) der Kategorie „männlich“ oder<br />
„weiblich“ zugeordnet. Etwa drei Prozent der Studierenden<br />
haben diese Frage mit „Nicht binär“ beantwortet, ein Prozent<br />
gab „Sonstiges“ an oder wollte keine Angaben zum<br />
Geschlecht machen (Tabelle 1).<br />
Bei der Abfrage nach den Studienrichtungen an der <strong>BOKU</strong><br />
war mit 50 Prozent der Anteil an Bachelorstudierenden<br />
am höchsten, gefolgt von 39 Prozent Master- und zehn<br />
Prozent Doktoratsstudierenden. Nur ein Prozent gab andere<br />
Studienformen an. Dagegen verteilen sich Care-Verantwortung<br />
oder Sorgepflichten unter den Studierenden<br />
mit knapp 20 Prozent beinahe gleichmäßig auf Bachelor-,<br />
Master- und Doktoratsstudien.<br />
Bei der Fragegruppe „Studieren mit gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen oder Behinderungen / Studying with<br />
health impairments or disabilities“ war eine wesentliche<br />
Erkenntnis, dass 19 Prozent der Studierenden angeben,<br />
eine Behinderung oder gesundheitliche Beeinträchtigung<br />
zu haben, die sich „studienerschwerend“ auswirkt. Von<br />
diesen 19 Prozent sind wiederum 41 Prozent der Meinung,<br />
dass ihre Behinderung oder gesundheitliche Beeinträchtigung<br />
einen „starken“, 15 Prozent meinten sogar einen „sehr<br />
starken“, Einfluss auf den Studienalltag und Studienverlauf<br />
hat (Abbildung 1).<br />
Ein Großteil der betroffenen Studierenden möchte tendenziell<br />
nicht bzw. ist unsicher darüber, ob/dass andere<br />
Kenntnis über ihre Behinderung / Einschränkung haben<br />
sollen. Ein Drittel (35 Prozent) der Befragten hat das Gefühl,<br />
dass Mitstudierende bzw. Lehrende oft unsicher<br />
sind und nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen<br />
sollen. Aus der Umfrage geht ebenso hervor, dass die<br />
42 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
meisten Beeinträchtigungen nicht direkt sichtbar sind.<br />
82 Prozent der Studierenden haben ihre Behinderung oder<br />
gesundheitliche Beeinträchtigung als „nicht sichtbar“ deklariert,<br />
meist handelt es sich hierbei um psychische oder<br />
chronische Erkrankungen (Abbildung 2).<br />
Erfreulich ist, dass bei der Abfrage nach der „Bekanntheit<br />
von Unterstützungsstellen“ die ÖH und deren Referate<br />
mit 82 Prozent den meisten Studierenden bekannt sind.<br />
53 Prozent aller Studierenden kennen die Koordinationsstelle,<br />
wobei der Anteil jener, die eine studienerschwerende<br />
Beeinträchtigung haben, mit 62 Prozent noch etwas<br />
höher liegt.<br />
Bei der dritten Fragegruppe „Vielfalt und Inklusion an der<br />
<strong>BOKU</strong> / Diversity and Inclusion at <strong>BOKU</strong>“ zeigt sich, dass<br />
die <strong>BOKU</strong> in vielen Bereichen bereits als inklusiv und vielfältig<br />
wahrgenommen wird. Etwa 92 Prozent der Befragten<br />
gaben vor allem Veranstaltungen und Diversitätsstellen,<br />
bauliche Strukturen oder die Vielfalt von Menschen an der<br />
<strong>BOKU</strong> sowie Genderdiversität als positive und wesentliche<br />
Gründe für dieses Empfinden an (Abbildung 3). ■<br />
Abbildung 1: Einfluss der Beeinträchtigung<br />
auf das Studium<br />
gar nicht /<br />
not at all<br />
kaum / hardly<br />
stark / strong<br />
sehr stark /<br />
very strong<br />
Sonstiges<br />
Abbildung 2: Sichtbarkeit der Behinderung oder<br />
gesundheitlichen Beeinträchtigung<br />
sichtbar<br />
nicht sichtbar<br />
weiß nicht<br />
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention<br />
(UN-BRK) 2008 hat sich Österreich unter<br />
anderem dazu verpflichtet, alle Bildungseinrichtungen<br />
– auch Hochschulen - barrierefrei zugänglich zu<br />
machen. Bezugnehmend auf diese Verpflichtungen<br />
wurden beispielsweise für die Nationale Strategie zur<br />
sozialen Dimension in der Hochschulbildung (BMWFW<br />
2017) oder im Gesamtösterreichischen Universitätsentwicklungsplan<br />
GUEP 2022-2027 (2019) Forderungen<br />
nach inklusiveren Zugängen und breiterer Teilhabe<br />
an der Hochschulbildung für Menschen mit Behinderungen<br />
und gesundheitlichen Beeinträchtigungen<br />
formuliert. Um Inklusion im tertiären Hochschulsystem<br />
weiter voranzutreiben, ist es daher wichtig, die<br />
Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen als<br />
Akteur*innen in Wissenschaft und Forschung noch<br />
stärker zu fördern und den Auf- und Ausbau von Inklusion<br />
und Barrierefreiheit (im Sinne eines umfassenden<br />
Verständnisses von Barrierefreiheit) auf allen<br />
Ebenen weiter fortzusetzen.<br />
Abbildung 3: Was ist an der <strong>BOKU</strong> inklusiv?<br />
Alles<br />
Generell<br />
Bauliche Strukturen<br />
Menschen<br />
Diversitätsstellen und VA<br />
Sprache<br />
Diversitätsstrategie<br />
Studienrichtungen<br />
Genderdiversität<br />
Umfrage<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
43
GENDER & DIVERSITY<br />
Der erste Diversity Day<br />
an der <strong>BOKU</strong> University<br />
Von Ela Posch<br />
Mit zwei<br />
Höhepunkten<br />
wurde am 5. Juni<br />
zum ersten Mal<br />
an der <strong>BOKU</strong> der<br />
Diversity Day<br />
mitten im Pride<br />
Month gefeiert.<br />
Personen aus allen Bereichen der<br />
<strong>BOKU</strong> machten sich bei einer<br />
gemeinsamen Zugfahrt auf den<br />
Weg von Wien zum <strong>BOKU</strong>-Standort<br />
Tulln, wo die neuen und progressiven<br />
Regenbogenfahnen gehisst wurden.<br />
Ein ganzer Menschenzug, bestehend<br />
aus Studierenden, Forschenden, Mitgliedern<br />
der Universitätsleitung, des<br />
Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen,<br />
des Betriebsrats und zahlreichen<br />
Mitarbeiter*innen aus der<br />
Verwaltung, wanderte den Wissenschaftspfad<br />
entlang, um zuerst am<br />
UFT und später am IFA mit dem Hissen<br />
der Fahnen ein starkes Zeichen für<br />
mehr Toleranz und Respekt und gegen<br />
Diskriminierung und Gewalt zu setzen.<br />
Der zweite Höhepunkt stand ganz<br />
im Zeichen der Diversität in der Forschung.<br />
In ihren Begrüßungsworten<br />
bekräftigte Rektorin Eva Schulev-Steindl<br />
die Wichtigkeit, sich für<br />
Diversität einzusetzen – es gehe vor<br />
allem darum, sich für mehr Chancengerechtigkeit,<br />
Inklusion und Gleichberechtigung<br />
stark zu machen. Mit<br />
Sustainable Diversity verfolgt die<br />
<strong>BOKU</strong> University in ihrer Diversitätsstrategie<br />
wichtige Kernziele – etwa<br />
Gleichstellung und Antidiskriminierung,<br />
Accessibility und soziale Inklusion<br />
oder ethnische Diversität und<br />
Rassismuskritik – und verschränkt<br />
diese mit den nachhaltigen Entwicklungszielen<br />
der Agenda 2030.<br />
ERSTMALS DIVERSITÄTSPREIS<br />
FÜR FORSCHUNG<br />
Zum ersten Mal wurden an der <strong>BOKU</strong><br />
Diversitätspreise für die Forschung<br />
vergeben. Die fünfköpfige Jury hatte<br />
unter allen Einreichungen zwei<br />
herausragende Forschungsprojekte<br />
ausgewählt: das Forschungsprojekt<br />
Klimasoziales Linz von Christina Plank<br />
und ihrem Team, das mit dem Hauptpreis<br />
ausgezeichnet wurde, sowie das<br />
Forschungsprojekt Accessible Spaces<br />
for All von Tatjana Fischer und ihrem<br />
Team, das mit dem Anerkennungspreis<br />
zurück nach Wien reisen durfte.<br />
In entspannter Atmosphäre bei Brötchen<br />
und Getränken konnten die Teilnehmenden<br />
mehr zu den Projekten<br />
erfahren, netzwerken und sich mit<br />
den Preisträger*innen austauschen,<br />
ehe der gemeinsame Rückweg nach<br />
Wien angetreten wurde.<br />
Das Team der Koordinationsstelle<br />
freut sich bereits jetzt auf die kommenden<br />
Diversity Days an der <strong>BOKU</strong> –<br />
Tage, an denen Chancengerechtigkeit,<br />
Teilhabe, Diversität und Inklusion im<br />
Zentrum stehen sollen und Räume,<br />
die zur gemeinsamen Reflexion, zum<br />
Austausch und zum Feiern von Vielfalt<br />
einladen sollen.<br />
■<br />
Diversity Day<br />
https://short.boku.ac.at/<br />
diversitaetsstrategie<br />
Forschungspreis<br />
Diversität <strong>2024</strong><br />
https://short.boku.ac.at/<br />
diversitaetspreis_<br />
forschung<br />
44 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
Beim diesjährigen Töchtertag durften die elf- bis 16-jährigen<br />
Teilnehmer*innen das neue River Lab der <strong>BOKU</strong> kennenlernen<br />
und einen spannenden Tag mit Workshops, Inputs und<br />
Quiz erleben. Christine Sindelar führte durch die beeindruckenden<br />
Räumlichkeiten des River Labs, wo die Teilnehmer*innen aktuelle<br />
Forschungsprojekte hautnah kennenlernen konnten.<br />
Im Workshop Die dunklen Wolken in der Welt der Fische durften<br />
die Teilnehmer*innen experimentelle Untersuchungen im Fische-<br />
Labor durchführen. Die Workshopleiter*innen des Instituts für<br />
Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung, Lena Bittmann,<br />
Christoph Hauer, Alex Plasser und Lisa Schmalfuß, begleiteten<br />
die Teilnehmer*innen beim Untersuchen, Beobachten und<br />
Experimentieren mit den Fischen und zeichneten die angehenden<br />
Fischexpert*innen nach bestandenem Quiz aus.<br />
Der Töchtertag<br />
an der <strong>BOKU</strong><br />
<strong>2024</strong><br />
Von Ela Posch<br />
Die Forscherinnen Sarah-Joe Burn, Sarah Gorr und Natalia Nöllenburg<br />
vom Institut für Nutztierwissenschaften erarbeiteten in<br />
dem Workshop Vom SmartPhone zur SmartFarm zusammen mit<br />
den Teilnehmer*innen Visionen für eine Landwirtschaft der Zukunft,<br />
um smarte Technologien vor allem für mehr Tierwohl und<br />
Tiergesundheit zu entwickeln.<br />
LINK<br />
Die Koordinationsstelle bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden<br />
und Kooperationspartner*innen.<br />
■<br />
https://short.boku.ac.at/girlsday24<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
45
DIDAKTIK<br />
Die Bedeutung von KI in der<br />
forschungsgeleiteten Lehre und<br />
worauf geachtet werden muss<br />
Von Andreas Zitek und Alexandra Strauss-Sieberth<br />
Künstliche Intelligenz oder KI<br />
ist mittlerweile ein Thema an<br />
allen Hochschulen. Insbesondere<br />
„Large Language Models“ (LLMs)<br />
wie ChatGPT üben derzeit auf das<br />
gesamte Bildungssystem einen großen<br />
Druck aus.<br />
Viele Hochschulen, wie auch die <strong>BOKU</strong>,<br />
haben daher Orientierungsrahmen für<br />
den Einsatz von KI in der Lehre geschaffen,<br />
eidesstattliche Erklärungen<br />
angepasst und Regelungen für die<br />
Kennzeichnung der Verwendung von<br />
KI-Tools in schriftlichen Abschlussarbeiten<br />
festgelegt (siehe zusätzliche<br />
Informationen am Ende des Artikels).<br />
In diesem Beitrag wollen wir Lehrende<br />
zu Wort kommen lassen, die sich<br />
intensiv mit KI in der Forschung, aber<br />
auch in der Lehre auseinandersetzen,<br />
um ein gemeinsames Verständnis und<br />
eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.<br />
Schließlich sieht das World<br />
Economic Forum in den Bereichen<br />
KI und Nachhaltigkeit in Zukunft die<br />
größten Jobzuwächse, weshalb genau<br />
diese Kombination für die Studierenden<br />
der <strong>BOKU</strong> von höchster Relevanz<br />
ist.<br />
Wir haben dazu <strong>BOKU</strong>-Lehrende zum<br />
Einsatz von Künstlicher Intelligenz<br />
befragt.<br />
Wie beeinflusst KI die Forschung,<br />
welche Rolle spielt sie und wird sie<br />
in Zukunft spielen? Wie verwenden<br />
Sie KI in der Forschung?<br />
Andreas Holzinger: Für mich als Forscher<br />
in diesem Bereich ist es sehr<br />
amüsant, dass jetzt jede(r) über KI<br />
spricht, obwohl die Popularität dieses<br />
Begriffs (der eigentlich ein falscher<br />
Begriff ist, welchen wir aber nie mehr<br />
aus unserem Sprachgebrauch wegbekommen<br />
werden) vor allem durch die<br />
großen Erfolge im maschinellen Lernen<br />
(Machine-Learning) entstanden<br />
ist – mit dem derzeit besten Beispiel,<br />
den sehr populären großen Sprachmodellen.<br />
Eines dieser Sprachmodelle<br />
ist der sogenannte Generative<br />
Pre-trained Transformer, abgekürzt<br />
GPT. Sprachmodelle wie GPT haben<br />
drei augenscheinliche Eigenschaften:<br />
1) sie funktionieren, 2) die Bedienung<br />
ist einfach, und 3) sie liefern oft verblüffende<br />
Ergebnisse. Das, was wir<br />
46 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
jetzt sehen, hat mehr als 70 Jahre<br />
an Entwicklung hinter sich – ist also<br />
nicht über Nacht gekommen, und baut<br />
auf drei Konzepten auf:<br />
1) Skalierbarkeit (alles, was heute digital<br />
ist, ist skalierbar ... wir Menschen<br />
sind aber nicht skalierbar ...)<br />
2) Parallelisierbarkeit (alles, was heute<br />
digital ist, ist parallelisierbar ... wir<br />
Menschen sind auch nicht parallelisierbar<br />
...)<br />
»Ich setzte mich für einen<br />
synergetischen Ansatz<br />
menschenzentrierter KI ein,<br />
um neue Technologien mit<br />
menschlichen Werten,<br />
ethischen Grundsätzen und<br />
rechtlichen Anforderungen<br />
in Einklang zu bringen,<br />
damit Sicherheit und<br />
Schutz gewährleistet sind.«<br />
Andreas Holzinger<br />
»Um angemessen, aber auch<br />
kritisch, mit dieser Technologie<br />
umgehen zu können, ist<br />
es wichtig, diese zur verstehen<br />
– einen entsprechend hohen<br />
Stellenwert sollten daher die<br />
mathematische Grundausbildung<br />
inklusive Statistik und<br />
Data Science in den zukünftigen<br />
Studiengängen der <strong>BOKU</strong><br />
haben.«<br />
Karsten Schulz<br />
3) Vernetztheit (alles, was heute digital<br />
ist, ist vernetzt ... wir Menschen<br />
können uns zum Beispiel nur über<br />
den mühsamen schmalbandigen Kanal<br />
„Sprache“, vielleicht noch über<br />
Gesten, austauschen, aber Computer<br />
können sich parallel (siehe 2) und<br />
hochdimensional austauschen. Das<br />
ist vielen gar nicht bewusst – und das<br />
in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend<br />
ist…).<br />
Genau diese drei Konzepte, die „KI“<br />
erfolgreich gemacht haben, stellen<br />
aber umgekehrt auch zukünftige potenzielle<br />
Gefahren dar, da diese auch<br />
zu unerwünschten Wirkungen und<br />
großen Problemen führen können;<br />
daher setze ich mich ja für einen synergetischen<br />
Ansatz menschenzentrierter<br />
KI ein, um neue Technologien<br />
mit menschlichen Werten, ethischen<br />
Grundsätzen und rechtlichen Anforderungen<br />
in Einklang zu bringen,<br />
damit Sicherheit und Schutz gewährleistet<br />
sind.<br />
Die großen Sprachlernmodelle haben<br />
aber auch wesentliche inhärente<br />
Nachteile, wie zum Beispiel 1) einen<br />
extrem hohen Ressourcenbedarf, vor<br />
allem hinsichtlich des Rechenbedarfes<br />
mit enorm großem CO 2<br />
-Fußabdruck<br />
(gerade das sollte an der <strong>BOKU</strong><br />
diskutiert werden, solche Modelle<br />
sind alles andere als „Green AI“),<br />
2) einen hohen Bedarf an menschlichen<br />
Ressourcen für die manuelle<br />
Konfiguration, sonst würde aufgrund<br />
vorhandener Trainingsdaten ein enormer<br />
Bias entstehen, was zu ethisch<br />
extrem fragwürdigen Ergebnissen führen<br />
würde, und 3) (der wahrscheinlich<br />
größte Nachteil) eine schlechte<br />
Nachvollziehbarkeit (Interpretierbarkeit/Erklärbarkeit)<br />
und Transparenz.<br />
ChatGPT ist einfach eine (sehr gut<br />
funktionierende) Plaudertasche, die<br />
sich hin- und herwindet, wenn es<br />
konkret wird und oftmals äußerst<br />
falsche Ergebnisse liefert. Hier ist<br />
und bleibt die Hauptfrage: „Kann ich<br />
meinen Ergebnissen vertrauen“? Siehe<br />
dazu einige von mir diesbezüglich<br />
verfasste Publikationen am Ende des<br />
Artikels.<br />
Karsten Schulz: KI wird zukünftig in<br />
der Forschung eine bedeutende Rolle<br />
spielen und bereits bald ein Standardwerkzeug<br />
in den Wissenschaften darstellen.<br />
Dazu werden auch wissenschafts-ethische<br />
Aspekte wie Transparenz,<br />
Erklärbarkeit, Gerechtigkeit und<br />
Datenschutz an Bedeutung gewinnen.<br />
Am Institut entwickelten wir selbst<br />
KI-gestützte Verfahren für eine verbesserte<br />
Prognose des Niederschlags-<br />
Abfluss-Verhaltens in hydrologischen<br />
Einzugsgebieten und zur Regionalisierung<br />
von Modellparametern. Damit<br />
unterstützen wir u. a. ein effizienteres<br />
Hochwasserrisikomanagement und die<br />
effiziente Zuflussprognose der österreichischen<br />
Wasser- und Energiewirtschaft.<br />
Zum Einsatz kommen eine<br />
Kombination aus sogenannten „Deep-<br />
Neural-Networks“ in verschiedenen<br />
Varianten (LSTM, Transformer, CNN,<br />
Autoencoder) und Methoden aus der<br />
Linguistik („Symbolic Regression“). Methodische<br />
Schwerpunkte liegen in der<br />
Entwicklung von „erklärbaren“ Strukturen<br />
(explainable AI) und der Analyse<br />
von Unsicherheiten.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
47
Bernhard Spangl: KI im weitesten<br />
Sinn wird in der Forschung bereits<br />
seit Jahrzehnten eingesetzt und hat<br />
die Modellbildung basierend auf gemessenen<br />
Daten und die Vorhersagegenauigkeit<br />
immer weiter verbessert.<br />
Die Verwendung von LLMs und<br />
ChatGPT im engeren Sinn wird das<br />
Schreiben und Korrigieren von Code<br />
und Artikeln beschleunigen, wobei<br />
die Kompetenz, die Ergebnisse zu<br />
bewerten und auf Richtigkeit zu überprüfen,<br />
wichtig und entscheidend<br />
sein wird.<br />
Enrico Soranzo: KI revolutioniert die<br />
Forschung, indem sie komplexe Muster<br />
erkennt und neue Erkenntnisse ermöglicht.<br />
Durch maschinelles Lernen<br />
können Daten analysiert und Trends<br />
identifiziert werden, die menschliche<br />
Forscher*innen möglicherweise übersehen.<br />
Meine Forschung profitiert von<br />
KI durch die Entwicklung fortschrittlicher<br />
Modelle zur Datenauswertung<br />
und Prognose. Durch die Integration<br />
von KI in den Forschungsprozess kann<br />
effizienter gearbeitet beziehungsweise<br />
können bessere Ergebnisse erzielt<br />
werden.<br />
Es geht nicht darum, dass KI menschliche<br />
Entscheidungsfindung ersetzt,<br />
sondern dass sie diese begleitet und<br />
ergänzt. Menschliche Intuition und<br />
Erfahrung bleiben unersetzlich, während<br />
KI als leistungsstarker Assistent<br />
dient, der bei der Analyse komplexer<br />
Daten unterstützt und fundierte Entscheidungen<br />
ermöglicht. Die Kombination<br />
aus menschlicher Kreativität<br />
und KI-Präzision führt zu Synergien,<br />
die unser Verständnis vertiefen und<br />
innovative Lösungsansätze hervorbringen.<br />
Meine Vision ist eine harmonische<br />
Koexistenz von menschlichem<br />
und künstlichem Intellekt, die<br />
zu bahnbrechenden Fortschritten in<br />
der Forschung führt.<br />
Oliver Meixner: Bis jetzt ist der Einfluss<br />
von KI auf meine Forschungsaktivitäten<br />
noch überschaubar. Vor allem<br />
zu Beginn eines Forschungsvorhabens,<br />
zur Einarbeitung in eine Thematik,<br />
auch etwa zur Begriffsbestimmung<br />
und insbesondere für sprachliche Korrekturen<br />
(DeepL) bei englischsprachigen<br />
Publikationen ist KI für mich ein<br />
wertvolles Hilfsmittel. In Zukunft wird<br />
sich der Einsatz von KI in der Forschung<br />
sicher noch weiter etablieren,<br />
wobei der Output stets mit Bedacht zu<br />
verwenden ist. Eine intensive Prüfung<br />
der KI-generierten Ergebnisse wird<br />
immer notwendig sein, im Zusammenspiel<br />
zwischen Forschenden und KI<br />
liegen aber sicher große Potenziale.<br />
Verwenden Sie KI in der Lehre? Auch<br />
hinsichtlich der Idee „forschungsgeleiteter<br />
Lehre“? Welche Möglichkeiten<br />
und Schwierigkeiten/Probleme sehen<br />
Sie bei der Verwendung von KI in der<br />
Lehre – auch, aber nicht nur in Bezug<br />
zu ChatGPT – Schlagwort Schreiben,<br />
Prüfungen, Lernen und Lehren?<br />
»Die Herausforderung wird<br />
sein, mit den Studierenden<br />
die Möglichkeiten und<br />
Grenzen von ChatGPT auszuloten<br />
und ihnen gleichzeitig<br />
die Kompetenz zu<br />
vermitteln, die Ergebnisse<br />
bewerten und auf ihre<br />
Richtigkeit überprüfen zu<br />
können.«<br />
Berhard Spangl<br />
Andreas Holzinger: Für den Einsatz<br />
spezieller KI-Tools wie ChatGPT,<br />
DeepL, QuillBot, Duolingo-Bots in der<br />
Lehre gilt: Das sind Werkzeuge - wie<br />
ein Hammer. Und hier gelten alle Regeln<br />
für moderne Werkzeuge - es wäre<br />
unklug diese nicht einzusetzen. ABER<br />
diese neuartigen Werkzeuge haben<br />
eben neuartige Nachteile und diese<br />
muss man kennen und berücksichtigen.<br />
KI-generierte Inhalte können ungenau<br />
und/oder irrelevant sein, wenn die zugrundeliegenden<br />
Modelle nicht richtig<br />
trainiert oder kontextualisiert sind. Es<br />
besteht die Gefahr, dass Menschen<br />
sich zu sehr auf diese Tools verlassen<br />
und dadurch wichtige Fähigkeiten im<br />
kritischen Denken und Problemlösen<br />
nicht ausreichend entwickeln. In allererster<br />
Linie muss Problemlösekompetenz<br />
gefördert und aufrechterhalten<br />
werden - das macht uns Menschen<br />
so besonders.<br />
Der Einsatz von KI in der Lehre wirft<br />
auch ethische Fragen auf, insbesondere<br />
in Bezug auf Datenschutz und die<br />
mögliche Verzerrung (Bias, Fairness<br />
usw.) in den Lehrmaterialien und Bewertungssystemen.<br />
Karsten Schulz: Hinsichtlich des Einsatzes<br />
von KI in der Lehre gibt es<br />
meiner Ansicht nach zwei Aspekte:<br />
erstens wie man selbst zur Unterstützung<br />
der eigenen Lehrtätigkeit KI<br />
einsetzen kann und zweitens, wie man<br />
die Vielfalt der Methoden aus der KI<br />
an die Studierenden weitergibt.<br />
Zur Unterstützung der eigenen Lehrtätigkeit<br />
empfehle ich die einschlägigen<br />
Fortbildungsveranstaltungen an<br />
der <strong>BOKU</strong>. Hinsichtlich der Nutzung<br />
von KI (insbesondere ChatGPT) durch<br />
Studierende versuchen wir zu vermitteln,<br />
wo und in welcher Form die<br />
Verwendung sinnvoll sein kann, aber<br />
auch eindeutig zu kommunizieren,<br />
dass letztendlich die Studierenden<br />
für das, was sie (auch mit Unterstützung<br />
von KI) „produzieren“, selbst<br />
verantwortlich sind. Die Ausbildung<br />
der Studierenden in KI wird durch<br />
die Erweiterung der Statistik und<br />
Data Science Module in den neuen<br />
B.Sc.-Studiengängen gefördert, muss<br />
aber dann entsprechend in den MSc-<br />
Curricula, auch in Hinblick auf die<br />
oben genannten ethischen Aspekte,<br />
ausgebaut werden.<br />
48 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
FREEPIK/JAVILO<br />
Bernhard Spangl: Methoden des<br />
statistischen/maschinellen Lernens<br />
werden bereits jetzt gelehrt. Der Einsatz<br />
von ChatGPT erfolgt derzeit noch<br />
nicht. Die Herausforderung wird sein,<br />
mit den Studierenden die Möglichkeiten<br />
und Grenzen von ChatGPT<br />
auszuloten und ihnen gleichzeitig die<br />
Kompetenz zu vermitteln, die Ergebnisse<br />
bewerten und auf ihre Richtigkeit<br />
überprüfen zu können.<br />
Enrico Soranzo: Ich nutze KI in der<br />
Lehre insbesondere in der LVA „KI in<br />
der Geotechnik“ (siehe <strong>BOKU</strong>-<strong>Magazin</strong><br />
1/<strong>2024</strong>). GenAI bietet vielfältige<br />
Möglichkeiten, zum Beispiel könnten<br />
Studierende Referate erstellen. Obwohl<br />
dies nicht explizit vorgesehen<br />
ist, sehe ich kein Problem, solange<br />
die Inhalte überprüft werden. Diese<br />
Methode macht Studierende zu<br />
Gutachter*innen, was die kritische<br />
Analyse fördert. Es ist jedoch sicherzustellen,<br />
dass die Verwendung von KI<br />
nicht die Notwendigkeit menschlicher<br />
Beurteilung ersetzt, sondern als Ergänzung<br />
dient, um Lernen und Lehren<br />
zu verbessern.<br />
KI kann auch als ChatBot verwendet<br />
werden. Zum Beispiel können Studierende<br />
fachspezifische Fragen stellen<br />
und sich Konzepte erklären lassen.<br />
Jedoch ist es notwendig, dass sie auf<br />
MANFRED FABIAN PICHLBAUER<br />
»Ein einfacher Zugang zu<br />
entsprechenden Tools in<br />
der Vollversion, insbesondere<br />
im Bereich der Forschung,<br />
wäre wünschenswert.<br />
Daneben braucht es<br />
klare Regeln, wie an der<br />
<strong>BOKU</strong> in Zukunft mit KIgenerierten<br />
Inhalten umzugehen<br />
ist.«<br />
Oliver Meixner<br />
die sogenannten „Halluzinationen“<br />
achten, d h. falsche oder irreführende<br />
Ergebnisse, die von KI-Modellen<br />
erzeugt werden. Diese können auftreten,<br />
wenn das Modell aufgrund<br />
unzureichender oder verzerrter Daten<br />
falsche Schlussfolgerungen zieht.<br />
Oliver Meixner: Ich motiviere Studierende<br />
bei ausgewählten Lehrveranstaltungen<br />
zum Einsatz von ChatGPT,<br />
insbesondere in der Konzeptionsphase<br />
eines Seminars (bei anderen<br />
LV-Typen setze ich bis dato keine KI<br />
ein). Die Einarbeitung in das Thema<br />
erfolgt damit weitaus schneller, die<br />
Kreativität der Studierenden wird<br />
gefördert. Sämtliche KI-generierten<br />
Inhalte werden dabei von den Studierenden<br />
umfassend dokumentiert.<br />
Nicht alle Studierenden machen von<br />
dieser Möglichkeit Gebrauch, es dürfte<br />
wohl noch gewisse Barrieren geben.<br />
Daher zeige ich auch insbesondere zu<br />
Beginn einiger Lehrveranstaltungen,<br />
welcher Output mit KI erzielt wird und<br />
wie dieser zu interpretieren ist.<br />
Was würden Sie sich von der <strong>BOKU</strong><br />
in Bezug zu KI in der Forschung und<br />
Lehre wünschen?<br />
Andreas Holzinger: Ich wünsche mir<br />
eine fachübergreifende Vernetzung<br />
über Departmentgrenzen hinweg, da<br />
die Stärke der <strong>BOKU</strong> gerade in der<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
49
NICKY WEBB<br />
»Was wir derzeit<br />
benötigen, ist eine<br />
verbesserte Infrastruktur,<br />
einschließlich Zugang zu<br />
Cloud-Lösungen wie AWS,<br />
Azure, Colab usw. Dies würde<br />
die Forschung und Lehre im<br />
Bereich KI erheblich fördern.«<br />
Enrico Soranzo<br />
LITERATUR<br />
Holzinger, A. 2021. The Next Frontier: AI<br />
We Can Really Trust. In: Kamp, Michael<br />
(ed.) Proceedings of the ECML PKDD<br />
2021, CCIS 1524. Cham: Springer Nature,<br />
pp. 427--440, doi:10.1007/978-3-030-<br />
93736-2_33. Online verfügbar:<br />
www.aholzinger.at/wordpress/<br />
wp-content/uploads/2022/02/HOLZ-<br />
INGER-2021-The-Next-Frontier-AI-We-<br />
Can-Really-Trust.pdf<br />
Holzinger, A. 2018. Interpretierbare KI:<br />
Neue Methoden zeigen Entscheidungswege<br />
künstlicher Intelligenz auf. c’t <strong>Magazin</strong><br />
für Computertechnik, 22, 136-141.<br />
Online verfügbar: www.heise.de/select/<br />
ct/2018/22/1540263049336608<br />
Holzinger, A. 2018. Explainable AI (ex-AI).<br />
Informatik-Spektrum, 41, (2), 138-143,<br />
doi:10.1007/s00287-018-1102-5. Online<br />
verfügbar: https://doi.org/10.1007/s00287-<br />
018-1102-5<br />
LINK<br />
Neue eidesstattliche Erklärung der<br />
<strong>BOKU</strong>: https://boku.ac.at/studienservices/themen/infos-studienabschluss/<br />
abschlussarbeiten/eidesstattlicheerklaerung<br />
Vielfalt ihrer Themen liegt, die die<br />
Welt braucht. Eine fachübergreifende<br />
Vernetzung mit der KI wäre hochaktuell<br />
und höchstrelevant als Alleinstellungsmerkmal<br />
für die <strong>BOKU</strong>.<br />
Karsten Schulz: Zunächst möchte<br />
ich positiv erwähnen, dass die <strong>BOKU</strong><br />
relativ schnell mit einem Orientierungsrahmen<br />
zu „Hochschullehre und<br />
Künstliche Intelligenz“ auf die Entwicklung<br />
im Bereich der LLM (Large<br />
Language Models) und insbesondere<br />
ChatGPT reagiert hat. Auch dass ab<br />
Mitte <strong>2024</strong> ein <strong>BOKU</strong>-weiter Zugang<br />
zu ChatGPT o. ä. für den Einsatz in<br />
Lehre und Forschung vorgesehen ist,<br />
halte ich für sehr positiv. Um angemessen,<br />
aber auch kritisch, mit dieser<br />
Technologie umgehen zu können,<br />
ist es wichtig, diese zur verstehen<br />
– einen entsprechend hohen Stellenwert<br />
sollten daher die mathematische<br />
Grundausbildung inklusive Statistik<br />
und Data Science in den zukünftigen<br />
Studiengängen der <strong>BOKU</strong> haben.<br />
Enrico Soranzo: Ich würde mir von<br />
der <strong>BOKU</strong> wünschen, dass die bestehende<br />
departmentübergreifende<br />
Initiative <strong>BOKU</strong> Data Science weiter<br />
gestärkt wird, die von Ursula Laa und<br />
Theresa Scharl-Hirsch geleitet wird<br />
und teilweise auch Fragen zur KI in<br />
Forschung und Lehre behandelt. Diese<br />
Initiative ist großartig für Networking<br />
und Koordination. Was wir derzeit jedoch<br />
benötigen, wie auch in der Initiative<br />
diskutiert, ist eine verbesserte<br />
Infrastruktur, einschließlich Zugang zu<br />
Cloud-Lösungen wie AWS, Azure, Colab<br />
usw. Dies würde die Forschung und<br />
Lehre im Bereich KI erheblich fördern.<br />
Oliver Meixner: Vor allem ein einfacher<br />
Zugang zu entsprechenden Tools<br />
in der Vollversion, insbesondere im<br />
Bereich der Forschung, wäre wünschenswert.<br />
Daneben braucht es klare<br />
Regeln, wie an der <strong>BOKU</strong> in Zukunft<br />
mit KI-generierten Inhalten umzugehen<br />
ist. Dazu ist aber ja schon einiges<br />
in Bewegung.<br />
W<br />
Weitere Details zur Dokumentation der<br />
Verwendung von KI im Rahmen von<br />
Abschlussarbeiten finden sich in den<br />
Formatvorlagen von Masterarbeiten und<br />
Dissertationen.<br />
Univ.Prof. Ing. Mag. Mag. Dr. Andreas<br />
Holzinger, Institut für Forsttechnik (FT),<br />
Human-Centered AI Lab (HCAI Lab)<br />
Univ.Prof. Dipl.Geoökol. Dr. Karsten<br />
Schulz, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft<br />
(HyWa)<br />
DI Dr. Bernhard Spangl,<br />
Institut für Statistik (STAT)<br />
Dr. Enrico Soranzo, MBA MSc.,<br />
Institut für Geotechnik (IGT)<br />
Ao.Univ.Prof. Mag. Dr. Oliver Meixner,<br />
Institut für Marketing und Innovation<br />
Bernhard Spangl: Für mich wäre eine<br />
Vernetzung über die Fachrichtungen<br />
hinweg wichtig.<br />
DI Dr. Andreas Zitek, MSc. und DI in Alexandra Strauss-Sieberth, BEd. sind in der Lehrentwicklung<br />
im Bereich E-Learning und Didaktik tätig.<br />
50 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
DIDAKTIK<br />
Was darf,<br />
was soll,<br />
was muss?<br />
Wie steht es<br />
um „Ethik“ in der<br />
Lehre an der <strong>BOKU</strong><br />
Ergebnisüberblick zur Umfrage<br />
zu Ethik in der Lehre der <strong>BOKU</strong>-<br />
Ethikplattform<br />
Von Harald Rennhofer, Caroline Hammer<br />
und Wolfgang Liebert für die AG Lehre<br />
der Ethikplattform<br />
Eine der Kernaufgaben der<br />
Ethikplattform der <strong>BOKU</strong> ist<br />
die Förderung ethischen Bewusstseins<br />
in Forschung, Lehre und<br />
im Umgang miteinander. Dies geschieht<br />
durch regelmäßige Treffen<br />
der Ethik-Plattform, in themenspezifischen<br />
Arbeitsgruppen (AGs) und<br />
verschiedenen Veranstaltungen, wie<br />
Vorträgen oder Weiterbildungen.<br />
Schon 2011 wurde eine Umfrage zu<br />
ethischen Aspekten in der Lehre<br />
durchgeführt. Aus dem Stimmungsbild<br />
sollten Aktivitäten der neu eingerichteten<br />
Ethikplattform abgeleitet<br />
werden. Nunmehr wurde 2022 abermals<br />
eine neue Umfrage unter Lehrenden<br />
und Studierenden durch die<br />
AG Ethik in der Lehre vorbereitet. Ziel<br />
war es, zu erfahren, ob Ethik als Thema<br />
in der Lehre explizit oder zumindest<br />
implizit vorkommt und wie die<br />
Wahrnehmungen, Erwartungen oder<br />
Wünsche diesbezüglich sind. Einstellungen,<br />
Haltungen und Eindrücke von<br />
Lehrenden und Studierenden sollten<br />
aufgrund von zwei ähnlichen Fragebögen<br />
sichtbar und vergleichbar werden.<br />
ETHISCHE ASPEKTE<br />
ALS WICHTIG ERACHTET<br />
Bei den Lehrenden wurden 141 Fragebögen<br />
vollständig ausgefüllt, bei<br />
den Studierenden 266, das entspricht<br />
jeweils 6,6 bzw. 2,6 Prozent der <strong>BOKU</strong>-<br />
Lehrenden beziehungsweise -Studierenden.<br />
1 Mit leichten Schwankungen<br />
waren alle Departments und alle Studienrichtungen<br />
sowie verschiedene<br />
Altersgruppen vertreten. Auffallend<br />
ist, dass bei den Lehrenden gleich<br />
viele, bei den Studierenden aber doppelt<br />
so viele Frauen* wie Männer* den<br />
Fragebogen ausgefüllt haben. Bei den<br />
1<br />
2021 zählte die <strong>BOKU</strong> 10.374 Studierende<br />
und 2.141 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen.<br />
2<br />
Dies spiegelt sich in der Entwicklung<br />
des Querschnittsthemas (QST) „Ethik“<br />
wider, das in Abstimmung mit dem Senat<br />
im Rahmen der Bachelor-Modularisierung<br />
ab 2025 etabliert werden soll.<br />
Lehrenden waren die Drittmittelangestellten<br />
sehr schwach vertreten, aber<br />
bei den Professor*innen hat etwa ein<br />
Viertel geantwortet. Entfristeter Mittelbau<br />
war am stärksten vertreten.<br />
Die Bemühungen der Ethikplattform,<br />
ethisches Bewusstsein an der <strong>BOKU</strong><br />
und in der Lehre zu fördern, werden<br />
grundsätzlich von Studierenden und<br />
Lehrenden begrüßt. Über 80 Prozent<br />
der Studierenden befürworten es,<br />
wenn in Zukunft ethische Aspekte<br />
stärker in die Lehre eingebunden<br />
würden, am besten direkt als Teil der<br />
Fachlehre selbst oder mittels eigener<br />
Ethikgrundlagen-LVs im Pflicht- bzw.<br />
Wahlpflichtbereich ab etwa dem dritten<br />
Semester. 2<br />
Fast alle Studierenden wünschen sich<br />
ein Pflichtfach oder Wahlpflichtfach –<br />
oder zumindest ein freies Wahlfach –<br />
mit ethischen Inhalten. Ethische Themen,<br />
die von Studierenden in der Lehre<br />
als relevant wahrgenommen oder auch<br />
als interessant empfunden werden,<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
51
sind etwa Umweltethik, Tierethik,<br />
Gentechnik, Rolle der Wissenschaft<br />
und Werthaltungen, Gerechtigkeit<br />
und Gleichbehandlung. Studierende<br />
sehen den Mehrwert eines Diskurses<br />
mit Ethik-Bezug darin, sich persönlich<br />
besser positionieren zu können,<br />
ein kritisches Auseinandersetzen mit<br />
der verhandelten Thematik oder ein<br />
umfassenderes Verständnis zu ermöglichen.<br />
Während 43 Prozent ethische<br />
Aspekte bei der Vermittlung von<br />
Fachwissen begrüßen würden, ein<br />
Drittel schwerlich mit Ja oder Nein<br />
antworten kann, lehnen das 13 Prozent<br />
der Studierenden ab.<br />
VERMITTLUNG ETHISCHER ASPEKTE<br />
Die Lehrenden sehen einen Bezug zu<br />
Ethik in ihrer Forschung (22 Prozent),<br />
ihrem Forschungsfeld (33 Prozent),<br />
oder es gibt den Bezug zumindest<br />
peripher (29 Prozent). Ein Großteil<br />
der Lehrenden befürwortet die Einbindung<br />
von ethischen Fragen in der<br />
Lehre und sieht darin einen Mehrwert<br />
(80 Prozent) während sechs Prozent<br />
das ablehnen. Die meisten Befürwortenden<br />
sehen – wie die Studierenden<br />
– den Mehrwert darin, dass eine<br />
kritische Auseinandersetzung mit der<br />
verhandelten Thematik ein umfassenderes<br />
Verständnis dazu und die<br />
persönliche Positionierung ermöglicht<br />
wird. Viele Lehrende diskutieren sowohl<br />
im Arbeitsumfeld als auch mit<br />
Studierenden über ethische Fragestellungen.<br />
Themen dabei sind zum<br />
Beispiel Nachhaltigkeit, Ressourcenverteilung,<br />
Werthaltungen und Verantwortung,<br />
aber auch Forschungsfreiheit<br />
versus Auftragsforschung. 55 Prozent<br />
halten die Vermittlung von ethischen<br />
Aspekten im Rahmen der Wissensvermittlung<br />
für notwendig. Genauso<br />
viele geben an, ethische Themen in<br />
Master-LVs anzusprechen und knapp<br />
ein Viertel tut dies in Bachelor-LVs. Als<br />
einschränkend machen viele geltend,<br />
dass keine Zeit und kein Raum für<br />
solche Themen sei.<br />
Aus Sicht der Studierenden:<br />
War Ethik in die Lehre<br />
eingebunden?<br />
Nein<br />
15 %<br />
Andere<br />
18 %<br />
Ja<br />
67 %<br />
Erfahrung von Studierenden mit ethischen<br />
Fragestellungen ohne die UBRM<br />
Studierenden, von denen 97 Prozent mit<br />
Ja geantwortet haben - UBRM hat eine<br />
verpflichtende Ethik-VO in der STEOP.<br />
Studienabschnitt, in dem<br />
Lehrende Ethik einbinden?<br />
Keiner<br />
12 %<br />
Keine<br />
Antwort<br />
10 %<br />
Bachelor<br />
23 %<br />
Interesse an einer Weiterbildung?<br />
Keine<br />
Angabe<br />
33 %<br />
Nein<br />
23 %<br />
Master<br />
55 %<br />
Thematisieren ethischer<br />
Fragestellungen bzw. Aspekte<br />
in einer LV durch Lehrende.<br />
Ja<br />
48 %<br />
Interesse der Lehrenden an einer Weiterbildung,<br />
die das Einbinden ethischer<br />
Fragen in die Lehre thematisiert.<br />
WER GIBT IMPULSE?<br />
50 Prozent der Lehrenden zeigen<br />
grundsätzlich Bereitschaft sich in ethischen<br />
Fragen weiterzubilden. Themen,<br />
die für Fortbildungen genannt wurden,<br />
sind unter anderem ethische Konzepte,<br />
das Verhältnis Wissenschaft,<br />
Technik, Gesellschaft und Ethik samt<br />
Verantwortungsfragen, Umweltethik<br />
und -gerechtigkeit, Fallbeispiele, Möglichkeiten,<br />
wie Wertefragen beleuchtet<br />
und in die Lehre eingebunden und wie<br />
Machtverhältnisse thematisiert werden<br />
können. Passend dazu erwarten<br />
Studierende eher Impulse vonseiten<br />
der Lehrenden, aber etwa 50 Prozent<br />
der Studierenden sehen sich selbst<br />
mit in der Verantwortung, ethische<br />
Aspekte in der Lehre stärker einzufordern,<br />
vor allem über gemeinsame<br />
Diskussionen und kritisches Nachfragen.<br />
Lehrende wünschen sich mehr<br />
Anerkennung durch die <strong>BOKU</strong>-Institutionen<br />
und eine Anlaufstelle mit passendem<br />
didaktischem und ethischem<br />
Know-how.<br />
Für die Ethikplattform folgt, sich weiterhin<br />
für mehr Ethik-relevante Lehre<br />
an der <strong>BOKU</strong> einzusetzen und weitere<br />
Fortbildungen für Lehrende anzubieten.<br />
So kann erreicht werden, dass<br />
Studierende früh- und rechtzeitig mit<br />
Verantwortungs- und Orientierungsfragen<br />
in Berührung kommen, die mit<br />
der Entwicklung einflussreicher Technologien<br />
stets einhergehen. Die nächste<br />
Fortbildung ist für 30. September<br />
<strong>2024</strong> anlässlich des 300. Geburtsjahres<br />
von Immanuel Kant geplant. Um den<br />
(ethischen) Diskurs an der <strong>BOKU</strong> zu<br />
stärken und Studierenden die wesentliche<br />
Grundlage von Interdisziplinarität<br />
für ein umfassendes Problemverständnis<br />
näherzubringen, veranstaltet<br />
die Ethikplattform mit der ÖH und<br />
anderen Kooperationspartner*innen<br />
seit 2011 die Veranstaltungsreihe des<br />
<strong>BOKU</strong>- Kinos. Da in der Umfrage deutlich<br />
wurde, dass die Ethik-Thematik<br />
für wesentlich erachtet wird, ist dies<br />
ein Impuls für die Plattform, hier weiter<br />
und verstärkt aktiv zu bleiben.<br />
Schlussendlich liegt es an uns allen,<br />
ethisches Bewusstsein an der Universität<br />
in der Lehre, der Forschung und<br />
im Umgang miteinander zu stärken.<br />
Für weitere Informationen zu den<br />
Tätigkeiten der Ethikplattform und<br />
Veranstaltungs- bzw. Fortbildungshinweise<br />
https://boku.ac.at/ethikplattform/<br />
52 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
DIDAKTIK<br />
Lehre von Studierenden<br />
für Studierende: Das<br />
<strong>BOKU</strong>-Tutorien-Zertifikat<br />
Von Verena Vlajo und Alexandra Strauss-Sieberth<br />
Ein Tutorium bietet die Möglichkeit,<br />
erste Erfahrungen<br />
in der Hochschullehre zu<br />
sammeln. Dabei wird die Bedeutung<br />
der Rolle der Tutor*innen in<br />
einer Lehrveranstaltung häufig unterschätzt.<br />
Doch welche Möglichkeiten<br />
bietet ein Tutorium den Studierenden,<br />
welche Aufgaben kommen dabei auf<br />
sie zu und welche Qualifizierungsmöglichkeiten<br />
bietet ein <strong>BOKU</strong>-Tutorium?<br />
Tutor*innen können eine wichtige<br />
Rolle als Bindeglied zwischen Studierenden<br />
und Lehrenden einnehmen,<br />
sofern sie in ein didaktisch<br />
durchdachtes Konzept eingebunden<br />
werden. „Peer Teaching“ bietet Studierenden<br />
die Möglichkeit, ihr Wissen<br />
an andere weiterzugeben. Dies<br />
impliziert für die Tutor*innen eine<br />
verantwortungsvolle Aufgabe, die sie<br />
mit großem Engagement erfüllen.<br />
Die Aufgaben von Tutor*innen an der<br />
<strong>BOKU</strong> sind vielfältig und anspruchsvoll.<br />
Tutor*innen wiederholen Inhalte,<br />
rechnen Übungen, regen zur tieferen<br />
Beschäftigung mit dem Stoff an und<br />
decken Verständnisprobleme auf.<br />
VERTRAGLICHE GRUNDLAGE<br />
VON TUTOR*INNEN<br />
An der <strong>BOKU</strong> gibt es seit Langem das<br />
System, dass sich Studierende als<br />
„Tutor*innen“ engagieren. Diese werden<br />
gemäß §30 des Kollektivvertrags<br />
als studentische Mitarbeiter*innen<br />
im Lehrbetrieb angestellt. Die befristete<br />
Anstellungsdauer richtet sich<br />
nach der Lehrveranstaltungszeit des<br />
jeweiligen Semesters.<br />
QUALIFIZIERUNG VON<br />
TUTOR*INNEN ALS EINSTIEG<br />
EINER UNIVERSITÄREN KARRIERE<br />
Lehrkompetenz ist Bestandteil akademischer<br />
Personal- und Persönlichkeitsentwicklung<br />
und muss nicht erst<br />
im Promotions- oder Habilitationsprozess<br />
beginnen. Bereits bei Studierenden<br />
sind Interesse und eine offene<br />
Akzeptanz für die Entfaltung einer<br />
Lehrpersönlichkeit spezifischen Charakters<br />
zu wecken. Bei späterem Verlassen<br />
der Hochschule können sie auf<br />
in diesem Kontext entwickelte Schlüsselkompetenzen<br />
zurückgreifen. Darüber<br />
hinaus kann hochschuldidaktische<br />
Qualifizierung und Erfahrung auch in<br />
Stellenbesetzungen Berücksichtigung<br />
finden und für Zertifikatsprogramme<br />
der Hochschuldidaktik angerechnet<br />
werden, finden sie doch unter ähn<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
53
FEEDBACK ZU<br />
DEN FORTBILDUNGEN<br />
Das Tutorien-Zertifikat der <strong>BOKU</strong> ist eine<br />
große Bereicherung für alle Tutor*innen,<br />
egal ob einzelne Module oder das gesamte<br />
Modulpaket (um das Zertifikat zu erhalten)<br />
absolviert wird. Ich persönlich finde die<br />
Kombination von den didaktischen Einheiten,<br />
die zu den Pflichtmodulen zählen,<br />
und den freien Wahlmodulen, in denen der<br />
Fokus eher auf praktische Skills gelegt<br />
wird, eine sehr gute Kombination. Vielleicht<br />
nicht jeder von uns wird im Uni-Alltag ein<br />
Lehrvideo gestalten und jedes Online Tool<br />
nutzen, jedoch war der Einblick in diese<br />
Themenbereiche sehr wertvoll und auch<br />
für den weiteren Berufsweg nützlich.<br />
lichen Bezeichnungen, Inhalten, Methoden und Trainer*innen Verbreitung.<br />
(Positionspapier Netzwerk Tutorienarbeit 2018)<br />
Die <strong>BOKU</strong> Didaktik bietet Tutor*innen die Chance, sich bestmöglich<br />
auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Zum<br />
einen können Tutor*innen an Fortbildungen teilnehmen, die speziell<br />
für sie konzipiert wurden. Zum anderen können sie sich im Rahmen<br />
des zweitägigen Tutorien-Zertifikats für eine Basisqualifizierung anmelden.<br />
Ziel des Zertifikatslehrganges ist es, Tutor*innen zu befähigen,<br />
kompetent in der Lehre zu agieren sowie die Vermittlung von<br />
Schlüsselkompetenzen für die erfolgreiche Gestaltung von Tutorien zu<br />
ermöglichen. Es wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass<br />
allen Tutor*innen eine zielgruppenadäquate, hochschuldidaktische<br />
Fortbildung angeboten werden kann.<br />
ZERTIFIKATSPROGRAMM<br />
Das Zertifikatsprogramm wird ab dem WS 2023/24 angeboten, umfasst<br />
zwei Tage à acht Stunden (à 60 Minuten) und ist nach dem Blended<br />
Learning Konzept (Online- und Präsenzeinheiten) aufgebaut. Es setzt<br />
sich aus einen Pflichtmodul und frei wählbaren Fortbildungen im<br />
Rahmen eines Wahlmoduls zusammen. Im Rahmen des Pflichtmoduls<br />
sollte eine kurze Lehrphilosophie verfasst werden.<br />
Die didaktische Fortbildung von Tutor*innen stellt einen wichtigen<br />
Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Hochschullehre dar. Tutor*innen<br />
fungieren als Bindeglied zwischen Lehrenden und Studierenden<br />
und tragen dazu bei, den studentischen Blickwinkel in die Lehre zu<br />
integrieren.<br />
W<br />
LITERATUR<br />
Positionspapier Netzwerk Tutorienarbeit 2018<br />
https://tutorienarbeit.de/fileadmin/user_upload/Tutorienarbeit/pdf/Positionspapier/Positionspapier_Netzwerk_Tutorienarbeit_2018_lang.pdf<br />
https://short.boku.ac.at/Tutorienzertifikat<br />
Vielen Dank für das Angebot mit den<br />
spannenden Fortbildungen für Tutor*innen!<br />
Meine Tutorien profitieren mittlerweile<br />
schon davon :)<br />
Ich habe dieses Wintersemester das empfohlene<br />
Tutor*innen-zertifikat absolviert<br />
und möchte dazu gerne Feedback geben.<br />
Ich kann es allen weiterempfehlen, die<br />
noch etwas länger als Tutor*innen arbeiten<br />
werden. Persönlich kann man davon<br />
aber sowieso immer etwas mitnehmen.<br />
Nachdem ich in meinem Tutorbereich doch<br />
eher in einer „Bubble“ arbeite, war es sehr<br />
interessant, auch mal von anderen Personen<br />
aus verschiedensten Tutoriumsbereichen<br />
etwas mitzubekommen. Tutor*in ist<br />
eben nicht gleich Tutor*in - aber nachdem<br />
die Schulungen sehr vieles abdecken, ist<br />
wirklich für jeden Bereich etwas dabei. Mit<br />
16 Stunden „nebenbei“ sind die Schulungen<br />
auch nicht allzu zeitintensiv und ein<br />
paar davon waren ohnehin online, wobei<br />
jene vor Ort doch den größeren Nutzen<br />
hatten. Zweimal war es nötig, einen halben<br />
Tag Zeit zu finden, aber für diese Halbtage<br />
hat es auch mehr als nur einen Termin<br />
gegeben, so dass es gut einteilbar war.<br />
Das Zertifikatsprogramm hat mir sehr gut<br />
gefallen und hat mir auch einige Anregungen<br />
und Ideen gegeben, die ich schon in<br />
meine Arbeit als Tutor integrieren konnte.<br />
54 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
Aufbau des Zertifikats<br />
Pflichtmodul<br />
Das Pflichtmodul setzt sich aus vier verpflichtenden Kursen zusammen, mit einem Arbeitsaufwand von zwölf<br />
Arbeitsstunden. Das Modul muss zur Abdeckung der Schlüsselkompetenzen verpflichtend absolviert werden.<br />
Erste Schritte in<br />
der Hochschuldidaktik<br />
Tutoring Philosophy<br />
Schreibwerkstatt<br />
Lehrphilosophie<br />
Gender- und<br />
Diversitätskompetenz<br />
Diese Grundlagenveranstaltung vermittelt Tutor*innen erste didaktische<br />
Grundlagen. Neben der Planung des Tutoriums werden der Aufbau einer<br />
Lehreinheit, die Anwendung didaktischer Methoden, Constructive Alignment<br />
und Lernziele vermittelt. Außerdem werden die Bedeutung der Tutor*innenrolle<br />
sowie Tipps und Tricks rund ums Tutorium besprochen.<br />
Die eigene Haltung zum Lernen und zu Lernenden spielt eine große Rolle<br />
bei der Wissensvermittlung. Die Reflexion dieser Haltung und Ableitung<br />
konkreter Handlungsstrategien ermöglichen Klarheit für Tutor*innen.<br />
In dieser Fortbildung wird genauer beleuchtet, was eine Lehrphilosophie<br />
beinhaltet. In Folge wird gemeinsam im Team und mit der Trainerin für jede*n<br />
Teilnehmer*in eine eigene Lehrphilosophie erarbeitet!<br />
In dieser Veranstaltung werden Begrifflichkeiten und Grundlagen von<br />
Gender und Diversity vermittelt. In einer gemeinsamen Reflexion wird der<br />
individuelle Zugang beleuchtet und daraus auch konkrete Handlungsstrategien<br />
im Umgang mit Lernenden abgeleitet.<br />
Wahlmodul<br />
Das Wahlmodul setzt sich aus Fortbildungen aus verschiedenen Bereichen zusammen, die jedes Semester adaptiert<br />
und angepasst werden. Es müssen Fortbildungen im Ausmaß von vier Stunden absolviert werden.<br />
<strong>BOKU</strong>learn 4.1<br />
Hybridlehre – <strong>BOKU</strong> 4.0<br />
Fit für Onlinetools<br />
Lehrvideos<br />
Studierende kennen <strong>BOKU</strong>learn nur aus der Studierendensicht. Dieses<br />
Training zeigt Tutor*innen, welche Möglichkeiten <strong>BOKU</strong>learn bietet. Der Focus<br />
liegt dabei auf der Handhabung der Lernplattform und der Kursverwaltung.<br />
Außerdem wird der Einsatz von Lernaktivitäten zur Förderung der gewünschten<br />
Lernergebnisse sowie die Bereitstellung von Inhalten bzw. Materialien vermittelt.<br />
Die Studierenden lernen die Hybridanlage der <strong>BOKU</strong> kennen und erleben dabei im<br />
direkten Einsatz welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Gemeinsam wird die<br />
Anlage getestet und auch Limitierungen der Technik besprochen.<br />
Tutor*innen lernen wichtige <strong>BOKU</strong>-spezifische Tools für die Onlinelehre<br />
kennen. Umfragen, Kollaboratives Arbeiten, Abstimmungen, Wordclouds, aber<br />
auch z. B. die direkte Integration dieser Tools in PowerPoint stehen im Fokus.<br />
In dieser Fortbildung wird der Bogen vom Storytelling bis zum fertigen Video für<br />
die Lehre gespannt. Möglichkeiten der Videoproduktion werden aufgezeigt – sei<br />
es im Hörsaal, Zuhause oder im Studio. Außerdem wird das Lightboard der <strong>BOKU</strong><br />
vorgestellt und ein Einblick in die Nachbearbeitung der Videos gegeben.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
55
DIDAKTIK<br />
Mikrobiologie für<br />
Agrarwissenschaften und<br />
für das tägliche Leben<br />
Von Johanna Burtscher und Eva Wagner<br />
ADOBE STOCK<br />
Warum wirken Antibiotika<br />
nicht gegen Viren? Warum<br />
verderben Salami und Marmelade<br />
nicht bei Raumtemperatur?<br />
Warum kann sich Heu selbst entzünden<br />
und wie können sich Mikroorganismen<br />
an veränderte Bedingungen<br />
wie Dürre, Hitze oder Kälte anpassen?<br />
In der Vorlesung „Mikrobiologie für<br />
Agrarwissenschaften“ werden Fragen<br />
behandelt, die nicht nur zum<br />
Verständnis der wichtigen Rolle von<br />
Mikroorganismen in den Agrarwissenschaften<br />
beitragen, sondern auch das<br />
Bewusstsein für deren Bedeutung in<br />
unserem täglichen Leben schärfen.<br />
STUDIERENDE BESTIMMEN<br />
THEMEN MIT<br />
Die Vorlesung Mikrobiologie (AW) ist<br />
eine wöchentliche Pflichtlehrveran-<br />
staltung für das dritte Semester im<br />
Bachelorstudium Agrarwissenschaften<br />
mit rund 150 bis 300 angemeldeten<br />
Studierenden pro Semester. Die<br />
grundlegenden Inhalte sind aus traditionellen<br />
mikrobiologischen Lehrbüchern<br />
abgeleitet. Zusätzlich werden<br />
interessante aktuelle Zeitungsartikel,<br />
wissenschaftliche Publikationen,<br />
Webseiten oder Videos verwendet,<br />
um die Inhalte in einen größeren Kontext<br />
zu stellen. Darüber hinaus bestimmen<br />
die Studierenden einen wesentlichen<br />
Teil der Vorlesungsinhalte<br />
selbst, indem sie gefragt werden,<br />
was sie besonders interessant oder<br />
relevant finden oder ob es Themen<br />
gibt, die sie gerne vertiefen würden.<br />
Eine Auswahl der vorgeschlagenen<br />
Inhalte wird in die geplanten Vorlesungsinhalte<br />
integriert und es werden<br />
vertiefende Lernunterlagen auf der<br />
Online-Lernplattform <strong>BOKU</strong>learn zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Im Rahmen der Lehrveranstaltung<br />
lernen die Studierenden wichtige<br />
Eigenschaften von Mikroorganismen<br />
zu erkennen und zu beschreiben<br />
sowie mikrobiologische Organismen<br />
im weitesten Sinne (wie Bakterien,<br />
Archaeen, Pilze, Viren) anhand ihrer<br />
Eigenschaften aufzulisten, zu klassifizieren<br />
und voneinander zu unterscheiden.<br />
Anhand von anschaulichen<br />
Beispielen können die Studierenden<br />
die Rolle der Mikroorganismen für<br />
Mensch, Tier und Umwelt erläutern.<br />
LAUFENDE WISSENSÜBERPRÜFUNG<br />
Die Lernziele werden für jede Vorlesungseinheit<br />
definiert und den Studierenden<br />
zu Beginn jeder Einheit vorgestellt.<br />
Während oder am Ende der<br />
Einheit werden die Lernziele durch<br />
kurze Self-Assessments, Diskussionen<br />
im Plenum oder Umfragen überprüft.<br />
Die summative Prüfung dieser<br />
Lehrveranstaltung besteht aus einer<br />
schriftlichen Prüfung am Ende der<br />
Lehrveranstaltung, bestehend aus<br />
fünf offenen Fragen. Zur Selbstüberprüfung<br />
während der Prüfungsvorbereitung<br />
stehen ein freiwilliger Multiple-Choice-Test<br />
in <strong>BOKU</strong>learn sowie<br />
eine Liste mit Fragen, die sich an den<br />
formulierten Lernzielen orientieren,<br />
zur Verfügung.<br />
ALLE FRAGEN SIND MÖGLICH<br />
Die Vorlesungen wurden eigenständig<br />
von jeweils einer Vortragenden (Johanna<br />
Burtscher Jahre 19/20, 20/21,<br />
56 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
STIMMEN VON<br />
STUDIERENDEN<br />
In dieser LV hat alles gestimmt: eine<br />
gute Bandbreite von Wissen, hervorragende<br />
Unterlagen, ein freundlicher<br />
Umgang, interaktive Lehre,<br />
aktuelles aus der Wissenschaft und<br />
Forschung.<br />
Eva Wagner (M.) und Johanna Burtscher (r.) mit Vizerektorin Doris Damyanovic<br />
bei der Preisverleihung.<br />
21/22, und 23/24; Eva Wagner während<br />
der Elternkarenz von Johanna<br />
Burtscher 22/23) abgehalten. Die<br />
Überbrückung der Karenzzeit haben<br />
wir als Chance gesehen, uns auszutauschen,<br />
voneinander zu lernen und<br />
die Lehrveranstaltung zu verbessern.<br />
Dass Lehren und Lernen sehr eng<br />
miteinander verbunden sind, ist für<br />
uns beide als Lehrende besonders<br />
wichtig. Die engagierten und offenen<br />
Fragen der Studierenden fordern uns<br />
regelmäßig heraus und motivieren<br />
uns, immer wieder neue Inhalte zu erarbeiten,<br />
zu erlernen und in die Lehrveranstaltung<br />
einfließen zu lassen.<br />
Fragen werden während der Lehrveranstaltung<br />
laufend wertschätzend<br />
aufgegriffen und beantwortet. Dies<br />
geschieht entweder durch das Erarbeiten<br />
der Antwort, durch die Ermutigung<br />
der anderen Studierenden,<br />
die Frage zu beantworten und dabei<br />
gleichzeitig ihren eigenen Wissensstand<br />
abzurufen, oder durch die direkte<br />
Beantwortung und allenfalls<br />
Wiederholung des Inhalts.<br />
Dabei versuchen wir, keine Grenzen<br />
zu setzen und auch Fragen zu berücksichtigen,<br />
die nicht direkt mit dem<br />
Vorlesungsinhalt zu tun haben. Die<br />
Atmosphäre ist dadurch auch öfter<br />
etwas lockerer und humorvoller (sowohl<br />
durch Beiträge der Studierenden<br />
als auch der Vortragenden). Im Rahmen<br />
der Präsenzvorlesung wurden<br />
auch praktische Anschauungsmaterialien<br />
integriert, so wurden von und<br />
mit Studierenden ATP-Bestimmungen<br />
auf verschiedenen Oberflächen im<br />
Hörsaal oder im Gebäude durchgeführt,<br />
um etwa zu vermitteln und zu<br />
verstehen, wie viele Mikroorganismen<br />
sich auf einem Türgriff und wie vergleichsweise<br />
wenige sich auf einem<br />
Toilettensitz befinden.<br />
FEEDBACK DER STUDIERENDEN<br />
Persönlich nehmen wir in dieser Lehrveranstaltung<br />
ein überdurchschnittliches<br />
Engagement und Interesse seitens<br />
der Studierenden wahr. Besonders<br />
häufig heben die Studierenden<br />
das didaktische Konzept, den partizipativen<br />
Ansatz durch Themenvorschläge,<br />
Beiträge und Fragen sowie<br />
den Praxisbezug durch die Beispiele<br />
aus Forschung und Alltag positiv hervor.<br />
Am meisten Freude bereitet es<br />
uns als Lehrende natürlich, wenn wir<br />
ein langfristiges Interesse und eine<br />
Begeisterung für unser Forschungsgebiet<br />
wecken können. W<br />
Eine der besten Lehrveranstaltungen,<br />
durch regelmäßige Bezüge auf<br />
bereits in der Lehrveranstaltung erworbenes<br />
Wissen, alltagsrelevante<br />
& gut nachvollziehbare Beispiele<br />
und den sehr gut organisierten<br />
Aufbau der Lehrveranstaltung. Zusätzlich<br />
geht die Lehrende gut auf<br />
Fragen ein, ist zuverlässig in der<br />
Kommunikation, freundlich und<br />
gleichzeitig gut in zeitlicher Organisation.<br />
Self Assessements und Lernergebnisse<br />
bei jeder Einheit. Dadurch,<br />
dass es mir persönlich immer wieder<br />
schwerfällt, die wichtigsten<br />
Punkte herauszuheben, ist es eine<br />
große Hilfe beim Lernen. Zusätzlich<br />
finde ich Verknüpfungen des Stoffs<br />
mit aktuellen Ereignissen sehr interessant<br />
und einfacher zu merken<br />
und zu verstehen! Alle Fragen<br />
der Studierenden wurden auch wie<br />
immer bemüht und ausführlich beantwortet.<br />
Für mich eine gelungene<br />
Lehrveranstaltung!<br />
Ich konnte mich total für die Mikrobiologie<br />
begeistern.<br />
Ass.Prof. in Dr. in Johanna Burtscher und<br />
Eva Wagner, PhD forschen und lehren<br />
beide am Institut für Lebensmittelwissenschaften,<br />
sie wurden im Rahmen der<br />
<strong>BOKU</strong>-Lehrpreise 2023 für ihre Vorlesung<br />
mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
57
Connecting Time: Celebrating the 60 th<br />
Anniversary of the Venice Charter with<br />
Heritage Science Austria and ICOMOS<br />
Von Ulrike Krippner, Leon Ploszczanski und Gertrud Haidvogl<br />
DOMINIK ROSNER<br />
Am 28. Mai <strong>2024</strong> veranstaltete<br />
das <strong>BOKU</strong>-Team von Heritage<br />
Science Austria ein hybrides<br />
Café an der <strong>BOKU</strong>. Heritage Science<br />
Austria wurde 2018 gegründet, um<br />
Wissenschaftler*innen, die in den Bereichen<br />
Natur-, Ingenieur- und Geisteswissenschaften<br />
zum kulturellen und<br />
natürlichen Erbe Österreichs forschen,<br />
zu vernetzen. Eines der Ziele ist die<br />
Mitarbeit im europäischen Konsortium<br />
European Research Infrastructure for<br />
Heritage Science E-HRIS. Die Vorträge<br />
wurden von rund 40 Teilnehmer*innen<br />
besucht, unter anderen Forscher*innen<br />
von der <strong>BOKU</strong> University, der TU<br />
Wien, der Akademie der bildenden<br />
Künste, der Universität für angewandte<br />
Kunst Wien, der Österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften sowie<br />
von Fachleuten aus dem Bundesdenkmalamt,<br />
dem Bundesministerium für<br />
Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und<br />
Sport, von ICOMOS Austria und dem<br />
Kunsthistorischen Museum.<br />
Anlass der Veranstaltung war das<br />
60-jährige Jubiläum der „Internationalen<br />
Charta für die Erhaltung und<br />
Restaurierung von Denkmälern und<br />
Stätten“, kurz Charta von Venedig,<br />
und der Beginn einer Kooperation<br />
zwischen HS Austria und ICOMOS<br />
Austria, dem Österreichischen Nationalkomitee<br />
des Internationalen<br />
Rats für Denkmalpflege. Caroline<br />
Jäger-Klein, TU Wien, und Präsidentin<br />
von ICOMOS Austria, betonte die<br />
Aktualität der Charta von Venedig.<br />
Oberster Grundsatz sei, die historische<br />
Authentizität und Integrität<br />
des kulturellen Erbes zu respektieren<br />
und gleichzeitig die Notwendigkeit<br />
einer angemessenen Anpassung und<br />
Nutzung im zeitgenössischen Kontext<br />
anzuerkennen. Ulrike Herbig, TU<br />
Wien, und Leiterin der Monitoringgruppe<br />
ICOMOS Austria, zeigte Strategien<br />
des präventiven Monitorings,<br />
die das Management von Welterbestätten<br />
unterstützen.<br />
Ulrike Krippner, Institut für Landschaftsarchitektur<br />
ILA/<strong>BOKU</strong>, erläuterte,<br />
dass historische Freiräume<br />
seit einem Entscheid des österreichischen<br />
Verfassungsgerichtshofs im<br />
Jahr 1964 nicht als Kulturerbe gelten<br />
und folglich nicht per se unter Denkmalschutz<br />
fallen. Damit könne in der<br />
Pflege und im Management nur ungenügend<br />
auf aktuelle Herausforderungen,<br />
wie Klimawandel und Urbanisierung,<br />
reagiert werden. Roland Tusch<br />
und Daniela Lehner, beide ebenfalls<br />
ILA/<strong>BOKU</strong>, präsentierten Ergebnisse<br />
eines FWF-geförderten Projekts<br />
zur Kulturlandschaft Wachau. Auch<br />
das neue Denkmalschutzgesetz, das<br />
mit 1. September <strong>2024</strong> in Kraft tritt,<br />
korrigiert die Defizite des österreichischen<br />
Denkmalschutzes nicht.<br />
Damit bleiben historische Freiräume<br />
und Landschaften – trotz ihrer hohen<br />
kulturellen, künstlerischen und ökologischen<br />
Bedeutung – in Österreich<br />
weiterhin ungenügend geschützt. W<br />
LINKS<br />
https://heritagescience.at/<br />
http://icomos.at/wp2021/<br />
Logo Connecting<br />
Time: Celebrating the<br />
60 th Anniversary of<br />
the Venice Charter<br />
with Heritage Science<br />
Austria and ICOMOS:<br />
Generiert mit Copilot<br />
DI in Dr. in Ulrike Krippner ist Senior<br />
Scientist am Institut für Landschaftsarchitektur,<br />
Mag. Leon Ploszczanski, MA<br />
ist technischer Mitarbeiter am Institut<br />
für Physik und Materialwissenschaft und<br />
Mag. a Dr. in Gertrud Haidvogl ist Privatdozentin<br />
am Institut für Hydrobiologie und<br />
Gewässermanagement.<br />
58 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
59
SPLITTER<br />
Die <strong>BOKU</strong>-Weine sind da!<br />
Weiß oder rot, Sauvignon Blanc oder oder<br />
Zweigelt? Zum bereits 15. Mal wurden im Rahmen<br />
des begehrten studentischen Wettbewerbs die<br />
offiziellen <strong>BOKU</strong>-Weine <strong>2024</strong> prämiert.<br />
Am 16. Mai wurden sie am UFT Tulln verkostet<br />
und für ausgezeichnet befunden. Seit nunmehr<br />
15 Jahren schreibt die <strong>BOKU</strong> University mit der<br />
ÖH <strong>BOKU</strong> diesen Wettbewerb für Weine aus, die<br />
aus einem familiären Weinbaubetrieb inskribierter<br />
Studierender stammen. Auch <strong>2024</strong> nutzten<br />
wieder <strong>BOKU</strong>-Studierende die Gelegenheit, als<br />
Nachwuchswinzer*innen auf sich aufmerksam<br />
zu machen.<br />
<strong>BOKU</strong>/CHRISTOPH GRUBER<br />
Die Gewinner*innen der <strong>BOKU</strong>-<br />
Prämierung <strong>2024</strong> sind<br />
<strong>BOKU</strong>/CHRISTOPH GRUBER<br />
Weiß: Thomas Honsig, Masterstudent WÖW,<br />
Weingut Honsig, Norbert u. Maria Honsig,<br />
2051 Platt 15. Sauvignon Blanc, 2023<br />
Rot: Leon Rauschmann, Masterstudent WÖW,<br />
Weingut Lichtenberger González, Seestraße 42,<br />
7091 Breitenbrunn. Blaufränkisch 2021<br />
International: Katja Simon, Masterstudentin WÖW,<br />
Weingut Simon-Bürkle GbR, Wiesenpromenade 13,<br />
D-64673 Zwingenberg. Spätburgunder 2022<br />
Saft: Georg Jauk, Masterstudent Forstwirtschaft,<br />
Weingut Tor zur Sonne, 2162 Falkenstein 143<br />
Walk of Insects<br />
Der WALK OF INSECTS, den Edgar Honetschläger<br />
für den Campus Türkenschanze<br />
realisierte, wurde am 21. Mai offiziell von<br />
der BIG gemeinsam mit dem Künstler<br />
an der <strong>BOKU</strong> präsentiert. Honetschläger<br />
hatte mit der Entomologin Dominique<br />
Zimmermann vom Naturhistorischen<br />
Museum und mit <strong>BOKU</strong>-Angehörigen ein<br />
künstlerisches „Insektenmanifest“,<br />
bestehend aus 13 Forderungen zum<br />
Schutz dieser Lebewesen entwickelt.<br />
Das Manifest ist Teil einer permanenten<br />
Arbeit auf dem Vorplatz des Exnerhauses.<br />
Darüber hinaus wurde als integraler<br />
Bestandteil des Projekts ein Grundstück<br />
in einer ländlichen Gegend Niederösterreichs<br />
angekauft und in eine „Non Human<br />
Zone“ verwandelt. In dieser menschenfreien<br />
Zone soll Lebensraum an Insekten<br />
und Vögel zurückgegeben und langfristig<br />
geschützt werden. Edgar Honetschläger<br />
verbindet in seiner Arbeit künstlerische<br />
Gestaltung mit Aktivismus im Bereich<br />
Umweltschutz und Nachhaltigkeit.<br />
Er verweist auf den vom Menschen verursachten<br />
drastischen Insektenschwund<br />
und stellt die Frage nach dem gesellschaftlichen<br />
Umgang mit der Natur ins<br />
Zentrum seiner künstlerischen und<br />
kollaborativen Praxis.<br />
60 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
MARTINA RAGONER<br />
Die <strong>BOKU</strong> beim<br />
Vienna City Marathon<br />
Nach dem<br />
Marathon ist vor<br />
dem Marathon:<br />
Die erfolgreichen<br />
Teilnehmer*innen<br />
der <strong>BOKU</strong><br />
MÜNZE ÖSTERREICH<br />
Münze „Lebendiger Boden“<br />
PIA KLEBER<br />
In einer atemberaubenden Leistung nahmen unter<br />
anderem zwei Staffeln der <strong>BOKU</strong> University (<strong>BOKU</strong><br />
Rockets + TUR<strong>BOKU</strong>) am 41. Wiener Marathon teil<br />
sowie ein <strong>BOKU</strong>-Läufer am Halbmarathon. Unsere<br />
Läufer*innen erreichten am 21. April <strong>2024</strong> das Ziel<br />
trotz eisiger Temperaturen mit einem breiten Grinsen,<br />
bereit für mehr. Wir gratulieren herzlich!<br />
Die ganze<br />
lange Nacht<br />
geforscht<br />
Martin Gerzabek ist unter die Münz-Designer gegangen,<br />
nachdem er von der Münze Österreich gebeten worden<br />
war, bei der Gestaltung einer 25-Euro-Silber-Niobmünze<br />
„Lebendiger Boden“ zum Thema Edaphon, also<br />
Bodenleben, mitzuwirken, die am 16. Mai präsentiert<br />
wurde. Start für den Entwurf war ein intensives Interview<br />
durch die Grafiker*innen der Münze Österreich zu<br />
der Bedeutung und Entwicklung von Böden und deren<br />
Funktionen, sowie über das Bodenleben. „Dann durfte<br />
ich die ersten Entwürfe kommentieren und von fachlicher<br />
Seite Anmerkungen machen“, schildert Martin<br />
Gerzabek den Design-Prozess. Sehr beeindruckt habe<br />
ihn dann die grafische Umsetzung, nämlich „auf so kleiner<br />
Fläche, doch so viele Botschaften unterzubringen“.<br />
Auf der Münze sind vor allem die Bodenentwicklung<br />
und das Bodenleben dargestellt. Die Bodenentwicklung<br />
wird durch das Gestein, die Vegetation, das Klima<br />
(Niederschlag), das Bodenleben und die Zeit symbolisiert.<br />
Auf der zweiten Seite finden sich verschiedenste<br />
Bodenlebenwesen - von Pilzhyphen bis zum Maulwurf,<br />
die auch die unterschiedlichen Größen und Funktionen<br />
der Lebewesen im Boden symbolisieren.<br />
UNESCO<br />
Die <strong>BOKU</strong> University war bei der Langen Nacht der<br />
Forschung <strong>2024</strong> mit 50 Stationen an den Standorten<br />
Türkenschanze, Muthgasse, am Wasserbaulabor in Wien,<br />
UFT und Department für Agrarbiotechnologie, IFA Tulln<br />
sowie auch an den beiden Standorten „Forschung im<br />
Zentrum“, die vom Wissenschafts- und Klimaschutzministerium<br />
organisiert werden, vertreten. Das Programm<br />
konnte sich sehen lassen und reichte von „Wo balgen<br />
sich Algen und was stört den Stör?“ über „Materialforschung<br />
- wann bricht’s?“, „Fitnessstudio für Immunzellen<br />
- wie können T-Zellen trainiert werden, damit sie<br />
Krebs erkennen?“ bis zu „Tauchen im Jungbrunnen“ und<br />
„Die Buchstabensuppe in der Speisekarte: Lebensmittelallergene“.<br />
Und zum Glück brauchte der „Baubot“ des<br />
Instituts für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes<br />
Bauen, das auf dem Heldenplatz der Frage „Wie sieht<br />
die Zukunft des Bauens aus?“ nachging, niemanden, der<br />
ihm den Regenschirm hält.<br />
UNESCO-Session in Paris<br />
Von 5. bis 7. Juni fand in Paris die „26. Ordinary Session<br />
of the IHP Intergovernmental Council IGC“ des UNESCO<br />
Intergovernmental Hydrological Programme IHP unter<br />
dem Vorsitz von Helmut Habersack statt. Im November<br />
2023 war Habersack einstimmig zum Präsidenten<br />
dieses zwischenstaatlichen Rates gewählt worden.<br />
Das IHP ist die einzige UNO-Organisation, die sich der<br />
Wasserforschung widmet. Unter anderem wurde über<br />
die Umsetzung des derzeit laufenden IX. Rahmenprogramms<br />
“Science for a Water Secure World in a Changing<br />
Environment” beraten. Weiters fanden Vorbereitungen<br />
zum 50-Jahr-Jubiläum von IHP und zu 60 Jahre<br />
Wasserforschung an der UNESCO 2025 statt.<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
61
Die <strong>BOKU</strong> trauert<br />
um Manfried Welan<br />
Von Stefan Vogel und Johann Werfring<br />
Der langjährige Rektor und<br />
wegweisende Visionär der<br />
Universität für Bodenkultur<br />
Wien ist am 22. Mai im Alter<br />
von 86 Jahren verstorben.<br />
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied<br />
von unserem Altrektor Manfried<br />
Welan. Sein Tod hinterlässt eine<br />
Lücke in der wissenschaftlichen Gemeinschaft<br />
und bei all jenen, die das<br />
Privileg hatten, ihn zu kennen, mit ihm<br />
zu arbeiten oder von ihm zu lernen.<br />
<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />
Manfried Welan wurde am 13. Juni<br />
1937 in Wien geboren. Im Anschluss<br />
an sein Studium der Rechtswissenschaften<br />
begann er nach beruflichen<br />
Stationen am Verfassungsgerichtshof<br />
und in der wissenschaftlichen<br />
Abteilung der Wirtschaftskammer<br />
Österreich eine beeindruckende akademische<br />
Laufbahn. 1969 wurde er an<br />
der Universität für Bodenkultur Wien<br />
zum Außerordentlichen Professor und<br />
Vorstand des Instituts für Rechtswissenschaften<br />
ernannt, 1973 zum<br />
Ordentlichen Universitätsprofessor.<br />
1974 bis 1976 war Welan Prorektor<br />
der <strong>BOKU</strong>, von 1977 bis 1981 Rektor<br />
und sodann bis 1984 erneut Prorektor.<br />
Von 1979 bis 1981 war er Mitglied des<br />
Präsidiums des Fonds zur Förderung<br />
der wissenschaftlichen Forschung und<br />
erster Präsident der Österreichischen<br />
Rektorenkonferenz, der nicht von der<br />
Universität Wien kam. In diesen Funktionen<br />
begann Manfried Welan ab den<br />
ausgehenden 1970er-Jahren mit viel<br />
Verve die Bedeutung der <strong>BOKU</strong> in der<br />
heimischen Universitätslandschaft<br />
und im Bewusstsein deren Entscheidungsbefugten<br />
zu verankern. 1990<br />
wurde er zum dritten Mal zum Rektor<br />
der Universität für Bodenkultur Wien<br />
gewählt. 1994 bis 2001 bekleidete er<br />
das Amt des Vizerektors. Bis zu seiner<br />
Emeritierung im Jahr 2005 war er als<br />
Ordentlicher Professor tätig.<br />
Über seine akademische Karriere hinaus<br />
engagierte sich Welan als zutiefst<br />
demokratischer Mensch auch<br />
politisch. Als einer von Erhard Buseks<br />
„Bunten Vögeln“ war er für die ÖVP<br />
Abgeordneter zum Wiener Landtag,<br />
Gemeinderat und von 1987 bis 1990<br />
Dritter Landtagspräsident im Wiener<br />
Landtag sowie von 1986 bis 1987<br />
Stadtrat.<br />
AUTONOMIE DES DENKENS<br />
Sein größtes Vermächtnis hinterlässt<br />
Manfried Welan jedoch als langjähriger<br />
Rektor der Universität für Bodenkultur<br />
Wien. Er prägte die <strong>BOKU</strong><br />
nachhaltig und setzte wichtige Impulse<br />
für ihre Entwicklung. Sein unermüdlicher<br />
Einsatz für die Förderung<br />
des wissenschaftlichen Nachwuchses<br />
und seine visionäre Führung machten<br />
ihn zu einem wegweisenden Rektor.<br />
Welan sah die Universität nicht nur<br />
als eine Stätte des Wissenserwerbs,<br />
sondern die Zeit des Studierens auch<br />
als Lebensschule und stellte seine<br />
Einführungslehrveranstaltungen für<br />
Erstsemestrige unter das Motto „Ler-<br />
62 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
nen Sie lernen, lernen Sie lesen, lernen<br />
Sie leben!“ Es ging ihm um die<br />
individuelle Autonomie des Denkens,<br />
alles interessierte ihn. Seine Neugierde<br />
zu allen möglichen Themen war ein<br />
wesentlicher Charakterzug von ihm.<br />
<strong>BOKU</strong>-Rektorin Eva Schulev-Steindl:<br />
„Manfried Welan wird uns als herausragender<br />
Wissenschaftler, inspirierender<br />
Mensch, unermüdlicher Verfechter<br />
unserer demokratischen Werte<br />
und als eine der großen Persönlichkeiten<br />
der Universität für Bodenkultur<br />
in Erinnerung bleiben. Sein Wirken,<br />
seine intellektuelle Weitsicht und sein<br />
Humanismus werden weit über seinen<br />
Tod hinaus fortwirken.“<br />
WEGWEISENDE ARBEITEN<br />
Er veröffentlichte zahlreiche wegweisende<br />
Arbeiten und leistete bedeutende<br />
Beiträge zur Weiterentwicklung<br />
des österreichischen Verfassungsrechts.<br />
Welan war einer der Begründer<br />
des österreichischen Umweltrechts,<br />
vor allem des Agrarumweltrechts. Er<br />
zählte zu den Wegbereitern der Juristenpolitologie<br />
und der politischen<br />
Rechtslehre in Österreich. Weitere<br />
wissenschaftliche Hauptarbeitsgebiete<br />
von Manfried Welan waren die<br />
Themenbereiche Demokratie, Parlamentarismus,<br />
Staatsoberhaupt und<br />
Regierung sowie die Verfassungsgerichtsbarkeit,<br />
von den Grund- und<br />
Freiheitsrechten vor allem Eigentum<br />
und Gleichheit.<br />
Ein wichtiges Thema, das er im kollegialen<br />
Kreis häufig diskutierte, waren<br />
Fragen der Universitätsorganisation.<br />
Er war ein großer Befürworter der Universitätsautonomie.<br />
Beim Symposium<br />
zur Gründung des Departments für<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften<br />
der <strong>BOKU</strong> im Jahr 2004 beendete<br />
er seinen Festvortrag mit dem Ausruf<br />
„Autonomie, Autonomie, Autonomie!“<br />
In diesem Zusammenhang sei auch<br />
seine Rolle als Wegbereiter der Entwicklung<br />
der Universität für Bodenkultur<br />
Wien vom „Hochschülchen“ zu<br />
einer modernen „Life-Sciences-Universität“<br />
erwähnt.<br />
INDIVIDUALIST DURCH UND DURCH<br />
Manfried Welan war ein höchst origineller<br />
Mensch und ein Individualist<br />
durch und durch. Obwohl weltanschaulich<br />
fest in der ÖVP verankert,<br />
setzte er sich nicht selten für Anliegen<br />
ein, die traditionellerweise von Protagonisten<br />
anderer Parteien vertreten<br />
werden. Schon in seinen ersten Jahren<br />
an der <strong>BOKU</strong> war er Vertrauensdozent<br />
für ausländische Studierende<br />
gewesen. Bemerkenswerterweise<br />
hatte er bereits zu jener Zeit auch<br />
den Fragestellungen der Umweltforschung<br />
und -bildungspolitik einen besonderen<br />
Stellenwert zugemessen.<br />
Gemeinsam mit Helmuth Gatterbauer<br />
und Ruth-Elvira Groiss hatte er sich<br />
an der Universität für Bodenkultur<br />
Wien bereits in den 1970er-Jahren in<br />
Forschung und Lehre dem „grünen<br />
Recht“ zugewandt, später wirkte er<br />
im Naturschutzbund Österreich ehrenamtlich<br />
mit. Die Etablierung Wiens<br />
als international anerkannte Wissenschaftsstadt<br />
war ihm Zeit seines wissenschaftlichen<br />
Berufslebens – und<br />
darüber hinaus – ein großes Anliegen.<br />
In Analogie zum „Goldenen Wiener<br />
Herz“ prägte er in diesem Zusammenhang<br />
die Metapher vom „Goldenen<br />
Wiener Hirn“.<br />
Immer wieder überraschte der für<br />
seinen Geistes- und Wortwitz bekannte<br />
Gelehrte mit bildsprachlichen<br />
Novitäten. Den Staat Österreich bezeichnete<br />
er einmal ironisch als eine<br />
„Republik der Mandarine und Funktionäre“.<br />
Manfried Welan, der selbst in<br />
vielerlei Institutionen gestaltend aktiv<br />
war, fand sich in diesem komplexen<br />
Staatsgefüge erstaunlich gut zurecht.<br />
Er agierte darin als „Ein Diener der<br />
Zweiten Republik“, so der Titel des<br />
zweiten Teils seiner fünfbändigen Autobiografie.<br />
Als er bereits mehr als 75<br />
Jahre alt war, äußerte er einem Kollegen<br />
gegenüber, dass in kurzer Zeit<br />
eine nicht geringe Anzahl an Freunden<br />
und Weggefährten von ihm verstorben<br />
waren. Die Frage, wie es ihm dabei<br />
ging, beantwortete Manfried Welan<br />
in gewohnt bildsprachlicher Manier:<br />
„Ich komme mir vor wie ein Baum in<br />
einem Wald, der immer lichter wird.“<br />
Einige Jahre später erschien der vierte<br />
Band seiner Autobiografie mit dem<br />
Titel „Ein Baum in der Lichtung. Alterserwachen.“<br />
Seinen inneren Kompass,<br />
der ihn sein Leben lang geleitet<br />
hatte, und der jetzt sein Vermächtnis<br />
ist, hat Manfried Welan in diesem<br />
Buch so beschrieben: „Mitwirken ist<br />
gefragt, selbstständig und wachsam<br />
sein, g’scheit sein und trotz allem<br />
weitermachen, auch als Wächter der<br />
Republik, des Rechtsstaates und der<br />
Demokratie!“<br />
LIEBE ZUM SCHREIBEN<br />
Mehr als 30 Bücher und nicht weniger<br />
als 300 Beiträge in Fachbüchern<br />
und -zeitschriften hat Manfried Welan<br />
hinterlassen. Er publizierte zudem<br />
reichlich in verschiedenen österreichischen<br />
Zeitungen sowie Zeitschriften<br />
und war ein gefragter Interviewpartner<br />
zu politischen und gesellschaftlichen<br />
Themen in gedruckten<br />
Medien wie auch in Radio und Fernsehen.<br />
Seine Lust am Schreiben entsprang<br />
aus der bereits früh vorhandenen<br />
Liebe zur Literatur. Noch kurz<br />
vor seinem Ableben erschien das von<br />
ihm gemeinsam mit Raoul Kneucker<br />
verfasste Werk „Die Fragen des Pilatus.<br />
Wahrheit – Gerechtigkeit – Glaube“.<br />
Wie aus seinem privaten Umfeld<br />
bekannt ist, hatte der nun kurz vor<br />
seinem 87. Geburtstag verschiedene<br />
Altrektor auch noch weitere Publikationen<br />
geplant.<br />
Die Persönlichkeit Manfried Welans<br />
war feinsinnig und facettenreich. Die<br />
von ihm geliebte Wissenschaft und<br />
sein tief empfundenes Gottvertrauen<br />
gerieten nie in Widerspruch. Längst<br />
hatte er weit über die Grenzen der<br />
österreichischen Bundeshauptstadt<br />
hinaus zur Prominenz gezählt. Wer<br />
ihn kannte, weiß, dass er sich darauf<br />
aber nie etwas eingebildet hat. Mit<br />
seiner freundlichen, weltoffenen, toleranten<br />
und empathischen Art wie<br />
auch mit seinem humorvollen Wesen<br />
erwarb er sich die Sympathie zahlreicher<br />
Menschen. Bis zuletzt meisterte<br />
er mit wachem Verstand sein<br />
Leben. Manfried Welan, der auch zur<br />
Geschichte der <strong>BOKU</strong> publizierte und<br />
als deren Rektor die Erforschung ihrer<br />
Geschichte förderte, hat sich mit seinem<br />
von vielen als außergewöhnlich<br />
empfundenen Wirken in die mehr als<br />
150-jährige Geschichte der von ihm<br />
geliebten Institution in nachhaltiger<br />
Weise eingeschrieben. W<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
63
Studentische Start-ups<br />
Das Team der <strong>BOKU</strong>:BASE begleitet bereits seit vielen Jahren Student*innen<br />
und Forscher*innen auf einem Stück ihres Weges zur Gründung eines Unternehmens.<br />
Viele Gründer*innen widmen sich gesellschaftlichen Themen, um<br />
eine nachhaltige Entwicklung anzustoßen oder zu fördern.<br />
procery steht dabei am Beginn des Gründungsprozesses und kann von Lehrangeboten<br />
wie der Sustainability Challenge profitieren.<br />
Mit Perspektive Landwirtschaft kam ein von <strong>BOKU</strong>-Alumni gegründetes Unternehmen<br />
anlässlich seines zehnjährigen Bestehens an die <strong>BOKU</strong> zurück – mit<br />
einem Symposium zu ihrem Herzensthema, der Hofnachfolge.<br />
KONTAKT Michael Ambros | michael.ambros@boku.ac.at | base.boku.ac.at<br />
Symposium „Hofnachfolge neu gedacht“ an der <strong>BOKU</strong><br />
Perspektive Landwirtschaft feiert das Zehn-Jahres-Jubiläum Von Vanessa Kaiser<br />
PERSPEKTIVE LANDWIRTSCHAFT<br />
Team Perspektive Landwirtschaft<br />
Der Verein Perspektive Landwirtschaft<br />
(vormals „N.E.L. -<br />
Netzwerk Existenzgründung<br />
in der Landwirtschaft“) wurde im<br />
Jahre 2013 von <strong>BOKU</strong>-Student*innen<br />
gegründet. Nach anfänglich großem<br />
ehrenamtlichen Einsatz ist der Verein<br />
im Laufe der letzten zehn Jahre<br />
stetig gewachsen. Mittlerweile besteht<br />
dieser aus einem dreiköpfigen<br />
Büro-Team und einem ehrenamtlichen<br />
Vorstand. Gemeinsam mit über<br />
800 Mitgliedern setzt sich Perspektive<br />
Landwirtschaft aktiv für neue<br />
Formen der Hofübergabe (v. a. der<br />
außerfamiliären Hofnachfolge) und<br />
den Erhalt von vielfältigen Höfen ein.<br />
Anlässlich des Zehn-Jahres-Jubiläums<br />
hat der Verein, gemeinsam mit<br />
dem Institut für Ökologischen Landbau,<br />
am 25. und 26. März <strong>2024</strong> zum<br />
Symposium „Hofnachfolge neu gedacht“<br />
an die <strong>BOKU</strong> eingeladen. Dabei<br />
stand die Hofnachfolge im Fokus,<br />
denn seit 1995 ist die Anzahl landund<br />
forstwirtschaftlicher Betriebe<br />
in Österreich stark gesunken. Die<br />
Gründe dafür sind vielfältig – häufig<br />
fehlen Nachfolger*innen. Knapp ein<br />
Drittel aller Betriebsleiter*innen über<br />
50 Jahre hat keine gesicherte Hofnachfolge.<br />
Gleichzeitig gibt es viele<br />
motivierte Personen, die ihre Zukunft<br />
in der Landwirtschaft sehen.<br />
Im Rahmen des Symposiums wurde<br />
mit Wissenschaftler*innen, u. a. mit<br />
Marianne Penker, land- und forstwirtschaftlichen<br />
Organisationen und Berater*innen<br />
aus Österreich, z. B. mit<br />
der Lebens- & Sozialberaterin Susan-<br />
64 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
ne Fischer und Akteur*innen anderer<br />
europäischer Länder, wie etwa der<br />
Schweizer Kleinbauernvereinigung<br />
sowie Personen aus der landwirtschaftlichen<br />
Praxis über verschiedenste<br />
Themen diskutiert. Vor allem<br />
die fehlende Hofnachfolge, neue Formen<br />
(z. B. außerfamiliäre Hofnachfolge,<br />
Betriebskooperationen) und die<br />
Möglichkeiten für junge Menschen<br />
zum Einstieg in die Landwirtschaft<br />
standen hierbei im Mittelpunkt.<br />
Die Erfahrungsberichte von Praktiker*innen<br />
zeigten, dass die außerfamiliäre<br />
Hofübergabe Perspektiven<br />
bieten kann. So hat Johannes<br />
Schullern, selbst <strong>BOKU</strong>-Student,<br />
vor zwei Jahren mit seiner Partnerin<br />
den Ferdlhof in Oberösterreich<br />
übernommen und auf Milchziegen<br />
umgestellt. Gesucht haben sie nicht<br />
lange, im Gegensatz zu Sabine Gruber<br />
und ihrem Mann Josef, die erst nach<br />
zehn Jahren ihren Traumbetrieb in<br />
Salzburg gefunden haben. Wie viele<br />
und welche der aktuell über 350<br />
Hofsuchenden auf der Plattform von<br />
Perspektive Landwirtschaft Glück haben,<br />
ist schwer vorhersehbar. Ihnen<br />
gegenüber stehen etwa 100 Steckbriefe<br />
von Landwirt*innen, die nach<br />
einer geeigneten Nachfolge Ausschau<br />
halten.<br />
Das Ergebnis nach zwei inspirierenden<br />
Tagen: Es ist Zeit, neue Formen<br />
der Hofnachfolge als Chance zu sehen,<br />
um Betriebe zu erhalten, die<br />
Branche zu verjüngen, neue Ideen, Innovationen<br />
und Investitionen auf die<br />
Höfe zu bringen. Mit dem Symposium<br />
wurden Erfolge gefeiert und neue<br />
Ideen für die Zukunft geschmiedet.<br />
Für Perspektive Landwirtschaft ist<br />
klar: Um Höfe zu erhalten, braucht es<br />
auch neue Wege der Hofnachfolge -<br />
denn jeder Hof zählt! W<br />
KONTAKT<br />
DI in Vanessa Kaiser, BEd<br />
info@perspektive-landwirtschaft.at<br />
www.perspektive-landwirtschaft.at<br />
Team procery<br />
procery<br />
Free Walking Tour durch den Supermarkt<br />
IIn einer Zeit, in der Gesundheit,<br />
Umwelt und Wohlstand von täglichen<br />
Entscheidungen abhängen,<br />
ist es essenziell, beim Thema<br />
Ernährung anzusetzen. Bei procery<br />
setzen wir uns dafür ein, einen nachhaltigen<br />
Einkauf für alle zugänglich zu<br />
machen. Im Rahmen der Sustainability<br />
Challenge bekommen wir mit<br />
unserem interdisziplinären Team von<br />
Student*innen verschiedener Universitäten<br />
die Unterstützung, diese Idee<br />
in einen Businessplan umzuwandeln.<br />
Stell dir vor, du betrittst einen Supermarkt<br />
und wirst von einem procery-<br />
Guide begrüßt. Er erklärt dir in nur 45<br />
Minuten, wie du dich gesund, preiswert<br />
und nachhaltig ernähren kannst.<br />
Von Philip Guttenbrunner<br />
Die Vorteile unseres Ansatzes sind<br />
vielfältig: Die Teilnehmer*innen gewinnen<br />
mehr Wohlbefinden durch<br />
die gesündere Ernährungsweise, Ernährungstrainer*innen<br />
erhalten eine<br />
Plattform, nachhaltige Produktmarken<br />
erzielen mehr Sichtbarkeit und<br />
Supermärkte bekommen die Möglichkeit,<br />
sich für Bewusstseinsbildung<br />
einzusetzen.<br />
Interesse geweckt? Dann melde dich<br />
kostenlos für die nächste Führung<br />
über den QR-Code an! W<br />
procery, PHILIP GUTTENBRUNNER<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
65
Submitting a Grant:<br />
How the FoS can support you!<br />
<strong>BOKU</strong> Forschungsservice (FoS)/Research Support,<br />
Innovation & Technology Transfer, Project support<br />
By Olivier Guillaume<br />
You have taken the decision to apply to a programme of excellence call* - that’s<br />
already a good first step. But, did you know that the Service unit <strong>BOKU</strong> Forschungsservice<br />
(FoS)/Research Support, Innovation & Technology Transfer can support you?<br />
FWF/KLAUS RANGER<br />
Indeed, let us know if …<br />
▶ You need information on a specific call<br />
▶ You are searching for advices & feedbacks in drafting<br />
your proposal<br />
▶ You need somebody to proof read your application<br />
▶ You received an invitation to a hearing session in front<br />
of a panel of experts; that’s fantastic. We can organise<br />
training interviews for you!<br />
Helmut Haberl, Institute of<br />
Social Ecology, coordinator of a<br />
new project REMASS, funded by<br />
FWF Emerging Field, in March<br />
<strong>2024</strong>.<br />
PRIVAT<br />
Wei Wu, Institute of Geotechnical<br />
Engineering, recent recipient of<br />
MOTRAN, an ERC Advanced Grant,<br />
in March <strong>2024</strong>.<br />
„Ich habe mich sehr gefreut, die<br />
Förderung Advanced Grant vom<br />
Europäischen Forschungsrat (ERC)<br />
zu erhalten. Mit Professionalität<br />
und Engagement haben Olivier<br />
Guillaume und Lada Fialova mir<br />
beim Korrekturlesen und Probeinterview<br />
maßgeblich geholfen,<br />
mein Antragsprofil zu schärfen.“<br />
“Winning large Multiple Principal<br />
Investigators grants such as<br />
the FWF Emerging Fields is a<br />
complex endeavour. One needs a<br />
sharp, focused research agenda,<br />
while integrating research interests<br />
and expertise of the whole<br />
group. Help organized by Olivier<br />
Guillaume and collaborators<br />
from <strong>BOKU</strong>’s research services<br />
was hugely helpful, above all in<br />
preparation for the hearings.”<br />
Das Vorhaben REMASS (Resilience and Malleability of<br />
Social Metabolism) wurde vom Österreichischen Wissenschaftsfonds<br />
(FWF) mit einer Förderung in Höhe von<br />
7,1 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre ausgezeichnet.<br />
Ein bedeutender Meilenstein für das neue<br />
Forschungsfeld, das von Wissenschaftler*innen der Wirtschaftsuniversität<br />
Wien, dem Complexity Science Hub,<br />
der IIASA, der Universität Wien und der Central European<br />
University Vienna unter Federführung der <strong>BOKU</strong> University<br />
getragen wird.<br />
W<br />
REMASS https://short.boku.ac.at/2y8q5v<br />
MORTAN (Modelling transient granular flow) soll maßgeblich<br />
dazu beitragen, ein tieferes Verständnis für das<br />
dynamische Verhalten granularer Materialien bei Zustandsänderungen<br />
zu erlangen. Dadurch eröffnen sich<br />
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie<br />
Geogefahr, Geotechnik und Verfahrenstechnik. Es ermöglicht<br />
beispielsweise die präzise Analyse und Vorhersage<br />
von Phänomenen wie dem Übergang von stabilen Hängen<br />
zu Muren, von festen Skipisten zu Lawinen sowie von<br />
Verflüssigungs-, Strömungs- und Verstopfungsprozessen<br />
in industriellen Anwendungen.<br />
MOTRAN https://short.boku.ac.at/exo64600<br />
Now, you know: Do not hesitate to contact the FoS Team,<br />
we are here to support you!<br />
W<br />
* i. e. ERC, FWF Emerging Field, FWF ASTRA, WWTF VRG<br />
LINKS<br />
Upcoming calls, FoS seminars and contacts: https://boku.ac.at/fos<br />
ERC@<strong>BOKU</strong> https://short.boku.ac.at/kq8o22<br />
CONTACT<br />
olivier.guillaume@boku.ac.at<br />
66 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
PIXABAY, USER KALHH (CC0 LIZENZ)<br />
Aus <strong>BOKU</strong> Forschung entstandene<br />
Erfindungen zu gesellschaftsrelevanter<br />
Anwendung<br />
zu bringen, macht einen zentralen<br />
Punkt unserer Third Mission aus. Doch<br />
schon am Anfang dieses Wegs können<br />
Unsicherheiten aufkommen, beispielsweise:<br />
Handelt es sich bei den<br />
vorliegenden Forschungsergebnissen<br />
um eine Erfindung? Hat diese Projektidee<br />
Erfindungs- und kommerzielles<br />
Verwertungspotenzial? Das Pre-Check<br />
Ideenformular des <strong>BOKU</strong> Technologietransfers<br />
soll hierbei eine unbürokratische<br />
Hilfestellung bieten. Es ermöglicht<br />
eine erste formlose Einschätzung<br />
und Bewertung von potenziellen Erfindungen<br />
oder Ideen. Die benötigten<br />
Angaben beinhalten hauptsächlich<br />
eine kurze Beschreibung der Ergebnisse/der<br />
Idee und deren Abgrenzung<br />
zum aktuellen Stand der Technik.<br />
Damit kann das Team des Technologietransfers<br />
ermitteln, ob eine offizielle<br />
Meldung einer Diensterfindung<br />
notwendig ist. Auch zu Möglichkeiten<br />
zur Erhöhung von Verwertungschancen<br />
einer Projektidee kann so schnell<br />
informiert werden. Das Pre-Check<br />
Ideenformular bietet Forschenden<br />
daher eine unkomplizierte Möglichkeit,<br />
den ersten Schritt zu machen,<br />
um den Wert ihrer Forschung in die<br />
Gesellschaft einzubringen. W<br />
Von Marie-Thérèse Salcher-Konrad<br />
KONTAKT/CONTACT<br />
techtransfer@boku.ac.at<br />
LINK<br />
Das hat<br />
Potenzial!<br />
Mit dem Pre-Check<br />
Ideenformular zu<br />
einer ersten<br />
Einschätzung einer<br />
Erfindung<br />
https://boku.ac.at/fos/technologietransfer<br />
YOU’VE GOT POTENTIAL!<br />
Get an initial assessment of your<br />
invention with the Pre-Check Idea<br />
Form<br />
Disseminating inventions created<br />
from <strong>BOKU</strong> research into society is<br />
central to our Third Mission. However,<br />
uncertainties might arise right<br />
at the start of this journey: Do my<br />
research results actually qualify as<br />
an invention? Has this project idea<br />
got inventive potential and is there<br />
scope for commercial exploitation?<br />
The <strong>BOKU</strong> Technology Transfer’s<br />
Pre-Check Idea Form is designed to<br />
provide unbureaucratic assistance.<br />
It enables an initial informal assessment<br />
and evaluation of potential<br />
inventions or ideas. Mainly, a brief<br />
description of the results/the idea<br />
and of their distinction from the<br />
current state of the art is required.<br />
The Technology Transfer Team can<br />
then determine whether an official<br />
notification of a service invention<br />
is necessary. Additionally, guidance<br />
on how to increase the chances of<br />
commercialising your project idea<br />
can be provided. The Pre-Check Idea<br />
Form thereby serves as a catalyst<br />
for researchers to introduce the<br />
benefits generated through their<br />
research into society. W<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
67
Das neue <strong>BOKU</strong>-<br />
Forschungsinformationssystem<br />
Ein Überblick<br />
Von Horst Mayr<br />
Nach einigen Jahren der Neuprogrammierung,<br />
unterbrochen<br />
durch notwendige Entwicklungen<br />
im ‚alten‘ System (z. B.<br />
rund um die elektronische Projektmeldung)<br />
und leider auch Verzögerungen<br />
(Corona) fand das Go Live des<br />
Projekts „FIS3+“ am 4. März <strong>2024</strong><br />
statt.<br />
Wesentliches Ziel der Neuprogrammierung<br />
war es, eine moderne Architektur<br />
zu entwickeln, die den aktuellen<br />
Anforderungen von User*innen<br />
an IT-Systeme Rechnung trägt.<br />
Das neu designte öffentliche Portal<br />
ist nunmehr nachhaltig, barrierefrei<br />
und responsive: Nachhaltig durch die<br />
Entwicklung eines Designs, um den<br />
ökologischen Fußabdruck möglichst<br />
gering zu gestalten (Seiten sollen<br />
rasch geladen werden), ein umfassend<br />
barrierefreies Design entsprechend<br />
den gesetzlichen Vorgaben (auch benachteiligte<br />
Personen, z. B. mit Sehbeeinträchtigung,<br />
sollen sich über<br />
Forschung informieren können) sowie<br />
die Realisierung eines responsiven Designs,<br />
welches auf die Eigenschaften<br />
des benutzten Endgeräts (z. B. Smartphone)<br />
reagieren kann. Darüber hinaus<br />
bietet das neue Portal bei der „Suche<br />
nach Forscher*innen“ mit Hilfe des<br />
Schlagwortverzeichnis der Statistik<br />
Austria wieder eine Expert*innensuche<br />
an. Zwecks verbesserter Kommunikation<br />
mit der Scientific Community<br />
sowie der interessierten Öffentlichkeit<br />
sind Social-Media-Elemente<br />
(u. a. Facebook, Twitter) auf allen<br />
Seiten integriert, um auf kurzem Wege<br />
neue Forschungsleistungen sichtbar(er)<br />
machen zu können.<br />
»Im Unterschied zum alten<br />
FIS müssen alle erfassten<br />
Datensätze vom FIS-Team<br />
überprüft und validiert<br />
werden. Erst dann werden<br />
neue Einträge öffentlich<br />
sichtbar und können für<br />
gesetzlichen Berichte<br />
und Erhebungen sowie<br />
Exporte durch die Forscher*innen<br />
selbst<br />
berücksichtigt werden.«<br />
Horst Mayr<br />
RAINER RESSMANN<br />
Die neue Datenerfassung ist durchgehend<br />
barrierefrei und zweisprachig<br />
gestaltet. Breadcrumbs, die Möglichkeit,<br />
das Farbdesign entsprechend<br />
den eigenen Bedürfnissen anpassen<br />
zu können, sowie die durchgehende<br />
Verwendung von Screen Reader runden<br />
die Barrierefreiheit für Menschen<br />
mit Behinderung ab. FIS3+ soll zeitnah<br />
zertifiziert werden (WACA, Web<br />
Accessibility Certificate).<br />
Erstmals sind alle Navigationselemente,<br />
Formulare, Placeholder, Tooltips<br />
und Infoseiten für die internationalen<br />
<strong>BOKU</strong>-Forscher*innen in<br />
englischer Sprache auswählbar. Für<br />
das neue FIS wurden Moodle-Kurse<br />
– sowohl in deutscher als auch<br />
in englischer Sprache – eingerichtet,<br />
diese sind sowohl für das allgemeine<br />
als auch wissenschaftliche Personal<br />
via <strong>BOKU</strong> Learn zugänglich.<br />
Das „neue“ FIS besteht aus dem Bereich<br />
Personenprofil u. a. mit Publikationen,<br />
Vorträgen, Community<br />
Services sowie einer Kurzdarstellung<br />
für die <strong>BOKU</strong>-Institute. Publikationen<br />
können wie bisher aus Web of<br />
Science und Pubmed und seit dem<br />
Go Live auch aus Scopus importiert<br />
werden. Neu implementiert wurde<br />
auch ein umfassendes Modul für den<br />
Import bzw. die manuelle Dokumentation<br />
von Medienbeiträgen in Print-,<br />
Web-, Radio- und TV-Medien: Durch<br />
eine Kooperation mit Observer GmbH,<br />
welche nationale Printmedien sowie<br />
Web-Portale in Österreich, Deutschland<br />
und der Schweiz im Auftrag der<br />
<strong>BOKU</strong> University nach Nennung derselben<br />
screent und „gefundene“ Medienbeiträge<br />
über eine API-Schnitt-<br />
68 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
stelle für die weitere Verwendung<br />
in FIS3+ zur Verfügung stellt, sowie<br />
die Kooperation mit dem Verband<br />
Österreichischer Privatsender, welche<br />
einen „freien“ Import von Radiobeiträgen<br />
mit <strong>BOKU</strong>-Forschungsbezug<br />
über eine API-Schnittstelle<br />
aus dem „Cultural Broadcast Archiv“<br />
ermöglichen, konnten für die <strong>BOKU</strong><br />
Forscher*innen maßgeschneiderte<br />
Erfassungsformulare für sonstige<br />
Medienbeiträge entwickelt werden.<br />
Forscher*innen können nun auch ihre<br />
Forschungsschwerpunkte mit Bildern<br />
präsentieren.<br />
Erstmals wurde eine Testautomatisierungssoftware<br />
(Ranorex) implementiert,<br />
die einen Quantensprung<br />
bei der Überprüfung von Erfassungsformularen<br />
(negatives/positives Testing<br />
usw.) bedeutet! Im Unterschied<br />
zum alten FIS müssen alle erfassten<br />
Datensätze vom FIS-Team überprüft<br />
und validiert werden. Erst dann werden<br />
neue Einträge öffentlich sichtbar<br />
und können für gesetzliche Berichte<br />
und Erhebungen (z. B. Wissensbilanz),<br />
für Evaluationen (von Professuren<br />
und Departments) sowie Exporte<br />
durch die Forscher*innen selbst (z.<br />
B. für Projektanträge) berücksichtigt<br />
werden. Einerseits bedingt dieser<br />
Ansatz zwar einen größeren Bearbeitungsaufwand<br />
für das FIS-Team,<br />
andererseits bedeutet das auch eine<br />
deutlich verbesserte Datenqualität,<br />
falsch oder mangelhaft erfasste Datensätze<br />
gehören damit der Vergangenheit<br />
an.<br />
AUSBLICK<br />
Die <strong>BOKU</strong> University deckt mit dem<br />
neuen System „FIS3+“ die Bedürfnisse<br />
und Wünsche der <strong>BOKU</strong>-Forscher*innen<br />
sowie der Universitätsleitung ab.<br />
Sie ist damit bestmöglich für zukünftige<br />
Entwicklungen aufgestellt, kann<br />
gezielt das hauseigene System jederzeit<br />
anpassen und ist damit unabhängig<br />
von kommerziellen Lösungen. Diese<br />
Unabhängigkeit war für die <strong>BOKU</strong><br />
in der Vergangenheit wichtig und soll<br />
es auch in Zukunft sein. Die <strong>BOKU</strong> ist<br />
weiterhin offen für Kooperationen mit<br />
anderen Universitäten, im Austausch<br />
mit Partner*innen lässt sich vieles<br />
leichter (weiter)entwickeln. W<br />
The new <strong>BOKU</strong> research information system<br />
An overview<br />
The main aim of reprogramming the <strong>BOKU</strong> FIS was to develop a modern<br />
architecture that takes into account the current requirements of users of<br />
IT systems. The redesigned public portal is now sustainable, accessible and<br />
responsive: sustainable through the development of a design to minimise<br />
the ecological footprint (pages should load quickly), a comprehensively<br />
accessible design in accordance with legal requirements (disadvantaged<br />
people, e. g. with visual impairments, should also be able to inform themselves<br />
about <strong>BOKU</strong>'s research) and the realisation of a responsive design<br />
that can react to the characteristics of the end device used (e. g. smart<br />
phones). In addition, the new portal offers an expert search when searching<br />
for researchers with the help of Statistics Austria's keyword directory. To<br />
improve communication with the scientific community and the interested<br />
public, social media elements (e. g. Facebook, Twitter) are integrated on all<br />
pages in order to make new research achievements more visible.<br />
Of course, the new data collection is also barrier-free and bilingual throughout.<br />
Breadcrumbs, the option to adapt the colour design to your own needs<br />
and the consistent use of screen readers round off the accessibility for<br />
people with disabilities. FIS3+ is to be certified in the near future (WACA,<br />
Web Accessibility Certificate). For the first time, all navigation elements,<br />
forms, placeholders, tooltips and information pages for international <strong>BOKU</strong><br />
researchers can be selected in English. Moodle courses - in both German<br />
and English - have been set up for the new FIS and are accessible to both<br />
general and academic staff via <strong>BOKU</strong> Learn.<br />
The ‘new’ FIS consists of the personal profile section with publications,<br />
lectures, community services and a brief description of the <strong>BOKU</strong> institutes.<br />
As before, publications can be imported from Web of Science and<br />
Pubmed and, since Go Live, also from Scopus. Another new feature is a<br />
comprehensive module for importing and manual documentation of media<br />
contributions in print, web, radio and TV media: Thanks to a cooperation<br />
with Observer GmbH, which screens national print media and web portals<br />
in Austria, Germany and Switzerland on behalf of <strong>BOKU</strong> University for<br />
mentions of the same and makes ‘found’ media contributions available for<br />
further use in FIS3+ via an API interface, as well as the cooperation with<br />
the Association of Austrian Private Broadcasters, which enables a ‘free’<br />
import of radio contributions with a <strong>BOKU</strong> research reference via an API<br />
interface from the ‘Cultural Broadcast Archive’, customised entry forms<br />
for other media contributions could be developed for <strong>BOKU</strong> researchers.<br />
Researchers can now also present their main research areas with images.<br />
LINKS<br />
FIS (DEutsch) https://forschung.boku.ac.at/dex<br />
FIS (ENglish) https://forschung.boku.ac.at/en<br />
Moodle-Kurse für die Verwendung des FIS (nach Login)<br />
DE-Version https://learn.boku.ac.at/course/view.php?id=53261<br />
EN-Version https://learn.boku.ac.at/course/view.php?id=53263<br />
KONTAKT<br />
horst.mayr@boku.ac.at<br />
<strong>BOKU</strong> Mag<br />
2 | <strong>2024</strong><br />
69
FORSCHUNG: FAQ<br />
STRATEGISCHE KOOPERATION<br />
<strong>BOKU</strong>–UMWELTBUNDESAMT<br />
Das neue<br />
Forschungsinformationssystem<br />
FIS3+<br />
Von Horst Mayr<br />
Ich finde meine erfassten Datensätze nicht.<br />
Im Unterschied zum alten System muss jeder Datensatz<br />
vom FIS-Team überprüft und validiert werden.<br />
Falsch oder unzureichend erfasste Datensätze werden<br />
vom FIS-Team an die Forscher*innen zwecks Korrektur<br />
zurückgespielt. Nur validierte Einträge sind öffentlich<br />
sichtbar und können für Auswertungen/Datenexporte<br />
berücksichtigt werden.<br />
Wie merke ich, ob ein Datensatz unvollständig ist?<br />
Die Startseite in der Datenerfassung dient als Dashboard.<br />
Dort findet man jene Datensätze, die zu korrigieren<br />
sind. Es ist zu beachten, dass das FIS-Team regelmäßig<br />
Datensätze kontrolliert, gleichzeitig aber auch<br />
Ressourcen für die Weiterentwicklung des Systems sowie<br />
den Ausbau neuer Funktionalitäten widmen muss.<br />
Ich kann mich nicht ausloggen.<br />
Die neue FIS verwendet wie alle anderen <strong>BOKU</strong>-Systeme<br />
ab sofort „Shibboleth“ als Login. Ist man im <strong>BOKU</strong>-<br />
Netzwerk eingeloggt, ist man auch im FIS eingeloggt. Ein<br />
Logout aus dem FIS hätte ein Logout auch aus anderen<br />
Systemen zur Folge. Einfach den Browser schließen.<br />
Wie kann ich meine Daten exportieren?<br />
Da das neue FIS auf Nachhaltigkeit Rücksicht nimmt<br />
und der ökologische Fußabdruck möglichst minimal<br />
sein soll, sollen die Forscher*innen ihre Listen in der<br />
Datenerfassung so zusammenstellen, wie sie diese z. B.<br />
für Projektanträge brauchen. Dafür bietet das neue FIS<br />
eine Reihe von Filtermöglichkeiten, die Listen können<br />
z. B. als Word-File exportiert werden. W<br />
LINKS<br />
FIS (DEutsch) https://forschung.boku.ac.at/de<br />
FIS (ENglish) https://forschung.boku.ac.at/en<br />
Moodle-Kurse für die Verwendung des FIS (nach Login)<br />
DE-Version https://learn.boku.ac.at/course/view.php?id=53261<br />
EN-Version https://learn.boku.ac.at/course/view.php?id=53263<br />
KONTAKT<br />
fis@boku.ac.at<br />
JÜRGEN PLETTERBAUER<br />
Aufgrund einer neuen beruflichen Herausforderung<br />
habe ich meine Tätigkeit als Koordinator<br />
der Strategischen Kooperation <strong>BOKU</strong>-Umweltbundesamt<br />
mit Ende Mai <strong>2024</strong> beendet. In den<br />
letzten sieben Jahren konnte ich dank dieser bemerkenswerten<br />
Verbindung zweier österreichischer<br />
Expert*innen-Häuser - die in dieser Form weltweit<br />
wohl einzigartig ist - Einblicke in viele relevante (Umwelt-)Themen<br />
gewinnen. Dabei durfte ich spannende<br />
Projekte und Vorhaben auf den Weg bringen und begleiten.<br />
Damit verbunden, konnte ich eine Vielzahl<br />
an Menschen kennenlernen, die mit viel Leidenschaft<br />
und Engagement an diesen Themen arbeiten, um zu<br />
einer positiven Zukunft von Mensch und Natur beizutragen.<br />
Bei allen Kolleg*innen bedanke ich mich herzlich für<br />
die gute und konstruktive Zusammenarbeit sowie<br />
das positive Feedback, das ich über die letzten Jahre<br />
immer wieder erhalten habe. Besonders bedanken<br />
möchte ich mich bei den Mitgliedern des Kooperationsbeirats<br />
sowie den Vorsitzenden des Beirats, die<br />
mich in meiner Tätigkeit über die letzten Jahre begleitet<br />
und unterstützt haben.<br />
Ich hoffe, dass die Strategische Kooperation auch<br />
in Zukunft gedeiht und weiterhin als „Role Model“<br />
für Zusammenarbeit dienen kann. In Zeiten großer<br />
gesellschaftlicher Herausforderungen und multipler<br />
Krisen sind Kooperation und gegenseitiges Verständnis<br />
wichtige Grundlagen, um nachhaltige Lösungen<br />
zu finden.<br />
W<br />
LINK<br />
Abschiedsgrüße<br />
Von Florian Borgwardt<br />
http://short.boku.ac.at/fos_stratkoopbokuu<br />
70 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>
FARM<br />
FOOD<br />
FUTURE
72 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong><br />
ILLUSTRATION: ANIKA LEODOLTER
DAS MAGAZIN DES ALUMNIVERBANDES DER UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN • 06/<strong>2024</strong> • NR. 2<br />
<strong>BOKU</strong> Jobtag<br />
im Rückblick
WANTED: Alumni als<br />
Botschafter * innen<br />
der <strong>BOKU</strong> University!<br />
Du hast deine Zeit an der <strong>BOKU</strong> sehr genossen?<br />
Du hast bereits mehrere Jahre Berufserfahrung?<br />
Du möchtest Schüler*innen für ein Studium an<br />
der <strong>BOKU</strong> begeistern?<br />
Wir suchen dich!<br />
Besuche Schulen in deiner Nähe und stelle die <strong>BOKU</strong> University<br />
mit ihren vielfältigen Studiengängen vor.<br />
Teile deine Erlebnisse aus dem Studium und Uni-Leben.<br />
Erzähle von deinen Erfahrungen und beruflichen Erfolgen.<br />
Denn Alumni sind das Aushängeschild jeder Universität.<br />
Werde ein*e Botschafter*in und inspiriere die nächste<br />
Generation der <strong>BOKU</strong>-Alumni!<br />
Bei Interesse kontaktiere Ewald Pertlik unter alumni@boku.ac.at.<br />
SHUTTERSTOCK.COM | LIGHTFIELD STUDIOS
EDITORIAL<br />
<strong>BOKU</strong>-Alumni<br />
sind gefragt!<br />
H. MOALLA<br />
Das war der <strong>BOKU</strong> Jobtag<br />
Ein kurzer Rückblick<br />
4<br />
Der Arbeitsmarkt steht vor<br />
großen Herausforderungen<br />
und Veränderungen.<br />
Neue Technologien und<br />
Arbeitsmodelle sowie Themen<br />
wie Nachhaltigkeit und<br />
die Gestaltung der Zukunft unseres<br />
Planeten rücken immer mehr<br />
in den Fokus. Dass die <strong>BOKU</strong> University ihrem Anspruch<br />
zu den führenden Universitäten im Bereich<br />
Life Sciences und Nachhaltigkeit zu zählen gerecht<br />
wird, zeigt sich an der hohen Nachfrage nach unseren<br />
Absolvent*innen am Arbeitsmarkt.<br />
H. MOALLA<br />
18<br />
We need to plug the leaks!<br />
Dies wurde am 14. März am <strong>BOKU</strong> Jobtag deutlich,<br />
bei dem das <strong>BOKU</strong> Career Center zum Austausch<br />
zwischen Studierenden, Alumni und potenziellen Arbeitgeber*innen<br />
in die Muthgasse lud. Unsere Studierenden<br />
und Jungabsolvent*innen konnten direkte<br />
Kontakte in die Arbeitswelt knüpfen und die rund<br />
40 vertretenen Unternehmen näher kennenlernen.<br />
Interview with KT-alumna<br />
Marion Liemberger<br />
Viele Aussteller*innen waren durch unsere Alumni<br />
selbst vertreten. Sie sind mit ihrem Beitrag für Gesellschaft,<br />
Wissenschaft und Forschung unverzichtbare<br />
Partner*innen, um Brücken zwischen Studium und<br />
Berufswelt zu schlagen. Denn <strong>BOKU</strong>-Absolvent*innen<br />
sind die Aushängeschilder unserer Universität.<br />
LVA GMBH<br />
Standardisierung in der<br />
Mykotoxinanalytik<br />
30<br />
In diesem Zusammenhang möchten wir unsere<br />
Alumni auch dazu aufrufen und die Möglichkeit bieten,<br />
in Schulen zu gehen, um die <strong>BOKU</strong>-Studien und<br />
ihre Arbeitserfahrungen zukünftigen Studierenden<br />
vorzustellen. Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme<br />
unter alumni@boku.ac.at.<br />
Martin Sowa<br />
Jobtag-Organisator<br />
Kommentar von David Steiner<br />
Ausgabe 06/<strong>2024</strong> • Nr. 2<br />
PEFC-06-39-01<br />
alumni.boku.wien/magazin | IMPRESSUM<br />
Herausgeber: Alumnidachverband der Universitä für Bodenkultur Wien, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, www.alumni.boku.wien • Geschäftsführer<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI: Ewald Pertlik, alumni@boku.ac.at • Redaktion: Natalia Lagan, alumnimagazin@boku.ac.at, Tel.: 01/47654-10442 • Auflage:<br />
5.500 • Mitarbeit: Martin Sowa, Dorottya Bazso, Manfred Gössinger, Benedikt Fritz, Jana Pirolt, Konstantin Heidler, Lena Maria Leiter, Sebastian Nieß,<br />
Jennifer Hatlauf, Pia Euteneuer, Susanne Stöhr-Eißert, Eugenio Diaz-Pines, Gerhard Moitzi, Stefan Grossauer, Lukas Landler, David Steiner • Lektorat:<br />
Marlene Gölz, Mathilde Sengoelge • Coverbild: Fotos von Haroun Moalla • Grafik: Monika Medvey, Mira Schwanda (Praktikum) • Druck: Druckerei<br />
Berger – PEFC-zertifiziert: das PEFC-Zertifikat garantiert eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung. Das Holz stammt aus aktiv<br />
nachhaltig und klimafit bewirtschafteten Wäldern.<br />
Alle redaktionellen Beiträge sind nach bestem Wissen recherchiert, es wird jedoch keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen.<br />
Namentlich nichtgekennzeichnete Beiträge stammen von der Redaktion. Redaktionelle Bearbeitung und Kürzung von Beiträgen sind aus Platzgründen<br />
vorbehalten. Nichtgekennzeichnete Fotos sind private Fotos.<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
3
<strong>BOKU</strong> Jobtag –<br />
Einblicke in<br />
die moderne<br />
Arbeitswelt<br />
Am 14. März lud das <strong>BOKU</strong> Career Center<br />
zum diesjährigen <strong>BOKU</strong> Jobtag in die<br />
AULA Muthgasse. Fast 40 Unternehmen<br />
nahmen teil, um den Studierenden und<br />
Alumni der <strong>BOKU</strong> spannende Karrieremöglichkeiten<br />
zu präsentieren.<br />
Text: Martin Sowa, Natalia Lagan • Fotos: Haroun Moalla<br />
4<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI •• NR.2 –– 06/24
An<br />
informativen Messeständen bot sich<br />
den Besucher*innen die Möglichkeit,<br />
wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt<br />
zu erlangen und wichtige Kontakte für ihre berufliche<br />
Zukunft zu knüpfen. Viele Unternehmen nutzten auch<br />
die Chance, sich dem Publikum beim Firmen-Pitch<br />
auf der Jobtagbühne zu präsentieren und gaben Einblicke<br />
in ihre genauen Tätigkeitsbereiche sowie Unternehmenskultur.<br />
Besucher*innen konnten zudem ihre Bewerbungsunterlagen<br />
optimieren lassen: Bei einem professionellen<br />
Bewerbungsfotoshooting in Kooperation mit<br />
Foto Schuster, oder beim vom <strong>BOKU</strong> Career Center<br />
angebotenen kostenlosen CV- und LinkedIn-Check.<br />
Auch ein eigener Verkaufsstand des <strong>BOKU</strong> Shops<br />
war vor Ort, bei dem man sich mit hochwertigen<br />
Merchandising-Produkten eindecken konnte. ARROW-RI<br />
Wir danken allen Unternehmen, die teilgenommen haben:<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
5
SPLITTER<br />
Ein besonderes Highlight war die Podiumsdiskussion<br />
zum Thema »Work-Life-Balance, flexible<br />
Arbeitszeitmodelle und moderne Unternehmenskultur«,<br />
bei der fünf Firmenvertreter*innen<br />
aus <strong>BOKU</strong>-relevanten Branchen dem Moderator<br />
Martin Sowa Frage und Antwort standen. Alle waren<br />
sich einig, dass der Arbeitsmarkt in den letzten<br />
Jahren starke Veränderungen durchgemacht<br />
hat. Anna Maria Nusko von der Wiener Stadtwerke-Gruppe<br />
nannte dabei das »Reverse Interview«<br />
als Beispiel. Dabei müssen Unternehmen nicht nur<br />
sich selbst und ihre Werte präsentieren, sondern<br />
die Kandidat*innen in einem Interview von sich<br />
überzeugen – die größte Herausforderung, wie sich<br />
herausstellt. Es ist den Firmen klar, dass potentielle<br />
Arbeitnehmer*innen eine sinnstiftende Arbeit und<br />
ein angenehmes Arbeitsumfeld präferieren. Daher<br />
bemühen sich die Arbeitgeber*innen, flexible und<br />
maßgeschneiderte Job-Profile anzubieten, um alle<br />
Bedürfnisse, wie Sabbaticals, Homeoffice, diverse<br />
Weiterbildungsangebote, Aufstiegsmöglichkeiten,<br />
Flexibilität, eine gesunde Work-Life-Balance u. v. m.<br />
abzudecken. Um sich den Kandidat*innen zu präsentieren,<br />
setzen die Unternehmen auf persönlichen<br />
Kontakt, zum Beispiel auf Jobmessen, Weiterbildungsveranstaltungen<br />
und kulturelle Events wie<br />
auch die Comic Con.<br />
ARROW-RI<br />
6<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI •• NR.2 –– 06/24
SPLITTER<br />
»<br />
Wir hatten schon öfter Praktikant*innen<br />
von der <strong>BOKU</strong> bei uns und das hat<br />
immer sehr gut funktioniert. Daher möchten<br />
wir unser Netzwerk, die Naturregion und den<br />
Verein selbst beim Jobtag unter die Leute<br />
bringen. Wir freuen uns über freiwillige helfende<br />
Hände von der <strong>BOKU</strong>!<br />
— Melanie Frauendienst,<br />
Landschaftspflegeverein<br />
»<br />
Forst-Studierende der <strong>BOKU</strong> sind die<br />
perfekten Kandidat*innen für uns, da<br />
das Studium sehr breit aufgestellt ist, von<br />
Forstwirtschaft über Ökologie und Ökonomie<br />
ist alles dabei.<br />
— Veronika Rappai, Österreichische<br />
Bundesforste<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
7
SPLITTER<br />
»<br />
Wir sind immer auf der Suche nach<br />
kompetenten Mitarbeiter*innen und<br />
als <strong>BOKU</strong>-Absolvent glaube ich, dass wir<br />
sehr gut geeignet sind. Letztes Jahr beim<br />
Jobtag hat sich mein Kollege bei unserem<br />
Messestand vorgestellt und ist nun Teil<br />
unseres Teams! Die Veranstaltung ist auch<br />
sehr gut organisiert. Es lohnt sich.<br />
— Georg Husner, ASFINAG<br />
8<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI •• NR.2 –– 06/24
SPLITTER<br />
»Es geht gar nicht darum, die besten Köpfe<br />
anzuwerben, sondern dass Menschen die passende<br />
Stelle für sich selbst finden«, fasst es Harald<br />
Gattermeyer von der anapur AG treffend<br />
zusammen.<br />
Anschließend hielten am Nachmittag einige<br />
universitäre und externe Serviceeinrichtungen<br />
Kurzvorträge mit Angeboten für Studierende<br />
sowie Alumni. Zum Abschluss des Tages bot<br />
sich noch die Möglichkeit, nach Voranmeldung<br />
am »Speed-Dating« mit bevorzugten Firmen<br />
teilzunehmen, um in kurzen persönlichen Gesprächen<br />
die Unternehmen noch näher kennenzulernen<br />
und den ein oder anderen Job zu<br />
ergattern.<br />
Insgesamt war der <strong>BOKU</strong> Jobtag <strong>2024</strong> ein<br />
inspirierendes Event, das den Studierenden<br />
und Absolvent*innen wertvolle Einblicke in die<br />
Berufswelt ermöglichte und die Chance bot,<br />
wichtige Kontakte für ihre berufliche Zukunft<br />
zu knüpfen. •<br />
Alle Fotos und Videos<br />
zum Nachsehen auf:<br />
alumni.boku.wien/jobtag<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
9
VERBÄNDE<br />
Verband österreichischer<br />
Lebensmittel- und Biotechnologen<br />
Die Welt des Apfels<br />
Texte: Manfred Gössinger<br />
Der Apfel stand am 4. Dezember 2023 im<br />
Mittelpunkt der VÖLB-Fortbildungsserie<br />
»Gutes aus Österreich – aus eigener Hand«.<br />
An der HBLA und BA für Wein- und Obstbau<br />
Klosterneuburg gab der Leiter des Instituts<br />
für Obstbau, Lothar Wurm, einen umfangreichen<br />
Überblick über die aktuelle Situation<br />
des Apfels auf dem Frischmarkt.<br />
Von den weltweit rund 20.000 Sorten mit einer<br />
Produktionsmenge von etwa 70 Mio. Tonnen<br />
ist der Apfel in Österreich die wichtigste Obstkultur<br />
mit einer Anbaufläche von ungefähr<br />
7.700 ha und einer Produktionsmenge von<br />
ca. 180.000 Tonnen (exkl. der gleichen Menge<br />
Streuobst). In den Intensivanlagen werden mit<br />
schlanker Spindel meist auf einer M9-Unterlage<br />
auch etwa 20 % Bio-Äpfel erzeugt. Zu den<br />
wichtigsten Sortengruppen zählen Sommer-/<br />
Herbst-/Wintersorten, Haupt-/Nebensorten,<br />
Frischmarkt-/Verarbeitungssorten, alte/neue<br />
Sorten, schorfresistente/-anfällige Sorten,<br />
mehrfachresistente/anfällige<br />
Sorten, rot-/weißfleischige<br />
Sorten u. v. m.<br />
Von knapp 30 sorgfältig<br />
ausgewählten<br />
Sorten konnten die<br />
Teilnehmer*innen die<br />
unterschiedlichen Vorund<br />
Nachteile verkosten<br />
– von alten Sorten (z. B.<br />
Cox Orange, Kronprinz Rudolf,<br />
Goldparmäne, Ilzer Rosenapfel) über Hauptsorten<br />
(z. B. Golden Delicious,<br />
Pinova, Gala, Jonagold),<br />
Nebensorten (z. B. Rubinette),<br />
mehrfachresistente<br />
Sorten (z. B.<br />
Remo), rotfleischige<br />
Sorten (z. B. Red<br />
Moon), neue Sorten<br />
(z. B. SweeTango, Natyra,<br />
Red Pop, Rockit)<br />
und schorfresistente<br />
Sorten (z. B. Topaz, Opal).<br />
Die Apfel-Vielfalt ist bemerkenswert – leider<br />
auf dem österreichischen Frischmarkt nicht<br />
ausreichend abgebildet.<br />
»Alles rund um den Käse«<br />
in Wieselburg<br />
22 kg Käse wird im Jahresdurchschnitt pro Person in Österreich<br />
verzehrt. Die Vielfalt des Käseangebots aus Österreich ist so<br />
groß, sodass man jeden Tag im Jahr einen anderen essen könnte.<br />
Dass Grillkäse auf dem Grill bei hohen Temperaturen nicht<br />
schmilzt, hängt von einem gewissen pH-Wert bei der Herstellung<br />
ab. Je feiner der Bruch geschnitten wird, desto härter wird das<br />
Käse-Endprodukt. Diese sowie weitere interessante Fakten verrieten<br />
uns die Käseexpert*innen Martin Rogenhofer und Tanja<br />
Ramharter-Koll vom Lebensmitteltechnologischen Zentrum in<br />
Wieselburg.<br />
Die Teilnehmer*innen der VÖLB-Fortbildungsserie »Gutes aus<br />
Österreich – aus eigener Hand« erhielten am 9. April eine Führung<br />
durch das Technikum – inklusive einer Verkostung von selbst<br />
hergestellten Getränken, wie beispielsweise Energy-Drinks, Alcopops<br />
und Milchersatz-Getränken aus u. a. Hafer – durch die HBLFA<br />
Francisco Josephinum sowie das angrenzende Schloss.<br />
Was ist bei einer Käse-Verkostung zu beachten? Welches Getränk<br />
begleitet welchen Käse am besten? Welche Senf-Saucen werden<br />
üblicherweise bei solch einer Verkostung angeboten? Wie werden<br />
Käse voneinander unterschieden? Und, natürlich, wie schmecken<br />
verschiedene Käse? All diese Fragen wurden im Zuge einer begleiteten<br />
Verkostung zur Zufriedenheit der Teilnehmenden beantwortet.<br />
Vom milden Ziegenkäse über den bereits etwas würzigen<br />
und einzigen »echt österreichischen Mondseer-Käse«, den<br />
»quietschenden« Bier-Käse (Magerkäse), Cheddar, italienischen<br />
Parmesan bis hin zum kräftig-würzigen Blauschimmelkäse<br />
reichte der Bogen verschiedener<br />
verkosteter Weich- und Hartkäse, begleitet<br />
von Weinen – klassischer Grüner Veltliner<br />
bis zur süßen Auslese – und Bieren<br />
– von Pils bis Stammbräu. Auch<br />
wenn für das menschliche Ohr nicht<br />
wahrnehmbar, aber isst man ein<br />
Stück Käse und trinkt dazu den richtigen<br />
Wein, kommt es im Gaumen zu<br />
einer Geschmacksexplosion. Einfach<br />
fantastisch!<br />
10 <strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
VERBÄNDE<br />
Rückblick: <strong>BOKU</strong>-Treff des<br />
Agrarabsolventenverbandes<br />
Text: Benedikt Fritz<br />
Am 12. März fand am Standort Türkenschanze<br />
der <strong>BOKU</strong>-Treff des Agrarabsolventenverbandes<br />
statt. Nach der Begrüßung durch Obmann Hans<br />
Steinwider und Geschäftsführer des Alumnidachverbandes<br />
Ewald Pertlik nahm der ehemalige<br />
Rektor und nunmehrige Präsident der<br />
Christian Doppler Forschungsgesellschaft Martin Gerzabek<br />
die rund 40 Anwesenden mit auf eine Reise durch die letzten<br />
zehn Jahre. Die Bilanz kann sich absolut sehen lassen. So gehört<br />
die <strong>BOKU</strong> University im Bereich der Agrarwissenschaften<br />
mittlerweile zu den weltweit führenden Universitäten<br />
und belegt im QS World University Ranking per subject im<br />
Fachgebiet Land- und Forstwirtschaft den exzellenten 16.<br />
Platz 1 . Berichtet wurde auch über einen Rückgang der Inskriptionszahlen,<br />
dem die zunehmende Konkurrenz durch<br />
agrarische Studiengänge an Fachhochschulen sowie den<br />
demografischen Wandel zugrunde liegt.<br />
Beeindruckend ist hingegen die bauliche Entwicklung der<br />
<strong>BOKU</strong>-Standorte. Neben der Generalsanierung des Gregor-<br />
Mendel-Hauses und dem Neubau des TÜWI-Gebäudes wurde<br />
ein neuer Holzbau westlich des Schwackhöfer-Hauses<br />
errichtet, das Ilse-Wallentin-Haus. Nach einer Besichtigung<br />
dieser Gebäude fand der Abend bei Klängen der Jagdhornbläser*innen<br />
und einem kleinen Umtrunk seinen Ausklang.<br />
1<br />
QS World University Rankings for Agriculture and Forestry 2023 |<br />
Top Universities (https://www.topuniversities.com/universitysubject-rankings/agriculture-forestry)<br />
L. KALCHER<br />
© LFS OBERSIEBENBRUNN<br />
LFS Obersiebenbrunn<br />
Direktor<br />
Arno Kastelliz<br />
ist seit Februar<br />
Direktor der LFS<br />
Obersiebenbrunn.<br />
Nach seinem <strong>BOKU</strong>-Studium<br />
in Pflanzenproduktion,<br />
arbeitete er als Assistent am<br />
damaligen Institut für Pflanzenbau<br />
und Pflanzenzüchtung.<br />
Nach einigen Jahren in der<br />
Qualitätssicherung und Produzentenbetreuung<br />
einer Gemüsegenossenschaft<br />
sammelte er als<br />
Ein- und Verkäufer für Obst und<br />
Gemüse Erfahrung, ehe er 2007<br />
als Lehrer in Obersiebenbrunn<br />
zu unterrichten begann. Seine<br />
nunmehrigen Hauptaufgaben als<br />
Direktor liegen in der zeitgemäßen<br />
Grundbildung zukünftiger<br />
Landwirt*innen und all jener<br />
Berufsfelder, die unter den Begriff<br />
»soziale Dienste« fallen. Eine<br />
große Herausforderung liegt in<br />
der Anstellung neuer Lehrkräfte.<br />
PORR Group<br />
Teamleiter<br />
Straßenbau<br />
Michael<br />
Putsche leitet<br />
seit März das<br />
Team Straßenbau<br />
bei der PORR Steiermark. In seiner<br />
neuen Position koordiniert er den<br />
Straßenbau am Standort Mürzzuschlag.<br />
Anschließend an die HTBLVA<br />
Graz Ortweinschule absolvierte er<br />
das <strong>BOKU</strong>-Studium der Kulturtechnik<br />
und Wasserwirtschaft. Schon<br />
während der Studienzeit war er<br />
regelmäßig bei der PORR Group<br />
und diversen <strong>BOKU</strong>-Instituten als<br />
Praktikant tätig. Nach Abschluss<br />
des Studiums startete er mit der<br />
Arbeit an diversen Tiefbauprojekten<br />
in Graz seinen Werdegang.<br />
Nach einigen Jahren wechselte er<br />
als Bauleiter im Straßenbau zurück<br />
nach Mürzzuschlag. Dort bot sich<br />
ihm zusätzlich die Möglichkeit,<br />
berufsbegleitend den Masterstudiengang<br />
Lean Baumanagement<br />
an der TU Graz zu absolvieren.<br />
EIN-/AUFSTIEG<br />
Merz<br />
Therapeutics<br />
Austria<br />
Geschäftsführer<br />
Nach dem<br />
<strong>BOKU</strong>-Studium<br />
der Lebensmittel- und Biotechnologie<br />
und der Promotion im<br />
Jahr 2000 war Alexander Zach<br />
über 20 Jahre in forschenden<br />
Pharmaunternehmen tätig, mit<br />
Stationen in der Schweiz, Singapur,<br />
Indien und dem Vereinigten<br />
Königreich. Immer unter dem<br />
Motto »Therapeutische Innovationen<br />
aus der Biotechnologie<br />
so schnell wie möglich Patient*innen<br />
zugänglich machen.«<br />
Seit April ist er Geschäftsführer<br />
von Merz Therapeutics Austria<br />
und verantwortet das Pharmageschäft<br />
des deutschen Familienunternehmens<br />
in Österreich<br />
mit dem Schwerpunkt auf der<br />
Erforschung und Behandlung von<br />
neurologischen Erkrankungen.<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
11
DRAUSSEN<br />
Unser Arbeitsplatz Natur<br />
PANNATURA vereint bei Esterhazy die Tätigkeitsbereiche<br />
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz und steht<br />
für umsichtiges Planen und Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit<br />
auf den Flächen im Burgenland. Die natürlichen<br />
Gegebenheiten rund um den Neusiedler See sind mindestens<br />
genauso vielfältig wie die Aufgaben, die dadurch entstehen –<br />
im Wald, am Wasser und am Feld.<br />
Im Sonderjournal „Draußen – Unser Arbeitsplatz Natur“<br />
macht PANNATURA mit persönlichen Erzählungen und<br />
Videos der Mitarbeiter die Tätigkeitsfelder rund um<br />
Land- und Forstwirtschaft spürbar. Daher erzählen Clara,<br />
Steffi und Robert hier von ihren Highlights im<br />
Joballtag bei PANNATURA.<br />
ROBERT<br />
Landwirtschaftlicher Standortleiter<br />
am Bio-Landgut Esterhazy<br />
in Donnerskirchen<br />
„Für einen Landwirt ist es das Schönste, wenn das<br />
Saatgut zu wachsen beginnt und man sieht, dass<br />
man seine Arbeit gewissenhaft erledigt hat und etwas<br />
Wertvolles dabei entsteht. Am Ende des Tages<br />
zählt für mich aber genauso, dass alle Mitarbeiter<br />
wieder gesund vom Feld zurückkommen und der<br />
Arbeitstag noch gemeinsam beendet werden kann.<br />
Wir sind ein junges Team, das sehr freundschaftlich<br />
und auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Deshalb ist<br />
ein gemeinsamer Tagesausklang oft wertvoller als<br />
jedes Meeting, weil wir den Tag Revue passieren<br />
lassen können und so auch dazulernen.“<br />
FLORIAN<br />
Bereichsleiter<br />
Holzlogistik<br />
WOFÜR MACHST DU DIESEN JOB –<br />
WAS SIND DEINE HIGHLIGHTS?<br />
„Mein Aufgabenbereich ist sehr abwechslungsreich<br />
und vielfältig. Kein Tag gleicht dem anderen.<br />
Und: Wir erzeugen bei PANNATURA durch nachhaltige,<br />
forstliche Bewirtschaftung des Waldes einen<br />
der wichtigsten Rohstoffe: Holz. Hierbei durch meine<br />
Arbeit mitwirken zu dürfen, macht mich stolz.“<br />
STEFFI<br />
Forstrevierleiterin<br />
im Burgenland<br />
„Durch meinen Beruf sorge ich für den Schutz des<br />
Waldes und leiste einen wichtigen ökologischen und<br />
gesellschaftlichen Beitrag – das ist für mich der<br />
schönste Aspekt. Das nachhaltige Arbeiten auf den<br />
PANNATURA-Flächen im Sinne des Generationenvertrags<br />
sorgt dafür, dass auch künftige Generationen<br />
die Schönheit und Bedeutung unserer Wälder<br />
noch spüren und erleben können. Es ist gut zu<br />
wissen, dass ich hierbei in meinem Job einen Beitrag<br />
leisten kann.“<br />
Hier geht’s zu den<br />
Videos der Mitarbeiter!<br />
Du möchtest Teil des Teams werden? Dann sieh‘ dich auf<br />
pannatura.at nach der passenden Stelle um! Wir freuen uns<br />
auf dich!<br />
KONTAKT UND BEWERBUNG<br />
Mag. (FH) Kerstin Schmitl-Ohr<br />
+43 2682 63004 134<br />
k.schmitl-ohr@esterhazy.at<br />
12 <strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
INTERVIEW<br />
SAVE THE DATE: Exkursion <strong>2024</strong><br />
Texte: Sebastian Nieß<br />
Auch dieses Jahr lädt der KT-Verband wieder zu seiner jährlichen<br />
Exkursion ein. Heuer besichtigen wir die Renaturierungsmaßnahmen<br />
des Liesingbaches im 23. Wiener Gemeindebezirk mit anschließendem<br />
gemütlichem gemeinsamem Ausklang bei Speis und Trank.<br />
27. SEPT.<br />
Verband der Absolventinnen und<br />
Absolventen der Studien für Kulturtechnik<br />
und Wasserwirtschaft<br />
Fr., 27.9.<strong>2024</strong>, 14:00 Uhr<br />
Ort: Liesingbach (23. Bezirk)<br />
Aus organisatorischen Gründen ist die Anzahl der Teilnehmenden<br />
begrenzt. Nähere Informationen werden in<br />
Kürze auf unserer Homepage www.ktverband.at bekannt<br />
gegeben.<br />
Pilotprojekt »Wissen|schafft|Zukunft«<br />
Das vom Verband mitfinanzierte Pilotprojekt konnte bereits knapp<br />
2.000 Schüler*innen erreichen. Bei 32 verschiedenen Workshops,<br />
Vorträgen und Exkursionen, acht davon im Bereich der Umweltingenieurwissenschaften,<br />
konnten Interessierte Einblicke in innovative<br />
Themenbereiche erlangen.<br />
Sollten Sie als Absolvent*in Interesse haben, mitzuwirken<br />
und Schüler*innen Ihren Arbeitsbereich vorzustellen,<br />
melden Sie sich bei Johannes Ehrlinger unter:<br />
johannes.ehrlinger@boku.ac.at<br />
NEW STANDARD<br />
STUDIO<br />
Creative Concepter<br />
und Copywriter<br />
EIN-/AUFSTIEG<br />
Maria Angerler<br />
studierte im Bachelor<br />
Umwelt- und Bioressourcenmanagement<br />
und absolvierte<br />
im Anschluss einen Master in Nachhaltigkeitsmanagement<br />
am IMC Krems.<br />
Bereits neben dem Studium arbeitete<br />
sie in der Nachhaltigkeitsabteilung<br />
einer österreichischen Bank und<br />
engagierte sich bei CliMates Austria,<br />
bevor es sie vergangenes Jahr zu KPMG,<br />
einer der Big Four, nach Frankfurt in<br />
den Sustainability Audit verschlug. Mit<br />
März ging die berufliche Reise weiter,<br />
diesmal nach Berlin zu NEW STANDARD<br />
STUDIO, einer Agentur für Nachhaltigkeitskommunikation,<br />
-beratung und<br />
Design. In ihrer aktuellen Position als<br />
Creative Concepter und Copywriter<br />
entwickelt sie unter anderem motivierende<br />
Nachhaltigkeitsstrategien und<br />
Kommunikationskonzepte mit Impact<br />
für Unternehmen und Organisationen.<br />
Weitzer<br />
Woodsolutions<br />
Head of<br />
Technical Sales<br />
Mit ausgeprägter<br />
Affinität für die<br />
Themen Wald und<br />
Rohstoff Holz inskribierte Christian<br />
Tippelreither 2005 an der <strong>BOKU</strong> und<br />
absolvierte erfolgreich das Bachelorund<br />
Masterstudium Holztechnologie<br />
und Management. Seine berufliche<br />
Laufbahn startete er 2011 bei der<br />
renommierten DOKA GmbH, wo er<br />
auch eine Führungsposition innehatte.<br />
Nach acht Jahren wechselte er in den<br />
Bereich der Forschung und Innovation<br />
und leitete fünf Jahre lang die Geschäfte<br />
des Holzclusters Steiermark. Seit März<br />
dieses Jahres fungiert er als Head of<br />
Technical Sales bei Weitzer Woodsolutions.<br />
Hier möchte er die Entwicklung<br />
des Werkstoffs Holz in neue Anwendungsfehler<br />
vorantreiben. Besonders<br />
im Fokus steht dabei der Bereich Mobilität,<br />
wo in Zukunft erste serientaugliche<br />
Strukturbauteile für Autos und<br />
Züge aus Holz sichtbar werden sollen.<br />
© HOLZCLUSTER STEIERMARK<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
13
© P. MONIHART<br />
EIN-/AUFSTIEG<br />
Österreichischer<br />
Gemeindebund<br />
Präsident<br />
Johannes Pressl<br />
absolvierte nach<br />
seinem <strong>BOKU</strong>-Studium<br />
der Landschaftsplanung<br />
mit dem Wahlschwerpunkt<br />
Agrarökonomik eine<br />
Weiterbildung zum land- und forstwirtschaftlichen<br />
Berater an der<br />
berufspädagogischen Akademie in<br />
Wien. Später machte er eine Ausbildung<br />
zum Unternehmensberater an<br />
der Akademie für Unternehmensberatung<br />
(AFU). Beruflich stieg Pressl 1995<br />
als Projektleiter in der Mostgalerie<br />
in Stift Ardagger ein. Ein Jahr später<br />
wechselte er als Projektmanager zu<br />
der NÖ.Regional.GmbH im Mostviertel.<br />
Ab 1995 war er Gemeinderat und<br />
Umweltgemeinderat in Ardagger, wo<br />
er schließlich 2005 zum Bürgermeister<br />
gewählt wurde. Im April 2011 wurde<br />
Pressl zum Vizepräsidenten und zehn<br />
Jahre später zum Präsidenten des<br />
Niederösterreichischen Gemeindebundes<br />
gewählt. Seit Februar dieses<br />
Jahres ist er nun auch Präsident des<br />
Österreichischen Gemeindebundes.<br />
Sein Ziel: »Mit Herz und Hirn und mit<br />
starker Stirn sich bestmöglich für die<br />
Interessen der Gemeinden einzusetzen<br />
und den Lebensraum der Bürger*innen<br />
so gut es geht zu gestalten.«<br />
Saatzucht Gleisdorf<br />
GmbH<br />
Geschäftsführer<br />
Jakob Moser ist seit<br />
März Geschäftsführer<br />
der Saatzucht<br />
Gleisdorf GmbH.<br />
Der Obersteirer absolvierte 2014 das<br />
Masterstudium Angewandte Pflanzenwissenschaften<br />
an der <strong>BOKU</strong><br />
University. Berufliche Erfahrung<br />
sammelte er sowohl national als auch<br />
international beim Maschinenring<br />
Steiermark, der Bauer GmbH und<br />
TIMAC AGRO. Die Saatzucht Gleisdorf<br />
züchtet seit 1948 Kulturpflanzen an<br />
steirischen Standorten mit Winterzuchtgärten<br />
in Chile, Mexiko sowie<br />
Teneriffa und ist Weltmarktführer<br />
in der Züchtung von Ölkürbis.<br />
Grußworte der neuen<br />
Vereinsleitung<br />
Liebe Alumni,<br />
die Stelle der ÖGLA-Vereinsleitung<br />
wurde neu besetzt, und ich<br />
freue mich sehr, euch in dieser<br />
Rolle hier begrüßen zu dürfen.<br />
Mein Name ist Konstantin Heidler.<br />
Ich bin Landschaftsarchitekt, 32 Jahre<br />
alt, und durfte bisher bei Studio Vulkan in<br />
Zürich, bei bauchplan in Wien, und bei fabulism in<br />
Berlin mitarbeiten. Nun bin ich sehr glücklich, Teil des Berufsverbandes<br />
zu sein, um einen Beitrag zur Förderung der Landschaftsarchitektur<br />
und -planung in Österreich leisten zu können.<br />
Liebe Grüße,<br />
Konstantin Heidler<br />
Österreichische Gesellschaft<br />
für Landschaftsarchitektur<br />
Neue zoll+ im Oktober<br />
Text: Konstantin Heidler<br />
Die nächste Ausgabe der zoll+ erscheint im Oktober <strong>2024</strong> und<br />
beschäftigt sich mit dem Thema »Vielfalt«. Das Heft gibt Raum<br />
für interessante Artikel zu Artenvielfalt, Gendervielfalt, Vielfalt in<br />
der Branche und andere diverse Bereiche. Wir werden auch eine<br />
bunte Palette an Projekten vorstellen.<br />
Du fühlst dich angesprochen und würdest gerne deine<br />
Ideen und Ansätze mit uns teilen? Arbeite mit und<br />
vergrößere den Blickwinkel auf die Vielfalt dieses spannenden<br />
Heftes mit deiner Kreativität! Melde dich unter<br />
office@zollplus.org für mehr Informationen!<br />
14<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
EIN-/AUFSTIEG<br />
SAVE THE DATE!<br />
15. & 16. November<br />
20 Jahre Masterstudium<br />
Wildtierökologie und<br />
Wildtiermanagement<br />
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums möchten wir gemeinsam<br />
feiern! Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erwartet<br />
unsere Besucher*innen.<br />
TAG<br />
1<br />
TAG<br />
2<br />
AUFRUF:<br />
15. November <strong>2024</strong><br />
Exkursion – Allentsteig<br />
Truppenübungsplatz (NÖ)<br />
07:30 Treffpunkt, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180<br />
Wien<br />
08:00 Abfahrt<br />
20:00 Rückkehr<br />
16. November <strong>2024</strong><br />
Wildtierökologie Tagung<br />
Festsaal, Gregor-Mendel-Straße 33, 3. Stock<br />
Agenda – Änderungen vorbehalten<br />
10:00 Beginn<br />
Impulsvorträge – Informationen folgen<br />
12:30 Mittagspause<br />
13:30 Festreden – Informationen folgen<br />
17:00 Ende der Veranstaltung<br />
Ab<br />
18:00 Ausklang bei einem gemeinsamen<br />
Abendessen<br />
Buschenschank Fuhrgassl-Huber<br />
(Neustift am Walde 68, 1190 Wien)<br />
An alle Absolvent*innen<br />
Falls Sie Interesse haben, einen Impulsvortrag zu halten,<br />
melden Sie sich bitte bis 30.9.<strong>2024</strong> bei Jennifer Hatlauf<br />
unter jennifer.hatlauf@boku.ac.at<br />
ILLUSTRATION: M. MEDVEY<br />
Stadt Wien –<br />
Wiener Wohnen<br />
Kundenservice<br />
GmbH<br />
Abteilungsleiterin<br />
Befund Grünanlagen<br />
Filipa Rajic absolvierte<br />
das Masterstudium der Landschaftsplanung<br />
& -architektur. Schon<br />
während des Studiums arbeitete sie<br />
im Bereich der Dachbegrünung. Nach<br />
dem Abschluss bot sich der Einstieg<br />
in die Baubranche, wo sie sechs Jahre<br />
im Projekt- und Qualitätsmanagement<br />
tätig war. Seit bereits sieben Jahren<br />
arbeitet Rajic bei der Stadt Wien –<br />
Wiener Wohnen Kundenservice<br />
GmbH. Ihre Tätigkeiten umfassten<br />
bisher die Bereiche Qualitäts-, Prozess-<br />
und Projektmanagement bis hin<br />
zu Schulungen. Bis vor Kurzem leitete<br />
sie die Abteilung Abrechnungskontrolle,<br />
bis sie im April in die Leitung<br />
der Abteilung Befund Grünanlagen<br />
wechselte. Diese ist zuständig für<br />
die Organisation von Baum- und<br />
Spielplatzkontrollen sowie zum Teil<br />
auch für erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen<br />
von Spielplätzen<br />
der Wiener Wohnen Anlagen.<br />
OMV Aktiengesellschaft<br />
Senior Expert Microbial<br />
Cell Technology<br />
Hannes<br />
Rußmayer<br />
hat 2015 das<br />
Doktorat der Bodenkultur im Fachbereich<br />
Biotechnologie abgeschlossen.<br />
Seine berufliche Laufbahn startete<br />
er im selben Jahr als Postdoc im<br />
Christian Doppler Labor für Glycerin<br />
Biotechnologie. Danach war er von<br />
2021 bis <strong>2024</strong> als Senior Scientist im<br />
Start-up FermX tätig. Seit März ist<br />
er als Senior Expert Microbial Cell<br />
Technology bei der OMV Aktiengesellschaft<br />
angestellt, wo seine<br />
Hauptaufgabe die Implementierung<br />
von mikrobiellen Prozessen für<br />
die Produktion von nachhaltigen<br />
Chemikalien und Biotreibstoffen ist.<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
15
VERBÄNDE<br />
Österreichischer ForstakademikerInnen<br />
Verband<br />
Neues von den ForstAlumni<br />
Text: Jana Pirolt<br />
Im Herbst 2023 fand die 18. Generalversammlung des Verbandes<br />
in Reichenau an der Rax statt. Neben dem Rückblick<br />
auf vergangene Aktivitäten wurden zukünftige Verbandsagenden<br />
besprochen. Die Exkursion führte die Teilnehmenden<br />
auf die Waldbrandfläche in Hirschwang. An dieser Stelle<br />
möchte sich der Verband nochmals für die interessante<br />
Exkursion bei der Forstverwaltung Quellenschutz der Stadt<br />
Wien bedanken.<br />
Im Zuge der Hauptausschusssitzung im Dezember 2023<br />
in den Räumlichkeiten der Land&Forst Betriebe Österreich<br />
wurde Reinhard Ribitsch, Präsident des Vereins der<br />
Diplomingenieure der Wildbach- und Lawinenverbauung,<br />
als neues Hauptausschussmitglied sowie die neue Schriftführerin<br />
Jana Pirolt begrüßt.<br />
Besonders erfreulich ist die Neugestaltung der Homepage<br />
und des Logos des Verbandes. Unter www.forstalumni.at<br />
kann die aktualisierte Website erkundet werden.<br />
1<br />
Im Jänner startete der Verband ins neue Jahr mit einem<br />
spannenden Vortrag über die Forstwirtschaft in Südosteuropa<br />
von dem renommierten Referenten und Forstrechtsexperten<br />
Christian Brawenz.<br />
Zahlreiche Teilnehmer*innen fanden den Weg zur Veranstaltung<br />
an die <strong>BOKU</strong> und beteiligten sich im Anschluss an<br />
der regen Diskussion. Wir bedanken uns herzlich beim Referenten<br />
sowie bei Ewald Pertlik für die Organisation und<br />
freuen uns auf weitere kommende Veranstaltungen.<br />
1) Stefan Spinka (rechts) begutachtet eine Karte des Waldbrandbereichs in<br />
Hirschwang 2) Beim Gastvortrag, v. l. n. r.: Marco Lassnig, Ewald Pertlik,<br />
Renate Haslinger, Christian Brawenz, Stefan Spinka 3) v. l. n. r.: Stefan<br />
Spinka, Peter Mayer, Gerald Dirnberger, Marco Lassnig<br />
2<br />
3<br />
16 <strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
VERBÄNDE<br />
Absolventenverband von Holzwirtschaftern, Holztechnologen und<br />
Naturfasertechnologen an der Universität für Bodenkultur Wien<br />
SAVE THE DATES!<br />
Alle VHÖ-Mitglieder und jene, die es noch werden wollen,<br />
können sich für diesen Herbst bereits diese Termine vormerken:<br />
Text: Lena Maria Leiter<br />
1<br />
18.–19. Oktober <strong>2024</strong><br />
Exkursion nach Oberösterreich<br />
Von 18. bis 19. Oktober ist unsere nächste holzwirtschaftliche<br />
Exkursion geplant. Obwohl der Termin noch nicht fixiert<br />
ist, darf er bereits im Kalender notiert werden. An beiden Tagen<br />
werden sowohl fachlich als auch kulturell Interessierte<br />
mit Sicherheit auf ihre Kosten kommen. Das genaue Programm<br />
steht noch nicht fest, wird den Mitgliedern<br />
jedoch zeitnah bekannt gegeben. Mögliche<br />
Exkursionspunkte sind unter anderem das<br />
Sperrholzwerk Schweitzer, der Möbelhersteller<br />
Team7, Smurfit Kappa Nettingsdorf<br />
oder auch der bekannte Baumwipfelpfad<br />
im Salzkammergut.<br />
2<br />
15. November <strong>2024</strong><br />
VHÖ-Vollversammlung<br />
Die diesjährige Vollversammlung<br />
wird am Freitag, den 15. November,<br />
in Wien stattfinden. Mit der<br />
Holzausstellung im Technischen<br />
Museum wird es davor auch wieder<br />
ein kulturelles Programm<br />
geben. Genauere Informationen<br />
folgen.<br />
EIN-/AUFSTIEG<br />
© DACHVERBAND FÜR NATUR- UND UMWELTSCHUTZ<br />
Dachverband<br />
für Natur- und<br />
Umweltschutz<br />
Geschäftsführer<br />
Hanspeter<br />
Staffler absolvierte<br />
das Studium der<br />
Forstwirtschaft an der <strong>BOKU</strong> University.<br />
Nach einem kurzen Aufenthalt bei<br />
der Südtiroler Forstbehörde wechselte<br />
er 1996 zum Ingenieurbiologischen<br />
Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung,<br />
wo er 2002 die Gebietsbauleitung<br />
Süd übernahm. Fünf Jahre<br />
später wurde Staffler an die Spitze des<br />
Bevölkerungsschutzes und 2014 zum<br />
Generaldirektor der Landesverwaltung<br />
berufen. Im Zuge seiner politischen<br />
Laufbahn gelang ihm 2018 der Sprung<br />
in den Landtag, dessen Wiederwahl<br />
er im vergangenen Herbst knapp<br />
verpasste. Nun verschlägt ihn seine<br />
neue Position als Geschäftsführer<br />
des Dachverbandes für Natur- und<br />
Umweltschutz »back to the roots«,<br />
wo er sich wieder mit ökologischen<br />
Themen befassen darf, welche Staffler<br />
bereits seit der Studienzeit faszinieren.<br />
Land&Forst<br />
Betriebe<br />
Österreich<br />
Generalsekretär<br />
Martin Kubli<br />
studierte an der<br />
<strong>BOKU</strong> University Forstwissenschaften.<br />
Schon in jungen Jahren<br />
engagierte er sich in zahlreichen<br />
ehrenamtlichen Funktionen rund<br />
um die Land- und Forstwirtschaft,<br />
z. B. als Bundesleiter der Landjugend<br />
Österreich. Beruflich konnte<br />
er sich bei der Kooperationsplattform<br />
»Forst Holz Papier« (FHP)<br />
und PEFC Austria in der Branche<br />
beweisen und die Wertschöpfungskette<br />
der Forst- und Holzwirtschaft<br />
kennenlernen und mitentwickeln.<br />
Seit Februar führt er als Generalsekretär<br />
den Verband der Land&-<br />
Forst Betriebe Österreich mit Sitz<br />
in Wien, dessen Mitglieder ca.<br />
1,6 Mio. Hektar in der Land- und<br />
Forstwirtschaft bewirtschaften.<br />
LFS Hollabrunn<br />
Direktor<br />
Stefan Amon<br />
wurde mit April<br />
zum Direktor der<br />
LFS Hollabrunn<br />
ernannt. Der<br />
Josephiner inskribierte 2009 an der<br />
HAUP für Lehramt und 2010 an der<br />
<strong>BOKU</strong> University für Agrarwissenschaften.<br />
Zeitgleich begann er bereits<br />
als Lehrer an der LFS Hollabrunn<br />
zu unterrichten, wobei er das<br />
<strong>BOKU</strong>-Masterstudium Angewandte<br />
Pflanzenwissenschaften berufsbegleitend<br />
absolvierte. An der LFS<br />
baute er die hauseigene Fahrschule<br />
für den Traktorführerschein auf,<br />
war sieben Jahre lang als Administrator<br />
tätig und bekleidete danach<br />
die Funktion des Abteilungsvorstands<br />
für die Abteilung Landwirtschaft<br />
mit Weinbau. Im landwirtschaftlichen<br />
Fachschulwesen war er<br />
als Fachkoordinator für Landtechnik<br />
und Digitalisierung im Einsatz.<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
17
INTERNATIONAL ALUMNI – INTERVIEW<br />
We need to plug the leaks!<br />
After completing her studies in Water Management and Environmental Engineering at <strong>BOKU</strong><br />
University, Marion Liemberger traveled across the globe developing her knowledge in global water<br />
management. Now, she reflects on her professional journey, sharing insights into her passion<br />
for water engineering and discussing the challenges she's encountered while emphasizing the<br />
importance of sustainable practices in addressing global water issues.<br />
Interview: Natalia Lagan, Dorottya Bazso<br />
Construction supervision of reservoir tanks in rural Nepal,<br />
Austrian Red Cross with Nepal Red Cross, May/June 2019<br />
Was living and working abroad<br />
always part of your career plan?<br />
One of the reasons I chose the English<br />
Master’s program was because<br />
I knew I was going to work abroad. I<br />
have always been a »free bird« wanting<br />
to go somewhere. My father was<br />
an international consultant, so I grew<br />
up familiar with this lifestyle.<br />
Where does your fascination for<br />
water and engineering come from?<br />
My father has spent all his life working<br />
in water, so it was something that<br />
I was very familiar with. Because he<br />
studied at <strong>BOKU</strong> I had always heard<br />
many good things about the university.<br />
After graduating from a technical<br />
high school for mechanical engineering,<br />
I took a gap year to figure out what<br />
I wanted. My father helped me get an<br />
internship with the local water utility<br />
in Uganda and it got me interested<br />
in water supply. After returning, I remember<br />
sitting in my grandmother’s<br />
living room, watching the news about<br />
a tremendous earthquake that hit<br />
Haiti in 2010. The Austrian Red Cross<br />
provided emergency supplies, and<br />
I thought, »I want to do that! This is<br />
cool!« Being a people person, I always<br />
wanted to do something meaningful<br />
for society. I couldn’t imagine being a<br />
doctor, architect, or farmer, but water<br />
seemed cool.<br />
What have been the highlights and<br />
challenges of your career so far?<br />
In 2015, an earthquake in Nepal disrupted<br />
the water supply schemes.<br />
The Austrian Red Cross helped<br />
rebuild them, and returning in<br />
2020 and seeing the progress was<br />
mind-blowing. The coolest thing was<br />
seeing everyone able to open a tap<br />
and access fresh water in a small village<br />
with maybe 15 houses, where<br />
people had to cross a busy street<br />
to fetch water. This was definitely<br />
one of the highlights of my career. A<br />
major challenge was moving to Brazil<br />
in the middle of the pandemic to<br />
manage a large wastewater project<br />
involving over 75 km of pipes and<br />
20 pumping stations. It was tough<br />
because even though I speak Portuguese,<br />
I had to learn the technical<br />
terms quickly. It was very challenging<br />
but also a fun experience that<br />
nobody can take away from me.<br />
18<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
INTERNATIONAL ALUMNI – INTERVIEW<br />
Follow-up mission to Nepal, January 2020<br />
What brought you back to Europe?<br />
I left Brazil at the end of 2023 to join<br />
Ramboll. It is a global engineering<br />
consultancy with its head office in<br />
Copenhagen, Denmark. A professional<br />
friend, Cor Merks, asked me to<br />
help him build a designated team at<br />
Ramboll focusing on water loss projects<br />
worldwide. Now, we are building<br />
a new young team in order to tackle<br />
water losses in water distribution<br />
networks. I want to implement an internship<br />
program, particularly in our<br />
field, to start training young people<br />
early to have a long-lasting impact.<br />
Currently, I work independently with<br />
the guidance of experts, which is exactly<br />
what we need: independence<br />
and our voices to be heard instead<br />
of just following what the seniors<br />
say. I enjoy my working environment<br />
because you feel included, and your<br />
opinions matter.<br />
Do you plan to stay in Denmark<br />
long-term?<br />
Denmark is a great place to be. I very<br />
much enjoy the work culture and my<br />
current role in the company. Therefore,<br />
I see no reason to leave, but<br />
you can never say never. Travel will<br />
always be part of my work and will<br />
Collecting water samples in rural northern<br />
Uganda, November 2019<br />
continue to be so. I love going on<br />
work missions, getting a real feeling<br />
of the situation on-site and the people<br />
involved. However, it is important<br />
to have a base somewhere. I have<br />
found a great community at Ramboll<br />
with fantastic colleagues who made<br />
me feel welcome from day one.<br />
What is your main focus with water<br />
management?<br />
I never got to participate in an emergency<br />
response like those I saw on<br />
the news, but I prioritize building<br />
lasting solutions, particularly in water<br />
loss reduction, which is very important<br />
to me. It is so simple: If you have<br />
leaking pipes, you fix them. In theory,<br />
reducing leakage could supply up to 2<br />
billion people with drinking water. It<br />
is such a logical work field, but politicians<br />
tend to invest in more »visible«<br />
projects that they can take pictures<br />
of. They will not take a picture of a<br />
fixed pipe buried underground. That<br />
is the reality. It may be simple and<br />
common sense, but people usually<br />
do what looks good, gets votes, and<br />
can be sold. Although with increasing<br />
stress on water resources and water<br />
scarcity we see more work being<br />
done to address water losses.<br />
How significant is the issue of<br />
water loss on a global scale?<br />
Very. Global water losses are estimated<br />
to be 126 billion cubic meters per<br />
year. It's everywhere, though some<br />
countries manage it better than others.<br />
For instance, the Netherlands<br />
has to treat its groundwater extensively<br />
due to its poor quality, making<br />
any loss costly. Losing water would be<br />
like taking money and throwing it in<br />
the trash bin. Another issue that has<br />
been overlooked for years is that water<br />
utilities are the biggest customers<br />
of energy companies. We use it for<br />
everything, which brings us to consider<br />
its carbon footprint as an environmental<br />
problem. We could reduce<br />
all of this by just fixing the leaks. That<br />
would be amazing.<br />
Do you consider water loss one of<br />
the biggest challenges in water<br />
management?<br />
Yes, mainly because water loss is<br />
connected to so many other issues.<br />
Reducing leakage can mitigate blackouts<br />
by decreasing energy consumption,<br />
creating a domino effect of benefits.<br />
This is why we are developing<br />
an international framework for water<br />
loss reduction. There's a leakage<br />
emission initiative that started two<br />
years ago, led by this fantastic guy in<br />
the U.S., Steve Cavanaugh. Together,<br />
we are trying to build a database of<br />
water loss reduction projects and<br />
case studies to present to organizations<br />
like the World Bank, showing<br />
their value as climate change investments.<br />
Although, of course, every<br />
country would require a separate<br />
approach depending on their needs.<br />
Personally, I do not care about the<br />
countries’ motives; I care about the<br />
water that gets saved and providing<br />
better water quality.<br />
How can water quality<br />
be improved?<br />
If you have a leak, water escapes,<br />
but dirt can also enter the pipes. As<br />
long as the water flows at a constant<br />
speed and maintains enough pressure,<br />
dirt is unlikely to get in. However,<br />
when water is limited, the water<br />
supply often gets turned off at night,<br />
and empty pipes can fill with dirt. Investing<br />
so much money and energy in<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
19
water treatment without guaranteeing<br />
safe drinking water quality really<br />
frustrates me, especially when people<br />
don’t recognize its importance. I<br />
like the social impact of my work. I'm<br />
a great project manager. I enjoy conveying<br />
the importance of water, which<br />
ties everything together socially and<br />
environmentally, even if the public<br />
doesn’t always »see« its impact.<br />
This industry may not be well-paid,<br />
but you don’t work in water for the<br />
money; you do it because you care.<br />
Connecting people to fresh water by<br />
reducing loss is incredibly rewarding.<br />
How do you see the future of water<br />
engineering and potential new<br />
challenges?<br />
The world is challenged by climate<br />
change, and water shortages will<br />
likely increase. We will need to make<br />
our systems more resilient. Dealing<br />
with water shortages will cause future<br />
political conflicts and migration<br />
waves, especially if one state runs low<br />
on drinking water while another has<br />
plenty. We will need to include other<br />
industries and have better dialogues,<br />
like agriculture and energy that rely<br />
on water. Working closely together<br />
and collaborating will help us face<br />
many future challenges.<br />
What are your interests outside of<br />
work?<br />
Two years ago, I was selected to be<br />
a Young Water Professional on the<br />
management team of the International<br />
Water Association (IWA) and I<br />
hope to be selected for another two<br />
years. Organizing events in my free<br />
time, though unpaid, is fulfilling. I am<br />
trying to get younger people involved<br />
in this field, especially women. At the<br />
Water Loss <strong>2024</strong> Conference in Spain,<br />
there were no women on the panel<br />
discussion. The worst thing is that<br />
most attendees didn’t even notice.<br />
How could anyone not notice this?<br />
In two years, the conference will be<br />
held in Rio, Brazil, as we try to attract<br />
different crowds by holding it in various<br />
locations. I am excited to return<br />
there, and other female engineers<br />
and I are planning to ensure more<br />
women are represented on stage. In<br />
addition to the water world, I enjoy<br />
traveling, doing sports, and spending<br />
time with friends and family.<br />
Excursion to the Brennerbasistunnel<br />
construction site organised by the Austrian<br />
Young Water Professionals, May 2023<br />
How do you cope with cultural<br />
differences when working<br />
internationally?<br />
It depends on the location, but you<br />
have to be very open and understanding<br />
of the local culture. You need to<br />
accept that you can’t change stereotypes<br />
and gender norms, or you will<br />
get frustrated. In Denmark, it’s easier<br />
because it’s Europe, but Uganda was<br />
challenging. People often stared at me<br />
because I looked different, which can<br />
be uncomfortable. It’s all about adaptation.<br />
You can’t force your perspective<br />
on others; different cultures have<br />
their own valid ways of living.<br />
Would you recommend gaining<br />
work or study experience abroad?<br />
It’s not for everyone. Some people<br />
prefer staying in their home base.<br />
However, in the water sector, joining<br />
the Young Water Professionals<br />
is beneficial. In Austria, they meet<br />
every two months and sometimes<br />
organize workshops with German or<br />
Czech groups. While living abroad is<br />
not for everyone, I encourage people<br />
to be open to trying new things.<br />
Students can start with Erasmus –<br />
which is fantastic! I did an exchange<br />
semester in Spain, learned the language,<br />
adapted, and became more<br />
perceptive. It took me longer to finish<br />
my studies, but I gained incredible<br />
experience. Life is long; spending an<br />
extra year at university to enjoy it is<br />
worthwhile.<br />
Did you enjoy your time at <strong>BOKU</strong>?<br />
<strong>BOKU</strong> is awesome, the best university!<br />
What I love most about <strong>BOKU</strong><br />
is that they teach you to connect<br />
everything to the environment, which<br />
I still benefit from a lot. For example,<br />
when building a dam, I also consider<br />
the aquatic system and ecology. I enjoyed<br />
the excursions and hands-on<br />
practical work. This is something that<br />
makes <strong>BOKU</strong> stand out. Of course,<br />
you have to study the theory, but you<br />
also get a lot of practice. I was not the<br />
go-to-every-class kind of student, but<br />
<strong>BOKU</strong>’s flexibility allowed me to take<br />
exams when I felt ready. You learn<br />
how to be independent and plan your<br />
own time – definitely required skills<br />
for project management.<br />
Did you build a good network with<br />
teachers and students at <strong>BOKU</strong>?<br />
Yes, I did. I am still in contact with a<br />
few former colleagues. You naturally<br />
lose some friends when you leave<br />
a country, but I still talk to my thesis<br />
supervisor, Günter Langergraber, and<br />
Thomas Ertl from SIG. They sometimes<br />
message me on LinkedIn when<br />
they find something interesting. I<br />
also often meet people from <strong>BOKU</strong><br />
through work and projects.<br />
What is your life motto?<br />
Live your life. Go for it. Don’t wait for<br />
things to happen. Don’t push things<br />
to a later stage. If you want them, do<br />
them. If you fail, you fail. That’s fine.<br />
But don’t just wait for opportunities<br />
to arise. Be you. Be a great person.<br />
Respect others. Just go for it. •<br />
Marion Liemberger graduated in<br />
November 2018 and obtained a double<br />
degree from <strong>BOKU</strong> University in Water<br />
Management and Environmental Engineering<br />
and from Cranfield University<br />
(UK) in Community Water and Sanitation.<br />
She started her professional career at<br />
the Austrian Red Cross as a safe drinking<br />
water, sanitation and hygiene (WASH) delegate<br />
in Nepal and Rwanda. Afterwards,<br />
she moved to Uganda for six months to<br />
work for an energy start-up, followed by<br />
another mission back to Nepal. In 2021,<br />
Liemberger moved to Brazil where she<br />
worked as a project manager for wastewater<br />
projects for almost three years. At<br />
the beginning of <strong>2024</strong>, she returned to<br />
Europe to take on a position as a consultant<br />
for water loss reduction at Ramboll in<br />
Copenhagen.<br />
20<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
SPLITTER<br />
<strong>BOKU</strong>-PROFESSOREN<br />
RÄTSEL<br />
WER BIN ICH?<br />
48 Jahre ist es nun her,<br />
mein erster Tag an der <strong>BOKU</strong>.<br />
Woanders hin? Nein, nie mehr!<br />
Stammend aus einer Försterfamilie<br />
der Forsttechnik verschrieben<br />
Und mein ganzes Leben<br />
einfach an der <strong>BOKU</strong> geblieben.<br />
Die Feldübungen mit den Studierenden,<br />
die waren stets mein Jahreshighlight!<br />
In universitären Gremien viel vertreten,<br />
was für eine spannende Zeit.<br />
Vier Jahre ins Ausland gependelt, hier und da!<br />
Errätst du, wer ich bin? – Ist doch glasklar!<br />
NEUES VON DER <strong>BOKU</strong> UNIVERSITY<br />
Das Institut für Biologisch Inspirierte Materialien<br />
ist nun das…<br />
Institut für Kolloid- und Biogrenzflächenforschung (IKB)<br />
Institute of Colloid and Biointerface Science (ICBS)<br />
SeedWorld<br />
Die 20 einflussreichsten<br />
Frauen in der Pflanzenzüchtung<br />
und Saatgutwirtschaft<br />
2023 in der EU<br />
Im März veröffentlichte SeedWorld<br />
erneut eine Liste der »20 Most Influential<br />
Women in the EU Seed Sector in 2023«. Darunter ist<br />
<strong>BOKU</strong>-Alumna Franziska Löschenberger. In ihren 32 Jahren<br />
in der Saatgutforschung war sie für die Züchtung von über<br />
120 Winterweizen-Sorten zuständig.<br />
J. UCKERMANN<br />
Wir gratulieren!<br />
ABB. SYMBOLISCH<br />
Sie wissen, um welchen <strong>BOKU</strong>-Lehrenden es sich handelt?<br />
Dann schicken Sie uns bis 4. Juli eine E-Mail mit<br />
Ihrer Antwort an alumnimagazin@boku.ac.at. Unter<br />
den richtigen Antworten werden drei <strong>BOKU</strong>-Kappen mit<br />
neuem Logo verlost.<br />
Auflösung aus der Dezember-Ausgabe: Margit Laimer, Institut für<br />
Molekulare Biotechnologie<br />
Foto: AdobeStock<br />
Check our open<br />
positions now!<br />
ZUM NACHLESEN:<br />
SN.AT, 28. MÄRZ<br />
Forschung mit<br />
Herzblut – Mehr<br />
als 30 Jahre für die<br />
Wissenschaft<br />
Über drei Jahrzehnte forschte und leitete HNT-Alumnus<br />
Manfred Brandstätter die Holzforschung Austria (HFA).<br />
Im Gespräch mit holzbau austria lesen Sie über seine<br />
Leidenschaft für den Holzbau, den Rohstoff Holz sowie<br />
deren Zukunftspotentiale.<br />
HFA<br />
YOUR<br />
DEVELOPMENT<br />
@SAN GROUP<br />
We are the place to be for interns, young professionals,<br />
and experienced professionals in the fields of<br />
■ Agricultural sciences<br />
■ Crop protection<br />
■ Plant Sciences<br />
■ Veterinary medicine<br />
■ Microbiology<br />
■ Biotechnology<br />
■ (Bio)Chemistry<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 www.san-group.com<br />
– 06/24<br />
21
SPLITTER<br />
TULLN<br />
Auszeichnung der besten Studienleistung<br />
Text: Susanne Stöhr-Eißert<br />
Im Rahmen des 22. <strong>BOKU</strong>-Symposiums »Tierernährung« am IFA-Tulln am<br />
29. Februar wurde der Preis der H. Wilhelm Schaumann Stiftung 2023 für<br />
die beste Studienleistung am Gebiet Tierernährung in Höhe von 500 € an<br />
Florentine Kranzler (im Bild mit Martin Gierus) verliehen. Ihre ausgezeichnete<br />
Masterarbeit beschäftigt sich mit der »Methodenentwicklung,<br />
Anwendung und Ergebnisauswertung des Laser Methan Detektors zur<br />
Messung des Methanausstoßes bei Milchrindern«. Der Preis wurde feierlich<br />
vom Betreuer und Leiter des Instituts für Tierernährung, Tierische<br />
Lebensmittel und Ernährungsphysiologie (TTE) Martin Gierus überreicht.<br />
<strong>BOKU</strong> | TTE<br />
LEHRFORST ROSALIA<br />
Projektstart »Am<br />
Puls der Natur«<br />
Text: Eugenio Diaz-Pines<br />
HOLTERMANN HOLTERMANN<br />
Die Modernisierungs- und Digitalisierungsarbeiten<br />
im Rahmen des vom<br />
BMBF geförderten Projekts »Am Puls<br />
der Natur« am Lehrforst Rosalia sind<br />
schon in vollem Gange. Im Frühling<br />
wurden knapp zwei Kilometer Stromund<br />
Glasfaserkabel im Wald verlegt,<br />
um zahlreiche Monitoring-Stationen<br />
digital zugänglicher zu machen. Das ermöglicht,<br />
ökologische Beobachtungen<br />
zu wichtigen Ökosystemparametern in<br />
Echtzeit aufzuzeichnen und abzurufen.<br />
Zudem wird der Datentransfer nun<br />
auch automatisiert, um die Übertragung<br />
von erfassten Datensätzen in das<br />
eLTER-Netzwerk (European Long-Term<br />
Ecosystem Research) zu erleichtern.<br />
Im Rahmen des Projekts wird auch an<br />
langfristigen Klimawandelmanipulationen<br />
geforscht, um die Auswirkungen<br />
auf Ökosysteme unter veränderten<br />
Umweltbedingungen zu verstehen und<br />
vorhersagen zu können. Durch den<br />
Einsatz neuer Instrumente und automatisierter<br />
Erfassungssysteme werden<br />
kontinuierlich hochauflösende Messungen<br />
des Treibhausgasaustausches<br />
zwischen Biosphäre und Atmosphäre<br />
erfasst.<br />
22 <strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
SPLITTER<br />
Reptil des<br />
Jahres <strong>2024</strong>:<br />
Die Kreuzotter<br />
Vipera berus<br />
Text: Lukas Landler<br />
E. ZILLNER | <strong>BOKU</strong><br />
Winterweizen in Begleitsaat mit Winterackerbohne im November 2023<br />
ILLUSTRATION: M. MEDVEY<br />
VERSUCHSWIRTSCHAFT GROSS-ENZERSDORF<br />
Projekt »Vielfaltsaaten«<br />
Text: Pia Euteneuer<br />
Die Fruchtfolge wurde in den letzten Jahrzehnten oft vereinfacht und konzentriert<br />
sich hauptsächlich auf einige wenige Kulturen, wie Weizen, Gerste<br />
und Mais. Dies kann sowohl die Biodiversität als auch die Widerstandsfähigkeit<br />
des Ackerbausystems beeinträchtigen. Das Projekt »Vielfaltsaaten«<br />
an der <strong>BOKU</strong>-Versuchswirtschaft zielt darauf ab, die Landwirtschaft<br />
nachhaltiger zu gestalten, indem es Begleitpflanzen, insbesondere Leguminosen,<br />
gemeinsam mit den Hauptkulturen anbaut. Begleitbepflanzung<br />
kann dazu beitragen, dass Nährstoffe für die Hauptkulturen bereitgestellt<br />
und gleichzeitig Umweltprobleme wie Nitratauswaschungen minimiert<br />
werden. Darüber hinaus können diese Begleitpflanzen Biodiversität und<br />
Regenwürmer fördern, die für die Erhaltung der Bodenqualität und zur<br />
Resilienz des Ackerbausystems beitragen. Das Projekt läuft seit Oktober<br />
2023 für vier Jahre und innerhalb einer Fruchtfolge werden verschiedene<br />
Parameter erhoben: Bodenfeuchtigkeit, Stickstoffgehalt, Nitratauswaschung,<br />
Ernteertrag und das Vorkommen von Regenwürmern. Durch die<br />
Untersuchung der Auswirkungen von Begleitpflanzen und verschiedenen<br />
Düngemethoden strebt das Projekt an, eine Möglichkeit zu schaffen, nicht<br />
nur effizient zu produzieren, sondern auch die Umwelt zu schützen und<br />
sich den Herausforderungen des Klimawandels in der Region anzupassen.<br />
? Pflanzennährstoffe<br />
Bodendeckung<br />
Regenwürmer<br />
Ertrag<br />
Herbst 23 Frühjahr 24 Ernte 24 Herbst 24 Frühjahr 25 Ernte 25 Herbst 25 Frühjahr 26 Ernte 26 Herbst 26 Frühjahr 27 Ernte 27 Herbst 27<br />
? ?<br />
?<br />
?<br />
WEIZEN<br />
?<br />
RAPS<br />
KEY MILESTONES<br />
?<br />
?<br />
?<br />
WEIZEN<br />
?<br />
?<br />
?<br />
RAPS<br />
Während noch um 1900<br />
vielerorts Fanggeld für<br />
tote Kreuzottern gezahlt<br />
wurde, sind sie heute streng<br />
geschützt und in Österreich als<br />
gefährdet eingestuft. Ein heimisches<br />
Refugium für diese schönen<br />
Schlangen sind die Alpen, wo sie<br />
weit verbreitet angetroffen werden<br />
können. Auf Grund ihrer scheuen<br />
Lebensweise bekommen Wandernde<br />
sie dennoch selten zu Gesicht,<br />
am ehesten noch beim Sonnen an<br />
exponierten Stellen. Als Anpassung<br />
an kältere Umgebungen – im Gebirge<br />
aber auch in ihrem nördlichen<br />
Verbreitungsgebiet, das bis nach<br />
Finnland reicht – verbleiben die Eier<br />
der Kreuzotter im Mutterleib bis die<br />
Jungtiere schlüpfen. Die kurzen warmen<br />
Perioden würden nicht ausreichen,<br />
damit sich die Eier außerhalb<br />
des Körpers entwickeln. Obwohl viele<br />
Individuen das charakteristische<br />
dunkle Zick-Zack-Muster auf hellem<br />
Untergrund aufweisen, können die<br />
Färbungen erstaunlich variabel sein.<br />
Bekannt sind etwa gänzlich schwarze<br />
Tiere, die »Höllenottern«, aber<br />
auch rötliche, kupferfarbene und<br />
graue Individuen mit unterschiedlich<br />
stark ausgeprägter Musterung<br />
kommen häufig vor. Hauptgefährdungen<br />
dieser Art stellen Lebensraumverlust<br />
dar, wie etwa Trockenlegung<br />
von Mooren, Verlust der<br />
Übergangszone zwischen Wiese und<br />
Wald sowie Erschließung von neuen<br />
Skigebieten.<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
23
WIR SUCHEN DICH<br />
ALS GARTENPLANER/IN<br />
BEI OBI<br />
DARUM WIRST DU ES<br />
BEI UNS LIEBEN:<br />
▪ Mindestens 2.324 €* brutto<br />
und Überzahlung möglich<br />
▪ Attraktive Prämien<br />
▪ Sicherer Arbeitsplatz<br />
▪ Top-Schulungskonzept<br />
▪ Spannender & kreativer Job<br />
* € 2.324,- brutto bei 38,5 h/Woche<br />
ERFAHRE<br />
MEHR!<br />
obi-jobs.at<br />
24 <strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
SPLITTER<br />
ALUMNI | N. LAGAN<br />
Leiter des Lehrforsts tritt<br />
in den Ruhestand<br />
Text: Ewald Pertlik<br />
Josef Gasch hat fast sein gesamtes Berufsleben dem<br />
Lehrforst der Universität für Bodenkultur gewidmet.<br />
Er hat sich dabei nie in den Vordergrund gedrängt,<br />
jedoch mit Beharrlichkeit und Ausdauer »seinen«<br />
Lehrforst in bester Art und Weise gehegt. War der<br />
Lehrforst lange Zeit mehr oder minder auf die<br />
Durchführung von forstlichen Lehrveranstaltungen<br />
beschränkt, so ist es ihm erfolgreich gelungen, die<br />
Gebäude für Veranstaltungen anderer Fachdisziplinen<br />
und auch für externe Nutzer*innen zu öffnen.<br />
Eine der herausragenden Eigenschaften von Josef ist,<br />
sich Problemen systematisch zu nähern, sie nüchtern<br />
zu analysieren und dann oft überraschende Lösungen<br />
zu finden und umzusetzen. Das anfängliche<br />
Problem der schwachen Internetanbindung am Lehrforst<br />
hat er so gelöst, indem er eine »Richtfunkstrecke«<br />
vom Dach des Gebäudes zum nächstgelegenen<br />
Knoten etablierte.<br />
Mit seiner ruhigen und besonnenen Art hat er es<br />
immer verstanden, ein gutes Einvernehmen mit<br />
den österreichischen Bundesforsten als Eigentümer<br />
aufrecht zu erhalten.<br />
Ewald Pertlik und Karl Stampfer überreichten Josef Gasch (Mitte) das<br />
Abschiedsgeschenk<br />
Wir wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten<br />
Ruhestand.<br />
<strong>BOKU</strong> IN DEN MEDIEN: kurier.at, 18. Februar<br />
Feuer in Bibliothek:<br />
Wie Know-how aus NÖ<br />
bei Restaurierung hilft<br />
Als vor 20 Jahren ein verheerendes Feuer in<br />
der Anna Amalia Bibliothek in Weimar wütete,<br />
stand eine Sammlung an rund 800 wertvollen<br />
und einzigartigen Handschriften sowie Notendrucken<br />
mit insgesamt 50.000 Blättern in<br />
unmittelbarer Nähe des Brandherdes. In der<br />
Projektkooperation »Made in NÖ« mit dem<br />
<strong>BOKU</strong>-Institut für Chemie nachwachsender<br />
Rohstoffe unter der Koordination von Antje<br />
Potthast wurde gemeinsam mit der Weimarer<br />
Bibliothek ein neuartiges Verfahren zur Restaurierung<br />
der verkohlten Weimarer »Aschebücher«<br />
mithilfe von Cellulose, genauer mit<br />
Nanocellulose, entwickelt. Dafür werden die<br />
Cellulose-Fasern immer weiter aufgespalten,<br />
bis sie winzig und unsichtbar sind, und schließlich<br />
auf die beschädigten Blätter gesprüht, um<br />
diese zu stabilisieren. »Die Nanocellulose ist<br />
mit freiem Auge nicht sichtbar und beeinflusst<br />
auch eine spätere Digitalisierung nicht« betont<br />
Potthast. Das Verfahren erfüllt auch Ansprüche<br />
in Hinsicht auf Langzeitstabilität. Der Nachteil<br />
ist, dass es aufwendig und teuer ist. •<br />
<strong>BOKU</strong> KLASSIK STIFTUNG WEIMAR<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
25
SPLITTER<br />
AUS DEM ARCHIV<br />
Das außergewöhnliche Leben<br />
des Otmar Reiser<br />
Otmar Reiser, geboren am<br />
21. Dezember 1861 in Wien,<br />
begeisterte sich seit jungen<br />
Jahren für die Natur, vor allem<br />
sammelte er leidenschaftlich<br />
Vogeleier und Nester. Nach<br />
Abschluss seines Studiums an<br />
der Hochschule für Bodenkultur<br />
mit der II. Diplomprüfung<br />
im Jahr 1886 widmete er sein<br />
Leben der Ornithologie und<br />
Naturforschung. Mit 26 Jahren<br />
wurde er nach Sarajevo berufen,<br />
um am Aufbau des »Bosnisch-Herzegowinischen<br />
Landesmuseums«<br />
mitzuwirken.<br />
Über drei Jahrzehnte betreute<br />
er mit Hingabe die Sammlung<br />
der zoologischen Abteilung als<br />
Leiter. Neben dem Museumsaufbau<br />
erforschte er intensiv<br />
die Tier- und Pflanzenwelt des<br />
Balkans. Eine Vielzahl von Tierarten,<br />
die er entdeckte, wurde<br />
nach ihm benannt. Durch<br />
seine Tätigkeit im Museum<br />
hatte Reiser die Gelegenheit,<br />
viel zu reisen, wobei er unter<br />
anderem Bulgarien, Griechenland,<br />
Montenegro, Serbien<br />
und Brasilien besuchte.<br />
Nachdem die geplante<br />
Eröffnung eines weiteren<br />
Museumsgebäudes durch das<br />
Attentat auf Erzherzog Franz<br />
Ferdinand 1914 in Sarajevo<br />
ausblieb, musste auch Reiser<br />
seine Karriere unterbrechen,<br />
da er zum Kriegsdienst<br />
eingezogen wurde. Trotz<br />
vieler persönlicher Opfer<br />
wie Vermögensverlust und<br />
Staatsbürgerschaftsänderung<br />
blieb seine Hingabe an Natur<br />
und Wissenschaft unerschütterlich.<br />
1932 erhielt er zudem<br />
die Ehrendoktorwürdigung<br />
der Universität Graz. Nach<br />
der Pensionierung und bis zu<br />
seinem Tod am 31. März 1936<br />
lebte er bescheiden auf einem<br />
landwirtschaftlichen Gut in<br />
Pickern (heutiges Slowenien)<br />
und blieb mit dem Naturhistorischen<br />
Museum in Wien<br />
verbunden. Seine Leidenschaft<br />
als Ornithologe zeigte sich<br />
in einer beeindruckenden<br />
Kollektion von 16.000 Stücken<br />
an gesammelten Eiern und<br />
Nestern, die er bereits 1912<br />
dem Wiener Naturhistorischen<br />
Museum schenkte. »Reisers<br />
schlichte, bescheidene<br />
Art hat<br />
ihn selten in der<br />
Öffentlichkeit<br />
hervortreten<br />
lassen und sein<br />
Name ist wohl in<br />
weiteren Kreisen<br />
wenig bekannt<br />
geworden«, jedoch<br />
werden seine bedeutsamen<br />
Beiträge<br />
zur Ornithologie<br />
ihn als einen der<br />
bedeutendsten Forscher<br />
seiner Zeit in<br />
Erinnerung halten.<br />
Quelle: Nachruf der Zool.-<br />
Bot. Ges. Österreich, verfasst<br />
vom Zoologen Ludwig<br />
Lorenz-Liburnau<br />
<strong>BOKU</strong> IN DEN MEDIEN: science.apa.at,<br />
16. Februar<br />
Forscher machten<br />
tief im Boden<br />
erneuerbare<br />
Energie zu Erdgas<br />
Das Speichern überschüssiger Energie<br />
aus erneuerbaren Quellen ist eine der<br />
großen Fragen auf dem Weg zur viel<br />
zitierten Energiewende. So verfolgt<br />
Andreas Loibner vom <strong>BOKU</strong>-Institut<br />
für Umweltbiotechnologie seit einigen<br />
Jahren gemeinsam mit dem Gasspeicher-Betreiber<br />
RAG Austria einige<br />
Projekte zur Speicherung erneuerbarer<br />
Energie in Form von Wasserstoff<br />
und dessen Umwandlung in Methan,<br />
welches nach Verbrennung wieder in<br />
den Kohlenstoffkreislauf geführt werden<br />
kann. Neben dem unterirdischen<br />
Großversuch im oberösterreichischen<br />
Unterpilsbach stellte das Team um<br />
Loibner die dortigen Bedingungen im<br />
Labor nach. Es zeigte sich, dass die<br />
Umwandlung sehr effizient vonstattengehen<br />
kann. Es bildete sich Methan<br />
aus Wasserstoff und dem in geringen<br />
Mengen im Erdgas enthaltenen CO 2<br />
,<br />
welches über einen längeren Zeitraum<br />
vollständig im Boden verschwand,<br />
berichtet Loibner. Wasserstoff sei ein<br />
wichtiger Aspekt, werde uns aber<br />
nicht alleine vor der Klimaerwärmung<br />
retten, denn es bräuchte mehr als<br />
nur eine Technologie, um rund 85 %<br />
fossile Energieträger zu ersetzen, resümiert<br />
der Wissenschafter. •<br />
PIXABAY<br />
26 <strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
SPLITTER<br />
BUCH-TIPP<br />
Behördlich<br />
autorisiert. Staatlich<br />
beeidet. Im Nationalsozialismus<br />
verfolgt.<br />
Die Geschichte der österreichischen<br />
Ingenieurkammern<br />
und Ziviltechniker:innen<br />
1860–1957<br />
304 Seiten, erhältlich im Handel für 49 €<br />
und als gratis E-Book zum Download<br />
In Kooperation mit der Bundeskammer<br />
der Ziviltechniker:innen arbeiteten<br />
die beiden Historikerinnen Ingrid<br />
Holzschuh und Alexandra Wachter die<br />
Geschichte der österreichischen Ingenieurkammern<br />
und Ziviltechniker*innen wissenschaftlich auf – von der<br />
Gründung des Berufsstandes bis in die Nachkriegszeit.<br />
Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Vergangenheitsbewältigung<br />
der Zeit des Nationalsozialismus<br />
gelegt. Portraits und Lebensläufe von vertriebenen<br />
sowie hingerichteten jüdischen Ziviltechnikern bis hin<br />
zu Aufklärung über Leugner des Holocausts in eigenen<br />
Rängen werden beleuchtet. Das letzte Kapitel widmet<br />
sich der zunehmenden Rolle der Frau in dem Berufsfeld,<br />
wobei die Tätigkeiten der ersten Pionierinnen im<br />
Vordergrund stehen. »Die Motivation der Kammer,<br />
dieses Buch zu veröffentlichen, war bedingt durch<br />
die häufig auftretende Konfrontation mit der Vergangenheit.<br />
Daher können wir jeder Institution ans Herz<br />
legen, die Vergangenheit, aber allem voran die NS-Zeit,<br />
aufzuarbeiten!«, so Vizepräsident der Bundeskammer<br />
für Ziviltechniker:innen und KTWW-Alumnus Klaus<br />
Thürriedl.<br />
BUNDESKAMMER DER ZIVILTECHNIKER:INNEN/APA-FOTOSERVICE/SCHEDL<br />
V. l. n. r.: Klaus Thürriedl (Vizepräsident der Bundeskammer der Ziviltechniker*innen),<br />
Alexandra Wachter (Autorin und Herausgeberin), Ingrid<br />
Holzschuh (Autorin und Herausgeberin), Daniel Fügenschuh (Präsident der<br />
Bundeskammer der Ziviltechniker*innen)<br />
PODCAST-TIPP:<br />
18. APRIL<br />
Land Schafft Leben:<br />
»Klimaziel: Ernährung |<br />
Helga Kromp-Kolb«<br />
Im Land Schafft Leben Podcast »Wer<br />
nichts weiß, muss alles essen« spricht<br />
Maria Fanninger mit Meteorologin<br />
Helga Kromp-Kolb über das Zusammenspiel<br />
von Klima und Wetter und deren Einfluss auf<br />
die Landwirtschaft. Wie muss sich die österreichische<br />
Landwirtschaft verändern, damit in kommenden turbulenten<br />
Zeiten die Lebensmittelversorgung gesichert<br />
bleibt? Ist eine Umstellung des Ernährungsstils notwendig?<br />
Wie können Konsument*innen dazu beitragen? Dies<br />
und vieles mehr hören Sie in dieser Podcast-Folge.<br />
BUCH-TIPP<br />
Heute wurden wieder<br />
Lawinen gesprengt<br />
508 Seiten, 34,90 Euro,<br />
erhältlich im Heeresgeschichtlichen<br />
Museum Wien<br />
Im 32. Band der Reihe »Schriften<br />
des Heeresgeschichtlichen<br />
Museums« befasste sich<br />
<strong>BOKU</strong>-Alumnus und emeritierter<br />
Leiter der Sektion der Wildbach- und Lawinenverbauung<br />
in Tirol Siegfried Sauermoser damals im<br />
Rahmen seiner Dissertation mit den Lawinenabgängen<br />
im Hochgebirge an der italienisch-österreichischen<br />
Grenze während des 1. Weltkrieges. Sind mehr Soldaten<br />
durch Lawinenabgänge ums Leben gekommen als<br />
durch Fremdeinwirkung? Antworten auf diese und viele<br />
weitere Fragen lesen Sie in diesem Werk.<br />
PODCAST-TIPP:<br />
2. MAI<br />
Der Klimadialog:<br />
»Welchen Einfluss hat das<br />
Klima auf unser Gemüse,<br />
Simon Vetter?«<br />
UBRM-Alumnus Simon Vetter betreibt<br />
seit über acht Jahren den Vetterhof in<br />
Lustenau, wo er sich intensiv mit nachhaltiger<br />
Landwirtschaft auseinandersetzt. Im Podcast<br />
Klimadialog schildert er seine Erfahrungen mit klimawandelbedingten<br />
Hindernissen als Landwirt.<br />
@ vetterhof | www.vetterhof.at<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
27
SPLITTER<br />
Vom Studium der Landwirtschaft<br />
zur Spitze der Edelkonserven-<br />
Produktion<br />
Text: Stefan Grossauer<br />
Stefan Grossauer ist Absolvent der Universität für Bodenkultur<br />
sowie Gründer und kreativer Kopf hinter Grossauer<br />
Edelkonserven im idyllischen Kamptal. Seine Reise begann<br />
mit einer Leidenschaft für hochwertige Lebensmittel, die er<br />
schon während seines Studiums der Landwirtschaft entwickelte<br />
und in vielen Praktika erleben durfte.<br />
Grossauer Edelkonserven begann 2006 mit der Verarbeitung<br />
alter Gemüsesorten. Heute kombiniert Stefan in seinen<br />
Produkten österreichische Tradition mit italienischen Einflüssen,<br />
um einzigartige Geschmackserlebnisse zu schaffen.<br />
Grossauer Edelkonserven bietet bereits eine breite Auswahl<br />
an über 150 Produkten. So wurde auch die Bio-Bruschetta-<br />
Linie 2019 zum Bio-Produkt des Jahres gekürt.<br />
Was Stefan an seiner Tätigkeit am meisten Spaß macht, ist<br />
die Kombination aus Kreativität und Handwerkskunst. Jedes<br />
Produkt, das seine Manufaktur verlässt, ist das Zusammenspiel<br />
aus Experimentieren, Feinabstimmung und dem<br />
Streben nach höchster Qualität. Der direkte Kontakt mit der<br />
Kundschaft ist für ihn eine ständige Quelle der Motivation.<br />
Für die Zukunft plant er, sein Sortiment weiter auszubauen<br />
und neue Geschmackserlebnisse zu kreieren. Er strebt<br />
danach, Grossauer Edelkonserven als führende Marke im<br />
Bereich hochwertiger Feinkostprodukte weiter zu etablieren<br />
und seine Leidenschaft für erstklassige Lebensmittel mit<br />
noch mehr Menschen zu teilen.<br />
Alle Produkte und weitere Informationen unter<br />
www.edelkonserven.at<br />
<strong>BOKU</strong> IN DEN MEDIEN: science.orf.at, 12. März<br />
Elektroschrott<br />
trennen mit<br />
Bierhefe<br />
Schätzungen zufolge könnten bis 2030<br />
weltweit mehr als 70 Millionen Tonnen<br />
Elektroschrott pro Jahr anfallen.<br />
Umso wichtiger ist es, richtig zu recyceln.<br />
Bei defekten Elektrogeräten ist<br />
das aber alles andere als einfach. »Das<br />
liegt vor allem an der Komplexität<br />
dieses Schrotts«, so Klemens Kremser<br />
vom <strong>BOKU</strong>-Institut für Umweltbiotechnologie.<br />
Je mehr unterschiedliche<br />
Metalle in einem Produkt enthalten<br />
sind und je komplexer die Materialmischung<br />
ist, desto komplizierter<br />
sei auch das Recycling. Gemeinsam<br />
mit einem Forschungsteam um Anna<br />
Sieber (K1-MET-Kompetenzzentrum<br />
in Linz) arbeitet Kremser an dem<br />
Recyclingprozess der Biosorption<br />
mittels Bierhefen, einem Restprodukt<br />
beim Bierbrauen. Den Forscher*innen<br />
gelang es, mit der Hefe bestimmte<br />
Metalle aus einer zuvor damit angereicherten<br />
Lösung zu ziehen. Da Bierhefe<br />
in großen Mengen verfügbar ist, ist ihr<br />
Einsatz kostengünstig und bringt auch<br />
keine Gesundheitsrisiken mit sich. Der<br />
Prozess muss aber erst noch weiterentwickelt<br />
und schrittweise skaliert<br />
werden, bis er sich auf internationaler<br />
Ebene etablieren kann. •<br />
DOKUMOL | PIXABAY<br />
28 <strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
SPLITTER<br />
IN MEMORIAM<br />
H. KRAUS<br />
Christian Wallner<br />
Christian Wallner verstarb<br />
unerwartet am 20. März im<br />
76. Lebensjahr. 1948 in Baden<br />
geboren, studierte er später<br />
Landwirtschaft in Wien an der<br />
Universität für Bodenkultur.<br />
Nach erfolgreichem Studienabschluss<br />
startete er seinen<br />
beruflichen Werdegang im<br />
öffentlichen Dienst des Landes<br />
Niederösterreich, zuerst bei<br />
der Niederösterreichischen<br />
Landeskammer und später<br />
bei der niederösterreichischen<br />
Agrarbehörde. Er fungierte<br />
Gebhard<br />
Aschenbrenner<br />
Ende April <strong>2024</strong> ist Gebhard<br />
Aschenbrenner im 69. Lebensjahr<br />
verstorben.<br />
Nach dem Landwirtschaftsstudium<br />
an der Universität<br />
für Bodenkultur trat er in das<br />
Österreichische Kuratorium für<br />
Landtechnik und Landentwicklung<br />
(ÖKL) ein und hat dieses<br />
31 Jahre lang (davon 18 Jahre<br />
als Geschäftsführer) geprägt.<br />
Er hat die österreichische<br />
Landtechnik miterlebt und<br />
mitgestaltet. Insbesondere der<br />
fachliche Austausch zwischen<br />
Landwirtschaft-Beratung-Wissenschaft-Landtechnikindustrie<br />
ebenso als Geschäftsführer des<br />
österreichischen Imkerverbandes,<br />
des niederösterreichischen<br />
Pferdezuchtverbandes von 1976<br />
bis 1984 sowie der niederösterreichischen<br />
Umweltberatung.<br />
Im öffentlichen Dienst galt sein<br />
starkes Interesse der Erhaltung<br />
und Weiterentwicklung<br />
des ländlichen Raumes, auch<br />
unter der Berücksichtigung<br />
von Menschen mit besonderen<br />
Bedürfnissen. In seiner Amtszeit<br />
als Geschäftsführer des niederösterreichischen<br />
Pferdezuchtverbandes<br />
setzte er wesentliche<br />
Akzente für die positive Entwicklung<br />
der Pferdezucht durch u. a.<br />
regionale Pferdeschauen.<br />
»Christian Wallner war ein humorvoller,<br />
kritischer Geist, der für die<br />
Pferdezucht unseres Bundeslandes<br />
Außerordentliches geleistet<br />
hat«, so Leopold Erasimus über<br />
seinen verstorbenen Kollegen.<br />
und -vertrieb lag ihm sehr am<br />
Herzen. Er baute nachhaltig<br />
den Kontakt zu den agrarischen<br />
Forschungs- und Bildungseinrichtungen<br />
auf, um den<br />
Wissenstransfer in die landwirtschaftliche<br />
Praxis zu verbessern.<br />
Die bekannten »ÖKL-Seminare«<br />
waren ihm sehr wichtig, weil<br />
damit den landwirtschaftlichen<br />
Betrieben mit ihren Herausforderungen<br />
in der Produktionstechnik<br />
Lösungen und Hilfestellungen<br />
angeboten wurden.<br />
Seine Diskussionsbeiträge<br />
waren von einer umfassenden<br />
Fach- und Praxiskompetenz<br />
gekennzeichnet und häufig von<br />
seinem aufheiternden Charakter<br />
begleitet. Gebhard Aschenbrenner<br />
hat Menschen zusammengeführt<br />
und damit einen Mehrwert<br />
für die österreichische<br />
Landwirtschaft geliefert.<br />
Gerhard Moitzi, Versuchswirtschaft<br />
Groß-Enzersdorf<br />
Friedrich »Fritz«<br />
Leisch<br />
Mit tiefer Trauer und großer Anerkennung<br />
nehmen wir Abschied von<br />
Friedrich Leisch, dem Leiter des<br />
Instituts für Statistik, welcher am 24.<br />
April nach schwerer Krankheit im<br />
Alter von 55 Jahren verstorben ist.<br />
Nach seinem Studium der Technischen<br />
Mathematik an der TU<br />
Wien arbeitete Leisch dort als<br />
Assistent am Institut für Statistik<br />
und Wahrscheinlichkeitstheorie im<br />
Bereich des Statistical Computing.<br />
Im Jahr 2006 wechselte er an die<br />
LMU München als Professor für<br />
Computergestützte Statistik. Seit<br />
1997 gehörte er zum R Core Development<br />
Team und wurde 2002<br />
zum ersten Generalsekretär der R<br />
Foundation berufen. Er entwickelte<br />
das Sweave-System, das reproduzierbare<br />
Forschung in der Sprache<br />
R einführte.<br />
Seit seiner Berufung als Professor<br />
an die <strong>BOKU</strong> im Jahr 2011 prägte<br />
Fritz Leisch das akademische<br />
Leben an unserer Universität.<br />
Seine Leitung des Departments für<br />
Raum, Landschaft und Infrastruktur<br />
war von seiner Fähigkeit geprägt,<br />
Konsens zu schaffen und alle<br />
Mitarbeiter*innen zu unterstützen.<br />
Darüber hinaus war Fritz Leisch ein<br />
engagierter Lehrer, der unzählige<br />
Studierende betreute, aber auch<br />
statistische Methoden in interdisziplinäre<br />
Projekte einbrachte. Sein<br />
Vermächtnis wird in den zahlreichen<br />
Publikationen, Softwarepaketen<br />
und akademischen Arbeiten<br />
weiterleben.<br />
Wir würdigen Fritz Leischs Lebenswerk<br />
mit aufrichtiger Dankbarkeit<br />
und werden sein Andenken in<br />
Ehren halten. Er wird uns und der<br />
wissenschaftlichen Gemeinschaft<br />
unvergessen bleiben!<br />
Institut für Statistik<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
29
KOMMENTAR:<br />
DAVID STEINER<br />
Referenzmaterialien in<br />
der Mykotoxinanalyse:<br />
Die Säulen der<br />
Qualitätssicherung<br />
Die Analyse von Mykotoxinen, den<br />
schädlichen Stoffwechselprodukten<br />
von Schimmelpilzen, ist von entscheidender<br />
Bedeutung für den Schutz der<br />
öffentlichen Gesundheit. Im Laufe der<br />
Jahre hat sich die Mykotoxinanalytik<br />
durch die Entwicklung neuer Techniken<br />
stark weiterentwickelt. Während<br />
in den 1980er- und 1990er-Jahren<br />
vor allem Massenspektrometrie<br />
(MS)-basierte Methoden als Ergänzung<br />
zu Techniken wie Dünnschichtchromatographie<br />
und Enzym-gebundenen<br />
Immunoassays verwendet wurden, hat<br />
sich seit den frühen 2000er-Jahren die<br />
Flüssigchromatographie in Verbindung<br />
mit der Tandem Massenspektrometrie<br />
(LC-MS/MS) als bevorzugte<br />
Methode etabliert. Moderne LC-MS/<br />
MS Verfahren bieten eine höhere<br />
Geschwindigkeit, Empfindlichkeit und<br />
Identifizierungsmöglichkeit für hunderte<br />
Mykotoxine gleichzeitig. Diese<br />
Fortschritte haben die Effizienz und<br />
Zuverlässigkeit der Mykotoxinanalytik<br />
erheblich verbessert und dazu beigetragen,<br />
die Lebensmittelsicherheit zu<br />
erhöhen. 1<br />
Die Bedeutung und Arten<br />
von Referenzmaterialien<br />
in der Mykotoxinanalytik<br />
Im Zusammenhang mit der Mykotoxinanalytik<br />
spielen Referenzmaterialien<br />
(RMs) eine fundamentale Rolle,<br />
da sie als Vergleichsgrundlage für die<br />
Validierung und Standardisierung<br />
analytischer Verfahren dienen. Durch<br />
die Verwendung von RMs können<br />
Labore die Genauigkeit, Präzision und<br />
Reproduzierbarkeit ihrer Analysen<br />
sicherstellen. Referenzmaterialien sind<br />
in verschiedenen Formen erhältlich<br />
und umfassen sowohl Flüssig- als auch<br />
Feststandards sowie Matrix-Materialien,<br />
die die realen Lebensmittel- und<br />
Futtermittelmatrices repräsentieren.<br />
Diese Vielfalt ermöglicht den Laboren,<br />
Analyseverfahren unter realistischen<br />
Bedingungen zu validieren und<br />
sicherzustellen, dass die Ergebnisse<br />
praxisrelevant sind. Besonders<br />
hervorzuheben sind zertifizierte<br />
Referenzmaterialien (ZRMs), die durch<br />
streng kontrollierte und metrologisch<br />
validierte Verfahren charakterisiert<br />
werden. Diese ZRMs verfügen über ein<br />
Zertifikat, das den Wert der spezifizierten<br />
Eigenschaft, deren Unsicherheit<br />
und eine Aussage zur metrologischen<br />
Rückführbarkeit angibt. Die Verwendung<br />
von ZRMs ist von entscheidender<br />
Bedeutung, da sie das Vertrauen in die<br />
Vergleichbarkeit der Analyseergebnisse<br />
zwischen verschiedenen Laboren<br />
gewährleisten. 2<br />
Vom ISO-Guide 34<br />
zur ISO 17034<br />
Die Transformation vom ISO-Guide 34<br />
zur ISO 17034 im Jahr 2016 markierte<br />
einen Meilenstein in der Entwicklung<br />
der Qualitätssicherung und -kontrolle<br />
in der Mykotoxinanalytik. Vor dieser<br />
Beispiele für ZRMs<br />
LVA GMBH<br />
Transformation wurden die technischen<br />
Kompetenzanforderungen für<br />
die Herstellung von Referenzmaterialien<br />
entweder allein gemäß ISO-Guide<br />
34 oder in Verbindung mit ISO/IEC<br />
17025 bewertet. Die Entscheidung zur<br />
Umstellung auf die ISO 17034 resultierte<br />
aus dem wachsenden Bedarf<br />
nach einer einheitlichen Normierung,<br />
die die Anforderungen für die Kompetenz<br />
von Referenzmaterialherstellern<br />
klar definiert. Dies ermöglichte<br />
Akkreditierungsstellen, die bisher nicht<br />
nach ISO-Guide 34 allein akkreditieren<br />
konnten, den steigenden Bedarf an<br />
Akkreditierung von RM-Herstellern<br />
zu erfüllen. Gleichzeitig erleichterte<br />
die neue Norm die kombinierte<br />
Anwendung mit anderen relevanten<br />
Standards der ISO/IEC 17000-Serie,<br />
wie ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17043,<br />
was zu einer verbesserten Integration<br />
und Harmonisierung in der gesamten<br />
Branche führte. Die Umstellung<br />
auf ISO 17034 brachte eine klarere<br />
Strukturierung der Anforderungen<br />
für die Herstellung von Referenzmaterialien<br />
mit sich und ermöglichte<br />
eine effizientere Akkreditierung von<br />
RM-Herstellern. 3<br />
Qualitätsstudie der<br />
LVA GmbH<br />
Eine aktuelle Studie, unter der Leitung<br />
der LVA GmbH, widmet sich der eingehenden<br />
Bewertung der Qualität von<br />
Mykotoxinstandards. Dies geschieht<br />
durch den Einsatz modernster analytischer<br />
Verfahren wie hochauflösender<br />
LVA GMBH<br />
30<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24
Massenspektrometrie (LC-Orbitrap-<br />
MS), sowie Flüssigchromatographie mit<br />
Dioden-Array-Detektor (LC-DAD) und<br />
LC-MS/MS. Diese Forschungsarbeit ist<br />
das Ergebnis einer partnerschaftlichen<br />
Zusammenarbeit zwischen der LVA<br />
GmbH, der Universität für Bodenkultur<br />
Wien (<strong>BOKU</strong> University) und der Universität<br />
Szeged. Im Fokus stehen dabei<br />
die Analyse von drei Flüssigstandards<br />
(Aflatoxin B1, Deoxynivalenol und<br />
Zearalenon), die von zehn führenden<br />
Anbietern bezogen wurden. Die<br />
durchgeführten LC-MS/MS-Messungen<br />
(an der <strong>BOKU</strong>) und HPLC-DAD-Messungen<br />
(an der LVA) sind in Abbildung<br />
2 dargestellt.<br />
Jeder Standard (n = 30) wurde dabei<br />
von jedem Labor im Dreifachansatz<br />
analysiert, um eine robuste Datenbasis<br />
zu gewährleisten. Nach der Normierung<br />
jedes Standards auf denselben<br />
Konzentrationswert wurde der Durchschnitt<br />
der Peakflächen pro Standardset<br />
ermittelt. Dieser Durchschnittswert<br />
diente als Referenz zur Bestimmung<br />
der individuellen Wiederfindungsraten.<br />
Für die Bewertung der Gültigkeit wurden<br />
sowohl die Unsicherheitsfaktoren<br />
der jeweiligen analytischen Messungen<br />
als auch die vom Zertifikat angegebenen<br />
Merkmalswerte berücksichtigt. Bei<br />
30 % der untersuchten Produkte lagen<br />
die Werte außerhalb des individuellen<br />
Akzeptanzbereichs, was eine kritische<br />
Überprüfung der Zertifikatsangaben<br />
erforderlich macht. Mögliche Gründe<br />
hierfür könnten sowohl Materialinstabilität<br />
als auch Verunreinigungen sein.<br />
Insbesondere letztere werden derzeit<br />
durch detaillierte Orbitrap-MS-Analysen<br />
an der Universität Szeged genauer<br />
untersucht.<br />
Anpassungsbedarf<br />
der ISO 17034<br />
Die vorläufigen Ergebnisse der Studie<br />
verdeutlichen die Notwendigkeit einer<br />
Ergänzung der aktuellen ISO 17034<br />
Kriterien für RM-Hersteller, insbesondere<br />
hinsichtlich der maximal zulässigen<br />
Unsicherheit. Während einige<br />
Standards trotz einer signifikanten<br />
Abweichung (> 5 %) vom Referenzwert<br />
akzeptable Ergebnisse erzielten, zeigten<br />
andere Standards mit geringerer<br />
Abweichung (< 3 %) ein unzureichendes<br />
Ergebnis.<br />
LC-MS/MS- und HPLC-DAD-Messergebnisse<br />
Diese Diskrepanz deutet darauf hin,<br />
dass die derzeitigen Richtlinien möglicherweise<br />
nicht ausreichend sind, um<br />
die Vielfalt der Herausforderungen in<br />
Bezug auf die Herstellung, Homogenität<br />
und Stabilität der RMs angemessen<br />
abzudecken.<br />
Eine weitere Erkenntnis aus der Studie<br />
ist die Bedeutung einer Reinheitsprüfung<br />
für finale Produkte. Während<br />
einige Standards trotz ihrer höheren<br />
Abweichung akzeptable Ergebnisse<br />
lieferten, könnte dies auf Verunreinigungen<br />
zurückzuführen sein, die<br />
möglicherweise nicht angemessen<br />
Glossar<br />
ISO 17034<br />
LC-DAD<br />
LC-MS/MS<br />
Internationale Norm, welche die allgemeinen Anforderungen<br />
an die Herstellung von Referenzmaterialien, einschließlich<br />
zertifizierter Referenzmaterialien, festlegt.<br />
Analytisches Trennverfahren (Flüssigchromatographie) mit<br />
Hilfe eines Dioden-Array-Detektors<br />
Flüssigchromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie-Kopplung;<br />
ein analytisches Verfahren zur Trennung<br />
und Bestimmung von Molekülen<br />
LC-Orbitrap-MS Flüssigchromatographie-Orbitrap-Massenspektrometrie<br />
dient zur hochauflösenden Analyse von Molekülen.<br />
(Z)RMs<br />
Quellen<br />
berücksichtigt wurden. Es ist daher<br />
entscheidend, dass die Norm klarstellt,<br />
dass finale Produkte und nicht<br />
nur Ausgangsmaterialien einer umfassenden<br />
Reinheitsuntersuchung unterzogen<br />
werden müssen, um sicherzustellen,<br />
dass keine Verunreinigungen<br />
im finalen Produkt vorliegen, die die<br />
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der<br />
Analyseergebnisse beeinträchtigen<br />
könnten. Eine solche Bestimmung<br />
könnte den Standardprozess für die<br />
Herstellung von RMs verbessern und<br />
die Qualitätssicherung in der Analytikindustrie<br />
stärken. •<br />
(Zertifizierte) Referenzmaterialien sind Stoffe mit einer<br />
oder mehreren definierten Eigenschaften für den Einsatz<br />
als Maß oder Vergleichsgröße bei Messverfahren.<br />
1 Zhang, K.; Phillips, M. Opinion: Multi-Mycotoxin Reference Materials. Foods 2022, 11, 2544.<br />
2 Wise, S.A. What is novel about certified reference materials?. Anal Bioanal Chem 410, 2045–2049<br />
(2018).<br />
3 Trapmann, S., Botha, A., Linsinger, T.P.J. et al. The new International Standard ISO 17034: general<br />
requirements for the competence of reference material producers. Accred Qual Assur 22, 381–387<br />
(2017).<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24<br />
31
ALUMNI IN ENGLISH<br />
<strong>BOKU</strong> Jobtag – Insights into<br />
the Future Working World<br />
On March 14 th , the <strong>BOKU</strong> Career Center<br />
hosted its annual job fair, featuring<br />
nearly 40 companies showing different<br />
career paths for students and alumni.<br />
Attendees gained insights into the<br />
growing job market and received professional<br />
assistance in improving their<br />
job applications. A panel discussion emphasized<br />
work-life balance and modern<br />
corporate culture. The event concluded<br />
with personalized »speed dating«<br />
sessions for attendees to connect with<br />
potential employers. For more insights<br />
into the event, refer to page 4.<br />
H. MOALLA<br />
9/27<br />
10/18<br />
+19<br />
11/15<br />
11/15<br />
+16<br />
SAVE THE DATES<br />
The Association of Graduates of the Studies in<br />
Cultural Engineering and Water Management invites<br />
members to an excursion to Liesingbach on September<br />
27 th (visit ktverband.at for more infos), and seeks alumni<br />
engagement in the pilot project »Wissen|schafft|Zukunft«<br />
(contact: johannes.ehrlinger@boku.ac.at)<br />
The Association of Graduates in Forestry,<br />
Wood Technology and Natural Fiber<br />
Technology has organised a two-day excursion to Upper<br />
Austria on October 18 th & 19 th and a general assembly in<br />
Vienna on November 15 th .<br />
The Specialist Group for Wildlife Ecology and<br />
Wildlife Management celebrates the 20 th anniversary<br />
of its Master study programme with a<br />
two-day event on November 15 th & 16 th featuring an excursion<br />
and a conference.<br />
For more information, read the articles on pages 13 to 17.<br />
Reptile of the Year <strong>2024</strong>:<br />
The adder, Vipera berus<br />
The reptile of the year, the<br />
common European adder, is<br />
now strictly protected<br />
and classified as<br />
endangered in Austria.<br />
Found in the<br />
Alps, they’re elusive<br />
and sometimes seen<br />
basking in sunlight. Their<br />
adaptation to colder climates<br />
includes retaining eggs internally until<br />
hatching. Threats include habitat loss,<br />
such as drainage of wetlands and<br />
development of ski resorts, which<br />
endanger their transitional habitats.<br />
For more details about the adder,<br />
turn to page 23.<br />
M. MEDVEY<br />
From the Archives:<br />
The Remarkable Life<br />
of Otmar Reiser<br />
Otmar Reiser, born on December 21,<br />
1861 in Vienna developed a passion<br />
for nature from a young age, particularly<br />
collecting bird eggs and nests. After completing<br />
his studies at the University of Natural Resources and<br />
Life Sciences, he dedicated his life to ornithology and natural<br />
sciences. Many of the animal species he discovered were<br />
named after him. At 26, he was called to Sarajevo to help establish<br />
the Bosnian-Herzegovinian National Museum, where<br />
he oversaw the zoological collection for over three decades.<br />
Despite personal sacrifices caused by the first world war, he<br />
remained connected with Vienna's Natural History Museum<br />
and gifted his 16,000-piece ornithology collection. To read<br />
more about his life, challenges, and accomplishments read<br />
the full article on page 26.<br />
Reference Materials in Mycotoxin<br />
Analysis: The Pillars of Quality<br />
Assurance<br />
Advancements in mycotoxin analysis, especially<br />
using mass spectrometry (MS) and liquid chromatography<br />
with tandem mass spectrometry (LC-MS/<br />
MS), have greatly improved. These techniques<br />
provide quick, sensitive, and precise detection of<br />
multiple mycotoxins. Certified reference materials<br />
are vital for ensuring consistent and accurate results<br />
across labs conducting this kind of analysis.<br />
A study led by LVA GmbH in cooperation with<br />
<strong>BOKU</strong> University and University of Szeged focuses<br />
on an in-depth assessment of the quality of<br />
mycotoxin standards and how transitioning to ISO<br />
17034 enhances the quality of mycotoxin analysis<br />
but still requires further adaptation; read the<br />
opinion piece on page 30.<br />
<strong>BOKU</strong> ALUMNI • NR.2 – 06/24