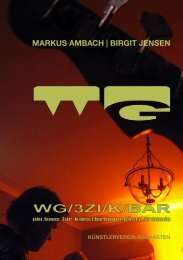B1|A40 THE BEAUTY OF THE GRAND ROAD
DIE SCHÖNHEIT DER GROSSEN STRASSE 2014 EINE AUSSTELLUNG IM STADTRAUM DER A40 VON DUISBURG BIS DORTMUND 14.06.2014 – 07.09.2014 MAP MARKUS AMBACH PROJEKTE URBANE KÜNSTE RUHR (HG.) WIENAND
DIE SCHÖNHEIT DER GROSSEN STRASSE 2014
EINE AUSSTELLUNG IM STADTRAUM DER A40 VON DUISBURG BIS DORTMUND
14.06.2014 – 07.09.2014
MAP MARKUS AMBACH PROJEKTE
URBANE KÜNSTE RUHR
(HG.)
WIENAND
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
JAKOB KOLDING<br />
OHNE TITEL<br />
NEUE BEWEGLICHE SZENERIEN „Wir werden die mechanischen Zivilisationen<br />
und die kalte Architektur, die am Ende ihres Wettrennens<br />
zu langweiliger Freizeit führen, nicht verlängern. Wir haben vor, neue<br />
bewegliche Szenerien zu erfinden […]“, 1 verkündete der französische<br />
Künstler und Aktivist Ivan Chtcheglov 1953 unter dem Pseudonym Gilles<br />
Ivain in seinem Pamphlet Formel für einen neuen Urbanismus. Chtcheglovs<br />
Text inspirierte die Psychogeografie der Situationisten und<br />
ihren Modus der Bewegung durch den urbanen Raum: die dérive, das<br />
Abweichen vom vorgesehenen Weg, das leidenschaftliche Driften und<br />
absichtliche Verlaufen.<br />
Das ästhetische Modell, das der situationistischen Stadterfahrung zugrunde<br />
liegt, ist die Collage. Guy Debords Guide psychogéographique de<br />
Paris von 1957 beruhte auf dem von Georges Peltier erstellten Plan de<br />
Paris à vol d’oiseau von 1920–1940; Debords Guide zerschneidet diesen<br />
Stadtplan in verschiedene Teile – unités d’ambiance –, die mehr oder<br />
weniger weit voneinander abgerückt und durch rote Pfeile unterschiedlicher<br />
Anzahl und Stärke miteinander verbunden sind. Die Pfeile kartieren<br />
die unbewussten Bewegungen der Person, die diese fragmentierten<br />
räumlichen Einheiten durchquerte. Doch der Collage-Charakter<br />
von Debords Guide war bereits ein Merkmal des Pariser Stadtraums<br />
selbst, seit die Haussmann’schen Boulevards und Avenuen Mitte des<br />
19. Jahrhunderts die historisch gewachsenen Strukturen der Stadt<br />
durchschnitten hatten. „Die dérive“, bemerkte Henri Lefèbvre rückblickend,<br />
„war aus meiner Sicht eher eine Praxis als eine Theorie. Sie zeigte<br />
die zunehmende Fragmentierung der Stadt. Im Lauf der Geschichte<br />
war die Stadt einmal eine starke organische Einheit gewesen; doch<br />
diese Einheit war seit einiger Zeit zunehmend in Auflösung begriffen,<br />
fragmentierte sich […].“ 2<br />
Im gleichen Jahr, in dem Chtcheglov vorschlug, die Straße zum Schauplatz<br />
„neuer beweglicher Szenerien“ zu machen, brachte ein Schriftsteller<br />
die Straße ins Theater. „Landstraße. Ein Baum. Abend.“, lautet<br />
Becketts Beschreibung des elementaren Bühnenbilds von Warten auf<br />
Godot, das im Januar 1953 in Paris uraufgeführt wurde. Hier wie dort –<br />
im fiktionalen Raum des Theaters wie in der umherschweifenden Aneignung<br />
des öffentlichen Raums – wurde die Straße zu einer Bühne für<br />
mehr oder weniger prekäre Existenzen.<br />
Die künstlerische Auseinandersetzung mit Theatralizität begann im<br />
Werk von Jakob Kolding vor mehr als einer Dekade, wie etwa in einer<br />
Reihe von Collagen, in denen (teils beschnittene) Abbildungen von<br />
Robert Morris’ Arbeit Two Columns von 1961 und anderen Werken des<br />
amerikanischen Künstlers Verwendung finden. 3 Morris hatte die beiden<br />
grauen, quadratischen Pfeiler zuerst nicht als autonome Skulpturen gezeigt,<br />
sondern als Elemente einer Performance des New Yorker Living<br />
Theater eingesetzt, wo sie für die vertikale und die liegende Position<br />
des Tänzers standen. Für den Kritiker Michael Fried waren Objekte wie<br />
diese bekanntlich „ein Plädoyer für eine neue Art von Theater […]. Während<br />
in früherer Kunst‚ alles, was das Werk hergibt, stets in ihm selbst<br />
lokalisiert‘ ist, wird in der literalistischen Kunst ein Werk in einer Situation<br />
erfahren – und zwar in einer, die geradezu definitionsgemäß den Betrachter<br />
mit umfaßt […].“ 4 Oder, wie Morris selbst formulierte: „Man ist<br />
sich stärker als früher dessen bewußt, daß man selber die Beziehungen<br />
herstellt, indem man das Objekt aus verschiedenen Positionen, unter<br />
wechselnden Lichtbedingungen und in unterschiedlichen räumlichen<br />
Zusammenhängen erfaßt.“ 5<br />
Hier – bei diesem Bewusstsein, „daß man selber die Beziehungen herstellt“<br />
– setzt Koldings Installation von figurativen schwarz-weißen<br />
Collagen in dem von der A40 buchstäblich zerschnittenen Areal rund<br />
um den Frillendorfer Platz an. Wie so viele städtische Plätze ist auch<br />
dieser eher ein transitorischer Funktionsraum und Nicht-Ort im Sinne<br />
Marc Augés. 6 Koldings Arbeiten besetzen die unterschiedlichen Räume<br />
in unmittelbarer Nähe der Autobahn – Bushaltestelle, Restgrünfläche,<br />
Unterführung, Treppenaufgang – wie eine Bühne und machen dadurch<br />
umso sichtbarer, was diesem Ort ansonsten fehlt: eine Art Zusammenhang.<br />
Die Übergänge zwischen den verstreuten Standpunkten der Cut-Outs<br />
sind ebenso hart und abrupt wie die Binnenbeziehungen mancher der<br />
ungefähr lebensgroßen Gestalten, unter ihnen eine wahrscheinlich<br />
weibliche Figur, deren Oberkörper von einem Pappkarton verborgen ist,<br />
in den ein maskenartiges Gesicht geschnitten ist, oder eine männliche<br />
Gestalt, deren obere Hälfte auf ein antikes Statuen-Fragment montiert<br />
wurde. In seiner physischen Integrität gefährdet erscheint auch der auf<br />
dem Kopf stehende Breakdancer, der im Beton festzustecken scheint –<br />
wobei sich durchaus unterschiedliche Lesarten seiner Gestalten herausarbeiten<br />
lassen, wie Kolding betont: „Ich habe zu schätzen gelernt,<br />
wie beispielsweise ein auf dem Kopf stehender Mann in einem sehr<br />
konkreten Sinne ein Kommentar auf Machtverhältnisse und die Nutzung<br />
von Raum sein kann – er kann ein buchstäblicher Ausdruck dafür sein,<br />
die Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, oder eine Art Lebensgefühl<br />
ausdrücken.“ 7<br />
Die größte Gemeinsamkeit der Collagen besteht – neben der Reduktion<br />
auf Schwarz-Weiß-Werte – in ihrer relativen Vereinzelung. „Der Raum<br />
des Nicht-Ortes“, konstatiert Augé, „schafft keine besondere Identität<br />
156