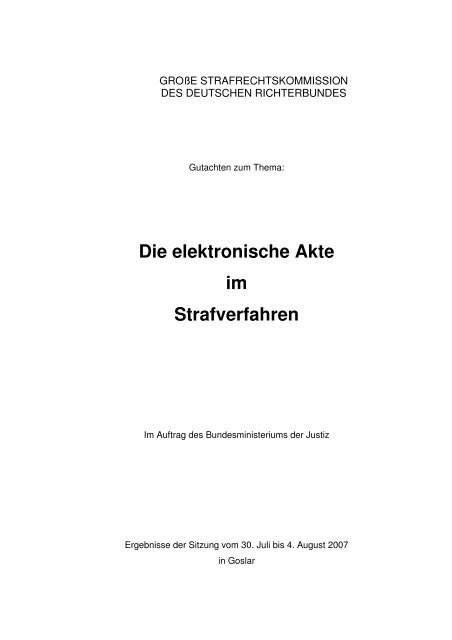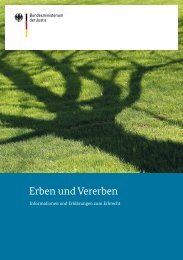Elektronische Akte im Strafverfahren - Bundesministerium der Justiz
Elektronische Akte im Strafverfahren - Bundesministerium der Justiz
Elektronische Akte im Strafverfahren - Bundesministerium der Justiz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
GROßE STRAFRECHTSKOMMISSION<br />
DES DEUTSCHEN RICHTERBUNDES<br />
Gutachten zum Thema:<br />
Die elektronische <strong>Akte</strong><br />
<strong>im</strong><br />
<strong>Strafverfahren</strong><br />
Im Auftrag des <strong>Bundesministerium</strong>s <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong><br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Sitzung vom 30. Juli bis 4. August 2007<br />
in Goslar
Teilnehmerinnen/Teilnehmer<br />
<strong>der</strong> Sitzung <strong>der</strong> Großen Strafrechtskommission in Goslar<br />
vom 30 Juli. bis 4. August 2007:<br />
1. Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Großen Strafrechtskommission:<br />
- Richter am Landgericht Magdeburg CASPARI<br />
- Präsident des Landgerichts Landau / Pfalz DR. FALK<br />
- Oberstaatsanwältin bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft bei dem<br />
Schleswig-Holsteinischen OLG Schleswig HEß, GESCHÄFTSFÜHRERIN<br />
- Vizepräsident am Amtsgericht Saarbrücken DR. KRÜGER<br />
- Leiten<strong>der</strong> Oberstaatsanwalt bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
bei dem Oberlandesgericht Braunschweig NIESTROJ<br />
- Vorsitzen<strong>der</strong> Richter am Landgericht Dortmund NÜSSE<br />
- Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein in Schleswig<br />
REX, VORSITZENDER<br />
- Oberstaatsanwalt bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft Stuttgart SCHMID<br />
- Richterin am Oberlandesgericht Dresden SCHRÖDER<br />
- Richter am Amtsgericht Hamburg WENSKE<br />
2. Gäste:<br />
- Präsident des Landgerichts a. D. in Ingolstadt GRIESER<br />
- Richterin am Amtsgericht Mosbach HAMMER<br />
- Vorsitzen<strong>der</strong> Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht<br />
Hamburg a. D. MENTZ<br />
- Oberstaatsanwalt be<strong>im</strong> Bundesgerichtshof Karlsruhe DR. BAUER<br />
- Vorsitzen<strong>der</strong> des Deutschen Richterbundes Oberstaatsanwalt FRANK<br />
- Grün<strong>der</strong> <strong>der</strong> Normfall GmbH in München PROF. DR. HAFT<br />
- Ministerialrätin <strong>im</strong> <strong>Bundesministerium</strong> <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> Berlin<br />
HILGENDORF-SCHMID<br />
- Generalstaatsanwalt a. D. IN BRAUNSCHWEIG DR.KINTZI<br />
- Rechtsanwalt in Mainz KNIERIM<br />
- Ministerialdirektor a. D. in Bonn PROF. DR.RIEß<br />
2
ÜBERSICHT<br />
0. Vorbemerkungen<br />
I. Historische Entwicklung <strong>der</strong> „elektronischen <strong>Justiz</strong>“<br />
(Telefax, PC, E-mail usw.)<br />
1. Allgemein<br />
2. Das Telegramm<br />
3. Das Telex (Fernschreiben)<br />
4. Das Teletexverfahren (Bürofernschreiben)<br />
5. Der Telebrief<br />
6. Das Telefax<br />
7. Das PC-Telefax<br />
8. Datenträger<br />
9. Versand elektronischer Dokumente<br />
10. Die elektronische Signatur<br />
10.1 Signaturvarianten<br />
10.2 Anwendungsmöglichkeiten<br />
II. Die elektronische <strong>Akte</strong> in ausländischen Rechtssystemen<br />
1. Allgemein<br />
2. Län<strong>der</strong>berichte<br />
2.1 Österreich<br />
2.2 Schweiz<br />
2.3 Frankreich<br />
2.4 Spanien<br />
2.5 Luxemburg<br />
2.6 Finnland<br />
3. Zusammenfassung<br />
III. Überblick de lege lata über die rechtliche Ausgestaltung<br />
elektronischer <strong>Akte</strong>n in verschiedenen Rechtsordnungen<br />
(z. B. VwGO, ZPO, FGO, SGG usw.)<br />
1. Ausgangsüberlegungen<br />
2. Überblick über die rechtliche Ausgestaltung <strong>der</strong><br />
elektronischen <strong>Akte</strong> in den einzelnen Verfahrensordnungen<br />
3
2.1 Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
2.2 Beschränkung auf einzelne Gerichte o<strong>der</strong> Verfahren<br />
2.3 <strong>Elektronische</strong> <strong>Akte</strong>nführung und Dokumententransfer<br />
2.4 Die allgemeine beweisrechtliche Bedeutung des transferierten<br />
Papierdokuments<br />
2.4.1 Zur grundsätzlichen Konzeption des JKomG<br />
2.4.2 Zur Konzeption des OWiG<br />
2.5 Signaturfragen bei <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
2.6 Zur Beweiskraft von elektronischen Dokumenten<br />
2.7 Der Rücktransfer von elektronischen Dokumenten in<br />
Papierdokumente<br />
2.8 <strong>Akte</strong>neinsichtsrecht bei elektronischer <strong>Akte</strong>nführung<br />
3. Zusammenfassung und Ausblick<br />
IV. Überblick de lege lata über die rechtliche und tatsächliche Ausgestaltung<br />
elektronischer Kommunikation <strong>im</strong> Ordnungswidrigkeiten-<br />
und Strafrecht<br />
1. Einführung<br />
2. Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
3. Technische Rahmenbedingungen<br />
4. Die elektronische <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Ordnungswidrigkeitenverfahren<br />
4.1 Beispiele praktischer Umsetzung<br />
4.1.1 Schleswig-Holstein<br />
4.1.2 Hessen<br />
4.1.3 Brandenburg<br />
4.2 Zwischenergebnis<br />
5. Keine elektronische <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong><br />
6. <strong>Elektronische</strong> Hilfsmittel <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong><br />
6.1 Überblick: Ausstattung <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> <strong>der</strong> Län<strong>der</strong><br />
6.1.1 Hardware<br />
6.1.2 Software<br />
6.2 Modelle einer elektronischen <strong>Akte</strong>nbearbeitung<br />
6.2.1 MODESTA<br />
6.2.1.1 Hintergrund<br />
6.2.1.2 Technische Funktionsweise<br />
6.2.1.3 Die geplante 3. Stufe<br />
6.2.1.4 Die geplante Verfahrensbearbeitung mit MODESTA<br />
6.2.1.5 Anfor<strong>der</strong>ungen an die Hardware<br />
6.2.1.6 Kosten<br />
6.2.1.7 Ausblick<br />
6.2.2 Normfall<br />
6.2.2.1 Funktionsweise<br />
4
6.2.2.2 Ausblick<br />
6.3 <strong>Elektronische</strong> Hilfsakte<br />
6.3.1 Brandenburg<br />
6.3.1.1 Ablauf<br />
6.3.1.2 Erfahrenswerte<br />
6.3.1.3 Perspektiven<br />
6.3.2 Bremen<br />
6.3.2.1 Werkstatt Bremen<br />
6.3.2.2 Erfahrenswerte<br />
6.3.2.3 Perspektiven<br />
6.3.3 Bayern<br />
6.3.4 Hamburg<br />
6.3.5 Hessen<br />
6.3.6 Baden-Württemberg<br />
6.3.7 Zwischenergebnis<br />
6.4 Sonstige elektronische Hilfsmittel<br />
6.4.1 Recherchemöglichkeiten<br />
6.4.1.1 Das Internet<br />
6.4.1.2 Juristische Datenbanken<br />
6.4.1.3 Das Intranet<br />
6.4.2 Korrespondenz per E-Mail<br />
6.4.3 E-Fax<br />
6.4.4 Spracherkennung<br />
6.4.5 Register online abfragen<br />
6.4.6 <strong>Elektronische</strong> Strafanzeigen<br />
6.4.7 Internationale Datenübermittlung <strong>im</strong> Ermittlungsverfahren<br />
6.4.8 <strong>Elektronische</strong> Gefangenenpersonalakte<br />
6.4.9 Unterstützung steuerstrafrechtlicher Ermittlungen<br />
7. Fazit<br />
V. Modellhafte Darstellung des Ablaufes eines <strong>Strafverfahren</strong>s bei voller<br />
Nutzung einer elektronischen <strong>Akte</strong><br />
1. Digitale Daten in <strong>der</strong> Rechtswirklichkeit<br />
1.1 Vorbemerkung<br />
1.2 Technische Voraussetzungen einer elektronischen <strong>Akte</strong><br />
1.3 Software-Programme<br />
1.4 Bedeutung <strong>der</strong> digitalen Daten<br />
1.4.1 Digitale Daten <strong>im</strong> Wirtschaftsleben<br />
1.4.2 Digitale Daten in <strong>der</strong> Kommunikation<br />
1.4.3 Digitale Daten <strong>im</strong> Gesundheitswesen<br />
1.4.4 Digitale Daten in <strong>der</strong> Versicherungsbranche<br />
1.4.5 Digitale Daten in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong><br />
1.4.6 Datenabgleich zwischen Finanz- und Sozialbehörden<br />
5
1.4.7 Mauterfassungssystem<br />
1.4.8 Finanzverwaltung<br />
1.4.9 Digitale Daten <strong>im</strong> Strafrecht<br />
1.5 Rechtsgrundlagen <strong>der</strong> digitalen Buchführung<br />
1.5.1 Handelsrecht<br />
1.5.2 Abgabenordnung<br />
1.5.3 Zum Ort (und Aufbewahrungsort) <strong>der</strong> Buchführung<br />
1.5.4 Zugriffsrecht <strong>der</strong> Finanzverwaltung<br />
1.5.5 Digitale („papierlose“) Unterlagen<br />
2. Ermittlungsverfahren<br />
2.1 Eingang <strong>der</strong> Strafanzeige<br />
2.1.2 Einleitungsvermerk <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
2.1.3 Vorermittlungen zur Prüfung des Anfangsverdachts<br />
2.1.4 Ermittlungsauftrag<br />
2.1.5 Anlage <strong>der</strong> Verfahrensordner<br />
2.1.6 Anlage einer Begleitakte<br />
2.1.7 Innerdienstliche Zwischenberichte und Verfahrensmanagement<br />
2.1.8 Beantragung richterlicher Beschlüsse<br />
2.1.9 Weiterleitung <strong>der</strong> Beschlüsse an die Ermittlungsbehörden,<br />
Durchführung <strong>der</strong> Ermittlungsmaßnahmen<br />
2.1.10 Ermittlungen <strong>der</strong> Polizei<br />
2.1.11 Erhebung von Beweismitteln<br />
2.1.12 Auskünfte etc.<br />
2.1.13 Auswertung von Beweismitteln<br />
2.1.14 Auswertung durch Einsatz <strong>der</strong> Sicherungs- und Auswertesoftware<br />
IDEA<br />
2.1.15 Auswertung an<strong>der</strong>er Datenbestände<br />
2.1.16 Einsatz digitaler Daten <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Vermögensabschöpfung<br />
2.1.17 Zeugenvernehmung<br />
2.1.18 Verteidigung<br />
2.1.19 Beschuldigtenvernehmung<br />
2.1.20 Untersuchungshaft<br />
2.1.21 Fertigung des polizeilichen Schlussberichts<br />
2.1.22 Rückleitung <strong>der</strong> Ermittlungsakten an die Staatsanwaltschaft<br />
2.1.23 Fertigung <strong>der</strong> abschließenden Verfügungen, Anklageerhebung<br />
2.1.24 Sonstiges<br />
3. Zwischenverfahren<br />
4. Hauptverhandlung<br />
4.1 Ausstattung des Richtertisches mit Computer<br />
4.2 Die Protokollerstellung erfolgt ebenfalls elektronisch<br />
4.3 Hauptverhandlung<br />
4.4 Urteil<br />
5. Rechtsmittel<br />
6
6. Vollstreckung<br />
6.1 Strafvollstreckung<br />
6.2 Vollstreckung <strong>der</strong> Freiheitsstrafe<br />
6.3 Sonstige Maßnahmen <strong>der</strong> Besserung und Sicherung<br />
6.4 Einzug von Geldstrafen<br />
7. Wie<strong>der</strong>aufnahme des Verfahrens (§§ 359 ff StPO)<br />
VI. Teilnahmeverpflichtung am elektronischen Rechtsverkehr für<br />
Verfahrensbeteiligte und sonstige Personen (Versicherungen,<br />
Privatpersonen usw.)<br />
1. Richter und Staatsanwälte<br />
2. Rechtsanwälte<br />
3. Privatpersonen und private Institutionen<br />
4. Staatliche Institutionen<br />
5. Sachverständige<br />
VII. Spannungsfeld von elektronischem <strong>Strafverfahren</strong> und Verfahrensrechten<br />
<strong>der</strong> Verfahrensbeteiligten (Beschuldigte, Opfer, Nebenkläger,<br />
Strafverteidigung)<br />
1. <strong>Akte</strong>neinsichtsrecht<br />
1.1 Der Beschuldigte und sein Verteidiger<br />
1.2 Sicherheitsprobleme<br />
1.3 Sonstige Verfahrensbeteiligte<br />
2. Anwesenheitsrechte und daran anknüpfende sonstige<br />
Verfahrensrechte<br />
3. Geltendmachung von Verfahrensrechten<br />
VIII. Spannungsfeld von staatsanwaltlicher/richterlicher Überzeugungsbildung<br />
und elektronischer <strong>Akte</strong><br />
1. Vorbemerkung<br />
2. Das Ermittlungsverfahren<br />
2.1 Überzeugungsbildung des Staatsanwalts<br />
2.1.1 Allgemeine Problemstellungen<br />
2.1.1.1 Asservate<br />
2.1.1.2 Urkunden<br />
2.1.1.3 Sonstige <strong>Akte</strong>nbestandteile<br />
2.1.1.4 Sonstige sinnlich wahrnehmbare Beweismittel<br />
2.1.2 Ermittlungsverfahren – Veranlassung weiterer Ermittlungen –<br />
7
2.1.3 Ermittlungsverfahren - Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO -<br />
2.1.4 Ermittlungsverfahren - Einstellung wegen geringer Schuld o. ä.<br />
ohne Beteiligung des Gerichts -<br />
2.1.5 Ermittlungsverfahren - Strafbefehlsantrag, Anklageerhebung –<br />
2.1.6 Die Unbekanntsachen (UJs-Verfahren)<br />
2.2 Überzeugungsbildung des Richters<br />
2.2.1 Ermittlungsrichter<br />
2.2.2 Beteiligung an Einstellungsentscheidungen<br />
3. Das gerichtliche Verfahren<br />
3.1 Strafbefehlsverfahren<br />
3.2 Zwischenverfahren nach Anklageerhebung<br />
3.3 Hauptverhandlung mit Urteilsfindung<br />
4. Zusammenfassung<br />
IX. <strong>Elektronische</strong> <strong>Akte</strong> und internationaler Rechtsverkehr<br />
1. Eingehende Ersuchen<br />
2. Ausgehende Ersuchen<br />
3. Sonstige Information auf elektronischem Weg<br />
4. Ausblick<br />
X. Die elektronische <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Rechtsmittelverfahren<br />
XI. Aufbewahrungsfristen/Archivierung <strong>der</strong> Originalvorgänge<br />
1. Aufbewahrungsbest<strong>im</strong>mungen<br />
2. Die elektronische <strong>Akte</strong> und die Archivierung<br />
XII. Modellvorschlag <strong>der</strong> Strafrechtskommission für eine elektronische<br />
<strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> (de lege ferenda)<br />
- Einzeldarstellung eines Verfahrensgangs vom Beginn <strong>der</strong> Ermittlungen<br />
bis zum Abschluss <strong>der</strong> Vollstreckung<br />
- Einzeldarstellung <strong>der</strong> jeweils damit verbundenen Rechtsprobleme<br />
- Chancen und Risikoabwägung<br />
1. Vorbemerkungen<br />
2. Denkbarer Ablauf des <strong>Strafverfahren</strong>s<br />
2.1 Ermittlungsverfahren<br />
2.1.1 Verfahrenseinleitung durch die Polizei<br />
2.1.2 Verfahren bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
2.1.2.1 Registrierung und Einleitungsverfügung<br />
8
2.1.2.1 <strong>Elektronische</strong> Ermittlungsführung<br />
2.1.2.3 Rechte des Beschuldigten/Verteidigers<br />
2.1.2.4 Entscheidung über den Verfahrensabschluss<br />
2.1.2.5 Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung und –verteilung<br />
2.1.2.6 Einbeziehung <strong>der</strong> Generalstaatsanwaltschaft<br />
3. Das strafgerichtliche Verfahren<br />
3.1 Zwischenverfahren und Vorbereitung <strong>der</strong> Hauptverhandlung<br />
3.2 Hauptverhandlung<br />
3.2.1 Auswirkungen auf die Beweisaufnahme<br />
3.2.2 Auswirkungen auf das Strafurteil<br />
3.2.3 Rechtsmittelverfahren<br />
3.3 Das Vollstreckungsverfahren/Aufbewahrung <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong><br />
4. Schlussbetrachtung<br />
XIII. Zusammenfassung<br />
XIV. Anhang<br />
9
0. Vorbemerkungen<br />
Das Bundsministerium <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> hat <strong>im</strong> Juni 2007 <strong>der</strong> Großen Straf-<br />
rechtskommission des Deutschen Richterbundes den Auftrag erteilt,<br />
ein Gutachten zu dem Problemkreis<br />
Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong><br />
zu erstatten.<br />
Mit dem <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz (JKomG) vom 22. März 2005, in<br />
Kraft getreten am 1. April 2005, sind grundlegende Voraussetzungen für<br />
die Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> in den verschiedenen Verfah-<br />
rensordnungen (ZPO, ArbGG, FGO, SGG, VwGO, OWiG) geschaffen<br />
worden. Dies gilt in dieser Form jedoch nicht für das <strong>Strafverfahren</strong>. Die<br />
elektronische <strong>Akte</strong> ist für das <strong>Strafverfahren</strong> bisher nicht vorgesehen,<br />
wenn auch mit § 41a StPO eine Regelung eingeführt wurde, die den<br />
allgemeinen elektronischen Rechtsverkehr ermöglichen und erleichtern<br />
soll. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass ein funktionieren<strong>der</strong> elektroni-<br />
scher Rechtsverkehr nicht gleichzeitig eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung<br />
bedingt, son<strong>der</strong>n dafür wie<strong>der</strong>um beson<strong>der</strong>e Voraussetzungen geschaffen<br />
werden müssen.<br />
Um sich mit dem Thema <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> zu<br />
befassen, gibt es eine Vielzahl von Gründen, die durch einen sich <strong>im</strong>-<br />
mer mehr in <strong>der</strong> Praxis durchsetzenden elektronischen Rechtsverkehr<br />
beson<strong>der</strong>e Bedeutung erlangen:<br />
- die <strong>der</strong>zeitige Führung von Papierakten ist aufwendig. In vielen<br />
<strong>Strafverfahren</strong> werden die Daten aus formalen Gründen zu Papier<br />
gebracht. Sie werden digital erstellt, erhoben und bearbeitet - ins-<br />
beson<strong>der</strong>e massenweise erfasste Anzeigen – und in Papierform<br />
ausgedruckt, das Verfahren wird jedoch nach kurzen Ermittlungen<br />
10
zw. ohne weitere Ermittlungen eingestellt, die Unterlagen an-<br />
schließend in Papierform abgelegt.<br />
- Digitale Daten stellen in weiten Bereichen die Grundlage des<br />
Wirtschafts- und Privatlebens bereits jetzt dar.<br />
- Ermittlungen erfolgen weitgehend elektronisch, z. B. in Verfahren<br />
wegen Urheberrechtsverletzungen durch illegale Downloads von<br />
Fileservern o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Auswertung digitaler Daten; die Auswer-<br />
tungstabellen werden digital erstellt, die digitale Form bleibt <strong>im</strong><br />
weiteren Verfahren jedoch ungenutzt.<br />
- Die in großen <strong>Strafverfahren</strong> zu erhebenden Datenmengen wer-<br />
den <strong>im</strong>mer umfangreicher und können in Papierform nicht mehr<br />
ausgewertet und dargestellt werden (z. B. 700 Or<strong>der</strong> Verfahrens-<br />
akten, 40.000 Asservate).<br />
- Digitale Daten lassen sich leicht bearbeiten bzw. vervielfältigen,<br />
die Auswertung ist einfach, die Daten sind leicht zugänglich und<br />
speicherbar.<br />
Das <strong>Bundesministerium</strong> <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> hat ausgeführt, dass eine umfas-<br />
sende Begutachtung <strong>der</strong> möglichen Nutzung in <strong>der</strong> Praxis beleuchtet<br />
werden soll, wobei folgen<strong>der</strong> Aufbau des Gutachtens aus dortiger Sicht<br />
vorstellbar wäre:<br />
I. Erhebung des Ist-Zustandes<br />
1. Tatsächliche Voraussetzungen:<br />
Welche Anwendungen laufen bereits bei Polizei/Staatsanwalt-<br />
schaften/Gerichten (nur soweit <strong>Strafverfahren</strong>);<br />
Dabei ist zur Strukturierung darauf zu achten und unterscheiden,<br />
dass es sich jeweils um rein interne Anwendungen o<strong>der</strong> um einen<br />
Austausch zwischen den genannten Stellen und sogar auch zwi-<br />
11
schen den Stellen und Dritten (Angeklagte, Rechtsanwälte, Verletz-<br />
te pp.) handeln kann.<br />
Hier sollte gezielt die Berliner Anwendung MODESTA einbezogen<br />
werden.<br />
2. Sind diese Anwendungen rechtlich abgesichert?<br />
Reicht z. B. § 41 a StPO?<br />
II. Kurzfristige Perspektive<br />
Welche weitergehenden Anwendungen mit dem Ziel, soweit wie mög-<br />
lich auf Papier zu verzichten, sind ausgehend von dem Ist-Zustand<br />
kurzfristig zu verwirklichen? Eckpunkte hierfür<br />
- Im Tatsächlichen: Vorhandene Ausstattung, Kompatibilität über Be-<br />
hörden- und Län<strong>der</strong>grenzen hinweg, Möglichkeiten, weitere Mittel<br />
zu erhalten.<br />
- Im Rechtlichen: Würden diese erweiterten Anwendungen zusätzli-<br />
che rechtliche Grundlagen brauchen?<br />
III. Längerfristige Perspektive – (vollständige) elektronische <strong>Akte</strong>?<br />
Hier ist ein Schwerpunkt insbeson<strong>der</strong>e auf Rechtsfragen zu setzen,<br />
ob/inwieweit dies mit Grundsätzen des <strong>Strafverfahren</strong>s und grundle-<br />
genden Rechten <strong>der</strong> Beschuldigten, <strong>der</strong> Verteidigung, des Opfers ver-<br />
einbar bzw. auf welchen Wegen ggf. die Wahrung dieser Rechte auch<br />
bei elektronischer <strong>Akte</strong> ermöglicht werden kann. Welche gesetzlichen<br />
Regelungen wären erfor<strong>der</strong>lich?<br />
Der Vorsitzende <strong>der</strong> Großen Strafrechtskommission des Deutschen<br />
Richterbundes Generalstaatsanwalt Rex hat darüber hinaus vorberei-<br />
tend eine Aufstellung von zahlreichen Einzelfragen erarbeitet (vgl. An-<br />
lage zu 0 a). Das <strong>Bundesministerium</strong> <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> hat darauf hingewie-<br />
12
sen, dass auch diese aufgeworfenen Fragen und Aspekte in dem Gut-<br />
achten ihren Nie<strong>der</strong>schlag finden sollen.<br />
Zur Begriffsbest<strong>im</strong>mung sei angemerkt, dass <strong>im</strong> Folgenden für den<br />
Begriff <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> die Definition aus <strong>der</strong> Monografie von<br />
Schwoerer (vgl. Anhang zu 0 b) zugrunde gelegt wird. Danach wird <strong>der</strong><br />
Begriff <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> erklärt als die rechtlich maßgebliche<br />
Gesamtheit <strong>der</strong> bezüglich einer best<strong>im</strong>mten Angelegenheit anfallenden<br />
und geordneten Daten. Papiergebundene Dokumente sind daneben<br />
nicht mehr <strong>Akte</strong>nbestandteil. Nicht elektronisch erfasst werden hinge-<br />
gen beispielsweise noch Asservate, die als solche zur Beweisführung<br />
erhalten bleiben müssen o<strong>der</strong> beschlagnahmte Fahrerlaubnisse.<br />
Soweit eine elektronische <strong>Akte</strong> neben einer vollständigen und rechtlich<br />
maßgebenden <strong>Akte</strong> in Papierform besteht, wird nachstehend von einer<br />
elektronischen Hilfsakte gesprochen. Diese wird allein zur Unterstüt-<br />
zung und Erleichterung von Arbeitsabläufen (insbeson<strong>der</strong>e be<strong>im</strong> Re-<br />
cherchieren) eingesetzt.<br />
I. Historische Entwicklung <strong>der</strong> „elektronischen <strong>Justiz</strong>“<br />
(Telefax, PC, E-mail usw.)<br />
1. Allgemein:<br />
Unter dem Begriff „elektronische <strong>Justiz</strong>“ versteht man die Vereinfachung<br />
und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und<br />
Transaktion innerhalb und zwischen den Institutionen <strong>der</strong> Judikative,<br />
sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern, Unternehmen und<br />
weiteren staatlichen Einrichtungen durch den Einsatz von Informations-<br />
und Kommunikationstechnologien.<br />
Das Prozessrecht sieht in allen Verfahrensordnungen die Schriftlichkeit<br />
vor. Die Kommunikation erfolgt über Schriftsätze. Zur Schriftform gehört<br />
13
die eigenhändige Unterschrift. Dies gilt „<strong>im</strong> Interesse <strong>der</strong> Rechtssicher-<br />
heit“ für alle Gerichtszweige. Daraus ergibt sich als Hauptproblem des<br />
elektronischen Rechtsverkehrs <strong>der</strong> Umstand, dass die elektronisch ü-<br />
bermittelten Dateien keine eigenhändige Unterschrift tragen können und<br />
damit <strong>der</strong> Schriftform nicht genügen. Dieser Umstand hat inzwischen zu<br />
zahlreichen Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Prozessordnungen geführt. Die Rechtspre-<br />
chung hat jedoch auf die technologischen Neuerungen jeweils reagiert<br />
und mo<strong>der</strong>ne Kommunikationsformen zugelassen, weil <strong>der</strong> Gesetzgeber<br />
und die Rechtsprechung auch aus verfassungsrechtlicher Sicht ver-<br />
pflichtet seien, auf den jeweiligen Stand <strong>der</strong> Nachrichtenübertragungs-<br />
technik Rücksicht zu nehmen und so den Rechtssuchenden die Wah-<br />
rung ihrer Rechte zu erleichtern.<br />
2. Das Telegramm<br />
Seit dem 1. Oktober 1849 bestand in Preußen das Telegraphenwesen<br />
als allgemeine öffentliche Nachrichtenverkehrseinrichtung. Die Gerichte<br />
waren nicht mit eigenen Telegraphen ausgestattet. Stattdessen gab es<br />
ein Aufgabetelegramm, das be<strong>im</strong> Aufgabepostamt verblieb und ein An-<br />
kunftstelegramm, das postalisch dem Gericht zugestellt wurde. Diese Art<br />
des Schriftverkehrs und <strong>der</strong> damit verbundenen Ausnahme von dem Ei-<br />
genhändigkeitsgrundsatz wurde durch Entscheidungen das Reichsge-<br />
richt <strong>im</strong> Jahre 1899 und später von allen Bundesgerichten als Gewohn-<br />
heitsrecht anerkannt.<br />
3. Das Telex (Fernschreiben)<br />
Die zum Telegramm entwickelte Rechtsprechung wurde auf das Fern-<br />
schreiben ausgedehnt. Dabei handelt es sich um eine Kommunikations-<br />
form, bei <strong>der</strong> <strong>der</strong> Empfänger eine schriftlich fixierte Nachricht erhält, die<br />
vom Absen<strong>der</strong> in ein Sendeteil, das wie eine Schreibmaschine bedient<br />
wird, eingegeben wird. Be<strong>im</strong> Empfänger entsteht ein maschinenschriftli-<br />
cher Text, <strong>der</strong> dem auf dem Sendegerät eingegebenen entspricht. Eine<br />
eigenhändige und handschriftliche Unterzeichnung ist daher nicht mög-<br />
lich und wurde von <strong>der</strong> Rechtsprechung nicht für erfor<strong>der</strong>lich gehalten.<br />
14
4. Das Teletexverfahren (Bürofernschreiben)<br />
Im Unterschied zum Telex kann auf dem Eingabegerät für das Bürofern-<br />
schreiben <strong>der</strong> eingegebene Text verän<strong>der</strong>t, gespeichert und abgesendet<br />
werden. Dem Empfänger geht die Nachricht in elektronischer Form zu,<br />
die auf dem Empfängergerät gespeichert wird. Der Empfänger entschei-<br />
det, ob und wann er es zur Kenntnis n<strong>im</strong>mt o<strong>der</strong> auf Papier ausdruckt.<br />
Die Rechtsprechung hat auch das Teletexschreiben als <strong>der</strong> Schriftform<br />
entsprechend anerkannt, obwohl die Nachrichtenübermittlung wie be<strong>im</strong><br />
E-Mail-Verkehr rein elektronisch erfolgt. Als Begründung für die Aner-<br />
kennung wurde ausgeführt, dass die Kommunikation mit diesen Geräten<br />
in den Gerichten angeboten werde und es wi<strong>der</strong>sprüchlich wäre, wenn<br />
die eingehenden Teletexnachrichten als formunwirksam angesehen<br />
würden.<br />
5. Der Telebrief<br />
Bei dem Telebriefverfahren handelt es sich um eine Kombination her-<br />
kömmlicher Zustellung und fernkopierter Übermittlung. Im Unterschied<br />
zum Teletexverfahren ist es möglich, auch zeichnerische Darstellungen<br />
wie die Unterschrift zu übermitteln. Der Telebrief ist eine gewöhnliche<br />
Briefsendung, bei <strong>der</strong> schriftliche Informationen auf einem Teil <strong>der</strong> Be-<br />
för<strong>der</strong>ungsstrecke auf fernmeldetechnischem Weg über Fernkopierer<br />
zwischen Postämtern übermittelt und anschließend als Fernkopie in ei-<br />
ner verschlossenen Umhüllung durch Postdienststellen ausgeliefert wer-<br />
den. Der BGH begründet die Formgültigkeit des Telebriefes damit, dass<br />
das Telegramm gewohnheitsrechtlich anerkannt sei und <strong>der</strong> Telebrief<br />
nach <strong>der</strong> Eigenart <strong>der</strong> Übermittlung dem Telegramm vergleichbar sei.<br />
Die Beson<strong>der</strong>heiten dieses Verfahrens und die Tatsache, dass die Un-<br />
terschrift des Absen<strong>der</strong>s wenn auch in kopierter Form vorhanden sei,<br />
gewährleisteten ein erhöhtes Maß an Zuverlässigkeit <strong>der</strong> Übermittlung<br />
und böten größere Sicherheit gegen unbefugten Gebrauch.<br />
15
6. Das Telefax<br />
Die Nachrichtenübermittlung erfolgt hier <strong>im</strong> Unterschied zum Telebrief<br />
ohne die Zwischenschaltung <strong>der</strong> Post. Die anfänglichen Bedenken ge-<br />
gen die Anerkennung als Schriftform resultierten gerade aus diesem Un-<br />
terschied; denn die nur private Übermittlung berge zu viele Manipulati-<br />
onsmöglichkeiten. Das Bundesarbeitsgericht hob frühere Entscheidun-<br />
gen auf, erkannte die Rechtsmitteleinlegung als formwirksam an und<br />
führte zur Begründung aus, dass solche Missbrauchsmöglichkeiten auch<br />
bei <strong>der</strong> Benutzung von Fernkopieranschlüssen <strong>der</strong> Prozessbevollmäch-<br />
tigen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Post nicht ausgeschlossen seien.<br />
7. Das PC-Telefax<br />
Das PC-Telefax wird auf einem PC mit einem Textverarbeitungspro-<br />
gramm erstellt und über ein Modem o<strong>der</strong> eine ISDN-Karte an das Tele-<br />
fax-Gerät des Empfängers geschickt. Der Unterschied zum Telefax be-<br />
steht darin, dass ein Computer die Funktion des Telefaxsendegerätes<br />
übern<strong>im</strong>mt. Eine eigenhändige Unterschrift kann das abgesendete Do-<br />
kument nicht tragen. Möglich ist aber, eine „eingescannte“ Unterschrift<br />
mit zu senden. Obwohl eine solche Unterschrift von je<strong>der</strong>mann wie ein<br />
Faks<strong>im</strong>ilestempel benutzt werden kann, hat die Rechtsprechung das<br />
PC-Telefax als formgerecht anerkannt. Angesichts <strong>der</strong> von <strong>der</strong> Recht-<br />
sprechung bisher schon zugelassenen Ausnahmen von dem strengen<br />
Schriftlichkeitserfor<strong>der</strong>nis wird dem technischen Fortschritt auf dem Ge-<br />
biet <strong>der</strong> Telekommunikation Rechnung getragen.<br />
8. Datenträger<br />
Bisher ist <strong>der</strong> Einsatz von Datenträgern, auf denen elektronisch erstellte<br />
Texte auf Diskette, CD o<strong>der</strong> DVD gespeichert sind, in <strong>der</strong> Rechtspre-<br />
chung nicht darauf untersucht worden, ob hier die Schriftform eingehal-<br />
ten wird. Der Einsatz von Datenträgern ist indes in den meisten Bundes-<br />
län<strong>der</strong>n <strong>im</strong> Rahmen des automatisierten Mahnverfahrens zulässig, so-<br />
16
lange bis zum Wi<strong>der</strong>spruch des Schuldners nur eine elektronische Ver-<br />
fahrensakte geführt wird.<br />
9. Versand elektronischer Dokumente<br />
<strong>Elektronische</strong> Netze und Kommunikationswege ermöglichen es, Informa-<br />
tionen über weite Strecken in kurzer Zeit auszutauschen. Es umfasst<br />
auch rechtlich relevante Dokumente wie z. B. Angebote, Bestellungen<br />
o<strong>der</strong> Rechnungen <strong>im</strong> E-Business o<strong>der</strong> Anträge und Bescheide <strong>im</strong> E-<br />
Gouvernement. Es werden an die übertragenen Informationen dabei<br />
zwei wesentliche Anfor<strong>der</strong>ungen gestellt: Erstens muss <strong>der</strong> Empfänger<br />
<strong>der</strong> Daten zweifelsfrei feststellen können, wer <strong>der</strong> Absen<strong>der</strong> ist (Authen-<br />
tizität und Nichtabstreitbarkeit) und zweitens muss ausgeschlossen wer-<br />
den, dass die Daten durch die Beteiligten o<strong>der</strong> durch Dritte unbemerkt<br />
manipuliert o<strong>der</strong> verfälscht werden können (Integrität).<br />
Die Rechtsprechung war bis zum Inkrafttreten des Form-Vorschriften-<br />
Anpassungsgesetzes (FormVorAnpG) vom 13. Juli 2001 nicht mit <strong>der</strong><br />
Frage befasst, ob eine Klage o<strong>der</strong> ein Rechtsmittel per E-mail als form-<br />
gerecht anerkannt werden könnte. Dieses Gesetz und das Gesetz zur<br />
Reform des Verfahrens bei Zustellungen <strong>im</strong> gerichtlichen Verfahren<br />
(ZustellungsRG) vom 25. Juni 2001 bildeten die rechtlichen Grundlagen<br />
für die Einreichung elektronischer Schriftsätze bei Gericht sowie elektro-<br />
nischer Zustellungen an einen best<strong>im</strong>mten Personenkreis. Die Vorschrif-<br />
ten gelten für alle Verfahrensvorschriften mit Ausnahme <strong>der</strong> Strafpro-<br />
zessordnung. In § 130 a ZPO, auf den die an<strong>der</strong>en Verfahrensordnun-<br />
gen Bezug nehmen, sind Form- und Zugangsvoraussetzungen des e-<br />
lektronischen Dokumentes geregelt. Die Vorschrift verlangt aber die qua-<br />
lifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz.<br />
10. Die elektronische Signatur<br />
Allgemeine Beschreibung<br />
Die Anfor<strong>der</strong>ungen an Authentizität und Nichtabstreitbarkeit sowie Integ-<br />
rität können durch den Einsatz <strong>der</strong> elektronischen Signatur erfüllt wer-<br />
den: Mit Hilfe von kryptografischen Verfahren macht die elektronische<br />
17
Signatur jede Manipulation o<strong>der</strong> Verfälschung an den Originaldaten für<br />
den Empfänger erkennbar. Durch eine sichere Zuordnung <strong>der</strong> eingesetz-<br />
ten kryptografischen Schlüssel zum Kommunikationspartner lässt sich<br />
außerdem <strong>der</strong> Urheber einer signierten Nachricht zweifelsfrei feststellen.<br />
Weiterhin können elektronische Signaturen auch eingesetzt werden, um<br />
einen Zeitpunkt festzuhalten, zu dem die Daten in einer best<strong>im</strong>mten<br />
Form vorgelegen haben (Zeitstempel). Diese Funktionen sind vor allem<br />
wichtig, wenn die elektronisch getätigten Transaktionen rechtlich ver-<br />
bindlich und damit beweisbar sein sollen. Für sichere Rechtsgeschäfte<br />
<strong>im</strong> Internet sind elektronische Signaturen mithin unverzichtbar. Elektro-<br />
nische Signaturen schützen allerdings nicht davor, dass Unbefugte Ein-<br />
blick in Daten erhalten. Bei vertraulichen Daten ist deshalb zur elektroni-<br />
schen Signatur eine Verschlüsselung erfor<strong>der</strong>lich.<br />
10.1 Signaturvarianten<br />
Regelungen zur elektronischen Signatur enthält das Signaturgesetz<br />
(SigG). <strong>Elektronische</strong> Signaturen können mit verschiedenen Verfahren<br />
auf unterschiedlichem Sicherheitsniveau realisiert werden. Das Signa-<br />
turgesetz definiert verschiedene Arten <strong>der</strong> elektronischen Signatur:<br />
- Einfache elektronische Signaturen (§ 2 Nr. 1 SigG) dienen dazu,<br />
den Urheber einer elektronischen Nachricht zu kennzeichnen, z.<br />
B. durch das Abspeichern einer eingescannten Unterschrift. Für<br />
einfache elektronische Signaturen sind keine Anfor<strong>der</strong>ungen be-<br />
züglich ihrer Sicherheit und Fälschungssicherheit definiert, so<br />
dass diese Signaturen nur einen sehr geringen Beweiswert ha-<br />
ben. Für beson<strong>der</strong>s werthaltige Transaktionen kommen sie in al-<br />
ler Regel nicht infrage.<br />
- Fortgeschrittene elektronische Signaturen (§ 2 Nr. 2 SigG) müs-<br />
sen höheren Anfor<strong>der</strong>ungen entsprechen: Sie müssen eine et-<br />
waige Manipulation <strong>der</strong> Daten erkennbar machen, sich eindeutig<br />
einer natürlichen Person mittels eines elektronischen Zertifikats<br />
zuordnen lassen und es ermöglichen, dass nur diese Person die<br />
erfor<strong>der</strong>lichen Mittel zur Signaturerzeugung unter ihrer alleinigen<br />
Kontrolle erhalten kann. Insofern verfügen fortgeschrittene elekt-<br />
ronische Signaturen grundsätzlich über einen höheren Beweis-<br />
18
wert. Die tatsächliche Sicherheit einer fortgeschrittenen elektroni-<br />
schen Signatur hängt jedoch von den eingesetzten Signaturver-<br />
fahren, den verwendeten Software- und Hardwarekomponenten<br />
und nicht zuletzt von <strong>der</strong> Sorgfalt <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Signatur-<br />
erstellung ab. Im Streitfall muss <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> daher <strong>im</strong> Zweifel<br />
beweisen, dass die Signatur tatsächlich in diesem Sinne sicher<br />
erzeugt wurde.<br />
- Die qualifizierte elektronische Signatur (§ 2 Nr. 3 SigG) geht dar-<br />
über hinaus, für <strong>der</strong>en Echtheit streitet bereits <strong>der</strong> Anscheinsbe-<br />
weis. Bei dieser höchsten Sicherheitsstufe <strong>der</strong> elektronischen Sig-<br />
natur wird die Signatur ihrem Urheber über ein qualifiziertes Zerti-<br />
fikat (§ 2 Nr. 7 SigG) zugeordnet. Durch das qualifizierte Zertifikat,<br />
das von einem vertrauenswürdigen Zertifizierungsdiensteanbieter<br />
(§ 2 Nr. 8 SigG) signiert wird, wird die Zusammengehörigkeit zwi-<br />
schen dem öffentlich bekannten Signaturprüfschlüssel <strong>der</strong> zur<br />
Prüfung <strong>der</strong> Signatur verwendet wird und <strong>der</strong> Identität des Signa-<br />
turschlüsselinhabers belegt. Der Zertifizierungsdiensteanbieter<br />
garantiert, dass die Angaben <strong>im</strong> qualifizierten Zertifikat und die<br />
Auskünfte seiner Verzeichnis- und Zeitstempeldienste korrekt<br />
sind und er die Anfor<strong>der</strong>ungen gem. Signaturgesetz und Signa-<br />
turverordnung erfüllt. Dazu gehört, dass <strong>der</strong> Zertifizierungs-<br />
diensteanbieter (ZDA) die sensiblen Zertifizierungsdienste in einer<br />
beson<strong>der</strong>s geschützten Umgebung betreibt (Trustcenter). Außer-<br />
dem klärt <strong>der</strong> ZDA den Anwen<strong>der</strong> über seine Sorgfaltspflichten <strong>im</strong><br />
Umgang mit <strong>der</strong> Signatur auf. Zertifizierungsdiensteanbieter un-<br />
terliegen <strong>der</strong> Aufsicht durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) und<br />
müssen dort <strong>im</strong> Rahmen ihrer Betriebsaufnahme und Betriebsan-<br />
zeige Nachweise und Belege und Erklärungen einschließlich ei-<br />
nes Sicherheitskonzeptes einrichten, die die Erfüllung <strong>der</strong> gesetz-<br />
lichen Anfor<strong>der</strong>ungen gem. Signaturgesetz und Signaturverord-<br />
nung dokumentieren.<br />
Qualifizierte elektronische Signaturen sind wegen ihres hohen Si-<br />
cherheitsniveaus in <strong>der</strong> Regel <strong>der</strong> handschriftlichen Unterschrift<br />
gleichgestellt und können grundsätzlich <strong>im</strong> Rechtsverkehr ebenso<br />
wie diese eingesetzt werden. Sollten Zweifel an <strong>der</strong> Sicherheit ei-<br />
19
ner qualifizierten elektronischen Signatur auftreten, kann eine<br />
Prüfung anhand des bei <strong>der</strong> BNetzA hinterlegten Sicherheitskon-<br />
zeptes Klarheit verschaffen. Zertifizierungsdiensteanbieter kön-<br />
nen eine solche Prüfung auch schon vor <strong>der</strong> Aufnahme des Be-<br />
triebes also insbeson<strong>der</strong>e unabhängig von einem konkreten<br />
Streitfall durchführen und sich dadurch akkreditieren lassen. Be<strong>im</strong><br />
Einsatz einer qualifizierten elektronischen Signatur mit Anbieter-<br />
akkreditierung besteht deshalb für die Anwen<strong>der</strong> ein hohes Maß<br />
an Rechtssicherheit. Die aktuelle Liste <strong>der</strong> bestätigten Produkte<br />
für die Ausführung einer qualifizierten Signatur und <strong>der</strong> Zertifizie-<br />
rungsdiensteanbieter mit Betriebsanzeige bzw. mit Anbieterakk-<br />
reditierung kann auf <strong>der</strong> Webside <strong>der</strong> BNetzA eingesehen wer-<br />
den. Die Anfor<strong>der</strong>ungen an die verschiedenen Arten von Signatu-<br />
ren und an die Zertifizierungsdiensteanbieter sowie <strong>der</strong>en Anbie-<br />
terakkreditierung sind <strong>im</strong> Signaturgesetz und in <strong>der</strong> Signaturver-<br />
ordnung geregelt.<br />
Fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen basie-<br />
ren heute auf Verfahren <strong>der</strong> asymmetrischen Kryptografie. Solche<br />
Verfahren verwenden zwei zusammengehörige kryptografische<br />
Schlüssel.<br />
Einer dieser Schlüssel wird als sog. privater Schlüssel (KPriv) zur<br />
Signaturerzeugung verwendet und vom Signaturersteller gehe<strong>im</strong><br />
gehalten, so dass kein Unbefugter mit diesem Schlüssel Signatu-<br />
ren erstellen kann. Der an<strong>der</strong>e Schlüssel wird als öffentlicher<br />
Schlüssel (KPOB) allen Kommunikationspartnern zur Verfügung<br />
gestellt und dient <strong>der</strong> Überprüfung <strong>der</strong> Signatur. Das kryptografi-<br />
sche Verfahren stellt sicher, dass eine Signatur, die sich mit dem<br />
öffentlichen Schlüssel prüfen lässt, nur mit dem zugehörigen pri-<br />
vaten Schlüssel erstellt worden sein kann und deshalb dem Inha-<br />
ber dieses Schlüssels zugerechnet werden muss. Die Veröffentli-<br />
chung <strong>der</strong> öffentlichen Schlüssel aller Kommunikationspartner in<br />
einem telefonbuchartigen Verzeichnis und die Zuordnung dieser<br />
Schlüssel zu Personen übern<strong>im</strong>mt <strong>der</strong> Zertifizierungsdienstean-<br />
20
ieter. Dazu erhebt er die erfor<strong>der</strong>lichen Daten und prüft die Iden-<br />
tität des Schlüsselinhabers. Diese Daten werden dann für den<br />
Fall <strong>der</strong> qualifizierten elektronischen Signatur in einem qualifizier-<br />
ten Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel verbunden, wobei<br />
diese Verknüpfung durch eine Signatur des Zertifizierungs-<br />
diensteanbieters vor Manipulationen geschützt ist. Das elektroni-<br />
sche Zertifikat hat eine feste Gültigkeitsdauer und kann vom<br />
Schlüsselinhaber über eine Hotline gesperrt werden, wenn z. B.<br />
die sicherere Verwahrung des zugehörigen privaten Schlüssels<br />
nicht mehr gegeben ist. Gesperrte Zertifikate werden <strong>im</strong> Ver-<br />
zeichnisdienst des Zertifizierungsdiensteanbieters gekennzeich-<br />
net. Die Gesamtheit <strong>der</strong> Systeme und Prozesse zur Ausgabe und<br />
Verwaltung <strong>der</strong> Zertifikate lässt man unter dem Begriff „Public-<br />
Infrastruktur“ zusammen.<br />
Qualifizierte elektronische Signaturen erfüllen eine Reihe von be-<br />
son<strong>der</strong>en Sicherheitsanfor<strong>der</strong>ungen, die eine Fälschung solcher<br />
Signaturen mit den verfügbaren technischen Mitteln ausschlie-<br />
ßen. Eine Darstellung dieser Sicherheitsstufen ginge hier zu weit,<br />
insoweit wird auf Informationsmaterial <strong>im</strong> Internet zu elektroni-<br />
schen Signaturen Bezug genommen, insbeson<strong>der</strong>e auf eine Ver-<br />
öffentlichung des Bundesamtes für Sicherheit in <strong>der</strong> Informations-<br />
technik „Grundlagen <strong>der</strong> elektronischen Signatur in <strong>der</strong> Technik-<br />
anwendung“ (vgl. Anlage zu I.).<br />
10.2 Anwendungsmöglichkeiten<br />
Die qualifizierte elektronische Signatur kann <strong>im</strong> Rechtsverkehr unter Pri-<br />
vaten bereits seit dem Inkrafttreten von § 126 a BGB <strong>im</strong> Jahre 2001 als<br />
Äquivalent zur Schriftform eingesetzt werden.<br />
Beson<strong>der</strong>e Bedeutung erlangt sie jedoch <strong>im</strong> öffentlichen Bereich: Wäh-<br />
rend <strong>im</strong> Privatrechtsverkehr <strong>der</strong> Grundsatz <strong>der</strong> Formfreiheit gilt, sieht<br />
das öffentliche Recht für Anträge und Bescheide regelmäßig die Schrift-<br />
form vor, so dass insbeson<strong>der</strong>e die Anträge einer Unterschrift bedürfen.<br />
Hinzu kommt, dass bei <strong>der</strong> elektronischen Ausstellung von Bescheiden<br />
21
<strong>der</strong> Integrität des Inhalts wie auch <strong>der</strong> Authentizität des Ausstellers we-<br />
gen <strong>der</strong> mit ihnen verbundenen Rechtswirkung eine beson<strong>der</strong>e Bedeu-<br />
tung zukommt.<br />
Ein erster Anwendungsbereich <strong>der</strong> qualifizierten elektronischen Signatur<br />
ist hierbei die elektronische Übermittlung von Rechnungen nach § 14<br />
Abs. 3 UStG: Um <strong>der</strong> erhöhten Gefahr eines Umsatzsteuerbetruges<br />
durch leichtere Fälschbarkeit elektronischer Rechnungen entgegenzu-<br />
wirken, berechtigen elektronisch ausgestellte Rechnungen einen Unter-<br />
nehmer nur dann zum Vorsteuerabzug, wenn sie mit einer qualifizierten<br />
elektronischen Signatur versehen sind. Im Rahmen des ELSTER-<br />
Projektes wurde durch die Entwicklung einer neuen Sicherheitsplattform<br />
für das Online-Portal (ELSTERonline) nunmehr auch die Möglichkeit ge-<br />
schaffen, neue Erklärungen sowie die seit 1. Januar 2005 grundsätzlich<br />
zwingend elektronisch abzugebenden Umsatz- und Lohnsteuervoran-<br />
meldung mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Im elektroni-<br />
schen Rechtsverkehr innerhalb und mit <strong>Justiz</strong>behörden wurde durch das<br />
Formanpassungsgesetz (FormAnpG) vom 13. Juli 2001 zunächst die e-<br />
lektronische Form <strong>der</strong> Schriftsätze zugelassen. Durch das JKomG vom<br />
22. März 2005 sind nunmehr auch die Zustellung gerichtlicher Entschei-<br />
dungen in elektronischer Form sowie die elektronische <strong>Akte</strong>nführung in<br />
<strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> möglich. Weitere Anwendungsbereiche <strong>im</strong> behördlichen Um-<br />
feld sind beispielsweise das Rechnungswesen in <strong>der</strong> Sozialversiche-<br />
rung, Patentanmeldungen be<strong>im</strong> DPMA sowie das Einwohnermeldewe-<br />
sen.<br />
Aus § 130a Abs. 2 ZPO ergibt sich, dass Bundesregierung und Landes-<br />
regierungen für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt<br />
best<strong>im</strong>men, von dem an elektronische Dokumente bei den Gerichten<br />
eingereicht werden können. Damit dürfte die bisherige einheitliche<br />
Rechtsprechung zu neuen Formen <strong>der</strong> elektronischen Datenübermitt-<br />
lung beendet sein und sich uneinheitlich <strong>im</strong> Bund und den 16 Bundes-<br />
län<strong>der</strong>n entwickeln, wenn es nicht gelingt, diese Entwicklung durch frei-<br />
willige Zusammenarbeit in <strong>der</strong> Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission zu steuern.<br />
Die Regelung hat viele Pilotprojekte für den elektronischen Rechtsver-<br />
kehr entstehen lassen, die auf sehr unterschiedliche Übertragungsver-<br />
22
fahren setzen. Eingeführt sind neben dem E-Mail-Verfahren das Upload<br />
auf einer speziellen Webseite sowie das beson<strong>der</strong>e Übertragungsverfah-<br />
ren nach dem OSCII-Protokoll. Der Bundesgerichtshof begann sein Pi-<br />
lotprojekt bereits <strong>im</strong> November 2001. Seit 2002 können be<strong>im</strong> Finanzge-<br />
richt in Hamburg Klagen per E-Mail eingereicht werden. Von dieser Mög-<br />
lichkeit wurde jedoch in den ersten 3 Jahren nur einmal Gebrauch ge-<br />
macht. Anfang des Jahres 2005 startete <strong>der</strong> elektronische Rechtsver-<br />
kehr am Verwaltungsgericht Koblenz. Ab Oktober 2005 folgten Sozialge-<br />
richte in Rheinland-Pfalz. Die Entwicklung des elektronischen Rechts-<br />
verkehrs wurde fortgesetzt durch das Gesetz über die Verwendung e-<br />
lektronischer Kommunikationsformen in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> (<strong>Justiz</strong>kommunikati-<br />
onsgesetz – JKomG) vom 22. März 2006. In diesem Gesetz sind die<br />
rechtlichen Voraussetzungen für eine vollständige elektronische <strong>Akte</strong><br />
geschaffen. Der Zeitpunkt ihrer Einführung soll wie be<strong>im</strong> FormVorAnpG<br />
durch Rechtverordnung best<strong>im</strong>mt werden. Für die Strafgerichte ist in §<br />
41a StPO nur best<strong>im</strong>mt, dass elektronische Dokumente versehen mit<br />
qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz bei Ge-<br />
richt eingereicht werden können. In Ordnungswidrigkeitenverfahren ist<br />
dagegen eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung möglich.<br />
Aus <strong>der</strong> Gesetzesbegründung (Drs 15/4067, S. 26) ergeben sich folgen-<br />
de Gründe für die Entscheidung des Gesetzgebers, <strong>der</strong>zeit <strong>im</strong> Strafver-<br />
fahren keine elektronische <strong>Akte</strong> einzuführen:<br />
a) Eingänge seitens externer Verfahrensbeteiligter werden auf nicht<br />
absehbare Zeit zu erheblichen Teilen auf Papier anfallen und<br />
müssten personalaufwendig konvertiert werden.<br />
b) Nie<strong>der</strong>schriften über die Vernehmung von Beschuldigten und Zeu-<br />
gen als nach Umfang und Bedeutung wesentliche Teile <strong>der</strong> Ermitt-<br />
lungsakte können nicht ohne erhebliche Beeinträchtigung ihres<br />
Beweiswertes durch elektronische Dokumente ersetzt werden.<br />
c) Die verbindliche Festlegung des Beschuldigten, Verteidigers o<strong>der</strong><br />
Nebenklägers auf papierlose Kommunikation mit den Strafverfol-<br />
gungsorganen würde wesentliche, mit dem Verfassungsprinzip des<br />
rechtlichen Gehörs kaum zu vereinbarende Zugangsschranken er-<br />
richten.<br />
23
d) Der verbindlichen Einführung stünden vielfach beschränkte techni-<br />
sche Möglichkeiten entgegen, weil am <strong>Strafverfahren</strong> vielfach Per-<br />
sonen beteiligt seien, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft auch zu-<br />
künftig nicht über die erfor<strong>der</strong>liche technische Ausstattung o<strong>der</strong> die<br />
notwendigen Kenntnisse verfügen werden.<br />
II. Die elektronische <strong>Akte</strong> in ausländischen Rechtssystemen<br />
1. Allgemein<br />
Bei <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ergeben sich verschiedene grundlegende<br />
Fragen, die <strong>im</strong> Wesentlichen folgende Themenbereiche betreffen:<br />
- den Zugang zur <strong>Justiz</strong>, namentlich die Sicherung von Authentizität<br />
und Identität <strong>der</strong> möglichen Eingaben,<br />
- die Verarbeitung und Sammlung von Daten in einer elektronischen<br />
<strong>Akte</strong><br />
- <strong>der</strong>en Sicherung und Archivierung.<br />
Diese Fragen stellen sich generell in jedem Land, auch wenn Ausmaß<br />
und Intensität von <strong>der</strong> Ausgestaltung des jeweiligen Rechtssystems ab-<br />
hängig sind. Deshalb liegt es nahe, einen Blick auf die Digitalisierung <strong>der</strong><br />
<strong>Justiz</strong> in ausländischen Rechtssystemen zu werfen.<br />
Ein Blick in die Nachbarlän<strong>der</strong> zeigt, dass die Weiterentwicklung <strong>der</strong><br />
„elektronischen <strong>Justiz</strong>“ überall mit großer Priorität betrieben wird. Allent-<br />
halben sind Pilotprojekte geplant o<strong>der</strong> teilweise bereits in Gang gesetzt.<br />
Sie betreffen die bloß unterstützende elektronische Datenverarbeitung,<br />
aber darüber hinaus auch Versuche, die Arbeit mit Papierdokumenten<br />
durch die mit elektronischen Dokumenten ersetzen. Diese Bemühungen<br />
konzentrieren sich <strong>im</strong> Wesentlichen auf Register und zivil- o<strong>der</strong> verwal-<br />
tungsrechtliche Verfahren, die Einführung <strong>der</strong> „elektronischen <strong>Akte</strong>“ in<br />
Strafsachen dürfte durchweg noch in mehr o<strong>der</strong> weniger weiter Ferne<br />
liegen.<br />
24
2. Län<strong>der</strong>berichte<br />
2.1 Österreich<br />
Mit beson<strong>der</strong>em Nachdruck ist die Einführung <strong>der</strong> elektronischen Daten-<br />
verarbeitung in Österreich betrieben worden.<br />
Mit <strong>der</strong> Einführung eines Abschnittes über elektronische Eingaben und<br />
Erledigungen in das Gerichtsorganisationsgesetz (§§ 89a ff. GOG) und<br />
<strong>der</strong> dazu ergangenen Verordnung über den elektronischen Rechtsver-<br />
kehr (ERV-Verordnung) sind dazu die Voraussetzungen geschaffen<br />
worden. Mit <strong>der</strong> am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Verordnung wird<br />
<strong>der</strong> web-basierte <strong>Elektronische</strong> Rechtsverkehr möglich. Er soll bis Ende<br />
2008 die bisherigen Zugangsregeln ablösen und ermöglicht eine papier-<br />
lose elektronische Kommunikation mit den österreichischen Gerichten.<br />
Das bereits jetzt mögliche Einbringen von Schriftsätzen über das Inter-<br />
net wird wesentlich erleichtert.<br />
Die Entwicklung <strong>der</strong> „elektronischen <strong>Justiz</strong>“ steht auch in Österreich un-<br />
ter dem Vorbehalt <strong>der</strong> Umsetzbarkeit nach den vorhandenen techni-<br />
schen Möglichkeiten.<br />
Nach § 89 b GOG hat <strong>der</strong> Bundesminister <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> „nach Maßgabe<br />
<strong>der</strong> technischen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf eine ein-<br />
fache und sparsame Verwaltung und eine Sicherung vor Missbrauch,<br />
1. die Eingaben zu best<strong>im</strong>men, die elektronisch angebracht werden<br />
dürfen,<br />
2. die gerichtlichen Erledigungen zu best<strong>im</strong>men, <strong>der</strong>en Inhalt anstatt<br />
in <strong>der</strong> Form schriftlicher Ausfertigungen elektronisch übermittelt<br />
werden darf.“<br />
Dieser Rahmen ist indes so ausgefüllt, dass von einem praktizierten<br />
elektronischen Rechtsverkehr gesprochen werden kann.<br />
Neben einem gut aufgestellten Netzwerk, das über das Bundesrechen-<br />
zentrum alle Gerichte Österreichs miteinan<strong>der</strong> verbindet, sind pragma-<br />
tisch vereinfachte Übermittlungen unter Verzicht auf eine qualifizierte<br />
25
Signatur für diese Vorreiterrolle in Europa bei <strong>der</strong> Nutzung des elektroni-<br />
schen Rechtsverkehrs ursächlich.<br />
Daneben ist aber auch <strong>der</strong> Nutzungszwang durch die Rechtsanwälte (§<br />
9 Abs.1a RAO) von ausschlaggeben<strong>der</strong> Bedeutung. Je<strong>der</strong> Rechtsanwalt<br />
ist verpflichtet, eine EDV-Anlage, die zur Übermittlung <strong>der</strong> Daten tauglich<br />
ist, vorzuhalten, gerichtliche Erledigungen können ihm elektronisch zu-<br />
gestellt werden. Jedem Anwalt ist über die Vernetzung die Einsicht in<br />
das Handelsregister (Firmenbuch) und das Grundbuch möglich.<br />
Eine entscheidende Weiterentwicklung ergab sich durch die Einbezie-<br />
hung <strong>der</strong> Mahnklagen in den elektronischen Rechtsverkehr. Nach einer<br />
Übergangszeit werden jetzt fast alle Mahnklagen elektronisch einge-<br />
reicht. Da eine Vielzahl von Zivilklagen sich aus den Mahnklagen entwi-<br />
ckelt, kann davon gesprochen werden, dass die Klageerhebung in Ös-<br />
terreich zu einem großen Teil auf elektronischem Wege erfolgt.<br />
Bislang erfolgte die Kommunikation über Modem und eine Telefonver-<br />
bindung zu einer Übermittlungsstelle, die den Eingang protokolliert. Auf<br />
die auf diesem Wege eingegangenen Eingaben hat das Bundesrechen-<br />
zentrum Zugriff, die sie an die jeweiligen Gerichte über das Intranet wei-<br />
terleitet. Die web - ERV erweitert diese Zugangsmöglichkeiten durch ei-<br />
nen Direktzugang, wobei die Anmeldung allerdings mit digitalen Zertifi-<br />
katen gesichert sein muss.<br />
Entscheidungen können in Mahnverfahren elektronisch zugesandt wer-<br />
den.<br />
Sofern Einspruch eingelegt wird, erfolgt die weitere Bearbeitung <strong>im</strong> her-<br />
kömmlichen Verfahren.<br />
Urteile werden nicht elektronisch zugestellt.<br />
Für die rechtlichen Grundlagen <strong>der</strong> Übermittlung sind Vorschriften des<br />
GOG und <strong>der</strong> dazu ergangenen ERV - Verordnung von Interesse, die <strong>im</strong><br />
Anhang zu II abgedruckt sind.<br />
Auch wenn die Kommunikation mit dem Gericht in Österreich in erhebli-<br />
chem Umfang auf den elektronischen Weg umgestellt ist und Daten e-<br />
26
lektronisch gesammelt und gespeichert werden, bedeutet dies nicht,<br />
dass eine elektronische <strong>Akte</strong> eingeführt ist, die die herkömmliche Papier-<br />
form ersetzt soweit sich das Verfahren über die automatisierten Verfah-<br />
ren wie das Mahnverfahren hinaus entwickelt.<br />
Jedenfalls in <strong>Strafverfahren</strong> ist die elektronische <strong>Akte</strong> noch Zukunftsmu-<br />
sik.<br />
Dabei zeigen sich auch in Österreich erhebliche praktische Schwierigkei-<br />
ten.<br />
Der Plan, mit <strong>der</strong> Umstellung des <strong>Strafverfahren</strong>s vom Untersuchungs-<br />
richtersystem zum staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren zum<br />
1. Januar 2008 den Papierverkehr zwischen Polizei und Staatsanwalt-<br />
schaft über eine Schnittstelle vorab elektronisch zu übermitteln, konnte<br />
nicht realisiert werden.<br />
2.2 Schweiz<br />
Auch für die Schweiz zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei die kantonale<br />
Vielfalt <strong>der</strong> Prozessordnungen zu beachten ist.<br />
Teilweise werden Eingaben, die elektronisch angebracht werden, aner-<br />
kannt, teilweise ist nur die Papierform möglich.<br />
Eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung, die die Papierform ersetzt ist zumin-<br />
dest in Strafsachen nicht bekannt. Zwar dürfen alle Urteile, Ladungen<br />
pp. elektronisch gespeichert und bearbeitet werden. Maßgeblich ist aber<br />
allein die Papierform.<br />
Aufbewahrungsvorschriften sind daher nicht ausgeprägt.<br />
Auch die neue StPO, die <strong>der</strong>zeit verabschiedet werden soll, enthält noch<br />
keine Vorschriften zu einer elektronischen <strong>Akte</strong>nführung<br />
2.3 Frankreich<br />
In Frankreich laufen <strong>der</strong>zeit einige Pilotprojekte zur Weiterführung <strong>der</strong><br />
Nutzung <strong>der</strong> elektronischen Datenverarbeitung. Diese betreffen sowohl<br />
das Zivil- wie auch das Strafrecht. Ab 2008 ist ein großflächiger Einsatz<br />
<strong>der</strong> IT-Anwendungen über die Pilotprojekte hinaus angekündigt, was<br />
darauf schließen lässt, dass die Erfahrungen aus diesen Projekten gute<br />
Ergebnisse gebracht haben.<br />
27
Es sollen zahlreiche Vorgänge elektronisch erfasst und für die digitale<br />
Bearbeitung nutzbar gemacht werden. Über Rechenzentren ist eine Ver-<br />
netzung geplant, die es möglich macht, Dossiers an an<strong>der</strong>e Staatsan-<br />
waltschaften o<strong>der</strong> Gerichte zu übermitteln und landesweit nach Vorgän-<br />
gen zu suchen sowie auch in <strong>Akte</strong>n an<strong>der</strong>er Gerichte und Staatsanwalt-<br />
schaften Einblick zu nehmen. Dabei gibt es verschiedene Einschränkun-<br />
gen, z. B. bei Verfahren vor dem Untersuchungsrichter o<strong>der</strong> bei Verfah-<br />
ren gegen Min<strong>der</strong>jährige.<br />
Die Anwälte werden nach Einführung <strong>der</strong> Vernetzung in die Lage ge-<br />
setzt, jeweils elektronisch den Verfahrensstand abzufragen, Entschei-<br />
dungen können elektronisch bekannt gemacht werden.<br />
Angestrebt wird aber auch eine unmittelbare Kommunikation zwischen<br />
Bürger und Gericht in Verfahren ohne Anwaltszwang.<br />
Allerdings findet auch nach den umfassenden Plänen keine vollständige<br />
elektronische Verarbeitung statt. Es gibt vielmehr weiterhin Papiervor-<br />
gänge,<br />
Die Papierakte bleibt vielmehr wohl die maßgebliche Grundlage des Ver-<br />
fahrens. In ihr werden die Originale verwahrt.<br />
Allerdings sollen die wichtigen Verfahrensteile eingescannt und so in e-<br />
lektronische Dokumente umgewandelt werden, dass sie mit Suchma-<br />
schinen bearbeitet werden können. Zu diesem Zweck stehen bei den<br />
Gerichten leistungsfähige Scanner und Server zur Verfügung.<br />
2.4 Spanien<br />
Für Spanien ergibt sich ein vergleichbares Bild, auch wenn die Entwick-<br />
lung noch etwas weniger weit fortgeschritten zu sein scheint.<br />
Durch königliches Dekret vom 26. Januar 2007 ist best<strong>im</strong>mt, dass in<br />
Spanien ein EDV- System eingeführt werden soll. In diesem „Lexnet“<br />
sollen Schriftsätze und <strong>Akte</strong>nbestandteile elektronisch erfasst und über-<br />
mittelt werden. Zur Nutzung gehört auch die elektronische <strong>Akte</strong>nführung.<br />
Die Mitarbeiter <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> sind zur Nutzung dieses Systems verpflichtet.<br />
Gleiches gilt für die Rechtsanwälte. Ausgenommen scheint aber <strong>der</strong><br />
spanische Gerichtsrat, <strong>der</strong> autonom über die Belange <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> be-<br />
28
st<strong>im</strong>mt. Inwieweit dieser seinerseits die Nutzung forciert, kann hier nicht<br />
geklärt werden.<br />
Über „Lexnet“ sollen Prozesserklärungen, Verfügungen und an<strong>der</strong>e<br />
Kommunikationselemente abgewickelt werden.<br />
Für die Übermittlung wird jeweils ein Protokoll elektronisch erstellt.<br />
Bei je<strong>der</strong> Nutzung bildet das System eine Meldung über die korrekte<br />
Übermittlung des Datums unter Nennung von Datum und Uhrzeit aus.<br />
Es wird <strong>der</strong> Eingang in <strong>der</strong> Mailbox des Empfängers dokumentiert. An<br />
den Absen<strong>der</strong> wird automatisch eine Empfangsbestätigung übersandt.<br />
Die Einführung des Systems steht unter dem Vorbehalt <strong>der</strong> jeweiligen<br />
technischen und finanziellen Möglichkeiten.<br />
Bislang ist lediglich in wenigen Gerichten ein Probebetrieb installiert<br />
worden. Erfahrungen fehlen. Insbeson<strong>der</strong>e zum Verhältnis von elektro-<br />
nisch geführter <strong>Akte</strong> zu den eingehenden schriftlichen Eingaben fehlen<br />
nähere Erkenntnisse.<br />
2.5 Luxemburg<br />
Im <strong>Strafverfahren</strong> des Großherzogtums Luxemburg ist allein die Papier-<br />
akte maßgeblich.<br />
Es gibt keine gesetzliche Grundlage für eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung.<br />
Dies gilt auch für den Zivilprozess.<br />
Derzeit ist allerdings eine elektronische Dokumentation <strong>im</strong> Aufbau, die<br />
die Entstehung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> dokumentiert. Es werden darin alle Schritte <strong>im</strong><br />
Verfahrensablauf dokumentiert, vom Eingang des ersten polizeilichen<br />
Ermittlungsberichts bis zur erledigenden Entscheidung. Der jeweilige<br />
Verfahrensstand und die Entwicklung des Verfahrens lassen sich damit<br />
„auf einen Blick“ elektronisch abfragen. Ziel ist es, die <strong>Akte</strong>nführung ü-<br />
bersichtlicher zu gestalten, nicht die Papierakte durch die elektronische<br />
<strong>Akte</strong> abzulösen. Die Papierakte bleibt allein verbindlich. Auf das Register<br />
haben Externe einschließlich <strong>der</strong> Rechtsanwälte und auch die Polizei<br />
keinen Zugriff.<br />
29
In größeren Verfahren werden die <strong>Akte</strong>n eingescannt (vermutlich als<br />
Bilddateien), auf CD o<strong>der</strong> DVD gebrannt und den Beteiligten zur Verfü-<br />
gung gestellt. Dafür ist wohl das Einverständnis aller Parteien ein-<br />
schließlich <strong>der</strong> Richter erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Eine weitere „Elektronisierung“ scheint <strong>der</strong>zeit in Luxemburg nicht für<br />
notwendig o<strong>der</strong> wünschenswert gehalten zu werden.<br />
2.6 Finnland<br />
Der Weg zur „elektronischen <strong>Justiz</strong>“ ist in Finnland weit fortgeschritten.<br />
Seit 1996 wird die EDV in erheblichem Umfang sowohl in Zivil- als auch<br />
in Strafsachen eingesetzt. Dabei ist aber auch in Finnland die Nutzung in<br />
Zivilsachen stärker in <strong>der</strong> Praxis fortgeschritten als in Strafsachen, wobei<br />
die Kommission über den heutigen Stand keine Erkenntnisse gewinnen<br />
konnte.<br />
Im Zivilverfahren hat die EDV insbeson<strong>der</strong>e bei dem dem deutschen<br />
Mahnverfahren ähnlichen summarischen Verfahren Bedeutung, das ei-<br />
nen Großteil <strong>der</strong> Verfahren betrifft. Die Anwendung <strong>der</strong> Elektronik wird<br />
dabei durch den Verzicht auf eine qualifizierte Signatur und damit auf ei-<br />
ne komplizierte Prüfung <strong>der</strong> Authentizität und Identität erleichtert. Dabei<br />
spielt aber auch eine Rolle, dass <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungseinzug zu einem gro-<br />
ßen Teil von wenigen Gesellschaften betrieben wird, die vornehmlich<br />
den Banken angeglie<strong>der</strong>t sind. Diesen wird in einem beson<strong>der</strong>en Zulas-<br />
sungsverfahren <strong>der</strong> erleichterte Zugang zu dem EDV - System <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong><br />
ermöglicht.<br />
Die Erhebung von Zahlungsklagen ist per Fax o<strong>der</strong> per e-Mail möglich.<br />
Dabei muss eine Kontaktanschrift angegeben sein, unter <strong>der</strong> sich das<br />
Gericht davon überzeugen kann, dass die Mail von dem genannten Ab-<br />
sen<strong>der</strong> stammt.<br />
Die Zahlungsauffor<strong>der</strong>ung wird dem Gegner unter Einschaltung <strong>der</strong> fin-<br />
nischen Post zugestellt, und zwar <strong>der</strong>gestalt, dass durch das Gericht ein<br />
elektronisches Dokument an das Zustellpostamt geschickt und dort aus-<br />
gedruckt wird. Dann wird es in Papierform dem Betroffenen zugestellt.<br />
30
Die Verteidigung kann schriftlich o<strong>der</strong> durch E-Mail an das Gericht ge-<br />
sandt werden.<br />
Die Entscheidung erfolgt als Grundlage <strong>der</strong> Vollstreckung in Papierform,<br />
wird aber zusätzlich den Beitreibungsgesellschaften auch elektronisch<br />
übermittelt, soweit sie das jeweilige Verfahren in Gang gesetzt haben.<br />
In ähnlicher Weise wird auch <strong>im</strong> streitigen Verfahren die Elektronik ein-<br />
gesetzt, um Schriftsätze und Verfügungen zu übermitteln, die wohl auch<br />
nur so gespeichert werden. Urteile werden allerdings weiter in Papier-<br />
form ausgefertigt.<br />
Für das Strafrecht scheint die digitale Aufarbeitung zum Zwecke <strong>der</strong> Er-<br />
leichterung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nbearbeitung <strong>im</strong> Vor<strong>der</strong>grund zu stehen. Es sind<br />
aber auch Links zu Registern und dem polizeilichen Informationssystem<br />
vorgesehen. Allerdings ist <strong>der</strong> Zugang zum Gericht in elektronischer<br />
Form möglich. Der Staatsanwalt übermittelt die Anklagedokumente in<br />
elektronischer Form an das Gericht. In gleicher Weise können Rechts-<br />
anwälte und auch Privatpersonen alle Dokumente in elektronischer Form<br />
an das Gericht übersenden.<br />
Es ist aber auch weiterhin möglich, Eingaben und Schriftsätze in Papier-<br />
form zu übersenden. Das Gericht scannt diese Dokumente nicht ein.<br />
<strong>Elektronische</strong> Dokumente werden offenbar in erheblichem Umfang aus-<br />
gedruckt.<br />
Alle Dokumente werden nämlich in Papierform aufbewahrt. In elektroni-<br />
scher Form werden <strong>Akte</strong>n nur auf Wunsch übermittelt.<br />
Beweismittel müssen in Papierform bereitgestellt werden.<br />
Die Archivierung findet nur in Papierform statt.<br />
3. Zusammenfassung<br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durchweg die EDV für die<br />
<strong>Justiz</strong> genutzt wird.<br />
Der Umfang ist von deutlichen Unterschieden geprägt.<br />
31
Eine elektronische <strong>Akte</strong> in Strafsachen, die aussagekräftige Hinweise für<br />
die Voraussetzungen einer praktikablen Handhabung geben könnte, ist<br />
<strong>im</strong> Ausland nicht zu erkennen.<br />
Dies gilt namentlich unter Beachtung <strong>der</strong> unterschiedlichen Rahmenbe-<br />
dingungen.<br />
Es fällt auf, dass in Län<strong>der</strong>n, in denen die „elektronische <strong>Justiz</strong>“ weit fort-<br />
geschritten ist, deutliche Abstriche hinsichtlich <strong>der</strong> Sicherung von Au-<br />
thentizität und Integrität gemacht worden sind. Ein reines E- Mail- Ver-<br />
fahren mit <strong>der</strong> bloßen Möglichkeit einer Identitätsprüfung durch das Ge-<br />
richt (wie in Finnland) dürfte den Anfor<strong>der</strong>ungen unter den in Deutsch-<br />
land gegebenen Verhältnissen nicht genügen.<br />
Dies gilt allemal für das Strafrecht, das eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung<br />
mit Zugangsmöglichkeiten von außen kaum verkraften dürfte.<br />
Symptomatisch dafür dürfte sein, dass auch in Österreich, dem Muster-<br />
land <strong>der</strong> „elektronischen <strong>Justiz</strong>“ die elektronische <strong>Akte</strong> in Strafsachen<br />
„Zukunftsmusik“ ist.<br />
Skepsis wird auch – insbeson<strong>der</strong>e <strong>im</strong> schweizerischen Rechtskreis – bei<br />
Versuchen geäußert, die mündliche Verhandlung zu „elektronisieren“,<br />
weil die Beurteilung von Glaubwürdigkeit und vergleichbarer Wertungen<br />
auf virtuellem Weg kaum möglich erscheint.<br />
Dies darf jedoch keinesfalls dazu führen, die Nutzung <strong>der</strong> Möglichkeiten<br />
<strong>der</strong> EDV zu unterlassen. Insbeson<strong>der</strong>e die unterstützende elektronische<br />
<strong>Akte</strong>nführung und die Erleichterung von <strong>Akte</strong>neinsicht birgt erhebliches<br />
Beschleunigungs- und Erleichterungspotenzial. Dabei muss – wie dies<br />
z.B. in Luxemburg geschieht – Wert darauf gelegt werden, dass die An-<br />
wendungen eine Weiterentwicklung zulassen.<br />
32
III. Überblick de lege lata über die rechtliche Ausgestaltung<br />
elektronischer <strong>Akte</strong>n in verschiedenen Rechtsordnungen<br />
(z. B. VwGO, ZPO, FGO, SGG usw.)<br />
1. Ausgangsüberlegungen<br />
Mit dem <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz (JKomG) vom 22. März 2005, in<br />
Kraft getreten am 1. April 2005, sind grundlegende Voraussetzungen für<br />
die Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> in den verschiedenen Verfah-<br />
rensordnungen (ZPO, ArbGG, FGO, SGG, VwGO, OWiG) geschaffen<br />
worden. Dies gilt, wie bereits angesprochen, in dieser Form nicht für<br />
das <strong>Strafverfahren</strong>.<br />
Gedanklich ist zwar zunächst die Frage „<strong>Elektronische</strong> <strong>Akte</strong>nführung"<br />
von <strong>der</strong> Frage des elektronischen Rechtsverkehrs zu trennen. Es beste-<br />
hen jedoch eindeutig auch Verbindungslinien. So macht einerseits eine<br />
elektronische <strong>Akte</strong> ohne prägenden elektronischen Rechtsverkehr auf<br />
Dauer wenig Sinn. Die rechtliche Zulassung und tatsächliche Existenz<br />
von elektronischem Rechtsverkehr drängt an<strong>der</strong>erseits zu <strong>der</strong> Überle-<br />
gung, ob dies in eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung münden sollte. Der<br />
Schwerpunkt liegt hier auf den Best<strong>im</strong>mungen, die sich ausdrücklich -<br />
nur - mit <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> befassen. Die verfahrensrechtliche<br />
Behandlung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> in den öffentlich-rechtlichen Pro-<br />
zessordnungen (VwGO, FGO, SGG) folgt dabei weitestgehend den<br />
zivilprozessualen Grundsätzen. Dies gilt auch für die Arbeitsgerichts-<br />
barkeit. Daher orientiert sich die Darstellung <strong>im</strong> Folgenden vorrangig<br />
an den einschlägigen zivilprozessualen Regelungen mit Querverwei-<br />
sung auf die übrigen Prozessordnungen.<br />
In die Übersicht einbezogen werden dabei auch die Normen des<br />
OWiG-Verfahrens. Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e dort, wo die Regelungen zur<br />
elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Bußgeldverfahren von den übrigen Verfahrens-<br />
ordnungen abweichen. Die Übersicht erfolgt auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong><br />
Vorschriften des <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetzes von März 2005. Sie<br />
33
efasst sich mit den Regelungen, in denen allgemein interessierende<br />
Aussagen zu einer elektronischen <strong>Akte</strong>nführung getroffen werden.<br />
Von beson<strong>der</strong>em Interesse ist dabei die Frage, wie <strong>der</strong> Gesetzgeber<br />
insbeson<strong>der</strong>e auch das Verhältnis von eingehenden<br />
Papierdokumenten und elektronischer <strong>Akte</strong> sieht. Denn in einem<br />
Punkt sind die Prognosen relativ einheitlich und eindeutig: Auch bei<br />
Umstellung auf eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung muss noch auf<br />
unabsehbare Zeit mit Eingängen in Papierform gerechnet werden, die<br />
in die elektronische <strong>Akte</strong> integriert werden müssen. Das hängt u. a.<br />
damit zusammen, dass <strong>im</strong> Bereich <strong>der</strong> Normalverfahren eine<br />
flächendeckende - d. h. also alle Privatpersonen - verpflichtende<br />
Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr zurzeit nicht in Sicht ist.<br />
Der Überblick beschränkt sich weitgehend auf eine beschreibende<br />
Darstellung <strong>der</strong> einzelnen Regelungen. Angesichts des Umstandes, dass<br />
die Regelungen teilweise noch nicht in Kraft gesetzt wurden (vgl. dazu<br />
3.1) und, soweit ersichtlich, auch in neueren Kommentaren zum<br />
Prozessrecht mangels einschlägiger Rechtsprechung ganz überwiegend<br />
nur die Gesetzeslage wie<strong>der</strong>gegeben wird, erscheint eine kritische<br />
Überprüfung von Einzelregelungen zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht.<br />
2. Überblick über die rechtliche Ausgestaltung <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> in den einzelnen Verfahrensordnungen<br />
2.1 Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
§ 298a Abs. 1 Satz 1 ZPO enthält als Grundsatz: Die Prozessakten<br />
können elektronisch geführt werden. Damit wird die Möglichkeit einer<br />
elektronischen <strong>Akte</strong>nführung gesetzlich festgeschrieben. In § 55b Abs.<br />
1 VwGO, § 52b Abs. 1 FGO, § 65b Abs. 1 SGG, § 46d Abs. 1 ArbGG<br />
finden sich dieselben Formulierungen. In § 11 Ob Abs. 1 OWiG heißt es<br />
in vergleichbarer Weise: Die Verfahrensakten können elektronisch ge-<br />
führt werden.<br />
In allen Prozessordnungen wird sodann vorgesehen, dass die Bun-<br />
desregierung und die Landesregierungen für ihren Bereich durch<br />
Rechtsverordnung den Zeitpunkt best<strong>im</strong>men, von dem an elektroni-<br />
34
sche <strong>Akte</strong>n geführt werden sowie die hierfür geltenden organisatorisch-<br />
technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Auf-<br />
bewahrung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>n.<br />
2.2 Beschränkung auf einzelne Gerichte o<strong>der</strong> Verfahren<br />
§ 298a Abs. 1 Satz 4 ZPO enthält den Zusatz: Die Zulassung <strong>der</strong> elektro-<br />
nischen <strong>Akte</strong> kann auf einzelne Gerichte o<strong>der</strong> Verfahren beschränkt<br />
werden. Dieselbe Regelung enthält § 55b Abs. 1 VwGO, § 52b Abs. 1<br />
FGO, § 65b Abs. 1 SGG, § 46d Abs. 1 ArbGG. Nach § 11 Ob Abs. 1 O-<br />
WiG kann die Zulassung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>nführung auf einzelne<br />
Behörden, Gerichte o<strong>der</strong> Verfahren beschränkt werden. Mit diesen Be-<br />
st<strong>im</strong>mungen wird deutlich, dass auch <strong>der</strong> Gesetzgeber gesehen hat, dass<br />
eine sofortige und umfassende Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> so<br />
nicht möglich ist, dass insbeson<strong>der</strong>e erst Erfahrungswerte in Teilberei-<br />
chen gewonnen werden müssen. Vor <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> müssen eine Vielzahl von rechtlichen, organisatorischen und techni-<br />
schen Problemen gelöst werden. Daher erhält auch nach <strong>der</strong> gesetzlichen<br />
Konzeption <strong>der</strong> Gedanke von Pilotprojekten <strong>im</strong> Bereich <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> eine herausragende Bedeutung.<br />
2.3 <strong>Elektronische</strong> <strong>Akte</strong>nführung und Dokumententransfer<br />
Es wurde bereits <strong>der</strong> Gedanke betont, dass es auch bei einer elekt-<br />
ronischen <strong>Akte</strong>nführung noch auf viele Jahre Papierdokumente ein-<br />
gehen werden. Daher sind die Normen von Interesse, die die Trans-<br />
formation von Papierunterlagen in elektronische Dokumente ausgestal-<br />
ten.<br />
Zentralnorm in diesem Zusammenhang ist § 298a Abs. 2 Satz 1<br />
ZPO: In Papierform eingereichte Schriftstücke und sonstige Unterla-<br />
gen sollen zur Ersetzung <strong>der</strong> Urschriften in ein elektronisches Doku-<br />
ment übertragen werden. § 298a Abs. 2 Satz 1 ZPO wird inhaltlich er-<br />
gänzt durch § 298a Abs. 3 ZPO. Danach muss das elektronische Do-<br />
kument den Vermerk enthalten, wann und durch wen die Unterlagen<br />
in ein elektronisches Dokument übertragen worden sind. Vergleichbare<br />
Regelungen, wenn auch teilweise sprachlich an<strong>der</strong>s dargestellt, enthal-<br />
35
ten § 55b Abs. 2, 4 VwGO, § 52b Abs. 2, 4 FGO, § 65b Abs. 2, 4<br />
SGG, § 46d Abs. 2, 3 ArbGG, § 110 b Abs. 2 OWiG.<br />
Nicht ausdrücklich angesprochen wird die Frage, wie Asservate, die sich<br />
strukturell <strong>der</strong> Umwandlung in elektronische Dokumente entziehen, bei<br />
einer elektronischen <strong>Akte</strong>nführung verwaltet werden sollen. Diese<br />
Frage ist in den einzelnen Verfahrensordnungen von unterschiedlicher<br />
Bedeutung. Sie gehört zu den organisatorischen Problemen, die auch<br />
bei einer elektronischen <strong>Akte</strong>nführung mitbedacht werden müssen.<br />
2.4 Die allgemeine beweisrechtliche Bedeutung des transferierten<br />
Papierdokuments<br />
Der unter 2.3. beschriebene Transfer eines Papierdokuments in ein<br />
elektronisches Dokument zwingt bereits <strong>im</strong> Ansatz zu einer<br />
Grundsatzentscheidung: Entwe<strong>der</strong> wird das neu hergestellte elektroni-<br />
sche Dokument das zentrale Beweismittel o<strong>der</strong> aber es wird auch wei-<br />
terhin entscheidend auf das - ursprüngliche - Papierdokument abge-<br />
stellt. Dieses zweite Konzept hat dann zur Folge, dass Papierdoku-<br />
mente auch weiterhin geordnet aufbewahrt werden müssen. Das Jus-<br />
tizkommunikationsgesetz entscheidet sich für die zweite Lösung (vgl.<br />
2.4.1), wobei aber <strong>im</strong> Bereich des Ordnungswidrigkeitenverfahrens<br />
nicht unwesentliche Abweichungen bestehen (vgl. 2.4.2).<br />
2.4.1 Zur grundsätzlichen Konzeption des JKomG<br />
Gemäß § 298a Abs. 2 Satz 2 ZPO - gleichlautend § 46d Abs. 2 Satz<br />
2 ArbGG - sind die (Papier-) Unterlagen, soweit sie in Papierform<br />
weiter benötigt werden, mindestens bis zum rechtskräftigen Abschluss<br />
des Verfahrens aufzubewahren. Die Frage, wer zu welchem Zeitpunkt<br />
entscheidet, ob das Papieroriginal weiter benötigt wird, regelt das Ge-<br />
setz nicht.<br />
Gemäß § 55b Abs. 3 VwGO, § 52b Abs. 3 FGO, § 65b Abs. 3 SGG<br />
sind die Originaldokumente mindestens bis zum rechtskräftigen Ab-<br />
schluss des Verfahrens aufzubewahren.<br />
Zu <strong>der</strong> Frage, wie lange <strong>im</strong> Ergebnis die Papierunterlagen aufbewahrt<br />
werden müssen, macht das JKomG selbst keine Angaben.<br />
36
Dagegen enthalten die Best<strong>im</strong>mungen nach dem JKomG Regelungen<br />
darüber, ob die Original (Papier-) Dokumente o<strong>der</strong> das neu hergestellte<br />
elektronische Dokument für das Verfahren zugrunde zu legen sind. §<br />
55b Abs. 5 VwGO, gleichlautend § 52b Abs. 5 FGO, § 65b Abs. 5<br />
SGG, enthält als Grundsatzregel: Dokumente, die nach Abs. 2<br />
hergestellt sind, sind für das Verfahren zugrunde zu legen, soweit<br />
kein Anlass besteht, an <strong>der</strong> Übereinst<strong>im</strong>mung mit dem eingereichten<br />
Dokument zu zweifeln. Danach kann also das durch Medientransfer<br />
hergestellte elektronische Dokument grundsätzlich für das Verfahren<br />
zugrunde gelegt werden. Ob die opt<strong>im</strong>istische Prognose in <strong>der</strong><br />
Gesetzesbegründung, dass in aller Regel die Identität nicht infrage<br />
gestellt sein wird, gerechtfertigt ist, wird erst die Zukunft zeigen.<br />
2.4.2 Zur Konzeption des OWiG<br />
Vergleichend zu den genannten Verfahrensordnungen wird an dieser<br />
Stelle die Konzeption des Ordnungswidrigkeitenverfahrens darge-<br />
stellt. Vertiefende Einzelheiten zum Ordnungswidrigkeitenverfahren<br />
werden unter IV 2.3 vorgestellt und untersucht.<br />
Wie in den übrigen genannten Verfahrensordnungen können auch<br />
nach dem OWiG (§ 110 b Abs. 1) Verfahrensakten elektronisch ge-<br />
führt werden. Damit stellt sich auch dort die Frage des Medien-<br />
transfers. Nach § 110 b Abs. 2 sind dafür geeignete Schriftstücke zur<br />
Ersetzung <strong>der</strong> Urschrift grundsätzlich in ein elektronisches Dokument<br />
zu übertragen. Gleiches gilt für Gegenstände des Augenscheins, die<br />
sich für eine Übertragung eignen. Gemäß § 110 b Abs. 2 Satz 2 OWiG<br />
muss das elektronische Dokument - wie in den an<strong>der</strong>en Verfahrensord-<br />
nungen auch - den Vermerk enthalten, wann und durch wen die Ur-<br />
schrift übertragen wurde. Auch die Regelung, dass die Urschriften<br />
bis zum Abschluss des Verfahrens aufzubewahren sind (§ 110 b Abs. 2<br />
Satz 3 OWiG), entspricht <strong>der</strong> allgemeinen Konzeption des JKomG (vgl.<br />
z. B. § 55b Abs. 3 VwGO). Wie die Urschriften aufzubewahren sind,<br />
wird <strong>im</strong> Gesetz nicht geregelt. § 110 b Abs. 2 Satz 3 OWiG einhält<br />
jedoch gegenüber den an<strong>der</strong>en Verfahrensordnungen eine ausdrückli-<br />
37
che Son<strong>der</strong>regelung: Die Urschriften sind so aufzubewahren, dass sie<br />
auf Anfor<strong>der</strong>ung innerhalb von einer Woche vorgelegt werden können.<br />
Bei <strong>der</strong> Best<strong>im</strong>mung dieser Frist hat sich <strong>der</strong> Gesetzgeber an den<br />
Ladungsfristen des § 71 Abs. 1 OWiG und § 217 StPO orientiert.<br />
Ob dies eine tragfähige Begründung für diese isoliert wirkende Be-<br />
st<strong>im</strong>mung ist, kann zweifelhaft sein. Insbeson<strong>der</strong>e könnte zweifelhaft<br />
sein, ob <strong>der</strong> Zweck <strong>der</strong> Regelung - Erhalt <strong>der</strong> Originalunterlagen durch<br />
das Gericht ohne Zeitverlust - wirklich erreicht werden kann.<br />
Denn die Rechtsfolgen einer Fristüberschreitung sind <strong>im</strong> Gesetz nicht<br />
geregelt. Bezüglich einer Vernichtungsmöglichkeit des Papierdoku-<br />
ments enthält das OWiG eine Son<strong>der</strong>regelung gegenüber den ande-<br />
ren Verfahrensordnungen. Gemäß § 110 b Abs. 4 OWiG ist eine Ver-<br />
nichtung <strong>der</strong> Urschrift vor Abschluss des Verfahrens möglich, wenn<br />
das elektronische Dokument zusätzlich zu dem Vermerk nach Abs. 2<br />
Satz 2 noch eine qualifizierte Signatur enthält. Das OWiG enthält<br />
auch Regelungen zur Frage, wie das Verhältnis von Urschrift und<br />
transferiertem elektronischen Dokument zu lösen ist. Gemäß § 110 e<br />
Abs. 1 OWiG ist ein <strong>im</strong> Wege des Transfers hergestelltes elektroni-<br />
sches Dokument hinsichtlich <strong>der</strong> Beweisaufnahme wie ein Schriftstück<br />
zu behandeln. Einer Vernehmung <strong>der</strong> einen Vermerk nach § 110 b Abs.<br />
2 Satz 2 o<strong>der</strong> Abs. 4 Satz 1 verantwortenden Person bedarf es nicht.<br />
Gemäß § 110 e Abs. 2 OWiG entscheidet das Gericht nach pflicht-<br />
gemäßem Ermessen, ob es für die Durchführung <strong>der</strong> Beweisaufnah-<br />
me eine zusätzlich zum elektronischen Dokument aufbewahrte Ur-<br />
schrift hinzuzieht. Damit stellt sich <strong>der</strong> Gesetzgeber jedenfalls <strong>im</strong><br />
OWiG-Verfahren etwas ausführlicher <strong>der</strong> grundsätzlichen Problema-<br />
tik: Dass die Gerichte durch die Aufbewahrungspflicht <strong>der</strong> Original-<br />
dokumente zu einer doppelten <strong>Akte</strong>nführung gezwungen sein könnten<br />
und damit <strong>der</strong> Vereinfachungseffekt einer elektronischen <strong>Akte</strong> aufge-<br />
hoben sein könnte. Mit <strong>der</strong> Regelung des § 110 e Abs. 2 OWiG - He-<br />
ranziehung <strong>der</strong> Originaldokumente für die Beweisaufnahme nach<br />
pflichtgemäßem Ermessen des Gerichts - wird auch indirekt die<br />
Grundsatzfrage angesprochen, ob ein Verteidiger z. B. über einen Be-<br />
38
weisantrag großflächig die Einführung <strong>der</strong> ursprünglichen Papierdo-<br />
kumente erzwingen kann.<br />
Die Gesetzesbegründung geht davon aus, dass eine solche<br />
Heranziehung nur in sehr seltenen Ausnahmefällen veranlasst sein wird.<br />
Die Praxisumsetzung muss noch die Antwort geben, ob diese<br />
Einschätzung wirklich berechtigt war. Festzuhalten ist, dass § 110 e<br />
OWiG - nur - die Durchführung <strong>der</strong> Beweisaufnahme regelt, nicht<br />
jedoch die Beweiswürdigung selbst. Geregelt wird also insbeson<strong>der</strong>e<br />
nicht, ob <strong>der</strong> Richter davon ausgehen kann, dass es sich bei dem<br />
Dokument um eine vollständige und korrekte Wie<strong>der</strong>gabe <strong>der</strong> Urschrift<br />
handelt.<br />
2.5 Signaturfragen bei <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
Eine Vielzahl von gerichtlichen Dokumenten bedürfen <strong>der</strong> Unter-<br />
schrift von Amtspersonen <strong>im</strong> weitesten Sinn, z. B. Urteile (§ 315 ZPO)<br />
o<strong>der</strong> Protokolle (§ 163 ZPO). Es muss daher die Frage geregelt werden,<br />
wie dies bei einer elektronischen <strong>Akte</strong>nführung zu handhaben ist. Die<br />
Antwort findet sich für den Zivilprozess in § 130b ZPO: Soweit die-<br />
ses Gesetz dem Richter, dem Rechtspfleger, dem Urkundsbeamten<br />
<strong>der</strong> Geschäftsstelle o<strong>der</strong> dem Gerichtsvollzieher die handschriftliche<br />
Unterzeichnung vorschreibt, genügt dieser Form die Aufzeichnung<br />
als elektronisches Dokument, wenn die verantwortenden Personen<br />
am Ende des Dokuments ihren Namen hinzufügen und das Dokument<br />
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen.<br />
Vergleichbare Regelungen beinhalten § 55a Abs. 3 VwGO, § 52a<br />
Abs. 3 FGO, § 65a Abs. 3 SGG, § 46c ArbGG, § 110 c Abs. 1 OWiG,<br />
wobei diese Regelungen dabei noch ausdrücklich auf das Signaturge-<br />
setz Bezug nehmen.<br />
Dabei wird bereits jetzt die Frage diskutiert, ob diese Sicherheitsanforde-<br />
rungen durch eine qualifizierte elektronische Signatur als überzogen<br />
eingestuft werden müssen. St<strong>im</strong>men Namensangabe und Signaturin-<br />
haber nicht überein, ist das elektronische Dokument mit einem Form-<br />
mangel behaftet. Über die Rechtsfolgen binnenjustizieller Formmängel<br />
soll ausweislich <strong>der</strong> Gesetzesbegründung wie bisher die Rechtspre-<br />
chung entscheiden. Vergleichbare Anfor<strong>der</strong>ungen - qualifizierte Signatur<br />
39
- verlangt das Gesetz <strong>im</strong> Übrigen auch für den allgemeinen eingehen-<br />
den elektronischen Rechtsverkehr (§ 130a ZPO, § 55a VwGO, §<br />
52a Abs. 1 FGO, § 65a Abs. 1 SGG), jedenfalls dort, wo die Dokumen-<br />
te einem schriftlich zu unterzeichnenden Schriftstück gleichstehen. Auch<br />
bei diesen Fachgerichtsbarkeiten wird <strong>der</strong> elektronische Rechtsverkehr<br />
erst durch eine Rechtsverordnung <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>verwaltungen eröffnet (vgl.<br />
z. B. § 55a Abs. 1 Satz 1 VwGO). Es muss dabei als überraschend be-<br />
zeichnet werden, dass bei diesen Fachgerichtsbarkeiten <strong>im</strong> Gegensatz<br />
zur ZP0 neben <strong>der</strong> qualifizierten Signatur auch ein an<strong>der</strong>es Verfahren<br />
zugelassen werden kann, das die Authentizität und die Integrität des ü-<br />
bermittelten elektronischen Dokuments sicherstellt (vgl. § 55a 1 4<br />
VwGO). Die Landesjustizverwaltungen sollen bereits angekündigt ha-<br />
ben, aus Gründen <strong>der</strong> Einheitlichkeit von dieser Möglichkeit keinen<br />
Gebrauch zu machen.<br />
2.6 Zur Beweiskraft von elektronischen Dokumenten<br />
Nach § 371a Abs. 1 ZPO finden auf private elektronische Dokumente,<br />
die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind, die<br />
Vorschriften über die Beweiskraft privater Urkunden entsprechende<br />
Anwendung. Der Anschein <strong>der</strong> Echtheit einer in elektronischer Form<br />
vorliegenden Erklärung kann nur durch Tatsachen erschüttert werden,<br />
die ernstliche Zweifel daran begründen, dass die Erklärung vom Sig-<br />
naturschlüssel-Inhaber abgegeben worden ist (§ 371a Abs. 1 Satz 2<br />
ZPO). Damit arbeitet <strong>der</strong> Gesetzgeber mit <strong>der</strong> Figur des Anscheins-<br />
beweises. In vergleichbarer Weise stellt § 371a Abs. 2 ZPO den Be-<br />
weiswert öffentlicher elektronischer Dokumente dem Beweiswert öf-<br />
fentlicher Urkunden gleich. Ausweislich <strong>der</strong> Gesetzesbegründung soll<br />
diese Vorschrift zugleich die gesetzliche Leitentscheidung bekräftigen,<br />
dass elektronische Dokumente dem Beweis durch Augenschein unter-<br />
fallen. Diese beweisrechtliche Gleichstellung des elektronischen Do-<br />
kuments mit <strong>der</strong> Papierurkunde wird als notwendige Voraussetzung für<br />
einen medienbruchfreien elektronischen Rechtsverkehr angesehen.<br />
2.7 Der Rücktransfer von elektronischen Dokumenten in Papierdokumente<br />
Auch bei einer elektronischen <strong>Akte</strong>nführung muss für eine Übermittlung in<br />
40
Papier an solche Prozessbeteiligten gesorgt werden, die nicht über<br />
einen elektronischen Zugang verfügen. § 298 Abs. 1 ZPO regelt dabei<br />
den binnenjustiziellen Medientransfer eines bei Gericht eingegangenen<br />
(§ 130a ZPO) o<strong>der</strong> bei Gericht erstellten elektronischen Dokuments in die<br />
Papierform, die dann den Prozessbeteiligten übermittelt werden kann.<br />
Nach § 298 Abs. 2 ZPO - ebenso § 55b IV 2 VwGO, § 52b IV 2 FGO, §<br />
65b IV 2 SGG - ist dafür ein Transfervermerk erfor<strong>der</strong>lich, <strong>der</strong> das<br />
Ergebnis <strong>der</strong> Integritätsprüfung, den Inhaber des Signaturschlüssels und<br />
den Zeitpunkt feststellen muss, an dem die elektronische Signatur mit<br />
dem Dokument verbunden wurde. Eine Rücktransferregelung enthält<br />
auch § 317 III ZPO. Danach können Ausfertigungen eines als<br />
elektronisches Dokument vorliegenden Urteils von einem<br />
Urteilsausdruck gemäß § 298 ZPO erteilt werden.<br />
2.8 <strong>Akte</strong>neinsichtsrecht bei elektronischer <strong>Akte</strong>nführung<br />
§ 299 Abs. 3 ZPO - ähnlich § 110 d Abs. 2 OWiG - regelt die <strong>Akte</strong>n-<br />
einsicht bei elektronisch geführten <strong>Akte</strong>n. Danach kann <strong>Akte</strong>neinsicht<br />
durch Erteilung eines <strong>Akte</strong>nausdrucks, durch Wie<strong>der</strong>gabe auf einem<br />
Bildschirm o<strong>der</strong> Übermittlung von elektronischen Dokumenten gewährt<br />
werden.<br />
Für die Übermittlung ist die Gesamtheit <strong>der</strong> Dokumente mit einer<br />
qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und gegen unbefug-<br />
te Kenntnisnahme zu schützen (vgl. § 299 Abs. 3 Satz 4 ZPO). Aus-<br />
weislich § 299 Abs. 3 Satz 2 ZPO kann nach dem Ermessen des<br />
Vorsitzenden Bevollmächtigten, die Mitglied einer Rechtsanwaltskam-<br />
mer sind, <strong>der</strong> elektronische Zugriff auf den Inhalt <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>n gestattet<br />
werden.<br />
In vergleichbarer Weise regelt § 110 d Abs. 2 Satz 3 OWiG für das Buß-<br />
geldverfahren, dass dem Verteidiger nach Abschluss <strong>der</strong> Ermittlungen<br />
auf Antrag <strong>Akte</strong>neinsicht auch durch die Gestattung des automatisier-<br />
ten Abrufs <strong>der</strong> elektronisch geführten <strong>Akte</strong> gewährt werden kann. Bei<br />
diesem automatisierten Abrufverfahren sind die datenschutzrechtlichen<br />
Standards zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass eine Verän<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> während des Zugriffs nicht möglich ist. Gesi-<br />
chert sein muss auch, dass <strong>der</strong> Abruf <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> nur durch<br />
41
den Verteidiger, nicht aber einen unberechtigten Dritten möglich sein<br />
darf.<br />
3. Zusammenfassung und Ausblick<br />
Durch das <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz sind für die einzelnen Verfah-<br />
rensordnungen die Voraussetzungen für die Einführung <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> geschaffen worden. Der Gesetzgeber hat sich bisher nicht<br />
dazu entschieden, die elektronische <strong>Akte</strong> auch <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> einzu-<br />
führen.<br />
Aus den gesetzlichen Vorschriften lassen sich bereits jetzt zentrale Ge-<br />
sichtspunkte für die Ausgestaltung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ableiten.<br />
Bereits jetzt zeigt sich jedoch auch, dass insbeson<strong>der</strong>e in Detailfra-<br />
gen noch eine Fülle von rechtlichen, technischen und organisatori-<br />
schen Problemen bestehen, die <strong>im</strong> Zusammenhang mit <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> gelöst werden müssen.<br />
Wichtig ist, dass die Normen sich <strong>im</strong> Echtbetrieb <strong>der</strong> Praxis bewähren. Nur<br />
so ist die allgemeine Akzeptanz zu erreichen, die Voraussetzung für eine<br />
zeitnahe Umsetzung des Konzepts <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ist.<br />
Notwendig ist insbeson<strong>der</strong>e auch, dass ein einheitlicher Rechtsrahmen<br />
für den elektronischen Rechtsverkehr und die elektronische<br />
<strong>Akte</strong>nführung entwickelt wird. Wenn auch fö<strong>der</strong>ale Gesichtspunkte zu<br />
berücksichtigen sind, bleibt eines als zentrale For<strong>der</strong>ung: Die<br />
Einheitlichkeit des Zugangs zur <strong>Justiz</strong> in ganz Deutschland und über<br />
Län<strong>der</strong>grenzen hinaus.<br />
Der Bundesgesetzgeber kann eine höhere Akzeptanz <strong>der</strong> neuen<br />
Technologien dadurch erreichen, dass die Voraussetzungen in allen<br />
Verfahrensordnungen, soweit möglich, einheitlich ausgestaltet werden.<br />
Dies ist nicht überall gelungen. So enthalten § 55b Abs. 3 VwGO,<br />
§ 52b Abs. 3 FGO und § 65b Abs. 3 SGG die gleichlautende<br />
Formulierung, dass die Originaldokumente (trotz Medientransfers)<br />
mindestens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens<br />
aufzubewahren sind. In § 298 a Abs. 2 Satz 2 ZPO heißt es<br />
dagegen: Die Unterlagen sind, soweit sie in Papierform weiter<br />
42
enötigt werden, mindestens bis zum rechtskräftigen Abschluss des<br />
Verfahrens aufzubewahren. Es fragt sich, ob diesem Zusatz „sofern sie in<br />
Papierform weiter benötigt werden" ein tieferer Sinn beizumessen ist.<br />
Bereits jetzt wird in <strong>der</strong> Kommentierung zu § 298 a ZPO jedenfalls<br />
eindringlich davor gewarnt, großflächig Originaldokumente vor<br />
Abschluss des Verfahrens zu vernichten.<br />
Ein weiteres Beispiel für die fehlende Abst<strong>im</strong>mung <strong>der</strong> Sachregelungen<br />
in den einzelnen Verfahrensordnungen ist § 110 e Abs. 2 OWiG. Danach<br />
entscheidet das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen über die Heran-<br />
ziehung <strong>der</strong> Urschriften bei <strong>der</strong> Beweisaufnahme. Gemäß § 55b Abs. 5<br />
VwGO sind dagegen die elektronischen Dokumente für das Verfahren<br />
zugrunde zu legen, soweit kein Anlass besteht, an <strong>der</strong> Übereinst<strong>im</strong>-<br />
mung mit dem eingereichten Dokument zu zweifeln. Auch hier stellt sich<br />
die Frage, ob mit den unterschiedlichen Formulierungen unterschiedliche<br />
Sachlösungen (z. B. gebundenes o<strong>der</strong> freies Ermessen) verbunden sind.<br />
Ansonsten hat <strong>der</strong> Überblick über die verschiedenen Verfahrensord-<br />
nungen aber gezeigt, dass <strong>der</strong> Gesetzgeber sich bei <strong>der</strong> Einführung<br />
<strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> weitgehend an einem einheitlichen Rechts-<br />
rahmen orientiert hat.<br />
IV. Überblick de lege lata über die rechtliche und tatsächliche<br />
Ausgestaltung elektronischer Kommunikation <strong>im</strong> Ordnungswidrigkeiten-<br />
und Strafrecht<br />
1. Einführung<br />
Die gegenwärtige Bedeutung elektronischer Kommunikation <strong>im</strong> Bereich<br />
<strong>der</strong> Strafgerichte und Staatsanwaltschaften soll aus verschiedenen Blick-<br />
winkeln dargestellt werden. Zunächst soll die Relevanz <strong>der</strong> vollelektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Ordnungswidrigkeiten- und <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> untersucht<br />
werden. Anhand <strong>der</strong> hierzu gewonnenen Ergebnisse soll dann herausge-<br />
arbeitet werden, inwieweit die durch den Gesetzgeber vorgegebene Ziel-<br />
best<strong>im</strong>mung eines weitgehend papierfreien Verfahrensablaufs bereits<br />
umgesetzt werden konnte.<br />
43
Darüber hinaus werden gegenwärtig zahlreiche elektronische Hilfsmittel<br />
von Strafgerichten und Staatsanwaltschaften eingesetzt. Die Darstellung<br />
soll einen Überblick über die wichtigsten Hilfsmittel bieten. Dabei wird auf<br />
regionale Beson<strong>der</strong>heiten eingegangen und Grenzen und Schwierigkei-<br />
ten be<strong>im</strong> Einsatz elektronischer Instrumentarien werden aufgezeigt. Im<br />
Zentrum dieses Abschnitts stehen insbeson<strong>der</strong>e Ausführungen zur sog.<br />
elektronischen „Hilfsakte“.<br />
Obgleich <strong>im</strong> Rahmen dieser Darstellung auch die Bedeutung <strong>der</strong> Verbin-<br />
dungen und Schnittstellen zu an<strong>der</strong>en Behörden, insbeson<strong>der</strong>e den Ord-<br />
nungs- und Polizeibehörden und den <strong>Justiz</strong>vollzugsanstalten, deutlich<br />
werden wird, wird auf <strong>der</strong>en Bedürfnisse und Interessen sowie infrastruk-<br />
turelle Ausstattung <strong>im</strong> IT-Bereich nur eingegangen, soweit es für Fragen<br />
<strong>der</strong> Strafjustiz zwingend erfor<strong>der</strong>lich ist. Gleiches gilt für Fragen betref-<br />
fend die informationstechnische Unterstützung des justiziellen Haushalts-<br />
und Personalwesens. Abzugrenzen ist die hier zu behandelnde Thematik<br />
zudem von Fragen des sog. elektronischen Rechtsverkehrs. Zwar ist die<br />
elektronische <strong>Akte</strong>nführung insgesamt ohne einen damit korrespondie-<br />
renden elektronischen Rechtsverkehr nicht denkbar; <strong>im</strong> Interesse einer<br />
deutlichen Akzentuierung des Themas soll <strong>der</strong> Schwerpunkt des Gutach-<br />
tens indes auf zentrale Fragen <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> gesetzt werden.<br />
Um ein möglichst vollständiges Bild von <strong>der</strong> rechtspraktischen Bedeutung<br />
<strong>der</strong> elektronischen Medien und ihren verschiedenen Einsatzgebieten zu<br />
erhalten, wurde für das vorliegende Gutachten auf verschiedene Er-<br />
kenntnisquellen zurückgegriffen. Neben bereits bestehenden Erhebungen<br />
einzelner Behörden, wie beispielsweise die sog. „Jenaer-Synopse“ <strong>der</strong><br />
Generalstaatsanwaltschaft des Freistaats Thüringen o<strong>der</strong> die aktuellen<br />
Län<strong>der</strong>berichte an die Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Datenverarbeitung<br />
und Rationalisierung in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> zum elektronischen Rechtsverkehr<br />
(BLK), wurden teilweise Fragenkataloge an Ordnungsbehörden und Jus-<br />
tizverwaltungen gesandt und später ausgewertet. Mit Vertretern zahlrei-<br />
cher <strong>Justiz</strong>verwaltungen und Ordnungsbehörden sowie <strong>der</strong> Gerichte wur-<br />
den Einzelgespräche über den IT-Bereich, best<strong>im</strong>mte Vorhaben o<strong>der</strong> re-<br />
gionale Beson<strong>der</strong>heiten geführt. Gleiches gilt insbeson<strong>der</strong>e für verschie-<br />
44
dene Innenministerien und -behörden zu Fragen <strong>der</strong> Organisation einer<br />
elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Bußgeldverfahren. Angesichts <strong>der</strong> zahlreichen re-<br />
gionalen Unterschiede auch und gerade <strong>im</strong> Bereich des Ordnungswidrig-<br />
keitenverfahrens, insbeson<strong>der</strong>e auf Grund stark unterglie<strong>der</strong>ter ord-<br />
nungsbehördlicher Zuständigkeiten, kann und soll diese Erhebung natür-<br />
lich nicht den Anspruch <strong>der</strong> Vollständigkeit erheben.<br />
Bevor auf die rechtstatsächliche Entwicklung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
bzw. <strong>der</strong> verschiedenen Formen elektronischer Hilfsmittel <strong>im</strong> Folgenden<br />
eingegangen wird, sollen zunächst <strong>der</strong>en rechtliche und tatsächliche Vor-<br />
gaben skizziert werden.<br />
2. Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
Schon bevor es ausdrückliche Regelungen für den elektronischen<br />
Rechtsverkehr und die elektronische <strong>Akte</strong>nführung <strong>im</strong> OWiG gab, führten<br />
Ordnungsbehörden verschiedener Bundeslän<strong>der</strong> Pilotprojekte zur aus-<br />
schließlich elektronisch geführten <strong>Akte</strong> in straßenverkehrsrechtlichen<br />
Bußgeldverfahren durch. Eingebunden in dieses Vorgehen waren neben<br />
den Polizeivollzugsbehörden teilweise auch die jeweils zuständigen<br />
Rechtsanwaltskammern nicht jedoch die Gerichte und Staatsanwaltschaf-<br />
ten. Für eine Koordinierung insbeson<strong>der</strong>e mit <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> bestand mangels<br />
eines rechtlichen Rahmens lange Zeit keine Notwendigkeit. Eine bundes-<br />
landübergreifende Abst<strong>im</strong>mung <strong>der</strong> einzelnen Modellversuche erfolgte bis<br />
auf sporadische Anfragen nicht.<br />
Mit Inkrafttreten des <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetzes (JKomG) <strong>im</strong> Jahre<br />
2005 erhielt unter an<strong>der</strong>em das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten einen<br />
neuen Abschnitt, in dem neben dem elektronischen Rechtsverkehr auch<br />
die elektronische <strong>Akte</strong>nbearbeitung <strong>im</strong> Bußgeldverfahren umfassend ge-<br />
regelt wurde (§§ 110a bis 100f OWiG). Ergänzt wurden die Vorschriften<br />
dieses Abschnitts durch die Best<strong>im</strong>mungen über die Archivierung elektro-<br />
nischer <strong>Akte</strong>n (§ 49d S. 1 OWiG) und die Gebührenregelung für die Ü-<br />
bermittlung elektronischer <strong>Akte</strong>n. Allesamt bauen die Regelungen auf den<br />
45
Vorschriften auf, die durch das Gesetz zur Anpassung <strong>der</strong> Formvorschrif-<br />
ten des Privatrechts und an<strong>der</strong>er Vorschriften an den mo<strong>der</strong>nen Rechts-<br />
geschäftsverkehr (FormVorAnpG) vom 13.7.2001 sowie durch das Ge-<br />
setz zur Reform des Verfahrens bei Zustellungen <strong>im</strong> gerichtlichen Verfah-<br />
ren (ZustRG) vom 25.6.2001 eingefügt worden sind. Durch diese und das<br />
Gesetz über die Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Sig-<br />
naturgesetz - SigG) wurden die Vorraussetzungen für die Einreichung e-<br />
lektronischer Schriftsätze bei Gericht und <strong>der</strong>en elektronische Zustellung<br />
unter Einhaltung best<strong>im</strong>mter Erfor<strong>der</strong>nisse, insbeson<strong>der</strong>e mit einer elekt-<br />
ronischen Signatur, geschaffen.<br />
Wie <strong>der</strong> rechtstatsächliche Teil des Gutachtens zeigen wird, kommt dem<br />
elektronischen Rechtsverkehr <strong>im</strong> Sinne einer rechtsverbindlichen Kom-<br />
munikation zwischen den Verfahrensbeteiligten untereinan<strong>der</strong> und dem<br />
Gericht auch und gerade mittels eines elektronischen Dokuments gegen-<br />
wärtig aus unterschiedlichen Gründen we<strong>der</strong> <strong>im</strong> Straf- noch <strong>im</strong> OWi-<br />
Verfahren erhebliche Bedeutung zu.<br />
Im <strong>Strafverfahren</strong> fehlt es zudem gegenwärtig an einer Regelung über ei-<br />
ne elektronische <strong>Akte</strong>nführung. Das <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz be-<br />
schränkte sich vielmehr mit § 41 a StPO auf die Einführung eines Pa-<br />
ragrafens, <strong>der</strong> die <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> bis dahin nicht gegebene Möglichkeit<br />
des elektronischen Rechtsverkehrs eröffnet. Deshalb sollen <strong>im</strong> Folgenden<br />
nach einer Skizze <strong>der</strong> technischen Vorgaben die konkreten Regelungen<br />
<strong>im</strong> OWi-Verfahren dargestellt werden.<br />
3. Technische Rahmenbedingungen<br />
Das Ziel einer vollelektronischen Vorgangsbearbeitung <strong>im</strong> Straf- wie <strong>im</strong><br />
Bußgeldverfahren stellt hohe Anfor<strong>der</strong>ungen insbeson<strong>der</strong>e an die techni-<br />
schen Voraussetzungen. Dabei ist <strong>der</strong> Blick über behördeninterne Abläu-<br />
fe hinaus auf ein behörden- und instanzübergreifendes elektronisches<br />
Kommunizieren zu richten.<br />
46
Die Ausstattung <strong>der</strong> Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie <strong>der</strong> Innen-<br />
behörden <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> (hier die <strong>der</strong> Polizei) weicht gegenwärtig qualitativ<br />
nicht stark von einan<strong>der</strong> ab. Erkennbar ist vielmehr, dass die Län<strong>der</strong> eine<br />
Vielzahl unterschiedlicher EDV-Fachverfahren zur Vorgangsbearbeitung<br />
<strong>im</strong> Straf- wie <strong>im</strong> Bußgeldverfahren auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Vollzugspolizeien,<br />
<strong>der</strong> Staatsanwaltschaften und <strong>der</strong> Gerichte einsetzen (vgl. auch Tabelle<br />
IV. 3.1.2). Auf die Ursachen und Gründe dieser Entwicklung kann in die-<br />
sem Rahmen nicht weiter eingegangen werden. Festzuhalten ist, dass es<br />
zumeist schon innerhalb <strong>der</strong> einzelnen Bundeslän<strong>der</strong> keine abgest<strong>im</strong>m-<br />
ten Entwicklungen für den Einsatz von Datenverarbeitungssoftware zwi-<br />
schen den Innen- und <strong>Justiz</strong>verwaltungen gibt. Abgesehen von den noch<br />
darzustellenden Entwicklungsverbünden einzelner Bundeslän<strong>der</strong>, fehlte<br />
es zudem lange Zeit an einem übergreifenden konzeptionellen Vorgehen.<br />
Gegenwärtig sind daher sowohl die Brücken zwischen den Landesjustiz-<br />
verwaltungen, hier den Gerichten und Staatsanwaltschaften, zu den Vor-<br />
gangsbearbeitungssystemen <strong>der</strong> Landespolizeien zu schlagen, als auch<br />
die jeweils eingesetzten Fachverfahren <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> aufeinan<strong>der</strong><br />
abzust<strong>im</strong>men, um einen reibungslosen Datenaustausch untereinan<strong>der</strong> zu<br />
gewährleisten.<br />
Die Diskussion <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kommission hat <strong>im</strong>mer wie<strong>der</strong> deutlich<br />
gemacht, dass größerer Wert auf eine einheitliche d. h. kompatible Da-<br />
tenverarbeitung in den Bundeslän<strong>der</strong>n aber auch innerhalb <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> zu<br />
legen ist!<br />
Die Folge einer lange Zeit fehlenden informationstechnischen Abst<strong>im</strong>-<br />
mung für das Bußgeldverfahren ist beispielsweise, dass Namen und Ad-<br />
ressen <strong>der</strong> Beteiligten o<strong>der</strong> Angaben zum Gegenstand eines Bußgeldver-<br />
fahrens mehrfach manuell erfasst werden müssen: durch den Polizeivoll-<br />
zugsbediensteten vor Ort, die Bußgeldstelle, die Staatsanwaltschaft, das<br />
Amtsgericht und schließlich <strong>im</strong> Falle einer Rechtsbeschwerde auch durch<br />
das Oberlandesgericht.<br />
Allein <strong>der</strong> elektronische Austausch von Dokumenten kann diesen Erfas-<br />
sungsaufwand nicht entscheidend reduzieren. Ein elektronischer Schrift-<br />
47
satz enthält zwar alle für die weitere Verfahrensbearbeitung benötigten<br />
Angaben (z.B. Namen, Anschrift, Vorwurf, etc). Solange diese Daten aber<br />
nur als Fließtext zur Verfügung stehen, ist es nur schwer möglich, sie au-<br />
tomationsgestützt aus dem Dokument zu extrahieren. Damit dies gelingt,<br />
müssen die Daten in strukturierter Form, also in einer streng definierten<br />
Reihenfolge und Anordnung zur Verfügung stehen.<br />
Benötigt wird daher ein zwischen sämtlichen Fachverfahren und bundes-<br />
wie landesweit eingesetztes, fest definiertes aber herstellerunabhängiges<br />
Schema, das es ermöglicht, die zur Verfahrensbearbeitung notwendigen<br />
Daten auszulesen und – nach Prüfung und Freigabe – in die jeweilige<br />
Verfahrensbearbeitungssoftware des Empfängers einzustellen.<br />
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Daten-<br />
verarbeitung und Rationalisierung in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> (BLK) auf Grund eines<br />
Auftrags <strong>der</strong> 73. <strong>Justiz</strong>ministerkonferenz (abrufbar unter<br />
www.justiz.de/BLK/beschluesse/index.php) zunächst organisatorisch-<br />
technische Leitlinien für die elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerich-<br />
ten und Staatsanwaltschaften (OT-Leit-ERV) (abrufbar unter<br />
www.xjustiz.de) entwickelt. Darin werden grundlegende Festlegungen für<br />
die Ausgestaltung des elektronischen Rechtsverkehrs getroffen und de-<br />
ren Umsetzung durch Beschluss <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>ministerkonferenz den Län-<br />
<strong>der</strong>n und dem Bund zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs<br />
empfohlen. Die durch die von <strong>der</strong> BLK eingesetzten Arbeitsgruppe „IT-<br />
Standards“ erarbeiteten technischen Rahmenvorgaben zur effektiven<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Leitlinien sind in <strong>der</strong> Anlage 1 zur OT-Leit-ERV nie<strong>der</strong>ge-<br />
legt worden. Weiter wurde diese Arbeitsgruppe mit <strong>der</strong> Ausarbeitung ei-<br />
nes Grunddatensatzes <strong>Justiz</strong> und eines darauf aufbauenden Datenstan-<br />
dards „X<strong>Justiz</strong>“ beauftragt.<br />
Der Grunddatensatz <strong>Justiz</strong> enthält eine fachliche Beschreibung <strong>der</strong> zu<br />
übermittelnden Daten, also <strong>der</strong> Datenfel<strong>der</strong>, die für die Übermittlung von<br />
Informationen schematisch zur Verfügung stehen sollen. Zur Umsetzung<br />
dieser Vorgaben in ein datentechnisches Format – den Standard X<strong>Justiz</strong><br />
– werden sog. XML-Schema-Dateien eingesetzt. Mit Hilfe dieser „Seiten-<br />
48
eschreibungssprache“ (vergleichbar mit <strong>der</strong> Seitenbeschreibungsspra-<br />
che „Hypertext Markup Language“, geläufig abgekürzt mit HTML) wird<br />
festgelegt, welche Elemente eine verfahrensbezogene Mitteilung enthal-<br />
ten müssen (z. B. sog. Dokument-Metadaten, wie Inhalt, Betreff, Absen-<br />
<strong>der</strong>, Empfänger, Verfahrensdaten, wie <strong>Akte</strong>nzeichen, Verfahrensgegens-<br />
tand, Person, Name, Anschrift) und in welcher Reihenfolge und Gliede-<br />
rung diese Elemente aufeinan<strong>der</strong> folgen müssen. Grundsätzlich sollen<br />
demnach alle Fel<strong>der</strong> die üblicherweise in den Fachanwendungen MEGA,<br />
MESTA, usw. vorkommen <strong>im</strong> Kern vereinheitlicht definiert werden.<br />
Diese in X<strong>Justiz</strong> zusammengefassten XML-Schemata bilden gegenwärtig<br />
die Grundlage für den Austausch von Daten <strong>im</strong> elektronischen Rechts-<br />
verkehr. Verfahrensbeteiligte, die X<strong>Justiz</strong>-konform kommunizieren,<br />
versenden XML-Dateien, <strong>der</strong>en Aufbau <strong>der</strong> Definition in den X<strong>Justiz</strong>-<br />
Schemata-Dateien entspricht. Diese X<strong>Justiz</strong>-Schemata wurden zwi-<br />
schenzeitlich allen Interessenten zugänglich gemacht (vgl. die <strong>der</strong>zeit<br />
gültige Version von X<strong>Justiz</strong>, abrufbar unter www.xjustiz.de). Sie soll es al-<br />
len interessierten Software-Herstellern ermöglichen, in ihre Programme<br />
Import- und Exportschnittstellen für den Austausch von X<strong>Justiz</strong>-Daten<br />
einzubauen. Damit soll eine Grundlage dafür geschaffen werden, dass al-<br />
le Beteiligten am elektronischen Rechtsverkehr – insbeson<strong>der</strong>e Anwälte,<br />
Gerichte und Staatsanwaltschaften – alle übermittelten Daten problemlos<br />
lesen und weiterverarbeiten können, und zwar unabhängig vom jeweils<br />
eingesetzten Betriebssystem und unabhängig von <strong>der</strong> verwendeten<br />
Kanzlei- o<strong>der</strong> Gerichtssoftware. Im weiteren Verlauf wurde X<strong>Justiz</strong> um<br />
weitere Fachmodule für beson<strong>der</strong>e Verfahrensarten (z.B. Grundbuch,<br />
Ordnungswidrigkeiten, Verfahren vor Verwaltungsgerichten, Sozialgerich-<br />
ten usw.) erweitert. Die Grundstruktur von X<strong>Justiz</strong> wurde so gewählt,<br />
dass hierfür keine komplett neue Datensatz-Definition erfor<strong>der</strong>lich wird.<br />
Vielmehr genügt es, die Elemente des Grunddatensatzes um die diejeni-<br />
gen Angaben zu erweitern, die <strong>im</strong> jeweiligen Fachbereich zusätzlich be-<br />
nötigt werden (vgl. nur die ausführliche Darstellung auf <strong>der</strong> Homepage<br />
www.xjustiz.de).<br />
49
Die gegenwärtige Version von X<strong>Justiz</strong> empfiehlt das XML-Format indes<br />
bislang nur für sog. Metadaten. Der darüber hinaus reichende Inhalt eines<br />
übermittelten Dokuments, beispielsweise einer anwaltlichen Einspruchs-<br />
schrift, wird hingegen außerhalb <strong>der</strong> XML-Strukturen in einem geson<strong>der</strong>-<br />
ten Dokument abgelegt und einer eigenen Datei übermittelt. Zur Frage,<br />
welche Dateiformate dafür zulässig sind, hat die BLK ebenfalls Empfeh-<br />
lungen abgegeben. Beson<strong>der</strong>s plastisch wird die beschriebene techni-<br />
sche Vorgehensweise, wenn die X<strong>Justiz</strong>-Daten als eine Art Briefum-<br />
schlag für die weiteren – <strong>im</strong> Fließtext verfassten – Dokumente angesehen<br />
werden, dessen Adressierung in einem laufenden Verfahren nur ein ein-<br />
ziges Mal vorgenommen werden muss.<br />
4. Die elektronische <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Ordnungswidrigkeitenverfahren<br />
In dem neu eingefügten zwölften Abschnitt des OWiG werden die Erstel-<br />
lung und Einreichung formgebundener und an<strong>der</strong>er elektronischer Doku-<br />
mente bei Behörden und Gerichten (§ 110a OWiG), die elektronische Ak-<br />
tenführung (§ 110b OWiG), die Zustellung elektronischer Dokumente<br />
durch Behörden und Gerichte (§ 110c OWiG), <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nausdruck, die Ak-<br />
teneinsicht und die <strong>Akte</strong>nübersendung (§ 110d OWiG) sowie die Durch-<br />
führung <strong>der</strong> Beweisaufnahme bei elektronischen Dokumenten (§ 110f<br />
OWiG) geregelt.<br />
Nach § 110 b Abs. 1 S. 1 OWiG können die Verfahrensakten elektronisch<br />
geführt werden. In welchem Umfang, für welche Verfahren und bei wel-<br />
chen Behörden und Gerichten die Verfahrensakten elektronisch geführt<br />
werden (können), hängt von <strong>der</strong> Entscheidung des zuständigen Verord-<br />
nungsgebers ab (§ 110b Abs. 1 S. 2, 3 und 4 OWiG). Um darüber hinaus<br />
Einzel- und Insellösungen schon auf Ebene <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> zu vermei-<br />
den, hat <strong>der</strong> jeweilige Verordnungsgeber zudem die organisatorisch-<br />
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewah-<br />
rung <strong>der</strong> elektronisch geführten <strong>Akte</strong>n festzulegen.<br />
Allein das Bundesland Schleswig-Holstein hat bislang von <strong>der</strong> Ermächti-<br />
gung aus § 110 b Abs. 1 S. 2 OWiG Gebrauch gemacht. Mit seiner Lan-<br />
50
desverordnung über die elektronische <strong>Akte</strong>nführung in Bußgeldverfahren<br />
vom 12. Dezember 2006 (vgl. Anhang) (BußGeldElektAktfV) werden die<br />
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen<br />
Behörden ermächtigt, <strong>Akte</strong>n <strong>im</strong> Bußgeldverfahren elektronisch zu führen;<br />
die Staatsanwaltschaften werden davon indes ausdrücklich ausgenom-<br />
men (§ 1 Abs. 1 S. 2 BußGeldElektAktfV).<br />
Der Verordnungsgeber räumt den Ordnungsbehörden damit die Möglich-<br />
keit zur elektronischen <strong>Akte</strong>nführung ein. Er trifft aber selbst keine Detail-<br />
regelungen über <strong>der</strong>en genaue Ausgestaltung. Hier knüpft er vielmehr an<br />
die Empfehlungen <strong>der</strong> Expertenkommissionen „AG IT-Standards“ an, die<br />
sich auf Bundesebene mit den technischen Rahmenvorgaben des elekt-<br />
ronischen Rechtsverkehrs und den Anfor<strong>der</strong>ungen an einzusetzenden<br />
Dokumentenmanagementsysteme (DMS) befasst hat (vgl. § 1 Abs. 2 und<br />
3 BußGeldElektAktfV).<br />
Durch das OWiG selbst geregelt wird <strong>der</strong> Umgang mit Schriftstücken und<br />
Dokumenten, welche in Papierform bei den Behörden eingereicht wer-<br />
den. Mit Rücksicht auf den klaren Wortlaut von § 110a Abs. 1 S. 1 OWiG<br />
ist dies auch bis auf weiteres zulässig. Sämtliche eingereichte und für die<br />
Übertragung geeignete Schriftstücke und Augenscheinsobjekte (soweit<br />
Augenscheinsobjekte in § 110 b Abs. 1 S. 1 OWiG scheinbar als „Ur-<br />
schriften“ legal definiert werden, dürfte dies erkennbar ein Einfallstor für<br />
Missverständnisse darstellen) sind in ein elektronisches Dokument zu<br />
übertragen und zur elektronisch geführten <strong>Akte</strong> zu nehmen, wobei es<br />
dem Verordnungsgeber frei steht, hiervon seinerseits Ausnahmen zu ges-<br />
tatten. Dafür eröffnet das Gesetz zwei unterschiedliche Möglichkeiten:<br />
Entwe<strong>der</strong> folgt auf die Übertragung eine Aufbewahrung <strong>der</strong> Urschrift bis<br />
zum Verfahrensabschluss (§ 110b Abs. 2 OWiG) o<strong>der</strong> auf die Übertra-<br />
gung folgt die Vernichtung <strong>der</strong> Urschrift bereits vor Abschluss des Verfah-<br />
rens (§ 110b Abs. 4 OWiG).<br />
Im ersten Fall bleibt das Ausgangsdokument, die Urschrift, neben dem<br />
durch Übertragung gefertigten elektronischen Dokument erhalten. Des-<br />
halb ist es erfor<strong>der</strong>lich, aber auch ausreichend, dass das elektronische<br />
51
Dokument einen Vermerk darüber enthält, durch wen und wann es von<br />
<strong>der</strong> Urschrift übertragen worden ist. Einer ausdrücklichen Bestätigung <strong>der</strong><br />
Identität von Urschrift und elektronischem Dokument bedarf es in diesem<br />
Fall ebenso wenig wie einer elektronischen Signatur. Weiter sind die ak-<br />
tenführenden Stellen bei diesem Vorgehen gesetzlich verpflichtet, die Ur-<br />
schriften bis zum Abschluss des Verfahrens <strong>der</strong>art zu aufzubewahren,<br />
dass auf sie binnen einer Woche zugegriffen werden kann (§ 110 b Abs.<br />
2 S. 3 OWiG).<br />
Von <strong>der</strong> zweiten Verfahrensweise, die Urschrift nach ihrer Übertragung in<br />
ein elektronisches Dokument zu vernichten, können die aktenführenden<br />
Stellen nur unter engen, bereits durch das Gesetz vorgegebenen Voraus-<br />
setzungen Gebrauch machen. Danach ist eine qualifizierte elektronische<br />
Signatur erfor<strong>der</strong>lich und <strong>der</strong> bereits von § 110b Abs. 2 S. 2 OWiG einge-<br />
for<strong>der</strong>te Vermerk hat sich hier auch auf die Authentizität von Urschrift und<br />
elektronischem Dokument sowie auf den Umstand, ob tatsächlich eine<br />
Urschrift o<strong>der</strong> lediglich eine Abschrift be<strong>im</strong> Medientransfer vorgelegen<br />
hat, zu beziehen (§ 110 b Abs. 4 S. 1 OWiG). Darüber hinaus darf keiner<br />
<strong>der</strong> Ausschlusstatbestände nach § 110 b Abs. 4 S. 2 OWiG vorliegen, die<br />
u.a. die Vernichtung von Beweismitteln sowie Einziehungs- und Verfalls-<br />
gegenständen von <strong>der</strong> Vernichtung ausnehmen. Schließlich ist es dem<br />
Verordnungsgeber nach § 110 b Abs. 4 S. 4 OWiG eröffnet, über diese<br />
Tatbestände hinaus gehende Aufbewahrungsvorschriften zu erlassen.<br />
Auf welche Art und Weise die Übertragung zu geschehen hat, welches<br />
Soft- und Hardwareprodukt eingesetzt und damit möglichen Sicherheitsri-<br />
siken begegnet werden kann, damit kein Anlass geschaffen wird, an <strong>der</strong><br />
Übereinst<strong>im</strong>mung mit <strong>der</strong> Urschrift zu zweifeln (vgl. § 110b Abs. 3 OWiG),<br />
lässt das Gesetz ebenso offen, wie die tatsächlichen wie rechtlichen An-<br />
for<strong>der</strong>ungen an eine dem Gesetzeszweck genügenden Aufbewahrung.<br />
4.1 Beispiele praktischer Umsetzung<br />
Im Folgenden sollen die bundesweit führenden Pilotprojekte zur Umset-<br />
zung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Bußgeldverfahren dargestellt werden.<br />
Darüber hinaus kann diese Darstellung angesichts <strong>der</strong> Vielzahl unter-<br />
52
schiedlicher Zuständigkeiten für die Bearbeitung von Bußgeldverfahren<br />
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und muss kleinere Pilotver-<br />
fahren hier ausblenden.<br />
4.1.1 Schleswig-Holstein<br />
Als erster Landkreis Schleswig-Holsteins richtete <strong>der</strong> Landkreis Stormarn<br />
<strong>im</strong> November 2006 bei seiner in Bad Oldesloe ansässigen Kreisverwal-<br />
tung ein Modellprojekt zur elektronischen Bearbeitung straßenverkehrs-<br />
rechtlicher Ordnungswidrigkeiten ein. Mittlerweile haben zahlreiche weite-<br />
re Landkreise die hier gewonnenen Erfahrungen übernommen und bear-<br />
beiten – mit leichten Unterschieden bei <strong>der</strong> eingesetzten Software – diese<br />
Vorgänge ebenfalls überwiegend elektronisch.<br />
Zum Ablauf:<br />
Die von <strong>der</strong> Polizei erfassten Daten werden in das dort eingesetzte Sys-<br />
tem mit <strong>der</strong> Software „OWi21“ <strong>der</strong> ekom21 GmbH, Gießen, eingegeben.<br />
Der gesamte Vorgang mit Beweismitteln, wie beispielsweise Lichtbil<strong>der</strong>n,<br />
Fahrtenschreiberaufzeichnungen o<strong>der</strong> Messstreifen, wird sodann an die<br />
zentrale OWi-Stelle in Neumünster abgegeben. Die Übermittlung <strong>der</strong><br />
Stamm- bzw. Metadaten, insbeson<strong>der</strong>e die Personalien des Betroffenen,<br />
werden über einen Server des Unternehmens DATAPORT in Kiel-<br />
Altenholz dorthin übermittelt. Noch in Papierform vorhandene Dokumente<br />
desselben Vorgangs werden dort eingescannt und sodann <strong>der</strong> Vorgang<br />
<strong>der</strong> örtlich und sachlich zuständigen Kreisverwaltung elektronisch über-<br />
mittelt. Die Beweismittel und Urschriften werden sodann postalisch über-<br />
sandt und in <strong>der</strong> Kreisverwaltung asserviert.<br />
In <strong>der</strong> Kreisverwaltung selbst erfolgt die Ablage <strong>der</strong> Urschriften und Be-<br />
weismittel <strong>im</strong> Wege eines beson<strong>der</strong>en Ablagesystems. Dazu werden<br />
sämtliche Eingänge mit ihrem jeweiligen Eingangsdatum und einer sog.<br />
Batch-Nummer – eine Art Indizierung – versehen und mit sämtlichen wei-<br />
teren Urschriften und eingegangenen Beweismitteln des nämlichen Da-<br />
tums in einem „Papier-Container“ archiviert. Mittels Batch-Nr. und Datum<br />
sind die Dokumente bzw. Asservate je<strong>der</strong>zeit auch kurzfristig auffindbar.<br />
Es ist geplant, nach einer Übergangszeit die Urschriften bereits während<br />
53
des laufenden OWi-Verfahrens zu vernichten und nur noch die Beweis-<br />
mittel aufzubewahren. Und damit von § 110 b Abs. 4 OWiG Gebrauch zu<br />
machen. Die damit erfor<strong>der</strong>lichen genauen Arbeitsabläufe, insbeson<strong>der</strong>e<br />
die damit verbundenen Signaturfragen, sind bislang indes ungeklärt.<br />
Gehen während des laufenden Bußgeldverfahrens weitere Zuschriften,<br />
z.B. Einsprüche, ein, werden diese eingescannt. Das Einscannen findet in<br />
einem geson<strong>der</strong>ten Raum in <strong>der</strong> Kreisverwaltung statt und wird durch<br />
zwei Mitarbeiter betreut, die zudem die Urschriften und Beweismittel auf-<br />
bewahren. Sämtliche eingehende Dokumente und Beweismittel werden<br />
hier, soweit es ihre Beschaffenheit zulässt, erfasst und von <strong>der</strong> eingesetz-<br />
ten Software in PDF-Dateien gewandelt. Digitale Lichtbil<strong>der</strong> werden als<br />
Datei in die elektronisch geführte <strong>Akte</strong> eingestellt. Soweit die Bil<strong>der</strong> ana-<br />
log hergestellt wurden, werden diese eingescannt und die Urschriften<br />
aufbewahrt. Gleiches gilt beispielsweise für Messstreifen von Alkoholtests<br />
und für Fahrtenschreiber.<br />
Zudem werden die hier hergestellten elektronischen Dokumente mit einer<br />
qualifizierten elektronischen Signatur des jeweils den Scannvorgang<br />
betreuenden Mitarbeiters versehen. Alle neun Mitarbeiter, die mit <strong>der</strong> e-<br />
lektronischen Abwicklung <strong>der</strong> Bußgeldverfahren betraut sind, verfügen<br />
über ein Kartenlesegerät und eine eigene Signaturkarte. Dabei wird indes<br />
nicht jedes Dokument, das eingescannt wurde, elektronisch signiert, son-<br />
<strong>der</strong>n dies erfolgt <strong>im</strong> Wege einer Massensignatur. Dazu werden jeweils 30<br />
bis 50 Seiten eingescannt und erst dann eine Zertifizierungsabfrage bei<br />
dem Zertifizierungsdienstleister, hier D-Trust GmbH, vorgenommen. Die-<br />
ses „chargenweise“ Signieren spart zunächst Zeit ein, denn je<strong>der</strong> Zertifi-<br />
zierungsvorgang durch eine Online-Abfrage be<strong>im</strong> Vertragspartner D-Trust<br />
GmbH dauert je nach Umfang des zu signierenden Dokuments mehrere<br />
Minuten. Dieses Vorgehen reduziert Kosten denn jede Datenabfrage <strong>im</strong><br />
Wege <strong>der</strong> Zertifizierung ist <strong>im</strong> Rahmen des geschlossenen Vertrags mit<br />
D-Trust GmbH kostenpflichtig.<br />
Die durch den Scannvorgang erstellten PDF-Dateien werden sodann au-<br />
tomatisch in ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingepflegt und<br />
54
an das OWi-Fachverfahren (WiNOWiG) zur Bearbeitung übergeben. Um-<br />
gekehrt werden sämtliche <strong>im</strong> OWi-Fachverfahren erstellten Dokumente<br />
ebenfalls an das DMS-Verfahren übergeben. Das DMS ist über eine<br />
Schnittstelle mit dem Fachverfahren für die Bearbeitung <strong>der</strong> Ordnungs-<br />
widrigkeiten verbunden. So können die für das <strong>Akte</strong>nzeichen (Denkbar<br />
hier beispielsweise eine Zuteilung anhand <strong>der</strong> letzten Ziffern des <strong>Akte</strong>n-<br />
zeichens, möglich ist aber auch ein Turnus anhand <strong>der</strong> Anfangsbuchsta-<br />
ben des Nachnamens usw.) zuständigen Mitarbeiter sämtliche elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong>nbestandteile ebenso wie den Verfahrensstand einsehen. Un-<br />
ter an<strong>der</strong>em ist über eine Kalen<strong>der</strong>funktion ein Überblick über den Ver-<br />
fahrensablauf vom Tattag bis hin zum Zeitpunkt <strong>der</strong> absoluten Verjährung<br />
gewährleistet.<br />
Neben dieser Darstellungsfunktion löst die erstmalige Erstellung eines<br />
<strong>Akte</strong>nvorgangs <strong>im</strong> OWi-Fachverfahren auch zahlreiche automatische<br />
Funktionen aus, die <strong>der</strong> einzelne Sachbearbeiter nicht manuell anstoßen<br />
muss. Darunter fällt zum Beispiel das Veranlassen des Absendens eines<br />
Anhörungsbogens, die Online-Abfrage eines Verkehrszentralregisteraus-<br />
zugs (VZR-Auszugs) über das sog. TESTA-Netz (TESTA (Trans-<br />
European Services for Telematics between Administrations) ist ein Over-<br />
lay-Netz <strong>der</strong> europäischen Verwaltungen) be<strong>im</strong> Kraftfahrt-Bundesamt in<br />
Flensburg o<strong>der</strong> eine Online-Anfrage be<strong>im</strong> Einwohnermeldeamt. Soweit<br />
erfor<strong>der</strong>lich können diese Vorgänge später auch individuell durch die<br />
Sachbearbeiter veranlasst werden, beispielsweise zur Abfrage eines<br />
Lichtbildes bei <strong>der</strong> Passbehörde o<strong>der</strong> eines weiteren VZR-Auszugs so-<br />
fern die Identitäten von Halter und Fahrer vermeintlich auseinan<strong>der</strong>fallen.<br />
Die Auskünfte <strong>der</strong> angerufenen Behörde werden zumeist online übermit-<br />
telt; teilweise übersendet das Kraftfahrtbundesamt die Daten auch posta-<br />
lisch. Soweit digitale Lichtbil<strong>der</strong> o<strong>der</strong> digitale Videosequenzen als Be-<br />
weismittel vorhanden sind, werden diese gegenwärtig noch manuell ab-<br />
gespeichert und nicht automatisch in das DMS übertragen. Die Mitarbei-<br />
ter arbeiten ausschließlich mit dem OWi-Fachverfahren und <strong>der</strong> elektro-<br />
nisch geführten <strong>Akte</strong>. Handschriftliche Verfügungen, beispielsweise be<strong>im</strong><br />
Veranlassen des Ausdrucks und <strong>der</strong> Zustellung eines Bußgeldbescheids,<br />
werden an keiner Stelle <strong>der</strong> Bearbeitung vorgenommen.<br />
55
Wird <strong>der</strong> Versand von Anhörungsbögen o<strong>der</strong> Bußgeldbescheiden durch<br />
das OWi-Fachverfahren veranlasst, so erhalten diese Anschreiben auf<br />
<strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>- und/o<strong>der</strong> Rückseite einen Bar-Code („Strich-Code“). Damit<br />
wird eine spätere maschinenlesbare Zuordnungsmöglichkeit geschaffen.<br />
Soweit die Betroffenen o<strong>der</strong> Rechtsanwälte bei ihren Zuschriften nämlich<br />
diese ihnen zugesandten Vordrucke verwenden, kann <strong>der</strong> Scanner <strong>der</strong><br />
Kreisverwaltung bei ihrem postalischen Rücklauf anhand des Bar-Codes<br />
die Zuordnung zum konkreten Bußgeldvorgang selbst vornehmen und<br />
stellt das eingegangene Dokument automatisch in das DMS zum pas-<br />
senden Vorgang ein. Über die Schnittstelle zum OWi-Fachverfahren wird<br />
das eingescannte Dokument dorthin übertragen und darüber hinaus wird<br />
<strong>der</strong> zuständige Sachbearbeiter über diesen Posteingang informiert. Drei-<br />
mal täglich geht auf diese Weise bei den Mitarbeitern <strong>der</strong> Kreisverwaltung<br />
die jeweils gesammelte elektronische Post ein.<br />
In diese elektronische <strong>Akte</strong> könnte grundsätzlich elektronisch („online“)<br />
durch Rechtsanwälte, die über eine elektronische Signatur verfügen, Ein-<br />
sicht genommen werden. Derzeit ist dieser Wunsch an die Behörde noch<br />
nicht herangetragen worden, sodass das dazu erfor<strong>der</strong>liche und vom<br />
Partnerunternehmen Opt<strong>im</strong>al Systems GmbH bereits entwickelte Modul<br />
für das bereits eingesetzte DMS noch nicht erworben und installiert wor-<br />
den ist. Auch zu datenschutzrechtlichen o<strong>der</strong> sicherheitstechnischen Fra-<br />
gen, insbeson<strong>der</strong>e zum Verän<strong>der</strong>ungsschutz <strong>der</strong> Datei, musste sich die<br />
Kreisverwaltung daher bislang nicht verhalten. Die Rechtsanwälte kom-<br />
munizieren mit ihr ebenso wie die Betroffenen nahezu ausnahmslos mit-<br />
tels Briefpost und Telefax. Nur vereinzelt gehen Emails ein, die dann um-<br />
gewandelt und in das DMS ebenso eingestellt werden. Der Kontakt mit<br />
Dritten erfolgt nicht mittels <strong>der</strong> Fachanwendung, sodass eingehende E-<br />
mails in das dafür erfor<strong>der</strong>liche Speicher-Format umgewandelt werden<br />
müssen. Auch die <strong>Akte</strong>neinsicht wird daher gegenwärtig lediglich in Form<br />
einer – dann durch Ausdruck herzustellenden – Papierakte gewährt. Aus<br />
diesen Gründen kommt <strong>der</strong> elektronischen Signatur gegenwärtig nur be-<br />
hördeninterne Bedeutung zu.<br />
56
Wird gegen den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt und diesem sei-<br />
tens <strong>der</strong> Kreisverwaltung nicht abgeholfen, erfolgt die Übersendung <strong>der</strong><br />
Verfahrensakte an die Staatsanwaltschaft. Dies geschieht nicht in elekt-<br />
ronischer Form. Der vorgangsbezogene Inhalt des DMS wird vielmehr<br />
ausgedruckt, paginiert und sodann in Papierform übersandt. Gegenwärtig<br />
fehlt den Staatsanwaltschaften und den Gerichten die technische Mög-<br />
lichkeit, <strong>im</strong> Wege von Schnittstellen <strong>der</strong> eingesetzten EDV-Systeme die<br />
Stammdaten aus dem System <strong>der</strong> jeweiligen Kreisverwaltung zu über-<br />
nehmen.<br />
Die in den „Papier-Containern“ archivierten Urschriften verbleiben nach<br />
Abgabe des Verfahrens sowie Ausdruck und Versand <strong>der</strong> Papierakte in<br />
den Räumen <strong>der</strong> Verwaltung. Nur in äußerst wenigen Fällen wurde bis-<br />
lang <strong>im</strong> gerichtlichen Verfahren die Vorlage <strong>der</strong> Urschrift eingefor<strong>der</strong>t. Die<br />
Archivierungsdauer best<strong>im</strong>mt eine Rechtsverordnung. Sie beträgt zwi-<br />
schen 6 Monaten und drei Jahren nach Abschluss des Verfahrens.<br />
Zum Einsatz spezieller Soft- und Hardware:<br />
Die Hardware konnte bis auf die Monitore an den einzelnen Mitarbeiter-<br />
arbeitsplätzen weitgehend aus <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> „Papierakte“ übernommen<br />
werden. An jedem Arbeitsplatz befindet sich nunmehr wenigstens ein 20-<br />
Zoll-Bildschirm. Zumeist arbeiten die Mitarbeiter sogar an 21-Zoll-<br />
Monitoren. Gegenwärtig finden Verhandlungen darüber statt, ob die Ar-<br />
beitsplätze als Bildschirmarbeitsplätze arbeitsschutzrechtlich einzuordnen<br />
sind und welche Konsequenzen, beispielsweise für Pausen, daraus fol-<br />
gen.<br />
Die Datensicherung erfolgt über zwei miteinan<strong>der</strong> korrespondierende,<br />
aber räumlich getrennt von einan<strong>der</strong> untergebrachte Server, die ebenfalls<br />
für die elektronische Abwicklung neu angeschafft werden mussten. Ein<br />
Datenabgleich bzw. Datenaustausch erfolgt zwischen beiden Speicher-<br />
medien einmal täglich.<br />
Die bereits vorhandene und auf Windows XP basierende Software-<br />
Fachanwendung für das Ordnungswidrigkeitenverfahren WINOWI kom-<br />
57
muniziert mittels einer Schnittstelle mit dem durch die Kreisverwaltung<br />
hinzugefügten Dokumenten-Management-System. Als DMS-Modul wird<br />
die Software OS.5/ECM („Enterprise-Content-Management“) des Herstel-<br />
lers Opitmal Systems GmbH, Berlin, eingesetzt, das sich <strong>im</strong> Minutentakt<br />
mit <strong>der</strong> Software WINOWI abgleicht.<br />
Über Opt<strong>im</strong>al Systems GmbH wurden auch die für die Mitarbeiter erfor-<br />
<strong>der</strong>lichen qualifizierten elektronischen Signaturen eingerichtet, die zuvor<br />
von D-Trust GmbH, Berlin, erworben worden waren. Für die Beantragung<br />
und Einrichtung solchen Signaturen mussten sich die Mitarbeiter jeweils<br />
<strong>im</strong> Wege des Post-Ident-Verfahrens gegenüber D-Trust GmbH legit<strong>im</strong>ie-<br />
ren und erhielten sodann Unterlagen, insbeson<strong>der</strong>e Pin-Code und Code-<br />
karte, jeweils einzeln mittels Postzustellungsurkunde zugesandt. Für je-<br />
den Arbeitsplatz musste zudem ein Kartenlesengerät für die Codekarte<br />
angeschafft und eingerichtet werden. Alle zwei Jahre erfolgt aus Sicher-<br />
heitsgründen ein Austausch <strong>der</strong> Chipkarten (eine Rücksprache mit dem<br />
Bundesamt für Sicherheitstechnik ergab, dass ein solcher - kosteninten-<br />
siver – Austausch dort nicht als erfor<strong>der</strong>lich angesehen wird. Im Abstand<br />
von etwa fünf bis sechs Jahren sollte über das BSI o<strong>der</strong> die Bundesnetz-<br />
agentur lediglich erfragt werden, ob die eingesetzten Schlüssellängen<br />
noch hinreichend sicher sind). Pro Kartenaustausch werden dafür seitens<br />
des Zertifizierungsunternehmens EUR 99,-- berechnet.<br />
Das Einscannen wird in <strong>der</strong> Kreisverwaltung mittels eines Scanners von<br />
Fijutsu, Typ Fi 5750, vorgenommen. Das Gerät kann die Vorlagen dop-<br />
pelseitig auch in Farbe bis zum Format A3 mit einer Auflösung von maxi-<br />
mal 600 dpi erfassen. Die Geschwindigkeit variiert zwischen Farb- und<br />
S/W-Scannvorgängen, beläuft sich aber auf etwa 60 Seiten pro Minute.<br />
Die Anschaffungskosten liegen zwischen sechs und siebentausend Euro.<br />
Zum sonstigen Aufwand:<br />
Die Mitarbeiter mussten bei Einführung des neuen Systems insbeson<strong>der</strong>e<br />
<strong>im</strong> Umgang mit <strong>der</strong> elektronischen Dokumentenverwaltung geschult wer-<br />
den. Dafür war ein Zeitraum von etwa einer Woche erfor<strong>der</strong>lich. Auf<br />
58
Grund aktueller Fragen erfolgen kürzere Nachschulungen in unregelmä-<br />
ßigen Abständen.<br />
4.1.2 Hessen<br />
Bereits seit September 2004 wird in <strong>der</strong> zentralen Bußgeldstelle des Re-<br />
gierungspräsidiums Kassel (ZBS) die Fachanwendung OWi21 eingesetzt.<br />
Das Verfahren wurde schon seitdem behördenintern ausschließlich pa-<br />
pierlos betrieben. Die <strong>Akte</strong> musste bislang nach Abschluss des Verfah-<br />
rens bei Weiterleitung des Vorgangs an die Staatsanwaltschaften indes<br />
zum Versand ausgedruckt werden. Seit dem 09.03.2007 wird in Hessen in<br />
einem Pilotprojekt begrenzt auf die StA Kassel <strong>der</strong> Rechtsverkehr in Ord-<br />
nungswidrigkeitenverfahren vollständig elektronisch abgewickelt.<br />
Zum Ablauf:<br />
Die Arbeitsabläufe ähneln stark dem in Schleswig-Holstein praktizierten<br />
Verfahren. Die ZBS erfasst und bearbeitet zentral für das Land Hessen –<br />
mit Ausnahme <strong>der</strong> Stadt Frankfurt – die anfallenden Bußgeldverfahren. Im<br />
Wege eines Massenscanvorgangs werden die eingehenden <strong>Akte</strong>n erfasst,<br />
signiert und in das System als sog. TIFF-Dateien eingestellt. Da auch in<br />
Hessen eine Massensignatur eingesetzt wird, um die täglich eingehenden<br />
neun- bis zwölftausend Papierdokumente zu bewältigen, können auch hier<br />
die Urschriften nicht nach § 110 b Abs. 4 OWiG bereits vor Abschluss des<br />
Verfahrens vernichtet werden, Sie werden für einen durch Rechtsverord-<br />
nung geregelten Zeitraum zwischen drei und fünf Jahren nach Verfah-<br />
rensabschluss, abhängig von <strong>der</strong> Schwere des Tatvorwurfs, aufbewahrt<br />
Das ähnlich wie in Schleswig-Holstein organisierte Aufbewahren <strong>der</strong> Ur-<br />
schriften während eines laufenden Verfahrens, auch unter Einsatz einer<br />
Indexierung, ermöglicht es <strong>der</strong> ZBS innerhalb von höchstens sieben Ta-<br />
gen auf die Urschriften bei Bedarf Zugriff zu nehmen. Lediglich in Einzel-<br />
fällen ist ein solches Ersuchen durch die Tatgerichte bislang an die Buß-<br />
geldstelle herangetragen worden. Im Einzelnen: ca. 30.000 Einsprüche in<br />
Hessen, davon 22.000 über die ZBS in Kassel (Rest Stadt Frankfurt); eine<br />
von zehn Staatsanwaltschaften ist angeschlossen; eines von 46 Gerichten<br />
59
ist angeschlossen; eine <strong>Akte</strong> hat durchschnittlich 30 Seiten; bei <strong>der</strong><br />
Staatsanwaltschaft Kassel gehen <strong>im</strong> Schnitt drei bis vier <strong>Akte</strong>n täglich ein.<br />
Vorhandene Lichtbil<strong>der</strong> können in Farbe eingescannt o<strong>der</strong>, wenn sie in di-<br />
gitaler Form vorliegen, auch in die Fachanwendung OWi21 eingelesen<br />
werden. Erleichtert und beschleunigt wird die Übersendung <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong><br />
bzw. Dateien durch die <strong>im</strong> selben Hause befindliche zentrale Filmauswer-<br />
testelle. Sämtliche eingehenden elektronischen Dokumente, wie zum Bei-<br />
spiel digitale Lichtbil<strong>der</strong>, werden sowohl in das PDF-Format für das DMS<br />
gewandelt, als auch in ihrer ursprünglichen Dateiform <strong>im</strong> DMS gespei-<br />
chert.<br />
Alle Schreiben, die von <strong>der</strong> ZBS versandt werden, enthalten auf Vor<strong>der</strong>-<br />
und Rückseite einen maschinenlesbaren Code („2D Data Matrix Code“),<br />
<strong>der</strong> bei Rücksendung, beispielsweise eines Anhörungsbogens, vom ein-<br />
gesetzten Scanner gelesen, dem richtigen Vorgang automatisch zugeord-<br />
net und so dem Sachbearbeiter zugespielt werden kann. Von <strong>der</strong> ZBS er-<br />
stellte Bußgeldbescheide werden nicht qualifiziert signiert. Gegenwärtig<br />
wird ausschließlich die dazugehörige Verfügung ausgedruckt, vom Mitar-<br />
beiter unterzeichnet und aufbewahrt. Sobald eine entsprechende Rechts-<br />
verordnung nach § 110 b Abs. 1 OWiG in Kraft tritt, kann nach § 110 c<br />
Abs. 1 S. 3 OWiG vorgegangen und die Verfügung elektronisch signiert<br />
zur <strong>Akte</strong> genommen werden.<br />
Gegenwärtig gibt es noch keine Möglichkeit, für Rechtsanwälte die <strong>Akte</strong><br />
online auf dem Server <strong>der</strong> ZBS einzusehen. In absehbarer Zeit soll aber<br />
auch dies realisiert werden.<br />
Seit März 2007 steht auf <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft Kassel ein Sys-<br />
tem zur Verfügung, das die Entgegennahme <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> und<br />
die Weiterbearbeitung bis zur Versendung an das Amtsgericht in elektro-<br />
nischer Form ermöglicht.<br />
Statt die Personendaten aus dem Papiervorgang in die staatsanwalt-<br />
schaftliche Fachanwendung MESTA mit <strong>der</strong> Hand einzutippen, erlaubt es<br />
60
<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Übersendung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> DOMEA-Format<br />
gleichfalls übersandte X-<strong>Justiz</strong>-Datensatz <strong>der</strong> Geschäftsstelle, die in einer<br />
Schnittstelle bereits vorliegenden Personendaten per Mausklick in die dor-<br />
tige MESTA-Fachanwendung zu übernehmen.<br />
Die <strong>Akte</strong> selbst wird in einem dafür eingerichteten Dokumentenmanage-<br />
mentsystem (DMS) <strong>im</strong> DOMEA-Standard von OpenText (Hessischer Lan-<br />
desstandard) vorgehalten und nach Vergabe eines <strong>Akte</strong>nzeichens <strong>der</strong> zu-<br />
ständigen Amtsanwältin in <strong>der</strong>en virtuellen Arbeitskorb gelegt. Parallel da-<br />
zu wird eine ebenfalls elektronisch generierte <strong>Akte</strong>nzeichenmitteilung au-<br />
tomatisch an die ZBS zurückgesandt.<br />
Die Dezernentin kann die <strong>Akte</strong> nun <strong>im</strong> DMS bearbeiten, durchblättern und<br />
z.B. eine Verfügung hinzufügen. Dann fügt sie eine solche aus den <strong>im</strong><br />
DMS vorgehaltenen Formularen bei und leitet die <strong>Akte</strong> – wie<strong>der</strong> per<br />
Mausklick – an den virtuellen Arbeitskorb ihrer Geschäftsstelle weiter, wo<br />
die <strong>Akte</strong> geöffnet und die Verfügung abgearbeitet wird. Ist das Verfahren<br />
bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft abgeschlossen, wird die Abgabe an das Amts-<br />
gericht in <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> verfügt. Die Geschäftsstelle erfasst die<br />
Abgabe in MESTA und legt die elektronische <strong>Akte</strong> in den <strong>im</strong> DMS vorhan-<br />
denen virtuellen Ausgangskorb für das Amtsgericht Kassel. Eine für die<br />
Versendung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> eingeschaltete Kommunikationsplattform („Daten-<br />
drehscheibe“; „Bitstock-Server“) versendet die <strong>Akte</strong> an das Amtsgericht<br />
Kassel, wo sie – zurzeit noch – ausgedruckt und dem zuständigen Richter<br />
in Papierform und als Datei vorgelegt wird.<br />
Sofern Nachermittlungen seitens des Gerichts erfor<strong>der</strong>lich sein sollten,<br />
wird die elektronische <strong>Akte</strong> des jeweiligen Vorgangs durch die Geschäfts-<br />
stelle an die Staatsanwaltschaft mit dem Hinweis auf die für erfor<strong>der</strong>lich<br />
gehaltenen Ermittlungen zurückgesandt und in <strong>der</strong> Fachanwendung (Eu-<br />
reka-Straf) <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nstatus auf „versand“ geän<strong>der</strong>t. Allein <strong>der</strong> Staatsan-<br />
waltschaft steht es nunmehr zu, die <strong>Akte</strong> zu ergänzen und die neuen Do-<br />
kumente hinzuzufügen. Die <strong>Akte</strong> ist auf Seiten des Gerichts während <strong>der</strong><br />
Dauer <strong>der</strong> Versendung für Verän<strong>der</strong>ungen gesperrt, womit <strong>der</strong> Gefahr<br />
vorgebeugt werden soll, dass zwei voneinan<strong>der</strong> abweichende <strong>Akte</strong>ninhal-<br />
61
te entstehen. Zwischenzeitlich bei Gericht eingehende Schreiben werden<br />
entwe<strong>der</strong> an die Staatsanwaltschaft mit <strong>der</strong> Bitte weitergeleitet, diese in<br />
die dort geführte <strong>Akte</strong> aufzunehmen, o<strong>der</strong> nach Rückkehr <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> bei Ge-<br />
richt aus einem elektronischen Retentordner in das DMS zum Vorgang<br />
eingepflegt.<br />
Die ausschließlich elektronische Weiterbearbeitung <strong>der</strong> elektronischen Ak-<br />
te bei Gericht ist ein weiterer Teil dieses Projektes, um das Verfahren bis<br />
hin zur Vollstreckung vollständig medienbruchfrei zu führen. An diesem<br />
wird <strong>der</strong>zeit gearbeitet. Gegenwärtig sind bereits vier Richter <strong>im</strong> Rahmen<br />
des Pilotprojekts am AG Kassel mit <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>nbearbeitung<br />
befasst. Eine Rechtsverordnung nach § 110 b Abs. 1 S. 2 OWiG wurde<br />
durch den hessischen Verordnungsgeber für den Bereich <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> bis-<br />
lang nicht erlassen. Diese befindet sich indes in Vorbereitung und soll An-<br />
fang 2008 in Kraft treten. Bis dahin wird deshalb neben <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> auch noch eine Papierakte geführt.<br />
Zum Einsatz spezieller Soft- und Hardware:<br />
Sämtliche 180 Arbeitsplätze <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> befassten<br />
Mitarbeiter sind mit einem 21-Zoll-Monitor ausgestattet. Hier ist jeweils<br />
die Auflösung so gewählt, das zwei DIN-A4-Seiten in Originalgröße ne-<br />
beneinan<strong>der</strong> angezeigt werden, wobei auf einer Seite ein Dokument aus<br />
<strong>der</strong> Fachanwendung OWi21 zu sehen ist und auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en ein ein-<br />
gescanntes Dokument. Da es sich nach Auffassung <strong>der</strong> ZBS um Bild-<br />
schirmarbeitsplätze handelt, steht den Mitarbeitern alle 50 Minuten eine<br />
zehnminütige Pause zu. Von <strong>der</strong> Lösung, zwei Monitore an jedem Ar-<br />
beitsplatz einzusetzen wurde Abstand genommen. Dieser Lösung hätten<br />
finanzielle, aber auch gesundheitliche Gründe („Kopfdrehen“) entgegen<br />
gestanden.<br />
Die eingesetzten Mittel für die qualifizierte Signatur werden dort als un-<br />
verhältnismäßig angesehen. Nach Angaben <strong>der</strong> ZBS belaufen sich die<br />
Kosten zur Zertifizierung pro Mitarbeiter auf EUR 300,-- bis 400,--. Die<br />
Problematik eines Kartentauschs <strong>im</strong> Zweijahresturnus wurde bei <strong>der</strong> ZBS<br />
noch nicht diskutiert.<br />
62
Das Einscannen wird in <strong>der</strong> Kreisverwaltung mittels eines Scanners von<br />
Microform, Waiblingen, vorgenommen. Das Gerät kann die Vorlagen dop-<br />
pelseitig auch in Farbe bis zum Format A3 mit einer Auflösung von maxi-<br />
mal 200 dpi erfassen. Die Geschwindigkeit variiert zwischen Farb- und<br />
S/W-Scannvorgängen, beläuft sich aber auf etwa 160 Seiten pro Minute.<br />
Die Anschaffungskosten liegen etwa bei 60.000,-- Euro.<br />
Die Ausstattung <strong>der</strong> Amtsanwaltschaft in Kassel wurde an die Anforde-<br />
rungen <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>nbearbeitung angepasst. Die Mitarbeiter<br />
arbeiten mit einem großen 16:9 Monitor. Auf diesem können Sie die<br />
Fachanwendung MESTA und das DOMEA-DMS gleichzeitig ansehen<br />
und bearbeiten.<br />
Die Ausstattung <strong>der</strong> Richterarbeitsplätze wurde ebenfalls angepasst. Dort<br />
beschreitet man <strong>der</strong>zeit aber einen an<strong>der</strong>en Weg. Die vier Richterarbeits-<br />
plätze wurden jeweils mit zwei 19-Zoll-Monitoren ausgestattet. Auf dem<br />
einen kann die Fachanwendung EUREKA-Straf bearbeitet werden. Auf<br />
dem an<strong>der</strong>en ist die elektronische <strong>Akte</strong> des DMS einzusehen und zu be-<br />
arbeiten. Die Akzeptanz dieser Bearbeitungsweise sei gegenwärtig unter<br />
den an dem Projekt freiwillig mitarbeitenden Richtern hoch.<br />
Die Datensicherung erfolgt gegenwärtig über den landeseigenen IT-<br />
Dienstleister. Spezielle und vom <strong>Strafverfahren</strong> abweichende Datensiche-<br />
rungen werden <strong>der</strong>zeit während <strong>der</strong> Pilotierung nicht vorgenommen. Auch<br />
diese Frage soll aber geklärt werden, wenn es um eine Anwendung <strong>der</strong><br />
elektronischen <strong>Akte</strong> auf <strong>der</strong> gesamten Fläche Hessens geht.<br />
Zur Frage <strong>der</strong> Ermöglichung einer dauerhaften Datenarchivierung werden<br />
<strong>im</strong> Rahmen dieser Pilotierung unter wissenschaftlicher Beratung <strong>der</strong> Uni-<br />
versität Kassel <strong>der</strong>zeit zwei mögliche Verfahrensweisen diskutiert. Zum<br />
einen wird erörtert, die Unterlagen dauerhaft in dem originär gewählten<br />
Format vorzuhalten und sog. Viewer-Werkzeuge einzusetzen. Hierbei<br />
wird die freilich bestehende Gefahr, dass technische Entwicklungen ir-<br />
gendwann zur Unleserlichkeit <strong>der</strong> Dateien alter Formate führen können,<br />
63
erkannt. An<strong>der</strong>erseits wird angedacht, mittels PDF/Archive des Unter-<br />
nehmens Adobe schon bei <strong>der</strong> Dateierstellung ein Werkzeug einzuset-<br />
zen, dass eine lange Lesbarkeit garantiert.<br />
Zum sonstigen Aufwand:<br />
Ein beson<strong>der</strong>er Schulungsaufwand sei mit Umstellung auf eine aus-<br />
schließlich elektronische <strong>Akte</strong>nführung nicht angefallen, da die Mitarbeiter<br />
bereits seit längerer Zeit mit dem eingesetzten Fachverfahren OWi21 ver-<br />
traut gewesen seien. Auch die Zusammenarbeit zwischen Bußgeldbehör-<br />
de, Staatsanwaltschaft und dem Richtern sei reibungslos verlaufen. Be-<br />
reits vor Einführung <strong>der</strong> rein elektronischen Bearbeitung sei den Richtern<br />
das Verfahren auch vor Ort in <strong>der</strong> ZBS vorgestellt worden. In <strong>der</strong> ZBS<br />
herrscht <strong>der</strong> Eindruck vor, dass durch diese offene Kommunikation zwi-<br />
schen den beteiligten Stellen Vorurteile und Bedenken schon <strong>im</strong> Vorwege<br />
abgebaut werden konnten.<br />
4.1.3 Brandenburg<br />
Im Land Brandenburg werden seit dem Jahre 2005 bis auf wenige einer<br />
beson<strong>der</strong>en Fachbehörde zugewiesene Sachverhalte die Bußgeldverfah-<br />
ren in <strong>der</strong> Zentralen Bußgeldstelle (ZBSt), Gransee, abgewickelt. Der Ab-<br />
lauf nach Aufnahme des Vorgangs durch die Vollzugspolizei deckt sich<br />
weitgehend mit dem zuvor für Schleswig-Holstein dargestellten Verfah-<br />
rensgang.<br />
Zum Ablauf:<br />
Die ZBSt setzt die Software SC-OWi/BB <strong>der</strong> Softcon AG, ein. Auch diese<br />
Fachanwendung bietet einen hohen Automatisierungsgrad und berechnet<br />
beispielsweise Fristen und überwacht Termine. Als Modul ist an diese<br />
Fachanwendung ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) angebun-<br />
den. Dieses DMS wird wie<strong>der</strong>um durch die Softwarekomponente Filenet<br />
unterstützt, dass eine Archivierung eingescannter Bil<strong>der</strong> ermöglicht.<br />
Alle selbst erstellten Schreiben werden vorgangsgebunden gespeichert.<br />
Der Ausdruck von Serienbriefen, etwa Ermittlungsschreiben an die Polizei<br />
o<strong>der</strong> Anschreiben an die Betroffenen und Rechtsanwälte, Bußgeldbe-<br />
64
scheide o<strong>der</strong> Anhörungsschreiben, erfolgt an zentraler Stelle durch Hoch-<br />
leistungsdrucker in <strong>der</strong> ZBSt. Sämtliche Schreiben werden auch hier indi-<br />
ziert.<br />
Die gesamte Eingangspost wird auch hier gescannt und dem Vorgang<br />
automatisch zugeordnet. Sämtliche Schreiben werden dabei optisch ar-<br />
chiviert und dazu nach dem Scannen und Speichern in Bilddateien (Da-<br />
teiformat: TIFF) konvertiert. Eine Verän<strong>der</strong>ung ihrer Inhalte soll anschlie-<br />
ßend nicht mehr möglich sein. Auch die Beweismittel werden, soweit<br />
möglich, eingescannt. Davon erfasst sind auch hier beispielsweise Mess-<br />
protokolle, Eichscheine, und Fahrtenschreiber. Der Sachbearbeiter erhält<br />
bei jedem neu erfassten Vorgang, <strong>der</strong> auf Grund <strong>der</strong> Geschäftsteilung<br />
seiner Zuständigkeit unterfällt, und bei jedem Posteingang zu einem sei-<br />
ner laufenden Verfahren einen elektronischen Hinweis auf das neue Do-<br />
kument.<br />
In sehr vereinzelt gebliebenen Fällen haben Rechtsanwälte ihre Schrift-<br />
sätze <strong>im</strong> Wege des elektronischen Rechtsverkehrs und unter Verwen-<br />
dung einer elektronischen Signatur übersandt, die dann in eine an<strong>der</strong>e<br />
Datei umgewandelt zum Vorgang <strong>im</strong> DMS genommen werden konnten.<br />
Falls es sich bei diesem Schreiben um einen verfahrensbeendenden Be-<br />
schluss o<strong>der</strong> ein Urteil handelt, verfügt <strong>der</strong> Sachbearbeiter in <strong>der</strong> Fach-<br />
anwendung nur noch den Abschluss des Verfahrens. Die ggf. erfor<strong>der</strong>li-<br />
che Mitteilung an das VZR erfolgt sodann automatisch.<br />
Eine elektronische Signatur <strong>der</strong> erfassten elektronischen Dokumente wird<br />
<strong>der</strong>zeit nicht vorgenommen. Das Land Brandenburg hat bislang noch kei-<br />
nen Gebrauch von seiner Ermächtigung zum Erlass <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Rechtsverordnung nach § 110 b Abs. 1 S. 2 OWiG gemacht. Deshalb<br />
werden sämtliche Urschriften bis zum rechtskräftigen Abschluss <strong>der</strong> Ver-<br />
fahren aufbewahrt. Auf das DMS und die elektronische <strong>Akte</strong>nbearbeitung<br />
wird auf Geheiß des Innenministeriums dennoch nicht verzichtet, weil die<br />
<strong>Akte</strong>nbearbeitung innerhalb <strong>der</strong> ZBSt dadurch erheblich beschleunigt<br />
werden konnte.<br />
65
Die Aufbewahrung <strong>der</strong> Urschriften erfolgt nach einem ähnlichen Prinzip<br />
wie in Schleswig-Holstein unter Vergabe best<strong>im</strong>mter Indexwerte, die eine<br />
Rückverfolgung binnen einer Woche gestatten. Nach Angaben <strong>der</strong> ZBSt<br />
werden dadurch aber kostenintensive räumliche wie personelle Ressour-<br />
cen gebunden.<br />
Neben <strong>der</strong> fehlenden Rechtsgrundlage sind <strong>der</strong>zeit nicht vorhandene<br />
Schnittstellen zu den Fachanwendungen <strong>der</strong> Staatsanwaltschaften und<br />
Gerichte ursächlich für den fortdauernden Ausdruck und Versand einer<br />
Papierakte. Für die nahe Zukunft ist eine digitale Schnittstelle jedenfalls<br />
zur Generalstaatsanwaltschaft geplant, über die <strong>der</strong> Austausch von Do-<br />
kumenten und Vorgangsdaten auf Basis von XJusitz zwischen beiden<br />
eingesetzten Fachverfahren (SC-OWi/BB und MESTA) möglich werden<br />
soll. In MESTA soll dann automatisch ein neues Js-OWi-<strong>Akte</strong>nzeichen<br />
angelegt werden. Die elektronischen Dokumente aus dem DMS sollen<br />
dann in das seitens <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft eingesetzte Programm SAS<br />
(Staatsanwaltschaftliches Schreibwerk) abgelegt werden. Automatisiert<br />
soll auf demselben Wege die <strong>Akte</strong>nzeichenmitteilung an die ZBSt erfol-<br />
gen. Da dieser Vorgang erhebliche technische Anpassungen über die<br />
Schnittstellenprogrammierung hinaus, beispielsweise die Anschaffung<br />
von Chipkarten und Lesegeräten für die elektronische Signatur sowie den<br />
Erlass einer Rechtsverordnung nach § 110b OWiG erfor<strong>der</strong>t, wird die<br />
Umsetzung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Zuteilung des je-<br />
weiligen Verfahrens an die zuständige Staatsanwaltschaft soll dann durch<br />
die Generalstaatsanwaltschaft vorgenommen werden.<br />
Auch in Brandenburg wurde die Erfahrung gemacht, dass Urschriften und<br />
Beweismittel als „Original“ nur in sehr seltenen Einzelfällen und dann<br />
ausschließlich auf Antrag eines Rechtsanwaltes durch die Tatgerichte<br />
angefor<strong>der</strong>t werden. Dass diese auf best<strong>im</strong>mte Rechtsfragen o<strong>der</strong> Ur-<br />
schriften ein signifikantes Interesse richten, ist bei diesen wenigen Fällen<br />
nicht erkennbar geworden.<br />
66
Allerdings gibt es bereits jetzt die Möglichkeit, dass Betroffene, auch als<br />
sog. „Naturparteien“, mittels eines Zugangspasswortes Anhörungsbögen<br />
und an<strong>der</strong>e Formulare online (www.polizei.brandenburg.de) ausfüllen<br />
können. Mit dem postalisch zugesandten Anhörungsbogen erhalten die<br />
Betroffenen zugleich einen Login für die Datenbank, mit denen sie sich<br />
sodann anmelden und das Formular ohne Postlaufzeiten und Portokos-<br />
ten ausfüllen können. Angezeigt bekommen sie dabei nur das, was ihnen<br />
bereits in Papierform jeweils vorliegt. Gegenwärtig werden monatlich ca.<br />
4.000 online beantwortete Formulare registriert, die sodann etwa ein bis<br />
drei Sekunden nach dem elektronischen Versenden durch den Betroffe-<br />
nen in das DMS eingestellt werden. Auf das Erfor<strong>der</strong>nis einer elektroni-<br />
schen Signatur wurde hier bewusst verzichtet. Zukünftig soll diese Funk-<br />
tion aber dahin ausgebaut werden, dass Rechtsanwälte darüber vollstän-<br />
dige <strong>Akte</strong>neinsicht bekommen können, wobei die elektronische Signatur<br />
dann eine Voraussetzung sein wird. Bislang erhalten die Rechtsanwälte<br />
einen Ausdruck <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>. Für die Zukunft auch geplant ist<br />
<strong>der</strong> Austausch <strong>der</strong> Daten zwischen <strong>der</strong> ZBSt und <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft.<br />
Zum Einsatz spezieller Soft- und Hardware:<br />
Neben den bereits benannten Programmen für die Fachanwendung und<br />
das DMS wird das Einscannen in <strong>der</strong> ZBSt mittels eines Scanners von Fi-<br />
jutsu, Typ Fs 4340 C für DINA4 – Vorgänge und fs 4750 für DINA3 –<br />
Vorgänge vorgenommen. Eingesetzt wird dabei die Scannsoftware File-<br />
net-Capture und eine Indizieranwendung, um die Urschriften <strong>der</strong> einges-<br />
cannten Unterlagen zuordnen zu können. Die aus Sicht <strong>der</strong> ZBSt zukünf-<br />
tig notwendige Datenmigration wird <strong>der</strong>zeit in Zusammenarbeit mit dem<br />
Unternehmen IBM und <strong>der</strong> Software Filenet vorgenommen.<br />
Zum Sonstigen Aufwand:<br />
Ein außergewöhnlicher Schulungsaufwand wurde in Brandenburg nicht<br />
verzeichnet. Bereits seit nahezu zehn Jahren seien die Mitarbeiter mit ei-<br />
ner elektronischen Bearbeitung <strong>der</strong> Verfahren vertraut. Seit 2003 arbeite-<br />
ten die Mitarbeiter auch mit dem <strong>der</strong>zeit eingesetzten DMS. Die vorhan-<br />
denen Kenntnisse hätten sie nun lediglich noch ergänzen müssen. Allein<br />
bei den Mitarbeitern <strong>im</strong> Scannbereich wurden die Handhabe des Scan-<br />
67
ners, <strong>der</strong> Umgang mit entsprechen<strong>der</strong> Software und die Beson<strong>der</strong>heiten<br />
des Indizierens näher unterrichtet.<br />
Mangels einer elektronischen Übersendung <strong>der</strong> Daten werden gegenwär-<br />
tig nicht nur Zeitverluste durch die wie<strong>der</strong>holte Erfassung <strong>der</strong> sog. Meta-<br />
daten bei Staatsanwaltschaften und Gerichten verzeichnet. Darüber hin-<br />
aus fielen erhebliche Kosten und Zeitverluste durch Kurierfahrten zwecks<br />
Übergabe <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> an die Staatsanwaltschaften an. Diese erhöhten sich,<br />
sobald die Staatsanwaltschaften o<strong>der</strong> die Gerichte, die <strong>Akte</strong>n nach § 69<br />
Abs. 4 S. 1 OWiG wegen unzureichen<strong>der</strong> Sachaufklärung an die ZBSt zu-<br />
rückgesandt würden.<br />
4.2 Zwischenergebnis<br />
Der vorstehend unternommene empirische Überblick zeigt auf, dass die<br />
Bundeslän<strong>der</strong> die durch den Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten<br />
zur elektronischen <strong>Akte</strong>nbearbeitung in Bußgeldverfahren zumindest teil-<br />
weise aufgreifen. Neben den dargestellten Pilotverfahren gibt es ähnliche<br />
Entwicklungen auch in Nie<strong>der</strong>sachsen und Berlin. Die Abläufe sind dort<br />
ähnlich, insbeson<strong>der</strong>e wird auch dort bei Abgabe des Verfahrens an die<br />
<strong>Justiz</strong> gegenwärtig noch eine Papierakte erstellt, da es sowohl an den<br />
technischen Übermittlungsmöglichkeiten wie an einer Rechtsverordnung<br />
nach § 110 b OWiG mangelt.<br />
In an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n ist die Umsetzung des § 110b OWiG dagegen<br />
nicht in vergleichbarer Weise vorangeschritten. So setzen beispielsweise<br />
die Bundeslän<strong>der</strong> Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Ham-<br />
burg gegenwärtig <strong>im</strong>mer noch vollständig auf die Papierakte. In Hamburg<br />
wurde erst jüngst eine Projektgruppe für die Umsetzung einer elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> gegründet. Dabei wurde auch hier die Einführung <strong>der</strong> Fach-<br />
anwendung OWi21 konkret diskutiert. In die Planungen soll von Beginn<br />
an die <strong>Justiz</strong> eingebunden werden. Eine Realisierung <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> wird hier frühestens für das Jahr 2010 erwartet.<br />
Die vorgestellten Pilotverfahren werden nicht koordiniert. Die Kontakte<br />
und ein Erfahrungsaustausch finden eher auf <strong>der</strong> Ebene einzelner Mitar-<br />
68
eiter statt. Gleichwohl lassen sich aber einige übereinst<strong>im</strong>mende wichti-<br />
ge Erfahrungswerte neben den erkennbar gewordenen technischen<br />
Schwierigkeiten mit <strong>der</strong> kostenintensiven Schnittstellenprogrammierung in<br />
den Fachanwendungen aus den jeweiligen Testverfahren festhalten:<br />
Beispielsweise sind mit den Verteidigern bislang keine Probleme aufge-<br />
treten. Nur in seltenen Fällen wurde auf die Einsicht in eine archivierte<br />
Urschrift bestanden und damit ausnahmsweise <strong>der</strong> Ausdruck des einges-<br />
cannten Dokuments nicht akzeptiert. Diesem Ansinnen kann in allen Pi-<br />
lotverfahren <strong>im</strong> gesetzlich vorgegebenen Zeitfenster von einer Woche<br />
(§ 110 b Abs. 2 S. 3 OWiG) entsprochen werden. Offen bleibt aber, ob<br />
diese zurückhaltenden Angriffe <strong>der</strong> Verteidigung gegen die Art und Weise<br />
<strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nführung ein Ergebnis <strong>der</strong> Außendarstellung und Transparenz<br />
<strong>der</strong> jeweils handelnden Bußgeldstellen ist o<strong>der</strong> <strong>der</strong> – soweit ersichtlich –<br />
fehlenden Fortbildungsangebote und damit bislang nicht geschaffener<br />
Sensibilität für die mit <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> zusammenhängenden Fra-<br />
gen auf Rechtsanwaltsseite geschuldet ist.<br />
Auch werden in den dargestellten Pilotierungen zur Erfassung von Vor-<br />
gängen und postalischen Eingängen Massenscannverfahren eingesetzt.<br />
Angewandt wird danach gerade nicht das von § 110b Abs. 2 und 4 OWiG<br />
vorgegebene Verfahren. Danach können eingereichte Schriftstücke („Ur-<br />
schriften“) durch ein elektronisches Dokument ersetzt und noch vor Ver-<br />
fahrensabschluss vernichtet werden, wenn sie den Vermerk enthalten,<br />
wann und durch wen sie erstellt wurden (§ 110 b Abs. 2 OWiG) und dar-<br />
über hinaus einen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verse-<br />
henen Vermerk darüber enthalten, dass Urschrift und elektronisch er-<br />
zeugtes Dokument authentisch sind und ob die Urschrift <strong>im</strong> Original o<strong>der</strong><br />
als Abschrift vorgelegen hat (§ 110 b Abs. 4 OWiG). Mit dieser Bearbei-<br />
tungsweise wäre aber <strong>der</strong> Posteingang von bis zu 12.000 Stück täglich<br />
durch die Bußgeldstelle nicht zu bewältigen. Denn es ist den Mitarbeitern<br />
schon nicht möglich, die Authentizität jedes elektronisch erfassten Doku-<br />
ments mit seiner Urschrift in Papierform ohne ganz erheblichen Zeitver-<br />
lust zu überprüfen (vgl. § 110 b Abs. 4 S. 1 Nr. 1 OWiG). Auch würde die<br />
gefor<strong>der</strong>te qualifizierte elektronische Signatur jedes einzelnen elektroni-<br />
69
schen Dokuments mindestens eine Minute dauern und damit einen zu-<br />
sätzlichen erheblichen Zeitverlust bedeuten. Allein diese Aspekte führen<br />
schon jetzt dazu, dass <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> dargestellten Modellprojekte von §<br />
110 b Abs. 4 OWiG kein Gebrauch gemacht wird. Die Urschriften werden<br />
systematisch aufbewahrt, sodass als geringeres Übel die Kosten für Mit-<br />
arbeiter und Räumlichkeiten <strong>der</strong>zeit hingenommen werden und die vom<br />
Gesetz eingeräumte Möglichkeit, Archivierungskosten durch verkürzte<br />
Aufbewahrungszeiten einzusparen praktisch leerläuft.<br />
Fragen des <strong>Akte</strong>neinsichtsrechts sind gegenwärtig in allen Pilotierungen<br />
noch ohne Bedeutung, da ausschließlich <strong>im</strong> Papierwege vollständig Ak-<br />
teneinsicht gewährt wird. Erst für die Zukunft sind unterschiedliche Wege<br />
<strong>der</strong> Realisierung einer Einsicht in die elektronische <strong>Akte</strong> geplant. Daran<br />
anknüpfende Fragen zu Manipulationsmöglichkeiten <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong>n <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>neinsicht sind deshalb ebenfalls bislang ohne<br />
praktische Relevanz.<br />
Auf eine bemerkenswerte rechtliche Entwicklung soll hier abschließend<br />
noch hingewiesen werden. Mit Beschluss vom 22.6.2006 – 5 StR 578/05<br />
hat <strong>der</strong> Bundesgerichtshof entschieden, dass in EDV-gestützten Verfah-<br />
ren in Verkehrsordnungswidrigkeiten Eingriffe des Sachbearbeiters in den<br />
automatisierten Arbeitsablauf nicht mit schriftlichem Handzeichen belegt<br />
werden müssen. Der Beweis einer verjährungsunterbrechenden Anord-<br />
nung o<strong>der</strong> Entscheidung kann durch die Vorgangshistorie, einen lücken-<br />
losen Ausdruck <strong>der</strong> auf eine best<strong>im</strong>mte Tat <strong>im</strong> EDV-Verfahren bezogenen<br />
elektronischen Geschäftsvorgänge und eingeleitete Maßnahmen geführt<br />
werden (BGHSt 51, 72, 79 ff.). Damit ist in Bezug auf die ausgesprochen<br />
kurze Verjährungszeit von drei Monaten bei Verkehrsordnungswidrigkei-<br />
ten zunächst Rechtssicherheit für die Bußgeldstellen und Gerichte auch<br />
für den Umgang mit <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> geschaffen worden. Die Ent-<br />
scheidung ist aber darüber hinaus auch von Interesse für den elektroni-<br />
schen Erlass eines Bußgeldbescheids. Für diesen sehen §§ 65, 66 OWiG<br />
nicht das Erfor<strong>der</strong>nis einer eigenhändigen Unterschrift vor. Auch nach<br />
höchstrichterlicher Rechtsprechung bedarf es einer solchen mit Blick auf<br />
eine wirksame Verfahrensvoraussetzung nicht (vgl. BGHSt 42, 380, 383<br />
70
ff.). Von diesen eingeführten Grundsätzen wird nun bei <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong>nbearbeitung abgewichen, wenn § 110c Abs. 1 S. 2 OWiG vorgibt,<br />
dass <strong>der</strong> <strong>im</strong> Rahmen des §§ 110b, 110c Abs. 1 S. 1 OWiG erstellte Buß-<br />
geldbescheid qualifiziert elektronisch zu signieren ist. Die vorstehend zi-<br />
tierte jüngere Entscheidung des 5. Strafsenats zu den Voraussetzungen<br />
einer verjährungsunterbrechenden Wirkung <strong>der</strong> Anhörung und die darin<br />
hervorgehobenen Indizien (z.B. elektronische gespeicherte Befehle, lü-<br />
ckenlose elektronische Dokumentation etc.) könnten auch für die Frage<br />
<strong>der</strong> Wirksamkeit des elektronischen Erlasses eines Bußgeldbescheides<br />
fruchtbar gemacht und die darauf bezogene gerichtliche Kontrolldichte<br />
dadurch erhöht werden. Soweit <strong>der</strong> Gesetzgeber auch den Bußgeldbe-<br />
scheid <strong>der</strong> qualifizierten elektronischen Signatur unterstellt und dabei an-<br />
scheinend einzig eine Vereinheitlichung mit an<strong>der</strong>en Verfahrensarten er-<br />
strebt, n<strong>im</strong>mt er die zuvor dargestellten mit <strong>der</strong> elektronischen Signatur<br />
zusammenhängenden Zeitverluste und Kosten ohne gleichzeitigen Ge-<br />
winn für das Bußgeldverfahren in Kauf.<br />
5. Keine elektronische <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong><br />
Das <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz sieht die Einführung <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> nicht vor. Es beschränkt sich mit § 41a StPO auf<br />
die Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs nach Maßgaben einer<br />
Rechtsverordnung. Einzig <strong>der</strong> Eingang elektronischer Dokumente bei Ge-<br />
richt und Staatsanwaltschaft werden geregelt. Diese sind nach § 41 a<br />
Abs. 1 S. 5 StPO unverzüglich auszudrucken. Einer Regelung über die<br />
Ausgangsseite bedurfte es nicht, da insoweit § 173 Abs. 3 ZPO über die<br />
Verweisung in § 37 Abs. 1 S. 1 ZPO zur Anwendung kommt.<br />
Bedenken in <strong>der</strong> Literatur, nach denen den Strafgerichten und Staatsan-<br />
waltschaften bereits de lege lata die elektronische <strong>Akte</strong>nführung aufge-<br />
zwungen werden kann, haben sich bislang empirisch nicht belegen las-<br />
sen. Zwar ist zuzugeben, dass die Strafprozessordnung bislang keine<br />
Regelung über eine Aufbewahrung <strong>der</strong> Datei bzw. <strong>der</strong> Beweisqualität ih-<br />
res Ausdrucks enthält. Praktisch machen von <strong>der</strong> Möglichkeit, <strong>im</strong> Wege<br />
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten zu kommunizieren,<br />
71
we<strong>der</strong> Rechtsanwälte noch sog. Naturparteien zu einem nennenswerten<br />
Anteil Gebrauch. Fast ausnahmslos wird schriftlich kommuniziert.<br />
6. <strong>Elektronische</strong> Hilfsmittel <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong><br />
6.1 Überblick: Ausstattung <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> <strong>der</strong> Län<strong>der</strong><br />
Die nachstehenden Ausführungen sollen die <strong>der</strong>zeitige Ausstattung <strong>der</strong><br />
Gerichte und Staatsanwaltschaften <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> mit elektronischen Hilfs-<br />
mitteln skizzieren. Dazu wird weitgehend auf eine tabellarische Übersicht<br />
zurückgegriffen.<br />
6.1.1 Hardware<br />
Ausweislich <strong>der</strong> jährlichen Län<strong>der</strong>berichte <strong>der</strong> Landesjustizministerien an<br />
die Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission sind alle Gerichte und Staatsanwaltschaf-<br />
ten <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> nahezu flächendeckend mit Bildschirmarbeitsplätzen (d.h.<br />
PC und Standardsoftware) ausgestattet.<br />
Verbreitet ist zudem die IT-Struktur eines Server-Based-Computing, bei<br />
dem sämtliche PCs (Clients) an den Arbeitsplätzen <strong>der</strong> Mitarbeiter auf<br />
Server für das Abrufen von Daten und Software zurückgreifen. Das er-<br />
laubt insbeson<strong>der</strong>e auch unterd<strong>im</strong>ensionierten o<strong>der</strong> veralteten PCs Appli-<br />
kationen wie etwa den Internet-Explorer o<strong>der</strong> typische Office-<br />
Anwendungen (Word/Excel) anstatt in ihrem eigenen <strong>im</strong> Arbeitsspeicher<br />
eines zentralen Applikations-Servers ablaufen zu lassen. Die Client-PCs<br />
werden dabei als Terminals verwendet, die lediglich dem Eingeben von<br />
Daten dienen und diese an einen Terminal-Server schicken. Dieser führt<br />
die eigentliche Bearbeitung durch und sendet die sich daraus ergebende<br />
Bearbeitung zurück auf den Bildschirm des Client-Terminals. Über diese<br />
Client-Terminal-Struktur sind die justiziellen Arbeitsplätze untereinan<strong>der</strong><br />
nahezu überall vollständig miteinan<strong>der</strong> vernetzt.<br />
6.1.2 Software<br />
Geprägt wird die praktische Bearbeitung straf- und ordnungswidrigkeiten-<br />
rechtlicher Verfahren in deutschen Staatsanwaltschaften und Gerichten<br />
zunächst durch die eingesetzten EDV-Fachanwendungen. In den Bun-<br />
72
deslän<strong>der</strong>n finden verschiedene Vorgangsbearbeitungs- und Vorgangs-<br />
verwaltungssysteme unterschiedlicher Hersteller Anwendung. Sie sind<br />
jeweils auf die Bedürfnisse <strong>der</strong> Staatsanwaltschaften bzw. auf die <strong>der</strong> Ge-<br />
richte und zumeist unter Einsatz eines speziellen weiteren Software-<br />
Moduls auf die Belange <strong>der</strong> Strafgerichte ausgerichtet.<br />
Als Beispiel für eine EDV-Fachanwendung soll hier lediglich das Projekt<br />
MESTA (Mehrlän<strong>der</strong>-Staatsanwaltschafts-Automation) vorgestellt wer-<br />
den. Die Län<strong>der</strong> Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein beauf-<br />
tragten als Entwicklungsverbund, dem später auch Hessen beigetreten<br />
ist, die Datenzentrale Schleswig-Holstein mit <strong>der</strong> Programmentwicklung.<br />
MESTA soll zu einer Vereinfachung und Verkürzung <strong>der</strong> Verfahrensab-<br />
läufe in den Staatsanwaltschaften beitragen.<br />
Kernpunkt <strong>der</strong> Anwendung ist eine Schriftguterstellung, in <strong>der</strong> einmal er-<br />
fasste Daten zu verschiedenen Zwecken, von <strong>der</strong> Registratur eines Neu-<br />
eingangs bis zum Abschluss des Vollstreckungsverfahrens, unterschied-<br />
lich aufbereitet werden können. So liegen z.B. ca. 80 Vordrucke bereit,<br />
die mit einer eingebundenen Textverarbeitungssoftware bearbeitet und<br />
automatisch mit Falldaten gefüllt werden können. Alle innerbehördlichen<br />
Funktionseinheiten sollen – soweit erfor<strong>der</strong>lich – auf die Daten zugreifen<br />
dürfen. Bislang notwendige <strong>Akte</strong>ntransporte sollen wegfallen. Schnittstel-<br />
len erlauben die Kommunikationsbeziehungen zu externen Partnern wie<br />
z. B. dem Bundeszentralregister o<strong>der</strong> dem Verkehrszentralregister. Auch<br />
können beispielsweise sämtliche zu versendende Schriftstücke gesam-<br />
melt an einer Stelle ausgedruckt und versandt werden. In Hessen werden<br />
auf diesem Wege jährlich über 260.000 Schreiben versandt.<br />
Daneben gibt es weitere Entwicklungsverbünde betreffend staatsanwalt-<br />
schaftliche aber auch gerichtliche Fachanwendungen. Für letztere ist hier<br />
namentlich <strong>der</strong> Verbund FORUMStar hervorzuheben, dem neben Bayern<br />
und Baden-Württemberg auch die Bundeslän<strong>der</strong> Rheinland-Pfalz und Sach-<br />
sen angehören.<br />
73
Die eingesetzten Fachanwendungen sind jeweils unterschiedlichen Alters<br />
und Entwicklungsstandes. Ungeachtet <strong>der</strong> mit dem Versionsalter <strong>der</strong><br />
Software einhergehenden Verbesserungen dürften sie allesamt ein ähnli-<br />
ches Leistungsspektrum abdecken. In jüngster Zeit gehen die Landesjus-<br />
tizverwaltungen dazu über, in ihren jeweils eingesetzten EDV-<br />
Fachanwendungen Schnittstellen auf X<strong>Justiz</strong>-Basis programmieren zu<br />
lassen, um zukünftig den <strong>der</strong>zeit nur in wenigen Ausnahmefällen mögli-<br />
chen und durchgeführten Datenaustausch zwischen Staatsanwaltschaf-<br />
ten und Gerichten zu ermöglichen.<br />
Auf Grund <strong>der</strong> Vielfalt <strong>der</strong> Aufgaben <strong>der</strong> ordentlichen Gerichtsbarkeit<br />
kommt eine Vielzahl an IT-Fachverfahren zum Einsatz. Hier sollen aus-<br />
schließlich die für das Straf- und Bußgeldverfahren zentralen Fachverfah-<br />
ren dargestellt werden:<br />
74
EDV-Fachverfahren in <strong>der</strong> Strafjustiz<br />
Staatsanwaltschaften Gerichte<br />
Baden-Württemberg web.sta forumSTAR<br />
Bayern<br />
Berlin<br />
Brandenburg<br />
Bremen<br />
Hamburg<br />
Hessen<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
web.sta;<br />
Kommunikation mit Polizei <strong>im</strong> Ansatz über Easy II<br />
möglich aber noch in <strong>der</strong> Pilotverfahrensphase<br />
ASTA und JUKOS;<br />
schrittweise Einführung von MODESTA<br />
MESTA<br />
ergänzt um SAS und digitale Diktiertechnik<br />
web.sta<br />
auch Registerabfragen BZR und VZR über<br />
Zentralrechner in Celle möglich<br />
MESTA<br />
Abfrage bei BZR und VZR erfolgt elektronisch<br />
MESTA<br />
Auslagerung des Postversands bei Massendrucksachen;<br />
in UJs Sachen werden dort die Bescheide für die<br />
Amtsanwaltschaft Frankfurt erstellt.<br />
ARGUS StA<br />
forumstar;<br />
STRAFTEXT (Textverarbeitung, einschließlich<br />
Protokollführung); Kommunikation<br />
mit web.sta auf Xjustiz-Basis<br />
möglich<br />
AULAK<br />
MEGA<br />
Datenaustausch mit BZR und VZR ist<br />
in beide Richtungen möglich;<br />
EUREKA-Straf<br />
MEGA<br />
geplant ist Umsetzung von<br />
EUREKA-Straf<br />
EUREKA<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen web.sta EUREKA-Staf<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Saarland web.sta<br />
Sachsen<br />
MESTA<br />
unter Ergänzung durch ACUSTA, das Texterstellung unter<br />
Nutzung <strong>der</strong> unter MESTA gespeicherten Daten bieten<br />
soll<br />
CUST;<br />
langfristig Umstieg und Migration <strong>der</strong> Daten in<br />
web.sta V 3.0<br />
web.sta;<br />
Kommunikationsnetz mit Polizei und Registern;<br />
TV-StA (Textverarbeitung mit Textbausteinen)<br />
ARGUS AG Straf ARGUS LG Straf<br />
ARGUS OLG Straf (<strong>im</strong> Testlauf befindet<br />
sich zur Zeit automatische Abfrage<br />
des BZR und des VZR)<br />
JUDICA<br />
Sachsen-Anhalt web.sta EUREKA<br />
Schleswig-Holstein<br />
Thüringen<br />
MESTA<br />
elektronische Kommunikation mit an<strong>der</strong>en Behörden,<br />
insbeson<strong>der</strong>e Registern, u.A. das zentrale staatsanwalt-<br />
schaftliche Verfahrensregister<br />
web.sta V 2.1;<br />
forumSTAR als XML-fähiges Textsystem<br />
MAJA<br />
langfristig Umstieg auf forumSTAR<br />
geplant<br />
EUREKA<br />
inklusive elektronische Geschäftsverteilungsplan<br />
<strong>der</strong>selben Anwendung in<br />
Teilen <strong>der</strong> Strafgerichte<br />
forumSTAR STRAFTEXT (Textverarbeitung,<br />
einschließlich Protokollführung)<br />
MEGA<br />
elektronische Kommunikation mit dem<br />
Bundeszentralregister und Verkehrszentralregister<br />
MEGA<br />
plus weitere Fachapplikationen zur Berechnung<br />
von PKH, rechnerische Best<strong>im</strong>mung<br />
<strong>der</strong> BAK <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong><br />
75
6.2 Modelle einer elektronischen <strong>Akte</strong>nbearbeitung<br />
Als eine Grundvoraussetzung für die elektronische Kommunikation aber<br />
wesentlich auch für die Errichtung und Bearbeitung einer elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> wurde bereits einleitend auf eine möglichst einheitliche EDV-<br />
Sprache verwiesen. Insbeson<strong>der</strong>e die Übernahme bereits erfasster elekt-<br />
ronischer Dokumente durch an<strong>der</strong>e Behörden und Instanzen führt erst<br />
zur erstrebten nachhaltigen Effizienzsteigerung durch die elektronischen<br />
Hilfsmittel. Dass insbeson<strong>der</strong>e die Übernahme sog. „strukturierten Partei-<br />
vortrags“ gegenwärtig auf X<strong>Justiz</strong>-Basis geschieht, wurde bereits darge-<br />
stellt (vgl. IV 2.2.)<br />
Den mit dem X<strong>Justiz</strong>-Standard einhergehenden Nachteil, dass eine Viel-<br />
zahl von Schemata entwickelt und durch die Rechtsanwen<strong>der</strong> beachtet<br />
werden müssen, um eine weitgehende Strukturierung <strong>der</strong> zunächst aus-<br />
nahmslos <strong>im</strong> Fließtext vorhandenen Daten zu ermöglichen, versuchen<br />
Anbieter von DMS-Sorftware mit ihren Programmen zu überwinden. Der<br />
Blick soll hier fokussiert werden auf das Modellprojekt <strong>der</strong> Berliner Gene-<br />
ralstaatsanwaltschaft „MODESTA“ und die „Normfall“-Software <strong>der</strong> Norm-<br />
fall GmbH, München, <strong>der</strong>en Grün<strong>der</strong> Prof. Dr. Haft als Gast <strong>der</strong> Sitzung<br />
<strong>der</strong> Großen Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes anwe-<br />
send war.<br />
6.2.1 MODESTA<br />
Das Projekt MODESTA (Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Staatsanwaltschaften) wird<br />
gegenwärtig durch die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in Zusammenar-<br />
beit mit dem Unternehmen Fabasoft Deutschland GmbH, Frankfurt, (einer<br />
Tochter <strong>der</strong> in Linz, Österreich, ansässigen Fabasoft International Servi-<br />
ces GmbH) betrieben. Ziel von MODESTA ist es, eine vollelektronische<br />
<strong>Akte</strong>nbearbeitung <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> zu ermöglichen. Dabei sollen insbe-<br />
son<strong>der</strong>e die Polizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte auf lange<br />
Sicht eingebunden werden.<br />
Geplant ist eine schrittweise Einführung von MODESTA unter Ablösung<br />
<strong>der</strong> gegenwärtig eingesetzten Fachanwendung ASTA. (Automation <strong>der</strong><br />
Staatsanwaltschaft und <strong>der</strong> Amtsanwaltschaft). Im Rahmen <strong>der</strong> gegen-<br />
76
wärtig realisierten ersten Stufe von insgesamt drei Stufen wird lediglich<br />
die Registratur mittels MODESTA geführt. Ergänzt wird die Registratur-<br />
funktion <strong>im</strong> Zuge <strong>der</strong> geplanten zweiten Stufe ab Herbst 2008 um ein in<br />
MODESTA integriertes Schreibwerksystem. Im Zuge des zeitlich noch<br />
nicht konkretisierten Vollbetriebs als dritte Stufe soll unter vollständigem<br />
Einsatz auch eines Dokumentenmanagementsystems die Fachwendung<br />
ASTA abgelöst und <strong>der</strong> Umstieg von <strong>der</strong> papiergestützten auf die elektro-<br />
nische <strong>Akte</strong> vollzogen werden. Die technischen und organisatorischen<br />
Voraussetzungen für den Vollbetrieb nehmen allerdings noch längere Zeit<br />
in Anspruch, sodass auf absehbare Zeit auch in Berlin die Papierakte<br />
maßgeblich ist. Der Tatsache, dass es an einer § 110 b OWiG entspre-<br />
chenden Rechtsgrundlage für das <strong>Strafverfahren</strong> fehlt, kommt daher <strong>der</strong>-<br />
zeit weniger Bedeutung zu.<br />
6.2.1.1 Hintergrund<br />
Ein Projektteam bestehend aus Vertretern <strong>der</strong> Berliner Staatsanwalt-<br />
schaften, insbeson<strong>der</strong>e Staatsanwälten und Ingenieuren, und Mitarbei-<br />
tern von Fabasoft GmbH hat das von Fabasoft GmbH allgemein angebo-<br />
tene Produkt eGov-Suite mit dem Ziel überarbeitet, es für die spezifische<br />
Vorgangsbearbeitung in <strong>der</strong> Strafverfolgung nutzbar zu machen.<br />
Der reguläre eGov-Suite ist als Standardprodukt für die behördliche elekt-<br />
ronische <strong>Akte</strong>nbearbeitung konzipiert und Kern des Fabasoft GmbH Pro-<br />
duktangebotes für den Öffentlichen Sektor. Das Produkt ist zertifiziert<br />
nach <strong>der</strong> Verwaltungs- und Compliance-Norm DOMEA-Konzept 2.0 (Do-<br />
kumentenmanagement und elektronische Archivierung <strong>im</strong> IT-gestützten<br />
Geschäftsgang) <strong>der</strong> Koordinierungs- und Beratungsstelle <strong>der</strong> Bundesre-<br />
gierung für Informationstechnik in <strong>der</strong> Bundesverwaltung (KBSt). Unter<br />
DOMEA wird das Konzept für Dokumentenmanagement und elektroni-<br />
sche Archivierung in <strong>der</strong> öffentlichen Verwaltung verstanden. An die Stel-<br />
le <strong>der</strong> Papierakten sollen künftig behördliche Geschäftsprozesse treten,<br />
die medienbruchfrei und vollständig elektronisch realisiert werden kön-<br />
nen. Das DOMEA-Konzept liefert dafür Richtlinien, ist aber trotz seiner<br />
weiten Verbreitung und <strong>der</strong> Möglichkeit <strong>der</strong> entsprechenden Zertifizierung<br />
kein genormter Standard. Als thematischen Schwerpunkt behandelt das<br />
77
DOMEA-Organisationskonzept den Geschäftsgang unter ablauforganisa-<br />
torischen Aspekten. So wird <strong>der</strong> behördliche Geschäftsgang wie folgt be-<br />
schrieben: Eingangsbehandlung - Bearbeitung - Postausgang - Archivie-<br />
rung.<br />
Anknüpfend an eGov-Suite sollte das eingesetzte Projektteam die Be-<br />
son<strong>der</strong>heiten des <strong>Strafverfahren</strong>s berücksichtigen. Fabasoft GmbH ent-<br />
wickelte vor diesem Hintergrund das Produkt eGov-Suite/GStA, das so-<br />
dann in den Testbetrieb genommen wurde.<br />
6.2.1.2 Technische Funktionsweise<br />
Der eGov-Suite/GStA soll <strong>im</strong> Vollbetrieb die herkömmlichen Fachanwen-<br />
dungen zur Vorgangsbearbeitung vollständig ersetzen. Dafür enthält er<br />
neben einem Dokumentenmanagementsystem, ein eigenes Schreibwerk<br />
mit eingepflegter Formularsammlung sowie eine Vielzahl weiterer Funkti-<br />
onen.<br />
Gegenwärtig beschränkt sich die erste Stufe von MODESTA auf den<br />
wechselseitigen Austausch von Metadaten zwischen dem polizeilichen<br />
Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS und <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft. Die-<br />
ser Austausch zwischen POLIKS und MODESTA erfolgt auf X<strong>Justiz</strong>-<br />
Basis. Die maßgebliche Papierakte wird <strong>der</strong>zeit per Kurier/Stafette an die<br />
Staatsanwaltschaft überbracht. Eingescannt wird sie <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> ers-<br />
ten Stufen nicht. Geht <strong>der</strong> Vorgang bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft ein, wird<br />
elektronisch über eine sichere Leitung unter Angabe des polizeilichen Ak-<br />
tenzeichens <strong>der</strong> Metadatensatz aus POLIKS abgefragt und in MODESTA<br />
übernommen. Auf demselben Weg wird das staatsanwaltschaftliche Ak-<br />
tenzeichen an POLIKS übermittelt und dort erfasst. Maßgebend ist wei-<br />
terhin die Papierakte. In diese werden sämtliche Neueingänge eingehef-<br />
tet.<br />
Die Neueingänge sollen weitgehend automatisch durch MODESTA in die<br />
Geschäftsverteilung gegeben und den einzelnen Dezernaten zugeordnet<br />
werden. Dazu wird nicht auf eine Zuordnung mittels Nachnamen o<strong>der</strong><br />
Endziffern des <strong>Akte</strong>nzeichens zurückgegriffen. Maßstab ist vielmehr die<br />
78
Auslastung <strong>der</strong> Dezernate nach bereits erfolgten Eingängen. Für jedes<br />
Dezernat führt MODESTA ein Punktekonto. Das Dezernat, welches bis-<br />
lang die wenigsten Punkte aufweist, bekommt das neue Verfahren zuge-<br />
teilt. Stellt sich später heraus, dass die Sache überdurchschnittlich um-<br />
fangreich ist, kann <strong>der</strong> Faktor auf Veranlassung eines Dezernen-<br />
ten/Abteilungsleiters für dieses Verfahren neu berechnet und damit das<br />
Punktekonto korrigiert werden. Neben <strong>der</strong> Zuordnung von Verfahren <strong>der</strong><br />
Alltags- und Bagatellkr<strong>im</strong>inalität können auf diese Weise auch einfach<br />
gelagerte UJs-Sachen in die Geschäftsverteilung gegeben werden. We-<br />
niger sinnvoll dürfte diese Verteilung aber bei Verfahren sein, die in die<br />
Zuständigkeiten von Son<strong>der</strong>dezernaten fallen. Hier kommen namentlich<br />
das Wirtschafts-Korruptionsstrafrecht o<strong>der</strong> die Organisierte Kr<strong>im</strong>inalität in<br />
Betracht. Der Dezernent kann neben <strong>der</strong> Korrektur seines Punktekontos<br />
eine Fehlzuteilung aber korrigieren lassen und dadurch eine Neuzutei-<br />
lung des Verfahrens erreichen.<br />
Obgleich bislang auf die Papierakte nicht verzichtet werden kann, setzt<br />
die Berliner Generalstaatsanwaltschaft bereits jetzt auf das Projekt MO-<br />
DESTA. Denn lediglich etwa 25% <strong>der</strong> Ermittlungsverfahren werden vor ih-<br />
rem Abschluss an die Gerichte übersandt. Dabei sind bereits Verfah-<br />
renseinstellungen und Anträge an die Ermittlungsrichter inbegriffen. Somit<br />
können bereits heute auch ohne gerichtliche Einbindung 75% <strong>der</strong> Verfah-<br />
ren (z.B. nach §§ 170 Abs. 2 StPO, 45 JGG) mit MODESTA bearbeitet<br />
werden. Die restlichen Verfahren werden den Gerichten ausschließlich<br />
als Papierakte zugänglich gemacht.<br />
6.2.1.3 Die geplante 3. Stufe<br />
Mit Einführung <strong>der</strong> geplanten dritten Stufe soll dieser Transportweg weg-<br />
fallen. Neben den Metadaten sollen auch sämtliche weitere <strong>Akte</strong>ninhalte<br />
elektronisch übermittelt werden, nachdem sie bei <strong>der</strong> Polizei entwe<strong>der</strong><br />
selbst erstellt o<strong>der</strong> dort durch Einscannen erfasst worden sind. Die Berli-<br />
ner Generalstaatsanwaltschaft geht insoweit davon aus, dass etwa 80%<br />
<strong>der</strong> zu führenden Verfahren durch die Polizei <strong>im</strong> Wege des ersten Zugriffs<br />
eingeleitet und erst danach an die Staatsanwaltschaft abgegeben wer-<br />
den. Weitere fünf bis zehn Prozent werden durch die Zoll- und Steuer-<br />
79
fahndungsdienststellen erfasst. Nur ein kleiner Teil <strong>der</strong> Ermittlungsverfah-<br />
ren wird tatsächlich durch die Staatsanwaltschaft selbst eingeleitet, so-<br />
dass <strong>der</strong> Großteil an Datenerfassung und bei den Polizeidienststellen zu<br />
erfolgen hat und dort <strong>der</strong> Organisations- und Kostenaufwand anfällt. In<br />
welcher Weise die elektronische Übermittlung <strong>der</strong> übrigen <strong>Akte</strong>ninhalte<br />
erfolgen soll, ist noch ungeklärt. Im Gespräch ist ein Zugriff über einen<br />
Pfad („link“) auf X<strong>Justiz</strong>-Basis auf ein XDOMEA-Dateiformat, das dann<br />
als Zipp-Datei übersandt werden kann. Entsprechende Vorschläge wur-<br />
den <strong>der</strong> BLK bereits durch die Bundespolizei unterbreitet.<br />
Bislang ist als Ablauf für die dritte Stufe geplant, dass die elektronischen<br />
Dokumente <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft übermittelt werden, diese ihre Verfü-<br />
gungen vorn<strong>im</strong>mt, ggf. weiteren Schriftverkehr dem DMS hinzufügt und<br />
schließlich eine abschließende Entscheidung trifft. Für den Fall <strong>der</strong> An-<br />
klageerhebung ist geplant, dem Gericht ebenfalls die <strong>Akte</strong> elektronisch zu<br />
übermitteln. Eine entsprechende Schnittstelle mit den gerichtlichen Vor-<br />
gangsbearbeitungsprogrammen gibt es indes noch nicht.<br />
Anscheinend unerörtert ist indes die Frage geblieben, wie sichergestellt<br />
werden kann, dass alle beteiligten Dienststellen stets über die aktuelle<br />
Fassung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> verfügen. Dies kann insbeson<strong>der</strong>e dann problematisch<br />
werden, wenn auf Seiten <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft und <strong>der</strong> Polizei während<br />
eines länger andauernden und komplexen Ermittlungsverfahrens weitere<br />
Dokumente eingehen. Hier ist zu entscheiden, welche <strong>Akte</strong> als führend<br />
angesehen werden soll und sicherzustellen, dass an verschiedenen Stel-<br />
len nicht unterschiedliche <strong>Akte</strong>ninhalte und dadurch ineffiziente Informati-<br />
onsdefizite entstehen.<br />
Dieser Aspekt wurde bislang nur <strong>im</strong> Zusammenhang mit einer elektroni-<br />
schen Übersendung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> an den Ermittlungsrichter diskutiert. Solan-<br />
ge dieser eine elektronische Form <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> zur Bearbeitung hat und <strong>der</strong><br />
Vermerk „versandt“ eingetragen ist, soll in MODESTA ein Sperrvermerk<br />
jede weitere Bearbeitung auf Seiten <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft unmöglich<br />
sein. Erst wenn die Beschlüsse durch das Amtsgericht gefasst wurden<br />
und <strong>der</strong> Vermerk „versandt“ gelöscht wurde, sollen zwischenzeitlich er-<br />
80
stellte o<strong>der</strong> eingegangene und bis dahin in einem Retent abgelegte Do-<br />
kumente dem Vorgang hinzugefügt werden können.<br />
6.2.1.4 Die geplante Verfahrensbearbeitung mit MODESTA<br />
Der eGov-Suite/GStA besteht in <strong>der</strong> dritten Stufe aus unterschiedlichen<br />
Portalseiten, namentlich dem „Posteingang“, dem sog. „Arbeitsvorrat“,<br />
dem „Schreibtisch“ und „Sitzungstermine“. Allesamt sind sie abhängig<br />
von <strong>der</strong> jeweiligen Funktion des Benutzers (z.B. Geschäftstellenmitarbei-<br />
ter, Dezernent, Behördenleiter) konfigurierbar und für diese einsehbar.<br />
Die Bildschirmmaske des staatsanwaltschaftlichen Dezernenten glie<strong>der</strong>t<br />
sich in drei Teile: „Maßnahmen“ (links oben), „<strong>Akte</strong>nbaum“ (links unten)<br />
und <strong>der</strong> Anzeige des jeweils aufgerufenen <strong>Akte</strong>nblatts bzw. des gerade<br />
bearbeiteten Dokuments.<br />
Der <strong>Akte</strong>nbaum<br />
Dieser und damit die <strong>Akte</strong>nstruktur lässt sich grundsätzlich unterschied-<br />
lich darstellen. Ohne weiteres ist es möglich, die Struktur chronologisch<br />
aufzubauen. Darüber hinaus bietet MODESTA die Möglichkeit, die Do-<br />
kumente nach Kategorien (z.B. Zeugenvernehmungen, Anzeigen, Haftbe-<br />
fehl etc.) anzeigen zu lassen. Dies setzt indes voraus, dass dem Doku-<br />
ment zu einem früheren Zeitpunkt diese Eigenschaft bereits zugeschrie-<br />
ben wurde. Soweit es sich um Dokumente handelt, die in MODESTA<br />
selbst erzeugt wurden, ist dies unproblematisch, da das System selbst<br />
den Dokumenten die möglichen Attribute zuschreibt. An<strong>der</strong>s ist es hinge-<br />
gen bei Dokumenten, die von <strong>der</strong> Berliner Polizei in POLIKS erstellt o<strong>der</strong><br />
gar von Dritten in Papierform übersandt und sodann eingescannt worden<br />
sind. Hier bedarf es für jedes einzelne Dokument <strong>der</strong> Zuweisung einer Ei-<br />
genschaft, um später die Verknüpfung mit einer Kategorie zu ermögli-<br />
chen.<br />
Ebenfalls können statt des <strong>Akte</strong>nbaums sämtliche neueingegangenen<br />
Dokumente aufgerufen werden. Wählt <strong>der</strong> Benutzer ein beliebiges Doku-<br />
ment aus dem <strong>Akte</strong>nbaum aus, so erscheint es auf <strong>der</strong> rechten Bild-<br />
schirmseite. Daneben kann <strong>der</strong> Benutzer mittels Knopfdruck durch die e-<br />
lektronischen Dokumente vor- und zurückblättern.<br />
81
Die Maßnahmen: Für die <strong>Akte</strong>nbehandlung und tägliche Arbeit des<br />
staatsanwaltschaftlichen Dezernenten sieht das Produkt etwa 80 ver-<br />
schiedene Werkzeuge vor, die sog. „Maßnahmen“. Die alphabetisch auf-<br />
gezählten „Maßnahmen“ enthalten beispielsweise die Aktionen „<strong>Akte</strong>n<br />
beiziehen“, „<strong>Akte</strong>neinsicht gewähren“, „Anklage“, „Ermittlungsauftrag er-<br />
teilen“ und „Registerauskunft“.<br />
Klickt <strong>der</strong> Dezernent auf die entsprechende Schaltfläche „Ermittlungsauf-<br />
trag erteilen“, erscheint rechts ganzseitig auf dem Monitor das entspre-<br />
chende Formular, in dem bereits die Metadaten (z.B. <strong>Akte</strong>nzeichen) ent-<br />
halten sind. In das Formular trägt er den konkreten Ermittlungsauftrag ein<br />
(beispielsweise Vernehmung des Zeugen XY) und kann <strong>im</strong> Kopf des<br />
Formulars die zuständige Polizeidienststelle auswählen. Auch für diese<br />
spezielle Anwendung werden unterschiedliche Textbausteine vom Pro-<br />
dukt angeboten, die lediglich ergänzt werden müssen.<br />
Ebenfalls über die Schaltfläche „Maßnahmen“ kann <strong>der</strong> Dezernent in das<br />
Menü „Anklage“ gelangen. Hier werden die bereits vorhandenen Metada-<br />
ten auf verschiedene Registerkarten verteilt, um eine übersichtliche An-<br />
zeige zu gewährleisten. So finden sich beispielsweise die Registerkarten<br />
„Personalien/Anklagesatz“, „Beweismittel“, „Wesentliches Ergebnis <strong>der</strong><br />
Ermittlungen“ und „Anträge zur Anklageschrift“. Auch für die Abschluss-<br />
verfügung gibt eine umfangreiche Maske, die eine Vielzahl denkbarer<br />
Verfügungsinhalte bereits vorhält, die durch Anklicken für das konkrete<br />
Verfahren jeweils aktiviert werden können. Soweit <strong>der</strong> Dezernent in seine<br />
Verfügung einen Punkt aufnehmen will, den MODESTA nicht in Masken-<br />
form vorsieht, kann er sich nach Abschluss <strong>der</strong> Maske das Dokument in<br />
<strong>der</strong> Textverarbeitung OpenText anzeigen lassen und beliebig viele Ände-<br />
rungen vornehmen. Dies gilt <strong>im</strong> Übrigen für nahezu alle Maßnahmen.<br />
Das Dokument ist fertig gestellt und die Maßnahme beendet, wenn <strong>der</strong><br />
Dezernent abschließend eine Frist für die elektronische Wie<strong>der</strong>vorlage in<br />
Form einer Erinnerung an dieses Verfahren setzt und damit die sog.<br />
„Schlusszeichnung“ vorn<strong>im</strong>mt. Diese obliegt <strong>im</strong>mer ihm. Das gilt auch,<br />
82
wenn er ein Dokument erstellt hat aber die Anschrift des Adressaten<br />
durch die Geschäftsstelle noch zu ermitteln ist. Dann übersendet er <strong>der</strong><br />
Geschäftsstelle das Dokument als Entwurf, diese recherchiert, gibt die<br />
fehlenden Daten ein und sendet es zurück an den Dezernenten. Nach ei-<br />
ner abschließenden Überprüfung n<strong>im</strong>mt er sodann die Schlusszeichnung<br />
vor und erst dann wird das Dokument dem Vorgang hinzugefügt, automa-<br />
tisch elektronisch paginiert und zugleich abgeschickt.<br />
Eine spätere Verän<strong>der</strong>ung des Inhalts soll nicht möglich sein. Sämtliche<br />
Dokumente werden von MODESTA durch das Programm PDF-Rea<strong>der</strong><br />
angezeigt. Für alle Vorgänge ist die Berechtigung auf den Servern auf<br />
das Lesen bereits erstellter Dokumente beschränkt, sobald diese eine<br />
Schlusszeichnung enthalten. Sofern ein Dokument entfernt werden soll,<br />
geht das nur auf Ebene <strong>der</strong> Metadaten durch ein Weißen des Doku-<br />
ments. Ein weißes und paginiertes Blatt bleibt indes an Stelle des frühe-<br />
ren Dokuments <strong>Akte</strong>nbestandteil.<br />
Schnittstellen: Um über die Maßnahme „Registerauszüge“ eine Abfrage<br />
zu tätigen, besteht gegenwärtig noch eine Schnittstelle zur zuvor aus-<br />
schließlich eingesetzten Fachanwendung ASTA. Darüber werden die Re-<br />
gister online angefragt, ohne dass eine Maske des ASTA-Systems ange-<br />
zeigt wird. Die Registerauskunft wird ebenfalls online vom BZR, VZR,<br />
ZStA überspielt und in MODESTA erfasst. Darüber hinaus werden über<br />
diese Schnittstelle auch die staatsanwaltschaftlichen Statistiken <strong>der</strong>zeit<br />
noch gepflegt. MODESTA selbst bietet dafür noch keine Funktion.<br />
Zukünftig sollen über eine weitere Schnittstelle zur gerichtlichen Fachan-<br />
wendung AULAK Sitzungstermine bzw. <strong>der</strong>en Än<strong>der</strong>ungen übermittelt<br />
werden können. Bislang und auf absehbare Zeit gibt es indes keine Mög-<br />
lichkeit, die in MODESTA geführte <strong>Akte</strong> auch dem Gericht zugänglich zu<br />
machen. Es fehlt an den erfor<strong>der</strong>lichen, erst zu programmierenden<br />
Schnittstellen.<br />
83
6.2.1.5 Anfor<strong>der</strong>ungen an die Hardware<br />
Für die 1.400 Bildschirmarbeitsplätze sind Än<strong>der</strong>ungen geplant. Zwar<br />
wird auch in Berlin das Modell des Server-Based-Computing praktiziert.<br />
Damit ist gewährleistet, dass auch veraltete einzelne Arbeitsplatzrechner,<br />
die sog. Clients, auf Hochleistungsserver, auf denen die Fachanwendung<br />
und sämtlich Daten und Funktionen bereitstehen, ohne Zeitverlust zugrei-<br />
fen können (vgl. IV 3.1). Indes ist eine Ausstattung sämtlicher Arbeitsplät-<br />
ze <strong>der</strong> Dezernenten mit 24-Zoll-Monitoren <strong>im</strong> Breitbildformat geplant. Auf<br />
diesen können zwei DINA4-Seiten nebeneinan<strong>der</strong> angesehen werden.<br />
Von <strong>der</strong> Bildschirmoberfläche sollen <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nbaum und die übrigen<br />
Funktionen von MODESTA etwa die Hälfte o<strong>der</strong> Zweidrittel einnehmen.<br />
Der Rest soll für das Schreibwerk zur Verfügung stehen. Die Ausstattung<br />
<strong>der</strong> Geschäftsstellen soll mit Monitoren <strong>im</strong> 21-Zoll-Format erfolgen.<br />
Für die Datensicherung will die Berliner Generalstaatsanwaltschaft zu-<br />
künftig auf die Server des landeseigenen IT-Dienstleistungszentrums<br />
(ITDZ) zurückgreifen. Diese befinden sich in einem Hochsicherheitsbe-<br />
reich, <strong>der</strong> seinerseits gegen Stromausfall über das Notstromaggregat <strong>der</strong><br />
angrenzenden JVA abgesichert ist. Dabei sollen die Daten auf verschie-<br />
denen Servern gespeichert werden („Clustern“), die sich regelmäßig mit-<br />
einan<strong>der</strong> abgleichen. Alle Server sollen räumlich und auch brandschutz-<br />
technisch von einan<strong>der</strong> getrennt untergebracht sein.<br />
6.2.1.6 Kosten<br />
Bislang wurde für das Projekt MODESTA ein Betrag zwischen zwei und<br />
drei Millionen Euro investiert. Von diesem Betrag sind die gegenwärtig in<br />
den Pilotverfahren eingesetzten Lizenzen bereits erfasst. Für den Fall,<br />
dass MODESTA zukünftig in Berlin in den Vollbetrieb gehen sollte, fallen<br />
für die 1.400 betroffenen Arbeitsplätze etwa EUR 200.000 jährlich an Li-<br />
zenzgebühren an.<br />
Darüber hinaus fallen Anschaffungskosten für die Monitore an. Gegen-<br />
wärtig wird <strong>der</strong> Schulungsaufwand für alle 1.400 betroffenen Mitarbeiter<br />
jeweils mit einer Woche veranschlagt. Diese Schulungen werden gestaf-<br />
felt und anschließend regelmäßig durchgeführt. Von Beginn an soll darauf<br />
84
geachtet werden, dass Multiplikatoren geschult werden, <strong>der</strong>en Arbeits-<br />
plätze zentral liegen und die leicht für viele <strong>im</strong> Alltag zu erwartende Rück-<br />
fragen erreichbar sind.<br />
Das bestehende IT-Referat soll erweitert werden. Insbeson<strong>der</strong>e soll für<br />
akut auftretende Fragen <strong>der</strong> Dezernenten und Geschäftsstellen ein „Help-<br />
Desk“ eingerichtet werden. Die Software- und Datenpflege, insbeson<strong>der</strong>e<br />
das Anpassen von „Maßnahmen“ an aktuelle Bedürfnisse soll dann maß-<br />
geblich <strong>im</strong> eigenen Haus erfolgen. Dadurch soll auch Zeitverlusten vor-<br />
gebeugt werden, die eintreten könnten, wenn zur Neufassung einer Maß-<br />
nahme o<strong>der</strong> eines Formulars Fabasoft GmbH verständigt werden muss<br />
und erst einige Tage später einen Techniker schicken kann. Fabasoft<br />
GmbH selbst betreut das System <strong>im</strong> Ganzen und liefert Updates.<br />
Für die Einrichtung (qualifizierter) elektronischer Signaturen und dem<br />
damit verbundenem Erwerb von Lizenzen und Zertifizierungen sieht die<br />
finanzielle Planung des Projekts MODESTA bislang nicht vor. Da <strong>der</strong><br />
Vollbetrieb von MODESTA erst in einigen Jahren laufen wird und gegen-<br />
wärtig die Strafprozessordnung die elektronische <strong>Akte</strong>nführung nicht vor-<br />
sieht, wartet die Berliner Generalstaatsanwaltschaft diesbezüglich ab.<br />
Haushaltsmittel sollen dafür nicht gebunden werden, wenn nicht sicher<br />
feststeht, ob es zukünftig nicht doch eine gesetzgeberische Neuausrich-<br />
tung bezogen auf die Signatur elektronischer Dokumente geben wird. Bis<br />
dahin werden alle Schreiben (bis auf best<strong>im</strong>mte Schreiben wie Anklage<br />
o<strong>der</strong> Beschwerden) mit dem Hinweis „ohne Unterschrift gültig“ versehen.<br />
Dem gegenüber rechnen die Berliner Behörden mit einer deutlichen Effi-<br />
zienzsteigerung durch verringerte <strong>Akte</strong>ntransportwege und damit verbun-<br />
dene Wartezeiten. Zudem rechnet man die entfallenden erheblichen Kos-<br />
ten für die von <strong>der</strong> früheren Fachanwendung ASTA benötigten Oracle-<br />
Lizenzen sowie das Sparpotential durch den kostengünstigen Einsatz <strong>der</strong><br />
„OpenOffice“-Produkte sowie des kostengünstigen Internetbrowsers<br />
„Firefox“ dagegen.<br />
85
6.2.1.7 Ausblick<br />
Soweit ersichtlich werden bis Ende 2008 die ersten beiden Stufen für die<br />
Einführung von MODESTA umgesetzt sein. Der Einsatz einer Vollversion<br />
mit einer vollautomatischen elektronischen <strong>Akte</strong> wird noch längere Zeit in<br />
Anspruch nehmen. Ungeachtet <strong>der</strong> dafür notwendigen gesetzgeberi-<br />
schen Rahmenbedingungen ist die Berliner Polizei erst in mehr als zwei<br />
Jahren soweit, dass sie die Vorgänge sämtlich elektronisch in POLIKS er-<br />
fassen bzw. einscannen und dort einstellen kann. Bis dahin werden wei-<br />
ter die Vorbereitungen für einen medienbruchfreien Transfer sämtlicher<br />
Daten und nicht lediglich nur <strong>der</strong> Metadaten getroffenen werden.<br />
Mag MODESTA insbeson<strong>der</strong>e in einfach gelagerten Verfahren o<strong>der</strong> auch<br />
in UJs-Verfahren bereits jetzt zu einer effizienten Zeit und Papier sparen-<br />
den Verfahrenserledigung beitragen, werden Verfahren mittleren Um-<br />
fangs und gehobener Komplexität es auch weiterhin erfor<strong>der</strong>lich machen,<br />
dass die <strong>Akte</strong> zwischen den Ermittlungsrichtern be<strong>im</strong> Amtsgericht, <strong>der</strong><br />
Staatsanwaltschaft und den Polizeidienststellen hin- und hergeschickt<br />
wird. Hierzu sind die notwendigen technischen Voraussetzungen mit den<br />
beteiligten Dienststellen, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Gerichtsseite, zu klären,<br />
Schnittstellen zu schaffen o<strong>der</strong> ein einheitliches Bearbeitungssystem zu<br />
vereinbaren. Weiter ist bislang offensichtlich ungeklärt, wie es realisiert<br />
werden kann, dass es eine aktuelle elektronische <strong>Akte</strong> gibt, gleichwohl<br />
aber Polizei und ggf. auch Ermittlungsrichter ihrerseits auf eine aktuelle<br />
<strong>Akte</strong>nlage zugreifen können, ohne dass mehrere Leitakten verschiede-<br />
nen Inhalts entstehen. Die vollautomatische Geschäftszuteilung dürfte<br />
insbeson<strong>der</strong>e bei Komplex- und Spezialverfahren an ihre Grenzen sto-<br />
ßen, so dass hier eine manuelle Prüfung erfor<strong>der</strong>lich bleibt.<br />
Ebenfalls offen ist bislang die Frage, wie Erkenntnisse aus technischen<br />
Überwachungen (z.B. beispielsweise Telefonüberwachungen, Observati-<br />
onen) in das DMS eingestellt werden sollen. Hierzu wurde jüngst eine<br />
Projektgruppe gebildet. Ungeregelt ist bislang auch, ob die sog. Ver-<br />
schlusssachen mit Daten über Vertrauenspersonen und Verdeckten Er-<br />
mittlern tatsächlich zukünftig auch elektronisch unter Beschränkung <strong>der</strong><br />
86
jeweiligen Zugriffsrechte verwaltet werden sollen o<strong>der</strong> ob dazu am Pan-<br />
zerschrank festgehalten wird.<br />
6.2.2 Normfall<br />
Das <strong>im</strong> Jahre 2000 durch Prof. Dr. Dr. Haft gegründete Münchner Unter-<br />
nehmen Normfall GmbH verfolgt – soweit beide Ansätze überhaupt ver-<br />
gleichbar sind – mit seinem Produkt für die elektronische <strong>Akte</strong> einen von<br />
X<strong>Justiz</strong> abweichenden Weg (vgl. Anhang zu IV b).<br />
6.2.2.1 Funktionsweise<br />
Die „Normfall“-Software stellt ein Dokumentenmanagementsystem zur<br />
Verfügung, anhand dessen <strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> abgebildet und in eine be-<br />
liebige Struktur gebracht werden kann. Neben <strong>der</strong> standardmäßig bei<br />
DMS-Software verfügbaren Stichwortsuchfunktion bietet „Normfall-<br />
Software“ auch eine systematische Suchfunktion an.<br />
Vom Hersteller hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang insbeson-<br />
<strong>der</strong>e, dass die herkömmliche Schlagwortsuche <strong>im</strong> Rahmen einer Volltext-<br />
recherche häufig ineffizient sei. Beispielsweise führe die Suche mittels ei-<br />
nes Zeugennamens in einer viele tausend Seiten umfassenden Ermitt-<br />
lungsakte zu einer Vielzahl an Treffern. Demgegenüber biete „Normfall-<br />
Software“ die Möglichkeit, die <strong>Akte</strong> von Beginn an beispielsweise in eine<br />
hierarchische Baumstruktur zu bringen, innerhalb <strong>der</strong>er sodann auf be-<br />
st<strong>im</strong>mte Verästelungen beschränkte Suchfunktionen ausgelöst und durch<br />
ein solches „Entlanghangeln“ die gesuchten Schriftstücke mit den Aussa-<br />
gen des Zeugen aufgefunden werden können. Dabei setzt sich die mit<br />
„Normfall-Sorftware“ geführte <strong>Akte</strong> aus drei Komponenten zusammen<br />
(vgl. auch die Screenshots unter<br />
www.Normfall.de/index.php5?menu=man&submenu=sshots&.).<br />
Die Dokumentensammlung: Hier werden alle elektronischen Dokumente,<br />
die zur <strong>Akte</strong> gehören o<strong>der</strong> ihr später <strong>im</strong> Laufe eines Verfahrens hinzuge-<br />
fügt werden sollen, in einem Projektordner beispielsweise in chronologi-<br />
scher Reihenfolge abgelegt.<br />
87
Der Strukturmanager:. Mit dessen Hilfe werden hierarchische Baumstruk-<br />
turen erstellt. Diese Baumstrukturen sollen sich nicht an chronologischen<br />
Vorgaben richten. Maßgebend soll vielmehr die dem Rechtsfall innewoh-<br />
nende juristische Struktur sein. Als Beispiel aus dem Zivilverfahren wird<br />
die Grundstruktur Sachverhalt, Rechtslage, beteiligte Personen und vor-<br />
handene Urkunden aufgegriffen. Diese Strukturpunkte können dann ih-<br />
rerseits weiter unterglie<strong>der</strong>t werden. So könnte <strong>der</strong> Sachverhalt bei-<br />
spielsweise in Kläger- und Beklagtenvortrag strukturiert werden. Denkbar<br />
sind entsprechende Glie<strong>der</strong>ungen grundsätzlich auch für das Strafverfah-<br />
ren.<br />
Der Dokumentenmanager: Mittels dieser Komponente werden die Doku-<br />
mente aus <strong>der</strong> Dokumentensammlung mit den Glie<strong>der</strong>ungspunkten ver-<br />
knüpft. An jeden einzelnen Glie<strong>der</strong>ungspunkt des Strukturmanagers las-<br />
sen sich beliebig viele Dokumente aus <strong>der</strong> Dokumentensammlung anbin-<br />
den.<br />
Zu Beginn einer Vorgangsbearbeitung ist nach Erfassung <strong>der</strong> Dokumente<br />
eine falladäquate Dokumenten-Struktur („Baumdiagramm“) zu erstellen.<br />
Anschließend werden die in <strong>der</strong> Dokumentensammlung enthaltenen Do-<br />
kumente gesichtet und an die verschiedenen Glie<strong>der</strong>ungsebenen ange-<br />
bunden. Dabei können einzelne Dokumente auch mit verschiedenen<br />
Glie<strong>der</strong>ungsebenen verknüpft und damit vield<strong>im</strong>ensional erschlossen<br />
werden.<br />
Darüber hinaus soll „Normfall-Software“ auch die gemeinsame <strong>Akte</strong>nbe-<br />
arbeitung unterstützen. Dies erfolgt zunächst durch den Versand <strong>der</strong> Pro-<br />
jektdatei per E-Mail. In die ihm zugesandte Projektdatei legt <strong>der</strong> Empfän-<br />
ger seinerseits die von ihm erstellen Dokumente ein und schafft selbst<br />
Verknüpfungen mit den bereits bestehenden o<strong>der</strong> von ihm noch zu erstel-<br />
lenden Strukturebenen. Die so geän<strong>der</strong>te Datei wird sodann an den ur-<br />
sprünglichen Absen<strong>der</strong> zurückgesandt.<br />
Weiter wird von „Normfall-Software“ die gemeinsame <strong>Akte</strong>nführung über<br />
eine sog. web-<strong>Akte</strong> unterstützt. Dabei könnten die Projektordner auf ei-<br />
88
nem Gerichtsserver stehen, um auf diese online zugreifen und die Projek-<br />
te so bearbeitet werden können. Bei Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> wird automa-<br />
tisch eine E-Mail an die übrigen Verfahrensbeteiligten generiert.<br />
6.2.2.2 Ausblick<br />
Die Normfall-Software wird bereits forensisch eingesetzt. Soweit ersicht-<br />
lich geschah dies in mindestens einem wirtschaftsstrafrechtlichen Groß-<br />
verfahren. Dabei kam die Software <strong>im</strong> Rahmen des Hauptverfahrens bei<br />
sämtlichen Verfahrensbeteiligten zum Einsatz. Vor dem Hintergrund die-<br />
ser bislang sehr begrenzten forensischen Erprobung sind daher noch<br />
keine substanziellen empirischen Befunde erhoben worden. Hier dürfte<br />
insbeson<strong>der</strong>e zentrale Bedeutung erlangen, ob „Normallfall-Software“ tat-<br />
sächlich geeignet ist, umfassend <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> eingesetzt zu werden.<br />
Auch in Fällen <strong>der</strong> Alltags- und Bagatellkr<strong>im</strong>inalität müssten dann Struk-<br />
turebenen schon seitens <strong>der</strong> hier fe<strong>der</strong>führenden Polizei geschaffen wer-<br />
den. Ob diese über die zeitlichen Ressourcen und die dafür ggf. erfor<strong>der</strong>-<br />
liche Sachkunde verfügt, ist zumindest fraglich.<br />
Auch fehlt es bislang an praktischen Erkenntnissen darüber, ob <strong>im</strong> Straf-<br />
verfahren die mit „Normfall-Software“ vorgeschlagene gemeinsame Ak-<br />
tenführung durch sämtliche Verfahrensbeteiligte, insbeson<strong>der</strong>e auch <strong>der</strong><br />
Verteidigung, tatsächlich praktikabel ist.<br />
6.3 <strong>Elektronische</strong> Hilfsakte<br />
Ungeachtet <strong>der</strong> Frage, ob und in welchem Umfang eine vollelektronische<br />
<strong>Akte</strong>nführung <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> sinnvoll und wünschenswert ist, haben<br />
Staatsanwaltschaften verschiedener Bundeslän<strong>der</strong> bereits durchweg po-<br />
sitive Erfahrungen mit einer elektronischen Hilfsakte gemacht. Diese wird<br />
neben <strong>der</strong> rechtlich wie tatsächlich maßgebenden Papierakte erstellt und<br />
gepflegt. Hier sollen einige Erfahrungen und Ansätze skizziert werden:<br />
6.3.1 Brandenburg<br />
In einem 2005 vor dem Landgericht Neuruppin wegen Bandenkr<strong>im</strong>inalität<br />
geführten Großverfahren sah sich die Staatsanwaltschaft 16 Verteidigern<br />
gegenüber, die den kompletten Ermittlungsvorgang (ca. 11.000 Seiten<br />
89
Sachakten und zahlreiche Stehordner mit Protokollen <strong>der</strong> Telefonüber-<br />
wachung sowie weitere umfangreiche Beiakten) als eingescannte Dateien<br />
auf ihren Laptops in <strong>der</strong> Hauptverhandlung täglich zur Verfügung hatten.<br />
Dabei konnten die Verteidiger jeweils über Suchfunktionen sämtliche Ak-<br />
teninhalte nach Stichworten auf den Bildschirm rufen. Der angesichts<br />
dessen von den staatsanwaltschaftlichen Sitzungsvertretern beklagten<br />
„Waffenungleichheit“ begegnete die Staatsanwaltschaft durch die An-<br />
schaffung einer eigenen elektronischen Dokumentenverwaltung sowie ei-<br />
nes Scanners und betrachtete dieses Großverfahren als Pilotprojekt. Wei-<br />
tere Verfahren folgten, in denen elektronische <strong>Akte</strong>n als Hilfsmittel die Ar-<br />
beit <strong>der</strong> Staatsanwälte unterstützen sollten und bereits bei Beginn <strong>der</strong><br />
Ermittlungen eingerichtet, sodann gepflegt und damit tagesaktuell gehal-<br />
ten werden konnten.<br />
6.3.1.1 Ablauf<br />
Zunächst wird dabei <strong>der</strong> gesamte vorhandene <strong>Akte</strong>ninhalt ebenso wie al-<br />
le später eingehenden Schreiben, Vermerke o<strong>der</strong> Ermittlungsergebnisse<br />
mittels eines Hochleistungsscanners erfasst und elektronische Dokumen-<br />
te <strong>im</strong> PDF - Dateiformat erstellt. Bevor diese in das eingesetzte Doku-<br />
mentenmangementsystem eingestellt werden, „läuft“ über die erfassten<br />
Texte ein standardmäßiges Texterkennungssystem (OCR-Programm<br />
„Optical-Character-Recognition“). Dadurch wird später die praktisch be-<br />
son<strong>der</strong>s bedeutsame Suchfunktion ermöglicht. Sodann werden die elekt-<br />
ronischen Dokumente in das Dokumentenmanagementsystem eingestellt.<br />
Als DMS findet die Software ELO („<strong>Elektronische</strong>r Leitzordner“, <strong>der</strong> ELO<br />
Digital Office GmbH Stuttgart) in <strong>der</strong> Version 6.0 Anwendung.<br />
Ob für das Erfassen <strong>der</strong> Papierdokumente die Staatsanwaltschaft o<strong>der</strong><br />
die Polizei zuständig sein sollte, war anfänglich zwischen den Behörden<br />
unklar. Später gingen diese Arbeiten vermehrt auf die Polizei über und<br />
soll in Zukunft aus Sicht <strong>der</strong> Generalstaatsanwaltschaft auch bei <strong>der</strong> Poli-<br />
zei verortet bleiben.<br />
Die Texterfassung und Dokumentenstruktur <strong>im</strong> DMS wird spiegelbildlich<br />
an <strong>der</strong> weiterhin maßgebenden Papierlage ausgerichtet (Stichwort:<br />
90
„Baumstruktur“). Je<strong>der</strong> Ordner <strong>der</strong> Leit-, Bei- o<strong>der</strong> Beweismittelakte wird<br />
in einem eigenen Verzeichnis abgelegt. Dadurch erhofft man sich eine<br />
zügige Orientierung sowohl in <strong>der</strong> Papier- wie in <strong>der</strong> deckungsgleichen<br />
elektronischen <strong>Akte</strong>.<br />
Die Papierakte verbleibt <strong>im</strong> laufenden Ermittlungsverfahren bei <strong>der</strong> ermit-<br />
telnden Polizeidienststelle. Dort wird sie weiter gepflegt und aktualisiert.<br />
Sobald neue <strong>Akte</strong>nbestandteile hinzukommen, werden diese von <strong>der</strong> Po-<br />
lizei eingescannt und dem zuständigen Dezernenten <strong>der</strong> Staatsanwalt-<br />
schaft verschlüsselt (GNUPG http://www.gnupg.org/(de)/index.html) per<br />
E-Mail zugesandt (aus Sicherheitsgründen soll dies zukünftig über einen<br />
geson<strong>der</strong>ten Server (per File Transfer Protocol – FTP) erfolgen, weil <strong>der</strong><br />
E-mail-Korrespondenz keine definierte Ende-zu-Ende-Verbindung aufge-<br />
baut wird), <strong>der</strong> sie seinerseits in das DMS einpflegt, sodass beide Ermitt-<br />
lungsstellen <strong>im</strong> Idealfall jeweils über den aktuellen <strong>Akte</strong>n- und Ermitt-<br />
lungsstand verfügen. Zusätzlich werden diese Dateien ausgedruckt und<br />
in eine bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft geführte Zweitakte eingepflegt, die ins-<br />
beson<strong>der</strong>e für Anträge be<strong>im</strong> Ermittlungsrichter vorgesehen ist. Gegen-<br />
wärtig ist nur die einseitige Übersendung von Unterlagen durch die Poli-<br />
zei an die Staatsanwaltschaft und nicht umgekehrt möglich, denn bislang<br />
war die Polizei nicht bereit, sich ebenfalls „ELO“ o<strong>der</strong> ein damit kompatib-<br />
les DMS anzuschaffen.<br />
Im Jahre 2007 wurden die Fachanwendung MESTA und das eingesetzte<br />
Schreibwerksprogramm SAS um die Komponenten einer OCR-<br />
Texterkennung, einer Such- und Recherchefunktion sowie einen sog.<br />
Viewer erweitert. Über MESTA können zudem Abfragen aus dem BZR<br />
o<strong>der</strong> VZR vorgenommen und die elektronisch eingehenden Antworten in<br />
das DMS eingepflegt werden, sodass nunmehr ein in MESTA integriertes<br />
DMS in den Pilotverfahren zur Verfügung steht.<br />
Die jeweils zuständigen Gerichte haben <strong>im</strong> Hauptverfahren bislang kei-<br />
nen Gebrauch von den elektronisch zur Verfügung stehenden Daten ge-<br />
macht. Von einem grundsätzlich denkbaren Einsatz eines Beamers wur-<br />
de daher in den bislang gelaufenen Pilotverfahren kein Gebrauch ge-<br />
91
macht. Die Sitzungsvertreter <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft hingegen sind in <strong>der</strong><br />
Hauptverhandlung mit einem Laptop ausgestattet und haben die Daten<br />
auf <strong>der</strong> Festplatte abgelegt.<br />
Soweit Verteidiger sich legit<strong>im</strong>ieren und <strong>Akte</strong>neinsicht gewährt werden<br />
soll, wird den Verteidigern bislang zunächst statt <strong>der</strong> Einsicht in die Pa-<br />
pierakte eine CD-Rom mit den erfassten elektronischen Dokumenten an-<br />
geboten. Soweit die Verteidiger dies ablehnen und auf einer Einsicht in<br />
die Papierlage bestehen, wird ihnen diese gewährt.<br />
6.3.1.2 Erfahrungswerte<br />
Die Erfahrungen <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft Neuruppin mit diesem Vorgehen<br />
in den bislang durchgeführten drei Großverfahren sind nachhaltig positiv.<br />
Hervorgehoben wird dabei zunächst die ganz erhebliche Zeitersparnis.<br />
Da die Ermittlungsakten sowohl bei <strong>der</strong> Polizei wie auch bei <strong>der</strong> Staats-<br />
anwaltschaft nahezu auf dem aktuellem Stand gehalten werden, ist beid-<br />
seitig <strong>im</strong>mer ein Zugriff möglich. Zudem haben Anträge be<strong>im</strong> Ermittlungs-<br />
richter nicht zur Folge, dass längere Wartezeiten eintreten, um die <strong>Akte</strong><br />
dafür zu aktualisieren o<strong>der</strong> sogar auf die Leitakte verzichtet werden muss,<br />
solange diese vom Ermittlungsrichter benötigt wird. Stattdessen kann sie<br />
direkt vom Staatsanwalt in Form <strong>der</strong> aktuellen Zweitschrift übergeben<br />
werden, während die Polizei weiter über die Erstschrift verfügt. Zudem<br />
ermöglicht die Suchfunktion eine schnelle und effiziente Orientierung in<br />
<strong>der</strong> <strong>Akte</strong>. Das gilt nicht nur während des Ermittlungsverfahrens, son<strong>der</strong>n<br />
auch bei <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> Anklage und in beson<strong>der</strong>em Maße in <strong>der</strong><br />
Hauptverhandlung <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Erörterung überraschen<strong>der</strong> Anträge<br />
o<strong>der</strong> Aussagen.<br />
Schon diese verbesserte Sachbehandlung führt nach Angaben <strong>der</strong> Gene-<br />
ralstaatsanwaltschaft zu erheblichen Einsparungen bei Kopie- und Druck-<br />
kosten sowie anwaltlichen Gebühren. Denn in allen bislang durchgeführ-<br />
ten Pilotverfahren hätten sich die Verteidiger größtenteils mit <strong>der</strong> Aus-<br />
händigung einer mit dem <strong>Akte</strong>ninhalt bespielten DVD zufrieden gezeigt.<br />
Soweit Verteidiger auf eine Einsicht in die Papierakte und die Aushändi-<br />
92
gung o<strong>der</strong> Erstellung einer Kopieakte bestehen würden, werde diese für<br />
sie gefertigt. In den drei bislang durchgeführten Großverfahren sei dies<br />
aber die Ausnahme geblieben, welche die Einspareffekte nicht in Frage<br />
stellen konnten.<br />
Diesen Einsparungen stünden nur geringe Aufwendungen für die erfor-<br />
<strong>der</strong>liche Hard- und Software gegenüber. Neben den marktüblichen Prei-<br />
sen für den <strong>im</strong> Einsatz befindlichen Laptop werden durch die Staatsan-<br />
waltschaft Neuruppin etwa EUR 200,-- bis 300,-- pro Lizenz für „ELO“<br />
veranschlagt.<br />
Schließlich wird durch die Generalstaatsanwaltschaft hervorgehoben,<br />
dass alle mit diesen Pilotverfahren befassten Dezernenten sehr zufrieden<br />
mit ihrem Hilfsmittel waren und sich in <strong>der</strong> Ausstattung nunmehr auf „Au-<br />
genhöhe“ mit den Verteidigern wähnten und „Waffengleichheit“ wie<strong>der</strong><br />
gewahrt sahen. Betont wird schließlich noch, dass die <strong>Akte</strong> auch bei<br />
auswärtigen Terminen, beispielsweise Durchsuchungen und Vernehmun-<br />
gen, stets mittels Laptop präsent ist. Bemerkt wird in den Stellungnahmen<br />
<strong>der</strong> Generalstaatsanwaltschaft allerdings auch, dass dieses Vorgehen<br />
nicht bei jedem Verfahren erfor<strong>der</strong>lich und sinnvoll ist. Bislang betrafen<br />
die drei Pilotverfahren ausschließlich Großverfahren aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
organisierten Kr<strong>im</strong>inalität o<strong>der</strong> Korruption.<br />
6.3.1.3 Perspektiven<br />
Die Staatsanwaltschaft Neuruppin wählt gegenwärtig Großverfahren aus,<br />
die für die Anwendung des ELO und das damit zusammenhängende<br />
Vorgehen in Betracht kommen. Dieser Weg soll fortgeschritten und Erfah-<br />
rungen gesammelt werden. Nach und nach soll <strong>der</strong> ansteigende Bedarf<br />
an Hardware, z.B. Laptops, und Lizenzen gedeckt werden. Mit <strong>der</strong> Polizei<br />
bzw. dem Innenministerium laufen die Gespräche über den Einsatz von<br />
„ELO“ weiter. Zudem wird versucht, an<strong>der</strong>e Bundeslän<strong>der</strong> für dieses Vor-<br />
gehen zu gewinnen und durch Entwicklungsgemeinschaften die Kosten<br />
insbeson<strong>der</strong>e für die Software und <strong>der</strong>en Lizenzen zu senken.<br />
93
6.3.2 Bremen<br />
Auch die Staatsanwaltschaft Bremen wurde durch Sachzwänge zu einem<br />
Vorgehen mittels elektronisch unterstützter <strong>Akte</strong>nführung gebracht.<br />
In einem Korruptions-Großverfahren mit zwölf Beschuldigten und einem<br />
parallel laufenden Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mussten<br />
zügig zahlreiche Kopien <strong>der</strong> aus insgesamt über 60 Leitzordnern beste-<br />
henden Leitakten erstellt werden. Die dafür erfor<strong>der</strong>lichen personellen wie<br />
technischen Voraussetzungen waren nicht vorhanden. Zufällig wurde be-<br />
kannt, dass eine Werkstatt für behin<strong>der</strong>te Menschen in Bremen (Martins-<br />
hof, eine Einrichtung <strong>der</strong> Stadt Bremen, Bischoffstraße 2 – 8, 28203 Bre-<br />
men) Kopierdienstleistungen anbot. Diese nahm die Staatsanwaltschaft in<br />
Anspruch und ließ dort sämtliche <strong>Akte</strong>nkopien erstellen. Später beauf-<br />
tragte <strong>der</strong> zuständige Dezernent die Einrichtung auch mit <strong>der</strong> Erstellung<br />
einer elektronischen Fassung. Dazu stellte er eine Zweitschrift zur Verfü-<br />
gung die eingescannt und <strong>im</strong> PDF-Format erstellt wurde. Dieser Weg<br />
wurde auch in weiteren Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Bremen<br />
beschritten.<br />
6.3.2.1 Werkstatt Bremen<br />
Die Einrichtung richtete <strong>im</strong> Zuge <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Staatsan-<br />
waltschaft Bremen ihre technischen Voraussetzungen <strong>im</strong>mer weiter nach<br />
den dortigen Bedürfnissen aus.<br />
Dies gilt zunächst für die bereits zu Beginn <strong>der</strong> Zusammenarbeit geregel-<br />
ten Fragen des Datenschutzes. Die für die Scann- und Kopierarbeiten<br />
genutzten Räume sind mittels Code gegen den Zutritt Unberechtigter ge-<br />
sichert. Zudem sind sie gegen Einsichtnahme von außen abgeschirmt.<br />
Sämtliche mit den Arbeiten betraute Mitarbeiter <strong>der</strong> Einrichtung wurden<br />
<strong>im</strong> Wege einer Verpflichtungserklärung zur Verschwiegenheit verpflichtet.<br />
Die <strong>Akte</strong>n werden von diesen Mitarbeitern bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft ab-<br />
geholt und später nach Erfassung zurücktransportiert. Eingesetzt für die<br />
Texterfassungsarbeiten werden keine körperlich behin<strong>der</strong>ten, son<strong>der</strong>n<br />
beispielsweise depressiv erkrankte Mitarbeiter.<br />
94
Die <strong>Akte</strong>n werden mittels eines Hochleistungsscanners (Böwe, Bell und<br />
Howl, Spectrum XF, Anschaffungspreis EUR 25.000,--) erfasst. Der<br />
Scanner ist in <strong>der</strong> Lage, farbig sowie vor- und rückseitig bis zu 100.000<br />
Seiten am Tag zu erfassen.<br />
Darüber hinaus waren die Bedingungen <strong>der</strong> Werkstatt für die Staatsan-<br />
waltschaft Bremen attraktiv. Für das Einscannen o<strong>der</strong> Kopieren einer Ak-<br />
te (inklusive Lochen und Einlegen in einen Ordner) werden 0,03 EUR be-<br />
rechnet. Für die Erstellung einer Datei <strong>im</strong> PDF-Format fallen zusätzlich<br />
EUR 0,10/Datei an. Die hinzukommende Mehrwertsteuer beläuft sich auf<br />
7%. Darüber hinaus können 50% des auf die Arbeitsleistung <strong>der</strong> Werk-<br />
statt entfallenden Rechnungsbetrages nach § 140 SGB IX auf eine even-<br />
tuell anfallende Ausgleichsabgabe angerechnet werden.<br />
6.3.2.2 Erfahrungswerte<br />
Die Erfahrungen <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft Bremen mit dieser Art <strong>der</strong> elekt-<br />
ronischen Erfassung von <strong>Akte</strong>n sind durchweg positiv. Dies gilt zunächst<br />
für die Zuverlässigkeit <strong>der</strong> Einrichtung in zeitlicher wie qualitativer Hin-<br />
sicht. Auch kleine Rechnungsbelege wurden auseinan<strong>der</strong> geheftet und<br />
sorgsam eingescannt. Bei den beteiligten Rechtsanwälten ist die <strong>Akte</strong>n-<br />
einsicht in Form einer CD-Rom auf gute Resonanz gestoßen. Auch die<br />
jeweiligen Kammermitglie<strong>der</strong> haben mit diesen Daten gearbeitet.<br />
Gegenwärtig sind die von <strong>der</strong> Werkstatt Bremen elektronisch erfassten<br />
Dokumente allerdings noch nicht suchfähig. In einem Großverfahren<br />
konnten indes durch ein IT-Mitarbeiter des Landgerichts die Datei durch<br />
Einsatz eines Texterkennungsprogramms die Daten suchfähig gemacht<br />
werden.<br />
6.3.2.3 Perspektiven<br />
Zurzeit bestehen keine Planungen, die Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Werkstatt<br />
Bremen zu systematisieren und zu intensivieren. Weiterhin soll gelegent-<br />
lich auf die Dienste <strong>der</strong> Werkstatt Bremen zurückgegriffen werden. Ent-<br />
scheidungsbefugt dafür ist <strong>der</strong> einzelne Dezernent nach Rücksprache mit<br />
seinem Abteilungsleiter.<br />
95
6.3.3 Bayern<br />
Einen einheitlichen Einsatz elektronischer <strong>Akte</strong>nführung gibt es auch in<br />
<strong>der</strong> bayerischen <strong>Justiz</strong> gegenwärtig nicht. Indes gibt es erste Schritte, den<br />
Staatsanwaltschaften den Zugriff auf die polizeiliche Ermittlungsdaten-<br />
bank „EASy II“ (Ermittlungs- und analysegestütztes EDV-System, rola<br />
Security Solutions GmbH, Oberhausen) zu gewähren. Insbeson<strong>der</strong>e war<br />
die Staatsanwaltschaft München I hier eingebunden.<br />
Bei „EASy II“ handelt es sich nicht um ein Dokumentenmanagementsys-<br />
tem, son<strong>der</strong>n um eine „Ermittlungsdatenbank“. In diese werden unter-<br />
stützt durch die eingebundene Software Word, Excel, etc, Personenda-<br />
ten, Kontakt- Telekommunikationsverbindungsdaten sowie Papierlagen<br />
über Geldflüsse sowie Immobilien und Kraftfahrzeuge eingepflegt. Zu-<br />
nächst werden diese Daten dort verwaltet. Darüber hinaus stehen sie a-<br />
ber auch in an<strong>der</strong>en Verfahren <strong>im</strong> Wege eines verfahrensübergreifenden<br />
EDV-Managements für Suchläufe zur Verfügung. Daten werden mittels<br />
dieser Software-Datenbank-Technik verknüpft, um <strong>im</strong> Wege <strong>der</strong> Daten-<br />
satzanalyse Strukturen, Zusammenhänge und Hierarchien aufzudecken.<br />
Das Verfahren wird ausschließlich in sog. Großverfahren gegen die Ban-<br />
denkr<strong>im</strong>inalität eingesetzt. Der Staatsanwaltschaft steht gegenwärtig nur<br />
ein lesen<strong>der</strong> Zugriff zur Verfügung. Sie selbst kann keine Dokumente in<br />
„EASy II“ einstellen. Aber auch dieser beschränkte Zugriff hat sich als<br />
zeitsparend erwiesen, weil aktuelle Informationen, beispielsweise über<br />
TÜ-Verbindungen und <strong>der</strong>en Inhalte, bei Polizei und Staatsanwaltschaft<br />
zu gleicher Zeit verfügbar waren. Zudem sind die Daten auch bei Durch-<br />
suchungen o<strong>der</strong> auswärtigen Vernehmungen ständig präsent. Die Daten<br />
liegen dabei auf einem sog. Citrix-Terminal-Server und stehen auch <strong>der</strong><br />
Staatsanwaltschaft über eine verschlüsselte Verbindung (VPN) und ei-<br />
nem Zugriff durch die Firewall zur Verfügung.<br />
Weitgehend ungeklärt sind <strong>der</strong>zeit beispielsweise noch datenschutzrecht-<br />
liche Fragen. Insbeson<strong>der</strong>e ist gegenwärtig offen, wie verhin<strong>der</strong>t werden<br />
kann und soll, dass den Staatsanwaltschaften <strong>der</strong> Zugriff auch auf prä-<br />
ventiv gespeicherte Daten möglich wird.<br />
96
6.3.4 Hamburg<br />
Die <strong>Justiz</strong> in <strong>der</strong> Hansestadt hat bislang keine eigenen Erfahrungen mit<br />
<strong>der</strong> Erstellung einer elektronischen Hilfsakte neben <strong>der</strong> Papierakte ge-<br />
macht. In einem Großverfahren wegen Betrugs, dessen Leitakte mittler-<br />
weile 13.000 Seiten umfasst, haben die Verteidiger die Leitakte suchfähig<br />
eingescannt und sodann <strong>der</strong> Kammer und <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft zur<br />
Verfügung gestellt. Die Beweismittelordner wurden darauf hin durch die<br />
Staatsanwaltschaft eingescannt und ihrerseits den übrigen Beteiligten zur<br />
Verfügung gestellt. Durch die Kammer wird insbeson<strong>der</strong>e die effektive<br />
Recherchemöglichkeit anhand <strong>der</strong> Datei hervorgehoben. Auch bei diesen<br />
Daten handelt es sich um Dateien <strong>im</strong> PDF-Format, die auf Grund eines<br />
zuvor angewandten OCR-Programms suchfähig sind.<br />
In einem weiteren Verfahren gegen die Organisierte Kr<strong>im</strong>inalität wird ge-<br />
genwärtig die Erstellung einer elektronischen Hilfsakte mit <strong>der</strong> Polizei<br />
Hamburg abgest<strong>im</strong>mt. Hier hat sich die Polizei bereit erklärt, die Papier-<br />
akte einzuscannen, wobei mangels vorhandener Software lediglich TIFF-<br />
bzw. PDF-Dateien erstellt werden, die nicht suchfähig sein werden.<br />
6.3.5 Hessen<br />
In Hessen scheint sich aus dem innovativen Vorgehen einer Großen<br />
Strafkammer des Landgerichts Darmstadt ein Projekt für das gesamte<br />
Bundesland zu entwickeln.<br />
Eine Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Darmstadt begann <strong>im</strong><br />
vergangenen Jahr die Papierakten eines Großverfahrens (20.000 Seiten<br />
Leitakte zzgl. diverser Beweismittelordner und Fallakten) einzuscannen.<br />
Dabei wurden Kopiergeräte eingesetzt, die auch über eine Scannfunktion<br />
verfügten. Der Scannvorgang selbst wurde durch die Wachtmeisterei des<br />
Gerichts vorgenommen.<br />
Sämtliche Dokumente wurden eingescannt und in das PDF-Format ver-<br />
wandelt. Durch den ebenfalls erfolgten Einsatz einer Texterkennungs-<br />
software wurde eine spätere Schlagwortsuche in den elektronisch erfass-<br />
ten Dokumenten eröffnet.<br />
97
Eingesetzt wird dazu die Software Adobe Acrobat Professional. Sie er-<br />
möglicht nicht nur einen Stichwortsuchlauf, <strong>der</strong> nach Angaben <strong>der</strong> Straf-<br />
kammer nahezu problemlos und effektiv läuft. Daneben eröffnet diese<br />
Software aber auch die Möglichkeit, Lesezeichen, Anmerkungen und<br />
Kommentare in den elektronischen Dokumenten anzubringen. Insbeson-<br />
<strong>der</strong>e können die Strafkammermitglie<strong>der</strong> in <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> mit unterschiedlichen<br />
Farben unterstreichen und Anmerkungen anbringen. Als ganz beson<strong>der</strong>s<br />
wichtig für eine strukturierte Vorbereitung <strong>der</strong> Hauptverhandlung wurde<br />
seitens <strong>der</strong> Kammermitglie<strong>der</strong> die Möglichkeit eingeschätzt, einzelne in<br />
Adobe Acrobat Professional abgelegte Dokumente (z. B. Bl. 3768 und<br />
18.987 d. A.) miteinan<strong>der</strong> zu verlinken und einem Stichwort (z.B. „Zeuge<br />
Meier“) zuzuordnen. Damit ist sowohl eine Verlinkung untereinan<strong>der</strong> als<br />
auch über das Stichwort möglich und für die Arbeitsversion eine Baum-<br />
struktur herstellbar, die vollkommen unabhängig von <strong>der</strong> zumeist chrono-<br />
logischen Blattsammlung <strong>der</strong> Polizei ist.<br />
Beson<strong>der</strong>s positiv wurde von den Praktikern bewertet, dass sie sämtliche<br />
<strong>Akte</strong>nbestandteile dieser Großverfahren auf ihren – ebenfalls vom Land-<br />
gericht zur Verfügung gestellten – Laptops auch zu Hause je<strong>der</strong>zeit ver-<br />
fügbar haben. Diese Arbeitsweise ist bei Wirtschaftsstrafverfahren, die<br />
neben umfangsreichen Hauptakten zumeist eine größere Anzahl Um-<br />
zugskartons mit Beweismitteln und Beweismittelordnern umfassen, un-<br />
denkbar.<br />
Mit dieser technischen Ausstattung geht am Landgericht Darmstadt eine<br />
mo<strong>der</strong>ne technische Ausstattung <strong>der</strong> Sitzungssäle („Mediensäle“) einher.<br />
In den vorhandenen Sälen sind jeweils zwei Beamer angebracht. Auf die-<br />
sen können Filme und Urkunden in Augenschein genommen werden.<br />
Nachdrücklich positiv bewerten die Praktiker auch den Effekt von Vorhal-<br />
ten über den Beamer. Hier seien beson<strong>der</strong>s gute Ergebnisse erzielt wor-<br />
den, da die Urkunden, beispielsweise Schecks, Vermerke, Verträge, auch<br />
vergrößert vorgehalten werden können. Sämtliche Berufsrichter nehmen<br />
ihre Laptops mit in die Hauptverhandlung und haben so durchgehend<br />
98
Zugriff auf die <strong>Akte</strong>nlage und können diese je<strong>der</strong>zeit auf die Leinwände<br />
projizieren.<br />
Angesichts <strong>der</strong> vollständigen Akzeptanz dieser elektronischen Dateien<br />
auch auf Seiten <strong>der</strong> Verteidigung wurde in jenem Verfahren, dass Anlass<br />
für dieses Vorgehen war, wie in sämtlichen weiteren an<strong>der</strong>en Verfahren<br />
vollständig auf das Erstellen papiergestützter Kopieakten verzichtet. Bis-<br />
lang sei es noch nicht vorgekommen, dass die Verteidiger auf die Erstel-<br />
lung einer papiergestützten <strong>Akte</strong>n bestanden haben. Die weiteren Verfah-<br />
rensbeteiligten erhalten freilich eine unkommentierte und unstrukturierte,<br />
lediglich chronologisch angeordnete Version <strong>der</strong> eingescannten <strong>Akte</strong>.<br />
Abschließend sei hier hervorgehoben, dass die Richter <strong>der</strong> Großen Straf-<br />
kammer auch einen erheblichen atmosphärischen Vorteil in dieser Vor-<br />
gehensweise erkennen. Die leichte und flexible Verfügbarkeit des eigent-<br />
lich „sperrigen“ und komplexen <strong>Akte</strong>nstoffs und die technischen Möglich-<br />
keiten mit Laptop und Beamer in <strong>der</strong> Hauptverhandlung vermittelten den<br />
Beteiligten den Eindruck eines hoch professionellen Vorgehens, <strong>der</strong> dazu<br />
führe, dass das Gericht wie<strong>der</strong> „ernst genommen werde“.<br />
6.3.6 Baden-Württemberg<br />
Auch in Baden-Württemberg hat insbeson<strong>der</strong>e die Schwerpunktstaats-<br />
anwaltschaft Wirtschaftskr<strong>im</strong>inalität in Stuttgart Erfahrungen mit elektro-<br />
nisch erfassten <strong>Akte</strong>n gemacht. Auch diese gehen letztlich zurück auf das<br />
Engagement einzelner Dezernenten. An dieser Stelle wird auf die Ausfüh-<br />
rungen unter V („Modellhafte Darstellung eines <strong>Strafverfahren</strong>s bei voller<br />
Nutzung einer elektronischen <strong>Akte</strong>“) hingewiesen, die sich insbeson<strong>der</strong>e<br />
zu <strong>der</strong> praktischen Anwendung in Baden-Württemberg verhalten.<br />
3.3.7 Zwischenergebnis<br />
Die dargestellten empirischen Befunde belegen die hervorragenden Mög-<br />
lichkeiten einer IT unterstützten Verfahrensführung bei sog. Komplexver-<br />
fahren. Deutlich wird auch, dass es eine Vielzahl an Insellösungen gibt,<br />
die projektiert und erprobt werden. In zahlreichen Fällen gehen diese auf<br />
das Engagement und die Kreativität einzelner Praktiker zurück, die sich<br />
99
angesichts des zunehmenden Verfahrensumfangs und <strong>der</strong> Komplexität<br />
insbeson<strong>der</strong>e von Wirtschaftsstrafsachen und Verfahren gegen die Orga-<br />
nisierte Kr<strong>im</strong>inalität bei gleichzeitig <strong>im</strong>mer knapper werdenden justiziellen<br />
Ressourcen zum Handeln gedrängt sahen.<br />
Die bisher gemachten nachhaltig positiven Erfahrungen sollten Anlass<br />
sein, den Einsatz <strong>der</strong> sog. elektronischen Hilfsakte zukünftig weiter aus-<br />
zubauen. Dafür streitet insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> angesprochene Aspekt <strong>der</strong><br />
Waffengleichheit zwischen Gerichten und Staatsanwaltschaften einerseits<br />
und eine technisch wie finanziell hervorragend ausgestattete Verteidi-<br />
gung in Wirtschaftsstrafverfahren an<strong>der</strong>erseits. Auch die erwähnte atmo-<br />
sphärische Wirkung eines professionell IT-unterstützten Auftritts von Ge-<br />
richt und Staatsanwaltschaft sollte nicht unterbewertet werden. Eine in<br />
diesem Sinne verstandene effiziente Einbindung elektronischer Unter-<br />
stützung kann darüber hinaus schon <strong>im</strong> Ermittlungsverfahren die Verfah-<br />
rensübersicht über tausende Seiten aus Leit- und Beweismittelakten<br />
schaffen und dadurch insbeson<strong>der</strong>e zügig den Einsatz <strong>der</strong> prozessualen<br />
Rückgewinnungs- und Gewinnabschöpfungsmöglichkeiten ermöglichen.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e aber die Betrachtung <strong>der</strong> elektronischen Hilfsakte unter<br />
Kostengesichtspunkten macht ihre Notwendigkeit deutlich. Denn gegen-<br />
wärtig werden durch die Staatsanwaltschaften in Großverfahren gelegent-<br />
lich Kopieakten für die Verteidiger erstellt. Oftmals vervielfältigen die Ver-<br />
teidiger die <strong>Akte</strong> für sich <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>neinsicht aber selbst. Dabei<br />
sind in Wirtschaftsstrafsachen mittleren Umfangs regelmäßig etwa 2000<br />
Seiten Leit- bzw. Hauptakte zu kopieren. Darüber hinaus liegen regelmä-<br />
ßig mehrere tausend Seiten Urkunden in sog. Beweismittelordnern vor.<br />
Größere Verfahren umfassen daher ohne weiteres bis zu zehntausend<br />
und mehr Blatt Papier. Erstellt <strong>der</strong> Verteidiger sich seine Kopieakte<br />
selbst, so steht ihm dafür nach dem Gesetz über die Vergütung <strong>der</strong><br />
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz<br />
– RVG) ein Auslagenerstattungsanspruch zu. Dieser beträgt für die Her-<br />
stellung von Ablichtungen aus Behörden- und Gerichtsakten<br />
100
für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50 EUR<br />
und<br />
für jede weitere Seite 0,15 EUR.<br />
Ein Verfahren mit 3000 zu kopierenden Papierseiten begründete daher<br />
einen Kostenerstattungsanspruch des Verteidigers einzig für seine Ko-<br />
pierarbeiten in Höhe von 462,50 EUR zzgl. 19% USt. In Großverfahren<br />
mit nicht selten vier bis sechs und mehr Verteidigern multipliziert sich die-<br />
ser Aufwand entsprechend.<br />
An dieser Stelle kann nicht durchkalkuliert werden, welcher Betrag für ei-<br />
ne kopierte Seite einzustellen wäre, wenn die <strong>Justiz</strong> die <strong>Akte</strong>n mit eige-<br />
nen Geräten und eigenem Personal vervielfältigte. Ohne weiteres kann<br />
dem aber als Vergleichswert das Angebot <strong>der</strong> Werkstatt Bremen gegen-<br />
übergestellt werden. Diese berechnet pro kopierte Seite inklusive Lochen<br />
und Einheften in Ordner 0,03 EUR und damit bei 3000 Seiten einen Be-<br />
trag 90,-- EUR zzgl. 7% MWSt. Durch dieses Vorgehen ließen sich daher<br />
bis zu 80% des an Rechtsanwälte zu zahlenden Aufwandsersatzes ein-<br />
sparen. Dass die Staatsanwaltschaften und Gerichte diesen ernorm<br />
günstigen Wert mit eigenen Mitteln, eigenen Kopiergeräten und Mitarbei-<br />
tern, unterbieten können, steht kaum zu erwarten. Nahe liegt aber, dass<br />
die damit verbundenen Kosten sicher nicht die Höhe <strong>der</strong> rechtsanwalt-<br />
schaftlichen Kostenerstattung erreichen dürften.<br />
Dazu kommt die Möglichkeit, die <strong>Akte</strong>n nicht schlicht zu kopieren, son-<br />
<strong>der</strong>n sie <strong>im</strong> selben Arbeitsgang auch durch Einscannen elektronisch zu<br />
erfassen. Für das Erstellen einer PDF-Datei von den eingescannten Ak-<br />
ten werden durch die Werkstatt Bremen nochmals 0,10 EUR pro Datei<br />
berechnet. Daher ist es denkbar, neben einer einzigen papiergestützten<br />
Kopieakte nur CD-Roms mit dem identischen <strong>Akte</strong>ninhalt zu erstellen und<br />
diese den Verteidigern <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>neinsicht zu Verfügung zu<br />
stellen.<br />
101
Angesichts <strong>der</strong> bisher durchgehend positiven Resonanz <strong>der</strong> Verteidiger<br />
steht nicht zu erwarten, dass sie sich nachdrücklich gegen ein solches<br />
Vorgehen aussprechen. Sollten einzelne gleichwohl auf einer papierge-<br />
stützten <strong>Akte</strong> bestehen, so steht einer durch sie veranlassten Vervielfälti-<br />
gung freilich nichts entgegen. Ob sie die dafür entstehenden Kosten in-<br />
des nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ersetzt verlangen kön-<br />
nen, ist (ggf. durch den Gesetzgeber) gebührenrechtlich zu klären, be-<br />
rührt aber die prozessualen Abläufe des <strong>Strafverfahren</strong>s nicht unmittel-<br />
bar.<br />
Angesichts dieser sehr guten Aussichten auf eine nachhaltige Effizienz-<br />
steigerung und signifikanten Kostensenkungsmöglichkeiten sowie nicht<br />
zuletzt dem damit verbundenen ökologischen Handeln, bleibt zu hoffen,<br />
dass dieser hier angedeutete Weg einer Unterstützung durch elektroni-<br />
sche Hilfsakten und die dafür notwendige Hardware weiter für die <strong>Justiz</strong><br />
ermöglicht und durch sie beschritten wird.<br />
6.4 Sonstige elektronische Hilfsmittel<br />
In <strong>der</strong> täglichen Praxis <strong>der</strong> deutschen Staatsanwaltschaften und Strafge-<br />
richte finden eine Vielzahl elektronischer Hilfsmittel zur Unterstützung <strong>der</strong><br />
Ermittlungsarbeiten aber auch zur Effektivierung <strong>der</strong> täglichen Arbeitsab-<br />
läufe Anwendung. An dieser Stelle kann davon kein vollständiges Bild<br />
gezeichnet werden. Unerwähnt bleiben insbeson<strong>der</strong>e elektronische Ver-<br />
fahren zur Verfahrenskostenbeitreibung o<strong>der</strong> zur Asservatenverwaltung.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e sind nach Einschätzung zahlreicher Praktiker aus ver-<br />
schiedenen Behörden <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> aber die <strong>im</strong> Folgenden dargestellten<br />
Anwendungen und Hilfsmittel aus <strong>der</strong> täglichen praktischen Arbeit nicht<br />
mehr wegzudenken:<br />
6.4.1 Recherchemöglichkeiten<br />
6.4.1.1 Das Internet<br />
Über den Zugriff auf das Internet verfügen Richter und Staatsanwälte ü-<br />
ber zahlreiche Möglichkeiten, Informationen einzuholen und über die<br />
gängigen Suchmaschinen, wie beispielsweise „Google“, selbst zu recher-<br />
chieren. Damit verbunden ist nicht nur ein erheblicher Zeitgewinn, son-<br />
102
<strong>der</strong>n auch eine deutliche Kostenersparnis. Hier soll exemplarisch allein<br />
auf einzusparende Kosten für die Telefonauskunft verwiesen werden.<br />
Denn sowohl über das kostenlose Teledienstangebot<br />
www.telefonbuch.de und www.gelbeseiten.de <strong>der</strong> Deutsche Telekom<br />
Medien GmbH als auch über die Unternehmens- und Kanzleihomepages<br />
selbst kann zügig die jeweils benötigte Erreichbarkeit aufgeklärt werden.<br />
In diesem Zusammenhang sind auch die auf diesem Wege leicht und<br />
schnell einzuholende Informationen aus Bereichen an<strong>der</strong>er <strong>Justiz</strong>verwal-<br />
tungen und <strong>der</strong> Legislative zu nennen. Über aktuelle Entwicklungen <strong>der</strong><br />
Bundesgesetzgebung kann über die Homepages <strong>der</strong> jeweils beteiligten<br />
Ministerien zugegriffen werden. Alle Landesjustizverwaltungen bieten das<br />
aktuelle Landesrecht in ihren Internetpräsenzen an, so dass das zeitauf-<br />
wändige Recherchieren in den Gerichtsbibliotheken zumeist überflüssig<br />
geworden ist. Durch eine übersichtliche Darstellung und gute „Suchfunk-<br />
tionen“ auf den jeweiligen Homepages ist <strong>der</strong> Zugriff auf die aktuelle ver-<br />
fassungsgerichtliche, höchst- und obergerichtliche Rechtsprechung ver-<br />
gleichbar einfach geworden. Insbeson<strong>der</strong>e können durch das kostenlose<br />
Abonnement eines sog. „Newsletter“, z.B. den <strong>der</strong> Pressestellen vom<br />
Bundesverfassungsgericht und des <strong>Bundesministerium</strong>s <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>, aktu-<br />
elle Entwicklungen einfach und „nebenbei“ mitverfolgt werden. Aber auch<br />
die Abfrage und Suche nach europarechtlichen Vorschriften ist beispiels-<br />
weise über EUR-Lex zügig möglich.<br />
6.4.1.2 Juristische Datenbanken<br />
Die Landesjustizverwaltungen haben allesamt mit juris GmbH und Verlag<br />
C.H. Beck oHG Rahmenverträge geschlossen und bieten ihren Rechts-<br />
anwen<strong>der</strong>n dadurch umfassende Recherchemöglichkeiten in <strong>der</strong> Daten-<br />
bank „juris“ und „beck-online“. Über letztere sind insbeson<strong>der</strong>e zahlreiche<br />
Zeitschriften, wie beispielsweise die NJW und die NStZ, abrufbar. Unter-<br />
schiedlich ausgestaltet ist hier indes noch <strong>im</strong>mer die Anzahl an Berechti-<br />
gungen. Während einige Bundeslän<strong>der</strong>, so zum Bespiel Berlin, Hamburg,<br />
Schleswig-Holstein, Brandenburg und Rheinland-Pfalz, diese Recher-<br />
chemöglichkeit an jedem richterlichen- und staatsanwaltschaftlichen Ar-<br />
beitsplatz gewähren, stellen an<strong>der</strong>e <strong>Justiz</strong>verwaltungen nur eine Berech-<br />
103
tigung für eine Abteilung bzw. ein Dezernat zur Verfügung und sparen<br />
hier Lizenzgebühren ein.<br />
Darüber hinaus haben vereinzelte Bundslän<strong>der</strong> mit best<strong>im</strong>mten Fachda-<br />
tenbanken Rahmenverträge geschlossen. Dazu zählt beispielsweise <strong>der</strong><br />
Zugriff auf „ibr-online“, eine Datenbank für die Immobilien- und Bauwirt-<br />
schaft <strong>der</strong> id Verlags GmbH, durch die Län<strong>der</strong> Brandenburg, Hessen und<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen. Durch einen Vertrag mit Recht für Deutschland GmbH<br />
wird den nie<strong>der</strong>sächsischen <strong>Justiz</strong>behörden die Nutzung <strong>der</strong> Online-<br />
Datenbank "Recht für Deutschland" hinsichtlich folgen<strong>der</strong> Verkündungs-<br />
blätter ermöglicht: Bundesgesetzblatt Teil I und II inkl. Archiv, Nie<strong>der</strong>-<br />
sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt inkl. Archiv, Nie<strong>der</strong>sächsi-<br />
sches Ministerialblatt (nur <strong>der</strong> amtliche Teil) ab Abonnementbeginn. Von<br />
dem Unternehmen wird ein elektronischer Benachrichtigungsdienst be-<br />
reitgestellt, <strong>der</strong> bei Neuerscheinung einer <strong>der</strong> genannten Verkündungs-<br />
blätter dessen Inhaltsverzeichnis per E-Mail übermittelt.<br />
Zu konstatieren ist indes, dass diese Entwicklung hin zu einer umfassen-<br />
den und zu begrüßenden Recherchemöglichkeit und damit effizienten Ar-<br />
beitsweise nicht ohne Einfluss auf die Ausstattung mit Buchliteratur<br />
geblieben ist. So ging in den Län<strong>der</strong>n Hamburg und Bremen damit einher,<br />
dass über Jahrzehnte eingeführte und insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Hauptver-<br />
handlung unentbehrliche Kommentarliteratur wie <strong>der</strong> „Meyer-Goßner“,<br />
StPO, o<strong>der</strong> <strong>der</strong> „Tröndle/Fischer“, StGB, nicht mehr für jeden Richter bzw.<br />
Staatsanwalt angeschafft werden, obgleich beide zum Grundhandwerks-<br />
zeug gehören und nicht über beck-online abrufbar sind, sodass in nicht<br />
mehr professioneller Weise häufig mit veralteten Auflagen gearbeitet<br />
werden muss.<br />
6.4.1.3 Das Intranet<br />
Die Informationstechnik erleichtert darüber hinaus auch die behördenin-<br />
terne Kommunikation. Zahlreiche Landesjustizverwaltungen bedienen<br />
sich dazu des sog. „Intranets“. Darunter wird ein organisationsinternes,<br />
nicht-öffentliches Rechnernetzwerk, das auf den gleichen Techniken und<br />
Anwendungen wie das Internet basiert und den Mitarbeitern einer<br />
104
Organisation als Informations-, Kommunikations- und Anwendungsplatt-<br />
form zur Verfügung steht, verstanden. Über dieses haben alle Mitarbeiter<br />
Zugriff beispielsweise auf Verfügungen und Weisungen <strong>der</strong> Behördenlei-<br />
tung, Informationen allgemeiner Art, umfassende Vordruck- und Formu-<br />
larsammlungen o<strong>der</strong> Hinweisen auf das Fortbildungsangebot.<br />
6.4.2 Korrespondenz per E-Mail<br />
In den Bereichen sämtlicher Landsjustizverwaltungen verfügen Richter<br />
und Staatsanwälte über die Möglichkeit, mittels Email zu kommunizieren.<br />
Dies geschieht nahezu ausschließlich über persönliche E-Mailadressen.<br />
Auch auf diese Weise können daher Informationen eingeholt werden.<br />
Darüber hinaus verkürzen sich die Kommunikationswege auch hausin-<br />
tern. Beispielsweise können Beschluss- und Urteilsentwürfe unter Kam-<br />
mermitglie<strong>der</strong>n verschickt werden, Rückrufbitten in teilweise schwierig er-<br />
reichbaren Rechtsanwaltskanzleien hinterlassen o<strong>der</strong> auch auf diesem<br />
Wege wichtige Informationen <strong>der</strong> Behördenleitung- bzw. Gerichtsführung<br />
versandt werden.<br />
Auch die behördenübergreifende Kommunikation wird deutlich erleichtert.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e gilt dies für den Kontakt zu Europol und Eurojust. Bei-<br />
spielsweise war es in einem Hamburger Verfahren, in dem die Entschei-<br />
dung über eine Untersuchungshaftanordnung <strong>im</strong> Raum stand, durch die-<br />
se elektronische Kommunikation möglich, binnen eines Tages Auskunft<br />
über eine strafrechtliche Vorbelastung des Beschuldigten aus Frankreich<br />
zu erhalten. Nach Übersendung einer Email an das „German Desk“ <strong>der</strong> in<br />
Den Haag ansässigen Behörde und dem Hinweis auf die nicht näher be-<br />
kannte Verurteilung durch ein Gericht in Meaux, Frankreich, aus dem<br />
Jahre 2002 reagierte das „Nationale Mitglied für Deutschland“ prompt,<br />
sandte nach Hamburg ebenfalls per Email das Eurojust-<strong>Akte</strong>nzeichen,<br />
nahm Kontakt zum französischen Vertreter bei Eurojust auf und einen<br />
Tag später hatte das in Hamburg zur Entscheidung berufene Gericht das<br />
französische Urteil aus Meaux vorliegen, das sofort zur Übersetzung ge-<br />
geben und wenige Tage später tragend den sodann erlassenen Haftbe-<br />
fehl berücksichtigt werden konnte.<br />
105
6.4.3 E-Fax<br />
Eine weitere Beschleunigung <strong>der</strong> Arbeitsabläufe und ein Einsparen von<br />
Papier wird durch die Einrichtung eines Programms, mit dem ein Telefax<br />
am PC empfangen und dann betrachtet werden kann. Hierzu wird unter-<br />
schiedliche, auch Windows-gestützte, Software eingesetzt, die das ein-<br />
gehende Telefax in eine TIFF-, GIF- o<strong>der</strong> SFF-Datei umwandelt. Auf die-<br />
se Weise können beispielsweise bei <strong>der</strong> Bearbeitung von Anträgen <strong>im</strong><br />
Hauptverfahren die Antragsschriften ohne Vervielfältigung auf Papier ü-<br />
bermittelt und sie den Prozessbeteiligten, beispielsweise <strong>der</strong> Staatsan-<br />
waltschaft, ohne Zeit- und Kostenverlust per E-Mail übersandt werden.<br />
Die Einrichtung eines sog. E-Fax ist indes gegenwärtig wohl (noch) die<br />
Ausnahme am richterlichen o<strong>der</strong> staatsanwaltschaftlichen Arbeitsplatz.<br />
6.4.4 Spracherkennung<br />
In zahlreichen Bundeslän<strong>der</strong>n werden unterschiedliche Geräte und Soft-<br />
wareprogramme für die Spracherkennung eingesetzt. Die Bewertung die-<br />
ses technischen Hilfsmittels fiel indes nach den hier durchgeführten Er-<br />
hebungen ambivalent aus. Maßgeblich hängt <strong>der</strong> Erfolg vom Einsatz des<br />
einzelnen Anwen<strong>der</strong>s an. Dieser muss sich nicht nur mit dem System ver-<br />
traut machen. Er muss auch den Wortschatz des Geräts pflegen und er-<br />
weitern sowie seine Sprechweise an die Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Soft- und<br />
Hardware anpassen. Durchgesetzt hat sich dieses technische Hilfsmittel<br />
daher wohl (noch) nicht.<br />
Zu unterscheiden ist die digitale Spracherkennung von digitalen Diktaten.<br />
Bei letzterem wird das gesprochene Wort des Diktierenden durch eine<br />
spezielle Software aufgezeichnet und auf einem Server hinterlegt. Auf die<br />
dortige Audio-Datei können Schreibkräfte später zurückgreifen und das<br />
Diktat entgegen nehmen. Anwendung finden teilweise Mischformen, bei<br />
denen <strong>der</strong> Diktierende eine Spracherkennungssoftware benutzt, an die<br />
aber zudem eine Audio-Datei gekoppelt ist. Die Schreibkraft öffnet eben<br />
diese Dateien, sieht den erfassten Text, vergleicht ihn mit den von <strong>der</strong><br />
Software erkannten Worten und korrigiert Fehler. Insbeson<strong>der</strong>e die letzte-<br />
re Verfahrensweise hat sich bislang nicht durchgesetzt. Die Texterfas-<br />
106
sung durch geübte Schreibkräfte auf ein Diktat wird als schneller angese-<br />
hen, als die spätere Fehlerkorrektur.<br />
6.4.5 Register online abfragen<br />
Zahlreiche Gerichte und Staatsanwaltschaften machen bereits gegenwär-<br />
tig Gebrauch von <strong>der</strong> Möglichkeit, Auszüge aus dem Bundeszentral- und<br />
Verkehrszentralregister online abzurufen. Dabei werden regelmäßig über<br />
die Datenbankanwendung Access von Microsoft und eine Schnittstelle <strong>im</strong><br />
jeweils eingesetzten Vorgangsbearbeitungssystem, beispielsweise<br />
MESTA o<strong>der</strong> MEGA, die darin gespeicherten und zur Abfrage notwendi-<br />
gen Stammdaten – z.B. Name, Vorname, Geburtsdatum – herausgelesen<br />
und an die jeweilige registerführende Behörde über das bereits angeführ-<br />
te TESTA-Netz übersandt. Die Zusendung des angefor<strong>der</strong>ten Auszugs<br />
erfolgt dann je nach informationstechnischer Ausstattung und Wunsch<br />
entwe<strong>der</strong> online o<strong>der</strong> per Fax, bevor die Registerbehörden dann eine<br />
Ausfertigung postalisch zu den <strong>Akte</strong>n senden.<br />
6.4.6 <strong>Elektronische</strong> Strafanzeigen<br />
Bis auf die Län<strong>der</strong> Bayern, Bremen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen<br />
und Thüringen bieten die an<strong>der</strong>en zehn Län<strong>der</strong> die Möglichkeit über sog.<br />
„Internet-Polizeiwachen“ Strafanzeigen auch online zu erstatten. Die je-<br />
weils eingesetzten Fachanwendungen bieten soweit ersichtlich die Mög-<br />
lichkeit, die vom Anzeigenden übersandten und durch die Polizeien je-<br />
weils verschlüsselten Daten direkt in die polizeiliche Fachanwendung,<br />
beispielsweise ComVor, einzustellen. Zumeist wird die IP-Adresse des<br />
Anzeigenden jedenfalls für mehrere Tage mit Zust<strong>im</strong>mung des Anzeigen-<br />
den gespeichert, um <strong>im</strong> Falle eines Missbrauchsverdachts einen Ermitt-<br />
lungsansatz zu haben. Den wenigen von <strong>der</strong> Polizei Hamburg verzeich-<br />
neten Missbrauchsfällen steht eine stetig wachsende Zahl an elektroni-<br />
schen Eingängen gegenüber. In Nordrhein-Westfalen werden gegenwär-<br />
tig jährlich etwa 20.000 Anzeigen auf diesem Wege registriert.<br />
6.4.7 Internationale Datenübermittlung <strong>im</strong> Ermittlungsverfahren<br />
Der Austausch von Informationen während laufen<strong>der</strong> Ermittlungsverfah-<br />
ren ist bereits gegenwärtig auch grenzüberschreitend möglich.<br />
107
Insbeson<strong>der</strong>e <strong>im</strong> Bereich <strong>der</strong> bandenmäßigen Rauschgiftkr<strong>im</strong>inalität<br />
konnten hier durch „Gemeinsame Ermittlungsgruppen“, § 83k IRG, er-<br />
hebliche Erfolge erzielt werden. Dabei wurden insbeson<strong>der</strong>e <strong>im</strong> Wege<br />
von TÜ-Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse über das TESTA-Netz<br />
nach Deutschland ohne Zeitverlust überspielt, konnten hier auf Optical-<br />
Disk – ebenso wie sämtliche an<strong>der</strong>en auch national gewonnenen TÜ-<br />
Daten – gespeichert, übersetzt und als weiterführende Erkenntnisse ge-<br />
gen die Beschuldigten unverzüglich eingesetzt werden.<br />
6.4.8 <strong>Elektronische</strong> Gefangenenpersonalakte<br />
Im Hessischen <strong>Justiz</strong>vollzug wurde flächendeckend ein DOMEA-<br />
gestütztes Dokumentenmangagementsystem (OpenText) eingeführt. Die-<br />
ses wurde integriert in das Fachverfahren BASIS-Web. Darauf gestützt<br />
wurde durch die Landesjustizverwaltung Hessen eine Gefangenpersonal-<br />
akte entwickelt, die gegenwärtig in <strong>der</strong> JVA Wiesbaden in zwei Abteilun-<br />
gen pilotiert wird.<br />
Mit je<strong>der</strong> Aufnahme von Gefangenendaten in dem Fachverfahren BASIS-<br />
web wird in dem Dokumentenmanagementsystem eine elektronische Ak-<br />
te generiert, welche in ihrem logischen Aufbau den Vorgaben über eine<br />
Gefangenenaktenführung <strong>der</strong> Vollzugsgeschäftsstellenordnung ent-<br />
spricht. Entsprechend den Zugriffsrechten auf die Inhalte <strong>der</strong> papierge-<br />
stützten Gefangenenakte sind auch für die elektronisch geführte <strong>Akte</strong> die<br />
Berechtigungen einzelner Stellen auf den allgemeinen Schriftverkehr, die<br />
Gefangenendaten o<strong>der</strong> auch den Gutachtenteil individuell begrenzt.<br />
Festgelegte Merkblätter werden automatisch in <strong>der</strong> entsprechenden Un-<br />
terordnung angelegt Rechtlich relevante Dokumente können digital sig-<br />
niert ausgetauscht werden.<br />
Der Versand an an<strong>der</strong>e Stellen innerhalb <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> ist vorgesehen und<br />
soll Verfahrensabläufe beschleunigen. Insbeson<strong>der</strong>e sollen die Vollstre-<br />
ckungsakten den Strafvollstreckungsakten <strong>der</strong> zuständigen Abteilungen<br />
<strong>der</strong> Staatsanwaltschaften und den zuständigen Strafvollstreckungskam-<br />
mern elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Gegenwärtig werden für<br />
108
die Übersendung <strong>der</strong> papiergestützten <strong>Akte</strong> etwa sechs Tage benötigt.<br />
Zukünftig soll ein Online-Zugriff über einen Login <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
auf den Server des Strafvollzugs und eine verschlüsselte Leitung erfol-<br />
gen. Angedacht ist auch eine Datenübermittlung unter Einsatz des XML-<br />
Formats und <strong>der</strong> Einrichtung einer Schnittstelle mit MESTA. Auf diesem<br />
Wege könnten beispielsweise Stammdaten automatisch eingepflegt wer-<br />
den. Auf Grund des für die Schnittstelleneinrichtung erfor<strong>der</strong>lichen Kos-<br />
tenaufwands wird indes <strong>der</strong> Online-Zugriff <strong>der</strong>zeit präferiert. Auf diesem<br />
Wege soll die <strong>Akte</strong> ab Anfang 2008 dann eingesehen werden können,<br />
wobei dafür <strong>der</strong> Einsatz des PDF-Formats vorgesehen ist.<br />
Im Zuge dieser Pilotierung wurden sämtliche Verwaltungsarbeitsplätze<br />
<strong>der</strong> JVA mit 19-Zoll-Monitoren ausgestattet. Die Arbeitsplätze <strong>der</strong> Regist-<br />
ratur verfügen zudem über Monitore <strong>im</strong> Format von 21 Zoll.<br />
6.4.9 Unterstützung steuerstrafrechtlicher Ermittlungen<br />
7. Fazit<br />
Zur Unterstützung <strong>der</strong> steuerstrafrechtlichen Ermittlungen wird u.a. in<br />
Hamburg gegenwärtig die bereits <strong>im</strong> Rahmen von Betriebsprüfungen in<br />
nahezu allen Finanzverwaltungen <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> eingesetzte Soft-<br />
ware IDEA, AvenDATA GmbH, Berlin, eingesetzt. Sie soll insbeson<strong>der</strong>e<br />
in Wirtschaftsstrafsachen helfen, <strong>im</strong> Rahmen von Durchsuchungen und<br />
Beschlagnahmen von Datenmaterial erheblichen Umfangs (beispielswei-<br />
se als Excel-, Word o<strong>der</strong> Datenbankdateien) aufgefundene Dokumente<br />
erleichtert zu sichten und verschiedene Suchfunktionen ermöglichen.<br />
Die in den laufenden Projekten zur elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> OWi-Verfahren<br />
gewonnenen Erkenntnisse und Schwierigkeiten zeigen auf, dass eine<br />
Vielzahl komplexer tatsächlicher wie rechtlicher Fragen be<strong>im</strong> Übergang<br />
auf die vollständige elektronische <strong>Akte</strong>nführung zu klären sind. Hier sei<br />
lediglich auf die Frage <strong>der</strong> Archivierung und Aufbewahrung von Urschrift<br />
und die damit korrespondierenden rechtlichen Fragen zum Beweisan-<br />
tragsrecht verwiesen. Soweit dem Gesetzgeber für sein Vorgehen inner-<br />
halb <strong>der</strong> Strafprozessordnung <strong>im</strong> Schrifttum vereinzelt vorgehalten wird,<br />
109
dass er von falschen Prämissen ausgehe und die elektronische <strong>Akte</strong> nicht<br />
an<strong>der</strong>s als <strong>im</strong> OWi-Verfahren realisierbar sei, greift dieser Einwand zu<br />
kurz. Er blendet insbeson<strong>der</strong>e aus, dass die Regeln des Strengbeweises<br />
bei <strong>der</strong> Ahndung von Verwaltungsunrecht vielfach aufgeweicht sind. Den<br />
„schützenden Formen“ <strong>im</strong> Strafprozess, insbeson<strong>der</strong>e in teilweise erheb-<br />
lich konfliktgeladenen Verfahren, und die Tiefe <strong>der</strong> <strong>im</strong> Raum stehenden<br />
Rechtsgutseingriffe kommt eine signifikant höhere Bedeutung zu. Sie zu<br />
beachten und umzusetzen, steht einer voreiligen Umsetzung <strong>der</strong> elektro-<br />
nischen <strong>Akte</strong> entgegen und zwingt zu einer sensiblen Umsetzung <strong>der</strong><br />
technischen Möglichkeiten <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong>.<br />
Dennoch vertritt die Kommission die Ansicht, dass die <strong>im</strong> Bußgeldverfah-<br />
ren gewonnenen Erfahrungen mit dem entsprechenden Augenmaß für<br />
den Strafprozess fruchtbar gemacht werden können. Die Koordinierung<br />
und Abst<strong>im</strong>mung <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> innerhalb <strong>der</strong> Bund-<br />
Län<strong>der</strong>kommission und ihre Arbeitsgruppen leisten dazu schon jetzt ei-<br />
nen wesentlichen Beitrag. In <strong>der</strong>en Erörterungen können zukünftig auch<br />
Belange weiterer Verfahrensbeteiligter einfließen, wie beispielsweise die<br />
<strong>der</strong> Jugendgerichts- und <strong>der</strong> Bewährungshilfe.<br />
Nicht zuletzt bietet eine parallel dazu geför<strong>der</strong>te elektronische Hilfsakte<br />
<strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> die Möglichkeit, den Staatsanwaltschaften und Gerich-<br />
ten die Vorteile einer elektronischen Verfahrensunterstützung nahe zu<br />
bringen. Auch auf diesem Wege können wertvolle Erfahrungen gewonnen<br />
und Akzeptanz bei den Rechtsanwen<strong>der</strong>n auf dem anspruchsvollen Weg<br />
zu einer vollelektronischen Vorgangsbearbeitung geschaffen werden.<br />
110
V. Modellhafte Darstellung des Ablaufs eines <strong>Strafverfahren</strong>s bei<br />
voller Nutzung einer elektronischen <strong>Akte</strong><br />
1. Digitale Daten in <strong>der</strong> Rechtswirklichkeit<br />
1.1 Vorbemerkung<br />
Die modellhafte Darstellung des Ablaufs eines <strong>Strafverfahren</strong>s bei voller<br />
Nutzung einer „elektronischen <strong>Akte</strong>“ erfor<strong>der</strong>t wegen <strong>der</strong> Komplexität die<br />
Darlegung einiger Prämissen, ohne die eine elektronischen <strong>Akte</strong> nicht ge-<br />
führt werden kann; diese Prämissen werden praktisch vor die Klammer<br />
gezogen.<br />
1.2 Technische Voraussetzungen einer elektronischen <strong>Akte</strong><br />
Auf die Ergebnisse <strong>der</strong> Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Datenverarbeitung<br />
und Rationalisierung in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> und die OT-Leit-ERV kann an dieser<br />
Stelle nicht näher eingegangen werden. Lediglich die folgenden kurzen<br />
Hinweise erscheinen angezeigt:<br />
Nach den Vorgaben <strong>der</strong> Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission, und diese For<strong>der</strong>ung<br />
hebt auch die Kommission beson<strong>der</strong>s hervor, ist eine wesentliche Vor-<br />
aussetzung für einen voll ausgebauten elektronischen Rechtsverkehr die<br />
Entwicklung eines (zumindest) bundesweit einheitlichen Standards für<br />
den Austausch elektronischer Informationen. Hierbei geht es nicht allein<br />
um den Austausch von Dokumenten, für die möglicherweise auf Markt-<br />
standards wie HTML (Hypertext Markup Language) o<strong>der</strong> PDF (Portable<br />
Document Format) zurückgegriffen werden könnte. Vielmehr sollen auch<br />
einzelne verfahrensbezogene Daten - etwa die Adressen von Prozessbe-<br />
teiligten o<strong>der</strong> Angaben über bevorstehende Verhandlungstermine - mög-<br />
lichst so ausgetauscht werden können, dass sie <strong>der</strong> Empfänger durch ein-<br />
fachen Mausklick in seine eigene Bürosoftware übernehmen kann.<br />
Um dies zu ermöglichen, hat die Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission für Datenver-<br />
arbeitung und Rationalisierung in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> (BLK) den Datensatz X<strong>Justiz</strong><br />
entwickelt. Darin werden in Form einer Datensatzbeschreibung Datenfel-<br />
<strong>der</strong> definiert, die den Austausch möglichst vieler verfahrensrelevanter Da-<br />
111
ten ermöglichen sollen. Der Datensatz X<strong>Justiz</strong> ist Bestandteil <strong>der</strong> organi-<br />
satorisch-technischen Leitlinien für den elektronischen Rechtsverkehr mit<br />
den Gerichten und Staatsanwaltschaften.<br />
Die technischen Voraussetzungen für die Realisierung einer einfachen<br />
elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> sind <strong>im</strong> Wesentlichen gegeben,<br />
Fragen <strong>der</strong> Datensicherheit bedürfen weiterer Klärung.<br />
Bereits <strong>der</strong>zeit können aufgrund <strong>der</strong> Verbindung über das Internet sämtli-<br />
che am Verfahren Beteiligten kommunizieren: Anzeigeerstatter mit Poli-<br />
zei/Staatsanwaltschaft, Polizei mit Staatsanwaltschaft, Poli-<br />
zei/Staatsanwaltschaft mit Zeugen, Polizei/Staatsanwaltschaft mit Vertei-<br />
digern, Staatsanwaltschaft mit Gericht und an<strong>der</strong>en Staatsanwaltschaft,<br />
Gerichte mit an<strong>der</strong>en Gerichten, Verteidiger mit Ge-<br />
richt/Staatsanwaltschaft. Große Datenmengen können entwe<strong>der</strong> in ver-<br />
sendbare Datenpakete unterteilt und über das Internet versandt o<strong>der</strong> aber<br />
auf Datenträgern übermittelt werden. Dabei darf das Problemfeld Daten-<br />
schutz nicht außer Acht gelassen werden!<br />
Soweit Papierunterlagen bei Behörden/Gerichten eingereicht o<strong>der</strong> <strong>im</strong><br />
Rahmen von Ermittlungen erhoben werden, können diese schnell digitali-<br />
siert und in die elektronische <strong>Akte</strong> integriert werden. Mo<strong>der</strong>ne Scanner<br />
können in wenigen Minuten einzelne Blätter und ganze Stehordner mit<br />
500 Blättern – Vor- und Rückseite – in solcher Qualität digitalisieren,<br />
dass sie nach Umwandlung mit Hilfe einer OCR Software (optical charac-<br />
ter recognition) auch digital ausgewertet werden können.<br />
Die technischen Geräte, die zur Realisierung einer elektronischen <strong>Akte</strong><br />
erfor<strong>der</strong>lich sind, befinden sich auf einem so hohen Entwicklungsstand,<br />
dass damit ordentlich gearbeitet werden kann: Die PC’s haben ausrei-<br />
chende Arbeitsgeschwindigkeiten und Speichermöglichkeiten, die Verbin-<br />
dungsmöglichkeiten sind gegeben. Server haben einen Speicherplatz, <strong>der</strong><br />
auch für umfangreiche <strong>Justiz</strong>vorgänge ausreicht. Die Server werden<br />
grundsätzlich gespiegelt, d.h. <strong>der</strong>selbe Vorgang wird zwe<strong>im</strong>al gesichert.<br />
112
Die Sicherheit bei <strong>der</strong> Arbeit mit einer elektronischen <strong>Akte</strong> erfor<strong>der</strong>t Ver-<br />
besserungen. Die Versendung von E-Mail mit Unterlagen aus einer Er-<br />
mittlungs- bzw. Gerichtsakte setzt einen sicheren Datenweg voraus. Bei<br />
E-Mails handelt es sich um flüchtige Datenpakete <strong>im</strong> Netz, <strong>der</strong>en Inhalt<br />
von jedem Kundigen eingesehen und sogar manipuliert werden können,<br />
die einzelnen Teilpakete einer Mail können – wenn sie ungesichert ver-<br />
sandt werden – verschiedene Wege nehmen. Die Darstellung und Aufbe-<br />
wahrung <strong>der</strong> ein- und ausgehenden Mails sind jeweils von den System-<br />
einstellungen abhängig. Mit Hilfe <strong>der</strong> SSL – Technik ist jedoch bereits jetzt<br />
eine relativ sichere Übermittlung möglich.<br />
Die Identität des Versen<strong>der</strong>s sollte bei Teilnahme am Rechtsverkehr<br />
durch eine Signatur bzw. einen Nachweis gewährleistet sein. Bei dem 16.<br />
EDV Gerichtstag 2007 wurde über positive Entwicklungen bei Anwendung<br />
<strong>der</strong> elektronischen Signatur berichtet.<br />
Bei <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> ist eine Verfahrensdoku-<br />
mentation erfor<strong>der</strong>lich. Damit werden die organisatorischen und techni-<br />
schen Zusammenhänge erfasst/dargestellt, die zum Nachweis <strong>der</strong> Revisi-<br />
onssicherheit und zum Verständnis des Verfahrens <strong>der</strong> elektronischen Ar-<br />
chivierung in einem konkreten System notwendig sind. Hierzu zählen die<br />
Fachanwendungen, die auf das Archivsystem aufsetzen, die technische<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Fachanwendung (Systemkonfiguration, Standard- und In-<br />
dividualkomponenten, Hardware), die organisatorischen Anweisungen für<br />
Anwen<strong>der</strong> und Betreiber, Betriebsvoraussetzungen, sowie die Kriterien<br />
zur Software-Identifikation (ist das beschriebene System wirklich das real<br />
genutzte System?), Zugriffsberechtigungen etc.<br />
Für Buchführungssysteme schreiben die GoBS (Grundsätze ordnungs-<br />
mäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme) eine solche Verfahrensdo-<br />
kumentation vor. Werden kaufmännische Dokumente archiviert, so wird<br />
auch das Archiv wie ein Buchführungssystem betrachtet. Der Betreiber<br />
muss hierbei nachweisen, dass die Übereinst<strong>im</strong>mung <strong>der</strong> archivierten Do-<br />
kumente mit den Originalen sichergestellt ist und dass während <strong>der</strong> Er-<br />
fassung und Speicherung keine Verluste o<strong>der</strong> unkontrollierte Än<strong>der</strong>ungen<br />
denkbar sind (Revisionssicherheit).<br />
113
Zur Archivierung von Papierunterlagen:<br />
In <strong>Strafverfahren</strong> werden <strong>im</strong>mer wie<strong>der</strong> Papierunterlagen eingehen, da es<br />
eine vollkommene digitale Kommunikation nicht geben wird. Diese<br />
Schriftstücke müssen nach Umwandlung in elektronische Dokumente ar-<br />
chiviert werden (vgl. zum Zivilprozessrecht § 298 a Abs. 2 ZPO) denn es<br />
muss eine einfache Möglichkeit bestehen, auf diese Unterlagen später<br />
wie<strong>der</strong> zuzugreifen, sei es zur Überprüfung des Originalbeleges o<strong>der</strong> zum<br />
späteren Ausscheiden <strong>der</strong> Unterlagen (vgl. unten). Da dieses Erfor<strong>der</strong>nis<br />
zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten bestehen kann, ist we<strong>der</strong> eine Ab-<br />
lage nach zeitlichem Eingang noch eine tageweise Ablage aller Unterla-<br />
gen o<strong>der</strong> die Vergabe laufen<strong>der</strong> Nummern die geeignete Technik.<br />
Es bietet sich eine elektronische Kennzeichnung je<strong>der</strong> einzelnen Unterla-<br />
ge mittels Barcode an, wie es bereits <strong>im</strong> elektronischen OWi-Verfahren<br />
<strong>der</strong> Fall ist. Für die Ablage von Papierdokumenten durch Scannen mit<br />
Barcode gibt es unterschiedliche Systeme. Hierbei werden <strong>Akte</strong>nzeichen,<br />
Beschuldigtennamen, Anzeigeerstatter und Ablageort als Meta-<br />
Information in Verschlagwortungsmasken hinterlegt, aus den digitalen Da-<br />
ten werden barcodierte Dokumentenaufkleber gefertigt, diese aufgeklebt,<br />
sodann die Dokumente gescannt und abgelegt.<br />
114
Formular zu Bearbeitung von Papierunterlagen:<br />
1.3 Software-Programme<br />
Die Standard - Software zur Erstellung einer elektronischen <strong>Akte</strong> und<br />
<strong>der</strong>en Verbindung zu den Richter- und Staatsanwaltsarbeitsplätzen so-<br />
wie den Geschäftsstellen, sowie zur Kommunikation ist so entwickelt,<br />
dass damit gearbeitet werden kann. Auf die nachstehenden Ausführun-<br />
gen wird bei <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong><br />
mit den sich wie<strong>der</strong>holenden Vorgängen wie Erstellung <strong>der</strong> Stammda-<br />
ten (auch Grunddaten genannt), Anlage <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>, Hinzufügung von Do-<br />
kumenten, Erstellung von Formularen, Anbringen von Vermerken auf<br />
einzelnen Unterlagen, Versendung von <strong>Akte</strong>n (Versendungsdaten) etc.<br />
Bezug genommen. Wie bereits oben ausgeführt, kann auf X<strong>Justiz</strong>.Straf<br />
hier nicht näher eingegangen werden.<br />
Bei <strong>der</strong> Anlage bzw. Führung einer elektronischen Strafakte handelt es<br />
sich um ein Dokumentenmanagement, das aus Elementen wie Archiv,<br />
<strong>Akte</strong>nschrank, Ordner und Register besteht. Jedes Objekt, wie eine Ak-<br />
te, Anzeige, Einleitungsverfügung, Ladung, Vernehmung, Durchsu-<br />
chungsprotokoll und Beweismittel, wie Anklage, Hauptverhandlungspro-<br />
tokoll und Urteil, wird – gleich ob durch Scannen digitalisiert o<strong>der</strong> am PC<br />
erstellt - in den elektronischen Archiven abgespeichert. Dies gilt auch für<br />
eingescannte Originaldokumente wie Personalausweis, Pass o<strong>der</strong> Füh-<br />
rerschein.<br />
115
In dem Programm ELO (vgl. unten2.Teil Anlage <strong>der</strong> Verfahrensordner)<br />
sieht beispielsweise die Einstiegseite zu einer elektronischen <strong>Akte</strong> fol-<br />
gen<strong>der</strong>maßen aus:<br />
Mit einem Mausklick navigiert man in <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nstruktur, öffnet Ordner<br />
und blättert in Dokumenten. Wahlweise steht eine Baumstruktur o<strong>der</strong><br />
die herkömmliche Ordneransicht zur Verfügung.<br />
Die einzelnen Dokumente können aufgerufen und <strong>im</strong> Ablauf angesehen<br />
werden, z.B. die Seiten einer <strong>Akte</strong>:<br />
116
Die Dokumente können in ihrem ursprünglichen Format abgelegt werden wie<br />
z.B. Microsoft Word, MS Excel, Bil<strong>der</strong>, u.a., aber auch als unverän<strong>der</strong>bare PDF -<br />
Datei.<br />
Durch Einscannen <strong>der</strong> Papierdokumente werden alle Dokumente in die elektro-<br />
nische <strong>Akte</strong> überführt. Es gibt also keine Dokumente die in Papierform bearbeitet<br />
werden. Die Originale müssen jedoch aufbewahrt werden.<br />
Beispiel: Personalausweis<br />
o<strong>der</strong> ein Schadensfoto, das digital o<strong>der</strong> in Papierform hergestellt wurde<br />
und sodann in die <strong>Akte</strong> überführt wird:<br />
Zur Integration von E-Mails und Office-Dokumenten<br />
Die Software ermöglicht die Integration von E-Mails und Office-<br />
Dokumenten direkt in das Archiv o<strong>der</strong> den relevanten Vorgang: Bei dem<br />
Programm ELO ermöglichen die Programmteile ELOgovernment und<br />
ELOkommunal durch die offenen Schnittstellen und die integrierte Pro-<br />
grammierumgebung z. B. eine nahtlose Integration.<br />
117
Die Arbeit mit den Archiven und Ordnern kann mit Hilfe von Passwort-<br />
schutz und Schlüsselvergabe gesichert werden.<br />
Die <strong>Akte</strong>n können mit einem elektronischen Wie<strong>der</strong>vorlagetermin verse-<br />
hen werden. Die Aufgaben werden hierbei automatisch auch mit <strong>der</strong> Out-<br />
look-Terminverwaltung synchronisiert.<br />
Wie<strong>der</strong>vorlageliste aus einem an<strong>der</strong>en Programm:<br />
118
In <strong>der</strong> Regel verfügen die Programme über Netzwerkfunktionalität, d.h.,<br />
es können mehrere Benutzer gleichzeitig mit ein- und demselben Archiv<br />
arbeiten. Dies bedeutet, dass eine Geschäftstelle eine Ladung mit den in<br />
einer <strong>Akte</strong> enthaltenen Verfahrensdaten herstellen kann, <strong>der</strong> zuständige<br />
Dezernent kann eine Zeugenvernehmung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> anschließen.<br />
Durch Import-/Export-Funktionen besteht die Möglichkeit für die Berech-<br />
tigten, Dokumente, o<strong>der</strong> Ordner zwischen dem Archiv und Laptops hin-<br />
und her zu versenden, Archive können auch auf DVD gebrannt werden.<br />
Mit Hilfe einer Software (ScanSoft PDF Create! 4), die über einen Pass-<br />
wortschutz verfügt, können Dokumente, Zeichnungen und Bil<strong>der</strong> in PDF-<br />
Dateien verwandelt werden, die austauschfreundlich sind. Diese PDF -<br />
Dateien können unverän<strong>der</strong>bar als E-Mail verschickt werden. Der Emp-<br />
fänger kann sie ausdrucken o<strong>der</strong> <strong>im</strong> Browser anschauen, unabhängig<br />
vom jeweiligen System. Kennwortschutz und 128-Bit-Verschlüsselung<br />
können verhin<strong>der</strong>n, dass Unbefugte die Unterlagen bearbeiten o<strong>der</strong> –<br />
wenn gewünscht - ausdrucken. In die PDF Dateien können Wasserzei-<br />
chen und Lesezeichen eingefügt werden. Mehreren Dateien können durch<br />
die Stapelverarbeitung gleichzeitig bearbeitet werden.<br />
Mit Hilfe kleiner Programme können farblich markierte Notizen (Post it) in<br />
den <strong>Akte</strong>n festgehalten werden ohne dass sich dies auf das abgespei-<br />
cherte Dokument auswirkt.<br />
An die Sicherheit werden hohe Anfor<strong>der</strong>ungen gestellt. Die unbeabsich-<br />
tigte Verän<strong>der</strong>ung von gespeicherten Dokumenten wird durch Prüfcodes<br />
verhin<strong>der</strong>t, die die archivierten Dokumente überwachen und gegen unbe-<br />
rechtigte Än<strong>der</strong>ungen schützen. Eine weitere Sicherung besteht dadurch,<br />
dass die Software alle Aktionen protokolliert, die <strong>im</strong> System durchgeführt<br />
werden und hierüber auf Anfor<strong>der</strong>ung exakt berichtet.<br />
Das Einloggen ist nur möglich, nachdem sich <strong>der</strong> Benutzer mit Name und Pass-<br />
wort identifiziert hat. Ferner ist das Fortschreiben o<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>n eines Dokumen-<br />
tes nachvollziehbar. Unbefugte Verän<strong>der</strong>ungen sind hierdurch <strong>im</strong> Prinzip nicht<br />
möglich.<br />
119
Zum <strong>Elektronische</strong>n Rechtsverkehr mit <strong>der</strong> Anwaltschaft<br />
Mit <strong>der</strong> Anwaltschaft – insbeson<strong>der</strong>e den Verteidigern – ist eine Kommu-<br />
nikation über das Internet möglich.<br />
Die Bund-Län<strong>der</strong>-Kommission hat über die Arbeitsgruppe "iT-technische<br />
Standards in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>" zunächst den Grunddatensatz X-<strong>Justiz</strong> geschaf-<br />
fen, <strong>der</strong> Informationen beinhaltet, die alle <strong>Justiz</strong>bereiche, gleich ob es um<br />
ein Zivilverfahren, eine Strafsache o<strong>der</strong> eine Angelegenheit <strong>der</strong> freiwilli-<br />
gen Gerichtsbarkeit geht, betrifft; <strong>der</strong> Datensatz liegt zwischenzeitlich in<br />
<strong>der</strong> Version 1.3.2 vor. Durch die Definition von Datenfel<strong>der</strong>n in Form einer<br />
Datensatzbeschreibung wird die Grundlage geschaffen, grundsätzlich un-<br />
abhängig von <strong>der</strong> verwendeten Gerichts- o<strong>der</strong> Kanzleisoftware und unab-<br />
hängig vom jeweils eingesetzten Betriebssystem Daten lesen und weiter-<br />
verarbeiten zu können. Für das Strafrecht existiert bereits das Fachmodul<br />
„X<strong>Justiz</strong>.Straf“.<br />
1.4 Bedeutung <strong>der</strong> digitalen Daten<br />
Die Existenz und Anwendung digitaler Daten hat einen maßgeblichen<br />
Einfluss auch auf das Strafrecht, d.h. auf die Begehung, Verfolgung und<br />
Ahndung von Straftaten, insbeson<strong>der</strong>e bei Wirtschaftsdelikten. Es ist des-<br />
halb angebracht, auf die Bedeutung <strong>der</strong> digitalen Daten für das tägliche<br />
Leben, die Wirtschaft und die Gesellschaft einzugehen. So ist z.B. <strong>der</strong> E-<br />
Commerce - <strong>der</strong> Handel <strong>im</strong> Internet - ein fester Bestandteil <strong>im</strong> täglichen<br />
Leben vieler Menschen geworden. Im Einzelnen:<br />
1.4.1 Digitale Daten <strong>im</strong> Wirtschaftsleben<br />
Der normale Schriftverkehr findet heute großenteils per E-Mail statt. Die<br />
E-Mail hat das Geschäftsleben nachhaltig verän<strong>der</strong>t, sie ist zum Stan-<br />
dard für Mitteilungen geworden. Digitale Daten finden sich bei <strong>der</strong> Tele-<br />
kommunikation, aber auch bei <strong>der</strong> Satellitenkommunikation, die u.a. zur<br />
Steuerung von Flotten (LKW’s, Schiffe o<strong>der</strong> Flugzeuge) bzw. <strong>der</strong> Verfol-<br />
gung <strong>der</strong> Wege von Waren dient.<br />
Die digitale Buchführung ist ebenfalls Standard <strong>im</strong> Wirtschaftsleben. Zu<br />
den rechtlichen Grundlagen vgl. 1. Teil Abschn. V.<br />
120
Die übrigen internen schriftlichen Unterlagen in Unternehmen werden e-<br />
benfalls digital geführt: So sind in Kundenakten alle Unterlagen zum Kun-<br />
den verfügbar. Nicht nur die Debitorenbelege, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> gesamte<br />
Schriftverkehr mit Eingangs- und Ausgangspost, egal ob per Brief, E-Mail<br />
o<strong>der</strong> per Fax. Auch Eingaben des Kunden in elektronische Formulare, Te-<br />
lefonnotizen, und Mitschnitte von Telefonaten (Voice Mail) können verwal-<br />
tet werden.<br />
Die Vertragsakten in Unternehmen werden digital geführt, dezentral sind<br />
Zugriffe auf diese Unterlagen möglich. Dies ist insbeson<strong>der</strong>e bei unter-<br />
schiedlichen internen Lagerorten wichtig.<br />
Personalakten werden ebenfalls elektronisch geführt.<br />
Die Daten in <strong>der</strong> Produktion werden digital erfasst. Der Zugriff auf solche<br />
Daten ist z.B. in Produkthaftungsfällen o<strong>der</strong> in Fällen <strong>der</strong> Produktpiraterie<br />
von großer Bedeutung. Dies gilt auch für die digitalen Daten in <strong>der</strong> For-<br />
schung<br />
1.4.2 Digitale Daten in <strong>der</strong> Kommunikation<br />
Die allgemeine Kommunikation erfolgt weitgehend mit Hilfe digitaler Da-<br />
ten, auf die in Ermittlungsverfahren zugegriffen werden muss.<br />
1.4.3 Digitale Daten <strong>im</strong> Gesundheitswesen<br />
Im Gesundheitswesen ist die digitale Patientenakte <strong>der</strong> Standard. In<br />
Krankenhäusern kann die elektronische Patientenakte lebensrettend sein,<br />
da innerhalb kürzester Zeit durch die hohe Qualität <strong>der</strong> Dokumentation auf<br />
die Daten zugegriffen werden kann. Be<strong>im</strong> klinischen Personal führt die di-<br />
gitale <strong>Akte</strong> zur Zeitersparnis.<br />
In Arztpraxen hat <strong>der</strong> Arzt mit Hilfe <strong>der</strong> elektronischen Patientenakte alle<br />
Informationen zum Patienten vor sich, Arztbriefe, Laborbefunde, EKGs<br />
o<strong>der</strong> OP-Berichte. Den Dokumentationspflichten kann hierdurch Rech-<br />
nung getragen werden.<br />
121
1.4.4 Digitale Daten in <strong>der</strong> Versicherungsbranche<br />
In <strong>der</strong> Versicherungsbranche werden praktisch alle Fälle mit Hilfe <strong>der</strong> e-<br />
lektronischen <strong>Akte</strong> bearbeitet.<br />
So bietet die Firma ELO (<strong>Elektronische</strong>r Leitzordner <strong>der</strong> Fa. Leitz) ein<br />
Enterprise-Content-Management (ECM)-System für Banken und Versi-<br />
cherungen zur Verwaltung von Kredit- und Versicherungsakten.<br />
Die spartenübergreifende Standardlösung für die Versicherungswirtschaft<br />
iQURE ermöglicht direkte Informationsverfügbarkeit, ganzheitliche Vor-<br />
gangsbearbeitung mit hoher Versicherungsfachlichkeit und revisionssi-<br />
chere Langzeitarchivierung. Der Zugang zu den gespeicherten Informati-<br />
onen ist wahlweise über den Sachbearbeiterpostkorb, die Vorgangsbear-<br />
beitung o<strong>der</strong> die elektronische Versicherungsakte möglich.<br />
1.4.5 Digitale Daten in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong><br />
In <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> findet mit <strong>der</strong> elektronischen Registerführung ab dem 1. Ja-<br />
nuar 2007 flächendeckend ein elektronischer Rechtsverkehr statt<br />
(e-government). Der Zugang ist nur noch elektronisch eröffnet, Auskünfte<br />
aus dem Register werden (vornehmlich) in elektronischer Form erteilt.<br />
So wird nach § 8 Abs. 1 HGB n.F. das Handelsregister ab 1.1.2007 bun-<br />
desweit elektronisch geführt, zuständig für die Führung bleiben die Amts-<br />
gerichte.<br />
Mit <strong>der</strong> Einführung von § 8b HGB wurde zusätzlich zum Handelsregister<br />
ein zentrales Unternehmensregister geschaffen. Damit ist entsprechend<br />
den Vorgaben <strong>der</strong> EU-Publizitäts-Richtlinie 2003/58/EG vom 15.7.2003<br />
zur Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> 1. gesellschaftsrechtlichen Richtlinie und Teilen <strong>der</strong> EU-<br />
Transparenz-Richtlinie 2004/109/EG vom 15.12.2004 und basierend auf<br />
einem entsprechenden Vorschlag <strong>der</strong> Regierungskommission Corporate<br />
Governance sichergestellt, dass alle publikationspflichtigen Daten über<br />
ein Unternehmen zentral und elektronisch abrufbar sind. Das Unterneh-<br />
mensregister führt die bislang in verschiedenen Datenquellen enthaltenen<br />
Unternehmensdaten aus dem Handelsregister, dem Bundesanzeiger und<br />
an<strong>der</strong>en Datenquellen in einem einheitlichen Zugangsportal zusammen.<br />
In das Unternehmensregister werden gem. § 8b Nr. 1-3 HGB n.F. alle Ein-<br />
tragungen <strong>im</strong> Handelsregister, Genossenschaftsregister und Partner-<br />
schaftsregister und <strong>der</strong>en Bekanntmachungen eingetragen, außerdem<br />
122
Unterlagen <strong>der</strong> Rechnungslegung, gesellschaftsrechtliche Bekanntma-<br />
chungen <strong>im</strong> Bundesanzeiger, Mitteilungen aus dem Aktionärsforum nach<br />
§ 127a AktG sowie kapitalmarktrechtliche Veröffentlichungen nach dem<br />
WpHG, dem WpÜG, <strong>der</strong> Börsenzulassungsverordnung, dem Investment-<br />
gesetz und § 9 InsO. Zum Mindestinhalt des Unternehmensregisters ge-<br />
hören auch die Ad-hoc-Mitteilungen börsennotierter Unternehmen.<br />
§ 10 HGB n.F. regelt die Bekanntmachung <strong>der</strong> Eintragung <strong>im</strong> Handelsre-<br />
gister. Nach § 10 Satz 1 HGB n.F. sind die Bekanntmachungen vom Ge-<br />
richt in dem von <strong>der</strong> Landesjustizverwaltung best<strong>im</strong>mten elektronischen<br />
Informations- und Kommunikationssystem zu bewirken. Die Bundeslän<strong>der</strong><br />
nehmen die Veröffentlichung <strong>der</strong> Handelsregisterdaten auf <strong>der</strong> Internet-<br />
seite www.handelsregister.de vor, die auch über<br />
www.unternehmensregister.de erreicht werden kann.<br />
Bekanntmachungen, zu denen GmbH und AG verpflichtet sind, sind nach<br />
§ 12 GmbHG, § 25 AktG <strong>im</strong> elektronischen Bundesanzeiger zu veröffent-<br />
lichen.<br />
Die Anmeldung muss nach § 12 Abs. 1 HGB n. F. in elektronischer Form<br />
erfolgen. Das Gutachten <strong>der</strong> IHK soll nach § 23 Satz 4 HRV n. F. elektro-<br />
nisch eingeholt und übermittelt werden.<br />
Nach § 325 HGB n. F. sind die gesetzlichen Vertreter sämtlicher Kapital-<br />
gesellschaften verpflichtet, den Jahres- o<strong>der</strong> Konzernabschluss be<strong>im</strong><br />
Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch einzureichen.<br />
Ab 2007 sind damit ca. 1 Mio. Unternehmen verpflichtet, ihre Abschlüsse<br />
elektronisch fristgerecht für je<strong>der</strong>mann zur Verfügung zu stellen.<br />
Wer Handelsregisterdaten eines deutschen Unternehmens benötigt, muss<br />
nicht überlegen, welches län<strong>der</strong>spezifische Portal er verwenden muss, die<br />
Auskünfte werden bundesweit über http://www.justiz.de/ erteilt.<br />
In Baden-Württemberg hat die Grundbuchdatenzentrale ihren Echtbetrieb<br />
aufgenommen. Seit 28. April 2004 können Grundbuchdaten online einge-<br />
sehen und abgerufen werden. Großkunden wie z.B. Banken o<strong>der</strong><br />
Bausparkassen können nach Erteilung einer Zulassung Grundbuchdaten<br />
selbst per Fernabfrage abrufen.<br />
123
Das Mahnverfahren wird seit vielen Jahren erfolgreich elektronisch ge-<br />
führt.<br />
1.4.6 Datenabgleich zwischen Finanz- und Sozialbehörden<br />
Der elektronische Datenabgleich zwischen Finanz- und Sozialbehörden<br />
ermöglicht es, Angaben von Antragstellern auf best<strong>im</strong>mte Sozialleistun-<br />
gen auf Unst<strong>im</strong>migkeiten zu überprüfen. Hierdurch werden in einer Viel-<br />
zahl von Fällen Sachverhalte aufgedeckt, die den Anfangsverdacht einer<br />
Straftat, etwa des Betruges gemäß § 263 StGB, begründen. Die von den<br />
verschiedenen Ämtern eingeschalteten Staatsanwaltschaften erhalten die<br />
Erkenntnisse in elektronischer Form.<br />
1.4.7 Mauterfassungssystem<br />
Die von dem satelliten- und mobilfunkgestützten Mauterfassungssystem<br />
erhobenen Daten über die Mautentrichtung werden gespeichert und dem<br />
zuständigen Bundesamt für den Güterverkehr in Köln zur Verfügung ge-<br />
stellt.<br />
1.4.8 Finanzverwaltung<br />
Im elektronischen Rechtsverkehr mit <strong>der</strong> Finanzverwaltung werden über<br />
das Kommunikationsprogramm Elster jährlich bereits ca. 3,5 Mio. Steuer-<br />
erklärungen abgegeben.<br />
1.4.9 Digitale Daten <strong>im</strong> Strafrecht<br />
Bereits heute fallen in <strong>Strafverfahren</strong> digitale Daten in großem Umfang an,<br />
die noch nicht sinnvoll eingesetzt werden können, son<strong>der</strong>n mit hohem<br />
Aufwand doppelt produziert werden. So werden z.B. Anzeigen mehrfach<br />
erfasst, digitale erstellte Vernehmungen zumindest in Teilen neu ge-<br />
schrieben, da die digitalen Daten nicht weitergegeben werden (können).<br />
Dokumente, Auswertungen, in Ermittlungsakten enthaltene Dokumentati-<br />
onen, einzelne Ermittlungsergebnisse o<strong>der</strong> Beweismittel, werden - obwohl<br />
digital produziert – erneut bearbeitet.<br />
Als Beispiel seien Urheberrechtsverletzungen angeführt: die kompletten<br />
Daten <strong>der</strong> Tat und des Tatherganges werden digital in <strong>der</strong> Anzeige auf<br />
Datenträger mitgeteilt: IP – Nummer, Zeitraum, Daten raubkopierter Files<br />
124
etc., müssen jedoch neu in weitere Formulare, Schreiben u. a. eingetra-<br />
gen werden.<br />
1.5 Rechtsgrundlagen <strong>der</strong> digitalen Buchführung<br />
In einer Großzahl von (Wirtschafts-)<strong>Strafverfahren</strong> spielen die Daten <strong>der</strong><br />
digitalen Buchführung eine entscheidende Rolle. Steuerhinterziehung, Un-<br />
treue, Betrug, Unterschlagung, Buchführungs- und Bilanzdelikate sowie<br />
Insolvenzdelikte können meist nur mit Hilfe <strong>der</strong> digitalen Buchführung auf-<br />
geklärt werden. Zur Durchführung <strong>der</strong> Vermögensabschöpfung sind häu-<br />
fig ebenfalls elektronische Buchführungsdaten erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Nach <strong>der</strong> neuen (<strong>der</strong>zeitigen) Rechtslage sind Unternehmen verpflichtet,<br />
ihre steuerrelevanten Daten maschinell auswertbar zur Verfügung zu stel-<br />
len, sofern ihr Rechnungswesen elektronisch geführt wird. Dies gilt inzwi-<br />
schen für die überwiegende Mehrzahl <strong>der</strong> Betriebe. Diese steuerrelevan-<br />
ten Daten umfassen die gesamte Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuch-<br />
haltung und die Lohnbuchhaltung, all die Daten, die auch bei <strong>der</strong> Be-<br />
triebsprüfung und bei <strong>der</strong> Ermittlung von Wirtschaftsdelikten von Bedeu-<br />
tung sind. Im Einzelnen:<br />
1.5.1 Handelsrecht<br />
In den §§ 239 Abs. 4, 257 Abs. 3 HGB; §§ 146 Abs. 5, 147 Abs. 2 u. 5<br />
AO sind digitale Daten vorausgesetzt. Grundsätze ordnungsmäßiger DV-<br />
gestützter Buchführungssysteme (GoBS) sind in einem Schreiben des<br />
<strong>Bundesministerium</strong>s <strong>der</strong> Finanzen an die obersten Finanzbehörden <strong>der</strong><br />
Län<strong>der</strong> vom 7. November 1995 präzisiert.<br />
Danach können die nach steuerlichen Vorschriften zu führenden Bücher<br />
und sonst erfor<strong>der</strong>lichen Aufzeichnungen nach § 146 Abs. 5 <strong>der</strong> Abga-<br />
benordnung auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Form <strong>der</strong><br />
Buchführung einschließlich des dabei angewandten Verfahrens den<br />
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) entspricht. Als Daten-<br />
träger kommen neben den Bildträgern insbeson<strong>der</strong>e auch die maschinell<br />
lesbaren Datenträger (z.B. USB - Stick, Magnetband, Magnetplatte, e-<br />
lektro-optische Speicherplatte) in Betracht.<br />
125
Die Ordnungsmäßigkeit einer DV-gestützten Buchführung ist grundsätz-<br />
lich nach den gleichen Prinzipien zu beurteilen wie die einer manuell er-<br />
stellten Buchführung<br />
1.5.2 Abgabenordnung<br />
Für die Anwendung <strong>der</strong> Regelungen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit<br />
digitaler Unterlagen in den §§ 146 Abs. 5 S. 3, 147 Abs. 2 Nr. 2 und Abs.<br />
6, 200 Abs. 1 AO hat das <strong>Bundesministerium</strong> <strong>der</strong> Finanzen die Grundsät-<br />
ze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) er-<br />
lassen.<br />
Wesentliche Grundzüge <strong>der</strong> Archivierung sind:<br />
Originalzustand je<strong>der</strong>zeit erkennbar<br />
Je<strong>der</strong>zeitige Wie<strong>der</strong>herstellung und Lesbarmachung<br />
Ausschluss von Manipulationsmöglichkeiten<br />
Einsatz von Datenträgern, die Än<strong>der</strong>ungen nicht zulassen<br />
Gesamtes DV-System muss sicherstellen, dass keine Än<strong>der</strong>ungen mög-<br />
lich sind.<br />
Bei Konvertierung in ein unternehmenseigenes Format muss eine Archi-<br />
vierung bei<strong>der</strong> Formate mit einheitlichem Index erfolgen.<br />
Protokollierung bei Bearbeitung relevanter Unterlagen.<br />
Seit <strong>der</strong> Einführung dieser Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbar-<br />
keit digitaler Unterlagen am 1. Januar 2002 ist es den Finanzbehörden in<br />
Deutschland gestattet, mittels elektronischem Datenzugriff auf mit DV-<br />
Systemen erstellte Buchführungen zuzugreifen (vgl. Nr. V 1.5.4).<br />
1.5.3 Zum Ort (und Aufbewahrungsort) <strong>der</strong> Buchführung<br />
Das Handelsrecht kennt hierzu keine Normen, es gelten die Grundsätze<br />
ordnungsmäßiger Buchführung, also §§ 238ff HGB. Die Verlagerung in<br />
das Ausland ist zulässig, weshalb Unternehmen Teile <strong>der</strong> Buchführungs-<br />
verarbeitung bereits in das Ausland verlagert haben.<br />
126
Steuerrechtlich sind nach § 146 Abs. 2 Satz 1 AO die Bücher <strong>im</strong> Inland zu<br />
führen und aufzubewahren.Nach § 147 Abs. 2 Nr. 2 AO muss „<br />
...sichergestellt sein, dass die<br />
Wie<strong>der</strong>gabe o<strong>der</strong> die Daten während <strong>der</strong> Dauer <strong>der</strong> Aufbewahrungsfrist<br />
je<strong>der</strong>zeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und maschinell<br />
ausgewertet werden können“.<br />
1.5.4 Zugriffsrecht <strong>der</strong> Finanzverwaltung<br />
Sind Buchhaltungsunterlagen mit Hilfe eines DV-Systems erstellt worden,<br />
hat die Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6 AO das Recht, Einsicht in die<br />
gespeicherten Daten zu nehmen und das DV-System zur Prüfung dieser<br />
Unterlagen zu nutzen. Sie kann auch verlangen, dass die Daten nach ih-<br />
ren Vorgaben maschinell ausgewertet werden o<strong>der</strong> ihr die gespeicherten<br />
Daten auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung ge-<br />
stellt werden.<br />
Der „unmittelbare Datenzugriff“ beinhaltet den Nur-Lesezugriff auf DV-<br />
Systeme durch den Prüfer zur Prüfung <strong>der</strong> Buchhaltungsdaten, Stammda-<br />
ten und Verknüpfungen (beispielsweise zwischen den Tabellen einer rela-<br />
tionalen Datenbank). Darunter fällt auch die Nutzung vorhandener Aus-<br />
wertungsprogramme des betrieblichen DV-Systems zwecks Filterung und<br />
Sortierung <strong>der</strong> steuerlich relevanten Daten.<br />
Be<strong>im</strong> „mittelbaren Datenzugriff“ müssen die steuerlich relevanten Daten<br />
entsprechend den Vorgaben des Prüfers vom Unternehmen o<strong>der</strong> einem<br />
beauftragten Dritten maschinell ausgewertet werden, um anschließend<br />
einen Nur-Lesezugriff durchführen zu können. Verlangt werden darf aber<br />
nur eine maschinelle Auswertung mit den <strong>im</strong> DV-System vorhandenen<br />
Auswertungsmöglichkeiten. Die Kosten <strong>der</strong> maschinellen Auswertung hat<br />
das Unternehmen zu tragen. Darüber hinaus sind die Unternehmen zur<br />
Unterstützung des Prüfers durch mit dem DV-System vertraute Personen<br />
verpflichtet.<br />
Bei <strong>der</strong> „Datenträgerüberlassung“ (Maschinelle Auswertung <strong>der</strong> überlas-<br />
senen Daten, i. d. R. auf CD-ROM bzw. DVD, mit <strong>der</strong> Prüfsoftware IDEA)<br />
sind <strong>der</strong> Finanzbehörde mit den gespeicherten Unterlagen und Aufzeich-<br />
nungen alle zur Auswertung <strong>der</strong> Daten notwendigen Informationen (z.B.<br />
über die Dateistruktur, die Datenfel<strong>der</strong> sowie interne und externe Ver-<br />
127
knüpfungen) in maschinell auswertbarer Form zur Verfügung zu stellen.<br />
Dies gilt auch in den Fällen, in denen sich die Daten bei Dritten befinden.<br />
Zu dem Terminus „steuerlich relevante Daten“ gibt es keine allgemein<br />
gültige Definition. „Steuerlich relevant“ sind Daten <strong>im</strong>mer dann, wenn sie<br />
für die Besteuerung des Steuerpflichtigen von Bedeutung sein können.<br />
Nach den GDPdU ist es Aufgabe des Steuerpflichtigen, die steuerrelevan-<br />
ten Daten von den an<strong>der</strong>en abzugrenzen. Er wird sich dabei auch an da-<br />
tenschutzrechtlichen bzw. beson<strong>der</strong>en berufsspezifischen Gesichtspunk-<br />
ten orientieren müssen. Gibt es über diese Abgrenzung Meinungsver-<br />
schiedenheiten zwischen Steuerpflichtigen und Steuerprüfer, ist <strong>im</strong> Einzel-<br />
fall zu entscheiden, welche Folgerungen zu ziehen sind. Unberührt blei-<br />
ben die bestehenden Regelungen zur Vorlage einer umfassenden Verfah-<br />
rensdokumentation (§ 147 Abs. 1 AO, GoBS), wonach <strong>der</strong> Prüfer in <strong>der</strong><br />
Lage sein muss, sich innerhalb angemessener Zeit einen vollständigen<br />
Systemüberblick zu verschaffen. Dazu gehört auch ein Überblick über die<br />
<strong>im</strong> DV-System insgesamt vorhanden Informationen (zum Beispiel Reports<br />
und Tabellen).<br />
Steuerlich relevante Daten sind danach insbeson<strong>der</strong>e Finanzbuchhaltung,<br />
Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und Nebenbuchhaltung. Kosten-<br />
stellen kommt <strong>im</strong> Hinblick auf den Datenzugriff beson<strong>der</strong>e Bedeutung zu.<br />
Sie unterliegen dem Zugriff <strong>der</strong> Finanzverwaltung, soweit sie steuerlich re-<br />
levant sind, zum Beispiel zur Bewertung von Wirtschaftsgütern. Kosten-<br />
stellen, die Beteiligungen o<strong>der</strong> Bewertungen von Vermögensgegenstän-<br />
den o<strong>der</strong> Rückstellungen zum Gegenstand haben, sind ebenso aufbe-<br />
wahrungs- und vorlagepflichtig wie solche, die Grundlagen für die Bemes-<br />
sung von Verrechnungspreisen enthalten.<br />
<strong>Elektronische</strong> Registrierkassen sind Bestandteil des DV-Systems <strong>im</strong> Sin-<br />
ne des § 147 Abs. 6 AO. Bei den in <strong>der</strong> Registrierkasse gespeicherten<br />
Daten handelt es sich deshalb um Daten, die dem Einsichtsrecht nach<br />
dieser Vorschrift unterliegen.<br />
"Mithilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt" <strong>im</strong> Sinne des § 167<br />
Abs. 6 Satz 1 AO sind auch solche Unterlagen gem. § 147 Abs. 1 AO, die<br />
<strong>der</strong> Steuerpflichtige für eine papierlose Buchführung eingescannt hat. Ma-<br />
128
schinell auswertbar <strong>im</strong> Rahmen des Datenzugriffes gem. § 147 Abs. 6<br />
Satz 1 AO sind auch Unterlagen, die nicht mathematisch sortiert und gefil-<br />
tert werden können.<br />
Der Prüfer hat auch über das firmeninterne Intranet Zugriff auf aufbewah-<br />
rungspflichtige, digitalisierte Unterlagen. Die erfor<strong>der</strong>liche Verfahrensdo-<br />
kumentation umfasst auch die Daten des Intranets.<br />
1.5.5 Digitale („papierlose“) Unterlagen<br />
Dem Zugriff <strong>der</strong> Prüfer und auch <strong>der</strong> Ermittler in Steuerstrafverfahren bzw.<br />
bei normalen Kr<strong>im</strong>inaldelikten unterliegen sämtliche originäre digitale Un-<br />
terlagen. Hierbei handelt es sich um alle in das DV-System in elektroni-<br />
scher Form eingehenden und die <strong>im</strong> DV-System erzeugten Daten.<br />
Die Betriebsprüfer haben keinen Zugriff auf die digitalen Unterlagen, die<br />
nicht zur Weiterverarbeitung in einem DV-gestützten Buchführungssystem<br />
geeignet sind (z.B. Textdokumente). Einen solchen Zugriff haben jedoch<br />
die Ermittler in normalen Kr<strong>im</strong>inalfällen.<br />
Maschinelle Auswertung bedeutet den Zugriff auf alle gespeicherten Da-<br />
ten (einschließlich <strong>der</strong> Stammdaten und Verknüpfungen) mit Sortier und<br />
Filterfunktionen. Im Einzelnen: Handelsbücher (Konten, Offene-Posten-<br />
Listen, Warenwirtschaftssysteme, Personalbuchhaltung, z.B. zu <strong>der</strong> Fra-<br />
ge, bei welchem Mitarbeiter an fraglichen Tatzeiten Fehlzeiten hinterlegt<br />
waren).<br />
Zu den sonstigen papierlosen Unterlagen gehören auch die E-Mails und<br />
die in den Dokumenten-Management-Systemen (DMS) abgelegten Unter-<br />
lagen.<br />
Sofern <strong>der</strong> Inhalt von E-Mails für die Besteuerung von Bedeutung ist (z.B.<br />
E-Mail mit Excel-Tabelle als Anhang), besteht Aufbewahrungspflicht gem.<br />
§ 147 AO sowie gem. § 257 HGB, wenn die E-Mail einen Buchungsbeleg<br />
o<strong>der</strong> Handelsbrief darstellt. Hierbei handelt es sich bei den E-Mails um o-<br />
riginär digitale Dokumente. Die E-Mails sind mit einem unverän<strong>der</strong>lichen<br />
Index zu versehen und aufzubewahren<br />
129
Für die maschinelle Auswertung ist es unerheblich, ob die Daten automa-<br />
tisch Eingang in die Buchführung finden o<strong>der</strong> Importfunktionen zur Daten-<br />
übernahme vorhanden sind (z.B. E-Mail mit steuerlich relevanter Ver-<br />
tragsgestaltung).<br />
2. Teil: Modellhafte Darstellung des Ablaufs eines <strong>Strafverfahren</strong>s mittels<br />
einer elektronischen <strong>Akte</strong>.<br />
Folgende Schritte sollen den möglichen Ablauf eines größeren <strong>Strafverfahren</strong>s<br />
unter Einsatz einer elektronischen <strong>Akte</strong> aufzeigen. Es kann sich allerdings nur<br />
um die rud<strong>im</strong>entäre Darstellung eines „workflow“ handeln.<br />
2. Ermittlungsverfahren<br />
2.1 Eingang <strong>der</strong> Strafanzeige<br />
In einem großen Ermittlungsverfahren gehen Strafanzeigen in sehr unter-<br />
schiedlicher Form – auch zeitlich gestaffelt - bei den verschiedenen Straf-<br />
verfolgungsorganen ein:<br />
Eingang bei <strong>der</strong> Polizei<br />
Bei <strong>der</strong> Polizei wird die mündlich vorgetragene Anzeige elektronisch er-<br />
fasst. Die Grunddaten – Anzeigenerstatter, Verdächtiger, Tat, Tatzeit etc.<br />
werden in den Stammdatensatz aufgenommen, ein polizeiliches <strong>Akte</strong>n-<br />
zeichen wird vergeben. Eine elektronische Verfahrensakte wird damit be-<br />
reits bei <strong>der</strong> Polizei angelegt. Die Sachverhaltsdarstellung wird digital pro-<br />
tokolliert, die Datei wird in die elektronische <strong>Akte</strong> eingefügt. Die körperlich<br />
übergebenen schriftlichen Beweismittel werden so vorbereitet - Entfernen<br />
von Klammern, Prüfung auf Vollständigkeit usw. – dass sie mit dem Er-<br />
fassungsgerät gescannt und digital in <strong>der</strong> elektronischen Strafakte in ein<br />
elektronisch geführtes Beweismittelheft überführt werden. Die Dokumen-<br />
te liegen damit als Bilddateien vor. Hintergrundfarben, Wasserzeichen<br />
usw. bleiben erhalten.<br />
Die schriftlich eingereichte Anzeige wird ebenfalls eingescannt und <strong>der</strong><br />
elektronischen <strong>Akte</strong> angeschlossen.<br />
130
Die Originale werden be<strong>im</strong> Scannen nach einem einheitlichen System<br />
(vgl. Archivierung von Papierunterlagen) auf folgende Weise mit einem<br />
Barcode versehen:<br />
Mit <strong>der</strong> verwendeten Software können die für die Verwaltung <strong>der</strong> Unterla-<br />
gen erfor<strong>der</strong>lichen Angaben wie <strong>Akte</strong>nzeichen, Beschuldigtennamen, An-<br />
zeigeerstatter o. ä. und Ablageort als Meta-Information in frei definierbare<br />
Verschlagwortungsmasken hinterlegt werden. Mit Hilfe <strong>der</strong> Software wer-<br />
den aus diesen digitalen Daten Barcodes (barcodierte Dokumentenauf-<br />
kleber) zur eindeutigen Identifizierung erstellt. Der Barcode wird mit ein-<br />
gescannt. Für die Dokumentenrecherche übersetzt das BARCODE-Modul<br />
<strong>der</strong> jeweiligen Software die erkannten Strichcodes in Verschlagwortungs-<br />
informationen wie z.B. Ablageort. Dies ermöglicht den späteren Zugriff in<br />
<strong>der</strong> Registratur.<br />
Anschließend erfolgt die Ablage <strong>im</strong> Archiv; sofern das Original an die<br />
Staatsanwaltschaft übermittelt werden muss, hat eine geson<strong>der</strong>te<br />
Versendung zu erfolgen (eine Unterscheidung könnte z.B. nach UJs bzw.<br />
Js-Verfahren erfolgen).<br />
Bei umfangreicheren Verfahren muss sichergestellt sein, dass weitere O-<br />
riginalunterlagen, die <strong>im</strong> Laufe des Verfahrens eingehen, ebenfalls ein-<br />
gescannt, mit einem Barcode versehen und sodann mit den bisherigen<br />
Unterlagen in <strong>der</strong> Original-Beleg-<strong>Akte</strong> gesammelt werden, damit später<br />
auf sie zugegriffen werden kann.<br />
Die elektronisch eingegangene Anzeige wird in <strong>der</strong> elektronischen polizei-<br />
lichen <strong>Akte</strong> des Falles archiviert.<br />
Nachdem die Anzeigen bei <strong>der</strong> Polizei digital erfasst worden sind, hat die-<br />
se die Staatsanwaltschaft ohne Verzug zu unterrichten (§ 163 StPO). Die<br />
Anzeige wird hierzu in elektronischer Form an die Staatsanwaltschaft ü-<br />
bermittelt. Auf das Erfassungs- und Übermittlungssystem ComVor wird an<br />
an<strong>der</strong>er Stelle eingegangen. Bei <strong>der</strong> Polizei Baden-Württemberg wird das<br />
System seit 29. Mai 2007 sukzessive eingeführt.<br />
131
Sichergestellte körperliche Beweismittel werden mit Begleitschreiben <strong>der</strong><br />
StA übermittelt, die entsprechenden Unterlagen sind bereits digitalisiert<br />
und wurden mit dem Anzeigevorgang <strong>der</strong> StA zugeleitet.<br />
Eingang bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
Die elektronisch von <strong>der</strong> Polizei übermittelten Anzeigen werden in <strong>der</strong><br />
staatsanwaltschaftlichen Vorgangsverwaltung direkt erfasst.<br />
Von den bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft in Papierform eingehenden Privatan-<br />
zeigen bzw. Anzeigen von Rechtsanwälten werden die Stammdaten e-<br />
benfalls in <strong>der</strong> staatsanwaltschaftlichen Vorgangsverwaltung digital er-<br />
fasst. Die Originalunterlagen müssen durch Scannen digitalisiert und an-<br />
schließend mit Hilfe des Barcode-Systems abgelegt werden. Die Stamm-<br />
daten stellen die Grundlage <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> dar, aufbauend hier-<br />
auf werden <strong>im</strong> elektronischen Archiv Ordner mit den erfor<strong>der</strong>lichen Unter-<br />
ordnern angelegt, in welche die Verfahrensunterlagen aufgenommen<br />
werden; zur Anlage <strong>der</strong> Ordner vgl. 5. unten.<br />
Die bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft digital eingehenden Anzeigen und die den<br />
Anzeigen angeschlossenen digitalen Dokumente/Beweismittel werden in<br />
die elektronische <strong>Akte</strong> direkt übernommen.<br />
Sind die Voraussetzungen geschaffen (X<strong>Justiz</strong>.Straf), so kommt auch ei-<br />
ne automatisierte Übergabe und Übernahme in Betracht: Der Anzeigeer-<br />
statter/Rechtsanwalt übermittelt seine Anzeige in einem elektronischen<br />
Format an die Staatsanwaltschaft, das von <strong>der</strong> dort installierten Fachan-<br />
wendung (Vorgangsverwaltung) verstanden wird. Daten wie Name und<br />
Anschrift des Anzeigeerstatters sowie seines Anwaltes, ferner die Daten<br />
des Tatverdächtigen, können hierdurch automatisch per Mausklick in die<br />
staatsanwaltschaftliche <strong>Akte</strong>nverwaltungssoftware übernommen werden.<br />
Zuweisung an den Dezernenten<br />
Nach Registrierung wird die Anzeige von <strong>der</strong> Datenerfassungsstelle als<br />
elektronische <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Archiv elektronisch abgespeichert, <strong>der</strong> zuständige<br />
Abteilungsleiter wird über das Intranet von dem Eingang <strong>der</strong> Anzeige, de-<br />
132
en Registrierung bzw. <strong>der</strong> Ablage <strong>im</strong> elektronischen Archiv unterrichtet.<br />
Er kann nach Aufruf <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> auf dem Bildschirm das<br />
Stammdatenblatt, die eigentliche Anzeige sowie eine erste Vernehmung<br />
des Anzeigeerstatters lesen. Auf einem zweiten Bildschirm hat er die<br />
Möglichkeit, auf an<strong>der</strong>e Dateien – gegebenenfalls über das Internet - zu-<br />
zugreifen. Ein vorheriges Schließen <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> – d.h. <strong>der</strong> geöffneten Datei -<br />
wäre zu aufwändig und vom Zeitaufwand her nicht zu rechtfertigen. Der<br />
Abteilungsleiter kann nun die Zuständigkeit <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft bzw.<br />
seiner Abteilung prüfen, das Verfahren mit einem geson<strong>der</strong>ten Vermerk<br />
dem zuständigen Dezernenten zuweisen, dies in <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
vermerken und den Vermerk an die Geschäftstelle zurückleiten. Diese<br />
veranlasst den Eintrag des Dezernats in das elektronische Register und<br />
holt gegebenenfalls weitere Einkünfte (VV, Mel<strong>der</strong>egister) ein.<br />
Die Geschäftsstelle leitet das Verfahren dem Dezernenten zu, <strong>der</strong> sich<br />
unter dem angegebenen <strong>Akte</strong>nzeichen mit seinem Zugangscode die <strong>Akte</strong><br />
<strong>im</strong> elektronischen Archiv holt und mit <strong>der</strong> Bearbeitung <strong>der</strong> Anzeige be-<br />
ginnt.<br />
2.1.2 Einleitungsvermerk <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
Der Staatsanwalt wertet den Anzeigevorgang aus und fertigt, zumindest in<br />
großen Verfahren, einen Einleitungsvermerk, in welchem er<br />
• den Anfangsverdacht hinsichtlich best<strong>im</strong>mter Sachverhalte<br />
• die entsprechenden Strafnormen und ihre Tatbestandselemente<br />
• die jeweils konkret Verdächtigen sowie<br />
• seine Zuständigkeit (Nr. 26 RiStBV),<br />
schriftlich festhält. Dies erfolgt in einem digitalen Vermerk, <strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
elektronischen <strong>Akte</strong> abgelegt wird.<br />
2.1.3 Vorermittlungen zur Prüfung des Anfangsverdachts<br />
Kann aufgrund <strong>der</strong> Angaben in <strong>der</strong> Anzeige o<strong>der</strong> wenn diese anonym er-<br />
stattet worden ist, ein Anfangsverdacht noch nicht bejaht werden, kom-<br />
men zunächst Vorermittlungen in Betracht. Auf elektronischem Weg kön-<br />
nen z.B. Registerauszüge beschafft o<strong>der</strong> Anfragen bei <strong>der</strong> BaFin durchge-<br />
führt werden, <strong>der</strong>en Ergebnis in einen Unterordner eingestellt werden.<br />
133
Auch das Internet bietet sich als digitales Suchportal an, neben dem be-<br />
kannten „google“ z.B. mit folgenden Auswertungsprogrammen:<br />
Copernic 2001:<br />
Metasuchmaschine, Browser<br />
Info: http://www.copernic.com<br />
WebSite-Watcher:<br />
Der WSW prüft und überwacht eine beliebige Anzahl von Web-Seiten auf<br />
up dates und Än<strong>der</strong>ungen<br />
Info: http://aignes.com/de/<br />
Visual-Route<br />
Tool zur Best<strong>im</strong>mung des Servers incl. Integrierter Who-is-Abfragen<br />
Info: http://www.webhits.de/visualroute/<br />
HTTrack<br />
Programm zum Herunterladen von Internet - Seiten, die anschließend<br />
off-line gesichtet werden können.<br />
Info: http://www.httrack.com/page0.php<br />
2.1.4 Ermittlungsauftrag<br />
Nach Bejahung des Anfangsverdachts ist <strong>der</strong> Polizei – zumindest in<br />
Großverfahren - ein Ermittlungsauftrag zu erteilen. Dieser wird – bislang<br />
auch – über eine gesicherte Internetverbindung übermittelt.<br />
Der Ermittlungsauftrag richtet sich nach einer - in <strong>der</strong> Regel mit <strong>der</strong> Poli-<br />
zei abgest<strong>im</strong>mten - Ermittlungskonzeption, die <strong>im</strong> Wesentlichen folgende<br />
Punkte enthält:<br />
• zu ermittelnde Sachverhalte und <strong>der</strong>en rechtliche Bewertung,<br />
• Ermittlungsschritte,<br />
• Teilnahme des Staatsanwalts an Ermittlungen erfor<strong>der</strong>lich<br />
(Nr. 3 RiStBV: Vernehmungen, Durchsuchungen),<br />
• einzusetzende Personalressourcen,<br />
• beson<strong>der</strong>er Personalbedarf (z.B. zur Sicherung elektronischer Daten),<br />
• Vermögensabschöpfung,<br />
• Verwendung von Fragenkatalogen,<br />
• Beauftragung von externen/internen Sachverständigen,<br />
• Einsatz von Auswertungsprogrammen wie IDEA u.a.,<br />
134
• Zusammenarbeit mit Fachbehörden wie Rentenversicherungsträger<br />
u.a.,<br />
• Einbindung europäischer Institutionen wie OLAF, Eurojust u.a.,<br />
• zeitlicher Rahmen für die einzelnen Ermittlungsschritte,<br />
• Erfahrungen mit „Vorläufer“ – Verfahren,<br />
• Lagerraum erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Die hierfür erfor<strong>der</strong>lichen Ausarbeitungen werden digital erstellt.<br />
Dienstinterne Planungen werden in einen <strong>der</strong> herkömmlichen „Handakte“<br />
entsprechenden elektronischen Ordner eingestellt, <strong>der</strong> mit einem beson-<br />
<strong>der</strong>en Kennzeichen zu versehen ist, jedoch dem Hauptordner <strong>der</strong> elektro-<br />
nischen Verfahrensakte zugeordnet ist.<br />
Auch bei einer elektronischen <strong>Akte</strong> ist mit dem Ermittlungsauftrag bereits<br />
ein <strong>Akte</strong>nplan zu erstellen, damit während <strong>der</strong> Ermittlungen die entspre-<br />
chenden Unterlagen an <strong>der</strong> richtigen Stelle abgelegt werden und später<br />
zu finden sind.<br />
Der <strong>Akte</strong>naufbau (<strong>Akte</strong>nplan) wird ebenfalls <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Ermittlungs-<br />
konzeption erstellt. Die technische Gestaltung bzw. Vorgehensweise bei<br />
<strong>der</strong> Anlage <strong>der</strong> elektronischen Ermittlungsakte richtet sich nach dem an-<br />
gewandten Programm (Paperport, ELO, Normfall, Baumstruktur – vgl.<br />
nachstehend Nr. 2.1.5).<br />
Die Ermittlungsakten umfassen die Verfahrensakten und die Fallakten mit<br />
den Beweismittelordnern, die dem Gericht vorgelegt werden. Den Ord-<br />
nern ist – auch bei <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> - jeweils ein Inhaltsverzeichnis<br />
voranzustellen.<br />
Innerhalb <strong>der</strong> Verfahrensakten sind geson<strong>der</strong>te Ordner zu erstellen für<br />
• Verfahrenskosten<br />
• Vermögenszugriffe/Finanzermittlungen<br />
• Haftordner<br />
• Rechtshilfe<br />
• Protokolle von Telefonüberwachungen<br />
• Postüberwachung<br />
135
• Sachverständigengutachten.<br />
Beweismittelordner enthalten<br />
• eingescannte Kopien <strong>der</strong> beweisrelevanten Schriftstücke aus den<br />
Asservaten, geordnet nach Tatvorwürfen; die Fundstellen <strong>der</strong><br />
Asservate sind anzugeben<br />
• digitale Kopien aus öffentlichen Registern,<br />
• Auskünfte an<strong>der</strong>er Behörden,<br />
• Vernehmungen,<br />
• Bankermittlungen nach Personen, Firmen und Konten getrennt.<br />
Beiakten<br />
Die von an<strong>der</strong>en Behörden beigezogenen <strong>Akte</strong>n werden digitalisiert und<br />
ebenfalls in geson<strong>der</strong>ten digitalen Ordnern abgelegt. Hierbei handelt es<br />
sich um<br />
• Sachakten aus an<strong>der</strong>en/früheren Verfahren,<br />
• Insolvenzakten<br />
• Handelsregisterakten,<br />
• <strong>Akte</strong>n aus Zivilverfahren,<br />
• <strong>Akte</strong>n <strong>der</strong> Auslän<strong>der</strong>behörden,<br />
• <strong>Akte</strong>n des Sozialamts,<br />
• <strong>Akte</strong>n <strong>der</strong> Zoll-, Steuer- o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er Behörden.<br />
Die <strong>im</strong> Lauf des Verfahrens erhobenen Originalbeweismittel gehören zu<br />
den geson<strong>der</strong>t aufzubewahrenden Asservaten, es sind lediglich die digita-<br />
lisierten Kopien zu den (digitalen) Ordnern mit den Fallakten zu nehmen.<br />
Gutachtensaufträge sind (ausschließlich) vom Staatsanwalt in schriftlicher<br />
Form zu erteilen und (möglichst digital) zu übermitteln. Sollte <strong>der</strong> Gutach-<br />
ter nicht in <strong>der</strong> Lage sein, in digitaler Weise Daten zu erhalten, ist <strong>der</strong> Auf-<br />
trag auszudrucken und dem Sachverständigen zuzuleiten.<br />
136
2.1.5 Anlage <strong>der</strong> Verfahrensordner<br />
Für die Führung eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens ist die über-<br />
sichtliche und gut zu handhabende <strong>Akte</strong> eine unabdingbare Vorausset-<br />
zung. Es gibt mehrere Systeme, die die Anlage solcher Verfahrensakten<br />
ermöglichen:<br />
Modell PaperPort<br />
Mit dem Programm PaperPort (www.paperport.de) kann man digitalisierte<br />
Dokumente in frei anlegbaren Ordnern und Unterordnern organisieren,<br />
durchsuchen und verteilen, Dokumentenseiten per Drag & Drop kombi-<br />
nierten entfernen und neu zusammenstellen<br />
Aus Anwendungen heraus o<strong>der</strong> aus vorhandenen Dateien sowie aus<br />
Webseiten kann man PDF-Dateien erstellen.Die einzelnen Dokumente<br />
kann man nacheinan<strong>der</strong> und seitenweise anschauen, ohne ein neues<br />
Fenster zu öffnen.<br />
Paperport durchsucht alle Microsoft Office Dokumente, PDF-Dateien und<br />
gescannte Dokumente nach einzelnen Stichwörtern.<br />
Suchmaske:<br />
Ferner können mit Anmerkungs-Tools Bereiche hervorgehoben werden<br />
ohne das Original-Dokument zu verän<strong>der</strong>n.<br />
137
Fallbearbeitung:Die als Beweismittel in Frage kommenden Unterlagen<br />
werden in einer Baumstruktur abgelegt<br />
Die in den Ordnern abgelegten digitalen Vernehmungen, Stellungnahmen<br />
und Schriftsätzen, Gutachten o<strong>der</strong> Beweismittel können systematisch<br />
ausgewertet werden:<br />
Die Vorgehensweise bei <strong>der</strong> Auswertung orientiert sich am bisherigen<br />
bewährten Vorgehen einer kontextbezogenen Auswertung, Beson<strong>der</strong>hei-<br />
ten eines Einzelfalles können berücksichtigt werden.<br />
138
Die gesamten Beweismittel und Ermittlungsakten stehen ortsunabhängig<br />
zur Verfügung, d.h., auch bei auswärtigen Vernehmungen kann unmittel-<br />
bar auf sie zurückgegriffen werden. Die Suche nach Schlagwörtern ist hilf-<br />
reich; bei <strong>der</strong> Fertigung von Kopien werden die Kosten verringert.<br />
Auch die an<strong>der</strong>en an einem großen Ermittlungsverfahren regelmäßig be-<br />
teiligten Behörden (Finanzverwaltung, Zoll, Rentenversicherungsträger)<br />
können durch die digitale Arbeitsweise den Verfahrensstoff rasch bearbei-<br />
ten und innerhalb ihrer Verwaltungen die Steuerbescheide bzw. die For-<br />
<strong>der</strong>ungsschreiben <strong>der</strong> Sozialversicherung fertigen.<br />
ELO<br />
Das Softwaresystem ELO - <strong>Elektronische</strong>r Leitz Ordner – ermöglicht das<br />
Archivieren von digitalen und Papier-Dokumenten. Word-, Excel- und an-<br />
<strong>der</strong>e PC-Dokumente können direkt in das ELO Archivsystem abgespei-<br />
chert werden. Ferner ist das Scannen und direkte Ablegen von Papierdo-<br />
kumenten in das ELO Archivsystem möglich. Eine Fax-Schnittstelle er-<br />
möglicht das Versenden abgelegter Dokumente ohne vorherigen Aus-<br />
druck Die archivierten Dokumente können je<strong>der</strong>zeit ausgedruckt werden.<br />
Die Register können selbst strukturiert und gewählt werden. Durch indivi-<br />
duelle Farbgebung (vom <strong>Akte</strong>nschrank bis zum Dokument) kann auch op-<br />
tisch Ordnung gehalten werden. Automatische Sortierfunktionen und die<br />
Zuweisung von Schlagworten für Dokumente erleichtern das Suchen und<br />
Finden. Kopier- und Verschiebemechanismen erlauben eine schnelle<br />
Umstrukturierung <strong>der</strong> abgelegten Dokumente.<br />
Das System hat eine Wie<strong>der</strong>vorlage-Funktion, Notizzettel können ohne<br />
Än<strong>der</strong>ung des Originaldokuments angebracht werden. Ferner hat das<br />
ELO System ein Postkorb-Modul mit umfangreichen Empfangs- und Ver-<br />
teilfunktionen.<br />
Bei ausreichen<strong>der</strong> Bildqualität kann ELO Office aus eingescannten Do-<br />
kumenten mittels OCR (optical character recognition) einen Text machen,<br />
also die vorkommenden Wörter erkennen und diese z.B. in eine Volltext-<br />
datenbank einfügen.<br />
139
Normfall<br />
Dieses System hat Prof. Dr. Haft <strong>der</strong> Kommission vorgestellt. Es ist be-<br />
reits unter IV 3.2.2 kurz beschrieben.<br />
Anlage einer digitalen <strong>Akte</strong> mit Betriebsprogramm<br />
Mit Hilfe von Windows lässt sich eine Baumstruktur entwickeln, mit wel-<br />
cher die erfor<strong>der</strong>lichen Ordner für die Aufbereitung <strong>der</strong> <strong>im</strong> Rahmen eines<br />
Ermittlungsverfahrens entstehenden Unterlagen erstellt werden können.<br />
Die einzelnen Verfahrensdokumente werden digitalisiert und in die Ordner<br />
in einer logischen Folge abgelegt. In dieser Form stehen sie für die<br />
Durchsicht, Auswertung o<strong>der</strong> Verlagerung zur Verfügung. Die Recherche<br />
in den digitalen Dokumenten ist möglich. Die Bearbeitungsmöglichkeiten,<br />
die für eine digitale <strong>Akte</strong> erfor<strong>der</strong>lich sind, können mit einer einfachen<br />
Baumstruktur jedoch nicht erreicht werden, da nur geringe technische<br />
Möglichkeiten zur weiteren Bearbeitung eröffnet. Aus diesem Grund sind<br />
professionelle Software-Lösungen vorzuziehen.<br />
2.1.6 Anlage einer Begleitakte<br />
Da in einem <strong>Strafverfahren</strong> Schriftstücke in Papierform anfallen, sollte ei-<br />
ne Begleitakte angelegt werden, in <strong>der</strong> die aktuell eingehenden Urkunden<br />
o<strong>der</strong> Bevollmächtigungen, die nach <strong>der</strong> Digitalisierung nicht direkt in das<br />
Archiv gehen, gesammelt werden können. In die Begleitakte können auch<br />
140
Datenträger gegeben werden, die solche umfangreichen Dateien enthal-<br />
ten, dass diese (noch nicht) über das Intranet o<strong>der</strong> das Internet versandt<br />
werden können. Sobald das System <strong>der</strong> vollständigen Barcode – Erfas-<br />
sung von Schriftstücken aus Papier etabliert ist, kann auf diese Begleitak-<br />
te verzichtet werden.<br />
2.1.7 Innerdienstliche Zwischenberichte und Verfahrensmanagement<br />
In Großverfahren sind zur regelmäßigen Unterrichtung des Staatsanwalts<br />
und zur Dokumentation des Verfahrensganges sowie zur Herbeiführung<br />
<strong>der</strong> verfahrensför<strong>der</strong>nden Entscheidungen schriftliche Zwischenberichte/-<br />
vermerke erfor<strong>der</strong>lich, die sich anhand einer elektronisch geführten <strong>Akte</strong><br />
effektiv erstellen lassen.<br />
Die hohen Anfor<strong>der</strong>ungen an die Ermittlungsarbeit erfor<strong>der</strong>n ein Verfah-<br />
rensmanagement/Verfahrenscontrolling. Bei den Ermittlungsbehörden ist<br />
deshalb für den internen Dienstgebrauch in elektronischer Form ein Ver-<br />
fahrensblatt anzulegen, in welches die grundlegenden Daten des Verfah-<br />
rens in einer Zeitschiene eingetragen werden, z. B.,<br />
• die erste gemeinsame Erörterung mit <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft,<br />
• <strong>der</strong> Eingang des Ermittlungsauftrages,<br />
• die Abarbeitung <strong>der</strong> einzelnen Schritte,<br />
• Gespräche mit dem Staatsanwalt über den weiteren Verfahrensgang.<br />
Bei Zeiten <strong>der</strong> Nichtbearbeitung ist zu festzuhalten, an welchem an<strong>der</strong>en<br />
Verfahren gearbeitet wurde.<br />
Das Verfahrenscontrolling dient dazu, einen permanenten Soll-Ist-<br />
Abgleich zwischen <strong>der</strong> Ermittlungskonzeption und den tatsächlichen Er-<br />
mittlungen vorzunehmen, um so Probleme o<strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Sachla-<br />
ge frühzeitig erkennen und gegebenenfalls die Ermittlungskonzeption er-<br />
gänzen zu können.<br />
141
2.1.8 Beantragung richterlicher Beschlüsse<br />
Zur Beweissicherung<br />
Die Beantragung richterlicher Beschlüsse zur Beweissicherung - Durch-<br />
suchungen (§§ 102 ff. StPO), Beschlagnahme (§§ 94 ff. StPO), Überwa-<br />
chung <strong>im</strong> Postverkehr (§ 99 StPO), Überwachung <strong>im</strong> Fernmeldeverkehr(<br />
§ 100 a StPO) o<strong>der</strong> körperliche Untersuchungen und Eingriffe (§§ 81 ff.<br />
StPO) - erfolgt ebenfalls digital. In den Beschlussanträgen wird auf den<br />
bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft vorhandenen Stammdatensatz zugegriffen, so<br />
dass nur <strong>der</strong> reine Antragstext neu geschrieben werden muss.<br />
Dem Ermittlungsrichter werden <strong>der</strong> elektronisch erstellte Antrag und die<br />
bislang entstandene digitale <strong>Akte</strong>, d.h. die digital angelegten Ordner mit<br />
den bislang angefallenen Unterlagen über eine gesicherte Internetverbin-<br />
dung - o<strong>der</strong> bei sehr umfangreichen Unterlagen auf einem Datenträger -<br />
übermittelt. Die in <strong>der</strong> digitalen <strong>Akte</strong> enthaltenen einzelnen Blätter sind<br />
elektronisch blattiert, d.h., mit einem Zeichen so versehen, dass die ur-<br />
sprüngliche Reihenfolge unverän<strong>der</strong>bar bestehen bleibt.<br />
Dies ist erfor<strong>der</strong>lich, da die digitale <strong>Akte</strong> in dem Zustand verbleiben muss,<br />
in welchem sie dem Gericht vorgelegen hat, um zu einem späteren Zeit-<br />
punkt nachprüfen zu können, aufgrund welcher Erkenntnisse <strong>der</strong> An-<br />
fangsverdacht bejaht worden ist. Die Frage <strong>der</strong> Verjährung richtet sich<br />
ebenfalls nach den zum Zeitpunkt des Erlasses <strong>der</strong> richterlichen Ent-<br />
scheidung bekannten Tatsachen. Es muss also eine elektronische Verän-<br />
<strong>der</strong>ungssperre an dieser Stelle eingebaut sein, die mittels Software mög-<br />
lich ist.<br />
Zur Sicherung <strong>der</strong> Verfahrensdurchführung<br />
In gleicher Weise erfolgt auch die Beantragung richterlicher Beschlüsse<br />
zur Sicherung <strong>der</strong> Verfahrensdurchführung, wie die Anordnung <strong>der</strong> Unter-<br />
suchungshaft (§ 112 ff. StPO) o<strong>der</strong> die Auslieferung.<br />
Zum vorläufigen Schutz <strong>der</strong> Allgemeinheit<br />
Auch die richterlichen Beschlüsse zum vorläufigen Schutz <strong>der</strong> Allgemein-<br />
heit, wie das vorläufige Berufsverbot (§§ 132 a StPO, 70 StGB), die Un-<br />
tersuchungshaft wegen Wie<strong>der</strong>holungsgefahr (§ 111 a StPO) o<strong>der</strong> die<br />
142
vorläufige Entziehung <strong>der</strong> Fahrerlaubnis (§ 111 a StPO) können unter<br />
Übermittlung einer digitalen <strong>Akte</strong> auf elektronischem Weg beantragt wer-<br />
den.<br />
2.1.9 Weiterleitung <strong>der</strong> Beschlüsse an die Ermittlungsbehörden,<br />
Durchführung <strong>der</strong> Ermittlungsmaßnahmen<br />
Nach Übermittlung <strong>der</strong> entsprechenden Entscheidung des Richters durch<br />
dessen Geschäftsstelle an die Staatsanwaltschaft und Einstellung <strong>der</strong><br />
Entscheidung in den entsprechenden Ordner <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> wird<br />
diese von <strong>der</strong> Geschäftstelle auf Anweisung des Dezernenten an die Po-<br />
lizei bzw. an die an<strong>der</strong>en Ermittlungsbehörden per Internet o<strong>der</strong> Datenträ-<br />
ger übermittelt.<br />
Bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft wird die <strong>Akte</strong> mit einem elektronischen Wie-<br />
<strong>der</strong>vorlagetermin versehen (vgl. 1. Teil, Abschn. III), <strong>der</strong> Dezernent erhält<br />
aufgrund <strong>der</strong> Eintragung in eine Wie<strong>der</strong>vorlagedatei einen Hinweis auf<br />
den Termin.<br />
2.1.10 Ermittlungen <strong>der</strong> Polizei<br />
Anhand des Ermittlungsauftrags, <strong>der</strong> vorgegebenen Verfahrensstruktur<br />
und <strong>Akte</strong>nordnung können die Ermittlungspersonen die einzelnen Ermitt-<br />
lungsschritte durchführen. Grundsätzlich sind die anfallenden Papierunter-<br />
lagen zu digitalisieren, d.h. unter Verwendung des Barcode-Systems zu<br />
scannen und zur elektronischen <strong>Akte</strong> zu geben, die Originale sind so zu<br />
archivieren, dass später auf sie zugegriffen werden kann.<br />
Bei <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> Ermittlungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen muss<br />
ein Ausdruck <strong>der</strong> richterlichen Beschlüsse vorgehalten werden, da nicht<br />
damit zu rechnen ist dass je<strong>der</strong> Betroffene ein Gerät zur Lesbarmachung<br />
hat bzw. <strong>im</strong>mer ein Laptop zur Verfügung steht.<br />
Während <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> Maßnahmen wird digital gearbeitet.<br />
2.1.11 Erhebung von Beweismitteln<br />
Die Erhebung von Beweismitteln erfolgt unter Einsatz <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> weitgehend <strong>im</strong> klassischen Stil mittels Durchsicht von Räumen und<br />
143
Behältnissen und Beschlagnahme/Sicherstellung <strong>der</strong> beweiserheblichen<br />
Unterlagen.<br />
Beweismittel sind tatbestandsorientiert zu beschaffen. Zur Vorbereitung<br />
einer Durchsuchung sind Personen und Objekte von dem ermittelnden<br />
Sachbearbeiter kurzfristig abzuklären und mögliche sachkundige Teil-<br />
nehmer rechtzeitig und inhaltlich hinreichend einzubinden. Die Vermerke<br />
hierzu werden elektronisch erstellt und in die <strong>Akte</strong> eingefügt.<br />
Einsatzplan:<br />
Ort 79999 Musterdorf 10000 Xing<br />
Objekt Max Mustermann<br />
Firma<br />
B Strasse 2<br />
Peter Mustermann<br />
Wohnung<br />
78834 Lingen<br />
X Strasse 10<br />
Peter Mustermann<br />
Firma<br />
Kennung I-A II-A II-B<br />
Fahn<strong>der</strong> Müller<br />
...<br />
....<br />
Die Asservierung <strong>der</strong> Beweismittel erfolgt in Anlehnung an ein anerkann-<br />
tes Asservierungssystem. Die Beweismittel sind mit Fundstellenangabe<br />
elektronisch zu erfassen, damit sie später übernommen werden können,<br />
z.B. <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Beweiswürdigung o<strong>der</strong> zur Rückgabe <strong>der</strong> sicherge-<br />
stellten <strong>Akte</strong>n.<br />
A u fk le b e r fü r d ie B e w e is m itte lb e s c h riftu n g<br />
Die entsprechenden Kennzeichnungsformulare sind vor Ort zu erstellen,<br />
mit einem tragbaren Drucker herzustellen und direkt auf den sichergestell-<br />
ten Unterlagen anzubringen.<br />
k<br />
X S ta d t<br />
V e rfa h re n : M ü lle r, M a ie r S tA s tu t tg a r t, 1 0 0 J s 1 2 2 3 4 5 /0 7<br />
F u n d o rt: _ _ __ __ __ _ _Schlafz<strong>im</strong>mer,<br />
Schrank _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _<br />
__ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ _<br />
e rh o b e n d u rc h : _ __ __ _ __ __ _Müller __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __<br />
V e rz .N r. _ _ _ _ _I I - A 3 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
144
Das Sicherstellungsverzeichnis ist vor Ort digital zu erstellen, es wird<br />
nach Abschluss <strong>der</strong> Maßnahme in die elektronische <strong>Akte</strong> in den Ordner<br />
Durchsuchungen abgelegt.<br />
Sicherstellungsverzeichnis<br />
Sicherstellungsverzeichnis<br />
Objekt: 78000 X Stadt<br />
Kennung: II-A (Wohnung)<br />
VerzNr.<br />
1<br />
...<br />
39 1 Ordner „Konto Luxemburg“<br />
Zur Sicherung von Datenmaterial n<strong>im</strong>mt an <strong>der</strong> Durchsuchung ein Fach-<br />
mann <strong>der</strong> Kr<strong>im</strong>inalpolizei bzw. einer an<strong>der</strong>en Ermittlungsbehörden teil, <strong>der</strong><br />
die technische Sicherung <strong>der</strong> Daten durch Spiegelung einer Festplatte<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e geeignete Maßnahmen übern<strong>im</strong>mt.<br />
2.1.12 Auskünfte etc.<br />
Erfor<strong>der</strong>liche Auskünfte werden aus dem – bereits oben dargestellten -<br />
elektronisch geführten Handelsregister bzw. Unternehmensregister be-<br />
schafft. Dies gilt auch für ausländische öffentliche Register, aus denen<br />
ohne Einschaltung <strong>der</strong> Rechtshilfe Informationen beschafft werden kön-<br />
nen. Ferner steht das Internet in großem Umfang zur Informationsbe-<br />
schaffung zur Verfügung.<br />
Sach- und Personenfahndung werden von <strong>der</strong> Kr<strong>im</strong>inalpolizei bereits heu-<br />
te vollelektronisch durchgeführt, eine elektronische Kopie <strong>der</strong> Maßnahme<br />
wird in den entsprechenden Ordner abgelegt.<br />
2.1.13 Auswertung von Beweismitteln<br />
Trotz Digitalisierung werden auch heute noch in großem Umfang klassi-<br />
sche Papierakten sichergestellt. Diese Beweisstücke – es kann sich um<br />
zigtausend Asservate handeln - müssen in klassischer Weise zunächst<br />
gesichtet, also durchgeblättert, werden und es muss vom wesentlichen<br />
Inhalt Kenntnis genommen werden. Ziel ist es, alle Asservate ausnahms-<br />
los einzuscannen und sodann auszuwerten. Dies stellt – zumindest in<br />
Großverfahren - noch einen sehr hohen Kostenfaktor dar, so dass man<br />
145
sich <strong>der</strong>zeit darauf beschränkt, die als wesentlich für die Beweisführung<br />
erachteten Unterlagen herauszusuchen. Hierzu werden die „interessan-<br />
ten“ Beweisstücke „hochgestellt“, kopiert und die Kopien in „Beweismittel-<br />
ordnern“ zusammengefasst. Diese Beweismittelordner werden digitali-<br />
siert, hierbei <strong>im</strong> tif - Format abgespeichert und so zur Grundlage <strong>der</strong> digi-<br />
talen Beweismittelakte gemacht.<br />
Die Original – Beweismittelordner werden mittels Barcode gekennzeich-<br />
net und so asserviert, dass auf sie zu einem späteren Zeitpunkt problem-<br />
los zugegriffen werden kann.<br />
Gegebenenfalls ist es nach weiteren Ermittlungen und Vernehmungen er-<br />
for<strong>der</strong>lich, die Beweisstücke nach neuen Gesichtspunkten erneut durch-<br />
zusehen.<br />
Zur weiteren Auswertung muss be<strong>im</strong> Einscannen (Digitalisieren) <strong>der</strong> Be-<br />
weisstücke eine so hohe dpi – Zahl erzielt werden, damit die Dokumente an-<br />
schließend von einem Texterkennungsprogramm (OCR - optical character<br />
recognition -) bearbeitet und digital ausgewertet werden können. Hierdurch<br />
besteht die Möglichkeit, in Sekundenschnelle in Hun<strong>der</strong>ttausenden von Blät-<br />
tern nach best<strong>im</strong>mten Namen o<strong>der</strong> Begriffen elektronisch zu suchen. Hierzu<br />
bieten die Programme ABBYY Finerea<strong>der</strong> und Adobe Professionell Recher-<br />
chemöglichkeiten, aber auch das Dokumentenmanagementsystem ELO (vgl.<br />
oben 5). Die Programme haben jeweils einen hohen Erkennungswert sowie<br />
die Möglichkeit <strong>der</strong> Korrektur von nicht o<strong>der</strong> falsch erkannten Worten, es ist<br />
ein unmittelbarer Vergleich des Bildes mit dem erkannten Text möglich. Das<br />
Ergebnis wird <strong>im</strong> PDF-Format abgespeichert.<br />
Mit dem kostenlosen Acrobat Rea<strong>der</strong> ist eine einfache Auswertung bzw.<br />
Suche in den digitalisierten Beweismitteln ebenfalls möglich. Allerdings<br />
kann mit Hilfe von Adobe Professional ein Index <strong>der</strong> Beweismittel erstellt<br />
bzw. eine erweiterte Auswertung vorgenommen werden.<br />
Bezogen auf einen konkreten Fall heißt dies, dass mit Hilfe <strong>der</strong> genannten<br />
Programme die digital erfassten Beweisstücke digital ausgewertet wer-<br />
den. Es werden Tausende von Dokumenten nach best<strong>im</strong>mten Namen,<br />
zeitlichen Daten, Geldbewegungen u. a. elektronisch durchsucht. Hierbei<br />
146
werden best<strong>im</strong>mte Verhaltens- und Anweisungsstrukturen gefunden, die<br />
be<strong>im</strong> Lesen von Unterlagen so nicht erkennbar sind. Ferner sind Unterla-<br />
gen zu einem best<strong>im</strong>mten Datum bzw. zu einem best<strong>im</strong>mten Zeitraum<br />
(z.B. Unterlagen zu einer Besprechung lt. Kalen<strong>der</strong>eintrag) zu finden, die<br />
dann <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Erstellung von Fallakten digital durch Drag and Drop<br />
zur Beweisführung zusammengetragen werden können.<br />
2.1.14 Auswertung durch Einsatz <strong>der</strong> Sicherungs- und Auswertesoftware<br />
IDEA<br />
Digitale Buchführung und Datenzugriff<br />
Wie bereits oben dargestellt, bedient sich die Finanzverwaltung be<strong>im</strong> Da-<br />
tenzugriff bundeseinheitlich <strong>der</strong> frei auf dem Markt verfügbaren und bei<br />
Wirtschaftsprüfern bereits seit langem verbreiteten Prüfsoftware „IDEA“<br />
(vgl. Information in Anlage zu V). Die Prüfsoftware IDEA liest eine große<br />
Anzahl von Dateiformaten, (wenige) nicht erkennbare Dateiformate müs-<br />
sen in lesbare Formate konvertiert werden.<br />
Seit längerem sind sowohl Dienststellen <strong>der</strong> Kr<strong>im</strong>inalpolizei als auch<br />
Staatsanwaltschaften mit diesem Programmpaket ausgerüstet. Da auf-<br />
grund rechtlicher Vorgaben und <strong>der</strong> praktischen Bewährung heutzutage<br />
Buchführung in Unternehmen ohne EDV nicht mehr denkbar ist, bietet<br />
sich seit dem digitalen Zugriff ab 01.01.2002 die Prüfsoftware auch für<br />
<strong>Strafverfahren</strong> als gutes Ermittlungsinstrument an.<br />
Im Ermittlungsverfahren muss das EDV-System des Beschuldigten vor<br />
<strong>der</strong> Durchsuchung in Erfahrung gebracht werden, eine enge Zusammen-<br />
arbeit zwischen dem Dezernenten <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft, dem polizeili-<br />
chem Sachbearbeiter/EDV-Spezialist und dem Wirtschaftsreferenten bzw.<br />
dem Sachbearbeiter für Buchprüfung ist erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Entsprechende Hard- und Software muss bei <strong>der</strong> Durchsuchung mitge-<br />
führt werden.<br />
Einsatzgebiet IDEA-Software<br />
Neben <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong> reinen Buchhaltungsdaten kann Idea auch<br />
große Datenmengen strukturieren, analysieren und visualisieren: Auswer-<br />
tung von Massedaten wie z.B. Darstellung von Kapitalflüssen, Lizenzum-<br />
sätzen, Kontoübersichten etc., Generierung von Summen- und Saldenlis-<br />
ten, Altersbest<strong>im</strong>mung von For<strong>der</strong>ungen und Verbindlichkeiten etc.. Fer-<br />
147
ner können Prüfungen auf Plausibilität und Vollständigkeit erfolgen. Mög-<br />
lich ist auch die Auswertung nach rechtlichen Vorgaben wie zum Beispiel<br />
die Berechnung <strong>der</strong> Zahlungsunfähigkeit (10%-Schwellenwert).<br />
Des Weiteren können Lückenanalysen und Mehrfachbelegungen vorge-<br />
nommen werden:<br />
Mo<strong>der</strong>ne Lagerbuchhaltungssysteme erzeugen für Lagerabgänge auto-<br />
matisch entsprechende Ausgangsrechnungen. Sind in <strong>der</strong> Finanzbuchhal-<br />
tung die Rechnungs- o<strong>der</strong> Lieferscheinnummern nicht fortlaufend ver-<br />
zeichnet, kann dies einen Hinweis für nicht in <strong>der</strong> Gewinn- und Verlust-<br />
rechnung erfasste Umsätze bilden. Ebenso wie nicht fortlaufende Rech-<br />
nungsnummern können auch doppelt erfasste Rechnungsnummern er-<br />
fasst werden.<br />
Ein weiteres typisches Einsatzgebiet <strong>der</strong> Lückenanalyse ist das Vorrats-<br />
vermögen. Fehlende Artikelnummern können ein Anhaltspunkt für nicht<br />
vollständig erfasste Bestände sein.<br />
Die Überprüfung von parallelen Dateien kann ebenfalls Manipulationen<br />
aufdecken:<br />
Die Abst<strong>im</strong>mung von Lagerabgängen <strong>der</strong> Fertigwaren <strong>im</strong> Lagerbuchhal-<br />
tungssystem mit den Ausgangsrechnungen kann das Ausstellen von<br />
Scheinrechnungen aufdecken.<br />
Weitere Prüffel<strong>der</strong> können erhöhte Abschreibungen sein; eine spezielle<br />
Prüfroutine liefert eine Aufstellung von Arbeitnehmern, die mehrfach in <strong>der</strong><br />
Lohnbuchhaltung geführt werden (Doppelbeschäftigungen). Auch mehrfa-<br />
che geringfügige Beschäftigungsverhältnisse lassen sich mittels Prü-<br />
fungsmakro feststellen: ein Vergleich <strong>der</strong> Stammdaten liefert eine Aufstel-<br />
lung aller Arbeitnehmer, die zwei o<strong>der</strong> mehrere geringfügige Beschäfti-<br />
gungsverhältnisse bei dem zu prüfenden steuerpflichtigen Arbeitgeber<br />
ausüben.<br />
148
Sicherung des Datenmaterials<br />
Sicherung über GDPdU-Schnittstelle (vgl. oben)<br />
Jede aktuelle Version eines Finanzbuchhaltungsprogramms verfügt über<br />
eine GDPdU-Datenausgabe<br />
Die sichergestellten Daten<br />
149
Abbild <strong>der</strong> Index-Datei<br />
Einlesen <strong>der</strong> Daten mit Hilfe des Zusatzmoduls Smart X<br />
Durchsuchen nach <strong>der</strong> Index-Datei<br />
150
Auswählen <strong>der</strong> zu <strong>im</strong>portierenden Daten<br />
Nach dem Import<br />
Daten in IDEA<br />
151
Spezifische Sicherungen<br />
Hierzu existiert eine Arbeitsanleitung <strong>der</strong> Bund-Län<strong>der</strong>-AG „IDEA-<br />
Schulung“ in pdf-Format.<br />
Auswertung von Altsystemen<br />
Aufgrund von Versionsän<strong>der</strong>ungen, Updates o<strong>der</strong> Upgrades hat kein Un-<br />
ternehmen während <strong>der</strong> Aufbewahrungsfrist für Buchhaltungsunterlagen<br />
die gleiche Software. Dies kann bei <strong>der</strong> Sicherung zu Schwierigkeiten füh-<br />
ren. Zwar muss ausgemusterte Hard- und Software während <strong>der</strong> gesetzli-<br />
chen Aufbewahrungsfrist <strong>im</strong>mer dann in uneingeschränkt nutzbarem Um-<br />
fang weiter für den Datenzugriff vorgehalten werden, wenn Altdaten nicht<br />
unverän<strong>der</strong>t durch ein neues bzw. ein upgedatetes System <strong>im</strong> Sinne <strong>der</strong><br />
GDPdU ausgewertet werden können. Allerdings finden sich auf dem frei-<br />
en Markt Auswertungstools für den Zugriff auf Buchhaltungsaltbestände<br />
mit IDEA, bei <strong>der</strong>en Benutzung das Altsystem nicht vorhanden sein muss.<br />
Die mit <strong>der</strong> Datensicherung beauftragten Stellen müssen diese Problema-<br />
tik kennen.<br />
Übernahme in die elektronische <strong>Akte</strong><br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> IDEA – Auswertungen werden in einen geson<strong>der</strong>ten<br />
Ordner <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> übernommen und stehen dort in Sekun-<br />
denschnelle abrufbereit zur Verfügung.<br />
152
2.1.15 Auswertung an<strong>der</strong>er Datenbestände<br />
Auch E-Mail Verkehr, Satellitenfunk, u. a. kann mit Hilfe von Auswer-<br />
tungsprogrammen nach einzelnen Kriterien ausgewertet werden. So wird<br />
<strong>der</strong> sichergestellte Email Verkehr nach Namen, Geschäftsarten und zeitli-<br />
cher Abfolge ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Auswertungen werden<br />
ebenfalls in einen geson<strong>der</strong>ten Ordner <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> übernom-<br />
men.<br />
2.1.16 Einsatz digitaler Daten <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Vermögensabschöpfung<br />
Bei <strong>der</strong> Vermögensabschöpfung (§§ 73 ff StGB) kommt es in <strong>der</strong> Regel<br />
auf die Feststellung des Erlangten an. Dies ist bei Wirtschaftsdelikten oft<br />
schwierig. Bei Korruptionsdelikten ist es z.B. erfor<strong>der</strong>lich, die Steigerung<br />
des Wertes eines Unternehmens zu ermitteln (z. B. Kölner Müllskandal).<br />
Hierzu ist die Sicherung und Auswertung betrieblicher Vorgänge vorzu-<br />
nehmen. Die Datenerhebung folgt denselben Regeln wie bei <strong>der</strong> Siche-<br />
rung von Beweismitteln (§ 111 b Abs. 4 StPO, §§ 111b ff StPO).<br />
Die entsprechenden Beschlüsse sowie <strong>der</strong> Schriftverkehr werden in <strong>der</strong><br />
elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Ordner Vermögensabschöpfungsakte digital abge-<br />
legt, für jeden einzelnen Vermögenswert ist ein geson<strong>der</strong>ter Unterordner<br />
anzulegen. In diesem sind auch die Maßnahmen des Rechtspflegers fest-<br />
zuhalten. Zustellungsurkunden sind zu digitalisieren und <strong>im</strong> entsprechen-<br />
den Ordner abzulegen.<br />
Zu einem spätern Zeitpunkt kann rasch die Höhe <strong>der</strong> sichergestellten<br />
Vermögenswerte erhoben werden, <strong>der</strong> Richter weiß in <strong>der</strong> Hauptverhand-<br />
lung, in welchem Umfang Verfall o<strong>der</strong> Einziehung angeordnet werden<br />
muss.<br />
Im Fall <strong>der</strong> Rückgewinnungshilfe kann die Benachrichtigung <strong>der</strong> Geschä-<br />
digten über die sichergestellten Vermögenswerte (§ 111 e Abs. 3 StPO)<br />
aus den Daten <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> gefertigt werden. Die Mitteilung<br />
<strong>der</strong> Sicherstellung durch Bekanntmachung <strong>im</strong> elektronischen Bundesan-<br />
zeiger (§ 111 e Abs. 4 StPO) kann mit Hilfe <strong>der</strong> digitalen Tabellen eben-<br />
falls zügig erfolgen.<br />
153
2.1.17 Zeugenvernehmungen<br />
Die Zeugenvernehmung (§ 48 ff. StPO) wird mit Papierausdrucken <strong>der</strong> di-<br />
gital erstellten Ladung in die Wege geleitet, die Vernehmung selbst digital<br />
geschrieben. Der Hinweis auf das Zeugnisverweigerungsrecht aus per-<br />
sönlichen Gründen (§ 52 StPO) o<strong>der</strong> aus beruflichen Gründen (§ 53<br />
StPO) wird in dem digital erstellten Vernehmungsprotokoll festgehalten.<br />
Die Unterschrift des Zeugen kann auf ein ausgedrucktes Exemplar <strong>der</strong><br />
Vernehmung angebracht werden. Diese ist zu digitalisieren und als Datei<br />
zur elektronischen <strong>Akte</strong> in den Unterordner „Zeugenvernehmungen“ zu<br />
nehmen. Ferner kann eine Unterschrift auf einem digitalen Graphiktablett<br />
geleistet und anschließend in den PC zum elektronischen Dokument<br />
übertragen werden. Das Original ist mittels Barcode abzulegen. Sofern<br />
die Technik für eine ausreichend sichere elektronische Unterschrift vor-<br />
handen ist, kann auf die Papierunterschrift verzichtet werden.<br />
2.1.18 Verteidigung<br />
Zentraler Informationsträger in <strong>der</strong> Anwaltschaft ist nach wie vor die Pa-<br />
pierakte. Mit Hilfe <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> können aber auch in einer An-<br />
waltskanzlei alle selbst hergestellten digitalen Dokumente automatisch<br />
gespeichert und die externen Dokumente eingescannt und zur <strong>Akte</strong> ge-<br />
nommen werden.<br />
Die Kommunikation zwischen <strong>Justiz</strong> und Anwaltschaft erfolgt bis zum Ein-<br />
satz von X<strong>Justiz</strong>.Straf über das Internet. Zwar wird dem Einsatz von E-<br />
Mails die fehlende Sicherheit entgegengehalten: Bei einer E-Mail weiß<br />
man nicht mit völliger Sicherheit, wann und ob sie den Empfänger erreicht<br />
hat. Bislang wurden solche Sicherheitsprobleme noch nicht relevant, mit<br />
dem SSL – Programm kann ihnen begegnet werden.<br />
Dem Verteidiger, <strong>der</strong> sich elektronisch legit<strong>im</strong>iert hat, wird die Strafanzei-<br />
ge elektronisch übermittelt, um eine Stellungnahme abzugeben. Dieser<br />
kann – sofern sein Mandant nicht über elektronische Medien zu erreichen<br />
ist - das Schriftgut ausdrucken und mit seinem Mandanten durchspre-<br />
chen; sofern eine Erklärung abgegeben werden soll, wird diese elektro-<br />
nisch erstellt und <strong>der</strong> Polizei o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft übermittelt. Den<br />
Anwälten könnten als Anreiz zum vermehrten Einsatz <strong>der</strong> digitalen Signa-<br />
154
tur Kostenvorteile durch Weitergabe <strong>der</strong> Einsparungen bei Verwendung<br />
<strong>der</strong> Signatur gewährt werden (zum Kostenaspekt vgl. auch schon IV)<br />
Zur <strong>Akte</strong>neinsicht kann dem Verteidiger <strong>der</strong> bisherige <strong>Akte</strong>nbestand in e-<br />
lektronischer Form übermittelt werden, sei es per CD bzw. DVD, abhängig<br />
vom Umfang <strong>der</strong> bislang angefallenen Ermittlungsakte.<br />
Die Ladung zu einem Termin (Beschuldigtenvernehmung), ein <strong>Akte</strong>naus-<br />
zug o<strong>der</strong> eine Gutachtenübersendung können über das Internet zur An-<br />
waltskanzlei geleitet werden und dort <strong>im</strong> Terminkalen<strong>der</strong> vermerkt wer-<br />
den.<br />
2.1.19 Beschuldigtenvernehmung<br />
Die Beschuldigtenvernehmung (§ 163 a III StPO) wird mit einem Papier-<br />
ausdruck <strong>der</strong> digital erstellten Ladung von <strong>der</strong> Polizei o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Staatsan-<br />
waltschaft in die Wege geleitet, die Vernehmung selbst jedoch digital fest-<br />
gehalten. Die digitalen Unterlagen werden <strong>im</strong> Ordner<br />
„Beschuldigtenvernehmung“ abgelegt.<br />
2.1.20 Untersuchungshaft<br />
Der Haftbefehlsantrag, die richterliche Entscheidung, die Festnahme o<strong>der</strong><br />
die Ausschreibung zur Festnahme können durchweg <strong>im</strong> elektronischen<br />
Verkehr erfolgen. Die <strong>Akte</strong>n werden dem Richter elektronisch übermittelt,<br />
vgl. oben Nr. 2.1.8.<br />
Die Haftbefehlseröffnung, die Anordnung <strong>der</strong> Haft werden elektronisch<br />
protokolliert und in einen elektronischen Haftordner übernommen.<br />
In Haftfällen legen die Ermittlungspersonen einen Haftkalen<strong>der</strong> in elektro-<br />
nischer Form an, in welchem die Ermittlungshandlungen <strong>im</strong> Verfahren zur<br />
Vorbereitung <strong>der</strong> Haftkontrolle (§§ 121,122 StPO) laufend fortgeschrieben<br />
werden.<br />
In Haftsachen sind (bei Papierakten) <strong>Akte</strong>ndoppel anzulegen, um dem<br />
Gebot <strong>der</strong> Verfahrensbeschleunigung gerecht zu werden (Haftprüfungs-<br />
termine) und um zur <strong>Akte</strong>neinsicht (§ 147 Abs. 1, 4 StPO) eine aktuelle<br />
<strong>Akte</strong> zur Verfügung zu haben. Diese wichtige Vorgabe ist bei Anwendung<br />
155
<strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ohne weiteres umzusetzen, da an <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> laufend gearbeitet wird und zum Zeitpunkt <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nvorlage in<br />
kürzester Zeit eine Mehrfertigung durch Kopie <strong>der</strong> Daten hergestellt wer-<br />
den kann.<br />
Die Haftvorlageberichte für das OLG werden elektronisch erstellt und zu-<br />
sammen mit den bis dato vorliegenden Ermittlungs- und Beweismittelak-<br />
ten über die Generalstaatsanwaltschaft dem OLG in elektronischer Form<br />
zugeleitet.<br />
Besuchserlaubnisse o<strong>der</strong> Anträge von Untersuchungsgefangenen werden<br />
über das Internet bzw. das Intranet gestellt, bearbeitet und übermittelt,<br />
sodann in <strong>der</strong> elektronischen Haftakte des Verfahrens abgelegt.<br />
2.1.21 Fertigung des polizeilichen Schlussberichts<br />
Durch die Digitalisierung kann <strong>der</strong> Schlussbericht auf die Unterlagen <strong>der</strong><br />
Ermittlungsakte und <strong>der</strong> Beweismittel direkt zugreifen. Mittels sog. Hyper-<br />
links, die <strong>im</strong> laufenden Text bei Zitaten o<strong>der</strong> Fundstellenangaben einge-<br />
fügt werden, können einzelne Beweismittel per Mausklick direkt aufgeru-<br />
fen werden, die sofort auf dem Bildschirm erscheinen. Dies gilt für alle di-<br />
gitalisierten Beweismittel, seien es Urkunden, Skizzen, Abrechnungen,<br />
Ergebnisse von Ermittlungshandlungen, Tabellen etc.<br />
Ferner kann auf Gesetzestexte, Verordnungen, Richtlinien, interne<br />
Dienstanweisungen o. ä. verweisen werden, durch einen Hyperlink sind<br />
diese Unterlagen sofort sichtbar und können dann in <strong>der</strong> Hauptverhand-<br />
lung mittels eines Beamers an die Wand projiziert werden, wo sie dann für<br />
den ganzen Gerichtsaal bei einem Format von 2 x 3 Meter gut sichtbar<br />
sind.<br />
Beispiel:<br />
4.3.1.1 Rückware<br />
Eine Möglichkeit, ausgeführte Waren bei <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>einfuhr in das Zollge-<br />
biet <strong>der</strong> Europäischen Union <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Überführung in den zoll-<br />
rechtlich freien Verkehr einer sog. Vorzugsbehandlung zuzuführen, ist die<br />
156
Abfertigung als Rückware. Bei diesem Verfahren werden keine Abgaben<br />
erhoben.<br />
Eine Abfertigung als Rückware kommt bei <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>einfuhr eines ehe-<br />
mals aus <strong>der</strong> Europäischen Union ausgeführten Lkw, bei dem es sich ur-<br />
sprünglich um eine Gemeinschaftsware handelte, nur bei einer förmlichen<br />
Zollabfertigung unter Verwendung des Einheitspapiers ggf. unter zusätzli-<br />
cher Vorlage eines INF 3<br />
(Rückwarenerklärung) in Betracht (BMF-Erlass vom 05.04.2004 – Az.: III<br />
B 1 – Z 1901 – 10/04).<br />
Daran fehlt es hier.<br />
Eine konkludente Zollanmeldung (durch Passieren <strong>der</strong> Zollstelle) nach<br />
Art. 230 S.1 Buchstabe b) i. V. m. Art. 233 Durchführungsvorschriften zum<br />
Zollkodex <strong>der</strong> Gemeinschaften (künftig: Zollkodex-DVO) zur Überführung<br />
eines Lkw als Rückware in den zollrechtlich freien Verkehr ist einer au-<br />
ßerhalb <strong>der</strong> Europäischen Union ansässigen Person nicht möglich (Art.<br />
64 Abs.2 b) ZK und Urteil des Finanzgerichts Thüringen v. 11.04.2002 –<br />
Az.: II 246/98).<br />
(Die rot markierten digitalen Fundstellen sind hier nicht vernetzt und damit<br />
nicht sichtbar, erscheinen <strong>im</strong> Original jedoch direkt nach Anklicken)<br />
Der Leser <strong>der</strong> Schlussberichte, ebenso wie später <strong>der</strong> Leser <strong>der</strong> Anklage-<br />
schrift, muss also nicht beständig neue Beweismittelordner aufschlagen und<br />
durchblättern. Da die Verwendung von Hyperlinks das Lesen vereinfacht,<br />
gerät (hoffentlich) niemand in die Versuchung, Beweismittel (bzw. <strong>der</strong>en Ko-<br />
pien) nicht selbst anzusehen. Die „Glaubhaftigkeit“ <strong>der</strong> Berichte und <strong>der</strong> An-<br />
klageschrift gewinnt dadurch sehr.<br />
2.1.22 Rückleitung <strong>der</strong> Ermittlungsakten an die Staatsanwaltschaft<br />
Die Polizei/Ermittlungsbehörden leiten den digitalen Schlussbericht mit<br />
<strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft zur Fertigung <strong>der</strong> ab-<br />
schließenden Verfügungen zu.<br />
157
Die Prüfung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>n und die Lektüre <strong>der</strong> Schlussbericht sowie <strong>der</strong> Be-<br />
weismittel am Bildschirm sind sehr anstrengend. Gegebenfalls werden<br />
Ausdrucke einzelner Dokumente hergestellt.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> digitalisierten <strong>Akte</strong> ist eine schnelle Kommunikation zwi-<br />
schen <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft und Ermittlungsbehörden hinsichtlich Nach-<br />
ermittlungen möglich. Da <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nbestand elektronisch auch bei <strong>der</strong> Er-<br />
mittlungsbehörde vorhanden ist, können Einzelerhebungen o<strong>der</strong> Auswer-<br />
tungen rasch durchgeführt werden.<br />
2.1.23 Fertigung <strong>der</strong> abschließenden Verfügungen, Anklageerhebung<br />
Den Verteidigern kann – soweit nicht bereits geschehen - <strong>Akte</strong>neinsicht<br />
auf einem digitalen Datenträger gewährt werden. Die in Papierform abge-<br />
legten Unterlagen sind in einem beson<strong>der</strong>en Verzeichnis <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> vermerkt, in diese Unterlagen kann <strong>der</strong> Verteidiger ebenfalls<br />
<strong>Akte</strong>neinsicht nehmen.<br />
Die Anklage mit dem von § 200 StPO vorgegebenen Inhalt ist mit Hilfe <strong>der</strong><br />
elektronischen <strong>Akte</strong> gut zu fertigen. Die Stammdaten werden überprüft,<br />
<strong>der</strong> Anklagesatz formuliert; die Beweismittel sind dem elektronischen<br />
Schlussbericht zu entnehmen. Da die Beweismittel elektronisch vorliegen,<br />
kann auf diese direkt zugegriffen werden, d.h., es besteht die Möglichkeit,<br />
Teile zu kopieren und in die Anklage zu übernehmen. Die Verwendung<br />
<strong>der</strong> Suchfunktion bietet sich bei Verfassung <strong>der</strong> Anklage an.<br />
Ein neues Vorstrafenverzeichnis ist elektronisch einzuholen und <strong>der</strong> elekt-<br />
ronischen <strong>Akte</strong> in einem geson<strong>der</strong>ten Ordner anschließen, <strong>der</strong> nicht <strong>der</strong><br />
<strong>Akte</strong>neinsicht Dritter zur Verfügung steht.<br />
Die Anklage wird dem Gericht mit formularmäßigem elektronischem An-<br />
schreiben <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft übermittelt, das bereits sämtliche<br />
Stammdaten in elektronischer Form enthält. Die Anklage sowie die Ermitt-<br />
lungsakten/digitale Beweismittelakten werden dem Gericht je nach Um-<br />
fang mittels Internet o<strong>der</strong> mit einem digitalen Datenträger übermittelt.<br />
2.1.24 Sonstiges<br />
Im Ermittlungsverfahren fallen aus verschiedenen Gründen Kosten<br />
/Gebühren an. Die Abrechnung kann elektronisch erfolgen: die Ge-<br />
158
schäftsstelle stellt eine elektronische Rechnung aus, die digital über das<br />
Internet an den Empfänger gesandt wird; dieser weist die Zahlung mittels<br />
Online-Banking an, die elektronischen Belege werden zur elektronischen<br />
Verfahrensakte in den Unterordner „Kosten“ genommen.<br />
<strong>Akte</strong>neinsicht von Geschädigten, Sachstandanfragen und sonstige Aus-<br />
künfte können ebenfalls elektronisch erfolgen.<br />
3. Zwischenverfahren<br />
Das formularmäßige elektronische Anschreiben <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
enthält die Stammdaten in solcher Weise, dass sie nach Eingang bei Ge-<br />
richt – ohne nochmalige Erfassung - direkt in das gerichtliche Verwal-<br />
tungssystem übernommen werden können und nach Klärung und Festle-<br />
gung <strong>der</strong> zuständigen Kammer/Richter bzw. des <strong>Akte</strong>nzeichens und des-<br />
sen Eintragung von nun an dem Gericht für weitere Entscheidungen zur<br />
Verfügung stehen.<br />
Nach Eingang <strong>der</strong> Anklage wird eine elektronische Gerichtsakte angelegt.<br />
Für jedes Verfahren wird ein Stammdatensatz gefertigt, <strong>der</strong> von nun an<br />
dem Gericht zur Verfügung steht. Die neu entstehenden einzelnen Ver-<br />
fahrensblätter werden anhand von vorhandenen elektronischen Formula-<br />
ren erstellt, wie z.B. Mitteilung <strong>der</strong> Anklageschrift, Eröffnungsbeschluss.<br />
Das Formularblatt wird <strong>der</strong> elektronischen Gerichtsakte angeschlossen,<br />
so dass die Gerichtsakte als einheitliche Datei aufgeblättert werden kann.<br />
Die elektronische <strong>Akte</strong> besteht damit nunmehr aus <strong>der</strong> Ermittlungsakte mit<br />
den Verfahrensakten, Beweismittelordnern, gegebenenfalls Beiakten und<br />
nunmehr <strong>der</strong> Gerichtsakte.<br />
4. Hauptverhandlung<br />
4.1 Ausstattung des Richtertisches mit Computer<br />
Für die Hauptverhandlung bedeutet eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung,<br />
dass <strong>der</strong> Richtertisch <strong>im</strong> Gerichtssaal in ausreichendem Umfang mit<br />
Computern ausgestattet ist. Ideal sind schräg in die Arbeitsfläche einge-<br />
lassene Bildschirme, damit <strong>der</strong> Blick auf den Saal und die handelnden<br />
159
Personen nicht durch einen senkrecht stehenden Bildschirm beeinträch-<br />
tigt wird.<br />
Ferner ist <strong>im</strong> Gerichtssaal ein Beamer mit <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Projektions-<br />
fläche von mindestens 3 x 2 Meter angebracht, auf welche <strong>im</strong> Laufe <strong>der</strong><br />
Hauptverhandlung die erfor<strong>der</strong>lichen Beweismittel projiziert werden kön-<br />
nen.<br />
Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben ihre eigenen Laptops mit dem<br />
vollständigen <strong>Akte</strong>ninhalt. Die Ordner und die dem Archivierungssystem<br />
o<strong>der</strong> dem Betriebssystem <strong>im</strong>manenten Suchfunktionen sind damit bei den<br />
Verfahrensbeteiligten vorhanden, die Waffengleichheit ist insoweit ge-<br />
wahrt. Alle Beteiligten haben also die Möglichkeit, elektronisch auf den<br />
gesamten <strong>Akte</strong>nbestand zuzugreifen.<br />
4.2 Die Protokollerstellung erfolgt ebenfalls elektronisch<br />
4.3 Hauptverhandlung<br />
Zur Wahrung <strong>der</strong> Unabhängigkeit <strong>der</strong> Richter ist darauf zu achten, dass<br />
Richter je<strong>der</strong>zeit Zugriff auf die Original-Unterlagen des Verfahrens ha-<br />
ben. Hierzu sollten die Unterlagen entwe<strong>der</strong> dem Gericht übergeben o<strong>der</strong><br />
diesem zumindest angeboten werden, je<strong>der</strong>zeit in die Originale Einblick<br />
zu nehmen zu können.<br />
Die Hauptverhandlung (§§ 226 ff. StPO) beginnt mit dem Aufruf <strong>der</strong> Sa-<br />
che (§ 243 Abs. 1 S 1). Die Daten können dem Bildschirm entnommen<br />
werden, auf welchem die Gerichtsakte in elektronischer Form wie<strong>der</strong>ge-<br />
geben ist.<br />
Die Prüfung, ob die Öffentlichkeit gewahrt ist (§§ 169, 171 a, 172 GVG),<br />
erfolgt unabhängig von <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>.<br />
Die Feststellung <strong>der</strong> Präsenz (§ 243 Abs. 1 S 2 StPO) kann anhand <strong>der</strong><br />
vom Gericht mit elektronischem Formular verfügten Anwesenheitspflich-<br />
ten bzw. <strong>der</strong> <strong>im</strong> Gerichtssaal anwesenden Verfahrensbeteiligten geprüft<br />
bzw. festgestellt werden.<br />
Sofern Zwangsmaßnahmen gegen den Angeklagten erfor<strong>der</strong>lich sind<br />
(§ 230 Abs. 2 i. V. m. § 134 Abs. 2 StPO - Vorführungsbefehl; § 230<br />
Abs. 2 StPO - Haftbefehl) können diese anhand <strong>der</strong> elektronischen Ge-<br />
160
ichtakte unschwer gefertigt werden.<br />
Sofern Zeugen nicht erschienen sind (§ 51 Abs. 1 StPO: Auferlegung <strong>der</strong><br />
Kosten Festsetzung von Ordnungsgeld, bei Nichtbeitreibung: Ordnungs-<br />
haft) können die erfor<strong>der</strong>lichen Maßnahmen ebenfalls einfach anhand <strong>der</strong><br />
elektronischen Formulare und des vorhandenen Stammdatensatzes er-<br />
lassen werden. Dies gilt auch für eine Vorführung<br />
Die Anwesenheit des Verteidigers ist ebenfalls festzustellen.<br />
Für die gemeinsame Belehrung <strong>der</strong> Zeugen (§ 57 StPO)ist die elektronische Ak-<br />
te nicht erfor<strong>der</strong>lich, ebenso nicht für die Auffor<strong>der</strong>ung an die Zeugen, den Saal<br />
zu verlassen (§ 243 Abs. 2 S 1 StPO).<br />
Die Vernehmung des Angeklagten zur Person (§ 243 Abs. 2 S 2 StPO)<br />
kann anhand <strong>der</strong> in <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> vorhandenen Erkenntnisse<br />
erfolgen. Da die Vorstrafen (vgl. § 243 Abs. 4 StPO) in einem geson<strong>der</strong>-<br />
ten Ordner enthalten sind, besteht nicht die Gefahr, dass diese bereits bei<br />
<strong>der</strong> Vernehmung zur Person erörtert werden.<br />
Die Verlesung des Anklagesatzes § 243 Abs. 3 S. 1 StPO in Form des<br />
Eröffnungsbeschlusses als unerlässliches Verfahrenserfor<strong>der</strong>nis kann an-<br />
hand des auf dem Bildschirm des Staatsanwalts vorhandenen Textes er-<br />
folgen, <strong>der</strong> von den an<strong>der</strong>en Verfahrensbeteiligten mitverfolgt werden<br />
kann.<br />
Die Belehrung des Angeklagten (§ 243 Abs. 4 S 1), Vernehmung zur Sa-<br />
che (§ 243 Abs. 4 S 2 StPO) durch den Vorsitzenden (§ 238 StPO), das<br />
Fragerecht des Staatsanwalts (§ 240 Abs. 2 StPO) o<strong>der</strong> die Zurückwei-<br />
sung von Fragen die nicht zur Sache gehören o<strong>der</strong> die ungeeignet sind<br />
(§ 241 Abs. 2 StPO) erfolgen mit Hilfe <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>. Ferner be-<br />
steht <strong>der</strong> Vorteil, dass auch bei größeren Verfahren die <strong>Akte</strong> mit den Be-<br />
weismitteln in das Beratungsz<strong>im</strong>mer genommen werden kann, ohne dass<br />
größere Transportprobleme bestehen.<br />
Bei <strong>der</strong> Verwertung früherer Aussagen (§ 254 StPO: Verlesung richterli-<br />
cher Protokolle) o<strong>der</strong> dem Vorhalt <strong>der</strong> Vernehmung an den Zeugen<br />
(BGHSt 21, 285) ist die elektronische <strong>Akte</strong> hilfreich, sie ermöglicht das<br />
161
schnelle Auffinden <strong>der</strong> entsprechenden Unterlagen.<br />
Beweisaufnahme §§ 244 f. StPO<br />
Die Vernehmung <strong>der</strong> Zeugen erfolgt anhand <strong>der</strong> in <strong>der</strong> elektronischen<br />
Ermittlungsakte abgelegten Unterlagen. Die Fundstelle kann sich entwe-<br />
<strong>der</strong> aus einem mit Hyperlink versehenen Ermittlungsbericht ergeben, o<strong>der</strong><br />
durch Suche mit dem internen Suchprogramm, ferner dadurch, dass (wie<br />
bei <strong>der</strong> konventionellen <strong>Akte</strong>) ein elektronischer Ordner aufgeschlagen<br />
wird und die einzelnen Blätter am Bildschirm durchgelaufen lassen wer-<br />
den.<br />
Ob <strong>der</strong> Zeuge wie bereits früher aussagt, ob Än<strong>der</strong>ungen vorliegen, ob<br />
ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 StPO besteht, kann anhand <strong>der</strong><br />
elektronischen Ermittlungsakte festgestellt werden.<br />
Frühere Aussagen können mit Hilfe eines Beamers zum Zweck des Vor-<br />
halts an die an Wand projiziert werden, ebenso an<strong>der</strong>e Unterlagen die<br />
dem Zeugen vorgehalten werden, wie Skizzen, Abrechnungen u. a.<br />
Sachverständigenbeweis §§ 72 - 84 StPO<br />
Ausführungen des Sachverständigen können ebenfalls an die Wand proji-<br />
ziert werden und sind so leicht nachvollziehbar. Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e,<br />
wenn es sich um komplexe Anknüpfungstatsachen (Tatsachen, die er sei-<br />
nem Gutachten zugrunde legt) o<strong>der</strong> Befundtatsachen (aufgrund eigener<br />
Sachkunde ermittelt) handelt.<br />
Urkundenbeweis, §§ 249, 251 StPO, Augenschein §§ 86, 162, 225, 249<br />
Abs. 1 S. 2 StPO<br />
Originalbeweismittel sind durch die Projektion leicht einzusehen. Die Öf-<br />
fentlichkeit bleibt bei dieser Vorgehensweise auch gewahrt: anstelle einer<br />
Ansammlung von Verteidigern und Staatsanwälten vor dem Richtertisch<br />
kann je<strong>der</strong> Verfahrensbeteiligte von seinem Platz aus das Dokument ein-<br />
sehen kann.<br />
162
Auch dem Vorsitzenden bleibt <strong>der</strong> Blick in den Gerichtssaal unversperrt<br />
und er kann so sein Hausrecht wahrnehmen.<br />
Der Beweiswert elektronischer Dokumente wird unter VIII dargestellt.<br />
Die Stellung von Beweisanträgen mit Beweisthema und Beweismittel<br />
(§ 244 StPO) erfolgt problemlos mit <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>: entwe<strong>der</strong><br />
wird <strong>der</strong> Beweisantrag in Papierform erstellt und sodann bei Gericht digi-<br />
talisiert und in die elektronische Gerichtsakte integriert o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Antrag<br />
wird bereits digital erstellt.<br />
Bei <strong>der</strong> Ablehnung von Beweisanträgen (§ 244 Abs. 3 - 5 StPO) werden<br />
die Beschlüsse elektronisch gefertigt, unterzeichnet und in <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> abgespeichert. In <strong>der</strong> Hauptverhandlung werden die Be-<br />
schlüsse aufgerufen und verlesen, sodann vom Urkundsbeamten als An-<br />
lage zum Protokoll des jeweiligen Verhandlungstages genommen.<br />
Die Berücksichtigung von § 257 StPO, d.h. das Erklärungsrecht des An-<br />
geklagten zur Vernehmung jedes Mitangeklagten und nach je<strong>der</strong> einzel-<br />
nen Beweiserhebung wird in das elektronische Hauptverhandlungsproto-<br />
koll übernommen.<br />
Das nach dem Schluss <strong>der</strong> Beweisaufnahme folgende Plädoyer des<br />
Staatsanwalts (§ 258 Abs. 1, 3, StPO) und das Plädoyer des Verteidigers<br />
werden durch die elektronische <strong>Akte</strong> vereinfacht. In die elektronischen Ak-<br />
tenblätter können Notizen angebracht werden, auf die schnell und ein-<br />
fach zugegriffen werden kann.<br />
Das letzte Wort des Angeklagten (§ 258 Abs. 2 StPO) wird <strong>im</strong> Protokoll<br />
vermerkt.<br />
Für die gehe<strong>im</strong>e Urteilsberatung §§ 260 - 264 StPO, die Verkündung des<br />
Urteils und Bekanntgabe <strong>der</strong> Urteilsgründe §§ 260 Abs. 1, 268 StPO, die<br />
Verlesung <strong>der</strong> Beschlüsse zur Strafaussetzung zur Bewährung und zur<br />
Verwarnung mit Strafvorbehalt § 268 a StPO o<strong>der</strong> des Beschlusses über<br />
Fortdauer <strong>der</strong> Untersuchungshaft o<strong>der</strong> einstweiligen Unterbringung -<br />
163
§ 268 b StPO, bzw. die Belehrung über Strafaussetzung zur Bewährung<br />
u. ä.: § 268 a Abs. 3 StPO und die Rechtsmittelbelehrung § 35 a StPO<br />
ergeben sich keine Beson<strong>der</strong>heiten.<br />
4.4 Urteil<br />
Bei <strong>der</strong> Fertigung des Urteils nach §§ 264, 267 StPO ergeben sich eben-<br />
falls keine Beson<strong>der</strong>heiten.<br />
Bei einzelnen Delikten ist die elektronische <strong>Akte</strong> von Vorteil. So sind bei<br />
Wirtschaftsstraftaten anhand von Tabellen viele Einzelheiten darzulegen,<br />
vgl. z.B. die hohen Anfor<strong>der</strong>ungen an Urteile <strong>im</strong> Steuerstrafrecht. Die Ur-<br />
teilsgründe müssen nicht nur die Summe <strong>der</strong> verkürzten Steuern, son<strong>der</strong>n<br />
auch <strong>der</strong>en Berechnung <strong>im</strong> Einzelnen - für jede Steuerart und jeden Steu-<br />
erabschnitt geson<strong>der</strong>t - angeben. Hierbei kann auf die digital festgehalte-<br />
nen Ergebnisse <strong>der</strong> Ermittlungsverfahrens, unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Hauptverhandlung, zurückgegriffen werden.<br />
Das Urteil wird elektronisch gefertigt und so gespeichert, dass es nicht<br />
mehr verän<strong>der</strong>bar ist. Dies ist mittels Software möglich, <strong>der</strong> Vorgang wird<br />
in <strong>der</strong> Vorgangsverwaltung protokolliert.<br />
Rechtskraft tritt ein, wenn kein Rechtsmittel mehr möglich ist, sei es we-<br />
gen Fristablaufs,<br />
Verzichts, Rücknahme eines eingelegten Rechtsmittels o<strong>der</strong> Unanfecht-<br />
barkeit.<br />
Die Vollstreckbarkeit wird festgestellt durch einen entsprechenden Ver-<br />
merk, den <strong>der</strong> Urkundsbeamte <strong>der</strong> Geschäftsstelle be<strong>im</strong> Gericht auf <strong>der</strong><br />
Urschrift o<strong>der</strong> einer beglaubigten Abschrift <strong>der</strong> zu vollstreckenden Ent-<br />
scheidung anbringt.<br />
Dieser Vermerk wird auf dem ersten Blatt des elektronisch erstellten und<br />
gespeicherten Urteils angebracht. Die Software ermöglicht es den Be-<br />
rechtigten – den Urkundsbeamten <strong>der</strong> Geschäftsstelle – Verän<strong>der</strong>ungen<br />
an dem ansonsten unverän<strong>der</strong>baren elektronischen Dokument, d.h. dem<br />
Urteil, anzubringen.<br />
164
5. Rechtsmittel<br />
Gegen das Urteil kann ein Rechtsmittel eingelegt werden. Der Ablauf <strong>der</strong><br />
stark formalisierten Rechtsmittelverfahren kann durch die Anlage jeweils<br />
neuer Ordner in <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> festgehalten werden (vgl. <strong>im</strong> Üb-<br />
rigen auch Ausführungen unter X)<br />
6. Vollstreckung<br />
6.1 Strafvollstreckung<br />
Unter Strafvollstreckung versteht man all jene Maßnahmen, die nach<br />
Rechtskraft eines Strafurteils erfor<strong>der</strong>lich werden, um die <strong>im</strong> Urteil ange-<br />
ordneten Rechtsfolgen durchzuführen (§§ 449 StPO). Dazu gehören ins-<br />
beson<strong>der</strong>e<br />
• die Vollstreckung verhängter Freiheitsstrafen und sonstiger Freiheits-<br />
entziehungen (z.B. Strafarrest, Jugendarrest), die Vollstreckung ver-<br />
hängter Maßnahmen <strong>der</strong> Besserung und Sicherung,<br />
• <strong>der</strong> Einzug <strong>der</strong> verhängten Geldstrafen,<br />
• die Durchsetzung des Fahrverbots, <strong>der</strong> Entziehung <strong>der</strong> Fahrerlaubnis,<br />
• die Mitteilung <strong>der</strong> Verurteilungen an das vom Generalbundesanwalt<br />
geführte Bundeszentralregister und das vom Kraftfahrtbundesamt ge-<br />
führte Verkehrszentralregister sowie<br />
• alle diesbezüglich notwendigen Folgeentscheidungen.<br />
Da gemäß § 451 StPO Vollstreckungsbehörde die Staatsanwaltschaft ist<br />
und sie alle Anordnungen zu treffen bzw. erfor<strong>der</strong>liche gerichtliche Ent-<br />
scheidungen herbeizuführen hat,<br />
wird die <strong>Akte</strong> nach Rechtskraft wie<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft geführt.<br />
Bei <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> wird das als Datei vorhandene Urteil mit dem<br />
digital angebrachten Rechtskraftvermerk vom Gericht <strong>der</strong> Staatsanwalt-<br />
schaft übermittelt, dies erfolgt über das justizielle Intranet.<br />
Die Vollstreckungsgeschäftsstelle vergibt anhand <strong>der</strong> Stammdaten des<br />
Verurteilten ein Vollstreckungsaktenzeichen und legt einen neuen Ordner<br />
an mit dem Titel „Vollstreckungsakte“. Da funktionell gemäß § 31 II RPflG<br />
grundsätzlich <strong>der</strong> Rechtspfleger für die Aufgaben <strong>der</strong> Strafvollstreckung<br />
zuständig ist, wird die elektronische <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> zentralen Speicher abgespei-<br />
165
chert und <strong>der</strong> zuständige Rechtspfleger hiervon unterrichtet. Er holt sich<br />
die <strong>Akte</strong> zur Bearbeitung auf seinen Bildschirm.<br />
6.2 Vollstreckung <strong>der</strong> Freiheitsstrafe<br />
Zur Vollstreckung <strong>der</strong> Freiheitsstrafe wird <strong>der</strong> Verurteilte durch den<br />
Rechtspfleger <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft geladen. Dabei werden ihm Zeit des<br />
Strafantritts und die JVA genannt, in <strong>der</strong> er seine Strafe anzutreten hat.<br />
Welche das ist, ergibt sich aus dem Vollstreckungsplan, den die Landes-<br />
justizverwaltung gemäß § 152 StVollzG erlässt.<br />
Der Rechtspfleger ruft hierzu das entsprechende digitale Formular auf,<br />
welches aufgrund des Stammdatensatzes bereits alle Grunddaten enthält<br />
und trägt lediglich noch die erfor<strong>der</strong>lichen Daten <strong>der</strong> Vollstreckung ein.<br />
Diese lassen sich nach entsprechenden Eingaben in eine Datenmaske<br />
elektronisch berechnen. Das Formular wird ausgedruckt und dem Verur-<br />
teilten (in Papierform) zugeleitet, das elektronisch erstellte Dokument wird<br />
zur Vollstreckungsakte abgespeichert.<br />
Stellt sich <strong>der</strong> Verurteilte nicht, kann gegen ihn Vollstreckungshaftbefehl<br />
erlassen werden (§ 457 StPO). Dieser wird mit Hilfe des Stammdatensat-<br />
zes erstellt und <strong>der</strong> Polizeidienststelle zugeleitet.<br />
Die Staatsanwaltschaft kann aus Gründen <strong>der</strong> Vollzugsorganisation o<strong>der</strong><br />
zur Vermeidung<br />
beson<strong>der</strong>er Härten die Vollstreckung aufschieben (455a, 456 StPO). Bei<br />
Auslieferung o<strong>der</strong> Landesverweisung kann sie von <strong>der</strong> Vollstreckung ab-<br />
sehen (§ 465a StPO). Für diese Entscheidungen ist aber nicht <strong>der</strong><br />
Rechtspfleger, son<strong>der</strong>n nur <strong>der</strong> Staatsanwalt zuständig. Er ist also elekt-<br />
ronisch in den Vorgang ein zuschalten, indem ihm das entsprechen For-<br />
mular zur weiteren Bearbeitung zugeleitet wird.<br />
Die eigentliche Durchführung <strong>der</strong> Freiheitsstrafe (Strafvollzug) und die<br />
Entlassung nachvollständiger Strafverbüßung liegen in <strong>der</strong> Verantwortung<br />
<strong>der</strong> JVA. Diese wird von <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft auf elektronischem Weg<br />
unterrichtet.<br />
6.3 Sonstige Maßnahmen <strong>der</strong> Besserung und Sicherung , beispielsweise die<br />
Entziehung <strong>der</strong> Fahrerlaubnis, die Sperrfrist für die Wie<strong>der</strong>erteilung <strong>der</strong><br />
166
Fahrerlaubnis und das Berufsverbot, werden ebenfalls von <strong>der</strong> Staatsan-<br />
waltschaft vollstreckt, indem die zuständigen Fachbehörden über die er-<br />
folgte Verurteilung unterrichtet werden. Gleiches gilt für das eine Neben-<br />
strafe darstellende Fahrverbot. Auch hierbei ruft <strong>der</strong> Rechtspfleger das<br />
entsprechende digitale Formular auf, welches aufgrund des Stammdaten-<br />
satzes bereits alle Grunddaten enthält und trägt lediglich noch die erfor-<br />
<strong>der</strong>lichen Daten ein. Das Formular wird ausgedruckt und dem Verurteilten<br />
(in Papierform) zugeleitet, das elektronisch erstellt Dokument wird zur<br />
Vollstreckungsakte abgespeichert.<br />
6.4 Der Einzug von Geldstrafen erfolgt ebenfalls durch die Staatsanwalt-<br />
schaft. Kommt <strong>der</strong> Verurteilte seiner Zahlungsverpflichtung nach, ist die<br />
Vollstreckung erledigt. An<strong>der</strong>nfalls wird zunächst versucht, die Geldstrafe<br />
durch eine Vollstreckung in das Vermögen des Verurteilten einzuziehen.<br />
Bleibt auch dies erfolglos, ordnet die Strafvollstreckungsbehörde die Voll-<br />
streckung <strong>der</strong> Ersatzfreiheitsstrafe an und vollstreckt diese. Diese Vor-<br />
gänge können mit elektronisch erstellten Formularen abgewickelt werden<br />
7. Wie<strong>der</strong>aufnahme des Verfahrens ( §§ 359 ff. StPO)<br />
Die Wie<strong>der</strong>aufnahme eines Verfahrens ist nur zulässig, wenn einer <strong>der</strong> <strong>im</strong><br />
Gesetz genau festgelegten Wie<strong>der</strong>aufnahmegründe vorliegt (§§ 359 -<br />
373a StPO). Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>auf-<br />
nahme zugunsten des Verurteilten und <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>aufnahme zuungunsten<br />
des Angeklagten.<br />
Wie<strong>der</strong>aufnahmegründe bei Wie<strong>der</strong>aufnahme zugunsten des Verurteilten<br />
liegen vor:<br />
- wenn eine in <strong>der</strong> Hauptverhandlung zu seinen Ungunsten als echt<br />
vorgebrachte Urkunde unecht o<strong>der</strong> verfälscht war;<br />
- wenn <strong>der</strong> Zeuge o<strong>der</strong> Sachverständige sich bei einem zuunguns-<br />
ten des Verurteilten abgelegten Zeugnis o<strong>der</strong> abgegebenen Gut-<br />
achten einer vorsätzlichen o<strong>der</strong> fahrlässigen Verletzung <strong>der</strong> Ei-<br />
167
despflicht o<strong>der</strong> einer vorsätzlichen falschen uneidlichen Aussage<br />
schuldig gemacht hat;<br />
- wenn bei dem Urteil ein Richter o<strong>der</strong> Schöffe mitgewirkt hat, <strong>der</strong><br />
sich in Beziehung auf die Sache einer strafbaren Verletzung sei-<br />
ner Amtspflichten schuldig gemacht hat, sofern die Verletzung<br />
nicht vom Verurteilten selbst veranlasst ist;<br />
- wenn ein zivilgerichtliches Urteil, auf welches das Strafurteil ge-<br />
gründet ist, durch ein an<strong>der</strong>es rechtskräftig gewordenes Urteil<br />
aufgehoben ist;<br />
- wenn neue Tatsachen o<strong>der</strong> Beweismittel beigebracht sind, die al-<br />
leine o<strong>der</strong> in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen die<br />
Freisprechung des Angeklagten o<strong>der</strong> in Anwendung eines milde-<br />
ren Strafgesetzes eine geringere Bestrafung o<strong>der</strong> eine wesentlich<br />
an<strong>der</strong>e Entscheidung über eine Maßregel <strong>der</strong> Besserung und Si-<br />
cherung zu begründen geeignet sind;<br />
- wenn <strong>der</strong> Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Ver-<br />
letzung <strong>der</strong> Europäischen Konvention zum Schutze <strong>der</strong> Men-<br />
schenrechte und Grundfreiheiten o<strong>der</strong> ihrer Protokolle festgestellt<br />
hat und das Urteil auf dieser Verletzung beruht.<br />
Wie<strong>der</strong>aufnahmegründe bei Wie<strong>der</strong>aufnahme zuungunsten des Ange-<br />
klagten liegen vor:<br />
- wenn eine in <strong>der</strong> Hauptverhandlung zu seinen Gunsten als echt<br />
vorgebrachte Urkunde unecht o<strong>der</strong> verfälscht war;<br />
- wenn <strong>der</strong> Zeuge o<strong>der</strong> Sachverständige sich bei einem zugunsten<br />
des Angeklagten abgelegten Zeugnis o<strong>der</strong> abgegebenen Gutach-<br />
ten einer vorsätzlichen o<strong>der</strong> fahrlässigen Verletzung <strong>der</strong> Ei-<br />
despflicht o<strong>der</strong> einer vorsätzlichen falschen uneidlichen Aussage<br />
schuldig hat;<br />
168
- wenn bei dem Urteil ein Richter o<strong>der</strong> Schöffe mitgewirkt hat, <strong>der</strong><br />
sich in Beziehung auf die Sache einer strafbaren Verletzung <strong>der</strong><br />
Amtspflichten schuldig gemacht hat;<br />
- wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht o<strong>der</strong> außergerichtlich ein<br />
glaubwürdiges Geständnis <strong>der</strong> Straftat abgelegt wird.<br />
Das Wie<strong>der</strong>aufnahmeverfahren wird durch einen formgebundenen Antrag<br />
eingeleitet, <strong>der</strong> die Wie<strong>der</strong>aufnahmegründe und die Beweismittel angeben<br />
muss. Vom Verurteilten kann <strong>der</strong> Antrag nur mit einem Strafverteidiger<br />
gestellt werden. Der Antrag ist gem. § 367 StPO an das nach § 140a<br />
GVG zuständige Gericht zu richten. Der Antrag kann aber auch bei dem<br />
Gericht eingereicht werden, dessen Urteil angefochten wird; dieses leitet<br />
den Antrag dann an das zuständige Gericht weiter.<br />
Der schriftliche Wie<strong>der</strong>aufnahmeantrag des Verteidigers in Papierform<br />
wird zunächst durch Scannen digitalisiert, von <strong>der</strong> gerichtlichen Datener-<br />
fassungsstelle mit dem entsprechenden <strong>Akte</strong>nzeichen versehen und in<br />
Form eines neuen Datenordners als elektronische <strong>Akte</strong> über das justiziel-<br />
le Intranet dem zuständigen Gericht zugeleitet. Die zuständige Geschäfts-<br />
stelle legt einen neuen Ordner „Wie<strong>der</strong>aufnahme“ an. Das Gericht n<strong>im</strong>mt<br />
zunächst eine Zulässigkeitsprüfung (sog. Additionsverfahren) vor und<br />
prüft insbeson<strong>der</strong>e, ob <strong>der</strong> Antrag die gesetzliche Form wahrt, ob er ge-<br />
setzliche Wie<strong>der</strong>aufnahmegründe (vgl. oben) geltend macht und ob er<br />
geeignete Beweismittel anführt.<br />
Das Gericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss,<br />
<strong>der</strong> digital erstellt wird. Entwe<strong>der</strong> wird <strong>der</strong> Antrag als unzulässig verworfen<br />
o<strong>der</strong> er wird zugelassen. Der Beschluss wird <strong>der</strong> Geschäftsstelle elektro-<br />
nisch zugeleitet, den Beteiligten zugestellt und in <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
„Wie<strong>der</strong>aufnahme“ abgelegt. Gegen die Entscheidung kann die jeweils<br />
unterlegene Partei sog. sofortige Beschwerde einlegen.<br />
Ist <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>aufnahmeantrag zulässig, prüft das Gericht <strong>im</strong> sog. Probati-<br />
onsverfahren, ob <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>aufnahmeantrag begründet ist, d.h. ob die<br />
169
Voraussetzungen <strong>der</strong> <strong>im</strong> Gesetz genannten Wie<strong>der</strong>aufnahmegründe auch<br />
tatsächlich vorliegen.<br />
Das Gericht beauftragt – mit elektronisch erstelltem Formular - einen<br />
Richter mit <strong>der</strong> Beweisaufnahme. In dieser werden die vom Antragsteller<br />
angetretenen Beweise und Tatsachen auf ihre Richtigkeit hin überprüft.<br />
Hierzu wird auch die elektronische <strong>Akte</strong> des vorangegangenen Verfah-<br />
rens, dessen Wie<strong>der</strong>aufnahme angestrebt wird, beigezogen. Gegebenen-<br />
falls müssen die Originale von digitalisierten Urkunden – soweit sie nach<br />
rechtskräftigem Abschluss nicht bereits zurückgegeben sind - herbeige-<br />
schafft werden. Dies ist aufgrund <strong>der</strong> <strong>im</strong> Barcode enthaltenen Angaben<br />
über den Aufbewahrungsort möglich.<br />
Nach Schluss <strong>der</strong> Beweisaufnahme sind die Staatsanwaltschaft mit elekt-<br />
ronisch erstelltem Formular und <strong>der</strong> Angeklagte mit elektronisch erstell-<br />
tem aber in Papierform ausgedrucktem Formular - unter Best<strong>im</strong>mung ei-<br />
ner Frist zu weiterer Erklärung über das Ergebnis <strong>der</strong> Beweisaufnahme<br />
aufzufor<strong>der</strong>n. Die Staatsanwaltschaft gibt ihre Erklärung in elektronischer<br />
Form dem Gericht gegenüber ab.<br />
Anschließend ergeht ohne mündliche Verhandlung ein Beschluss des Ge-<br />
richtes. Lehnt es die Wie<strong>der</strong>aufnahmevoraussetzungen ab, verwirft es<br />
den Wie<strong>der</strong>aufnahmeantrag. Hiergegen kann <strong>der</strong> Antragsteller sofortige<br />
Beschwerde einlegen.<br />
Bejaht das Gericht die Begründetheit, ordnet es i. d. R. die Wie<strong>der</strong>auf-<br />
nahme des Verfahrens und die Erneuerung <strong>der</strong> Hauptverhandlung an<br />
(§ 370 Abs. 2 StPO).<br />
In gesetzlich best<strong>im</strong>mten Ausnahmefällen kann das Gericht auch ohne ei-<br />
ne neue Hauptverhandlung (durch Beschluss) entscheiden, nämlich etwa<br />
dann, wenn aufgrund entsprechend eindeutiger Beweislage (und i. d. R.<br />
bei Zust<strong>im</strong>mung <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft) nur ein Freispruch in Betracht<br />
kommt o<strong>der</strong> wenn bei einem verstorbenen Verurteilten (das Wie<strong>der</strong>auf-<br />
nahmeverfahren zugunsten des Verurteilten wird durch dessen Tod nicht<br />
ausgeschlossen) ein Freispruch in Betracht kommt (§ 371 StPO).<br />
170
Der Beschluss mit dem die Wie<strong>der</strong>aufnahme und die erneute Hauptver-<br />
handlung angeordnet werden, kann von <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft nicht<br />
mehr angefochten werden. Er beseitigt die Rechtskraft und vor allem die<br />
Vollstreckbarkeit des angefochtenen Urteils.<br />
Er versetzt das Verfahren in den Zustand zurück, in dem es sich vor dem<br />
Urteil befunden hat. Die Vollstreckung muss demnach sofort beendet<br />
werden.<br />
In <strong>der</strong> neuen Hauptverhandlung (§ 373 StPO) hat das dasselbe Gericht<br />
wie <strong>im</strong> Wie<strong>der</strong>aufnahmeverfahren neu und selbständig über den Anklage-<br />
vorwurf zu entscheiden, so, als wenn zuvor niemals ein Urteil ergangen<br />
wäre.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e muss die gesamte Beweisaufnahme vollständig durchge-<br />
führt, d.h. also etwa Zeugen vernommen werden. Zu diesem Zweck kann<br />
auf die in digitaler Form vorliegende Verfahrensakte mit Ermittlungsakte<br />
und Beweismittelakte zugegriffen werden. Durch die elektronische Spei-<br />
cherung stehen die Beweisergebnisse zur Verfügung. Soweit die Origina-<br />
le von digitalisierten Urkunden nach rechtskräftigem Abschluss bereits zu-<br />
rückgegeben sind stehen nunmehr jedenfalls die digitalisierten Asservate<br />
zur Verfügung.<br />
Die neue Verhandlung kann, wie jede an<strong>der</strong>e „normale“ Hauptverhand-<br />
lung mit Verurteilung o<strong>der</strong> Freispruch (o<strong>der</strong> auch Einstellung) enden.<br />
Wird <strong>der</strong> Verurteilte frei gesprochen, muss das bisherige Urteil aufgeho-<br />
ben werden.<br />
Ergeht nach <strong>der</strong> neuen Hauptverhandlung ein Urteil, kann dieses, von <strong>der</strong><br />
jeweils „unterlegenen“ Partei mit den allgemeinen Rechtsmitteln (Beru-<br />
fung/Revision) angefochten werden. Diese Vorgänge können elektronisch<br />
abgewickelt werden.<br />
171
VI. Teilnahmeverpflichtung am elektronischen Rechtsverkehr für<br />
Verfahrensbeteiligte und sonstige Personen (Versicherungen,<br />
Privatpersonen usw.)<br />
Die elektronische <strong>Akte</strong> kann die ihr zugedachten Effizienzsteigerungen umso<br />
eher erreichen, je mehr die Verfahrensbeteiligten und sonstigen Personen am<br />
elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Arbeits- und<br />
Kostenaufwand für die Transformation von bzw. in die Papierform würde ent-<br />
fallen bzw. weniger werden, darüber hinaus könnte eine Verfahrensbeschleu-<br />
nigung erzielt werden. Daher stellt sich die Frage, ob die am Verfahren betei-<br />
ligten Personen hierzu verpflichtet werden können.<br />
1. Richter und Staatsanwälte<br />
Die Arbeit mit <strong>der</strong> Verfahrensakte stellt die Kerntätigkeit für Richter und<br />
Staatsanwälte dar. Sofern diese nicht zur Nutzung verpflichtet werden<br />
könnten, würde die Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> faktisch ins Lee-<br />
re gehen. Die Verpflichtungsmöglichkeit dieses Personenkreises ist so-<br />
mit von zentraler Bedeutung.<br />
Für den <strong>der</strong>zeitigen Stand <strong>der</strong> „Elektronisierung“ des Rechtsverkehrs er-<br />
gibt sich folgendes Bild:<br />
Fast flächendeckend besteht die Möglichkeit <strong>der</strong> Nutzung elektronischer<br />
Medien für die Kommunikation nach innen und außen. Exemplarisch sei<br />
nur auf den E-Mail-Verkehr verwiesen. Die Recherchemöglichkeit des<br />
Internets und die juris-Datenbank werden für die Entscheidungsfindung<br />
verwendet. Darüber hinaus existieren Programme, die die Abfassung<br />
und Umsetzung <strong>der</strong> Entscheidung erleichtern (wie<strong>der</strong>um exemplarisch<br />
seien Forum-Star sowie Textbausteine und Anklagemuster genannt).<br />
Weiterhin findet Software Verwendung, die zur Aufbereitung des Verfah-<br />
rensstoffes dient (z. B. „IDEA“).<br />
Rechtliche Regelungen, die für Richter o<strong>der</strong> Staatsanwälte eine Ver-<br />
pflichtung zur Nutzung <strong>der</strong> oben aufgezeigten Möglichkeiten begründen<br />
würden, existieren - soweit ersichtlich – an<strong>der</strong>s als in an<strong>der</strong>en Verfah-<br />
rensordnungen (vgl. etwa Handelsregister, Grundbuch) nicht.<br />
172
Im staatsanwaltschaftlichen Bereich finden sich jedoch zum Teil inner-<br />
dienstliche Anordnungen entsprechenden Inhalts. Diese erstrecken sich<br />
verstärkt nicht nur auf die kommunikative/verfahrenstechnische Seite,<br />
son<strong>der</strong>n auch auf inhaltliche Aspekte. Für den richterlichen Bereich ist<br />
<strong>der</strong>artiges nicht bekannt.<br />
Jenseits dieser verbindlichen Vorgaben sind jedoch – gerade auch <strong>im</strong><br />
richterlichen Bereich – Tendenzen zu verzeichnen, die – etwa <strong>im</strong> Rah-<br />
men von Qualitätszirkeln – auf eine freiwillige Selbstverpflichtung abzie-<br />
len.<br />
Durch die zunehmende Ausstattung mit elektronischen Medien bei<br />
gleichzeitigem Abbau von Personal (Geschäftsstellenmitarbeiter,<br />
Wachtmeister) entsteht darüber hinaus ein faktischer Druck, elektroni-<br />
sche Arbeits- und Hilfsmittel zu benutzen. Je nach den konkreten Gege-<br />
benheiten, die von Bundesland zu Bundesland verschieden sein können,<br />
kann sich dieser Druck zu einem Zwang entwickeln, weil die Organisati-<br />
on eine an<strong>der</strong>e Form nicht mehr zulässt. Fast flächendeckend erfolgt<br />
beispielsweise bereits jetzt <strong>der</strong> Hauspostverkehr digital, so dass jeden-<br />
falls eine diesbezügliche Information nur unter Nutzung <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen Medien möglich ist, ohne dass dies geregelt o<strong>der</strong> auch nur prob-<br />
lematisiert würde.<br />
Zu <strong>der</strong> sich anschließenden Frage, ob eine rechtliche Verpflichtung zur<br />
Arbeit mit einer elektronischen <strong>Akte</strong> bzw. zur sonstigen Teilnahme am<br />
elektronischen Rechtsverkehr begründet werden könnte, ist Folgendes<br />
auszuführen:<br />
Mit beson<strong>der</strong>er Schärfe stellt sich die Frage für den richterlichen Bereich<br />
mit Blick auf die in Artikel 97 Abs. 1 Grundgesetz (GG) garantierte rich-<br />
terliche Unabhängigkeit.<br />
Diese Problematik ist mit unterschiedlicher Bewertung und Akzentuie-<br />
rung Gegenstand zweier Promotionsarbeiten jüngeren Datums (vgl. An-<br />
173
hang zu VI) gewesen. Hinsichtlich <strong>der</strong> ausführlichen dogmatischen Auf-<br />
bereitung und <strong>der</strong> diesbezüglichen Problemstellungen soll zur Vermei-<br />
dung von Wie<strong>der</strong>holungen auf diese Arbeiten Bezug genommen werden.<br />
Die Kommission ist einhellig <strong>der</strong> Auffassung, dass sich dann, wenn sich<br />
<strong>der</strong> Gesetzgeber für die Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> als die für<br />
die StPO verbindliche <strong>Akte</strong>nform entscheidet, aus <strong>der</strong> Natur <strong>der</strong> Sache<br />
bzw. dem Gesamtzusammenhang <strong>der</strong> richterlichen Aufgaben die Ver-<br />
pflichtung ergibt, mit dieser <strong>Akte</strong>nform zu arbeiten.<br />
Dass <strong>der</strong> Gesetzgeber eine solche Regelung treffen kann, dürfte unstrei-<br />
tig sein. Der Begriff <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> wird in <strong>der</strong> StPO vorausgesetzt, nicht defi-<br />
niert. Entgegenstehende höherrangige Gesichtspunkte, etwa verfas-<br />
sungsrechtliche Vorgaben, bestehen insoweit nicht. Für das zu Artikel 97<br />
Abs. 1 GG bestehende Spannungsfeld ist darauf zu verweisen, dass<br />
selbst dann, wenn <strong>der</strong> Schutzbereich dieser Gewährleistung berührt<br />
würde, die Belange des Gemeinwohls wie die Vorteile <strong>der</strong> Effektivierung<br />
<strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>gewährung (Kostenersparnis, Beschleunigung etc.) den Ein-<br />
griff in die auch nur um <strong>der</strong> Sache, nicht um ihrer selbst willen gewähr-<br />
leistete richterliche Unabhängigkeit rechtfertigen würden.<br />
Diese grundsätzliche Aussage unterliegt jedoch gewissen Einschrän-<br />
kungen:<br />
- Sofern für einen best<strong>im</strong>mten Personenkreis (etwa bedingt durch<br />
Krankheit) die Nutzung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> nicht möglich bzw.<br />
zumutbar ist, muss in geeigneter Weise sichergestellt sein, dass die<br />
Betroffenen gleichwohl ihrer Kerntätigkeit <strong>der</strong> Rechtsprechung nach-<br />
gehen können.<br />
- Unabhängig davon muss es angesichts <strong>der</strong> nicht zu leugnenden fak-<br />
tischen Gegebenheit, dass schon 100 Seiten nicht am Bildschirm ge-<br />
lesen werden können, geschweige denn mehrere tausend Blatt um-<br />
fassende Großverfahren, möglich bleiben, dass <strong>der</strong> Richter in dem<br />
von ihm für erfor<strong>der</strong>lich gehaltenen Umfang zur Bearbeitung einen<br />
174
Papierausdruck fertigen kann. Dies scheint auch mit Blick auf den<br />
Kernbereich <strong>der</strong> richterlichen Unabhängigkeit geboten, <strong>der</strong> - trotz <strong>der</strong><br />
entgegenstehenden, zuvor dargelegten Gemeinwohlinteressen – je-<br />
denfalls dann verletzt sein dürfte, wenn die zur Nutzung <strong>der</strong> elektro-<br />
nischen <strong>Akte</strong> verpflichtenden Regelungen dazu führen würden, dass<br />
die Qualität <strong>der</strong> Rechtsprechung hierunter leidet.<br />
Daher ist sicherzustellen, dass verwaltungstechnische Regelungen wie<br />
Anweisungen, die auf ein „Ausdruckverbot“ abzielen o<strong>der</strong> letztlich gar<br />
dem Vorwurf <strong>der</strong> „Haushaltsuntreue“ Vorschub leisten könnten, unter-<br />
bleiben.<br />
Lediglich klarstellend ist darauf zu verweisen, dass die obigen Ausfüh-<br />
rungen ausschließlich den inhaltlichen Aspekt <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>narbeit betreffen,<br />
jedoch die Verpflichtung des Richters zur „technischen“ Bearbeitung, et-<br />
wa zur Verwendung eines elektronischen Ladungsformulars, ebenso<br />
unberührt lassen wie die Verpflichtung, elektronische Äußerungen von<br />
Verfahrensbeteiligten, etwa per E-Mail übersandte Schriftsätze, zur<br />
Kenntnis zu nehmen.<br />
Für den staatsanwaltschaftlichen Bereich erscheint eine Verpflichtung<br />
aufgrund <strong>der</strong> bestehenden Weisungsgebundenheit grundsätzlich als un-<br />
problematisch. Jedoch sollten auch in diesem Bereich – wenn auch nur<br />
zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Akzeptanz – Ausweichmöglichkeiten geschaffen wer-<br />
den, sofern dadurch keine innerdienstlichen Belastungen entstehen.<br />
Ein Son<strong>der</strong>problem besteht hinsichtlich <strong>der</strong> Aufteilung <strong>der</strong> Aufgaben zwi-<br />
schen Richter/Staatsanwalt und Geschäftsstelle.<br />
Die Kommission ist sich <strong>der</strong> Tatsache bewusst, dass eine vollständige<br />
Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> die Geschäftsstelle wie auch die<br />
Schreibkanzlei überflüssig machen soll und gerade die in diesem Be-<br />
reich zu erwartenden Personaleinsparungen die Landesjustizverwaltun-<br />
gen veranlassen werden, die Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> mit be-<br />
son<strong>der</strong>er Vehemenz zu forcieren. Sie ist auch <strong>der</strong> Meinung, dass dies<br />
175
grundsätzlich eine Frage <strong>der</strong> innerdienstlichen Organisation ist. Nach ih-<br />
rer Auffassung sind jedoch <strong>im</strong> staatsanwaltschaftlichen wie <strong>im</strong> gerichtli-<br />
chen Bereich die rechtlich geordneten, ihm aus Sachgründen zugeord-<br />
neten Aufgaben des Urkundsbeamten <strong>der</strong> Geschäftsstelle zu wahren.<br />
Exemplarisch sei insoweit auf den Eingangsvermerk auf dem Urteil und<br />
dessen Bedeutung <strong>im</strong> strafrechtlichen Revisionsverfahren (absoluter<br />
Revisionsgrund § 338 Nr. 7 StPO) und die Rechtskraftvermerke verwie-<br />
sen.<br />
Die Kommission sieht es weiterhin als problematisch an, dass bei Ein-<br />
führung des elektronischen Rechtsverkehrs <strong>der</strong> Verwaltungsanteil des<br />
Richters o<strong>der</strong> Staatsanwalts steigen könnte, dieser mit an<strong>der</strong>en Worten<br />
in entsprechendem Umfang seiner Kerntätigkeit entzogen werden könn-<br />
te. Die erhofften Einspareffekte dürften dadurch deutlich relativiert wer-<br />
den.<br />
2. Rechtsanwälte<br />
Weiterhin stellt sich die Frage, ob für Rechtsanwälte, die in Strafverfah-<br />
ren in verschiedenen Funktionen, sei es als Verteidiger, Nebenkläger-<br />
vertreter o<strong>der</strong> Zeugenbeistand auftreten, mit Blick auf die Einführung ei-<br />
ner elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> eine Verpflichtung zur elektro-<br />
nischen Kommunikation geschaffen werden kann. Dies ist wie unter<br />
II 2.1 dargestellt in Österreich bereits <strong>der</strong> Fall.<br />
Verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich insoweit aus den Arti-<br />
keln 12 und 19 Abs. 4 GG. Zwar dürfte insoweit nur eine Berufsaus-<br />
übungsregelung vorliegen bzw. das Recht auf Zugang zum Gericht<br />
durch das Vorschreiben einer best<strong>im</strong>mten Kommunikationsform jeden-<br />
falls nicht in seinem Kerngehalt verletzt sein, jedoch ist zweifelhaft, ob –<br />
wie dies zum Teil vertreten wird - die Effektivität <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>gewährung<br />
auch in diesem Kontext als rechtfertigen<strong>der</strong> Gemeinwohlbelang heran-<br />
gezogen werden kann. Im <strong>Strafverfahren</strong> ist <strong>der</strong> Rechtsanwalt in ers-<br />
ter Linie als Interessenvertreter seines Mandanten, sei es des Angeklag-<br />
ten, des Nebenklägers o<strong>der</strong> des Zeugen tätig. Zudem handelt es sich<br />
176
um ein Verfahren, das aufgrund des staatlichen Strafverfolgungsan-<br />
spruchs durchzuführen ist und eine Vielzahl von - möglicherweise kom-<br />
plexen - Verfahrenskonstellationen zum Inhalt haben kann. Insoweit un-<br />
terscheidet sich <strong>der</strong> Strafprozess grundlegend vom Handelsregister,<br />
Grundbuch- o<strong>der</strong> Mahnverfahren, für die entsprechende gesetzliche<br />
Verpflichtungen geschaffen worden sind, und in denen nach <strong>der</strong> Partei-<br />
max<strong>im</strong>e ein in weiten Teilen schematisiertes Verfahren zu durchlaufen<br />
ist. Zudem werden in jenem Bereich häufig Notare tätig, denen schon<br />
wegen ihres öffentlichen Amtes eine Verpflichtung eher zugemutet wer-<br />
den kann.<br />
Die Kommission ist daher <strong>der</strong> Auffassung, dass <strong>der</strong>zeit eine gesetzliche<br />
Verpflichtung für den Bereich des <strong>Strafverfahren</strong>s grundsätzlich nicht<br />
geschaffen werden kann.<br />
Ob sich mit fortschreiten<strong>der</strong> „Elektronisierung“ des Rechtsverkehrs ins-<br />
gesamt Anlass zu einer abweichenden Beurteilung ergibt, kann <strong>der</strong>zeit<br />
nicht hinreichend sicher beurteilt werden. Gegebenenfalls könnte eine<br />
sachgerechte Entwicklung durch Übergangsregelungen geför<strong>der</strong>t wer-<br />
den, etwa dahingehend, dass für einen überschaubaren abgrenzbaren<br />
Kreis von Anwälten quasi eine „Pilotierung“ durchgeführt wird, wobei<br />
sich allerdings das Folgeproblem sachgerechter Abgrenzungskriterien<br />
stellt.<br />
Gleichwohl dürfte auch ohne rechtliche Verpflichtung eine Tendenz zur<br />
elektronischen Kommunikation bestehen, erst recht dann, wenn die e-<br />
lektronische <strong>Akte</strong> den „Normfall“ darstellt und alle Verfahrensbeteiligten<br />
ein Interesse daran haben, ohne aufwändige und kostenintensive Trans-<br />
formationen untereinan<strong>der</strong> zu kommunizieren. Insbeson<strong>der</strong>e dürften in<br />
Verfahren, in denen große Datenmengen zu verarbeiten sind (z. B. Wirt-<br />
schaftsstrafsachen) schon die verbesserten Aufbereitungsmöglichkeiten<br />
den in diesem Bereich tätigen Rechtsanwalt veranlassen, am elektroni-<br />
schen Rechtsverkehr nicht nur teilzunehmen, son<strong>der</strong>n sogar seine eige-<br />
ne <strong>Akte</strong>nführung entsprechend einzurichten.<br />
177
Die Kommission vertritt die Auffassung, dass vom Grundsatz <strong>der</strong> Un-<br />
möglichkeit zur rechtlichen Verpflichtung dann eine Ausnahme gemacht<br />
werden könnte, wenn standardisierte Kommunikationen in Rede stehen,<br />
wobei ein solcher Anwendungsbereich in <strong>Strafverfahren</strong> allerdings eher<br />
klein sein dürfte. Zu denken wäre etwa an <strong>Akte</strong>neinsichtsgesuche, Gel-<br />
tendmachung von Kosten, Zustellungen etc. Insoweit stellt sich jedoch<br />
die Frage, ob für einen <strong>der</strong>art kleinen Teilbereich die entstehenden Kos-<br />
ten zum erzielten Nutzen noch <strong>im</strong> Verhältnis stehen.<br />
Nach alledem sollte von rechtlichen Verpflichtungsregelungen insgesamt<br />
abgesehen werden, denn es ist zu erwarten, dass durch die tatsächli-<br />
chen Rahmenbedingungen ein faktischer Zwang zur Teilnahme am e-<br />
lektronischen Rechtsverkehr entsteht. Sofern ein Bedürfnis dafür gese-<br />
hen wird, diese Entwicklung zu forcieren, könnten Anreize über ein Ge-<br />
bührensystem geschaffen werden, das die elektronische Kommunikation<br />
auf die eine o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Weise, finanziell honoriert.<br />
In jedem Fall wäre dafür Sorge zu tragen, dass <strong>im</strong> Bereich <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> ein<br />
einheitliches EDV-System Verwendung findet. Dass es dem Rechtsan-<br />
walt an<strong>der</strong>enfalls nicht zugemutet werden könnte, jedwedes bei irgend-<br />
einer <strong>Justiz</strong>behörde verwendete System bei sich vorzuhalten, liegt auf<br />
<strong>der</strong> Hand. Er wird umso eher zu entsprechenden Investitionen bereit<br />
sein, je häufiger sein System Verwendung finden kann.<br />
3. Privatpersonen und private Institutionen<br />
Private Personen, etwa <strong>der</strong> Angeklagte, <strong>der</strong> Nebenkläger, <strong>der</strong> Zeuge,<br />
können nach dem <strong>der</strong>zeitigen Verfassungsverständnis nicht zum elekt-<br />
ronischen Rechtsverkehr verpflichtet werden. Hier gilt Art. 19 Abs. 4 GG,<br />
wonach <strong>der</strong> Zugang zum Gericht nicht unnötig erschwert werden darf, in<br />
beson<strong>der</strong>em Maße. Ebenso ist <strong>der</strong> Aspekt des rechtlichen Gehörs<br />
(Art. 103 GG) ins Feld zu führen.<br />
Auch bei diesem Personenkreis wird jedoch die zunehmende Elektroni-<br />
sierung des gesamten Lebensumfeldes zu einer verstärkten Wahrneh-<br />
178
mung bestehen<strong>der</strong> Möglichkeiten zur elektronischen Kommunikation<br />
führen.<br />
Im beson<strong>der</strong>en Maße gilt dies für private Institutionen (z. B. Versiche-<br />
rungen), die bereits jetzt in weitem Umfang „elektronisiert“ sind und ein<br />
entsprechendes gesteigertes Interesse daran haben werden, elektroni-<br />
sche Informationen senden und auch erhalten zu können. Auch hier<br />
könnte diese Tendenz durch „Bonus-Malus-Systeme geför<strong>der</strong>t werden.<br />
In diesem Bereich wäre auch am ehesten an eine gesetzliche Verpflich-<br />
tung zu denken, wobei eine solche bei faktisch flächendecken<strong>der</strong> Nut-<br />
zung <strong>der</strong> elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten dann allerdings<br />
fast wie<strong>der</strong> überflüssig wäre.<br />
4. Staatliche Institutionen<br />
Staatliche Institutionen, die eine Amtsträgereigenschaft haben, z. B. Fi-<br />
nanzbehörden, können demgegenüber <strong>im</strong> Rahmen ihrer Rechtsordnun-<br />
gen bereits jetzt zur Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr ge-<br />
zwungen werden.<br />
5. Sachverständige<br />
Eine gewisse Zwitterstellung nehmen die Sachverständigen ein. Hier<br />
hängt es von ihrem Rechtsstatus ab, ob eine gesetzliche Verpflichtung<br />
möglich ist. Soweit sie unter diesem Gesichtspunkt den Privaten zuzu-<br />
ordnen sind, etwa ein nie<strong>der</strong>gelassener Psychiater als Sachverständi-<br />
ger, gelten die obigen diesbezüglichen Ausführungen. Demgegenüber<br />
ist <strong>der</strong> Sachverständige einer öffentlichen Behörde, etwa <strong>der</strong> Amtsarzt,<br />
wie diese zu behandeln.<br />
179
VII. Spannungsfeld von elektronischem <strong>Strafverfahren</strong> und Verfahrensrechten<br />
<strong>der</strong> Verfahrensbeteiligten (Beschuldigte, Opfer,<br />
Nebenkläger, Strafverteidigung)<br />
1. <strong>Akte</strong>neinsichtsrecht<br />
Ein wesentliches Verfahrensrecht <strong>der</strong> Strafprozessordnung ist das Recht auf<br />
<strong>Akte</strong>neinsicht.<br />
1.1 Der Beschuldigte und sein Verteidiger<br />
Gemäß § 147 Abs. 1 StPO ist <strong>der</strong> Verteidiger befugt, die <strong>Akte</strong>n, die dem<br />
Gericht vorliegen o<strong>der</strong> diesem <strong>im</strong> Fall <strong>der</strong> Anklageerhebung vorzulegen<br />
wären, einzusehen sowie amtlich verwahrte Beweisstücke zu besichti-<br />
gen. Nach Abs. 4 dieser Vorschrift sollen dem Verteidiger, soweit nicht<br />
wichtige Gründe entgegenstehen, die <strong>Akte</strong>n mit Ausnahme <strong>der</strong> Be-<br />
weisstücke zur Einsichtnahme in seine Geschäftsräume o<strong>der</strong> in seine<br />
Wohnung mitgegeben werden.<br />
Der Beschuldigte selbst hat kein eigenes <strong>Akte</strong>neinsichtsrecht (Meyer-<br />
Goßner, StPO, 50. Aufl. § 147 Rdnr. 3). Ihm können jedoch Auskünfte<br />
und Abschriften aus den <strong>Akte</strong>n erteilt werden, soweit nicht <strong>der</strong> Untersu-<br />
chungszweck gefährdet werden könnte und nicht überwiegende schutz-<br />
würdige Interessen Dritter (z. B. gefährdeter Zeugen, Belange <strong>der</strong> Int<strong>im</strong>-<br />
sphäre, Geschäfts- o<strong>der</strong> Betriebsgehe<strong>im</strong>nisse) entgegenstehen (§ 147<br />
Abs. 7 StPO).<br />
Diese grundlegenden Verfahrensrechte dürfen durch die elektronische<br />
<strong>Akte</strong> keine Einschränkung erfahren.<br />
- Es ist daher sicherzustellen, dass <strong>der</strong> Verteidiger wie bisher vollum-<br />
fänglich vom <strong>Akte</strong>ninhalt Kenntnis erlangt, d. h. die elektronische Ak-<br />
te muss vollständig sein. Sie muss den gesamten Prozessstoff ein-<br />
schließlich <strong>der</strong> in Papierform eingereichten Unterlagen enthalten. Im<br />
Falle eines Papierausdruckes muss dieser sämtliche elektronisch<br />
eingereichten Dokumente umfassen.<br />
180
- Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass <strong>im</strong> Bedarfsfall Zugang<br />
auch zu den in Papierform eingereichten und aufbewahrten Unterla-<br />
gen <strong>im</strong> Original („Tüteninhalt“) besteht.<br />
Probleme könnten in diesem Zusammenhang auftreten, wenn <strong>Akte</strong>nein-<br />
sicht durch das Gericht zu gewähren ist, bei dem die elektronische <strong>Akte</strong><br />
geführt wird, während sich die „Tüten“ bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft o<strong>der</strong><br />
gar noch bei <strong>der</strong> Polizei befinden. Der Grundsatz des fairen Verfahrens<br />
könnte tangiert sein, wenn es dem Verteidiger auferlegt würde, sich an<br />
mehrere Stellen zu wenden, um sich die <strong>Akte</strong>n quasi „zusammenzusu-<br />
chen“. An<strong>der</strong>erseits dürfte die Zahl <strong>der</strong> Fälle, in denen <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong><br />
<strong>Akte</strong>neinsicht auf die „Tütendokumente“ Zugriff genommen werden wird,<br />
eher die Ausnahme darstellen, da die elektronische <strong>Akte</strong> – wie oben<br />
dargelegt – auch <strong>der</strong>en Inhalt vollständig wi<strong>der</strong>spiegeln muss. Insoweit<br />
ist damit zu rechnen, dass möglicherweise zunächst vorhandenes Miss-<br />
trauen bezüglich einer exakten Wie<strong>der</strong>gabe des Originals in <strong>der</strong> elektro-<br />
nischen <strong>Akte</strong> schwinden wird, so dass <strong>der</strong> Problematik insgesamt keine<br />
größere Bedeutung zukommen dürfte. Sie könnte <strong>im</strong> Übrigen dadurch<br />
gelöst werden, dass die <strong>Akte</strong>neinsicht gewährende Stelle verpflichtet<br />
wird, auch den Zugriff auf die „Tüteninhalt“ organisatorisch zu bewerk-<br />
stelligen.<br />
In technischer Hinsicht könnte die <strong>Akte</strong>neinsicht durch Übersendung ei-<br />
nes Datenträgers (etwa einer CD bzw. DVD) o<strong>der</strong> durch „Überspielen“<br />
<strong>der</strong> Daten bzw. <strong>im</strong> Wege des sogenannten „Fernabrufs“, d. h. dadurch<br />
erfolgen, dass <strong>der</strong> Rechtsanwalt Zugriff auf die elektronische <strong>Akte</strong> erhält.<br />
Letztere Möglichkeiten erscheinen insoweit vorzugswürdig, als sie die<br />
Einsicht in eine taggenau aktualisierte <strong>Akte</strong> ermöglichen und Kopier- und<br />
Versandkosten entfallen.<br />
Soweit <strong>der</strong> Verteidiger nicht über die entsprechende Technik verfügt,<br />
müsste ihm ein Papierausdruck zur Verfügung gestellt werden, da er –<br />
wie oben dargelegt – nicht zur Teilnahme am elektronischen Rechtsver-<br />
kehr verpflichtet werden kann.<br />
181
Gegebenenfalls kann <strong>Akte</strong>neinsicht auch auf <strong>der</strong> Geschäftsstelle <strong>der</strong>ge-<br />
stalt gewährt werden, dass <strong>der</strong> gespeicherte Text über den Bildschirm<br />
sichtbar gemacht wird, wobei dies jedoch spätestens in Großverfahren<br />
keine praktikable und mit Blick auf eine effektive Verteidigung auch<br />
rechtlich fragwürdige Alternative darstellen dürfte.<br />
1.2 Sicherheitsprobleme<br />
Die Einsicht in eine elektronische <strong>Akte</strong> wirft zahlreiche Sicherheitsprob-<br />
leme auf.<br />
Ein Zugriff Unbefugter auf die übermittelten <strong>Akte</strong>ninhalte ist weitest-<br />
möglich auszuschließen. Sowohl die Versendung einer CD/DVD <strong>im</strong><br />
Postwege als auch das Internet weisen insoweit spezifische Probleme<br />
auf.<br />
Die Kommission vertritt die Auffassung, dass eine elektronische Versen-<br />
dung aus den oben genannten Gründen wünschenswert ist, so dass –<br />
soweit dies sicherheitstechnisch möglich ist – dieser <strong>der</strong> Vorzug vor <strong>der</strong><br />
nicht weniger risikobehafteten postalischen Versendung von Datenträ-<br />
gern gegeben werden sollte.<br />
Daher ist eine Grundvoraussetzung für die Einführung <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong>, dass das Problem <strong>der</strong> Verschlüsselung bei <strong>der</strong> Kommunika-<br />
tion zwischen den Verfahrensbeteiligten insgesamt gelöst wird.<br />
Im Falle <strong>der</strong> Gewährung von <strong>Akte</strong>neinsicht <strong>im</strong> Wege des „Fernabrufs“,<br />
bei dem <strong>der</strong> Verteidiger Zugriff auf die <strong>im</strong> Computersystem <strong>der</strong> aktenfüh-<br />
renden Stelle gespeicherten elektronischen <strong>Akte</strong> enthält, ist technisch<br />
sicherzustellen, dass tatsächlich lediglich ein Zugriff erfolgt und keinerlei<br />
Manipulationsmöglichkeiten bestehen.<br />
Hinsichtlich des Datenschutzes darf die Elektronisierung <strong>der</strong> Kommuni-<br />
kation <strong>im</strong> Rechtsverkehr nicht dazu führen, dass die bislang geltenden<br />
Standards unterschritten werden.<br />
182
Zwar ist die Gefahr <strong>der</strong> Kenntnisnahme Unbefugter von schutzwürdigen<br />
Daten wohl eher niedriger, jedenfalls nicht höher einzustufen als be<strong>im</strong><br />
herkömmlichen Schriftverkehr, da – soweit ersichtlich – effektive techni-<br />
sche Sicherungsmöglichkeiten bestehen, jedoch bedarf dieser äußerst<br />
sensible Bereich einer beson<strong>der</strong>en Aufmerksamkeit, da - wie die aktuelle<br />
Diskussion um die „elektronische Steuernummer“ zeigt - insoweit erheb-<br />
liche Befürchtungen bestehen, die einer flächendeckenden Akzeptanz<br />
dieser Kommunikationsform entgegenstehen könnten.<br />
Lediglich ergänzend sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen,<br />
dass die elektronische <strong>Akte</strong> die „He<strong>im</strong>arbeit“ begünstigt, so dass auch<br />
am He<strong>im</strong>arbeitsplatz des Richters dieselbe Datensicherheit wie be<strong>im</strong><br />
Dienstarbeitsplatz zu gewährleisten ist.<br />
Spezifische Probleme weist die Weitergabe von <strong>Akte</strong>n(Bestandteilen) in<br />
elektronischer Form an den Beschuldigten auf. Eine solche kann häufig<br />
aus vielerlei Gründen, etwa in Großverfahren o<strong>der</strong> in Verfahren, in de-<br />
nen bereits die Tat selbst digital begangen wurde (z. B. alle Formen <strong>der</strong><br />
Computerkr<strong>im</strong>inalität) jedenfalls zweckmäßig, wenn nicht gar rechtlich<br />
geboten sein.<br />
Es ist grundsätzlich die Entscheidung des Verteidigers, ob und wie er<br />
dem Mandanten den <strong>Akte</strong>ninhalt bekannt macht.<br />
Problematisch erscheinen in diesem Zusammenhang jedoch Fälle, in<br />
denen <strong>der</strong> Beschuldigte missbräuchlich sensible <strong>Akte</strong>nbestandteile, etwa<br />
Opferfotos, Geschäftsdaten etc. an die Presse weiterleitet o<strong>der</strong> sogar<br />
dem allgemeinen Zugriff durch Veröffentlichung <strong>im</strong> Internet preisgibt.<br />
Hier kann es zu einem Spannungsverhältnis zwischen Opferschutzge-<br />
sichtspunkten und Beschuldigtenrechten kommen, das zwar auch be-<br />
reits jetzt bei <strong>der</strong> Papierakte besteht. Jedoch stellt die <strong>im</strong> Vergleich zum<br />
Papier, das erst für die elektronische Weiterleitung aufbereitet werden<br />
muss, bestehende leichtere Weitergabemöglichkeit zwar keine substan-<br />
ziell an<strong>der</strong>sartige, jedoch eine graduell höhere Gefahr dar, <strong>der</strong> effektiv<br />
entgegenzuwirken ist.<br />
183
Für den Fall von Aufzeichnungen auf Bild-Tonträgern zeigen das Wi<strong>der</strong>-<br />
spruchsrecht des Zeugen gemäß § 58 a Abs. 3 StPO und die Regelung<br />
des § 58 Abs. 2 Satz 4 StPO (Verbot <strong>der</strong> Vervielfältigung und Weiterga-<br />
be) Lösungsansätze auf, die gegebenenfalls sinngemäß auf an<strong>der</strong>e<br />
sensible <strong>Akte</strong>nbestandteile übertragen werden könnten. Entsprechende<br />
<strong>Akte</strong>nbestandteile könnten mit einem „Sperrvermerk“ versehen werden<br />
mit <strong>der</strong> Folge, dass diese nicht elektronisch übermittelt, son<strong>der</strong>n lediglich<br />
auf <strong>der</strong> Geschäftsstelle eingesehen werden könnten. Auch könnten die<br />
Weitergabemöglichkeiten des Verteidigers gesetzlich beschränkt wer-<br />
den. Zu diskutieren wären schließlich Sanktionsmöglichkeiten gegen-<br />
über dem sich missbräuchlich verhaltenden Angeklagten, etwa durch<br />
Erweiterung des § 353 d StGB.<br />
Für die Rechte des Beschuldigten aus Art. 147 Abs. 7 StPO auf Aus-<br />
kunft und Abschriften aus den <strong>Akte</strong>n stellen sich keine beson<strong>der</strong>en Prob-<br />
leme. Da er nicht zur elektronischen Kommunikation gezwungen werden<br />
kann, vgl. oben A III.) ist zu gewährleisten, dass <strong>im</strong> Bedarfsfalle Papier-<br />
ausdrucke <strong>der</strong> relevanten <strong>Akte</strong>nteile hergestellt werden.<br />
1.3 Sonstige Verfahrensbeteiligte<br />
<strong>Akte</strong>neinsicht erhalten <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> weiterhin die Verfahrens-<br />
bevollmächtigten des Privatklägers (§ 385 Abs. 3 StPO), des Nebenklä-<br />
gers (§ 397 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 385 Abs. 3 StPO), des<br />
Einziehungs- und Verfallsbeteiligten (§ 434 Abs. 1 Satz 2, § 442 Abs. 1<br />
StPO), des Verletzten (§ 406 e StPO) und des Antragstellers in den Ver-<br />
fahren nach §§ 23 ff. EGGVG sowie § 109 StVollzG, des Weiteren ge-<br />
mäß § 474 StPO <strong>Justiz</strong>behörden und an<strong>der</strong>e öffentliche Stellen, nach<br />
§ 395 AO die Finanzbehörde <strong>im</strong> Steuerstrafverfahren und gemäß § 475<br />
StPO Privatpersonen und sonstige Stellen über einen Rechtsanwalt.<br />
In diesem Zusammenhang hat weiterhin <strong>der</strong> Sachverständige Erwäh-<br />
nung zu finden, dem § 80 Abs. 2 StPO ein <strong>Akte</strong>neinsichtsrecht einräumt.<br />
184
Da Unterschiede lediglich <strong>im</strong> Hinblick auf den Umfang und die Voraus-<br />
setzungen des <strong>Akte</strong>neinsichtsrechts bestehen, ergeben sich in den vor-<br />
genannten Fällen keine über die zuvor dargelegten hinausgehenden be-<br />
son<strong>der</strong>en Probleme, die in <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> als solcher ihre Ur-<br />
sache haben, so dass sinngemäß auf die obigen Ausführungen verwie-<br />
sen werden kann. Beson<strong>der</strong>s hingewiesen werden soll jedoch auf den<br />
Umstand, dass die oben beschriebene Missbrauchsgefahr bei Weiterga-<br />
be <strong>der</strong> Daten in gleicher Weise für sensible Daten des Beschuldigten,<br />
etwa aus psychiatrischen Sachverständigengutachten, besteht und die-<br />
ser entsprechend entgegenzuwirken ist.<br />
Da private Personen einschließlich ihrer Bevollmächtigten nicht zur Teil-<br />
nahme am elektronischen Rechtsverkehr gezwungen werden können<br />
(vgl. VI. 2. u. 3.), ist die Verschriftlichung des <strong>Akte</strong>ninhalts rechtlich, or-<br />
ganisatorisch und finanziell zu gewährleisten.<br />
Soweit justiznahe und private Stellen und Einrichtungen (exemplarisch<br />
sei auf die <strong>Justiz</strong>vollzugsanstalt, die Bewährungshilfe, die Jugendge-<br />
richtshilfe, die AOK, die Agentur für Arbeit verwiesen) aus den <strong>Akte</strong>n In-<br />
formationen benötigen und beanspruchen können, ist beson<strong>der</strong>es Au-<br />
genmerk darauf zu richten, dass ihnen lediglich die Informationen zur<br />
Verfügung gestellt werden, die für ihre Aufgabenerfüllung unerlässlich<br />
sind. Sensible Daten (etwa des Beschuldigten hinsichtlich Art und Ein-<br />
zelheiten seiner Tat, z. B. eines Sexualdelikts, bei Mitteilungen an die<br />
gemeinnützige Arbeit vermittelnde Stelle) müssen in dem erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Umfang geschützt werden.<br />
2. Anwesenheitsrechte und daran anknüpfende sonstige Verfahrens-<br />
rechte<br />
Die StPO sieht weiterhin in einer Vielzahl von Fällen Anwesenheitsrech-<br />
te <strong>der</strong> Verfahrensbeteiligten vor, zum einen bereits <strong>im</strong> Ermittlungsverfah-<br />
ren (etwa § 168 c StPO, auch in Verbindung mit § 163 a Abs. 3 Satz 2<br />
StPO sowie § 168 d StPO für Beschuldigte und Verteidiger, § 406 f<br />
Abs. 2 StPO für den Rechtsbeistand des nicht nebenklageberechtigten<br />
185
Verletzten), insbeson<strong>der</strong>e aber auch in <strong>der</strong> Hauptverhandlung, an <strong>der</strong><br />
neben dem Beschuldigten und dem Verteidiger auch <strong>der</strong> Privatkläger,<br />
<strong>der</strong> Nebenkläger (§ 397 Abs. 1 mit den Mitwirkungsrechten des § 397<br />
Abs. 1 Satz 3 StPO), ebenso dessen Verfahrensbevollmächtigter (§ 397<br />
Abs. 1 Satz 2, § 378 StPO) und <strong>der</strong> nebenklageberechtigte Verletzte und<br />
sein Bevollmächtigter (§ 406 g StPO) teilnehmen können, denen das<br />
Gesetz hieran anknüpfend unterschiedliche Informations-, Antrags- und<br />
Äußerungsrechte zuerkennt. Für den Sachverständigen räumt § 80<br />
StPO Anwesenheits- und Fragerechte ein.<br />
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass in be-<br />
st<strong>im</strong>mten Verfahrensarten die Anwesenheit spezifischer Verfahrensbe-<br />
teiligter (etwa <strong>der</strong> Jugendgerichtshilfe und <strong>der</strong> Erziehungsberechtigten in<br />
Jugendstrafsachen (§§ 38, 50, 67 JGG) regelmäßig erfor<strong>der</strong>lich ist und<br />
diesen verschiedenen Beteiligungsrechte zukommen.<br />
Festzuhalten ist insoweit zunächst, dass das Recht auf Anwesenheit als<br />
solches durch die Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> nicht beeinträch-<br />
tigt wird.<br />
Soweit jedoch die Nachvollziehbarkeit <strong>der</strong> Verhandlung sowie die Aus-<br />
übung <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Anwesenheit verbundenen Rechte (z. B. des Frage-<br />
rechts, des Beweisantragsrechts, des Ablehnungsrechts) o<strong>der</strong> auch die<br />
Wahrnehmung <strong>der</strong> Aufgabe, z. B. <strong>der</strong> Jugendgerichtshilfe o<strong>der</strong> des<br />
Sachverständigen, die Kenntnis best<strong>im</strong>mter <strong>Akte</strong>ninhalte erfor<strong>der</strong>lich<br />
macht, die mündlich nicht sachgerecht kommuniziert werden können<br />
(z. B. <strong>der</strong> Inhalt von Bilanzen), ist den Verfahrensbeteiligten in geeigne-<br />
ter Weise <strong>der</strong> Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen. Dies<br />
kann durch Gewährung von Einsicht auf den Computerbildschirm <strong>der</strong><br />
Vernehmungsperson bzw. am Richtertisch o<strong>der</strong> in geeigneten Fällen,<br />
etwa bei größerem Umfang <strong>der</strong> Informationen und insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong><br />
Hauptverhandlung, über einen Beamer erfolgen.<br />
186
3. Geltendmachung von Verfahrensrechten<br />
Zur effektiven Geltendmachung von Verfahrensrechten bedarf es wei-<br />
terhin einer effektiven Kommunikation aller Verfahrensbeteiligten unter-<br />
einan<strong>der</strong>.<br />
Insoweit ist zunächst festzuhalten, dass Verfahrensbeteiligte, die nicht<br />
zur elektronischen Kommunikation verpflichtet werden können, nach wie<br />
vor die Gelegenheit erhalten müssen, Anträge und Erklärungen in Pa-<br />
pierform einzureichen, denn es dürfen für diesen Personenkreis, insbe-<br />
son<strong>der</strong>e Naturalparteien – auch faktisch – keine unzumutbaren Zu-<br />
gangsbeschränkungen geschaffen werden. Ebenso ist eine Übersen-<br />
dung behördlicher/gerichtlicher Dokumente in Papierform in entspre-<br />
chenden Fällen zu gewährleisten.<br />
Soweit sie an <strong>der</strong> elektronischen Kommunikation teilnehmen, stellt sich<br />
die Frage <strong>der</strong> Authentizität <strong>der</strong> Erklärung.<br />
Augenfällig tritt dieses Problem dort in Erscheinung, wo best<strong>im</strong>mte<br />
Rechte schriftlich abzufassende o<strong>der</strong> zu unterzeichnende Erklärungen<br />
und Anträge for<strong>der</strong>n (z. B. Rechtsmittel wie § 314, § 341 StPO).<br />
Nach geltendem Recht sieht § 41 a StPO für Fälle wie die hier in Rede<br />
stehenden eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signatur-<br />
gesetz vor. Diese hat sich jedoch in <strong>der</strong> bisherigen Praxis als untauglich<br />
erwiesen. Es ist daher für diese Fälle eine Lösung zu finden, die –<br />
jedenfalls mit annähernd gleicher Sicherheit – die Authentizität gewähr-<br />
leistet.<br />
Die Kommission hat in diesem Zusammenhang verschiedene Lösungen<br />
erörtert und hält die eingescannte handschriftliche Unterschrift für eine<br />
tragfähige Lösung des Problems, mit <strong>der</strong> <strong>im</strong> Übrigen auch zu Protokoll<br />
des Urkundsbeamten <strong>der</strong> Geschäftsstelle abgegebene Erklärungen au-<br />
torisiert werden könnten.<br />
187
Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß für Zustellungsur-<br />
kunden und Empfangsbekenntnisse.<br />
Bei Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> sollte auch <strong>der</strong> Zustellungs-<br />
nachweis elektronisch, entsprechend den zuvor aufgezeigten techni-<br />
schen Möglichkeiten, erbracht werden können. Da jedoch in weitem Um-<br />
fang nach wie vor die Einreichung von Zustellungsnachweisen in Papier-<br />
form möglich sein muss, ist dafür Sorge zu tragen, dass entsprechende<br />
Schriftstücke <strong>der</strong> jeweiligen <strong>Akte</strong> korrekt zugeordnet werden. Im Bereich<br />
des Ordnungswidrigkeitenverfahrens sind bereits jetzt in Teilbereichen<br />
Zustellungsurkunden mit <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> zugeordneten Barcodes versehen.<br />
Das Originaldokument ist aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen.<br />
Spezifische Probleme birgt zudem <strong>der</strong> Einsatz <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
bzw. <strong>der</strong> elektronische Rechtsverkehr für den Fall, dass <strong>der</strong> Beschuldig-<br />
te sich in Untersuchungshaft befindet.<br />
Hier wird sich über kurz o<strong>der</strong> lang die Frage stellen, ob trotz <strong>der</strong> damit<br />
verbundenen Sicherheitsprobleme dem Gefangenen ein Computer in<br />
<strong>der</strong> Haftzelle zur Verfügung gestellt werden muss. Zum einen ist diesbe-<br />
züglich an die Fälle zu denken, in denen <strong>der</strong> Beschuldigte zur effektiven<br />
Verteidigung Zugang zu umfangreichem Datenmaterial benötigt, das ihm<br />
sinnvollerweise nur in elektronischer Form zugänglich gemacht werden<br />
kann (z. B. in großen Wirtschaftsstrafverfahren). Zum an<strong>der</strong>en ist auch<br />
denkbar, dass <strong>der</strong> Gefangene, etwa zur schnelleren Kommunikation mit<br />
dem Verteidiger, aber auch mit dem Gericht die elektronischen Medien<br />
nutzen möchte. Hier könnte etwa für die nicht überwachte Verteidiger-<br />
post die Einrichtung eines eigenen E-Mail-Postfachs in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>voll-<br />
zugsanstalt in Frage kommen. Ob er für eigene Schreiben an den Ver-<br />
teidiger jedoch auf die Nutzung eines allgemeinen, in <strong>der</strong> Verwaltung <strong>der</strong><br />
<strong>Justiz</strong>vollzugsanstalt befindlichen Computers verwiesen werden kann,<br />
dürfte mit Blick auf den ungehin<strong>der</strong>ten/unüberwachten Verkehr zwischen<br />
Beschuldigten und Verteidiger jedoch mehr als fraglich sein.<br />
188
VIII. Spannungsfeld von staatsanwaltlicher/richterlicher<br />
Überzeugungsbildung und elektronischer <strong>Akte</strong><br />
1. Vorbemerkung<br />
Sowohl die staatsanwaltschaftliche wie auch die richterliche Überzeu-<br />
gungsbildung sind <strong>im</strong> Rahmen des strafrechtlichen Verfahrens dann von<br />
Bedeutung, wenn <strong>der</strong> Staatsanwalt o<strong>der</strong> Richter auf <strong>der</strong> Grundlage des<br />
ihm zur Verfügung stehenden Verfahrensstoffes darüber zu entscheiden<br />
hat,<br />
- ob das Verfahren bei ihm weiter geführt wird,<br />
- wie das Verfahren bei ihm weiter geführt wird,<br />
- ob er eine (ermittlungs- o<strong>der</strong> hauptverfahrens-) interne o<strong>der</strong> abschlie-<br />
ßende Entscheidung trifft und gegebenenfalls<br />
- welchen Inhalt die (ermittlungs- o<strong>der</strong> hauptverfahrens-) abschließende<br />
o<strong>der</strong> interne Entscheidung hat.<br />
Die Art und Weise, wie <strong>der</strong> Staatsanwalt o<strong>der</strong> Richter seine Überzeu-<br />
gung, die <strong>der</strong> Entscheidung zu Grunde liegt, zu bilden hat, ist lediglich in<br />
§ 261 StPO für die Urteilsfindung durch den Richter explizit erwähnt.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> übrigen Entscheidungsfindungen ist <strong>der</strong> Staatsanwalt<br />
o<strong>der</strong> Richter jedoch dennoch nicht frei in seiner Entscheidung, son<strong>der</strong>n<br />
jedenfalls an die an<strong>der</strong>en Verfahrensvorschriften gebunden. Diese<br />
best<strong>im</strong>men zwar nicht ausdrücklich, wie <strong>der</strong> Staatsanwalt o<strong>der</strong> Richter<br />
seine Überzeugung zu bilden hat; sie best<strong>im</strong>men aber, vom Vorliegen<br />
welcher Voraussetzungen sich <strong>der</strong> Staatsanwalt o<strong>der</strong> Richter zu über-<br />
zeugen hat (beispielsweise vom Vorliegen einzelner Verdachtsgrade als<br />
Voraussetzung für best<strong>im</strong>mte Maßnahmen). Unabhängig davon, wie er<br />
sich also eine Überzeugung bildet, ist somit zwar nicht die Überzeu-<br />
gungsbildung selbst geregelt und überprüfbar, regelmäßig überprüfbar<br />
ist aber das Ergebnis <strong>der</strong> Überzeugungsbildung.<br />
Unter Berücksichtigung dieses Rahmens <strong>der</strong> staatsanwaltschaftlichen<br />
und richterlichen Überzeugungsbildung stellt sich die Frage, ob diese<br />
189
Überzeugungsbildung <strong>der</strong>zeit auf Grundlagen beruht, die durch die Ein-<br />
führung einer elektronischen Verfahrensakte beeinflusst werden würden.<br />
Bejahendenfalls wäre zu prüfen, ob die Beeinflussung mit <strong>der</strong> bisherigen<br />
Systematik des Strafprozessrechts in Einklang steht. Nur wenn ein Wi-<br />
<strong>der</strong>spruch festzustellen wäre, wäre weiter zu prüfen, ob und gegebenen-<br />
falls auf welchem Weg dieser Wi<strong>der</strong>spruch gelöst werden sollte/könnte.<br />
Diese Prüfung erfolgt nachfolgend entsprechend dem üblichen Ablauf<br />
des strafrechtlichen Ermittlungs- und Hauptverfahrens.<br />
2. Das Ermittlungsverfahren<br />
2.1 Überzeugungsbildung des Staatsanwalts<br />
2.1.1 Allgemeine Problemstellungen<br />
Sowohl aus dem Legalitätsprinzip des § 152 Abs. 2 StPO wie auch aus<br />
§ 160 Abs. 1 StPO folgt, dass das Ermittlungsverfahren einzuleiten ist,<br />
wenn die Staatsanwaltschaft - auf welchem Weg auch <strong>im</strong>mer - von dem<br />
Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält. Dieser Verfolgungszwang be-<br />
steht unabhängig davon, ob die Staatsanwaltschaft selbst Adressat einer<br />
Anzeige ist o<strong>der</strong> auf welchem Weg sie ansonsten Kenntnis von dem<br />
Verdacht erhält. Meist erhält sie die Kenntnis nach entsprechenden<br />
(Vor)ermittlungen durch die Polizei (§ 163 StPO).<br />
In diesem Verfahrensstadium ergibt sich aus einer elektronischen <strong>Akte</strong><br />
keine Beson<strong>der</strong>heit. Es kann sowohl die Anzeige bereits elektronisch er-<br />
stattet worden sein, sie kann elektronisch aufgenommen worden sein<br />
o<strong>der</strong> sie kann in eine Dateiform transformiert worden sein, was regelmä-<br />
ßig durch Scannen des Strafanzeigeformulars als Ausgangsobjekt (die-<br />
se Bezeichnung wird <strong>im</strong> Folgenden für alle Dokumente verwendet, die<br />
mittels Scannen in die elektronische <strong>Akte</strong> übertragen worden sind) ge-<br />
schehen wird. Je<strong>der</strong> dieser Wege reicht aus, um mittels <strong>der</strong> digitalen o-<br />
<strong>der</strong> digitalisierten Anzeige die Staatsanwaltschaft zu einer Entschließung<br />
über die Art und Weise des Fortgangs des Verfahrens zu veranlassen.<br />
190
In diesem Verfahrensstadium ist lediglich zu beachten, dass in den Fäl-<br />
len, in denen <strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> als solcher für die Ent-<br />
schließung <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft keine ausreichende Entscheidungs-<br />
grundlage bietet, <strong>der</strong> Rückgriff auf die Gegenstände möglich sein muss,<br />
von <strong>der</strong>en Zustand o<strong>der</strong> Beschaffenheit sich <strong>der</strong> Staatsanwalt für seine<br />
Entschließung zu überzeugen hat. Bei diesen Gegenständen kann es<br />
sich zum einen um die Ausgangsobjekte, zum an<strong>der</strong>en um Asservate<br />
handeln.<br />
2.1.1.1 Asservate:<br />
hierbei sind die Asservate zu unterscheiden, die<br />
- üblicherweise geson<strong>der</strong>t - also außerhalb <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> - aufbewahrt wer-<br />
den; hier ergeben sich wegen <strong>der</strong> ohnehin von <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> getrennten<br />
Aufbewahrung keine Unterschiede zwischen elektronischer <strong>Akte</strong> und<br />
<strong>der</strong> heutigen Papierakte; daneben gibt es aber auch<br />
- die Asservate, die regelmäßig bei <strong>der</strong> Papierakte aufbewahrt werden,<br />
insbeson<strong>der</strong>e Schriftstücke (Verträge, Briefe, geschäftliche Unterla-<br />
gen u. s. w.); werden dem Staatsanwalt solche Dokumente bei einer<br />
elektronischen <strong>Akte</strong> lediglich in gescannter Form zur Kenntnis gege-<br />
ben, kann dies - wenn die Beschaffenheit des Ausgangsobjektes<br />
(nicht dessen Inhalt, <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> erkennbar ist)<br />
von wesentlicher Bedeutung ist - seine Überzeugungsbildung dar-<br />
über, welcher Fortgang dem Verfahren zu geben ist (weitere Ermitt-<br />
lungen o<strong>der</strong> § 170 Abs. 1 StGB mangels hinreichenden Tatver-<br />
dachts) beeinflussen; <strong>im</strong> Fall einer elektronischen <strong>Akte</strong> muss dem-<br />
nach gewährleistet sein, dass jene Ausgangsobjekte dem Staatsan-<br />
walt beispielsweise in Form einer Papier-Beiakte umgehend zur Ver-<br />
fügung gestellt werden können, wenn es für die Überzeugungsbil-<br />
dung und Entschließung des Staatsanwalts auf diese Ausgangsob-<br />
jekte <strong>im</strong> Original ankommt. Als einfachste Lösung erscheint insoweit<br />
die regelmäßige Anlegung von Papier-Beiakten, in die alle Aus-<br />
gangsobjekte zentral aufgenommen werden. Aufgenommen werden<br />
müssen allerdings nur die Unterlagen, die als Papierdokument über<br />
191
ihren bloßen Inhalt - <strong>der</strong> sich nach dem Einscannen auch aus <strong>der</strong> e-<br />
lektronischen <strong>Akte</strong> ergibt - hinaus noch zusätzliche Informationen<br />
beinhalten, die <strong>im</strong> Laufe des Verfahrens bedeutsam werden können<br />
(zum Beispiel Originalunterschriften). Aufgrund solchen beson<strong>der</strong>en<br />
Inhalts können die Ausgangsobjekte selbst <strong>im</strong> Verlauf des Verfah-<br />
rens als Beweismittel benötigt werden, was ihrer vorzeitigen Vernich-<br />
tung entgegensteht. An<strong>der</strong>s als die heutige Papier-<strong>Akte</strong> würde es<br />
sich bei <strong>der</strong> Papier-Beiakte um ein einzelnes Exemplar handeln. Der<br />
Erstellung von Zweit- o<strong>der</strong> mehrfach Ausfertigungen dieser Papier-<br />
<strong>Akte</strong>, die nur die Ausgangsobjekte enthält, hätten aufgrund ihres<br />
ausschließlich vervielfältigten Inhalts keinen Informationswert, <strong>der</strong><br />
über den <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> hinaus ginge. Diese Papier-Beiakte<br />
müsste vorzugsweise mit den Asservaten zentral gelagert und ge-<br />
führt werden und würde nur bei konkreter Anfor<strong>der</strong>ung übersandt.<br />
Einzelheiten hierzu blieben noch zu klären, so zum Beispiel die Fra-<br />
ge, ob die Papier-Beiakte stets zentral bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft ge-<br />
lagert wird o<strong>der</strong> eine Lagerung während des Ermittlungsverfahrens<br />
und nach Abschluss des Hauptverfahrens bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
und während eines Hauptverfahrens bei Gericht erfolgt, o<strong>der</strong> auch<br />
die Frage, ob die Papier-Beiakte auf Anfor<strong>der</strong>ung wegen konkreten<br />
Prüfungsbedarf eines Originals insgesamt übersandt wird o<strong>der</strong> nur<br />
die konkret zu prüfenden <strong>Akte</strong>nbestandteile versandt werden.<br />
In seiner Entscheidung darüber, ob <strong>der</strong> Staatsanwalt ein Ausgangsob-<br />
jekt <strong>im</strong> Original sehen will, muss <strong>der</strong> Staatsanwalt weitestgehend unge-<br />
bunden sein. Einschränkungen dahingehend, dass er beispielsweise auf<br />
eine Augenscheinseinnahme von für seine Entschließung relevantem<br />
Material verzichten muss, wenn sich ein Foto von jenem Material in <strong>der</strong><br />
elektronischen <strong>Akte</strong> befindet, sind unzulässig. Sie würden den Staats-<br />
anwalt in seiner ureigensten Entschließungsfreiheit beeinträchtigen. Dar-<br />
über hinaus könnten sich sogar Amtshaftungsansprüche daraus erge-<br />
ben, dass <strong>der</strong> Staatsanwalt seine Entschließungsgrundlage auf den In-<br />
halt einer elektronischen <strong>Akte</strong> beschränkt, wenn sich bei <strong>der</strong> Augen-<br />
scheinseinnahme von Gegenständen das Fehlen einer Straftat aufge-<br />
drängt hätte und deshalb weitere Eingriffe in die Rechte des Beschuldig-<br />
192
ten ausgeblieben wären. Sachgerecht erscheint es, wenn es insoweit in<br />
das pflichtgemäße Ermessen des Staatsanwalts gestellt wird, die Origi-<br />
nale zur Augenscheinseinnahme abzufor<strong>der</strong>n. Eines freien Ermessens<br />
bedarf es hingegen nicht, weil das Abfor<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Originale kein Selbst-<br />
zweck ist und ein pauschales Abfor<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Originale die wesentlichen<br />
Vorzüge einer elektronischen <strong>Akte</strong> (wenig <strong>Akte</strong>n- und Papierumlauf, Ver-<br />
fahrensbeschleunigung) wie<strong>der</strong> einschränken würde. Letztlich dürfte es<br />
sich insoweit aber ohnehin um ein eher theoretisches Problem handeln:<br />
da die Papier-Beiakte voraussichtlich ohnehin bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
geführt werden müsste, dürfte es kaum einen Fall geben, in dem einem<br />
ermittelnden Staatsanwalt die Einsichtnahme in die Papier-Beiakte ver-<br />
wehrt wird mit <strong>der</strong> Begründung, die Einsichtnahme entspreche nicht sei-<br />
nem pflichtgemäßem Ermessen. Mittelbar relevant kann dieses Problem<br />
allerdings dann werden, wenn sich aus <strong>der</strong> „überflüssigen“ Abfor<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Papier-Beiakte Verfahrensverzögerungen ergeben. Insbeson<strong>der</strong>e in<br />
Haftsachen könnte <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft dann <strong>der</strong> Vorwurf einer<br />
rechtswidrigen Verfahrensverzögerung gemacht werden, wenn schon<br />
<strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ausgereicht hätte, um beispielsweise<br />
den für die Anklageerhebung erfor<strong>der</strong>lichen hinreichenden Tatverdacht<br />
zu begründen. Um insoweit klarzustellen, dass <strong>der</strong> Staatsanwalt die Pa-<br />
pier-Beiakte nur dann zu prüfen hat, wenn er konkreten Anlass zu Zwei-<br />
feln hat, dass <strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> nicht mit dem Aus-<br />
gangsobjekt übereinst<strong>im</strong>mt, könnte sich eine klarstellende Regelung wie<br />
die des § 110 e Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 OWiG zumindest <strong>im</strong> Zu-<br />
sammenhang mit § 170 Abs. 1 StPO anbieten.<br />
2.1.1.2 Urkunden:<br />
In <strong>der</strong> heutigen Papierakte befinden sich regelmäßig diverse Urkunden<br />
<strong>im</strong> Original; dabei handelt es sich zum einen um<br />
- Urkunden, die als Beweismittel zur <strong>Akte</strong> gelangt sind; hierfür gelten<br />
die vorherigen Ausführungen; daneben handelt es sich um<br />
- Urkunden, die während des Ermittlungsverfahrens angefertigt wor-<br />
den sind, zum Beispiel Vernehmungsprotokolle mit Unterschriften.<br />
193
Für den Umgang mit diesen Originalen gilt jedoch das Ausgeführte<br />
ebenfalls entsprechend. Sollte es für die Überzeugungsbildung des<br />
Staatsanwalts von wesentlicher Bedeutung sein, eine solche Urkun-<br />
de als Ausgangsobjekt <strong>im</strong> Original in Augenschein zu nehmen, weil<br />
es auf <strong>der</strong>en Beschaffenheit und nicht nur <strong>der</strong>en Inhalt ankommt,<br />
muss ihm auch insoweit <strong>im</strong> Rahmen seines pflichtgemäßen Ermes-<br />
sens ein umgehen<strong>der</strong> Zugriff auf diese Urkunden ermöglicht werden.<br />
In weiten Teilen dürfte es sich hinsichtlich dieser Urkunden bei einer<br />
konsequenten Umstellung auf eine elektronische <strong>Akte</strong> um ein auslau-<br />
fendes Problem handeln, da die <strong>der</strong>zeit noch als Urkunden erstellten<br />
Schriftstücke künftig unmittelbar als Teile <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ange-<br />
fertigt würden.<br />
2.1.1.3 Sonstige <strong>Akte</strong>nbestandteile:<br />
Alle sonstigen <strong>Akte</strong>nbestandteile (Vermerke, Skizzen, Gutachten, Fotos<br />
u. s. w.) wären von einer Umstellung auf eine elektronische <strong>Akte</strong> nicht<br />
beeinflusst. Für den Wert dieser Unterlagen für das Verfahren kommt es<br />
nicht darauf an, ob <strong>der</strong> Staatsanwalt sie auf dem Papier o<strong>der</strong> in digitaler<br />
Form zur Kenntnis nehmen kann. Die „Beschaffenheit“ dieser <strong>Akte</strong>nbe-<br />
standteile ist regelmäßig ohne Bedeutung.<br />
Diese Ausführungen übergreifend sind selbstredend erfor<strong>der</strong>lich, dass<br />
<strong>der</strong> Staatsanwalt davon ausgehen kann, dass das durch Scannen ent-<br />
standene digitalisierte Dokument mit dem Ausgangsobjekt überein-<br />
st<strong>im</strong>mt. Dafür ist es erfor<strong>der</strong>lich, dass für das Scannen von Unterlagen<br />
ein verlässliches Verfahren vorgesehen wird, bei dessen Einhaltung <strong>der</strong><br />
Staatsanwalt von einer Übereinst<strong>im</strong>mung zwischen Ausgangsobjekt und<br />
digitalisiertem Abbild ausgehen kann (vergleiche § 110 b Abs. 1 und 2<br />
OWiG). In diesem Verfahren werden über die Sicherstellung <strong>der</strong> Ver-<br />
lässlichkeit des Scan-Vorgangs auch Regelungen dahingehend zu tref-<br />
fen sein, welche das Ausgangsobjekt „beschreibenden“ Vermerke be<strong>im</strong><br />
Scannen hinzugefügt werden müssen. Hier ist beispielsweise daran zu<br />
denken, dass be<strong>im</strong> Scannen von Kopien ausdrücklich vermerkt werden<br />
muss, wenn es sich bereits bei dem Ausgangsobjekt um eine Kopie<br />
194
handelt (vergleiche § 110 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 OWiG). An<strong>der</strong>enfalls<br />
würde <strong>der</strong> Staatsanwalt als Nutzer <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> zwar die<br />
gescannte Kopie inhaltlich „unverfälscht“ zur Kenntnis nehmen können,<br />
könnte aber nicht erkennen, dass es sich um eine gescannte Kopie han-<br />
delt. Diese für seine Entscheidung möglicherweise bedeutsame Informa-<br />
tion muss ihm daher auf zusätzlichem Weg verschafft werden, weil sie<br />
ihm ansonsten durch die Bereitstellung ausschließlich des gescannten<br />
Abbildes verloren ginge. Er wäre dann aber gehalten, von sich aus alle<br />
die Ausgangsobjekte in Augenschein zu nehmen, von <strong>der</strong>en Vorliegen<br />
<strong>im</strong> Original (in <strong>der</strong> Papier-Beiakte) es ankommt. Damit wäre aber ein<br />
wesentlicher Vorteil <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>, nämlich <strong>der</strong> Zeitgewinn<br />
durch den grundsätzlichen Umgang nur mit dieser <strong>Akte</strong>, in weiten Teilen<br />
wie<strong>der</strong> verloren.<br />
Lediglich hingewiesen werden soll an dieser Stelle darauf, dass zu be-<br />
achten sein wird, dass dieses normierte Verfahren zwar für das Scannen<br />
innerhalb <strong>der</strong> Behörde vorgesehen und dort auch die Einhaltung wei-<br />
testgehend gewährleistet werden kann. Ungelöst wäre damit aber noch<br />
die Frage <strong>der</strong> Kontrolle in den Fällen, in denen bereits ein Verfahrensbe-<br />
teiligter das Ausgangsobjekt gescannt hat und <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
nur dieses digitalisierte Abbild zur Verfügung stellt. Solche Bestandteile<br />
einer elektronischen <strong>Akte</strong> hätten sicherlich einen geringeren Beweiswert<br />
als die Bestandteile, die mittels eines vorgeschriebenen Verfahrens be-<br />
hördlich gescannt worden sind. An<strong>der</strong>erseits sind auch die von dritter<br />
Seite gescannten Unterlagen durchaus <strong>der</strong> freien Beweiswürdigung zu-<br />
gänglich. Im Ergebnis dürfte hier ähnlich zu verfahren sein wie heute mit<br />
Ablichtungen und Kopien, die von Zeugen o<strong>der</strong> Rechtsanwälten zur <strong>Akte</strong><br />
gereicht werden. Besteht Anlass zu Zweifeln daran, dass das Abbild das<br />
Original tatsächlich unverfälscht wie<strong>der</strong>gibt, wird auch <strong>im</strong> Fall einer elekt-<br />
ronischen <strong>Akte</strong> das Original zum Zwecke des Scannens in <strong>der</strong> Behörde<br />
abgefor<strong>der</strong>t werden müssen.<br />
2.1.1.4 Sonstige sinnlich wahrnehmbare Beweismittel:<br />
Hingewiesen werden soll zudem auf die Möglichkeit, dass je nach den<br />
technischen Möglichkeiten einer elektronischen <strong>Akte</strong> auch daran zu den-<br />
195
ken ist, dass in die <strong>Akte</strong> selbst beispielsweise TÜ-Aufnahmen <strong>im</strong> Origi-<br />
nalmitschnitt, Videodokumentationen vom Tatort o<strong>der</strong> ähnlich akustische<br />
o<strong>der</strong> optische Verfahrensteile aufgenommen werden könnten. Dadurch<br />
würden die Möglichkeiten <strong>der</strong> Kenntnisnahme aller Verfahrensbeteiligten<br />
von diesen Teilen <strong>der</strong> Ermittlungen erheblich erleichtert und überprüfbar,<br />
Streitigkeiten über den Inhalt einer TÜ-Aufnahme könnten bereits in ei-<br />
nem frühen Stadium allein durch Einsicht in die elektronische <strong>Akte</strong> ver-<br />
mieden o<strong>der</strong> gelöst werden.<br />
Erhält <strong>der</strong> Staatsanwalt die elektronische <strong>Akte</strong> mit dem für seine Ent-<br />
schließung erfor<strong>der</strong>lichen Inhalt, kommen folgende Entschließungen in<br />
Betracht:<br />
2.1.2 Ermittlungsverfahren<br />
- Veranlassung weiterer Ermittlungen -<br />
Entschließt sich <strong>der</strong> Staatsanwalt dazu, dass es vor einer das Ermitt-<br />
lungsverfahren abschließenden Entscheidung weiterer Ermittlungen be-<br />
darf, kann er diese selbst vornehmen, §§ 161 Abs. 1, 161 a Abs. 1<br />
StPO. Die weiteren Ermittlungen kann <strong>der</strong> Staatsanwalt sowohl auf <strong>der</strong><br />
Grundlage <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> vornehmen, wie er auch das Ergeb-<br />
nis seiner Ermittlungen in die elektronische <strong>Akte</strong> aufnehmen kann.<br />
Entschließt sich <strong>der</strong> Staatsanwalt, weitere Ermittlungen durch Dritte (Po-<br />
lizei, Verwaltungsbehörde, Ermittlungsrichter) vornehmen zu lassen,<br />
kann er diesen Dritten entwe<strong>der</strong> die elektronische <strong>Akte</strong> übermitteln o<strong>der</strong><br />
den Inhalt ausdrucken und den <strong>Akte</strong>ninhalt in zu Papier gebrachter Form<br />
den Dritten übersenden. Auch für diese Entscheidung des Staatsan-<br />
walts, wer die Ermittlungen vornehmen soll, ist die Form <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> ohne<br />
Bedeutung. Folgeprobleme könnten sich allerdings daraus ergeben,<br />
dass auch <strong>der</strong> Dritte gegebenenfalls Zugriff auf die Ausgangsobjekte<br />
haben muss, die er bislang in <strong>der</strong> Papierakte findet. Hierbei ist bei-<br />
spielsweise zu denken an Vernehmungsprotokolle <strong>im</strong> Original, wenn sie<br />
zum Zwecke eines Vorhalts an eine an<strong>der</strong>e Person, die das tatsächliche<br />
Vorliegen jenes Vernehmungsprotokolls anzweifelt, benötigt werden.<br />
196
Für solche Fälle muss dafür Sorge getragen werden, dass sich aus ei-<br />
nem künftigen Auseinan<strong>der</strong>fallen des Inhalts <strong>der</strong> heutigen Papierakte in<br />
den einen - „inhaltlichen“ - Teil, <strong>der</strong> sich künftig in <strong>der</strong> elektronischen Ak-<br />
te befindet, und einen weiteren - „dokumenten-körperlichen“ - Teil, <strong>der</strong><br />
sich in einer Papier-Beiakte befindet, keine wesentlichen Nachteile für<br />
die Verfahrensbearbeitung ergeben. Insofern erscheint es jedoch aus-<br />
reichend, wenn die Papier-Beiakte wie bereits vorgeschlagen zentral<br />
verwahrt und nur auf ausdrückliche Anfor<strong>der</strong>ung versandt wird, zumal<br />
sich das Erfor<strong>der</strong>nis ihres Vorliegens nur selten „plötzlich“ ergeben wird<br />
(wie in dem genannten Beispiel zur Vorlage an einen zweifelnden Zeu-<br />
gen). Für solche Ausnahmefälle scheinen die theoretisch denkbaren<br />
Verzögerungen durch ein geson<strong>der</strong>tes Abfor<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Papier-Beiakte<br />
verantwortbar, zumal sich dieses Problem auch schon heute ergeben<br />
kann, wenn beispielsweise anhand von kopierten Zweit- o<strong>der</strong> Drittakten<br />
ermittelt wird.<br />
Als Problem <strong>im</strong> Zusammenhang mit einer verfahrensbedeutsamen Ü-<br />
berzeugungsbildung wird dieses Auseinan<strong>der</strong>fallen von elektronischer<br />
<strong>Akte</strong> und Papier-Beiakte aber nur bedeutsam, wenn die weiteren Ermitt-<br />
lungshandlungen von einem Ermittlungsrichter vorgenommen werden<br />
sollen (vgl. unten). Bezüglich <strong>der</strong> übrigen in die Ermittlungen eingebun-<br />
denen Personen (Polizei, Verwaltungsbehörden, Sachverständige) er-<br />
gibt sich aus dem möglichen Auseinan<strong>der</strong>fallen von elektronischer <strong>Akte</strong><br />
und Papier-Beiakte kein Problem bei <strong>der</strong>en Überzeugungsbildung, da es<br />
auf <strong>der</strong>en Überzeugung für das Verfahren nicht ankommt. Soweit sich<br />
allerdings aus <strong>der</strong> fehlenden Ansicht <strong>der</strong> Ausgangsobjekte <strong>im</strong> Original<br />
Probleme für die Ermittlungsaufgaben bei den beauftragten Dritten er-<br />
geben, kann dies letztlich den Wert von <strong>der</strong>en Arbeitsergebnissen min-<br />
<strong>der</strong>n. Auch hier muss deshalb zumindest bei Nachfragen <strong>der</strong> Dritten die<br />
Möglichkeit geschaffen werden, ihnen neben <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
auch den Inhalt <strong>der</strong> Papier-Beiakte zugänglich zu machen, sofern sie<br />
diesen Inhalt für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen.<br />
197
2.1.3 Ermittlungsverfahren<br />
- Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO -<br />
Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise, wenn sich das Verfahren<br />
in einem frühen Stadium ohne weitere Ermittlungsansätze als einstel-<br />
lungsreif erweist, sei es, weil keine Straftat ersichtlich ist o<strong>der</strong> weil es<br />
zwar eine als Beschuldigte einer Straftat geführte Person gibt, ihr die Tat<br />
aber offensichtlich nicht nachzuweisen ist, o<strong>der</strong> weil ein Verfahrenshin-<br />
<strong>der</strong>nis besteht. Auch in diesem Fällen würde die Entschließung des<br />
Staatsanwalts, das Verfahren aus diesen Gründen gemäß § 170 Abs. 1<br />
StPO einzustellen, von <strong>der</strong> Form einer elektronischen <strong>Akte</strong> nicht beein-<br />
flusst.<br />
2.1.4 Ermittlungsverfahren<br />
- Einstellung wegen geringer Schuld o. ä. ohne Beteiligung des<br />
Gerichts -<br />
Alleine auf die staatsanwaltschaftliche Überzeugungsbildung kommt es<br />
schließlich noch in dem Verfahrensstadium an, in dem über eine Einstel-<br />
lung des Verfahrens trotz bestehenden Tatverdachts ohne Beteiligung<br />
des Gerichtes zu entscheiden ist (zum Beispiel §§ 153 Abs. 1 Satz 2,<br />
154 Abs. 1 StPO). Auch insoweit sind indes keine Schwierigkeiten er-<br />
kennbar, die sich aus <strong>der</strong> Form <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ergeben könn-<br />
ten. Der Staatsanwalt hat sich lediglich davon zu überzeugen, dass das<br />
Verfahren einerseits nicht gemäß § 170 Abs. 1 StPO einstellungsreif ist<br />
und an<strong>der</strong>erseits keine sonstigen Umstände vorliegen, die <strong>der</strong> Einstel-<br />
lung entgegenstehen (zum Beispiel kein Verbrechensverdacht bei beab-<br />
sichtigter Einstellung nach § 153 StGB). Diese Überzeugung kann er<br />
aus einer elektronischen <strong>Akte</strong> in gleicher Weise wie heute aus einer Pa-<br />
pierakte gewinnen.<br />
2.1.5 Ermittlungsverfahren<br />
- Strafbefehlsantrag, Anklageerhebung -<br />
Unter Beachtung <strong>der</strong> vorgenannten Ausführungen ist schließlich auch für<br />
den Zeitpunkt, in dem <strong>der</strong> Staatsanwalt sich zur Stellung eines Strafbe-<br />
fehlsantrages o<strong>der</strong> zur Erhebung <strong>der</strong> Anklage entschließt, keine Proble-<br />
me für seine Überzeugungsbildung durch die Einführung <strong>der</strong> elektroni-<br />
198
schen <strong>Akte</strong> zu erwarten. Er kann sich regelmäßig seine Überzeugung<br />
vom hinreichenden Tatverdacht aus dem Inhalt <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
verschaffen. Soweit er darüber hinaus Ausgangsobjekte selbst in Au-<br />
genschein nehmen muss, um über das Vorliegen des hinreichenden<br />
Tatverdachts zu entscheiden, kann er auf den Inhalt <strong>der</strong> dann von ihm<br />
anzufor<strong>der</strong>nden Papier-Beiakte zurückgreifen.<br />
2.1.6 Die Unbekannt-Sachen (UJs-Verfahren)<br />
Handelt es sich um ein Verfahren gegen Unbekannt (UJs-Verfahren)<br />
ohne weitere Ermittlungsansätze, ergeben sich aus einer elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> keine Probleme. Die <strong>Akte</strong> enthält, unabhängig von ihrer Form, in<br />
diesem Fall nichts, was für die Überzeugungsbildung des Staatsanwalts<br />
von Bedeutung sein könnte. Seine Entschließung, das Verfahren in Er-<br />
mangelung eines Tatverdächtigen und weiterer Ermittlungsansätze ge-<br />
mäß § 170 Abs. 1 StPO einzustellen, würde von <strong>der</strong> Form einer elektro-<br />
nischen <strong>Akte</strong> nicht beeinflusst.<br />
2.2 Überzeugungsbildung des Richters<br />
Im Zuge des Ermittlungsverfahrens bedarf es <strong>der</strong> Überzeugungsbildung<br />
eines Richters in den Fällen, in denen <strong>der</strong> Richter als Ermittlungsrichter<br />
tätig werden soll (§ 162 StGB), sowie in den Fällen, in denen er die Zu-<br />
st<strong>im</strong>mung zu einer Verfahrenseinstellung geben soll (§§ 153 Abs. 1 Satz<br />
1, § 153 a Abs. 1 Satz 1 StGB).<br />
2.2.1 Ermittlungsrichter<br />
Für die Tätigkeit des Ermittlungsrichters und seiner erfor<strong>der</strong>lichen Über-<br />
zeugungsbildung insbeson<strong>der</strong>e vor dem Erlass von Anordnungen, mit<br />
denen Eingriffe in die Rechte des Beschuldigten o<strong>der</strong> dritter Personen<br />
angeordnet werden, gelten die obigen Ausführungen entsprechend: Er<br />
kann seine Tätigkeit auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ausüben,<br />
muss aber <strong>im</strong> Rahmen seines an <strong>der</strong> Amtsaufklärungspflicht orientierten<br />
pflichtgemäßen Ermessens Zugriff auf die Papier-Beiakte nehmen kön-<br />
nen.<br />
199
Dabei erscheint die Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> für die Tätig-<br />
keit des Ermittlungsrichters wie auch für die Dauer des Verfahrens<br />
durchaus vorteilhaft. Derzeit ergeben sich häufig Probleme daraus, dass<br />
dem Ermittlungsrichter zwar ein Antrag auf Erlass einer Anordnung vor-<br />
liegt, ihm aber aus zeitlichen Gründen nicht <strong>der</strong> gesamte <strong>Akte</strong>ninhalt zur<br />
Verfügung steht. In diesen Fällen darf <strong>der</strong> Richter nicht alleine wegen<br />
<strong>der</strong> fehlenden Unterlagen seine Tätigkeit verweigern, er kann aber ver-<br />
langen, dass ihm <strong>der</strong> Sachverhalt, auf dem <strong>der</strong> an ihn gerichtete Antrag<br />
beruht, plausibel dargelegt wird. Hieraus können sich <strong>im</strong> Einzelfall kom-<br />
munikationsbedingte Missverständnisse ergeben, so dass we<strong>der</strong> auszu-<br />
schließen ist, dass <strong>der</strong> Richter einen Antrag zurückweist, dem er bei<br />
Kenntnis des tatsächlichen <strong>Akte</strong>ninhalts entsprochen hätte, noch auszu-<br />
schließen ist, dass er einem Antrag entspricht, den er bei Kenntnis des<br />
tatsächlichen <strong>Akte</strong>ninhalts zurückgewiesen hätte. In beiden Konstellatio-<br />
nen ist es rechtsstaatlich bedenklich, dass <strong>der</strong> Richter seine Überzeu-<br />
gung nicht auf <strong>der</strong> Grundlage des tatsächlichen Verfahrensstoffes ge-<br />
wonnen hat und deshalb zu einem „objektiv falschen“ Ergebnis bei sei-<br />
ner Überzeugungsbildung und Entscheidung gelangt ist. Im Falle einer<br />
elektronischen <strong>Akte</strong> wären solche Probleme jedenfalls dann, wenn jede<br />
Verfahrenshandlung und jede Information sogleich in die elektronische<br />
<strong>Akte</strong> aufgenommen wird, künftig nicht mehr zu erwarten. Dem Ermitt-<br />
lungsrichter könnte in kürzester Zeit <strong>der</strong> gesamte <strong>Akte</strong>ninhalt übermittelt<br />
und damit als Basis für seine Überzeugungsbildung zeitnah zugänglich<br />
gemacht werden.<br />
Wie bereits ausgeführt, müssen dem Richter vor seiner Entscheidung<br />
die verfahrenswesentlichen Gegenstände und Unterlagen zur Verfügung<br />
gestellt werden, wenn er dies verlangt. Soweit es sich um Material han-<br />
delt, dessen Augenscheinseinnahme für den Richter notwendig ist, ist es<br />
Ausfluss seiner richterlichen Unabhängigkeit, sich dieses Material vor<br />
seiner Entscheidung vorlegen zu lassen. Allerdings erscheint es auch <strong>im</strong><br />
Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit verantwortbar, dass das Ge-<br />
richt die Vorlage jenes Materials nach pflichtgemäßem, nicht nach freiem<br />
Ermessen verlangen kann. Denn dem pflichtgemäßen Ermessen wird<br />
das Vorlageverlangen bereits dann entsprechen, wenn das Gericht ei-<br />
200
nen sachlichen Grund für die Augenscheinseinnahme hat, wovon regel-<br />
mäßig auszugehen sein wird. Im Ergebnis wird es aber insoweit kaum<br />
tatsächliche Probleme geben. For<strong>der</strong>t ein Ermittlungsrichter Ausgangs-<br />
objekte <strong>im</strong> Original an, dürfte es zeitaufwändiger sein, sich mit ihm dar-<br />
über auseinan<strong>der</strong> zu setzen, ob dies tatsächlich erfor<strong>der</strong>lich ist, als ihm<br />
die angefor<strong>der</strong>ten Unterlagen umgehend zu übersenden. Problematisch<br />
könnte eine überflüssige Abfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ausgangsobjekte durch den<br />
Ermittlungsrichter allenfalls dienstaufsichtsrechtlich sein, wenn es für die<br />
Abfor<strong>der</strong>ung an einem sachlichen Grund fehlt und durch die Abfor<strong>der</strong>ung<br />
vermeidbare Verfahrensverzögerungen eingetreten sind. An<strong>der</strong>erseits<br />
wird sich durch die erfolgte Einsichtnahme in die Papier-Beiakte in mate-<br />
rieller Hinsicht kaum ein Verfahrensverstoß ergeben können.<br />
Fraglich ist allerdings, ob sich gerade <strong>im</strong> Zusammenhang mit <strong>der</strong> Tätig-<br />
keit des Ermittlungsrichters, die regelmäßig eine Entscheidung des Rich-<br />
ters binnen kurzer Zeit erfor<strong>der</strong>t, die Wochenfrist etwa des § 110 b Abs.<br />
2 Satz 3 OWiG als ausreichend erweist. Es ist vielmehr davon auszuge-<br />
hen, dass sich für die Bereitstellung <strong>der</strong> Papier-Beiakte ein System er-<br />
for<strong>der</strong>lich machen wird, das zumindest während <strong>der</strong> Phase des Ermitt-<br />
lungsverfahrens und in Haftsachen gegebenenfalls auch noch darüber<br />
hinaus eine grundsätzlich schnellere Vorlage abgefor<strong>der</strong>ter Ausgangs-<br />
objekte ermöglicht.<br />
Die elektronische <strong>Akte</strong> könnte aber auch in dieser Hinsicht nicht zu un-<br />
terschätzende Vorteile bieten. Beispielsweise bezüglich Asservaten, bei<br />
denen sich schon heute gelegentlich eine geson<strong>der</strong>te und teils verfah-<br />
rensverzögernde Abfor<strong>der</strong>ung von <strong>der</strong> Asservatenstelle erfor<strong>der</strong>lich<br />
macht, könnte bei Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> verstärkt mit digi-<br />
talen Fotos gearbeitet werden, die auch die Betrachtung eines abgelich-<br />
teten Asservats aus unterschiedlichen Perspektiven erlauben. Auf die-<br />
sem Weg könnte in erheblich einfacherer Form als heute dem Richter<br />
<strong>der</strong> Anblick des Asservats zugänglich gemacht werden, ohne dass die-<br />
ser das Asservat selbst in Augenschein nehmen muss (sofern es nicht<br />
auf Beschaffenheiten des Asservats ankommt, die sich nur durch unmit-<br />
telbare Augenscheinseinnahme feststellen lassen).<br />
201
2.2.2 Beteiligung an Einstellungsentscheidungen<br />
Die Ausführungen unter 2.2.1 gelten in vergleichbarer Weise in den Fäl-<br />
len, in denen <strong>der</strong> Richter seine Zust<strong>im</strong>mung zu einer Einstellung durch<br />
die Staatsanwaltschaft geben soll. Ein Unterschied zu seiner Tätigkeit<br />
als Ermittlungsrichter ergibt sich lediglich daraus, dass er als Ermitt-<br />
lungsrichter seine Tätigkeit nicht verweigern darf, solange die beantragte<br />
Handlung zulässig ist (betrifft vor allem den Antrag auf richterliche Ver-<br />
nehmung eines Zeugen o<strong>der</strong> des Beschuldigten). Bei <strong>der</strong> Zust<strong>im</strong>mung<br />
zu einer von <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft beabsichtigten Einstellung des Ver-<br />
fahrens handelt es sich jedoch nur um eine Prozesserklärung des Ge-<br />
richts, über die <strong>der</strong> Richter nicht nur hinsichtlich des „Wie“, son<strong>der</strong>n auch<br />
hinsichtlich des „Ob“ <strong>im</strong> Rahmen seiner richterlichen Unabhängigkeit zu<br />
entscheiden hat.<br />
Dieser Unterschied än<strong>der</strong>t indes nichts daran, dass sich das Gericht an-<br />
hand des <strong>Akte</strong>ninhalts vor <strong>der</strong> Abgabe dieser Erklärung ebenso wie vor<br />
<strong>der</strong> Vornahme einer Handlung als Ermittlungsrichter eine Überzeugung<br />
auf <strong>der</strong> Grundlage des <strong>Akte</strong>ninhalts bilden können muss. Da das Gericht<br />
mit seiner Zust<strong>im</strong>mung zu <strong>der</strong> Einstellung als Ausnahme vom Legalitäts-<br />
prinzip diesen Verfahrensabschluss mit verantworten soll, muss das Ge-<br />
richt in die Lage versetzt werden, sich von <strong>der</strong> Einstellungswürdigkeit<br />
des Verfahrens zu überzeugen.<br />
In diesem Verfahrensstadium muss sich das Gericht folglich insbesonde-<br />
re davon überzeugen können, dass gegen den Beschuldigten ein hinrei-<br />
chen<strong>der</strong> Tatverdacht besteht. Dies muss das Gericht an dem ihm zu-<br />
gänglich gemachten <strong>Akte</strong>ninhalt prüfen können. Regelmäßig wird dies<br />
dem Gericht aus dem Inhalt <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> möglich sein. Dem<br />
Gericht muss es jedoch auch hier <strong>im</strong> Rahmen eines pflichtgemäßen Er-<br />
messens möglich sein, Ausgangsobjekte, die nur Gegenstand <strong>der</strong> Pa-<br />
pier-Beiakte sind, <strong>im</strong> Original beiziehen zu können, wenn dies für die<br />
Überzeugungsbildung des Gerichtes erfor<strong>der</strong>lich ist. Zwar gelten für die<br />
Überzeugungsbildung des Gerichts in diesem Verfahrensstadium keine<br />
festen Beweisregeln. Dennoch kann das Gericht nicht alleine auf den In-<br />
202
halt <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> verwiesen werden. Denn das Gericht kann<br />
eine Mitverantwortung für die Verfahrenseinstellung nur dann überneh-<br />
men, wenn ihm die Möglichkeit zur umfassenden fundierten Überzeu-<br />
gungsbildung eröffnet wird. Dies gilt schon deshalb, weil beispielsweise<br />
eine vom Gericht mitgetragene Einstellung nach § 153 a StPO den Be-<br />
schuldigten je nach Höhe <strong>der</strong> Auflage durchaus in erheblicher Weise be-<br />
lasten kann.<br />
Kann sich das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen alle <strong>Akte</strong>nbe-<br />
standteile verschaffen, die nicht Gegenstand <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>,<br />
son<strong>der</strong>n Inhalt einer Papier-Beiakte sind, sind folglich Probleme durch<br />
die Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> auch in diesem Verfahrensstadi-<br />
um nicht zu befürchten.<br />
3. Das gerichtliche Verfahren<br />
3.1. Strafbefehlsverfahren<br />
Im Rahmen eines Strafbefehlsverfahrens (§ 407 ff. StPO) gelten die zu-<br />
vor gemachten Ausführungen zur richterlichen Tätigkeit als Ermittlungs-<br />
richter o<strong>der</strong> bei Einstellungszust<strong>im</strong>mungen entsprechend. Auch in die-<br />
sem Verfahren muss sich das Gericht heute - nur - anhand des Papier-<br />
akteninhalts und gegebenenfalls durch die Augenscheinseinnahme von<br />
Asservaten eine Überzeugung davon verschaffen, dass <strong>der</strong> Angeschul-<br />
digte <strong>der</strong> ihm <strong>im</strong> Strafbefehl zur Last gelegten Tat hinreichend verdächtig<br />
ist. Die Überzeugungsbildung erfolgt hier auf gleiche Weise wie <strong>im</strong> Falle<br />
<strong>der</strong> Prüfung einer Zust<strong>im</strong>mung zu einer Einstellungsentscheidung <strong>der</strong><br />
Staatsanwaltschaft.<br />
3.2 Zwischenverfahren nach Anklageerhebung<br />
Hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, so hat das Gericht <strong>im</strong><br />
Rahmen des Zwischenverfahrens zu prüfen, ob die Anklage zur Haupt-<br />
verhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird (§ 203<br />
StPO). Diese Prüfung erfolgt zunächst wie<strong>der</strong>um nur anhand des <strong>Akte</strong>n-<br />
inhalts. Insoweit gelten daher ebenfalls die zuvor gemachten Ausführun-<br />
203
gen zur Ermittlungsrichtertätigkeit, Einstellungszust<strong>im</strong>mung und zum<br />
Strafbefehlsverfahren entsprechend.<br />
Sofern das Gericht <strong>im</strong> Rahmen des Zwischenverfahrens weitere Be-<br />
weiserhebungen für erfor<strong>der</strong>lich hält (§ 202 StPO), sind diese auf <strong>der</strong><br />
Grundlage <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> möglich. Das Gericht kann die elekt-<br />
ronische <strong>Akte</strong> an Polizei und Verwaltungsbehörden weiterleiten, kann sie<br />
ausdrucken und als Papierakte versenden und kann neue <strong>Akte</strong>nbe-<br />
standteile, die aufgrund <strong>der</strong> weiteren Ermittlungen entstehen, selbst in<br />
die elektronische <strong>Akte</strong> aufnehmen o<strong>der</strong> überführen. Die Tätigkeit des<br />
Gerichts ist insoweit <strong>der</strong> Tätigkeit <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft bei <strong>der</strong> Veran-<br />
lassung weiterer Ermittlungen vergleichbar (siehe oben). Probleme<br />
durch die Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> sind in diesem Verfah-<br />
rensstadium wie<strong>der</strong>um nicht erkennbar.<br />
3.3. Hauptverhandlung mit Urteilsfindung<br />
Über das Ergebnis <strong>der</strong> Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach<br />
seiner freien, aus dem Inbegriff <strong>der</strong> Verhandlung geschöpften Überzeu-<br />
gung, § 261 StPO. Grundlage <strong>der</strong> Überzeugungsbildung sind dabei die<br />
Beweismittel (Einlassung des Angeklagten und gegebenenfalls <strong>der</strong> Mit-<br />
angeklagten, Aussagen von Zeugen, Gutachten von Sachverständigen,<br />
Objekte, die in Augenschein genommen werden, sowie Urkunden und<br />
an<strong>der</strong>e Schriftstücke).<br />
Da die Beweisaufnahme dem Mündlichkeitsprinzip (§§ 250, 261 StPO)<br />
folgt, ist <strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>n als solcher und damit auch die Form <strong>der</strong><br />
<strong>Akte</strong>n grundsätzlich für die Beweisaufnahme ohne Bedeutung.<br />
Dies än<strong>der</strong>t sich jedoch dann, wenn<br />
- aus den <strong>Akte</strong>n Vorhalte gemacht werden,<br />
- <strong>Akte</strong>nbestandteile in Augenschein genommen werden o<strong>der</strong><br />
- Urkunden und an<strong>der</strong>e Schriftstücke als Beweismittel verlesen werden.<br />
204
Die gleiche Verlässlichkeit wie bei <strong>der</strong> heutigen Papierakte hat <strong>der</strong> Inhalt<br />
<strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> dann, wenn es sich bei dem betreffenden Ak-<br />
tenbestandteil um ohnehin digitale Daten handelt, die bei <strong>der</strong> heutigen<br />
Papierakte erst ausgedruckt und dann zur <strong>Akte</strong> genommen werden (zum<br />
Beispiel Kontoverdichtungen in Wirtschaftsstrafverfahren). Ebenso ver-<br />
lässlich ist <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>ninhalt zudem, wenn die <strong>Akte</strong>nbestandteile unmittel-<br />
bar in die elektronische <strong>Akte</strong> eingegeben worden ist (zum Beispiel Ver-<br />
nehmungsprotokolle, die nicht erst auf Papier erstellt, son<strong>der</strong>n unmittel-<br />
bar in die elektronische <strong>Akte</strong> eingegeben werden). Bei sonstigen <strong>Akte</strong>n-<br />
bestandteilen, die durch Scannen zum Bestandteil <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> gemacht werden, ist für die Verlässlichkeit auf die Richtigkeit des<br />
<strong>Akte</strong>ninhalts erfor<strong>der</strong>lich, dass das Gericht auf ein fehlerlos und voll-<br />
ständig arbeitendes Scan-Verfahren vertrauen kann. Sofern die bei <strong>der</strong><br />
Erstellung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> verwendete Technik die erfor<strong>der</strong>liche<br />
Verlässlichkeit aufweist - was bei <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> vor ihrer Ein-<br />
führung bereits sichergestellt sein muss - , kann <strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> faktisch in gleichem Umfang und in gleicher Weise wie <strong>der</strong><br />
heutige Inhalt <strong>der</strong> Papierakte bei <strong>der</strong> Beweisaufnahme in Augenschein<br />
genommen und aus seinem Inhalt vorgehalten o<strong>der</strong> verlesen werden.<br />
Um allerdings auch prozessrechtlich die Zulässigkeit dieses Umgangs<br />
mit dem Inhalt <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> bei <strong>der</strong> Beweisaufnahme abzusi-<br />
chern, sollte eine dem § 110 e Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 OWiG entspre-<br />
chende Vorschrift über die Durchführung <strong>der</strong> Beweisaufnahme mit elekt-<br />
ronischen Dokumenten auch in die StPO aufgenommen werden. Der<br />
Umstand, dass <strong>im</strong> Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens we-<br />
gen § 77 a OWiG ohnehin eine weniger strenge Beweisaufnahme wie in<br />
einem Strafprozess erfolgt, steht <strong>der</strong> Aufnahme einer dem § 110 e Abs.<br />
1 und Abs. 2 Satz 1 OWiG entsprechenden Vorschrift in die StPO nicht<br />
entgegen. Denn diese Vorschrift best<strong>im</strong>mt nicht, dass das digitale Abbild<br />
des Ausgangsobjektes in <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> denselben Beweiswert<br />
wie das Ausgangsobjekt selbst besitzt. Über den Beweiswert und die<br />
Aufklärungsbedürftigkeit bezüglich des Ausgangsobjektes hat das Ge-<br />
richt auch weiterhin entsprechend seiner Aufklärungspflicht zu entschei-<br />
den. Dieser Vorgang ist dem heutigen Umgang mit Kopien vergleichbar,<br />
die wie das kopierte Schriftstück verwendet werden können, wenn an<br />
205
<strong>der</strong> Übereinst<strong>im</strong>mung <strong>der</strong> Kopie mit dem kopierten Dokument kein Zwei-<br />
fel besteht. Eine Kopie kann heute sowohl zur Feststellung von Äußer-<br />
lichkeiten (z.B. Größe eines Schriftstücks) in Augenschein genommen<br />
werden (sofern <strong>der</strong> festzustellende Umstand nicht ausschließlich dem<br />
Original „körperlich anhaftet“, wie zum Beispiel <strong>der</strong> Abdruck einer Unter-<br />
schrift o<strong>der</strong> die Beschaffenheit des Papiers des Originals) wie sie auch<br />
zur Feststellung des Inhalts des Originals als Urkunde verlesen werden<br />
kann, sofern an <strong>der</strong> inhaltlichen Übereinst<strong>im</strong>mung keine ernsthaften<br />
Zweifel bestehen.<br />
Als denkbares Problem könnte sich zumindest in <strong>der</strong> ersten Zeit nach<br />
Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> ergeben, dass es eine Rechtspre-<br />
chung zur generellen Verlässlichkeit des Scan-Verfahrens nicht gibt. Es<br />
ist allerdings ohnehin damit zu rechnen, dass sich <strong>der</strong> Wandel von <strong>der</strong><br />
Papierakte zur elektronischen <strong>Akte</strong> nicht unmittelbar vollziehen wird.<br />
Vielmehr ist zu erwarten, dass zunächst die Unterstützung <strong>der</strong> Arbeit mit<br />
<strong>der</strong> heutigen Papierakte mit <strong>der</strong> Verbreiterung des Umgangs mit einer<br />
elektronischen <strong>Akte</strong> als Hilfsakte ausgebaut werden wird. In diesem Sta-<br />
dium wird sich bereits die Verlässlichkeit <strong>der</strong> verschiedenen Scan-<br />
Verfahren zeigen. Nur dann, wenn in diesem Entwicklungsstadium keine<br />
nennenswerten technischen Probleme auftauchen, wird ein Wechsel von<br />
<strong>der</strong> Papierakte als Hauptakte hin zur elektronischen <strong>Akte</strong> als Hauptakte<br />
in Betracht kommen. In diesem Fall wird eine fehlende o<strong>der</strong> nur geringe<br />
Rechtsprechung zur grundsätzlichen Verlässlichkeit <strong>der</strong> Scan-Verfahren<br />
keine Probleme mehr bereiten.<br />
Auch wenn <strong>der</strong> Gesetzgeber und die <strong>Justiz</strong> von <strong>der</strong> Verlässlichkeit <strong>der</strong><br />
Technik überzeugt sind, bleibt es allerdings gleichwohl denkbar, dass <strong>im</strong><br />
Rahmen eines strafprozessualen Hauptverfahrens die Übereinst<strong>im</strong>mung<br />
eines Ausgangsobjektes mit dem gescannten Abbild angezweifelt wird.<br />
Für die sich dann ergebende Frage, wann ein Rückgriff auf Ausgangsob-<br />
jekte von den Verfahrensbeteiligten verlangt werden kann, dürfte bereits<br />
die heutige Regelung des § 244 StPO eine ausreichende Lösung bieten.<br />
Zunächst gilt ohnehin die Amtsaufklärungspflicht des § 244 Abs. 2 StPO.<br />
206
Auf die Scan-Technik zurück zu führende Zweifel an <strong>der</strong> Übereinst<strong>im</strong>-<br />
mung von Ausgangsobjekten und gescanntem Abbild hat das Gericht<br />
daher selbst aufzuklären, allerdings entsprechend <strong>der</strong> zuvor gemachten<br />
Ausführungen nur dann, wenn <strong>im</strong> Einzelfall Anlass zu Zweifeln an <strong>der</strong><br />
ansonsten üblichen Verlässlichkeit <strong>der</strong> Übertragung in die elektronische<br />
<strong>Akte</strong> besteht. Dies ist ebenfalls mit dem heutigen Umgang mit Kopien<br />
vergleichbar, bei dem das Gericht grundsätzlich nicht zur Aufklärung<br />
verpflichtet ist, mittels welcher Kopiertechnik eine Kopie erstellt wurde<br />
und ob <strong>im</strong> Zusammenhang mit dieser Technik Unregelmäßigkeiten ent-<br />
standen sein könnten.<br />
Anträge <strong>der</strong> Verfahrensbeteiligten auf Beiziehung <strong>der</strong> Originale dürften<br />
daher in den meisten Fällen ohnehin nur Beweisermittlungsanträge sein,<br />
denen das Gericht (nur) <strong>im</strong> Rahmen seiner Aufklärungspflicht nachzu-<br />
gehen verpflichtet ist.<br />
Sollte <strong>der</strong> Beweisantrag so konkret formuliert sein, dass eine konkrete<br />
Abweichung von Ausgangsobjekt und gescanntem Abbild - sei es aus<br />
technischen Gründen, sei es aufgrund von Unregelmäßigkeiten be<strong>im</strong><br />
Scannen selbst - behauptet wird, handelt es sich um einen Beweisantrag<br />
auf Einnahme des Augenscheins vom Ausgangsobjekt. Dieser Antrag<br />
kann insbeson<strong>der</strong>e dann abgelehnt werden, wenn die behauptete Ab-<br />
weichung unerheblich ist o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Antrag zur Prozessverschleppung ge-<br />
stellt wird (§ 244 Abs. 3 Satz 2 2. und 6. Alt. StPO). Darüber hinaus<br />
kann <strong>der</strong> Antrag nach § 244 Abs. 5 Satz 1 StPO aber auch abgelehnt<br />
werden, wenn die Augenscheinseinnahme nach pflichtgemäßem Er-<br />
messen des Gerichts zur Erforschung <strong>der</strong> Wahrheit nicht erfor<strong>der</strong>lich ist.<br />
Dies wird insbeson<strong>der</strong>e dann in Betracht kommen, wenn <strong>der</strong> Beweisan-<br />
trag zwar konkret formuliert, dennoch aber erkennbar „ins Blaue hinein“<br />
gestellt wird. Dabei ist zwar damit zu rechnen, dass <strong>der</strong>artige Beweisan-<br />
träge aus tatsächlicher o<strong>der</strong> behaupteter Skepsis vor <strong>der</strong> Technik an-<br />
fänglich vermehrt gestellt werden. Bestätigt sich jedoch mit <strong>der</strong> Zeit <strong>im</strong>-<br />
mer wie<strong>der</strong> die Zuverlässigkeit des Scan-Verfahrens, werden diese An-<br />
träge zum einen abnehmen und zum an<strong>der</strong>en mit zunehmen<strong>der</strong> Dauer<br />
<strong>im</strong>mer leichter über § 244 Abs. 5 Satz 1 StPO abgelehnt werden kön-<br />
207
nen. Im Zusammenhang mit diesen denkbaren prozessualen Schwierig-<br />
keiten ist allerdings ohnehin zu konstatieren, dass je<strong>der</strong> Angeklagte und<br />
auch die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, dass in einem Strafverfah-<br />
ren nur verlässliche Technik verwendet wird. Gerade in <strong>der</strong> Anfangszeit<br />
nach Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> wird es daher auch ein<br />
rechtsstaatliches Gebot sein, Zweifel an dieser Zuverlässigkeit auch <strong>im</strong><br />
Rahmen <strong>der</strong> Öffentlichkeit einer Hauptverhandlung auszuräumen.<br />
Unabhängig von <strong>der</strong> denkbaren Problematik bezüglich <strong>der</strong> Übereinst<strong>im</strong>-<br />
mung von Ausgangsobjekt und gescanntem Abbild sollte vor <strong>der</strong> Einfüh-<br />
rung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> auch geprüft werden, wie sonstige Vorzüge<br />
<strong>der</strong> Papierakte auch noch nach <strong>der</strong> Umstellung erhalten bleiben können.<br />
In erster Linie ist hier daran zu denken, dass eine Vernehmungsproto-<br />
koll, das von <strong>der</strong> vernommenen Person eigenhändig unterzeichnet, mög-<br />
licherweise sogar noch <strong>im</strong> Text handschriftlich geän<strong>der</strong>t worden ist, eine<br />
gewisse Wahrscheinlichkeit dafür bietet, dass die vernommene Person<br />
den Vernehmungstext tatsächlich - zumindest dem Inhalt nach - so als<br />
ihre Aussage verstanden wissen wollte. Dies kann bei späteren Unst<strong>im</strong>-<br />
migkeiten über jene frühere Aussage <strong>im</strong> Rahmen einer Beweiswürdi-<br />
gung von erheblichem Gewicht sein. Dieser Vorteil bei <strong>der</strong> Beweiswürdi-<br />
gung ginge verloren, wenn sich nach Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
eine Protokollierung darauf beschränkt, den Text sogleich in die elektro-<br />
nische <strong>Akte</strong> aufzunehmen und nicht erneut zur Unterschrift auszudru-<br />
cken. Es wird daher zu prüfen sein, in welcher Form eine vernommene<br />
Person ihre Zust<strong>im</strong>mung zu dem Vernehmungstext in gleich geeigneter<br />
Weise wie durch die bisherige Unterzeichnung erklären kann. Es sollte<br />
zudem gewährleistet sein, dass Korrekturen des Vernehmungsprotokolls<br />
durch die vernommene Person auch bei <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> als sol-<br />
che zu erkennen sind. Ein Verfahren mit einer (qualifizierten) elektroni-<br />
schen Signatur wird sich dazu voraussichtlich nicht eignen, da nicht da-<br />
von auszugehen ist, dass die jeweils vernommene Person über diese<br />
Signatur verfügt. Die Signaturmöglichkeit des Vernehmungsbeamten<br />
wie<strong>der</strong>um bietet nicht den gleichen Beweiswert wie eine entsprechende<br />
Signatur <strong>der</strong> vernommenen Person. Eine Lösungsmöglichkeit wäre je-<br />
doch, dass von Vernehmungsprotokollen eine Ausfertigung ausgedruckt,<br />
208
diese dann vom Vernommenen unterzeichnet und diese Urkunde dann<br />
zur Papier-Beiakte genommen wird (vergleiche § 298 a Abs. 2 ZPO).<br />
Würde <strong>der</strong> Vernehmungstext später angezweifelt, müsste in diesem Fall<br />
auf die Papier-Beiakte zurückgegriffen werden, wobei dieser potentielle<br />
Aufwand aber vertretbar erscheint<br />
Vorteilhaft kann die elektronische <strong>Akte</strong> in <strong>der</strong> Hauptverhandlung dann<br />
sein, wenn ihr Inhalt durch Übertragung auf einen individuellen Bild-<br />
schirm für jeden Verfahrensbeteiligten o<strong>der</strong> durch eine großflächige Pro-<br />
jektion <strong>im</strong> Gerichtssaal besser als bislang allen Verfahrensbeteiligten zur<br />
Kenntnis gegeben werden kann. Auf diese Weise kann sowohl ein Vor-<br />
halt, <strong>der</strong> dann mitgelesen werden kann, verständlicher gemacht werden,<br />
wie auch Fotos für alle Verfahrensbeteiligten erleichtert betrachtet wer-<br />
den können. Dies dürfte die Qualität <strong>der</strong> Beweisaufnahme unter Mithilfe<br />
<strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> sogar steigern, da Vorhalte und Augen-<br />
scheinseinnahmen plastischer würden und <strong>der</strong> jeweils betroffene Verfah-<br />
rensbeteiligte den Verfahrensteil, <strong>der</strong> gerade Gegenstand <strong>der</strong> Beweis-<br />
aufnahme ist, unmittelbar vor Augen hätte. Eine auf diesem Weg ver-<br />
lässlichere Beweisaufnahme würde auch eine Verbesserung <strong>der</strong> Mög-<br />
lichkeit <strong>der</strong> Überzeugungsbildung durch das Gericht herbeiführen.<br />
4. Zusammenfassung:<br />
Die Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> wirft keine<br />
wesentlichen Probleme in Bezug auf die in verschiedenen Phasen des<br />
Verfahrens notwendige Überzeugungsbildung bei Staatsanwaltschaft<br />
und Gericht auf.<br />
Neben <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> bedarf es jedoch einer geson<strong>der</strong>ten Auf-<br />
bewahrung <strong>der</strong> Ausgangsdokumente, die durch Scannen in die elektro-<br />
nische <strong>Akte</strong> übernommen worden sind. Dies betrifft jedenfalls die Aus-<br />
gangsobjekte, die über ihren reinen Informationsinhalt auch wegen ihnen<br />
anhaften<strong>der</strong> Umstände (Beschaffenheit, Originalschriften u. a.) für die<br />
Beweisaufnahme von Bedeutung sein können. Eine Aufbewahrung in<br />
einer Papier-Beiakte bietet sich an.<br />
209
Bedarf es zur Überzeugungsbildung von Staatsanwalt o<strong>der</strong> Richter des<br />
Rückgriffs auf die Ausgangsobjekte, so sind diese ihm zur Verfügung zu<br />
stellen. Eine generelle Übersendung <strong>der</strong> Papier-Beiakte an die jeweils<br />
mit Ermittlungen betraute Person o<strong>der</strong> an das Gericht ist indes nicht er-<br />
for<strong>der</strong>lich.<br />
Soweit <strong>im</strong> Rahmen einer Beweisaufnahme Zweifel an <strong>der</strong> Übereinst<strong>im</strong>-<br />
mung von Ausgangsobjekt und Inhalt <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> bestehen,<br />
ist das Gericht zur Klärung <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Amtsaufklärungspflicht<br />
gehalten. Im Rahmen des Beweisantragsrechtes erscheint bereits <strong>der</strong> §<br />
244 StPO in seiner heutigen Fassung als ausreichend, um mit Beweis-<br />
anträgen in Bezug auf die Scan-Technik und die Zuverlässigkeit des<br />
Scan-Verfahrens und seiner Ergebnisse in rechtsstaatlich befriedigen<strong>der</strong><br />
Weise umgehen zu können.<br />
IX. <strong>Elektronische</strong> <strong>Akte</strong> und internationaler Rechtsverkehr<br />
Die Möglichkeit <strong>der</strong> grenzüberschreitenden Kommunikation unter Verwen-<br />
dung einer elektronischen <strong>Akte</strong> richtet sich nach den jeweiligen Verträgen,<br />
seien sie bilateral o<strong>der</strong> seien es Verträge, mit denen sich mehrere Staaten<br />
(beispielsweise die EU-Mitgliedsstaaten) verpflichten haben.<br />
1. Eingehende Ersuchen<br />
Im Falle eines eingehenden Auslieferungsersuchens best<strong>im</strong>mt § 10 Abs.<br />
1 Satz 1 IRG, dass die Auslieferung nur bei Vorliegen eines Haftbefehls,<br />
einer Urkunde mit entsprechen<strong>der</strong> Rechtswirkung o<strong>der</strong> eines vollstreck-<br />
baren, eine Freiheitsentziehung anordnenden Erkenntnisses einer zu-<br />
ständigen Stelle des ersuchenden Staates zulässig ist. Für eine Auslie-<br />
ferung zur Vollstreckung einer Strafe wird ausdrücklich eine in § 10 Abs.<br />
3 IRG näher beschriebene Urkunde verlangt. (Für Durchlieferungsersu-<br />
chen verweist § 43 Abs. 3 IRG auf § 10 IRG, für Ersuchen auf Vollstre-<br />
210
ckung ausländischer Erkenntnisse vergleiche Art. 49 Abs. 1 Nr. 1, 52<br />
Abs. 1 IRG.)<br />
Diese Unterlagen müssen nach <strong>der</strong> Rechtsprechung bei <strong>der</strong> Entschei-<br />
dung über die Auslieferung grundsätzlich <strong>im</strong> Original vorliegen. Für die<br />
Entscheidung über den Erlass eines Auslieferungshaftbefehls (§ 15 Abs.<br />
1 IRG) genügt indes auch ein vorab übersandtes Fax, sofern es die Re-<br />
produktion <strong>der</strong> Originalunterschriften beziehungsweise <strong>der</strong> Beglaubi-<br />
gungsvermerke erkennen lässt. Aufgrund des vergleichbaren Wortlautes<br />
dürfte sich das Verfahren nach Art. 12 des Europäischen Auslieferungs-<br />
übereinkommens (EuAlÜbk) ähnlich gestalten – wobei dies umstritten<br />
ist. Eine weiterreichende Zulässigkeit für eine Übersendung <strong>der</strong> Unterla-<br />
gen per Fax gilt zwischen den Staaten, die sich dem Abkommen vom<br />
26. Mai 1989 zwischen den Mitgliedstaaten <strong>der</strong> Europäischen Gemein-<br />
schaften über die Vereinfachung und Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> Verfahren zur<br />
Übermittlung von Auslieferungsersuchen (EG-Fax-Konv) angeschlossen<br />
haben.<br />
Diese Ausführungen belegen, dass einige europäischen Staaten auch<br />
<strong>im</strong> Rahmen des internationalen Rechtsverkehrs durchaus bereit sind,<br />
neue Kommunikationswege zu beschreiten und Übermittlungen auf die-<br />
sem Wege wie die Übermittlung von Originalen anzuerkennen. Es er-<br />
scheint daher nicht unwahrscheinlich, dass sich nach <strong>der</strong> Einführung e-<br />
lektronischer Strafakten in zumindest einigen europäischen Staaten Be-<br />
mühungen ergeben werden, auch <strong>im</strong> internationalen Rechtshilfeverkehr<br />
auf elektronischem Wege zu kommunizieren.<br />
2. Ausgehende Ersuchen<br />
Wie ausgehende Ersuchen abzufassen sind und welchen formalen An-<br />
for<strong>der</strong>ungen sie zu genügen haben, richtet sich nach dem Recht des<br />
Staates, <strong>der</strong> um die Gewährung von Rechtshilfe ersucht wird. Wie die<br />
Form <strong>der</strong> Ersuchen heute aussehen sollten, lässt sich aus den Nr. 8 und<br />
27 <strong>der</strong> (die Judikative nicht bindenden) Richtlinie für den Verkehr mit<br />
dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) entnehmen.<br />
211
Sofern seitens eines ausländischen Staates, <strong>der</strong> nicht Partner des EG-<br />
Fax-Konv ist, die Übersendung eines Papierausdrucks o<strong>der</strong> (beglaubig-<br />
ten Ablichtungen) von Originalen verlangt wird, muss dem mit <strong>der</strong> Über-<br />
sendung <strong>der</strong> verlangten Unterlagen entsprochen werden. Allerdings<br />
dürfte sich die Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> auch insoweit nicht<br />
als wesentliches Hin<strong>der</strong>nis erweisen. Ausdrucke aus <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> können je<strong>der</strong>zeit gefertigt und mit den Vermerken versehen wer-<br />
den, die von dem ausländischen Staat verlangt werden.<br />
Da eine Vereinheitlichung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nführung auf elektronischem Wege<br />
zwischen mehreren Staaten o<strong>der</strong> beispielsweise auf Ebene <strong>der</strong> EU illu-<br />
sorisch sein dürfte, wird dies auch bei <strong>der</strong> Einführung einer elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> deutschen <strong>Strafverfahren</strong> <strong>der</strong> zumindest mittelfristig zu<br />
erwartende Weg <strong>der</strong> Kommunikation <strong>im</strong> internationalen Rechtsverkehr<br />
sein.<br />
3. Sonstige Information auf elektronischem Weg<br />
Zwar bestehen bereits heute für das <strong>Strafverfahren</strong> bedeutsame Regis-<br />
ter, die von den europäischen Staaten auf elektronischem Weg eingese-<br />
hen und genutzt werden können (zum Beispiel das Schengener Informa-<br />
tionssystem, Art. 93 ff. SDÜ, o<strong>der</strong> die Strafregistervernetzung zwischen<br />
einzelnen Mitgliedsstaaten <strong>der</strong> EU, vgl. Anhang zu IX). Darüber hinaus<br />
ist man auf EU-Ebene bestrebt, best<strong>im</strong>mte Register auf EU-Ebene zu<br />
zentralisieren (zum Beispiel ein zentrales DNA- und Fingerabdruck-<br />
Register). Die Einrichtung einer Zentraldatei für best<strong>im</strong>mte, ausgesuchte<br />
und in <strong>der</strong> Regel auch hinsichtlich des Informationsgehalts vergleichs-<br />
weise „schlanke“ Daten o<strong>der</strong> eine Vernetzung solcher nationaler Dateien<br />
lässt sich jedoch in technischer Hinsicht und <strong>im</strong> Hinblick auf die <strong>im</strong> ein-<br />
zelnen zu beachtenden Verfahrensfragen nicht mit <strong>der</strong> Vereinheitlichung<br />
<strong>der</strong> elektronischen Führung ganzer <strong>Akte</strong>n vergleichen, was für einen ge-<br />
genseitigen Informationsaustausch mit ganzen <strong>Akte</strong>n(teilen) auf elektro-<br />
nischem Weg erfor<strong>der</strong>lich wäre. An<strong>der</strong>erseits bedeutet die Einführung<br />
einer elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> deutschen Ermittlungs- und <strong>Strafverfahren</strong><br />
212
nicht, dass <strong>der</strong> Inhalt soweit nötig nicht auch künftig noch ausgedruckt<br />
und gegebenenfalls auf Papier in die für den internationalen Rechtshilfe-<br />
verkehr erfor<strong>der</strong>liche Fassung gebracht werden kann.<br />
Dass auf europäischer Ebene durchaus in Richtung einer möglichst ein-<br />
fachen und schnellen Information auf dem bestgeeigneten Weg gedacht<br />
wird, lässt sich auch aus Art. 44 Abs. 1 SDÜ erkennen. Danach ver-<br />
pflichten sich die Vertragsparteien, nach Maßgabe <strong>der</strong> entsprechenden<br />
internationalen Verträge und unter Berücksichtigung <strong>der</strong> örtlichen Gege-<br />
benheiten und <strong>der</strong> technischen Möglichkeiten - insbeson<strong>der</strong>e in den<br />
Grenzregionen - direkte Telefon-, Funk-, Telex- und an<strong>der</strong>e Verbindun-<br />
gen zum Zwecke <strong>der</strong> Erleichterung <strong>der</strong> polizeilichen und zollrechtlichen<br />
Zusammenarbeit, insbeson<strong>der</strong>e <strong>im</strong> Hinblick auf die rechtzeitige Übermitt-<br />
lung von Informationen <strong>im</strong> Zusammenhang mit <strong>der</strong> grenzübergreifenden<br />
Observation und Nacheile zu schaffen.<br />
Sollte sich die elektronische <strong>Akte</strong>nführung in <strong>Strafverfahren</strong> in Deutsch-<br />
land bewähren, kann sie durchaus Anregung zu gleichen o<strong>der</strong> zumin-<br />
dest ähnlichen Verfahrensweisen <strong>im</strong> Ausland bieten, wie schon heute<br />
die elektronische Führung an<strong>der</strong>er Verfahren <strong>im</strong> Ausland Beispiele für<br />
eine elektronische <strong>Akte</strong>nführung in Deutschland bieten kann (vgl. BT-Dr.<br />
15/4067, S. 27).<br />
4. Ausblick:<br />
Vor dem Hintergrund, dass zumindest <strong>der</strong> zwischenstaatliche elektroni-<br />
sche Rechtsverkehr ausbaufähig erscheint und darüber hinaus in den<br />
letzten Jahren das Bedürfnis <strong>der</strong> europäischen Mitgliedstaaten am<br />
schnellen wechselseitigen Austausch von Informationen erheblich ge-<br />
wachsen ist, dürfte sich die Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> deut-<br />
schen <strong>Strafverfahren</strong> auch für den internationalen Rechtsverkehr eher<br />
als för<strong>der</strong>lich denn als hin<strong>der</strong>lich erweisen.<br />
Aus heutiger Sicht dürfte die elektronische <strong>Akte</strong> zwar für den internatio-<br />
nalen Rechtsverkehr (noch) keine Vorteile bieten. An<strong>der</strong>erseits sind aber<br />
213
auch Hin<strong>der</strong>nisse nicht zu erwarten, solange <strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> zur Übermittlung <strong>im</strong> internationalen Rechtsverkehr ausge-<br />
druckt und <strong>im</strong> übrigen soweit nötig auf den Inhalt <strong>der</strong> Papier-Beiakte mit<br />
den Ausgangsdokumenten zurück gegriffen werden kann.<br />
X. Die elektronische <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Rechtsmittelverfahren<br />
Bei Verwendung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> als Hauptakte sind die<br />
sich <strong>im</strong> Hinblick auf Einlegung und Begründung <strong>der</strong> Rechtsmittel ergeben-<br />
den Rechtsfragen bereits durch den durch das <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz<br />
eingeführten § 41 a StPO weitgehend gelöst worden. Im Falle einer elektro-<br />
nischen <strong>Akte</strong>nführung wird danach dem Rechtsmittelführer auch weiterhin<br />
gestattet werden, sein Rechtsmittel nach Maßgabe <strong>der</strong> §§ 314 Abs.1, 341<br />
Abs. 1 auf herkömmliche Weise einzulegen, da er nicht gesetzlich verpflich-<br />
tet werden kann, am elektronischen Rechtsverkehr teilzunehmen. Dass das<br />
Gesetz zum gegenwärtigen Zeitpunkt insoweit auch dem Verteidiger frei stellt,<br />
seine Erklärungen in herkömmlicher Form abzugeben, ist auf dem Boden <strong>der</strong> zur<br />
Zeit auch in Teilen <strong>der</strong> Anwaltschaft noch feststellbaren Zurückhaltung bei <strong>der</strong><br />
Verwendung elektronischer Medien sicher berechtigt. Die künftige Entwicklung<br />
wird zeigen, ob nicht bereits innerhalb weniger Jahre die elektronische Kom-<br />
munikation <strong>im</strong> Geschäftsleben <strong>der</strong>art verbreitet ist, dass jedenfalls denjenigen<br />
Verteidigern, die als Rechtsanwälte zugelassen und nicht Verteidiger <strong>im</strong> Sinne des<br />
§ 138 Abs. 2 StPO sind, auferlegt werden kann, am elektronischen Rechtsverkehr<br />
teilzunehmen.<br />
Soweit <strong>der</strong> durch das <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz eingeführte § 41 a StPO<br />
dem Rechtsmittelführer gestattet, sein Rechtsmittel wahlweise auch in<br />
elektronischer Form einzulegen, ist in diesem Zusammenhang darauf<br />
hinzuweisen, dass die <strong>im</strong> Gesetz <strong>im</strong> Grundsatz vorgesehene Beschränkung<br />
auf Fälle, in denen <strong>der</strong> Rechtsmittelführer über eine qualifizierte elektro-<br />
nische Signatur verfügt, sinnvoller Weise dahin gehend ergänzt wird, „dass<br />
auch ein an<strong>der</strong>es sicheres Verfahren zugelassen werden (kann), das die<br />
Authentizität und Integrität des übermittelten Dokumentes sicherstellt" (§ 41 a<br />
214
Abs. 1 Satz 2 StPO). Insoweit hat <strong>der</strong> Gesetzgeber einen vorsichtigen Aus-<br />
stieg aus den vielfach als überzogen angesehenen Anfor<strong>der</strong>ungen hinsicht-<br />
lich <strong>der</strong> Anwendung <strong>der</strong> qualifizierten elektronischen Signatur unternommen.<br />
Zwar wird auch dieses „an<strong>der</strong>e sichere Verfahren", wie <strong>im</strong>mer es beschaffen<br />
sein mag, eine hohe Hürde für die meisten unvertretenen Angeklagten be-<br />
deuten, es dürfte aber dennoch unerlässlich sein, um - wie bisher durch die<br />
Formvorschriften <strong>der</strong> §§ 314, 341 StPO - sicher zu stellen, wer das Rechts-<br />
mittel eingelegt hat.<br />
Entsprechendes gilt für die Berufungsbegründung (§ 317 StPO).<br />
Zu Recht umfasst § 41 a StPO aber nicht die Möglichkeit, die Revisionsbegrün-<br />
dung nach § 345 Abs. 2 2. Alt. StPO, also durch den Angeklagten selbst,<br />
ebenfalls in elektronischer Form einzulegen, da die Filterfunktion des für die<br />
Aufnahme <strong>der</strong> Erklärung zuständigen Rechtspflegers zur Verhin<strong>der</strong>ung un-<br />
qualifizierten Vorbringens erhalten bleiben muss. Die danach auch nach<br />
Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> möglichen schriftlichen Erklärungen<br />
können unschwer elektronisch aufbereitet (eingescannt) werden, so dass<br />
das Prinzip <strong>der</strong> möglichst vollständigen elektronischen <strong>Akte</strong>nführung nicht<br />
durchbrochen wird.<br />
Im Hinblick auf das weitere Verfahren nach zulässiger Berufung o<strong>der</strong> Revi-<br />
sion (§§ 320, 321, 347 StPO) ergeben sich in praktischer Hinsicht erheb-<br />
liche Beschleunigungseffekte, da zeitraubende <strong>Akte</strong>nversendungen durch<br />
jeweils elektronische Übermittlung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>n vermieden werden können,<br />
was in <strong>der</strong> Summierung <strong>der</strong> Vorgänge die Verwirklichung des <strong>im</strong> Strafver-<br />
fahren beson<strong>der</strong>s bedeutsamen Beschleunigungsgrundsatzes namentlich<br />
aber nicht nur bei Haftsachen wirkungsvoll erleichtert.<br />
Für das Beschwerdeverfahren gilt in rechtlicher Hinsicht Entsprechendes.<br />
Anträge und Erklärungen können - müssen aber nicht - nach § 41 a StPO in<br />
elektronischer Form abgegeben werden. Namentlich hinsichtlich <strong>der</strong> wäh-<br />
rend laufen<strong>der</strong> Hauptverhandlung eingelegten Beschwerden können - je-<br />
denfalls <strong>im</strong> Verkehr zwischen den beteiligten Gerichten und Staatsanwalt-<br />
schaften - die Dateien, die an Stelle <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>n treten, ohne größeren Zeit-<br />
verlust <strong>der</strong> jeweils zuständigen Stelle zugänglich gemacht werden. So kann<br />
215
<strong>im</strong> Beschwerdeverfahren die in <strong>der</strong> Praxis häufig nicht beachtete als Soll-<br />
vorschrift ausgestalte Frist § 306 StPO zur Vorlage <strong>der</strong> Beschwerde an das<br />
Beschwerdegericht leichter gewahrt werden, wenn die <strong>Akte</strong> in elektronischer<br />
Form vorliegt und es keiner zeitrauben<strong>der</strong> Herstellung von Kopien <strong>der</strong> betref-<br />
fenden <strong>Akte</strong>nteile bedarf.<br />
XI. Aufbewahrungsfristen/Archivierung <strong>der</strong> Originalvorgänge<br />
1. Aufbewahrungsbest<strong>im</strong>mungen<br />
Zunächst bedarf es <strong>der</strong> Klärung, welche Aufbewahrungsfristen für<br />
Strafakten nach geltendem Recht bestehen. Da die Verfahrensgesetze<br />
insoweit keine rechtlichen Regelungen enthalten und die Materie auch in<br />
Landesgesetzen nicht erfasst ist, an<strong>der</strong>erseits aber ein erhebliches Bedürfnis<br />
einer einheitlichen Handhabung <strong>im</strong> gesamten Bundesgebiet bestand und fort-<br />
besteht, hat die Konferenz <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>verwaltungen des Bundes und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong><br />
1971 Best<strong>im</strong>mungen über die Aufbewahrungsfristen für das Schriftgut <strong>der</strong> or-<br />
dentlichen Gerichtsbarkeit, <strong>der</strong> Staatsanwaltschaften und <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>vollzugs-<br />
behörden (AufbewBest.) erlassen und fortgeschrieben. Der gegenwärtige<br />
Stand ist März 2006.<br />
Die hier bedeutsamen Auszüge dieser Best<strong>im</strong>mungen (Abschnitt l Allge-<br />
meine Grundsätze, BI. 1-5, und Abschnitt lI Aufbewahrungsfristen spe-<br />
ziell Teil C Straf- und Bußgeldverfahren, BI. 6 und 12 - 15) sind Anhang<br />
des Gutachtens (zu XI a)<br />
Aus den Best<strong>im</strong>mungen ergeben sich für Strafakten Aufbewahrungsfristen<br />
zwischen 5 und 30 Jahren. Diese Fristen verlängern sich faktisch<br />
regelmäßig noch dadurch, dass die Frist erst mit Ablauf des Jahres des<br />
Eintrittes <strong>der</strong> Rechtskraft <strong>der</strong> Entscheidung (s. Abschnitt 16. Abs.1) beginnt,<br />
bei einer nachträglicher Gesamtstrafenentscheidung erst nach diesem<br />
Zeitpunkt (Abs. 2). Betrachtet man insbeson<strong>der</strong>e den Katalog in Abschnitt 2<br />
Nr. 48, so werden viele Strafakten insgesamt sicherlich über einen Zeitraum<br />
216
von 35 - 40 Jahren nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens<br />
aufbewahrt werden müssen. Diese in den Län<strong>der</strong>n und bis zum Jahre<br />
2006 auch <strong>im</strong> Bund (GBA und BGH) als Verwaltungsanweisungen<br />
praktizierten Best<strong>im</strong>mungen werden wegen ihrer weit reichenden<br />
Beschränkung des Rechtes auf informationelle Selbstbest<strong>im</strong>mung, die<br />
zudem nicht einmal in Gesetzesform erfolgt, seit Jahren durch<br />
Datenschutzbeauftragte gerügt. Hilger hat sich nach einer Be-<br />
standsaufnahme des geltenden Rechtes dieser For<strong>der</strong>ung aus ver-<br />
fassungspolitischen Gründen unter dem nahe liegenden Hinweis auf<br />
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungs-<br />
urteil (BVerfGE 65, 1 ff) <strong>im</strong> Wesentlichen angeschlossen.<br />
Im Rahmen des <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetzes hat nun auch <strong>der</strong><br />
Bundesgesetzgeber diesen For<strong>der</strong>ungen und Überlegungen Rechnung<br />
getragen und in Art. 11 das Schriftgutaufbewahrungsgesetz (SchrAG)<br />
erlassen, das am 1.4. 2006 in Kraft getreten ist. Auf Grund verfas-<br />
sungsrechtlicher Bedenken ist <strong>der</strong> Geltungsbereich des Gesetzes aber<br />
abweichend vom Entwurf nur auf Schriftgut <strong>der</strong> Gerichte des Bundes<br />
und des Generalbundesanwaltes begrenzt worden (BT Dr 15/4952 S.<br />
32). Zudem enthält das Gesetz keine Angaben über die konkreten<br />
Aufbewahrungsfristen son<strong>der</strong>n insoweit in § 2 lediglich eine Verord-<br />
nungsermächtigung, von <strong>der</strong> aber bisher noch nicht Gebrauch gemacht<br />
worden ist. Nach Auskunft des <strong>Bundesministerium</strong>s <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> wird eine<br />
VO vorbereitet, die nach Möglichkeit 2008 in Kraft treten soll.<br />
Damit hat sich an <strong>der</strong> bisherigen Rechtspraxis - für die Län<strong>der</strong> ohnehin,<br />
faktisch aber auch für den Bund - nichts geän<strong>der</strong>t. Darüber hinaus kann<br />
aber auch die Prognose gewagt werden, dass etwaige künftige<br />
Regelungen durch ein Tätigwerden des Verordnungsgebers <strong>im</strong> Bund,<br />
sowie Spezialgesetze in den Län<strong>der</strong>n mit entsprechenden<br />
Detailregelungen o<strong>der</strong> Verordnungsermächtigungen <strong>im</strong> Ergebnis kaum<br />
zu wesentlichen Verkürzungen <strong>der</strong> gegenwärtig praktizierten<br />
Aufbewahrungsfristen von Strafakten führen können. Das folgt<br />
bereits aus dem Gebot <strong>der</strong> Sicherung einer effektiven Strafverfolgung.<br />
So gilt auch für formell abgeschlossene Ermittlungsverfahren, dass die<br />
217
zu Grunde liegenden <strong>Akte</strong>n bei neuen wissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen (Beispiel: DNA-Analyse) o<strong>der</strong> sonstigen neuen<br />
Ermittlungsergebnissen auch nach Jahrzehnten wie<strong>der</strong> benötigt<br />
werden können. Gleiches gilt für gerichtlich abgeschlossene Verfahren<br />
nicht nur <strong>im</strong> Hinblick auf die Vollstreckung, son<strong>der</strong>n etwa auch bei<br />
neuen Erkenntnissen über weitere Mittäter (Beispiel: Schleyer-Mord)<br />
und für Wie<strong>der</strong>aufnahmeverfahren die auch noch nach dem Tode des<br />
Verurteilten zulässig sein können (§ 361 Abs. 2 StPO).<br />
Im Ergebnis wird mithin bedacht werden müssen, dass auch eine elektro-<br />
nisch geführte Strafakte in einer Vielzahl von Fällen mindestens 30 Jahre<br />
aufbewahrt werden muss.<br />
Wird die <strong>Akte</strong> voll elektronisch geführt, erscheint es nach gegenwärtigem<br />
informationstechnologischen Erkenntnisstand nicht gesichert, dass für<br />
die nächsten 30 Jahren ein Zugang zu heute abgespeicherten Daten<br />
wirklich gewährleistet werden kann. Die Erfahrungen <strong>der</strong> letzten 20<br />
Jahre zeigen, dass <strong>der</strong> schnelle Wechsel <strong>der</strong> Hardware (insbeson<strong>der</strong>e<br />
<strong>der</strong> Speichermedien) und <strong>der</strong> Software (Betriebssysteme, sowie <strong>der</strong> als<br />
Anwen<strong>der</strong>programme benötigten Schreib-, Bild- und Audioprogramme<br />
und <strong>der</strong>en Zusammenspiel) aber auch <strong>der</strong> natürliche Alterungsprozess<br />
verwendeter Speicher dazu führen, dass <strong>der</strong> Zugriff zu älteren Dateien<br />
<strong>der</strong>art langfristig nicht - zumindest nicht mit <strong>der</strong> für den täglichen Umgang<br />
<strong>im</strong> <strong>Justiz</strong>bereich erfor<strong>der</strong>lichen Leichtigkeit - sicher zu stellen ist. Zu<br />
weiteren technischen Informationen zum Problem <strong>der</strong> Langzeitarchivierung<br />
siehe: Anhang zu XI b.<br />
Man kann zur Lösung des Aufbewahrungsproblems lediglich in elektro-<br />
nischer Form vorliegen<strong>der</strong> Dateien natürlich auf den technologischen<br />
Fortschritt vertrauen, wie es die Konferenz <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>verwaltungen bei <strong>der</strong><br />
Aktualisierung <strong>der</strong> Aufbewahrungsbest<strong>im</strong>mungen <strong>im</strong> Abschnitt I Nr. 3. Abs. 1<br />
möglicherweise getan hat, sofern das Problembewusstsein vorhanden war.<br />
Das Problem ließe sich aber auch dadurch lösen, dass die Dateien in best<strong>im</strong>m-<br />
ten Fristen (5-10 Jahre?) unter den dann geltenden technischen Bedingungen<br />
neu abgespeichert werden. Notfalls müsste die <strong>Akte</strong> rechtzeitig vor Ablauf ih-<br />
218
er „elektronischen Verfallfrist" ausgedruckt und Papierform aufbewahrt wer-<br />
den. Das mag zwar als ein erheblicher neuer Verwaltungsaufwand erschei-<br />
nen, dürfte aber den <strong>im</strong> Verfahren durch Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
erzielten Effektivitätsgewinn insgesamt nicht entscheidend in Frage stellen.<br />
Vielleicht liegen bis zur noch nicht unmittelbar bevorstehenden Einführung <strong>der</strong><br />
elektronischen Strafakten bereits erste Erfahrungen mit dem Umgang lang-<br />
fristig aufzubewahren<strong>der</strong> Dateien aus an<strong>der</strong>en Rechtsgebieten vor. In Be-<br />
tracht kämen etwa Erkenntnisse aus dem Umgang mit Registerdaten etwa<br />
nach Umsetzung des am 1. 1. 2007 in Kraft getretenen Gesetzes über elekt-<br />
ronische Handelsregister und Genossenschaftsregister (EHUG). Das Ge-<br />
setz selber (s. Art 1, § 8a EHUG), sowie Berichte aus <strong>der</strong> Praxis äußern<br />
sich dazu bisher nicht.<br />
2. Die <strong>Elektronische</strong> <strong>Akte</strong> und die Archivierung<br />
Die Verpflichtungen <strong>der</strong> Gerichte und Behörden gegenüber den<br />
Staatsarchiven sind in den jeweiligen Archivgesetzen des Bundes und <strong>der</strong><br />
Län<strong>der</strong> geregelt.<br />
Bei den elektronisch geführten <strong>Akte</strong>n liegt eine Papierform nicht vor. Den<br />
Archivgesetzen von Bund und Län<strong>der</strong>n ist jedoch keine Verpflichtung zu<br />
entnehmen, auf welche Weise die Behörden und Gerichte ihre <strong>Akte</strong>n zu<br />
führen haben, insbeson<strong>der</strong>e dass diese den Staatsarchiven in Papierform<br />
vorzulegen sind. Vielmehr beinhalten einige Archivgesetze ausdrückliche<br />
Regelungen, dass gegebenenfalls auch elektronisch geführte Dateien<br />
als solche vorzulegen sind (§ 2 Abs. 8 BArchG: „Träger von<br />
Datenaufzeichnungen"; § 2 Abs. 1 Hamb ArchG: „maschinenlesbare<br />
Datenträger"). Das lässt insgesamt den sicheren Schluss zu, dass die<br />
Vorlageverpflichtungen aus den Archivgesetzen <strong>der</strong> Einführung einer<br />
elektronischen <strong>Akte</strong> nicht entgegenstehen. Diese könnte die<br />
Aufgabenerfüllung <strong>der</strong> Staatsarchive sogar eher erleichtern, da die<br />
Übermittlung und Aufbewahrung elektronischer Dateien von deutlich<br />
geringeren Komplikationen begleitet sein dürfte, als <strong>der</strong> Transport und die<br />
Aufbewahrung teils umfangreicher <strong>Akte</strong>nbestände. Zudem wäre es <strong>der</strong> zur<br />
Übermittlung <strong>der</strong> Datei verpflichteten Stelle, leichter als bisher möglich,<br />
219
die Datei frühzeitig zu übermitteln, da sie ihr auch weiterhin zur<br />
Verfügung steht und nicht, wie bei papierenen <strong>Akte</strong>n mit Rücksicht auf<br />
in ferner Zukunft auftretende Vollstreckungsprobleme o<strong>der</strong> etwaige<br />
Wie<strong>der</strong>aufnahmegesuche über einen langen Zeitraum zurückgehalten<br />
werden muss. Auch wird es für die abgebende Stelle in <strong>der</strong> Regel<br />
leichter sein, diejenigen <strong>Akte</strong>nteile, die aus Gründen des Gehe<strong>im</strong>- o<strong>der</strong><br />
Datenschutzes dem Archiv nicht anzubieten sind (§ 2 Abs. 1<br />
Satz2ArchG; § 2 Abs. 2 Satz 2 Hamb ArchG), aus einer elektronisch vorlie-<br />
genden Datei auszuson<strong>der</strong>n als aus einer <strong>im</strong> Papierform geführten <strong>Akte</strong>.<br />
Zum Thema Langzeitarchiv für digitale Medien sei schließlich noch auf das<br />
Projekt „Kopal“ hingewiesen:<br />
Das deutsche Projekt „Kopal“ soll auch alte Digitaldaten über Jahrhun<strong>der</strong>te<br />
lesbar erhalten. Das Bundesbildungsministerium för<strong>der</strong>t mit insgesamt<br />
4,2 Mio. Euro den Aufbau eines Langzeitarchivs für digitale Informationen.<br />
Neben <strong>der</strong> bisher üblichen Methode <strong>der</strong> sog. „Bistream Preservation“, bei <strong>der</strong><br />
die Daten regelmäßig auf neue, aktuelle Speichermedien umkopiert werden,<br />
verfolgt Kopal einen neuartigen Ansatz: Um auch die historische Formatviel-<br />
falt in den Griff zu bekommen, haben die Kopal-Partner eine Software entwi-<br />
ckelt, die automatisch technische Eckpunkte einer Datei – also Format, Be-<br />
triebssystem, Versionsnummer <strong>der</strong> verwendeten Software und <strong>der</strong>gleichen –<br />
extrahiert und in eine Datenbank schreibt. So haben die Archivare einen Ü-<br />
berblick darüber, welche Dateien auf einer vom Verschwinden bedrohten<br />
Software beruhen. Damit diese Metadaten nicht ihrerseits irgendwann unle-<br />
serlich werden, werden sie <strong>im</strong> weit verbreiteten Klartext-Format XML abge-<br />
speichert, das notfalls auch ohne spezielle Software gelesen werden kann.<br />
(vgl. auch Anhang zu XI c).<br />
220
XII. Modellvorschlag <strong>der</strong> Strafrechtskommission für eine elektronische<br />
<strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> (de lege ferenda)<br />
- Einzeldarstellung eines Verfahrensgangs vom Beginn <strong>der</strong> Ermittlungen<br />
bis zum Abschluss <strong>der</strong> Vollstreckung<br />
- Einzeldarstellung <strong>der</strong> jeweils damit verbundenen Rechtsprobleme<br />
- Chancen und Risikoabwägung<br />
1. Vorbemerkungen<br />
Bereits seit etlichen Jahren befinden sich Staatsanwaltschaften und<br />
Gerichte auf dem Weg in die "elektronische <strong>Justiz</strong>". Wie sich aus den<br />
jährlichen Län<strong>der</strong>berichten <strong>der</strong> Landesjustizministerien an die Bund-<br />
Län<strong>der</strong>-Kommission ergibt und <strong>im</strong> Gutachten bereits dargestellt, sind<br />
nahezu alle Staatsanwaltschaften und Gerichte <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> flächende-<br />
ckend mit Bildschirmarbeitsplätzen ausgestattet. Der Einsatz einer<br />
Vielzahl von EDV-Fachanwendungen (z. B. web.sta, mesta, und EU-<br />
REKA-Straf, vgl. IV 3. und V) sind aus <strong>der</strong> täglichen Arbeit <strong>der</strong> Staats-<br />
anwälte und Strafrichter nicht mehr wegzudenken. Sie dienen insbe-<br />
son<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Registratur, <strong>der</strong> Schriftguterstellung und <strong>der</strong> erleichterten<br />
Vorgangsbearbeitung. Sämtliche innerbehördlichen Funktionseinheiten<br />
sollen auf die Daten zugreifen können, sodass ein aufwändiger <strong>Akte</strong>n-<br />
transport vermieden und das Verfahren beschleunigt wird. Schnittstel-<br />
len erlauben außerdem die Kommunikation mit externen Behörden, wie<br />
z. B. dem Bundeszentralregister o<strong>der</strong> dem Zentralen Staatsanwaltli-<br />
chen Verfahrensregister. Darüber hinaus bedienen sich Strafverfol-<br />
gungsbehörden und Gerichte zur Erleichterung <strong>der</strong> täglichen prakti-<br />
schen Arbeit einer Vielzahl elektronischer Hilfsmittel. Neben den Re-<br />
cherchemöglichkeiten <strong>im</strong> Internet und (auch behördenübergreifenden)<br />
Informationsmöglichkeiten mithilfe des Intranets stehen umfangreiche<br />
juristische Datenbanken (z. B. juris online) zur Verfügung. Nicht nur in<br />
Deutschland, son<strong>der</strong>n auch in den europäischen Nachbarstaaten wird<br />
<strong>der</strong>zeit <strong>der</strong> Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs, <strong>der</strong> eine mög-<br />
lichst umfassende digitalisierte Kommunikation zwischen sämtlichen<br />
Verfahrensbeteiligten ermöglichen soll, vorangetrieben.<br />
221
Am Endpunkt dieser Entwicklung könnte die Einführung einer elektro-<br />
nischen <strong>Akte</strong> stehen, die eine medienbruchfreie Speicherung sämtli-<br />
cher <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen würde.<br />
Auch wenn die StPO den Begriff "<strong>Akte</strong>" nicht ausdrücklich definiert, be-<br />
stehen keine Zweifel, dass nach gelten<strong>der</strong> Rechtslage <strong>Akte</strong>n in Papier-<br />
form zu führen sind. Die Einführung einer vollelektronischen <strong>Akte</strong> be-<br />
darf daher einer Gesetzesän<strong>der</strong>ung. Während das <strong>im</strong> Jahr 2005 in<br />
Kraft getretene <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz in verschiedenen Verfah-<br />
rensordnungen, u. a. <strong>im</strong> Ordnungswidrigkeitenrecht (vgl. III), die elekt-<br />
ronische <strong>Akte</strong>nbearbeitung ausdrücklich zugelassen hat (vgl. §§ 110a<br />
bis 110f OWiG), fehlt eine <strong>der</strong>artige Ermächtigung für das Strafverfah-<br />
ren. Aus <strong>der</strong> Gesetzesbegründung (BT-Drs. 15/4067, S. 26) lässt sich<br />
entnehmen, dass <strong>der</strong> Gesetzgeber u. a. mögliche Beeinträchtigungen<br />
des Beweiswertes durch den Einsatz elektronischer Dokumente be-<br />
fürchtet hat. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass u. a. aus verfas-<br />
sungsrechtlichen Gründen auch künftig die Möglichkeit einer Korres-<br />
pondenz in Papierform erhalten bleiben müsse, wodurch eine perso-<br />
nalaufwändige Umwandlung in digitale Dokumente erfor<strong>der</strong>lich würde.<br />
Dennoch hat <strong>der</strong> Gesetzgeber als notwendige Vorstufe für die Einfüh-<br />
rung einer elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Strafprozess die Möglichkeit des e-<br />
lektronischen Rechtsverkehrs durch die Einführung des § 41a StPO<br />
eröffnet. Die zur Umsetzung erfor<strong>der</strong>lichen Rechtsverordnungen <strong>der</strong><br />
<strong>Justiz</strong>verwaltung fehlen jedoch bisher weitgehend.<br />
Auch wenn die Nutzung einer ausschließlich elektronischen Strafakte<br />
in Deutschland – und soweit ersichtlich auch <strong>im</strong> Ausland – de lege lata<br />
nicht zulässig ist, kann <strong>im</strong> Folgenden jedoch auf gewisse Erfahrungen<br />
zurückgegriffen werden, die in Großverfahren durch den Einsatz elekt-<br />
ronischer Hilfsakten (z. B. bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft Stuttgart; vgl.<br />
Darstellung unter V) gewonnen wurden. Eine gewisse Orientierungshil-<br />
fe bieten auch Erkenntnisse aus verschiedenen Pilotprojekten zum Ein-<br />
satz <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Bußgeldverfahren (z. B. in Schleswig-<br />
Holstein und in Hessen).<br />
222
In den folgenden Abschnitten soll <strong>der</strong> denkbare Ablauf eines Strafver-<br />
fahrens vom Beginn <strong>der</strong> Ermittlungen bis zum Abschluss <strong>der</strong> Vollstre-<br />
ckung nach einer de lege ferenda denkbaren Einführung <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong>nführung dargestellt und die dabei zu erwartenden rechtli-<br />
chen und tatsächlichen Probleme und Risiken ebenso wie die mögli-<br />
chen Chancen, die die Kommission erkennt, dargestellt werden.<br />
Bereits an dieser Stelle ist jedoch auf eine technische Grundvorausset-<br />
zung für die sinnvolle Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> hinzuwei-<br />
sen.<br />
Die Kommission ist einhellig <strong>der</strong> Ansicht:<br />
Die Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> setzt zwingend ein<br />
bundesweites elektronisches Datenverbundsystem zumin-<br />
dest zwischen Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und<br />
Gerichten voraus, das einen reibungslosen und sicheren<br />
Datenaustausch untereinan<strong>der</strong> gewährleistet.<br />
Die Elektronisierung <strong>der</strong> Kommunikation <strong>im</strong> strafprozessua-<br />
len Rechtsverkehr darf nicht dazu führen, dass die bislang<br />
für den Datenschutz geltenden Standards unterschritten<br />
werden.<br />
Bisher sind diese Möglichkeiten nicht einmal auf Landesebene zwi-<br />
schen Polizei und Staatsanwaltschaft sichergestellt. Ohne eine län-<br />
<strong>der</strong>übergreifende Vernetzung würden sich die mit <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong><br />
elektronischen <strong>Akte</strong> erzielbaren Vorteile jedoch schnell relativieren, da<br />
elektronische Strafakten stets wie<strong>der</strong> in Papierform umgewandelt wer-<br />
den müssten, sobald Ermittlungshandlungen in an<strong>der</strong>en Bundeslän-<br />
<strong>der</strong>n notwendig würden. Bei <strong>der</strong> Entwicklung gemeinsamer bundeswei-<br />
ter Datennetze wird auch zu bedenken sein, dass die verfahrensbe-<br />
st<strong>im</strong>menden Daten (Metadaten) in strukturierter Form nach einem be-<br />
st<strong>im</strong>mten Schema zu übermitteln sind, damit diese Datenfel<strong>der</strong> auto-<br />
matisch in die jeweilige Verfahrensbearbeitungssoftware des Empfän-<br />
gers eingestellt werden können-. Selbstverständlich muss durch eine<br />
223
entsprechende Verschlüsselung <strong>der</strong> Kommunikation ein Zugriff Unbe-<br />
fugter auf die übermittelten <strong>Akte</strong>ninhalte weitestmöglich auszuschlie-<br />
ßen sein.<br />
2. Denkbarer Ablauf des <strong>Strafverfahren</strong>s<br />
2.1 Ermittlungsverfahren:<br />
2.1.1Verfahrenseinleitung durch die Polizei<br />
Nach den Erfahrungen <strong>der</strong> Praxis liegt etwa 80 % <strong>der</strong> staatsanwalt-<br />
schaftlichen Ermittlungsverfahren eine polizeiliche Anzeigenaufnahme<br />
zugrunde. Sofern die Polizeibehörden von Amts wegen (§ 163<br />
Abs. 1 StPO) tätig werden o<strong>der</strong> aber eine mündlich erstattete Strafan-<br />
zeige aufnehmen (§ 158 Abs. 1 StPO), erfolgt die Vorgangserstellung<br />
in aller Regel unmittelbar mithilfe elektronischer Vorgangsbearbei-<br />
tungssysteme (z. B. Nivadis, Inpol etc.). Das in diesen Fällen bisher in<br />
Papierform zur <strong>Akte</strong> genommene Anzeigenformular stellt somit ledig-<br />
lich einen Ausdruck, nicht jedoch die elektronische Urfassung <strong>der</strong><br />
Strafanzeige dar. Bei Einführung <strong>der</strong> elektronischen Strafakte könnte<br />
auf diesen Ausdruck somit problemlos verzichtet werden. Dasselbe gilt<br />
für die Fälle, in denen die Strafanzeige über das Internet erstattet wird.<br />
So besteht bereits heute in den meisten Bundeslän<strong>der</strong>n die Möglich-<br />
keit, über sog. "Internetpolizeiwachen" Strafanzeigen "online" zu erstat-<br />
ten. Der Anzeigeerstatter erhält dann eine elektronische Eingangsbes-<br />
tätigung. Auf diese Weise eingehende Strafanzeigen können ohne wei-<br />
teres in die polizeilichen Fachanwendungssysteme zur weiteren Bear-<br />
beitung übernommen werden. Trotz zunehmen<strong>der</strong> Nutzung des elekt-<br />
ronischen Rechtsverkehrs ist allerdings auf absehbare Zeit auch wei-<br />
terhin mit dem Eingang schriftlicher Strafanzeigen zu rechnen. Da nach<br />
Art. 19 Abs. 4 GG <strong>der</strong> Zugang zum Gericht nicht unnötig erschwert<br />
werden darf, wird Privatpersonen, wie Geschädigten, Zeugen o<strong>der</strong><br />
auch Beschuldigten <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> keine Verpflichtung zur Teilnah-<br />
me am elektronischen Rechtsverkehr auferlegt werden können. In <strong>der</strong>-<br />
artigen Fällen müssten Strafanzeigen o<strong>der</strong> aber auch sonstige vorge-<br />
legte Schriftstücke durch Scannen in elektronische Dokumente umge-<br />
wandelt und zum Vorgang genommen werden. Hierfür sind verlässliche<br />
224
Verfahren zu entwickeln, die grundsätzlich die Gewähr dafür bieten,<br />
dass das durch Scannen entstandene digitalisierte Dokument mit dem<br />
Ausgangsobjekt übereinst<strong>im</strong>mt. So wäre nach Ansicht <strong>der</strong> Kommission<br />
nach dem Vorbild des § 110b Abs. 2 OWiG zu for<strong>der</strong>n, dass elektroni-<br />
sche Dokumente einen Vermerk enthalten, wann und durch wen die<br />
Urschrift übertragen worden ist und ob beispielsweise das Ausgangs-<br />
objekt als Original o<strong>der</strong> in Abschrift vorgelegen hat (§ 110b Abs. 4<br />
Nr. 2 OWiG). An<strong>der</strong>s als <strong>im</strong> Ordnungswidrigkeitenverfahren, das unter<br />
engen Voraussetzungen eine Vernichtung <strong>der</strong> in Papierform einge-<br />
reichten Urschriften zulässt (§ 110b Abs. 4 OWiG), wird wegen <strong>der</strong><br />
strengeren Beweisregeln <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> nach Ansicht <strong>der</strong> Kommis-<br />
sion eine Aufbewahrung von in Papierform eingegangenen Dokumen-<br />
ten zumindest bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss unum-<br />
gänglich sein. Zu diesem Zweck wäre bei Bedarf parallel zur elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> eine "Begleitakte" für schriftliche Unterlagen zu führen, wo-<br />
bei bereits bei <strong>der</strong> Polizei durch organisatorische Maßnahmen sicher-<br />
gestellt werden müsste, dass diese <strong>Akte</strong>n problemlos <strong>der</strong> digitalen<br />
"Hauptakte" zuzuordnen sind.<br />
Problematisch erscheint <strong>der</strong> Kommission nach <strong>der</strong>zeitiger Rechtslage,<br />
ob auch <strong>der</strong> für die Verfolgung best<strong>im</strong>mter Straftaten erfor<strong>der</strong>liche<br />
Strafantrag (§ 77ff StGB) per E-Mail wirksam gestellt werden kann. Im<br />
Grundsatz wird dies in <strong>der</strong> Kommentierung bejaht, wobei sich wegen<br />
des Schriftlichkeitserfor<strong>der</strong>nisses aus § 158 Abs. 2 i. V. m. § 41a StPO<br />
jedoch folgern ließe, dass <strong>der</strong> per E-Mail gestellte Strafantrag mit einer<br />
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz verse-<br />
hen werden müsste. Diese hohen Anfor<strong>der</strong>ungen dürften sich in <strong>der</strong><br />
Praxis nicht zuletzt wegen <strong>der</strong> für das Signaturverfahren anfallenden<br />
erheblichen Kosten als deutliches Hemmnis für die Beteiligung privater<br />
Personen am elektronischen Rechtsverkehr erweisen. Um die Prüfung<br />
<strong>der</strong> Authentizität einer per E-Mail abgegebenen Erklärung <strong>im</strong> ausrei-<br />
chenden Umfang zu ermöglichen, sollte (de lege ferenda) auch die<br />
eingescannte handschriftliche Unterschrift ausreichen. Um dem Schrift-<br />
lichkeitsgebot bei Strafanträgen Rechnung zu tragen, könnte nach Ein-<br />
gang einer elektronischen Strafanzeige dem Anzeigeerstatter auch ein<br />
225
Antragsformular übersandt werden, das nach Rücklauf und Einscan-<br />
nung zur Begleitakte zu nehmen wäre.<br />
Nach Eingang <strong>der</strong> Strafanzeigen und ggf. <strong>der</strong>en Überführung in die e-<br />
lektronische <strong>Akte</strong> könnte die polizeiliche Vorgangsbearbeitung weiter-<br />
hin problemlos in digitaler Form erfolgen. Dies gilt sowohl für Bearbei-<br />
tervermerke wie auch die Aufnahme digital erstellter Vernehmungspro-<br />
tokolle, Fotos o<strong>der</strong> Videosequenzen vom Tatort. Zur Vermeidung unnö-<br />
tiger Transporte von Asservaten würde es sich ferner anbieten, diese<br />
mithilfe einer Digitalkamera zu fotografieren und die Fotos in eine elekt-<br />
ronische Asservatenliste aufzunehmen. Auf diese Weise ließe sich<br />
vermutlich in vielen Fällen <strong>im</strong> Rahmen späterer Beweiswürdigung die<br />
Inaugenscheinnahme körperlicher Gegenstände durch <strong>der</strong>en Betrach-<br />
tung am Bildschirm ersetzen.<br />
2.1.2 Verfahren bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
2.1.2.1 Registrierung und Einleitungsverfügung<br />
Soweit in relativ wenigen Fällen Strafanzeigen unmittelbar bei <strong>der</strong><br />
Staatsanwaltschaft eingehen, gelten für die Behandlung dieser Ein-<br />
gänge die oben gemachten Ausführungen entsprechend. In <strong>der</strong> Regel<br />
würden die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen jedoch mit <strong>der</strong> elekt-<br />
ronischen Übersendung eines von <strong>der</strong> Polizei häufig bereits weitge-<br />
hend ausermittelten Vorgangs beginnen. Denkbar wäre, dass die <strong>Akte</strong><br />
zunächst auf dem Bildschirm einer zentralen Eingangsgeschäftsstelle<br />
erscheint, die wie<strong>der</strong>um den Vorgang elektronisch entsprechend dem<br />
Geschäftsverteilungsplan – ggf. über die Abteilungsleitung – an die zu-<br />
ständigen Dezernentinnen und Dezernenten weiterleitet. Diese erken-<br />
nen dann auf ihrem Bildschirm den Neueingang in ihrem virtuellen Ak-<br />
tenkorb. Als Alternative kommt die weitgehend automatische Verteilung<br />
<strong>der</strong> Neueingänge nach dem Maßstab <strong>der</strong> konkreten Auslastung <strong>der</strong> je-<br />
weiligen Dezernenten in Betracht. So wird z. B. nach dem bei <strong>der</strong><br />
Staatsanwaltschaft Berlin durchgeführten Projekt MODESTA für jedes<br />
Dezernat ein Punktekonto geführt und das Dezernat, das die wenigsten<br />
Punkte aufweist, bekommt jeweils das neue Verfahren zugeteilt. Dabei<br />
ist selbstverständlich auch eine Korrektur des Punktekontos möglich,<br />
226
falls sich ein Verfahren als überdurchschnittlich umfangreich heraus-<br />
stellt. Eine <strong>der</strong>artige Verteilungspraxis dürfte nach Ansicht <strong>der</strong> Kom-<br />
mission insbeson<strong>der</strong>e bei in etwa "gleichwertigen" Verfahren <strong>der</strong> All-<br />
tags- und Bagatellkr<strong>im</strong>inalität (z. B. in <strong>der</strong> Amtsanwaltschaft) sinnvoll<br />
sein.<br />
Nach Eingang des Vorgangs kann <strong>der</strong> jeweilige Dezernent mithilfe <strong>der</strong><br />
entsprechenden Bearbeitungssoftware die Eintragung des Verfahrens<br />
am Bildschirm verfügen, wodurch gleichzeitig eine elektronische Ein-<br />
gangsbestätigung an die Polizei ausgelöst wird. Diese enthält neben<br />
<strong>der</strong> Mitteilung des staatsanwaltschaftlichen <strong>Akte</strong>nzeichens auch einen<br />
"Barcode" (Strichcode) für später von <strong>der</strong> Polizei noch nachzusenden-<br />
de Schriftstücke o<strong>der</strong> Asservate. Der Strichcode ermöglicht das elekt-<br />
ronische Auslesen, sodass die mit dieser Kennzeichnung ausgestatte-<br />
ten Schriftstücke nach Einscannung automatisch in die jeweilige digita-<br />
lisierte <strong>Akte</strong> eingestellt werden können. Diese Vorgehensweise hat sich<br />
bereits in pilotierten elektronisch abgewickelten Bußgeldverfahren, so<br />
z. B. in Schleswig-Holstein, bewährt. Im Gegensatz zur dortigen Praxis,<br />
die eingescannten Papiernachgänge jeweils in nach Eingangsdatum<br />
angelegten "Tüten" aufzubewahren, erscheint <strong>im</strong> Strafermittlungsver-<br />
fahren die Zusammenfassung sämtlicher Papiereingänge in einer für<br />
jedes Verfahren anzulegenden "Begleitakte" sachgerechter. Da <strong>im</strong><br />
<strong>Strafverfahren</strong> voraussichtlich wesentlich häufiger auf körperliche Ori-<br />
ginalvorgänge zurückgegriffen werden muss als <strong>im</strong> Bußgeldverfahren,<br />
wird das Auffinden <strong>der</strong> Unterlagen hierdurch deutlich erleichtert. Das-<br />
selbe gilt <strong>im</strong> Ergebnis auch für die notwendige Aufbewahrung bzw. Ar-<br />
chivierung des zu einem best<strong>im</strong>mten Verfahren gehörenden Beweis-<br />
materials.<br />
2.1.2.1 <strong>Elektronische</strong> Ermittlungsführung<br />
Nach <strong>der</strong> elektronischen Eintragungsverfügung (Registrierung) des<br />
Verfahrens erfolgt die weitere <strong>Akte</strong>nbearbeitung durch den Dezernen-<br />
ten mithilfe des zur Verfügung stehenden jeweiligen elektronischen<br />
Fachverfahrens. So bietet z. B. MODESTA den Dezernenten ca.<br />
80 verschiedene "Maßnahmen" (z. B. <strong>Akte</strong>n beiziehen, Ermittlungsauf-<br />
227
trag erteilen und Registerauskunft erfor<strong>der</strong>n) an, die <strong>der</strong> Dezernent<br />
durch Anklicken auf <strong>der</strong> entsprechenden Schaltfläche des Bildschirms<br />
aufrufen kann. Nach diesem Arbeitsschritt erscheinen sodann die be-<br />
reits mit den jeweiligen Metadaten (z. B. <strong>Akte</strong>nzeichen) ausgestatteten<br />
Formulare, die <strong>der</strong> Dezernent dann u. a. auch mithilfe von Textbaustei-<br />
nen am Bildschirm ausfüllen kann. Auf dem in drei Teile geglie<strong>der</strong>ten<br />
Bildschirm erscheint neben den Maßnahmen gleichzeitig ein "<strong>Akte</strong>n-<br />
baum", <strong>der</strong> die <strong>Akte</strong>nstruktur erkennen lässt und die Möglichkeit eröff-<br />
net, Dokumente nach best<strong>im</strong>mten Kategorien (z. B. Zeugenverneh-<br />
mungen, Anzeigen, Haftbefehle etc.) anzeigen zu lassen. In <strong>der</strong> dritten<br />
Spalte des Bildschirms erscheint gleichzeitig das jeweils gerade aufge-<br />
rufene <strong>Akte</strong>nblatt. Nach Beendigung einer Verfügung erfolgt die sog.<br />
"Schlusszeichnung", wodurch das Dokument dem Vorgang hinzuge-<br />
fügt, automatisch elektronisch paginiert und zugleich abgesandt wird.<br />
Sofern sich private Empfänger nicht vorher mit <strong>der</strong> elektronischen Ü-<br />
bermittlung von Dokumenten einverstanden erklärt haben, werden ent-<br />
sprechende Dokumente (z. B. Ladungen zur Vernehmung, Einstel-<br />
lungsbescheide o<strong>der</strong> Einstellungsnachrichten etc.) einer speziellen<br />
Ausgangsgeschäftsstelle übermittelt, wo mithilfe von Hoch-<br />
leistungsdruckern sämtliche die Behörde verlassenden Schriftstücke<br />
ausgedruckt und in den Postverkehr gegeben werden. Soweit mit ei-<br />
nem Rücklauf von Schriftstücken (PZU, Anhörbogen etc.) zu rechnen<br />
ist, sind diese von vornherein mit dem für das jeweilige Verfahren aus-<br />
gegebenen Barcode zu versehen, damit sie nach späterem Eingang<br />
auf <strong>der</strong> zentralen Posteingangsstelle und Einscannung automatisch <strong>der</strong><br />
jeweiligen elektronischen <strong>Akte</strong> zugeordnet werden können.<br />
Bei entsprechen<strong>der</strong> Ausstattung <strong>der</strong> Fachverfahrenssoftware sind nicht<br />
nur sämtliche erfor<strong>der</strong>lichen Registerauskünfte (Bundeszentralregister,<br />
Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister, Verkehrszent-<br />
ralregister) online abrufbar, son<strong>der</strong>n auch Auskünfte von Behörden und<br />
an<strong>der</strong>en öffentlichen Stellen ließen sich unter Vermeidung <strong>der</strong> bisher<br />
üblichen Postlaufzeiten problemlos elektronisch zu den <strong>Akte</strong>n bringen,<br />
zumal nach Ansicht <strong>der</strong> Kommission staatliche Institutionen durch<br />
Rechtsvorschriften zur Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr<br />
228
verpflichtet werden können (vgl. VI 4). Auch wenn eine solche Ver-<br />
pflichtung – wie bereits dargestellt – für Privatpersonen und private In-<br />
stitutionen aus verfassungsrechtlichen Gründen wohl nicht zu realisie-<br />
ren ist (vgl. VI 3), dürften jedoch vielfach wirtschaftliche Interessen zu<br />
einem faktischen "Anschlusszwang" führen. Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e für<br />
Versicherungen, <strong>der</strong>en <strong>Akte</strong>n schon heute weitgehend elektronisiert<br />
sind.<br />
Soweit die Staatsanwaltschaft Parallelermittlungen mit Hilfe verschie-<br />
dener Polizeibehörden beabsichtigt, hätte die elektronische <strong>Akte</strong> den<br />
großen Vorteil, dass dies ohne aufwändige Herstellung von Mehrfach-<br />
akten erfolgen könnte. Je<strong>der</strong> <strong>der</strong> betreffenden Polizeidienststellen wäre<br />
problemlos ein <strong>Akte</strong>nduplikat zu übermitteln. Dieselben Erwägungen<br />
gelten auch für die evtl. notwendige Einschaltung eines Ermittlungs-<br />
richters. Diesem könnten nicht nur die <strong>Akte</strong>, son<strong>der</strong>n auch sämtliche<br />
an<strong>der</strong>en digital erfassten Beweismittel ohne Kopieraufwand zur Ver-<br />
fügung gestellt werden. Mithilfe entsprechen<strong>der</strong> Schreibprogramme<br />
bestünde für den Ermittlungsrichter auch die Möglichkeit, z. B. Teile <strong>der</strong><br />
elektronisch übermittelten staatsanwaltschaftlichen Antragsbegründung<br />
nach entsprechen<strong>der</strong> Überprüfung in seine eigene Beschlussaus-<br />
fertigung zu übernehmen.<br />
In den vorgenannten Fällen paralleler Arbeiten mit <strong>der</strong> Ermittlungsakte<br />
ist jedoch stets sicherzustellen, welche <strong>Akte</strong> als "führend" anzusehen<br />
ist, damit nicht <strong>im</strong> Ergebnis unterschiedliche elektronische "Hauptak-<br />
ten" entstehen. Aus diesem Grund sieht die Fachanwendung MODES-<br />
TA einen "Sperrvermerk" vor, <strong>der</strong> jede weitere Bearbeitung auf Seiten<br />
<strong>der</strong> Staatsanwaltschaft unmöglich macht, sofern <strong>im</strong> System ein "Ver-<br />
sandvermerk" eingetragen ist. Erst wenn z. B. die Beschlüsse des Er-<br />
mittlungsrichters ergangen und übermittelt worden sind und <strong>der</strong> Ver-<br />
merk "versandt" gelöscht wurde, besteht die Möglichkeit zwischenzeit-<br />
lich erstellte o<strong>der</strong> eingegangene Dokumente aus einem elektronischen<br />
Retentordner dem Vorgang hinzuzufügen. Vom Dezernenten am Bild-<br />
schirm verfügte Fristen werden generell automatisch überwacht.<br />
229
2.1.2.3 Rechte des Beschuldigten / Verteidigers<br />
Die Rechte eines Verteidigers gemäß § 147 Abs. 1 StPO, <strong>Akte</strong>nein-<br />
sicht zu nehmen, bzw. <strong>der</strong> Anspruch des Beschuldigten auf Erteilung<br />
von Auskünften und Abschriften aus den <strong>Akte</strong>n unter den Vorausset-<br />
zungen des § 147 Abs. 7 StPO dürfen durch die Einführung einer elekt-<br />
ronischen <strong>Akte</strong> nicht beschränkt werden. Es ist daher mithilfe entspre-<br />
chen<strong>der</strong> organisatorischer Vorkehrungen sicherzustellen, dass Vertei-<br />
digern, die nicht über eine entsprechende Technik verfügen und als<br />
Privatpersonen zur Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr wohl<br />
auch kaum verpflichtet werden können, einen Papierausdruck <strong>der</strong> <strong>Akte</strong><br />
erhalten und <strong>im</strong> Bedarfsfall auch Zugang zu den in Papierform in <strong>der</strong><br />
"Begleitakte" verwahrten Originalunterlagen bekommen. Auch für den<br />
Beschuldigten, <strong>der</strong> ebenfalls nicht zur Teilnahme am elektronischen<br />
Rechtsverkehr gezwungen werden kann, ist zu gewährleisten, dass<br />
ggf. zur Umsetzung seiner Rechte Papierausdrucke hergestellt werden<br />
können.<br />
Auch ohne rechtliche Verpflichtung wird jedoch für die Anwaltschaft re-<br />
lativ schnell ein Bedürfnis zur elektronischen Kommunikation <strong>im</strong> Straf-<br />
prozess entstehen. Neben einer Vereinfachung und Beschleunigung<br />
<strong>der</strong> Verfahrensabläufe lassen sich insbeson<strong>der</strong>e in Großverfahren die<br />
übersandten Datenmengen elektronisch sehr viel einfacher, z. B. durch<br />
den Einsatz von Suchverfahren und Verlinkung, aufbereiten. Ggf. könn-<br />
te die wünschenswerte Teilnahme von Rechtsanwälten am elektroni-<br />
schen Rechtsverkehr auch durch entsprechende Gebührenanreize ge-<br />
för<strong>der</strong>t werden.<br />
Technisch wäre die <strong>Akte</strong>neinsicht durch Übersendung eines Datenträ-<br />
gers (CD bzw. DVD), durch "Überspielen" <strong>der</strong> Daten o<strong>der</strong> <strong>im</strong> Wege des<br />
sog. "Fernabrufs" (vgl. § 110d Abs. 2 S. 3 OWiG) denkbar, wobei die<br />
letztgenannte Möglichkeit den Vorteil hätte, dass <strong>der</strong> Verteidiger jeweils<br />
taggenau Kenntnis von <strong>der</strong> aktuellen <strong>Akte</strong>nlage erhielte und Kopier-<br />
sowie Versandkosten entfallen würden. Aus Gründen des Datenschut-<br />
zes dürfte dabei jedoch sicherzustellen sein, dass <strong>der</strong> Fernabruf jeweils<br />
in <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> dokumentiert wird und dass ein Abruf nur<br />
durch den Verteidiger (Ausgabe eines best<strong>im</strong>mten Passwortes, Ver-<br />
230
schlüsselung <strong>der</strong> Datenübertragung) und nicht durch einen unbefugten<br />
Dritten erfolgen kann. Darüber hinaus ist technisch zu gewährleisten,<br />
dass eine Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> während des Zugriffs<br />
ausgeschlossen wird.<br />
Regelungsbedürftig erscheint in diesem Zusammenhang auch die Fra-<br />
ge, wie die missbräuchliche Verbreitung sensibler <strong>Akte</strong>nbestandteile,<br />
wie etwa Opferfotos o<strong>der</strong> Geschäftsdaten z. B. durch die Einstellung<br />
ins Internet verhin<strong>der</strong>t werden kann. Zwar besteht auch bei Verwen-<br />
dung von Papierakten ein Spannungsverhältnis zwischen Opferschutz-<br />
gesichtspunkten und Beschuldigtenrechten, wenn <strong>der</strong> Verteidiger sei-<br />
nem Mandanten den <strong>Akte</strong>ninhalt bekannt gibt. Die leichtere Weiterga-<br />
bemöglichkeit elektronischer Dokumente führt jedoch zu einer deutlich<br />
höheren Missbrauchsgefahr, da diese nicht wie eine Papierakte zu-<br />
nächst für die elektronische Weiterleitung aufbereitet werden müssen.<br />
Es wird daher zu prüfen sein, und darauf weist die Kommission beson-<br />
<strong>der</strong>s hin, ob best<strong>im</strong>mte <strong>Akte</strong>nbestandteile möglicherweise mit einem<br />
"Sperrvermerk" zu versehen sind mit <strong>der</strong> Folge, dass diese nicht elekt-<br />
ronisch übermittelt, son<strong>der</strong>n lediglich auf <strong>der</strong> Geschäftsstelle eingese-<br />
hen werden können. Neben einer denkbaren Beschränkung <strong>der</strong> Wei-<br />
tergabemöglichkeiten des Verteidigers wäre auch zu diskutieren, ob<br />
missbräuchliches Verhalten des Beschuldigten z. B. durch eine Erwei-<br />
terung des § 353d StGB erfasst werden sollte.<br />
Für den Fall, dass sich ein Beschuldigter in Untersuchungshaft befindet<br />
und zur effektiven Verteidigung Zugang zu umfangreichem Datenmate-<br />
rial benötigt, wird man möglicherweise prüfen müssen, ob für die nicht<br />
überwachte Verteidigerpost die Einrichtung eines eigenen E-Mail-<br />
Postfaches in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>vollzugsanstalt in Betracht kommt.<br />
2.1.2.4 Entscheidung über den Verfahrensabschluss<br />
Nach Durchführung sämtlicher erfor<strong>der</strong>lichen Ermittlungen hat <strong>der</strong><br />
Staatsanwalt auf <strong>der</strong> Grundlage des Beweisergebnisses die Frage des<br />
hinreichenden Tatverdachtes zu prüfen. In diesem Zusammenhang<br />
231
stellt sich die Frage, ob die Überzeugungsbildung durch Verwendung<br />
elektronischer Dokumente beeinträchtigt werden könnte.<br />
Soweit über den elektronischen <strong>Akte</strong>ninhalt hinaus noch zusätzliche In-<br />
formationen, die sich nur aus den Originalunterlagen ergeben, benötigt<br />
werden (z. B. Vorliegen einer Originalunterschrift?) ist sicherzustellen,<br />
dass die zu dem jeweiligen Vorgang gehörende Papierbegleitakte je-<br />
<strong>der</strong>zeit einsehbar ist. Dasselbe gilt auch für die Inaugenscheinnahme<br />
von Asservaten, sofern <strong>der</strong> Aussagewert digitaler Fotos für eine ab-<br />
schließende Beurteilung des Sachverhaltes nicht ausreicht. Um einen<br />
schnellen Zugriff des Dezernenten zu ermöglichen, erscheint es ange-<br />
bracht, dass die Begleitakten ebenso wie die Asservate nicht bei <strong>der</strong><br />
Polizei verbleiben, son<strong>der</strong>n grundsätzlich bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
aufbewahrt werden.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e dann, wenn das Einscannen von Papierdokumenten von<br />
einer Behörde in einem verlässlichen Verfahren erfolgt ist, wird <strong>der</strong><br />
Staatsanwalt nur dann die Papierbeiakte zu prüfen haben, wenn kon-<br />
kreter Anlass zu Zweifeln besteht, dass <strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> mit dem Ausgangsobjekt übereinst<strong>im</strong>mt (vgl. die klarstellende Re-<br />
gelung in § 110e Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 OWiG). Dieselben Grundsät-<br />
ze gelten auch für eingescannte Vernehmungsprotokolle.<br />
Im Übrigen dürfte nach Ansicht <strong>der</strong> Kommission <strong>der</strong> Beweiswert sons-<br />
tiger <strong>Akte</strong>nbestandteile (Vermerke, Skizzen, Gutachten, Fotos usw.)<br />
von einer Umstellung auf die elektronische <strong>Akte</strong>nführung nicht negativ<br />
beeinflusst werden.<br />
Da <strong>im</strong> Fall des Einsatzes einer elektronischen <strong>Akte</strong> technisch die Mög-<br />
lichkeit besteht, in diese auch akustische o<strong>der</strong> optische Verfahrensteile<br />
(TÜ-Aufzeichnungen, Videodokumentationen vom Tatort etc.) aufzu-<br />
nehmen, ist hierdurch vielmehr eine Steigerung des Beweiswertes zu<br />
erwarten. So ließe sich auf diese Weise z. B. frühzeitig Streit über die<br />
korrekte Protokollierung von TÜ-Aufnahmen vermeiden.<br />
232
Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass unter Beachtung<br />
best<strong>im</strong>mter organisatorischer Vorgaben durch die Einführung einer e-<br />
lektronischen <strong>Akte</strong> keine negativen Auswirkungen auf die Entschei-<br />
dungsfindung des Staatsanwalts zu befürchten sind.<br />
2.1.2.5 Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung und -verteilung<br />
Soweit durch das erfor<strong>der</strong>liche Einscannen von Schriftstücken zusätzli-<br />
che Arbeit für Servicekräfte anfällt, wird dieser Mehraufwand mit Si-<br />
cherheit durch Einsparung bisher üblicher Kopiertätigkeit ausgeglichen.<br />
Die Kommission weist darauf hin, dass <strong>der</strong> Einsatz <strong>der</strong> elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> in Verbindung mit dem Einsatz mo<strong>der</strong>ner Fachverfahren und Do-<br />
kumenten-Managementsysteme zu einer Verlagerung von Verwal-<br />
tungsaufgaben von den bisherigen Serviceeinheiten auf die Dezernen-<br />
tinnen und Dezernenten führen wird. Serviceeinheiten (Geschäftsstel-<br />
len) <strong>im</strong> herkömmlichen Sinne wären bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft weitge-<br />
hend überflüssig, da die Dezernenten ihre Verfügungen per Mausklick<br />
selbst ausführen und Schreibarbeiten am Computer erledigen. Um die-<br />
sen zusätzlichen Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten, dürften zu-<br />
nächst ein komfortabel ausgestatteter elektronischer Arbeitsplatz mit<br />
großformatigen Monitoren, leistungsfähigen Rechnern, Laserdruckern<br />
und Kartenlesegeräten sowie eine benutzerfreundliche Software erfor-<br />
<strong>der</strong>lich sein. Zur Vermeidung von Datenverlusten, die überflüssige Ar-<br />
beit auslösen würden, ist ferner eine kontinuierliche tägliche Datensi-<br />
cherung mithilfe korrespondieren<strong>der</strong>, aber getrennt untergebrachter<br />
Server unumgänglich. Regelmäßige und gründliche Schulungen für<br />
den effektiven Umgang mit <strong>der</strong> zur Verfügung stehenden Hard- und<br />
Software könnten sicherlich ebenso zur Kompensation zusätzlicher<br />
Verwaltungsarbeit beitragen wie <strong>der</strong> Einsatz von Spracherkennungs-<br />
systemen, die auf die jeweilige Fachanwendung abgest<strong>im</strong>mt sind.<br />
Ganz wesentlich erleichtert wird die staatsanwaltschaftliche Arbeit je-<br />
doch durch die Möglichkeit, selbst in Großverfahren mit umfangreichen<br />
Beweismittelordnern sämtliche <strong>Akte</strong>nbestandteile mithilfe eines Lap-<br />
tops und elektronischer Datenträger auch für die Arbeit zu Hause je-<br />
233
<strong>der</strong>zeit verfügbar zu haben. Darüber hinaus wird die Erstellung einer<br />
individuellen Arbeitsversion <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> z. B. mit Hilfe einer Baumstruktur<br />
ermöglicht, die vollkommen unabhängig von <strong>der</strong> zumeist chronologi-<br />
schen Blattsammlung <strong>der</strong> Polizei ist. Der Einsatz von Such- und Aus-<br />
wertungssystemen (z. B. IDEA) sowie die Verlinkung zu in speziellen<br />
Ordnern abgelegten Dokumenten erleichtert zusätzlich die Beherrsch-<br />
barkeit des <strong>Akte</strong>nmaterials in Umfangsverfahren (vgl. umfängliche Dar-<br />
stellung unter V).<br />
2.1.2.6 Einbeziehung <strong>der</strong> Generalstaatsanwaltschaft<br />
Für den Fall, dass die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren<br />
gemäß § 170 Abs. 2 StPO mangels hinreichenden Tatverdachtes o<strong>der</strong><br />
aber aus Opportunitätsgründen gemäß <strong>der</strong> §§ 153 ff. StPO einstellt,<br />
wird diese Entscheidung in nicht geringem Umfang von Beschwerde-<br />
führern angegriffen, sodass die Vorgänge – sofern keine Wie<strong>der</strong>auf-<br />
nahme <strong>der</strong> Ermittlungen erfolgt – <strong>der</strong> Generalstaatsanwaltschaft zur<br />
Entscheidung vorzulegen sind. Auch für dieses Verfahren ließen sich<br />
aufwändige <strong>Akte</strong>ntransporte und Verfahrensverzögerungen vermeiden,<br />
wenn die Möglichkeit einer elektronischen <strong>Akte</strong>nübermittlung bestünde.<br />
Nicht zuletzt aus diesem Grunde sollten auf jeden Fall auch die Gene-<br />
ralstaatsanwaltschaften in ein allgemein anzustrebendes Datenver-<br />
bundsystem <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>behörden einbezogen werden. Auch die Sach-<br />
bearbeitung in Beschwerdeverfahren bei <strong>der</strong> Generalstaatsanwalt-<br />
schaft wäre bei Nutzung entsprechen<strong>der</strong> Fachverfahren mittels elekt-<br />
ronischer "Zs-Hefte" ohne weiteres denkbar. Nach Abschluss des Be-<br />
schwerdeverfahrens könnten die <strong>Akte</strong>n dann entwe<strong>der</strong> mit dem Be-<br />
scheid <strong>der</strong> Generalstaatsanwaltschaft elektronisch an die Staatsan-<br />
waltschaft o<strong>der</strong> aber mit einem – ggf. eingescannten – Klageerzwin-<br />
gungsantrag des Beschwerdeführers dem Oberlandesgericht zugeleitet<br />
werden.<br />
Entsprechendes gilt für die <strong>Justiz</strong>ministerien <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> in Fällen weite-<br />
rer sachlicher Dienstaufsichtsbeschwerden.<br />
234
3. Das strafgerichtliche Verfahren<br />
3.1 Zwischenverfahren und Vorbereitung <strong>der</strong> Hauptverhandlung<br />
Sofern die Staatsanwaltschaft den hinreichenden Tatverdacht bejaht,<br />
könnte mittels <strong>der</strong> jeweils zur Verfügung stehenden Fachanwendungen<br />
und Datenmanagement-Systeme am PC ein Strafbefehlsantrag bzw.<br />
eine Anklageschrift erstellt und dem Gericht zusammen mit <strong>der</strong> <strong>Akte</strong><br />
elektronisch übermittelt werden. Das dortige Datenverarbeitungssys-<br />
tem würde die Metadaten automatisch erfassen und die <strong>Akte</strong> dem zu-<br />
ständigen Richter / Vorsitzenden entwe<strong>der</strong> mittels eines automatischen<br />
Turnussystems o<strong>der</strong> aber über die Vermittlung einer elektronischen<br />
Posteingangsstelle zuleiten. Der zuständige Staatsanwalt bekäme<br />
gleichzeitig eine elektronische Eingangsbestätigung und die Mitteilung<br />
des entsprechenden gerichtlichen <strong>Akte</strong>nzeichens. Soweit bei <strong>der</strong><br />
Staatsanwaltschaft noch eine Papierbegleitakte o<strong>der</strong> aber Asservate<br />
vorhanden sind, verbleiben diese dort, wobei allerdings sichergestellt<br />
sein muss, dass sie bei Bedarf kurzfristig auf Anfor<strong>der</strong>ung dem zustän-<br />
digen Gericht zugeleitet werden können. Die weitere gerichtliche Bear-<br />
beitung des Vorgangs erfolgt mit einer speziellen elektronischen Fach-<br />
anwendung, wobei die richterlichen Arbeitsplätze in ihrer Ausstattung<br />
den bereits für die Staatsanwaltschaft genannten Anfor<strong>der</strong>ungen ent-<br />
sprechen müssen.<br />
Während die Staatsanwaltschaft aufgrund ihrer Weisungsgebundenheit<br />
relativ problemlos durch entsprechende Dienstanweisungen o<strong>der</strong> ge-<br />
setzliche Vorschriften zur Nutzung einer elektronischen <strong>Akte</strong> verpflich-<br />
tet werden kann, erscheint zweifelhaft, ob die in Art. 97 Abs. 1 GG ga-<br />
rantierte richterliche Unabhängigkeit einer <strong>der</strong>artigen Regelung für den<br />
richterlichen Bereich entgegenstehen könnte. Im Ergebnis wird man<br />
dies jedoch verneinen müssen. Selbst wenn man den Schutzbereich<br />
des Art. 97 Abs. 1 für betroffen hielte, wäre die Einführung einer elekt-<br />
ronischen <strong>Akte</strong> jedenfalls zur Wahrung <strong>der</strong> Belange des Gemeinwohls<br />
wie <strong>der</strong> Vorteile <strong>der</strong> Effektivierung <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>gewährung (Kostenerspar-<br />
nis, Beschleunigung etc.) grundsätzlich gerechtfertigt. Selbstverständ-<br />
lich muss gewährleistet bleiben, dass Personen, die z. B. durch Krank-<br />
235
heit an einer Nutzung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> gehin<strong>der</strong>t sind, dennoch<br />
ihrer richterlichen Kerntätigkeit nachgehen können. Darüber hinaus<br />
wird man letztlich sowohl Richtern wie auch Staatsanwälten zubilligen<br />
müssen, dass sie bei Bedarf auch Papierausdrucke <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> zur Er-<br />
leichterung ihrer Arbeit fertigen dürfen, da die Lesbarkeit umfangreiche-<br />
rer <strong>Akte</strong>nteile am Bildschirm begrenzt ist. Ein Ausdruck von <strong>Akte</strong>nteilen<br />
als Papierhilfsakte wäre daher ebenso zuzulassen, wie nach bisheriger<br />
Rechtslage das Herstellen elektronischer Hilfsakten bzw. <strong>Akte</strong>nteile.<br />
Sofern das Gericht <strong>im</strong> Zwischenverfahren ergänzende Beweiserhe-<br />
bungen für erfor<strong>der</strong>lich hält (§ 202 StPO), können diese ebenso wie<br />
von <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft durch Versendung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
an die Polizei o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Ermittlungsbehörden veranlasst werden.<br />
Falls eine elektronische Weiterleitung <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> nicht möglich wäre,<br />
müsste diese zunächst ausgedruckt und die <strong>im</strong> Rücklauf eingehenden<br />
neuen <strong>Akte</strong>nbestandteile durch Einscannen in die elektronische <strong>Akte</strong><br />
überführt werden. Für das Einholen von Auskünften sowie für die Ferti-<br />
gung von Ladungen, die <strong>der</strong> Richter am Bildschirm veranlassen kann,<br />
ergeben sich gegenüber <strong>der</strong> bereits dargestellten staatsanwaltschaftli-<br />
chen Tätigkeit keine Beson<strong>der</strong>heiten. Auch <strong>im</strong> richterlichen Bereich ist<br />
daher mit einer nicht unproblematischen Zunahme verwalten<strong>der</strong> Auf-<br />
gaben zu Lasten <strong>der</strong> Kerntätigkeit zu rechnen. An<strong>der</strong>erseits zeichnen<br />
sich aber nach Ansicht <strong>der</strong> Kommission auch kompensierende Entlas-<br />
tungseffekte ab.<br />
Da <strong>der</strong> Vorsitzende eines Spruchkörpers die elektronische <strong>Akte</strong> unmit-<br />
telbar nach Eingang sofort problemlos dem zuständigen Berichterstat-<br />
ter zuleiten kann, dürfte diese parallele Bearbeitungsmöglichkeit gera-<br />
de in Großverfahren zu einer deutlichen Beschleunigung des<br />
Zwischenverfahrens führen. Dasselbe gilt auch für die Möglichkeit zur<br />
Erstellung einer elektronischen Arbeitsakte, die ohne Transportschwie-<br />
rigkeiten auch eine häusliche Vorbereitung des Gerichts ermöglicht.<br />
Soweit elektronische Strafakten zur weiteren Bearbeitung auf private<br />
Rechner <strong>der</strong> erkennenden Richter überspielt werden, muss allerdings<br />
<strong>der</strong> Datenschutz wie bei einer Übertragung <strong>im</strong> öffentlichen Bereich ge-<br />
236
wahrt bleiben. Die Problematik wäre jedoch durch die Anschaffung<br />
dienstlicher Laptops, die auch zu Hause genutzt werden könnten, ver-<br />
meidbar.<br />
3.2 Hauptverhandlung<br />
3.2.1 Auswirkungen auf die Beweisaufnahme<br />
Da in <strong>der</strong> Hauptverhandlung grundsätzlich das "Unmittelbarkeits- und<br />
Mündlichkeitsprinzip" (§§ 250, 261 StPO) gilt, sind die <strong>Akte</strong>n und somit<br />
auch ihre Form in diesem Verfahrensabschnitt nur von untergeordneter<br />
Bedeutung. Ausnahmen gelten jedoch in Fällen des <strong>Akte</strong>nvorhalts, <strong>der</strong><br />
Inaugenscheinnahme von <strong>Akte</strong>nbestandteilen sowie bei <strong>der</strong> Verlesung<br />
von Urkunden und an<strong>der</strong>er Schriftstücke als Beweismittel. Hier stellt<br />
sich die Frage, ob <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> die gleiche Verlässlichkeit<br />
und nach Ansicht <strong>der</strong> Kommission <strong>der</strong>selbe Beweiswert wie <strong>der</strong> heuti-<br />
gen Papierakte zukommen. Dies dürfte insbeson<strong>der</strong>e dann zu bejahen<br />
sein, wenn es sich bei best<strong>im</strong>mten <strong>Akte</strong>nbestandteilen (z. B. Konto-<br />
verdichtungen in Wirtschaftsstrafverfahren) ohnehin um digitale Daten<br />
handelt, die nach bisherigem Recht ausgedruckt und dann in Papier-<br />
form zur <strong>Akte</strong> genommen werden müssen.<br />
Sofern elektronische <strong>Akte</strong>nbestandteile durch Einscannen von Papier-<br />
dokumenten erstellt werden, muss vor Einführung einer elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> auf jeden Fall sichergestellt sein, dass die eingesetzte Scantech-<br />
nik so verlässlich ist, dass das Gericht regelmäßig auf eine fehlerlose<br />
und vollständige Übertragung vertrauen kann. Um prozessrechtlich<br />
klarzustellen, dass die elektronische Wie<strong>der</strong>gabe eines Schriftstückes<br />
<strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Beweisaufnahme wie die Vorlage eines Schriftstücks<br />
zu behandeln ist, sollte de lege ferenda eine § 110e Abs. 1 OWiG ent-<br />
sprechende Vorschrift in die StPO aufgenommen werden.<br />
Über den Beweiswert eines elektronischen Dokuments und die Frage<br />
einer Überprüfung <strong>der</strong> Identität mit dem Ausgangsobjekt hat das Ge-<br />
richt <strong>im</strong> Rahmen seiner gesetzlichen Aufklärungspflicht (§ 244<br />
Abs. 2 StPO) zu befinden, wobei auf die Rechtsprechung zur Beweis-<br />
kraft von Fotokopien zurückgegriffen werden kann.<br />
237
Zumindest bis zum Vorliegen einer gefestigten Rechtsprechung zur<br />
Verlässlichkeit des Scanverfahrens erscheint es jedoch nicht unwahr-<br />
scheinlich, dass seitens <strong>der</strong> Angeklagten o<strong>der</strong> Verteidiger relativ häufig<br />
angezweifelt werden wird, ob das verwendete elektronische Dokument<br />
mit dem gescannten Ausgangsobjekt übereinst<strong>im</strong>mt. Die Befürchtung,<br />
dass durch entsprechende Beweisanträge letztlich das Gericht ge-<br />
zwungen werden könnte, <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Hauptverhandlung "flächen-<br />
deckend" wie<strong>der</strong> auf Papierdokumente zurückgreifen zu müssen, er-<br />
scheint jedoch unbegründet. Abgesehen davon, dass <strong>der</strong> Beweisantrag<br />
auf Einnahme eines Augenscheins vom Ausgangsobjekt nach § 244<br />
Abs. 5 S. 1 StPO bereits dann abgelehnt werden kann, wenn die Au-<br />
genscheinseinnahme nach pflichtgemäßem Ermessen des Gerichts zur<br />
Erforschung <strong>der</strong> Wahrheit nicht erfor<strong>der</strong>lich ist, werden nach Ansicht<br />
<strong>der</strong> Kommission <strong>der</strong>artige Anträge auch relativ schnell abnehmen,<br />
wenn sich – was selbstverständlich sein sollte – die Zuverlässigkeit des<br />
Scanverfahrens <strong>im</strong>mer wie<strong>der</strong> herausstellt.<br />
Problematisch erscheint hingegen <strong>der</strong> Wert von Vorhalten, wenn <strong>der</strong><br />
Text des Vernehmungsprotokolls sogleich in die elektronische <strong>Akte</strong><br />
aufgenommen wird und an<strong>der</strong>s als die bisherigen Papierprotokolle kei-<br />
ne Unterschrift o<strong>der</strong> ggf. auch handschriftliche Einbesserungen des<br />
Vernommenen enthält. Bei späteren Unst<strong>im</strong>migkeiten über die frühere<br />
Aussage könnte dem digital erstellten Vernehmungsprotokoll ein ver-<br />
min<strong>der</strong>ter Beweiswert zukommen. Da vernommene Personen in <strong>der</strong><br />
Regel nicht über eine elektronische Signatur verfügen werden, mit <strong>der</strong><br />
sie das Protokoll zeichnen können, bietet sich nach Ansicht <strong>der</strong> Kom-<br />
mission als Lösungsmöglichkeit zumindest bei wichtigen Vernehmun-<br />
gen ein Ausdruck des Protokolls an, <strong>der</strong> dann mit Unterschrift und<br />
handschriftlichen Einbesserungen des Vernommenen eingescannt und<br />
zur Begleitakte genommen werden kann. Im Zweifelsfall müsste dann<br />
notfalls auf dieses Dokument <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Beweisaufnahme zu-<br />
rückgegriffen werden.<br />
238
Im Übrigen ließe sich die Qualität <strong>der</strong> Beweisaufnahme bei Verwen-<br />
dung einer elektronischen <strong>Akte</strong> durchaus steigern. So wären <strong>Akte</strong>nbe-<br />
standteile, die zum Vorhalt dienen sollen o<strong>der</strong> Augenscheinseinnah-<br />
men von digitalen Fotos mittels individueller Bildschirme für jeden Ver-<br />
fahrensbeteiligten o<strong>der</strong> aber auch durch eine großflächige Projektion<br />
<strong>im</strong> Gerichtssaal sehr viel plastischer und einfacher (auch für die Zu-<br />
schauer) bekanntzumachen als bisher. Da die elektronische <strong>Akte</strong> au-<br />
ßerdem die Möglichkeit bietet, digitale Suchfunktionen zu nutzen, er-<br />
leichtert sie insbeson<strong>der</strong>e in Großverfahren das schnelle Auffinden von<br />
best<strong>im</strong>mten Zeugenaussagen o<strong>der</strong> sonstigen Beweismitteln, wodurch<br />
sich auch für die Hauptverhandlung ein nicht unerheblicher Beschleu-<br />
nigungseffekt ergeben dürfte.<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Einführung <strong>der</strong> elekt-<br />
ronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> Hinblick auf die notwendige Überzeugungsbildung in<br />
<strong>der</strong> strafrechtlichen Hauptverhandlung keine wesentlichen Probleme in<br />
Bezug auf die notwendige Überzeugungsbildung des Gerichtes auf-<br />
wirft, son<strong>der</strong>n in best<strong>im</strong>mten Konstellationen sogar eine effektivere und<br />
schnellere Beweisaufnahme erwarten lässt.<br />
3.2.2 Auswirkungen auf das Strafurteil<br />
Die Strafurteile könnten vom Richter – wie zum Teil bisher bereits üb-<br />
lich – ggf. unter Verwendung von Spracherkennungstechnik am PC er-<br />
stellt und anschließend mit einer elektronischen Signatur des Gerichtes<br />
sowie mit einer Verän<strong>der</strong>ungssperre versehen werden. Anschließend<br />
wäre mit entsprechendem Einverständnis des Empfängers eine elekt-<br />
ronische Zustellung denkbar o<strong>der</strong> aber das Urteil könnte über eine<br />
zentrale Ausgangsgeschäftsstelle nach Ausdruck in herkömmlicher<br />
Weise zugestellt werden. Unproblematisch ließe sich auch bereits un-<br />
mittelbar nach Urteilsverkündung <strong>der</strong> Tenor einer rechtskräftig gewor-<br />
denen Entscheidung gemäß § 13 Abs. 2 Strafvollstreckungsordnung<br />
<strong>der</strong> Staatsanwaltschaft zur Einleitung <strong>der</strong> Vollstreckung übermitteln.<br />
Auch wenn sich nach dem vorstehend skizzierten Modell Service-<br />
einheiten (Geschäftsstellen / Schreibdienst) in erheblichem Umfang<br />
239
einsparen ließen, wäre allerdings nach Ansicht <strong>der</strong> Kommission darauf<br />
zu achten, dass die strafprozessualen Aufgaben des "Urkundsbeamten<br />
<strong>der</strong> Geschäftsstelle" auch weiterhin gewahrt bleiben. Im Hinblick auf<br />
die Bedeutung für das strafrechtliche Revisionsverfahren (§ 338<br />
Nr. 7 StPO) müssten Urteile mit einem elektronischen unverän<strong>der</strong>baren<br />
Eingangsvermerk <strong>der</strong> Geschäftsstelle versehen werden. Eine entspre-<br />
chende Verfahrensweise wäre auch für das Anbringen von Rechts-<br />
kraftvermerken vorzusehen.<br />
3.2.3 Rechtsmittelverfahren<br />
Die Einlegung von Berufung und Revision müsste aus Rechtsstaatlich-<br />
keitsgrundsätzen auch künftig nach Maßgabe <strong>der</strong> §§ 314 Abs. 1, 341<br />
Abs. 1 StPO auf herkömmliche Weise möglich sein. Rechtsmittelschrif-<br />
ten wären dann einzuscannen und <strong>im</strong> Original zur Begleitakte zu neh-<br />
men. Darüber hinaus könnte de lege ferenda eine wirksame Einlegung<br />
auch <strong>im</strong> Wege elektronischer Kommunikation erfolgen, wobei hinsicht-<br />
lich des Formerfor<strong>der</strong>nisses (Schriftlichkeit / elektronische Signatur) auf<br />
die obigen Ausführungen Bezug genommen wird.<br />
Nach Einlegung einer zulässigen Berufung o<strong>der</strong> Revision würden sich<br />
bei Einsatz einer elektronischen <strong>Akte</strong> erhebliche Beschleunigungsef-<br />
fekte durch das Einsparen zeitrauben<strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nversendungen ergeben.<br />
Dasselbe gilt sinngemäß auch für das Beschwerdeverfahren, indem<br />
sich insbeson<strong>der</strong>e die Frist des § 306 Abs. 2 StPO leichter einhalten<br />
ließe, da auf das Erstellen von Kopien best<strong>im</strong>mter <strong>Akte</strong>nteile verzichtet<br />
werden könnte.<br />
3.3 Das Vollstreckungsverfahren / Aufbewahrung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
Nachdem die um den gerichtlichen Teil ergänzte elektronische <strong>Akte</strong> mit<br />
einem rechtskräftigen Urteil an die Staatsanwaltschaft übermittelt wor-<br />
den ist, führt <strong>der</strong> zuständige Dezernent mit dem hierfür vorgesehenen<br />
Dokumentenmanagementsystem die vor Einleitung <strong>der</strong> Vollstreckung<br />
noch notwendigen Verfügungen (Asservatenentscheidungen, DNA-<br />
Anträge etc.) aus und leitet die <strong>Akte</strong> sodann auf elektronischem Wege<br />
an den zuständigen Rechtspfleger weiter. Dieser legt mit einer speziell<br />
240
für das Vollstreckungsverfahren eingerichteten Fachanwendung ein e-<br />
lektronisches Vollstreckungsheft an, aus dem heraus er die notwendi-<br />
gen Maßnahmen (z. B. Haftantrittsladung, Registermitteilungen, Kos-<br />
tenrechnungen) veranlasst. Die Vollstreckung von Geldstrafen könnte<br />
dabei bis zur evtl. Anordnung von Ersatzfreiheitsstrafe (Überwachung<br />
von Zahlungseingängen, Mahnungen) weitestgehend automatisiert ab-<br />
laufen.<br />
Zur effektiven Vollstreckung von Freiheitsstrafen wäre langfristig ein di-<br />
gitaler Datenaustausch mit den zuständigen <strong>Justiz</strong>vollzugsanstalten<br />
durch Einrichtung entsprechen<strong>der</strong> EDV-Schnittstellen anzustreben. Die<br />
bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft vorhandenen Vollstreckungsunterlagen<br />
könnten dann von den jeweiligen Vollzugsanstalten unmittelbar zur<br />
Generierung einer elektronischen Gefangenenpersonalakte verwendet<br />
werden. Durch die Möglichkeit, Vollstreckungshefte auch den zustän-<br />
digen Strafvollstreckungskammern elektronisch zur Verfügung zu stel-<br />
len, ließen sich darüber hinaus auch die Verfahrensabläufe bei beding-<br />
ten Entlassungen, Reststrafengesuchen etc. deutlich beschleunigen.<br />
Nach Abschluss des Vollstreckungsverfahrens müsste <strong>der</strong> Zugriff auf<br />
elektronische <strong>Akte</strong>n entsprechend den bisherigen Best<strong>im</strong>mungen über<br />
die Aufbewahrungsfristen (vgl. auch XI) für das Schriftgut <strong>der</strong> ordentli-<br />
chen Gerichtsbarkeit <strong>der</strong> Staatsanwaltschaften und <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>vollzugs-<br />
behörden möglich sein. Zur Sicherung einer effektiven Strafverfolgung<br />
und einer eventuellen Verfahrenswie<strong>der</strong>aufnahme werden danach<br />
auch elektronische <strong>Akte</strong>n in einer Vielzahl von Fällen mindestens<br />
30 Jahre aufbewahrt werden müssen. Speichermedien und die dazu-<br />
gehörige Software unterliegen jedoch erfahrungsgemäß einem schnel-<br />
len technischen Wandel. Auch natürliche Alterungsprozesse <strong>der</strong> Spei-<br />
chermedien begründen Zweifel an einer langfristigen Zugriffsmöglich-<br />
keit auf elektronisch gespeichertes Datenmaterial. Diese technische<br />
Problematik ließe sich jedoch notfalls dadurch lösen, dass die Dateien<br />
in best<strong>im</strong>mten Fristen nach dem dann jeweils geltenden technischen<br />
Standard neu abgespeichert würden.<br />
241
4. Schlussbetrachtung<br />
Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass vor Einführung<br />
einer vollelektronischen Vorgangsbearbeitung <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> erst<br />
noch eine Vielzahl technischer, organisatorischer und rechtlicher Prob-<br />
leme gelöst werden müssen.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die Einrichtung bundesweit nutzbarer Datenverbundsys-<br />
teme und entsprechend ausgerüsteter Arbeitsplätze, die eine schnelle<br />
und sichere elektronische Kommunikation zwischen allen am Verfahren<br />
beteiligten Institutionen und Personen ermöglichen, dürfte neben finan-<br />
ziellen Mitteln einen enormen Koordinierungsaufwand für die Bundes-<br />
und Landesjustizverwaltungen erfor<strong>der</strong>n.<br />
An<strong>der</strong>erseits ist aber auch erkennbar, dass auf längere Sicht <strong>der</strong> Ein-<br />
führung einer vollelektronischen <strong>Akte</strong> wohl keine unüberwindlichen<br />
Hin<strong>der</strong>nisse entgegenstehen. So sind insbeson<strong>der</strong>e Sorgen über einen<br />
geringeren Beweiswert elektronischer Dokumente unbegründet, wenn<br />
sichergestellt ist, dass bei Bedarf ein Zugriff auf die Originalunterlagen<br />
erfolgen kann.<br />
Viele Detailprobleme lassen sich jedoch auch mit großer Fantasie nicht<br />
sicher prognostizieren. Sie werden sich vielmehr erst <strong>im</strong> Echtbetrieb<br />
herausstellen.<br />
Eine gleichzeitige flächendeckende Einführung <strong>der</strong> elektronischen<br />
Strafakte wäre daher nach Ansicht <strong>der</strong> Kommission nicht vertretbar.<br />
Vielmehr kommt nach dem Vorbild des § 110b OWiG zunächst eine<br />
regionale und evtl. auf einzelne Verfahrensbeteiligte beschränkte Zu-<br />
lassung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong>nbearbeitung nach Maßgabe konkreti-<br />
sieren<strong>der</strong> Rechtsverordnungen in Betracht.<br />
Für eine Pilotierung beson<strong>der</strong>s geeignet erscheinen <strong>der</strong> Kommission<br />
insbeson<strong>der</strong>e Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter (UJs-<br />
Sachen), da es sich hierbei um standardisiert ablaufende Vorgänge ge-<br />
242
ingen Umfangs handelt, an <strong>der</strong>en Bearbeitung in <strong>der</strong> Regel nur Staats-<br />
anwaltschaft und Polizei beteiligt sind. Auch die bereits heute bei eini-<br />
gen Staatsanwaltschaften übliche Verfahrensweise, in Großverfahren<br />
elektronische <strong>Akte</strong>ndoppel einzusetzen (vgl. Darstellung unter V), er-<br />
scheint geeignet, wertvolle Erfahrungen zu liefern.<br />
Erst wenn die Arbeit mit einer vollelektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong> "Inselbetrieb"<br />
erfolgreich verläuft, wird man nach und nach mit <strong>der</strong> notwendigen Ak-<br />
zeptanz für eine generelle Einführung rechnen können. Ein völliger<br />
Verzicht auf Dokumente in Papierform wird allerdings auch in absehba-<br />
rer Zukunft nicht möglich sein, da Privatpersonen aus verfassungs-<br />
rechtlichen Gründen <strong>im</strong> Strafprozess nicht zur Teilnahme am elektroni-<br />
schen Rechtsverkehr gezwungen werden können. Schriftstücke sind<br />
daher stets weiterhin <strong>im</strong> Original entgegenzunehmen und parallel zur<br />
elektronischen <strong>Akte</strong> aufzubewahren.<br />
Zurzeit stehen wir noch am Anfang einer Entwicklung zur elektronischen<br />
Strafjustiz, für die das <strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetz mit <strong>der</strong> Einführung<br />
des § 41a StPO die Weichen gestellt hat. Bis zur Einführung einer<br />
bundesweit möglichen vollelektronischen Vorgangsbearbeitung werden<br />
nach Ansicht <strong>der</strong> Kommission noch etliche Jahre vergehen. Den<br />
weiteren Fortgang <strong>der</strong> Entwicklung gilt es aber aktiv und aufgeschlossen<br />
zu begleiten, da bereits heute die Vorteile einer elektronischen <strong>Akte</strong><br />
deutlich sichtbar sind.<br />
Neben umfangreichen Vereinfachungs- und Einspareffekten, sowohl <strong>im</strong><br />
materiellen Bereich (z. B. Papier, Vorhaltung von Lager- und<br />
Transportraum) wie auch be<strong>im</strong> Personaleinsatz (Service-, Schreib-<br />
kräfte), schlägt insbeson<strong>der</strong>e die enorme Verfahrensbeschleunigung zu<br />
Buche. Bisher übliche mehrtätige <strong>Akte</strong>ntransportzeiten werden durch nur<br />
Sekunden dauernde elektronische Übertragungszeiten ersetzt. Ein<br />
Zuwachs an Rechtsstaatlichkeit entstünde jedoch nicht nur durch die<br />
opt<strong>im</strong>ierte Wahrung des <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> geltenden Beschleuni-<br />
gungsgrundsatzes, son<strong>der</strong>n auch durch eine effektivere Strafverfolgung<br />
<strong>im</strong> Bereich von Großverfahren (z. B. Wirtschaftsstrafsachen), in denen<br />
243
Datenmengen anfallen, die letztlich erst durch ihre Digitalisierung einer<br />
sachgerechten Auswertung zugänglich und damit beherrschbar werden.<br />
XIII. Zusammenfassung<br />
Nach alledem stellt die Kommission einst<strong>im</strong>mig fest:<br />
1. Sie hat rechtliche/technische und organisatorische Fragen einer elektronischen<br />
<strong>Akte</strong> <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong> (de lege ferenda) erörtert.<br />
2. Sie hält <strong>im</strong> Grundsatz die Einführung einer elektronischen <strong>Akte</strong> <strong>im</strong><br />
<strong>Strafverfahren</strong> für möglich.<br />
3. Sie hält die elektronische <strong>Akte</strong> für vereinbar mit tragenden Grundsätzen<br />
<strong>der</strong> Strafprozessordnung, insbeson<strong>der</strong>e dem Beweisrecht.<br />
4. Sie hat wichtige organisatorische Probleme erörtert, die gelöst werden<br />
müssen.<br />
5. Die Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> bedingt die Lösung einer Vielzahl<br />
technischer Probleme, von denen die Kommission einen Ausschnitt<br />
zur Kenntnis genommen hat.<br />
6. Die Kommission empfiehlt nachhaltig den weiteren Ausbau elektronischer<br />
Unterstützung zur Papierakte, um organisatorisch und technisch<br />
Erfahrungen zu sammeln.<br />
7. Die Kommission spricht sich für Modellprojekte aus, weil nur <strong>im</strong> Praxisbetrieb<br />
die nötigen Erfahrungen und Aussagen für die Realisierungschancen<br />
einer elektronischen <strong>Akte</strong> gewonnen werden können.<br />
Birgit Heß Erhard Rex<br />
244
XIV. Anhang<br />
zu O:<br />
a) Schwoerer, Max<br />
Die elektronische <strong>Justiz</strong>.<br />
Ein Beitrag zum elektronischen Rechtsverkehr unter Berücksichtigung des<br />
<strong>Justiz</strong>kommunikationsgesetzes<br />
Verlag: Duncker & Humblot – Berlin<br />
b) Realisierungskonzept<br />
Praxisrelevante Umsetzungsschritte<br />
1. Digitalisierung bei den Ermittlungspersonen <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft<br />
(Polizei, Hauptzollämter, Bundespolizei usw.)<br />
2. Kompatibilität <strong>der</strong> EDV-Systeme für die polizeiliche Digitalisierung<br />
3. Die Digitalisierung von Erklärungen, die nach <strong>der</strong> Strafprozessordnung<br />
<strong>der</strong> Schriftform bedürfen (Strafantrag usw.)<br />
4. Die Digitalisierung von Verkehrsunfallskizzen, Fotos, an<strong>der</strong>en grafischen<br />
Darstellungen bei <strong>der</strong> Polizei<br />
5. Das polizeiliche Einscannen von Schriftstücken, die <strong>im</strong> weitesten Sinne<br />
Beweismittel sind, aber herkömmlicher Weise in die <strong>Akte</strong>n eingeheftet<br />
werden<br />
(z. B. <strong>der</strong> Schriftverkehr bei Betrugsdelikten, Mietverträge, „vorprozessua-<br />
ler“ Schriftwechsel usw.).<br />
6. Die polizeiliche Entscheidung dahin, ob stattdessen (o<strong>der</strong> zusätzlich) das<br />
einzelne Beweismittel in ein Beweismittelheft eingeheftet wird, das dann<br />
schriftlich übersandt werden muss.<br />
245
7. Die Sicherstellung <strong>der</strong> parallelen Übermittlung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong><br />
und des Beweismittelheftes an die Staatsanwaltschaft durch die Polizei<br />
8. Ermittlungen durch Behörden verschiedener Art, die an <strong>der</strong> „elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong>“ nicht beteiligt sind und die deswegen in Papierform erfolgen.<br />
Einscannen dieser Ermittlungen durch die Polizei.<br />
9. Versendung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> durch die Polizei an die Organisatio-<br />
nen, die mit <strong>der</strong> elektronischen Übersendung einverstanden sind und die<br />
<strong>Akte</strong> auch elektronisch auslesen können (z. B. an<strong>der</strong>e Polizeidienststel-<br />
len, häufig Versicherungen, häufig Rechtsanwälte usw.).<br />
10. Polizeiliches Ausdrucken und Versenden einer <strong>Akte</strong> in Schriftform, wenn<br />
die an<strong>der</strong>e Institution die elektronische <strong>Akte</strong> nicht auslesen kann o<strong>der</strong><br />
auslesen will o<strong>der</strong> aus Rechtsgründen nicht auslesen darf (z. B. bei poli-<br />
zeilichen „Rechtshilfevorgängen“, <strong>im</strong> internationalen Verkehr, bei Ein-<br />
sichtsgesuchen von Institutionen, die gesetzlich zu elektronischem Ausle-<br />
sen nicht verpflichtet werden können).<br />
11. Die Herstellung <strong>der</strong> elektronischen Kompatibilität bei Ermittlungen von z.<br />
B. zehn verschiedenen Polizeidienststellen <strong>im</strong> gesamten Bundesgebiet<br />
12. Sicherstellung <strong>der</strong> elektronischen Lesbarkeit durch die Polizei bei größe-<br />
ren Ermittlungen vor Ort (z. B. Durchsuchungen, bei denen <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nin-<br />
halt für die Polizei für den Durchsuchungserfolg erfor<strong>der</strong>lich ist).<br />
13. <strong>Elektronische</strong> Übersendung an die Staatsanwaltschaft, Kompatibilität <strong>der</strong><br />
gegenseitigen EDV-Systeme<br />
14. <strong>Elektronische</strong> Eintragung in die Datensysteme <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft (die<br />
mit dem Eintragungsinhalten <strong>der</strong> Polizei bundesweit nicht identisch sind!),<br />
anhand eines vereinbarten Schemas.<br />
246
15. 70 % aller Verfahren werden bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft eingestellt und<br />
gelangen daher nicht zum Gericht. Für diese 70 % ergeben sich besonde-<br />
re Handlungsmöglichkeiten:<br />
16. Bei sog. Unbekanntsachen (unbekannter Täter, keine Ermittlungsansätze)<br />
erfolgt eine 100 %ige elektronische <strong>Akte</strong>nhaltung ohne Papierform. In <strong>der</strong><br />
Regel kommen in diesen Verfahren nur <strong>Akte</strong>neinsichtsanträge von Versi-<br />
cherungen und Rechtsanwälten. Für diese ergibt sich ein Trend dahinge-<br />
hend, dass diese Organisation selbst eine elektronische Übersendung<br />
wünscht, weil sie Arbeit und Geld erspart. Tritt <strong>der</strong> seltene Fall auf, dass<br />
eine <strong>Akte</strong> in Papierform die Behörde <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft verlassen<br />
muss, muss sie dann notfalls ausgedruckt werden.<br />
Für Schleswig-Holstein ist das Problem <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> in Unbe-<br />
kanntsachen in einer Strategiekommission unter meiner Leitung und <strong>der</strong><br />
Leitung des Direktors des Landeskr<strong>im</strong>inalamtes bereits vorangetrieben<br />
und soll bereits de lege lata verwirklicht werden.<br />
17. Bei <strong>Akte</strong>n, die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt werden,<br />
könnte ähnlich verfahren werden wie bei Unbekanntsachen. Sind weitere<br />
Ermittlungen nicht erfor<strong>der</strong>lich, kann die <strong>Akte</strong> elektronisch aufgerufen und<br />
elektronisch eingestellt werden. Sollten wi<strong>der</strong> Erwarten Institutionen Ak-<br />
teneinsicht begehren, die ein Recht auf eine Papierakte haben (dies muss<br />
gesetzlich geklärt werden), kann je<strong>der</strong>zeit die Papierakte ausgedruckt<br />
werden.<br />
Sind weitere Ermittlungen notwendig, wird das Verfahren aber mangels<br />
hinreichenden Tatverdachts eingestellt, erfolgt eine elektronische Über-<br />
sendung an die Ermittlungspersonen (in <strong>der</strong> Regel die Polizei), so dass<br />
die <strong>Akte</strong> schließlich ebenfalls rein elektronisch eingestellt und weggelegt<br />
werden kann (Ausnahmen wie zuvor).<br />
18. Wird das Verfahren nach einer Ermessensvorschrift eingestellt (z. B. §§<br />
153, 153 a, 154 StPO), so sind die Fallkonstellationen identisch mit den<br />
Fallkonstellationen zur vorigen Ziffer<br />
247
19. In Papierform müssen alle Schreiben ausgedruckt werden, die an Privat-<br />
personen gerichtet sind (weil auch de lege ferenda keine private Verpflich-<br />
tung zu elektronischem Auslesen begründet werden kann). Sämtliche<br />
Einstellungsnachrichten, Bescheide an Anzeigeerstatter usw. sind für die<br />
Postversendungszentrale auszudrucken, werden dort ausgedruckt und<br />
von dort aus direkt versandt. Eine – teilweise – Papierform <strong>der</strong> elektroni-<br />
schen <strong>Akte</strong> ist dadurch nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />
20. Eine Vielzahl schriftlicher Unterlagen wird durch Privatpersonen nach wie<br />
vor eingereicht werden (die dann in die elektronische <strong>Akte</strong> eingescannt<br />
werden können). Gleichwohl müssen die schriftlichen Unterlagen in Form<br />
eines Beweismittelheftes aktenmäßig geführt werden und sie müssen,<br />
wenn es entscheidungserheblich ist, aktenmäßig hervorgesucht und dem<br />
Dezernenten bei <strong>der</strong> elektronischen Bearbeitung vorliegen.<br />
21. Die Lösung allgemeiner EDV-mäßig verursachter Probleme:<br />
22. Die elektronische Signatur (z. B. bei einer Zeugenvernehmung die Signa-<br />
tur auf je<strong>der</strong> Seite!) muss gelöst werden<br />
23. Vorsätzliche o<strong>der</strong> fahrlässige Manipulationen durch Verän<strong>der</strong>ung des In-<br />
haltes einer Urkunde, einer Zeugenaussage usw. müssen ausgeschlos-<br />
sen werden. Sie sind bei elektronischer <strong>Akte</strong>nführung leichter möglich als<br />
bei <strong>der</strong> Papierakte.<br />
24. Im Massenbetrieb <strong>der</strong> Staatsanwaltschaften muss die manipulative o<strong>der</strong><br />
unachtsame Löschung von <strong>Akte</strong>n o<strong>der</strong> <strong>Akte</strong>nbestandteilen technisch aus-<br />
geschlossen sein! (z. B. ist an eine parallele Sicherungskopie grundsätz-<br />
lich zu denken vergleichbar TÜ-Bän<strong>der</strong>n, bei denen ein TÜ-Tonband als<br />
Arbeitsaufnahme dient, die ausgewertet werden kann und ein TÜ-<br />
Tonband als Sicherungstonband zur Verfügung steht).<br />
Die EDV-mäßige Lesbarkeit <strong>der</strong> <strong>Akte</strong> muss in Anbetracht <strong>der</strong> extremen<br />
Arbeitsbelastung <strong>der</strong> Staatsanwältinnen/Staatsanwälte gesichert sein<br />
(z. B. sind bislang 150 elektronische Seiten sehr viel schwerer durchzu-<br />
blättern, bei Würdigung von Zeugenaussagen pp. <strong>der</strong>zeit schwieriger vor-<br />
248
und zurückblätterbar als bei einer Papierakte. Diese EDV-Nachteile wer-<br />
den nicht vollständig beseitigt werden können, spielen aber eine große<br />
Rolle. An<strong>der</strong>erseits findet eine Entlastungskompensation dadurch statt,<br />
dass z. B. <strong>der</strong> Staatsanwalt nach best<strong>im</strong>mten Suchbegriffen z. B. Zeu-<br />
gennamen, Tatortnamen usw. die <strong>Akte</strong> elektronisch durchsuchen kann<br />
und damit schneller zum Ziel kommt als be<strong>im</strong> Durchblättern <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>).<br />
25. Anklage und gerichtliches Verfahren<br />
26. 30 % <strong>der</strong> <strong>Strafverfahren</strong> werden angeklagt o<strong>der</strong> <strong>im</strong> Strafbefehlsantrag er-<br />
ledigt, hierbei tauchen die meisten EDV-Probleme auf.<br />
27. Bei den Staatsanwaltschaften muss ein flächendeckendes Textbaustein-<br />
system und ein verbindliches Anwendungssystem geschaffen werden<br />
(<strong>der</strong>zeit haben die 16 Bundeslän<strong>der</strong> in Deutschland ca. 5 verschiedene<br />
Anwendungssysteme).<br />
28. Die verbindliche Anwendung von Textbausteinen darf nicht am Mitbe-<br />
st<strong>im</strong>mungsgesetz scheitern.<br />
29. Das alternative „Selberschreiben“ am Computer muss nach wie vor ges-<br />
tattet sein (z. B. auch bei Anklagen pp., die durch Textbausteine nicht<br />
sachgerecht erstellt werden können). Allerdings muss das „Selberschrei-<br />
ben“ ausschließlich <strong>im</strong> Rahmen des jeweiligen EDV-Systems erfolgen,<br />
weil ansonsten nur „bedrucktes Papier“ geliefert wird.<br />
30. Spracherkennungssysteme (z. B. in Schleswig-Holstein für ¼ aller<br />
Staatsanwältinnen/Staatsanwälte vorhanden) müssen in das EDV-System<br />
so integriert werden, dass auch dadurch die elektronische <strong>Akte</strong> gewahrt<br />
bleiben kann (bislang erzeugen sie vorwiegend „bedrucktes Papier“).<br />
31. Diktiergeräte alter Art könnten nur noch zugelassen sein, wenn sie digitale<br />
Diktiergeräte sind und in das EDV-System <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft kom-<br />
plett integriert sind.<br />
249
32. Verbindliche Einführung <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> auch <strong>im</strong> gerichtlichen<br />
Verfahren (vergleichbar z. B. <strong>der</strong> Finanzgerichtsbarkeit)<br />
33. Übersendung des – in aller Regel in diesen Fällen – vorhandenen Be-<br />
weismittelheftes parallel zur elektronischen <strong>Akte</strong><br />
34. Ausdrucken <strong>der</strong> Anklage und aller übrigen Ladungen pp. nach elektroni-<br />
scher Anweisung durch eine Postversendungsstelle und Versandt dieser<br />
Dokumente<br />
35. <strong>Elektronische</strong> <strong>Akte</strong>neinsicht an die Institutionen, die damit „zufrieden“ sind<br />
36. Verbindliche Festlegung eines Kreises von <strong>Akte</strong>neinsichtsberechtigten,<br />
die nur noch Anspruch auf Übersendung einer elektronischen <strong>Akte</strong> haben<br />
37. Der Amtsaufklärungsgrundsatz und die elektronische <strong>Akte</strong>:<br />
Der Qualitätsstandard richterlicher Wahrheitsfindung darf durch eine e-<br />
lektronische <strong>Akte</strong> in keinem Fall beeinträchtigt werden.<br />
38. Im Grenzbereich muss daher von <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft großzügiger ein<br />
Beweismittelheft angelegt werden, als dies bislang <strong>der</strong> Fall ist<br />
39. Die Einsichtnahme aller Prozessbeteiligter in Beweismittel muss auf <strong>der</strong>en<br />
Verlangen in <strong>der</strong> Hauptverhandlung in Papierform sichergestellt sein. Es<br />
muss aber auch eine Möglichkeit geben, die Beweise elektronisch in <strong>der</strong><br />
Hauptverhandlung darzustellen, wenn keiner <strong>der</strong> Prozessbeteiligten aus-<br />
drücklich wi<strong>der</strong>spricht.<br />
Das Urteil muss elektronisch erstellt werden (wobei dieselben Probleme<br />
gelöst werden müssen wie bei <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft).<br />
40. Das Vollstreckungsverfahren:<br />
250
41. Für das Vollstreckungsverfahren ergeben sich keine über die zuvor vor-<br />
gestellten Regelungen hinausgehenden Probleme.<br />
42. Die Zugriffsmöglichkeiten auf <strong>Akte</strong>nteile, die Komplettakten o<strong>der</strong> best<strong>im</strong>m-<br />
te <strong>Akte</strong>ninhalte durch die „aktenführende“ Behörde, durch Ermittlungsper-<br />
sonen, durch das Gericht, durch Bewährungs- und Gerichtshilfe, durch<br />
soziale Institutionen z. B. bei Täter-Opfer-Ausgleich, Opferberichterstat-<br />
tung, gemeinnützige Arbeit zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafe,<br />
durch die Jugendgerichtshilfe usw. muss geklärt sein, die Zugriffe müssen<br />
EDV-mäßig protokolliert werden (Datenschutzaspekte!)<br />
Rechtliche Probleme<br />
Rechtliche Probleme müssen gelöst werden, die sich zwangsläufig aus den<br />
oben genannten Anwendungskonzepten ergeben. Sie umfassen u. a. folgende<br />
Bereiche:<br />
1. Die strafprozessualen Eingriffsbefugnisse <strong>der</strong> Ermittlungsbehörden und<br />
ihre elektronische Umsetzbarkeit<br />
2. Die Vereinbarkeit prozessualer Rechte von Verfahrensbeteiligten (z. B.<br />
Geschädigte, Nebenkläger, Opfer, Strafverteidigung, Beschuldigte) müs-<br />
sen auch bei EDV-Anwendung wahrnehmbar sein.<br />
3. Die Zugriffsberechtigung muss analog den herkömmlichen strafprozessu-<br />
alen Regeln über <strong>Akte</strong>neinsicht, Auskunft aus den <strong>Akte</strong>n usw. geregelt<br />
werden.<br />
4. Ein etwaiges Spannungsverhältnis richterlicher Unabhängig-<br />
keit/elektronische <strong>Akte</strong> muss geklärt werden.<br />
5. Der Standard von Wahrheitsfindung nach dem Amtsaufklärungsgrundsatz<br />
bei Gericht muss auch bei elektronischer <strong>Akte</strong> gewahrt bleiben<br />
251
6. Die grundlegenden Verfahrensrechte <strong>der</strong> Strafverteidigung, insbeson<strong>der</strong>e<br />
das Beweisantragsrecht, müssen erhalten bleiben, soweit es in einem<br />
Spannungsverhältnis zur elektronischen <strong>Akte</strong> rechtlich o<strong>der</strong> faktisch ste-<br />
hen könnte.<br />
7. Es muss rechtlich geklärt werden, ein etwaiges Spannungsverhältnis zwi-<br />
schen elektronischer <strong>Akte</strong> und Rechtshilfevorgängen, Vereinbarkeit mit<br />
von Deutschland abgeschlossenen internationalen Rechtshilfeverträgen,<br />
mit dem Europäischen Haftbefehlsgesetz usw.<br />
8. Vereinbarkeit <strong>der</strong> elektronischen <strong>Akte</strong> mit – <strong>der</strong>zeit in <strong>der</strong> Umsetzungs-<br />
phase befindlichen – grundlegenden europäischen Verfahrensrechten von<br />
Beschuldigten <strong>im</strong> <strong>Strafverfahren</strong>. Einflussnahme durch das Bundesjustiz-<br />
ministerium in diesem laufenden Diskussionsprozess.<br />
9. Befriedigende Regelung <strong>der</strong> Datenschutzfragen, die sich aus <strong>der</strong> elektro-<br />
nischen <strong>Akte</strong> ergeben.<br />
Das <strong>Bundesministerium</strong> hat in seinem Gutachtenauftrag darauf hingewiesen,<br />
dass diese Einzelfragen innerhalb <strong>der</strong> jeweiligen Themenbereiche außerdem<br />
aufgegriffen werden sollten.<br />
c) 1. Bundesamt für Sicherheit in <strong>der</strong> Informationstechnik<br />
http://www.bsi.bund.de/esig/index.htm<br />
2. Bundesnetzagentur: elektronische Signatur<br />
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/gz.html<br />
252
zu II:<br />
§ 89 c GOG<br />
(1) Für Eingaben <strong>im</strong> elektronischen Rechtsverkehr gelten die Best<strong>im</strong>mun-<br />
gen über den Inhalt schriftlicher Eingaben; sie bedürfen keiner Gleich-<br />
schriften und Rubriken. Soweit solche benötigt werden, hat das Gericht<br />
die entsprechenden Ausdrucke herzustellen. Eingaben <strong>im</strong> elektroni-<br />
schen Rechtsverkehr entfalten auch die Rechtswirkungen <strong>der</strong> Schrift-<br />
lichkeit <strong>im</strong> Sinne des § 886 ABGB; § 4 Abs. 2 SigG ist insoweit nicht an-<br />
zuwenden.<br />
(2) Soweit dies in <strong>der</strong> Verordnung nach § 89b Abs. 2 angeordnet ist,<br />
1. sind die Eingaben mit einer geeigneten elektronischen Signatur zu<br />
unterschreiben;<br />
2. kann auch ein an<strong>der</strong>es sicheres Verfahren, das die Authentizität und<br />
die Integrität des übermittelten elektronischen Dokuments sicherstellt,<br />
angewandt werden;<br />
3. sind Beilagen zu elektronischen Eingaben in Form von elektronischen<br />
Urkunden (Urschriften o<strong>der</strong> elektronischen Abschriften von Papierur-<br />
kunden) anzuschließen.<br />
(3) Für elektronisch übermittelte gerichtliche Erledigungen gelten die Best<strong>im</strong>-<br />
mungen über den Inhalt schriftlicher Ausfertigungen gerichtlicher Erledi-<br />
gungen. In <strong>der</strong> Ausfertigung ist zwingend <strong>der</strong> Name des Entscheidungs-<br />
organs anzuführen. Die Ausfertigungen gerichtlicher Erledigungen sind<br />
mit <strong>der</strong> elektronischen Signatur <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> zu versehen, soweit dies in<br />
<strong>der</strong> Verordnung nach § 89b Abs. 2 vorgesehen ist. Die elektronische<br />
Signatur <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> ist eine Signatur, die zumindest den Erfor<strong>der</strong>nissen<br />
des § 2 Z 3 lit. a, b und d SigG entspricht. Soweit die Rückführung <strong>der</strong><br />
Ansicht des gesamten Dokuments in eine Form, die die Signaturprüfung<br />
zulässt, möglich ist, gelten für die Prüfbarkeit <strong>der</strong> elektronischen Signa-<br />
tur <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> und die Rückführbarkeit von Ausdrucken § 19 Abs. 3 und §<br />
20 E-GovG. Im Übrigen sind die Best<strong>im</strong>mungen des SigG anzuwenden.<br />
(4) Der Bundesminister für <strong>Justiz</strong> hat die notwendigen Zertifizierungsdienste<br />
für die elektronische Signatur <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> sowie die sicheren elektroni-<br />
schen Signaturen <strong>der</strong> zur Überbeglaubigung berechtigten Organe si-<br />
cherzustellen. Jede Verwendung <strong>der</strong> elektronischen Signatur <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong><br />
ist automationsunterstützt in einem Protokoll, das den Namen des An-<br />
253
wen<strong>der</strong>s ausweist, festzuhalten. Dieses Protokoll ist mindestens drei<br />
Jahre lang aufzubewahren.<br />
(5) Eingaben, welche elektronisch eingebracht werden dürfen, sind von<br />
Rechtsanwälten und Notaren nach Maßgabe <strong>der</strong> technischen Möglich-<br />
keiten <strong>im</strong> elektronischen Rechtsverkehr einzubringen.<br />
§ 89 d GOG<br />
(1) <strong>Elektronische</strong> Eingaben (§ 89a Abs. 1) gelten als bei Gericht ange-<br />
bracht, wenn ihre Daten zur Gänze bei <strong>der</strong> Bundesrechenzentrum<br />
GmbH eingelangt sind. Ist vorgesehen, dass die Eingaben über eine<br />
Übermittlungsstelle zu leiten sind (§ 89b Abs. 2), und sind sie auf diesem<br />
Weg bei <strong>der</strong> Bundesrechenzentrum GmbH tatsächlich zur Gänze einge-<br />
langt, so gelten sie als bei Gericht mit demjenigen Zeitpunkt angebracht,<br />
an dem die Übermittlungsstelle dem Einbringer rückgemeldet hatte, dass<br />
sie die Daten <strong>der</strong> Eingabe zur Weiterleitung an die Bundesrechenzent-<br />
rum GmbH übernommen hat.<br />
(2) Elektronisch übermittelte gerichtliche Erledigungen und Eingaben (§ 89<br />
§ 89i.<br />
a Abs. 2) gelten als zugestellt, sobald ihre Daten in den elektronischen<br />
Verfügungsbereich des Empfängers gelangt sind.<br />
(1) Soweit Parteien und Beteiligten ein Recht auf <strong>Akte</strong>neinsicht zusteht, ha-<br />
ben sie nach Maßgabe <strong>der</strong> vorhandenen technischen Möglichkeiten An-<br />
spruch darauf, Ablichtungen <strong>der</strong> ihre Sache betreffenden <strong>Akte</strong>n und Ak-<br />
tenteile zu erhalten.<br />
ERV - Verordnung 2006<br />
Zulässigkeit des elektronischen Rechtsverkehrs<br />
§ 1.<br />
(1) Alle Eingaben und Beilagen von Eingaben an Gerichte und Staatsanwalt-<br />
schaften können nach Maßgabe <strong>der</strong> §§ 5, 8a, 9 und 10 elektronisch ein-<br />
gebracht werden.<br />
(2) Eine zur Verbesserung (§§ 84, 85 ZPO) zurückgestellte Eingabe kann<br />
nicht neuerlich elektronisch eingebracht werden. Die zur Verbesserung<br />
254
einer zurückgestellten Eingabe erfor<strong>der</strong>lichen Erklärungen o<strong>der</strong> Beilagen<br />
können jedoch elektronisch eingebracht werden.<br />
(3) Erledigungen und Beilagen können nach Maßgabe des § 5 an Einbrin-<br />
ger, die vom elektronischen Rechtsverkehr Gebrauch gemacht haben<br />
o<strong>der</strong> ausdrücklich <strong>der</strong> elektronischen Zustellung zugest<strong>im</strong>mt haben, e-<br />
lektronisch zugestellt werden. Unbeschadet <strong>der</strong> Wirksamkeit <strong>der</strong> elekt-<br />
ronischen Zustellung ist auf Antrag <strong>im</strong> Einzelfall die Erledigung auch<br />
schriftlich auf Papier auszufertigen.<br />
(3a) <strong>Elektronische</strong> Auszüge aus <strong>der</strong> Datenbank des Firmenbuchs sowie Ur-<br />
kunden, die aus den Urkundensammlungen des Grundbuchs und des<br />
Firmenbuchs abgerufen werden, sind zur Gewährleistung <strong>der</strong> Authentizi-<br />
tät und Integrität mit <strong>der</strong> elektronischen Signatur <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> (§ 89c Abs. 3<br />
GOG) zu versehen. Auf ausdrückliches Verlangen kann dies unterblei-<br />
ben.<br />
(4) In <strong>der</strong> Zeit zwischen 16.00 Uhr und 24.00 Uhr sowie an Samstagen,<br />
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ist eine elektronische Zustellung<br />
nicht zulässig.<br />
(5) Erledigungen, die zu eigenen Händen zuzustellen sind, sind ebenso wie<br />
<strong>der</strong> Beschluss, mit dem eine Anmerkung <strong>der</strong> Rangordnung bewilligt wird<br />
(§ 54 GBG), von <strong>der</strong> elektronischen Zustellung ausgenommen.<br />
Übermittlungsstellen, Direktverkehr<br />
§ 3<br />
(1) Der Einbringer einer elektronischen Eingabe hat sich einer Übermittlungs-<br />
stelle zu bedienen. Die Übermittlungsstellen sind von <strong>der</strong> Bundesminis-<br />
terin für <strong>Justiz</strong> auf <strong>der</strong> Website „www.edikte.justiz.gv.at“ <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> be-<br />
kannt zu machen.<br />
(1a) Bedient sich ein Teilnehmer am elektronischen Rechtsverkehr mehrerer<br />
Übermittlungsstellen, so sind Erledigungen und Beilagen über jene Ü-<br />
bermittlungsstelle elektronisch zuzustellen, die vom Teilnehmer zuletzt<br />
beauftragt wurde. Die Übermittlungsstelle hat <strong>der</strong> Bundesrechenzentrum<br />
GmbH den Zeitpunkt <strong>der</strong> Beauftragung bekannt zu geben.<br />
(2) Die Bundesministerin für <strong>Justiz</strong> kann, soweit dies auf Grund <strong>der</strong> techni-<br />
schen Möglichkeiten zweckmäßig ist o<strong>der</strong> einer einfacheren und spar-<br />
255
sameren Verwaltung dient, anordnen, dass best<strong>im</strong>mte Eingaben und Er-<br />
ledigungen unmittelbar <strong>im</strong> Wege <strong>der</strong> Bundesrechenzentrum GmbH zu<br />
übermitteln sind (Direktverkehr). In diesem Fall treffen die Bundesre-<br />
chenzentrum GmbH die Pflichten <strong>der</strong> Übermittlungsstelle.<br />
(3) Für die Anordnung des Direktverkehrs (Abs. 2) ist überdies erfor<strong>der</strong>lich,<br />
dass die technischen und organisatorischen Bedingungen für eine siche-<br />
re und wirtschaftliche Datenübertragung erfüllt sind; hiezu ist die Bun-<br />
desrechenzentrum GmbH anzuhören.<br />
(4) Vor Aufnahme <strong>der</strong> Übertragungen hat die Übermittlungsstelle in einem<br />
Testbetrieb sicherzustellen, dass ein einwandfreier Betrieb gewährleistet<br />
ist.<br />
(5) Bei schwerwiegenden Verstößen gegen diese Verordnung o<strong>der</strong> gravie-<br />
ren<strong>der</strong> Unzuverlässigkeit <strong>im</strong> Betrieb kann <strong>der</strong> Übermittlungsstelle <strong>der</strong><br />
weitere Betrieb untersagt werden.<br />
Ausdruck <strong>der</strong> Eingaben<br />
§ 8.<br />
(1) Von einer elektronisch eingebrachten Eingabe ist erfor<strong>der</strong>lichenfalls ein<br />
zu IV:<br />
a)<br />
Ausdruck herzustellen. Für die weitere Erledigung, insbeson<strong>der</strong>e für ge-<br />
kürzte Urschriften, ist dieser Ausdruck zu verwenden.<br />
Landesverordnung über die elektronische <strong>Akte</strong>nführung<br />
Vom 12. Dezember 2006<br />
GVOBI. 2006, 360<br />
§1<br />
(1) Die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen<br />
Behörden können <strong>Akte</strong>n <strong>im</strong> Bußgeldverfahren elektronisch führen. Satz 1 findet<br />
auf Staatsanwaltschaften keine Anwendung.<br />
(2) Für die Bildung, Führung und Aufbewahrung <strong>der</strong> elektronisch geführten <strong>Akte</strong>n sind<br />
die Festlegungen über Datenformate, Schnittstellen und Sicherheitsverfahren<br />
in den „Technischen Rahmenvorgaben für den elektronischen<br />
Rechtsverkehr" in <strong>der</strong> Fassung vom 21. April 2005 (Anlage 1 <strong>der</strong><br />
256
„Organisatorisch- technischen Leitlinie für den elektronischen Rechtsverkehr<br />
mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften - OTLeit-ERV") zugrunde zu<br />
legen; diese werden bei dem für <strong>Justiz</strong> zuständigen Ministerium in Papierform<br />
vorgehalten und können auf <strong>der</strong> Internetseite www.xjustiz.de eingesehen<br />
werden.<br />
(3) Die von den in Absatz 1 genannten Behörden eingesetzten<br />
Dokumentenmanagementsysteme müssen dem DOMEA-Standard genügen<br />
und für die Verfahrensübernahme durch eine an<strong>der</strong>e Behörde über eine<br />
Schnittstelle verfügen, die dem XML-Datenaustauschformat X<strong>Justiz</strong><br />
mindestens in <strong>der</strong> Version 1.3.0 zuzüglich dem Fachmodul<br />
X<strong>Justiz</strong>.Straf/Owi entspricht. Die in Satz 1 genannten<br />
Dokumentenmanagementsysteme müssen ab den 1. Januar 2009<br />
mindestens den Standard DOMEA 2.1 erfüllen. Der DOMEA-Standard<br />
und das XML-Datenaustauschformat werden bei dem für <strong>Justiz</strong><br />
zuständigen Ministerium in Papierform vorgehalten. Der DOMEA-<br />
Standard kann auf <strong>der</strong> Internetseite www.domea.de und das XML-<br />
Datenaustauschformat auf <strong>der</strong> Internetseite www.xjustiz.de eingesehen<br />
werden.<br />
§2<br />
Werden <strong>Akte</strong>n elektronisch geführt, sind sämtliche zu den <strong>Akte</strong>n gehörende<br />
Schriftstücke in die elektronische Form zu überführen, soweit es sich nicht<br />
um in Verwahrung zu nehmende o<strong>der</strong> in an<strong>der</strong>er Weise sicherzustellende<br />
Urschriften handelt, die als Beweismittel von Bedeutung sind o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Einziehung o<strong>der</strong> dem Verfall unterliegen. Interne Verfügungen sind in<br />
elektronischer Form zu erstellen.<br />
§3<br />
Für jeden Vorgang ist eine elektronische <strong>Akte</strong> anzulegen.<br />
§4<br />
Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens sind die elektronischen<br />
Vorgänge einschließlich des Begleitdokuments bis zu ihrer Löschung o<strong>der</strong><br />
Übergabe an das Landesarchiv in den Datenformaten TIFF o<strong>der</strong> PDF/A zu<br />
speichern. Soweit für Zwecke <strong>der</strong> Recherche erfor<strong>der</strong>lich, können Daten <strong>im</strong><br />
Format TIFF ergänzend auch <strong>im</strong> Format txt gespeichert werden.<br />
257
) www.Normfall.de o<strong>der</strong> www.normfall.de<br />
zu V:<br />
a) hierzu www.xjustiz.de o<strong>der</strong> www.justiz.de mit vielen weiterführenden<br />
zu VI:<br />
zu IX:<br />
Übersicht:<br />
Hinweisen zu den technischen Voraussetzungen <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong>kommunikation<br />
und <strong>der</strong>en rechtlichen Grundlagen; ferner Jürgen Ehrmann, <strong>Justiz</strong>ministe-<br />
rium Baden-Württemberg , IT-Standards in <strong>der</strong> <strong>Justiz</strong> - wozu und wie?<br />
XML-Tage 2007, Humboldt-Universität zu Berlin vom 24.-26.09.2007 =<br />
http://www.xml-clearinghouse.de/ws/XMLT2007/folien/ejustice/2-4-<br />
Ehrmann.pdf)<br />
b) Softwareanbieter: Audicon GmbH, 70565 Stuttgart, Am Wallgraben 100<br />
bzw. 40221 Düsseldorf, Neuer Zollhof 3, http://www.audicon.net/<br />
Bonenberger, Lohnsteuer: Die Anwendung von „Idea“, Praxis Steuerstraf-<br />
recht, 2006, 249 Groß/Wiessinger, Die digitale Betriebsprüfung mit <strong>der</strong><br />
IDEA-Prüfsoftware – Selbsttest zur opt<strong>im</strong>alen Vorbereitung, BC 2003, 250<br />
Bro<strong>der</strong> Gretemann, Die elektronische <strong>Akte</strong> als Voraussetzung eines EDV-<br />
Gesamtkonzepts für die <strong>Justiz</strong>, 1996, S. 153 ff.; Max Schwoerer, Die elektronische<br />
<strong>Justiz</strong> 2005, S. 96 ff.<br />
Aktuelle Informationen zur europäischen Strafregistervernetzung<br />
(NJR — Network of Judicial Registers)<br />
(Stand: 1. November 2007)<br />
A. Vorbemerkung Seite 1<br />
B. Grundlagen <strong>der</strong> europäischen Strafregistervernetzung Seite 2<br />
C. Beteiligung weiterer Län<strong>der</strong> an <strong>der</strong> europäischen Strafregistervernetzung Seite 2<br />
D. Teilnahme an <strong>der</strong> Strafregistervernetzung per Briefpost o<strong>der</strong> Telefax Seite 3<br />
258
E. Personenkreis, über den Anfragen gestellt werden können Seite 4<br />
F. Einsatz <strong>der</strong> Verständnishilfe Straftaten Seite 5<br />
G . V e r s c h i e d e n e s Seite 5<br />
1. Bitte Frankreichs zur möglichst umfassenden<br />
Nutzung des NJR-Systems Seite 5<br />
2. Angabe des Arrondissements bei größeren<br />
französischen Städten Seite 6<br />
3. Bitte Spaniens zur Beachtung <strong>der</strong> Beson<strong>der</strong>heiten<br />
spanischer Nachnamen Seite 6<br />
4. Zahlenmäßige Entwicklung des elektronischen Datenaustauschs Seite 7<br />
H. Informationen <strong>im</strong> Internet; Auskünfte zum Verfahren Seite 7<br />
A. Vorbemerkung<br />
Mit Schreiben vom 19. April 2006 hatte das Bundesjustizministerium die<br />
Landesjustizverwaltungen über die Aufnahme des Echtbetriebs <strong>der</strong><br />
europäischen Strafregistervernetzung zwischen den Staaten Frankreich,<br />
Deutschland, Spanien und Belgien informiert. Insbeson<strong>der</strong>e <strong>im</strong> Hinblick<br />
auf die Ausdehnung des Systems auf weitere Län<strong>der</strong> und auf<br />
Än<strong>der</strong>ungen be<strong>im</strong> Personenkreis, über den Anfragen gestellt werden<br />
können, soll diese Information nunmehr aktualisiert werden.<br />
B. Grundlagen <strong>der</strong> europäischen Strafregistervernetzung<br />
Kern des Projekts ist die Schaffung einer sicheren elektronischen Kom-<br />
munikationsmöglichkeit <strong>der</strong> Strafregister <strong>der</strong> beteiligten Partnerstaaten<br />
untereinan<strong>der</strong>. In Verbindung mit <strong>der</strong> in Deutschland bereits bestehenden<br />
elektronischen. Kommunikation <strong>der</strong> nationalen Behörden mit dem Bun-<br />
deszentralregister (Automatisches Mitteilungs- und Auskunftsverfahren<br />
be<strong>im</strong> Bundeszentralregister, kurz „AUNMAU") ermöglicht das Strafregis-<br />
tervernetzungsprojekt die medienbruchfreie elektronische Übermittlung<br />
von Auskunftsersuchen deutscher Behörden an die Strafregister <strong>der</strong><br />
Partnerstaaten des Projekts sowie <strong>der</strong>en medienbruchfreie elektroni-<br />
sche Beantwortung. Das Bundeszentralregister fungiert hierbei als deut-<br />
sche Kopfstelle.<br />
Die neu geschaffene Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung von Aus-<br />
kunftsersuchen tritt neben den herkömmlichen Weg des Rechtshilfeverkehrs<br />
(Abwicklung in Papierform). Ebenso wie dieser beruht sie auf dem Europäi-<br />
schen Rechtshilfeübereinkommen von 1959 und dem Beschluss des Rats <strong>der</strong><br />
Europäischen Union vom 21. November 2005 (2005/876/J sog. „Dringlich-<br />
259
keitsmaßnahme"). Das Erfor<strong>der</strong>nis, ein förmliches Rechtshilfeersuchen in <strong>der</strong><br />
Sprache des ersuchten Landes zu stellen, entfällt. Ziel des Projekts ist es, die<br />
Auskunftserteilung zu beschleunigen und zudem die Verständlichkeit <strong>der</strong> Aus-<br />
künfte zu erhöhen.<br />
Zwischen Deutschland, Frankreich, Spanien und Belgien wurde <strong>der</strong> Echtbe-<br />
trieb für Auskunftsersuchen Anfang April 2006 aufgenommen.<br />
C. Beteiligung weiterer Län<strong>der</strong> an <strong>der</strong> europäischen Strafregister-<br />
vernetzung 1. Aufnahme des Echtbetriebs mit <strong>der</strong> Tschechi-<br />
schen Republik.<br />
Am 1. November wurde <strong>der</strong> Echtbetrieb zwischen Deutschland und <strong>der</strong><br />
Tschechischen Republik aufgenommen. Seither werden Straf-<br />
nachrichten ausschließlich elektronisch ausgetauscht. Für die deut-<br />
schen Staatsanwaltschaften und Gerichte ist es nunmehr möglich, An-<br />
fragen über das NJR-System an das tschechische Zentralregister zu<br />
stellen. Soweit die Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung <strong>der</strong> An-<br />
frage von <strong>der</strong> Staatsanwaltschaft o<strong>der</strong> dem Gericht zum Bundesamt für<br />
<strong>Justiz</strong> (als <strong>der</strong> deutschen Kopfstelle) noch nicht in die einzelnen einge-<br />
setzten Fachverfahren integriert ist, ermöglicht das Bundesamt für <strong>Justiz</strong><br />
die Teilnahme übergangsweise auch auf dem Post- bzw. Faxweg, vgl.<br />
hierzu unten D.<br />
2. Bevorstehen<strong>der</strong> Echtbetrieb mit Luxemburg<br />
Der Echtbetrieb mit Luxemburg wird voraussichtlich <strong>im</strong> Laufe des 1.<br />
Quartals 2008 aufgenommen werden. Das Bundesjustizministerium<br />
wird hierüber zu gegebener Zeit geson<strong>der</strong>t informieren.<br />
3. Aufnahme weiterer Partnerstaaten<br />
Im Juni 2007 wurden die Slowakei, das Vereinigte Königreich, Polen,<br />
Slowenien und Italien als weitere Projektpartner aufgenommen. Die zur<br />
Teilnahme am elektronischen Datenaustausch erfor<strong>der</strong>lichen techni-<br />
schen Voraussetzungen sollen in diesen Län<strong>der</strong>n <strong>im</strong> kommenden<br />
Jahr geschaffen werden. Nach bisheriger Planung ist mit Aufnahme<br />
des Echtbetriebs <strong>im</strong> 1. Halbjahr 2009 zu rechnen. Auch hierüber wird<br />
das Bundesjustizministerium zu gegebener Zeit informieren.<br />
260
D. Teilnahme an <strong>der</strong> Strafregistervernetzung per Briefpost o<strong>der</strong> Telefax<br />
Nach wie vor ermöglicht das Bundesamt für <strong>Justiz</strong> seinen Kommunikati-<br />
onspartnern die Teilnahme an <strong>der</strong> Strafregistervernetzung auch dann, wenn<br />
noch keine Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung <strong>der</strong> Anfragen an das<br />
Bundesamt für <strong>Justiz</strong> (als deutscher Kopfstelle) besteht.<br />
Das Bundesamt für <strong>Justiz</strong> n<strong>im</strong>mt Auskunftsersuchen per Briefpost o<strong>der</strong><br />
Telefax entgegen und speist sie in den elektronischen Datenaustausch<br />
mit den Partnerregistern ein, Die entsprechenden Auskünfte werden in <strong>der</strong><br />
Folge per Telefax an die anfragenden Behörden zurück geleitet.<br />
Die Auskunftsersuchen sind per Post o<strong>der</strong> per Telefax zu richten an:<br />
Bundesamt für <strong>Justiz</strong><br />
Sachgebiet BZR 32 / IR<br />
53094 Bonn<br />
Telefaxnummer; 01888 410 5603<br />
Die Auskunftsersuchen bedürfen keiner beson<strong>der</strong>en Form. Es genügt<br />
die Übermittlung eines Personenstammblatts o<strong>der</strong> eines deutschen<br />
Registerauszugs, soweit ein solcher bereits vorliegt. Zur Identifizierung<br />
<strong>der</strong> betreffenden Person <strong>im</strong> Register sollten die für BZR-Anfragen übli-<br />
chen Personendaten übermittelt werden. Als Mindestdaten müssen die<br />
Anfragen den Geburtsnamen, den Vornamen. das Geburtsdatum und<br />
den Geburtsort enthalten.<br />
E. Personenkreis, über den Anfragen gestellt werden können<br />
Auf Betreiben<strong>der</strong> Projektpartner musste Deutschland einer Modifikation des Perso-<br />
nenkreises zust<strong>im</strong>men, über den <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Strafregistervernetzung<br />
Anfragen gestellt werden können. Eine Verpflichtung zur Auskunftsertei-<br />
lung besteht bei elektronisch übermittelten Anfragen nunmehr bei folgen-<br />
den vier Personengruppen:<br />
261
1. Staatsangehörige des angefragten Staates<br />
2. Staatsangehörige von Staaten, die nicht zur EU gehören<br />
3. Staatenlose Personen<br />
4. Personen mit unbekannter Staatsangehörigkeit<br />
Von den Staatsanwaltschaften und Gerichten elektronisch übermittelte<br />
Anfragen, die nicht diesem sog. Staatsangehörigkeitskompromiss ent-<br />
sprechen, werden vorn Bundesamt für <strong>Justiz</strong> nicht an das ausländische<br />
Register weiter geleitet, son<strong>der</strong>n mit einem entsprechenden Hinweis auto-<br />
matisch an die anfragende Stelle zurückgeleitet.<br />
Vereinbart wurde auf Veranlassung <strong>der</strong> Projektpartner außerdem, dass An-<br />
fragen über Personen aus den Gruppen 2. bis 4. nur dann gestellt werden<br />
sollen, wenn objektive Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Person in<br />
dem angefragten Land bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sein<br />
könnte. Die verantwortungsvolle Handhabung dieser Anfor<strong>der</strong>ung liegt in<br />
den Händen <strong>der</strong> Nutzer. Deutschland hat die Projektpartner bereits mehr-<br />
fach darauf hingewiesen, dass <strong>der</strong> hohe Anteil an Positivauskünften<br />
(Auskünften mit Eintragungen) bei <strong>der</strong> Beantwortung deutscher Auskunftser-<br />
suchen — hierzu unten G.4. — zeigt, dass die deutschen Staatsanwalt-<br />
schaften und Gerichte Auskunftsersuchen an die Projektpartner nicht rou-<br />
tinemäßig o<strong>der</strong> willkürlich stellen.<br />
Hintergrund des von den Projektpartnern gewünschten Ausschlusses<br />
von Anfragen über Angehörige von EU-Mitgliedsstaaten ist die politi-<br />
sche Entscheidung auf EU- Ebene über das zukünftige Strafregistersys-<br />
tem in Europa, Danach sollen alle strafrechtlichen Verurteilungen einer<br />
Person zentral <strong>im</strong> Strafregister des He<strong>im</strong>atstaats gespeichert werden. Die<br />
Vollständigkeit dieses Registers soll durch Strafnachrichtenaustausch und<br />
entsprechende Aufbewahrungspflichten sichergestellt werden.<br />
Es ist darauf hinzuweisen, dass alle Projektpartner unabhängig von den<br />
Vereinbarungen übenden Betrieb <strong>der</strong> Strafregistervernetzung nach dem Eu-<br />
ropäischen Rechtshilfeübereinkommen in Strafsachen von 1959 und nach<br />
dem Beschluss des Rats <strong>der</strong> Europäischen Union vom 21. November 2005<br />
— 2005/876/J1 — nach wie vor dazu verpflichtet sind schriftliche Anfragen<br />
262
aus Deutschland auch dann zu beantworten, wenn sie Angehörige eines<br />
an<strong>der</strong>en EU•Mitgliedsstaates o<strong>der</strong> sogar einen Deutschen betreffen.<br />
F. Einsatz <strong>der</strong> Verständnishilfe Straftaten<br />
Zwischenzeitlich haben alle Vernetzungspartner damit begonnen, bei<br />
<strong>der</strong> Beantwortung von Auskunftsersuchen die sog. Verständnishilfe Straf-<br />
taten („table of offences") einzusetzen. Sie wurde geschaffen, um den<br />
Nutzern <strong>der</strong> europäischen Strafregistervernetzung das Verständnis <strong>der</strong><br />
aus dem Ausland erteilten Auskünfte zu erleichtern, wenn sie die aus-<br />
ländische Sprache nicht verstehen.<br />
Für die Verständnishilfe Straftaten wurden 44 Straftatenfamilien gebildet,<br />
die wie<strong>der</strong>um in insgesamt 178 Unterfamilien eingeteilt wurden, Die Fa-<br />
milien 1 bis 32 sind an die Straftatenkategorien des Europäischen Haft-<br />
befehls angelehnt. Für Straftaten, die sich keiner <strong>der</strong> 44 Straftatenfamili-<br />
en zuordnen lassen, wurde eine geson<strong>der</strong>te Kategorie<br />
„Sonstige Straftaten" als geschaffen. Die vollständige Verständnishilfe<br />
Straftaten ist auf <strong>der</strong> Internetseite des Bundesamtes für <strong>Justiz</strong> vorhanden,<br />
vgl. unten H.<br />
Die Zuordnung <strong>der</strong> den Eintragungen zugrunde liegenden Straftaten zu den Katego-<br />
rien <strong>der</strong> Verständnishilfe erfolgt durch die ausländische Register-<br />
behörde. Es handelt sich um eine unverbindliche Hilfestellung.<br />
G. Verschiedenes<br />
1. Bitte Frankreichs zur möglichst umfassenden Nutzung des NJR-Systems<br />
Aus Frankreich kam wie<strong>der</strong>holt <strong>der</strong> Hinweis, dass nach wie vor viele<br />
Anfragen an das dortige Register nicht elektronisch über das NJR-<br />
System, son<strong>der</strong>n von den deutschen Staatsanwaltschaften und Ge-<br />
richten unmittelbar auf dem Papierweg o<strong>der</strong> per Telefax übermittelt<br />
werden. Im Hinblick auf die für die europäische Strafregistervernetzung<br />
geschaffenen organisatorischen Strukturen und auf Mehraufwand bei<br />
<strong>der</strong> Bearbeitung von Papier- und Faxanfragen hat das französische<br />
263
Zentralregister darauf hingewiesen, großes Interesse an einer möglichst<br />
weitgehenden elektronischen Übermittlung von Anfragen aus<br />
Deutschland zu haben.<br />
Unter Hinweis auf die Zuständigkeit <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> und die Unab-<br />
hängigkeit <strong>der</strong> Gerichte hat das Bundesjustizministerium zugesagt,<br />
die Bitte nach verstärkter Nutzung des elektronischen Anfragewegs an<br />
die deutschen Nutzer weiter zu leiten.<br />
Zusätzlich wurde in Zusammenarbeit mit Frankreich ein Formblatt ent-<br />
wickelt, das das französische Zentralregister regelmäßig seinen Antwor-<br />
ten beifügt, wenn die Anfrage nicht elektronisch übermittelt wurde.<br />
2. Angabe des Arrondissements bei größeren französischen Städten<br />
Frankreich hat darauf hingewiesen, dass es bei Angabe des Geburts-<br />
orts bei den Städten Paris und Lyon erfor<strong>der</strong>lich ist, die Nummer des<br />
Arrondissements anzugeben.<br />
3. Bitte Spaniens zur Beachtung <strong>der</strong> Beson<strong>der</strong>heiten spanischer Nachnamen<br />
Spanien hat die Partner des Vernetzungsprojekts darauf hingewiesen,<br />
dass eine zuverlässige Beantwortung von Auskunftsersuchen nur dann<br />
sichergestellt werden kann, wenn <strong>der</strong> vollständige spanische Nachname<br />
mitgeteilt wird. Spanische Nachnamen bestehen regelmäßig aus zwei<br />
einzelnen Namen, dem ersten Nachnamen des Vaters und dem ersten<br />
Nachnamen <strong>der</strong> Mutter <strong>der</strong> betroffenen Person. Eine Eheschließung<br />
hat in Spanien keinen Einfluss auf den Namen <strong>der</strong> Eheleute.<br />
Um bei Verfahren gegen spanische Staatsangehörige zutreffende In-<br />
formationen über Eintragungen <strong>im</strong> spanischen Register zu bekommen,<br />
aber auch um es <strong>der</strong> spanischen Registerbehörde bei rechtskräftiger<br />
Verurteilung des Betroffenen in Deutschland zu ermöglichen, die ent-<br />
sprechende Strafnachricht ordnungsgemäß zu verwerten, wird ange-<br />
regt, bei spanischen Betroffenen in allen Verfahrensstadien auf die<br />
genaue Erfassung des Namens zu achten.<br />
264
zu XI:<br />
4. Statistik zum elektronischen Datenaustausch <strong>im</strong> NA-System<br />
Von Januar bis September 2007 wurde die europäische Straf-<br />
registervernetzung wie folgt genutzt:<br />
Von Deutschland wurden 848 Anfragen über das KIR-System an die<br />
Partnerregister übermittelt. In 215 Fällen wurden die Anfragen von den<br />
Partnerregistern mit Positivauskünften beantwortet.<br />
Von den Partnern wurden 1322 Anfragen an Deutschland gestellt. In<br />
257 Fällen waren die Antworten Positivauskünfte.<br />
H. Informationen <strong>im</strong> Internet; Auskünfte zum Verfahren<br />
Detaillierte Informationen zum System sind auf <strong>der</strong> Internetseite des<br />
Bundesamtes für <strong>Justiz</strong> wvvw.bundesiustizamt de/behoerden<br />
• vorhanden.<br />
Für Fragen zum Verfahren hat das Bundesamt für <strong>Justiz</strong> die E-Mail-<br />
Adresse<br />
njr-info@bfj.bund.de<br />
eingerichtet.<br />
a) Die hier bedeutsamen Auszüge <strong>der</strong> Best<strong>im</strong>mungen des Aufbewahrungs-<br />
best<strong>im</strong>mungsgesetzes (AufbewBest.) (Abschn. I Allgemeine Grundsätze<br />
Bl. 1 – 5 und Abschn. II Aufbewahrungsfristen speziell Teil C Straf- und<br />
Bußgeldverfahren Bl. 6 und 12 – 15:<br />
Allgemeine Grundsätze<br />
1. Schriftgut <strong>im</strong> Sinne <strong>der</strong> Aufbewahrungsbest<strong>im</strong>mungen sind <strong>Akte</strong>nregis-<br />
ter, öffentliche Register, Grundbücher, Namenverzeichnisse, Karteien,<br />
Urkunden, <strong>Akte</strong>n und Blattsammlungen sowie einzelne Schriftstücke, Bü-<br />
cher, Drucksachen, Karten, Pläne, Zeichnungen, Lichtbil<strong>der</strong>, Bild-, Ton-<br />
und Datenträger sowie sonstige Gegenstände, die Bestandteile o<strong>der</strong> Anla-<br />
gen <strong>der</strong> <strong>Akte</strong>n geworden sind.<br />
265
2. (1) Mit Ausnahme des in Absatz 2 genannten Schriftgutes sind die<br />
Aufbewahrungsbest<strong>im</strong>mungen auf das darin nicht genannte Schriftgut<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
(2) Die Aufbewahrung <strong>der</strong> Personalakten <strong>der</strong> Richterinnen und Richter, Be-<br />
amtinnen und Beamten, <strong>der</strong> Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge, Heilver-<br />
fahren, Unterstützungen, Erholungsurlaub, Erkrankungen, Umzugs- und Rei-<br />
sekosten und <strong>der</strong> Versorgungsakten best<strong>im</strong>mt sich nach den jeweiligen lan-<br />
desspezifischen Regelungen' ) .<br />
(3) Die Aufbewahrung <strong>der</strong> Personalakten <strong>der</strong> Angestellten, Arbeiterin-<br />
nen und Arbeiter best<strong>im</strong>mt sich nach Nrn. 224, 385, 507, 653, 753 und 813.<br />
Die Fristen beziehen sich nur auf die Personalakten als solche. Nebenakten<br />
können unmittelbar nach ihrer Schließung (Nr. 7 Abs. 3) ausgeson<strong>der</strong>t<br />
werden.<br />
3. Die Aufbewahrungsbest<strong>im</strong>mungen finden grundsätzlich auch Anwen-<br />
dung, wenn Schriftgut zur Ersetzung <strong>der</strong> Urschrift als Wie<strong>der</strong>gabe auf<br />
einem Bildträger o<strong>der</strong> auf an<strong>der</strong>en Datenträgern aufbewahrt wird. Im<br />
Übrigen sind die insoweit getroffenen beson<strong>der</strong>en Best<strong>im</strong>mungen zu be-<br />
achten. Gelten für <strong>Akte</strong>n und <strong>Akte</strong>nteile (z. B. Urteile, Beschlüsse usw.)<br />
unterschiedliche Aufbewahrungsfristen, so richtet sich die Dauer <strong>der</strong> Auf-<br />
bewahrung des Bild- o<strong>der</strong> Datenträgers, <strong>der</strong> an die Stelle <strong>der</strong> Urschriften<br />
tritt, nach <strong>der</strong> jeweils längsten Aufbewahrungsfrist.<br />
4. Erscheint eine Aufbewahrungsfrist <strong>im</strong> Einzelfall aus beson<strong>der</strong>en<br />
Gründen zu kurz, so kann die Richterin bzw. <strong>der</strong> Richter o<strong>der</strong> die<br />
Beamtin bzw. <strong>der</strong> Beamte, diebzw. <strong>der</strong> die Weglegung verfügt, eine<br />
längere Aufbewahrungsfrist best<strong>im</strong>men. Dasselbe gilt, wenn Personen, die<br />
ein berechtigtes Interesse nachweisen, einen Antrag auf längere<br />
Aufbewahrung stellen.<br />
5. Soweit in Abschnitt II, Spalte 4 eine Aufbewahrungsfrist nicht angeordnet ist<br />
(„keine"), ist das Schriftgut unmittelbar nach seiner Weglegung nach den<br />
dazu erlassenen beson<strong>der</strong>en Vorschriften auszuson<strong>der</strong>n.<br />
6. (1) Die Aufbewahrungsfrist für das Schriftgut in Straf- und Bußgeldsachen<br />
beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem das Urteil, <strong>der</strong> Strafbefehl usw.<br />
- bei mehreren Beschuldigten o<strong>der</strong> Betroffenen - die letzte Entscheidung<br />
rechtskräftig geworden ist. Ist das Verfahren ohne eine Entscheidung be-<br />
endet worden, die nach § 7 Abs. 1 AktO <strong>der</strong> Rechtskraftbescheinigung be-<br />
266
darf, beginnt die Aufbewahrungsfrist mit Ablauf des Jahres, in dem die das<br />
Verfahren beendende Entscheidung getroffen worden ist.<br />
(2) Wird nachträglich auf eine Gesamtstrafe erkannt, ist die Aufbewah-<br />
rungsfrist für das Schriftgut über die in die Entscheidung einbezogenen<br />
Verurteilungen nach dem Tage <strong>der</strong> Rechtskraft <strong>der</strong> Gesamtstrafenent-<br />
scheidung neu zu best<strong>im</strong>men. (3) Ist zum Zeitpunkt des Weglegens <strong>der</strong><br />
<strong>Akte</strong>n die in Abschnitt II best<strong>im</strong>mte - vom Tage <strong>der</strong> Rechtskraft an berech-<br />
nete - Frist für die Aufbewahrung des Schriftgutes bereits abgelaufen, o<strong>der</strong><br />
endet diese mit Ablauf des Jahres <strong>der</strong> Weglegung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> beiden darauf<br />
folgenden Jahre, so ist das Schriftgut vom Beginn des auf die Weglegung<br />
folgenden Jahres für 3 weitere Jahre aufzubewahren. Dies gilt nicht in den Fäl-<br />
len <strong>der</strong> Nrn. 46 a) und 628 a).<br />
7. (1) Die Aufbewahrungsfrist für das in Nr. 6 nicht genannte Schriftgut beginnt<br />
mit dem auf das Jahr <strong>der</strong> Weglegung folgenden Jahr, für Personalakten be-<br />
ginnt sie mit <strong>der</strong>en Abschluss.<br />
(2) Als Jahr <strong>der</strong> Weglegung gilt<br />
a) bei Prüfungsarbeiten und sonstigen Prüfungsunterlagen das Jahr, in<br />
dem die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling erfolgt ist, <strong>im</strong><br />
Falle <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>holungsprüfung das Jahr, in dem das Ergebnis <strong>der</strong> letzten<br />
Prüfung bekannt gegeben worden ist;<br />
b) bei Hinterlegungen das Jahr, in dem die Hinterlegung beendet worden<br />
ist o<strong>der</strong> die Fristen <strong>der</strong> §§ 19-22 HO abgelaufen sind;<br />
c) bei Büchern über Urkundenverwahrungen (Nr. 225) das Jahr, in dem alle<br />
darin verzeichnete Fälle erledigt sind;<br />
d) bei Gefangenenbüchern mit den dazugehörigen Gefangenenkarteien und<br />
bei den Listen über die den Gefangenen abgenommenen Gegenstände<br />
sowie bei Büchern und Nachweisen über die den Gefangenen<br />
abgenommenen Gel<strong>der</strong> das Jahr, in dem <strong>der</strong> Vollzug bezüglich aller darin<br />
aufgeführten Gefangenen beendet ist;<br />
e) für (Sammel)<strong>Akte</strong>n mit den Unterlagen über die Schöffenwahl,<br />
Schöffenauslosung und Schöffengeschäftsstelle (§ 1 Abs. 4 AktO) das Jahr<br />
des Ablaufs <strong>der</strong> jeweiligen Wahlperiode,<br />
f) für <strong>Akte</strong>n über sonstige Angelegenheiten, für die die Weglegung<br />
nicht durch beson<strong>der</strong>e Vorschrift geregelt ist, das Jahr, in dem die letzte<br />
Verfügung zur Sache ergangen ist.<br />
267
(3) Personalakten sind - soweit sich aus den landesspezifischen Regelun-<br />
gen nichts an<strong>der</strong>es ergibt - abgeschlossen,<br />
a) wenn die bzw. <strong>der</strong> Angestellte o<strong>der</strong> die Arbeiterin bzw. <strong>der</strong> Arbeiter<br />
- aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden ist, mit Ablauf des Jahres<br />
<strong>der</strong> Vollendung des 65. Lebensjahres,<br />
<strong>im</strong> Falle<br />
- <strong>der</strong> Weiterbeschäftigung über das 65. Lebensjahr hinaus mit Ablauf des<br />
Jahres, in dem das Beschäftigungsverhältnis endet,<br />
des vorherigen Todes mit Ablauf des Todesjahres;<br />
b) wenn die Notarin bzw. <strong>der</strong> Notar, die Notarassessorin bzw. <strong>der</strong> No-<br />
tarassessor, die Rechtsanwältin bzw. <strong>der</strong> Rechtsanwalt, <strong>der</strong> Rechts-<br />
beistand o<strong>der</strong> sonstige Inhaber einer Rechtsberatungserlaubnis<br />
- aus dem Amt bzw. dem Beruf ausgeschieden ist, mit Ablauf des Jah-<br />
res <strong>der</strong> Vollendung des 70. Lebensjahres,<br />
<strong>im</strong> Falle<br />
<strong>der</strong> Tätigkeit über das 70. Lebensjahr hinaus mit Ablauf des Jahres, in<br />
dem das Amts- o<strong>der</strong> Berufsverhältnis endet, des vorherigen Todes mit<br />
Ablauf des Todesjahres, einer notwendigen Abwicklung (§ 55 BRAO) nach<br />
<strong>der</strong>en Beendigung, einer Notariatsverweserschaft (§ 56 BNotO) nach <strong>der</strong>en<br />
Abwicklung;<br />
c) wenn es sich um eine juristische Person o<strong>der</strong> eine Personenverei-<br />
nigung handelt, mit Ablauf des Jahres, in dem die Löschung <strong>im</strong> Handelsregis-<br />
ter o<strong>der</strong><br />
Partnerschaftsregister eingetragen o<strong>der</strong> die Auseinan<strong>der</strong>setzung abge-<br />
schlossen ist.<br />
(4) Bei automationsunterstützter Schriftgutverwaltung kann abweichend<br />
von Absatz 1 Satz 1 die Aufbewahrungsfrist auch von einem früheren Zeit-<br />
punkt (z. B. vom Datum <strong>der</strong> Weglegungsverfügung) an berechnet werden. Die<br />
Entscheidung hierüber trifft die Behördenleitung. Entsprechendes gilt auch bei<br />
<strong>der</strong> automationsunterstützten Schriftgutverwaltung in Straf- und Bußgeldsa-<br />
chen.<br />
(5) Für Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften über<br />
Min<strong>der</strong>jährige sowie für die zur Zuständigkeit des Familiengerichts o<strong>der</strong><br />
des Vormundschaftsgerichts gehörenden Angelegenheiten sonstiger<br />
268
Fürsorge für ein unter elterlicher Sorge stehendes Kind beginnt die Auf-<br />
bewahrungsfrist abweichend von Absatz 1 Satz 1 mit dem Jahr, das auf das<br />
Jahr folgt, in dem das Kind - soweit mehrere Geschwister vorhanden sind,<br />
das jüngste an <strong>der</strong> Angelegenheit beteiligte Kind - volljährig geworden ist,<br />
auch wenn die Sache auf an<strong>der</strong>e Weise vorher geendet hat.<br />
(6) Wird ein Verfahren aufgenommen o<strong>der</strong> fortgesetzt, nachdem die<br />
<strong>Akte</strong>n bereits weggelegt sind (z. B. durch einen Antrag auf Wie<strong>der</strong>aufnah-<br />
me des Verfahrens), so beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem sie erneut<br />
weggelegt worden sind, eine neue Aufbewahrungsfrist.<br />
8. Für die Ablieferung von Schriftgut an die Staatsarchive gelten die<br />
dafür erlassenen beson<strong>der</strong>en Vorschriften.<br />
"Anmerkung: § 113f LBG Baden-Württemberg; Art. 1008 BayBG; § 56f LBG<br />
Berlin; § 63 LBG Bbg.; § 93h Bremisches Beamtengesetz/Richtlinien über<br />
die Erhebung und Führung von Personalaktendaten vom 25.05.1996<br />
(Bremisches Amtsblatt S. 433); § 96g LBG Hamburg; § 107f LBG Hessen; §<br />
106 LBG Mecklenburg-Vorpommern; VV zu § 101 NBG; § 102g LBG Nord-<br />
rhein-Westfalen; § 102f LBG Rheinland-Pfalz; § 108f Saarländisches Be-<br />
amtengesetz; § 123 LBG Sachsen; § 106h LBG Schleswig-Holstein; § 103 LBG<br />
Thüringen; § 90f BG LSA“<br />
b) Zu weiteren technischen Informationen zum Problem <strong>der</strong> Langzeitarchivierung<br />
siehe:<br />
http://www.idk.de/de/ecmbloq/2006/11 /14/digitale-langzeit-archivierunq-datenverschwinden-technik-veraltet/<br />
http://www.documanaqer.de/maqazin/artikel 993print langzeitarchivierunq<br />
haltbarkeit daten.html<br />
http://www.langzeitarchivierunq.de/presse#section 12<br />
c) http://kopal.langzeitarchivierung.de/index.php.de.<br />
269