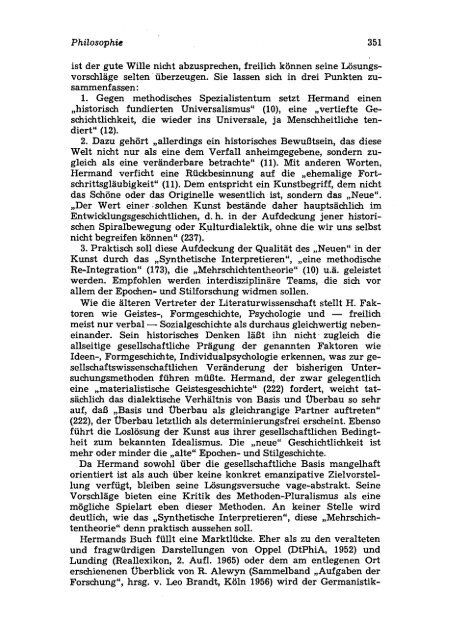Das Argument 72 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 72 - Berliner Institut für kritische Theorie eV Das Argument 72 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
350 Besprechungen Philosophie Hermand, Jost: S y n t h e t i s c h e s I n t e r p r e t i e r e n . Zur Methodik der Literaturwissenschaft. Sammlung dialog, Nr. 27. Nymphenburger Verlagshandlung, München 1968 (268 S., Pb., 14,80 DM). Teil I des Buches — „Der Methodenpluralismus seit 1900" — referiert (mit guter Quellenkenntnis der Zeit der Jahrhundertwende) die Richtungen des Positivismus, der Geistesgeschichte, der nationalvölkischen Spielart, der Psychoanalyse, der westlichen Soziologie und der marxistischen Literaturwissenschaft, des Existentialismus und der textimmanenten Methode. So informativ die Kapitel häufig zu lesen sind, so beziehungslos stehen die einzelnen Phasen der Wissenschaftsgeschichte für den Leser nebeneinander. Hermand unterläßt es durchweg — von bescheidenen Erklärungsansätzen abgesehen — die Methodenentwicklung in ihrer dialektischen Verflochtenheit mit dem gesamtgesellschaftlichen Prozeß der deutschen Geschichte vom Kaiserreich bis zum Adenauerstaat zu entfalten. Erst das Zusammensehen von ideologischer Entwicklung und sozioökonomischem Prozeß würde es ermöglichen, wissenschaftsgeschichtlich bedeutsame Phänomene wie die antihistorische Wendung, die Fortschrittsfeindschaft, den Irrationalismus, den Formalismus usw. zu verstehen. Da die gesellschaftspolitische Relevanz der einzelnen Forschungsrichtungen nicht erkannt wird, endet alles in einer Abnormitätenschau, was etwa den Vorteil hat, die faschistische Periode der Germanistik als unwissenschaftlich aus der Diskussion zu entfernen. So empfiehlt Hermand „diesen Bereich nicht als Literaturwissenschaft, sondern als völkischen Feuilletonismus zu bezeichnen" (79). Der heute im Westen herrschende Methoden-Pluralismus ist u.E. nach ohne theoretische Fundierung, die Auswahl und Kombination der Methoden bleiben dem persönlichen Gutdünken des einzelnen Forschers überlassen. Eine Kalkulation der möglichen Priorität einer Methode bzw. des Interdependenzverhältnisses der einzelnen methodischen Richtungen findet nicht statt, dafür herrscht Eklektizismus und Willkür. Die häufig nur rein verbale Rückkehr zur historischen Forschung hat sich nicht als Korrektur des Pluralismus erwiesen. Die Historismus-Problematik ist weiter ungeklärt. Hermand erkennt ein gut Teil des hier beschriebenen Dilemmas. Seinem Versuch im II. Teil des Buches — „Möglichkeiten einer Synthese" —
Philosophie 351 ist der gute Wille nicht abzusprechen, freilich können seine Lösungsvorschläge selten überzeugen. Sie lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: 1. Gegen methodisches Spezialistentum setzt Hermand einen „historisch fundierten Universalismus" (10), eine „vertiefte Geschichtlichkeit, die wieder ins Universale, ja Menschheitliche tendiert" (12). 2. Dazu gehört „allerdings ein historisches Bewußtsein, das diese Welt nicht nur als eine dem Verfall anheimgegebene, sondern zugleich als eine veränderbare betrachte" (11). Mit anderen Worten, Hermand verficht eine Rückbesinnung auf die „ehemalige Fortschrittsgläubigkeit" (11). Dem entspricht ein Kunstbegriff, dem nicht das Schöne oder das Originelle wesentlich ist, sondern das „Neue". „Der Wert einer solchen Kunst bestände daher hauptsächlich im Entwicklungsgeschichtlichen, d. h. in der Aufdeckung jener historischen Spiralbewegung oder Kulturdialektik, ohne die wir uns selbst nicht begreifen können" (237). 3. Praktisch soll diese Aufdeckung der Qualität des „Neuen" in der Kunst durch das „Synthetische Interpretieren", „eine methodische Re-Integration" (173), die „Mehrschichtentheorie" (10) u.ä. geleistet werden. Empfohlen werden interdisziplinäre Teams, die sich vor allem der Epochen- und Stilforschung widmen sollen. Wie die älteren Vertreter der Literaturwissenschaft stellt H. Faktoren wie Geistes-, Formgeschichte, Psychologie und — freilich meist nur verbal — Sozialgeschichte als durchaus gleichwertig nebeneinander. Sein historisches Denken läßt ihn nicht zugleich die allseitige gesellschaftliche Prägung der genannten Faktoren wie Ideen-, Formgeschichte, Individualpsychologie erkennen, was zur gesellschaftswissenschaftlichen Veränderung der bisherigen Untersuchungsmethoden führen müßte. Hermand, der zwar gelegentlich eine „materialistische Geistesgeschichte" (222) fordert, weicht tatsächlich das dialektische Verhältnis von Basis und Überbau so sehr auf, daß „Basis und Überbau als gleichrangige Partner auftreten" (222), der Überbau letztlich als determinierungsfrei erscheint. Ebenso führt die Loslösung der Kunst aus ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit zum bekannten Idealismus. Die „neue" Geschichtlichkeit ist mehr oder minder die „alte" Epochen- und Stilgeschichte. Da Hermand sowohl über die gesellschaftliche Basis mangelhaft orientiert ist als auch über keine konkret emanzipative Zielvorstellung verfügt, bleiben seine Lösungsversuche vage-abstrakt. Seine Vorschläge bieten eine Kritik des Methoden-Pluralismus als eine mögliche Spielart eben dieser Methoden. An keiner Stelle wird deutlich, wie das „Synthetische Interpretieren", diese „Mehrschichtentheorie" denn praktisch aussehen soll. Hermands Buch füllt eine Marktlücke. Eher als zu den veralteten und fragwürdigen Darstellungen von Oppel (DtPhiA, 1952) und Lunding (Reallexikon, 2. Aufl. 1965) oder dem am entlegenen Ort erschienenen Überblick von R. Alewyn (Sammelband „Aufgaben der Forschung", hrsg. v. Leo Brandt, Köln 1956) wird der Germanistik-
- Seite 96 und 97: 300 Michael Neriich Werkes bedeutun
- Seite 98 und 99: 302 Michael Neriich selbst schuld d
- Seite 100 und 101: 304 Michael Neriich aber hat Schalk
- Seite 102 und 103: 306 Michael Neriich hältnis von Li
- Seite 104 und 105: 308 Michael Neriich sehen Partei si
- Seite 106 und 107: 310 Michael Neriich „wenn sie ana
- Seite 108 und 109: 312 Michael Neriich Der Beitrag von
- Seite 110 und 111: 314 Dieter Richter Ansichten einer
- Seite 112 und 113: 316 Dieter Richter der Wettbewerbsf
- Seite 114 und 115: 318 Dieter Richter einen ideologisc
- Seite 116 und 117: 320 Dieter Richter Wissenschaft als
- Seite 118 und 119: 322 Dieter Richter Sprachanalysen d
- Seite 120 und 121: 324 Dieter Richter zieren. Insofern
- Seite 122 und 123: 326 Zur Diskussion gestellt: Peter
- Seite 124 und 125: 328 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 126 und 127: 330 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 128 und 129: 332 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 130 und 131: 334 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 132 und 133: 336 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 134 und 135: 338 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 136 und 137: 340 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 138 und 139: 342 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 140 und 141: 344 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 142 und 143: 346 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 144 und 145: 348 Peter Eisenberg und Hartmut Hab
- Seite 148 und 149: 352 Besprechungen Student zu Herman
- Seite 150 und 151: 354 Besprechungen verkehr von freie
- Seite 152 und 153: 356 Besprechungen Zeitraum so gewä
- Seite 154 und 155: 358 Besprechungen erlesener" (W. Ka
- Seite 156 und 157: 360 Besprechungen standene Gesellsc
- Seite 158 und 159: 362 Besprechungen (MEW 3, S. 553).
- Seite 160 und 161: 364 Besprechungen innerideologisch.
- Seite 162 und 163: 366 Besprechungen antizipierenden u
- Seite 164 und 165: 368 Besprechungen vidualität dysfu
- Seite 166 und 167: 370 Besprechungen lensprache", „
- Seite 168 und 169: 372 Besprechungen Badura, Bernhard:
- Seite 170 und 171: 374 Besprechungen als ein Moment op
- Seite 172 und 173: 376 Besprechungen Im einleitenden K
- Seite 174 und 175: 378 Besprechungen zeigen, „daß
- Seite 176 und 177: 380 Besprechungen Wissenschaftliche
- Seite 178 und 179: 382 Besprechungen Interessen des em
- Seite 180 und 181: 384 Besprechungen II. Weltkrieg sol
- Seite 182 und 183: 386 Besprechungen sehen Praxis das
- Seite 184 und 185: 388 Besprechungen adressen wird bei
- Seite 186 und 187: 390 Besprechungen Das Fazit seiner
- Seite 188 und 189: 392 Besprechungen Die eigentlich th
Philosophie 351<br />
ist der gute Wille nicht abzusprechen, freilich können seine Lösungsvorschläge<br />
selten überzeugen. Sie lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:<br />
1. Gegen methodisches Spezialistentum setzt Hermand einen<br />
„historisch fundierten Universalismus" (10), eine „vertiefte Geschichtlichkeit,<br />
die wieder ins Universale, ja Menschheitliche tendiert"<br />
(12).<br />
2. Dazu gehört „allerdings ein historisches Bewußtsein, das diese<br />
Welt nicht nur als eine dem Verfall anheimgegebene, sondern zugleich<br />
als eine veränderbare betrachte" (11). Mit anderen Worten,<br />
Hermand verficht eine Rückbesinnung auf die „ehemalige Fortschrittsgläubigkeit"<br />
(11). Dem entspricht ein Kunstbegriff, dem nicht<br />
das Schöne oder das Originelle wesentlich ist, sondern das „Neue".<br />
„Der Wert einer solchen Kunst bestände daher hauptsächlich im<br />
Entwicklungsgeschichtlichen, d. h. in der Aufdeckung jener historischen<br />
Spiralbewegung oder Kulturdialektik, ohne die wir uns selbst<br />
nicht begreifen können" (237).<br />
3. Praktisch soll diese Aufdeckung der Qualität des „Neuen" in der<br />
Kunst durch das „Synthetische Interpretieren", „eine methodische<br />
Re-Integration" (173), die „Mehrschichtentheorie" (10) u.ä. geleistet<br />
werden. Empfohlen werden interdisziplinäre Teams, die sich vor<br />
allem der Epochen- und Stilforschung widmen sollen.<br />
Wie die älteren Vertreter der Literaturwissenschaft stellt H. Faktoren<br />
wie Geistes-, Formgeschichte, Psychologie und — freilich<br />
meist nur verbal — Sozialgeschichte als durchaus gleichwertig nebeneinander.<br />
Sein historisches Denken läßt ihn nicht zugleich die<br />
allseitige gesellschaftliche Prägung der genannten Faktoren wie<br />
Ideen-, Formgeschichte, Individualpsychologie erkennen, was zur gesellschaftswissenschaftlichen<br />
Veränderung der bisherigen Untersuchungsmethoden<br />
führen müßte. Hermand, der zwar gelegentlich<br />
eine „materialistische Geistesgeschichte" (222) fordert, weicht tatsächlich<br />
das dialektische Verhältnis von Basis und Überbau so sehr<br />
auf, daß „Basis und Überbau als gleichrangige Partner auftreten"<br />
(222), der Überbau letztlich als determinierungsfrei erscheint. Ebenso<br />
führt die Loslösung der Kunst aus ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit<br />
zum bekannten Idealismus. Die „neue" Geschichtlichkeit ist<br />
mehr oder minder die „alte" Epochen- und Stilgeschichte.<br />
Da Hermand sowohl über die gesellschaftliche Basis mangelhaft<br />
orientiert ist als auch über keine konkret emanzipative Zielvorstellung<br />
verfügt, bleiben seine Lösungsversuche vage-abstrakt. Seine<br />
Vorschläge bieten eine Kritik des Methoden-Pluralismus als eine<br />
mögliche Spielart eben dieser Methoden. An keiner Stelle wird<br />
deutlich, wie das „Synthetische Interpretieren", diese „Mehrschichtentheorie"<br />
denn praktisch aussehen soll.<br />
Hermands Buch füllt eine Marktlücke. Eher als zu den veralteten<br />
und fragwürdigen Darstellungen von Oppel (DtPhiA, 1952) und<br />
Lunding (Reallexikon, 2. Aufl. 1965) oder dem am entlegenen Ort<br />
erschienenen Überblick von R. Alewyn (Sammelband „Aufgaben der<br />
Forschung", hrsg. v. Leo Brandt, Köln 1956) wird der Germanistik-