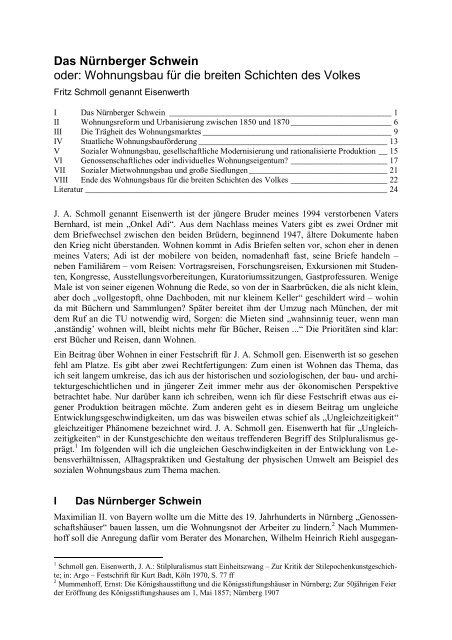Das Nürnberger Schwein oder: Wohnungsbau ... - Kunstlexikon Saar
Das Nürnberger Schwein oder: Wohnungsbau ... - Kunstlexikon Saar
Das Nürnberger Schwein oder: Wohnungsbau ... - Kunstlexikon Saar
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong><br />
<strong>oder</strong>: <strong>Wohnungsbau</strong> für die breiten Schichten des Volkes<br />
Fritz Schmoll genannt Eisenwerth<br />
I <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong> _____________________________________________________ 1<br />
II Wohnungsreform und Urbanisierung zwischen 1850 und 1870 ________________________ 6<br />
III Die Trägheit des Wohnungsmarktes _____________________________________________ 9<br />
IV Staatliche <strong>Wohnungsbau</strong>förderung _____________________________________________ 13<br />
V Sozialer <strong>Wohnungsbau</strong>, gesellschaftliche M<strong>oder</strong>nisierung und rationalisierte Produktion __ 15<br />
VI Genossenschaftliches <strong>oder</strong> individuelles Wohnungseigentum? _______________________ 17<br />
VII Sozialer Mietwohnungsbau und große Siedlungen _________________________________ 21<br />
VIII Ende des <strong>Wohnungsbau</strong>s für die breiten Schichten des Volkes _______________________ 22<br />
Literatur ________________________________________________________________________ 24<br />
J. A. Schmoll genannt Eisenwerth ist der jüngere Bruder meines 1994 verstorbenen Vaters<br />
Bernhard, ist mein „Onkel Adi“. Aus dem Nachlass meines Vaters gibt es zwei Ordner mit<br />
dem Briefwechsel zwischen den beiden Brüdern, beginnend 1947, ältere Dokumente haben<br />
den Krieg nicht überstanden. Wohnen kommt in Adis Briefen selten vor, schon eher in denen<br />
meines Vaters; Adi ist der mobilere von beiden, nomadenhaft fast, seine Briefe handeln –<br />
neben Familiärem – vom Reisen: Vortragsreisen, Forschungsreisen, Exkursionen mit Studenten,<br />
Kongresse, Ausstellungsvorbereitungen, Kuratoriumssitzungen, Gastprofessuren. Wenige<br />
Male ist von seiner eigenen Wohnung die Rede, so von der in <strong>Saar</strong>brücken, die als nicht klein,<br />
aber doch „vollgestopft, ohne Dachboden, mit nur kleinem Keller“ geschildert wird – wohin<br />
da mit Büchern und Sammlungen? Später bereitet ihm der Umzug nach München, der mit<br />
dem Ruf an die TU notwendig wird, Sorgen: die Mieten sind „wahnsinnig teuer, wenn man<br />
‚anständig’ wohnen will, bleibt nichts mehr für Bücher, Reisen ...“ Die Prioritäten sind klar:<br />
erst Bücher und Reisen, dann Wohnen.<br />
Ein Beitrag über Wohnen in einer Festschrift für J. A. Schmoll gen. Eisenwerth ist so gesehen<br />
fehl am Platze. Es gibt aber zwei Rechtfertigungen: Zum einen ist Wohnen das Thema, das<br />
ich seit langem umkreise, das ich aus der historischen und soziologischen, der bau- und architekturgeschichtlichen<br />
und in jüngerer Zeit immer mehr aus der ökonomischen Perspektive<br />
betrachtet habe. Nur darüber kann ich schreiben, wenn ich für diese Festschrift etwas aus eigener<br />
Produktion beitragen möchte. Zum anderen geht es in diesem Beitrag um ungleiche<br />
Entwicklungsgeschwindigkeiten, um das was bisweilen etwas schief als „Ungleichzeitigkeit“<br />
gleichzeitiger Phänomene bezeichnet wird. J. A. Schmoll gen. Eisenwerth hat für „Ungleichzeitigkeiten“<br />
in der Kunstgeschichte den weitaus treffenderen Begriff des Stilpluralismus geprägt.<br />
1 Im folgenden will ich die ungleichen Geschwindigkeiten in der Entwicklung von Lebensverhältnissen,<br />
Alltagspraktiken und Gestaltung der physischen Umwelt am Beispiel des<br />
sozialen <strong>Wohnungsbau</strong>s zum Thema machen.<br />
I <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong><br />
Maximilian II. von Bayern wollte um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Nürnberg „Genossenschaftshäuser“<br />
bauen lassen, um die Wohnungsnot der Arbeiter zu lindern. 2 Nach Mummenhoff<br />
soll die Anregung dafür vom Berater des Monarchen, Wilhelm Heinrich Riehl ausgegan-<br />
1 Schmoll gen. Eisenwerth, J. A.: Stilpluralismus statt Einheitszwang – Zur Kritik der Stilepochenkunstgeschichte;<br />
in: Argo – Festschrift für Kurt Badt, Köln 1970, S. 77 ff<br />
2 Mummenhoff, Ernst: Die Königshausstiftung und die Königsstiftungshäuser in Nürnberg; Zur 50jährigen Feier<br />
der Eröffnung des Königsstiftungshauses am 1, Mai 1857; Nürnberg 1907
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 2 / 24<br />
gen sein. Riehl war 1848 Mitglied des Paulskirchenparlaments und seit 1854 Professor für<br />
Staatswissenschaft in München, er gilt als einer der Väter der Sozialwissenschaften in<br />
Deutschland. Er sah in einer ständisch geordneten Gesellschaft und in funktionsfähigen Familien<br />
die wichtigsten Grundlagen politischer Stabilität, Riehl war ein Konservativer, ein kulturpessimistischer<br />
Stadtkritiker. Wahrscheinlich waren neben Riehls Initiative auch die Ergebnisse<br />
der hygienischen Untersuchungen von Pettenkofers über die Choleraepidemie des<br />
Jahres 1854 in München, die 1855 publiziert worden sind, ausschlaggebend, 3 denn von Pettenkofer<br />
hat sich (ähnlich wie Varrentrapp in Frankfurt a. M. und Virchow in Berlin) in der<br />
zweiten Hälfte des 19. Jhs. unermüdlich für Wohnungs- und Stadthygiene eingesetzt. Sein<br />
Bericht über die Münchener Epidemie hat weit über Bayern hinaus große Aufmerksamkeit<br />
erfahren, zumal die Cholera in Europa eine neue Seuche war, die erst im 19. Jahrhundert auftrat.<br />
Nürnberg, dessen wirtschaftliche Bedeutung im 18. Jahrhundert sehr zurückgegangen war,<br />
verlor mit dem Wiener Kongress seine Reichsunmittelbarkeit und wurde bayrisch. Danach<br />
erlebte die Stadt schon von den 1820er Jahren an einen frühindustriellen Aufschwung: neben<br />
den traditionellen Gewerbezweigen (Nahrungsmittel, Spielzeug, Holzwaren) spielten Metallverarbeitung,<br />
Tuchfabrikation, Chemie und Farbenfabrikation ein zunehmende Rolle. Frühe<br />
Industriestandorte entwickelten sich im Osten und Süden der alten Stadt sowie zwischen<br />
Nürnberg und Fürth. Nürnberg-Fürth war ja bekanntlich auch die erste deutsche Eisenbahnlinie<br />
(„Ludwigsbahn“ 1835). Von ca. 25.500 Einwohnern im Jahre 1806 wuchs Nürnberg auf<br />
ca. 44.500 im Jahre 1834 – schneller und früher als die meisten anderen deutschen Städte,<br />
relativ (nicht absolut) auch schneller als München. Nürnberg dürfte also keine zufällige, sondern<br />
eine wohlüberlegte Wahl für die königliche Initiative gewesen sein.<br />
Abb. 1 (Quelle: Mummenhoff, Ernst: Die Königshausstiftung und die Königsstiftungshäuser<br />
in Nürnberg; Zur 50jährigen Feier der Eröffnung des Königsstiftungshauses am 1, Mai 1857;<br />
Nürnberg 1907)<br />
Aber das <strong>Nürnberger</strong> Bürgertum war auch nach 1848 selbstbewusst, allzu großen Einfluss des<br />
Hofes mochte man nicht. Der Bürgermeister von Waechter versuchte, die königliche Initiative<br />
zu kanalisieren, indem er sich bemühte, eine bürgerliche Gesellschaft ins Leben zu rufen, die<br />
Arbeiterwohnungsbau betreiben sollte. Dieser erste Versuch schlug aber fehl, und es kam<br />
3 Pettenkofer, Max von: Untersuchungen und Beobachtungen über die Verbreitungsart der Cholera; München<br />
1855
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 3 / 24<br />
doch die „Königshausstiftung“ zustande, die 1855-57 das erste Stiftungshaus im Kartäusergarten<br />
(Grasergasse) baute. Es handelte sich also nicht um eine Genossenschaft, dennoch war<br />
weiterhin auch vom „Genossenschaftshaus“ die Rede.<br />
Abb. 2 (Quelle wie Abb. 1)<br />
Architekt des Königsstiftungshauses war Baurat Solger. Die zitierte Publikation von Mummenhoff<br />
zeigt auf dem Umschlag die Fassade des Hauses und innen den Grundriss eines Obergeschosses<br />
(Abb. 1, 2). Es handelt sich um ein viergeschossiges Gebäude, das aus drei<br />
zusammengekoppelten Zweispännern (zwei Wohnungen pro Treppenabsatz) besteht. An den<br />
Grundrissen fällt zweierlei auf.<br />
��Erstens, es sind unter den sechs Wohnungen pro Geschoss jeweils auch einige sehr große,<br />
groß zumindest, wenn man als Maßstab nicht bürgerliche Wohnformen nimmt, sondern<br />
das, was um die Mitte des 19. Jahrhunderts als wohnungsreformerische Forderung für angemessene<br />
Arbeiterwohnungen galt: Stube, Küche und zwei Kammern, um Eltern, männliche<br />
und weibliche Kinder jeweils in getrennten Schlafräumen unterzubringen – nur so<br />
konnte nach Auffassung der Wohnungsreformer Sitte und Anstand in die Arbeiterfamilien<br />
getragen werden.<br />
��Zweitens: die Grundrisse sind nicht sehr funktional; bereits 1847/48 hatte C. W. Hoffmann<br />
für die Berliner gemeinnützige Baugesellschaft voll ausgebildete Zweispännertypen<br />
entwickelt, bei denen es keine gefangenen Räume gab, sondern jeder Raum der Wohnung<br />
von einem kleinen Vorraum aus erschlossen ist – ein wohl durchdachter Grundrisstyp, der<br />
bis heute im innerstädtischen <strong>Wohnungsbau</strong> eine Rolle spielt (Abb. 3). Solgers Grundriss<br />
mit der durchgehenden Mittelwand und einer Raumfolge, die an Bürgerhäuser des 18.<br />
Jahrhunderts erinnert, bleibt dahinter zurück.<br />
<strong>Das</strong> Königsstiftungshaus wurde 1896 vom Germanischen Nationalmuseum aufgekauft und<br />
1899 abgerissen. Die Stiftung baute aus dem Verkaufserlös ein neues Haus, das ebenfalls<br />
Wohnungen der Größe von 37 m² bis zu 80 m² (!) enthielt.
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 4 / 24<br />
Abb. 3: C. W. Hoffmann, Typengrundriss für viergeschossige Zweispänner der Berliner gemeinnützigen<br />
Baugesellschaft (Quelle: StA Münster, Oberpräsidium Nr. 2512)<br />
Einige Jahre später führte die Initiative des <strong>Nürnberger</strong> Bürgermeisters von Waechter schließlich<br />
doch zur Gründung einer Baugesellschaft: 1862 wurde die „<strong>Nürnberger</strong> Wohnungsverein<br />
Actiengesellschaft“ gegründet. Gründungsmitglieder waren <strong>Nürnberger</strong> Unternehmer. Man<br />
ging die Sache systematisch an: Informationen über ähnliche Gründungen <strong>oder</strong> Initiativen aus<br />
Chemnitz, Dresden, Wien, Frankfurt und Berlin wurden gesammelt, im „<strong>Nürnberger</strong> Kurier“<br />
erschien eine sechsteilige Artikelserie „Die Wohnungsfrage“, aus der auch hervorgeht, dass<br />
die Berliner Gemeinnützige Baugesellschaft (gegründet 1847), das vom Prinzen Albert initiierte<br />
und finanzierte Modellhaus auf der Weltausstellung in London 1851 4 und die Cité Ouvrière<br />
in Mulhouse (Elsaß) den <strong>Nürnberger</strong> Gründern bekannt waren – das bedeutet: man bezog<br />
alle um 1860 verfügbaren, wichtigen praktischen Erfahrungen, Versuche und Gedanken<br />
zum Arbeiterwohnungsbau in die eigenen Überlegungen ein. 5<br />
Die Gesellschaft setzte in ihren Statuten die Gewinnausschüttung („Verzinsung des Actienkapitals“)<br />
auf 4% fest, bei günstiger Geschäftsentwicklung sollte die Ausschüttung auf bis zu<br />
5% angehoben werden können, aber nicht darüber hinaus. Eine Rücklage („Reservefonds“)<br />
4 <strong>Das</strong> Musterhaus des Prinzen Albert war auf der Grundlage von Musterentwürfen des Architekten Henry Roberts<br />
für die Londoner Weltausstellung 1851 errichtet worden (ders: H. R. H. Model Houses for Families, London<br />
1851); die Übersetzung der Publikation besorgte C. F. Busse als „Ausgeführte Familienhäuser für die Arbeitenden<br />
Klassen, Heft 1, Berlin 1852 (weitere Hefte folgten nicht)<br />
5 Stadtarchiv Nürnberg, Rep. E 6, Verein 201, Band 1; vgl. auch: Fritz Schmoll; Wohnungsnot und Wohnungsreform<br />
in Deutschland; Diss. Stuttgart 1979, S. 456 ff
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 5 / 24<br />
sollte aus Überschüssen, sonstigen Zuwendungen und einer bereits vorhandenen Stiftung eines<br />
Mitglieds gebildet werden. Die Miete sollte so kalkuliert werden, dass die normale Verzinsung<br />
sowie laufende Kosten und eine Instandhaltungsrücklage erwirtschaftet werden können.<br />
Abb. 4: Solger, Grundrisse zu den Häusern Flaschenhofgarten 17/19 (linke Bildhäflte) und 21<br />
(rechts) für den Wohnungsverein Nürnberg AG (Quelle: StadtA Nürnberg, Rep. E 6, Verein<br />
201, Bd. 1)<br />
Die <strong>Nürnberger</strong> Wohnungsverein AG baute 1862 drei Wohngebäude, zwei mit je 18 Wohnungen,<br />
davon eines im Flaschenhofgarten 17 – 21, das die Zeiten überdauert hat und 1974<br />
noch intakt und bewohnt war (seither habe ich nicht mehr überprüft, ob es noch steht), und<br />
eines mit wohl 36 Wohnungen in der Bauvereinstraße. Auch für diese Gebäude lieferte Baurat<br />
Solger die Entwürfe. Offenbar hatte er die Pläne von C. W. Hoffmann für die Berliner gemeinnützige<br />
Baugesellschaft inzwischen gründlich studiert, denn nunmehr plant er dreige-
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 6 / 24<br />
schossige Zweispänner, die in der Grundrissdisposition mit dem von C. W. Hoffmann entwickelten<br />
Typ so gut wie identisch sind (Abb. 4).<br />
Nicht nur die Architekten mussten sich mit der Frage auseinandersetzen, wie eine gute Arbeiterwohnung<br />
aussehen soll. Auch die Bewohner mussten sich mit der neuen – städtischen –<br />
Lebensweise auseinandersetzen. Arbeiterfamilien in den rasch wachsenden Städten des mittleren<br />
und späten 19. Jahrhunderts waren zu einem Teil Zuwanderer aus ländlichen Regionen,<br />
zu einem Teil rekrutierten sie sich aus der vorindustriellen städtischen Unterschicht, die im<br />
18. und frühen 19. Jahrhundert stetig angewachsen war. Ob aus ländlichen <strong>oder</strong> städtischen<br />
Verhältnissen kommend – Erfahrungen hatten sie damit, sich als Familien auf der Basis vorindustrieller<br />
Erwerbs- und Sozialstrukturen irgendwie durchzubringen. Erfahrungen mit einer<br />
städtischen Lebensweise, mit der Trennung von Wohnen und Arbeiten, mit einer weniger auf<br />
Subsistenzwirtschaft und Eigenproduktion und mehr auf Warenkonsum ausgerichteten Lebensweise<br />
hatten sie nicht. Die Grundlage, in der eigenen Hauswirtschaft einen Grossteil des<br />
alltäglichen Bedarfs selbst zu produzieren, war ihnen jedoch durch die städtische Wohnform<br />
genommen. <strong>Das</strong> wird am Beispiel einer Mieterfamilie der <strong>Nürnberger</strong> Wohnungsverein AG<br />
besonders plastisch: sehr zum Entsetzen des wohlmeinenden großbürgerlichen Vorstands der<br />
AG versuchten sie nämlich, auf dem Dachboden des dreigeschossigen Mietshauses, ein<br />
<strong>Schwein</strong> zu halten. 6 Ja, wo auch sonst? <strong>Das</strong> wird wohl ein Kündigungsgrund gewesen sein,<br />
denn die Hausordnung sah unter Ziff. 11 vor:<br />
„Untersagt sind alle Zänkereien im Hause, und alles unnütze Geräusch, Geschrei, dann alle<br />
lärmenden Spiele und lästiges Herumtreiben der Kinder, überhaupt alles, was die Ruhe und<br />
Ordnung der übrigen Hausbewohner stören <strong>oder</strong> dem Hause Schaden zufügen kann.“ 7<br />
II Wohnungsreform und Urbanisierung zwischen 1850 und 1870<br />
Nürnberg ist nicht die einzige Stadt, in der um 1850 erste Anstrengungen zur Verbesserung<br />
der Wohnungssituation der „arbeitenden Klassen“ unternommen wurden. <strong>Das</strong> Thema kam im<br />
Zuge der Industrialisierung in England, Frankreich, Belgien, der Schweiz und Deutschland<br />
um die Jahrhundertmitte auf. Charakteristisch ist die enge Verknüpfung der theoretischen<br />
Diskussion mit praktischen Versuchen. Nürnberg ist hierfür nur ein Beispiel.<br />
In den – vor 1870 noch wenigen – schnell wachsenden Städten war die soziale Lage der hereinströmenden<br />
Bevölkerung miserabel, das ist hinreichend dokumentiert und analysiert. Engels<br />
„Lage der Arbeitenden Klassen in England“ 8 ist nach wie vor ein überaus lesenswertes<br />
Dokument. In den Kategorien von Marx gedacht, ist dies eine Folge der Ausbeutung. Die industrielle<br />
Reservearmee der Arbeits-, Land- und Vermögenslosen hat nur die eigene Arbeitskraft<br />
zu verkaufen und muss den Lohn akzeptieren, den das Kapital bietet, und das hat um<br />
1850 zum anständigen Wohnen, Kleiden, Essen meist nicht gereicht. In den Kategorien der<br />
liberalen Ökonomie sind niedrige Löhne Voraussetzung für Investitionen und Investitionen<br />
Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand: nur was nicht konsumiert wird, kann investiert<br />
werden. Sowohl aus der einen wie aus der anderen Sicht wäre die Wohnungsfrage also eigentlich<br />
eine Lohnfrage. Aber zwischen den beiden Polen einer sozialistischen und einer rein<br />
wirtschaftsliberalen Position gab es eine Diskussion um Wohnungsreform, die die Wohnungsfrage<br />
als eigenes Feld der Fürsorge bzw. Sozialpolitik entdeckt und um die Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts wichtige grundlegende Gedanken zur Wohnungsreform entwickelt hat. Beherrschend<br />
ist in der damaligen Diskussion die Vorstellung, dass Wohnungsprobleme Ursache<br />
6 Sitta, Josef: Die Entwicklung der gemeinnützigen Bautätigkeit in Nürnberg von 1850 bis 1930; Wirtschaftswiss.<br />
Diplomarbeit Erlangen-Nürnberg 1965 (Typoskript vorh. in Stadtarchiv Nürnberg), S. 28<br />
7 Stadtarchiv Nürnberg, Rep. E 6, Verein 201, Band 1<br />
8 Leipzig 1845
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 7 / 24<br />
(und nicht etwa Folge) weiterer sozialer, ethischer und hygienisch-medizinischer Probleme<br />
sind. 9<br />
Zwischen 1842 und 1870 erschienen im deutschsprachigen Raum etwa 70 Beiträge zur „Arbeiterwohnungsfrage“,<br />
meist kleinere Einzelschriften <strong>oder</strong> Artikel in Fachzeitschriften, letztere<br />
vor allem im „Arbeiterfreund“ des Centralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden<br />
Klassen, 10 vereinzelt auch in Bau-Fachzeitschriften. Die Diskussion war verbunden mit praktischen<br />
Versuchen, vor allem durch Gründung von Baugesellschaften, vereinzelt auch durch<br />
Stiftungen, die Wohnungssituation der Arbeiter zu verbessern. Die Bewegung war getragen<br />
von bürgerlichen Kreisen. Die jeweiligen lokalen Initiatoren waren meist auch über die Diskussion<br />
anderwärts informiert, insbesondere die Beispiele aus London und Mulhouse waren<br />
wohl allgemein bekannt. Der erste und auch der zweite internationale Wohltätigkeitskongress<br />
in Brüssel (1856 und 1857) hatte jeweils auch dieses Thema auf der Tagesordnung, der internationale<br />
Gedankenaustausch zur Arbeiterwohnungsfrage fand also auch dort ein Forum.<br />
Innerhalb der Wohnungsreform-Diskussion gab es unterschiedliche Strömungen. Einer der<br />
frühesten und profiliertesten Autoren war der christlich-konservative Publizist Victor Aimé<br />
Huber, Professor für Literaturgeschichte in Berlin und Mitinitiator der Berliner gemeinnützigen<br />
Baugesellschaft. 11 In seinem Konzept verband sich Wohnungsreform als innere Kolonisation<br />
mit Vorstellungen von einer ständisch strukturierten Gesellschaft, deren Grundlage und<br />
Kernelement ethisch und ökonomisch intakte Familien sein sollten. Eine der Familie übergeordnete<br />
Struktureinheit war in Hubers Gesellschaftsmodell die Genossenschaft (vor allem im<br />
Konsum-, weniger im Produktionsbereich), die es den Familien ermöglichen und erleichtern<br />
sollte, durch gemeinschaftliche Selbsthilfe den Alltag zu meistern und den Lebensstandard<br />
allmählich zu erhöhen. Wohnungsreform verband sich bei Huber mit der Idee genossenschaftlich<br />
organisierter Arbeitersiedlungen am Rand <strong>oder</strong> im Umland der wachsenden Städte.<br />
Im Gegensatz zu Huber vertraten die Anhänger des Wirtschaftsliberalismus die Auffassung,<br />
dass der Markt die Wohnungsfrage entsprechend den Marktgesetzen lösen werde. Der 9.<br />
Kongress deutscher Volkswirte befand im Jahre 1867:<br />
„Die Wohnungsfrage in Städten kann nur gelöst werden, wenn es gelingt, die Herstellung der<br />
Wohngebäude, namentlich auch der kleinen und billigeren Wohnungen unter der Berücksichtigung<br />
der nothwendigen, abseiten des Staats festzustellenden Sanitäts-Bedingungen, nach<br />
Maaßgabe des Bedürfnisses durch die Privat-Spekulation zu beschaffen.“ 12<br />
Diese liberale Position differenziert sich bis Ende der 1860er Jahre in unterschiedliche Argumentationsstränge<br />
aus. Eine Fraktion, publizistisch angeführt von Julius Faucher, stellte die<br />
Rolle des Bodenmarktes in den Mittelpunkt und behauptete eine Monopolstellung der städtischen<br />
Grundbesitzer, die es ihnen ermögliche, Grundstückspreise und dadurch die Kosten des<br />
Wohnens hoch zu halten. Dieses Monopol sollte durch Ausdehnung der Städte in die Fläche<br />
aufgehoben werden und – für einen profilierten Wirtschaftsliberalen der Jahre um 1850 eine<br />
erstaunliche Forderung – durch ein staatliches Verbot von Mietskasernen in den neu zu erschließenden<br />
Stadterweiterungsgebieten. 13 Insofern war diese Fraktion ein Vorläufer der Bo-<br />
9<br />
Schmoll, Fritz: Wohnungsnot und Wohnungsreform, S. 96 ff<br />
10<br />
<strong>Das</strong> Organ des Centralvereins in Preußen für das Wohl der arbeitenden Klassen kam von 1852 bis 1860 unter<br />
dem Titel „Mitteilungen des Zentralvereins...“, von 1861 bis 1863 als „Zeitschrift des Zentralvereins ...“ und ab<br />
1863 als „Der Arbeiterfreund“ heraus und enthält zahlreiche Beiträge zu Wohnungsfragen.<br />
11<br />
Huber, Victor Aimé: Über innere Ansiedlung und Colonisation; in: Janus, Jg. 1846. Danach zahlreiche Schriften<br />
bis Ende der 1860er Jahre<br />
12<br />
Vierteljahresschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte, Bd. 19 (Jg. 5/1867) S. 122 ff<br />
13<br />
So: Faucher, Julius: Die Bewegung für Wohnungsreform, in: Vierteljahresschrift für Volkswirthschaft und<br />
Kulturgeschichte, , Jg. 1865/66. Ders.: Über Häuserbauunternehmung im Geiste der Zeit; das. Jg. 1869
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 8 / 24<br />
denreform-Bewegung, die um 1900 diese Argumentationslinie wieder aufnahm, dann angeführt<br />
von Rudolf Eberstadt mit zahlreichen Publikationen. 14<br />
Eine andere Fraktion stellte die genossenschaftliche Selbsthilfe in den Mittelpunkt: Wohnungssuchende<br />
sollten sich zu Baugenossenschaften (Spar- und Bauvereinen) zusammenschließen,<br />
durch kleine Sparbeiträge Eigenkapital ansammeln und davon Häuser bauen. Dabei<br />
folgten die meisten Anhänger dieser Richtung der Vorstellung von geschlossenen Siedlungen<br />
mit kleinen Häusern im Umland großer Städte, insoweit an die Gedanken von V. A. Huber<br />
anknüpfend. Die Genossenschaften sollten fertiggestellte Häuser den Mitgliedern übergeben,<br />
die sie nach und nach abbezahlen sollten. 15<br />
Die Wohnungsreformdiskussion reflektiert die räumlichen und sozialen Erscheinungen der<br />
frühen Urbanisierung. Vor 1870 war der Wohnungsmarkt in Deutschland wenig entwickelt,<br />
Wohnen zur Miete konnte noch kein funktionierendes Versorgungsmodell sein. Selbst höhere<br />
Löhne hätten den Arbeitern zunächst kaum die Möglichkeit eröffnet, bessere und größere<br />
Wohnungen zu konsumieren, denn diese waren kaum vorhanden. Zwar gab es schon vor dem<br />
19. Jahrhundert in den Städten auch Mietwohnungen, in einzelnen Städten waren bis zur Hälfte<br />
der Wohnungen nicht vom Eigentümer, sondern von Mietern bewohnt. Insbesondere Gruppen,<br />
die nicht als selbstständige Handwerker und Händler im eigenen Haus eine eigene Wirtschaft<br />
betrieben, wohnten zur Miete. Schon seit dem 18. Jahrhundert und bis zur Einführung<br />
der Gewerbefreiheit war diese Gruppe ständig gewachsen. Daneben gab es auch Adelige, Militärs<br />
und Beamte, die ihre Stadtwohnung mieteten. Kleine, billige Mietwohnungen für die<br />
Versorgung der sehr schnell anwachsenden Arbeiter- und Unterschichten waren bis gegen<br />
1870 eher ein „Abfallprodukt“ des bürgerlichen Wohnhausbaus: in Kellern, Dachböden, Hinterhäusern,<br />
in Räumen innerhalb der Wohnung anderer Familien (als „Aftermieter“) <strong>oder</strong><br />
ganz ohne Anspruch auf einen eigenen Raum (als „Schlafgänger“) musste sich mit Wohnraum<br />
versorgen, wer auf der Suche nach Lohnarbeit in die Stadt zog. So verdichtete sich die<br />
Bebauung in früh industrialisierten Städten das ganze 19. Jahrhundert über durch Anbau, Aufstockung<br />
und Bebauung von Hofflächen.<br />
Demgegenüber mussten Industrieunternehmer, die „auf der grünen Wiese“ neue Standorte<br />
entwickelten, auch für den <strong>Wohnungsbau</strong> selber sorgen – insbesondere in der standortgebundenen<br />
Bergbau- und Hüttenindustrie bildete sich früh der Werkswohnungsbau heraus. Als<br />
älteste deutsche Werkssiedlung, die im Zuge der Industrialisierung errichtet wurde, gilt gemeinhin<br />
die Siedlung „Eisenheim“ der Gute-Hoffnungs-Hütte in Oberhausen (ab 1846). Aber<br />
auch andernorts entstanden früh Werkswohnungen. Bisweilen lässt sich eine kontinuierliche<br />
Entwicklung nachzeichnen von der merkantilistischen Ansiedlungspolitik des 18. Jhs. zum<br />
Werkswohnungsbau des 19. Jhs.. So etwa im Finowtal nahe Eberswalde (Preußen) nordöstlich<br />
von Berlin, wo zusammen mit einem Messingwerk von der Kriegs- und Domänenkammer,<br />
also vom preußischen Fiskus, von der 30er Jahren des 18. Jhs. an Arbeiter- und „Officianten“-Häuser<br />
gebaut wurden, die den Kern einer bis in die 20er Jahre des 20. Jhs. ständig<br />
erweiterten Siedlung bildeten. 16<br />
Wo in der ersten Hälfte des 19. Jhs. vereinzelt doch städtische Mietwohngebäude errichtet<br />
wurden, waren sie bekannt und berüchtigt: etwa die „Wülknitz’schen Familienhäuser“ in der<br />
Rosenthaler Vorstadt in Berlin – dort hat der Kammerherr von Wülcknitz, märkischer Gutsbesitzer,<br />
schon um 1825 sechs mehrgeschossige Miethäuser errichten lassen, die insgesamt<br />
ungefähr 425 einzelne Stuben enthielten, jede als Wohnung für eine Familie gedacht und auch<br />
14<br />
Eberstadt, Rudolf: Städtische Bodenfrage, Berlin 1894 und danach zahlreiche weitere Beiträge<br />
15<br />
Ein prominenter Vertreter dieser Richtung ist: Sax, Emil: Die Wohnungszustände der arbeitenden Klassen und<br />
ihre Reform, Wien 1869<br />
16<br />
Vgl. Seifert/Bodenschatz/Lorenz, <strong>Das</strong> Finowtal im Barnim, Berlin 2000, S. 17
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 9 / 24<br />
so vermietet. Bettine von Arnim hat in ihrem „Dies Buch gehört dem König“ 17 einen Anhang<br />
beigefügt („Bericht eines jungen Schweizers aus dem Vogtlande“) in dem die erbärmlichen<br />
Zustände in diesen Familienhäusern beschrieben sind. Es hat sich nach der Rekonstruktion<br />
von Geist/Kürvers um langgestreckte Gebäude mit drei Haupt- und ein bis zwei Dachgeschossen<br />
gehandelt, in denen beidseits eines Mittelgangs die Stuben angeordnet waren. 18<br />
Die Wohnungsreformer beschränkten sich nicht auf theoretische Diskussionen. Zwischen<br />
1840 und 1870 gab es in 26 deutschen Städten Gründungen von gemeinnützigen Baugesellschaften<br />
und ähnlichen Unternehmungen. Nicht alle gegründeten Unternehmen, aber viele<br />
von ihnen bauten tatsächlich auch einige Wohnungen. Die Gründungen erfolgten in der Regel<br />
durch die lokalen Honoratioren – Intellektuelle und Industrielle – bisweilen hat sich das jeweilige<br />
Herrscherhaus engagiert, wie in Bayern <strong>oder</strong> Preußen. Gemeinnützig waren die Baugesellschaften<br />
insofern, als die Ausschüttung auf das gezeichnete Kapital (der meist in der<br />
Rechtsform der AG gegründeten Unternehmen) auf 4% begrenzt war (in Nürnberg auf 5% -<br />
aber das wurde nie erreicht). Die begrenzte Gewinnausschüttung ist eines der Leitmotive der<br />
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, sie zieht sich von der ersten derartigen Gründung (Berlin<br />
1847) bis zum 1990 aufgehobenen Gesetz über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen<br />
hindurch.<br />
Hinter dem Konzept der Gemeinnützigkeit durch Gewinnausschüttungs-Beschränkung steht<br />
die Vorstellung eines Kompromisses zwischen zwei doch unvereinbaren Zielen: Die Gewinnausschüttung<br />
sollte einerseits genug Anreiz bieten, privates Kapital in den Arbeiterwohnungsbau<br />
(<strong>oder</strong> in der jüngeren Diktion des Zweiten <strong>Wohnungsbau</strong>gesetzes der alten Bundesrepublik<br />
aus dem Jahre 1956: in den „<strong>Wohnungsbau</strong> für die breiten Schichten des Volkes“ 19 )<br />
zu lenken. Die Begrenzung auf 4% sollte andrerseits günstige Mieten garantieren. Ohne staatliche<br />
Subventionen wurden aber beide Ziele verfehlt: 4% waren zu niedrig, um mit rentablen<br />
Investitionsmöglichkeiten zu konkurrieren, aber zu hoch, um niedrige Mieten zu sichern.<br />
J. A. Romberg, Herausgeber der „Zeitschrift für praktische Baukunst“, neben C. W. Hoffmann<br />
einer der wenigen Architekten, die sich in der Wohnungsreform-Bewegung engagierten,<br />
durchschaute dieses ökonomische Dilemma. Mit seiner kritischen Haltung war er aber um<br />
die Mitte des 19. Jahrhunderts noch völlig isoliert, erst kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert<br />
setzte sich die Ansicht, dass der Staat mit Subventionen den Massenwohnungsbau fördern<br />
sollte, zunächst einmal in der theoretischen Literatur durch. Romberg schreibt schon<br />
1845, also noch im Vormärz:<br />
„Es giebt in unserer Zeit wenig reiche Leute, welche für solchen wohlthätigen Zweck ein bedeutendes<br />
Capital opfern. Wenn aber dasselbe nicht geopfert, sondern verzinst werden soll,<br />
so fällt jeder Vortheil für das Gemeinwohl weg. Es ist durchaus nicht wahr, dass für die untern<br />
Klassen in größeren Städten, wo der Grund und Boden gekauft werden muß, von einem<br />
Privatmanne Wohnungen erbaut werden können, die zu billigem Zins abzugeben seien, und<br />
jede Berechnung der Art ist entweder Selbsttäuschung <strong>oder</strong> eine Täuschung Anderer.“ 20<br />
Ã<br />
III Die Trägheit des Wohnungsmarktes<br />
<strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong> auf dem Dachboden zeigt exemplarisch: es gibt Entwicklungsphasen,<br />
in denen sich Lebensbedingungen und Alltagspraxis mit unterschiedlicher Geschwindigkeit<br />
entwickeln. Tradierte Praktiken sind den veränderten Bedingungen nicht mehr angemes-<br />
17<br />
Berlin 1843<br />
18<br />
Geist, Johann Friedrich und Klaus Kürvers: <strong>Das</strong> Berliner Mietshaus, Bd. I 1740 – 1862, München 1980<br />
19<br />
II. WoBauG (1956) § 1<br />
20<br />
Romberg, J. A.: Über den Mangel an kleinen Wohnungen in unseren Städten; in: Zeitschrift für praktische<br />
Baukunst, Jg. 5/1845, S. 298
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 10 /<br />
24<br />
sen, das Alte reibt sich am Neuen. Auch die Wohnungsreformbewegung des 19. Jhs. ist insgesamt<br />
Ausdruck unterschiedlicher Entwicklungsgeschwindigkeiten: der <strong>Wohnungsbau</strong> bleibt<br />
qualitativ und vor allem quantitativ hinter dem schnell steigenden Bedarf an Wohnraum in<br />
den wachsenden Städten zurück. Weder von der liberalen Position aus, die eine Lösung durch<br />
den Markt beschwor, noch von der sozialistischen Position aus, die die Wohnungsfrage als<br />
Nebenwiderspruch des antagonistischen Verhältnisses von Kapital und Arbeit definierte,<br />
konnte die Ökonomie des Wohnungsmarktes und des <strong>Wohnungsbau</strong>s begriffen werden.<br />
Ökonomisch betrachtet sind Mietwohngebäude Sachkapital. <strong>Das</strong> in Wohngebäuden gebundene<br />
Kapital gibt über lange Zeiträume Nutzungen ab: ein Haus kann man hundert Jahre <strong>oder</strong><br />
länger bewohnen. Dementsprechend besteht nur ein kleiner Teil des Wohnungsangebots aus<br />
neu errichteten Gebäuden, der Wohnungsmarkt ist ein Bestandsmarkt, das Angebot ist nahezu<br />
starr, für eine rasch steigende Nachfrage steht nicht sofort ein entsprechend größeres Angebot<br />
zur Verfügung. Vielmehr passt sich das Angebot nur langsam an eine gestiegene Nachfrage<br />
an, die Angebotsfunktion reagiert unelastisch auf Nachfrageveränderungen.<br />
Die unelastische Reaktion des Wohnungsangebots hat Folgen: bei steigender Nachfrage wird<br />
zunächst der vorhandene Wohnraum intensiver genutzt, und die Mieten (Preise) steigen über<br />
einen theoretisch gedachten „Gleichgewichtspreis“ hinaus. Intensivere Nutzung des Wohnungsbestands<br />
heißt: überbelegte Wohnungen, Nutzung von Kellerräumen, Nebengelassen<br />
und Dachböden als Wohnung, eben die Erscheinungen, die die Wohnungsreformer um 1850<br />
beobachteten.<br />
Wie lange es dauert, bis aus einer gestiegenen Einwohnerzahl eine steigende Wohnungsnachfrage<br />
und aus steigender Wohnungsnachfrage eine rege Bautätigkeit entsteht, hängt von vielen<br />
Faktoren ab und kann nicht allgemeingültig beantwortet werden. Zunächst spielt natürlich<br />
Zahlungsfähigkeit, also die oben angesprochene Lohnfrage eine Rolle, die vom wirtschaftlichen<br />
Wachstum abhängt und natürlich auch davon, wie sich das (im Falle von Wachstum)<br />
größer werdende Sozialprodukt auf Investitionen und Konsum verteilt und wie gewachsene<br />
Konsummöglichkeiten sozial verteilt sind. Die Realeinkommen der breiten Schichten sind<br />
wohl erst nach 1870 gestiegen, erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten Lohnabhängige<br />
vermehrt die Freiheit, zu entscheiden, welchen Anteil des gestiegenen Einkommens sie auf<br />
Wohnen und andere Konsumgüter verteilen.<br />
Die Frage des Anteils der Miete an den Konsumausgaben hat die Zeitgenossen sehr beschäftigt,<br />
seit Hermann Schwabe 1868 seine Ergebnisse einer statistischen Analyse der Konsumausgaben<br />
der Berliner Steuerpflichtigen und der Berliner Kommunalbeamten veröffentlicht<br />
hat. 21 Anhand beider Datenreihen hat Schwabe einen Zusammenhang entdeckt, den zuvor der<br />
Leipziger Statistiker Engel schon für die Nahrungsmittel-Ausgaben belegt hat und der danach<br />
vielfach diskutiert und überprüft wurde. Heute gilt das „Schwabe’sche Gesetz“ als allgemeine<br />
Tendenz des Konsumverhaltens von Haushalten und verursacht keinerlei Aufregung mehr: je<br />
höher das Einkommen, um so geringer der Anteil, der für lebensnotwendige Güter ausgegeben<br />
wird. Wohnen gehört zum Lebensnotwendigen, mit sinkendem Einkommen steigt der<br />
Anteil der Mietausgaben am gesamten verfügbaren Einkommen. Schwabe formuliert: „Je<br />
ärmer jemand ist, einen desto größeren Theil seines Einkommens muß er für Wohnung verausgaben.“<br />
Selbstverständlich ist dieser Zusammenhang kulturell überformt: in verschiedenen<br />
Kulturen, Subkulturen, Schichten und Regionen ist der Anteil der Wohnausgaben am Haushaltsbudget<br />
unterschiedlich.<br />
<strong>Das</strong> Verhältnis der Veränderungsrate (beispielsweise in Prozent) der Mietausgaben zur Veränderungsrate<br />
des Einkommens nennt man Einkommenselastizität der Miete. Eine Elastizität<br />
21 Schwabe, Hermann: <strong>Das</strong> Verhältnis von Miethe und Einkommen in Berlin; in: Berlin und seine Entwicklung –<br />
Gemeinde-Kalender und städtisches Jahrbuch für 1868
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 11 /<br />
24<br />
größer 1 bedeutet, dass bei steigendem Einkommen ein größerer Teil des Zuwachses für eine<br />
höhere Miete, also für mehr <strong>oder</strong> besseren Wohnraum ausgegeben wird. Bei einer Elastizität<br />
gleich 1 ändert sich das Verhältnis Mietausgaben zu gesamten Konsumausgaben nicht, wenn<br />
das Einkommen steigt. Bei einer Elastizität kleiner 1 wird vom Zuwachs weniger für zusätzlichen<br />
Wohnkonsum ausgegeben, aber immer noch steigt der Wohnkonsum mit steigendem<br />
Einkommen, nur eben unterproportional. Die Einkommenselastizität bestimmter Konsumausgaben<br />
gilt als Hinweis auf die Konsumpräferenzen der Haushalte: Güter, bei denen die Einkommenselastizität<br />
hoch ist, sind dem Haushalt wichtig, es sind superiore Güter, beispielsweise<br />
Luxusgüter; Güter, bei denen die Einkommenselastizität niedrig ist, sind inferiore, notwendige<br />
Güter. Je geringer die Einkommenselastizität, um so ausgeprägter ist die Sättigung.<br />
Auch negative Einkommenselastizitäten (bei steigendem Einkommen gibt der Haushalt absolut<br />
weniger für ein bestimmtes Gut aus) kommen vor: absolut inferiore Güter werden mit steigendem<br />
Einkommen durch höherwertige ersetzt bzw. ganz aus dem Konsumplan gestrichen.<br />
Einkommenselastizitäten nahe Null sind also ein Hinweis auf Sättigungstendenzen für ein<br />
bestimmtes Gut bei einem bestimmten Haushaltstyp. Anhand der Schwabe’schen Datenreihen<br />
wurden Einkommenselastizitäten errechnet. Es ist ein wenig erstaunliches Ergebnis, dass die<br />
Einkommenselastizität der Wohnungsmiete mit steigendem Einkommen abnimmt: je reicher<br />
ein Haushalt, um so mehr rückt das Wohnen vom Bereich der luxuriösen in den Bereich der<br />
notwendigen (inferioren) Güter. 22<br />
Hohe Einkommenselastizitäten der Mietausgaben bei den ärmeren städtischen Haushalten,<br />
wie sie anhand der Schwabe’schen Daten für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts belegt<br />
sind, bedeuten also, dass die Nachfrage nach Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen<br />
noch bei weitem nicht gesättigt war. Wie auch, angesichts der oben geschilderten<br />
Wohnverhältnisse?<br />
Nicht die Zahl der Einwohner <strong>oder</strong> die Zahl der Haushalte ohne Wohnung sondern steigende<br />
Realeinkommen und eine positive Einkommenselastizität der Wohnausgaben waren also die<br />
Voraussetzungen dafür, dass eine steigende, zahlungskräftige Nachfrage nach kleineren Wohnungen<br />
in den wachsenden Städten entstehen konnte. Ohne diese Voraussetzung war eine<br />
„Lösung der Wohnungsfrage durch die Privatspekulation“ nicht möglich. Dies wurde von den<br />
liberalen Wohnungsreformern jedoch nicht thematisiert, vielmehr wurde das „Schwabe’sche<br />
Gesetz“ als Ausdruck der Unfähigkeit der ärmerem Schichten interpretiert, den Wert des<br />
Wohnens richtig zu schätzen. Erst nach 1870 setzte eine bedeutende Steigerung der Reallöhne<br />
ein: zwischen 1871 und 1914 haben sich diese nahezu verdoppelt. 23 Erst mit steigenden Realeinkommen<br />
war eine Bedingung für eine rege Bautätigkeit erfüllt .<br />
Eine gestiegene, zahlungskräftige Nachfrage ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende<br />
Bedingung für ein steigendes Wohnungsangebot. Vielmehr muss die gestiegene Nachfrage<br />
von potentiellen Bauherren als anhaltend eingeschätzt werden. Die lange Lebensdauer von<br />
Wohngebäuden – ökonomisch: die lange Kapitalbindung – führt dazu, dass nicht in erster<br />
Linie die jeweils aktuelle Nachfragesituation entscheidend ist, sondern die erwartete künftige<br />
Entwicklung. Erst wenn die Investition in Grundstück und Wohngebäude eine Kapitalrentabilität<br />
verspricht, die mit anderen Investitionsmöglichkeiten gleichzieht, wird privates Kapital in<br />
nennenswertem Umfang in den Bau von Mietwohnungen für eine anonyme Nachfrage strömen.<br />
Der Mietwohnungsbau war von Anfang an durch einen hohen Anteil an Fremdmittelfinanzierung<br />
gekennzeichnet, für die Mitte des 19. Jahrhunderts wird von Fremdkapitalquoten von 2/3<br />
22 Asta Hampe, 1958, zitiert nach Jenkis: <strong>Das</strong> Schwabe’sche Gesetz und die Lütge’sche Regel; in: Jenkis (Hg):<br />
Kompendium der Wohnungswirtschaft, München 3 S. 361 ff<br />
23 Kaschuba, Wolfgang, Lebenswelt und Kultur der unterbürgerlichen Schichten im 19. und 20. Jahrhundert,<br />
München 1990, S. 34
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 12 /<br />
24<br />
berichtet. Darlehen für den <strong>Wohnungsbau</strong> wurden bis zur Reichsgründung überwiegend von<br />
Privaten gewährt. Meist handelte es sich um hypothekarisch besicherte Kredite, die nicht regelmäßig<br />
getilgt, sondern am Ende der vereinbarten Laufzeit in einem Betrag voll zurückgezahlt<br />
wurden. Hypothekenbanken entstanden (nach dem Vorläufer der 1769 gegründeten<br />
Schlesischen „Landschaften“, die Agrarkredite bereitstellten) ab 1835 (Bayerische Hypotheken-<br />
und Wechselbank, München), vermehrt ab 1867, zunächst allerdings ebenfalls spezialisiert<br />
auf landwirtschaftliche Kredite. Hypothekenordnungen, wie die preußische von 1872<br />
liberalisierten den Pfandbrief- und Darlehensmarkt, so dass die Banken sich über die Emission<br />
von Pfandbriefen refinanzieren und ihr Angebot an Darlehen rasch ausdehnen konnten.<br />
Die Ausleihungen wuchsen von 0,17 Mrd Mark im Jahre 1870 auf ca. 10 Mrd Mark im Jahre<br />
1900. 24 Den Ausleihungen entspricht ein gleiches Wachstum der Pfandbriefemissionen: im<br />
Zuge der Industrialisierung und insbesondere im Gründerjahre-Boom wurden private Ersparnisse<br />
in großem Umfang in Pfandbriefen angelegt.<br />
Neben steigender, zahlungskräftiger Nachfrage und einem funktionierenden, liquiden Kapitalmarkt<br />
bedarf es eines ausreichenden Angebots an erschlossenen, bebaubaren Grundstücken,<br />
damit Wohnungen entstehen können. Die kommerzielle Erschließung von Bauland besorgten<br />
zunehmend „Terraingesellschaften“, die im Einzugsbereich wachsender Städte von den 60er<br />
Jahren des 19. Jhs. an entstanden. Bekannt wurde in Deutschland J. A. W. Carstenn durch<br />
seine Projekte in Wandsbek bei Hamburg, später in Lichterfelde bei Berlin (ab 1866). Terraingesellschaften<br />
kauften agrarisch genutztes Land auf, sorgten für die Erschließung, parzellierten<br />
das Gelände und verkauften die so geschaffenen Grundstücke zur Bebauung weiter.<br />
Diese ersten Projekte waren zunächst für den Villenbau konzipiert, später aber wurden Stadterweiterungsgebiete<br />
auf diese Weise auch für den Mietshausbau erschlossen. Die Errichtung<br />
der Gebäude selber wurde überwiegend von mittelständischen Bauhandwerkern organisiert<br />
und häufig auch – bis zum Verkauf – vorfinanziert. Der Bauunternehmer des 19. Jahrhunderts<br />
war in vielen Fällen Architekt, Bauausführender und Bauträger zugleich. Die Entwürfe wurden<br />
– sofern es sich um innerstädtische Mietshäuser handelte – von den Baumeistern und nur<br />
selten von Architekten angefertigt. Käufer der bebauten Mietwohngrundstücke, das heißt Anbieter<br />
von Mietwohnungen, waren vielfach mittelständische Handwerker, kleine Unternehmer<br />
und Händler, die das „Zinshaus“ als Kapitalanlageobjekt und Alterssicherung erwarben.<br />
Es kamen also mehrere Faktoren zusammen, die dazu geführt haben, dass sich ab 1870 eine<br />
rege Bautätigkeit in vielen Städten entwickelte:<br />
��die zahlungskräftige Nachfrage nach Wohnungen war aufgrund gewachsener Realeinkommen<br />
auch breiterer Schichten gestiegen,<br />
��für die Erschließung von Bauland hatten sich mit den Terraingesellschaften kommerzielle<br />
Strukturen herausgebildet,<br />
��zunehmende Ersparnisse mittlerer Schichten wurden in Pfandbriefen angelegt und dienten<br />
der Refinanzierung der Baukredite<br />
��ein entwickeltes Hypothekenbanksystem organisierte dieses Geschäft indem diese Einlagen<br />
gesammelt und in Baudarlehen umgewandelt wurden.<br />
Auf dieser Grundlage entfaltete sich zwischen 1870 und dem ersten Weltkrieg in den Städten<br />
jene Bautätigkeit, deren Hinterlassenschaft wir heute noch als Mietskasernengürtel bzw.<br />
Gründerzeitviertel ringförmig um den vorindustriellen Stadtkern fast aller deutscher Städte<br />
vorfinden. Zwar reichte die Bautätigkeit wohl lediglich dazu aus, die Wohnungsversorgung<br />
der Arbeiter und städtischen Unterschichten qualitativ ein wenig zu verbessern; zumindest<br />
scheint der Indikator „Wohndichte“ (heizbare Zimmer pro Person) auf eine Verbesserung<br />
24 Goedecke, Wolfgang / Kerl, Volkher / Scholz, Helmut, Die deutschen Hypothekenbanken, Frankfurt a. M.<br />
1997, S. 38 f
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 13 /<br />
24<br />
hinzudeuten – er ging im Kaiserreich wohl ein wenig zurück 25 . Bereits das aber ist bemerkenswert,<br />
denn die Jahre zwischen 1870 und 1910 sind zugleich der Zeitraum der größten<br />
Zunahme der städtischen Bevölkerung in der deutschen Geschichte überhaupt. 26<br />
Die Entwicklung zwischen 1871 und 1914 erfolgte allerdings nicht kontinuierlich sondern in<br />
konjunkturellen Schüben, insbesondere konzentrierte sich die Bautätigkeit auf die Gründerjahre<br />
1871 – 1873 und die Zeit zwischen 1895 und 1910, unterbrochen durch kleinere Krisen.<br />
Der <strong>Wohnungsbau</strong> ist ein Nachzügler der Konjunktur. Im Aufschwung werden für die steigende<br />
industrielle Produktion zunächst mehr Arbeitskräfte nachgefragt, es kommt zur Zuwanderung<br />
in die Städte, die Wohnungsnachfrage nimmt zu. Zugleich steigen die Gewinnaussichten<br />
in der Industrie, die Kapitalanlage in den <strong>Wohnungsbau</strong> erscheint demgegenüber zunächst<br />
weniger attraktiv, der <strong>Wohnungsbau</strong> kommt noch nicht in Schwung. Erst wenn die<br />
gestiegene Nachfrage sich in steigenden Mieten niederschlägt, entscheiden sich mehr Investoren<br />
für den <strong>Wohnungsbau</strong>. Zwischen Investitionsentscheidung und Fertigstellung der Wohnung,<br />
das heißt marktwirksamem Angebot vergehen mehrere Jahre – das ist heute nicht anders,<br />
als im 19. und 20. Jh.. Je nach Länge des Konjunkturzyklus ist dann bereits der Abschwung<br />
<strong>oder</strong> die Talsohle erreicht, die fertiggestellten Wohnungen werden nicht mehr alle zu<br />
den ursprünglich kalkulierten Mieten abgenommen, es kommt zu Insolvenzen, Zwangsversteigerungen<br />
und Unternehmenszusammenbrüchen in der Bau- und Wohnungswirtschaft.<br />
IV Staatliche <strong>Wohnungsbau</strong>förderung<br />
Der Ruf nach staatlicher Intervention zur Beseitigung der Wohnungsnot kam schon um 1870<br />
auf, es dauerte aber noch fast zwei Generationen und bedurfte der Umwälzungen während<br />
und nach dem ersten Weltkrieg, ehe eine <strong>Wohnungsbau</strong>förderung aus Mitteln des staatlichen<br />
Haushalts etabliert wurde. In der preußischen Bürokratie wurde schon seit 1891 an einem<br />
Entwurf zu einem Wohnungsgesetz gearbeitet, das erst 1918 verabschiedet wurde. Es sollen<br />
hier nicht die verschiedenen Argumentationsstränge mit den dahinter stehenden, teilweise<br />
divergierenden Interessenlagen nachgezeichnet werden, die die Verabschiedung des preußischen<br />
Wohnungsgesetzes so schwierig gemacht haben. 27 Ferner waren auf Reichsebene 1917<br />
ein Mieterschutzgesetz und 1918 ein Wohnungsmangelgesetz (zunächst nur zum Schutz der<br />
Familien von Kriegsteilnehmern) erlassen worden. Die staatliche Subvention des <strong>Wohnungsbau</strong>s<br />
war in diesen Gesetzen bzw. Gesetzentwürfen zunächst gar nicht enthalten. Sie wurde in<br />
das preußische Wohnungsgesetz erst 1918 aufgenommen und auf Reichsebene in einer Bundesratsverordnung<br />
über Baukostenzuschüsse geregelt. Es zeichnete sich nämlich im letzten<br />
Kriegsjahr immer deutlicher ab, dass die vorhandenen Wohnungen auch nicht annähernd ausreichen<br />
würden, um die heimkehrenden Soldaten und ihre Familien aufzunehmen, nachdem<br />
der <strong>Wohnungsbau</strong> im Jahrzehnt 1909 - 1918 nahezu zum Erliegen gekommen war. Der Plan<br />
einer Staatsanleihe im Umfang von 20 Mio Mark zur Finanzierung staatlicher <strong>Wohnungsbau</strong>kredite<br />
wurde allerdings im Kaiserreich nicht mehr umgesetzt. Die Weimarer Republik hat<br />
also den staatlich geförderten <strong>Wohnungsbau</strong> nicht erfunden, sondern wichtige Instrumente<br />
vom Kaiserreich geerbt.<br />
Mietpreisstop schützt kurzfristig diejenigen Haushalte, die eine Wohnung haben, vor explodierenden<br />
Mieten. Mittel- und langfristig setzt ein Mietenstop die Knappheitssignale außer<br />
Kraft, die von steigenden Mieten ausgehen und führt damit zu mehr Wohnungs- / Wohnflä-<br />
25<br />
So – mit Hinweis auf die problematische Quellenlage – von Saldern, Adelheid, Häuserleben, Bonn 1997, S.<br />
46 f<br />
26<br />
Im einzelnen vgl. Reulecke, Jürgen, Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, Frankfurt a. M. 1985, S.<br />
68 ff<br />
27<br />
Dazu im einzelnen: Niethammer, Lutz, Ein langer Marsch durch die Institutionen; in: Niethammer (Hg) Woh-<br />
nen im Wandel, Wuppertal 1979, S. 363 ff
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 14 /<br />
24<br />
chenkonsum der einzelnen Haushalte – ein wohnungsreformerisch gewollter Effekt, denn<br />
Wohnungsnot war ja vor allem definiert als zu dichte Wohnungsbelegung, zu geringer Wohnflächenkonsum.<br />
Ein Mietenstop verhindert aber außerdem steigende Renditen der Vermieter,<br />
so dass anlagesuchendes Kapital nicht in den <strong>Wohnungsbau</strong> gelenkt wird. Damit nimmt ein<br />
Mietenstop den Wohnungsmarkt gewissermaßen in die Zange: mehr Nachfrage und weniger<br />
Angebot. Ein Mietenstop muss daher mit staatlicher Subvention (<strong>oder</strong> direktem staatlichem<br />
<strong>Wohnungsbau</strong>) zusammengehen, wenn er nicht zur Verschärfung der Knappheit führen soll.<br />
Kurzfristig sind Mietenstop und Subvention ein sehr wirksames Instrumentenpaar, wenn<br />
Wohnungsmangel schnell überwunden werden soll und die langsame Reaktion des freien<br />
Marktes gesellschaftlich <strong>oder</strong> politisch nicht akzeptiert werden kann. Langfristig führt dieses<br />
Instrumentenpaar aber zu immer höherem Subventionsbedarf, insbesondere dann, wenn auch<br />
die Mieten in den neuen, subventionierten Wohnungen niedrig gehalten werden, was ja das<br />
sozialpolitische Ziel ist. Denn niedrige Mieten im Sozialwohnungssektor üben einen Konkurrenzdruck<br />
auf den nicht subventionierten <strong>Wohnungsbau</strong> aus mit der Folge, dass dort immer<br />
weniger investiert wird, der subventionierte <strong>Wohnungsbau</strong> also einen immer größeren Anteil<br />
an der <strong>Wohnungsbau</strong>produktion einnehmen muss: crowding out – Verdrängung privater Investitionen<br />
durch staatliche, nennen Ökonomen diesen Effekt.<br />
Der Staat hat die Mittel für die Subventionen ja nicht einfach, sie müssen über Steuereinnahmen<br />
aufgebracht werden, das heißt, die Mittel stehen an anderer Stelle dem privaten Sektor<br />
nicht für Investitionen zur Verfügung. Die ökonomische Krise des Weimarer Staates dürfte<br />
wohl zu einem erheblichen Teil auf eine Sozialpolitik – und auch auf einen sozialen <strong>Wohnungsbau</strong><br />
– zurückzuführen sein, der die Wachstumskraft der deutschen Wirtschaft überfordert<br />
hat. 28<br />
In nennenswertem Umfang wurde die <strong>Wohnungsbau</strong>subventionierung der Weimarer Republik<br />
erst nach der Hyperinflation von 1920 wirksam: Vor 1924 wurden Förderungsmittel aus dem<br />
allgemeinen Haushalt gewährt; die Art der Subvention wurde bis 1921 mehrfach verändert<br />
und blieb immer hinter den geplanten Zahlen zurück, da die Inflation sich beschleunigte. Mit<br />
der Dritten Steuernotverordnung von 1924 wurde das System grundsätzlich umgestellt: von<br />
da an wurde der Althausbesitz mit einer Geldentwertungs-Ausgleichsteuer (in Preußen: Hauszinssteuer)<br />
belegt. Dadurch sollte ein Ausgleich geschaffen werden dafür, dass die vor 1914<br />
aufgenommenen Hypothekendarlehen durch die Inflation entwertet worden waren, die Hauseigentümer<br />
damit also faktisch schuldenfrei gestellt waren. Zugleich sollten die Mieten im<br />
Althausbestand angehoben werden (die Steuer war umlegbar auf die Miete), um so die Altbaumieten<br />
an die höheren Neubaumieten subventionierter Wohnungen anzugleichen. Damit<br />
sollte das System aus Mietenstop und <strong>Wohnungsbau</strong>subvention langfristig überflüssig gemacht<br />
werden. <strong>Das</strong> Aufkommen aus der Hauszinssteuer floss zu ca. 50% in den allgemeinen<br />
Staatshaushalt, aus dem Rest wurden zinsgünstige Darlehen für den sozialen <strong>Wohnungsbau</strong><br />
ausgereicht („Hauszinssteuer-Hypothek“). Die Gemeinden haben in unterschiedlichem Maße,<br />
insgesamt aber wahrscheinlich noch einmal in der gleichen Größenordnung Darlehen aus ihren<br />
Haushalten ausgereicht und Bürgschaften für Kapitalmarktdarlehen übernommen. Über<br />
die Zahl der zwischen 1924 und 1931 so neu errichteten Wohnungen gibt es in der Literatur<br />
unterschiedliche Angaben, es dürfte sich um 2 Mio bis 2,5 Mio gehandelt haben, davon in den<br />
Jahren intensivster Bautätigkeit 1928 – 1930 jährlich ca. 300.000 Wohnungen, während im<br />
Kaiserreich der jährliche Wohnungszugang im Durchschnitt bei ca. 200.000 Wohnungen<br />
lag. 29 Die Hauszinssteuermittel kamen überwiegend gemeinnützigen Baugenossenschaften<br />
und <strong>Wohnungsbau</strong>gesellschaften zugute, deren Anteile im Eigentum der Städte <strong>oder</strong> anderer<br />
Non-Profit-Organisationen (z. B. der Gewerkschaften) waren.<br />
28<br />
Vgl. von Saldern, Adelheid, Häuserleben, S. 122 mit weiteren nachweisen zu diesem Aspekt der Wirtschaftsgeschichte<br />
der Weimarer Republik.<br />
29<br />
Verschiedene Quellen ausgewertet bei Schmoll, Wohnungsnot, S. 311 und von Saldern, Häuserleben, 121
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 15 /<br />
24<br />
Im Prinzip muss eine staatliche Subvention die Differenz ausgleichen zwischen einer Rendite,<br />
die in der Gesamtwirtschaft mit Investitionen durchschnittlich erzielt wird, und der im spezifischen<br />
Sektor – hier: im sozialer <strong>Wohnungsbau</strong> – erzielbaren Rendite. Dabei ist es von großer<br />
Bedeutung, wie hoch die durchschnittlich erzielbare Rendite ist. Privates Kapital kann in<br />
jedem Sektor angelegt werden, Maßstab wird immer eine gesamtwirtschaftliche Rendite sein.<br />
Sozial gebundenes Kapital kann nicht in jedem beliebigen Sektor eingesetzt werden. <strong>Das</strong> Kapital<br />
der gemeinnützigen <strong>Wohnungsbau</strong>gesellschaften und Genossenschaften war sozial gebunden.<br />
Die von der Wohnungsreform-Bewegung entwickelten Grundsätze der Gemeinnützigkeit<br />
sehen vor, dass das Kapital<br />
��nur im <strong>Wohnungsbau</strong> eingesetzt wird<br />
��dass Überschüsse in den <strong>Wohnungsbau</strong> reinvestiert werden<br />
��dass die Rendite auf 4% begrenzt ist.<br />
Die Konzentration der Subventionen auf gemeinnützige Wohnungsunternehmen bedeutet,<br />
dass nur die Differenz zwischen dieser auf 4% begrenzten Renditeerwartung und der tatsächlich<br />
im sozialen <strong>Wohnungsbau</strong> erzielbaren subventioniert werden muss. Die Konzentration<br />
auf gemeinnützige Wohnungsunternehmen hat also dazu geführt, dass mit gleichen Mitteln<br />
mehr Wohnungen gefördert werden konnten, als bei einer Förderung privater Investoren möglich<br />
gewesen wäre.<br />
Die Neubauleistung von zwei bis zweieinhalb Millionen Wohnungen bedeutete, dass etwa<br />
14% der Menschen um 1930 in einer Neubauwohnung lebten. Die Belegungsdichte der Wohnungen<br />
sank, sowohl durch die Ausweitung des städtischen Wohnungsangebots, als auch<br />
durch Verbesserung der städtischen Verkehrsmittel, die nun erlaubten, auch vom Stadtrand<br />
<strong>oder</strong> aus dem Umland innerstädtische Arbeitsplätze zu erreichen. 30 Ein nicht unerheblicher<br />
Teil der städtischen Bevölkerung war also mit neuen Wohnungen versorgt. Dies war Ergebnis<br />
der ersten Phase des sozialen Miet- und Genossenschafts-<strong>Wohnungsbau</strong>s in Deutschland.<br />
Während der Wirtschaftskrise wurde 1930 zunächst die Hälfte, 1931 dann das gesamte Aufkommen<br />
der Hauszinssteuer in den allgemeinen Staatshaushalt gelenkt, <strong>Wohnungsbau</strong>kredite<br />
wurden nur noch aus den geringen Rückflüssen finanziert. <strong>Das</strong> war das Ende des sozialen<br />
<strong>Wohnungsbau</strong>s der Weimarer Republik: 1932 wurde nur noch etwa ein Viertel der Neubauleistung<br />
des Spitzenjahres 1929 erreicht.<br />
V Sozialer <strong>Wohnungsbau</strong>, gesellschaftliche M<strong>oder</strong>nisierung und<br />
rationalisierte Produktion<br />
Der soziale <strong>Wohnungsbau</strong> der Weimarer Republik war nicht nur und vielleicht nicht einmal<br />
in erster Linie Angelegenheit der Ökonomen. Die Neubauwohnung in der Neubausiedlung<br />
war ein städteplanerisches, architektonisches und sozialreformerisches Projekt von hohem<br />
Rang und großer, vor allem auch kommunalpolitischer Bedeutung. Gerade die architekturgeschichtlich<br />
bedeutsamen Beispiele, die sich in fast allen deutschen Großstädten finden, brechen<br />
radikal mit der Stadt des 19. Jhs.. Man denke etwa die Siedlungsbauten von Bruno Taut<br />
und Martin Wagner in Berlin <strong>oder</strong> von Ernst May in Frankfurt am Main. Wohl gab es vor<br />
1914 bereits vereinzelte Vorläufer wohnungsreformersicher Architektur, aber eine Breitenwirkung<br />
entfalteten sie nicht. Angesichts der berühmten Beispiele des m<strong>oder</strong>nen Siedlungsbaus<br />
der zwanziger Jahre darf aber nicht übersehen werden, dass es um Gestaltungsfragen<br />
heftige Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit und unter Architekten gab, insbesondere<br />
Kontroversen zwischen Traditionalisten und Verfechtern des Neuen Bauens. In dieser Debatte<br />
konnten sich zunächst die Funktionalisten als kulturelle Avantgarde etablieren. Die Gestaltung<br />
der Wohnungsgrundrisse war demgegenüber viel weniger kontrovers, auch Gebäude, die<br />
30 Ebenda mit weiteren Nachweisen
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 16 /<br />
24<br />
in traditionalistischer <strong>oder</strong> regionalistischer Bauform gestaltet waren, wiesen in der Regel sehr<br />
sorgfältig durchdachte und durchgeplante Wohnungsgrundrisse auf. Die Ideale der Wohnungsreformer<br />
des 19. Jhs. wurden nun verwirklicht und weiterentwickelt: Grundrisse mit<br />
einzelnen, nach den wichtigsten häuslichen Funktionen gegliederten Räumen, in der Regel<br />
mit einer der Wohnung zugeordneten Freifläche (Terrasse, Mietergarten <strong>oder</strong> Balkon), funktionale<br />
Küchen, ausreichend Abstellmöglichkeiten, Möglichkeit der Querlüftung der Wohnungen<br />
und Orientierung der Räume und der Gebäudeanordnung nach Kriterien der Besonnung<br />
und Belüftung haben sich nun durchgesetzt.<br />
Aus dem Avantgarde-Bewußtsein heraus wirkten Stadtplaner, Architekten und Wohnungsunternehmen<br />
auch pädagogisch auf die Bewohner ein. Sie konnten dabei auf Traditionen der<br />
Baugenossenschafts-Bewegung aufbauen, die seit 1890 einen gewissen Aufschwung genommen<br />
hatte. Parallel zu den Studien über optimale Wohnungsgrundrisse wurden die Bewohner,<br />
und dabei vorwiegend die Hausfrauen angehalten, sich entsprechend der neuen, rationell gestalteten<br />
Wohnung auch rational zu verhalten. Taylor’s Prinzipien der Arbeitsteilung und der<br />
rationellen Produktionsabläufe wurden auf die Hausarbeit übertragen und in einen Fortschritts-<br />
und Emanzipationsdiskurs eingebunden. Konsumorientierte Haushaltsführung wurde<br />
so kulturell vorbereitet und unterstützt. Prominentes Beispiel hierfür ist sicherlich die Frankfurter<br />
Küche und die Rolle ihrer Erfinderin Margarete Schütte-Lihotzky im Team von Ernst<br />
May in Frankfurt a. M.<br />
In der Weltwirtschaftskrise der frühen 30er Jahre fand keineswegs eine Umkehr dieser Entwicklung<br />
statt. Zwar konnten sich in der Krise diejenigen politischen Kräfte durchsetzen, die<br />
den geförderten <strong>Wohnungsbau</strong> und die Preis- und Belegungskontrolle im Wohnungsbe- stand<br />
von Anfang an bekämpft hatten. Die Hauszinssteuermittel flossen ab 1930 vollständig in den<br />
allgemeinen Staatshaushalt, die <strong>Wohnungsbau</strong>subventionen wurden um 70% gekürzt. Die<br />
ohnehin geringe Größe der geförderten Wohnungen wurde weiter reduziert, zu diesem Zweck<br />
wurden Untersuchungen über minimale Wohnungsgrößen gefördert. 31 Die verbliebenen Subventionsmittel<br />
wurden auf die Anlage und den Bau von Kleinsiedlungen umgestellt: (teilweise)<br />
Eigenleistung beim Bau und später (teilweise) Eigenversorgung mit Produkten der kleingärtnerisch<br />
bewirtschafteten Siedlerstelle wurden zum Programm für Arbeitslose und deren<br />
Familien. Die in den 20er Jahren genährte Hoffnung auf Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse<br />
durch standardisierten Massenwohnungsbau auf relativ hohem Qualitätsniveau<br />
wurden so auf das rechte Maß proletarischer Existenzbedingungen zurückgestutzt.<br />
Die städtischen <strong>Wohnungsbau</strong>gesellschaften und die Baugenossenschaften wurden durch das<br />
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz von 1934 „gleichgeschaltet“ und in die deutsche Arbeitsfront<br />
eingegliedert. <strong>Das</strong> Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (basierend auf der Wohnungsgemeinnützigkeitsverordnung<br />
von 1930) galt in der alten BRD – um nationalsozialistische Zielsetzungen<br />
und Gleichschaltungs-Vorschriften bereinigt – bis zur Aufhebung durch den Bundesgesetzgeber<br />
1990.<br />
Zugleich konnten sich zunehmend traditionalistische Gestaltungsauffassungen Anerkennung<br />
verschaffen. Vor allem in den ersten Jahren des nationalsozialistischen Regimes wurde der<br />
M<strong>oder</strong>nisierungsanspruch auf der kulturellen Ebene zunächst zurückgenommen, sozial- demokratisches<br />
und sozialistisches M<strong>oder</strong>nitätspathos als ”Kulturbolschewismus” diffamiert.<br />
Demgegenüber wurde der <strong>Wohnungsbau</strong> durch staatliche Beschränkung der Kreditzinsen<br />
faktisch wieder angekurbelt. Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen wurden im Zuge<br />
der ”Gleichschaltung” in die ”Deutsche Arbeitsfront” eingegliedert, zu wenigen, potenten<br />
Großunternehmen zusammengefasst und auf die politische Linie der NSDAP ausgerichtet.<br />
31 Symptomatisch der Titel einer Ausstellung, veranstaltet vom II. Internationalen Kongress für Neues Bauen<br />
und dem Frankfurter Hochbauamt im Jahre 1930: „Die Wohnung für das Existenzminimum“ (Katalog: Frankfurt<br />
a. M., Englert & Schlosser 1930)
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 17 /<br />
24<br />
Gefördert durch staatliche Kredite, Bürgschaften und Steuervergünstigungen stieg das Neubauvolumen<br />
erneut an und im Jahre 1937 wurden nochmals Fertigstellungszahlen erreicht, die<br />
an die der späten 1920er Jahre heranreichten. Dennoch gelang es in der gesamten Zwischenkriegsphase<br />
nicht, den Wohnungsfehlbestand (die Differenz aus Zahl der Privathaushalte und<br />
Zahl der Wohnungen) zu reduzieren. Daher blieb auch die Begrenzung des Mietanstiegs immer<br />
ein sozialpolitisches Erfordernis. So wurde 1936 erneut ein Mietpreisstop verhängt, der<br />
auch nach 1945 zunächst aufrecht erhalten blieb. Die Wohnungsgrößen im Massenwohnungsbau<br />
der 30er Jahre blieben minimal, aber die Zahl neu erbauter Wohnungen wurde wieder<br />
gesteigert.<br />
Vor allem ab 1940, als ein ”Führererlaß” Planungen für den <strong>Wohnungsbau</strong> nach dem Krieg<br />
anordnete, wurde der Gesichtspunkt der Rationalisierung des Bauprozesses wieder betont, die<br />
”Volkswohnung” sollte nun doch - ähnlich wie die Konsumgüter ”Volksempfänger” und<br />
Volkswagen” - in taylorisierter Massenproduktion hergestellt werden. Damit brach - unter<br />
NS-Vorzeichen - die aus den 20er Jahren bekannte Kontroverse zwischen Vertretern einer<br />
„rationalistischen” und einer traditionalistisch-regionalistischen Aesthetik wieder auf. Innerhalb<br />
der NS-Wohnungspolitik der 40er Jahre haben - wenn auch regionalistisch dekoriert -<br />
serielle Gestaltungsprinzipien erneut die Oberhand gewonnen. Dies ist in engem Zusammenhang<br />
mit der verstärkten Kriegs-Technik-Propaganda zu sehen: mehr und mehr wurde die<br />
Überlegenheit technisch-industrieller Produkte und Verfahren als Bedingung für den militärischen<br />
Sieg und damit als Hoffnungsträger für einen nationalistischen Nachkriegs-Sozialstaat<br />
gemacht. 32<br />
Auch der <strong>Wohnungsbau</strong> und die Wohnungspolitik der Weimarer Republik und des NS-Staats<br />
können als Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten von<br />
Lebensbedingungen, Alltagspraxis und <strong>Wohnungsbau</strong> gesehen werden. Aus der historischen<br />
Distanz betrachtet, erweist sich das Jahr 1933 dabei nicht als die große Zäsur, vielmehr erscheint<br />
die gesamte Zwischenkriegszeit als diejenige Epoche, in der die Orientierung auf Arbeitsteilung,<br />
konsumorientierte Lebensweise und Massenproduktion auch mit dem Vehikel<br />
des <strong>Wohnungsbau</strong>s vorangetrieben und kulturell sowie diskursiv abgesichert wird. Die adäquate<br />
Nutzung und Benutzung der Wohnung wird von den gesellschaftlichen Avantgarden<br />
vorgelebt und mit pädagogischem Impetus in die breiten Schichten des Volkes hinein vermittelt.<br />
Der <strong>Wohnungsbau</strong> ist jetzt nicht Nachzügler der Entwicklung, sondern wird – zusammen<br />
mit Umwälzungen in den Produktionsformen und der Arbeitswelt – zum Vorreiter. <strong>Wohnungsbau</strong><br />
und Wohnungsreform verlangen, dass sich die Alltagspraxis des Wohnens und der<br />
privaten Haushaltsführung an die neue Wohnung und den neuen Stadtteil anpassen sollen.<br />
Tatsächlich aber widersetzten sich sozialkulturelle Bedürfnisse und aesthetische Vorlieben der<br />
Bewohner vielfach den pädagogischen Absichten von Architekten, Stadtplanern und Wohnungsreformern:<br />
Gebrauch, Einrichtung und Umgestaltung der m<strong>oder</strong>nen Wohnung durch die<br />
Bewohner zeigen, dass diese sich ihre Wohnumwelt in anderer Weise – „rückständig“, „kitschig“,<br />
„unvernünftig“ – aneignen konnten, als die Planer das vorgesehen hatten. 33<br />
VI Genossenschaftliches <strong>oder</strong> individuelles Wohnungseigentum?<br />
Die Wohnungsreformer des 19. Jhs. und der 1920er Jahre konnten als einzigen Mittelweg<br />
zwischen Mietwohnung und dem Häuschen auf eigener Scholle den genossenschaftlichen<br />
<strong>Wohnungsbau</strong> sehen. Die Genossenschaftsidee ist schon beim ersten großen Wohnungsreformer,<br />
V. A. Huber ein zentraler Gedanke. Später haben gerade Liberale die genossenschaftliche<br />
Lösung favorisiert. Tatsächlich konnte die genossenschaftliche Selbsthilfe im Woh-<br />
32 Schmoll, Schneller Wohnen, S. 293 mit weiteren Quellennachweisen<br />
33 Näheres vgl. von Saldern, Häuserleben, S. 410
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 18 /<br />
24<br />
nungsbau erst um 1900 wirksam werden. Vor 1870 gibt es nur eine echte <strong>Wohnungsbau</strong>genossenschaft,<br />
den 1865 gegründeten und 1885 liquidierten Bürger-Bau-Verein zu Elberfeld<br />
und auch nach 1870 blieb deren Zahl gering. (Die übrigen frühen Gründungen, auch wenn Sie<br />
wie die Stiftung Maximilians II. in Nürnberg, mit dem Begriff Genossenschaft hantierten,<br />
hatten andere Rechtsformen, meist die der Aktiengesellschaft, manchmal die der Stiftung).<br />
Neben dem Gedanken der Selbsthilfe ist schon bei Huber und auch bei liberalen Autoren die<br />
befriedende Wirkung, die dem Privateigentum (auch in genossenschaftlicher Form) zugeschrieben<br />
wurde, Motor der Idee. Tatsächlich reichten aber die gemeinsam von den Wohnungssuchenden<br />
aufzubringenden Spargroschen nicht aus, um eine nennenswerte Bautätigkeit<br />
zu entfalten. Demgegenüber konnten sich die Kredit- und Konsumgenossenschaften nach dem<br />
Modell von Schulze-Delitzsch von der Jahrhundertmitte an positiv entwickeln (mit Mitgliedern<br />
hauptsächlich aus den Reihen der kleinen Handwerker, Kaufleute und qualifizierten<br />
Lohnarbeiter).<br />
Für Baugenossenschaften blieben bis gegen 1900 zwei Probleme ungelöst: in der Genossenschaft<br />
hafteten alle Mitglieder gesamtschuldnerisch und unbeschränkt. Dies musste gerade<br />
diejenigen abschrecken, die etwas zu verlieren hatten, denn sie hätten im Ernstfall mit ihrem<br />
gesamten Vermögen für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft einstehen müssen – unabhängig<br />
von der Höhe des eigenen Anteils. <strong>Das</strong> Erste Genossenschaftsgesetz (preußisches Gesetz<br />
1867, vom Norddeutschen Bund 1868 und vom Reich 1871 übernommen) schrieb ausdrücklich<br />
die unbeschränkte Haftung vor, um die Kreditwürdigkeit von Genossenschaften zu<br />
stärken; dies war im Interesse der landwirtschaftlichen, handwerklichen und Konsumgenossenschaften,<br />
verhinderte aber die Gründung von Baugenossenschaften, die – wollten sie in<br />
nennenswertem Umfang bauen – in großem Umfang Kredite hätten aufnehmen und so den<br />
Mitgliedern ein untragbares Haftungsrisiko aufbürden müssen. Erst mit dem Zweiten Genossenschaftsgesetz<br />
von 1889 wurde die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft mit beschränkter<br />
Haftung geschaffen. Zugleich wurde die Revisionspflicht eingeführt, die Genossenschaften<br />
mussten ihre Jahresabschlüsse von einem unabhängigen Prüfer des jeweiligen<br />
Genossenschaftsverbands prüfen lassen.<br />
<strong>Das</strong> zweite zentrale Problem der Baugenossenschaften, die Beschaffung günstiger Finanzierungsmittel,<br />
wurde ebenfalls gegen Ende des Jahrhunderts gelöst. Im Gesetz über die Alters-<br />
und Invaliditätsversicherung von 1889 – dem letzten der Bismarck’schen Sozialgesetze – war<br />
vorgesehen, dass das Kapital der Versicherungsanstalten „gemeinnützig“ anzulegen sei. Damit<br />
war zwar zunächst nicht die Förderung des gemeinnützigen <strong>Wohnungsbau</strong>s intendiert,<br />
aber die einzelnen Landesversicherungsanstalten entwickelten doch ein Eigeninteresse daran,<br />
die Wohnungslage ihrer Mitglieder zu verbessern, getreu einem der Hauptstränge der Argumentation<br />
der Wohnungsreformer, dass schlechte Wohnungen Ursache für Krankheit und<br />
Invalidität seien. Die Landesversicherungsanstalten reichten aus dem Versicherungsvermögen<br />
Baudarlehen an gemeinnützige Wohnungsunternehmen aus, mit denen der <strong>Wohnungsbau</strong><br />
für die Versicherten finanziert wurde. Es handelte sich um annuitätisch rückzahlbare Darlehen<br />
mit Zinssätzen unterhalb des Marktniveaus. Bis zum ersten Weltkrieg flossen so etwa 20% bis<br />
25% des Vermögens der Versicherungsanstalten, insgesamt etwa 0,5 Mrd Mark, in die Finanzierung<br />
des <strong>Wohnungsbau</strong>s durch gemeinnützige Genossenschaften und Gesellschaften. Zwischen<br />
1890 und dem ersten Weltkrieg gewannen so die <strong>Wohnungsbau</strong>genossenschaften immer<br />
mehr an Bedeutung. <strong>Das</strong> von Genossenschaften in den Städten errichtete Bauvolumen<br />
dürfte in diesem Zeitraum bei 1,5% des gesamten städtischen Wohnungs-Neubauvolumens<br />
gelegen haben. 34<br />
Die Genossenschaft war für viele Wohnungsreformer nur ein Kompromiss, eigentlich ging es<br />
darum, Arbeiterfamilien ein eigenes Heim auf eigener Scholle zu verschaffen. Dieses Konzept<br />
34 Vgl. ebda. S. 57 mit weiteren Nachweisen
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 19 /<br />
24<br />
wurde später, nach dem Ersten Weltkrieg vom Staat verfolgt. Arbeitslose und Kriegsheimkehrer<br />
wurden mit Grundstücken versorgt, auf denen sie sich – soweit möglich – in Eigenarbeit<br />
ein Häuschen errichten und später den Garten zur Eigenversorgung (und evtl. als Nebenerwerb)<br />
bewirtschaften sollten. Dieses Programm wurde mit dem Reichheimstättengesetz von<br />
1920 auch kodifiziert: Die Heimstättengesellschaften errichteten Kleinhäuser auf Grundstücken,<br />
die für gärtnerische Selbstversorgung und Nebenerwerb geeignet waren. Die Bewohner<br />
erwarben diese Häuser nach einem Mietkaufmodell. Bei einem Auszug konnten die Häuser<br />
und Grundstücke aber nicht auf dem freien Markt verkauft werden, sondern mussten zum<br />
Zeitwert an die Heimstättengesellschaft zurückverkauft werden.<br />
Ab 1930 wurden erneut Kleinhaus- und Nebenerwerbssiedlungen verstärkt gefördert, denn<br />
das Konzept passte auch sehr gut sowohl in die Wirtschaftspolitik des nationalsozialistischen<br />
Staates als auch in die Blut- und Boden-Ideologie. Daher wurde es nach 1933 zunächst einfach<br />
weitergeführt. Die überwiegende Orientierung auf den Kleinhausbau wurde vom nationalsozialistischen<br />
Staat aber bereits mit dem neuerlichen Wirtschaftsaufschwung ab Mitte der<br />
dreißiger Jahre wieder aufgegeben. Heimstätten erwiesen sich als ausgesprochene Kinder der<br />
Krise.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann in beiden deutschen Staaten darum, den durch die<br />
Kriegszerstörungen und die kriegsbedingten Vertreibungen potenzierten Wohnungsmangel zu<br />
beseitigen: während der rechnerische Wohnungsfehlbestand in den 1920er und 30er Jahren in<br />
ganz Deutschland zwischen 1 Mio und 1,5 Mio Wohnungen betrug, waren es 1950 allein in<br />
der Bundesrepublik 6,3 Mio. Angesichts dieser Lage beschloss bereits der Alliierte Kontrollrat,<br />
die Militärregierung vor der Gründung der beiden deutschen Staaten, die Zwangsbewirtschaftung<br />
der verbliebenen Wohnungen, und aus Mitteln des Marshall-Plans wurde auch<br />
<strong>Wohnungsbau</strong> subventioniert. Die junge Bundesrepublik setzte dann wieder, anknüpfend an<br />
die Vorkriegszeit, mit dem Ersten <strong>Wohnungsbau</strong>gesetz von 1950 zunächst auf den staatlich<br />
subventionierten Mietwohnungsbau.<br />
Mit dem Wohnungseigentumsgesetz von 1952 aber wurde ein zweiter Weg eröffnet, der nun<br />
endlich, nach hundert Jahren wohnungsreformerischer Diskussion, den breiten Schichten Eigentum<br />
an den von ihnen bewohnten vier Wänden ermöglichen sollte. Zuvor war Wohnungseigentum<br />
nur in Form des eigenen Hauses auf eigener Scholle möglich. Zwar konnte das<br />
Kleinhaus, das Reihenhaus, die Heimstätte am Stadtrand <strong>oder</strong> im weiteren Umland hinsichtlich<br />
Wohnfläche, Baukosten und Grundstückspreis minimiert werden, aber innerstädtisches<br />
Wohnen im Eigentum blieb den Reichen vorbehalten.<br />
Die Idee des Eigentums auf der Etage war nicht ganz neu, rechtlich präzise Rahmenbedingungen<br />
bestanden aber vor 1952 nicht. Erst das Wohnungseigentumsgesetz schuf Klarheit<br />
darüber, dass die jeweilige Wohnung mit einem ideellen Bruchteil des Grundstücks eine Einheit<br />
bildet, lieferte Kriterien für die Abgrenzung der individuellen Wohnung von den gemeinschaftlichen<br />
Gebäudeteilen, sicherte die Rechte des einzelnen Eigentümers auf eine ordnungsgemäße<br />
Instandhaltung gerade auch der gemeinschaftlichen Gebäudeteile und definierte<br />
das Wohnungseigentum als grundstücksgleiches Recht mit eigenem Grundbuchblatt. Damit<br />
wurde klar: der Wohnungseigentümer kann ebenso wie der Hauseigentümer mit seinem Eigentum<br />
nach Belieben verfahren, es selber bewohnen <strong>oder</strong> vermieten, es verkaufen, vererben<br />
und – vor allem – es mit Grundpfandrechten belasten. Erst dadurch ist die Grundlage für die<br />
Finanzierung von Eigentumswohnanlagen mithilfe von Hypotheken- <strong>oder</strong> Grundschuld-<br />
Darlehen geschaffen worden. <strong>Das</strong> Wohnungseigentumsgesetz hat seine eigene Erfolgsgeschichte.<br />
Wohnungseigentum stellt einen liberaleren und individualistischeren Mittelweg zwischen<br />
Mietwohnung und Häuschen auf eigener Scholle dar, als das Konzept der Genossenschaftsbewegung.<br />
Im wohnungspolitischen Diskurs wird seit 1952 bis heute Eigenheim und Eigen-
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 20 /<br />
24<br />
tumswohnung meist in einem Atemzug genannt und unter dem undifferenzierten Oberbegriff<br />
Wohneigentum zusammengefasst. Eine breite Lobby von Bauträgern, die Eigentumswohnungen<br />
errichten und anbieten, über Bausparkassen und Banken, die den Bau und Erwerb finanzieren,<br />
bis zur Bauindustrie preist die Vorzüge des Wohneigentums. Bereits das Zweite bundesrepublikanische<br />
<strong>Wohnungsbau</strong>gesetz von 1956 setzte auch für den sozialen <strong>Wohnungsbau</strong><br />
das Ziel, bevorzugt Wohneigentum zu schaffen. Der Begriff „für die breiten Schichten des<br />
Volkes“ ist dort in §1 verankert. Dennoch blieb der staatlich geförderte soziale <strong>Wohnungsbau</strong><br />
auch in der Bundesrepublik überwiegend Mietwohnungsbau. Wohnungseigentum wurde zwar<br />
gemäß der Zielsetzung des Zweiten <strong>Wohnungsbau</strong>gesetzes auch im Rahmen des sozialen<br />
<strong>Wohnungsbau</strong>s gefördert, viel wichtiger wurde aber im Lauf der bundesrepublikanischen Geschichte<br />
die eigens für das Wohneigentum entwickelte steuerliche Förderung.<br />
Bis 1952 wurde der Mietwohnungsbau und der <strong>Wohnungsbau</strong> für den eigenen Bedarf steuerlich<br />
in gleich behandelt: für die eigengenutzte Wohnung wurde steuerlich ein (fiktiver) Nutzungswert<br />
wie eine Mieteinnahme angesetzt. Vom Nutzungswert konnten Kosten, insbesondere<br />
Abschreibungsbeträge für die Abnutzung des Wirtschaftsguts Wohnung abgesetzt werden.<br />
Der Subventionseffekt bestand darin, dass steuerlich höhere Absetzungsbeträge zulässig<br />
waren, als eigentlich zum Ausgleich des tatsächlichen Wertverlusts des Gebäudes <strong>oder</strong> der<br />
Wohnung notwendig waren. Dadurch entstanden in den Steuerklärungen der Bauherren (bzw.<br />
später der Erwerber) Verluste, die das zu versteuernde Einkommen mindern und damit die<br />
Steuerbelastung senken konnten. Der selbstnutzende Bewohner zahlte also weniger Steuern,<br />
als ein Mieter unter sonst vergleichbaren Bedingungen.<br />
Von 1953 an konnte eine erhöhte steuerliche Absetzung nicht nur für den Bau neuer Wohnungen<br />
geltend gemacht werden, sondern auch für die Anschaffung, also den Kauf neu errichteter<br />
Ein- und Zweifamilienhäuser. Damit kam das Geschäft der Bauträger in Schwung. Ab<br />
1965 wurden diese Steuervorteile auch für den Aus- und Anbau gewährt. Von 1977 an wurde<br />
nicht nur der Neubau bzw. Aus- und Anbau, also die Schaffung zusätzlichen Wohnraums,<br />
sondern jeglicher Erwerb von Wohnraum für Eigennutzung durch erhöhte Absetzungen gefördert.<br />
Damit kam das Geschäft der Umwandlung bestehender Miethäuser in Wohnungseigentum<br />
in Schwung. 1987 wurde das System grundsätzlich umgestellt. An die Stelle der „Investitionsgut-Lösung“,<br />
also dem Ansatz eines Nutzungswertes für eigengenutzte Wohnungen,<br />
trat die „Konsumgut-Lösung“. Die Nutzungswert-Besteuerung und damit auch die Möglichkeit<br />
erhöhter Absetzungen entfiel. Dafür regelte ein neu in das Einkommensteuer-Gesetz eingefügter<br />
§ 10e, dass bestimmte Prozentsätze der Baukosten <strong>oder</strong> des Kaufpreises während der<br />
ersten acht Jahre nach Einzug in die eigengenutzte Wohnung als Sonderausgaben von den<br />
Einnahmen abgezogen werden können.<br />
Sowohl die frühere Absetzung von Abschreibungsbeträgen als auch der Sonderausgaben-<br />
Abzug hatten den Effekt, dass die Vorteile der Förderung um so höher sind, je höher das Einkommen<br />
des Wohnungseigentümers ist. Um die „ganz Reichen“ auszuschließen, gab es zwar<br />
Einkommens-Obergrenzen, aber bis zur Obergrenze war diese wenig soziale Wirkung unvermeidlich.<br />
Durch die Umstellung auf die Eigenheimzulage in den Jahren 1995/96 wurde dieser<br />
Effekt beseitigt. Seither gibt es – bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze – feste Zulagebeträge<br />
während der ersten acht Jahre nach Bezug der eigenen Wohnung.<br />
In den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg diente diese Förderung der Schaffung<br />
neuen Wohnraums. Wer vom Einkommen und den Ersparnissen her gerade in der Lage<br />
war, Wohneigentum zu bilden, sollte unterstützt werden, diese Absicht auch zu realisieren.<br />
Der soziale Mietwohnungsbau alleine schien nicht auszureichen, um den Wohnungsmangel<br />
der Nachkriegszeit zu beseitigen. Die Förderungsprinzipien für Wohneigentum und für Sozialwohnungen<br />
waren jedoch höchst verschieden. Sozialer <strong>Wohnungsbau</strong> wurde im Rahmen<br />
jährlicher, von den Bundesländern aufgelegter <strong>Wohnungsbau</strong>programme subventioniert,<br />
wenn das Programm ausgebucht war, standen für das jeweilige Jahr keine weiteren Mittel zur
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 21 /<br />
24<br />
Verfügung. Auf die Eigentumsförderung besteht demgegenüber ein Rechtsanspruch: wer die<br />
Bedingungen erfüllt, erhält die Steuervergünstigung bzw. Zulage.<br />
Auf dieser Grundlage dehnten sich im ländlichen Bereich und im Umland der Städte die Einfamilienhausgebiete<br />
aus, eine Entwicklung, die bis heute ungebrochen ist. Ökologisch und<br />
auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Kernstädte ist dies kritisch zu sehen. Aber die<br />
jeweiligen Umland-Gemeinden sind zuständig für die Bauleitplanung. Deren Organe sind<br />
oftmals Teil eines Interessenkartells für die Ausweisung neuer Baugebiete und für die Schaffung<br />
entsprechender Infrastruktureinrichtungen: die örtlichen Eigentümer ehemals landwirtschaftlicher<br />
Flächen realisieren (zumindest einen Teil) der Grundrentensteigerung; das örtliche<br />
Gewerbe gewinnt mit Einwohnern aus eher zahlungskräftigen Schichten (zumindest Teile<br />
eines) zusätzlichen Nachfragepotentials, die Gemeinde gewinnt zusätzliche Steuerzahler. Die<br />
Kosten für Infrastrukturinvestitionen werden entweder im Rahmen zweckgebundener Finanzzuweisungen<br />
vom Land und Bund mit getragen, <strong>oder</strong> sie werden – zunehmende Praxis – im<br />
Rahmen städtebaulicher Verträge von den Investoren/Bauträgern übernommen. Die baulichen<br />
Wucherungen am Rande der Ballungsgebiete vollziehen sich weitgehend konfliktfrei und<br />
depolitisiert.<br />
VII Sozialer Mietwohnungsbau und große Siedlungen<br />
Der soziale Mietwohnungsbau, der auf die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen<br />
zugeschnitten war, aber auch für Einzeleigentümer innerstädtischer Baugrundstücke (z.B.<br />
kriegszerstörte Gebäude) attraktiv war, wurde im Laufe der 1960er Jahre das zentrale<br />
Finanzierungsinstrument auch für die Entwicklung der Trabantensiedlungen am Rande der<br />
großen Städte. <strong>Das</strong> Konzept des Siedlungsbaus der 1920er Jahre wurde wieder aufgegriffen,<br />
aber in den Dimensionen vervielfacht, Siedlungen in der Größenordnung von 25.000 bis zu<br />
100.000 Einwohner entstanden. Die Namen der neuen Stadtteile – München-Neuperlach,<br />
Köln-Chorweiler, Berlin-Märkisches Viertel – haben heute noch einen ambivalenten Klang.<br />
Die ursprünglichen Bewohner der Großsiedlungen haben vor ihrem Umzug meist bereits in<br />
der jeweiligen Stadt <strong>oder</strong> in deren nahem Umland gewohnt: oft in innenstadtnahen<br />
Altbauquartieren, unter sehr beengten, häufig auch hinsichtlich der Sanitärausstattung<br />
unzureichenden Verhältnissen. Mit Beginn der Innenstadtsanierung in vielen Großstädten in<br />
den 60er Jahren gehörten dann auch vermehrt ”Umsetzmieter” zur ersten<br />
Bewohnergeneration. Zuwanderer von außerhalb waren dagegen selten. Es waren also<br />
hauptsächlich die mittleren Schichten der jeweils ortsansässigen Bevölkerung, die in die<br />
Großsiedlungen umgezogen sind. Sie haben damit ihren Wohnungsversorgungsstandard<br />
hinsichtlich Wohnfläche und Ausstattung erhöht.<br />
Der Bevorzugung einer sozial relativ homogenen Bevölkerungsauswahl entspricht die<br />
Standardisierung der Wohnungen: mit dem sozialen <strong>Wohnungsbau</strong> und insbesondere mit<br />
Großsiedlungsprojekten bot sich für Architekten und <strong>Wohnungsbau</strong>gesellschaften die<br />
Chance, gemäß den im Fachdiskurs bereits entwickelten Kriterien und Vorstellungen vom<br />
”richtigen” Wohnen die Produktion für einen anonymen Markt nun rationell und in großem<br />
Maßstab zu planen und umzusetzen. Auch hierin wird die in den 1920er Jahren begonnene<br />
Entwicklung fortgesetzt und potenziert. Den Bewohnern sollten Wohnungen zur Verfügung<br />
gestellt werden, die m<strong>oder</strong>ne Ansprüche im Hinblick auf Größe, Grundrissgestaltung,<br />
technische Ausstattung und Hygiene erfüllen. Dabei galt Rationalisierung und<br />
Standardisierung der Bauproduktion und Normung von Bauteilen als wesentliches Moment,<br />
um im Rahmen der ökonomischen Restriktionen, denen der Massenwohnungsbau stets<br />
unterlag, die Wohnqualität zu optimieren. Wohnungen und Gebäude des sozialen<br />
<strong>Wohnungsbau</strong>s sind somit häufig als Kombination relativ weniger standardisierter Elemente
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 22 /<br />
24<br />
und einer begrenzten Zahl von Wohnungstypen entstanden. Nutzungsmöglichkeiten und<br />
Grundrissdisposition sind auf die vermuteten Standardbedürfnisse anonymer Mieterhaushalte<br />
ausgerichtet und vereinheitlicht.<br />
Die ersten innerstädtischen Sanierungsvorhaben, die von den späten 1960er Jahren in Berlin<br />
<strong>oder</strong> im Frankfurter Westend begonnen wurden, folgten noch der für Großsiedlungen<br />
entwickelten Konzeption: flächenhafter Abriss der Stadtteile des 19. Jahrhunderts und<br />
Bebauung in der Art von Neubausiedlungen. Aber der gesellschaftliche Konsens mit der<br />
permanenten M<strong>oder</strong>nisierung der Stadt kippte innerhalb eines Jahrzehnts: um 1980 galt<br />
Sanierung bereits als der sichtbare Beweis für die Unfähigkeit von Staat, Gemeinden und<br />
großen Wohnungsunternehmen, mit dem komplexen Problem der Stadterneuerung fertig zu<br />
werden. Nur kleinteiliges und flexibles Vorgehen, Rückbesinnung auf die Qualitäten der<br />
Gründerzeit-Stadt, soziale und partizipatorische Orientierung der Verfahren – so die<br />
herrschende Meinung um 1980 - könne das Problem lösen. Ein weiteres Moment hat zur<br />
Umorientierung auf die Innenstadt und auf die Erhaltung vorhandener Bausubstanz<br />
beigetragen: Die Gemeindefinanz-Reform von 1972 hat die Städte an der Einkommensteuer<br />
beteiligt und dadurch den Wegzug einkommensstärkerer Bewohner ins Umland zu einem<br />
fiskalischen Problem gemacht - einer der Anlässe für die ”Stadtflucht-Debatte” jener Jahre.<br />
Die kulturelle Abwertung der Großsiedlungen und ihrer Bewohner, die schon Mitte der 60er<br />
Jahre begann, hat sich in den 80er Jahren in dem Maße verstärkt, wie standardisierte<br />
Konsumgüter an Symbolwert verloren haben. Gerade die Höherbewertung ökologischer und<br />
psychologischer Maßstäbe und die Formulierung ganzheitlicher Ansprüche, die von der linksalternativen<br />
Opposition gegen das Projekt einer konsumorientierten M<strong>oder</strong>nisierung<br />
vorgetragen worden sind, haben zur zunehmenden Differenzierung und Heterogenisierung<br />
von Lebensstilen und Konsummustern geführt. Vor diesem Hintergrund kam die<br />
Architektursprache des „Funktionalismus“ der Nachkriegszeit sehr schnell in Misskredit. Die<br />
Bauformen des Massenwohnungsbaus erschienen ebenso unzeitgemäß und rückständig, wie<br />
die Alltagspraktiken ihrer Bewohner.<br />
VIII Ende des <strong>Wohnungsbau</strong>s für die breiten Schichten des Volkes<br />
Die Förderung des sozialen <strong>Wohnungsbau</strong>s, wie sie sich seit der Hauszinssteuer-Ära<br />
herausgebildet hatte, ist 2002 eingestellt worden. Die Kritik an diesem Förderungssystem<br />
knüpfte nicht nur an den baulich-räumlichen Ergebnissen an, sondern wesentlich auch an der<br />
Ökonomie. Trotz hohem staatlichem Mitteleinsatz wurde die Zielgruppe der bedürftigen<br />
Haushalte nicht erreicht – das Stichwort lautete Fehlsubventionierung und Fehlbelegung der<br />
Wohnungen. Zudem wurden durch die staatliche Subvention private Investitionen in den<br />
<strong>Wohnungsbau</strong> verdrängt: das oben skizzierte crowding-out.<br />
Die staatliche Förderung des <strong>Wohnungsbau</strong>s schien immer weniger notwendig. Die<br />
demographische Entwicklung auf der Nachfrageseite und die hohen Neubauzahlen auf der<br />
Angebotsseite haben seit Mitte der 1990er Jahre in den meisten deutschen Regionen zu<br />
ausgeglichenen Wohnungsmärkten geführt, mit Engpässen nur noch in stark wachsenden<br />
Regionen wie etwa München/Oberbayern. Der Markt schien erstmals seit 150 Jahren für ein<br />
quantitativ ausgeglichenes Wohnungsangebot zu sorgen. Einen ersten Liberalisierungsschritt<br />
hatte bereits die Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes von 1940 zum<br />
Jahresende 1989 gebracht. Ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen verloren ihre<br />
Steuervergünstigungen, zugleich aber auch die Beschränkung ihres Geschäftsfeldes auf den<br />
<strong>Wohnungsbau</strong> und die Begrenzung der Gewinnausschüttung auf 4% vom Eigenkapital. <strong>Das</strong><br />
System des Sozialen <strong>Wohnungsbau</strong>s wurde überdies schon seit langem vor allem wegen der<br />
Ineffizienz der Subvention und Allokation kritisiert: die wirklich bedürftigen werden mit
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 23 /<br />
24<br />
dieser Subventionsform kaum erreicht. Eine Expertenkommission, von der Bundesregierung<br />
im Jahre 1992 eingesetzt, hat 1994 Änderungsvorschläge vorgelegt 35 , die 2001 zur<br />
Aufhebung des Zweiten <strong>Wohnungsbau</strong>gesetzes führten. An seine Stelle trat das<br />
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG). Ziel ist nun nicht mehr in erster Linie der Neubau von<br />
Wohnungen, sondern die Sicherung eines gewissen Bestands an belegungsgebundenen<br />
Wohnungen in unteren Preissegmenten. Die Zielgruppe der Förderung ist nunmehr ebenfalls<br />
enger gefasst, es geht nicht mehr um die „breiten Schichten des Volkes“, sondern um<br />
Haushalte, die „auf [staatliche] Unterstützung angewiesen“ sind.<br />
Die demographische Entwicklung deutet darauf hin, dass auch künftig eine Wohnungsnot,<br />
wie sie zwischen 1850 und 1990 in mehr <strong>oder</strong> weniger starker Ausprägung in deutschen<br />
Städten auftrat, der Vergangenheit angehört. Die Bevölkerungszahl in Deutschland geht schon<br />
seit langem zurück. Wohnungsnachfrager sind allerdings nicht Personen, sondern private<br />
Haushalte, und deren Zahl wird im kommenden Jahrzehnt noch leicht zunehmen, weil der<br />
Anteil der Einpersonen-Haushalte zunimmt und den Bevölkerungsrückgang<br />
überkompensiert. 36 Dieser Ausblick auf die künftige Entwicklung gilt allerdings nur für<br />
Deutschland insgesamt und im Hinblick auf die natürliche Bevölkerungsentwicklung.<br />
Wanderungsbewegungen über die Grenzen und innerhalb der Grenzen werden lokale<br />
Ungleichgewichte auch in der Zukunft verursachen.<br />
Dies ist bereits an den Wohnungsleerständen in Regionen mit Bevölkerungsrückgang<br />
erkennbar. Seit Mitte der 1990er Jahre war zunächst in vielen Teilen der neuen Bundesländer<br />
zu beobachten, dass das Wohnungsangebot die Nachfrage übersteigt, während noch im letzten<br />
Jahr der DDR ein erheblicher Wohnungsfehlbestand zu verzeichnen war. Der<br />
Zusammenbruch der Wirtschaft und Abwanderung von Arbeitssuchenden auf der einen Seite,<br />
staatlich forcierter Wohnungsneubau, vor allem auch im Eigentumssektor, auf der anderen<br />
Seite, haben diese Situation herbeigeführt. Mittlerweile finden sich ähnliche (wenn auch<br />
weniger stark ausgeprägte) Erscheinungen in strukturschwachen Regionen der alten Länder.<br />
Der Staat hat mit neuerlichen Subventionsprogrammen reagiert: Stadtumbau Ost und<br />
Stadtumbau West – so die Titel der entsprechenden Programme. Die Reduktion des<br />
Wohnungsbestands zur Anpassung an die verringerte Nachfrage durch Abrisse und Rückbau<br />
von Wohngebäuden wird subventioniert.<br />
Wieder zeigen sich die Folgen unterschiedlicher Entwicklungsgeschwindigkeiten. Diesmal<br />
haben sich Lebensbedingungen und Alltagspraktiken rasant verändert, zurück geblieben sind<br />
überflüssige Wohnungen – Sachkapital, das in der Erwartung einer viel längeren Lebens- und<br />
Amortisationsdauer investiert worden ist. Die Alltagspraxis der nicht abgewanderten, nicht<br />
mobilen Bewohner, die in den schrumpfenden Städten und Regionen zurück bleiben, wird<br />
sich an veränderte räumliche Verhältnisse anpassen müssen. Nicht überfüllte Wohnungen,<br />
sondern Städte und Quartiere, die mit Brachen durchsetzt sind wie der Emmenthaler mit<br />
Löchern, Wohngebäude in denen dauerhaft einige Wohnungen – meist in den obersten und<br />
unteren Geschossen – leer stehen, das wird zum Alltag gehören. Historische Stadtkerne, oft<br />
liebevoll und aufwändig denkmalpflegerisch restauriert, entwickeln sich zu Potemkin’schen<br />
Dörfern: in den Erdgeschossen noch Souvenirläden neben Schlecker <strong>oder</strong> Hennes & Mauritz,<br />
die Obergeschosse aber mehr und mehr unbewohnt. Wieder reibt sich das Alte am neuen: das<br />
<strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong> unter umgekehrten Vorzeichen.<br />
35 Sinn/Expertenkommission, Wohnungspolitik auf dem Prüfstand, Tübingen 1994<br />
36 Birg
Fritz Schmoll gen. Eisenwerrth, <strong>Das</strong> <strong>Nürnberger</strong> <strong>Schwein</strong>, Beitrag zur Festschrift J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, 2005, S. 24 /<br />
24<br />
Literatur<br />
�� von Arnim, Bettine : Dies Buch gehört dem König, Berlin 1843<br />
�� Birg, Herwig: Trends der Bevölkerungsentwicklung - Auswirkungen der<br />
Bevölkerungsschrumpfung, der Migration und der Alterung der Gesellschaft in Deutschland und<br />
Europa bis 2050, insbesondere im Hinblick auf den Bedarf an Wohnraum, Frankfurt/M. 2000<br />
�� Die Wohnung für das Existenzminimum (Ausstellungskatalog), Frankfurt a. M. 1930<br />
�� Eberstadt, Rudolf: Städtische Bodenfrage, Berlin 1894<br />
�� Engels, Friedrich: Die Lage der Arbeitenden Klassen in England, Leipzig 1845<br />
�� Faucher, Julius: Die Bewegung für Wohnungsreform, in: Vierteljahresschrift für Volkswirthschaft<br />
und Kulturgeschichte, Jg. 1865/66.<br />
�� Ders.: Über Häuserbauunternehmung im Geiste der Zeit; das. Jg. 1869<br />
�� Geist, Johann Friedrich / Kürvers, Klaus : <strong>Das</strong> Berliner Mietshaus, Bd. I 1740 – 1862, München<br />
1980<br />
�� Goedecke, Wolfgang / Kerl, Volkher / Scholz, Helmut: Die deutschen Hypothekenbanken,<br />
Frankfurt a. M. 1997<br />
�� Huber, Victor Aimé: Über innere Ansiedlung und Colonisation; in: Janus, Jg. 1846.<br />
�� Jenkis, Helmut: <strong>Das</strong> Schwabe’sche Gesetz und die Lütge’sche Regel; in: Jenkis (Hg):<br />
Kompendium der Wohnungswirtschaft, München<br />
�� Kaschuba, Wolfgang: Lebenswelt und Kultur der unterbürgerlichen Schichten im 19. und 20.<br />
Jahrhundert, München 1990<br />
�� Mummenhoff, Ernst: Die Königshausstiftung und die Königsstiftungshäuser in Nürnberg; Zur<br />
50jährigen Feier der Eröffnung des Königsstiftungshauses am 1, Mai 1857; Nürnberg 1907<br />
�� Niethammer, Lutz, Ein langer Marsch durch die Institutionen; in: Niethammer (Hg) Wohnen im<br />
Wandel, Wuppertal 1979, S. 363 ff<br />
�� Pettenkofer, Max von: Untersuchungen und Beobachtungen über die Verbreitungsart der Cholera;<br />
München 1855<br />
�� Reulecke, Jürgen: Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, Frankfurt a. M. 1985<br />
�� Roberts, Henry: H. R. H. Model Houses for Families, London 1851; die Übersetzung der<br />
Publikation besorgte C. F. Busse als „Ausgeführte Familienhäuser für die Arbeitenden Klassen,<br />
Heft 1, Berlin 1852 (weitere Hefte folgten nicht)<br />
�� Romberg, J. A.: Über den Mangel an kleinen Wohnungen in unseren Städten; in: Zeitschrift für<br />
praktische Baukunst, Jg. 5/1845<br />
�� von Saldern, Adelheid: Häuserleben, Bonn 1997<br />
�� Sax, Emil: Die Wohnungszustände der arbeitenden Klassen und ihre Reform, Wien 1869<br />
�� Schmoll gen. Eisenwerth, Fritz: Wohnungsnot und Wohnungsreform in Deutschland; Diss.<br />
Stuttgart 1979<br />
�� ders.: Schneller Wohnen; in: Borst, Renate u. a. (Hg.): <strong>Das</strong> neue Gesicht der Städte, Basel u. a.,<br />
1990, S. 286 ff<br />
�� Schmoll gen. Eisenwerth, J. A.: Stilpluralismus statt Einheitszwang – Zur Kritik der Stilepochenkunstgeschichte;<br />
in: Argo – Festschrift für Kurt Badt, Köln 1970, S. 77 ff<br />
�� Schwabe, Hermann: <strong>Das</strong> Verhältnis von Miethe und Einkommen in Berlin; in: Berlin und seine<br />
Entwicklung – Gemeinde-Kalender und städtisches Jahrbuch für 1868<br />
�� Sitta, Josef: Die Entwicklung der gemeinnützigen Bautätigkeit in Nürnberg von 1850 bis 1930;<br />
Wirtschaftswiss. Diplomarbeit Erlangen-Nürnberg 1965 (Typoskript vorh. in Stadtarchiv<br />
Nürnberg), S. 28<br />
�� Seifert/Bodenschatz/Lorenz: <strong>Das</strong> Finowtal im Barnim, Berlin 2000<br />
�� Sinn/Expertenkommission, Wohnungspolitik auf dem Prüfstand, Tübingen 1994