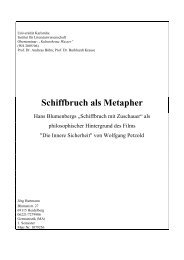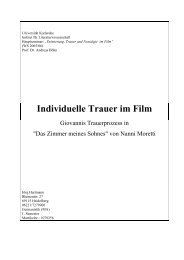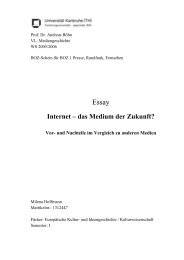Das Verhältnis von Spiel, Liebe und Alltag im Film „Jeux d'enfants“
Das Verhältnis von Spiel, Liebe und Alltag im Film „Jeux d'enfants“
Das Verhältnis von Spiel, Liebe und Alltag im Film „Jeux d'enfants“
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
UNIVERSITÄT KARLSRUHE (TH)<br />
Institut für Literaturwissenschaft<br />
Hauptseminar <strong>Spiel</strong> in Literatur <strong>und</strong> <strong>Film</strong><br />
(WS 2007/08)<br />
Prof. Dr. A. Böhn<br />
<strong>Das</strong> <strong>Verhältnis</strong> <strong>von</strong> <strong>Spiel</strong>, <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Alltag</strong> <strong>im</strong> <strong>Film</strong> <strong>„Jeux</strong> d’enfants“<br />
Manuela Popp<br />
Gerwigstraße 20<br />
76131 Karlsruhe<br />
0721/2049755<br />
Germanistik (HF)/Mult<strong>im</strong>edia (NF); BA<br />
5. Semester<br />
Matrikelnummer:1314512
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einführung......................................................................................................................1<br />
2. <strong>Das</strong> Wettspiel Sophies <strong>und</strong> Juliens.................................................................................2<br />
2.1 Die Ausgangsbedingungen des <strong>Spiel</strong>s...........................................................................2<br />
2.2 Die Wetten in der Kindheit............................................................................................5<br />
2.3 Die Wetten der Jugend...................................................................................................7<br />
2.4 <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> <strong>im</strong> Erwachsenenalter.....................................................................................9<br />
2.5 Der Tod........................................................................................................................13<br />
3. <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong>.............................................................................................................15<br />
3.1 <strong>Liebe</strong> als <strong>Spiel</strong>? ...........................................................................................................15<br />
3.2 <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> als Amour fou..............................................................................................16<br />
4. <strong>Alltag</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong>............................................................................................................18<br />
4.1 Der Begriff des <strong>Alltag</strong>s.................................................................................................18<br />
4.2 Der <strong>Alltag</strong> Juliens .................................................................................................... ...20<br />
4.2.1 Beziehung zum Vater.............................................................................................20<br />
4.2.2 Juliens Privatleben <strong>und</strong> Arbeit................................................................................21<br />
4.3 Der <strong>Alltag</strong> Sophies.......................................................................................................21<br />
4.4 Die Sonderrealität des <strong>Spiel</strong>s.......................................................................................22<br />
4.5 <strong>Alltag</strong> als <strong>Spiel</strong>? ..........................................................................................................24<br />
5. <strong>Das</strong> <strong>Verhältnis</strong> <strong>von</strong> <strong>Alltag</strong>, <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong>.................................................................24<br />
6. Was wäre, wenn? .........................................................................................................25
1. Einführung<br />
1<br />
Der Kinofilm Jeux d’enfants ist das Debüt des französischen Regisseurs Yann Samuell <strong>und</strong><br />
lief <strong>im</strong> Jahre 2003 in den französischen Kinos, bevor er 2004 auch in Deutschland zu sehen<br />
war. Er war jedoch in keinem der genannten Länder ein großer kommerzieller Erfolg. In<br />
Frankreich stand er in der Jahresstatistik 2003 mit 1,04 Mio. Zuschauern gerade einmal auf<br />
Platz 43 der meistbesuchten <strong>Film</strong>e. 1 Betrachtet man nur die französischen Produktionen, so<br />
steht er <strong>im</strong>merhin auf Platz 13, aber dennoch weit hinter den erfolgreichsten französischen<br />
Produktionen dieses Jahrs „Taxi 3“ (6,06 Mio. Zuschauer) <strong>und</strong> „Chouchou“ (3,80 Mio.<br />
Zuschauer). Auch bei der Kritik viel der <strong>Film</strong> durch:<br />
„La vie est cruelle, les scénaristes et les réalisateurs aussi – pour leurs personnages comme pour leur<br />
public. Tandis que se succèdent les blagues de potaches et les coups de théâtre téléphonés longue<br />
distance, il reste au spectateur la possibilité de méditer sur la résurrection des aspects les plus rances<br />
du vieux réalisme poétique.“ 2<br />
In Deutschland stellte der <strong>Film</strong> ebenfalls keinen kommerziellen Erfolg dar – aber zumindest<br />
<strong>von</strong> den Kritikern wurde er wohlwollender aufgenommen:<br />
„Aber was der französische Regisseur vorführt, <strong>von</strong> den Darstellern Guillaume Canet <strong>und</strong> Marion<br />
Cotillard in allen Phasen der Selbstentäußerung prächtig unterstützt, beweist Szene um Szene, welche<br />
w<strong>und</strong>erbaren Kinoüberraschungen die Kraft der Anarchie gebären kann.“(FAZ) 3<br />
„Samuell zeigt das Zusammenleben der beiden, das eher an ein Duell als an eine romantische Liaison<br />
erinnert, mit manchmal kitschigen, oft grandios st<strong>im</strong>mungsvollen <strong>und</strong> surrealen Bildern. Die Eleganz<br />
<strong>und</strong> Souveränität, mit der Samuell Szenen <strong>von</strong> mitreißender Magie erschafft, ist für ein Regie-Debüt<br />
bemerkenswert.“ (Münchner Merkur) 4<br />
Diesem Abwechslungsreichtum <strong>und</strong> der zynischen Subvertierung der Zuckerbäcker-Optik ist es zu<br />
verdanken, dass Jeux d’enfants so viel mehr geworden ist als eine bloße Kopie: Ein <strong>Film</strong> über das<br />
<strong>Spiel</strong>en <strong>und</strong> die <strong>Liebe</strong> - <strong>und</strong> vor allem über den Zusammenhang zwischen beidem. Ein <strong>Film</strong> auch über<br />
das Kino, über das, was man unter den Bildern etwa einer Amélie entdecken kann, wenn man nur tief<br />
genug gräbt.(filmzentrale.com) 5<br />
Es handelt sich be<strong>im</strong> <strong>Film</strong> <strong>„Jeux</strong> d’enfants“ mehr um einen Insider-<strong>Film</strong>, der <strong>von</strong> einem<br />
cineastisch versierten Publikum geschätzt wird, als um einen kanonisiert für gut bef<strong>und</strong>enen,<br />
1<br />
Statistik des centre national de la cinématographie.<br />
2<br />
Jean-Michel Frodon: Jeux d’enfants. In: Cahier du cinéma 582 (2003), S. 36.<br />
3<br />
Hans-Dieter Seidel: Schreckliche Kinder: Yann Samuells <strong>Film</strong> „<strong>Liebe</strong> mich, wenn du dich traust“. In: FAZ<br />
(11.08.2004), S. 35.<br />
4<br />
Ulricke Frick: Die heilige Dose. In: Münchner Merkur. http://www.merkuronline.de/mm_alt/nachrichten/kultur/film/art368,307983<br />
5<br />
Benjamin Happel: <strong>Liebe</strong> mich, wenn du dich traust. In: <strong>Film</strong>zentrale.<br />
http://www.filmzentrale.com/rezis/liebemichwenndudichtraustbh.htm, aufgerufen am 13.03.2008.
2<br />
erfolgreichen Kinofilm. Doch ganz unabhängig <strong>von</strong> dieser Tatsache ist er, unter dem Aspekt<br />
„<strong>Spiel</strong>“ betrachtet, ein interessantes <strong>und</strong> der Analyse berechtigtes Kunstwerk.<br />
In dieser Arbeit soll das <strong>Verhältnis</strong> <strong>von</strong> <strong>Spiel</strong>, <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Alltag</strong> untersucht, sowie gezeigt<br />
werden, dass das <strong>Spiel</strong> zwischen Sophie <strong>und</strong> Julien eine Form der Amour fou darstellt. Diese<br />
wahnsinnige, unerfüllte <strong>Liebe</strong> ist die Gr<strong>und</strong>lage des <strong>Spiel</strong>s, mit dessen Hilfe die beiden<br />
Protagonisten ihrem als langweilig <strong>und</strong> gleichförmig empf<strong>und</strong>enen <strong>Alltag</strong> entfliehen können.<br />
2. <strong>Das</strong> Wettspiel Sophies <strong>und</strong> Juliens<br />
Der <strong>Film</strong> <strong>„Jeux</strong> d’enfants“ thematisiert eine Form des <strong>Spiel</strong>s, die sehr häufig bei Kindern<br />
anzutreffen ist: <strong>Das</strong> Wettspiel. Es handelt sich nicht um das Wetten als Form des<br />
Glücksspiels, wie es bei Erwachsenen häufig anzutreffen ist, sondern um das Abschließen <strong>von</strong><br />
Wetten zwischen zwei Parteien, deren Erfüllung <strong>von</strong> der jeweils anderen gefordert wird. Ein<br />
Teilnehmer kann somit durch sein Handeln direkt Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Die<br />
Gr<strong>und</strong>frage lautet jedes Mal: „Wetten, dass du dich (nicht) traust?“, die der Partner durch die<br />
Ausführung eben jener Tatsache, um die es sich handelt, beantworten muss. Im Französischen<br />
wird diese Frage mit „cap ou pas cap?“ gestellt, in der deutschen Synchronisation mit „Top<br />
oder Flop?“ übersetzt. Im Folgenden soll gezeigt werden, wie es zum Beginn des <strong>Spiel</strong>s<br />
zwischen Julien <strong>und</strong> Sophie kommen kann, sowie die Wetten zwischen den beiden <strong>im</strong><br />
Einzelnen vorgestellt <strong>und</strong> ihre Bedeutung für den Verlauf der Geschichte dargelegt werden.<br />
2.1 Die Ausgangsbedingungen des <strong>Spiel</strong>s<br />
Der <strong>Film</strong> beginnt nach einem kurzen Prolog, in welchem Julien aus dem Off <strong>von</strong> <strong>Spiel</strong>en <strong>im</strong><br />
Allgemeinen erzählt, mit der Erklärung, wie es zu dem <strong>Spiel</strong> zwischen ihm <strong>und</strong> Sophie kam:<br />
„Ce jeux il a commencé avec une jolie maison, un joli bus sans conducteur, une jolie boîte et<br />
une jolie copine.“ (Minute 3:10) Doch gleich darauf wendet er ein: „Non, en vérité je me<br />
trompe. Le jeux a commencé un petit peu plutôt. Il a commencé par un mot dégoûtant qui veut<br />
rien dire de tout. Un mot comme: métastases.“ (Minute 3:24)<br />
Noch bevor näher darauf eingegangen wird, um welche Art <strong>von</strong> <strong>Spiel</strong> es sich überhaupt<br />
handelt, werden zunächst dessen Hintergründe erläutert.<br />
Juliens Mutter bekommt <strong>von</strong> einem Arzt die Diagnose Krebs gestellt, was für Julien jedoch<br />
ein leerer Begriff ist. „Metastasen“ stehe für ihn auf der selben Stufe wie „Mammut“, beides
3<br />
seien Begriffe, die für ihn nichts bedeuten. Er spürt jedoch intuitiv, dass es sich bei<br />
Metastasen um etwas Negatives handelt, <strong>und</strong> projiziert diese negativen Gefühle auf den Arzt,<br />
der die Mutter zu Hause besucht. Dieser fremde Mann stört die enge Beziehung, die Julien zu<br />
seiner Mutter hat. Bei einem Hausbesuch versteckt sich der Junge unter dem Bett seiner<br />
Mutter, beobachtet den Arzt kritisch <strong>und</strong> findet seine Hose „doof“. Es ist anzunehmen, dass er<br />
den schlechten Ges<strong>und</strong>heitszustand seiner Mutter <strong>und</strong> das Auftauchen des Arztes miteinander<br />
in Verbindung setzt, womöglich sogar Ursache <strong>und</strong> Wirkung verwechselt. Die enge<br />
Beziehung zu seiner Mutter findet bald darauf durch deren Tod ein abruptes Ende.<br />
Mit einer losen Assoziation Juliens wird daraufhin Sophie in die Geschichte eingeführt. Es<br />
gebe noch andere „doofe Wörter“, wie zum Beispiel „Kowalsky“ <strong>und</strong> „Polacke“ (Minute<br />
3:51). <strong>Das</strong> Bild zeigt daraufhin, wie Sophie auf der Straße steht <strong>und</strong> auf den Schulbus wartet,<br />
umringt <strong>von</strong> ihren Mitschülern, die sie besch<strong>im</strong>pfen. Ihre Schultasche wird auf die nasse<br />
Straße ausgeleert, <strong>und</strong> die Kinder machen sich über die Herkunft des Mädchens lustig. Später<br />
erfährt man zudem, dass Sophie aus einer ärmeren Familie stammt <strong>und</strong> mit dieser in einer<br />
Sozialwohnung lebt. Diese beiden Tatsachen, ihre polnische Abstammung sowie die armen<br />
materiellen <strong>Verhältnis</strong>se, machen Sophie zu einer Außenseiterin.<br />
Beide, Julien <strong>und</strong> Sophie, sind also in ihrer Lebensrealität mit negativen Situationen<br />
konfrontiert. Diese stellen nicht nur ein kurzfristiges Problem dar, sondern haben großen<br />
Einfluss auf deren jeweiliges Leben. Resultierend daraus fühlen sie sich in diesem nicht wohl.<br />
Auch wenn es sich um verschiedene konkrete Situationen handelt, ist die empf<strong>und</strong>ene<br />
Benachteiligung gleich. Diese Gleichheit ist die Gr<strong>und</strong>voraussetzung für ein agonales <strong>Spiel</strong><br />
wie das Wettspiel, das sich zwischen Sophie <strong>und</strong> Julien entwickelt. Denn nur auf Basis einer<br />
gegebenen oder künstlich geschaffenen Gleichheit <strong>im</strong> Rahmen des <strong>Spiel</strong>s können die<br />
Handlungen der Mitspieler vergleichbar gemacht werden. Dies gilt für alle agonalen <strong>Spiel</strong>e. 6<br />
<strong>Das</strong> kindliche Wetten gehört zu dieser Form der agonalen <strong>Spiel</strong>e, das sich durch seinen<br />
Wettkampfcharakter auszeichnet.<br />
<strong>Das</strong>s das Wettspiel zwischen Julien <strong>und</strong> Sophie in die Kategorie „<strong>Spiel</strong>“ eingeordnet werden<br />
kann, lässt sich auch durch die Anwendung der drei formalen Kennzeichen des <strong>Spiel</strong>s <strong>von</strong><br />
Huizinga 7 zeigen:<br />
6 Roger Callois: Die <strong>Spiel</strong>e <strong>und</strong> die Menschen. Maske <strong>und</strong> Rausch. Frankfurt/M, Berlin 1982, S. 21.<br />
7 Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur <strong>im</strong> <strong>Spiel</strong>. Reinbek bei Hamburg 1956, S. 14 ff.
4<br />
<strong>Das</strong> erste Kriterium für ein <strong>Spiel</strong> ist die Freiheit: es muss nicht gespielt werden, aber es gibt<br />
Gründe dafür, es dennoch zu tun. Diese sind <strong>im</strong> Fall <strong>von</strong> Julien <strong>und</strong> Sophie die<br />
Unzufriedenheit mit ihrem wirklichen Leben. Sophies Angebot der ersten Wette an Julien ist<br />
ihre eigene, freie Entscheidung, die jedoch durch die Diskr<strong>im</strong>inierung durch ihrer Mitschüler<br />
ausgelöst wird.<br />
<strong>Das</strong> zweite Kriterium ist die Sonderrealität des <strong>Spiel</strong>s: „<strong>Spiel</strong> ist nicht das ‚gewöhnliche’<br />
oder das ‚eigentliche’ Leben“ 8 , vielmehr ein Heraustreten aus ihm in eine zeitweilig andere<br />
Sphäre; man „tut bloß so“. <strong>Das</strong> es sich um ein <strong>Spiel</strong> handelt, das beide wirklich ernst nehmen,<br />
aber dennoch als <strong>Spiel</strong> begreifen, wird an dem Dialog deutlich, nachdem sie sich das erste<br />
Mal küssen. Sophie fordert <strong>von</strong> Julien: „<strong>Liebe</strong> mich“, was dieser mit „Cap“ beantwortet. Was<br />
<strong>von</strong> Julien vielleicht nur als Witz gemeint war, wird <strong>von</strong> Sophie sehr ernst aufgefasst <strong>und</strong><br />
entsetzt sie. In diesem Moment wird ihr klar, dass sie Julien nicht außerhalb ihrer <strong>Spiel</strong>s<br />
vertrauen kann – nur was Teil des <strong>Spiel</strong>s ist, ist für beide verbindlich. Es ist Sophie nicht<br />
möglich, eine Forderung an Julien innerhalb der „eigentlichen“ Realität zu stellen. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong><br />
findet in einer Sonderrealität statt, in der sich Sophie <strong>und</strong> Julien für die Zeit ihrer Wetten<br />
bewegen.<br />
<strong>Das</strong> dritte Kriterium des <strong>Spiel</strong>s ist seine Abgeschlossenheit <strong>und</strong> Begrenztheit: es wird<br />
innerhalb <strong>von</strong> best<strong>im</strong>mter Grenzen <strong>von</strong> Zeit <strong>und</strong> Raum gespielt. Dieser Punkt trifft auf das<br />
<strong>Spiel</strong> <strong>von</strong> Sophie <strong>und</strong> Julien nur teilweise zu. Sobald Sophie <strong>und</strong> Julien aufeinander treffen,<br />
treten sie automatisch in die Welt des <strong>Spiel</strong>s ein. Es ist somit auf die Zeit begrenzt, die Sophie<br />
<strong>und</strong> Julien zusammen verbringen. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> kennt jedoch kaum eine räumliche<br />
Abgetrenntheit zur Lebensrealität der beiden <strong>Spiel</strong>er. Jeder Ort, außer dem Zuhause Sophies,<br />
was <strong>im</strong> nächsten Abschnitt genauer erläutert wird, kann sich in einen Teil des <strong>Spiel</strong>felds<br />
verwandeln, wenn eine Aufgabe gestellt wird. Voraussetzung für das <strong>Spiel</strong> ist allerdings die<br />
räumliche Anwesenheit der <strong>Spiel</strong>dose. Dies wird in der Krankenhausszene deutlich (Minute<br />
19:45): Da Julien nicht <strong>im</strong> Besitz der Dose ist, kann er seiner Mutter keine Wette stellen. Ein<br />
zeitliches Ende für das <strong>Spiel</strong> ist jedoch nicht gegeben, beziehungsweise tritt erst mit dem Tod<br />
eines der beiden Mitspieler ein. Es handelt sich um ein lebenslanges <strong>Spiel</strong>, eine Art<br />
lebenslangen Pakt.<br />
8 Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur <strong>im</strong> <strong>Spiel</strong>. Reinbek bei Hamburg 1956, S. 14.
5<br />
Jedes <strong>Spiel</strong> unterliegt Regeln. „Sie best<strong>im</strong>men, was innerhalb der zeitweiligen Welt, die es<br />
herausgetrennt hat, gelten soll. Die Regeln eines <strong>Spiel</strong>s sind unbedingt bindend <strong>und</strong> dulden<br />
keine Zweifel.“ 9 Für das <strong>Spiel</strong> Juliens <strong>und</strong> Sophies gibt es eine Hauptregel. Wer die Dose<br />
besitzt, darf dem anderen eine Wette stellen, die dieser erfüllen muss. Ausgehend <strong>von</strong> dieser<br />
Gr<strong>und</strong>regel zeigt sich <strong>im</strong> Laufe der Geschichte jedoch noch eine weitere Regel. Es gibt einen<br />
Ort, der zum Tabu gemacht wird: <strong>Das</strong> Zuhause Sophies. Sie schämt sich für ihre Herkunft <strong>und</strong><br />
will nicht, dass Julien sie dort besucht. Als dieser gegen die Regel verstößt, ändert sich das<br />
<strong>Spiel</strong>. Bislang erzeugte es Nähe zwischen Sophie <strong>und</strong> Julien <strong>und</strong> festigte ihre Bindung. Ab<br />
diesem Zeitpunkt kehrt sich das <strong>Spiel</strong> in sein Gegenteil um <strong>und</strong> wird zum trennenden Element<br />
zwischen den beiden Protagonisten. Für alle <strong>Spiel</strong>e gilt: „Sobald die Regeln übertreten<br />
werden, stürzt die <strong>Spiel</strong>welt zusammen.“ 10<br />
2.2 Die Wetten in der Kindheit<br />
<strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> beginnt mit einer Wette, die Sophie an Julien stellt, damit dieser sich seine<br />
<strong>Spiel</strong>dose zurückholen kann. Zuvor reichte er diese Sophie als Geste kindlichen Mitgefühls,<br />
nachdem deren Mitschüler ihre Schultasche auf die Straße ausleeren. Während der Busfahrer<br />
Sophie be<strong>im</strong> Aufsammeln ihrer Schulhefte hilft, löst Julien die Handbremse des Busses, der<br />
daraufhin die Straße hinunter rollt. Bereits hier wird deutlich, dass das <strong>Spiel</strong> <strong>von</strong> Sophie <strong>und</strong><br />
Julien außerhalb der Konventionen verläuft. Der Busfahrer, der sich durch seine<br />
Hilfsbereitschaft auszeichnet, <strong>und</strong> die Schüler, die Sophie besch<strong>im</strong>pft haben, sind die<br />
Leidtragenden, also diejenigen, auf deren Kosten die Wette erfüllt wird. Während dies aus<br />
Sicht Sophies <strong>und</strong> Juliens eine durchaus gerechte Rache an den Schülern ist, kann man das für<br />
den Busfahrer nicht behaupten. Er wird sozusagen für seine gute Tat bestraft. Es wird schon<br />
anhand der ersten Wette deutlich, dass sich ihr <strong>Spiel</strong> nicht an moralischen Gr<strong>und</strong>sätzen<br />
orientiert, sondern es ausschließlich um die Erfüllung der dem <strong>Spiel</strong> <strong>im</strong>manenten Regeln geht.<br />
Es ist ein typisches Charakteristikum des <strong>Spiel</strong>s, dass herkömmliche Regeln außer Kraft<br />
gesetzt werden <strong>und</strong> eigene <strong>Spiel</strong>regeln gelten. Gesellschaftliche Normen, Gesetze <strong>und</strong> Werte<br />
haben für Sophie <strong>und</strong> Julien keine Gültigkeit. Sie leben nach den Regeln ihres eigenes <strong>Spiel</strong>s,<br />
dessen <strong>Spiel</strong>feld ihr gesamtes Umfeld umfasst, <strong>und</strong> bewerten Handlungen nicht nach<br />
gesellschaftlich anerkannten Gr<strong>und</strong>sätzen.<br />
9 Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur <strong>im</strong> <strong>Spiel</strong>. Reinbek bei Hamburg 1956, S. 18.<br />
10 Ebd., S. 18.
6<br />
Die zweite, ausführlich dargestellte Wette wird <strong>von</strong> Julien an Sophie gestellt. Die beiden<br />
Kinder gehen in die selbe Schulklasse <strong>und</strong> werden dort <strong>von</strong> ihrer Lehrerin aufgefordert,<br />
Wörter, die mit dem Buchstaben „B“ beginnen, zu nennen. Sophie meldet sich, wird<br />
aufgerufen, <strong>und</strong> beginnt in der deutschen Synchronisation aufzuzählen:<br />
„Bockmist, bumsen, Busen, Biene, Bordell, borstig, brünstig, biedere Bohnenstange, blödes<br />
Biest, bumst böses Biest“ (Minute 8:25). Die Lehrerin ist sehr erbost über diese Nennungen<br />
Sophies, <strong>und</strong> schickt sie zum Direktor. An der Dose, die nach dieser Aufzählung <strong>von</strong> Julien<br />
an Sophie gegeben wird, ist zu erkennen, dass es sich um eine Wette handelte. Julien, der<br />
durch die Übergabe der <strong>Spiel</strong>dose seine Komplizenschaft zu Sophie verraten hat, wird mit<br />
zum Direktor geschickt. In dieser Szene wird die fehlende Anerkennung <strong>von</strong><br />
Autoritätspersonen deutlich. Im <strong>Spiel</strong> gelten keine in der Gesellschaft anerkannten Autoritäten<br />
oder Hierarchien, wie sie zwischen einer Lehrerin <strong>und</strong> ihren Schülern normalerweise üblich<br />
sind.<br />
Im Büro des Direktors wird der Zuschauer Zeuge der dritten Wette. Während der Direktor den<br />
beiden Kindern eine Standpauke über Disziplin <strong>und</strong> Respekt hält, willigt Julien mit einem<br />
leise zu Sophie geflüstertem „Cap“ (Die Wette gilt) in eine dem Zuschauer bis dahin<br />
unbekannte, weitere Wette ein. Kurz darauf wird klar, was der Inhalt der Wette ist: Julien<br />
uriniert durch seine Hose auf den Fußboden des Z<strong>im</strong>mers des Direktors. Auch gegenüber dem<br />
Direktor, der in der Hierarchie noch einmal höher steht, greift das Autoritätsprinzip nicht.<br />
Diese beiden Wetten werden in einem darauf folgenden Tagtraum Juliens als Puppentheater<br />
wiedergegeben, das sich christlicher Metaphern bedient. Sophie <strong>und</strong> Julien stehen als Adam<br />
<strong>und</strong> Eva <strong>im</strong> Paradies, <strong>und</strong> Sophie fordert Julien mit dem Apfel der Verführung zu einer Wette<br />
auf. Der Direktor taucht in der Gestalt Gottes auf <strong>und</strong> bestraft die Kinder für ihr <strong>Spiel</strong> mit<br />
verschiedenen Qualen des Lebens, die <strong>von</strong> Abmagerungskuren bis zu Atomkriegen reichen.<br />
Als besonders schl<strong>im</strong>me Strafe erwähnt er zuletzt hübsche, kranke Mamas. Dies ist, aus der<br />
subjektiven Perspektive Juliens, das Schl<strong>im</strong>mste, was passieren kann. Mit dem Beginn des<br />
<strong>Spiel</strong>s verlieren Sophie <strong>und</strong> Julien ihre Unschuld <strong>und</strong> treten in die Welt des Unglücks ein.<br />
Während der Hochzeit <strong>von</strong> Sophies Schwester spielen sich die nächsten Wetten ab. Die<br />
beiden Kinder haben sich unter die lange Reihe <strong>von</strong> Tischen zurückgezogen <strong>und</strong> unterhalten<br />
sich dort über ihre Zukunftspläne. Danach fordert Sophie Julien dazu auf, ihr seine<br />
Geschlechtsteile zu zeigen. Dieser erfüllt die Aufgabe <strong>und</strong> fordert Sophie dazu auf, das<br />
Gleiche zu tun. Obwohl sie anmerkt, dass es eigentlich nicht <strong>im</strong> Sinne der <strong>Spiel</strong>regeln sei,
7<br />
eine Wette „zurückzustellen“, führt sie diese aus. Sie kritisiert die Form der Wette, jedoch<br />
nicht ihren Inhalt. Passend zu der dadurch aufgebauten Int<strong>im</strong>ität versucht Julien, Sophie zu<br />
küssen. Doch diese wehrt ihn mit den Worten ab: „C’est tellement plus s<strong>im</strong>ple d’être amis.“<br />
(Minute 18:49).<br />
Daraufhin schlägt ihm Sophie sofort die nächste Wette vor. Er muss das Tischtuch, auf dem<br />
sich die Hochzeitstorte befindet, herunter ziehen. Diese Wette dient vor allem der Auflösung<br />
der unangenehmen Situation, in der sich die beiden nach diesem missglückten, kindlichen<br />
Annäherungsversuch befinden. Somit wird sofort wieder der <strong>Spiel</strong>charakter hergestellt <strong>und</strong><br />
weder den Protagonisten, noch dem Publikum Zeit gelassen, die Bedeutung dieser „Abfuhr“<br />
wahrzunehmen.<br />
Eine letzte Wette wird in der Kindheit dargestellt. Diese findet jedoch nicht zwischen Julien<br />
<strong>und</strong> Sophie statt, sondern wird <strong>von</strong> Julien an seine Mutter gerichtet. Als diese <strong>im</strong><br />
Krankenhaus liegt, richtet ihr Sohn die Worte an sie: „Tu vas guérir, non? Cap ou pas cap?“<br />
(Minute 19:47). Doch seine Mutter antwortet ihm: „C’est pas toi qui a la boîte, mon cœur.“<br />
(Minute 19:54). Ohne die <strong>Spiel</strong>dose ist es demnach nicht möglich, eine Wette an eine andere<br />
Person zu stellen. Als Julien los laufen will, um sie zu holen, wird er noch <strong>im</strong> Krankenz<strong>im</strong>mer<br />
<strong>von</strong> seinem Vater aufgehalten. Kurze Zeit später steht Sophie mit der Dose in der Hand in der<br />
Z<strong>im</strong>mertür. Doch Julien glaubt, dass sie nur gekommen sei, um ihm eine weitere Aufgabe zu<br />
stellen. Der ernst gemeinte Hintergr<strong>und</strong> des Besuchs wird <strong>von</strong> Julien nicht wahrgenommen.<br />
Dem Zuschauer erschließt sich dieser jedoch anhand eines Blumenstraußes, den Sophie,<br />
nachdem sie aus dem Z<strong>im</strong>mer gegangen ist, in den Abfalle<strong>im</strong>er wirft, <strong>und</strong> der scheinbar für<br />
Juliens Mutter best<strong>im</strong>mt war. Hier wird das erste Mal deutlich, dass es Julien <strong>und</strong> Sophie<br />
nicht möglich ist, außerhalb ihres <strong>Spiel</strong>s auf ernsthafte Weise zu kommunizieren. Der<br />
Versuch der aufrichtig gemeinten Anteilnahme muss scheitern, da er nicht den Regeln des<br />
<strong>Spiel</strong>s gehorcht. Nur Handlungen, die Teil einer Wette sind, funktionieren zwischen den<br />
beiden.<br />
2.3 Die Wetten der Jugend<br />
Die nächste Wette findet nach einem zehnjährigen Zeitsprung statt. Mittlerweile sind Sophie<br />
<strong>und</strong> Julien 18-jährige Studenten, die eine enge Fre<strong>und</strong>schaft führen. Sophie verbringt viel Zeit<br />
<strong>im</strong> Hause der Janviers <strong>und</strong> ist eine Art Ziehschwester Juliens geworden.<br />
Obwohl sie bereits sehr spät für ihre, an diesem Tag stattfindende, mündliche Matheprüfung<br />
aufgestanden ist, fordert Julien sie heraus: Die Unterwäsche über die normale Oberbekleidung
8<br />
anziehen <strong>und</strong> so vor die Prüfer treten. Zwar findet dieser Vorschlag bei Sophie keinen<br />
freudigen Anklang, doch es ist klar, dass sie die Wette erfüllt. Eine Nichterfüllung ist keine<br />
Option. Es ist ein Kennzeichen aller bisherigen Wetten, dass es außer Frage steht, ob sie<br />
erfüllt werden – unabhängig der möglichen Konsequenzen. Bisweilen scheint es sogar so, als<br />
ob möglichst drastische Folgen den Reiz der Wetten erhöhten. Dies ist ein typisches<br />
Kennzeichen für <strong>Spiel</strong>e: Es wird Spannung gesucht, denn diese bereitet Lust. Auf diesen<br />
Punkt wird in Abschnitt 4.1 genauer eingegangen.<br />
Kurz darauf zeigt sich, dass die Wetten mittlerweile auch den sexuellen Bereich umfassen.<br />
Die kindlich-neugierige Form der Körperlichkeit, wie dem Zeigen der Geschlechtsorgane, hat<br />
sich weiterentwickelt. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> hat seine kindliche Unschuld, die es nie wirklich besaß, nun<br />
gänzlich verloren. Sophie fordert Julien dazu auf, mit Aurelie Miller, einer Kommilitonin, zu<br />
schlafen, <strong>und</strong> dieser dabei ihre Ohrringe abzunehmen. Sophie verletzt sich mit dieser Wette<br />
selbst. Denn die Unterstellung Juliens, Sophie sei eifersüchtig auf dieses Mädchen, trifft die<br />
Wahrheit. Möglicherweise hegt Sophie den Wunsch, Julien an eine Grenze zu führen, deren<br />
Überschreitung er nicht wagt. Doch er erfüllt die Wette regelgemäß. Die Ohrringe, die er<br />
Sophie später überreicht, wirft diese in den Abfluss, mit der Genugtuung, dass Aurelie nun<br />
gar nichts Wertvolles mehr besitze.<br />
Auch die nächste Wette spielt <strong>im</strong> sexuellen Bereich. Igor, der Sportlehrer, mit dem Aurelie<br />
Miller angeblich, <strong>und</strong> Sophie laut eigener Aussage ebenfalls geschlafen hat, ist das Opfer.<br />
Sophie muss Igor abwechselnd mit Julien ohrfeigen, <strong>im</strong>mer <strong>und</strong> <strong>im</strong>mer wieder. Dadurch<br />
macht Julien jede weitere sexuelle Annäherung zwischen Igor <strong>und</strong> Sophie unmöglich.<br />
Schlussendlich muss sie ihm sogar zwischen die Beine treten. Bei dieser Aufgabe zieht sie<br />
sich eine Verletzung an der Hand zu, wie man an der nächsten Einstellung erkennen kann<br />
(Minute 33:12). Während Sophie also Julien dazu auffordert, sexuell aktiv zu werden,<br />
verhindert Julien diese Aktivität Sophies durch seine Wette. Dies fördert das gängige<br />
Rollenverhalten <strong>von</strong> aktiv agierendem Mann <strong>und</strong> sich enthaltender Frau. Wie man <strong>im</strong><br />
weiteren Verlauf des <strong>Film</strong>s jedoch mitbekommt, entspricht Sophie nicht dem Typus der<br />
passiven Frau. Nur innerhalb der Wette tritt dieser Zug zu Tage. Auf die gesamte Geschichte<br />
bezogen, repräsentiert Sophie vielmehr das aktive Prinzip. Sie initiiert die erste Wette, sie<br />
bietet ihm in einer Wette die <strong>Liebe</strong>sbeziehung an, sie verhindert durch eine Wette den<br />
Kontakt zwischen den beiden für zehn Jahre.
9<br />
Die nächste Wette markiert einen Wendepunkt des <strong>Film</strong>s. Auf dem Nachhauseweg aus der<br />
Universität läuft Sophie auf der anderen Straßenseite als Julien. Sie ist sauer wegen der<br />
vergangenen Wette, bei der sie sich den Arm verletzt hat <strong>und</strong> fordert <strong>von</strong> Julien, sich bei ihr<br />
dafür zu entschuldigen. Doch er sieht dies nicht ein <strong>und</strong> argumentiert, Sophie hätte nicht<br />
wetten sollen. Dies ist jedoch nur ein Scheinargument, denn beide wissen, dass Wetten nicht<br />
abgelehnt werden. Als sich die beiden daraufhin um die <strong>Spiel</strong>dose rangeln, kommt es zur<br />
Annäherung. Ein tiefer Blick in die Augen führt zur Wette: „Embrasse-moi. Cap?“ (Minute<br />
33:45) Auf den schnellen Kuss Juliens reagiert Sophie, indem sie auf ein durch die beiden<br />
blockiertes Auto springt <strong>und</strong> Julien erneut auffordert: „J’ai dit embrasse-moi“ (Minute<br />
34:00), woraufhin dieser mit auf das Autodach steigt <strong>und</strong> Sophie leidenschaftlich küsst. Da<br />
sich der Autobesitzer über dieses Verhalten lautstark aufregt, laufen die beiden Hand in Hand<br />
da<strong>von</strong>, bis sie in einer Hauseinfahrt zum Stehen kommen. Dort fordert ihn Sophie auf: „A<strong>im</strong>e-<br />
moi.“ (Minute 34:48), was Julien mit einem „Cap“ beantwortet. Diese Antwort ist jedoch<br />
nicht das, was Sophie erwartet. Auf die Nachfrage, ob dies ein <strong>Spiel</strong> sei, antwortet Julien, dass<br />
es sich dabei um eine Wette handle, die sie ihm gerade gestellt habe. Daraufhin kippt die<br />
St<strong>im</strong>mung. Sophie wendet sich <strong>von</strong> ihm ab <strong>und</strong> verschwindet, Julien bleibt ratlos in der<br />
Einfahrt zurück. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong>, das bislang der Annäherung der beiden diente, kehrt sich gegen<br />
sie. In der nächsten Einstellung kommentiert Julien diesen Wendepunkt mit der Bemerkung,<br />
dass es Zeit sei, erwachsen zu werden. Dies passiere nicht, wie man als Kind glaubt, ganz<br />
langsam, sondern es erwische einen wie ein Zweig, der zurückschnellt. Zudem redet ihm sein<br />
Vater ins Gewissen. Es sei genug gespielt, <strong>und</strong> er solle sich auf sein Studium konzentrieren.<br />
Die Situation zwischen den beiden eskaliert. Juliens Vater wirft diesem vor, dass seine<br />
<strong>Spiel</strong>chen seine Frau, also Juliens Mutter, umgebracht hätten. Hier kommen bislang<br />
unausgesprochene Schuldvorwürfe zum Ausdruck.<br />
2.4 <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> <strong>im</strong> Erwachsenenalter<br />
Nach der Auseinandersetzung mit seinem Vater läuft Julien zu Sophie nach Hause, obwohl er<br />
ihr versprach, dort nie vorbeizukommen. Sophie reagiert auf dieses gebrochene Versprechen<br />
überaus sauer, n<strong>im</strong>mt seinen Plan, mit ihr da<strong>von</strong> laufen zu wollen, nicht ernst <strong>und</strong> schickt ihn<br />
weg. Wie unter Punkt 2.1 bereits erwähnt, stellt das Aufsuchen <strong>von</strong> Sophies Zuhause einen<br />
Regelbruch dar. Dadurch gerät das <strong>Spiel</strong> in eine andere Bahn. Julien <strong>und</strong> Sophie spielen nicht<br />
mehr gemeinsam gegen ihre Umwelt, sondern gegeneinander. Auf seine Aufforderung, ihm<br />
zu verzeihen, reagiert Sophie nicht.
10<br />
Nach einem Zeitsprung <strong>von</strong> schätzungsweise einigen Monaten versucht Sophie, die gestellte<br />
Wette einzulösen <strong>und</strong> Julien zu verzeihen. Sie will ihn zu Hause aufzusuchen, wird dort<br />
jedoch <strong>von</strong> dessen Vater fortgeschickt. Bei ihrem zweiten Versuch trifft sie ihn in der<br />
Bibliothek, wo sie zuerst einem fremden Jungen gegenüber ihre Entschuldigung übt <strong>und</strong><br />
schließlich zu Julien geht. Doch dieser geht nicht auf Sophie ein, er müsse lernen <strong>und</strong> könne<br />
frühestens in einem Jahr mit ihr reden. In ihrem Gespräch zeigt sich, dass Sophie starke<br />
Minderwertigkeitskomplexe wegen ihrer Herkunft hat. „La HLM [habitation à loyer modéré:<br />
französische Bezeichnung für Sozialwohnung, a.d.V.] c’est mon truc“, (Minute 41:50)<br />
kommentiert Sophie ein Buch über Städtebau, aus dem Julien gerade lernt. Dieser merkt an,<br />
dass sie sich nie über ihre Zukunft unterhalten hätten, <strong>und</strong> kritisiert das Leben <strong>im</strong> <strong>und</strong> für den<br />
Augenblick, das ein Kennzeichen ihrer Beziehung zueinander sei. Nur einmal sei die Zukunft<br />
Thema gewesen, <strong>und</strong> dies treffe die Wahrheit: „Tu est en train de devenir un tyran et moi –<br />
un flan“ (Minute 42:35). Mit diesen Worten verlässt sie ihn. Doch Julien springt auf <strong>und</strong> stellt<br />
sie zur Rede. Allerdings vergrößert sich der Spalt zwischen ihnen noch weiter. Sophie<br />
behauptet, die Männer zu studieren <strong>und</strong> versucht, ihre Stärke <strong>und</strong> Härte zu demonstrieren.<br />
Daraufhin will Julien ihr eine Wette stellen <strong>und</strong> sich für ihr „Studium“ anbieten. Doch auf<br />
ihren forschen Versuch, ihm die Hose zu öffnen, reagiert er ungehalten. Sophie spielt weiter<br />
die Rolle der kaltblütigen Verführerin. „Arrête? Pourquoi? C’est juste un pari.“ (Minute<br />
43:24). Ein letztes Mal versucht Julien, die Dinge zwischen ihm <strong>und</strong> Sophie zum Guten zu<br />
wenden. Er läuft ihr nach <strong>und</strong> erreicht sie vor der Bibliothek. Doch er schafft es nicht, seine<br />
wirklichen Gefühle für sie auszusprechen. Stattdessen drückt er ihr ein Kondom in die Hand<br />
mit der Anmerkung, sie solle bei ihren weiteren Studien vorsichtig sein. Sophie kommentiert<br />
diese Handlung mit den Worten, er werde es niemals schaffen, sie zu verletzen. Dies ist die<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die nächste Wette, die bei ihrem nächsten Zusammentreffen erfüllt werden<br />
wird. Als er schließlich dem Bus nachläuft, in den Sophie steigt, <strong>und</strong> ihm „Je t’a<strong>im</strong>e“<br />
hinterher ruft, ist dies ein weiteres Zeichen für die Unmöglichkeit einer glücklichen<br />
Beziehung. Sobald sich Julien <strong>und</strong> Sophie gegenüberstehen, passiert alles <strong>im</strong> Rahmen des<br />
<strong>Spiel</strong>s <strong>und</strong> echte Gefühle können nicht artikuliert werden. Nur in der Abwesenheit des<br />
anderen kann dies geschehen.<br />
Die ganze Szene demonstriert die Unfähigkeit einer aufrichtigen Kommunikation. Sie<br />
verletzen sich absichtlich gegenseitig, um ihre eigene Schwäche zu verbergen. Beiden<br />
verbietet es ihr Stolz, den nötigen Schritt auf den anderen zuzugehen.
11<br />
Die Erfüllung der nächsten Wette, Sophie zu verletzen, wird <strong>von</strong> Julien <strong>von</strong> langer Hand<br />
geplant. Mit der Einstiegsfrage „Tu a un robe de soirée?“ (Minute 46:40) steht er nicht wie<br />
ausgemacht ein Jahr, sondern vier Jahre später in dem Cafe, in dem Sophie mittlerweile<br />
arbeitet, vor ihr, mit der Absicht sie zum Essen einzuladen. Zuerst blockt ihn Sophie mit einer<br />
betont rationalen Haltung ab, doch Julien schafft es nach einiger Zeit, sie dazu zu bringen,<br />
ihre Meinung zu ändern. <strong>Das</strong> folgende Abendessen findet in einem gehobenen Restaurant<br />
statt. Die dabei entstehende Konversation ist darauf ausgelegt, Sophie glaubhaft zu machen,<br />
dass er sie heiraten möchte. Doch seine eigentliche Absicht ist eine andere. Julien will ihr<br />
seine zukünftige Frau Christelle vorstellen, Sophie als Trauzeugin gewinnen <strong>und</strong> das wahr<br />
machen, was sie nicht für möglich hielt: dass er sie jemals verletzen könne. Doch genau das<br />
gelingt ihm mit dieser Handlung. Es scheint so, als ob dies eine Art Rache an Sophie darstellt.<br />
Eine Rache dafür, dass sie keine Beziehung mit ihm eingehen wollte, da er seine Gefühle ihr<br />
gegenüber nie artikulieren konnte, obwohl sie doch vorhanden waren.<br />
Die Dose wird daraufhin <strong>von</strong> Sophie <strong>und</strong> Julien gemeinsam in einen Fluss geworfen, eine<br />
symbolische Handlung, die das Ende des <strong>Spiel</strong> kennzeichnen könnte. Doch dies ist nicht der<br />
Fall.<br />
Während Juliens <strong>und</strong> Christelles Hochzeit erscheint Sophie mit der <strong>Spiel</strong>dose <strong>und</strong> fordert ihn<br />
dazu auf, zu seiner Wette zu stehen, die noch aus Kindertagen offen stehe: Er müsse „Nein“<br />
vor dem Altar sagen. Doch für Julien ist das <strong>Spiel</strong> vorbei, er heiratet Christelle. <strong>Das</strong><br />
Eingreifen Sophies löst jedoch ein anderes Ereignis aus. Juliens Vater ist über ihr Auftreten so<br />
erbost, dass er sich, enttäuscht darüber, dass dieses Mädchen so viel Einfluss auf seinen Sohn<br />
hatte <strong>und</strong> ihm zufolge <strong>im</strong>mer noch hat, <strong>von</strong> diesem mit den Worten„Tu est banni de ma vie!“<br />
(Minute 56:15) lossagt.<br />
Die darauf folgende Szene zeigt den Wahnsinn des <strong>Spiel</strong>s in sehr drastischer Form. Während<br />
Julien neben den Gleisen einer Bahnstrecke sitzt, steht Sophie mit verb<strong>und</strong>en Augen zwischen<br />
diesen <strong>und</strong> versucht, ihren Auftritt während der Hochzeit zu relativieren. „C’était seulement<br />
une blague!“ (Minute 56:49). Doch Julien reagiert nicht. Es scheint, als ob er nur auf den Zug<br />
warten würde, der auf Sophie zurast. In letzter Sek<strong>und</strong>e reißt sie sich jedoch ihre Augenbinde<br />
herunter <strong>und</strong> springt zur Seite. Sein darauffolgendes „va en enfer“ beantwortet sie mit<br />
„D’accord. Mais tu es mon compagne.“ (Minute 57:57). Hier wird bereits auf den<br />
gemeinsame Tod der beiden vorausgedeutet. Die Szene wird <strong>von</strong> einer weiteren Wette<br />
Sophies abgeschlossen: zehn Jahre ohne ein Wiedersehen.
12<br />
Für Julien ist dies eine furchtbare Vorstellung. Er kann sich nicht denken, ein Leben ohne das<br />
<strong>Spiel</strong>, ohne die „Würze seines Lebens“, wie er es bezeichnet, zu führen. Wie er die darauf<br />
folgenden Jahre empfindet <strong>und</strong> wie er sich mit dem „faden Glück seines <strong>Das</strong>eins“ arrangiert,<br />
wird genauer unter Punkt 4.1 behandelt.<br />
Nach auf den Tag genau zehn Jahren erhält Julien ein Paket <strong>von</strong> Sophie mit der <strong>Spiel</strong>dose,<br />
ihrer Adresse <strong>und</strong> der Frage „Cap, pas cap?“ (Minute 70:15). Er macht sich sofort auf den<br />
Weg zu ihr <strong>und</strong> findet sie dort inmitten ihres verwüsteten Hauses vor. Als er eintritt, greift sie<br />
zum Telefon <strong>und</strong> meldet der Polizei, der Irre sei wieder bei ihr. Es dauere genau eine Minute,<br />
bis die Polizisten eintreffen, teilt sie dem zuerst überraschten, <strong>und</strong> dann in ein Lachen<br />
zwischen Wahnsinn <strong>und</strong> Freude ausbrechenden Julien mit. Während die Sek<strong>und</strong>en ticken,<br />
fügt er sich in die ihm zugeteilte Rolle des wahnsinnigen Irren ein <strong>und</strong> wirft ein wertvolles<br />
Erbstück Sophies zu Boden. Als er die Polizei vor dem Haus eintreffen hört, wendet er sich<br />
<strong>von</strong> Sophie ab, rennt zu seinem Auto <strong>und</strong> beginnt eine Hetzjagd mit den Streifenwägen. Sein<br />
währenddessen gehaltener Monolog illustriert sehr anschaulich seine Empfindungen<br />
bezüglich des <strong>Spiel</strong>s:<br />
„Sacrée Sophie, le jeu avait repris sur les chapeaux de roue. Du bonheur à l'état pur, brut, natif,<br />
volcanique, quel pied ! C'était mieux que tout, mieux que la drogue, mieux que l'héros, mieux que la<br />
dope, coke, crack, fix, joint, shit, shoot, snif, pét', ganja, marie-jeanne, cannabis, beuh, peyotl, buvard,<br />
acide, LSD, extasy. Mieux que le sexe, mieux que la fellation, soixante-neuf, partouze, masturbation,<br />
tantrisme, kama-sutra, brouette thaïlandaise. Mieux que le Nutella au beurre de cacahuète et le milkshake<br />
banane. Mieux que toutes les trilogies de George Lucas, l'intégrale des Muppet Show, la fin de<br />
2001. Mieux que le déhanché d'Emma Peel, Marilyn, la Schtroumpfette, Lara Croft, Naomi Campbell<br />
et le grain de beauté de Cindy Crawford. Mieux que la face B d'Abbey Road, les solos d'Hendrix le<br />
petit pas de Neil Armstrong sur la lune. Le Space Mountain, la ronde du Père Noël, la fortune de Bill<br />
Gates, les transes du Dalaï lama, les NDE, la résurrection de Lazare, toutes les piquouzes de<br />
testostérone de Schwarzy, le collagène dans les lèvres de Pamela Anderson. Mieux que Woodstock et<br />
les rave parties les plus orgasmiques. Mieux que la défonce de Sade, R<strong>im</strong>baud, Morrison et<br />
Castaneda. Mieux que la liberté. Mieux que la vie.“ (Minute 72:30-73:27)<br />
Diese Szene ist ein typisches Beispiel für ein Flow-Erlebnis, das eine Verschmelzung <strong>von</strong><br />
Handlung <strong>und</strong> Bewusstsein beschreibt, die zu einem gesteigerten Existenzbewusstsein führt. 11<br />
Die Verfolgungsjagd Juliens endet abrupt mit einem Unfall, bei dem sein Auto explodiert.<br />
Doch wie <strong>im</strong> Folgenden zu erkennen ist, trägt er nur leichte Schrammen da<strong>von</strong>. Zunächst wird<br />
der Zuschauer jedoch <strong>im</strong> Glauben gelassen, Julien sei bei diesem Unfall schwer zu Schaden<br />
gekommen <strong>und</strong> damit die Perspektive Sophies eingenommen. Diese erfährt telefonisch <strong>von</strong><br />
dem Unfall, wird ins Krankenhaus gerufen <strong>und</strong> bekommt dort <strong>von</strong> Julien einen bösen Scherz<br />
gespielt. Er gibt einen Patienten mit schweren Verbrennungen als sich selbst aus, indem er die<br />
11 Jürgen Fritz: <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> verstehen. Eine Einführung in Theorie <strong>und</strong> Bedeutung. Weinhe<strong>im</strong>, München 2004, S.<br />
99.
13<br />
<strong>Spiel</strong>dose neben dessen Bett stellt. Julien rechtfertigt diese Tat mit dem Kommentar, dass es<br />
nur Teil eines <strong>Spiel</strong>s sei. Doch mittlerweile klingt diese Erklärung nicht mehr überzeugend.<br />
Beide, Julien <strong>und</strong> Sophie, haben längst keine Kontrolle mehr über das <strong>Spiel</strong> <strong>und</strong> würden dafür<br />
alles riskieren. Sophie fällt zuerst auf diesen bösen Witz herein <strong>und</strong> fährt schockiert mit ihrem<br />
Mann, der sie begleitet hat, zurück nach Hause. Doch während sie <strong>im</strong> Auto weiter darüber<br />
nachdenkt, erkennt sie die Wahrheit. Auch Julien sieht ein, welchen Schock er damit Sophie<br />
angetan hat <strong>und</strong> bereut seine Handlung. In einer Art telekinetischer Kommunikation erkennen<br />
beide die Notwendigkeit, zueinander zurückzukehren <strong>und</strong> treffen vor dem Krankenhaus, <strong>im</strong><br />
klischeehaft strömenden Regen, aufeinander. Und Julien findet endlich die richtigen Worte,<br />
indem er Sophie das Lied „La vie en rose“ vorsingt, das als Motiv während des ganzen <strong>Film</strong>s<br />
auftaucht. Durch die Musik spricht er zu ihr <strong>und</strong> kann artikulieren, was ihm bislang nicht<br />
möglich war:<br />
„Quand elle me prend dans ses bras,<br />
Elle me parle tout bas,<br />
Je vois la vie en rose.<br />
Elle me dit des mots d'amour,<br />
Des mots de tous les jours,<br />
Et ça me fait quelque chose.“ (Minute 78:20)<br />
Doch die entstehende Spannung zwischen den beiden wird durch einen Faustschlag <strong>von</strong><br />
Sophies Mann zerstört. Julien fällt bewusstlos zu Boden, <strong>und</strong> Sophie kniet neben ihm nieder.<br />
Ihr Versuch ihn aufzuwecken scheitert zunächst <strong>und</strong> erst als sie ihm eine Wette stellt, kommt<br />
Julien wieder zu Bewusstsein. „Reviens! Cap ou pas cap?“ (Minute 80:22). Sophie hält<br />
Julien in ihren Armen, <strong>und</strong> zunächst scheint es, als ob die beiden endlich zueinander gef<strong>und</strong>en<br />
hätten.<br />
2.5 Der Tod<br />
Doch auf die gerade erlangte Vereinigung folgt das Ende des <strong>Spiel</strong>s. Sophie <strong>und</strong> Julien stehen<br />
auf dem Gr<strong>und</strong> einer Baugrube, eng umschlungen, <strong>und</strong> warten darauf, dass diese mit Beton<br />
aufgefüllt wird. Diese Szene rahmt den <strong>Film</strong>. Zu Beginn erzählte Julien, dass es ein <strong>Spiel</strong> gibt,<br />
das man niemals spielen solle: Sich in einen Betonblock gießen lassen. Doch genau damit<br />
endet das <strong>Spiel</strong> zwischen Sophie <strong>und</strong> Julien.<br />
„Et voilà. C’est comme ça comme on a gagné le jeux. Ensemble. Heureux. Et là en fond du béton on a<br />
enfin partagé notre rève d’enfance – un rève d’un amour sans fin.“ (Minute 82:45).<br />
In ihren letzten Minuten teilt Julien Sophie mit, welche Wetten er außerdem erfüllt hätte, die<br />
ihm Sophie jedoch nie gestellt hat. Die Letzte lautet: „T’a<strong>im</strong>er comme un fou.“ (Minute
14<br />
81:40) Hier wird explizit erwähnt, was unter Punkt 3.2 dargestellt wird: <strong>Das</strong>s es sich bei dem<br />
<strong>Spiel</strong> Sophies <strong>und</strong> Juliens um eine Form der Amour fou, der wahnsinnigen <strong>Liebe</strong>, handelt.<br />
In dem Moment, in dem sich die Beziehung <strong>von</strong> Julien <strong>und</strong> Sophie zu einer <strong>Liebe</strong>sbeziehung<br />
entwickelt, endet das <strong>Spiel</strong>. Und in dem Moment, in dem das <strong>Spiel</strong> endet, endet die Sehnsucht<br />
nach dem anderen, der Höhepunkt ist erreicht <strong>und</strong> nur der Tod kann diesen Höhepunkt ins<br />
Unendliche verlängern.<br />
<strong>Das</strong> alternative Ende, dass auf diese Szene folgt, wird unter Punkt 6 thematisiert.<br />
Die Verbindung <strong>von</strong> <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> Tod ist ein häufiges Motiv der europäischen Literatur. Tristan<br />
<strong>und</strong> Isolde, die als die „idealen <strong>Liebe</strong>nden des Abendlandes“ 12 bezeichnet werden <strong>und</strong> den<br />
gemeinsamen Tod wählen, sind das bekannteste Beispiel dafür. Nur dieser ermöglicht ihnen<br />
die Ewigkeit der <strong>Liebe</strong>, die sie <strong>im</strong> Leben nicht finden konnten. Andere bekannte Beispiele für<br />
die Verknüpfung <strong>von</strong> <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> Tod sind außerdem Shakespeares „Romeo <strong>und</strong> Julia“ oder<br />
Goethes „Die Leiden des jungen Werther“.<br />
Auch wenn man das <strong>Spiel</strong> in der Form des <strong>Liebe</strong>sspiels betrachtet, n<strong>im</strong>mt der Tod eine<br />
wichtige Rolle ein. Ein <strong>Liebe</strong>sspiel kann nur fortdauern, so lange es ein Vorspiel ist. Denn nur<br />
<strong>im</strong> Begehren <strong>und</strong> den Verführungsversuchen ist die <strong>Liebe</strong> ein <strong>Spiel</strong>, da sie nur dort den<br />
Freiraum <strong>und</strong> die Freiheit besitzt, die kennzeichnend für das <strong>Spiel</strong> sind. <strong>Das</strong> Vorspiel kann<br />
jedoch normalerweise nicht ewig verlängert werden. Aber durch das Mittel des Todes ist dies<br />
möglich. Der Tod macht das Begehren unsterblich <strong>und</strong> symbolisiert die Vereinigung des<br />
<strong>Liebe</strong>spaares. Positiv formuliert verhalten sich <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> Tod folgendermaßen zueinander:<br />
„Die <strong>Liebe</strong> in ihrer höchsten Form ist todesbereit. Sie will nicht besitzen, sondern sich<br />
schenken, alles dem Geliebten hingeben.“ 13 Die <strong>Liebe</strong>, die zum Tod bereit ist, kann jedoch<br />
auch eine Amour fou sein, die zur Selbstzerstörung der Partner führen kann:<br />
„Der <strong>Liebe</strong>stod ist der Tod der Amour fou! <strong>Das</strong> ist der Wahnsinn, der nur noch am menschlichen<br />
Leben <strong>und</strong> seiner Zerstörung gemessen werden kann. Daher ist diese Individualisierung <strong>im</strong> Zuge der<br />
Amour fou äußerst gefährlich, weil die individuelle Selbstbefreiung, die Selbstfreisetzung <strong>von</strong><br />
gesellschaftlicher Domestikation <strong>im</strong>mer zugleich in die individuelle Selbstzerstörung umschlagen<br />
kann.“ 14<br />
12 Gabriele Sorgo: Ein seltsames <strong>Spiel</strong>. <strong>Liebe</strong> zwischen Rausch <strong>und</strong> Rationalisierung. In: Bilstein, Winzen et al.<br />
(Hg.): Anthropologie <strong>und</strong> Pädagogik des <strong>Spiel</strong>s. Weinhe<strong>im</strong> 2005, S. 132.<br />
13 Gustav Bally: Vom <strong>Spiel</strong>raum der Freiheit. Basel, Stuttgart 1966, S. 109.<br />
14 Oliver Jahrhaus: Amour fou. Die Erzählung der Amour fou in Literatur, Oper <strong>und</strong> <strong>Film</strong>. Tübingen <strong>und</strong> Basel<br />
2004, S. 13.
3. <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong><br />
15<br />
In welcher Weise hängen <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong> nun genau zusammen? Unter welchen Umständen<br />
ist die <strong>Liebe</strong> ein <strong>Spiel</strong>? Und welche Art der <strong>Liebe</strong> existiert zwischen Julien <strong>und</strong> Sophie? Dies<br />
soll <strong>im</strong> Folgenden geklärt werden.<br />
3.1 <strong>Liebe</strong> als <strong>Spiel</strong>?<br />
Die <strong>Liebe</strong> ist, je nach Definition, das Gefühl der stärksten Zuneigung, die ein Mensch für<br />
einen anderen Menschen empfinden kann. Aber <strong>Liebe</strong> muss vermittelt werden. Ohne<br />
gegenseitige Zuwendung kann keine <strong>Liebe</strong> bestehen. Jede noch so starke <strong>Liebe</strong> n<strong>im</strong>mt durch<br />
das Fehlen <strong>von</strong> Kommunikation mit dem Geliebten ab, bis sie schließlich versiegt. Wäre dies<br />
nicht so, würde jede Trennung <strong>von</strong> einem geliebten Menschen weitere <strong>Liebe</strong>sbeziehungen<br />
verunmöglichen. <strong>Liebe</strong> muss gelebt werden <strong>und</strong> sie benötigt einen int<strong>im</strong>en Rahmen, in dem<br />
sie stattfinden kann. Außerdem führt die <strong>Liebe</strong> dazu, dass sich die <strong>Liebe</strong>nden in ihrer tiefsten<br />
Individualität wahrnehmen, sie erfahren sich als Subjekte <strong>und</strong> gleichzeitig als Teil eines<br />
Ganzen. 15<br />
Diese letzten beiden Punkte sind es, die am deutlichsten die Parallelen zwischen <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Spiel</strong> zeigen. Auch das <strong>Spiel</strong> baut eine eigene Welt auf, einen int<strong>im</strong>en Rahmen, in den nur die<br />
Mitspieler eintreten dürfen. Und auch hier nehmen sich die Teilnehmer in ihrer Individualität<br />
wahr. Jedes eigene Handeln erzeugt eine Reaktion be<strong>im</strong> Gegenüber <strong>und</strong> das Handeln des<br />
anderen wird zur Vorlage für eigenes Tun. Und gleichzeitig erfolgt eine Ausweitung des<br />
Selbst durch den Bezug auf den anderen, <strong>im</strong> <strong>Spiel</strong> genauso wie in der <strong>Liebe</strong>. 16<br />
Trotz dieser Parallelen ordnet Huizinga in seinem Standardwerk zum <strong>Spiel</strong> „Homo ludens“<br />
die <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> das Erotische nicht dem <strong>Spiel</strong> zu:<br />
„Wenn man alles genau betrachtet, scheint man gerade mit Rücksicht auf die erotische Bedeutung des<br />
Worts <strong>Spiel</strong>en, so allgemein verbreitet sie ist <strong>und</strong> so nahe sie bei der Hand liegt, <strong>von</strong> einer typischen<br />
<strong>und</strong> bewussten Metapher sprechen zu müssen.“ 17<br />
Huizinga bezieht das <strong>Liebe</strong>sspiel vor allem auf den Paarungsakt. Dieser hat für ihn keine<br />
spielerischen Elemente. Einige <strong>Spiel</strong>momente gesteht er jedoch dem Vorspiel dieses<br />
biologischen Paarungsakts zu. Je nachdem, was man unter <strong>Liebe</strong>sspiel verstehen möchte,<br />
15<br />
Oliver Jahrhaus: Amour fou. Die Erzählung der Amour fou in Literatur, Oper <strong>und</strong> <strong>Film</strong>. Tübingen <strong>und</strong> Basel<br />
2004, S. 27.<br />
16<br />
Johannes Biltstein et al.: Anthropologie <strong>und</strong> Pädagogik des <strong>Spiel</strong>s. Weinhe<strong>im</strong> <strong>und</strong> Basel 2005, S. 7.<br />
17<br />
Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur <strong>im</strong> <strong>Spiel</strong>. Reinbek bei Hamburg 1956, S. 49.
16<br />
macht der eigentliche Akt jedoch nur einen kleinen Teil des Ganzen aus. <strong>Das</strong> Reizen, das<br />
Verführen <strong>und</strong> das Austesten <strong>von</strong> Grenzen können sehr wohl unter die Kategorie <strong>Spiel</strong> fallen.<br />
Allerdings betont Huizinga, dass das Wort „<strong>Spiel</strong>en“ für erotische Beziehungen verwendet<br />
werden kann, die aus dem Rahmen der sozialen Norm fallen. Der Beziehung <strong>von</strong> Julien <strong>und</strong><br />
Sophie würde er mit Sicherheit das Potential einer Beziehung außerhalb der sozialen Norm<br />
zusprechen.<br />
Kommen wir nun zu der Verknüpfung <strong>von</strong> <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong> <strong>im</strong> <strong>Film</strong> Jeux d’enfants. Er zeigt<br />
offensichtlich keine gelebte <strong>Liebe</strong>sbeziehung zwischen Julien <strong>und</strong> Sophie. Dieser Platz wird<br />
stattdessen vom <strong>Spiel</strong> eingenommen. Es stellt die Verbindung zwischen den beiden<br />
Protagonisten her, die in einer Beziehung innerhalb des Rahmens der sozialen Norm <strong>von</strong> der<br />
<strong>Liebe</strong> eingenommen werden würde. Solch eine <strong>Liebe</strong>sbeziehung außerhalb der sozialen Norm<br />
kann als Amour fou bezeichnet werden. <strong>Das</strong>s diese hier vorliegt <strong>und</strong> das <strong>Spiel</strong> zwischen<br />
Julien <strong>und</strong> Sophie eine Form der Amour fou darstellt, soll <strong>im</strong> Folgenden gezeigt werden.<br />
3.2. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> als Amour fou<br />
Eine Amour fou ist eine wahnsinnige <strong>Liebe</strong>, eine <strong>Liebe</strong>, die nicht mehr <strong>im</strong> sozialen Rahmen<br />
stattfindet. Sie ist eine verhängnisvolle <strong>und</strong> eine leidenschaftliche <strong>Liebe</strong>.<br />
Wenn sich zwei <strong>Liebe</strong>nde in einer Amour fou verstrickt haben, übt die Gesellschaft keine<br />
Macht mehr über die Individuen aus. Es lässt sich sagen: „Mit der Amour fou verliert die<br />
Gesellschaft ihre Kraft zur Sozialisation <strong>und</strong> Domestikation.“ 18<br />
Genau dies findet sich <strong>im</strong> <strong>Spiel</strong> Juliens <strong>und</strong> Sophies wieder. Egal, wie sehr <strong>und</strong> wie oft diese<br />
bestraft werden, sie lassen nicht <strong>von</strong> ihrem <strong>Spiel</strong> ab. Die Gesellschaft, in Form der Eltern, der<br />
Schwester, des Direktors oder der Lehrerin, hat keinen Einfluss auf das <strong>Spiel</strong> der beiden<br />
Kinder. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> gibt die Regeln vor, nicht die Gesellschaft.<br />
Eine <strong>Liebe</strong>sbeziehung kann <strong>von</strong> Sophie <strong>und</strong> Julien jedoch nicht gelebt werden, aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
Unfähigkeit, sich gegenseitig ihre wahren Gefühle zu gestehen. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> eröffnet ihnen die<br />
Möglichkeit, trotzdem in intensiver Weise zu kommunizieren <strong>und</strong> sich <strong>und</strong> den anderen in<br />
seiner Individualität wahrzunehmen. <strong>Liebe</strong> ist, wie bereits erwähnt, eine<br />
Kommunikationsform <strong>und</strong> für Julien <strong>und</strong> Sophie ist das <strong>Spiel</strong> der Rahmen, in dem diese<br />
Kommunikation stattfinden kann.<br />
18 ebd., S. 12.
17<br />
Um zu zeigen, dass es sich be<strong>im</strong> <strong>Spiel</strong> um eine Form der Amour fou handelt, wird versucht,<br />
die Kriterien einer Amour fou auf das <strong>Spiel</strong> zwischen Sophie <strong>und</strong> Julien zu übertragen.<br />
Die Kennzeichen der Amour fou sind ihre Nähe zum Wahnsinn <strong>und</strong> zum A-sozialen. Im<br />
Gegensatz zu der Ruhe eines liebenden Paares ist die Amour fou <strong>von</strong> einer unstillbaren<br />
Dynamik gekennzeichnet. Außerdem lässt sich folgendes Gr<strong>und</strong>prinzip erkennen:<br />
„Die Partner sind entweder nicht gleichrangig in der Kategorie, die dabei jeweils herausgehoben<br />
wird, oder aber sie sind gleichrangig <strong>und</strong> <strong>von</strong> daher eigentlich ideale Partner, aber dennoch ohne die<br />
Möglichkeit, dieses Ideal auch zu verwirklichen <strong>und</strong> zu leben. Den <strong>Liebe</strong>nden in der Amour fou ist es<br />
nicht vergönnt, zu einem liebenden Paar zu werden.“ 19<br />
Diese vier Kriterien lassen sich jeweils auch <strong>im</strong> <strong>Spiel</strong> Sophies <strong>und</strong> Juliens wiederfinden. Je<br />
eine Wette soll dafür als Beleg dienen. Der Wahnsinn lässt sich beispielsweise in der Szene<br />
nach Juliens Hochzeit erkennen. Sophie steht mit verb<strong>und</strong>en Augen auf Bahnschienen <strong>und</strong><br />
versucht, ihre Störung der Hochzeit zu erklären, während Julien einige Meter <strong>von</strong> ihr entfernt<br />
sitzt. Es wird nicht wirklich deutlich, ob diese Situation Teil einer Wette ist, doch die<br />
<strong>Spiel</strong>dose, die vor Sophie auf dem Boden steht, ist ein Indiz dafür. Mit der Zeit wird Sophie<br />
misstrauisch. Sie weiß nicht, wo sie ist <strong>und</strong> warum sie dort stehen bleiben soll, wie Julien es<br />
ihr befohlen hat. Daraufhin zoomt die Kamera in den Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> der Zuschauer sieht,<br />
dass ein Zug auf Sophie zurast. Doch Julien schweigt weiterhin. Wenige Augenblicke, bevor<br />
der Zug Sophie überrollen würde, reißt sie sich die Augenbinde vom Kopf <strong>und</strong> rettet sich<br />
durch einen Sprung zur Seite. Julien setzt in dieser Szene also bewusst Sophies Leben aufs<br />
<strong>Spiel</strong> <strong>und</strong> handelt wahnsinnig.<br />
<strong>Das</strong>s die Amour fou a-sozial ist, bedeutet, dass sie sich jeder Gesellschaft <strong>und</strong> jeder<br />
Vergesellschaftung entzieht. 20 Sie funktioniert nicht nach den Regeln der Gesellschaft. Und<br />
genau hier wird die Parallele zum <strong>Spiel</strong> offensichtlich. Denn auch das <strong>Spiel</strong> funktioniert nicht<br />
nach den Regeln der Gesellschaft, sondern nach denen, die es <strong>von</strong> den <strong>Spiel</strong>ern<br />
vorgeschrieben bekommt. Und besonders <strong>im</strong> Fall <strong>von</strong> Sophie <strong>und</strong> Julien zeichnen diese sich<br />
durch Asozialität, durchaus auch <strong>im</strong> pejorativen Sinn dieses Wortes, aus. Exemplarisch<br />
hierfür ist die Szene <strong>im</strong> Z<strong>im</strong>mer des Direktors. Julien <strong>und</strong> Sophie werden zu diesem gebracht,<br />
nachdem Sophie durchaus auch als „asozial“ zu bezeichnende Worte <strong>im</strong> Klassenz<strong>im</strong>mer<br />
aufgezählt hat. <strong>Das</strong> Urinieren auf den Boden ist eine unzivilisierte Handlung, die nicht als<br />
Kinderstreich zu deklarieren ist. Ein Mensch, der sich an die Regeln der Gesellschaft hielt,<br />
würde so etwas nicht tun. Diese Handlung kann dem Bereich des A-sozialen <strong>und</strong> Asozialen<br />
zugerechnet werden.<br />
19 Oliver Jahrhaus: Amour fou. Die Erzählung der Amour fou in Literatur, Oper <strong>und</strong> <strong>Film</strong>. Tübingen <strong>und</strong> Basel<br />
2004, S. 38.<br />
20 ebd. S. 13.
18<br />
Die Dynamik ist ebenfalls ein Kennzeichen des <strong>Spiel</strong>s. Ein <strong>Spiel</strong> kann eine Sogwirkung<br />
entwickeln, so dass die <strong>Spiel</strong>er zu „<strong>Spiel</strong>bällen“ des <strong>Spiel</strong>s werden <strong>und</strong> <strong>von</strong> dessen Dynamik<br />
mitgerissen werden. Vor allem be<strong>im</strong> <strong>Spiel</strong> in Form des „ilinx“ ist dies der Fall.<br />
Im <strong>Verhältnis</strong> <strong>von</strong> Sophie <strong>und</strong> Julien lässt sich ebenfalls das Gr<strong>und</strong>prinzip der Amour fou<br />
erkennen. Sie sind gleichrangige <strong>und</strong> ideale Partner, „aber dennoch ohne die Möglichkeit,<br />
dieses Ideal auch zu verwirklichen <strong>und</strong> zu leben“. Sie gleichen sich in ihren<br />
Ausgangsbedingungen, wie unter Punkt 1.1 beschrieben. Die Disposition der beiden<br />
Protagonisten macht eine glückliche <strong>Liebe</strong>sbeziehung jedoch unmöglich, ist also den<br />
Charakteren <strong>im</strong>manent. Weil sie so sind, wie sie sind, können sie keine <strong>Liebe</strong>sbeziehung<br />
führen. Dies ist eine besonders tragische Form der Amour fou, da die Hindernisse nicht <strong>von</strong><br />
der Gesellschaft gemacht sind, sondern aus den Individuen selbst entspringen.<br />
Die Amour fou ist besonders eng mit dem Tod verb<strong>und</strong>en, denn wie bereits erwähnt ist „der<br />
<strong>Liebe</strong>stod [...] der Tod der Amour fou!“ 21 Dies ist möglicherweise das deutlichste Zeichen<br />
dafür, dass das <strong>Spiel</strong> die Rolle einer Amour fou einn<strong>im</strong>mt. Die letzte Wette, das Eingießen<br />
lassen in Beton, führt Julien <strong>und</strong> Sophie endlich zusammen <strong>und</strong> hier sind Amour fou <strong>und</strong><br />
<strong>Spiel</strong> eins.<br />
Sophie <strong>und</strong> Julien sind also ein Paar, das alle Kriterien einer Amour fou erfüllt. Sie leben<br />
diese Amour fou jedoch nicht in einer erotischen Weise aus, sondern in Form ihres <strong>Spiel</strong>s, auf<br />
welches alle Merkmale der Amour fou übertragen werden können.<br />
4. <strong>Alltag</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong><br />
In diesem Kapitel möchte ich zuerst zeigen, in welchem <strong>Verhältnis</strong> <strong>Spiel</strong> <strong>und</strong> <strong>Alltag</strong> stehen.<br />
Der soziale <strong>Alltag</strong> Juliens <strong>und</strong> Sophie soll dargestellt, die Sonderrealität des <strong>Spiel</strong>s damit<br />
verglichen <strong>und</strong> zuletzt die Frage gestellt werden, ob es möglich ist, <strong>Alltag</strong> als <strong>Spiel</strong> zu leben.<br />
4.1 Der Begriff des <strong>Alltag</strong>s<br />
Was bezeichnet der Begriff <strong>Alltag</strong>? Zunächst ist <strong>Alltag</strong> ein wertneutraler Begriff, <strong>und</strong><br />
bezeichnet die vornehmliche <strong>und</strong> ausgezeichnete Wirklichkeit des Menschen. 22 Er beinhaltet<br />
in einer etwas engeren Definition alle wiederholt ablaufenden Tätigkeiten, einerseits auf<br />
21<br />
Oliver Jahrhaus: Amour fou. Die Erzählung der Amour fou in Literatur, Oper <strong>und</strong> <strong>Film</strong>. Tübingen <strong>und</strong> Basel<br />
2004, S. 13.<br />
22<br />
Ralf Schnell (Hrsg.): Metzler-Lexikon Kultur der Gegenwart. Stuttgart, We<strong>im</strong>ar 2000, S. 16.
19<br />
einzelne Tage als auch auf längere Zeiträume, also wöchentliche, monatliche oder jährliche<br />
Wiederholungen, bezogen.<br />
Die Wiederholung <strong>und</strong> die Routine machen den <strong>Alltag</strong> vorhersagbar. Einerseits führt dies zu<br />
Entlastung, Sicherheit <strong>und</strong> stabilen Kommunikationsstrukturen, andererseits aber auch zu<br />
Langeweile <strong>und</strong> profanem, geistlosen Handeln. Genau dies ist der Punkt, der <strong>im</strong> <strong>Film</strong> Jeux<br />
d’enfants besonders betont wird. Die Wiederholungen <strong>und</strong> das Erleben des Immergleichen<br />
führen zu Unlust. Diese Unlust kann nur durch das <strong>Spiel</strong> beseitigt werden. Deshalb wird der<br />
<strong>Alltag</strong> ohne das <strong>Spiel</strong> <strong>von</strong> Julien als „fades Glück seines <strong>Das</strong>eins“ empf<strong>und</strong>en.<br />
Eine Möglichkeit, Unlust <strong>und</strong> Lust zu erklären, bietet die „Erholungstheorie“ 23 . Diese besagt,<br />
dass die Erschöpfung einseitig überbeanspruchter Kräfte zu Unlustgefühlen führt. Durch die<br />
Wiederholung alltäglicher Routinearbeiten kann dieser Fall eintreten. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> kann diese<br />
Unlusterfahrung beseitigen, da in diesem andere Tätigkeiten verfolgt werden, so dass sich<br />
währenddessen die übermäßig beanspruchten Kräfte, die <strong>im</strong> <strong>Alltag</strong> gefordert sind, erholen<br />
können. Natürlich kann man argumentieren, dass nicht notwendigerweise das Wettspiel<br />
zwischen Sophie <strong>und</strong> Julien diese Funktion übernehmen muss, sondern dass auch <strong>im</strong> Sport<br />
oder durch andere Freizeitaktivitäten dieser Effekt erzielt werden kann. Doch Julien ist mit<br />
diesem <strong>Spiel</strong> aufgewachsen <strong>und</strong> kennt die lustvolle Wirkung des <strong>Spiel</strong>s aus seiner Erfahrung.<br />
Somit steht dieses <strong>Spiel</strong> für ihn an erster Stelle <strong>und</strong> alles andere würde als minderwertige<br />
Kopie empf<strong>und</strong>en werden.<br />
Der Begriff <strong>Alltag</strong> kann <strong>im</strong> <strong>Film</strong> erst ab dem Eintritt ins Erwachsenenalter angewendet<br />
werden. Der kindliche <strong>Alltag</strong> ist zwar genauso durch wiederholte Handlungen strukturiert.<br />
Aber er ist <strong>von</strong> vielen Situationen durchsetzt, die zum ersten Mal auftreten, <strong>und</strong> somit den<br />
Reiz des Neuen tragen. Langeweile kann sich nicht einstellen, so lange eine Person <strong>im</strong>mer<br />
wieder mit neuen Dingen konfrontiert wird. Durch das Älterwerden <strong>und</strong> die damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Erfahrungen kommt es <strong>im</strong>mer seltener zu neuartigen Erlebnissen.<br />
Thomas Anz schreibt: „Im <strong>Spiel</strong> der Kunst sucht der Erwachsene nach dem verlorenen Glück<br />
seiner Kindheit.“ 24 Für Sophie <strong>und</strong> Julien übern<strong>im</strong>mt das Wettspiel diese Funktion. Dieser<br />
Gedanke ist auch bei Freud, Nietzsche <strong>und</strong> Huizinga zu finden: Für diese stelle das <strong>Spiel</strong> eine<br />
Art Entschädigung <strong>und</strong> Ersatz für das mit der Zivilisierung des Subjekts einhergehende<br />
Unglück dar. Dieses Unglück wird <strong>im</strong> <strong>Film</strong> Jeux d’enfants als Gefühl der Langeweile,<br />
Routine <strong>und</strong> Unfreiheit dargestellt.<br />
23 Thomas Anz: Literatur <strong>und</strong> Lust. München 1998, S. 62.<br />
24 ebd.
4.2 Der <strong>Alltag</strong> Juliens<br />
20<br />
In den zehn Jahren, die Julien ohne Sophie <strong>und</strong> das <strong>Spiel</strong> verbringt, führt er eine Ehe, der zwei<br />
Kinder entstammen, arbeitet in leitender Position <strong>im</strong> Baubetrieb. Er präsentiert dem<br />
Zuschauer in einer Aufzählung sein Leben mit 35 Jahren. Er habe alles: Eine Frau, zwei<br />
Kinder, drei Kumpel, vier Darlehen, fünf Wochen Ferien, sechs Dienstjahre, sieben mal sein<br />
Gewicht in Hi-Fi, acht Mal Verkehr pro Quartal, neun Mal den Erdumfang in Haushaltsmüll.<br />
Diese quantitative Aufzählung zeigt die Mechanisierung <strong>und</strong> Strukturierung seines <strong>Alltag</strong>s.<br />
Ironisch bezeichnet er diesen <strong>Alltag</strong> als Glück <strong>und</strong> Erfüllung seines Kindheitstraums: Ein<br />
mächtiger Tyrann zu sein.<br />
Charakterisierend für das Erwachsensein sei dies für ihn: „Avoir un compteur qui fait de zéro<br />
a deux cent dix et ne jamais faire que de soixante.“ (Minute 62:30). Er empfindet seinen<br />
<strong>Alltag</strong> als Einschränkung. Juliens Leben ist ein Beispiel für das wie bereits oben erwähnte<br />
„mit der Zivilisierung des Subjekts einhergehende Unglück“.<br />
Julien beschreibt sein Leben an dem Tag, als das letzte Treffen mit Sophie genau zehn Jahre<br />
vorüber ist. Dies ist der Anlass für ihn, über sein unerfülltes Leben zu reflektieren. Als letzten<br />
Punkt in seinem Monolog erwähnt er außerdem die zehn Jahre ohne seinen Vater. Dessen<br />
Abwesenheit beeinflusst Juliens Leben <strong>und</strong> erinnert ihn <strong>im</strong>mer wieder an Sophie, die<br />
Schuldige dieser Trennung.<br />
4.2.1. Beziehung zum Vater<br />
Obwohl die Beziehung zu seinem Vater in Juliens <strong>Alltag</strong> nicht gelebt wird, beeinflusst sie<br />
diesen in großem Maß. Eigenen Worten zufolge habe er ungefähr 40 Mal versucht, mit<br />
diesem in Kontakt zu treten, scheiterte jedoch jedes Mal, indem er beispielsweise wie <strong>im</strong><br />
gezeigten Fall, das Telefon auflegt, ohne sich zu melden. Für Julien war sein Vater <strong>im</strong>mer<br />
eine Person, die sich zwischen ihn <strong>und</strong> andere Menschen stellte sowie <strong>von</strong> Beginn an<br />
versuchte, das <strong>Spiel</strong> zu unterbinden. Die enge Bindung Juliens an seine Mutter wurde <strong>im</strong>mer<br />
wieder <strong>von</strong> seinem Vater einzuschränken versucht. Als dieser ihn zum Beispiel nach einer<br />
Wette aus dem Z<strong>im</strong>mer des Direktors abholt, versucht er zu verhindern, dass Julien sofort zu<br />
seiner kranken Mutter läuft (Minute 11:20). Ebenso versucht er das Wettspiel einzuschränken.<br />
Immer wieder erhält er <strong>von</strong> ihm dafür Strafen (zum Beispiel Minute 6:45 oder 11:00). Und<br />
obwohl Sophie eine zeitlang bei Julien <strong>und</strong> seinem Vater wohnt, hat Julien das Gefühl, dieser<br />
habe Sophie nie wirklich gemocht (Minute 6:40). Später stellt er Julien sogar vor die Wahl:<br />
„Choisis. C’est elle ou moi.“ (Minute 36:24). Doch trotz dieser Konflikte versucht Julien,<br />
nach der Trennung zu diesem <strong>im</strong>mer wieder den Kontakt herzustellen. Sein Vater kann als
21<br />
eine Art Gegenspieler zu Sophie <strong>und</strong> Julien gesehen werden. Somit ist er auch Teil des <strong>Spiel</strong>s,<br />
der, ohne es zu beabsichtigen, die Bindung zwischen den beiden stärkt, indem sie ihn als<br />
gemeinsamen Gegner empfinden.<br />
4.2.2. Juliens Privatleben <strong>und</strong> Arbeit<br />
Zwei konstituierende Elemente des <strong>Alltag</strong>s sind das Privatleben in Form <strong>von</strong> Ehe <strong>und</strong> Familie<br />
sowie die Erwerbsarbeit. In diesen beiden Bereichen wird Julien als passiver Mensch<br />
dargestellt, der Aufgaben <strong>von</strong> seiner Frau entgegenn<strong>im</strong>mt (Minute 60:35), <strong>von</strong> seinen Kindern<br />
als <strong>Spiel</strong>zeug benutzt wird (Minute 68:15), sowie stark <strong>von</strong> seinem Chef abhängig ist, so dass<br />
Christelle sogar meint, er solle eher mit diesem als mit ihr verheiratet sein (Minute 69:10).<br />
Julien besitzt keine Autonomie <strong>im</strong> <strong>Alltag</strong>, ganz <strong>im</strong> Gegensatz zur Welt des <strong>Spiel</strong>s, in dem das<br />
Erleben der eigenen Autonomie einen zentralen Punkt darstellt. 25<br />
Kontrastierend zu seinem passiven Verhalten <strong>im</strong> <strong>Alltag</strong>, wurde er in seiner Jugend als<br />
unbeschwerter Verführer dargestellt, der das Leben nicht sehr schwer n<strong>im</strong>mt <strong>und</strong> gerne<br />
Grenzen überschreitet. Es ist da<strong>von</strong> auszugehen, dass diese Wesenszüge <strong>im</strong>mer noch in ihm<br />
vorhanden sind, jedoch unterdrückt werden. In seinen Tagträumen <strong>von</strong> möglichen Wetten mit<br />
Sophie, zeigen sie sich in übersteigerter, gewalttätiger Form: Als der Tyrann, der er <strong>im</strong>mer<br />
sein wollte, erhängt er einen Mann, der zuvor gefesselt <strong>und</strong> geknebelt in seinem Kofferraum<br />
lag. Da es Julien nicht gelingt, seinen <strong>Alltag</strong> aktiv zu gestalten, sondern sich diesem<br />
ausgeliefert fühlt, stellt für ihn das abwesende <strong>Spiel</strong> einen Idealzustand <strong>von</strong> Freiheit <strong>und</strong><br />
Rausch dar.<br />
4.3 Der <strong>Alltag</strong> Sophies<br />
Den <strong>Alltag</strong> Sophies erfährt der Zuschauer nur aus der Perspektive Juliens. Da Sophies<br />
Ehemann mittlerweile ein gefeierter Fußballstar ist, der auf zahlreichen Werbeplakaten zu<br />
sehen ist, wird Julien <strong>im</strong>mer wieder an seine einstige <strong>Spiel</strong>partnerin erinnert. Er geht jedoch<br />
selbst da<strong>von</strong> aus, dass sie ihn vergessen habe (Minute 65:21). Julien stellt sich Sophies <strong>Alltag</strong><br />
als glückliches Leben an der Seite ihres Ehemanns vor. Dieser gebe ihr gewiss alles, was sie<br />
<strong>von</strong> einer Beziehung erwarte. Im Gegensatz zu seinem Leben n<strong>im</strong>mt das <strong>Spiel</strong> – in einer<br />
anderen Form – noch <strong>im</strong>mer einen Platz in ihrem Leben ein. Über ihren Mann hat sie Anteil<br />
an der Welt des Fußballspiels, das ihr die Erfahrung des Siegens <strong>und</strong> Verlierens an seiner<br />
Seite ermöglicht. Auch die Kommunikation zu ihrem Ehemann stellt sich Julien spielerisch<br />
25 Thomas Anz: Literatur <strong>und</strong> Lust. München 1998, S. 68.
22<br />
vor (Minute 67:55). Sie hat sich in seiner Phantasie Elemente des <strong>Spiel</strong>s in ihrem Leben<br />
erhalten können <strong>und</strong> ist deswegen nicht mehr auf ihn angewiesen.<br />
Umso mehr ist Julien deswegen <strong>von</strong> dem Paket, was er nach genau zehn Jahren <strong>von</strong> Sophie<br />
erhält, überrascht <strong>und</strong> schockiert. Aus den weiteren Handlungen Sophies kann geschlossen<br />
werden, dass ihr Leben nicht so glücklich verlaufen ist, wie sich Julien dies vorgestellt hat.<br />
Spätestens durch die gemeinsame Einbetonierung mit Julien wird klar, dass Sophie ähnliche<br />
Erfahrungen des <strong>Alltag</strong>s wie Julien gemacht haben muss. Auch für sie stellt das <strong>Spiel</strong> mit<br />
Julien einen Idealzustand dar, der sich nur <strong>im</strong> Tod verewigen lässt.<br />
4.4 Die Sonderrealität des <strong>Spiel</strong>s<br />
In der Phase der Kindheit kann das <strong>Spiel</strong> als natürliches, wenn auch übersteigertes Element<br />
<strong>und</strong> als Teil des Leben der beiden gesehen werden. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> n<strong>im</strong>mt bei Kindern einen<br />
großen Platz ein <strong>und</strong> ist ein gewöhnlicher, wünschenswerter Vorgang. Bereits damals entstand<br />
das <strong>Spiel</strong> jedoch nicht nur aus der Lust an ihm heraus, sondern auch aufgr<strong>und</strong> der<br />
empf<strong>und</strong>enen Unlust in der eigentlichen Realität (siehe 4.1). Es fügte sich aber in den<br />
kindlichen <strong>Alltag</strong> ein <strong>und</strong> kann als „normale“, typische Form des <strong>Spiel</strong>s bezeichnet werden.<br />
Dies ändert sich jedoch, als die Protagonisten erwachsen werden. Nach dem zehnjährigen<br />
Zeitsprung vom Leben der Achtjährigen zum Leben der Achtzehnjährigen, kann es nicht mehr<br />
als gewöhnliche Form des <strong>Spiel</strong>s bezeichnet werden. Dadurch, dass die Form des <strong>Spiel</strong>s<br />
gleich bleibt, die Lebensrealität sich aber durch das Älterwerden ändert, passt es nicht zum<br />
erwachsenen <strong>Alltag</strong> der Beiden. Auch Julien erkennt dies, <strong>und</strong> kommentiert es mit den<br />
Worten:<br />
„La règle du jeu était demeurée, rien a changé. Elle se bien pouvait appeler taquinerie lorsque nous<br />
étions gamins, devait à présence s’appeler perversion. Vous savez ce que c’est la perversion? C’est<br />
qu’une affaire du goût. Comme le goût chinois. On a<strong>im</strong>e ou on a<strong>im</strong>e pas. L’empêche que quand on est<br />
chinois on n’a pas le choix.“ (Minute 27:00)<br />
Obwohl er also die Perversion ihres <strong>Spiel</strong>s erkennt, sieht er keine Alternative. Sophie <strong>und</strong><br />
Julien werden zu diesem Handeln gezwungen, da sie – wie ein Chinese bei der Auswahl des<br />
Essens – keine Wahlmöglichkeit haben. <strong>Das</strong>s Julien ihr Handeln als pervers, also als <strong>von</strong> der<br />
Norm abweichend, bezeichnet, macht den Status des <strong>Spiel</strong>s als Sonderrealität deutlich.<br />
Einerseits erkennen die Protagonisten den Wahnsinn ihres <strong>Spiel</strong>es an, der <strong>im</strong>mer stärker wird,<br />
je länger das <strong>Spiel</strong> andauert. Aber sie sind so sehr dem Sog des <strong>Spiel</strong>es verfallen, dass sie sich<br />
nicht aus ihm befreien können. In der Kindheit herrschte, wie bereits unter Punkt 2.1 erwähnt,
23<br />
das Element des „agon“ 26 vor. Im Verlauf des <strong>Spiel</strong>s wird jedoch das Element des „ilinx“<br />
zunehmend stärker. Diese Kategorie beschreibt <strong>Spiel</strong>e, die<br />
„auf dem Begehren nach Rausch beruhen <strong>und</strong> deren Reiz darin besteht, für einen Augenblick<br />
die Stabilität der Wahrnehmung zu stören <strong>und</strong> dem klaren Bewusstsein eine Art wollüstiger<br />
Panik einzuflößen.“ 27<br />
Je älter Sophie <strong>und</strong> Julien werden, desto stärker steht der Wunsch nach Rausch <strong>im</strong> Gegensatz<br />
zur Realität des <strong>Alltag</strong>s <strong>und</strong> wird mit der Lebensrealität unvereinbar. Im „ilinx“ schwingt die<br />
Nähe zum Tod bereits mit. Durch eine starke körperliche Erfahrung wird das Bewusstsein für<br />
den Körper <strong>und</strong> die eigene Sterblichkeit erhöht. Besonders deutlich wird dies in der Szene, in<br />
der Julien vor der Polizei flieht (Minute 72:30).<br />
Mit dem körperlichen Rausch geht außerdem ein Rausch moralischer Art einher. 28 Der Hang<br />
der Menschen zu Unordnung <strong>und</strong> Zerstörung, der <strong>im</strong> <strong>Alltag</strong> normalerweise unterdrückt wird<br />
<strong>und</strong> durch kulturelle Formen sozialisiert wurde, gelangt hier zum Vorschein. Die Amoralität<br />
ist dem <strong>Spiel</strong> <strong>von</strong> Sophie <strong>und</strong> Julien bereits ab der ersten Wette inne. Moralische Regeln sind<br />
innerhalb des <strong>Spiel</strong>s außer Kraft gesetzt. Es wird also eine Sonderrealität aufgebaut, in der<br />
gesellschaftliche Maßstäbe keine Geltung haben.<br />
Die Welt des <strong>Alltag</strong>s steht der Welt des <strong>Spiel</strong>s konträr gegenüber. Die <strong>Spiel</strong>welt bietet eine<br />
Alternative zur realen Welt, die als unbefriedigend empf<strong>und</strong>en wird. Normalerweise ist dies<br />
ein Merkmal <strong>von</strong> Kinderspielen.<br />
„Auf der Folie <strong>von</strong> Erfahrungen in der realen Welt inszeniert das Kind in seinen <strong>Spiel</strong>welten<br />
phantasievolle Begebenheiten <strong>und</strong> schlüpft in attraktive Rollen. Es erfüllt sich in den <strong>Spiel</strong>prozessen<br />
Wünsche, die ihm die reale Welt bislang versagt hat: mächtig zu sein, hilfreiche Fre<strong>und</strong>e an der Seite<br />
zu wissen, Neues <strong>und</strong> Unbekanntes zu entdecken, Gefahren zu meistern.“ 29<br />
Doch da sich das <strong>Spiel</strong> in seiner Form nicht ändert, überträgt sich diese Funktion auch auf das<br />
<strong>Spiel</strong> <strong>im</strong> Erwachsenenalter. Man kann also behaupten, dass es Julien <strong>und</strong> Sophie nicht gelingt,<br />
erwachsen zu werden. Sie schaffen es nicht, ihre Wünsche in die Realität umzusetzen <strong>und</strong><br />
bleiben deswegen in ihrer Welt des <strong>Spiel</strong>s gefangen.<br />
26<br />
Roger Caillois: Die <strong>Spiel</strong>e <strong>und</strong> die Menschen. Maske <strong>und</strong> Rausch. Frankfurt/M, Berlin 1982, S. 21.<br />
27<br />
Ebd., S. 32.<br />
28<br />
Ebd., S. 33.<br />
29<br />
Jürgen Fritz: <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> verstehen. Eine Einführung in Theorie <strong>und</strong> Bedeutung. Weinhe<strong>im</strong>, München 2004, S.<br />
156.
4.5 <strong>Alltag</strong> als <strong>Spiel</strong>?<br />
24<br />
Wir stellen uns wieder die gleiche Frage wie bereits bei dem <strong>Verhältnis</strong> <strong>von</strong> <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong>:<br />
Kann <strong>Alltag</strong> als <strong>Spiel</strong> aufgefasst werden? Es gibt soziologische Theorien, wie zum Beispiel<br />
<strong>von</strong> Pierre Bourdieu, die den <strong>Alltag</strong> als <strong>Spiel</strong> beschreiben. Da der Begriff „<strong>Spiel</strong>“ eine breite<br />
semantische Spannweite hat, kommt es auf die Definition <strong>von</strong> „<strong>Spiel</strong>“ an, ob dies zutreffend<br />
ist, oder nicht. Bourdieu meint mit diesem Begriff vor allem das <strong>Spiel</strong> der gesellschaftlichen<br />
Klassen, die um Distinktion spielen. 30 Für den <strong>Film</strong> Jeux d’enfants sind seine Beschreibungen<br />
nicht besonders hilfreich. Sie deuten aber auf eine Interpretationsebene hin, die ich hier nur<br />
kurz erwähnen will. Sophie gehört einer anderen Gesellschaftsschicht als Julien an. Sie<br />
stammt aus einer ausländischen Familie, die in einer Sozialwohnung lebt. Julien dagegen ist<br />
ein Kind des Mittelstandes, das in einem sauberen Vorort mit freistehenden Häusern<br />
aufgewachsen ist. Sophie gehört also einer niedrigeren Schicht als Julien an. <strong>Das</strong> Wettspiel,<br />
das sich zwischen den beiden entwickelt, nivelliert diese Schichtunterschiede. Doch Sophie<br />
thematisiert ihre Herkunft <strong>im</strong>mer wieder. Inwieweit sie damit zur Zerstörung des <strong>Spiel</strong>s<br />
beiträgt, ist eine Frage, die hier ob der Begrenztheit der Arbeit keine Antwort erhalten kann.<br />
5. <strong>Das</strong> <strong>Verhältnis</strong> <strong>von</strong> <strong>Alltag</strong>, <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Spiel</strong><br />
Im Folgenden soll abschließend der Versuch unternommen werden, die drei Bereiche <strong>Spiel</strong>,<br />
<strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> <strong>Alltag</strong> zusammenzuführen.<br />
Die <strong>Liebe</strong> findet in Jeux d’enfants als Form der unerfüllten <strong>Liebe</strong> <strong>und</strong> der Amour fou statt.<br />
Der <strong>Alltag</strong> bildet dazu den Gegenpol, der alles Rationale, Vernünftige <strong>und</strong> Langweilige<br />
umfasst. <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> steht zwischen diesen beiden Bereichen <strong>und</strong> ist einerseits Teil der Amour<br />
fou, andererseits Teil des <strong>Alltag</strong>s. Es deutet jedoch in Richtung Amour fou <strong>und</strong> stellt damit<br />
eine Bedrohung für den <strong>Alltag</strong> dar. Je größer der Bereich des <strong>Alltag</strong>s wird, desto extremer<br />
wird das <strong>Spiel</strong>. Julien <strong>und</strong> Sophie nehmen <strong>im</strong>mer häufiger die Nähe zum Tod in Kauf, der ein<br />
Element der Amour fou ist. Doch sie haben keine Wahl. Die Amour fou ist wie ein Virus, den<br />
beide in sich tragen <strong>und</strong> deren Symptom das <strong>Spiel</strong> ist. Auch andere Symptome für diesen<br />
Virus wären denkbar. Doch der <strong>Film</strong> Jeux d’enfants wählt das Beispiel „<strong>Spiel</strong>“, <strong>und</strong> zeigt<br />
daran, wie er die Infizierten bis in den Tod führt.<br />
30 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Frankfurt am Main, 1982, S. 389.
6. Was wäre, wenn?<br />
25<br />
Zum Schluss soll noch knapp das alternative Ende des <strong>Film</strong>s betrachtet werden. Denn der<br />
<strong>Film</strong> endet nicht mit dem Eingießen in den Betonblock. Es folgt ein Gedankenexper<strong>im</strong>ent, in<br />
warmes, gelbes Licht getaucht. <strong>Das</strong> „Was-wäre-wenn?“ einer glücklichen <strong>Liebe</strong>. Es werden<br />
zwei alte Menschen gezeigt, die eine glückliche Beziehung führen, <strong>im</strong>mer noch Wetten<br />
abschließen <strong>und</strong> aussprechen können, was Sophie <strong>und</strong> Julien nie möglich war: „Je t’a<strong>im</strong>e“. In<br />
Rückblenden sieht man, wie sich Julien <strong>und</strong> Sophie in Situationen küssen, in denen sie in der<br />
ersten Version Distanz gewahrt haben, in denen es jedoch genauso gut zu einer Annäherung<br />
hätte kommen können – hätten sie nur den Mut dazu gehabt. Dies erinnert in der Gr<strong>und</strong>idee<br />
an Tom Tykwers „Lola rennt“. Wie in einem Computerspiel mit mehreren Leben können<br />
wenige, andere Entscheidungen zu einem völlig anderen Ende führen. Doch ist dieses Ende<br />
nicht konsequent. So wie die Charaktere <strong>von</strong> Julien <strong>und</strong> Sophie angelegt sind, wäre es ihnen<br />
nicht möglich gewesen, eine glückliche Beziehung <strong>im</strong> <strong>Alltag</strong> zu führen. <strong>Das</strong> gegenseitige<br />
Verletzen, die Unmöglichkeit der ernst gemeinten Kommunikation <strong>und</strong> die Leidenschaft der<br />
Amour fou, die zwischen den beiden besteht, hätten keine dauerhafte, glückliche Verbindung<br />
zugelassen. Die Beziehung <strong>von</strong> Julien <strong>und</strong> Sophie lebt durch <strong>und</strong> in der Distanz <strong>und</strong> ist nicht<br />
mit dem <strong>Alltag</strong> vereinbar.<br />
So ist die Variation des Endes womöglich eine versöhnliche Geste an den Zuschauer <strong>und</strong> der<br />
Versuch, diesen mit einem guten Gefühl aus dem Kino zu entlassen. Denkbar ist außerdem<br />
ein appellativer Hintergr<strong>und</strong>: Zeigt euch eure wahren Gefühle <strong>und</strong> sprecht aus, was ihr über<br />
einander denkt, damit ihr eine glückliche Beziehung führen könnt. Alles andere führt zur<br />
Zerstörung <strong>und</strong> der Unmöglichkeit glücklicher <strong>Liebe</strong>.
Literaturverzeichnis<br />
Anz, Thomas: Literatur <strong>und</strong> Lust. Glück <strong>und</strong> Unglück be<strong>im</strong> Lesen. München 1998.<br />
Bally, Gustav: Vom <strong>Spiel</strong>raum der Freiheit. Die Bedeutung des <strong>Spiel</strong>s bei Tier <strong>und</strong> Mensch.<br />
Basel/Stuttgart 1966.<br />
Bilstein, Johannes; Winzen, Matthias; Wulf, Christoph (Hg.): Anthropologie <strong>und</strong> Pädagogik<br />
des <strong>Spiel</strong>s. Weinhe<strong>im</strong> 2005.<br />
Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft.<br />
Frankfurt a.M. 1982.<br />
Caillois, Roger: Die <strong>Spiel</strong>e <strong>und</strong> die Menschen. Maske <strong>und</strong> Rausch. Frankfurt a.M. 1983.<br />
Centre National De La Cinématographie: Jahresbilanz 2003.<br />
http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/publications/dossiers_et_bil<br />
an/290/CNCinfo290_1.pdf, aufgerufen am 19.03.2008.<br />
Frick, Ulricke: Die heilige Dose. In: Münchner Merkur, http://www.merkuronline.de/mm_alt/nachrichten/kultur/film/art368,307983,<br />
aufgerufen am 13.03.2008.<br />
Happel, Benjamin: <strong>Liebe</strong> mich, wenn du dich traust. In: <strong>Film</strong>zentrale,<br />
http://www.filmzentrale.com/rezis/liebemichwenndudichtraustbh.htm, aufgerufen am<br />
13.03.2008.<br />
Fritz, Jürgen: <strong>Das</strong> <strong>Spiel</strong> verstehen. Eine Einführung in Theorie <strong>und</strong> Bedeutung.<br />
Weinhe<strong>im</strong>/München 2004.<br />
Frodon, Jean-Michel: Jeux d’enfants. In : Cahier du cinéma 582 (2003), S.36.<br />
Huizinga, Johan: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur <strong>im</strong> <strong>Spiel</strong>. Reinbek bei Hamburg<br />
1956.<br />
Jahraus, Oliver: Amour fou. Die Erzählung der Amour fou in Literatur, Oper, <strong>Film</strong>. Zum<br />
<strong>Verhältnis</strong> <strong>von</strong> <strong>Liebe</strong>, Diskurs <strong>und</strong> Gesellschaft <strong>im</strong> Zeichen ihrer sexuellen Infragestellung.<br />
Tübingen 2004.<br />
Krah, Hans; Ort, Claus-Michael; Wünsch, Marianne (Hg.): Weltentwürfe in Literatur <strong>und</strong><br />
Medien. Phantastische Wirklichkeiten - realistische Imaginationen. Kiel 2002.<br />
Matuschek, Stefan: Literarische <strong>Spiel</strong>theorie. Über Petrarca bis zu den Brüdern Schlegel.<br />
Heidelberg 1998.<br />
Schnell, Ralf (Hrsg.): Metzler-Lexikon Kultur der Gegenwart. Stuttgart, We<strong>im</strong>ar 2000.<br />
Schwendter, Rolf: Tag für Tag. Eine Kultur- <strong>und</strong> Sittengeschichte des <strong>Alltag</strong>s. Hamburg<br />
1996.<br />
Seidel, Hans-Dieter: Schreckliche Kinder: Yann Samuells <strong>Film</strong> „<strong>Liebe</strong> mich, wenn du dich<br />
traust“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (11.08.2004), S. 35,
http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~E26903BA3044D<br />
4D028152493657BB8800~ATpl~Ecommon~Scontent.html, aufgerufen am 19.03.2008.<br />
Tawada, Yoko: <strong>Spiel</strong>zeug <strong>und</strong> Sprachmagie in der europäischen Literatur. Eine ethnologische<br />
Poetologie. Tübingen 2000.