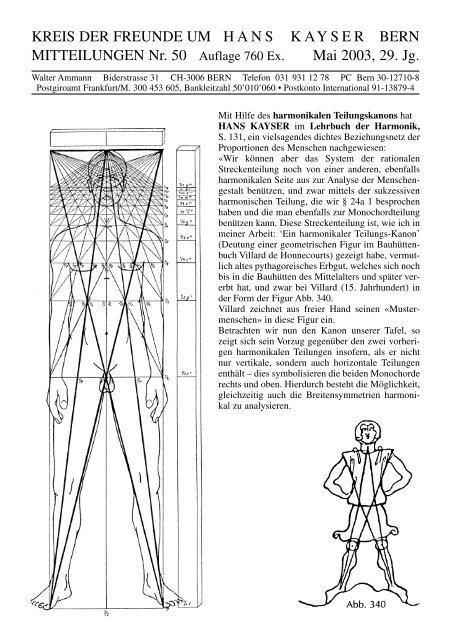Mitteilungen Nr. 50 - Hans Henny Jahnn
Mitteilungen Nr. 50 - Hans Henny Jahnn
Mitteilungen Nr. 50 - Hans Henny Jahnn
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KREIS DER FREUNDE UM H A N S K AY S E R BERN<br />
MITTEILUNGEN <strong>Nr</strong>. <strong>50</strong> Auflage 760 Ex. Mai 2003, 29. Jg.<br />
Walter Ammann Biderstrasse 31 CH-3006 BERN Telefon 031 931 12 78 PC Bern 30-12710-8<br />
Postgiroamt Frankfurt/M. 300 453 605, Bankleitzahl <strong>50</strong>’010’060 • Postkonto International 91-13879-4<br />
Mit Hilfe des harmonikalen Teilungskanons hat<br />
HANS KAYSER im Lehrbuch der Harmonik,<br />
S. 131, ein vielsagendes dichtes Beziehungsnetz der<br />
Proportionen des Menschen nachgewiesen:<br />
«Wir können aber das System der rationalen<br />
Streckenteilung noch von einer anderen, ebenfalls<br />
harmonikalen Seite aus zur Analyse der Menschengestalt<br />
benützen, und zwar mittels der sukzessiven<br />
harmonischen Teilung, die wir § 24a 1 besprochen<br />
haben und die man ebenfalls zur Monochordteilung<br />
benützen kann. Diese Streckenteilung ist, wie ich in<br />
meiner Arbeit: ‘Ein harmonikaler Teilungs-Kanon’<br />
(Deutung einer geometrischen Figur im Bauhüttenbuch<br />
Villard de Honnecourts) gezeigt habe, vermutlich<br />
altes pythagoreisches Erbgut, welches sich noch<br />
bis in die Bauhütten des Mittelalters und später vererbt<br />
hat, und zwar bei Villard (15. Jahrhundert) in<br />
der Form der Figur Abb. 340.<br />
Villard zeichnet aus freier Hand seinen «Mustermenschen»<br />
in diese Figur ein.<br />
Betrachten wir nun den Kanon unserer Tafel, so<br />
zeigt sich sein Vorzug gegenüber den zwei vorherigen<br />
harmonikalen Teilungen insofern, als er nicht<br />
nur vertikale, sondern auch horizontale Teilungen<br />
enthält – dies symbolisieren die beiden Monochorde<br />
rechts und oben. Hierdurch besteht die Möglichkeit,<br />
gleichzeitig auch die Breitensymmetrien harmonikal<br />
zu analysieren.
Inhalt Seite<br />
Bericht Symposion 2002, Ernst W. Weber 3–6<br />
<strong>Hans</strong> Kayser: Das Lehrbuch der Harmonik, ausführl. Besprechung von Fr. Oberkogler 7–38<br />
Bücherbesprechungen:<br />
Ernst Waldemar Weber: PISA und was nun? 39/40<br />
Alexander Lauterwasser: Wasser – Klang – Bilder 40/41<br />
Helmut Reis: Das Paradoxon des Ikosaeders 41/42<br />
Sebnem Yavuz, Hrsg.: Schriften zur Gregoriani-Forschung 43/44<br />
André M. Studer: Inwendiges Tagebuch 45–47<br />
Leserzuschrift 47<br />
Bestellung 48<br />
Die Verantwortung für die einzelnen Beiträge tragen jeweils die Verfasser<br />
Liebe Freunde der Harmonik<br />
Entsprechend der Auswahl der Themen und Redner, die Sie beim letztjährigen Symposion<br />
getroffen haben, werden am 8. November a.c. diejenigen Referenten zu uns sprechen, die die<br />
grösste Zustimmung erhalten haben, nämlich<br />
ERNST WALDEMAR WEBER, Muri BE, Verfasser der Bücher «Die vergessene Intelligenz»<br />
und «PISA und was nun?» über<br />
Die vergessene Intelligenz;<br />
Prof. Dr. WERNER SCHULZE, Wien, über<br />
Tag- und Nachtträume der Harmonik (Versuch einer Annäherung an die Harmonik),<br />
35 Jahre Harmonik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, internationale<br />
Ausstrahlung der Harmonik;<br />
ALEXANDER LAUTERWASSER, Heiligenberg,<br />
Wasser Klang Bilder (Titel des neuen Buches)<br />
Wir hoffen, auch dieses Jahr wieder eine grosse Zahl von Ihnen begrüssen zu dürfen.<br />
Mit freundlichen Grüssen<br />
Die MITTEILUNGEN erscheinen jährlich zweimal.<br />
Richtpreis im Jahr Fr. 15.– / Euro 10.–. Bitte möglichst mit Giro überweisen.<br />
Freunde in Deutschland zahlen auf Postbank NL Frankfurt, 300’453’605, Bankleitzahl<br />
<strong>50</strong>’010’060, in andern Ländern auf das Gelbe Konto international <strong>Nr</strong>. 91-13879-4 KREIS<br />
DER FREUNDE UM HANS KAYSER BERN.<br />
Der Einfachheit halber legen wir allen MITTEILUNGEN einen Einzahlungsschein bei. Wir<br />
danken all denen, die zweimal bezahlt haben.<br />
Wenn Sie die MITTEILUNGEN nicht mehr zu erhalten wünschen, möchten Sie diese bitte im<br />
gleichen Umschlag, damit der Absender ersichtlich ist, frankiert an uns zurückgehen lassen,<br />
wofür wir Ihnen bestens danken.<br />
2
Symposion der Freunde um <strong>Hans</strong> Kayser<br />
am 2. November 2002 in Bern<br />
Johannes Gruntz-Stoll: Weltbild und Klangwelt.<br />
Der harmonikale Kosmos des Johann Amos Comenius<br />
Eingebettet in Tonbeispiele aus der Zeit (Hassler und Buxtehude) werden wir eingeführt in<br />
das bewegte Leben des Comenius und in sein bekanntestes Werk, den 1658 in Nürnberg<br />
erstmals gedruckten «Orbis pictus». Diese «Bilder-Enzyklopädie für Kinder und Jugendliche»<br />
(lateinisch und deutsch) über Gott, die unbelebte und belebte Natur, den Menschen<br />
und seine Bedürfnisse und Tätigkeiten, seine Spiele, seine Tugenden, über Weisheit, Ordnung<br />
und Glauben bis zum Jüngsten Gericht ist – nach der Überzeugung des Referenten<br />
harmonikal – in 1<strong>50</strong> Kapitel gegliedert, «komponiert». Auf dem Titelblatt steht der Leitspruch<br />
Omnia sponte fluant absit violentia rebus (Gewalt sei ferne den Dingen). Dem Buch<br />
liegen heute noch gültige didaktische Grundregeln zugrunde (Motivation, Aufnahme des<br />
Lernstoffes durch die Sinne) und es erlebte einen phänomenalen Siegeszug mit nicht weniger<br />
als 244 Auflagen, bis zur Mitte des 19. Jahrh. vielerorts als verbindliches Lehrmittel.<br />
Comenius wurde 1592 geboren, verlor früh seine Eltern und beide Brüder, war schon als<br />
18-Jähriger Lehrer und Rektor an einer Lateinschule der Böhmischen Brüder, wurde Theologe<br />
(«ein Mann der Sehnsucht») und reiste viel, lebte zeitweise in Schweden, in Polen und<br />
in Amsterdam, wo er 1670 starb. Er war Zeitgenosse von Francis Bacon, Grimmelshausen<br />
und Descartes, den er persönlich kannte. Er hatte unglaubliche Schicksalsschläge zu<br />
erdulden: Er verlor vier Frauen, und dreimal wurden seine Bücher verbrannt.<br />
Nach Comenius genügen dem Menschen drei «Bücher»: Die Welt, sein Geist und Verstand<br />
und die Bibel. Für ihn ist die Ordnung die Seele der Dinge, alles ist geordnet nach Zahl,<br />
Mass und Gewicht. Das «Mysterium der Dreiheit» bestimmt sein Denken; es äussert sich<br />
in den 3 Harmonien (Lux universalis, harmonia major und harmonia minor) und den 3<br />
Methoden Analyse, Synthese und Synkise (Suche nach Entsprechungen und Resonanzen).<br />
Eine der zahlreichen Publikationen ist eine «Mutterschule». Zur Musik hat Comenius<br />
eine besondere Beziehung: Er staunt darüber, wie «mit so wenigen Tönen so viele Klänge»<br />
möglich sind.<br />
Alexandre Magnin: Bach, un genie visionaire<br />
(Weil das versprochene Résumé in deutsch nicht zur Verfügung stand, berichten wir etwas<br />
ausführlicher.)<br />
Nach einem kurzen Blick auf die Jugendjahre Bachs (der mit 10 Jahren Vollwaise wurde)<br />
und die Heirat mit Maria Barbara (die ihm 7 Kinder schenkte, von denen drei, darunter<br />
C.Ph.Emanuel, überlebten) wendet sich der Referent den angenehmen sechs Jahren als<br />
Hofkapellmeister von Köthen zu, wo Bach vom 9 Jahre jüngeren, musikliebenden Prinzen<br />
hoch geschätzt wurde. Im Jahre 1720 verstarb Maria Barbara piötzlich, während Bach mit<br />
dem Prinzen in Carlsbad weilte. Im Dezember 1721 heiratete Bach Anna Magdalena.<br />
In Köthen entstanden die Johannes-Passion, die 6 Brandenburgischen Konzerte und die<br />
zwei Zwillings-Sonaten für Flöte und Cembalo in Es-Dur und g-moll, deren Originale verschollen<br />
sind.<br />
Im folgenden lasse ich den Referenten auf Grund des mir vorliegenden Manuskripts (in<br />
gekürzter Form) selber sprechen:<br />
3
Die Musikologen hatten schon immer Zweifel - wegen des zu galanten, gefühlvollen Stils –<br />
ob diese Sonaten von Bach stammen. Meine Untersuchungen zur Symbolik Bachs liessen<br />
mich vermuten, dass die Sonate in g-moll ein Hochzeitsgeschenk an seine Gattin Anna<br />
Magdalena war. 1723 bewarb sich Bach um die Stelle des Thomaskantors in Leipzig, nicht<br />
zuletzt, weil der Prinz eine «Amusa» geheiratet hatte, die ihn «von der Musik entfernte».<br />
Bach erhielt die Stelle, aber für den Rat von Leipzig war er die zweite Wahl, weil der schon<br />
berühmte Telemann abgelehnt hatte. Die Vertragsklauseln sprechen nur von den Unterrichtsverpflichtungen<br />
und vom Gehorsam und Respekt gegenüber den Behörden und dem<br />
Rektor. Auf einen solchen Wechsel war der Charakter Bachs nicht vorbereitet; so ärgerte<br />
es ihn beispielsweise, über die Disziplin der Schüler wachen zu müssen wie ein Aufseher.<br />
Es ergaben sich zunehmend Schwierigkeiten, besonders als Ernesti, ein Theologe, brillanter<br />
Geist und bereits bekannter Schriftsteller, dem die wissenschaftlichen Fächer mehr am<br />
Herzen lagen als die Musik, im Alter von 27 Jahren Rektor der Thomasschule geworden<br />
war. Dazu kam im Jahre 1737 der Konflikt um den ersten Präfekten, der einen Schüler körperlich<br />
gemassregelt hatte, durch den Rektor entiassen und durch einen andern ersetzt<br />
worden war. Weil der Neue «falsch sang», jagte ihn Bach mitten aus dem Gottesdienst weg<br />
und verlangte den entlassenen Präfekten zurück. Die Affäre eskalierte und dauerte zwei<br />
Jahre. Sie belastete Bach und demütigte ihn. Wie konnte er unter diesen Umständen sein<br />
Werk weiterführen?<br />
Nachdem der Rat durch seinen Einspruch eine Wiederaufführung der Matthäuspassion am<br />
27. März 1739 verhindert hatte, beschwerte sich Bach, dass er schon 1737 daran gehindert<br />
worden sei, eine Musik für den Karfreitag zu schreiben. Bis dahin hatte er mehr als<br />
200 Kantaten und 4 Passionen geschrieben. C. Ph. Emanuel spricht in seinem Nekrolog<br />
von einer 5. Passion, die aber verschollen ist. Hier meine Erkenntnisse zu dieser Frage:<br />
Im Jahre 1737 fiel der Karfreitag auf den 19. April. An Ostern, dem 21. April, war Bach<br />
genau 52 Jahre und einen Monat alt. Sein Geschmack an Geheimnissen half ihm nun,<br />
seine 5. Passion zur Welt zu bringen. Mit Hilfe der «Gematrie», welche im christlichen Mittelalter<br />
aus der jüdischen Kabbala übernommen wurde, fügte Bach in seine h-moll-Suite<br />
für Flöte und Orchester eine unglaubliche Zahl von theologischen Botschaften ein, die den<br />
Tod Jesu und die vorangehenden Szenen genau schildern.<br />
(Einschub des Berichterstatters: Die Gematrie ordnet jedem Buchstaben in alphabetischer<br />
Reihenfolge eine Zahl zu, also A=1, B=2 bis Z=24, wobei I und J und ebenso U und V als<br />
je ein Buchstabe betrachtet wurde. Das ergibt für BACH dieZahl 2 + 1 + 3 + 8 = 14, für<br />
JSBACH 9 + 18 + 2 + 1 + 3 + 8 = 41, für JOHANN SEBASTIAN BACH 158, für JSB und<br />
für SDG (Soli Deo Gloria) 29. Bach hat durch die Anzahl der Noten, Takte oder Themeneinsätze<br />
mit dieser Methode Texte dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass – wie das<br />
letzte Beispiel zeigt – ein Wort eindeutig eine Zahl ergibt, dass aber umgekehrt eine Zahl<br />
verschiedene Deutungen zulässt. Dass es zwischen Gematrie und Harmonik keinen<br />
Zusammenhang gibt, dürfte klar geworden sein.)<br />
So signiert Bach sein Werk ein erstes Mal in der Fuge: BACH 52 Jahre. Etwas weiter, einige<br />
Takte vor dem Ende der Fuge, entdeckt man seine vollständige, chiffrierte Unterschrift,<br />
genau im Augenblick, als Christus am Kreuz stirbt. Schliesslich findet man eine dritte<br />
Unterschrift am Ende des Werks: Die letzten Noten der Suite tragen seine Initialen: J.S.B.<br />
(chiffriert gleich Soli Deo Gloria).<br />
4
Liebe Freunde, ich stelle fest, dass alle die Musikologen, die mit Lupen und Mikroskopen<br />
die Musik Bachs untersuchen, sich keine Sekunde lang vorstellen können, dass der<br />
gedemütigte Kantor seine h-moll-Sulte auf dem Fundament einer Kathedrale, zur Ehre<br />
Gottes und zur Wiedererweckung des Geistes bauen konnte.<br />
Eine letzte Frage: Warum sollte die berühmte «Badinerie» der h-moll-Suite eine Passion<br />
beschliessen? Nach meiner Ansicht wollte Bach damit unsern Geist durchlüften (oxygener).<br />
Es ist wie ein Donnerschlag, der die Maske der Traurigkeit zerreisst.<br />
Die Messe in h-moll war nicht für einen besonderen Anlass bestimmt, und ihre Teile stammen<br />
aus verschiedenen Zeiten: Das Sanctus entstand 1724, Kyrie und Gloria 1733. Aber<br />
Credo, Benedictus und Agnus Dei sind letzte Werke aus den Jahren 1749 und 17<strong>50</strong>.<br />
Für die Rätsel um die beiden Flöten-Sonaten in Es-Dur und in g-moll, deren Originale verschollen<br />
sind, ist vielleicht Carl Philipp Emanuel Bach verantwortlich. Nach dem Tod von<br />
Anna Magdalena im Jahr 1760 war er im Besitz der beiden Manuskripte. Am Ende seines<br />
eigenen Lebens hat er die erste Sonate als Werk seines Vaters signiert. Von der Sonate in<br />
g-moll, die Anna Magdalena bis zu ihrem Tod sorgfältig aufbewahrt hatte, habe ich ein Faksimile<br />
der einzigen gültigen Kopie erhalten. Darin fehlt merkwürdigerweise der 4. Takt. Aber<br />
in der Reprise und in der Bärenreiter-Ausgabe fehlt dieser Takt nicht. An dieser Stelle, oben<br />
rechts, müsste auch die Signatur des Komponisten gestanden haben. Wer ausser C.P.E.<br />
könnte den 4. Takt und den Namen Bachs entfernt haben? In dieser Vermutung werde ich<br />
bestärkt durch drei Dinge: 1. Die g-moll-Sonate erschien 1763 bei Breitkopf als Werk von<br />
Philipp Emanuel Bach. Aber 1774 schrieb dieser an Forkel: «Die geschriebenen Sachen,<br />
die Breitkopf von mir verkauft, sind theils nicht von mir, wenigstens sind sie alt und falsch<br />
geschrieben.» 2. Der erste Satz des 3. Brandenburgischen Konzerts aus dem Jahre 1721<br />
und der erste Satz der g-moll-Sonate haben den gleichen melodischen Charakter, und<br />
beide Sätze haben ausnahmsweise keine Tempobezeichnung. 3. In der 1739 entstandenen<br />
Sonate in h-moll für Flöte ist das zweite Thema des Andante eine Variation des Haupt-<br />
Themas der Sonate in g-moll.<br />
Es besteht kein Zweifel mehr: Diese galante und gefühlvolle Sonate (sie wurde uns durch<br />
Alexandre Magnin und seine Begleiterin am anschliessenden Konzert im Konservatorium<br />
feinfühlig dargeboten) ist wirklich ein Geschenk von Johann Sebastian Bach an Anna Magdalena<br />
zu ihrem Hochzeitstag.<br />
Sonja Ulrike Klug:<br />
Zahlensymbolik und heilige Geometrie der Kathedrale von Chartres<br />
Dem verheerenden 13. Brand von 1194 war der grösste Teil der sich im Bau befindlichen<br />
neuen Kathedrale und fast die ganze Stadt zum Opfer gefallen. Nur das Westportal – und<br />
wie durch ein Wunder die Reliquie – waren unversehrt geblieben. Es grenzt an ein weiteres<br />
Wunder, dass die Kathedrale innerhalb von 26 Jahren in der heute noch erhaltenen<br />
Form, in einem Zug erbaut werden konnte. Die Referentin ist überzeugt, dass das ohne<br />
das hermetische Wissen (Epistel der lauteren Brüder) und die Hilfe des Bernhard von Clairvaux<br />
aus Cluny nicht möglich gewesen wäre. Der Name eines Baumeisters ist nicht<br />
bekannt.<br />
Zeichnet man alle Marien-Kathedralen im Umkreis von Paris auf einer Karte ein, ergibt sich<br />
5
das Sternbild der Jungfrau! Die Steinskulpturen an den Portalen sind verschieden im Stil;<br />
am Westportal finden sich die ältesten. Unter anderem sind auch die 7 artes llberales dargestellt.<br />
Es sind noch die meisten der ursprünglichen Glasfenster erhalten, unter ihnen 34<br />
Fensterrosen.<br />
Die Kathedrale ist 234 m lang. Das Längsschiff (ohne Westportal) verhält sich zum Querschiff<br />
wie 3 zu 2. Nimmt man die ganze Länge, ergibt sich der goldene Schnitt. Auf der<br />
Suche nach dem heiligen Zentrum legte die Referentin die «Blume des Lebens» (Schar<br />
gleich grosser Kreise, deren Mittelpunkte auf ihren Schnittpunkten liegen) über den Grundriss.<br />
So konnte sie auch zeigen, weshalb die Vierung nicht quadratisch, sondern leicht<br />
rechteckig ist.<br />
Ebenfalls dem Muster der Blume des Lebens unterworfen ist das Labyrinth mit 34 Windungen,<br />
deren letzte ins Zentrum führt (Christus wurde 34jährig). Wenn man das Bild der<br />
Südrose rotieren lässt, zeigt sich in der Mitte des Symbol von Yin und Yang.<br />
Margret von Löwensprung: Das Tonoskop als Erzeuger von Klangfiguren aus der<br />
menschlichen Stimme in Forschung und Therapie<br />
Die Kymatik geht zurück auf Chladni und seine schwingenden Platten und vor allem auf<br />
Jenny, der 1967 und 1972 mit zwei grossformatigen Bildbänden an die Öffentlichkeit trat.<br />
Wichtig in der Entwicklung war auch Helmholtz für die Wahrnehmung der Töne (Ton-Empfindung).<br />
Beim von der Referentin gebauten Tonoskop schwingt eine Membran aus Gummi, also ein<br />
quasi dreidimensionales Medium, und feiner Quarzsand zeigt die Schwingungsbilder. Die<br />
Töne werden über eine etwa 25 bis 30 cm lange und etwa 3 bis 3,5 cm weite Röhre in ein<br />
rundes, ca 12 cm hohes Resonanzbecken von etwa 25 cm Durchmesser gesungen. Darauf<br />
aufgesetzt ist ein etwa 6 cm hoher Zylinder von etwa 12 cm Durchmesser, über den<br />
oben die Membran gespannt ist. (Die Masse sind aus der Erinnerung geschätzt.)<br />
Die Stimme der Referentin erzeugt erstaunlich schöne Bilder in axialen und radialen<br />
Teilungen, die sich wandeln mit der Tonhöhe, der Qualität des Tones (flache oder warme<br />
Stimme; Obertonreichtum) und der Lautstärke.<br />
Das Tonoskop hat sich besonders bewährt in der therapeutischen Arbeit mit gehörlosen<br />
(meist gehörschwachen) Kindern und mit geistig Behinderten. Sie müssen ihre Stimme<br />
führen, um schöne Bilder zu erzeugen, sie können mit ihr spielen, sie erfahren sich als<br />
Schöpfer dieser Figuren, sie erleben die Wohltat des Singens. Was besonders beeindruckt:<br />
Die andern Kinder schauen und hören fasziniert zu.<br />
Auf diesem Gebiet wurde noch wenig geforscht. Am Kayser-lnstitut in Wien gab es eine<br />
Arbeit über «Harmonikale Strukturen schwingender Membranen». Dabei wurde die Membran<br />
als Summe nebeneinander liegender Saiten betrachtet, was einige Fragen aufwirft.<br />
6<br />
Ernst Waldemar Weber
HANS KAYSER<br />
Das Lehrbuch der Harmonik 36x26 cm, 380 S., illustr., 19<strong>50</strong>, vergriffen<br />
Besprechung in «Die Kommenden», Jahrgang 28, <strong>Nr</strong>n. 11, 12, 13, ab 10. Juni 1974<br />
von Friedrich Oberkogler<br />
Das «Lehrbuch der Harmonik», wohl das umfassendste Werk <strong>Hans</strong> Kaysers, wurde<br />
1944 beendet, und 19<strong>50</strong>, nachdem es der Autor noch einmal revidiert hatte, in einer<br />
Prachtausgabe durch den Occident Verlag Zürich, der Öffentlichkeit übergeben. Auf<br />
breiteste Grundlage, vor allem hinsichtlich religiöser Symbolik, gestellt, gibt das Werk<br />
die ganze harmonikale Ideenwelt wieder, die den bedeutenden Schweizer «Musik-<br />
Denker» bereits in seinem ersten Buch, «Der hörende Mensch», beschäftigt hat. Was<br />
dort jedoch wie ein gewaltiger Aufriss seiner tönenden Perspektiven anmutet, erfährt<br />
hier seine bis in alle Einzelheiten gehende Durcharbeitung. Vom Inhalt dieses Buches<br />
soll nachstehend in einigen Aufsätzen berichtet werden.<br />
Hören – Ein Sehen von Innen<br />
HANS KAYSER lebte von 1891 bis 1964. Die Zeit von 1918 bis 1930 ist erfüllt mit der<br />
Arbeit am «Hörenden Menschen», dem Werk, das die Harmonik als System begründet.<br />
Dr. RUDOLF HAASE, Schüler HANS KAYSERS und damaligem Leiter des <strong>Hans</strong>-Kayser-<br />
Institutes für harmonikale Grundlagenforschung an der Wiener Musikhochschule,<br />
schreibt über diese nach geistigen Gütern dürstenden Nachkriegsjahre:<br />
«Es ist kein Zufall, dass in dieser Zeit Theosophie und Anthroposophie aufblühten,<br />
dass sich eine wissenschaftliche Astrologie neu konstituierte, dass man sich erneut<br />
mit den Rosenkreuzern befasste; kein Zufall auch, dass viele sich in der Wiederbelebung<br />
der Mystik Zukunftsträchtiges erhofften, so dass Kayser dem Inselverlag eine<br />
Mystiker-Ausgabe vorschlagen konnte und daraufhin auch den Auftrag erhielt, die<br />
Buchreihe ‘Der Dom – Bücher deutscher Mystik’ zu edieren. Alte esoterische Traditionen<br />
fanden also plötzlich ein lange verschüttetes Interesse, und so war die Zeit – unter<br />
dieser Perspektive betrachtet – durchaus reif für die Erneuerung der Harmonik, ganz<br />
abgesehen davon, dass auch Josef Matthias Hauer eine Art harmonikaler Esoterik mit<br />
stark mystischem Einschlag schuf» (Geschichte des harmonikalen Pythagoreismus).<br />
Die Beschäftigung mit der deutschen Mystik hat Kayser den Weg zur «Harmonik»<br />
finden lassen. JAKOB BÖHME, PARACELSUS und vor allem JOHANNES KEPLER war die Welt,<br />
die dem Metaphysiker Kayser den Gedanken erweckte, Mystik und Harmonik zu verbinden.<br />
Die wichtigste persönliche Begegnung für den Schweizer Gelehrten war jene<br />
mit PAUL HINDEMITH. Wir entnehmen den Darstellungen RUDOLF HAASES, dass beide<br />
intensiv miteinander korrespondierten, dass sie in Olten gemeinsam den Plan zur<br />
Gründung einer Musikschule fassten. Die Durchführung scheiterte an dem Ausbruch<br />
des Zweiten Weltkrieges und an Hindemiths Emigration.<br />
7
Dass der grosse zeitgenössische Komponist jedoch den Prinzipien der Harmonik auch<br />
späterhin verbunden blieb, ersehen wir nicht nur aus seiner theoretischen Arbeit<br />
«Unterweisung im Tonsatz», in der er klare Stellung gegen die abstrakt-temperierte<br />
Atonalität der Wiener Schule Schönbergs bezog; seine Verbundenheit mit KAYSERschen<br />
Impulsen fand ihren würdigen künstlerischen Ausdruck in seiner KEPLER-Oper<br />
«Die Harmonie der Welt» sowie in den ihr entnommenen drei symphonischen Sätzen,<br />
die der Komponist mit den Überschriften «Musica instrumentalis», «Musica humana»<br />
und «Musica mundana» versah. Begriffe, die einst BOETHIUS – mit pythagoreischsphärenharmonikalem<br />
Denken innig verbunden – geprägt hatte.<br />
Dieser kurze Hinweis soll den Leser vor irrtümlichen Vorstellungen bewahren, zu<br />
denen er durch den Titel des Buches leicht geführt werden könnte. Verbindet sich<br />
doch gewöhnlich mit dem Begriff «Harmonik» die Lehre vom Zusammenklang der<br />
Töne in der Musik. Für KAYSER stellt diese Akkordlehre jedoch nur einen unter zahlreichen<br />
Spezialfällen harmonikaler Phänomene dar.<br />
Unser Wort «Harmonik» findet seine Wurzel im griechischen Verbum αρµοττω = fügen,<br />
ordnen, und meint damit die «Wohlgefügtheit» des Universums aus gegenseitig widerstreitenden<br />
Kräften, so wie etwa HERAKLIT sagt: «Das widereinander Strebende zusammengehend;<br />
aus dem auseinander Gehenden die schönste Fügung»: αρµονια =<br />
Harmonia. (Zitiert nach HERMANN PFROGNER: «Musik – Geschichte ihrer Deutung».)<br />
Die Universalität seines Harmonie-Begriffes dokumentiert KAYSER allein schon dadurch,<br />
dass er die ganze Lehre seiner Harmonik als einen Weg zur «Akróasis», zur<br />
«Anhörung der Welt» auffasst; d.h. als Weg zu einem Ergründen von Weltzusammenhängen,<br />
die sich – um mit J. KEPLER zu sprechen – einem denkenden Hören erschliessen,<br />
«durch den Verstand, nicht durch das Ohr fassbar». Diese Weltzusammenhänge<br />
stellen sich ihm in harmonikalen Strukturen dar, die er in seinem Werk zu einer grandiosen<br />
Ganzheit zusammenfügt, und ihn eine ganz bestimmte Beziehung zu Welt,<br />
Erde und Mensch gewinnen lassen: eben eine Akróasis, eine «Welt-Anhörung», zum<br />
Unterschied unserer sonst gewonnenen «Welt-Anschauung, Aisthesis».<br />
Musik als Weltenbauprinzip<br />
Mit diesen neu erarbeiteten Erkenntnissen aber schlägt KAYSER einen gewaltigen<br />
Bogen zurück auf urältestes Weisheitsgut der Menschheit: zur Musik als «Weltenbauprinzip»<br />
und «Weltgesetzlichkeit». In den mannigfaltigsten Abwandlungen tritt uns<br />
immer wieder der «Lichtklang» sowohl in den Schöpfungsmythen der Naturvölker, als<br />
auch in den Kosmogonien der afro-asiatischen Hochkulturen, als die Ursubstanz alles<br />
Geschaffenen entgegen.<br />
In Indien ist es der Schöpfergott der Veden Praj – apati, der «reine Geist» des Brahman,<br />
der seinem Wesen nach «reiner Klang», reiner Hymnus ist. «Sein Körper bestand aus<br />
drei mystischen Silben, aus deren singender Aufopferung der Himmel, das Meer und<br />
die Erde hervorgingen» (MARIUS SCHNEIDER: «Singende Steine»). Und der Anfangstext<br />
des «Samavidhana-Brahmana» erzählt uns, wie Praj – apati die ganze Welt erschuf und<br />
ihr das «S – aman» als Lebensspeise gab. Es ist eine tönende, siebengliedrige «Speise»:<br />
8
«Von dem allerhöchsten Ton des S - amans leben die Götter, von dem ersten unter den<br />
folgenden die Menschen, von dem zweiten Gandharven (himmlische Genien) und<br />
Apsarasen (Paradiesmädchen), von dem dritten das Vieh, von dem vierten die Manen<br />
und diejenigen, die in Eiern liegen, von dem fünften die Asuras und Raksasas (Dämonen<br />
und Riesen), von dem letzten Kräuter, Bäume und die übrige Welt. Deshalb sagt<br />
man: das S - aman ist Speise» (zitiert nach H. PFROGNER, a.a.O.).<br />
In dem enzyklopädischen Sammelwerk Chinas, «Frühling und Herbst», das uns durch<br />
LÜ BU WE (gest. 237 v.Chr.) überliefert worden ist, und unter anderem die ältesten<br />
erhaltenen Notizen chinesischer Musiktheorie enthält, heisst es in bezug auf den<br />
Schöpfungs-Urbeginn:<br />
«In uralten Zeiten herrschte Dschu Siang Schi über die Welt. Damals bliesen viele<br />
Winde, die Kraft des Lichten sammelte sich, und alle Dinge lösten sich auf ... Da<br />
machte Schi Da die fünfsaitige Harfe, um die Kraft des Trüben herbeizurufen und die<br />
Lebewesen alle zu festigen.» (H. PFROGNER, a.a.O.).<br />
In Ägypten ist es die «singende Sonne, welche die Welt durch ihren Lichtschrei<br />
erschafft, oder Toth, der Gott des Wortes und der Schrift, des Tanzes und der Musik,<br />
welcher die Welt durch ein siebenmaliges Gelächter ins Leben rief, wobei er jedes Mal<br />
etwas entstehen liess, dass grösser war als er selbst». Dieser wichtige Hinweis von<br />
MARIUS SCHNEIDER wird uns im Werk HANS KAYSERS noch in ganz konkreter Form entgegentreten.<br />
In der Genesis ist es schliesslich der effektiv gewordene Ton, das Wort, aus dem die<br />
Welt entsteht: Und Gott sprach: Es werde Licht!<br />
Und der 19. Psalm beginnt mit den Versen: «Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und<br />
die Feste verkündigt das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem andern, und eine<br />
Nacht tut es der anderen kund – ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme.<br />
Ihr Klingen geht aus durch alle Lande, ihr Reden bis zum Ende der Welt.»<br />
Der Ton als tragender Weltengrund steht aber gleichzeitig in unmittelbarem Zusammenhang<br />
mit der Musik. Auf die Siebengliedrigkeit der tönenden Lebensspeise Praj – apatis<br />
wurde bereits verwiesen. Chinas «Frühling und Herbst» lässt uns dagegen<br />
unschwer eine Zwölfordnung der kosmischen Tonwelt erkennen:<br />
«Zur Zeit der Heiligen (der alten Könige), als höchste Vernunft auf Erden herrschte, war<br />
der Atem von Himmel und Erde im Einklang und erzeugte die Winde. Immer wenn die<br />
Sonne an einen bestimmten Punkt kam, so gab der Mond dem Wind einen Klang und<br />
auf diese Weise wurden die zwölf Tonarten erzeugt.»<br />
Nach Aufzählung der durch die zwölf Monate erzeugten zwölf Töne, heisst es abschliessend:<br />
«Wenn der Windatem von Himmel und Erde im rechten Verhältnis ist, so<br />
bestimmen sich die zwölf Tonarten.»<br />
Diese Überlieferungen dienten den Chinesen unter Heranziehung eingehender astronomischer<br />
Studien zur Erkenntnis einer umfassenden «musica mundana», einer Weltenmusik,<br />
die Himmelskörper, Götterwesen und Naturreiche in tönende Beziehungen<br />
setzte und aus der sie ihre 12 Lü-Tonarten und ihre Fünftonskala ableiteten.<br />
9
Ein schönes Beispiel für den Zusammenklang zwischen Musik und Kosmos bietet<br />
auch Ägypten, das uns der spät-antike Dio Cassius (etwa 155–235) überlieferte, und<br />
das HERMANN PFROGNER in seinem erwähnten Sammelband anführt:<br />
«Die Einteilung der Tage nach den sieben sogenannten Wandelsternen ist bei den<br />
Ägyptern aufgekommen und jetzt bei allen Völkern ... angenommen. Wenn man die<br />
sogenannte Harmonie, Diatessaron (= Quarte) (welche als Hauptteil der Musik angenommen<br />
wird) auf die Sterne, auf denen die ganze Ordnung der Himmelsbewegung<br />
beruht und zwar so, wie jeder seine Bahn beschreibt, überträgt und nun von dem äussersten<br />
Kreise, dem des Saturns, beginnt, mit Übergehung der zwei folgenden den<br />
Gott des vierten nimmt, von diesem dann wieder zwei Kreise überspringt, auf den siebenten<br />
fortrechnet, auf die gleiche Weise auch die übrigen durchgeht, und die Tage<br />
nach den Göttern dieser Kreise der Reihe nach benennt, so findet man, dass diese<br />
alle zu der Himmelsordnung in musikalischem Verhältnisse stehen.»<br />
Aus dieser Reihe von Beispielen, denen mit Absicht relativ breiter Raum gegeben<br />
wurde, lässt sich erkennen, wie der «Ton» ursprünglich als das eigentlich zeugende<br />
Urphänomen erlebt worden ist, aus dem dann im weiteren Verlauf der Evolution durch<br />
Aufspaltung des ursprünglich Einen in eine Vielheit, die musikalischen Bezogenheiten<br />
der verschiedenen Schöpfungsebenen erflossen: Planeten, Jahreszeiten, Wochentage,<br />
Himmelsrichtungen, Elemente, und die irdisch erklingenden Töne, sie alle offenbarten<br />
jeweils auf ihrer Ebene musikalische Entsprechungen, die sich zu einer Weltenmusik<br />
im umfassendsten Sinne gruppierten. So galt den Indern z.B. der Ton f als<br />
durchtönt von Jupiter, er war aber auch Ausdruck des Luft-Elementes, markierte<br />
Osten, galt als Frühlingston und Ton der Kindheit. Entsprechend dann die Reihe des<br />
Tones c: Mars, Feuer, Süd, Sommer, Jugend usw.<br />
Beiden Kriterien: dem Ton als schöpferisches Prinzip sowohl, als auch der Vielfalt der<br />
Töne als kosmischer Zusammenklang, gilt Kaysers Interesse. Als Fundament seiner<br />
Forschung dient ihm PYTHAGORAS, durch den all diese Lehren einer tönenden Weltenharmonie<br />
ihre, für das abendländische Denken verbindliche Fassung erhalten haben.<br />
PYTHAGORAS lehrte in jenem 6. Jahrhundert v.Chr., von dem PETER BAMM meint, dass<br />
es das «bedeutsamste und folgenschwerste Saeculum der ganzen Geschichte» sei.<br />
THALES VON MILET, BUDDHA, LAOTSE, KONFUZIUS vereint es in seinen verschiedenen Kulturkreisen<br />
der Erde. Unter Kaiser Kyros wurden die Lehren des ZARATHUSTRA im Avesta<br />
aufgezeichnet; den Bau des Artemistempels in Ephesos, die Geburt der Tragödie<br />
erlebte es ebenso, wie die unvergängliche Lyrik einer Sappho von Lesbos.<br />
In dieser Hoch-Zeit geistiger Wirkenskräfte erhält jenes, dem imaginativ-inspirativen<br />
Bewusstsein noch unmittelbar zugängliche Erlebnis einer Weltenmusik, durch PYTHA-<br />
GORAS seine durch Mass und Zahl begreifbare Ausgestaltung. Und von diesem Zeitpunkt<br />
an zieht sich eine «Geschichte des Pythagoreismus» wie ein roter Faden durch<br />
das abendländische Geistesleben. Von PLATO, EMPEDOKLES, HERAKLIT zu AUGUSTINUS,<br />
von PLOTIN zu LEIBNIZ und JOHANNES KEPLER, von JAKOB BÖHME zu SCHELLING und SCHO-<br />
PENHAUER – so verschieden die Welt dieser Denker sich auch gestalten mag, ihre «klingende<br />
Struktur» wird bei allen «hörbar».<br />
Und wie gewaltig tönt nicht die Welt in der abendländischen Dichtung! GOETHES<br />
Anfangsverse des «Prologs im Himmel» sind in diesem Zusammenhang oft zitiert wor-<br />
10
den, so dass wir sie hier nicht wiederholen müssen. Doch unzählige andere Beispiele<br />
lassen erkennen, wie in der abendländischen Seele dieses Tönen einer Sphärenmusik<br />
lebendig blieb, mag der heutige Intellekt auch alles nur als poetische Schwärmerei,<br />
Phantastik und Naivität einer noch kindlichen Menschheit ansehen.<br />
Man denke etwa an LENAUS zarte Verse seines «Waldliedchen», wo es heisst:<br />
«Klingend strömt des Mondes Licht<br />
Auf die Eich’ und Hagerose,<br />
Und im Kelch der feinsten Moose<br />
Tönt das ewige Gedicht.»<br />
Oder an EICHENDORFFS zauberhafte Poesie:<br />
«Schläft ein Lied in allen Dingen,<br />
Die da träumen fort und fort,<br />
Und die Welt hebt an zu singen,<br />
Triffst du nur das Zauberwort.»<br />
Man erinnere sich des Sehnsuchtsrufes eines NOVALIS in seinen Lehrlingen zu Sais:<br />
«O dass der Mensch die innre Musik der Natur verstände und einen Sinn für äussere<br />
Harmonie hätte!»<br />
Die Wirklichkeit der Sphärenharmonie<br />
Hier liegt das grosse Verdienst HANS KAYSERS: dass er uns die Lehre des PYTHAGORAS<br />
von der Sphärenharmonie, und damit alles, was in der Dichterseele auftönte, neu<br />
zugänglich macht. Dass er alles, was Mythos und dichterische Phantasie zu sein<br />
scheint, dem heutigen Bewusstsein in wissenschaftlich präziser Formgebung erschliesst.<br />
Dabei kommt es nicht darauf an, ob KAYSER, überwältigt von seinen Forschungsergebnissen,<br />
vielleicht über das gesetzte Ziel hinausgetragen wird. Nur ganz wenigen der<br />
grossen Denker und Entdecker war es vergönnt, die Objektivität sich zu bewahren,<br />
und nicht in eine verabsolutierende Einseitigkeit zu verfallen. Wir sollten dies nicht als<br />
Negativum werten. Denn gerade die Ausschliesslichkeit ihrer Blickrichtung schenkt<br />
ihnen und damit auch der Nachwelt, die Früchte ihres Forschens. «Des tät’gen Manns<br />
Behagen sei Parteilichkeit», lässt GOETHE in der «Pandora» seinen Prometheus sprechen.<br />
Solch «tätige Männer» dürfen wohl «parteilich» sein. Im Abstand-Bewahren aber<br />
müssen wir dankbar sein, dass uns KAYSER durch sein Werk zu realen Vorstellungen<br />
verhilft, wie der Ton gestaltend und formbildend die Welt durchklingt.<br />
Alle Bereiche der Natur, das Anorganische wie das Lebendige, sind durchtönt von dieser<br />
Weltenmusik. Und hier mag sich uns der Wunsch aufdrängen, diesen «Tanz der<br />
Stoffe», die «Koagulierung der Eiweisssubstanzen» konkreter, für unser irdisches Verstandesbewusstsein<br />
differenzierter begreifen zu können. Denn wie überall in der Darstellung<br />
seiner Forschungsergebnisse, hat auch hier RUDOLF STEINER Richtlinien und<br />
Denkweisungen gegeben. Sie auszuarbeiten ist die Aufgabe seiner Nachwelt. Und<br />
dafür kann in diesem speziellen Fall das Werk HANS KAYSERS wertvolle Hilfe sein, das<br />
uns mit seinen Klangstrukturen Zusammenhänge aufzeigt, die weit über das physikalische<br />
Phänomen der Chladnischen Klangfiguren hinausgehen. Um diese «Hörbilder»,<br />
11
wie KAYSER diese Strukturen nennt, in ihrer Bedeutung aber richtig werten und verstehen<br />
zu können, müssen wir uns vorerst mit der pythagoreischen Grundidee vertraut<br />
machen, die den Ausgangspunkt der gesamten harmonikalen Forschung HANS<br />
KAYSERS ausmacht.<br />
Pythagoras und die Geheimnisse der Ober- und Untertonreihe<br />
Diese pythagoreische Grundidee ist vor etwa 100 Jahren durch ALBERT VON THIMUS<br />
ausgearbeitet worden, wurde jedoch bis heute kaum von der Musiktheorie zur Kenntnis<br />
genommen. Sie stellt rein zahlenmässig einen Teilungskanon dar, welcher eine<br />
beliebige Strecke «rational» unterteilt. Da das Schema ursprünglich in der Form des<br />
griechischen Buchstaben L = Lambda (Λ) dargestellt worden ist, nannte es Thimus<br />
das «Lambdoma». Seine Schenkel werden durch mathematisch streng gesetzmässige<br />
Zahlenverhältnisse gebildet:<br />
6/1<br />
5/1<br />
4/1<br />
3/1<br />
2/1<br />
1/1<br />
Wir sehen: Am rechten Schenkel bleibt der Zähler konstant, der Nenner dagegen läuft<br />
von 1 bis ∞. Beim linken Schenkel ist es umgekehrt; der Zähler schreitet ins Unendliche,<br />
der Nenner bleibt konstant. Dabei ist festzuhalten, dass diese Zahlenverhältnisse<br />
nur der Übersicht halber in Bruchform geschrieben sind, in Wahrheit aber echte<br />
Proportionen darstellen.<br />
Das Lambdoma soll sagenhafte Eigenschaften besitzen und in den verschiedensten<br />
Bereichen, der Kunst, Philosophie, der religiösen Symbolik und so weiter, Anwendung<br />
gefunden haben. Die Abbildung, die RUDOLF HAASE in seiner «Geschichte des Pythagoreismus»<br />
bringt, ist den «Opera omnia» des BOETHIUS entnommen und zeigt ein<br />
Lambdoma mit spitzem Winkel. THIMUS beruft sich auf Iamblichus, dessen Lambdoma<br />
einen Winkel von 60 Grad aufweist, und damit stets ein gleichseitiges Dreieck ergibt,<br />
wo immer man seine Schenkelpaare durch eine Waagrechte verbindet. Angesichts<br />
seines erwähnten hohen Symbolgehaltes dürfte wohl die gleichseitige Dreiecksform<br />
12<br />
1/2<br />
1/3<br />
1/4<br />
1/5<br />
1/6
die ursprüngliche gewesen sein. Für unser Thema ist wichtig, dass die Proportionen,<br />
die es aufweist, dieselben sind, die PYTHAGORAS bei seinen Monochord-Untersuchungen<br />
hinsichtlich der Saitenteilung und der dadurch entstehenden Intervalle, fand.<br />
Setzen wir nämlich die Spitze des Lambdoma, den Zahlenwert 1/1, mit der Tonzahl<br />
einer bestimmten Saitenlänge gleich und teilen dann die Saite in die Hälfte – 1:2 (1/2)<br />
–, dann erklingt die Ober-Oktav des Tones der ursprünglichen Saitenlänge. Dritteln wir<br />
die Monochordsaite 1/1 und setzen den Steg an den Punkt 2:3, erhalten wir die<br />
Quinte. Verkürzen wir im Verhältnis 3:4, ergibt sich die Quarte des ursprünglichen<br />
Ausgangstones.<br />
Dasselbe Bild, in die Tiefe gespiegelt, ergibt die linke Schenkelreihe. Wenn die ursprüngliche<br />
Saitenlänge verdoppelt wird, das Verhältnis 2:1 = 2/1 entsteht, erklingt die<br />
Unteroktav des Ausgangstones 1/1.<br />
Neben den zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten spiegelt uns das Lambdoma also<br />
auch ganz bestimmte Intervallverhältnisse, wenn wir seine Zahlenproportionen als<br />
solche von Tonzahlen auffassen. Soweit jene pythagoreische «Grundidee». Wir lassen<br />
sie vorerst als historische Gegebenheit stehen und kehren zu unserem eigentlichen<br />
Thema zurück, den harmonikalen Untersuchungen HANS KAYSERS.<br />
Das experimentell greifbare Fundament seiner Forschung bildet die sogenannte Obertonreihe,<br />
jene geheimnisvolle, in jedem Ton verborgene Harmonie, deren Vorhandensein<br />
im 17. Jahrhundert entdeckt wurde.<br />
Jeder Ton weist bekanntlich eine bestimmte Anzahl von Schwingungen auf, d.h. regelmässige<br />
Bewegungen in einer bestimmten Zeiteinheit. Die Schwingungszahl eines<br />
Tones bestimmt dessen Tonhöhe. Kenne ich diese Schwingungszahl, dann kann ich<br />
sämtliche anderen Töne zu ihm in bestimmte Beziehungen setzen. Die praktische<br />
Durchführung nimmt sich folgendermassen aus:<br />
Wir geben einem bestimmten Ton – der Einfachheit halber sei es der Ton c – die<br />
Schwingungszahl 1. Selbstverständlich könnten wir für unser Experiment jeden beliebigen<br />
Ton dazu verwenden. Wir haben uns für den, für unsere Dur/Moll-Tonalität<br />
geltenden Grundton c entschlossen. Dieser Ton c weist in einer Sekunde eine ganz<br />
bestimmte Schwingungszahl (Frequenz) auf, die uns in ihrer effektiven Wertigkeit<br />
jedoch gar nicht interessieren muss. Wir geben vielmehr diesem bestimmten Ton c<br />
den Index 1 und sind uns bewusst, dass sich hinter ihm eine ganz bestimmte Grössenordnung<br />
seiner Schwingungszahl verbirgt. Für uns jedoch gilt die Tatsache, dass<br />
dieser Ton c in einer bestimmten Zeiteinheit eine (1) Schwingung vollzieht. Wobei<br />
nochmals betont werden soll, dass man diese Feststellung mit jedem beliebigen Ton<br />
vornehmen kann.<br />
Unser c hat also den Index 1 erhalten. Verdopple ich, verdreifache, vervierfache usw.<br />
ich nunmehr diese Schwingungszahl 1, dann resultiert daraus eine ganz bestimmte<br />
Tonfolge, die sich, von diesem c aus gemessen, folgendermassen ausnimmt:<br />
c c’ g’ c’’ e’’ g’’ (b’’) c’’’<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
c’’’ d’’’ e’’’ (fis’’’) g’’’ (a’’’) (b’’’) h’’’ c’’’’<br />
8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />
13
Das jeweilige Bezugsverhältnis zum Ausgangston ist deutlich erkennbar. Wenn ich die<br />
Schwingungszahl 1 verdopple, ergibt das die Oktave meines Grundtones c mit dem<br />
Index 2. Verdreifache ich die Schwingungszahl, erhalte ich einen Ton g, der um eine<br />
Quinte über der eben entstandenen Oktav, bzw. eine Duodezim über dem Ausgangston<br />
liegt, mit Index 3. Die Vervierfachung ergibt die nächst höhere Oktave des Grundtones.<br />
Durch Index 5 gewinnen wir die über der zweiten Oktav liegende grosse Terz.<br />
Index 6 gibt mir die Oktav des durch Index 3 gewonnenen g, usw. Die Indices sind<br />
theoretisch ad infinitum fortzusetzen.<br />
Die dadurch entstehende Tonfolge, die wir bis zum Index 16 aufnotiert haben, ist die<br />
Obertonreihe, jenes Naturphänomen, das immer auftritt, wenn Materie zum Tönen<br />
gebracht wird. Wo immer ein Stoff mit einer bestimmten Tonhöhe schwingt, tönt nicht<br />
allein sein eigentlicher Grundton, auf den er gestimmt ist, sondern mit ihm tönt ein<br />
theoretisch unbegrenztes Universum von Obertönen mit. Jeder erklingende Ton ist<br />
wirklich eine Klangsäule, die ins Unendliche reicht. Jeder erklingende Ton ist für sich<br />
selbst ein Zusammenklang von Tönen, eine Harmonie, die das Volumen, die Sättigung<br />
und Klangfarbe des Tones wesentlich beeinflusst.<br />
Die Obertonreihe ist also ein harmonisches Phänomen; denn sie bedeutet Zusammenklang,<br />
Gleichzeitigkeit. In ihrer Struktur bietet sie uns aber noch weitere, bemerkenswerte<br />
Eigenschaften. Etwa ihre «Quantelung» – ihr sprunghaftes Fortschreiten von<br />
einer Stufe zur anderen. Das ist keinesfalls so selbstverständlich, wie es aussehen<br />
mag. Denn die Zahlenreihe, mit der wir die Töne numeriert haben, sagt diesbezüglich<br />
nichts aus. In ihrem äusseren Erscheinungsbild ist sie zwar auch quantenhaft, setzt<br />
bestimmte Grössen, aber innerlich muss sie doch als Kontinuum gedacht werden.<br />
Denn zwischen den Grössen 1 und 2, 2 und 3 usw. liegen ja unendlich viele Zwischenstufen.<br />
Die Obertonreihe aber zeigt sich in ihrer inneren Struktur als echte,<br />
tatsächliche Quantelung. Zwischen ihrem ersten und zweiten Ton (der Oktave des<br />
ersten) liegt kein Ton, der ihr angehört. Der zweite, dem Grundton zunächst benachbarte<br />
Ton ist die Oktave. Mit dieser stufenweisen Entfaltung aber tritt uns auf tönender<br />
Ebene ein Prinzip entgegen, dem wir im Evolutionsgeschehen ebenfalls begegnen.<br />
Denn die Entwicklung geht nicht immer als Kontinuum vor sich. Auch die Natur macht<br />
«Sprünge»!<br />
Die Quantelung führt uns gleichzeitig an ein weiteres Phänomen heran: an die Intervallierung<br />
der Obertonreihe. Kayser bezeichnet sie als ihre «Seele». Diese Intervall-Folge<br />
lässt uns eine ganz bestimmte Struktur erkennen: ein stetiges Engerwerden der Intervallschritte:<br />
Oktave (8) – Quinte (5) – Quarte (4) – grosse Terz (3) – kleine Terz –<br />
schliesslich eine noch kleinere Terz, durch den Index 7 erzeugt. Da wir in unserer<br />
abendländischen Musik mit den Tönen der Indices 7, 11 und 13 – den sogenannten<br />
«ekmelischen» Tönen – nicht musizieren, wurden sie in Klammern gesetzt. Der vierte<br />
Oktavraum von c’’’ zu c’’’’ umfasst dann die Sekund-Intervalle mit all ihren verschiedenen<br />
Tonhöhen und Grössenordnungen. Im 5. Oktavraum würden dann sämtliche<br />
Prim-Grössen in Erscheinung treten. Damit erkennen wir, dass sich die Tonreihe asymptotisch<br />
immer mehr dem Grundton-Bereich annähert, ohne ihn jemals wirklich zu erreichen.<br />
Auch diese Verengung der Intervallschritte, das «Abklingen» der Obertonreihe, wie es<br />
HANS KAYSER nennt, ist ein Phänomen, das uns auf den verschiedensten Ebenen der<br />
14
Natur, wie auch des Lebens selbst, entgegentritt. HANS KAYSER weist in diesem Zusammenhang<br />
auf die Abnahme der Lichtausbreitung, auf alle physikalischen Kraftäusserungen,<br />
«welche nach dem ersten Anstoss durch Luft, Reibung usw. gebremst werden».<br />
Er führt die «Planetendichten und ihre Geschwindigkeiten» an, die ebenfalls einer<br />
«serialen Abnahme» gehorchen. Auf biologischer Ebene wäre das Tier- und Pflanzenreich<br />
zu erwähnen:<br />
«Fast jede Pflanzenform gehorcht in Gestalt und Wachstum einer quantenhaften harmonikalen<br />
‘Dichotomie’; bei den Tierformen sehen wir dasselbe besonders in den<br />
Gesetzen des Zellenaufbaus und -wachstums sowie den Chromosomenzahlen und<br />
Vererbungsregeln; beiden Bereichen gemeinsam ist eine ausgesprochene ‘ruckweise’,<br />
d.i. eben quantenhafte Progression ihrer Stammbäume, d.h. eine Entwicklung<br />
von einfachsten Typen zu immer differenzierteren, innerhalb welcher Gesamtlinie sich<br />
die einzelnen Prototypen immer wieder ‘erschöpfen’, d.h. abklingen, um neuen Platz<br />
zu machen.»<br />
Im subjektiv-menschlichen Bereich untersucht KAYSER die menschlichen Willenshandlungen,<br />
den Verlauf von Krankheiten und anderes mehr, und kommt auch hier zu dem<br />
Ergebnis eines anfänglich vehementen Einsetzens des jeweiligen Elementes und<br />
dessen allmähliches Abklingen.<br />
Die Intervalle als Träger der Tonalität<br />
Diese, für uns nicht nachprüfbaren Ergebnisse der Geistesforschung werden jedoch<br />
gerade durch das Intervallphänomen der Obertonreihe einsehbar und begreifbar. Die<br />
ersten uns erreichbaren materiellen Dokumente menschlichen Musizierens weisen uns<br />
auf pentatonische Tonfolgen. In ihnen ist die Quinte das strukturbildende Intervall.<br />
Denn das pentatonische Melos ist eine in einen Oktavraum hineinprojizierte Quintenreihe.<br />
Das Mittelalter vollzieht dann den Schritt zur Terz. Sie ist in der Dur/Moll-Tonalität das<br />
tragende Intervall, ja das harmonische Kriterium schlechthin. Unserem Jahrhundert<br />
schliesslich war es vorbehalten, die Terzen-Struktur zu überwinden und gleichsam in<br />
den 4. Oktavraum der Obertonreihe einzutreten: in die Sekund-Struktur.<br />
Die Reihenfolge, welche im musikgeschichtlichen Werden die Intervalle als strukturelle<br />
Träger der Tonalität bilden, entspricht also genau jener, wie sie sich in den verschiedenen<br />
Oktavräumen der Obertonreihe abzeichnet. Dokumentarisch verfolgen und<br />
bezeugen lässt sich dies, wie gesagt, nur bis zum 2. Oktavraum, also bis zum Quinten-Intervall.<br />
Doch wissen wir, dass der Zeitpunkt, von dem uns schriftliche Überlieferungen<br />
erhalten sind, nicht der Beginn der Musik war. Auch vorher hat es bereits<br />
«Musik» gegeben. Die Tatsache nun, dass sich in der von uns überschaubaren Zeitenfolge<br />
der Raum des die Tonalität tragenden Intervalls kontinuierlich verengt, lässt den<br />
Schluss zwingend erscheinen, dass in noch ferner zurückliegenden Zeiten wohl auch<br />
der erste Oktavraum von der Menschheit erlebt worden ist und die Oktave als der<br />
kleinste Abstand zwischen zwei Tönen empfunden wurde. Und jene Zeiträume, die<br />
noch grössere Intervalle als die Oktav als unmittelbar benachbart erlebten – sie<br />
15
sprengten, bildlich gesprochen, das Natur-Phänomen der Obertonreihe; das bedeutet<br />
aber nichts anderes, als dass diese Zeiträume physisch-irdisch nicht mehr zu fassen<br />
sind, wenngleich sie sich durchaus logisch den sichtbaren Zeugnissen voranstellen.<br />
Doch nicht nur für die Vergangenheit ist die Obertonreihe diesbezüglich ein Spiegel.<br />
Auch für die Zukunft können wir aus ihr eine Richtungsweise entnehmen. Der 5. Oktavraum<br />
würde uns ja das Hineinhören in das Prim-Intervall bringen, also ein Hineinhören<br />
in den Ton selbst. RUDOLF STEINER hat von dieser Zukunft ganz konkret gesprochen,<br />
in der einmal die Melodie im Ton vernommen werden wird.<br />
Allein nicht nur für den Musiker, auch für den Mathematiker mag unser Schema von<br />
Interesse sein. Denn es zeigt uns eine durchaus nicht selbstverständliche Tatsache:<br />
das Zusammenfallen von Ordinal- und Kardinalzahlen. Mit reinen Ordnungszahlen<br />
kann man bekanntlich nicht rechnen. Und zu Beginn haben wir ja nichts anderes<br />
getan, als die Reihe der Obertöne einfach durchnumeriert. Nun wäre es absurd, würden<br />
wir mit diesen Zahlen unseres Kalendariums rechnen wollen und den ersten zum<br />
zweiten Tag addieren, um den dritten Tag zu erhalten. Die Ordinalzahlen dienen ja<br />
lediglich dazu, eine Reihenfolge festzuhalten, die aus ganz anderen Umständen heraus<br />
entstanden ist. Denken wir z.B. an die verschiedenen Laufzeiten beim Sport, die<br />
wir in eine bestimmte Reihung bringen. Auch hier wäre es völlig sinnlos, den ersten<br />
Läufer mit dem zweiten zu addieren, um den dritten zu erhalten. (Nach RUDOLF HAASE:<br />
«Die harmonikalen Wurzeln der Musik»)<br />
Merkwürdigerweise sind derartige Operationen aber in unserem Falle möglich. Die<br />
Ordinalzahlen unserer Teiltöne sind rechnerisch durchaus brauchbar, d.h. sie können<br />
gleichzeitig als Kardinalzahlen verwendet werden. Die Proportion 3:5 entspricht tatsächlich<br />
der grossen Sext g’– e’’, 6:8 (= 3:4) bildet effektiv die Quart g’’– c’’’ usw.<br />
Man sollte diese Dinge nicht als selbstverständlich nehmen. Im Grunde ist im Weltenzusammenhang<br />
gar nichts selbstverständlich. Und wir müssten das Staunen über<br />
derartige Zusammenhänge, das uns unser Intellekt weitestgehend verlieren liess, wieder<br />
neu lernen. Die Harmonik bietet dazu eine einzigartige Möglichkeit.<br />
Ein zwar bekanntes, aber wesentlichstes Phänomen der Obertonreihe ist die Tatsache,<br />
dass sich durch den 3. und 5. Teilton im Verein mit dem Grundton der Dur-Dreiklang<br />
manifestiert, und wir diesen Zusammenklang daher als eine Naturgegebenheit<br />
erkennen müssen. Das Dur-Prinzip tritt jedoch noch stärker in Erscheinung, wenn wir<br />
uns alle 16 Teiltöne betrachten, und aus ihnen sowohl die ekmelischen Töne als auch<br />
die Oktavwiederholungen der ersten sechs Töne eliminieren. (Man nennt diesen, die<br />
ersten sechs Teiltöne umfassenden Tonraum, den «Senarius». In der abendländischen<br />
Musik wird nur mit Tönen aus diesem Tonbereich und seinen Multiplen musiziert.)<br />
Diese Operation ergäbe die Teiltöne: 1, 3, 5, 9, 15, 16. Projizieren wir sie in einen<br />
Oktavraum hinein, dann resultiert daraus die Tonfolge: c-d-e-g-h-c’. Das sind die Töne<br />
des Tonika- und Dominant-Dreiklanges. Dadurch sehen wir auch die Funktionsharmonik<br />
unserer Mehrstimmigkeit, soweit sie Dur betrifft, in der Obertonreihe verankert.<br />
Vergleichen wir abschliessend die aus den Teiltönen der Obertonreihe sich ergebenden<br />
Proportionen mit jenen des PYTHAGORAS, die er am Monochord fand gewahren wir<br />
ihre völlige Gleichheit. Nur eine Reziprozität der Brüche ist festzustellen, die sich<br />
jedoch notwendigerweise aus der Tatsache ableitet, dass PYTHAGORAS mit Saiten-<br />
16
längen, wir mit Frequenzen operierten. Die doppelte Frequenz (2/1) entsteht an der um<br />
die Hälfte verkürzten Saite (1/2).<br />
Aber nicht nur PYTHAGORAS kannte diese Proportionen-Lehre. Durch das ganze abendländische<br />
Musikwerden zieht sie sich hindurch, und im mittelalterlichen Orgelbau, ja im<br />
Instrumentenbau überhaupt spielten die Gesetze der Obertonreihe eine tragende<br />
Rolle, obwohl man damals von ihrer in der Stoffeswelt verankerten Realität noch nichts<br />
wusste. Erst 1636 hat sie MERSENNE als Naturphänomen entdeckt, und 1702 erst<br />
wurde durch SAVEUR der gesetzliche Aufbau der Obertonreihe voll erkannt. Ein Beweis,<br />
wie man aus einem «höheren Bewusstsein» heraus von Dingen wissen kann, die vorerst<br />
nicht experimentell nachvollziehbar sind und doch eine Realität bedeuten.<br />
Das Oberton-Phänomen mit seinem tönenden Universum kann uns als Gleichnis eines<br />
demiurgischen Schöpfungsaktes anmuten. Entfaltet sich die Fülle seiner Harmonie<br />
doch aus dem einen Zeugerton, wobei jeder der entstehenden Töne höher ist als sein<br />
Vorgänger. Werden wir dabei nicht an den ägyptischen Gott erinnert, der die Welt<br />
durch ein siebenfaches Lachen erschuf und jedesmal ein Wesen hervorbrachte, das<br />
grösser war als er selbst? Und welch einzigartiger Gleichklang zwischen der Welt des<br />
Geistes und der Welt der Sinne: beim siebenten Lachen, so heisst es in der Überlieferung,<br />
erschrak Toth ganz besonders. Denn dieser siebente Ton erzeugte den Drachen,<br />
d.h. «die Erkenntnis der Grausamkeit der Welt»; das Wissen also um «Gut» und<br />
«Bös». Es entspricht dem ersten ekmelischen Ton der Obertonreihe, der wohl noch in<br />
der Antike, doch nicht mehr im christlichen Abendland Verwendung fand.<br />
So kann die Obertonreihe zum klingenden Symbol für jeglichen Schöpfungsakt werden.<br />
Denn jedes Kunstwerk überragt seinen Schöpfer, geht in seiner Fülle über ihn hinaus,<br />
mag es nun von Götter- oder Menschenhand gestaltet sein.<br />
Die Untertonreihe<br />
Die Verankerung der Dur-Tonalität in der Obertonreihe als Naturphänomen ist nicht<br />
wegzudiskutieren. Leider haben wir kein gleichwertiges Korrelat für eine ebensolche<br />
Verwurzelung des Moll. Zwar könnte man bei einer genügend langen Erweiterung der<br />
Teiltonreihe auch jene Töne finden, die – herausgelöst und künstlich nebeneinandergestellt<br />
– den Moll-Klang ergeben würden. Durch diese Methode liesse sich schliesslich<br />
auch die ganze moderne Zwölftonreihe aus der Obertonreihe ableiten. Der<br />
Schluss aber, dass somit auch sie ein Naturphänomen sei, ist nicht haltbar. Denn<br />
erstens gewinnen wir solcherart die Moll-Tonalität bzw. die Zwölftonreihe nur durch<br />
eine Operation mit der Obertonreihe, nicht durch sie selbst. Denn der Dur-Klang wird<br />
uns dargereicht als unmittelbare Entfaltung ihrer ersten Teiltöne. Zweitens würden sich<br />
bereits die Moll-Klänge nur aus Teiltönen gewinnen lassen, die aus Vielfachen der Indices<br />
7, 11 oder 13 stammen. Sie würden daher nicht dem Senarius angehören. Da wir<br />
diese Teiltöne aber auf Grund der historischen Tatsachen für die abendländische<br />
Musik ausschliessen müssen, können wir sie jetzt nicht zur Grundlage der Moll-Tonalität<br />
heranziehen.<br />
17
Diese Operation ist also nicht anwendbar. Doch eine andere führt uns zum Ziel. Die<br />
Moll-Tonalität würde sich nämlich ebenso «von selbst» ergeben, wenn es eine Teiltonreihe<br />
gäbe, die sich als getreues Spiegelbild der Obertonreihe erweisen würde: als<br />
Untertonreihe. Nun konnte man durch bestimmte Experimente zwar einzelne Untertöne<br />
in der klingenden Materie nachweisen, eine geschlossene Reihe jedoch analog<br />
der Obertonreihe zu entdecken, war bisher nicht möglich. Und es dürfte dies auch<br />
kaum jemals der Fall sein. Wir haben daher zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine<br />
Untertonreihe und damit eine materielle Verankerung der Moll-Tonalität in der Stoffeswelt<br />
nicht gibt.<br />
Doch muss uns dies insofern nicht beschweren, da wir die Obertonreihe in einer<br />
durchaus zulässigen Art so «interpolieren» können, dass sie uns das Spiegelbild ihrer<br />
eigenen Reihung ergibt. Auch diese Interpolation liegt ja schon im Lambdoma. Denn<br />
die linke Schenkelreihe, auf der wir die Saitenlänge verdoppelten, verdreifachten usw.<br />
ergibt ja das genaue Spiegelbild der rechten: nämlich Unteroktav, Unterquint usw.<br />
Diese Töne sind aber für unser Tonerlebnis genauso real wie die Obertöne. Und auch<br />
akustisch unterscheidet sich der Ton der doppelten Saitenlänge, ausser durch seine<br />
unterschiedliche Höhe, in nichts von jenem der halbverkürzten. Unser Ausgangston c<br />
1/1 kann ja selbst auch als Oberton auftreten, denn unter ihm liegen ja noch weitere<br />
Töne, von denen er die Oktave, Quinte, Terz usw. als Oberton bilden kann. In diesem<br />
Sinne ist die Untertonreihe, um mit <strong>Hans</strong> Kayser zu sprechen, «eine psycho-physische<br />
Realität; denn sie lässt sich seelisch am Monochord ebenso exakt beurteilen wie die<br />
Obertonreihe». Wir gelangen somit zur Moll-Tonalität mittels einer durchaus erlaubten,<br />
weil erlebbaren Spiegelungs-Operation der Obertonreihe. Die physikalische Nicht-<br />
Existenz der Untertonreihe wird davon nicht berührt.<br />
Ober- und Untertonreihe spiegelbildlich einander gegenübergestellt zeigen uns die<br />
interessante Gegensätzlichkeit von Divergenz und Konvergenz. Die Obertonreihe, mit<br />
ihrer Frequenz-Vervielfachung, strebt ins Grenzenlose, ins unendlich Grosse, und ist<br />
somit divergent. Die Untertonreihe dagegen tendiert zu einer Grenze, obwohl auch sie<br />
eine unendliche Reihe ist, da sie den Grenzwert nie erreichen kann.<br />
0/0<br />
1 /1c<br />
1 / ∞ ... 1 /4c,, 1 /3f,, 1 /2c,<br />
UNTERTONREIHE<br />
nach Frequenzen<br />
2 /1c’ 3 /1g’ 4 /1c’’ ... ∞ /1<br />
OBERTONREIHE<br />
nach Frequenzen<br />
Deutlich ist die verdichtende, verengende Tendenz der oberen Reihe zu erkennen, wie<br />
ja auch der Moll-Klang etwas In-sich-Zusammenziehendes, deshalb für unser Ohr oft<br />
Schmerzvolles, erleben lässt, während die untere Seite als Dur-Reihe in die Ausweitung,<br />
Allumfassung strebt. Philosophisch hat PLATO dieses tönende Phänomen bereits<br />
in seiner «Diairesis» (Teilung der Idee) gefasst. Ihr liegt die Frage des Verhaltens des<br />
Einen zum Vielen zugrunde, die Frage nach dem Verhältnis der einzelnen Idee zu ihren<br />
sinnhaften Abbildern. Es geht also letztlich um die Frage: wie verhält sich die Sinneswelt<br />
zur Seinswelt. Plato versucht sie durch die Methode der Teilung (Diairesis) zu<br />
beantworten. HANS KAYSER führt dazu aus:<br />
18
«Eine übergeordnete Idee wird in zwei oder mehr Ideen geteilt, die einander ausschliessen<br />
und keiner weiteren Möglichkeit Raum geben. Nach demselben Grundsatz<br />
werden nun diese Ideen unterteilt, und dieser Prozess wird solange fortgesetzt, bis<br />
man bei Ideen angekommen ist, die keine Teilung mehr zulassen und ihre unmittelbaren<br />
Abbilder in der Sinneswelt haben. So wird etwa die Idee des Lebewesens fort<br />
und fort gespalten, bis in einem der sich immer zahlreicher verzweigenden Stränge die<br />
Ideen von Mann und Frau erreicht sind, die im bunten Variantenspiel der Erscheinungen<br />
dieser Welt widergespiegelt sind. Auf der untersten Stufe der Ideenwelt trifft also<br />
die Verstandeserkenntnis mit der Sinneswahrnehmung zusammen; es ist eine Korrelation<br />
der beiden Welten gefunden, die für den menschlichen Geist kontrollierbar ist.<br />
Wenn nun die Diairesis nach allen Richtungen und durch alle Stränge lückenlos durchgeführt<br />
ist, so ist der Bestand an Ideen vollständig aufgenommen und das Wesen<br />
einer jeden an dem ihr zukommenden Platze genau bestimmt.»<br />
Wer würde bei dieser Darstellung nicht an das berühmte Gespräch zwischen Goethe<br />
und Schiller über die Urpflanze denken?<br />
Plato hat diese Philosophie der Diairesis schematisch festgehalten:<br />
HANS KAYSER führt diese platonische Diairesis für die Tonwelt lückenlos durch und zeigt<br />
damit eindringlich auf, wie dieses ganze Weltgebäude in Wahrheit durchtönt ist.<br />
Folgen wir seiner Operation Schritt für Schritt. Zunächst gibt er dem Lambdoma die<br />
unserer Methodik angemessenere Form des Koordinatensystems. Was im Lambdoma<br />
ein 60-Grad-Winkel war, wird jetzt zu einem rechten und nimmt damit die Form der<br />
Diairesis PLATOS an:<br />
1 /1<br />
1 /2<br />
1 /3<br />
1 /4<br />
usw.<br />
2 /1<br />
3 /1<br />
c, 1/2<br />
4 /1 usw.<br />
Die Vervollständigung der Teilungsmöglichkeiten erzielt er durch Ausfüllung der von<br />
der waagrechten und senkrechten Schenkelreihe umgrenzten Fläche. Die Rechtfer-<br />
19<br />
1/1 c<br />
Das<br />
Eine<br />
2/1 c’<br />
2/2 c<br />
f,, 1/3 3/1 g’<br />
Das Begrenzende Das Viele Das Unbegrenzte<br />
∞ / ∞<br />
1/ ∞ ∞ / 1
tigung dafür ergibt sich aus der von uns bereits eingangs erwähnten Tatsache, dass<br />
jeder beliebige Ton zur Bildung der Obertonreihe, und damit auch zur Spiegelung in<br />
der Untertonreihe, verwendet werden kann, da ja jedem Ton eine Obertonreihe eigen<br />
ist. Und sie erfliesst weiter aus der vorhin getroffenen Feststellung, dass jeder Ton der<br />
Obertonreihe gleichzeitig auch Teilton einer Untertonreihe sein kann. Aus diesem<br />
Grunde können wir auch von jedem Teilton unserer Koordinatenlinien eine Ober- bzw.<br />
Untertonreihe bilden. Denn was für den real erklingenden Ton 1/1 c gilt, gilt auch für<br />
den Ton 1/2 c – wenn wir ihn als den real erklingenden Ausgangston wählen würden.<br />
Und es gilt ebenso für 1/3 g, für 1/4 c, usw. Das heisst, wir können von jedem Ton der<br />
von 1/1 c ausgehenden senkrechten Untertonreihe eine waagrecht verlaufende Obertonreihe<br />
bilden, analog unserer ersten, von 1/1 c horizontal ausgehenden Teilton-<br />
Koordinatenlinie. Diese Obertonreihen bilden aber gleichzeitig zu den Teiltönen dieser<br />
horizontalen Koordinatenlinie, wenn wir sie vertikal lesen, Untertonreihen. Das nimmt<br />
sich schematisch wie folgt aus:<br />
Untertonreihe<br />
Obertonreihe<br />
1/1 c 2/1 c’ 3/1 g’ 4/1 c’’ 5/1 e’’ 6/1 g’’<br />
1/2 c, 2/2 c 3/2 g 4/2 c’ 5/2 e’ 6/2 g’<br />
1/3 f,, 2/3 f, 3/3 c 4/3 f 5/3 a 6/3 c’<br />
1/4 c,, 2/4 c, 3/4 g 4/4 c 5/4 e 6/4 g<br />
1/5 as,,, 2/5 as,, 3/5 es, 4/5 as, 5/5 c 6/5 es<br />
1/6 f,,, 2/6 f,, 3/6 c, 4/6 f, 5/6 a, 6/6 c<br />
nach Frequenzen<br />
Es treten also horizontal gelesen lauter Obertonreihen, vertikal gelesen lauter Untertonreihen<br />
auf. Das ganze Feld wird dabei durch eine Diagonale in zwei Hälften geteilt.<br />
Der Zahlenwert dieser Diagonale ist immer 1, wie jener unseres Ausgangstones.<br />
Kayser nennt diese Diagonale daher die «Zeugertonlinie». Unschwer ist ihre Identität<br />
mit der Teilungslinie der platonischen Diairesis zu erkennen, die der Philosoph als «das<br />
Viele» bezeichnet.<br />
Quantitativ sind alle Quotienten rechts oberhalb der Zeugertonlinie grösser als 1, links<br />
unterhalb kleiner als 1. Dadurch, dass wir es im Diagramm mit einer Durchdringung<br />
von Ober- und Untertonreihen zu tun haben, ergibt sich eine eigenartige Verkettung<br />
von Dur- und Moll-Dreiklängen. Dies festzuhalten ist deshalb wichtig, weil Dur und Moll<br />
zwei völlig verschiedene Welten sind. Wir sprachen schon von der verengenden,<br />
verdichtenden Tendenz der Untertonreihe. Auf Moll bezogen, dürfen wir sagen, seine<br />
Wirkenskraft ist eine einstrahlende, zentripetale. Geisteswissenschaftlich gesehen ist<br />
dies eine ätherische Wirkenskraft. Sie kommt vom «Umkreis», von der Peripherie, und<br />
strahlt in die Verdichtung, zum Mittelpunkt, wie ihre «Konvergenz» erkennen lässt.<br />
Jetzt kann uns auch bewusst werden, warum wir die Untertonreihe in der sinnlichen<br />
Natur nicht finden können. Sie gehört dem «Gegenraum» an, der eben nicht sinnlich<br />
ist, aber als ätherische Wirksamkeit doch real dem Dingraum gegenübersteht.<br />
20
Das Dur dagegen, in der Obertonreihe manifestiert, hat ausstrahlende Tendenz. Es<br />
wirkt vom «Mittelpunkt», von der Materie hin zur Peripherie, in den kosmischen<br />
Umkreis zurück. Daher kann auch die Obertonreihe und ihre Dur-Tonalität ein Naturphänomen<br />
sein.<br />
Im Kern ihres Wesens zeigen uns diese beiden Kräfte jene Wirksamkeiten, die wir als<br />
Inkarnations- und Exkarnationsdynamik bezeichnen. So «durchtönt» das Dur und Moll<br />
alle Ebenen unseres Lebens:<br />
Mathematisch:<br />
konvergent – divergent<br />
Logisch:<br />
Kontraktion – Expansion<br />
Physiologisch:<br />
Einatmen – Ausatmen<br />
Physikalisch:<br />
Zentripetal – Zentrifugal<br />
Philosophisch:<br />
Mikrokosmos – Makrokosmos<br />
Musikalisch:<br />
Moll – Dur<br />
Pythagoreisch:<br />
Begrenzend – Unbegrenzt<br />
Geisteswissenschaftlich:<br />
Inkarnation – Exkarnation<br />
Wenn der Mathematiker uns daher einwenden wird, dass die sich am Diagramm<br />
ergebenden Phänomene selbstverständliche Resultate seiner Anlage sind, so gilt dies<br />
nur im Hinblick auf die reinen Zahlenwerte. Aber wir haben es hier nicht mit einem<br />
abstrakten Zahlenschema zu tun. Es ist ein bedeutsames Moment der KAYSERschen<br />
Harmonik, dass sie den Bezug zwischen Zahl und Ton so eindringlich aufzeigt. Denn<br />
jeder Zahlenwert, jede Proportion unseres Diagramms klingt, ist Ton, Intervall und<br />
damit: seelisches Erlebnis. Diese Brücke zwischen akustischer Apperzeption und<br />
seelischer Empfindungswelt, zwischen messbarer Quantität und psychischer Qualität<br />
ist etwas Einzigartiges der Harmonik.<br />
In diesem Zusammenhang können wir gleich auf ein weiteres «Metaphysikum» hinweisen,<br />
das uns durch diese «Brücke» bewusst werden kann. Wir hören die Oktav-Zwischenräume<br />
immer als gleiche Grösse, ob wir die Oktav c–c’, oder c’–c’’, oder c’’–c’’’<br />
nehmen. Auch am Tasteninstrument sind die Zwischenräume immer die gleichen. Auf<br />
unserem Diagramm ist dies jedoch keineswegs der Fall. Die Oktavräume der Obertonreihe<br />
weiten sich vielmehr: 1-2-4-8-16-32-64… usw. Wir hören in gleichen Abständen,<br />
was in ungleichförmigen, den Gesetzen einer geometrischen Reihe folgenden Distanzen<br />
erzeugt wird. Das Ohr verhält sich also reziprok zu unserem Auge. Denn wir<br />
schauen Dinge, die in der Natur äquidistant sind, perspektivisch, d.h. in einer nach Art<br />
der geometrischen Reihe eintretenden Verkürzung.<br />
21
Das qualitative Moment unserer beiden Diagramm-Hälften darf keinesfalls übersehen<br />
werden. Die Tatsache, dass es die Zeugertonlinie ist, die diese beiden Hälften scheidet,<br />
ist mehr als Symbol. Das «hart» empfundene Dur (durus = hart) wird häufig als<br />
«männlich» charakterisiert, während das weiche Moll (mollis = weich) sehr oft mit der<br />
weiblichen Empfindungswelt in Beziehung gesetzt wird. Wir haben also in unserem<br />
Diagramm eine männliche und eine weibliche Hälfte, die durch die Zeugertonlinie verbunden<br />
werden. Es lohnt, diesem Phänomen nachzuspüren. Wir müssen uns nur die<br />
innere Beweglichkeit bewahren, die Dinge einmal von der Sicht der Saitenlängen, zum<br />
anderenmal von jener der Frequenzen her zu betrachten.<br />
Würden wir nämlich die Saitenlängen als Ausgangspunkt nehmen, würde sich unsere<br />
Wertung des Diagramms umkehren: die Horizontale ergäbe die Unterton-Mollsphäre,<br />
die Vertikale den Dur-Oberton-Bereich. In den Saitenlängen kommt mehr das räumliche<br />
Element zur Sprache. Wie stellt sich das männliche Prinzip in den Raum? Als das<br />
konzentrierende, individualisierende Prinzip. Im Diagramm auf Saitenlängen aufgebaut,<br />
würde das die Aliquotenreihe 1/1, 1/2, 1/3, … 1/∞ = 0 ergeben, also Moll-<br />
Dynamik. Konzentration ins Kleine, Spezielle: Ausschliesslichkeit! Während die «Molldurchpulste»<br />
weibliche Reihe 1/1, 2/1, 3/1, … ∞/1 nach dem Unbegrenzten sich<br />
ausweitet, wie es der «universellen», sich weitenden Seelenhaltung des weiblichen<br />
Prinzips entspricht.<br />
Gehen wir jedoch zum zeitlichen Element, zur Dynamik, müssen wir unser Schema auf<br />
Frequenzen aufbauen, wie dies vorhin geschah. Und da wird uns das männliche Prinzip<br />
zu jener unermüdlich nach Transzendenz schweifenden Bewusstseinshaltung,<br />
während sich das weibliche als das Bewährende, die gewordenen Güter Behütende<br />
offenbart.<br />
Dadurch kann uns bewusst werden, wie die Entstehung eines Lebewesens eigentlich<br />
nur aus einer Androgynität heraus, einem Männlich-Weiblich-Sein zu erklären ist. Aus<br />
der «Monas» 1/1, dem gemeinsamen Zeugerton, der das Dur/Moll noch in sich trägt.<br />
Jede Individualität, wie sie uns als Erdenpersönlichkeit entgegentritt, ist gefügt aus<br />
zwei Welten, die einst aus einer einheitlichen Welt, dem Zeugerton 1/1, hervorgingen.<br />
Aber wir fragen weiter: Haben wir mit diesem Zeugerton auch den Urgrund seines<br />
Wesens erfasst? Mit dieser Frage eröffnet sich uns ein weiteres Phänomen unseres<br />
Diagramms, das uns tief in transzendentale Bereiche führt. Wenn wir nämlich daran<br />
gehen, alle auf dem Diagramm identischen Töne zu verbinden, so machen wir eine<br />
überraschende Entdeckung. Gemeint sind Töne, die in Höhenstufen und Charakter<br />
völlig gleich sind; also nicht nur gleiche Wertigkeit zeigen, sondern auch keine<br />
Oktavreduzierungen (Oktavierung in die Tiefe) oder Potenzierungen (Oktavierung in<br />
die Höhe) aufweisen. Verbindet man diese gleichen Töne, so liegen sie alle auf einer<br />
Geraden. KAYSER nennt diese Geraden die «Gleichtonlinien». Das allein wäre vielleicht<br />
noch nicht so überraschend, obwohl es keineswegs als so selbstverständlich angesehen<br />
werden darf. Überraschend aber ist, dass sich alle Gleichtonlinien, gegen<br />
alle Erwartung, nicht im Zeugerton 1/1 c treffen, sondern – dahinter: Also im Zahlenwert:<br />
0/0.<br />
22
x = ekmelischer Ton aus dem Index 7; v = Erniedrigungsakzent. Der Ton ist enharmonisch, mit niedrigerer Frequenz<br />
gegenüber den anderen, gleichnamigen Teiltönen gestimmt.<br />
Parabel von Tonwert 5/5c: Obertonreihe 5/5 c, 8/4 c’, 9/3 g’, 8/2 c’’. Die Äste münden in die Werte 0/0 und 0/6.<br />
Tonleiterkreis: Mittelpunkt 5/5 c<br />
Umkreis: 6/3 c’’’ – 7/4 b – 7/6 es – 6/7 a, – 4/7 d, – 3/6 c, – 3/4 g, – 4/3 f<br />
In die Oktav projiziert: b – c – d – es – f – g – a – b<br />
Zeichenerklärung: Z = Zeugertonlinie G = Gleichtonlinie<br />
In der harmonikalen Symbolik ist das der letzte Bezugspunkt aller Seinswerte. Das<br />
«Nichts» – das in Wahrheit das «All» bedeutet, da es das «Unoffenbare» darstellt, aus<br />
dem der androgyne Wesensgrund des Zeugertones selbst «emanierte». Der Symbolwert<br />
0/0 ist der Zustand «im Busen Gottes vor der Schöpfung» (GOETHE); der Zustand<br />
ehe Gott sprach. Der Zeugerton indessen ist der Augenblick des «Fiat», des: «Es<br />
werde!»<br />
Wieder könnten wir in zahllose Mythen und Religionen der Völker blicken, um diesen<br />
Ur-Beginn des Schöpfungsaktes, das «Sich-Aussprechen» der Gottheit in den verschiedensten<br />
Gestaltungen charakterisiert zu finden. In unserem Diagramm fassen wir<br />
durch «Mass» und «Zahl» und erleben als «Klang», was im Bewusstsein der Völker<br />
einst als Brahma, Nirwana, Moira – bzw. im Sinne des Zeugertones als Tao, als Atman<br />
und als Demiurg lebendig war.<br />
23
Und tiefe Metaphorik liegt darin, dass jeder einzelne Ton unseres Diagramms von<br />
seiner Gleichtonlinie getragen und gehalten wird und alle diese Linien, gleich Sonnenstrahlen<br />
von dem tiefsten und letzten Gottesgrund ausgehend, die Vielfalt der Erscheinungen<br />
durchtönen.<br />
HANS KAYSER, den der Lichtklang der «Gleichtonlinie» tief bewegte, weist auf FRIEDRICH<br />
RÜCKERT, der in seiner «Weisheit des Brahmanen» diesem Erlebnis dichterischen Ausdruck<br />
verliehen hat:<br />
«Wie von der Sonne gehn viel Strahlen erdenwärts,<br />
So geht von Gott ein Strahl in jedes Dinges Herz,<br />
An diesem Strahle hängt das Ding mit Gott zusammen,<br />
Und jedes fühlet sich dadurch von Gott enstanden.<br />
Von Ding zu Dinge geht seitwärts kein solcher Strahl<br />
Nur viel verworrne Streifenlichter allzumal.<br />
An diesen Lichtern kannst du nie das Ding erkennen:<br />
Die dunkle Scheidewand wird stets von ihm dich trennen.<br />
An deinem Strahl musst du vielmehr zu Gott aufsteigen,<br />
Und in das Ding hinab an seinem Strahl dich neigen,<br />
Dann siehest du das Ding wie’s ist, nicht wie es scheint,<br />
Wenn du es siehest mit dir selbst in Gott vereint.»<br />
(Vom Totenhügel, Spruch 166, S. 518. Wallstein Verlag, Schweinfurt, 1999.)<br />
Doch nicht nur der philosophisch-mythologischen Betrachtung bietet das Teiltondiagramm<br />
greifbare, bestätigende Hinweise. Auch dem Musiker erschliesst es wertvolle<br />
Erkenntnisse.<br />
Greift man z.B. auf der Zeugertonlinie einen c-Wert heraus, etwa 4/4 c oder 5/5 c –<br />
jeder Wert ist möglich –, und untersucht, wie sich von diesem gewählten c-Wert die<br />
Ober- bzw. Untertonreihe aufbaut, erhält man eine Kurve, von der bereits ALBERT VON<br />
THIMUS nachwies, dass sie den Gesetzen einer Parabel gehorcht. Ober- und Untertonreihen<br />
im Diagramm stellen sich also als Parabeln dar, deren einer Ast stets in den<br />
metaphysischen Ursprung 0/0 mündet, während der zweite in den Nullwert der um<br />
eine Stufe höheren Index-Zahl sich verliert. Haben wir als Ausgangspunkt den c-Wert<br />
5/5 gewählt, so weist dieser zweite Ast in den 0-Wert des Index 6. Da es nun kein<br />
Zufall sein kann, dass sich eine derartige Kurve durch die Obertonreihe gestaltet, müssen<br />
wir das Wesen der Parabel mit in die Betrachtung einbeziehen. Die Physik kennt<br />
sie als jene Kurve, mittels der sich vorwiegend dynamische Gesetze manifestieren.<br />
Jede Wurfbahn ist eine Parabel. Auch den Begriff der Beschleunigung drückt man in<br />
Parabeln aus. Demnach müsste die Harmonie selbst ein dynamisches Element in sich<br />
tragen. Das mag überraschen. Denn mit dem Akkord verbinden wir gewöhnlich die<br />
Vorstellung eines statischen Momentes, eines Elementes der Schwere.<br />
Auch das einstimmige Melos ist stets von Harmonie durchdrungen. Hier wird restlos<br />
deutlich, dass wir den Harmonie-Begriff als solchen von der Akkordlehre zu unterscheiden<br />
haben; dass letztere tatsächlich nur einen speziellen Fall des harmonischen<br />
Elementes darstellt. Die Harmonie, wie wir sie hier verstehen, ist ein Übergeordnetes,<br />
ein Geistig-Tönendes, das jedes Melos durchdringt. Man stelle sich die Anfangs-<br />
24
themen der 9. Symphonie BEETHOVENS und BRUCKNERS gegenüber, vergleiche sie etwa<br />
mit SCHUBERTS «Der Tod und das Mädchen» und dem Beginn von MOZARTS «Don<br />
Giovanni»-Ouvertüre. Wie völlig verschieden ist bei all diesen Werken die melodische<br />
Linie des Themas. Aber gemeinsam ist ihnen allen die d-Moll-Harmonie, und damit der<br />
Grundcharakter des seelischen Ausdrucks. Denn alle diese Themen sind aus der d-<br />
Moll-Sphäre heraus gestaltet. Das geistig-tönende d-Moll hat sich in ihrer Melodik realisiert<br />
und individualisiert. Der Helfer zu diesem Inkarnationsprozess war der Genius<br />
des Meisters, der das Tönen dieser Harmonie zu erlauschen vermochte und der melodischen<br />
Linie die geistesgemässe Gestaltung gab. Die Harmonie, die das Melos<br />
durchtönt, ist ein Sphärisch-Qualitatives, eine Ganzheit geistig-tönender Intensitäten.<br />
Der Akkord ist ein materielles Abbild dieser sich durchdringenden Kräfte, der in der<br />
Gleichzeitigkeit seines Zusammenklanges die «Dauer» widerspiegelt, in der die Harmonie<br />
urständet, ohne jedoch die Dynamik des von seinen Tönen getragenen Melos-<br />
Stromes zu verlieren. ERNST KURTH hat dies in seiner «Musikpsychologie» erspürt,<br />
wenn er von der «Spannungs-Energie» des Akkordes spricht, die eine potentielle Kraft<br />
bedeutet, und die Dynamik des Melos als fliessende, kinetische Energie bezeichnet:<br />
«Jeder Akkord ist eine neue Verteilung von Kräften. Denn das ist psychologisch das<br />
Wesentliche, dass sich ein Spannungszustand aus einem Einzelton über den Klang<br />
ausgiesst, dem er angehört.»<br />
Diese Klangspannung aber ist nicht berechenbar, meint Kurth, wir stossen damit an<br />
das «unnahbare Ganze». Und dieses «unnahbare Ganze» ist ja eben die hinter jedem<br />
Melos wesende Harmonie, die das «Widerstrebende zusammenführt» und aus dem<br />
«Auseinander-Gehenden die schönste Fügung» erstehen lässt. Dieser Widerstreit im<br />
Einklang, dieser Zusammenklang in der Vielheit spiegelt sich auch im Akkord. Daraus<br />
resultiert jedes «potentielle Spannungselement», das Dynamik und nicht Statik bedeutet.<br />
«Von dieser Seite betrachtet erscheinen Akkorde als aufgespeicherte und im<br />
Zusammenwirken verwandelte Energien.» (E. KURTH, a.a.O.) Nur als Klang-Masse<br />
erlebt, bedeuten sie Schwere, Statik und werden zum Grab jedes Melos.<br />
Die für den Musiker jedoch interessante Gesetzmässigkeit unseres Diagramms zeigt<br />
sich, wenn wir die Frage nach der Tonleiter und ihrer Gestaltungsform stellen. Zwei<br />
Phänomene sind es vor allem, die eine Tonfolge zu einer echten Ton-Leiter machen:<br />
Erstens muss die Tonleiter immer ein geschlossenes Ganzes sein, zweitens muss<br />
diese Geschlossenheit durch eine Stufenfolge, d.h. zumindest durch Ganztonschritte<br />
(grosse Sekunden) zum Ausdruck kommen. Halbton-Schritte (kleine Sekunden) sind<br />
nicht unbedingt erforderlich, denn auch die sechsstufige Ganztonfolge ist bereits eine<br />
echte Leiter. Nicht aber gilt dies z.B. für die pentatonische Tonfolge, da hier ein Terzenschritt<br />
die Sekundfolge unterbricht und damit die Geschlossenheit stört. Der Ganztonschritt<br />
ist, wie KAYSER formuliert, das «Elementarquantum» jeder Leiter und damit<br />
des Melos.<br />
Beide Kriterien finden wir in unserem Diagramm exakt in Erscheinung treten. Wir können<br />
ihm nämlich nicht nur Parabeln, sondern auch Kreise einzeichnen. Der Kreis ist –<br />
geometrisch – die geschlossenste, vollkommenste Linie; die schönste «Ganzheit».<br />
Wenn wir von der Zeugertonlinie aus Kreise ziehen, so dass der Mittelpunkt entweder<br />
25
auf einen Tonwert der Zeugertonlinie fällt, oder zwischen zwei benachbarten Tonwerten<br />
auf ihr zu liegen kommt, so sehen wir, dass die Peripherie dieser Kreise Tonwerte<br />
berührt, die in ihrer Gesamtheit eine Tonleiter ergeben. Die Tonleitern gestalten<br />
sich in unserem Diagramm zu Kreisen, ein Phänomen, das selbst den Mathematiker<br />
in Erstaunen versetzt; denn hier hören die Dinge auf, «selbstverständlich» zu sein.<br />
Diese Gesetzlichkeit entzieht sich der «Anlage» des Diagramms.<br />
Die Wirksamkeit harmonikal-kosmischer Gesetzmässigkeiten<br />
Soweit das erste Phänomen: Geschlossenheit der Tonleiter – als geometrisches<br />
Analogon: der Kreis im Diagramm. Das zweite manifestiert sich in der Tatsache, dass<br />
die überwiegende Anzahl der sich durch die Kreisperipherien bildenden Leitern mit<br />
ihrem Grundton um einen Ganzton tiefer liegt als der Zeugerton des Diagramms. Da<br />
wir in unserem Fall c als Zeugerton wählten, ergibt sich B-Dur als Tonalität bei der<br />
überwiegenden Anzahl der möglichen Kreise. Ein kleinerer Teil von ihnen stellt sich<br />
als Erweiterung von B-Dur dar, indem sie wichtige Zwischenglieder wie Leittöne,<br />
Dominante und Subdominante realisieren. In geringer Zahl treten auch einige Mollskalen<br />
auf.<br />
Damit scheint für KAYSER auch die naturgemässe Verankerung des Ganztones bewiesen.<br />
«Nicht die Zeiten und Völker haben künstliche Tonleitern konstruiert», begegnet<br />
er diesbezüglichen Behauptungen gewisser Musikhistoriker, «sondern sie haben<br />
sich – bewusst oder unbewusst – aus der naturgegebenen harmonikalen Tonentwicklung<br />
diejenigen Skalen ausgesucht, welche der Natur des Tongesetzes am meisten<br />
entsprachen.»<br />
Wir werden richtig vermuten, wenn wir diese «bewusste oder unbewusste» Immanenz<br />
der Tonleiter im Ton, nach der, in organischer Entfaltung, allmählich die verschiedenen<br />
Tonfolgen erwuchsen, mit zu den Weistümern alten Mysteriengutes zählen. Von den<br />
Mysterienstätten strahlten die Impulse zu jenen Melodie-Bildungen aus, die den<br />
harmonikalen-kosmischen Gesetzmässigkeiten entsprachen.<br />
In der Frage nach einer dem klingenden «Material» selbst innewohnenden geist- und<br />
naturgemässen Ordnung hat die KAYSERsche These in neuester Zeit, völlig unabhängig<br />
von ihr, durch die Konsonanztheorie HEINRICH HUSMANNS eine kaum zu widerlegende<br />
Bestätigung erfahren. HUSMANNS gewissenhaftest durchgeführten Untersuchungen<br />
des menschlichen Gehörgangs haben ihn ein sinnreiches Zusammenwirken von Oberund<br />
Kombinationstönen im menschlichen Ohr erkennen lassen. Unter Kombinationston<br />
verstehen wir jenen Ton, der durch das gleichzeitige Erklingen zweier Töne entsteht,<br />
deren Frequenzen nicht zu nahe beisammenliegen. Seine Schwingungszahl ist<br />
entweder gleich der Differenz der Schwingungszahlen der beiden erzeugenden Töne,<br />
dann sprechen wir von «Differenzton», oder ihrer Summe: «Summationston». Beide in<br />
einem Begriff zusammengefasst nennt man Kombinationston.<br />
Dieses Zusammenwirken von Ober- und Kombinationstönen und die daraus resultierenden<br />
Konsonanz- und Dissonanzerscheinungen im Gehörgang führten HUSMANN zu<br />
der Erkenntnis, dass das Ohr zusätzlich für sich selbst subjektive Obertöne ausbilden<br />
26
müsse und dass sich diese nach der gleichen Gesetzmässigkeit entfalten würden wie<br />
die objektiven der Obertonreihe.<br />
Die HUSMANNsche Konsonanztheorie blieb, wie vorauszusehen war, nicht unangefochten;<br />
doch konnte sie bis jetzt nicht widerlegt werden. Mit ihrer Richtigkeit aber stehen<br />
wir vor der Tatsache, dass die Gesetze der Obertonreihe nicht nur in der Natur, in der<br />
Stofflichkeit der Materie, sondern auch im Menschen selbst verankert sind. Und dass<br />
die Heranbildung unserer Dur/Moll-Tonalität in keiner Weise Spekulation oder Willkür<br />
war, sondern im strengsten Sinne den menschlichen Gehör-Voraussetzungen entsprach.<br />
Halten wir diese Argumente aber aufrecht, ergeben sich daraus weittragende<br />
Konsequenzen für die Beurteilung unserer heutigen abstrakt-temperierten Atonalität.<br />
Für den Harmoniker muss diese atonale Zwölftonstruktur etwas der Naturordnung wie<br />
den physiologischen Hörvoraussetzungen Widersprechendes sein. Sein Urteil über die<br />
Atonalität steht daher a priori fest. In seiner Schrift «Die harmonikalen Wurzeln der<br />
Musik» spricht es RUDOLF HAASE auch in ganzer Schärfe aus:<br />
«Bei solcher Sachlage ist es daher nicht zu erhoffen, dass sich der hörende Mensch<br />
an eine intellektuelle und seriell total durchorganisierte Musik gewöhnen werde, wie es<br />
sich die Avantgardisten immer wieder wünschen. Man kann sich freilich auch an Strassenlärm<br />
gewöhnen, doch ist im Ernst von einer derartigen Gewöhnung ja wohl nicht<br />
die Rede. Gemeint sein kann nur eine Gewöhnung im Sinne eines allmählichen Verstehenlernens<br />
der Vorgänge – und gerade die ist wegen der prinzipiellen Unzugänglichkeit<br />
durch die Gehörsapperzeption unmöglich.»<br />
Der Ton im Anorganischen<br />
Im Bereich des Anorganischen ist die «Durchtönung der Welt» relativ leicht zu erkennen.<br />
Die Analogien liegen greifbar zur Hand. Die Parallelität der Proportionen zwischen<br />
den Atomgewichten der Elemente und den Tonwerten ist vielleicht eine der unmittelbarsten<br />
Entsprechungen. Kayser hat den interessanten Versuch gemacht, die Atomgewichte<br />
jeweils den analogen Teiltonwerten zuzuordnen. Das leichteste Element –<br />
Wasserstoff –, mit dem Atomgewicht 1.008, setzte er dem Zeugerton 1/1 gleich, und<br />
füllte mit ihm die ganze Zeugertonlinie aus. Dadurch wird die Zeugertonlinie zu einer<br />
H-Achse, da auf den Werten 2/2, 3/3, 4/4 usw. immer das Element H zu liegen<br />
kommt. Helium, mit dem Wert 4 setzte er auf die Tonwerte 4/1, 8/2, 12/3, 16/4 usw.<br />
Dann Lithium (Li), mit dem Atomgewicht 6.94 (= 7) an die entsprechenden Koordinaten-Orte<br />
7/1, 14/2, 21/3 … Auf diese Weise vervollständigte er die Tabelle bis zum<br />
schwersten Element Uran, mit der Atomgewichtszahl 92, was einen Umfang des<br />
Diagramms von 60 mal 220 cm ergab.<br />
Was für eine Erkenntnis konnte er nun aus der fertigen Aufstellung gewinnen? Das<br />
Diagramm ergab eine deutliche Zusammenballung der Gewichte unter den harmonikalen<br />
Zahlen 1–7, während sie unter den übrigen ekmelischen Rationen, die ausserhalb<br />
des Senarius und Septenarius liegen, sehr dünn gesät waren, ja oft überhaupt<br />
fehlten. Ein Beweis, dass auch im Bereich der anorgnischen Natur dieser Zahlenraum<br />
eine entscheidende Rolle spielt. Und die Frage nach dem Warum kann befriedigend<br />
eigentlich nur durch die Harmonik beantwortet werden: weil diese Zahlengesetze eben<br />
27
gleichzeitig Tonwert-Proportionen sind, und nach diesen tönenden Gesetzen einst der<br />
«Tanz der Stoffe» vor sich ging.<br />
Die Einbeziehung des Septenarius muss uns dabei weder als Ausnahme noch Unstimmigkeit<br />
dieses Gesetzes erscheinen. Wir wiesen bereits darauf hin, dass mit den<br />
Tönen der Siebener-Rationen noch das alte Griechenland musiziert hat. Und heute<br />
sind neuerdings Bestrebungen im Gange, impulsiert vor allem durch MARTIN VOGEL, die<br />
Werte des 7. Teiltones der Obertonreihe wieder in unser Tonsystem einzubeziehen.<br />
Von der Gehör-Disposition her gesehen liegt jedenfalls keine Ursache vor, die Möglichkeit<br />
an eine echte Gewöhnung dieser Tonfrequenzen in Zweifel zu ziehen.<br />
Suchen wir nach weiteren Entsprechungen zwischen Stoff und Ton, dann bildet die<br />
sogenannte «Isotopie» ein interessantes, «klingendes» Phänomen. Unter Isotopie verstehen<br />
wir die merkwürdige Erscheinung, dass bei verschiedenen Atomgewichtszahlen<br />
die Charakteristik des Elements völlig gleich bleibt. Trotz anderer Gewichtsstruktur<br />
bietet das Element das gleiche Erscheinungsbild. In die Klangwelt übertragen, stellt<br />
sich uns damit die Enharmonik im Bereich der Elemente dar. Auch bezüglich des In-<br />
Erscheinung-Tretens der Isotopie herrscht völliger Gleichklang mit der Enharmonik: je<br />
höher nämlich die Atomgewichte, bzw. Atomzahlen steigen, desto häufiger treten Isotopen<br />
auf; und je höher wir in den Teiltonreihen gehen, desto zahlreicher werden die<br />
enharmonischen Differenzierungen. Wir haben sie bereits kurz für den 5. Oktavraum<br />
der Obertonreihe angedeutet, wo es sich ja um die verschiedenen graduellen Unterschiedlichkeiten<br />
des Prim-Intervalls handelt. Und in dieser Unterschiedlichkeit der<br />
Frequenzen innerhalb ein und desselben Tones, liegt ja das Wesen der eigentlichen<br />
Enharmonik. Unser heutiger Begriff, der zwei verschiedenen Tonqualitäten wegen<br />
ihres geringen Frequenz-Unterschiedes in der Temperierung den gleichen Klangort<br />
zuweist, etwa ein fis dem ges, ein cis dem des gleichsetzt, ist bereits eine sinngemässe<br />
Übertragung des ursprünglichen enharmonischen Klangerlebnisses. Denn die<br />
echte Enharmonik meint gleiche Töne trotz verschiedener Frequenzen. Die Isotopie<br />
meint gleiche Elemente, trotz verschiedener Gewichte.<br />
Unerschöpflich im harmonikalen Gleichklang ist auch das Gebiet der chemischen<br />
Verbindungen. Sauerstoff z.B. verbindet sich mit anderen Elementen meistens im<br />
Verhältnis 1:1, 1:2, 1:3, 3:1, 1:5, 2:3. Viel seltener mit 1:4, 1:7, 7:2, 2:2 usw., eine<br />
höhere Wertigkeit als 7 und 8 tritt überhaupt nicht auf. Nur bei den komplizierteren<br />
organischen Verbindungen ist dies der Fall. KAYSER zieht daraus den Schluss:<br />
Das Daltonsche Gesetz der multiplen Proportionen, «wonach sich die Elemente nach<br />
einfachen Vielfachen ihrer Gewichte vereinigen, liefert die Grundlage der ganzen praktischen<br />
sowie theoretischen Chemie. Für den Harmoniker ein eklatanter Beweis, dass<br />
die Struktur der Dinge harmonikal angeordnet ist. Das aber besagt, dass diese höchst<br />
eigentümliche Neigung der Natur, die ersten Ganzzahlen in einer ausgesprochenen<br />
harmonikalen Proportionierung zu bevorzugen, auf eine intensive Verinnerlichung des<br />
Gestaltungsprozesses der ganzen Natur, inklusive des Menschen verweist». Darin liegt<br />
ein wesentliches Moment der «Musik aus den Dingen». Und die Beobachtung, dass<br />
unser seelisches Erleben – eben das Musikerleben – nach denselben Gesetzen verläuft,<br />
berechtigt uns von einer «Verinnerlichung» zu sprechen.<br />
28
Auch auf die rätselhafte Wirkungsweise von Katalysatoren weiss die Harmonik die<br />
vielleicht befriedigendste Antwort zu geben. Unter Katalysator versteht der Chemiker<br />
einen Körper, der durch sein blosses Vorhandensein die Reaktion anderer Stoffe<br />
beschleunigt, wenn nicht überhaupt erst möglich macht. So entsteht z.B. 40 Prozent<br />
Salpetersäure wie auf einem «Tischlein deck’ dich» hervorgezaubert, wenn man gereinigten<br />
Stickstoff, N2 oder N3 als Gas mit Sauerstoff O2 zusammenbringt und über<br />
einen Katalysator aus Platin leitet. Das Rätselhafte dabei ist, dass der Katalysator sich<br />
chemisch überhaupt nicht an der Reaktion beteiligt und diese doch entscheidet. Die<br />
Harmonik kann darin nur eine Parallele zum Prinzip der Resonanz sehen, das Ähnliches<br />
entstehen lässt: Eine Schwingung verstärkt sich durch das blosse Vorhandensein<br />
von Resonatoren. Geht man von der Tatsache einer harmonikalen Gliederung und<br />
Ordnung der Grundstufe aus, dann darf man der Vermutung KAYSERS beipflichten,<br />
dass sich «zwischen Katalysator und Reaktionsstoffen harmonikale Verhältnisse aufdecken<br />
liessen, welche der nur rechnerischen Betrachtung undurchsichtig bleiben,<br />
weil in der Harmonik nicht nur die Tonzahl, sondern auch der Ton-Wert mit in die<br />
Rechnung eingesetzt wird».<br />
Der «tönende Chemismus» des Lebens<br />
Steigt man vom Anorganischen in den Bereich des Organischen auf, wendet man sich<br />
dem Chemismus des Lebens zu, so treten einem vor allem die drei Urbaustoffe: Wasserstoff,<br />
Kohlenstoff und Sauerstoff entgegen. Diese drei Elemente stehen sowohl in<br />
ihren Atomgewichten, wie Atomzahlen in einem der einfachsten Teiltonverhältnisse:<br />
H C O<br />
Atomgewicht: 1 12 16<br />
Atomnummer: 1 16 18<br />
Teiltöne im Diagramm: c 1g 1c<br />
Wir gewahren ein klares Oktav-Quint-Verhältnis.<br />
Auch im Bereich des Organischen ist das eigentlich treibende, innere morphologische<br />
Moment der Zahlenbereich des Senarius. Besonders die Blätter und Blütenmorphologie<br />
lässt dies am deutlichsten erkennen. Die Teilungsverhältnisse gehen äusserst<br />
selten über den Faktor 5 als primärer Multiplikator hinaus. Meistens bleiben die Blüten<br />
bei einer 3-, 4- oder 5fachen Anordnung stehen. Die Rationenbilder 7, 11, 13, 17<br />
kommen selten vor. KAYSER verweist in diesem Zusammenhang auf die Passionsblume<br />
(Passiflora coerulea), bei welcher ein dreiteiliger Stempel auf einer ausgesprochenen<br />
fünfteiligen Staubgefäss- und Blütenblattanordnung sitzt, um zu zeigen, dass die<br />
Pflanze lieber zwei einfache, dem Senarius angehörende Rationenbildner verwendet,<br />
als einen «ekmelischen».<br />
Übrigens darf hier die Bemerkung eingeflochten werden, dass es kaum eine erhellendere<br />
Sicht, als die harmonikale auf die dreifache Benennung gibt, die RUDOLF STEINER<br />
dieser ätherischen Bildekraft gegeben hat, wenn er von ihr als Klang-, Zahlen- und<br />
29
chemischen Äther spricht. Für die harmonikale «Anhörung der Welt» ist diese Dreiheit<br />
eine notwendig-unzertrennbare Einheit. Bloss vom Namen her verstanden, wäre diese<br />
Notwendigkeit kaum einsehbar.<br />
Worin liegt aber nun die Unterschiedlichkeit der Klangphänomene zur anorganischen<br />
Natur. Die harmonikalen Analogien im Bereich des Anorganischen waren unschwer zu<br />
erkennen. Denn diese Region der Natur fanden wir so konstituiert, dass sie in ihren<br />
Zahlenproportionen die Teilungsverhältnisse widerspiegelte. Um ihr Erscheinungsbild<br />
«tönend» wahrzunehmen, genügte eine einzige Obertonreihe. Sie spiegelt uns alles<br />
ab, was wir an Strukturen im Anorganischen vorfanden. Dasselbe gilt auch noch für<br />
die Zahlenverhältnisse der drei Urbaustoffe des Lebendigen; es gilt ferner für die Vertikal-<br />
und Spiraltendenzen der Blüten- und Blattansätze im Pflanzenreich. Es reicht<br />
jedoch nicht mehr aus, um die Bildkräfte der Blatt- und Blütenformen selbst zum<br />
geistigen Ertönen zu bringen.<br />
Hier nun zeigt uns KAYSER, wie souverän er das Lambdoma zu handhaben weiss, wie<br />
er in völlig eigenständiger Weise abzuwandeln und weiterzubilden vermag. Doch<br />
waltet dabei in keinem seiner Experimente Willkür oder Spekulation, wie die Kritik<br />
vielleicht einwenden könnte. Das Teiltondiagramm bleibt ihm immer das tönende Ur-<br />
Bauprinzip. Doch variiert und kombiniert er seinen Grundplan mit gleicher Phantasiebegabung,<br />
wie die Natur ihre Grundprinzipien in tausendfacher Weise abzuwandeln,<br />
umzugestalten, zu variieren und zu metamorphosieren versteht, ohne dabei den Kern<br />
ihres Ur-Urprinzips preiszugeben. KAYSER geht im Sinne von GOETHES Metamorphosenlehre<br />
zu Werk:<br />
«Wende nun, o Geliebte, den Blick zum bunten Gewimmel,<br />
Das verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste bewegt.<br />
Jede Pflanze verkündet dir nun die ew’gen Gesetze,<br />
Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir.<br />
Aber entzifferst du hier der Göttin heilige Lettern,<br />
Überall siehst du sie dann, auch in verändertem Zug.»<br />
(GOETHE, Die Metamorphose der Pflanzen, C.H. Beck Verlag, München 1975, Hamburger<br />
Ausgabe, Band 13, S. 109.)<br />
Eine Möglichkeit zu solch einem «veränderten Zug» sah KAYSER darin, das Teiltondiagramm<br />
nicht unbedingt in ein quadratisches Koordinatensystem einschreiben zu müssen.<br />
Unter den vielen Gestaltungsmöglichkeiten bot sich ihm auch die Kreisform an,<br />
wie sie sich aus der Rastrierung eines Bogens Polarpapier ergibt. Mit dieser zum Kreis<br />
variierten Obertonreihe verbindet er gleichzeitig eine Kombinationsmöglichkeit, die<br />
sich wie von selbst aus den beiden Kreishälften ergab: vom Zeugerton aus – dem Mittelpunkt<br />
des Kreises – sowohl nach rechts wie nach links eine Obertonreihe erklingen<br />
zu lassen. Verbindet man die Tonwerte beider Reihen, schliessen sie sich zu einer<br />
Ganzheit zusammen, deren Kurvenform die schönsten Blattgestaltungen widerspiegelt.<br />
Was sich im Werk WERNER SCHÜPBACHS als «Pflanzengeometrie» ergibt, wird<br />
hier tönende Gesetzlichkeit. Die diesbezüglichen Abbildungen in den Büchern beider<br />
Autoren gleichen sich oft aufs Haar.<br />
Auf diese Weise ist ein erstes «Hörbild» gewonnen, wobei die Variationsmöglichkeiten<br />
der Teilton-Anordnungen beinahe unerschöpflich sind. Doch wie immer auch die<br />
30
Gestaltung sein mag, das wichtigste Kriterium bei der Pflanzenharmonik liegt in der<br />
Notwendigkeit der Kombination von mindestens zwei Teiltonreihen, soll die Pflanzengestalt<br />
harmonikal zum Erklingen gebracht werden.<br />
«Während die anorganische Natur so konstituiert ist, dass sie, falls ihre Tonpunkte<br />
‘geordnet’ sind, die Neigung zur Dauer hat, charakterisiert sich das Leben als eine<br />
Spannung zwischen zwei oder mehreren Tonsystemen, welche dadurch a priori eine<br />
fortwährende tonale, d.h. seelische Spannung erzeugen.» (H. KAYSER, Der hörende<br />
Mensch)<br />
Das KAYSERsche Hörbild kann ein wertvolles Mittel sein für jene meditative «Pflege der<br />
Welt der Töne», wie sie RUDOLF STEINER als ein Erfordernis auf dem Weg zur «Erkenntnis<br />
höherer Welten» angibt. Natürlich kann es den meditativen Akt nicht ersetzen, ohne<br />
den dieser Weg nie zu dem erstrebten Erkenntnisziel führen kann. Immer bleiben diese<br />
Hörbilder im «Vorhof» stehen, denn sie überschreiten nicht den Horizont unseres, an<br />
Sinne und Gehirn gebundenen Bewusstseins. Aber in diesem Denken kann, gleich<br />
einem Präludium aufklingen, was durch Meditation zu realem Seelenerlebnis wird:<br />
«Die ganze Natur fängt an, dem Menschen durch ihr Ertönen Geheimnisse zuzuraunen.<br />
Was vorher seiner Seele unverständlicher Schall war, wird dadurch sinnvolle<br />
Sprache der Natur. Und wobei er vorher nur Ton gehört hat, beim Erklingen des sogenannten<br />
Leblosen, vernimmt er jetzt eine neue Sprache der Seele. Schreitet er in solcher<br />
Pflege seiner Gefühle vorwärts, dann wird er bald gewahr, dass er hören kann,<br />
wovon er vorher nichts vermutet hat. Er fängt an, mit der Seele zu hören.» (RUDOLF<br />
STEINER, «Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?»)<br />
Wie sehr sich KAYSER in seiner Pflanzenharmonik im Einklang mit GOETHE fühlen<br />
musste, zeigt allein der Titel, den er seinem, ausschliesslich diesem Gebiet gewidmeten<br />
Werke gab: «Harmonia plantarum». Diese Benennung, die GOETHE ursprünglich<br />
seiner «Metamorphose der Pflanze» geben wollte, hat KAYSER ganz bewusst gewählt.<br />
Die harmonikale Stufenordnung tritt uns auch im Pflanzenwachstum entgegen. Ich gebe hier<br />
eine Parallele, die für sich<br />
spricht:<br />
Eine zukünftige harmonikale<br />
Pflanzenmorphologie müsste<br />
natürlich viel weiter in die<br />
Details gehen, das Verhältnis<br />
der logarithmischen zu den<br />
dezimalen Stufenordnungen<br />
näher untersuchen u.a.m.<br />
Hier handelt es sich nicht um<br />
Details, sondern um den Hinweis,<br />
dass die Pflanzenformen<br />
die harmonikale Raumkonfiguration<br />
unserer Seele an sich<br />
verkörpert, und dass wir in<br />
den konkreten Hörbildern dieser Formen ein Spiegelbild unserer psychischen Struktur sehen.<br />
31
Die Harmonik im Tierreich<br />
Reicher und noch mannigfaltiger zeigen sich die Möglichkeiten harmonikaler Lebensund<br />
Formanalysen im Tierreich. Allein die Spiralformen der Muscheln bieten ein schier<br />
unübersehbares Betätigungsfeld. Doch wollen wir auf solche morphologischen Analysen<br />
hier nicht eingehen. Für die knappe Übersicht, die hier von den Arbeiten KAYSERS<br />
gegeben werden soll, ist die Frage nach der Unterschiedlichkeit von Pflanze und Tier,<br />
wie sie sich dem Harmoniker darstellt, von noch grösserem Interesse.<br />
Wir haben hier ein äusseres und ein inneres Moment zu unterscheiden. Äusserlich<br />
betrachtet stellt sich die Tierwelt als etwas völlig vom Pflanzenreich gesondertes und<br />
Neues durch den Gehörsinn und seine Phonetik dar, d.h. durch die Reaktion auf akustische<br />
Laute sowohl, als auch durch die Fähigkeit, solche Laute von sich geben zu<br />
können. Mit diesem an sich so selbstverständlichen Unterscheidungsmerkmal, erspürt<br />
der Harmoniker jedoch etwas sehr Wesenhaftes: die Begabung des tierischen<br />
Wesens mit einem Astralleib, mit dem der Laut verbunden ist.<br />
Diese in das tierische Wesen einziehende Astralität spiegelt sich nun in dem inneren<br />
Unterscheidungsmoment sehr eindringlich wider: in den Hörbildern des Tierbereichs<br />
tritt nämlich zum erstenmal die Diatonik auf. Wir meinen damit eine Verbindung der<br />
Töne, die sich als geschlossene Skala, also als Tonleiter ausweist.<br />
Den Weg zu diesen Hörbildern weist wiederum die Variations- und Kombinationsmöglichkeit<br />
unseres Teiltondiagramms. Für das Pflanzenreich wurde bereits von der kreisförmigen<br />
Anordnung Gebrauch gemacht. Doch bieten sich noch andere Gestaltungsformen<br />
an: die gleichseitig-dreieckige etwa, die sphärische und logarithmische. Im<br />
«Lehrbuch der Harmonik» sind alle diese Möglichkeiten durchgeführt. Wir greifen nur<br />
beispielsweise zwei Ansätze dazu heraus.<br />
Kombination von Permutationen<br />
Lehrbuch, S. 182<br />
In dieser Art baut KAYSER eine tönende<br />
Natur, Schritt für Schritt, vor uns<br />
auf. Rückblickend ergibt sich dabei<br />
die Erkenntnis: Das Reich des Anorganischen<br />
findet sein harmonikales<br />
System in der räumlichen Konfiguration<br />
der Teiltonkoordinaten, beruhend<br />
auf einem System. Im Reich des<br />
Organischen, wie es sich in der Pflanze<br />
manifestiert, treten zwei oder mehr<br />
Teiltonkoordinatensysteme in polarer<br />
Gesetzlichkeit zueinander auf. Diese Systeme treffen sich im gemeinsamen Zeugerpunkt<br />
1/1, ihre Richtungen sind jedoch entgegengesetzte. «Das Leben stellt sich also<br />
dar als polare Spannung zwischen zwei oder mehreren Teiltonbereichen: Note gegen<br />
Note; der Kontrapunkt entsteht! Doch ist es eine tonale Statik, die im Pflanzenreich<br />
32
aufklingt. Es fehlt noch die eigentliche Form des Ausdrucks. Sie wird erst durch das<br />
Tier verwirklicht. Und da erwacht die Diatonik erstmalig zu form- und lebensbildender<br />
Bedeutung.» («Der hörende Mensch»)<br />
Alle diese so entwickelten Hörbilder führen zu tierischen Urbildern irgendwelcher Art,<br />
ein geeignetes Mittel, die verschiedenen zoologischen Urformen, wie Insekt, Fisch etc.<br />
als tonale Konfiguration zu bestimmen.<br />
Das Hörbild des Menschen<br />
Schliesslich wendet sich KAYSER dem Hörbild des Menschen zu. Auch hier ist die<br />
Methode die gleiche: Kombination und Variation von Teiltonreihen, wobei jetzt aber<br />
nicht nur ein Zeugerton in Erscheinung tritt, sondern die Teiltöne selbst zu neuen<br />
Generatoren herangezogen werden und von sich aus neue Teiltonreihen bilden. In<br />
seinem «Lehrbuch der Harmonik» entwickelt KAYSER dieses menschliche Hörbild von<br />
Index zu Index, uns solcherart miterleben lassend, welche Auswirkungen das Hinzutreten<br />
eines neuen Teiltones für den gesamten Hörbild-Organismus zeitigt. Und es ist<br />
faszinierend zu beobachten, wie sich allmählich die menschliche Leiblichkeit herausbildet.<br />
Relativ bald zeichnen sich die «Gliedmassen» ab, wobei die Teiltonreihen der<br />
«Arme» harmonisch das stärkste motorische Element enthalten, echte Obertonreihen<br />
in ihrer Dur-Moll-Tonalität darstellen, während das auf die unteren Extremitäten verweisende<br />
Schenkelpaar sich nur aus Grundtönen, aus reinen «Toniken» bildet und<br />
dadurch ein tragendes, statisches Moment aufweist.<br />
Mit dem Auftreten neuer Teiltöne kommt es weiter zur Herausbildung von je drei linken<br />
und rechten «unechten» (weil skalenmässig unvollständigen) kleinen Tonleiterkreisen.<br />
Von ihnen ergänzen sich je ein linker und rechter zu einer geschlossenen Leiter. Biologisch<br />
gesehen, tritt hier die Duplizierung wichtiger Organe in Erscheinung, wie etwa<br />
Lunge oder Niere.<br />
Noch auf ein zweites interessantes Detail sei hier verwiesen: In der weiteren Entwicklung<br />
des Hörbildes formt sich in der «Kopfregion» eine Ton-Ellipse heraus. Sie entsteht<br />
an jenem Punkt des Diagramms, an dem sich die Tonentwicklung zum erstenmal<br />
enharmonisch spaltet. Ausgehend vom Zeugerton c, erhalten wir zwei verschiedene<br />
b- und d-Werte. Dieselbe Ellipse, die man hier etwa der «Kehlkopfregion» zurechnen<br />
könnte, bildet sich aber gleichzeitig auch im unteren Abschnitt des Hörbildes heraus,<br />
in der «Genitalsphäre». Auch hier ergeben sich enharmonische Unterschiedlichkeiten<br />
von d- und b-Werten. Die zentrischen Töne sind bei beiden Ellipsen wertmässig identisch,<br />
haben jedoch verschiedene Orte: Die obere Ellipse gruppiert sich um 9/9 c, die<br />
untere um 8/8 c. Dieses Phänomen charakterisiert KAYSER mit folgender Überlegung:<br />
«Die polare morphologische Entsprechung in der Erkenntnis- und Sexualsphäre gibt<br />
der harmonikalen Analyse ein tiefes Geheimnis der Natur preis. Es wird nicht der innere,<br />
sowohl biologische wie psychologische Zusammenhang beider Sphären verständlich,<br />
sondern ihre enharmonische Struktur verweist uns auf eine tiefe Notwendigkeit<br />
33
dialektischer Bewegung der einzelnen Sphären in sich und unter sich hin. Der rätselhaften<br />
Verbundenheit von Zeugen und Wissen, dem sexualen ‘Erkennen’ in der Bibel,<br />
scheint also eine typisch harmonikale seelische Gestaltung vorgegeben, und wenn<br />
deren enharmonische Aufspaltung in den religiösen Mythen durch die verschiedensten<br />
Sündenfall-Erzählungen unbewusst gedeutet wird, so leuchten hier die gemeinsamen<br />
Beziehungen auf, kleine Teile freilich einer ungeheuren Kreisperipherie, deren wahrer<br />
Umfang und Mittelpunkt menschlichem Wissensdrang wohl immer verborgen bleiben<br />
wird.» (Lehrbuch der Harmonik)<br />
Ein grossartiger Brückenschlag zu jenen Schilderungen RUDOLF STEINERS, die uns die<br />
Begabung der gehirngebundenen Denktätigkeit als Folge der Geschlechtertrennung<br />
aufzeigen.<br />
Auch die «Mission» unseres Kehlkopfes als fern-zukünftiges «Zeugungsorgan» tönt in<br />
dessen Phänomen als harmonikale Veranlagung leise auf.<br />
Die Schlussfolgerung, die KAYSER aus seinen Hörbild-Untersuchungen zieht, führen ihn<br />
zu einem rein goetheanistischen Evolutions-Geschehen. Alle Naturformen lassen sich<br />
auf harmonikale Konfiguration zurückführen, und insbesondere die organischen Formen<br />
auf bestimmte Hörbilder des Urmenschen. Aus der tonalen Phänomenologie des<br />
Klanggesetzes tritt dieser Urmensch gleichsam heraus. Und er wandelt sich zu immer<br />
grösserer «Reinheit», d.h. er wird immer mehr und mehr zu jenem «apollinischen<br />
Typus», welcher dieses Tonphänomen am reinsten und vollkommensten aufklingen<br />
lässt. Im Lehrbuch zeigt KAYSER den männlichen und weiblichen Körper als klingenden<br />
Kanon auf, wie er in klaren Terz- und Quintproportionen gleichsam aus dem Monochord<br />
heraussteigt.<br />
Diese Herausbildung immer reinerer, vollkommenerer Formen ist das biologische<br />
Anliegen des Evolutionsprozesses:<br />
«Jeder Kombinationstyp verkörpert einen formbiologischen Rhythmus, ein ‘Artquantum’,<br />
mit dessen Fixierung, also Abspaltung er sein Ziel erreicht hat und einer neuen<br />
Stufe zustrebt. Die verschiedenen Tierformen wären demnach nichts anderes als eine<br />
Metamorphose des menschlichen Urbildes, wobei jede Stufe dieser Metamorphose<br />
als Artquantum eine entsprechende Tierform herausstellt, welche dann selbständig<br />
weiter existiert.» (Der hörende Mensch)<br />
Es verdient besondere Erwähnung, dass sich diese rein goetheanistische Biogenese<br />
für KAYSER zwangsläufig aus der Entfaltung seiner Hörbilder ergibt. Mögen seine Experimente<br />
für ihn auch nur die Bestätigung der Richtigkeit der GOETHEschen Entwicklungslehre<br />
gebracht haben, da er Goethes naturwissenschaftliche Schriften natürlich<br />
kannte – objektiv gesehen, hätte er jedoch zu keiner anderen Auffassung durch seine<br />
harmonikalen Forschungen gelangen können, auch wenn der Goetheanismus darüber<br />
nichts ausgesagt hätte.<br />
34
Diese harmonikalen Ergebnisse seiner Forschung prägt KAYSER in folgendes Schema:<br />
Mineral<br />
Niedere Tiere<br />
Vögel<br />
Heutiger Mensch<br />
URBILD DES MENSCHEN<br />
MINERALMENSCH<br />
PFLANZENMENSCH<br />
NIEDERER TIERMENSCH<br />
FISCHMENSCH<br />
VOGELMENSCH<br />
SÄUGETIERMENSCH<br />
HEUTIGER MENSCH<br />
?<br />
Der anthroposophisch orientierte Leser wird beim Studium dieser Hörbilder vielleicht<br />
an die JENNYschen kymatischen Versuche erinnert werden. Was bei diesen jedoch ein<br />
bloss äusseres Experimentieren mit Frequenzen darstellt – eine interessante Erweiterung<br />
des Phänomens der Chladnischen Klangfiguren – offenbart sich bei KAYSER als<br />
eine innere Struktur, die sich zwangsläufig aus dem Wesen des Tones ergibt.<br />
Johannes Kepler und die Sphärenharmonie<br />
Von Natur- und Menschenreich steigt Kayser schliesslich zur Sternenwelt auf, unmittelbar<br />
in die Sphäre der «Musica mundana». Und es erübrigt sich fast zu erwähnen,<br />
dass dabei Johannes KEPLER und seiner «Harmonices mundi» breitester Raum gegeben<br />
wird. Wenn wir darauf auch nicht näher eingehen wollen, so sei an Kaysers<br />
Darstellung doch dankenswert hervorgehoben, dass sie uns erkennen lässt, wie sehr<br />
diese «Weltharmonien» KEPLERS eigentliches Anliegen waren, und nicht etwa die<br />
35<br />
Pflanze<br />
Amphibien, Reptilien, Fische<br />
Säugetiere
Suche nach den berühmten drei Gesetzen, wie wir sie heute in ihrer blutleeren<br />
Abstraktion allein mit dem Namen KEPLER verbinden. Durch Kaysers verständnisvolles<br />
Nachvollziehen der Intentionen und Berechnungen des grossen Astronomen, ersteht<br />
die längst aus unserem Bewusstsein entschwundene Tatsache in lebendiger Anschaulichkeit<br />
wieder, dass Kepler zur Entdeckung seines wichtigsten, dritten Gesetzes<br />
nicht auf Grund verschiedener Zahlenbeziehungen im Planetensystem geführt wurde,<br />
dass es nicht ein «glücklicher Zufall» war, der ihn die Potenzierung und Kubierung der<br />
Werte finden liess, sondern dass diese Entdeckung die Frucht einer systematisch<br />
durchgeführten harmonikalen Technik war, der KEPLER bis zum Ende seiner Untersuchung<br />
treu blieb.<br />
Seine Vorgehensweise ist uns durch unser Teiltondiagramm längst vertraut. KEPLER<br />
suchte zunächst das Verhältnis der mittleren täglichen Geschwindigkeiten der Planeten,<br />
das er durch entsprechende Proportionierung und Umrechnung der harmonikalen<br />
Grenzwerte findet. Mit diesen Verhältniswerten operiert er nicht anders, als wir es<br />
in unserem Teiltondiagramm getan haben, als wir zu Oktav- und Quinttransponierungen<br />
schritten, um z.B. die Spiegelung der Obertonreihe zu erhalten. KEPLER erhebt die<br />
Planetenabstände zur 2., 3. und 4. Potenz, und vergleicht die Ergebnisse mit parallelen<br />
Oktavtranspositionen der mittleren Planetengeschwindigkeiten. Und da stellte sich<br />
heraus, dass sich die 2. Oktave der Umlaufzeiten verhielt wie die 3. Oktave der grossen<br />
Achsen. Ein Ergebnis, das Kepler dann in die uns bekannte, mathematische Formulierung<br />
prägt: «Die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten sich wie die Kuben ihrer<br />
mittleren Entfernungen von der Sonne.» Es ist das Ergebnis einer «tönenden Weltenharmonie»,<br />
nicht die Abstraktion einer seelenlosen Himmelsmechanik.<br />
Um jedoch in diesem Zusammenhang auch KAYSERS eigenständige Forschung zu würdigen,<br />
sei auf ein Experiment verwiesen, das bestimmt als eine Leistung besonderer<br />
Art zu werten ist. KAYSER verglich die Logarithmen der Planetenabstände mit den Teiltonlogarithmen<br />
seines Diagramms. Das Ergebnis war das Tonmaterial für eine über<br />
den Raum von zwei Oktaven ausgebreitete Tonfolge:<br />
Merkur<br />
Venus<br />
Erde<br />
Mars<br />
Diese Tonfolge ergibt – oktav-reduziert, und den Planetoidenwert als nicht mehr existierend<br />
eliminiert – eine Tonleiter, welche wohl diatonisch geschlossen ist, jedoch<br />
eigenartigen Charakter hat:<br />
Die erste Hälfte weist auf einen F-Dur-, die zweite auf einen f-Moll-Impuls.<br />
Planetoiden<br />
36<br />
Jupiter<br />
Saturn<br />
Uranus<br />
Neptun
Betrachten wir das Tonmaterial der ersten Folge genauer, unter Zusammenfassung<br />
einer äusseren und inneren Planetengruppierung, zeichnet sich in der ersten Gruppe<br />
ein Dur-Charakter ab, sowie die wichtigsten Intervalle: c-a-g-f: Terz, Quart, Quint,<br />
Sekund. Ein Umstand, der KAYSER zu dem Schluss veranlasst, dass die innere Planetengruppe:<br />
Merkur, Venus, Erde und Mars einheitlich und «harmonisch bezüglich ihrer<br />
Standpunkte organisiert ist».<br />
Die äussere Gruppe dagegen: Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun ergibt die Tonfolge<br />
b-g-e-des: einen verminderten Septimenakkord mit der deutlichen Auflösungstendenz<br />
nach C. Diese Tendenz liegt übrigens der gesamten Planeten-Tonfolge zugrunde, was<br />
man beim realen Klangerlebnis unschwer empfindet.<br />
Bemerkenswert ist ferner, dass «Erde» und «Saturn» mit nahezu identischen, einen<br />
Oktave auseinanderliegenden Tonwerten g’–g auftreten, und beide am wichtigsten Ort<br />
der äusseren und inneren Planetengruppe stehen, nämlich an der Stelle der Dominante<br />
(g ist die Dominante von c). Beide beherrschen somit von ihrer Position ihre Gruppe.<br />
In der Mitte, die beiden d-Werte umfassend, stünden die rätselvollen Planetoiden.<br />
Warum gerade zwischen Mars und Jupiter dieser doch offensichtlich zertrümmerte<br />
Planet? War tatsächlich einst an dieser Stelle ein Planet vorhanden? Die Harmonik<br />
wirft auf diese unbeantwortete Frage ein bedeutsames Licht.<br />
Nehmen wir hypothetisch an, dass in der Mitte zwischen der Jupiter- und Marssphäre<br />
tatsächlich ein Planet X einmal seinen Platz hatte. Nach den Logarithmen des Kayserschen<br />
Diagramms liegt der mittlere Wert der Planetoiden-Abstände nahe den beiden<br />
enharmonischen Stufen d und d. Das besagt, dass diese beiden Töne das erste<br />
enharmonisch gespaltene Paar in der Tonentwicklung des senarischen Kräftefeldes<br />
sind.<br />
Dazu kommt, dass dieser angenommene Planet X an der bevorzugtesten Stelle zu<br />
stehen kam; gleichsam an der schönsten Stelle dieser Tonfolge der gesamten Planetenkombination:<br />
Denn er bildet die Mitte des einzigen hier vorkommenden Dur-Akkordes:<br />
B-D-F! Er steht in der Terz dieses Dur-Akkordes. Und die Terz ist jenes Intervall,<br />
wo die Seele mit sich selbst Zwiesprache hält. Sie ist in unserer tonalen Musik zum<br />
bestimmenden Intervall des harmonischen Geschlechtes geworden. Sie ist das Ichbezogene<br />
Intervall, das neben ihrer «Innerlichkeit» auch zur «Süchtigkeit» verführt.<br />
Das alles ist die Terz geworden. Wodurch? In unserer Betrachtung stehen wir weit jenseits<br />
menschlicher Seelenhaftigkeit. Wir stehen in der Sternenwelt. Aber was zeigt sich<br />
uns? Da steht ein Sternenwesen an bevorzugtester Stellung dieser Himmelsmelodie.<br />
Es steht im «Herz- und Ich-Punkt» des hier auftönenden Dur-Akkordes. Und es steht<br />
an jener Stelle, wo sich die erste Tonspaltung vollziehen kann, wo Enharmonie die<br />
Möglichkeit zu ihrer Realisierung erhält.<br />
Wer dächte hier nicht an den Mythos um Luzifer, den schönsten Engel des schaffenden<br />
Gottes, den Lichtträger, der an dieser Stelle die «Spaltung» als erster setzte? Wie<br />
im Hörbild des Menschen, tritt uns auch am Himmel im ersten Aufklingen der Enharmonik<br />
der «Sündenfall», die «Sondierung» und «Aufspaltung» entgegen. Durch diese<br />
Entzweiung ist die urtümliche Harmonik, die im Zentrum ihres Erklingens einen reinen<br />
Dur-Akkord verkörperte, gestört. Der Planet X ist zersplittert, und was blieb ist eine<br />
eigenartige Dur/Moll-Mischung: eine «kosmische Geschlechtertrennung».<br />
37
Damit möge der kurze Aufriss der KAYSERschen «Akróasis» seinen Abschluss finden.<br />
So skizzenhaft er sich zeigen muss, dürfte er doch genügend Hinweise enthalten, um<br />
das Interesse für die harmonikale Phänomenologie im Leser zu wecken. Wie ernst es<br />
Kayser um die Verlebendigung dieser Erkenntnisse war, zeigt die pädagogische Nutzanwendung,<br />
die er für ein zukünftiges Musikstudium zieht:<br />
«In jede grössere Musikschule, vor allem jede Musikhochschule, gehört ein kleines harmonikales<br />
Laboratorium. Es wird die empfindlichste und sensibelste Zelle des Instituts<br />
sein, und alle, die durch diese Zelle hindurchgehen, werden ein tieferes Wissen um<br />
das Wesen der Musik mitbekommen, als es jeder andere musiktheoretische Unterricht<br />
zu geben vermag.»<br />
In dieser «Zelle» wird die Geometrie als bildhaft-exakter Ausgangspunkt aller harmonikalen<br />
Grundbegriffe genommen, Kristallographie als Identität von Ton- und Kristallentwicklung<br />
studiert, in dieser «Zelle» erschliesst sich durch das Mikroskop dem Schüler<br />
die Wunderwelt der Diatomeen und Radiolarien mit ihren einfachsten harmonikalen<br />
Formprinzipien; es wird ihm Architektur, Bildhauerkunst zum «singenden Marmor»,<br />
und Keplers gewaltige Harmonie der Welt ist ihm kein Phantasieprodukt mehr, sondern<br />
klingende, exakte, wenn auch für das Ohr nicht mehr hörbare Sphärenmusik.<br />
So wird Musik wieder die «quadriviale Kunst», die im Verein mit Mathematik, Geometrie<br />
und Astronomie den Wortgehalt der Welt zum Erklingen bringt. Aus dieser, zum<br />
Ethos der Mensch-Werdung getragenen Sicht, wendet sich KAYSER schliesslich an den<br />
schöpferischen Musiker unserer Zeit:<br />
«Ehrfurcht und Achtung vor dem Tongesetz ist der Sinn der Harmonik für den Musiker.<br />
Die strenge Schule einer zukünftigen harmonikal-musikalischen Satzlehre wird<br />
daher immer eine Schule der Natur sein, eine Beobachtung und ein Verstehen ihrer<br />
Normen und Gesetze.» (Der hörende Mensch, S. 335.)<br />
*****<br />
Unmittelbar vor dem Druck dieser MITTEILUNGEN erfahren wir durch Herrn Marcus<br />
Schneider, Basel, dass Prof. Dr. FRIEDRICH OBERKOGLER am 23. Januar 2000 im<br />
82. Lebensjahr in seinem geliebten Sommersitz Orplid im Pinzgau hoch über Neukirchen<br />
(Österreich) gestorben ist.<br />
«Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft<br />
macht atheistisch, doch<br />
auf dem Grund des Bechers wartet Gott.»<br />
Max Planck<br />
38
BÜCHERBESPRECHUNGEN<br />
Ernst Waldemar Weber<br />
PISA und was nun?<br />
Mit altersgemischten Klassen, weniger, aber betreuten Hausaufgaben, Elternschulung<br />
und mit mehr Musik zu einer besseren Bildung, 138 S., ill., Muri BE 2002, Fr. 32.–<br />
Mit grosser Hartnäckigkeit verfolgt der Autor das Ziel, mehr und besseren Musikunterricht<br />
in die Schulen zu bringen, weil er zusammen mit vielen Forschern und Erziehenden<br />
überzeugt ist, dass täglich musikalische Betätigung in den Schulen Persönlichkeit<br />
und Leistung der Kinder und Jugendlichen messbar fördert und das Klima in den Klassen<br />
entscheidend verbessert. Schon ab 1972 in seiner eigenen Schulklasse, dann<br />
1988 bis 1991 im Rahmen eines Nationalfonds-Projekts hat er das beweisen können<br />
(darüber und auch über die Schulversuche mit erweitertem Musikunterricht in Berlin<br />
1992 bis 1998 berichtet er im neuen Buch). Er war wesentlich beteiligt am Zustandekommen<br />
des Artikels zur Musikerziehung in der neuen Bundesverfassung und setzt<br />
sich jetzt ein für ein entsprechendes schweizerisches Rahmengesetz.<br />
Schon in «Die vergessene Intelligenz» hat Weber dargestellt, wie die menschliche<br />
Intelligenz ausgefächert wird in mindestens sieben selbständige aber miteinander vernetzte<br />
Intelligenzen; und wie durch diese neue Schau deutlich wird, über wieviele<br />
verschiedenartigste Kanäle erzogen werden muss und welche zentrale Rolle dabei die<br />
mit allen andern vernetzte musikalische Intelligenz spielt.<br />
Die für die deutschsprachigen Länder peinliche PISA-Studie über die nicht sehr brillante<br />
Lesefähigkeit ihrer 15-Jährigen nimmt der Autor als Anlass, mit neuen Erkenntnissen<br />
vertieften Argumenten und noch dringenderen Forderungen die Vision einer<br />
ganzheitlichen Erziehung und Schulung unserer Kinder darzustellen, die es nicht nur<br />
zustandebrächte, dass unsere Jugend besser lesen könnte, sondern auch in vielen<br />
andern Sparten kompetenter würde. Er geht dabei von der PISA-Studie selbst aus,<br />
indem er deren Ergebnisse bei uns mit denen der gut abschneidenden Länder, besonders<br />
Finnland vergleicht und untersucht, was von dort übernommen werden könnte.<br />
Neben den Hauptforderungen, wie sie im Untertitel stehen, werden die organisatorische<br />
Struktur des Bildungswesens (u.a. auch die kontraproduktive Selektion in den<br />
Schulen) und die im Argen liegende Ausbildung der Lehrkräfte diskutiert («Lehrerinnen<br />
und Lehrer müssen charismatische Persönlichkeiten werden und ein künstlerisches<br />
Flair haben»). Mit vielen überzeugenden Beispielen aus Praxis und Forschung wird aufgerollt,<br />
wie viel wirkungsvoller dank der neuen Betrachtungsweisen Erziehung vom<br />
Säugling bis zum adulten Menschen sein könnte. Dazu einige Beispiele: «Krippen<br />
machen Kinder klug (so wird die ‘Schulreife’ vorbereitet, statt wie bei uns abgewartet)»;<br />
«Schule muss endlich positiv erlebt werden, denn sonst werden viele an der<br />
unabdingbaren Forderung nach ‘life long learning’ zerbrechen»; ein individualisiertes<br />
Testsystem mit Eintragungen in ein persönliches Portofolio fördert die Eigenverantwortung<br />
der Lernenden. Im Kapitel «Musik im Zentrum» zeigt Weber auf, wie die Förde-<br />
39
ung der musikalischen Intelligenz alle andern Intelligenzen weiterbringen kann. So<br />
werden Fremdsprachen, bildnerisches Gestalten, Musik, Tanz und Werken fächerübergreifend<br />
unterrichtet.<br />
Die Bewegungs- und Tanzpädagogin Regula Leupold begleitet mit der Geschichte<br />
einer fiktiven Schulaufführung – illustriert mit doppelseitigen Zeichnungen – auf einer<br />
mehr intuitiven Ebene (ganz im Sinne des Buches: Alle Denksparten ansprechen!) die<br />
spannenden und wohlgeordneten Ausführungen des Autors.<br />
Das Buch verdiente es, unter einer breiten bildungspolitisch, pädagogisch und musikalisch<br />
interessierten Leserschaft verbreitet und beherzigt zu werden!<br />
Walter Amadeus Ammann<br />
Alexander Lauterwasser<br />
Wasser – Klang – Bilder<br />
Die schöpferische Musik des Weltalls. AT Verlag 2002, Fr. 48.–<br />
Ein faszinierendes und gewaltiges Werk, dieses Wasser – Klang – Bilder-Buch!<br />
Alexander Lauterwasser greift die Klangfiguren von Ernst F.F. Chladni am Übergang<br />
vom 18. zum 19. Jahrhundert sowie die Kymatik von <strong>Hans</strong> Jenny aus dem 20. Jahrhundert<br />
auf, vertieft deren Forschungsergebnisse und fügt ihnen die eigenen hinzu.<br />
Für mich stellt das Buch die Krönung alles bisherigen Schaffens auf diesem Gebiet<br />
dar.<br />
Es geht darum, Schwingungen als Töne oder Klänge in einem sensiblen Medium, hier<br />
dem Wasser, sichtbar werden zu lassen. Die Fülle der Bilder (zum grössten Teil farbig),<br />
die Lauterwasser vorlegt, ist überwältigend und steht schon für sich. Darüber hinaus<br />
aber gilt sein Interesse «dem grossen Themenbereich der Form- und Gestaltungsprozesse<br />
in der Natur bis hin zu Fragen der Morphogenese der Organismen», wie er<br />
in der Einleitung schreibt.<br />
Damit ist schon auf eine besondere Qualität seines Werks hingewiesen: Es stellt keine<br />
Dogmen vor uns hin, sondern vor allem Fragen. «Das eigene innere Berührtwerden<br />
und Staunen und die stets fragende Haltung waren für mich … der Leitfaden», bemerkt<br />
er im Nachwort, und das ist in jedem Textabschnitt zu spüren.<br />
Das Buch ist in fünf Teile gegliedert. Im ersten werden unter dem Titel «Kosmogonie<br />
und Klang» Aussagen aus Mythologie und Philosophie zur Frage zusammengetragen,<br />
«welche Kraft des Werdens» es gewesen sein könnte, «die aus dem Abgrund des<br />
‘Chaos’ jenes kunstvoll gestaltete Wunder hervorbringen konnte, dem die Griechen<br />
den Namen ‘Kosmos’ gaben» (S. 9). Die Antwort lautet nun nicht einfach «Schwingung»<br />
oder «Rhythmus» oder «Klang» (analog etwa dem «Wort» im Johannesevangelium);<br />
aber die gestaltbildende Kraft von Musik wird von den verschiedensten Kulturen<br />
her bezeugt und tritt hier durch die Klangbilder so überzeugend in Erscheinung, dass<br />
an ihrer schöpferischen Macht gar nicht zu zweifeln ist. So lautet der Untertitel des<br />
40
Buches denn auch, einem Wortlaut Novalis’ folgend: «Die schöpferische Musik des<br />
Weltalls». Diese Musik kann das Rauschen einer Quelle sein, der gleichbleibende Ton<br />
eines Monochords, der Gesang eines Buckelwals, eine Beethoven-Sonate: Lauterwasser<br />
lässt die ganze Breite von Schwingungen auf das «sensible Chaos» (Schwenk)<br />
Wasser einwirken.<br />
Im zweiten Teil wird ein phänomenologisch-physikalischer Überblick von Schwingungen<br />
gegeben und ihre Beziehungen zu Natur und Kultur aufgemacht, was dann im<br />
dritten Teil anhand der Chladnischen Klangfiguren ausgeweitet und vertieft wird. Wir<br />
werden angeregt, etwa das Fleckmuster eines Leopardenfells, die Gliederung eines<br />
Schildkrötenpanzers oder den Boden einer Geige nicht bloss zu sehen, sondern als<br />
Schwingungsphänomene gewissermassen auch zu hören. Lauterwasser erweist sich<br />
hier als echter Harmoniker: Resonanz und Resonanzbereitschaft sind ihm zentrale<br />
Begriffe, und hier möchte ich denn auch meine einzige kritische Frage anbringen:<br />
Wieso bleiben <strong>Hans</strong> Kayser und seine «Akróasis» so gut wie ausgeklammert?<br />
Den Höhepunkt des Buches bildet für mich aber dessen vierter Teil, in dem sich<br />
Lauterwasser nun ganz im Bereich seiner eigenen Forschungen befindet. Bilder und<br />
Gedankenführung beeindrucken mich gleichermassen. Ich will nur eine seiner tiefgründigen<br />
Fragen herausgreifen (ohne den darin enthaltenen Druckfehler zu wiederholen):<br />
«Steckt nicht in jedem auftretenden Muster … so etwas wie eine Erinnerung an die<br />
ursprüngliche, jetzt aber gestörte Einheit oder Ursymmetrie, an die zerbrochene verlorene<br />
Ganzheit – oder noch deutlicher: Ist das Muster selbst nicht ein individualisiertes<br />
Moment dieser Ganzheit, das noch etwas von deren Qualität in sich trägt und in seinen<br />
Strukturen offenbart?» (S. 102)<br />
Der abschliessende fünfte Teil des Buches besteht sodann fast gänzlich aus Bildern<br />
und Zitaten. Die allen Teilen beigefügten Zitate bilden ohnehin eine eigene, dritte Ebene<br />
des Buches. Ihre Auswahl ist gewiss auch persönlich, was dem Werk keinen Abbruch<br />
tut. Es ist ein Kleinod, und Nomen ist mir einmal mehr Omen: Lauterwasser reicht lauteres<br />
Wasser.<br />
«Geist schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier<br />
und wacht auf im Menschen», Altindisch, S. 25<br />
Gottfried Bergmann<br />
Helmut Reis<br />
Das Paradoxon des Ikosaeders<br />
Orpheus-Verlag, 227 S., Bonn 2002, Fr. <strong>50</strong>.–<br />
Dieses Buch über platonische und verwandte Körper in Natur, Wissenschaft und<br />
Kunst schliesst an die frühere Veröffentlichung von Helmut Reis an, «Natur und<br />
Harmonik», 1993 in Bonn erschienen. Auf spezielle harmonikale Betrachtungen lässt<br />
sich der Autor deshalb nicht ein. Dafür beschäftigt sich Reis mit den Erkenntnissen der<br />
Kristallographen der ersten Stunde, Kepler, Haüy, Hessel, Naumann, die es ihm<br />
ermöglichten, alle in Betracht kommenden Körper zu zeichnen, zu erfassen, zu<br />
verstehen.<br />
41
Der Leser darf sich tatsächlich auf viele Computerzeichnungen abstützen, die ihm helfen,<br />
sich im Labyrinth all dieser mathematischen Raumgebilde zu orientieren. Hier findet<br />
er den anschaulich-zeichnerischen Zugang. Und der nicht eben in grosser Mathematik<br />
ausgebildete künstlerische Betrachter erfreut sich an den vielen kunstvollen<br />
Darstellungen der platonischen Körper, die der Autor zusammengetragen hat: Darstellungen<br />
von Radiolarien (nach Haeckel), Zeichnungen von Wenzel Jamnitzer, München,<br />
tolle Konstruktionen von M.C. Escher.<br />
Für den geschichtlich Interessierten gibt es kurze Texte zur Kristallographie der oben<br />
genannten Naturforscher, die den seinerzeitigen Forschungsstand markieren. Kepler<br />
beispielsweise: «Kommen wir zur Sache: Da es immer so ist, sooft es zu schneien<br />
beginnt, dass jene ersten Schneeteilchen die Form von sechseckigen Sternchen an<br />
sich haben, muss da ein bestimmter Grund vorliegen. Warum fallen nicht in gleicher<br />
Weise Fünfecke oder Siebenecke?» Mit diesen Überlegungen Keplers beginnt das<br />
wissenschaftliche, nicht auf Autorität gegründete Forschen. «In den Naturwissenschaften<br />
gilt nur das Gewicht der Tatsache und der Vernunftgründe.» Im 19. Jahrhundert<br />
sucht und findet Haüy die gleichartigen Bauteilchen, deren Zusammensetzung die<br />
Kristallformen erklären. Hessel hingegen betrachtet mehr die Symmetrien der Kristalle,<br />
er findet sogar komplizierte Körper mit fünfzähliger Symmetrie, mit Namen, die<br />
recht schwer auszusprechen sind, etwa das Hexatonikosaeder.<br />
Die besondere Vorliebe des Autors gilt dem Rhomben-30-Flächner: Der Name sagt<br />
es: Es handelt sich um 30 Rhomben, die die Oberfläche dieses Körpers bilden. Sie<br />
umhüllen sowohl einen Dodekaeder (12 Flächen), als auch einen Ikosaeder (20<br />
Flächen). Es handelt sich aber keinesfalls nur um reine, nur für die Raumgeometrie<br />
wichtige Form: 1986 wurden Kristalle entdeckt, die es eigentlich nicht geben darf,<br />
sogenannte Quasikristalle, welche die Passform des Triakontaeders besitzen.<br />
Das Paradoxon des Ikosaeders, dem der Verfasser zwei Kapitel widmet, wollte sich<br />
mir nicht ganz eröffnen. Zwar schrieb Kepler (über eines seiner Bücher): «Das Buch<br />
setzt einen fähigen Kopf voraus, auch eine besondere geistige Aufmerksamkeit und<br />
ein unglaubliches Verlangen, die Ursache der Dinge kennen zu lernen.» Dieses Verlangen<br />
müsste der Leser also haben. Aber auch ohne diese Anstrengung kann der übrige<br />
Text gut verstanden werden.<br />
Die platonischen Körper zeigen sich in der Natur auch in überaus kleinen Formen: Das<br />
Kinderlähmungsvirus hat die Form eines 12-Flächners, das Herpes-Virus die Form<br />
eines 20-Flächners, das Aids-Virus die Form eines 12-Flächners mit aufgesetzten<br />
Pyramiden.<br />
Wie Helmut Reis vorführt, erregen diese Viren nicht nur Krankheiten, sondern ganz<br />
sicher auch Interesse bei kristallographisch interessierten Lesern mit elementarer<br />
mathematischer Bildung. Ihnen darf ich dieses schöne Buch empfehlen.<br />
<strong>Hans</strong>jürg Lengacher<br />
42
Sebnem Yavuz (Hrsg.)<br />
Eine Kriminal-Story aus dem 6. Jahrhundert<br />
Schriften zur Gregorianik-Forschung 1, Ars Gregoriana, Köln 2002, 171 S., Fr. 35.–<br />
Das Buch beginnt mit einem Übersichtsartikel von Joachim Gruber über die Boethius-<br />
Forschung der letzten 20 Jahre. Dann kommt Sebnem Yavuz zum Kern der Sache: Er<br />
stellt eine neue Theorie über den Ursprung der gregorianischen Gesänge vor und den<br />
Entwurf für eine neue Boethlus-Biografle.<br />
Nach der Überlieferung soll Boethius, römischer Adeliger und auf Grund seiner Schrift<br />
«de institutione musica» im Mittelalter «eine Art Musikheiliger und unantastbare Autorität»,<br />
(MGG) im Jahre 524 in einen Hochverratsprozess verwickelt und durch den Ostgotenkönig<br />
Theoderich I hingerichtet worden sein. Sein in der Haft geschriebenes<br />
berühmtestes Werk, die consolatio galt im Mittelalter als Inbegriff christlicher Frömmigkeit.<br />
Yavuz dagegen glaubt, dass sich Boethlus im Jahre 524 zusammen mit seiner Familie<br />
aus dem öffentlichen Leben in eine klosterähnliche Gemeinschaft zurückzog, um<br />
sich ungestört seinen musikalischen Studien widmen zu können und dass er daher<br />
seine Verurteilung und Hinrichtung – im Einverständnis mit dem Papst Johannes I und<br />
mit König Theoderich, dessen oberster Berater er war – selber vortäuschte und inszenierte.<br />
Yavuz vermutet, dass es dabei um die Erforschung der Grundlagen musikalischer<br />
Phänomene und ihrer Wirkung auf den Menschen ging. Damit verbunden war<br />
die Entwicklung des Systems der mystisch-spirituellen und äusserst tief wirkenden<br />
boethianischen Gesänge. Die Melodien, der formale Aufbau und das Tonartensystem<br />
wurden geschaffen zur Kommunikation mit Gott, wahrscheinlich auf Grund pythagoräischen<br />
Gedankengutes. Die dafür verwendeten Texte waren frühchristlich oder (nicht<br />
aus der Bibel stammende) religlöse Offenbarungstexte.<br />
Tragischerweise ist Boethlus wahrscheinlich kurz nach 546 doch hingerichtet worden,<br />
und zwar durch den 537 an die Macht gekommenen Papst Vigillus, der die boethianischen<br />
Gesänge und den wachsenden Zulauf des neuen spirituellen Zentrums fürchtete.<br />
Auch die Familie des Boethlus und seine Getreuen wurden verfolgt und hingerichtet,<br />
alle Spuren und Aufzeichnungen vernichtet oder unter Verschluss gebracht.<br />
Möglicherweise hat Papst Gregor der Grosse wenige Jahrzehnte danach aus einer<br />
Auswahl von boethianischen Gesängen und durch Unterlegung von biblischen Texten<br />
die gregorianischen Gesänge geschaffen.<br />
Der Autor listet ausführlich eine Reihe von Indizien auf, die seine Vermutungen stützen.<br />
All dies ist ja vorderhand noch wenig abgestützte Theorie, und die Quellenlage ist äusserst<br />
prekär: Es gibt bestenfalls Abschriften, die ihrerseits durchaus Fälschungen sein<br />
können. Im Mittelalter war es offenbar manchmal lebensgefährlich, die Wahrheit zu<br />
schreiben; vieles kursierte deshalb im Verborgenen oder wurde verschlüsselt. Und<br />
selbst Karl der Grosse, der mehr als 200 Jahre später Licht in das Dunkel um die<br />
boethianischen Gesänge bringen wollte, scheiterte am Widenstand des Papstes.<br />
Immerhin wurden dank dieser Bemühungen die Schriften des Boethius im Mittelalter<br />
berühmt, und der gregorianische Gesang – unterstützt durch die Legende seiner Entstehung<br />
durch eine kirchliche Autorität – wurde zum massgeblichen liturgischen<br />
Gesang der Kirche.<br />
43
In einem weiteren Hauptkapitel berichtet der Experte Manfred Dimde darüber, wie im<br />
Mittelalter und in der Renaissance Texte verschlüsselt wurden, um sie über die Jahrhunderte<br />
hinweg zu sichern. Es war eine hoch komplizierte Technik, die selbst in der<br />
vereinfachenden Darstellung durch den Autor nicht leicht zu begreifen ist und in jedem<br />
Fall eines besonderen Spürsinns bedarf. Die consolatio von Boethlus ist mit Sicherheit<br />
ein solcher Text, der nicht nur über die Hintergründe der Verurteilung, sondern wahrscheinlich<br />
auch über die boethianischen Gesänge berichtet. Das Original ist verschollen;<br />
es existiert eine Abschrift – mit verändertem Layout – von Cassiodor, einem Zeitgenossen<br />
von Boethius, der römischer Beamter und Geschichtsschreiber war.<br />
Auf Grund seiner 20 Jahre Forschungserfahrung, z.B. an den propheties des Nostradamus<br />
und dem Text über die Falknerei von Friedrich II stellt Dimde in Aussicht, die<br />
consolatio in den nächsten Jahren mit Hilfe des Computers zu entschlüsseln. Die<br />
Spannung in dieser Kriminalgeschichte bleibt also erhalten.<br />
Im letzten Kapitel bespricht Sebnem Yavuz einige für die Rekonstruktion der boethianischen<br />
Gesänge wichtige Elemente. Nach seiner Ansicht waren die Melodien «nicht<br />
am Wort entlang komponiert», sondern klar strukturiert und aus Bausteinen nach der<br />
Formel 3 + 2 Neumen aufgebaut. Boethius soll 13 Tonarten benutzt haben (die von<br />
Gregor auf 8 reduziert wurden), nämlich ausser den vier bekannten noch die «medialen»<br />
ionisch und aeolisch, alle je authentisch und plagal, dazu eine «übergeordnete»<br />
Tonart. Yavuz glaubt, dass Boethius einerseits ein Liniensystem verwendete zur Kennzeichnung<br />
der Tonhöhen und anderseits Neumen für zusätzliche, aussermusikalische<br />
Bedeutungen der Gesänge. Wahrscheinlich gab es auch – durch Neumen signalisierte<br />
– Abschnitte mit Obertongesang. Yavuz glaubt, dass das legendäre Antiphonar von<br />
Papst Gregor tatsächlich existiert hat. Wei! es im Klerus erheblichen Widerstand gab<br />
gegen die gregorianischen Gesänge (zunächst wurden sie nur von Benediktiner-Mönchen<br />
gesungen), erschienen die ersten Notationen erst im 9. Jahrhundert.<br />
Nach der Theorie von Yavuz entsprechen die lothringischen Neumen – im Gegensatz<br />
zu den von der Wissenschaft bisher favorisierten St. Galler Neumen – am ehesten<br />
denjenigen von Boethlus. An einigen Beispielen wird deutlich gemacht, dass es sich<br />
um einen nicht nur regionalen, sondern fundamentalen Unterschied handelt. (Einer der<br />
beiden nach Italien Abgesandten Karls des Grossen, welche den gregorianischen<br />
Gesang finden sollten, hatte seine Kenntnisse in das kirchliche Zentrum Metz<br />
gebracht, und Karl hatte verfügt, dass die Metzer Gesangskunst im Frankenreich als<br />
Vorbild zu dienen habe.)<br />
Zum Abschluss weist Yavuz nochmals darauf hin, dass vieles an seiner Theorie spekulativ<br />
ist, dass er damit mehr Fragen aufwirft als beantwortet, und dass er so die Forschung<br />
anregen möchte. Zwar ist die Arbeit vor allem interessant für Gregorianik-Kundige,<br />
und sie wird in diesen Kreisen sicher zu grossen Diskussionen führen. Aber auch<br />
für Laien und von weiter her Interessierte bringt sie viel, und seien es nur die Einblicke<br />
in die Geschichte des ausgehenden Altertums und frühen Mittelalters und die<br />
Geschicke der damaligen Menschen.<br />
Das Buch ist ein Paperback, aber im Umschlag und im Satzspiegel gediegen gestaltet<br />
und ansprechend illustriert. Da ist es doppelt schade, dass sich einige Druckfehler<br />
eingeschlichen haben. Hilfreich wäre auch ein Stichwortverzeichnis: denn häufig<br />
möchte man bei der Lektüre eine frühere Stelle nachschlagen. Ernst W. Weber<br />
44
André M. Studer<br />
Inwendiges Tagebuch 2001<br />
171 S., br., Rothenbühler Verlag, Stäfa 2002, Fr. 25.–<br />
Anstatt mühsam für diese reichhaltigen medial empfangenen Botschaften einen<br />
gemeinsamen Nenner zu suchen, seien hier einige Weisheiten im originalen Wortlaut<br />
wiedergegeben:<br />
Masken reisse nieder, auch die deine!<br />
Sie sind zu nichts nütze. Fesseln sind sie,<br />
erlauben euch nicht, zu sein, wer ihr wirklich seid.<br />
Tragt die Verantwortung<br />
für euer besseres wie für euer schlechteres Sein.<br />
Schämt euch nicht und fürchtet euch nicht.<br />
Im Geiste lässt sich ohnehin nichts verbergen.<br />
Wer es dennoch versucht, macht sich lächerlich. S. 16<br />
Hinweise über seinen Daseinszweck<br />
erhält jeder, wenn er, winzige Charakteristika<br />
nicht übersehend, seine Schwächen und Stärken hinterfragt.<br />
Würde schon früh in der Kindheit<br />
nach diesem Prinzip vorgegangen,<br />
könnten manche Irrwege vermieden werden. S. 30<br />
Es nimmt sich einer den Anteil, der ihm zusteht,<br />
geht damit in die Welt hinaus,<br />
sich eine unabhängige Existenz aufzubauen, scheitert,<br />
da er zu wenig durchdacht vorgegangen,<br />
da der Sünde der Habgier verfallen,<br />
da nur auf sein Ich bedacht,<br />
da keinen Augenblick seiner Herkunft<br />
und seines inneren Auftrags gedenkend,<br />
und rechtfertigt sich dann damit,<br />
das Erbe sei unzureichend und zu wenig abgesichert gewesen.<br />
Seine Unreife kann niemand einem andern anlasten<br />
als sich selbst und seiner Uneinsichtigkeit. S. 33<br />
Sarkastisch ist eine Bemerkung,<br />
wenn sie Geist zur Destruktion missbraucht.<br />
Sarkasmus ist die Waffe des Vernichters von Idealen.<br />
Nabelschauer deuten alles nach ihrem Ichbedürfnis,<br />
ohne jemals ihr ich preiszugeben. Sie sind Narren<br />
und Possenreisser, die sich ohne Scham selbst darstellen. S. 36<br />
45
Die Zeichen mehren sich,<br />
wonach Welten im Umbruch begriffen sind.<br />
Kinder und Narren ahnen nichts davon<br />
und führen ein Leben wie eh und je,<br />
in Streit und Konkurrenz die meisten,<br />
während Wenigen das Wissen um die Verwandlung<br />
ihrer selbst deutlich wird.<br />
Nicht Untergang, Wandlung ist angesagt. S. 41<br />
Zur Ausarbeitung eines neuen geistigen Dienstreglementes<br />
gehört der Wille zur Freiheit<br />
von jeglicher formalistischen Religion.<br />
Ohne Selbstfreigabe ist Friede im Herzen nicht möglich,<br />
zumindest solange sklavische Bindungen<br />
an religiöse Formalismen bestehen.<br />
Wie soll Friede mit dem Nächsten zustandekommen,<br />
wie Friede unter Völkern,<br />
wenn du nicht Frieden in deinem Innern,<br />
Frieden mit deinem Selbst gefunden? S. 43<br />
Gegen vielerlei Krankheiten kennt man kein Mittel.<br />
Dennoch gibt es ein Heilmittel für die meisten.<br />
Die erste Voraussetzung, diese zu erlangen,<br />
besteht in der demütigen Annahme des Leidens.<br />
Hilfe kann nur dem zukommen,<br />
der seine Hilfsbedürftigkeit erkannt und eingestanden.<br />
Heil ist Gnade und führt zur inneren<br />
und, steht genügend Zeit zur Verfügung,<br />
auch zur äusseren Heilung. S. 91<br />
Geh nie den Weg des Treulosen,<br />
nie den Weg des Undankbaren, wissend,<br />
dass du, was du bist, aus Ihm bist,<br />
dass du, was du weisst, aus Ihm weisst,<br />
der die Weisheit und Liebe selber ist.<br />
Geh den Weg, der dich letztlich zur Vereinigung mit Ihm führt.<br />
Ich weiss mich auf demselben Weg, dem Weg der Vielen,<br />
die Ihn erkannt haben. S. 115<br />
Im Namen Dessen, der unmanipulierbar<br />
und unbestechlich immer ist und in sich ruht,<br />
reinigt euch von allem Fremden und Unwesentlichen,<br />
auf dass Er durchscheine, Der euer unsterbliches Wesen ist.<br />
Er lehre uns, Ihn in unserem Bruder, unserer Schwester<br />
zu erkennen und in uns zu erfahren. S. 117<br />
46
Man mache sich, wenn unwissend, nie zu schaffen<br />
mit undurchschaubaren Wesenheiten.<br />
Man sei sich bewusst,<br />
dass es auch Boten der düsteren Welt gibt,<br />
die sich mit wenig löblichen Absichten tragen.<br />
Das Ego des nicht im Geiste stabilisierten Menschen<br />
fällt leicht in Versuchung,<br />
schönen Versprechungen Glauben zu schenken.<br />
Die Erkenntnis seiner selbst ist der Schlüssel<br />
zur Erkenntnis seines Nächsten.<br />
Es gibt keinen Grund, diesen zu fürchten,<br />
wenn man sich selbst kennt und seelisch im Griff hat. S. 121<br />
Am Vortag legen Terroranschläge das World Trade Center in New York und<br />
Teile des Pentagon in Washington in Schutt und Asche<br />
Ein Wort zur leidvollen gestrigen Wahnsinnstat:<br />
Viele suchen nach dem Sinn solchen Handelns.<br />
Sie werden ihn, als Ignoranten geistiger Gesetze, nicht finden.<br />
Verschiedenen übereinstimmenden alten Quellen zufolge,<br />
muss solches Unheil über die Menschheit kommen,<br />
wenn sie vor dem Ende des aktuellen Zyklus<br />
wissend und frei werden will. Doch wehe jenen,<br />
die sich im Rausch des Hasses als Täter zur Verfügung stellen! S. 125<br />
LESERZUSCHRIFT<br />
Lieber Walter<br />
Vor einigen Tagen erreichte mich eine Zuschrift zu meinem Buch «Zahl + Qualität», die<br />
ich den FREUNDEN UM HANS KAYSER nicht vorenthalten möchte:<br />
... Es ist das Beste, was ich seit Kaysers Schriften über Harmonik gelesen habe, ja, manches<br />
wird mir durch Ihre Ausf¨ührungen eigentlich erst zugänglich. Anders als Haase schreiben Sie für<br />
mich zwar im Geiste Kaysers, führen aber seine Harmonik weiter und vertiefen sie. Zum Beispiel<br />
glaube ich, erstmals in meinem Leben etwas von Quantenphysik verstanden zu haben, und<br />
dass mir dies über die Harmonik möglich wurde, befriedigt und beglückt mich tief. Und darüber<br />
hinaus entwickeln Sie im Kapitel «Tonphänomen und Quantenphysik» einen Begriff von Materie,<br />
in dem der Gegensatz von materialistischer und spiritualistischer Anschauungsweise überbrückt<br />
wird und sich aufhebt. Dies allein betrachte ich als eine bedeutende geisteswissenschaftliche<br />
Leistung ...<br />
47<br />
Herzliche Grüsse sendet Dieter Kolk
BESTELLUNG<br />
❑ zur Ansicht<br />
❑ gegen Rechnung<br />
Ex. SCHRIFTEN ÜBER HARMONIK Fr. Euro<br />
…<br />
…<br />
<strong>Nr</strong>. 17: RUDOLF STÖSSEL: Harmonikale Faszination, 166 S., über 100 Fig., br., 2. Aufl. 1986<br />
<strong>Nr</strong>. 10: ANDRE M. STUDER: Kriterien einer integralen Architektur. Werk und Transzendenz.<br />
26.– 17.–<br />
Anhang: Von der Idee zur Gestalt, 64 S., 44 Abb., br., 1984 118.– 11.80<br />
…<br />
…<br />
<strong>Nr</strong>. 11: RUDOLF HAASE: Zur Gesch. der Harmonik (Platon, Bahr, Hauer, Hesse), 76 S., br., 1984<br />
<strong>Nr</strong>. 12: JULIUS SCHWABE: Die Harmonik als schöpferische Synthese, 90 S., 25 Abb., br., 1985<br />
16.–<br />
17.–<br />
10.40<br />
11.10<br />
… <strong>Nr</strong>. 14: DIETER KOLK: Harmonik und Psychologie, 68 S., 12 Abb., br., 1985 112.– 7.80<br />
… RUDOLF STÖSSEL: Kleine Einführung in die Harmonik, 20 S., 5 Abb., br., 19842 … <strong>Nr</strong>. 15: RUDOLF STÖSSEL: Wege zur Harmonik, 86 S., über 100 Abb., br., 1987<br />
115.–<br />
127.–<br />
3.30<br />
17.70<br />
…<br />
…<br />
<strong>Nr</strong>. 17: RUDOLF HAASE: 20 Jahre H. Kayser-Inst. für harm. Grundlagenforschung, 68 S., br., 1988<br />
<strong>Nr</strong>. 18: ANDRE M. STUDER: Vernimm das Lied des Alls in Dir! Einführung in die Harmonik, 144 S.,<br />
147 Abb., br., 1990<br />
113.–<br />
133.–<br />
8.<strong>50</strong><br />
21.60<br />
…<br />
…<br />
…<br />
<strong>Nr</strong>. 20: KAYSER, LÜTHI, STÖSSEL: Hesses Glasperlenspiel und die Harmonik, 38 S., 1990<br />
<strong>Nr</strong>. 21: WALTER AMMANN: <strong>Hans</strong> Kayser, Biogr. Fragmente, 72 S., 27 Abb., br., 1991<br />
<strong>Nr</strong>. 22: LOTTI SANDT: H.H. <strong>Jahnn</strong>, Zur Literatur, Harmonik u. Weltanschauung, 92 S., geb., 1997<br />
115.–<br />
115.–<br />
18.–<br />
3.30<br />
9.80<br />
11.80<br />
… <strong>Nr</strong>. 22: LOTTI SANDT: Mythos u. Symbolik im Zauberberg von Th. Mann, 365 S., 40 Abb., br.,<br />
Für die «Freunde»<br />
= <strong>50</strong>% Rabatt<br />
Haupt Bern 1979 statt 45.– 25.– 16.60<br />
… <strong>Nr</strong>. 23: GERTRUD HOFER: Die Bedeutung der Musik in Mythen und Märchen, 44 S., br., 1998 15.– 9.80<br />
… <strong>Nr</strong>. 24: CHARLES HUMMEL: Pythagoras und die Schule von Chartres, 66 S., 13 Abb., br., 1998 18.– 11.80<br />
… <strong>Nr</strong>. 25: JOH. GRUNTZ-STOLL: Harmonik – Sprache des Universums, 152 S., 27 Abb., br., 2000 28.– 18.30<br />
… <strong>Nr</strong>. 26: HANS KAYSER: Aus meinem Leben, 196 S., zahlr. Abb., 2000 24.– 15.70<br />
... <strong>Nr</strong>. <strong>50</strong>: HANS KAYSER: Lehrbuch, Bespr. Oberkogler, 48 S., 2003 10.–<br />
… ANDRE M. STUDER: Manu (Zukunftsroman), 7<strong>50</strong> S., geb., Stäfa 1996 169.– 45.20<br />
… ANDRE M. STUDER: Inwendiges Tagebuch, 146 S., br., Stäfa 2000 25.– 16.60<br />
... <strong>Nr</strong>. 18: ANDRE M. STUDER: Inwendiges Tagebuch 2000, 158 S., br., Stäfa 2001 25.– 16.60<br />
... <strong>Nr</strong>. 18: ANDRE M. STUDER: Inwendiges Tagebuch 2001, 171 S., br., Stäfa 2002 25.– 16.60<br />
… <strong>Nr</strong>. 19: DIETER KOLK: Zahl und Qualität, Abhandl. zur Harmonik <strong>Hans</strong> Kaysers, 456 S., br., 1995 166.– 43.–<br />
❑ Ich wünsche Zustellung der MITTEILUNGEN DER FREUNDE UM HANS KAYSER BERN<br />
erscheinen jährlich zweimal 15.– 10.–<br />
... HANS KAYSER: Akróasis, 181 S., geb., 1984 4 37.–<br />
… HANS KAYSER: Lehrbuch der Harmonik, 36x26 cm, 380 S., viele, z.T. farbige Zeichn. u. Abb., 19<strong>50</strong>,<br />
Fotokopie, sorgfältig geb. 4<strong>50</strong>.– 295.–<br />
... idem, vergrössert auf 42x30 cm 580.– 395.–<br />
… HANS KAYSER: Orpheus, A4, 92 S., viele, z.T. farbige Zeichn. u. Tafeln, 1926, Fotokopie, geb. 3<strong>50</strong>.– 230.–<br />
… HANS KAYSER: Der hörende Mensch, 368 S., 79 z.T. aufklappbare Tafeln, Repr., Stuttgart 1993 148.– 97.–<br />
… HANS KAYSER: Tagebuch vom Binntal, 80 S., 16 Abb., mit Karten, br., Wien 1972 2 125.– 16.60<br />
… RUDOLF HAASE: Harmonikale Synthese, 96 S., 22 Abb., br., Wien 1980 132.– 21.30<br />
… URSULA HAASE: Der Briefwechsel <strong>Hans</strong> Kaysers, 72 S., br., Wien 1973 123.<strong>50</strong> 15.40<br />
… PAUL von NAREDI-RAINER: Architektur u. Harmonie, 312 S., 139 Abb., br., Köln 1999 6 40.– 26.–<br />
… HELMUT REIS: Harmonie und Komplementarität, 272 S., reich bebildert, Ln., Bonn 1983 145.– 30.<strong>50</strong><br />
… HELMUT REIS: 100 Jahre Balmerformel, 74 S., 34 Abb., br., Bonn 1985 123.30 15.30<br />
… HELMUT REIS: Der Goldene Schnitt, 190 S., Ln., Bonn 1990 136.– 24.<strong>50</strong><br />
… HELMUT REIS: Natur und Harmonik, 492 S., 200 Abb., Ln., Bonn 1993 82.– 56.–<br />
... HELMUT REIS: Das Paradoxon des Ikosaeders, 227 S., reich ill., Ln., Bonn 2002 <strong>50</strong>.– 34.–<br />
… OTTO SCHÄRLI: Werkstatt des Lebens, Durch die Sinne zum Sinn, 168 S., geb., Aarau 1995 2 142.– 27.<strong>50</strong><br />
… WALTER AMMANN: Baustilkunde von den Griechen bis zum Barock, 90 S., 180 Abb., Bern 2001 11 118.<strong>50</strong> 12.10<br />
… WALTER AMMANN: Baustilkunde vom Klassizismus bis heute, 120 S., 160 Abb., 10 Tfn, Bern 1998 4 118.<strong>50</strong> 12.10<br />
… PAUL ADAM + ARNOLD WYSS: Platonische u. archimedische Körper, 136 S., 5<strong>50</strong> Abb., 15 Vorlagen<br />
für Modelle einschl.: Die Sonderlinge, Bern u. Stuttgart, geb., 1984 2 165.– 42.60<br />
… KARL LEDERGERBER: Mit den Augen des Herzens, 128 S., Herder-Tb., 1988 118.90 5.90<br />
… KARL LEDERGERBER: Christoffels Auferstehung, 116 S., 26 Abb., geb., statt Fr. 22.<strong>50</strong> NUR 115.– 9.80<br />
… GOTTFRIED BERGMANN: Pflanzenstudien Heft 1, 78 S., über 100 Abb., geb., print edition 1997 40.– 26.20<br />
… GOTTFRIED BERGMANN: Pflanzenstudien Heft 2, <strong>50</strong> S., 57 Abb., print ed. 1998 20.– 13.10<br />
... GOTTFRIED BERGMANN: Pflanzenstudien Heft 3, 144 S., reich illustr., geb., Freier Arbeitskr., 2002 38.– 25.–<br />
… GOTTFRIED BERGMANN: Evolution des Menschlichen, 90 S., 200 Abb., br., Freier Arbeitskr., 2001 28.– 18.30<br />
... JOSEPH ESCHER Hg. u.a.: Neue Klänge in der Medizin, Musiktherapie i.d. I. Medizin, 192 S., br.,<br />
Bremen 1994 36.– 24.<strong>50</strong><br />
… TONIUS TIMMERMANN: Musen u. Menschen, Musik in Selbsterfahrung+Therapie. 172 S., br., 1998 26.60 17.40<br />
... FRANZ NÄF: Das Monochord, 178 S., über 70 Tab. u. Abb., br., Bern 1999 46.– 30.10<br />
… PETER M. HAMEL: Durch Musik zum Selbst, 2<strong>50</strong> S., br., 5. Aufl., Kassel 1989 17.– 11.10<br />
… ERNST WALDEMAR WEBER: Die vergessene Intelligenz, die Musik im Kreis der menschlichen<br />
Anlagen, 135 S., br., PAN-Verlag Zürich, 1999 38.– 25.–<br />
... ERNST WALDEMAR WEBER: Pisa und was nun?, Muri b. BE 2002 29.– 19.–<br />
... ALEXANDER LAUTERWASSER: Wasser – Klang – Bilder, 144 S., geb., reich illustriert, Aarau 2002 58.– 35.–<br />
... SONJA ULRIKE KLUG: Kathedrale des Kosmos (Chartres), 224 S., reich beb., Atlantis, München 2001 41.– 27.–<br />
... ALEXANDRE MAGNIN: Bach – ein visionäres Genie, 145 S., geb., Rothenbühler Verlag, 2000 39.– 26.<strong>50</strong><br />
Preisänderungen vorbehalten<br />
BLOCKSCHRIFT<br />
Name: Beruf:<br />
Adresse: PLZ/Ort:<br />
Datum: Unterschrift:<br />
Erhältlich entweder bei Ihrer Buchhandlung oder bei: WALTER AMMANN, Biderstrasse 31, CH-3006 Bern Febr. 2003