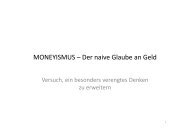Die Mystikerin Hadewijch und - Zentrum Seniorenstudium
Die Mystikerin Hadewijch und - Zentrum Seniorenstudium
Die Mystikerin Hadewijch und - Zentrum Seniorenstudium
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„<strong>Die</strong> Liebe ist alles!“ - <strong>Die</strong> <strong>Mystikerin</strong> <strong>Hadewijch</strong> <strong>und</strong> die radikale<br />
Spiritualität der ersten Beginen 1<br />
Vortrag gehalten anlässlich des <strong>Seniorenstudium</strong>s der LMU München am 19.5.2011<br />
von Gerald Hofmann, Landshut<br />
Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen <strong>und</strong> Vorstellungen Sie heute hierher gekommen<br />
sind. Bei manchem, was das Thema anspricht, kann man sicher davon ausgehen, dass es heut-<br />
zutage noch oder auch wieder auf ein gewisses Interesse stößt. Das gilt sicherlich für die<br />
Schlagwörter Spiritualität <strong>und</strong> Mystik, <strong>und</strong> auch die Liebe, um die es ja doch auch gehen<br />
wird, besitzt immer <strong>und</strong> bei fast jedem von uns einen hohen Aufforderungscharakter.<br />
Wir müssen uns hier jedoch zunächst darüber klar werden, dass wir uns mit diesem Thema -<br />
mit <strong>Hadewijch</strong> <strong>und</strong> den „ersten Beginen“ - auf das Mittelalter einlassen. Und das Mittelalter,<br />
da darf man sich nichts vormachen, ist im Wesentlichen eine weitgehend fremde Welt. Und<br />
deshalb sollten wir uns der Tatsache immer bewusst sein, dass unsere Vorstellungen zu bestimmten<br />
Themenbereichen, wie den hier angesprochenen, nicht automatisch mit denen des<br />
Mittelalters deckungsgleich sind.<br />
Bevor wir uns also auf die Spiritualität der mittelalterlichen Beginen am Beispiel der <strong>Mystikerin</strong><br />
<strong>Hadewijch</strong>s einlassen, wollen <strong>und</strong> müssen wir zunächst einmal fragen: Wer ist oder war<br />
<strong>Hadewijch</strong> eigentlich? Und: Wer oder was sind Beginen überhaupt?<br />
<strong>Die</strong> Beginen<br />
Beginnen wir mit den „Beginen“: <strong>Die</strong> Frauen, für die heute der Name Beginen eingeführt ist,<br />
wurden ursprünglich von den lateinisch schreibenden Chronisten zumeist einfach als mulieres<br />
religiosae: d. h. als „fromme Frauen“ bezeichnet. <strong>Die</strong>jenigen, die damals diesen Begriff im<br />
M<strong>und</strong>e oder in der Feder führten, machten damit auf ein Phänomen aufmerksam, welches ca.<br />
seit der Wende vom 12. auf das 13. Jahrh<strong>und</strong>ert zunehmend sichtbar wurde <strong>und</strong> das heute mit<br />
einer sog. „religiösen Frauenbewegung“ in Zusammenhang gebracht wird. Dabei sollte aber<br />
jeglicher frauenrechtlerische Unterton vermieden werden, handelt es sich doch zuallererst um<br />
eine religiöse Bewegung, wenn dabei auch Frauen erstmals eine quantitativ herausragende<br />
Rolle spielten.<br />
1 Hinweise auf die wichtigste verwendete Literatur <strong>und</strong> die zugr<strong>und</strong>e liegenden Textausgaben<br />
finden sich am Ende des Textes. Alle Zitate aus den Schriften <strong>Hadewijch</strong>s stammen aus den<br />
dort angegeben Ausgaben.
Überall in Mitteleuropa <strong>und</strong> in Italien, zunächst <strong>und</strong> vor allem aber im Gebiet des heutigen<br />
Belgien wurden damals Frauen von so etwas wie einer religiösen Sehnsucht erfasst, ihr Leben<br />
auf eine neuartige Weise radikal christlich auszurichten. Das bedeutet: Sie strebten nach<br />
einem apostolischen Leben in Armut <strong>und</strong> freiwilliger Keuschheit, oder umgekehrt: Sie waren<br />
bereit, auf einen bürgerlichen Wohlstand, auf Ehe <strong>und</strong> Familie zu verzichten <strong>und</strong> statt dessen<br />
ihr Leben <strong>und</strong> ihre Lebensführung in neuartiger Weise auf das Vorbild Jesus Christus auszu-<br />
richten. In der Anfangszeit noch im zwölften Jahrh<strong>und</strong>ert waren es einzelne Frauen, meist aus<br />
bürgerlichen Verhältnissen, die, wie man heute sagen würde: „ausstiegen“ <strong>und</strong> zunächst<br />
alleine, etwa als Reklusen oder Einsiedlerinnen, <strong>und</strong> später mit gleichgesinnten anderen<br />
Frauen zusammenlebten. In der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrh<strong>und</strong>erts bildeten sich dann<br />
zunehmend regelrechte Gemeinschaften, in denen die Frauen ein mehr oder weniger religiös<br />
geordnetes Leben führten, das im täglichen Leben durch karitative Tätigkeiten, durch<br />
Krankenpflege <strong>und</strong> Armenfürsorge gekennzeichnet war. Im Gegensatz zu regulierten Nonnen<br />
war diesen Frauen ein privates Eigentum gestattet <strong>und</strong> sie hatten auch die Möglichkeit, diese<br />
Lebensform auch wieder aufzugeben. Bald schon kam für diese Frauen die Bezeichnung<br />
Beginen auf, wobei es aber bis heute nicht eindeutig geklärt ist, woher diese Bezeichnung<br />
stammt. 2 Zumeist lebten sie in städtischen Konventen zusammen, seltener auch in eigenen<br />
Höfen. <strong>Die</strong> großen Beginenhöfe übrigens, die man noch heute - inzwischen als<br />
Weltkulturerbe der UNESCO - vor allem in Belgien bew<strong>und</strong>ern kann, reichen geschichtlich<br />
zwar meist bis ins 13. Jahrh<strong>und</strong>ert zurück, die erhaltenen Anlagen stammen i. d. R. aber erst<br />
aus späteren Jahrh<strong>und</strong>erten, als das Leben der Beginen bereits in weitgehend formalisierten<br />
Bahnen verlief.<br />
Ursachen der Bewegung der Mulieres Religiosae<br />
Wenn wir wenigstens kurz der Frage nachgehen wollen, worin die Ursachen dieser religiösen<br />
Bewegung liegen, dann müssen wir uns zwei Gesichtspunkte verdeutlichen. Zum einen: <strong>Die</strong><br />
Bewegung der Beginen war um 1200 nicht der einzige breite Versuch, dem christlichen Ideal<br />
durch einen apostolischen Lebensentwurf eine neue Geltung in der Christenheit zu verschaffen.<br />
Ich möchte dafür nur an die im Wesentlichen von Männern getragene Reformbewegung<br />
der Waldenser oder an diejenigen erinnern, aus denen später die berühmten Bettelorden der<br />
Franziskaner <strong>und</strong> Dominikaner hervorgegangen sind. Daran kann man erkennen, dass es da-<br />
2 In den ersten Jahrzehnten seines Gebrauchs brachten die Sprecher oder Schreiber damit<br />
allerdings eher eine abwertende <strong>und</strong> despektierliche Sichtweise zum Ausdruck.<br />
2
mals ein weitverbreitetes Bedürfnis gab, Christus <strong>und</strong> seine Botschaft wieder in ihrem Kern<br />
zu entdecken. Eine Gr<strong>und</strong> für die Bereitschaft vieler Menschen, ihr Leben damals radikal neu<br />
auszurichten, liegt sicherlich in den sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Veränderungen, die sich in<br />
der Gesellschaft im 12. <strong>und</strong> 13. Jahrh<strong>und</strong>ert allerorten bemerkbar machten. Gerade im Kern-<br />
land der Beginenbewegung in Flandern <strong>und</strong> Brabant entwickelten sich die Städte damals ra-<br />
sant zu urbanen Zentren, in denen ein früher kapitalistischer Geist Wachstum <strong>und</strong> Wohlstand,<br />
aber auch Gewinnmaximierung um jeden Preis, gesellschaftliche Spaltung <strong>und</strong> soziale Verlie-<br />
rer hervorbrachte. Einer zunehmenden, aber immer noch schmalen Schicht reicher Patrizier<br />
<strong>und</strong> Kaufleute stand ein zunehmendes Heer von Bettlern <strong>und</strong> Mittellosen gegenüber. <strong>Die</strong> Ver-<br />
hältnisse dürften wohl ein wenig an unsere heutigen erinnert haben. Es verw<strong>und</strong>ert vor diesem<br />
Hintergr<strong>und</strong> nicht, dass viele der Beginen <strong>und</strong> frommen Frauen auch aus dem Großbürgertum<br />
<strong>und</strong> dem Adel stammten.<br />
Der zweite Gesichtspunkt, der dazu herangezogen werden kann, das Entstehen einer religiösen<br />
Frauenbewegung zu erklären, ist folgender: Um die genannte Jahrh<strong>und</strong>ertwende herum,<br />
also ca. um 1200, hatte die westliche Christenheit schon über ein Jahrh<strong>und</strong>ert der kirchlichen<br />
Unruhe, der religiösen Umbrüche <strong>und</strong> Erneuerungen hinter sich, aber noch nicht zu Ende gebracht.<br />
Was im elften Jahrh<strong>und</strong>ert als ein Bestreben begonnen hatte, die kirchliche Sphäre<br />
deutlich von der weltlichen zu trennen, war seitdem immer auch mit dem Versuch einzelner<br />
<strong>und</strong> ganzer Gruppen verb<strong>und</strong>en, die Erscheinung der Kirche <strong>und</strong> die christliche Lebensform,<br />
wie sie an der Kurie <strong>und</strong> in den Klöstern praktiziert wurde, in Frage zu stellen <strong>und</strong> zu reformieren.<br />
In unserem Zusammenhang soll dafür nur an das Entstehen einiger bis heute bedeutender<br />
Orden erinnert werden, so der Karthäuser, der Prämonstratenser oder der Zisterzienser.<br />
Man mache sich bewusst: Um 1200 waren diese eigentlich noch blutjunge Orden. Doch während<br />
hier der Impetus der Reform sich von Haus aus eher auf eine Sonderform christlichen<br />
Lebens bezogen hatte, nämlich die klösterliche Lebensform, sahen sich die frühen Beginen<br />
ähnlich wie etwa Franz von Assisi auf eine neuartige Weise, nämlich als Menschen in der<br />
Welt, mit dem radikalen Anspruch Jesu Christi konfrontiert. Der Mensch Jesus wurde ihnen<br />
allen zum unverrückbaren Vor- <strong>und</strong> Leitbild, dem sie mit ihrer Lebensführung in je etwas anderer<br />
Ausprägung entsprechen wollten.<br />
Für die frommen Frauen der Anfangszeit ergab sich die Form eines solchen apostolischen Lebens<br />
konsequent als Folge ihrer Antwort auf diesen existenziellen Ruf. Das muss deshalb er-<br />
3
wähnt werden, weil eben diese Lebensform auch für die Hindernisse <strong>und</strong> Gefahren verant-<br />
wortlich war, denen die Beginen ausgesetzt waren. Während ein Leben, welches eine Begine<br />
alleine für sich führte, oft noch geduldet wurde, war die Bildung einer religiösen Gemein-<br />
schaft außerhalb einer von der Kirche anerkannten Lebensform in der damaligen Zeit ein gefährliches<br />
Wagnis. Der Bestand der Beginengruppen hing so immer wieder davon ab, dass es<br />
einflussreiche Unterstützer <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e gab, die sich um die Anerkennung der Beginengemeinschaften<br />
bei der Amtskirche bemühten <strong>und</strong> diese auch erwirkten. Den Frauen, die damals<br />
dem christlichen Ruf folgten, ging es schließlich ja auch nicht darum, außerhalb der kirchlichen<br />
Ordnung zu stehen. So war es ihnen beispielsweise auch in aller Regel selbstverständlich<br />
an einer geistlichen Betreuung durch einen Priester gelegen. Sie empfanden sich als Teil der<br />
Kirche <strong>und</strong> akzeptierten auch alle ihre wesentlichen religiösen Elemente, insbesondere etwa<br />
die Form des Gottesdienstes <strong>und</strong> die Eucharistie, ja sie erlebten diese mit einer neuen Lebendigkeit<br />
<strong>und</strong> Spiritualität. Es sei hier nur das Fronleichnamsfest erwähnt, welches auf Betreiben<br />
Julianas von Cornillon († 1252) installiert <strong>und</strong> 1246 in Lüttich erstmals gefeiert wurde.<br />
<strong>Die</strong> Eucharistie war für Juliana wie für fast alle frommen Frauen das zentrale liturgische Ereignis<br />
einer Begegnung mit dem lebendigen Christus.<br />
<strong>Die</strong> Nähe zur monastischen Lebensweise <strong>und</strong> Frömmigkeit<br />
Das Beispiel der eucharistischen Frömmigkeit vieler Beginen zeigt auch, dass bei ihnen bestimmte<br />
Elemente einer äußerlichen Nachfolge Christi, wie etwa das Armutsideal, zugunsten<br />
einer stärkeren Ausrichtung auf das Gebetsleben, die Liturgie <strong>und</strong> eine mystische Frömmigkeit<br />
zurücktraten. Das mag auch ein gewichtiger Gr<strong>und</strong> dafür gewesen sein, dass in der ersten<br />
Hälfte des 13. Jahrh<strong>und</strong>erts viele der frommen Frauen sowie ganze Beginengemeinschaften<br />
bereit waren, in einen der bestehenden Ordensverbände einzutreten, was diese aber angesichts<br />
der immensen Zahl aufnahmewilliger Frauen an organisatorische Grenzen brachte. Man gewinnt<br />
einen Eindruck von den quantitativen Verhältnissen dieser religiöser Bewegung, wenn<br />
man sich bewusst macht, dass in der ersten Hälfte des 13. Jahrh<strong>und</strong>erts im Gebiet des heutigen<br />
Belgiens ca. 50 Zisterzienserinnenklöster neu entstanden sind! Viele der frommen Frauen<br />
der Anfangszeit des Beginenwesens lassen deshalb auch eine zweigeteilte geistliche Biografie<br />
erkennen, insofern als sie einen Teil ihres Lebens als Beginen für einige Jahre allein <strong>und</strong>/oder<br />
in einer Gemeinschaft verbracht <strong>und</strong> sie irgendwann dann doch noch den Weg in ein reguläres<br />
Kloster gef<strong>und</strong>en haben, meistens, wie wir gesehen haben, in eines der Zisterzienserinnen.<br />
4
Ein berühmtes deutsches Beispiel dafür findet sich etwa im Leben der Magdeburger Begine<br />
Mechthild, die ihre letzten Lebensjahre im Zisterzienserinnenkloster Helfta verbracht hat.<br />
<strong>Die</strong> Viten<br />
Auch wenn wir danach fragen, was wir über das Tun <strong>und</strong> Denken, über das religiöse Selbstverständnis<br />
jener frommen Frauen wissen, werden wir wieder auf die Nähe zwischen den semireligiös<br />
lebenden Beginen in ihren meist städtischen Gemeinschaften <strong>und</strong> den klösterlichen<br />
Zisterzienserinnen hingewiesen. Denn einige der Beginen, die im Laufe ihres Lebens in ein<br />
Zisterzienserinnenkloster eingetreten waren, erwarb sich dort den Ruf der Heiligkeit, was<br />
dazu führte, dass Beschreibungen ihres Lebens, sog. Viten abgefasst wurden. Unter ihnen befindet<br />
sich etwa die schon genannte hl. Juliana, die allerdings nur locker den Zisterzienserinnen<br />
zugerechnet werden kann, die hl. Ida von Nijvel oder die heilige Lutgard von Tongeren,<br />
die Patronin Belgiens. Es sind im Wesentlichen diese Viten zisterziensischer Frauen <strong>und</strong> dazu<br />
einige wenige Lebensbeschreibungen von heiligmäßigen Frauen, die ihr ganzen Leben als<br />
Beginen verbracht haben, insgesamt r<strong>und</strong> etwas mehr als ein Dutzend Viten, die eine entscheidende<br />
Quelle unseres Wissen über die frommen Frauen in der ersten Hälfte des 13. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
bilden. 3<br />
<strong>Die</strong> Frage nach authentischen Zeugnissen<br />
Ein Nachteil der auf Lateinisch überlieferten Lebensbeschreibungen stellt allerdings der Umstand<br />
dar, dass sie i. d. R. nicht von den Frauen selbst verfasst wurden. Sie geben das wieder,<br />
was jeweils ein Mönch oder Geistlicher, also ein Mann, über das Leben der Frauen erfahren<br />
hat <strong>und</strong> was er davon mitteilen wollte. Es ist auch zu berücksichtigen, dass diese Männer mit<br />
ihren Beschreibungen die Heiligkeit der Frau bezeugen wollten, wozu sie diesen immer<br />
wieder stereotype Züge andichteten, die eben diese Heiligkeit nachweisen sollten, wie etwa<br />
besondere W<strong>und</strong>erkräfte oder Zeichen einer außerordentlichen Frömmigkeit. In jedem Fall<br />
muss man hier etwas vorsichtig sein, wenn man hier nach Spuren einer authentischen<br />
Spiritualität dieser Frauen sucht.<br />
Glücklicherweise besitzen wir immerhin von zwei frommen Frauen dieser Zeit <strong>und</strong> aus diesem<br />
Gebiet auch authentische Zeugnisse, d. h. Schriften, die von ihnen selbst stammen bzw.<br />
3<br />
Nahezu alle Texte stammen aus dem Gebiet der mittelalterlichen Diözese Lüttich. Dadurch<br />
macht auch die historische Quellenlage deutlich, dass es dieses Gebiet war, welches das<br />
<strong>Zentrum</strong> der Bewegung der frommen Frauen in Europa bildet.<br />
5
im Wesentlichen auf eigene Aufzeichnungen zurückgehen <strong>und</strong> damit einen unverstellten<br />
Blick auf die mystische Frömmigkeit der mulieres religiosae gewähren.<br />
<strong>Die</strong> eine von ihnen, Beatrice, war zunächst von ihrem Vater in die Obhut von Beginen gege-<br />
ben worden, wo sie eine Art religiöser Gr<strong>und</strong>ausbildung genossen hatte. Sie wurde anschlie-<br />
ßend Zisterzienserin <strong>und</strong> starb 1268 als Priorin der neu gegründeten Abtei von Nazareth. Von<br />
ihr ist ein mittelniederländischer Traktat überliefert, der „Über die sieben Weisen der Liebe“<br />
überschrieben ist, <strong>und</strong> eine Lebensbeschreibung, diese allerdings nur als eine lateinische Be-<br />
arbeitung ihrer eigenen in der Volkssprache abgefassten Tagebuchaufzeichnungen.<br />
Den größten <strong>und</strong> in jeder Hinsicht authentischen Einblick in die Spiritualität einer der from-<br />
men Frauen gewähren uns dagegen die Schriften einer Frau, die nach den äußerst dürftigen<br />
Spuren zu ihrer Person wohl <strong>Hadewijch</strong> geheißen hat.<br />
<strong>Hadewijch</strong><br />
Sie ist nicht nur der wichtigste Zeuge für die religiöse Geisteswelt <strong>und</strong> Haltung der frommen<br />
Frauen, sondern, ungeachtet dieser Tatsache, liegt mit ihren Schriften ein herausragendes<br />
geistiges Werk vor, dessen Originalität, dessen literarischer Reichtum <strong>und</strong> geistige Tiefe in<br />
ihrer Heimat <strong>und</strong> zumindest auch in den angloamerikanischen Ländern schon seit einigen Jahren<br />
erkannt wird.<br />
Wer war diese Frau? Wir wissen es nicht! Mit der Frage nach der historischen Identität von<br />
<strong>Hadewijch</strong> stehen wir noch immer vor einem großen Rätsel, um dessen Lösung sich seit Entdeckung<br />
ihrer Schriften im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert immer wieder Gelehrte bemüht haben. <strong>Die</strong> Mutmaßungen<br />
<strong>und</strong> Entgegnungen, die spitzfindigen Argumentationen <strong>und</strong> Auseinandersetzungen<br />
lesen sich inzwischen wie ein spannender Kriminalfall, dessen Auflösung allerdings wohl<br />
noch länger auf sich warten lassen wird. <strong>Hadewijch</strong> hat jedenfalls höchstwahrscheinlich zwischen<br />
dem letzten Drittel des 12. <strong>und</strong> der Mitte des 13. Jahrh<strong>und</strong>erts in Brabant als Begine<br />
<strong>und</strong> vielleicht auch als Rekluse gelebt. Es ist zuletzt auch nicht ausgeschlossen, dass sie gegen<br />
Ende ihres Lebens auch die erste Priorin des Zisterzienserinnenklosters Hertogendaal bei<br />
Löwen gewesen ist.<br />
Sicher ist indes, was wir von <strong>Hadewijch</strong> schriftlich überliefert bekommen haben. Dazu gehören<br />
zwei umfangreiche geistliche Gedichtsammlungen <strong>und</strong> zwei große Prosawerke, nämlich<br />
ein Visionsbuch <strong>und</strong> ein Buch der Briefe 4 . Alles, was wir von ihr wissen, wissen wir aus<br />
4 Im Mittelalter können verschiedenste Textsorten unter dem Titel „Brief“ firmieren, so auch<br />
bei <strong>Hadewijch</strong>. Jedenfalls sind auch <strong>Hadewijch</strong>s Briefe nicht lediglich private Schreiben,<br />
6
diesen Werken. Danach muss sie hochgebildet gewesen sein, war mit der lateinischen<br />
Theologie ebenso vertraut wie mit der französischen Troubadourdichtung ihrer Zeit. Man<br />
wird im Mittelalter schon suchen müssen, um eine Frau zu finden, die eine solche Bildung<br />
aufzuweisen hat, oder überhaupt eine Persönlichkeit, die in der Lage war, tradierte Gehalte<br />
mit einer derartigen geistigen Eigenständigkeit zu einem in sich geschlossenen Gesamtwerk<br />
zu verbinden. Aus diesem Charakteristikum kann man bereits auch einen wichtigen Zug ihrer<br />
Spiritualität ableiten: Auf den Ruf, den auch die anderen frommen Frauen von Christus<br />
vernommen haben, antwortet hier ein eigenständiges Ich, dem das, was es denkt, erfährt oder<br />
erlebt, nur dann wirklich zum Gr<strong>und</strong> einer wahrhaftigen Antwort auf Christi Ruf werden<br />
kann, wenn es authentisch, d. h. von Innen heraus gedacht, erfahren <strong>und</strong> erlebt wurde.<br />
... <strong>und</strong> Mystik<br />
Authentizität ist gewiss auch ein entscheidendes Stichwort, will man versuchen zu erklären,<br />
was eine mystische Frömmigkeit kennzeichnet, von der im Zusammenhang von <strong>Hadewijch</strong><br />
<strong>und</strong> anderen frommen Frauen immer wieder die Rede ist. Der Gegenstand ihrer Religion ist<br />
ihnen nämlich etwas im Denken, Fühlen <strong>und</strong> Erfahren lebendig Erlebtes, etwas Dringliches<br />
<strong>und</strong> Durchdringendes, dessen Mittelpunkt das lebendige Göttliche ist. Gott, das unnennbare<br />
Göttliche, ist ihnen kein unsicherer <strong>und</strong> immer wieder dunkler Gegenstand gläubigen<br />
Vertrauens, der immer wieder vor allem von außen an sie herangetragen werden muss,<br />
sondern Er ist eine Wirklichkeit, die von ihnen in vielfältiger Weise als eine gegenwärtige<br />
erlebt wird. Und dazu gehören sicherlich die Augenblicke regelrechter mystischer Entrückung<br />
<strong>und</strong> Vereinigung, aber dann auch - wie paradox sich das anhören mag - selbst die bittere<br />
Erfahrung der Abwesenheit Gottes.<br />
Minne<br />
Ein, ja das zentrale Element der Spiritualität der frommen Frauen oder dessen, was ich hier<br />
einmal als die mystische Dringlichkeit des Göttlichen bezeichne, ist nun in der Tat die Liebe<br />
oder minne, wie sie die Frauen in ihrer Sprache genannt haben. <strong>Die</strong> Liebe ist etwas, was jeder<br />
Mensch erfahren kann, eine gefühlshafte Strebekraft, die es auszeichnet, dass sie von uns<br />
Menschen gr<strong>und</strong>sätzlich als etwas Positives erachtet wird. Das sahen die frommen Frauen genauso,<br />
ihnen war aber auch bewusst, dass die Liebe als etwas Natürliches nicht etwas nur<br />
sondern beinhalten u.a. Traktate <strong>und</strong> Prosatexte freier Formen. Es sind Schreiben für eine<br />
gewisse Öffentlichkeit.<br />
7
Naturgegebenes ist, sondern von Gott selbst stammt. Wilhelm von St. Thierry, der zusammen<br />
mit Bernhard von Clairvaux <strong>und</strong> Augustinus zu den wichtigsten geistigen Mentoren der<br />
frommen Frauen gehört, hatte es ihnen folgendermaßen ins Stammbuch geschrieben: „<strong>Die</strong><br />
Liebe ist der menschlichen Seele vom Urheber der Natur als etwas Natürliches hinzugefügt<br />
worden.“ Damit wird eine Verbindung zwischen dem Menschen <strong>und</strong> Gott hergestellt, die<br />
durch das „Gott ist die Liebe“ des ersten Johannesbriefes so noch nicht bestand. Doch wenn<br />
mit der Natürlichkeit auch ein entscheidendes Bindeglied zwischen Gott <strong>und</strong> dem Menschen<br />
gef<strong>und</strong>en werden kann, ist die Göttlichkeit der Liebe im Menschen damit nicht automatisch,<br />
sondern nur der Möglichkeit nach gegeben. Das eigene Liebesvermögen bedarf nämlich einer<br />
Entwicklung, einer Formung <strong>und</strong> Veredlung, was nicht ohne Mühe vonstatten geht. Wir<br />
werden darauf zurückkommen.<br />
<strong>Die</strong> Liebe besitzt in den Augen <strong>Hadewijch</strong>s ein schillerndes Wesen <strong>und</strong> darf auch nicht in jedem<br />
Fall, wenn von ihr die Rede ist, <strong>und</strong> nicht völlig mit Gott gleichgesetzt werden. Gleichwohl<br />
ist es die Liebe Gottes, von der die Initiative zum Kontakt mit der Liebe des Menschen,<br />
die Einladung, ja der leidenschaftliche Aufruf an sie ausgeht. In einem Brief schreibt <strong>Hadewijch</strong><br />
über diese göttliche Liebe:<br />
Mit lauter Stimme ruft sie [die Liebe] kämpferisch <strong>und</strong> unermüdlich in die Herzen aller Liebenden:<br />
„Liebt die Liebe!“ Ihre Stimme dringt mit solcher Gewalt hervor, dass sie in ihrer<br />
Unerhörtheit furchtbarer als der Donner tönt.<br />
Und dieser Ruf der Liebe korrespondiert mit dem innersten Wesen Gottes selbst. Das geht<br />
etwa aus <strong>Hadewijch</strong>s erster Vision hervor, wo sich ihr das Wesen Gottes in eindrücklichen<br />
Bildern offenbart:<br />
Über dieser gewaltigen Stätte thronte derjenige, den ich suchte (...). Seine Gestalt war mit<br />
irgendwelchen Worten nicht zu beschreiben. Sein Haupt war groß <strong>und</strong> breit <strong>und</strong> weiß gelockt;<br />
es war gekrönt mit einer Krone, die einem Edelstein glich, der Sardonyx heißt <strong>und</strong> aus drei<br />
Farben besteht: schwarz, weiß <strong>und</strong> rot. Seine Augen waren unaussprechlich w<strong>und</strong>erbar anzusehen<br />
<strong>und</strong> zogen in Liebe fortwährend alle Dinge in Ihn hinein. (Doch) von diesem Geschehen<br />
vermag ich nichts in Worte zu fassen. Denn die unermesslich große Schönheit <strong>und</strong> die beseligende<br />
Lieblichkeit dieses erhabenen w<strong>und</strong>erbaren Angesichts nahm mir jede Möglichkeit, Ihn<br />
durch bildliche Vergleiche zu beschreiben.<br />
Es ist nicht die Zeit auf die einzelnen Elemente dieses beeindruckenden <strong>und</strong> gleichzeitig rätselhaften<br />
visionären Bildes hier näher einzugehen. Aber man erkennt deutlich: Aus dem inne-<br />
8
en Wesen Gottes heraus entfaltet seine Liebe eine universale Anziehungskraft, die wirklich<br />
alles in sich mit einbeziehen möchte. Allerdings nimmt der Mensch in diesem Prozess lieben-<br />
der Allverwandlung eine besondere Stellung ein, ja, <strong>Hadewijch</strong> war davon überzeugt, dass der<br />
Mensch <strong>und</strong> Gott, dass beide in gewisser Weise aufeinander angewiesen sind, wenn Gott im<br />
Menschen wie der Mensch in Gott die Vollendung jeweils seines Wesens finden soll. Der Ort<br />
dieser beidseitigen Vollendung ist die menschliche Seele, wie sie in ihrem 18. Brief auf ein-<br />
drückliche Weise erklärt:<br />
Begreife doch einmal, was die Seele im Innersten ausmacht, was das ist: Seele! <strong>Die</strong> Seele ist<br />
ein Wesen, das von Gott gesehen werden kann <strong>und</strong> das wiederum selbst Gott sehen kann. <strong>Die</strong><br />
Seele ist auch ein Wesen, das Gott zu gefallen wünscht <strong>und</strong> das über sich eine gerechte Herrschaft<br />
ausübt, insofern sie nicht durch etwas Fremdes, das unterhalb ihrer Würde liegt, geschwächt<br />
wird. Wo es so um die Seele steht, da ist sie eine Gr<strong>und</strong>losigkeit, in der sich Gott<br />
selbst wohl gefällt <strong>und</strong> wo Er das Wohlbehagen, das Er an sich selbst hat, andauernd in vollkommener<br />
Weise in ihr findet <strong>und</strong> sie umgekehrt auch andauernd in Ihm. <strong>Die</strong> Seele ist ein<br />
Weg, über den Gott aus seinen tiefsten Tiefen in seine Freiheit gelangt; <strong>und</strong> Gott ist ein Weg,<br />
über den die Seele in ihre Freiheit gelangt, <strong>und</strong> das bedeutet: in seinen Gr<strong>und</strong>, der nicht berührt<br />
werden kann, es sei denn, sie berühre ihn mit ihrer eigenen Tiefe. Und wäre Gott ihr<br />
nicht ganz <strong>und</strong> gar zu eigen, es würde ihr nicht genügen.<br />
„<strong>Die</strong> Seele ist ein Weg, über den Gott aus seinen tiefsten Tiefen in seine Freiheit gelangt; <strong>und</strong><br />
Gott ist ein Weg, über den die Seele in ihre Freiheit gelangt.“ Eine solch hohe Auffassung des<br />
Menschen, wie sie hier aus <strong>Hadewijch</strong>s Worten spricht, vermag auch heute noch zu überraschen.<br />
Stellt sie doch nicht, wie das sonst üblich gewesen ist, die Sündhaftigkeit <strong>und</strong> Schwäche<br />
des Menschen in den Mittelpunkt, sondern sie betont am Menschen zuerst sein unglaubliches<br />
Potenzial, nämlich in seiner Freiheit das Höchste wirklich erreichen zu können. Hören<br />
wir nochmals <strong>Hadewijch</strong>:<br />
[Denn] ich bin ein freier Mensch <strong>und</strong> zu einem Teil auch rein, <strong>und</strong> ich kann mit meinem Willen<br />
frei verlangen <strong>und</strong> so kühn wollen, wie ich will, <strong>und</strong> ich kann von Gott alles das erlangen<br />
<strong>und</strong> in Besitz nehmen, was Er ist...<br />
Aus dieser stolzen <strong>und</strong> zu ihrer Zeit sicher ungewöhnlichen Bek<strong>und</strong>ung einer essenziellen<br />
Freiheit des Menschen spricht jemand, der neu verstanden hat, was es bedeuten kann <strong>und</strong> bedeutet,<br />
dass der Mensch Ebenbild Gottes genannt wird. <strong>Hadewijch</strong> attestiert dem Menschen<br />
damit eine außerordentliche, von Gott verliehene allgemeine Würde, die so in der westlichen<br />
9
Christenheit lange Zeit nicht wahrgenommen wurde <strong>und</strong> die es in ihrer Konsequenz für eine<br />
gelebte Spiritualität des Einzelnen sicher auch bis heute noch immer zu entdecken gilt.<br />
Verlangen <strong>und</strong> leidenschaftliche Liebe<br />
Es überrascht vor diesem Hintergr<strong>und</strong> nicht, dass <strong>Hadewijch</strong> <strong>und</strong> viele der frommen Frauen<br />
ihrer Zeit ein ungeahntes Selbstbewusstsein auch in ihrem Verlangen zum Ausdruck brachten,<br />
mit Gott tatsächlich vereint zu sein. Eine Gelegenheit bot sich ihnen dazu in der Eucharistie,<br />
die sie immer wieder als eine wirkliche Begegnung mit dem lebendigen Christus erlebten <strong>und</strong><br />
schließlich gar zu einer echten Kommunion, zu einer mystischen Vereinigung mit dem göttlichen<br />
Geliebten führen konnte.<br />
Hören wir einen Ausschnitt aus <strong>Hadewijch</strong>s siebter Vision, die gerade auch in unseren Tagen<br />
aufgr<strong>und</strong> des kühnen Geschehens, das sie schildert, schon häufig für Gesprächsstoff gesorgt<br />
hat.<br />
<strong>Die</strong> Begegnung zwischen <strong>Hadewijch</strong> <strong>und</strong> Christus wird zunächst von einem johanneischen<br />
Adler auf zeremonielle Weise vorbereitet. Nachdem der Adler sowohl den am Altar verborgenen<br />
Herrn angesprochen hat als auch <strong>Hadewijch</strong>, die von einer großen Furcht vor dieser<br />
Begegnung <strong>und</strong> zugleich von einem unbändigen Verlangen erfüllt ist, fährt der Bericht fort:<br />
Da kam Er vom Altar, indem er sich selbst als ein Kind zeigte. [...] Und er wandte sich zu mir<br />
hin <strong>und</strong> nahm aus dem Ziborium seinen Leib in seine rechte Hand <strong>und</strong> in seine linke Hand<br />
nahm Er einen Kelch, der vom Altar zu kommen schien [...].Dann kam Er in der Kleidung <strong>und</strong><br />
in der Gestalt als Mann, wie Er sie an dem Tag hatte, als Er uns seinen Leib zum ersten Mal<br />
gab. In genau der Gestalt als Mensch <strong>und</strong> als Mann, liebenswert <strong>und</strong> schön <strong>und</strong> mit einem<br />
bezaubernden Antlitz erschien Er. Und Er kam zu mir mit einer solchen Demut, wie einer, der<br />
ganz <strong>und</strong> gar einem anderen gehört. Da gab Er sich selbst in der Form des Sakraments in der<br />
Gestalt, wie es gewöhnlich war. Und danach gab Er mir aus dem Kelch zu trinken, der Gestalt<br />
<strong>und</strong> dem Geschmack nach, wie es gewöhnlich ist. Danach kam Er selbst zu mir <strong>und</strong><br />
nahm mich fest in seine Arme <strong>und</strong> drückte mich an sich; <strong>und</strong> alle Teile meines Körpers spürten<br />
die seinen, so dass es ihnen, entsprechend dem Verlangen meines Herzens - nach meinem<br />
Mensch-Sein -, eine Lust war. Da wurde ich äußerlich bis zum Äußersten befriedigt. Auch<br />
hatte ich da kurzzeitig die Kraft, das auszuhalten. Doch nach wenigen Augenblicken schon<br />
verlor ich den schönen Mann als Gestalt außen aus dem Blick <strong>und</strong> ich sah Ihn ganz zunichte<br />
werden <strong>und</strong> so sehr hinschwinden [...], dass ich Ihn außerhalb von mir weder erkennen noch<br />
10
wahrnehmen noch unterscheiden konnte. In diesem Augenblick war es mir, als ob wir unter-<br />
schiedslos eins wären. [...]<br />
<strong>Die</strong>se Vision zeugt von einem unglaublich kühnen Selbstbewusstsein in der Begegnung mit<br />
dem göttlichen Geliebten, <strong>und</strong> sie zeigt auch, dass die Lebendigkeit der Liebe für diese<br />
Frauen etwas war, was sich tatsächlich auf das ganze Leben, <strong>und</strong> so etwa auch auf das affektive,<br />
ja erotische Gefühlsleben des Menschen erstrecken konnte. Der Text dokumentiert nicht<br />
zuletzt aber auch ein Verlangen <strong>und</strong> eine Sehnsucht nach dem Göttlichen, deren Intensität,<br />
wie befremdlich das dem Menschen von heute auch vorkommen mag, an die Grenzen seiner<br />
psychischen <strong>und</strong> physischen Belastbarkeit bringen kann.<br />
<strong>Hadewijch</strong> hat sich immer wieder mit dieser schier unbändigen Gewalt der Liebe beschäftigt,<br />
die den frommen Frauen wie ihr selbst sehr vertraut war. Dabei ist der mächtige Antrieb der<br />
Liebe für den Menschen nicht nur wichtig, er ist auch gr<strong>und</strong>sätzlich gut, ist er doch alleine<br />
imstande, der Sehnsucht nach dem Göttlichen jene unendliche Triebkraft zu verleihen, die der<br />
Unendlichkeit des göttlichen Gegenübers am Ende allein gewachsen ist.<br />
<strong>Die</strong> Tugend als Voraussetzung wahrhafter Liebe<br />
Gleichwohl konnte diese leidenschaftliche Sehnsucht nach einer Vereinigung mit dem göttlichen<br />
Geliebten auch Probleme aufwerfen. Dabei interessiert uns hier nur der eine Fall, dass<br />
diese Leidenschaft im frommen Menschen eine moralisch bedenkliche Eigendynamik entwickeln<br />
kann. Schon ca. h<strong>und</strong>ert Jahre vor Meister Eckhart erkannte nämlich <strong>Hadewijch</strong> das<br />
Problem, dass der Mensch auf solche genussvollen Einigungs-Erlebnisse um ihrer selbst willen<br />
aus sein konnte <strong>und</strong> diese dann möglicherweise über alles andere stellt. Eine solche Neigung,<br />
die vor allem auf die Befriedigung eigener affektiver Sehnsüchte schaut, war offensichtlich<br />
auch in den Kreisen der frommen Frauen ein Problem, auf das <strong>Hadewijch</strong> als geistliche<br />
Führerin zu reagieren hatte.<br />
<strong>Hadewijch</strong> weiß zwar, dass die genussvolle Seite liebender Sehnsucht <strong>und</strong> Einigung nicht aus<br />
dem Leben als ganzes ausgeklammert werden darf, soll auch die Liebe als ganze <strong>und</strong> umfassend<br />
wirksame ihr Recht behalten. Aber was bedeutet diese Liebe praktisch, wenn dieses Leben<br />
als ganzes auf eine umfassende Vollendung ausgerichtet ist, auf das also, worauf es<br />
eigentlich ankommt?<br />
Einen Großteil ihres geistigen Wirkens hat sie dieser zentralen Frage gewidmet. Im zehnten<br />
Brief etwa stellt <strong>Hadewijch</strong> dazu in einem knappen Syllogismus fest:<br />
11
„Wer Gott liebt, liebt seine Werke. Seine Werke sind vorzügliche Tugenden. Folglich liebt,<br />
wer Gott liebt, Tugenden.“<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich war in der Theologie des zwölften Jahrh<strong>und</strong>erts die Vorstellung verbreitet, dass<br />
sich die Liebe Gottes in einer Ordnung widerspiegelt, die überall gef<strong>und</strong>en werden kann, die<br />
allerdings auf Seiten des freien Menschen erst einmal hergestellt werden muss. Bei ihm stellt<br />
diese caritas ordinata, die geordnete Liebe, die Gr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> das Ziel zur Vervollkommnung<br />
der Persönlichkeit dar. Und die kann sich auf alles erstrecken, was ihn betrifft, besonders<br />
also auf sein Verhältnis zu den Mitmenschen, zur Natur, zu sich selbst <strong>und</strong> zu Gott.<br />
Für die ersehnte Erfüllung der Liebe bedeutet dies: Wenn die wirklich derjenigen entsprechen<br />
soll, die der Liebende für sich erhofft, dann ist sie an Voraussetzungen geb<strong>und</strong>en, die selbst<br />
im konkreten Leben erfüllt werden müssen. Man kann also nicht die Liebe als Glück erleben<br />
wollen, ohne eine echte Bereitschaft zu zeigen, die Liebe als ethischen Wert im Alltag konkret<br />
zu verwirklichen <strong>und</strong> koste dies selbst den Verzicht auf jegliches vordergründige Glück.<br />
<strong>Hadewijch</strong> ist allerdings eine zu gute Menschenkennerin, als dass sie nicht wüsste, dass der<br />
Mensch Entbehrungen nur schwer erträgt <strong>und</strong> er immer wieder seine ganze Spitzfindigkeit<br />
dafür aufbietet, sich selbst etwas vorzumachen <strong>und</strong> sich auf ein scheinbares Glück einzulassen.<br />
Immer wieder findet <strong>Hadewijch</strong> dazu entlarvende Worte, die nichts von ihrer Brisanz<br />
verloren haben:<br />
Wir haben zu viele Wünsche, uns steht der Sinn zu oft nach Entspannung <strong>und</strong> wir sind zu oft<br />
auf das aus, was uns behagt <strong>und</strong> Ruhe verschafft. Wir sind nicht bereit, (auch nur) irgendein<br />
Ungemach auszuhalten.(...) In der Kirche wollen wir von Gott erfüllt sein, aber zu Hause <strong>und</strong><br />
anderswo wollen wir von allen weltlichen Dingen wissen, ob sie uns von Vorteil sind oder<br />
schaden. (...) Wir wollen durch unbedeutende Liebesdienste zu einem guten Ansehen gelangen,<br />
<strong>und</strong> wir kümmern uns um eine elegante Kleidung, um erlesene Speisen, um schöne Dinge<br />
<strong>und</strong> um profane Vergnügungen, die keiner nötig hat.<br />
Dabei ist <strong>Hadewijch</strong> keine Moralistin. Im Gegenteil zeichnet sich ihr Denken auch hier auf<br />
eine angenehm unmittelalterliche Art dadurch aus, dass sie nicht etwa mit Strafen droht oder<br />
eine äußerliche Bußfertigkeit einfordert. Ihre scharfe Unterscheidung <strong>und</strong> ihre psychologische<br />
Kritik zielen auf Selbsterkenntnis <strong>und</strong> davon ausgehend auf eine Haltung der Person, die auf<br />
Demut gründet. Ja, Selbsterkenntnis <strong>und</strong> Demut sind nach <strong>Hadewijch</strong>s Verständnis sogar die<br />
gr<strong>und</strong>legenden Tugenden, welche die Voraussetzung bilden für die eigentliche Vervollkommnung<br />
der Tugend bzw. eines Lebens gottgefälliger Liebe, was insbesondere etwa eine<br />
gelebte Nächstenliebe mit einschließt.<br />
12
Ein solches Liebesverständnis, welches über einen engen gefühls- <strong>und</strong> selbstbezogen Raum<br />
hinauszugehen vermag <strong>und</strong> eine umfassende personale <strong>und</strong> ethische Vollendung des einzel-<br />
nen Menschen mit einschließt, bleibt das einzig vertretbare Ziel, selbst wenn das die Bereit-<br />
schaft erfordert, auch Leid zu ertragen <strong>und</strong> auf ein vordergründiges Glück zu verzichten.<br />
Auch die moderne Glücksforschung sieht dies ja übrigens inzwischen so: Ein echtes Lebens-<br />
glück beruht nicht auf einem Ende billigen Glücksgefühl, sondern auf einer Lebenskonzep-<br />
tion, die einem umfassenden Qualitätsanspruch gehorcht, wo insbesondere auch ethische<br />
Maßstäbe gelten.<br />
Allerdings bleibt an dieser Stelle immer noch zu fragen, welcher Qualitätsanspruch es denn<br />
ist, der bei <strong>Hadewijch</strong> eine echte Erfüllung <strong>und</strong> Vollendung des Lebens ermöglicht. Oben haben<br />
wir gehört: „Wer Gott liebt, liebt seine Werke. Und diese sind vorzügliche Tugenden.“<br />
Nun, mit diesem Gott der Werke <strong>und</strong> der vorzüglichen Tugend verweist <strong>Hadewijch</strong> hier wie<br />
auch andernorts nicht auf Gottvater, sondern eindeutig auf den Gottessohn. Der Gottmensch<br />
Jesus Christus bildet für <strong>Hadewijch</strong> <strong>und</strong> die frommen Frauen auf neuartige Weise den Inbegriff<br />
der lebenspraktischen Vollendung <strong>und</strong> das absolute Maß der eigenen ethischen <strong>und</strong> personalen<br />
Vollendung. In ihrem sechsten Brief findet sie einprägsame Worte für die neue radikale<br />
Bedeutung des Menschen Jesu im Leben des Gottsuchers:<br />
Wir alle wollen zwar Gott mit Gott sein, doch, weiß Gott, (nur) wenige von uns sind bereit, in<br />
ihrem Leben als Menschen sein Mensch-Sein zu teilen, (nur) wenige sind bereit sein Kreuz mit<br />
Ihm zu tragen, sind bereit mit Ihm am Kreuz zu hängen <strong>und</strong> die Schuld der Menschheit völlig<br />
zu begleichen.<br />
Mit dieser unerhörten Kritik an einer zu kurz greifenden, ja falschen Vorstellung von Vollendung<br />
gibt uns <strong>Hadewijch</strong> einen unmissverständlichen Hinweis darauf, welche Bedeutung<br />
Christus für eine echte gelebte Liebe hat. Sein ganzes irdisches Leben als Gottmensch wurde<br />
nämlich nicht nur von <strong>Hadewijch</strong> als eines vollendeter Liebe begriffen, welches als das lebenspraktische<br />
Vorbild schlechthin dient. <strong>Die</strong> Nachfolge Christi in Wort <strong>und</strong> Tat bildet die<br />
Voraussetzung <strong>und</strong> die Vollendung des Tugendlebens <strong>und</strong> damit auch desjenigen der gelebten<br />
Liebe, die nicht nur von <strong>Hadewijch</strong> bezeichnenderweise als Mutter aller Tugenden verstanden<br />
wurde. Und dass diese Nachfolge ganz konkret ein möglicherweise ziemlich hartes Leben zur<br />
Folge haben konnte, stellt Christus <strong>Hadewijch</strong> in der ersten Vision mit eigenen Worten in<br />
Aussicht:<br />
13
Wenn du mir in meinem Menschsein genauso gleich sein willst, wie du verlangst, die ganze<br />
Gottheit mit mir im Genießen zu teilen, dann musst du danach verlangen, der ärmste, elen-<br />
deste <strong>und</strong> verachtetste von allen Menschen zu sein. Alles Leid soll dir angenehmer sein als<br />
alle irdische Befriedigung. Lasse dich auf keine Weise verdrießen. Denn dieses Leid auszu-<br />
halten übersteigt jedes menschliche Maß.<br />
Es ist dieser radikale <strong>und</strong> unerhört wirkende Anspruch des Gottmenschen an <strong>Hadewijch</strong>, der<br />
für jeden Christen eine f<strong>und</strong>amentale Geltung beansprucht <strong>und</strong> der als Qualitätsanspruch die<br />
existenzielle Gr<strong>und</strong>lage für ein vollendetes Leben bildet, nach der wir oben gefragt haben.<br />
Denn, wenn dieser Anspruch zum tragenden Gr<strong>und</strong> meines Daseins geworden ist, wenn man<br />
sich in Wahrhaftigkeit, in Gerechtigkeit <strong>und</strong> Liebe dem Menschsein ganz stellt, dann verwirklicht<br />
sich im Menschen in gewisser Weise die göttliche Liebe selbst, die auch in der unergründlichen<br />
Einheit <strong>und</strong> Seligkeit Gottes wirkt. <strong>Die</strong>sen Zusammenhang verdeutlicht <strong>Hadewijch</strong><br />
im sechsten Brief mit folgenden Worten:<br />
In Gemeinschaft mit Gottes Menschheit sollst du hier unter Mühsal <strong>und</strong> in (einem Bewusstsein)<br />
der Gottferne leben, doch in Gottes Allmacht <strong>und</strong> Ewigkeit darfst du lieben <strong>und</strong> in seliger<br />
Ergebenheit von innen heraus jubeln. Denn die Wahrheit von ihnen beiden ist ein einziges<br />
Genießen! Und so, wie die Menschheit (Gottes) auf Erden dem Willen der (göttlichen) Majestät<br />
folgte, folge auch du hier in der Einheit der Liebe dem Willen von ihnen beiden. <strong>Die</strong>ne<br />
demütig unter ihrer einig-ungeteilten Herrschaft <strong>und</strong> stehe vor ihnen jederzeit als derjenige<br />
bereit, der ihrem Willen völlig unterworfen ist – <strong>und</strong> lasse sie mit dir machen, was sie wollen!<br />
„Denn die Wahrheit von ihnen beiden ist ein einziges Genießen!“ <strong>Die</strong> erfüllende Liebe in<br />
Gottes Allmacht <strong>und</strong> Ewigkeit, von der <strong>Hadewijch</strong> hier spricht, lässt das zu erduldende Leid<br />
<strong>und</strong> die Gottesferne unseres irdischen Daseins nicht verschwinden. Das eine ist in seiner<br />
Vollendung zwar im anderen aufgehoben. Aber Gottes Wille <strong>und</strong> Liebe erfüllen sich hier auf<br />
Erden eben in einem Leben, das auch <strong>und</strong> gerade in seiner Vollendung der unerbittlichen<br />
Härte nicht ausweicht. Wie es Christus <strong>Hadewijch</strong> gegenüber selbst bek<strong>und</strong>et::<br />
...ich lasse dich eine verborgene Wahrheit über mich wissen, die gleichwohl für den wahrnehmbar<br />
war, der es verstehen konnte: Dass ich mir, in welchem Ungemach ich mich auch<br />
befand, für keinen Augenblick über meine göttliche Macht eine Erleichterung verschaffte <strong>und</strong><br />
dass ich niemals Hilfe aus den Gaben meines Geistes erwartete, außer dass ich sie vor dem<br />
Tag, an dem die St<strong>und</strong>e der Vollendung meines irdischen Daseins kam, durch den Schmerz<br />
des Leidens erwarb, <strong>und</strong> zwar von meinem Vater, mit dem ich ganz <strong>und</strong> gar eins war, wie wir<br />
14
jetzt eins sind. Mein Leid <strong>und</strong> meine Schmerzen habe ich niemals durch meine Vollkommen-<br />
heit gewendet.<br />
Freilich kennt <strong>Hadewijch</strong> im Rahmen ihres Verständnis eines radikalen Lebens der Liebe<br />
auch Augenblicke liebevoller Seligkeit <strong>und</strong> glücklicher Erfüllung. Nur, darauf kommt es eben<br />
nicht an, sondern auf den Grad existenzieller Nachfolge, auch wenn das Glück hier nur paradox<br />
<strong>und</strong> Gott gleichsam nur als abwesender erfahrbar ist. Denn <strong>Hadewijch</strong> weiß: Der „Mangel<br />
des Genießens ist das schönste Genießen.“<br />
Um es noch einmal kurz zusammenzufassen:<br />
Wir tragen die göttliche Liebe, die wir als Glück, Befriedigung <strong>und</strong> Erlösung in der Vereinigung<br />
gleichsam von außen erhoffen <strong>und</strong> erwarten, zwar potenziell in uns. Doch erst, indem<br />
wir ihr durch ein Leben in der Tugend einer konsequenten Nachfolge Christi existenziell zu<br />
ihrem Recht verhelfen, kann die Vereinigung mit der göttlichen Liebe in Wahrheit stattfinden.<br />
<strong>Die</strong>se Liebe ist zwar ohne Illusionen, aber sie darf als einzige alles erhoffen.<br />
Schluss<br />
<strong>Hadewijch</strong> hat das, worüber sie geschrieben hat, soweit wir wissen, wohl selbst radikal gelebt,<br />
ja, diese von einem apostolischen Impetus <strong>und</strong> einer karitativen Leidenschaft durchdrungen<br />
Texte an die ihr Vertrauten liefern dafür ein beredtes Zeugnis. Ihre Schriften stellen dazu ein<br />
einmaliges Dokument christlicher Heiligkeit dar <strong>und</strong> sie zeigen auch, welchen geistigen<br />
Reichtum eine viel zu oft unterdrückte weibliche Geistlichkeit über die Zeit hinweg auch für<br />
uns heute bereithält. Indem diese Schriften ein spirituelles Bekenntnis mit dem Anliegen<br />
geistlicher Unterstützung <strong>und</strong> des Trostes, eine eigenständige theologische Reflexion mit<br />
einem außerordentlichen künstlerischen Niveau zu verbinden wissen, stellen sie nicht zuletzt<br />
auch das Zeugnis einer großen Lehrerin <strong>und</strong> genialen Literatin dar, die ihresgleichen bis in die<br />
Neuzeit hinein sucht.<br />
Kleines kommentiertes Verzeichnis gr<strong>und</strong>legender Literatur:<br />
Devreese, Daniel, Hadewid Greca te Merksem in 1212. Een historische reconstructie van debiografie<br />
van <strong>Hadewijch</strong>, Ons Geestelijk Erf 81 (2010) 151-193. [die neueste Untersuchung<br />
zu <strong>Hadewijch</strong>s Leben; bahnbrechend <strong>und</strong> spannend wie ein Krimi]<br />
15
Ganck, Roger De, Beatrice in her Context, 2 Bde., Kalamazoo 1991 (Cistercian Studies Series<br />
121 <strong>und</strong> 122). [die gründlichste Erschließung der Spiritualität der mulieres religiosae der<br />
jüngsten Vergangenheit]<br />
<strong>Hadewijch</strong>, Buch der Briefe, übersetzt <strong>und</strong> erläutert von Gerald Hofmann, St. Ottilien 2010.<br />
-, Das Buch der Visionen, Teil 1: Einleitung, Text <strong>und</strong> Übersetzung von Gerald Hofmann,<br />
Teil II: Kommentar von G.H., Stuttgart-Bad Cannstatt 1998 (Mystik in Geschichte <strong>und</strong><br />
Gegenwart Abt. 1, Bd. 12 u. 13).<br />
McGinn, Bernard, The Flowering of Mysticism. Men an Women in the New Mysticism, Vol.<br />
III of: The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism, New York 1998.<br />
[auch auf in deutscher Übersetzung erschienen; die wohl beste allgemeine Darstellung der<br />
Frauenmystik im geistesgeschichtlichen Kontext]<br />
Ruh, Kurt, Geschichte der abendländischen Mystik. Bd. II: Frauenmystik <strong>und</strong><br />
Franziskanische Mystik der Frühzeit, München 1993. [noch immer die einzige umfassende<br />
Darstellung der Frauenmystik eines deutschen Wissenschaftlers; z. T. etwas speziell]<br />
Simons, Walter, Cities of Ladies. Beguine Communities in the Medieval Low Countries 1200-<br />
1565, Philadelphia 2001. [das Standardwerk zur Geschichte der Beginenbewegung in den<br />
südlichen Niederlanden; unverzichtbar]<br />
16