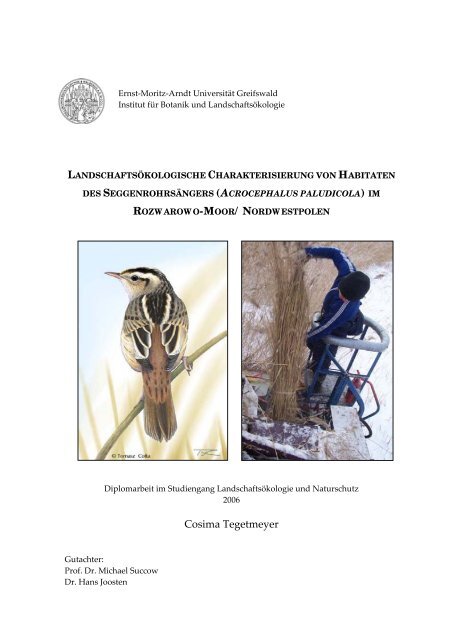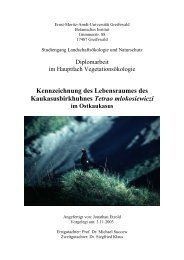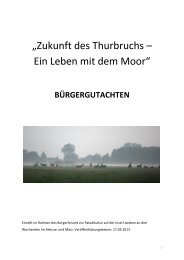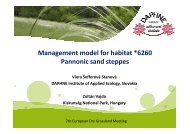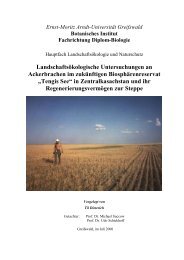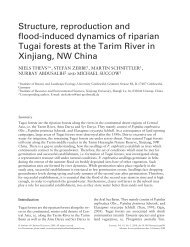Cosima Tegetmeyer - Institut für Botanik und Landschaftsökologie ...
Cosima Tegetmeyer - Institut für Botanik und Landschaftsökologie ...
Cosima Tegetmeyer - Institut für Botanik und Landschaftsökologie ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Botanik</strong> <strong>und</strong> <strong>Landschaftsökologie</strong><br />
LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG VON HABITATEN<br />
DES SEGGENROHRSÄNGERS (ACROCEPHALUS PALUDICOLA) IM<br />
ROZWAROWO-MOOR/ NORDWESTPOLEN<br />
Diplomarbeit im Studiengang <strong>Landschaftsökologie</strong> <strong>und</strong> Naturschutz<br />
2006<br />
Gutachter:<br />
Prof. Dr. Michael Succow<br />
Dr. Hans Joosten<br />
<strong>Cosima</strong> <strong>Tegetmeyer</strong><br />
Foto: W. Wichtmann
“ ich bin ein klein wild Vögelein<br />
<strong>und</strong> niemand kann mich zwingen”<br />
-Volkslied aus Siebenbürgen-
Danke ... Dziekuje<br />
In erster Linie danke ich Franziska Tanneberger <strong>für</strong> den Vorschlag zum Thema der Arbeit<br />
<strong>und</strong> deren Betreuung, die Bereitstellung von etlichen Kilogramm Literatur, von Bildern,<br />
Daten usw., <strong>für</strong> fachliche <strong>und</strong> logistische Hilfe sowie Korrekturlesen <strong>und</strong> seelischmoralische<br />
Unterstützung. Wahnsinn. Danke.<br />
Ich danke Prof. Michael Succow <strong>und</strong> Dr. Hans Joosten <strong>für</strong> meine Ausbildung <strong>und</strong> die<br />
fachliche Betreuung der Diplomarbeit.<br />
Der ganzen Familie Smolczynski möchte ich <strong>für</strong> ihre Gastfre<strong>und</strong>schaft <strong>und</strong> Hilfe danken,<br />
so war es mir möglich gewesen, während der Feldarbeit in Polen in direkter Nachbarschaft<br />
zum Rozwarowo-Moor zu leben. Dziekuje za pomoc!<br />
Vielen Dank an Pan Smolczynski, Pan Radne <strong>und</strong> Pan Piatkowski <strong>für</strong> ihr Interesse am<br />
Seggenrohrsänger <strong>und</strong> der Naturschutzarbeit in Rozwarowo sowie <strong>für</strong> die stets bereitwilligen<br />
Auskünfte über das Rozwarowo-Moor <strong>und</strong> das Gewerbe der Rohrwerbung.<br />
Marek Dylawerski danke ich <strong>für</strong> Informationen (Karten <strong>und</strong> Daten) über das Untersuchungsgebiet<br />
<strong>und</strong> die Möglichkeit, bei der Frühjahrszählung 2006 mitzuwirken <strong>und</strong> dabei<br />
Seggenrohrsänger zu beobachten.<br />
Ulrich Möbius danke ich <strong>für</strong> die Bereitstellung der Arbeitsgeräte <strong>und</strong> die Betreuung im<br />
Bodenlabor.<br />
Vielen Dank auch an Jan Peper <strong>für</strong> Transportlogistik, die Mithilfe bei den Torfbohrungen<br />
<strong>und</strong> <strong>für</strong> das Näherbringen der Mysterien von „ MS Word“.<br />
Ein Dankeschön geht an Nele Friedrich <strong>für</strong> emsigstes Korrekturlesen <strong>und</strong> <strong>für</strong> Mathe.<br />
Libi! Thank you for giving me so much energy and renovating my back.<br />
Und vielen Dank an meine Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> meine Familie da<strong>für</strong>, dass es Euch gibt.
Hiermit erkläre ich, die vorliegende Diplomarbeit mit dem Thema:<br />
„Landschaftsökologische Charakterisierung von Habitaten des Seggenrohrsängers (Acrocephalus<br />
paludicola) im Rozwarowo- Moor/Nordwestpolen“<br />
selbstständig verfasst <strong>und</strong> keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen verwendet zu<br />
haben. Aus anderen Werken in Wortlaut oder Sinngehalt entnommene Inhalte sind durch<br />
Angaben der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht.<br />
Greifswald, 21.12.2006<br />
<strong>Cosima</strong> <strong>Tegetmeyer</strong><br />
Kontakt:<br />
<strong>Cosima</strong> <strong>Tegetmeyer</strong><br />
Wolgaster Landstr. 6<br />
17493 Greifswald<br />
cosimat@gmx.de
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einleitung <strong>und</strong> Fragestellung 1<br />
2 Der Seggenrohrsänger 3<br />
2.1 Charakterisierung der Art <strong>und</strong> ihres Lebensraumes 3<br />
2.2 Weltweite Verbreitung <strong>und</strong> Populationsgröße 5<br />
2.3 Gefährdungsursachen 8<br />
2.4 Schutzmaßnahmen 9<br />
3 Untersuchungsgebiet 11<br />
3.1 Lage 11<br />
3.3 Klima 12<br />
3.2 Ausgangsgestein <strong>und</strong> Relief 12<br />
3.4 Wasserverhältnisse 16<br />
3.5 Landnutzungsgeschichte <strong>und</strong> aktuelle Vegetation 16<br />
3.6 Seggenrohrsängerbestand 17<br />
3.7 Schutzstatus 19<br />
4 Methoden 20<br />
4.1 Stratigraphie 20<br />
4.2 Abiotische Standortsfaktoren 20<br />
4.3 Vegetation 22<br />
4.5 Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik 24<br />
5 Ergebnisse 25<br />
5.1 Moorstratigraphie 25<br />
5.2 Abiotische Standortsfaktoren 27<br />
5.3 Vegetation 32<br />
5.3.1 Vegetationsformen 32<br />
5.3.2 Vegetationsstruktureinheiten (VSE) 36<br />
5.3.3 Weitere Kartiereinheiten 42<br />
5.3.4 Vegetationskarte 42<br />
6 Diskussion 43<br />
6.1 Kennzeichnung des Rozwarowo Moor 43<br />
6.1.1 Genese 43<br />
6.1.2 Ökologischer <strong>und</strong> hydrogenetischer Moortyp 46<br />
6.2 Bioindikation 46<br />
6.3 Einfluss der Nährstoffverhältnisse auf die Vegetation 47<br />
6.4 Einflußfaktoren auf die Ansiedlung des Seggenrohrsängers 49<br />
6.4.1 Vegetation 49<br />
6.4.2 Anforderungen an den Wasserstand 55<br />
6.5 Einfluß der Rohrwerbung auf die Entwicklung der Flächen 57<br />
6.6 Schutzmaßnahmen im Rozwarowo-Moor 60<br />
7 Zusammenfassung 63<br />
8 Summary 66<br />
9 Literaturverzeichnis 69
Abkürzungsverzeichnis<br />
AG Artengruppe nach Koska et al. (2001)<br />
Absch. Abschnitt<br />
BP before present (C-14 -Datierung: C-14 Jahre vor 1950)<br />
CBD Convention on Biological Diversity<br />
CMS Convention on Migratory Species<br />
DCA Detrended Correspondence Analysis<br />
Deck. Deckung<br />
dt. deutsch<br />
EU Europäische Union<br />
FFH Flora Fauna Habitat<br />
g. gemäht<br />
geb. ausgebaggert<br />
GOF Geländeoberfläche<br />
GesDeck. Gesamtdeckung<br />
IBA Important Bird Area (gemäß Artikel 4 der EU-Vogelschutzrichtlinie)<br />
IQA Interquantilabstand<br />
Ind. Individuum<br />
indet. indeterminiert<br />
IUCN International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources<br />
Jh. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
k Trophiestufe: kräftig<br />
K Küstenüberflutungsregime<br />
K1-6 Konsistenzklassen der Mudden nach Stegmann et al. (2001)<br />
ka kalkhaltig<br />
KS1 Krautschicht 1<br />
KS2 Krautschicht 2<br />
KV Kernverlust<br />
m Trophiestufe: mittel<br />
mS Mittelsand<br />
MoU Aquatic Warbler Memorandum of Understanding and Action Plan<br />
MS Moosschicht<br />
NLP Nationalpark<br />
n.g. nicht gemäht<br />
o.ä. oder Ähnliches<br />
Phr. Phragmites australis<br />
Phr.+ abgestorbenes Phragmites australis<br />
r Trophiestufe: reich<br />
s Trophiestufe: sehr reich<br />
sM singende(s) Männchen<br />
SPA Special Protection Area (gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie)<br />
Stet. Stetigkeit<br />
sub subneutral<br />
subsp. Unterart<br />
T Topogenes Wasserregime
U Schluff<br />
Us sandiger Schluff<br />
u. <strong>und</strong><br />
VF Vegetationsform nach Koska et al. (2001)<br />
za Trophiestufe: ziemlich arm<br />
∅ durchschnittlich, im Durchschnitt<br />
Namensverzeichnis<br />
polnisch deutsch<br />
Bagna Rozwarowskie Rozwarowo-Moor<br />
Buszęcin Büssenthin<br />
Dusin Düssin<br />
Dziwna Dievenow<br />
Grzybnica Fauler Bach<br />
Jez. Piaski Paatziger See<br />
Kamień Pomorski Cammin<br />
Powiat Kamieński Kreis Cammin<br />
Rekowo Reckow<br />
Rozwarowo Ribbertow<br />
Skarchowo Scharchowo<br />
Szczecin Stettin<br />
Warnowo Warnow<br />
Wołczenica Völzer Bach<br />
Zalew Kamieńskie Camminer Bodden
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 2.1: Der Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola) 3<br />
Abb. 2.2: Beispiele <strong>für</strong> mesotrophe Seggenrohrsänger-Habitate 5<br />
Abb. 2.3: Beispiele <strong>für</strong> eutrophe Seggenrohrsängerhabitate 5<br />
Abb. 2.4: Die Verbreitung des Seggenrohrsängers in der Brutsaison 7<br />
Abb. 2.5: Weltbestand des Seggenrohrsängers (sM) 7<br />
Abb. 3.1: Lage des Untersuchungsgebietes 11<br />
Abb. 3.2: Klimadiagramme von Szczecin <strong>und</strong> Ueckermünde 12<br />
Abb. 3.3: Topographische Karte des Untersuchungsgebietes (1:25000) 14<br />
Abb. 3.4: Geologische Übersichtskarte des Kreises Cammin 15<br />
Abb. 3.5: Grenzen des Vogelschutz-Gebietes <strong>und</strong> des EU-LIFE-Projektgebietes 18<br />
Abb. 3.6: Seggenrohrsängerbestand (sM) im Rozwarowo-Moor 1991-2006 19<br />
Abb. 4.1: Lage der Bohrpunkte im Untersuchungsgebiet 21<br />
Abb. 5.1: Beispiele <strong>für</strong> Bohrprofile 26<br />
Abb. 5.2: Medianwerte C/N-Verhältnisse in den einzelnen Kartiereinheiten 28<br />
Abb. 5.3: DCA-Ordinationsdiagramm: Streudiagramm der Vegetationsaufnahmen<br />
<strong>und</strong> gemessenen Standortparameter (pH-Wert, C/N-Verhältnis, Wasserstand<br />
über GOF, Bewirtschaftung) 30<br />
Abb. 5.4: DCA-Ordinationsdiagramm: Streudiagramm der Vegetationsaufnahmen<br />
<strong>und</strong> Standortparameter (Höhe KS1, Höhe KS2, Höhe Phr., Deck. MS, Deck.<br />
Streu, GesDeck., Deck. KS1, Deck. KS2, Deck. Phr., Deck Phr.+,<br />
Wasserstand über GOF) 31<br />
Abb. 5.5: Schilfbestände der eutrophen Grabenränder 37<br />
Abb. 5.6: Schilfbestände mit Thelypteris palustris 37<br />
Abb. 5.7: Schilfbestände mit hohem Seggenanteil 38<br />
Abb. 5.8: reine Schilfbestände 39<br />
Abb. 5.9: Schilfbestände mit hohem Seggenanteil 40<br />
Abb. 5.10: niedrige schilffreie Vegetation 40<br />
Abb. 5.11: Vegetation der Gräben 42<br />
Abb. 6.1: Lage des Idealprofilschnitts im Zentrum des Rozwarowo-Moors 43<br />
Abb. 6.2: Idealprofilschnitt im Zentrum des Rozwarowoer Moors (W-O) 44<br />
Abb. 6.3: Medianwerte der Höhe <strong>und</strong> Deckung der Vegetation der Kartiereinheiten 51<br />
Abb. 6.4: Vergleich der Vegetationsverhältnisse 1993 <strong>und</strong> 2005 53<br />
Abb. 6.5: Vergleich der ornithologischen Kartierung der Jahre 1993 <strong>und</strong> 2003-2006<br />
mit der Vegetationskarte vom Juli 2005 55<br />
Abb. 6.6: Schilfmahd im Januar 2006 in Rozwarowo 57<br />
Abb. 6.7: Vergleich von „first class“ <strong>und</strong> „second class reed” 58<br />
Abb. 6.8: Aktuelle <strong>und</strong> potenzielle Seggenrohrsängerhabitate im Rozwarowo-Moor 61
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 2.1: Internationale Konventionen <strong>und</strong> Abkommen 9<br />
Tab. 3.1: Deckungsgrad- <strong>und</strong> Stetigkeitsskala 23<br />
Tab. 5.1: pH-Verhältnisse der Vegetationsstruktureinheiten 27<br />
Tab. 5.2: C/N-Verhältnisse der Vegetationsstruktureinheiten 28<br />
Tab. 5.3: Trophiestufen 29<br />
Tab. 5.4: Übersichtstabelle der Vegetationstypen im Rozwarowo-Moor 34<br />
Tab. 6.1: Vergleich der „Interessen“ von Schilfbauern <strong>und</strong> Seggenrohrsänger<br />
im Untersuchungsgebiet 59<br />
Tab. A9: Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Test (zweiseitig)<br />
Tab. A10: Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Test (zweiseitig)<br />
Tab. A11: Messwerte der C/N-Verhätnisse <strong>und</strong> der pH-Werte
Einleitung <strong>und</strong> Fragestellung 1<br />
1 Einleitung <strong>und</strong> Fragestellung<br />
Der Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola) galt in Europa noch bis Anfang des 20. Jh.<br />
als häufiger Vogel der Niedermoore. Mit der großflächigen Zerstörung seines Lebens-<br />
raumes durch Entwässerung <strong>und</strong> die Intensivierung der Landwirtschaft kam es Mitte des<br />
20. Jh. zu einer dramatischen Bestandsabnahme. Heute gilt der Seggenrohrsänger als glo-<br />
bal bedroht (Aquatic Warbler Conservation Team 1999). Die Weltpopulation umfasst der-<br />
zeit noch 13.330-18.925 singende Männchen (sM) (Aquatic Warbler Conservation Team<br />
2006a).<br />
Gegenstand dieser Arbeit ist das Seggenrohrsänger-Brutgebiet „Rozwarowo-Moor“ in<br />
Nordwestpolen. Das dortige Brutvorkommen ist das Größte der der hochgradig gefährde-<br />
ten Pommerschern Population, der westlichsten der drei Teilpopulationen der Art (Aqua-<br />
tic Warbler Conservation Team 1999).<br />
Im Rozwarowo-Moor wird Schilf (Phragmites australis) <strong>für</strong> die Dachdeckerei gewonnen.<br />
Die Privatisierung des Moorgebietes 1994 <strong>und</strong> Intensivierung der Schilfwerbung stießen<br />
auf die Kritik polnischer Naturschützer. Tatsächlich sank der Seggenrohrsängerbestand<br />
nach Beginn der kommerziellen Rohrwerbung von 60 sM im Jahr 1991 auf 37 sM im Jahr<br />
2006 (Dylawerski mdl.). Seit 2006 wird in Rozwarowo ein EU-LIFE-Projekt durchgeführt,<br />
in welchem die Verbesserung der Lebensbedingungen <strong>für</strong> die Art experimentell auf Teil-<br />
flächen erprobt wird.<br />
Für die vorliegende Arbeit stellte sich folgende Frage:<br />
Ist die Rohrwerbung mit dem Schutz des Seggenrohrsängers vereinbar <strong>und</strong> welche Maß-<br />
nahmen müssen ergriffen werden um das Rozwarowo-Moor langfristig als Seggenrohr-<br />
sänger Brutgebiet zu sichern?<br />
Zur Beantwortung der Fragestellung wurden folgende Aufgaben bearbeitet:<br />
- Beschreibung der Moorgenese <strong>und</strong> Landnutzungsgeschichte, sowie abiotischer<br />
Standortfaktoren als Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die Bewertung von Entwicklungsfähigkeit <strong>und</strong><br />
Nutzung der Flächen;
2 Einleitung <strong>und</strong> Fragestellung<br />
- Erfassung der aktuellen Vegetation <strong>und</strong> Erstellung einer Vegetationskarte des un-<br />
tersuchten Gebietes;<br />
- Einschätzung der Untersuchungsflächen hinsichtlich ihrer Eignung als Bruthabitat<br />
<strong>für</strong> den Seggenrohrsänger <strong>und</strong> Ableitung von möglichen Schutzmaßnahmen.
Der Seggenrohrsänger 3<br />
2 Der Seggenrohrsänger<br />
2.1 Charakterisierung der Art <strong>und</strong> ihres Lebensraumes<br />
Der Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola) (Abb. 2.1) gehört zur Familie der Grasmü-<br />
cken (Sylviidae), welche der großen Ordnung der Singvögel (Passeriformes) zuzuordnen<br />
ist.<br />
Er wiegt 10-14 g <strong>und</strong> ist ca. 13 cm groß, wobei die Flügellänge 6-7 cm beträgt. Das Gefie-<br />
der besitzt eine gelbbraune Gr<strong>und</strong>farbe. Im Gegensatz zum sehr ähnlichen Schilfrohrsän-<br />
ger weist der Seggenrohrsänger zwei scharf abgegrenzte dunkle Längsstreifen am Kopf<br />
<strong>und</strong> ein kontrastreich gestreiftes Rückengefieder auf. Der Gesang ist einfach strukturiert,<br />
mit kurzen „errr-didi“ <strong>und</strong> „trtrtr-jüjü“ Rufen (Schulze-Hagen 1991).<br />
Im Gegensatz zu allen anderen Rohrsängern tritt bei der Fortpflanzung von Acrocephalus<br />
paludicola multiple Vaterschaft auf (Schulze-Hagen et al. 1993). Dabei paart sich das Weib-<br />
chen mit mehreren Männchen, so dass die Brut eines Geleges von mehreren Männchen<br />
abstammen kann. Auf Gr<strong>und</strong> der fehlenden Paarbindung wird die Populationsgröße ei-<br />
nes Gebietes nur anhand der Anzahl singender Männchen bestimmt <strong>und</strong> angegeben.<br />
Männchen wie Weibchen besetzten keine Reviere, da die genutzten Areale nicht vertei-<br />
digt werden. Die ca. 8 ha (Schulze-Hagen et al. 1999) großen, teilweise überlappenden<br />
Aufenthaltsräume werden von den Männchen auch während ihres Aufenthaltes im Brut-<br />
gebiet gewechselt. Die der Weibchen überschneiden sich ebenfalls. Deren Größe variiert<br />
während der Paarungszeit zwischen 2,8-6,4 ha <strong>und</strong> beträgt zur Brutzeit 1,6 ha (Schaefer et<br />
al. 2000).<br />
Abb. 2.1: Der Seggenrohrsänger-<br />
Acrocephalus paludicola<br />
Foto: A. Kozulin
4 Der Seggenrohrsänger<br />
Nestbau <strong>und</strong> Brutpflege werden vom Weibchen übernommen. Die Nester werden auf<br />
Bulten oder auf trockenem Boden gebaut (Schulze-Hagen 1991).<br />
Der Seggenrohrsänger brütet zweimal jährlich, im Mai <strong>und</strong> im Juli, zumeist an verschie-<br />
denen Standorten. Das Weibchen legt drei bis sechs Eier. Wahrscheinlich sind auf Gr<strong>und</strong><br />
der alleinigen Brutpflege des Weibchens eine lange Brutzeit, kurze Nahrungsflüge, eine<br />
hohe Fütterungsfrequenz, verzögerte Nestlingsentwicklung, sowie ein später Ausflug der<br />
Jungvögel charakteristisch (Schulze-Hagen et al. 1999).<br />
Der Seggenrohrsänger ist eine stenotope Art <strong>und</strong> brütet in ausgedehnten nassen Großseg-<br />
genrieden. Aufgr<strong>und</strong> der besonderen Fortpflanzungsform der multiplen Vaterschaft<br />
kommt der Seggenrohrsänger im Brutgebiet nur in Gruppen vor <strong>und</strong> es ist ihm nicht<br />
möglich kleine Feuchtgebiete unter 100 ha Ausdehnung zu besiedeln (Heise (1974) ,<br />
Kozulin (1999) <strong>und</strong> Kozulin & Flade (1999)).<br />
Als optimales Bruthabitat gelten Flächen mit einer homogenen Vegetation von 60-70 cm<br />
(Mai) Wuchshöhe (Kozulin & Flade 1999). Zu dichte, sehr hohe oder verbuschte Vegetati-<br />
on <strong>und</strong> Flächen ohne eine geringmächtige Schicht aus abgestorbener Vegetation des Vor-<br />
jahres werden wegen ungünstiger Nistplatz- <strong>und</strong> Nahrungsverhältnisse gemieden<br />
(Schulze-Hagen 1991). Dabei sollte der Untergr<strong>und</strong> nass oder mäßig hoch (bis ca. 15 cm)<br />
(Kozulin et al. 2004) überflutet sein <strong>und</strong> während der Sommermonate sollte der Wasser-<br />
spiegel nicht mehr als 50 cm unter die GOF fallen (Kozulin & Flade 1999).<br />
Solche speziellen Habitatverhältnisse finden sich vor allem in mesotrophen bis leicht eu-<br />
trophen Niedermooren (Kozulin & Flade 1999) <strong>und</strong> entsprechen nach Succow (2001) dem<br />
ökologischen Moortyp der subneutralen Basen-Zwischenmoore (Abb.2.2). Als primäre<br />
Habitate des Seggenrohrsängers werden daher Durchströmungsmoore, als die Zentren<br />
von großen Flußtalmooren <strong>und</strong> meso- bis leicht eutrophe Verlandungs-bzw. Ver-<br />
sumpfungsmoore angesehen (vgl. Joosten & Succow (2001)).<br />
Als Sek<strong>und</strong>ärhabitate gelten <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger eutrophe Feuchtgebiete, wie z.B.<br />
der NLP „Unteres Odertal“, das letzte Brutgebiet in Deutschland. Hier siedelt sich die Art<br />
jedoch nur bei regelmäßiger Bewirtschaftung (Mahd, Beweidung) an (Tanneberger et al.<br />
(2005) Tanneberger et al. (in Vorbereitung))(Abb. 2.3).
Der Seggenrohrsänger 5<br />
Abb. 2.2: Beispiele <strong>für</strong> mesotrophe Seggenrohrsänger-habitate<br />
links: Zvanets-Moor, Belarus; rechts: Pripiat-Moor, Urkaine (Fotos: M. Flade)<br />
Abb. 2.3: Beispiele <strong>für</strong> eutrophe Seggenrohrsängerhabitate<br />
links: NLP „Unteres Odertal“ Bewirtschaftung durch Mahd, rechts: NLP „Unteres Odertal“, Bewirtschaftung<br />
durch intensive Beweidung ab August (Fotos: F. Tanneberger)<br />
2.2 Weltweite Verbreitung <strong>und</strong> Populationsgröße<br />
Der Gesamtbestand wird derzeit auf 13.330-18.925 sM (Aquatic Warbler Conservation<br />
Team 2006a) geschätzt. Bis in die 1930er Jahre war der Seggenrohrsänger noch in Frank-<br />
reich, den Niederlanden, im westlichen Teil Deutschlands, Österreich, Italien, Rumänien<br />
<strong>und</strong> auf dem Balkan verbreitet (Schulze-Hagen 1991). Heute wird er in diesen Ländern<br />
nur noch auf dem Durchzug nachgewiesen.<br />
Der Seggenrohrsänger brütet heute noch in acht Ländern: Weißrussland, Polen, Ukraine,<br />
Ungarn, Russland, Deutschland, Litauen <strong>und</strong> Lettland. Das gesamte Vorkommen kann in<br />
drei, geographisch <strong>und</strong> teilweise genetisch isolierte Populationen aufgeteilt werden<br />
(Abb.2.4). Die in Klammern angegebenen Populationsgrößen (Anzahl sM) ergeben sich
6 Der Seggenrohrsänger<br />
aus dem geometrischen Mittel der Anzahl singender Männchen in den Jahren 1996-2005<br />
in den jeweiligen Brutgebieten. (alle Daten: Aquatic Warbler Conservation Team (2005)):<br />
1. Die Zentraleuropäische 1 Population (ca. 16000 sM).<br />
Hierzu zählen die Vorkommen in Weißrussland, Ostpolen, Ukraine, Litauen, Lett-<br />
land <strong>und</strong> eine geographisch isolierte Teilpopulation in Ungarn (ca. 600 sM). In<br />
Weißrussland wurden erst 1995 ca. 60 % des Gesamtbestandes des Seggenrohr-<br />
sängers entdeckt. 80 % des Weltbestandes konzentrieren sich auf nur fünf Brutge-<br />
biete (Zvanets, Dikoe, Yaselda, Oberer Pripiat –alle Weißrussland <strong>und</strong> Biebrza in<br />
Polen) (Schäffer & Schäffer 1999).<br />
2. Die Pommersche Population (ca. 145 sM).<br />
Zur pommerschen Population zählt man die Vorkommen entlang der deutsch-<br />
polnischen Grenze. Davon liegen sechs Brutgebiete in Westpolen <strong>und</strong> das einzige<br />
deutsche Brutgebiet im Nationalpark „Unteres Odertal“ (Tanneberger et al. 2005).<br />
Sie ist derzeit am stärksten gefährdet. Sie sank zwischen 1996 <strong>und</strong> 2005 um r<strong>und</strong><br />
zwei Drittel, von 250 auf 80 singende Männchen. Dieses Vorkommen stellt wahr-<br />
scheinlich den Rest einer ehemals großen (> zehntausend Individuen) genetisch i-<br />
solierten westlichen Population dar. Gr<strong>und</strong> zu dieser Annahme liefern historische<br />
Daten, genetische Untersuchungen (Giessing 2002) <strong>und</strong> Spurenelementanalysen<br />
von Seggenrohrsängerfedern (Pain et al. 2004). Aufgr<strong>und</strong> ihrer isolierten Stellung<br />
ist der Schutz dieser kleinen Population von großer Bedeutung <strong>für</strong> die intraspezifi-<br />
sche Diversität der Art.<br />
3. Die Sibirische Population (ca. 160 sM).<br />
Die Sibirische Population ist wahrscheinlich auf ein Ausweichen eines Teils der<br />
europäischen Population um 1960 in dieses Gebiet zurückzuführen. Ursache hier-<br />
<strong>für</strong> ist vermutlich der verstärkte Verlust an Lebensräumen infolge der Komplex-<br />
melioration in den frühen 1960iger Jahren („GULAG“ Hypothesis) (Aquatic Warb-<br />
ler Conservation Team 2005).<br />
1 Europa wird hier geographisch definiert, d.h. der Ural bildet die Ostgrenze.
Der Seggenrohrsänger 7<br />
Über die Überwinterungsgebiete des Seggenrohrsängers ist noch wenig bekannt. Er ist ein<br />
Fernzieher <strong>und</strong> überwintert nördlich des Äquators im tropischen Westafrika (z.B. Senegal,<br />
Mali) (Schäffer et al. 2006). Dort findet man ihn in den europäischen Burtgebieten ähneln-<br />
den Habitaten. Das sind vor allem Carex-, Phragmites- <strong>und</strong> Juncusgesellschaften in Mooren,<br />
an Fließgewässern, Seen <strong>und</strong> Brackwasserlagunen.<br />
2<br />
1<br />
Abb. 2.4: Die Verbreitung des Seggenrohrsängers in der Brutsaison.<br />
(Aquatic Warbler Conservation Team 2005) 1. Zentraleuropäische Population 2. Pommersche Population<br />
3. Sibirische Population<br />
Land<br />
Anzahl sM<br />
min max<br />
Lettland 0 3<br />
Deutschland 7 33<br />
Russland 50 500<br />
Litauen 160 320<br />
Ungarn 386 700<br />
Ukraine 1260 4235<br />
Polen 2634 3448<br />
Weißrussland 7009 11354<br />
Gesamt 13330 18925<br />
Gesamt<br />
Weißrussland<br />
Polen<br />
Ukraine<br />
Ungarn<br />
Lit auen<br />
Russland<br />
Deut schland<br />
Let t land<br />
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000<br />
3<br />
max<br />
mi n<br />
Anzahl sM<br />
Abb. 2.5: Weltbestand des Seggenrohrsänger (sM) 1996-2006<br />
Angegeben werden die Minimal- <strong>und</strong> Maximalgröße der Populationen in den einzelnen Staaten.<br />
(Aquatic Warbler Conservation Team 2006a)
8 Der Seggenrohrsänger<br />
2.3 Gefährdungsursachen<br />
Der Seggenrohrsänger ist heute als einziger Singvogel des europäischen Festlandes global<br />
bedroht. Die Art ist auf globaler <strong>und</strong> europäischer Ebene als „vulnerable“ („high risk of<br />
extinction in the wild“; (BirdLife International 2004b; BirdLife International 2004a)) einge-<br />
stuft. Die Roten Liste von Deutschland führt ihn in der Kategorie „1“ als vom Aussterben<br />
bedroht (Binot & et al. 2006).<br />
Hauptursache <strong>für</strong> die starken Bestandseinbrüche <strong>und</strong> das teilweise Aussterben des Seg-<br />
genrohrsängers im gesamten Verbreitungsgebiet ist die Zerstörung seines Lebensraums.<br />
Da der Seggenrohrsänger vorrangig in Flusstalmooren vorkommt, welche relativ leicht zu<br />
entwässernde Feuchtgebiete darstellen, wurde schon Anfang des 19. Jh. damit begonnen,<br />
diese <strong>für</strong> die Landwirtschaft zu kultivieren (vgl. (Dreyer 1913)). Beispielsweise wurden in<br />
Weißrussland seit 1960 90 % der geeigneten Habitate durch Entwässerung, Torfabbau<br />
<strong>und</strong> Urbarmachung zerstört (Kozulin & Flade 1999).<br />
In Europa erreichte die Entwässerung <strong>und</strong> Kultivierung dieser Standorte ihren Höhe-<br />
punkt mit der Komplexmelioration der sechziger Jahre <strong>und</strong> die Lebensräume von Acro-<br />
cephalus paludicola verschwanden großflächig, was zum extremen Rückgang des Seggen-<br />
rohrsängers in den westeuropäischen Staaten führte.<br />
Die verbliebenen Brutgebiete des Seggenrohrsängers sind trotz der Einrichtung großer<br />
Schutzgebiete bedroht. Die diesjährige Zerstörung von Moorgebieten durch Drainage in<br />
der Pripiat-Aue, Ukraine, führte zu einer fünffachen Abnahme der dortigen Seggenrohr-<br />
sängerbestände <strong>und</strong> es wird erwartet, dass der Seggenrohrsänger diese Gebiete in Zu-<br />
kunft nicht mehr aufsuchen wird. (Aquatic Warbler Conservation Team 2006b). Eine wei-<br />
tere Bedrohung stellen Brände dar, welche wie in Weissrussland (Zvanets <strong>und</strong> Yaselda),<br />
Polen (Biebrza) <strong>und</strong> Ungarn besonders im Frühjahr auf, als Weideland genutzten Mooren<br />
gelegt werden (Aquatic Warbler Conservation Team 2006a). Anhaltende Bedrohungen <strong>für</strong><br />
die Seggenrohrsängerhabitate (Kozulin & Flade 1999) besonders in Polen <strong>und</strong> Weißruss-<br />
land sind die Aufgabe traditioneller agrarischer Nutzungsformen (Mahd, Beweidung)<br />
<strong>und</strong> der daraus resultierenden Verschilfung, Verbuschung <strong>und</strong> Wiederbewaldung der<br />
Flächen, sowie die Wasserverschmutzung <strong>und</strong> -eutrophierung durch die Landwirtschaft.<br />
Damit verb<strong>und</strong>en ist eine hohe Vegetationsdichte <strong>und</strong> starke Akkumulation von altem<br />
Pflanzenmaterial aufgr<strong>und</strong> fehlender Mahd oder Beweidung. Diese scheinen sich negativ
Der Seggenrohrsänger 9<br />
auf das Nahrungsangebot <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger auszuwirken, der aufgr<strong>und</strong> seiner<br />
uniparentalen Brutpflege auf eine besonders gute Nahrungsgr<strong>und</strong>lage angewiesen ist (F.<br />
Tanneberger mdl.).<br />
Auch in Afrika sind Feuchtgebiete zunehmend von Landwirtschaft <strong>und</strong> Tourismus be-<br />
droht, daher gilt es zur Unterstützung der europäischen Schutzbemühungen, die Über-<br />
winterungsgebiete des Seggenrohrsängers zu lokalisieren <strong>und</strong> zu sichern (Schäffer et al.<br />
2006).<br />
2.4 Schutzmaßnahmen<br />
Der Schutz des Seggenrohrsängers soll auf internationaler <strong>und</strong> nationaler Ebene durch<br />
mehrere Konventionen <strong>und</strong> Abkommen gewährleistet werden (siehe Tab. 2.1). In<br />
Deutschland <strong>und</strong> Polen wird der Seggenrohrsänger in den Roten Listen als „vom Aus-<br />
sterben bedroht“ eingestuft (Aquatic Warbler Conservation Team 1999). Er wird durch<br />
das Gesetz zum Schutz wild lebender Tiere <strong>und</strong> Pflanzen § 41 <strong>und</strong> § 42 BNatSchG sowie<br />
die B<strong>und</strong>esartenschutzverordnung-BArtSchV geschützt. Auch in Polen besteht ein gesetz-<br />
licher Schutz <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger. Dort unterliegen seine Brutgebiete verschiedenen<br />
Schutzformen: Nationalpark, Naturreservat, Landschaftspark. Alle weiteren Brutgebiete,<br />
die nicht national geschützt werden, liegen in IBAs <strong>und</strong> werden jetzt durch das Netzwerk<br />
„Natura 2000“ erfasst. Heute stehen Moorökosysteme in Europa durch die FFH-Richtlinie<br />
größtenteils unter Schutz.<br />
Tab. 2.1: Internationale Konventionen <strong>und</strong> Abkommen<br />
Aufgeführt sind hier internationale Naturschutzkonventionen, von denen der Seggenrohrsänger erfasst<br />
wird <strong>und</strong> Abkommen, die speziell <strong>für</strong> seinen Schutz geschlossen wurden (Aquatic Warbler Conservation<br />
Team 2003).<br />
Abkommen Bemerkung<br />
Bonner Konvention CMS (1979)<br />
Aquatic Warbler MoU (2003)<br />
Gemeinsame Absichtserklärung zum Schutz des<br />
Seggenrohrsängers (15 Staaten )<br />
EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EGW) Anhang I, Netzwerk Natura 2000<br />
Berner Konvention (1979) Anhang II
10 Der Seggenrohrsänger<br />
So entstehen beispielsweise in Deutschland im Zuge der derzeitigen Revitalisierungs-<br />
maßnahmen ehemals landwirtschaftlich genutzter Moorflächen eu- <strong>und</strong> polytrophe<br />
Feuchtgebiete, welche sich erst nach Jahrzehnten wieder zu torfspeichernden Ökosyste-<br />
men <strong>und</strong> wahrscheinlich Jahrh<strong>und</strong>erten zu mesotrophen Standorten wandeln werden<br />
(Succow 2002). Kurz- <strong>und</strong> mittelfristig können so keine neuen natürlichen Lebensräume<br />
<strong>für</strong> den Seggenrohrsänger geschaffen werden. Eine kurzfristige Schaffung von Ersatzle-<br />
bensräumen ist wahrscheinlich nur durch gezielte Managementmaßnahmen möglich,<br />
wird aber durch das geringe wirtschaftliche Interesse an der landwirtschaftlichen Nut-<br />
zung solcher Flächen nach Ende der Brutperiode erschwert. Daher ist aktuell besonders<br />
die Entwicklung langfristig rentabler Nutzungsformen von Niedermoorstandorten z.B.<br />
durch Biomassenutzung <strong>und</strong> Agrarumweltprogramme von Bedeutung.<br />
Zum Schutz der Pommerschen Population wird derzeit federführend durch die Polnische<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> den Vogelschutz (OTOP) ein deutsch - polnisches „EU LIFE Projekt“<br />
durchgeführt. Ziel des Projektes ist neben der Ausarbeitung von Managementplänen <strong>für</strong><br />
die noch existierenden Brutgebiete eine experimentelle Erprobung der Biomassenutzung<br />
auf Seggenrohrsängerhabitaten.<br />
In Weißrussland werden zur Zeit Anstrengungen unternommen, degradierte Moorflä-<br />
chen zu renaturieren <strong>und</strong> nachhaltige Landnutzungsformen <strong>für</strong> diese Gebiete zu etablie-<br />
ren, was auch dem Seggenrohrsänger, der dort noch in großen Zahlen brütet zu Nutzen<br />
kommen wird (UNDP Projects 2006).
Untersuchungsgebiet 11<br />
3 Untersuchungsgebiet<br />
3.1 Lage<br />
Das Untersuchungsgebiet ist das 1600 ha große Moor „Bagno za Saletra“ (dt.:“Salpeter-<br />
Moor“), auch „Bagna Rozwarowskie“ (dt.:„Rozwarowo-Moore“) genannt.<br />
Es befindet sich in Nordwestpolen im Kreis Kamień zwischen den Städten Kamień Po-<br />
morski <strong>und</strong> Wolin (Abb. 3.1) <strong>und</strong> ist von sechs Dörfern umgeben (Abb. 3.3). Es wurde<br />
vorrangig der zentrale, vom Seggenrohrsänger besiedelte Teil des Feuchtgebietes mit ei-<br />
ner Größe von ca. 800 ha untersucht.<br />
Abb. Das Rozwarowo-Moor 3.1: Lage des Untersuchungsgebietes hat eine Nord-Süd-Ausdehnung (roter Kasten) von ca. 7 km <strong>und</strong> auf der Höhe<br />
(Geographische Gr<strong>und</strong>karte Norddeutschlands in Schulze (1989).<br />
von Rekowo eine maximale Ost-West-Ausdehnung von 3 km.
12 Untersuchungsgebiet<br />
3.3 Klima<br />
Das Klima des Kreises Kamień ist durch die unmittelbare Nähe zur Ostsee geprägt. Dieser<br />
Einfluss lässt sich in einem 10-30 km breiten küstenparallelen Streifen nachweisen. In die-<br />
sem Gebiet ist die Luftfeuchtigkeit höher als im Inland <strong>und</strong> die Temperaturgänge im Ta-<br />
ges- <strong>und</strong> Jahresgang sind gleichmäßig. Der Winter ist neblig <strong>und</strong> regnerisch, mit nur we-<br />
nigen Frosttagen, Frühling <strong>und</strong> Sommer beginnen spät im Jahr (Schwenkros 1994).<br />
Die Jahresmitteltemperaturen betragen im 20 km nordwestlich von Rozwarowo gelege-<br />
nen Warnowo 9 °C. Die gesamte Region der Odermündung ist relativ trocken, es fallen<br />
mittlere Niederschläge von 500-600 mm (Kamień Pomorski 583 mm) pro Jahr. Der Wind<br />
weht überwiegend aus westlicher Richtung (Umweltb<strong>und</strong>esamt 1993).<br />
Abb. 3.2: Klimadiagramm von Szczecin <strong>und</strong> Ueckermünde.<br />
Szczecin liegt ca. 60 km südlich, Ueckermünde ca. 50 km südwestlich von Rozwarowo. (Mühr<br />
2002)<br />
3.2 Ausgangsgestein <strong>und</strong> Relief<br />
Das Untersuchungsgebiet liegt in der Jungmoränenlandschaft des Nordostdeutsch-<br />
Polnischen Tieflands <strong>und</strong> wird dem Mecklenburger Stadium zugeordnet. Nördlich der<br />
Endmoränenbildungen der Velgaster Staffel, welche auch die Kerne der Inseln Wollin<br />
<strong>und</strong> Usedom bildet, liegt das Gebiet um Rozwarowo in der kuppigen Gr<strong>und</strong>moräne<br />
(Duphorn et al. 1995). Das Relief dieser Landschaft ist durch zahlreiche Schmelzwasserab-
Untersuchungsgebiet 13<br />
flussrinnen <strong>und</strong> kleinere kuppige Höhenzüge geprägt, welche aus Gr<strong>und</strong>moränenmateri-<br />
al bestehen <strong>und</strong> durch ein unregelmäßiges Abtauen <strong>und</strong> Wiedervordringen des Inlandei-<br />
ses entstanden sind. Dabei sind die schmalen, tief ausgewaschenen, von Ost nach West<br />
verlaufenden Rinnen (z.B. das Tal der Swiniec), von den breiten in Nord-Südrichtung<br />
verlaufenden Tälern zu unterscheiden. Erstere entstanden auf Gr<strong>und</strong> eines stillstehenden<br />
Eisrandes durch einen verhinderten Schmelzwasserabfluss nach Norden. Letztere kenn-<br />
zeichnen Gletscherzungenbecken, in denen das Wasser unter dem Eis abfließen konnte.<br />
Diesen ist auch das „Bagno za Saletra“ zuzuordnen (siehe Abb. 3.4). Dort findet man vor<br />
allem Sandböden, da lehmige Anteile vom langsam fließenden Wasser ausgewaschen<br />
werden konnten (Provinzverband von Pommern 1939).<br />
Die postglaziale Entwicklungsgeschichte des Rozwarowo-Moores ist eng mit der Entste-<br />
hung des Oderhaffs verb<strong>und</strong>en, welches das Ergebnis von Küstenausgleichsprozessen an<br />
den Inseln Wollin <strong>und</strong> Usedom sowie einem postglazialem Wasserspiegelanstieg ist.<br />
So stieg während der Litorinatransgression der Wasserspiegel der Ostsee im Atlantikum<br />
(8000-5000 BP) um ca. 30 m <strong>und</strong> erreichte fast das heutige Niveau (Duphorn et al. 1995).<br />
Dabei füllten sich glaziale Hohlformen mit Wasser, wodurch unter anderem das Achter-<br />
wasser entstand. Das Litorinameer drang in die glazialen Hohlformen <strong>und</strong> die Unterläufe<br />
der Peene, Recknitz <strong>und</strong> Warnow ein. Diese flachen Bereiche sind verlandet <strong>und</strong> bildeten<br />
ehemals die großen Durchströmungsmoorkomplexe des Norddeutschen Tieflandes. Auch<br />
die Hohlform des Rozwarowo-Moores wurde überflutet <strong>und</strong> ist heute mit organischem<br />
Material aufgefüllt <strong>und</strong> verlandet.<br />
Am Ostrand des Rozwarowo-Moors auf der Höhe von Rekowo befindet sich eine Binnen-<br />
salzstelle. Sie gehört zu einer Reihe von Salzquellen, die sich vom im Norden gelegenen<br />
Dziwnow über Kamień Pomorski, Chrzaszczewo, Rekowo nach Dobropole zieht ( K. Zi-<br />
arnek mdl.).
14 Untersuchungsgebiet<br />
0 1 Kilometer<br />
Abb. 3.3: Topographische Karte des Untersuchungsgebietes (1:25000)<br />
(Symon 1990). Die rote Linie begrenzt das in der Diplomarbeit bearbeitete Gebiet.<br />
Rekowo 1<br />
km<br />
Untersuchungsgebiet
Untersuchungsgebiet 15<br />
Abb. 3.4: Geologische Übersichtskarte des Kreises Cammin. (Maßstab nicht angegeben)<br />
Der rote Rahmen kennzeichnet die Lage des Untersuchungsgebietes, der eingezeichnete Ort<br />
„Reckow“ ist mit dem heutigen „Rekowo“ identisch (Provinzverband von Pommern 1939).
16 Untersuchungsgebiet<br />
3.4 Wasserverhältnisse<br />
Die Niederung wird von der Grzybnica durchflossen, welche aus dem im Süden liegen-<br />
den Piaski-See austritt, sich nördlich von Rozwarowo mit der Wołczenica vereinigt <strong>und</strong><br />
am Nordende des Moores in den Camminer Bodden mündet. Ihr Gefälle beträgt auf den<br />
sieben Kilometern vom Seeaustritt bis zur Haffmündung nur 0,1 m. Über die Dziwna, den<br />
östlichen Ausgang des Oderhaffs, besitzt der Camminer Bodden <strong>und</strong> somit auch die<br />
Grzybnica eine Verbindung zur Ostsee.<br />
Die Flüsse, die in das Oderhaff münden sind abhängig von den Wasserständen der Ost-<br />
see. So gibt es vor allen bei starkem NO-Wind Hochwasser <strong>und</strong> Brackwassereinbrüche in<br />
den Mündungsgebieten (Duphorn et al. 1995). Unter diesen Umständen kann auch das<br />
Rozwarowo-Moor zeitweilig unter Brackwassereinfluss geraten. Dies geschah letztmalig<br />
im Frühjahr 2004.<br />
3.5 Landnutzungsgeschichte <strong>und</strong> aktuelle Vegetation<br />
Der erste Hinweis auf das heutige „Bagno za Saletra“, findet sich auf einer Karte von 1679<br />
(Hoffmann 1679) (Anhang 1). Anlässlich des in diesem Jahre zwischen Schweden <strong>und</strong><br />
Preußen geschlossenen Friedens von St. Germain wurde das Camminer Gebiet damals<br />
von den Schweden, welche um 1630 in das Land einrückten, an Brandenburg zurückge-<br />
geben (Provinzverband von Pommern 1939). Auf der Karte ist die ehemalige Grenze zu<br />
sehen, welche das als „Rohrbruch“ bezeichnete Rozwarowo-Moor in zwei Hälften teilt.<br />
Die Grenze verlief vermutlich entlang der Grzybnica. Von der Schwedischen Landesauf-<br />
nahme 1692 ist das Gebiet nicht erfasst worden.<br />
In der Karte der Königlichen Preußischen Landesaufnahme von 1886 (Nr. 2054, 2154) ist<br />
auf einer der mineralischen Durchragungen im Moorgebiet östlich der Grzybnica das Gut<br />
„Wonneburg“ verzeichnet (Anhang 2 u. 3). Dieses wurde nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
verlassen (A. Smolczynski, mdl.). Noch heute weist eine Obstbaumgruppe <strong>und</strong> ein mit<br />
jungen Birken durchsetzter alter Hudewald auf die frühere Siedlung hin. Das Moor wur-<br />
de damals als Wiese <strong>und</strong> Weide genutzt. Im östlichen Teil wurde Torf gestochen. Schon<br />
um 1886 durchzogen einzelne Entwässerungsgräben das Gebiet (Anhang 2 u. 3).
Untersuchungsgebiet 17<br />
Der fertige Plan der „Genossenschaft zur Regulierung des Wonnebachs“ zur Melioration<br />
des Rozwarowoer Moorgebietes (Dreyer 1913) wurde, wahrscheinlich auf Gr<strong>und</strong> von<br />
technischen Schwierigkeiten (Graf von Flemming-Benz 1970) aufgegeben. Bis zum Zwei-<br />
ten Weltkrieg wurde das Moor weiterhin landwirtschaftlich genutzt.<br />
Nach 44 Jahren ohne nachweisbare Nutzung 2 wurden im Rozwarowo-Moor zum ersten<br />
Mal im Winter 1989 von Alfred Smolczynski 25.000 Bündel Schilf geerntet. Heute erntet er<br />
jährlich 250.000 Bündel <strong>und</strong> noch zwei weitere Landbesitzer bewirtschaften Flächen des<br />
Moorgebietes. Insgesamt wird auf ca. drei Vierteln der Fläche Schilf geerntet. Dabei zählt<br />
das Land als Agrarland, weswegen die Rohrwerber jährlich 100 Euro pro ha Fördergelder<br />
von der Europäischen Union erhalten (A. Smolczynski, mdl.). Von den Rohrwerbern wird<br />
das Moorgebiet als „Plantage“ bezeichnet, ein Anbau (im Sinne einer direkten Pflanzung)<br />
von Schilf findet dort jedoch nicht statt.<br />
Im Kreis Kamień findet Ackerbau nur auf den Kuppen der lehmigen Gr<strong>und</strong>moränen statt.<br />
Häufig werden Getreide, Raps <strong>und</strong> Mais angebaut. Auf den sandigen Böden der pleisto-<br />
zänen Abflussbahnen, die mit Talsanden verfüllt sind, stockt Kiefernforst. Auf den End-<br />
moränenzügen, wie im Nationalpark Wolin sind noch Laubwälder erhalten. In den bäuer-<br />
lichen Siedlungen, an Gewässern <strong>und</strong> Gräben, sowie an Feldrainen wachsen Pappeln <strong>und</strong><br />
Weiden.<br />
Die Vegetation im Rozwarowo-Moor besteht aus ausgedehnten Schilfröhrichten <strong>und</strong><br />
Großseggenrieden. Inselartig wachsen kleinere Gehölzgruppen aus Erlen (Alnus glutinosa)<br />
<strong>und</strong> Grauweiden (Salix cinerea) auf.<br />
3.6 Seggenrohrsängerbestand<br />
Das Moorgebiet bei Rozwarowo ist das Wichtigste der sieben verbliebenen Brutgebiete<br />
der Pommerschen Seggenrohrsängerpopulation. In diesem Gebiet hielten sich 2006 zur<br />
Brutzeit 37 sM auf, welche 47 % der Pommerschen Population ausmachen. Auch hier sind<br />
die Zahlen rückläufig. Haben sich 1991 noch 60 sM in Rozwarowo aufgehalten, waren es<br />
2 Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich das Rozwarowo-Moor in staatlichen Eigentum. Offiziell<br />
unterlag das Moor in diesem Zeitraum keiner Nutzung. Ob es jedoch von der lokalen Bevölkerung<br />
in geringem Maße <strong>für</strong> die Landwirtschaft genutzt wurde ist nicht bekannt.
18 Untersuchungsgebiet<br />
2001 nur noch 5. Erfreulicherweise hat sich der Bestand im Jahr 2004 leicht erholt, auf 22<br />
sM gegenüber 4 sM im Vorjahr (Abb. 3.5).<br />
Wodurch die starke Abnahme <strong>und</strong> momentane leichte Zunahme der Anzahl singender<br />
Männchen verursacht ist, ist unbekannt. Fünf Vermutungen liegen nahe:<br />
1. Während des Beobachtungszeitraumes von 1991 bis 2006 wurde der Bestand von ver-<br />
schiedenen Personen erfaßt. Dabei könnten die Bestände verschieden eingeschätzt wor-<br />
den sein, oder es sind verschiedene Flächen kontrolliert worden (F. Tanneberger mdl.).<br />
2. Auch der Nutzungswandel auf den Flächen durch die Rohrwerber ab 1989 könnte Ein-<br />
fluss auf die Bestandsgröße gehabt haben. Die geförderte Ausbreitung von Phragmites<br />
australis wird von polnischen Naturschützern als negative Entwicklung in den verbliebe-<br />
nen Habitaten bewertet (Jablonski 2004), dies ist jedoch umstritten, da die Seggenrohrsän-<br />
gerzahlen derzeit wieder steigen. Die Ausbreitung von Phragmites australis muss differen-<br />
ziert betrachtet werden, da es phänotypisch stark variieren kann.<br />
3. Die hydrologischen Bedingungen sind eng mit der Förderung von Phragmites australis<br />
verb<strong>und</strong>en, dazu werden die Moorflächen bis zu ca. 20 cm überstaut. Diese Praxis hat<br />
möglicherweise negative Einflüsse auf die Ansiedlung des Seggenrohrsängers.<br />
Anzahl sM<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1991<br />
1992<br />
k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
Abb. 3.5: Seggenrohrsängerbestand sM im Rozwarowo-Moor 1991-2006<br />
Daten aus (Czeraszkiewicz 1993), (Krogulec & Kloskowski 1997), (Maniakowski 2004), (Jablonski<br />
2004), M. Dylawerski 2006 mdl.)
Untersuchungsgebiet 19<br />
4. Auch die Witterungsbedingungen im Frühjahr können einen erheblichen Einfluss auf<br />
die Ansiedlung des Seggenrohrsängers haben. Nach Sturmereignissen kann es zu einem<br />
Rückstau von Boddenwasser ins Grzybnicatal kommen, so dass dort die Moorflächen<br />
hoch überstaut werden <strong>und</strong> sich keine Nistgelegenheiten bieten.<br />
5. Auch in den Überwinterungsgebieten oder auf Gr<strong>und</strong> ungünstiger Bedingungen wäh-<br />
rend des Zugs kann es zu Verringerungen des Bestands gekommen sein.<br />
3.7 Schutzstatus<br />
Das gesamte Moorgebiet von Rozwarowo (1600 ha) ist unter anderem aufgr<strong>und</strong> der An-<br />
wesenheit des Seggenrohrsänger als IBA ausgewiesen (PL003, Kriterium A1). Seit April<br />
2004 ist in Folge der EU-Erweiterung ein 4211,2 ha großes Vogelschutz-Gebiet ausgewie-<br />
sen (SPA, PLB320001, Typ A) worden, in dessen Zentrum die Fläche des EU-LIFE-<br />
Projektgebietes liegt (Abb. 3.6). Die Ausweisung erfolgte aufgr<strong>und</strong> des Brutbestandes von<br />
23 Vogelarten darunter z.B. Botaurus stellaris, Ciconia nigra, Milvus milvus, Crex crex <strong>und</strong><br />
Circus pygargus der EU-Vogelschutzrichtlinie Anhang I (Umweltministerium der Republik<br />
Polen 2006). Acht dieser Vogelarten stehen ebenfalls auf der polnischen Roten Liste.<br />
Abb. 3.6: Grenzen des Vogelschutz<br />
Gebietes <strong>und</strong> der Fläche des EU-<br />
LIFE- Projektes (OTOP 2005)<br />
Rozwarowo LIFE project site<br />
SPA Roswarowo mires bo<strong>und</strong>ary<br />
5 km
20 Methoden<br />
4 Methoden<br />
Die Feldarbeit fand im Juli 2005 bzw. im Januar 2006 statt. Dabei konzentrierten sich die<br />
Arbeiten vor allem auf die Flächen des Rozwarowo-Moors, welche momentan oder in nä-<br />
herer Vergangenheit vom Seggenrohrsänger besiedelt wurden. Die mineralischen Kup-<br />
pen, welche innerhalb des Moores aufragen, stellen keine potentiellen Seggenrohrsän-<br />
gerhabitate dar <strong>und</strong> wurden nicht untersucht. Für alle Aufnahmepunkte wurden per GPS<br />
- Gerät (Garmin Etrex) Hoch- <strong>und</strong> Rechtswerte ermittelt. Im Anschluss konnten die Daten<br />
der ornithologischen Kartierungen mit den hier erfassten Daten verschnitten werden.<br />
4.1 Stratigraphie<br />
Die Stratigraphie des Moores wurde mittels einer Polnischen Kappsonde (50 cm Länge,<br />
4,5 cm Durchmesser) mit 16 Bohrungen (Abb. 4.1) im Juli 2005 erfasst. Ein Transekt wurde<br />
wegen der Mineraldurchragungen auf der Ostseite der Grzybnica nicht angelegt. Die<br />
Bohrpunkte, mit einem GPS - Gerät (Garmin Etrex) eingemessen, wurden gleichmäßig<br />
über die ganze Untersuchungsfläche verteilt, um einen Gesamteindruck vom Aufbau des<br />
Moores zu erhalten. Die Torfe <strong>und</strong> Sedimente wurden nach Succow & Stegmann (2001)<br />
angesprochen. Der Zersetzungsgrad der Torfe (H) wurde in der zehnstufigen Skala nach<br />
von Post (AG Boden 1996) angegeben, die Konsistenz der Seesedimente (K) nach Succow<br />
& Stegmann (2001). Der Karbonatgehalt der Torfe wurde im Gelände nach AG Boden<br />
(1996) mittels 10 %iger Salzsäure bestimmt.<br />
4.2 Abiotische Standortsfaktoren<br />
An allen Bohrpunkten wurde im Juli 2005 eine Bodenprobe aus dem oberen Wurzelraum<br />
entnommen (Oberflächenprobe). Im Januar 2006 erfolgte zusätzlich an den Vegetations-<br />
aufnahmeflächen V6, V22, V24, V32, V36, V42, V43, V49, V60, V64, V65, V67, V70 eine<br />
Probenentnahme, um den pH-Wert <strong>und</strong> das C/N-Verhältnis im vegetationswirksamen<br />
Bodenbereich von sieben Vegetationsstruktureinheiten (Absch. 4.3 u. 5.3) zu ermitteln.<br />
Die achte Vegetationsstruktureinheit „Vegetation der Gräben“ (Absch. 5.3) wurde nicht<br />
beprobt. C/N-Verhältnis <strong>und</strong> pH-Wert wurden im Bodenlabor des Botanischen <strong>Institut</strong>s<br />
Greifswald bestimmt. Für die C/N- Analyse wurden zunächst alle lebende Wurzelmasse
Methoden 21<br />
aus den Proben entfernt. Dann wurden die Proben über Nacht im Ofen bei 80°C getrock-<br />
net <strong>und</strong> anschließend gemahlen (Pulverisette 14 Fritsch Idar-Oberstein; Siebgröße:<br />
0,2 mm).<br />
0 1 Kilometer Bohrpunkte<br />
Abb. 4.1: Lage der Bohrpunkte im Untersuchungsgebiet<br />
Kartengr<strong>und</strong>lage: (Symon 1990)
22 Methoden<br />
Vor dem Einwiegen in Zinnfolie wurden die Proben nochmals bei 80°C ca. eine St<strong>und</strong>e im<br />
Ofen getrocknet. Mit Hilfe des C/N-Analysegeräts (Elementar vario EL, elementar Analy-<br />
sesystem Hanau) wurde mittels DUMAS-Aufschluss der totale Stickstoff <strong>und</strong> Kohlen-<br />
stoffgehalt ermittelt, daraufhin erfolgte die Berechnung der C/N- Verhältnisse. Da die O-<br />
berflächenproben kalkfrei waren, galt Ctot = Corg .<br />
Für die pH-Wertmessung wurden 10 ml der frischen Torfsubstanz mit 25 ml CaCl2 ver-<br />
mischt <strong>und</strong> 16 St<strong>und</strong>en stehen gelassen. Der pH-Wert der im Wasserbad auf 25°C tempe-<br />
rierten Proben wurde mit Hilfe eines pH-Taschenmessgerät (WTW pH 330i) <strong>und</strong> einer<br />
SCHOTT Glaselektrode N64 gemessen.<br />
4.3 Vegetation<br />
Im Juli 2005 wurden 77 Vegetationsaufnahmen von jeweils 25 m² erhoben. Die Pflanzen-<br />
arten wurden dabei der Moosschicht, Krautschicht 1 <strong>und</strong> Krautschicht 2 zugeordnet. Die<br />
Trennung zwischen den Krautschichten erfolgte nicht nach absoluten Wuchshöhen, son-<br />
dern nach einem sichtbaren schichtartigen Höhenunterschied zwischen den am Standort<br />
vorkommenden Arten. Dabei wurde die jeweils niedrigere Schicht als Krautschicht 1<br />
(KS 1) bezeichnet. Die Bestimmung der Deckungsgrade der Arten erfolgte nach einer<br />
neunteiligen Skala nach Braun-Blanquet <strong>und</strong> Pfadenhauer (Dierschke 1994) (Tab. 3.1). Zu-<br />
sätzlich zur Höhe <strong>und</strong> Deckung der einzelnen Vegetationsschichten wurden an jedem<br />
Aufnahmepunkt folgende Parameter erfasst:<br />
- Gesamtdeckung der Vegetation [%];<br />
- Deckung von Phragmites australis [%];<br />
- Deckung trockener Schilfhalme aus dem Vorjahr [%];<br />
- Höhe von Phragmites australis [m];<br />
- Höhe der Streuauflage [m].<br />
Die Bestimmung <strong>und</strong> Benennung der Gefäßpflanzen erfolgte nach Jäger & Werner (2002),<br />
die der Moose nach Frahm & Frey (1992). Die Auswertung der Vegetationsaufnahmen er-<br />
folgte nach dem Vegetationsformenkonzept (Koska et al. 2001) <strong>und</strong> wurde mittels Cluste-<br />
ranalyse überprüft. Mit Hilfe der hierbei ermittelten Vegetationsformen ist es möglich<br />
Aussagen über die abiotischen Verhältnisse am Standort zu treffen (Bioindikation) (Koska<br />
et al. 2001).
Methoden 23<br />
Wenn eine eindeutige Zuordnung eines Vegetationstyps zu einer Vegetationsform nur<br />
mit Hilfe der Artengruppenzusammensetzung nicht möglich war, wurden die gemesse-<br />
nen C/N-Verhältnisse zur eindeutigen Bestimmung der Vegetationsform zur Hilfe ge-<br />
nommen (siehe Absch. 6.2). Dazu wurden die Trophiestufengrenzen nach Succow (Suc-<br />
cow & Stegmann 2001) benutzt.<br />
Zur Darstellung der Deckungsgrade in der Übersichtstabelle in Abschnitt 5.3 wurden die<br />
Klassen 1a <strong>und</strong> 1b sowie 2a <strong>und</strong> 2b zusammengefasst.<br />
Zusätzlich zu jeder Vegetationsaufnahme wurde an den Aufnahmepunkten auch die<br />
- Höhe des Wasserstandes über der Geländeoberfläche (GOF) [m] <strong>und</strong><br />
- Bewirtschaftung: Mahd im Winter stattgef<strong>und</strong>en / nicht stattgef<strong>und</strong>en (g./n.g.) er-<br />
fasst. In den folgenden Abschnitten beziehen sich alle Wasserstandsangaben auf die<br />
Sommerwasserstände im Juli 2005.<br />
Vegetationsformen werden mit Hilfe von Artengruppenkombinationen gebildet, wobei<br />
die Physiognomie der Vegetation unbeachtet bleibt. Da jedoch gerade Struktur, Höhe <strong>und</strong><br />
die schichtweise Gliederung der Vegetation <strong>für</strong> die Besiedelung der Flächen durch den<br />
Seggenrohrsänger von großer Bedeutung sind, wurden die ausgegliederten Vegetations-<br />
formen <strong>für</strong> die Vegetationskartierung nochmals feiner unterteilt bzw. zusammengefasst<br />
(siehe Tab. 5.3, sowie Anhang 7). Kriterien waren dabei die Dichte <strong>und</strong> Höhe der Vegeta-<br />
tion in KS1 <strong>und</strong> KS2, der Wasserstand über GOF sowie die Artenzusammensetzung.<br />
Tab. 3.1: Deckungsgrad- <strong>und</strong> Stetigkeitsskala<br />
Deckungsgradskala: neunteilig nach Braun.Blanquet <strong>und</strong> Pfadenhauer (Dierschke 1994)<br />
Stetigkeitsskala: Klassen nach Frey (Frey & Lösch 1998)<br />
Skala in % Stetigkeitsstufe in %<br />
r
24 Methoden<br />
So wurden acht Vegetationsstruktureinheiten (VSE) gebildet, welche als Kartiereinheiten<br />
genutzt worden. Die Vegetationskartierung erfolgte auf den aktuell vom Seggenrohrsän-<br />
ger besiedelten <strong>und</strong> seit neuster Zeit von diesem aufgegebenen Flächen im Moorzentrum<br />
(ca. 800 ha). Darüber hinaus wurden auch Gehölze, Gräben <strong>und</strong> Störflächen erfasst. Die<br />
Kartierung erfolgte mit Hilfe einer georeferenzierten Karte in ArcView <strong>und</strong> eines GPS-<br />
Geräts (Garmin Etrex). Zwei schwer zugängliche Flächen am Ostrand des Moors konnten<br />
nur aus der Entfernung beschrieben werden.<br />
4.5 Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik<br />
Mit den Programm Excel (Microsoft Office 2000) wurden die Vegetationsdaten geordnet.<br />
Diese Einteilung <strong>und</strong> das Indikationsvermögen der Artengruppen bezüglich abiotischer<br />
Standortparameter wurden mit einer Clusteranalyse <strong>und</strong> Korrespondenzanalyse (DCA)<br />
im Programm PcOrd überprüft.<br />
Die ermittelten C/N-Verhältnisse <strong>und</strong> pH-Werte wurden mittels des Mann-Whitney-U-<br />
Tests (zweiseitig) auf signifikante Unterschiede zwischen den Vegetationsstruktureinhei-<br />
ten geprüft. Der Mann-Whitney-U-Test ist ein parameterfreier statistischer Test <strong>und</strong> hat<br />
somit gegenüber dem T-Test den Vorteil, dass die zu betrachten Variable nicht normalver-<br />
teilt sein muss. (Somit kann von einer Transformation der Variable abgesehen werden.)<br />
Darüber hinaus kann der Mann-Whitney-U-Test auch bei kleinen Stichproben angewandt<br />
werden (Wilm 2006). Der Mann-Whitney-U-Test beruht auf dem Prinzip der Rangsum-<br />
men, wobei die Werte der zu betrachten Variable aufsteigend sortiert werden <strong>und</strong> einen<br />
Rang zugeschrieben bekommen. Die statistische Prüfgröße U wird aus den Rangsummen<br />
der Stichproben <strong>und</strong> den Fallzahlen der jeweils zu vergleichenden Datensätze ermittelt<br />
<strong>und</strong> mit dem kritischen U-Wert <strong>für</strong> das gewünschte Signifikanzniveau α (5/ 10 %) vergli-<br />
chen (Lettner 2006).<br />
Die Vegetationskarte sowie die Übersichtskarten mit Lage der Bohrpunkte, Vegetations-<br />
aufnahmen <strong>und</strong> der ornithologischen Kartierungen wurden in ArcView 3.0 erstellt. Für<br />
die Anfertigung weiterer Tabellen, Diagramme <strong>und</strong> Abbildungen wurden die Programme<br />
Excel, PowerPoint (beide Microsoft Office 2000), Corel Draw 10 <strong>und</strong> SPSS 10.0 verwendet.
Ergebnisse 25<br />
5 Ergebnisse<br />
5.1 Moorstratigraphie<br />
Die Bohrprotokolle der 16 Bohrungen sind in Anhang 4, die Bohrprofile in Anhang 5 dar-<br />
gestellt.<br />
Der mineralische Untergr<strong>und</strong> wurde in jeder Bohrung erreicht. Die Mächtigkeit der orga-<br />
nischen Ablagerungen reicht von 8 m (B1) am Nordende des Moores bei Dusin bis 0,80 m<br />
(B8) im Ostteil, nahe der mineralischen Durchragung des ehemaligen Wonneburg. Der<br />
Westteil des Moorkörper liegt in einem bis zu ca. 8 m ausgehöhltem Becken. Der Ostteil<br />
des Moores teilt sich in zwei, auf Gr<strong>und</strong> ihrer Untergr<strong>und</strong>verhältnisse verschiedene Ge-<br />
biete. Im Nordosten (vgl. Bohrung B6 <strong>und</strong> B8) überwiegen Flächen geringer Mächtigkei-<br />
ten org. Ablagerungen, wobei im Südwesten auch nahe der mineralischen Inseln Mäch-<br />
tigkeiten bis zu 6 m vorkommen (vgl. Bohrung B12, Abb. 5.1 u. Anhang 5b, B14 u. B13,<br />
Anhang 5b). Der erbohrte Untergr<strong>und</strong> setzt sich aus Fein- <strong>und</strong> Mittelsand zusammen, sel-<br />
ten wurde auch Schluff erbohrt.<br />
Über den mineralischen Sedimenten lagern bei Bohrung B3, B4, B5 Basisschilftorfe, bei<br />
Bohrung B9 <strong>und</strong> B10 Basisbraunmoos-Schilftorfe, bei Bohrung B13, B15 <strong>und</strong> B16 Basiser-<br />
lenholztorfe <strong>und</strong> bei Bohrung B12 <strong>und</strong> B14 Basiserlenholz-Grobseggentorfe verschiedener<br />
Mächtigkeiten. Darüber schließt sich eine, zum Teil mehrere Meter mächtige Mudde-<br />
schicht (K3-4) aus Grob- bis Feindetritus an. Diese wird jeweils durch eine Schilftorf-<br />
schicht überlagert. Den Abschluss der organischen Ablagerungen zur Geländeoberfläche<br />
bilden abhängig von der rezenten Vegetation Braunmoosschilftorfe, reine Schilftorfe <strong>und</strong><br />
Grobseggentorfe. Die muddeunterlagerten Torfschichten sind dabei nie mächtiger als 2 m.<br />
Dabei bildet Standort B13 eine Ausnahme, hier wurden die größten Torfmächtigkeiten<br />
von 3,80 m erbohrt, der Torf wird hier abwechselnd von Schilf, Braunmoosen, Grobseg-<br />
gen <strong>und</strong> Erlen gebildet. Die Muddeschicht ist hier nur 0,60 m mächtig.<br />
Weitere Ausnahmen bilden die Bohrungen B6, B7, B8. Hier wurde keine Mudde abgela-<br />
gert <strong>und</strong> der mineralische Untergr<strong>und</strong> liegt maximal 2 m unter der Geländeoberfläche<br />
(4 m bei B13). In Bohrung B6 überlagern 0,70 m Feinseggentorf eine 0,80 m mächtige<br />
Schilftorfschicht, Bohrung B8 besteht ausschließlich aus 0,80 m mächtigen Schilftorf <strong>und</strong>
26 Ergebnisse<br />
in Bohrung B7 überlagern 0,55 m Schilftorf 0,10 m Schilf-Erlentorf, noch darüber liegen<br />
0,30 m Grobseggentorf.<br />
Abb. 5.1: Beispiele <strong>für</strong> Bohrprofile<br />
Dargestellt werden die tiefste Bohrung B1 nahe der Mündung der Grzybnica, B2 <strong>und</strong> B11 im Inneren<br />
des Untersuchungsgebietes (Lage siehe Abb. 4.1).
Ergebnisse 27<br />
5.2 Abiotische Standortsfaktoren<br />
Die an den Bohrpunkten <strong>und</strong> ausgewählten Vegetationsaufnahmepunkten gemessenen 30<br />
pH-Werte (Anhang 11) reichen von 5,4 – 6,9 der Median liegt bei 6,4. Dabei liegt die Hälf-<br />
te der Werte im subneutralen (pH-Werte von 4,8 bis 6,4) <strong>und</strong> die andere Hälfte der Werte<br />
im alkalischen Bereich (pH-Werte ab 6,4) (Grenzen nach Succow (2001) (Tab. 5.2)). Insge-<br />
samt wurden 30 C/N-Verhältnisse (Anhang 11) ermittelt mit Werten von 13,4 – 48,3, der<br />
Median liegt bei 20,5. 10 % der Werte liegen im oligotrophen Bereich, 47 % im me-<br />
sotrophen Bereich <strong>und</strong> 43 % im eutrophen Bereich (Trophiestufen nach Succow (Succow<br />
& Stegmann 2001))( vgl. Abb. 5.2 u. Tab. 5.3). Dahingegen liegen <strong>für</strong> die Trophiestufen<br />
nach Succow (2001) korrigiert <strong>für</strong> Dumas-Aufschluss mit Daten von Tanneberger & Hah-<br />
ne (2003) durch Joosten& Domain mdl. (2005) in Kahrmann & Haberl (2005) 36 % der<br />
Werte im oligotrophen, 57 % im mesotrophen <strong>und</strong> 7 % im eutrophen Bereich (vgl. Tab.<br />
5.3). 28 der 30 untersuchten Oberflächenproben konnten den sieben näher betrachteten<br />
VSE zugeordnet werden. Die C/N – Werte streuen sehr stark, auch innerhalb der ver-<br />
schiedenen Vegetationsstruktureinheiten (Tab. 5.2 u. Abb. 5.2). Zwischen den einzelnen<br />
Vegetationsstruktureinheiten haben sich keine Unterschiede hinsichtlich der C/N-<br />
Verhältnisse <strong>und</strong> der pH-Werte gezeigt (Mann-Whitney-U-Test, Anhang 9 u. 10).<br />
Tab. 5.1: pH-Verhältnisse der Vegetationsstruktureinheiten<br />
1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder, 2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände<br />
mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände, 5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf, 6. niedrige<br />
schilffreie Vegetation, 7. Vegetation der Binnensalzstelle<br />
Struktureinheit 1 2 3 4 5 6 7<br />
pH-Werte 5.5 5.8 5.5 6.6 6.9 6.7 6.2<br />
6.8 6.3 6.0 6.6 6.5 6.8 6.9<br />
6.1 6.2 6.6 6.0 6.2 6.4<br />
6.5 6.4<br />
6.6<br />
6.1<br />
6.4<br />
6.7 6.8 5.4<br />
Median 6.3 6.3 6.3 6.6 6.3 6.7 6.6
28 Ergebnisse<br />
Tab. 5.2: C/N-Verhältnisse der Vegetationsstruktureinheiten<br />
1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder, 2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände<br />
mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände, 5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne<br />
Schilf, 6. niedrige schilffreie Vegetation, 7. Vegetation der Binnensalzstelle<br />
Struktureinheit 1 2 3 4 5 6 7<br />
C/N-Verhältnisse 16.0 15.5 22.2 29.2 25.5 16.8 15.4<br />
25.4 24.2 48.3 21.4 29.2 35.3 16.7<br />
15.1 20.5 23.7 18.7 25.5 20.4<br />
16.5 28.3<br />
19.8<br />
15.8<br />
40.2<br />
17.7 13.4 13.6<br />
Median 16.2 20.5 23.0 20.1 25.5 20.4 16.1<br />
C/N Verhältnis<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
N =<br />
4<br />
1<br />
7<br />
2<br />
4<br />
3<br />
Abb. 5.2: Medianwerte der C/N-Verhältnisse in den einzelnen Vegetationsstruktureinheiten<br />
Erklärung der Boxplots: Linie im Kasten: Median, Kastenunterkante: 1. Quantil (25%), Kastenoberkante:<br />
3. Quantil (75%), Kastenlänge: Interquantilabstand (IQA), Querlinien: Streuung der Werte<br />
über dem 1. Quantil <strong>und</strong> unterhalb des 3. Quantils (1,5*IQA), Kreis: Ausreißer, Zahlenangaben (N):<br />
Stichprobenanzahl. Vegetationsstruktureinheiten: 1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder ,<br />
2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände,<br />
5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf, 6. niedrige schilffreie Vegetation, 7. Vegetation<br />
der Binnensalzstelle.<br />
4<br />
4<br />
Kartiereinheiten<br />
4<br />
5<br />
3<br />
6<br />
oligotroph<br />
mesotroph<br />
eutroph<br />
polytroph<br />
2<br />
7
Ergebnisse 29<br />
Tab. 5.3: Trophiestufen<br />
Grenzen der Trophiestufen nach Succow (2001), Grenzen der Trophiestufen nach Joosten <strong>und</strong><br />
Domain mdl. (2005) modifiziert mit Korrelationskoeffizient zur Kjeldal/ Dumas-Umrechnung.<br />
Trophiestufen polytroph eutroph mesotroph oligotroph<br />
Grenzen nach Succow (2001) < 10 10 - 20 20 - 33 > 33<br />
Grenzen nach Joosten & Domain<br />
mdl. (2005)<br />
< 7 7 - 15 15 - 24 > 24<br />
In Abb. 5.3 werden Ergebnisse der Korrespondenzanalyse (DCA) dargestellt. In die Aus-<br />
wertung sind nur Aufnahmen mit vorhandenen Werten <strong>für</strong> das C/N-Verhältnis <strong>und</strong> den<br />
pH-Wert eingegangen. Ein signifikanter Zusammenhang von Vegetationseinheiten <strong>und</strong><br />
abiotischen Standortparametern (Wasserstand über der Geländeoberfläche, pH-Wert <strong>und</strong><br />
C/N-Verhältnis) ist durch die DCA nicht nachweisbar. Es ist somit nicht möglich, an<br />
Hand der gemessenen Standortparameter die unterschiedlichen Vegetationseinheiten <strong>und</strong><br />
ihre Verteilung zu erklären.<br />
Mittels der Mediane der auf Flächen der einzelnen Kartiereinheiten gemessenen C/N-<br />
Werte können jedoch die durch Bioindikation ermittelten Nährstoffverhältnisse der Kar-<br />
tiereinheiten 1 <strong>und</strong> 4 als kräftig sowie 2, 3 <strong>und</strong> 5 als mittel (zu Kartiereinheit 7 siehe Ab-<br />
schnitt 5.3.1.5) bestätigt werden (siehe Abb. 5.2). Allein die Nährstoffverhältnisse der Kar-<br />
tiereinheit 6 (ziemlich arm) spiegeln sich nicht in den gemessenen Werten wider.<br />
Die DCA in Abb. 5.4, in welche alle Aufnahmen eingegangen sind, zeigt keine signifikan-<br />
te Abhängigkeit der Vegetationseinheiten vom abiotischen Standortparameter „Wasser-<br />
stand über der GOF“. Hier lassen sich jedoch die Vegetationsstruktureinheiten nach inne-<br />
ren Struktureigenschaften voneinander abgrenzen. Das sind die Deckung <strong>und</strong> Höhe von<br />
Phragmites australis sowie Deckung <strong>und</strong> Höhe der übrigen krautigen Vegetation.
30 Ergebnisse<br />
V67<br />
B14<br />
V49<br />
B5<br />
B6<br />
V36<br />
V65<br />
DCA-<br />
Achse 2<br />
B11<br />
B12<br />
V4<br />
V<br />
V60<br />
B3<br />
B15<br />
B9<br />
B8<br />
V22 V24<br />
V64<br />
B4<br />
V32<br />
B13<br />
V42<br />
B10<br />
B2<br />
Abb. 5.3: DCA-Ordinationsdiagramm: Streudiagramm der Vegetationsaufnahmen <strong>und</strong> gemessenen<br />
Standortparameter (pH-Wert, C/N-Verhältnis, Wasserstand über GOF, Bewirtschaftung)<br />
Aufnahmen einer Vegetationsstruktureinheit sind farblich gleich gekennzeichnet.<br />
(1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder , 2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris,<br />
3. Schilfbestände mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände, 5. ungenutzte Sumpfvegetation<br />
ohne Schilf, 6. niedrige schilffreie Vegetation, 7. Binnensalzstelle)<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
V70<br />
B7<br />
DCA-<br />
Achse 1
Ergebnisse 31<br />
B1<br />
V6<br />
B6<br />
V7<br />
V4<br />
V3<br />
V3<br />
V3<br />
B5<br />
V3<br />
V4<br />
V4<br />
V3<br />
V4<br />
DCA-<br />
Achse 2<br />
V5<br />
V2<br />
3<br />
V2<br />
B15<br />
V5<br />
V<br />
4<br />
V3 V5 VX2<br />
V5 V2<br />
5<br />
V6<br />
V6<br />
V5<br />
B2<br />
V6 B13<br />
V2<br />
V6<br />
V5<br />
B8<br />
6<br />
7<br />
Deck. KS1<br />
V6<br />
V7<br />
Höhe KS2<br />
V3<br />
Deck. KS2<br />
Deck. Phr.<br />
B4<br />
DCA-Achse<br />
1<br />
V7<br />
B12<br />
V<br />
Höhe Phr.<br />
V6<br />
B7<br />
V<br />
V5<br />
V5<br />
V<br />
V<br />
V4<br />
V2<br />
V2<br />
B9<br />
V1<br />
V4<br />
V6<br />
V1<br />
V2<br />
V6<br />
V1<br />
V<br />
V4<br />
V4<br />
V2<br />
B10<br />
B11<br />
V4<br />
Abb. 5.4: DCA-Ordinationsdiagramm: Streudiagramm der Vegetationsaufnahmen <strong>und</strong> Standortparameter<br />
(Höhe KS1, Höhe KS2, Höhe Phr., Deck. MS, Deck. Streu, GesDeck., Deck. KS1, Deck.<br />
KS2, Deck. Phr., Deck Phr.+, Wasserstand über GOF)<br />
Aufnahmen einer Vegetationsstruktureinheit sind farblich gleich gekennzeichnet (1. Schilfbestände<br />
der eutrophen Grabenränder, 2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände mit hohem<br />
Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände, 5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf, 6. niedrige schilffreie<br />
Vegetation, 7. Binnensalzstelle). Achse 1 erklärt die Bewirtschaftung (Mahd) der Flächen. Achse<br />
2 erklärt die Deckung <strong>und</strong> Höhe von Schilf <strong>und</strong> KS 2.<br />
V1<br />
V2<br />
V3<br />
V1<br />
B3<br />
V<br />
V1<br />
V3<br />
V4<br />
VSE: 1<br />
2
32 Ergebnisse<br />
5.3 Vegetation<br />
Im Untersuchungsgebiet konnten sechs Vegetationsformen aus der Formationsklasse der<br />
offenen, ungenutzten Vegetation (Koska et al. 2001) <strong>und</strong> acht Vegetationsstruktureinhei-<br />
ten , welche auch als Kartiereinheiten genutzt worden, ausgegliedert werden (Tab. 5.3 u.<br />
Anhang 7).<br />
5.3.1 Vegetationsformen<br />
Die jeweilige Nummer nach dem Titel der Vegetationsform bezieht sich auf die Numme-<br />
rierung der VF in Koska & Timmermann (2001).<br />
5.3.1.1 Rohrkolben-Schnabelseggen-Ried (VF 12)<br />
Das Rohrkolben-Schnabelseggenried ist eine Vegetationsform der mesotroph-<br />
subneutralen Standorte der Wasserstufe 5+ mit topogenem Wasserregime. Die Nährkraft-<br />
stufe ist „ziemlich arm(-mittel)“ (za(-m)) <strong>und</strong> das entspricht einem C/N-Verhältnis von<br />
26-33. Diese Vegetationsform zeichnet sich im Untersuchungsgebiet durch ihre geringe<br />
Vegetationshöhe <strong>und</strong> das dichte Auftreten von Myrica gale aus. Die ∅ Höhe der Kraut-<br />
schicht 2 beträgt zwar 0,9 m, jedoch ist deren Deckung von ∅ nur 4 % gering. Der Wasser-<br />
stand liegt bei ∅ 15 cm über Flur, Myrica gale wächst vorrangig auf trockeneren Bulten<br />
von Carex elata. Neben Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, <strong>und</strong> Calamagrostis canescens<br />
kennzeichnen Arten wie Mentha aquatica, Cirsium palustre, Juncus conglomeratus <strong>und</strong> Eri-<br />
ophorum angustifolium die Einheit.<br />
5.3.1.2 Spitzmoos-Großseggen-Ried (VF 13)<br />
Das Spitzmoos-Großseggen-Ried kommt ebenfalls auf mesotroph-subneutralen Standor-<br />
ten der Wasserstufe 5+ mit topogenem Wasserregime vor. Die Nährkraftstufe ist „(ziem-<br />
lich arm-)mittel“ ((za-)m), <strong>und</strong> entspricht einem C/N-Verhältnis von 20-26. Diese Vegeta-<br />
tionsform umfasst Schilfröhrichte mit Thelypteris palustris-Unterwuchs, Schilfröhrichte mit<br />
Seggenunterwuchs <strong>und</strong> die schilffreien Flächen östlich der Grzybnica. Der Wasserstand
Ergebnisse 33<br />
beträgt Ø 0-15 cm über Flur, stellenweise ist eine Streuschicht vorhanden. Diese Vegetati-<br />
onsform wurde aufgr<strong>und</strong> von physiognomischen Unterschieden (Absch. 5.3.2) in drei<br />
Kartiereinheiten aufgeteilt.<br />
5.3.1.3 Teichsimsen-Schilf-Wasser-Ried (VF 26)<br />
Das Teichsimsen-Schilf-Wasser-Ried ist eine Vegetationsform der eutroph-subneutral-<br />
kalkhaltigen Standorte der Wasserstufe 6+ mit topogenem Wasserregime. Die Nährkraft-<br />
stufe ist „kräftig-reich“ (k-r) <strong>und</strong> entspricht einem C/N-Verhältnis von 10-20.<br />
Typisch sind Schwimmdecken von Hydrocharis morsus-ranae <strong>und</strong> Stratiotes aloides sowie<br />
Lemna trisulca <strong>und</strong> Spirodela polyrhiza, welche vorallem die Wasserflächen in den über 1 m<br />
tief ausgebaggerten Gräben bedecken. An den inneren Grabenrändern treten Acorus cal-<br />
mus, Phragmites australis <strong>und</strong> Butomus umbellatus als Begleiter auf. Ebenfalls gehören zu<br />
dieser Vegetationsform die fast reinen, sehr dichten Phragmites australis-Bestände, welche<br />
auf Flächen mit einem Wasserstand von durchschnittlich 20 cm über der Oberfläche vor-<br />
kommen. Der krautige Unterwuchs ist nur schwach entwickelt. Cardamine pratensis subsp.<br />
dentata wächst hierstellenweise am Boden. Es treten kleine Exemplare von Galium palustre<br />
<strong>und</strong> Lycopus europaeus treten auf.<br />
5.3.1.4 Zungenhahnenfuß-Großseggen-Ried (VF 27)<br />
Das Zungenhahnenfuß-Großseggen-Ried kommt auf eutroph-subneutral-kalkhaltigen<br />
Standorten der Wasserstufe 5+ mit topogenem Wasserregime vor. Die Nährkraftstufe ist<br />
„kräftig“ (k) <strong>und</strong> entspricht einem C/N-Verhältnis von 13-20. Diese fast reinen, sehr dich-<br />
ten Phragmites australis-Bestände kommen auf Flächen mit einem Wasserstand von<br />
durchschnittlich 7 cm über Flur vor. Der krautige Unterwuchs ist nur schwach entwickelt.<br />
Vereinzelt treten Galium palustre, Carex pseudocyperus, Mentha arvensis, Poa pratense, Carda-<br />
mine pratensis subsp. dentata, Stellaria palustre <strong>und</strong> Lycopus europaeus auf. Die Moosschicht<br />
aus Leptodictyum riparium ist gut ausgebildet.
34 Ergebnisse<br />
Tab. 5.4: Übersichtstabelle nach Dierschke (1994) der Vegetationstypen im Rozwarowoer Moor<br />
Die mit Nummern gekennzeichneten Vegetationseinheiten werden zu Vegetationsformen <strong>und</strong> Vegetationstruktureinheiten<br />
zusammengefasst. VF 26: Teichsimsen-Schilf-Wasserried, VF 12: Rohrkolben-<br />
Schnabelsegge-nRied, VF 13 Spitzmoos-Großseggen-Ried, VF 27 Zungenhahnenfuß-Großseggen-Ried,<br />
VF 39: Strandaster-Salzbinsen-Rasen, VF 50: Nachtschatten-Schilf-Staudenflur (Ausführliche Vegetationstabelle<br />
siehe Anhang 7)<br />
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Wasser über GOF [m] >1 0.21 0.15 0.01 0.14 0.20 0.05 0.01 0.03 0.07 0.07 0.00<br />
Gesamtdeckung % 68 96 87 95 97 89 83 99 94 97 99 100<br />
Deckung Phr. % 0 94 0 44 10 0 73 74 64 91 94 0<br />
Deckung Phr.+ % 0 6 0 3 0 0 1 5 4 3 2 0<br />
Höhe Phr. [m] 0.0 2.0 0.0 1.5 0.3 0.0 1.5 1.6 1.5 2.0 2.1 0.0<br />
Höhe KS2 [m] 0.2 2.0 0.9 1.5 1.1 1.4 1.5 1.6 1.4 2.0 2.1 0.0<br />
Höhe KS1 [m] 0.1 0.2 0.6 0.7 0.9 0.9 0.5 0.8 0.9 0.5 0.9 0.3<br />
Deck KS2 % 3 94 4 45 14 35 74 75 64 91 94 0<br />
Deck KS1% 18 30 87 74 92 59 51 68 63 28 23 100<br />
Deck MS % 0 2 0 4 0 0 36 26 44 18 0 0<br />
Höhe Streu [m] 0.00 0.03 0.03 0.06 0.06 0.00 0.05 0.04 0.06 0.01 0.04 0.04<br />
Vegetationsstruktureinheit 8 4 6 2 5 5 3 2 2 4 1 7<br />
Vegetationsform 26 12 13 27 50 (37) 39<br />
Wasserstufe 6+ 5+ 4+ 5+-4+<br />
Wasserregimetyp T T T T T K<br />
Trophiestufe m-r za-(m) (za-)m k s m-k<br />
Trophiestufengruppe eutroph mesotroph mesotroph eutroph polytroph eutroph<br />
Säure-Basen-Stufe sub-ka sub sub sub-ka sub-ka sub-ka<br />
Anzahl der Aufnahmen<br />
AG<br />
4 5 3 11 6 5 7 8 10 9 7 2<br />
11 Hydrocharis morsus-ranae V2<br />
11 Stratiotes aloides III3<br />
44 Acorus calamus III1<br />
12 Spirodela polyrhiza V3 IV3 I1 I+ I1<br />
14 Lemna trisulca III3 III3<br />
87 Phragmites australis III1 V5 V3 II1 V4 V4 V4 V5 V5<br />
39 Carex elata IV2 IV2 III3 V2 IV3 IV2 V2<br />
78 Lythrum salicaria III1 IV+ III1 II1 IV1 IV+ III+ IV1 II+<br />
64 Epilobium palustre IV+ III+ III+ V1 III1 I1 III+<br />
25 Potentilla palustris IV2 II2 II1 III1 III1 II2 IV2<br />
78 Lysimachia vulgaris IV1 IV2 III2 V2 II1 V2 V2 I1<br />
25 Calamagrostis stricta II1 V1 V+ I2 III2 IV2<br />
53 Lathyrus palustris II+ V+ III+ V1 II1 III+<br />
73 Carex disticha II1 II2 V4 V2 I2 II2 III2<br />
74 Calamagrostis canescens V2 III2 I1 V1<br />
Myrica gale V3 I+ III3<br />
54 Peucedanum palustre IV1 III2 V1 V2 II+ I+ I1<br />
58 Carex appropinquata II1 III2 III2 V2<br />
25 Carex lasiocarpa II3 I2 I1 V2
Ergebnisse 35<br />
63 Mentha aquatica I1 II2 II1 IV1 I1 I1 Ir<br />
77 Fillipendula ulmaria II1 III1 I+<br />
64 Equisetum fluviatile IV2 V2 V3<br />
25 Menyanthes trifoliata V3 I2 IV2<br />
55 Carex rostrata V3 II3 IV1<br />
24 Eriophorum angustifolium IV1<br />
63 Cirsium palustre IV1<br />
70 Juncus conglomeratus IV1 I1<br />
64 Galium palustre III1 IV1 IV1 V1 V1 V1 IV1 V1 IV1 IV1<br />
74 Lycopus europaeus I+ I+ V+ IV+ III+ II1 + III1 III+<br />
54 Lysimachia thyrsiflora I1 II1 I1 III1 I1 III1 II1 I1<br />
63 Myosotis palustris II1 I+ III1 I1 I1 III+ II1 III1<br />
42 Carex pseudocyperus I1 Ir IV1 II1 III+ III1<br />
92 Mentha arvensis III1 III1 III2 IV1 II1 III2<br />
95 Poa pratense I1 II+ I1 III1 II1<br />
54 Stellaria palustre I+ I+ IV1 III+ II2<br />
14 Leptodictyum riparium I1 II1 III3 III2 II2<br />
40 Cicuta virosa III+ Ir I+ I2 I+ I1 I2<br />
56 Thelypteris palustris V3 I2 V3 V2<br />
63 Calliergonella cuspidata I2 I1 II2 IV2<br />
44 Rumex hydrolapathum III1 I1 I1 V+ II+ I1<br />
42 Typha latifolia I+ IV1 Ir<br />
75 Solanum dulcamara I1 III1 I+ I1<br />
38 Ranunculus lingua III+ I1<br />
38 Cardamine pratensis subsp.<br />
dentata III1 I1 I+ V1 I1<br />
40 Sium latifolium I1 II1<br />
99 Urtica dioica III1 I1 IV1<br />
99 Poa trivialis I2 I3 III2<br />
99 Calystegia sepium I+ I1 I+ III1<br />
86 Symphytum officinalis I1 III1<br />
60 Triglochin maritimum V4<br />
72 Glaux maritima V3<br />
72 Juncus geradii V2<br />
72 Plantago major subsp. winteri V2<br />
72 Plantago maritima III2<br />
Atriplex spec. V2<br />
91 Potentilla anserina V3<br />
Trifolium fragiferum III+<br />
59 Schoenoplectus tabernaemontani I1 III+
36 Ergebnisse<br />
5.3.1.5 Strandastern-Salzbinsen-Rasen (VF 39)<br />
Der Strandastern-Salzbinsen-Rasen ist eine Vegetationsform der eutroph-subneutral-<br />
kalkhaltigen Standorte der Wasserstufe 5+ mit Küstenüberflutungsregime (Absch. 6.2.1).<br />
Wasser steht nicht in der Fläche. Die Nährkraftstufe ist „kräftig“ (k) (C/N von 13-20). Fol-<br />
gende Arten treten auf: Triglochin maritimum, Glaux maritima, Juncus geradii, Plantago major<br />
subsp. winteri, Plantago maritima, Atriplex spec., Potentilla anserina, Trifolium fragiferum <strong>und</strong><br />
Schoenoplectus tabernaemontani.<br />
5.3.1.6 Nachtschatten-Schilf-Staudenflur (VF 50)<br />
Die Nachtschatten-Schilf-Staudenflur ist eine Vegetationseinheit der polytroph-<br />
subneutral-kalkhaltigen Standorte der Wasserstufe 4+ mit topogenem Wasserregime. Die<br />
Nährkraftstufe ist „kräftig“ (k) (C/N von 10-13). An den eutrophierten Grabenrändern<br />
stehen besonders hohe (∅ 2,1 m), dichte Phragmites australis-Bestände. Die untere Kraut-<br />
<strong>und</strong> Moosschicht sind kaum bzw. nicht ausgebildet. Urtica dioica, Calystegia sepium <strong>und</strong><br />
Solanum dulcamara treten auf. Poa trivialis bedeckt stellenweise den Boden. Der Wasser-<br />
stand über Flur beträgt ∅ 7 cm.<br />
5.3.2 Vegetationsstruktureinheiten (VSE)<br />
Die in Klammern angegebene Nummerierung der VSE entsprechen der Kennzeichnung<br />
der jeweiligen Einheiten in der Übersichtstabelle (Tab. 5.4).<br />
5.3.2.1 Schilfbestände der eutrophen Grabenränder (1)<br />
Diese Kartiereinheit entspricht der Nachtschatten-Schilf-Staudenflur (VF 50) <strong>und</strong> umfasst<br />
die hohen dichten Schilfbestände, die vorrangig an eutrophen Grabenrändern <strong>und</strong> Stör-<br />
stellen vorkommen. Das Schilf ist brüchig <strong>und</strong> oft kantig verwachsen <strong>und</strong> daher bei den<br />
Rohrwerbern nicht beliebt („second class reed“, siehe Absch. 6.5). Die Flächen werden<br />
daher selten oder gar nicht gemäht.
Ergebnisse 37<br />
Vegetationsform Nachtschatten-Schilf-Staudenflur (VF 50)<br />
Trophie eutroph-polytroph<br />
Wasserstand ca. 10 cm über GOF<br />
Bewirtschaftung selten Wintermahd<br />
typische Arten Phragmites australis, Urtica dioica, Calystegia sepium, Solanum dulcamara<br />
5.3.2.2 Schilfbestände mit Thelypteris palustris (2)<br />
Diese niedrigen, lockeren Schilfbestände mit Thelypteris palustris kommen vor allem west-<br />
lich <strong>und</strong> nordöstlich der Grzybnica vor. Die Einheit ist dem Spitzmoos-Großseggen-Ried<br />
(VF 13) zuzuordnen. Diese Bestände werden seltener gemäht, da der Unterwuchs stört<br />
<strong>und</strong> das Schilf oft zu klein <strong>und</strong> unregelmäßig wächst. Die Flächen sind relativ trocken,<br />
hier steht im Mittel kein Wasser über der Geländeoberfläche. Phragmites australis steht hier<br />
niedrig (∅ 1,5 m) <strong>und</strong> schütter. Der gut entwickelte krautige Unterwuchs setzt sich vor-<br />
rangig aus Thelypteris palustris, Lysimachia vulgaris, Lathyrus palustris, Lythrum salicaria, Epi-<br />
lobium palustre, Galium palustre <strong>und</strong> Myosotis palustris zusammen. Die abgestorbenen Reste<br />
dieser Krautschicht 1 bilden hier eine Streuauflage.<br />
Abb. 5.6: Schilfbestände mit Thelypteris<br />
palustris<br />
Vegetationsform Spitzmoos-Großseggen-Ried<br />
(VF 13)<br />
Trophie mesotroph<br />
Wasserstand 0<br />
Bewirtschaftung unregelmäßige Wintermahd<br />
typische Arten Phragmites australis, Thelypteris<br />
palustris, Lysimachia vulgaris,<br />
Lathyrus palustris, Lythrum salicaria,<br />
Epilobium palustre<br />
Abb. 5.5: Schilfbestände<br />
der<br />
eutrophen Grabenränder
38 Ergebnisse<br />
5.3.2.3 Schilfbestände mit hohem Seggenanteil (3)<br />
Diese Einheit ist den Schilfbeständen mit Thelypteris palustris (VSE 2) sehr ähnlich, jedoch<br />
ist die Krautschicht 1 unter dem mäßig hohen (∅ 1,5 m) Schilf artenärmer <strong>und</strong> Thelypteris<br />
palustris fehlt. Sie ist ebenfalls dem Spitzmoos-Großseggen-Ried (VF 13) zuzuordnen. Die<br />
vorherrschenden Arten sind hier Carex pseudocyperus, Carex elata, Lythrum salicaria, Stellaria<br />
palustre, Galium palustre <strong>und</strong> Lycopus europaeus. Leptodictyum riparium bildet eine deutliche<br />
Moosschicht. Der Wasserstand in der Fläche beträgt ∅ 5 cm. Eine Streuschicht ist vorhan-<br />
den. Die Flächen werden regelmäßig gemäht.<br />
Vegetationsform Spitzmoos-Großseggen-Ried (VF.13)<br />
Trophie mesotroph<br />
Wasserstand ca. 5 cm über GOF<br />
Bewirtschaftung regelmäßige Wintermahd<br />
typische Arten Prhragmites australis, Carex pseudocyperus, Carex elata, Lythrum<br />
salicaria, Stellaria palustre<br />
5.3.2.4 reine Schilfbestände (4)<br />
In dieser Kartiereinheit wurden die Bestände des Zungenhahnenfuß-Großseggen-Rieds<br />
(VF 27) <strong>und</strong> die reinen Schilfbestände des Teichsimsen-Schilf-Wasser-Rieds (VF 26) zu-<br />
sammengefasst. Das hier dicht wachsende hohe (Ø 2 m), dünne, relativ gerade Schilf lässt<br />
sich durch den spärlichen Unterwuchs sehr gut mähen. Der Wasserstand in der Fläche<br />
beträgt ∅ 10-20 cm. Typische Arten sind Galium palustre, Lycopus europaeus, Cardamine pra-<br />
tensis subsp. dentata, Lemna trisulca <strong>und</strong> Spirodela polyrhiza.<br />
Abb. 5.7: Schilfbestände<br />
mit hohem<br />
Seggenanteil
Ergebnisse 39<br />
5.3.2.5 ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf (5)<br />
Diese weitgehend schilffreien Flächen tragen eine relativ niedrige Vegetation. Nur Peuce-<br />
danum palustre, Typha latifolia <strong>und</strong> Calamagrostis stricta ragen über die dichte Kraut-<br />
schicht 1. Das strukturreiche Seggenried kommt nur östlich der Grzybnica vor. Es ist der<br />
Vegetationsform des Spitzmoos-Großseggen-Rieds (VF 13) zuzuordnen. Die Wasserstän-<br />
de liegen im Durchschnitt bei 15 cm über Flur, diese variieren jedoch auf Gr<strong>und</strong> der ge-<br />
bildeten Bulte <strong>und</strong> Schlenken sehr stark. Die Vegetationseinheit ist geprägt von dem Vor-<br />
kommen mehreren Seggenarten: Carex elata, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex disticha,<br />
Carex acutiformis (Abb. 5.9 im Vordergr<strong>und</strong>) <strong>und</strong> Carex appropinquata, sowie einzelnen eu-<br />
traphenten Arten wie Rumex hydrolapathum <strong>und</strong> Typha latifolia. Weiterhin kommen vor:<br />
Ranunculus lingua, Peucedanum palustre, Calamagrostis stricta <strong>und</strong> Menyanthes trifoliata. Da<br />
auf diesen Flächen kein oder nur vereinzelt Schilf wächst, werden diese derzeit nicht be-<br />
wirtschaftet.<br />
Abb. 5.8: reine Schilfbestände<br />
Vegetationsform Zungenhahnenfuß-<br />
Großseggen-Ried (VF 27),<br />
Teichsimsen-Schilf-Wasser-<br />
Ried (VF 26)<br />
Trophie eutroph<br />
Wasserstand 10-20 cm über GOF<br />
Bewirtschaftung regelmäßige Wintermahd<br />
typische Arten Phragmites australis, Galium<br />
palustre, Lycopus europaeus,<br />
Cardamine pratensis<br />
subsp. dentata, Lemna trisulca,<br />
Spirodela polyrhiza
40 Ergebnisse<br />
5.3.2.6 niedrige schilffreie Vegetation (6)<br />
Diese inselartig im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes vorkommende Einheit ent-<br />
spricht dem Rohrkolben-Schnabelseggen-Ried (VF 12). Die Vegetation ist sehr niedrig<br />
<strong>und</strong> wird nur von einigen aufragenden Halmen von Calamagrostis stricta <strong>und</strong> Cirsium pa-<br />
lustre überragt. Der Wasserstand liegt bei ∅ 15 cm über Flur, Myrica gale wächst vorrangig<br />
auf trockeneren Bulten von Carex elata. Neben Carex rostrata, Menyanthes trifoliata <strong>und</strong> Ca-<br />
lamagrostis canescens kennzeichnen Arten wie Mentha aquatica, Cirsium palustre, Juncus con-<br />
glomeratus <strong>und</strong> Eriophorum angustifolium die Einheit.<br />
Abb. 5.9: ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf<br />
Vegetationsform Spitzmoos-Großseggen-Ried<br />
(VF 13)<br />
Trophie mesotroph<br />
Wasserstand ca. 15 cm über GOF (Bult-<br />
Schlenken-Struktur)<br />
Bewirtschaftung keine<br />
typische Arten Carex elata, Carex lasiocarpa,<br />
Carex rostrata, Carex disticha,<br />
Carex acutiformis, Rumex<br />
hydrolapathum, Typha<br />
latifolia,. Ranunculus lingua,<br />
Peucedanum palustre, Calamagrostis<br />
stricta, Menyanthes<br />
trifoliata<br />
Abb. 5.10: niedrige schilffreie<br />
Vegetation
Ergebnisse 41<br />
Vegetationsform Rohrkolben-Schnabelseggen-Ried (VF 12)<br />
Trophie mesotroph<br />
Wasserstand ca. 15 cm über GOF<br />
Bewirtschaftung keine<br />
typische Arten Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, Calamagrostis canescens, Mentha aquatica,<br />
Cirsium palustre, Juncus conglomeratus, Eriophorum angustifolium<br />
5.3.2.7 Vegetation der Binnensalzstelle (7)<br />
Die Kartiereinheit entspricht dem Strandastern-Salzbinsen-Rasen (VF 39). Am östlichen<br />
Rand des Rozwarowo-Moors <strong>und</strong> am westlichen Ufer der Wołczenica befindet sich eine<br />
Binnensalzstelle mit typischer Salzwiesenvegetation. Die Wiese wird im Sommer gemäht,<br />
stellenweise liegengebliebenes Mähgut bildet eine Streuschicht von ∅ 20 cm Höhe. Der<br />
Artenbestand ist komplett verschieden zum restlichen Untersuchungsgebiet. Folgende<br />
Arten treten auf: Triglochin maritimum, Glaux maritima, Juncus geradii, Plantago major subsp.<br />
winteri, Plantago maritima, Atriplex spec., Potentilla anserina, Trifolium fragiferum <strong>und</strong> Schoe-<br />
noplectus tabernaemontani.<br />
Vegetationsform Strandastern-Salzbinsen-Rasen (VF 39)<br />
Trophie eutroph<br />
Wasserstand 0<br />
Bewirtschaftung Sommermahd<br />
typische Arten Triglochin maritimum, Glaux maritima, Juncus geradii, Plantago major subsp.<br />
winteri, Plantago maritima, Atriplex spec., Potentilla anserina, Trifolium fragiferum,<br />
Schoenoplectus tabernaemontani<br />
5.3.2.8 Vegetation der Gräben (8)<br />
Die Kartiereinheit entspricht sowohl den Schwimmdecken, welche die Wasserflächen der<br />
Gräben bedecken als auch der Vegetation der inneren Grabenränder des Teichsimsen-<br />
Schilf-Wasser-Rieds (VF 26). Typische Arten sind Hydrocharis morsus-ranae <strong>und</strong> Stratiotes<br />
aloides sowie Lemna trisulca <strong>und</strong> Spirodela polyrhiza, welche die Wasserflächen in den über<br />
1 m tief ausgebaggerten Gräben bedecken. An den inneren Grabenrändern treten Acorus<br />
calamus, Phragmites australis <strong>und</strong> Butomus umbellatus auf.
42 Ergebnisse<br />
5.3.3 Weitere Kartiereinheiten<br />
Zusätzlich zu diesen Vegetationsstruktureinheiten, welche die wichtigsten strukturellen<br />
Eigenschaften <strong>und</strong> Artengefüge im Rozwarowo-Moor beschreiben, wurden bei der Kar-<br />
tierung die Bestände von Myrica gale erfasst. Außerdem wurden Weiden- <strong>und</strong> Erlenge-<br />
hölze markiert, wenn sie deutlich über die krautige Vegetation hinausragten. Ebenso<br />
wurden durch die Ablage von Schilfabfällen bedeckte Flächen gekennzeichnet. Schwer<br />
zugängliche Flächen, welche folglich nur ungenau beschrieben werden konnten wurden<br />
zusätzlich kenntlich gemacht: Das Bodenrelief ist hier sehr uneben (vermutlich durch alte<br />
Torfstiche o.ä.). Dadurch wechselt auch die Vegetation häufig <strong>und</strong> mit scharfen Gradien-<br />
ten. Überwiegend sind diese Flächen mit hohem dichten Schilf (entspräche VSE 1) <strong>und</strong><br />
kräftigen Sumpfpflanzen (Iris pseudacorus, Rumex hydrolapathus) bewachsen. Dazwischen<br />
finden sich Flächen mit niedrigerem Schilf (1,5-2 m) <strong>und</strong> wenig Unterwuchs (entspräche<br />
VSE 4).<br />
5.3.4 Vegetationskarte<br />
Die auf den Vegetationsstruktureinheiten <strong>und</strong> weiteren Kartiereinheiten basierende Vege-<br />
tationskarte befindet sich in Anhang 6.<br />
Abb. 5.11: Vegetation der Gräben<br />
Vegetationsform Teichsimsen-Schilf-<br />
Wasser-<br />
Ried (VF 26)<br />
Trophie eutroph<br />
Wasserstand min. 1 m über GOF<br />
Bewirtschaftung Ausbaggern<br />
typische Arten Phragmites australis,<br />
Hydrocharis morsus-ranae,<br />
Stratiotes aloides, Lemna<br />
trisulca <strong>und</strong> Spirodela<br />
polyrhiza
Diskussion 43<br />
6 Diskussion<br />
6.1 Kennzeichnung des Rozwarowo Moor<br />
6.1.1 Genese<br />
Im Vergleich zu anderen Bohrprofilen aus der Region des Oderhaffs sind bezüglich der<br />
Moorstratigraphie viele Gemeinsamkeiten zu erkennen. Dies lässt auf eine ähnliche Gene-<br />
se der Gebiete schließen. So wurden im Ueckertal ca. 1 m mächtige Schilftorfe mit darun-<br />
ter abgelagerter 3 m mächtiger Detritusmudde <strong>und</strong> Basistorfen aus Radizellen, Schilf <strong>und</strong><br />
Holz gef<strong>und</strong>en (Berg 2005).<br />
Für die Entwicklungsgeschichte des Rozwarowo-Moores ist folgendes anzunehmen: Im<br />
Untersuchungsgebiet wurden wahrscheinlich wie im Ueckertal vor ca. 10.000 Jahren die<br />
ersten Torfe in der Talsenke gebildet. Im Zuge des Abtauens des Inlandeises <strong>und</strong> der all-<br />
gemein milderen <strong>und</strong> feuchteren Klimabedingungen, die sich in Europa nach dem Weich-<br />
selglazial einstellten, sammelte sich in Senken <strong>und</strong> Niederungen Schmelz- <strong>und</strong> Abfluß-<br />
wasser.<br />
Abb. 6.1: Lage des in Abb. 6.2<br />
dargestellten Idealprofilschnitts<br />
im Zentrum des<br />
Rozwarowoer Moors<br />
Der Profilschnitt wurde mit<br />
Hilfe der Bohrungen B7, B8,<br />
B9, B10, B12, B15 <strong>und</strong> B16 angefertigt.<br />
1 Kilometer Aufnahmepunkte
44 Diskussion<br />
Der Gr<strong>und</strong>wasserspiegel stieg allmählich. Unter Flachwasserbedingungen bildeten sich<br />
Basistorfe aus Braunmoosen <strong>und</strong> Seggen (vgl. Abb. 6.2), stellenweise wuchsen auf diesen<br />
Schichten zusätzlich Schilftorfe auf.<br />
Der Substratwechsel von Torf zu Mudde kennzeichnet im Ueckertal den auf 6245+/-35 BP<br />
datierten Einfluss der Litorinatransgression (Berg 2005). Auch im Rozwarowo-Moor fin-<br />
det ein deutlicher Wechsel von Torf zu Detritusmudde statt. In der Muddeschicht gefun-<br />
dene Stücke der Herzmuschel (Cardium edule) zeigen Salzwasserverhältnisse an (B1, B3,<br />
B4, B10), wodurch auch in diesem Gebiet der Einfluss der Litorinatransgression deutlich<br />
wird. An den Talrändern weisen Erlenholztorfe auf eine Bewaldung (Erlensümpfe) des<br />
damaligen Gewässerufers hin. Die Verlandung des überfluteten Grzybnicatals wurde von<br />
Schilf dominiert, dessen Torf die Muddeschichten überlagert. Im flachgründigen nordöst-<br />
lichen Teil des Untersuchungsgebietes fehlt die Gewässerphase. Vermutlich ließen hier<br />
ein langsames Ansteigen des Wasserspiegels Schilf- <strong>und</strong> Seggentorfe aufwachsen.<br />
Abb. 6.2: Idealprofilschnitt im Zentrum des Rozwarowo Moors (W-O)<br />
Der Profilschnitt wurde mit Hilfe der Bohrungen B7, B8, B9, B10, B12, B15 <strong>und</strong> B16 (Lage siehe<br />
Abb. 6.1) angefertigt. Auf der mineralischen Aufwölbung befand sich ehemals das Vorwerk Wonneburg.
Diskussion 45<br />
Im Bereich der Binnensalzstelle zeugt eine 80 cm mächtige Erlenholztorfschicht von einem<br />
ehemaligen Erlenwaldbestand, wie er heute noch am westlichen Moorrand <strong>und</strong> stellen-<br />
weise innerhalb des Rozwarowo-Moores zu finden ist.<br />
Als die Verlandung des ehemaligen Gewässers abgeschlossen war, schloß sich eine Ver-<br />
sumpfung des Moorgebietes an. Diese ist auf den weiter ansteigenden Wasserspiegel der<br />
Ostsee zurückzuführen (Janke 1996). Durch den steigenden Wasserspiegel kann es einer-<br />
seits zu Überflutungen des Moores über die Verbindung zum Camminer Bodden, oder<br />
andererseits zu einer Anhebung des Gr<strong>und</strong>wasserspiegels, durch den Rückstau der Vor-<br />
fluter kommen. Im Ueckertal wuchsen ca. 1 m mächtige Schilftorfe auf Gr<strong>und</strong> von Über-<br />
flutung durch das Oderhaff auf der mächtigen Muddeschicht auf. Das Rozwarowo-Moor<br />
liegt hingegen weniger zur See exponiert als das Ueckertal. Jedoch ist anzunehmen, dass<br />
die Küstenausgleichsprozesse heute sehr viel fortgeschrittener sind <strong>und</strong> der Einfluss der<br />
Ostsee im Oderhaff <strong>und</strong> Camminer Bodden heute wesentlich geringer ist. Wahrscheinlich<br />
trugen in Rozwarowo anfangs Überflutung sowie später durch einen Wasserrückstau<br />
hervorgerufene Versumpfung zum weiterem Torfwachstum bei. Dadurch konnten auf<br />
dem Verlandungsmoor weiterhin Braunmoos-Schilftorfe aufwachsen. Auch die im<br />
flachgründigen Ostteil des Moores abgelagerten Torfe entstanden vermutlich auf Gr<strong>und</strong><br />
dieser Prozesse. Noch heute steigt der Wasserspiegel der Ostsee (Janke 1996), so dass das<br />
Torfwachstum unter natürlichen Bedingungen wahrscheinlich andauern würde. Da je-<br />
doch Großteile des Rozwarowo-Moors unter dem Einfluss der von den Landbesitzern<br />
praktizierten Wasserwirtschaft stehen, ist die weitere Entwicklung des Torfkörpers weit-<br />
gehend von dieser abhängig.<br />
Das Moor ist heute größtenteils gehölzfrei, da Erlen <strong>und</strong> Weidengebüsche, die in den<br />
Schilfbeständen aufwachsen, durch die Landbesitzer entfernt oder schon im Jugendstadi-<br />
um durch die Schilfmahd unterdrückt werden. Bei einem Ausbleiben der Nutzung würde<br />
das Rozwarowo-Moor unter aktuellen Bedingungen ausgehend von den schon vorhan-<br />
den Gehölzinseln wahrscheinlich langsam verbuschen. Eine vollständige Bewaldung des<br />
Gebietes in kürzerer Zeit ist jedoch unwahrscheinlich.
46 Diskussion<br />
6.1.2 Ökologischer <strong>und</strong> hydrogenetischer Moortyp<br />
Der ökologische Moortyp wird anhand der Trophiestufe <strong>und</strong> der Säurebasestufe be-<br />
stimmt. Die bioindikatorisch ermittelten Nährstoffverhältnisse stimmen nur teilweise mit<br />
den im Untersuchungsgebiet gemessenen Werten überein. So wurden <strong>für</strong> das Rohrkol-<br />
ben-Schnabelseggenried (siehe VF 12) mittels Bioindikation C/N –Werte zwischen 26 <strong>und</strong><br />
33 abgeleitet. Tatsächlich gemessen wurden die Werte 16,8; 20,4 <strong>und</strong> 35,3. Aufgr<strong>und</strong> die-<br />
ser hohen Abweichungen wurde bei der Auswertung vorrangig mit Bioindikation nach<br />
Koska et al. (2001)gearbeitet.<br />
Der Gr<strong>und</strong> <strong>für</strong> diese ungewöhnlich hohen Unterschiede der Meßwerte ist unbekannt. Die<br />
hohen Unterschiede zwischen den gemessenen C/N-Werten treten auch innerhalb der<br />
zwei Probengruppen (Juli 2005 <strong>und</strong> Januar 2006) auf (siehe Absch. 4.2). Die Werte der pH-<br />
Messungen der zwei Probengruppen hingegen ähneln sich sehr <strong>und</strong> unterstützen auch<br />
die Ergebnisse der Bioindikation. Die Werte der pH-Messungen liegen <strong>für</strong> die im Juli 2005<br />
gesammelten Proben zwischen 4,5 <strong>und</strong> 6,9 die der im Januar 2006 gesammelten zwischen<br />
5,4 <strong>und</strong> 6,9. Daher wird davon ausgegangen, dass die Jahreszeit, zu welcher die Proben<br />
gesammelt wurden, keinen Einfluss auf deren Qualität hatte.<br />
Das Rozwarowo-Moor ist nach den Messwertergebnissen <strong>für</strong> pH-Wert <strong>und</strong> C/N-<br />
Verhältnis (siehe Absch. 5.2) als mesotroph-subneutral einzustufen <strong>und</strong> wird nach Suc-<br />
cow (2001) als Basen-Zwischenmoor klassifiziert.<br />
Aus hydrogenetischer Sicht handelt es sich um eine Kombination aus einem Verlandungs-<br />
<strong>und</strong> Versumpfungsmoor, wobei letzteres auf dem Verlandungsmoor bzw. im östlichen<br />
flachgründigen Moorteil aufgewachsen ist (Absch. 6.1.1).<br />
6.2 Bioindikation<br />
6.2.1 Strandastern-Salzbinsen-Rasen (VF 39)<br />
Allein mit Hilfe der Artengruppenzusammensetzung (Koska et al. 2001) war es nicht<br />
möglich den Salzbinsen-Rasen eindeutig der Vegetationsform Strandaster-Salzbinsen-<br />
Rasen zuzuordnen (in Tabelle 5.4: VF (37)/39). Es ist offensichtlich, dass an der Binnen-
Diskussion 47<br />
salzstelle ein topogenes Wasserregime <strong>und</strong> kein Küstenüberflutungsregime vorherrscht.<br />
Anhand von eigenen Bodenproben wurden C/N-Verhältnisse von 15-17 gemessen, welche<br />
<strong>für</strong> eine Zuordnung in die Nährkraftstufe „kräftig“ (k) spricht. Die Zugehörigkeit zur Ve-<br />
getationsform 37, dem Sumpfsimsen-Salzbinsen-Rasen mit Nährkraftstufe mittel (C/N 20-<br />
26), kann somit verneint werden.<br />
6.2.2 Nachtschatten-Schilf-Staudenflur (VF 50)<br />
Die Bestimmung der Vegetationsform der Nachtschatten-Schilf-Staudenflur konnte eben-<br />
falls nicht eindeutig durch die Bioindikation erfolgen. Die stellenweise gemessenen C/N-<br />
Werte liegen zwischen 15 <strong>und</strong> 25 (Median 16,2) <strong>und</strong> zeigen keine polytrophen Nährstoff-<br />
verhältnisse an. Das Auftreten von Symphytum officinale (AG 86), Myosotis palustris (AG 63)<br />
<strong>und</strong> Lysimachia thyrsiflora (AG 54) schließen polytrophe Nährstoffverhältnisse aus. (vgl.<br />
Tab. 4-9 in Koska et al. (2001) S. 148). Diese Arten treten jedoch nur mit äußerst geringer<br />
Stetigkeit <strong>und</strong> Deckung (vgl. Tab. 5.4 <strong>und</strong> Anhang 7) auf. Auf Gr<strong>und</strong> des häufigen Auftre-<br />
tens der Urtica dioica-Gruppe, welche erhöhte Nährstoffverhältnisse anzeigt, wird vermu-<br />
tet, dass es sich hier um inhomogene Bestände mit einem Übergang von eutrophen zu po-<br />
lytrophen Nährstoffverhältnissen handelt. Es erfolgte somit die Zuordnung zur Nacht-<br />
schatten-Schilf-Staudenflur (polytroph).<br />
6.3 Einfluss der Nährstoffverhältnisse auf die Vegetation<br />
Die C/N-Verhältnisse, welche der Trophiestufeneinteilung nach Succow zugr<strong>und</strong>e liegen<br />
gingen aus Analysen nach Kjeldahl <strong>für</strong> Stickstoff <strong>und</strong> Jackson (Ctot) <strong>für</strong> Kohlenstoff her-<br />
vor (Succow (1981) <strong>und</strong> Succow (1988)). Die heute gängige <strong>und</strong> hier angewandte C/N-<br />
Verhältnisbestimmung nach Dumas führt allgemein zu niedrigeren Werten, da durch<br />
Kjeldahl nur etwa 59 % des Stickstoffes gegenüber Dumas erfasst werden (Bornmann<br />
1975). Vergleicht man die Ergebnisse der C/N-Verhältnisanalyse mit den Ergebnissen der<br />
Vegetationsaufnahmen <strong>und</strong> Bioindikation, so wird deutlich, dass die Vegetation des<br />
Rozwarowo-Moors der Trophiestufeneingrenzung nach Succow entspricht (siehe Tab.<br />
5.1). 10 % der Werte liegen im oligotrophen Bereich, 47 % im mesotrophen Bereich <strong>und</strong><br />
43 % im eutrophen Bereich (Trophiestufen nach Sccow (Succow & Stegmann 2001))( vgl.
48 Diskussion<br />
Abb. 5.2). Erfolgt eine Einordnung nach den Trophiestufengrenzen nach Joosten & Do-<br />
main mdl. (2005) in Kahrmann & Haberl (2005) wonach die Unterschiede der beiden Ana-<br />
lysemethoden durch einen Korrekturfaktor bereinigt werden sollten, lägen 36 % der Ana-<br />
lysewerte im oligotrophen Bereich. Im gesamten Rozwarowo-Moor wurden jedoch keine<br />
Flächen mit oligotrophe Bedingungen anzeigender Vegetation ( z.B. Sphagnum spec.) an-<br />
getroffen. Nur 7 % ( 2 Werte) liegen nach diesen Grenzen im eutrophen Bereich. Es wur-<br />
den jedoch mehrfach Standorte mit Urtica dioica <strong>und</strong> Calystegia sepium untersucht. Diese<br />
beiden Pflanzenarten weisen auf eutrophe Standortbedingungen hin. Daher werden die<br />
Trophiestufen nach Joosten & Domain (2005, mdl.) <strong>für</strong> die Beschreibung der Standortver-<br />
hältnisse im Rozwarowo-Moor als ungeeignet betrachtet.<br />
Bezüglich der C/N-Verhältnisse <strong>und</strong> der pH-Werte zeigten sich keine signifikanten Unter-<br />
schiede (Mann-Whitney-U-Test, siehe Anhang 9 <strong>und</strong> 10) zwischen den einzelnen VSE.<br />
Gründe da<strong>für</strong> sind wahrscheinlich die weite Streuung der C/N-Werte <strong>und</strong> einige Ex-<br />
tremwerte. So wurden beispielsweise in VSE 2 ein Wert von 40,2 (B15) <strong>und</strong> in VSE 3 ein<br />
Wert von 48,3 (B2) gemessen (siehe Anhang 11). Solche C/N-Verhältnisse sind nur aus<br />
armen Mooren bekannt <strong>und</strong> weisen auf oligotroph-saure Bedingungen hin (Succow 2001).<br />
Im Gegensatz dazu wurden jedoch in denselben Proben pH-Werte im subneutralen Be-<br />
reich (6,4 <strong>und</strong> 6,0) gemessen (Succow 2001). Es ist daher davon auszugehen, dass hier<br />
höchstwahrscheinlich fehlerhafte Messwerte der C/N-Verhältnisse vorliegen. Wodurch<br />
diese Fehler hervorgerufen wurden, ist unbekannt. Vergleiche mit der am jeweiligen<br />
Standort angetroffenen Vegetation, die in diesen VSE auf mesotrophe Standortverhältnis-<br />
se hindeutet, bestätigen diese Annahme. Aufgr<strong>und</strong> der kleinen Stichprobenmenge war es<br />
nicht möglich, diese Werte bei der statistischen Datenauswertung auszuschließen.<br />
Es wird folglich davon ausgegangen, dass im Untersuchungsgebiet überwiegend me-<br />
sotrophe neben stellenweise auftretenden eu- bis polytrophe Nährstoffverhältnisse vor-<br />
liegen. Unterschiede der Vegetationsdecke werden daher vorrangig auf die Flächenbe-<br />
wirtschaftung zurückgeführt. Dabei stehen Bewirtschaftungsmaßnahmen wie Mahd <strong>und</strong><br />
die Regulation der Wasserstände im Vordergr<strong>und</strong>.
Diskussion 49<br />
6.4 Einflußfaktoren auf die Ansiedlung des Seggenrohrsängers<br />
6.4.1 Vegetation<br />
6.4.1.1 Ableitung der relevanten Vegetationsverhältnisse aus Untersuchungen verschiedener<br />
Seggenrohrsängerbrutgebiete<br />
Allgemein wird das Bruthabitat des Seggenrohrsängers von Schulze-Hagen (1991) als<br />
„weitflächige, homogen strukturierte <strong>und</strong> überflutete bzw. nasse Fluren, von nicht zu<br />
breitblättrigen Gräsern mit geringer Vegetationsdichte, in < 50 cm Höhe <strong>und</strong> geringer An-<br />
zahl über dieses Niveau aufragender Strukturen“ beschrieben. Kozulin & Flade (1999) be-<br />
schreiben <strong>für</strong> Weißrussland mehrere Assoziationen des Magno-Caricion elatae als optimale<br />
Habitatbildner. Hohe Brutdichten wurden hier vor allem in „Seggen-Hypnum-Mooren“<br />
gef<strong>und</strong>en. Dahingegen werden Flächen mit Phragmites australis eher gemieden. Dies gilt<br />
ebenfalls <strong>für</strong> die Brutgebiete an der Biebrza in Ostpolen. Hohe Brutdichten wurden hier<br />
hauptsächlich in offenen Seggenrieden beobachtet (Dyrcz & Zdunek (1993) <strong>und</strong><br />
Kloskowski & Krogulec (1999)). Andere Untersuchungen ergaben, das homogene Seggen-<br />
<strong>und</strong> Cladium-riede optimale Bruthabitate <strong>für</strong> die Seggenrohrsänger bilden (Aquatic Warb-<br />
ler Conservation Team 1999). In Ungarn wurden die höchsten Brutdichten in relativ trok-<br />
kener Sumpf- <strong>und</strong> Niedermoorvegetation festgestellt (Kovacs & Vegvari 1999).<br />
Die Brutgebiete der Pommerschen Population sind sowohl von Seggen-Süßgras-<br />
Mischvegetation ( NLP „Unteres Odertal“, Wiesen bei Krajnik <strong>und</strong> NLP „Ujscie Warty“)<br />
als auch von Schilf charakterisiert (NLP „Wolinski“, Rozwarowo-Moor) (Tanneberger et<br />
al. 2005).<br />
Anhand der Beschreibungen der verschiedenen Seggenrohrsänger-Brutgebiete mit ihrer<br />
unterschiedlichen Artenausstattung wird deutlich, dass es <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger we-<br />
nig von Bedeutung zu sein scheint, aus welchen Pflanzenarten die Vegetation in den von<br />
ihm besiedelten Habitaten aufgebaut wird. Vor allem Vegetationsstruktur, Wasserver-<br />
hältnisse <strong>und</strong> Nahrungsangebot, welches von den ersteren beiden abhängt, spielen bei<br />
der Brutplatzwahl eine Rolle.
50 Diskussion<br />
Dabei lassen sich folgende Gemeinsamkeiten feststellen:<br />
1. Die Vegetation sollte im Jahresverlauf eine Höhe von ca. 1-1,5 m nicht überschrei-<br />
ten.<br />
2. Die Vegetation sollte homogen <strong>und</strong> <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger übersichtlich sein,<br />
ohne Bäume, Sträucher <strong>und</strong> hohe Schilfhalme o.ä., die das Hauptniveau der Vege-<br />
tation überragen.<br />
3. Die Vegetation sollte nicht zu dichte Bestände bilden. Seggenrohrsänger müssen<br />
sich innerhalb der Vegetation bewegen können, um Nahrung zu suchen. Für<br />
Schilfbestände werden maximale Halmdichten von 100 Halmen/m² (Kloskowski &<br />
Krogulec 1999) bis zu 200-300 Halmen/m² (Sellin 1989) angegeben. Diese großen<br />
Unterschiede ergeben sich wahrscheinlich aus der Tatsache, dass Schilfbestände,<br />
auch wenn sie homogen aussehen in ihrer Dichte (Halme/m²) sehr variieren kön-<br />
nen, da die Halme ungleichmäßig verteilt sind. Verschieden dichte Schilfbestände<br />
werden vermutlich auch vom Seggenrohrsänger in unterschiedlicher Weise ge-<br />
nutzt. Lockere Bestände werden wahrscheinlich als Singwarte <strong>und</strong> zur Nahrungs-<br />
suche bevorzugt aufgesucht, wobei in dichtere Beständen Schutz gesucht <strong>und</strong> Nes-<br />
ter gebaut werden. Eine <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger „optimale“ Schilfdichte gibt es<br />
daher nicht. Wichtig sind hier eher Mittelwert <strong>und</strong> Spannweite der Halmdichten<br />
(K. Ziarnek mdl.). Im Rozwarowo-Moor liegt die durchschnittliche Schilfhalm-<br />
dichte auf vom Seggenrohrsänger besiedelten Flächen bei 150 Halme/m², die<br />
Spannweite beträgt 40-324 Halme/m² (K. Ziarnek mdl.).<br />
In Abb. 6.3 sind <strong>für</strong> die einzelnen Kartiereinheiten Deckungsgrad <strong>und</strong> Höhe der Kraut-<br />
schichten 1 <strong>und</strong> 2 dargestellt.<br />
Die Schilfbestände der eutrophen Grabenränder <strong>und</strong> die reinen Schilfbestände (Einheit 1<br />
<strong>und</strong> 4) zeichnen sich durch eine sehr hohe KS 2 mit hohem Deckungsanteil aus. Durch<br />
den somit verursachten Lichtmangel wächst die untere Krautschicht (KS 1) zwar relativ<br />
hoch auf, nimmt jedoch eine geringe Deckung ein. Diese Bestände sind daher relativ dun-<br />
kel <strong>und</strong> dicht. Des Weiteren ist der Wasserstand über der GOF relativ hoch, so dass sich<br />
hier wahrscheinlich keine Nistplatzflächen finden (siehe auch Tab. 5.4). Somit stellen sie<br />
keine geeigneten Brutflächen <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger dar.
Diskussion 51<br />
Die niedrige schilffreie Vegetation <strong>und</strong> die Vegetation der Binnensalzstelle (VSE 6 <strong>und</strong> 7)<br />
bedecken nur relativ kleine Flächen. Auf der Fläche der Kartiereinheit 6 sind bisher keine<br />
Vorkommen von Seggenrohrsängern bekannt. Eine Ansiedlung wäre aber auf Gr<strong>und</strong> der<br />
strukturell als geeignet erscheinenden Vegetationsdecke möglich. Die Salzwiese (7) wird<br />
im Sommerhalbjahr gemäht <strong>und</strong> spielt als geeignetes Habitat keine Rolle. Die Schilfbe-<br />
stände mit Thelypteris palustris, Schilfbestände mit hohem Seggenanteil <strong>und</strong> ungenutzte<br />
Sumpfvegetation ohne Schilf (Einheiten 2, 3 <strong>und</strong> 5) bieten hingegen fast gegensätzliche<br />
Bedingungen. Die Höhe des Schilfes beträgt hier im Sommer durchschnittlich 1,5 m, die<br />
Höhe der Kräuter 0,8 m. Die relativ hohe Deckung der Krautschicht 1 beträgt durch-<br />
schnittlich 70 %.<br />
Höhe Krautschicht 1 [m]<br />
Deckung Krautschicht 1 [%]<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
.5<br />
0.0<br />
N =<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
N =<br />
7<br />
1<br />
7<br />
1<br />
29<br />
2<br />
29<br />
2<br />
7<br />
3<br />
14<br />
4<br />
Kartiereinheiten<br />
7<br />
3<br />
14<br />
4<br />
Kartiereinheiten<br />
11<br />
5<br />
11<br />
5<br />
3<br />
6<br />
3<br />
6<br />
2<br />
7<br />
2<br />
7<br />
Höhe Krautschicht 2 [m]<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
.5<br />
0.0<br />
N =<br />
N =<br />
7<br />
1<br />
7<br />
29<br />
2<br />
29<br />
7<br />
3<br />
14<br />
4<br />
Kartiereinheiten<br />
7<br />
14<br />
Kartiereinheiten<br />
Abb. 6.3: Medianwerte der Höhe <strong>und</strong> Deckung der Vegetation in den einzelnen Kartiereinheiten<br />
Erklärung der Boxplots: Linie im Kasten: Median, Kastenunterkante: 1. Quantil (25%), Kastenoberkante:<br />
3. Quantil (75%), Kastenlänge: Interquantilabstand (IQA), Querlinien: Streuung der<br />
Werte über dem 1. Quantil <strong>und</strong> unterhalb des 3. Quantils (1,5*IQA), Kreis: Ausreißer, Zahlenangaben<br />
(N): Stichprobenanzahl. Kartiereinheiten: 1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder , 2.<br />
Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände,<br />
5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf, 6. niedrige schilffreie Vegetation, 7. Vegetation<br />
der Binnensalzstelle.<br />
Deckung Krautschicht 2 [%]<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
11<br />
5<br />
11<br />
5<br />
3<br />
6<br />
3<br />
6<br />
2<br />
7<br />
2<br />
7
52 Diskussion<br />
Die mäßig hohe Krautschicht 2 (Phragmites australis) läßt genug Licht einfallen, dass sich<br />
eine kräftige Krautschicht 1 entwickeln kann, welche im darauf folgenden Jahr eine Streu-<br />
schicht aus abgestorbenen Pflanzenmaterial bildet, auch wenn das Schilf im Winter ent-<br />
fernt wird. Diese Verhältnisse stellen auf Gr<strong>und</strong> der im Sommer lichten Struktur, günstige<br />
Habitate <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger dar (vgl. Schulze-Hagen (1991) <strong>und</strong> Leisler (1988))<br />
<strong>und</strong> können somit als Leitbild <strong>für</strong> geeignete Seggenrohrsängerhabitate im Rozwaro-<br />
wo-Moor angesehen werden.<br />
6.4.1.2 Vergleich der ornithologischen Kartierung der Jahre 1993 <strong>und</strong> 2003-2006 mit der<br />
Vegetationskarte des Jahres 2005<br />
In Abb. 6.5 ist die Besiedlung des Rozwarowo-Moors durch den Seggenrohrsänger in ver-<br />
schiedenen Beobachtungsjahren dargestellt. Die Daten der ornithologischen Kartierung<br />
wurden mit den Ergebnissen der Vegetationskartierung 2005 unterlegt. Um die Übertra-<br />
gung der Vegetationsverhältnisse von 2005 auf den Zustand von 1993 zu rechtfertigen,<br />
werden die heutigen Vegetationsverhältnisse im Rozwarowo-Moor mit einer groben Be-<br />
schreibung der Vegetation im Jahre 1993 (Czeraszkiewicz 1993) verglichen. Die Vegetati-<br />
onsausstattung blieb im Vergleich der Jahre 1993 <strong>und</strong> 2005 abgesehen von zwei Ausnah-<br />
men relativ konstant. So lag der Anteil von Schilf auf der Fläche B (siehe Abb. 6.4) zwi-<br />
schen den beiden mineralischen Inseln 1993 bei 30 % (Czeraszkiewicz 1993). Auf zwei Flä-<br />
chen im östlichen Moorgebiet ist eine deutliche Zunahme von Phragmites australis zu ver-<br />
zeichnen. Noch heute sind dort viele Sauergräser (1993: 60 %) im Unterwuchs vertreten,<br />
der Anteil an Phragmites australis liegt jedoch heute bei mindestens 60 %. Da jedoch die<br />
Vegetationshöhe von (Czeraszkiewicz 1993) auf dieser Fläche mit 120 cm angegeben wur-<br />
de, kann davon ausgegangen werden, dass es sich hier um hoch- <strong>und</strong> dichtwüchsige Seg-<br />
gen wie z.B. Carex acutiformis gehandelt haben muss, die auch heute noch häufig an den<br />
Grabenrändern vorkommt.<br />
Die physiognomischen Merkmale der Vegetationsdecke sollten deshalb den heutigen ähn-<br />
lich gewesen sein. Auch auf der kleineren Fläche war der Seggenbestand im Jahr 1993 mit<br />
70 % laut (Czeraszkiewicz 1993) höher als im Jahr 2005 mit ca. 30 %. Die Höhe der Vegeta-<br />
tion betrug nur 30-60 cm (2005 ca. 12 cm). Diese Fläche ist jedoch relativ klein <strong>und</strong> wurde<br />
in Sommer 2005 teilweise gemäht, so dass sie hier vernachlässigt wird. Die momentan
Diskussion 53<br />
vom Seggenrohrsänger besiedelten Flächen (siehe Abb. 6.5), welche überwiegend westlich<br />
der Grzybnica liegen, waren jedoch schon 1993 überwiegend von Schilf geprägt (1993:<br />
90 %) (Czeraszkiewicz 1993). Der nordwestliche Teil des Untersuchungsgebietes wurde<br />
1993 nicht beschrieben (Fläche C) (alle besprochenen Flächen: siehe Abb. 6.4).<br />
Auffallend ist der Wechsel der Besiedlung von den nordöstlich gelegenen Seggenrieden<br />
im Jahr 1993 zu den von Phragmites australis dominierten südwestlichen Flächen in den<br />
Jahren 2003-2006. Während 1993 die Seggenrohrsänger Flächen besiedelten, die heute in<br />
drei verschiedene Vegetationsstruktureinheiten (VSE 2, 3 <strong>und</strong> 5) aufgeteilt sind, konzent-<br />
rieren sich die Vorkommen heute auf Schilfbestände mit Thelypteris palustris (VSE 2) <strong>und</strong><br />
Schilfbestände mit hohem Seggenanteil (VSE 3). Diese Entwicklung ist sehr wahrschein-<br />
lich auf den von den Eigentümer verursachten hohen Wasserstau auf den Flächen <strong>und</strong><br />
der somit verb<strong>und</strong>enen die Förderung von Phragmites australis zurückzuführen. Für die<br />
Aufgabe der Brut in den Seggenrieden <strong>und</strong> eine aktuelle ausschließliche Brut in schilfdo-<br />
minierten Flächen des Rozwarowo-Moors gibt es wahrscheinlich mehrere Ursachen:<br />
1. Wasserstandsregulation im Gebiet: Auf der Ostseite des Moores wird das Wasser<br />
in Frühjahr sehr hoch angestaut (ca. >20 cm über der GOF), darüber hinaus sind<br />
die bewirtschafteten Flächen, im Gegensatz zu den Flächen auf der Westseite nicht<br />
vollständig eingedeicht. So kann bei Meeresspiegelschwankungen der Ostsee zu-<br />
sätzlich Brackwasser aus dem Camminer Bodden über die Grzybnica in die Flä-<br />
chen eindringen.<br />
Abb. 6.4: Karte der Vegetationsstruktureinheiten<br />
(2005) mit Seggenrohrsängernachweisen<br />
(sM) (1993). Die Ellipsen<br />
markieren die im Text<br />
besprochenen Flächen<br />
(Abschnitt 6.4.1.2)<br />
(Legende siehe Abb. 6.5,<br />
Kartengr<strong>und</strong>lage: (Symon<br />
1990))<br />
1993<br />
C<br />
A<br />
B<br />
1 Kilometer
54 Diskussion<br />
Die eingedeichten Flächen auf der Westseite zeichnen sich hingegen durch sehr<br />
konstante <strong>und</strong> niedrigere Wasserstände (ca. 0 bis 15 cm über der GOF) aus. Sie<br />
werden momentan als besonders geeignete Bruthabitate eingeschätzt <strong>und</strong> wurden<br />
in den letzten Jahren vom Seggenrohrsänger bevorzugt aufgesucht.<br />
2. Verbuschung: Auf der Ostseite des Moores, östlich des nord-südlich verlaufenden<br />
Grabens, befinden sich größere Flächen schilffreier Seggenriede, welche nicht ge-<br />
nutzt werden. Das stellenweise Aufwachsen von Erlen <strong>und</strong> Weidengebüschen ist<br />
die Folge. Diese dadurch stark strukturierten inhomogenen Gebüsche <strong>und</strong> Röh-<br />
richtbestände entsprechen nicht mehr der Habitatpräferenz des Seggenrohrsän-<br />
gers.<br />
3. mögliche Nutzungsaufgabe: Es ist möglich, dass eine Veränderung der Vegetati-<br />
onsstruktur der Seggenriede nach einer Aufgabe extensiver Nutzung (möglicher-<br />
weise Mahd oder Beweidung) stattgef<strong>und</strong>en hat. Da über die Nutzung des Unter-<br />
suchungsgebietes zwischen 1945 <strong>und</strong> 1989 so gut wie nichts bekannt ist, kann dies<br />
jedoch nur eine Vermutung bleiben.<br />
Ein Wechsel des Brutgebietes aus ähnlichen Gründen ist auch aus dem NLP „Unteres O-<br />
dertal“ bekannt. Hier wurden in den 1990iger Jahren Süßgrasbestände (Knickfuchs-<br />
schwanzgesellschaften) Schlankseggenrieden (Carex acuta) vorgezogen (Bellebaum & Just<br />
2003; Tanneberger et al. 2006). Als Ursache wird die Nutzungsaufgabe (Mahd) auf den<br />
von Seggen dominierten Flächen angegeben, infolgedessen die Vegetation stetig höher<br />
<strong>und</strong> dichter aufwächst.<br />
2006 wurde erstmals nach 1993 wieder verstärkt die Osthälfte des Rozwarowo-Moors<br />
vom Seggenrohrsänger besiedelt. Dabei beschränkt sich die Ansiedlung streng auf Flä-<br />
chen der Kartiereinheiten 2 <strong>und</strong> 3. Diese positive Entwicklung zeigt, dass geeignete Habi-<br />
tate angenommen werden. Eine Sicherung des gegenwärtigen Zustands der Flächen ist<br />
daher unbedingt nötig, um die gegenwärtige Population zu stabilisieren. Weiterhin könn-<br />
te eine Ausweitung der als Leitbild angesehenen Standortverhältnisse der Kartiereinhei-<br />
ten 2 <strong>und</strong> 3 zu deren Anwachsen beitragen.
Diskussion 55<br />
1993 2003<br />
2004<br />
2006<br />
1 Kilometer<br />
Abb. 6.5: Vorkommen von Seggenrohrsängern in den Jahren 1993 <strong>und</strong> 2003-2006 auf der Vegetationskarte<br />
6.4.2 Anforderungen vom Juli 2005 dargestellt. an den Wasserstand<br />
(Kartengr<strong>und</strong>lage: (Symon 1990))<br />
2005<br />
Seggenrohrsänger (sM)<br />
Schilfbestände der eutrophen Grabenränder (VSE 1)<br />
Schilfbestände mit Thelypteris palustris (VSE 2)<br />
Schilfbestände mit Thelypteris palustris <strong>und</strong> Myrica gale (VSE 2)<br />
Schilfbestände mit hohem Seggenanteil (VSE 3)<br />
reine Schilfbestände (VSE 4)<br />
ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf (VSE 5)<br />
niedrige schilffreie Vegetation mit hohem<br />
Anteil an Myrica gale (VSE 6)<br />
Vegetation der Binnensalzstelle (VSE 7)<br />
Vegetation der Gräben (VSE 8)<br />
Weidengebüsch<br />
Erlengebüsch<br />
gestörte Flächen<br />
häufig wechselnde Einheiten, schwer begehbare Flächen, daher<br />
keine genaue Kartierung möglich
56 Diskussion<br />
In Weißrussland wurden die höchsten Dichten von Seggenrohrsängern (sM) in Mooren<br />
mit einem relativ konstanten Wasserstand (Fluktuationen < 20 cm) an der GOF angetrof-<br />
fen (Kozulin & Flade 1999). Aus Ungarn sind im Gegensatz dazu auch Brutvorkommen<br />
auf trockenem Grasland bekannt, zudem ist in extrem trockenen Jahren (1992-1994) ein<br />
Populationszuwachs verzeichnet worden (Kovacs & Vegvari 1999). Zu hoch überflutete<br />
Flächen werden vom Seggenrohrsänger nicht besiedelt. Das Weibchen baut sein Nest<br />
entweder auf Seggenbulten oder direkt auf den Erdboden (Schulze-Hagen 1991). Sind in<br />
einer seggenärmeren Vegetation wie in großen Teilen des Rozwarowo-Moores keine Bulte<br />
oder andere den Wasserspiegel überragende Strukturen vorhanden, zum Beispiel abge-<br />
storbene Pflanzenreste, können bei hohem Wasserstand keine Nester angelegt werden.<br />
Im Rozwarowo-Moor werden <strong>für</strong> die Ansiedlung des Seggenrohrsängers Wasserstände<br />
von bis zu 10 cm über der GOF (Mai) (M. Dylawerski mdl.) als günstig eingeschätzt. Auch<br />
im weißrussischen Brutgebiet „Sporovskiy“ fand man die höchste Dichte an sM auf Flä-<br />
chen mit einem Wasserstand von 0 – 10 cm über der GOF (Kozulin et al. 2004). Diese kön-<br />
nen daher aus hydrologischer Sicht als Leitbild <strong>für</strong> die Entwicklung geeigneter Seggen-<br />
rohrsängerhabitate gelten.<br />
Derartigen Bedingungen werden im Rozwarowo-Moor vor allem auf Flächen der Vegeta-<br />
tionsstruktureinheiten 2 <strong>und</strong> 3 (Schilfbestände mit Thelypteris palustris <strong>und</strong> Schilfbestände<br />
mit hohem Seggenanteil) auf der Westseite des Moores vorgef<strong>und</strong>en. Im Frühjahr steht<br />
das Wasser bis zu 15 cm in der Fläche, in den Sommermonaten hingegen sinkt der Was-<br />
serstand stellenweise unter die GOF. Im Gegensatz dazu wird auf der Ostseite auch in<br />
den Sommermonaten ein Überstau der Schilfflächen mit Thelypteris palustris durch das<br />
Einstauen der Wołczenica beibehalten.
Diskussion 57<br />
6.5 Einfluß der Rohrwerbung auf die Entwicklung der Flächen<br />
Der Verkauf der Moorflächen 1994 an private Schilfbauern wurde von polnischen Natur-<br />
schützern überwiegend negativ aufgefasst. Sie be<strong>für</strong>chteten einen tiefgreifenden Umbau<br />
der Flächen <strong>und</strong> damit den Verlust der Seggenrohrsängerhabitate. Durch großflächigen<br />
Wassereinstau wurde die Ausbreitung von Phragmites australis von den Schilfbauern stark<br />
gefördert. In den 90er Jahren waren ca. 25 % der Flächen mit Schilf bewachsen (OTOP<br />
2005), heute sind es dagegen 80-90 %. Tatsächlich sank der Bestand der Seggenrohrsän-<br />
gerpopulation nach Beginn der kommerziellen Rohrmahd scheinbar um die Hälfte (Abb.<br />
3.5). Bewiesen ist diese Annahme jedoch nicht, da während des Beobachtungszeitraumes<br />
von 1991 bis 2006 der Bestand von verschiedenen Personen erfaßt wurde (F. Tanneberger<br />
mdl.) (siehe Absch. 3.7).<br />
Rohr wird im Winter von ca. November bis Anfang April geworben. Im Frühjahr <strong>und</strong><br />
Sommer, also zur Brutzeit des Seggenrohrsängers findet so gut wie keine Störung im Ge-<br />
biet statt. Unterhaltungsmaßnahmen der Gräben <strong>und</strong> Wege beschränken sich auf punktu-<br />
elle, kurzzeitige Lärmstörungen durch Bagger. In dieser Hinsicht ist die Nutzung des<br />
Moorgebietes auf einen Zeitraum konzentriert, in dem sich der Seggenrohrsänger in den<br />
Überwinterungsgebieten aufhält.<br />
Abb. 6.6: Schilfmahd im<br />
Januar 2006 in Rozwarowo<br />
Das Bild zeigt eine mit fünf<br />
Personen betriebene Erntemaschine.<br />
(Foto: Franziska Tanneberger,<br />
Jan. 2006).
58 Diskussion<br />
Auch hinsichtlich der Nährstoffverhältnisse ergänzen sich die Interessen der Schilfbauern<br />
<strong>und</strong> Naturschützer: Durch die Mahd werden dem Gebiet regelmäßig geringe Mengen von<br />
Nährstoffen entzogen. Bei Nährstoffgehalten von 0,21-0,47 % Stickstoff, 0,01-0,05 % Phos-<br />
phor <strong>und</strong> 0,12-0,37 % Kalium in der Halmtrockenmasse (November/Dezember) (Sieghardt<br />
& Maier 1985) können dem Moor pro geerntete Tonne Schilftrockenmasse 2,1 -4,7 kg<br />
Stickstoff, 0,1-0,5 kg Phosphor <strong>und</strong> 1,2-3,7 kg Kalium entzogen werden. Auf diese Weise<br />
entwickeln sich langsam Standorte mit mesotrophen Nährstoffverhältnissen, auf welchen<br />
überwiegend das sogenannte „first class reed“ wächst.<br />
Abb. 6.7: Vergleich von „first class reed“ <strong>und</strong> „second class reed”<br />
links: Vergleich von Halmdurchmessern. oben: „first class reed“. links unten: „second class reed“.<br />
rechts: Vergleich von Schilfhalmen. Im Gegensatz zu den äußeren („first class“) geradewüchsigen<br />
kurzen Halmen ist der mittlere („second class“) länger, jedoch von kantig ungeradem Wuchs <strong>und</strong><br />
weniger stabil.
Diskussion 59<br />
Stabiles, dünnes <strong>und</strong> relativ kurzes Schilf (first class reed) wird gegenüber sehr langem,<br />
brüchigem Schilf mit großem Halmdurchmesser <strong>und</strong> in sich schiefen Wuchs (second class<br />
reed) in Rozwarowo <strong>für</strong> die Dachdeckerei bevorzugt <strong>und</strong> wird vor allem an Giebeln <strong>und</strong><br />
Fensterpartien verwandt (vgl. Abb. 6.7). Dachpartien dieses „first class reed“ zeichnen<br />
sich durch eine längere Haltbarkeit aus. Sie sind stabiler <strong>und</strong> weniger wasserdurchlässig.<br />
Durch das Entfernen der abgestorbenen Schilfhalme ist die Vegetation im Frühjahr sehr<br />
niedrig <strong>und</strong> homogen, neben Schilf wächst auch eine kräftige Krautschicht, diese Struktu-<br />
ren werden vom Seggenrohrsänger bevorzugt.<br />
Dahingegen werden Verbuschung <strong>und</strong> inhomogene Vegetation vom Seggenrohrsänger<br />
gemieden. Durch die Schilfmahd wird das Aufwachsen von Gehölzen weitgehend unter-<br />
drückt. Darüber hinaus werden Gehölzinseln <strong>und</strong> an den Moorrändern stockender Er-<br />
lenwald zur Vergrößerung der Schilfanbaufläche entfernt.<br />
Allein hinsichtlich der Feuchtigkeitsverhältnisse treten divergierende Interessen auf. Für<br />
das Schilfwachstum sind ganzjährig Flachwasserverhältnisse günstig (Wasserstand über<br />
der GOF 10-25 cm). So hoch überstaute Flächen werden vom Seggenrohrsänger nicht be-<br />
siedelt. Da die Wasserstände im Gelände der Schilfplantagen über Gewässereinstau sowie<br />
Gräben <strong>und</strong> Deiche geregelt sind, könnten hier entsprechende Maßnahmen auch im Zuge<br />
des EU-LIFE-Projektes zum Schutz des Seggenrohrsängers ergriffen werden.<br />
Tab. 6.1: Vergleich der „Interessen“ von Schilfbauern <strong>und</strong> Seggenrohrsänger im Untersuchungsgebiet.<br />
(+ = positiv, - = negativ, (-) = zum Teil negativ<br />
Schilfbauer Seggenrohrsänger<br />
Schilfbestand < 1 m - +<br />
Schilfbestand 1 - 1,5 m + +<br />
Schilfbestand 1,5 - 2 m + ( - )<br />
Schilfbestand > 2 m - -<br />
Unterwuchs (Kräuter) (-) +<br />
Wintermahd + +<br />
mesotrophe Nährstoffverhältnisse + +<br />
Wasserstand > 10 cm + -<br />
Gehölzaufwuchs - -
60 Diskussion<br />
6.6 Schutzmaßnahmen im Rozwarowo-Moor<br />
Das Ziel des von 2005 bis 2010 laufenden EU-LIFE Projekts “Conserving Acrocephalus pa-<br />
ludicola in Poland and Germany” (kurz: AW LIFE project) ist es, eine Basis <strong>für</strong> die Be-<br />
standssicherung <strong>und</strong> das Wiederanwachsen der Seggenrohrsängerpopulationen in Polen<br />
<strong>und</strong> Deutschland zu schaffen. Da<strong>für</strong> sollen 1500 ha neue potentielle Seggenrohrsängerha-<br />
bitate geschaffen <strong>und</strong> 1500 ha bestehende Habitate optimiert werden. Für die Langzeitsi-<br />
cherung dieser sollten kostendeckende Methoden der Flächennutzung <strong>und</strong> Pflege entwi-<br />
ckelt werden (OTOP 2005).<br />
Um diese Ziele zu erreichen wurden aus verschiedenen Brutgebieten neun Projektflächen<br />
ausgewählt. Entsprechend der Ausstattung der Habitate wurde eine Vielzahl von Metho-<br />
den des Lebensraummanagements durchgeführt <strong>und</strong> durch ein paralleles Monitoring der<br />
Habitatschlüsselfaktoren <strong>und</strong> Brutzahlen bewertet, um <strong>für</strong> jedes Habitat die am besten<br />
geeignete Methode des Habitatmanagements zu finden (OTOP 2005). Das Rozwarowo-<br />
Moor ist eines dieser Projekthabitate. Hier wird auf Versuchsflächen der Einfluss von<br />
Winter- <strong>und</strong> Sommermahd untersucht. Die Auswirkungen werden anhand der sich ein-<br />
stellenden Vegetationsstruktur, hydrologischer Verhältnisse, Nahrungsangebot <strong>und</strong><br />
schließlich der Brutzahlen überprüft. Das EU-LIFE Projekt legt ein besonderes Augen-<br />
merk auf die Einrichtung eines kostendeckenden Habitatmanagements. Dieses ist unter<br />
den derzeitigen Besitzverhältnissen nur durch eine im Winter stattfindende Schilfmahd<br />
möglich. Daher wird an dieser Stelle die Option der flächendeckenden Sommermahd als<br />
nicht praktikabel bewertet.<br />
Die Rohrwerberei stellt in der Region einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, welcher viele<br />
Arbeitsplätze schafft. Um den Seggenrohrsänger im Rozwarowo-Moor dauerhaft zu<br />
schützen, wird es nötig sein, die Interessen der Rohrwerber <strong>und</strong> des Naturschutzes noch<br />
stärker zu vereinen.<br />
In Abb. 6.8 sind die aktuell durch den Seggenrohrsänger besiedelten Moorflächen darge-<br />
stellt. Weitere Moorflächen werden auf Gr<strong>und</strong> ihrer Vegetationsstruktur als derzeit po-<br />
tenzielle Habitate angesehen, sind aber derzeit vom Seggenrohrsänger nicht besiedelt.
Diskussion 61<br />
Wie in Abschnitt 6.5 dargestellt sind die Habitate des Seggenrohrsängers vor allem durch<br />
den hohen Wassereinstau im Gebiet bedroht. Eine Intensivierung dieser Praxis ist in Zu-<br />
kunft zur Produktionssteigerung zu erwarten <strong>und</strong> könnte zwei negative Folgen haben:<br />
1. Durch den stetig hohen Wasserstand gehen Nistplatzmöglichkeiten verloren<br />
<strong>und</strong> die besiedelbare Fläche verkleinert sich.<br />
2. Durch das so geförderte Schilfwachstum bildet sich keine Krautschicht mehr <strong>und</strong><br />
die lockere zweistufige Vegetationsstruktur der jetzigen Habitate geht verloren.<br />
Abb. 6.8: Aktuelle <strong>und</strong> potenzielle Seggenrohrsängerhabitate im Rozwarowo-Moor<br />
Kartengr<strong>und</strong>lage: (Symon 1990).
62 Diskussion<br />
Seitens der Landbesitzer besteht ein großes Interesses am Schutz des Seggenrohrsängers.<br />
So wurden beispielweise an mehreren Stellen Beobachtungstürme errichtet <strong>und</strong> die Na-<br />
turschutzarbeit im Rozwarowo-Moor jederzeit bereitwillig unterstützt. Daher besteht<br />
große Hoffnung, dass sich die Interessen von Rohrwerbern <strong>und</strong> Seggenrohrsängerschüt-<br />
zern auch in Zukunft vereinen lassen.<br />
Zum Erhalt <strong>und</strong> zur Vergrößerung von geeigneten Brutflächen werden folgende Maß-<br />
nahmen empfohlen:<br />
1. Die im Rozwarowo-Moor vorherrschenden mesotrophen Nährstoffverhält-<br />
nisse, als Voraussetzung <strong>für</strong> die Entwicklung einer kräftigen Krautschicht<br />
neben Phragmites australis müssen erhalten bleiben. Daher sollten Mög-<br />
lichkeiten erdacht werden, wie eine mögliche, schleichende Eutrophierung<br />
des Rozwarowo-Moors durch die unmittelbar angrenzenden landwirt-<br />
schaftlich genutzten Flächen <strong>und</strong> die Grzybnica vermieden werden kann.<br />
2. Die Schilfmahd sollte bewahrt werden, um das Aufwachsen von Gehölzen<br />
im Moor zu verhindern. Darüber hinaus wird durch die Entfernung der<br />
abgestorbenen Schilfhalme <strong>für</strong> eine homogene <strong>und</strong> niedrige Vegetations-<br />
struktur im Frühjahr gesorgt. Die Schilfmahd stellt eine kostendeckende<br />
Form der Flächenpflege im Rozwarowo-Moor dar.<br />
3. Die aktuell vom Seggenrohrsänger besiedelten Flächen (siehe Abb. 6.10)<br />
müssen als Habitate erhalten werden. Da<strong>für</strong> muss auch in Zukunft auf ei-<br />
nen übermäßigen Wassereinstau ( > 10 cm, April-Juli) verzichtet werden.<br />
4. In den auf Gr<strong>und</strong> ihrer vorhandenen Vegetationsstruktur als potenzielle<br />
Seggenrohrsängerhabitate gekennzeichneten Flächen (siehe Abb. 6.10)<br />
müssen die Wasserstände auf 0-10 cm (April-Juli) abgesenkt werden.<br />
Um daraus resultierende mögliche Produktionsrückgänge der Rohrwerber zu entschädi-<br />
gen, könnten Baumgruppen <strong>und</strong> kleinere Erlenwaldbestände im Moor beseitigt werden,<br />
um die Schilfanbaufläche insgesamt zu vergrößern, wie es auch im EU-LIFE-Projekt vor-<br />
gesehen ist.
Zusammenfassung 63<br />
7 Zusammenfassung<br />
Der Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola) galt in Europa noch Anfang des 20. Jahr-<br />
h<strong>und</strong>erts als häufiger Vogel der Niedermoore. Mit der großflächigen Zerstörung seines<br />
Lebensraumes durch Entwässerung <strong>und</strong> Intensivierung der Landwirtschaft kam es Mitte<br />
des 20. Jh. zu einer dramatischen Bestandsabnahme. Heute gilt der Seggenrohrsänger als<br />
global bedroht (Aquatic Warbler Conservation Team 1999).<br />
Das in dieser Diplomarbeit untersuchte Rozwarowo-Moor beherbergt fast 50 % des Ge-<br />
samtbestandes der stark gefährdeten Pommerschen Seggenrohrsänger-Population. Sie<br />
stellt wahrscheinlich den Rest einer ehemals großen (> zehntausend Individuen) genetisch<br />
isolierten westlichen Population dar <strong>und</strong> sank zwischen 1996 <strong>und</strong> 2006 um r<strong>und</strong> zwei<br />
Drittel, von 250 auf 80 singende Männchen. 2006 wurden im Rozwarowo-Moor 37 sM ge-<br />
zählt.<br />
Das Moor wurde in der Vergangenheit extensiv landwirtschaftlich (Mahd, Beweidung)<br />
<strong>und</strong> zur Torfgewinnung genutzt. Trotz vorhandener Pläne ist es nie zu einer Entwässe-<br />
rung <strong>und</strong> Urbarmachung des Moores gekommen. Seit 1989 wird auf einem Großteil der<br />
Flächen Rohr <strong>für</strong> die Dachdeckerei geworben. Seit der EU-Erweiterung 2004 ist das Moor<br />
FFH-Gebiet.<br />
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit war:<br />
Ist die Rohrwerberei mit dem Schutz des Seggenrohrsängers vereinbar <strong>und</strong> welche Maß-<br />
nahmen müssen da<strong>für</strong> ergriffen werden?<br />
Im Juli 2005 wurden im zentralen Teil des Moores Stratigraphie, abiotische Standortver-<br />
hältnisse <strong>und</strong> Vegetation untersucht, um Moorgenese <strong>und</strong> -eigenschaften sowie die Eig-<br />
nung der Flächen als Seggenrohrsängerhabitat zu erfassen. Da<strong>für</strong> wurden 16 Torfkerne<br />
untersucht, von 29 Oberbodenproben wurden C/N-Verhältnis <strong>und</strong> pH-Wert bestimmt.<br />
Die Vegetation wurde mit Hilfe von 77 Vegetationsaufnahmen beschrieben. Die Daten
64 Zusammenfassung<br />
wurden mit multivariater Statistik (DCA) auf Zusammenhänge zwischen Vegetation <strong>und</strong><br />
abiotischen Standortverhältnissen geprüft.<br />
Die Torfbildung in dem in einem Gletscherzungenbecken gelegenen mesotroph-<br />
subneutralen Verlandungs- bzw. Versumpfungsmoor begann wahrscheinlich vor ca.<br />
10.000 Jahren. Die der untersten Torfschicht folgende, mehrere Meter mächtige Mudde-<br />
schicht weist auf die Litorinatransgression <strong>und</strong> eine lange Gewässerphase des Untersu-<br />
chungsgebietes hin. Die jüngsten Torfschichten wurden aus Schilf gebildet.<br />
Für das Untersuchungsgebiet wurde eine Vegetationskarte an Hand von acht Vegetati-<br />
onsstruktureinheiten (VSE) erstellt. Die Unterschiede zwischen den Vegetationsstruktur-<br />
einheiten sind nicht mit Hilfe der gemessenen Wasserstände, C/N- <strong>und</strong> pH-Werte auf a-<br />
biotische Standortsunterschiede zurückzuführen, sie beruhen vielmehr auf floristischen<br />
<strong>und</strong> physiognomischen Kriterien.<br />
Für den Seggenrohrsänger stellen die Kartiereinheiten „Schilfbestände mit Thelypteris pa-<br />
lustris“ (VSE 2) <strong>und</strong> „Schilfbestände mit hohem Seggenanteil“ (VSE 3) geeignete Bruthabi-<br />
tate dar. Kombiniert mit Frühjahrswasserständen von bis zu 10 cm über der Geländeober-<br />
fläche können sie als Leitbild <strong>für</strong> Seggenrohrsängerlebensräume im Rozwarowo-Moor<br />
gelten.<br />
Die Rohrwerbung stellt eine wirtschaftliche Form der Flächenpflege <strong>für</strong> den Erhalt des<br />
Seggenrohrsängers in Rozwarowo dar. Die Frage nach der Vereinbarkeit von Rohrwer-<br />
bung <strong>und</strong> Seggenrohrsängerschutz ist daher zu bejahen. Durch die regelmäßige Schilf-<br />
mahd werden den Flächen Nährstoffe entzogen <strong>und</strong> Gehölzaufwuchs verhindert. Durch<br />
das Entfernen des Altschilfes bildet sich im Frühjahr eine niedrige homogene Vegetati-<br />
onsstruktur. Andererseits wirkt sich die von den Schilfbauern praktizierte Wasserwirt-<br />
schaft eher negativ aus.
Zusammenfassung 65<br />
Um die Funktion des Gebietes als Schilfanbaugebiet <strong>und</strong> als Lebensraum <strong>für</strong> den Seggen-<br />
rohrsänger zu vereinen, wurden folgende Vorschläge <strong>für</strong> die Flächenbewirtschaftung<br />
formuliert:<br />
1. Eine mögliche, schleichende Eutrophierung des Rozwarowo-Moors durch die un-<br />
mittelbar angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen <strong>und</strong> die Grzybnica<br />
muss muss vermieden werden.<br />
2. Die Schilfmahd sollte zum Erhalt der homogenen <strong>und</strong> niedrigen Vegetationsstruk-<br />
tur im Frühjahr bewahrt werden <strong>und</strong> um das Aufwachsen von Gehölzen im Moor<br />
zu verhindern.<br />
3. Auch in Zukunft muss auf einen übermäßigen Wassereinstau ( > 10 cm, April-Juli)<br />
in den aktuell vom Seggenrohrsänger besiedelten Schilfbeständen verzichtet wer-<br />
den.<br />
4. Auf Flächen, die potenziell als Seggenrohrsänger-Habitate geeignet sind (siehe<br />
Abb. 6.8) müssen die Wasserstände auf 0-10 cm (April-Juli) abgesenkt werden.
66 Summary<br />
8 Summary<br />
Until the end of the 19 th century the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) used to be a<br />
common species of the European peatlands. In the 20 th century the population declined<br />
dramatically due to extensive destruction of its wildlife habitat (drainage and intensifica-<br />
tion of agriculture). Today it is globally threatened. Last breeding gro<strong>und</strong>s are fo<strong>und</strong> in<br />
Belarus, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Russia and Ukraine. The global<br />
population is estimated at aro<strong>und</strong> 12,000-20,500 singing males (Aquatic Warbler Conser-<br />
vation Team 2006a). The smallest and most endangered population is the West-<br />
Pommeranian. It is believed to constitute the last part of a huge Western population (over<br />
10,000 individuals) and to be genetically separated from all other known Aquatic Warbler<br />
populations (Giessing 2002). Between 1996 and 2006 it decreased from approx. 250 to 80<br />
singing males.<br />
The present study concentrates on the Aquatic Warbler breeding site “Rozwarowo-mire“<br />
in Poland, a 1600 ha sized peatland that shelters nearly 50 % of the West-Pommeranian<br />
population. In 2006, 37 singing males were counted in the Rozwarowo area.<br />
In the past, the peatland had been used for grazing, mowing and peat production pur-<br />
poses. It had never been drained, despite previous plans to do so (Dreyer 1913). Since<br />
1989 extensive winter reed-cutting has taken place. The Reed (Phragmites australis) consti-<br />
tutes a typical local vegetation widely used for thatches. In 2004, along with the enlarge-<br />
ment of the European Union (EU), the peatland was pronounced a NATURA 2000 site.<br />
Starting from the above facts this study attempts to answer the following questions:<br />
1. Is it possible to combine both economically useful reed-cutting and desirable<br />
Aquatic Warbler protection in the Rozwarowo area?<br />
2. What measures can be taken to pave the way to possible results?<br />
I started to look at the stratigraphy, the abiotic habitat characteristics and the vege-<br />
tation of the central portion of the peatland in July 2005 for the purpose of <strong>und</strong>er-
Summary 67<br />
standing its genesis, characteristics and suitability as an Aquatic Warbler breeding<br />
site.<br />
Stratigraphy was studied on the basis of 16 peat cores. C/N-ratios and pH-values were de-<br />
termined for 29 soil samples. 77 vegetation relevés were carried out. The data were ana-<br />
lysed by multivariate statistics (Detrended Correspondence Analyse (DCA)) for detection<br />
of interdependencies between vegetation and site conditions.<br />
10,000 years ago peat accumulation started in the glacial basin. The oldest peat layers (ba-<br />
sis peat) consist of mosses, Alnus glutinosa wood, sedges or reed. According to Berg (2005),<br />
the fairly thick layer of peat clay that follows would indicate an extend period of open wa-<br />
ter conditions due to the influence of the Litorina Transgression (6245+/-35 before pre-<br />
sent). The youngest peat layers are predominantly composed of reed.<br />
A vegetation map was generated based on 8 “Vegetationsstruktureinheiten” (VSE), which<br />
can be translated as “vegetation structure units”. The VSEs differ depending on the<br />
physiognomic and structural characteristics within the vegetation. The different abiotic<br />
habitat characteristics fo<strong>und</strong> among the units distinguished could not be verified statisti-<br />
cally.<br />
The characteristics of the vegetation units “reed areas with Thelypteris palustris” (VSE 2)<br />
and “reed areas with a high proportion of sedges” (VSE 3) describe a homogenous vegeta-<br />
tion, dominated by reed of loose growing, with 1,8 m maximum height and a developed<br />
herb layer <strong>und</strong>er the reed. These conditions along with an approx. 10 cm water level<br />
above soil surface, may constitute a model for an optimal Aquatic Warbler habitat in the<br />
Rozwarowo-mire.<br />
Reed cutting is a major economic factor in the Rozwarowo region. At the same time, it al-<br />
lows to maintain the Aquatic Warbler breeding sites in a cost-effective manner. On the<br />
one hand, reed-cutting withdraws nutrients from the sites, prevents shrubs and trees from<br />
spreading and helps create a homogenous vegetation structure in spring. On the other
68 Summary<br />
hand, current water management as practiced by the landowners (creation of excessive<br />
water levels in spring for reed growing enhancement) may have a negative impact on<br />
Aquatic Warbler breeding numbers.<br />
In order to combine both economic interests of landowners and the protection of Aquatic<br />
Warbler breeding sites, three recommendations are derived from the findings presented<br />
above:<br />
1. Favourable vegetation conditions for Aquatic Warbler breeding gro<strong>und</strong>s depend<br />
on mesotrophic habitat environments. All ongoing or future eutrophication in the<br />
Rozwarowo-mire should be avoided for protection and improvement of the cur-<br />
rent habitat conditions.<br />
2. Reed cutting prevents the spreading of shrubs and trees and helps to create a low<br />
and homogenous vegetation structure in spring. It ought to be maintained on ac-<br />
count of its ecological desirable impact on the habitat sites.<br />
3. Water level during spring-time should be maintained or lowered to approx. 10 cm<br />
above soil surface in both, currently by the Aquatic Warbler used sites and poten-<br />
tial habitat sites.
Literatur 69<br />
9 Literaturverzeichnis<br />
AG Boden 1996. Bodenk<strong>und</strong>liche Kartieranleitung. Stuttgart: Schweitzerbartʹsche Verlagsbuchhandlung.<br />
392 S.<br />
Aquatic Warbler Conservation Team 1999. World population, trends and conservation<br />
status of the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola. Vogelwelt 65-85.<br />
Aquatic Warbler Conservation Team 2003. Action Plan Concerning Conservation Measures<br />
for the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola. Minsk:<br />
http://www.aquaticwarbler.net/actionplan.htm.<br />
Aquatic Warbler Conservation Team 2005. Information about the global status and distribution.<br />
http://www.aquaticwarbler.net/situation.htm.<br />
Aquatic Warbler Conservation Team 2006a. Download von<br />
http://www.aquaticwarbler.net/index.html am 18.10.2006.<br />
Aquatic Warbler Conservation Team 2006b. Download von<br />
http://www.aquaticwarbler.net/news/ekologia2010.html am 20.11.2006.<br />
Bellebaum, J. & Just, P. 2003. Analyse der Habitatansprüche des Seggenrohrsängers im<br />
Unteren Odertal zur Pflege <strong>und</strong> Entwicklung von Brutgebieten. Brodersdorf <strong>und</strong><br />
Göttingen. 43 S.<br />
Berg, J. 2005. Räumlich-zeitliche Entwicklung des Unteren Ueckertalmoores bei Ueckermünde.<br />
Diplomarbeit. Ernst-Moritz-Arndt Universität. <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Botanik</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Landschaftsökologie</strong>. 85 S.<br />
Binot & et al. 2006. Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands-Register.<br />
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/RoteListeTiere.pdf: BfN.<br />
BirdLife International . Acrocephalus paludicola. 2006 IUCN Red List of Threatened Species<br />
. 2004a. IUCN 2006.<br />
BirdLife International 2004b. Birds in Europe - Population Estimates, Trends and Conservation<br />
Status. Birdlife Conservation Series. 374 S.<br />
Bornmann, P. 1975. Stickstoffbestimmungsmethoden in Abhängigkeit vom Molekülaufbau.<br />
Zitiert in Tanneberger & Hahne (2003).<br />
Czeraszkiewicz, R. 1993. Liczenie Wodniczki (Acrocephalus paludicola) na Pomorzu zahodnim<br />
w sezonie legowym 1993. Szczecin: OTOP.<br />
Dierschke, H. 1994. Pflanzensoziologie. Stuttgart: Ulmer. 683 S.<br />
Dreyer, J. 1913. Die Moore Pommerns, ihre geographische Bedingtheit <strong>und</strong> wirtschaftsgeographische<br />
Bedeutung. Greifswald. 319 S.
70 Literatur<br />
Duphorn, K., Kliewe, H., Niedermeyer, R.-O., Janke, W. & Werner, K. 1995. Die deutsche<br />
Ostseeküste. Berlin, Stuttgart: Gebrüder Borntraeger. 281 S.<br />
Dyrcz, A. & Zdunek, W. 1993. Breeding ecology of the Aquatic warbler Acrocephalus<br />
paludicola on the Bierbza marshes, NE Poland. Ibis 135: 181-189.<br />
Frahm, J.-P. & Frey, W. 1992. Moosflora. Stuttgart: UTB-Verlag.<br />
Frey, W. & Lösch, R. 1998. Lehrbuch der Geobotanik. Stuttgard, Jena, Lübeck, Ulm: Gustav<br />
Fischer Verlag. 436 S.<br />
Giessing, B. 2002. Viele Väter <strong>für</strong> eine Brut – vorteilhaft oder unausweichlich <strong>für</strong> das<br />
Weibchen? Zum Paarungssystem <strong>und</strong> zur Populationsgenetik des Seggenrohrsängers<br />
(Acrocephalus paludicola). Dissertation Universität Köln. 160 S.<br />
Graf von Flemming-Benz, H. 1970. Der Kreis Cammin. Ein pommersches Heimatbuch.<br />
Würzburg: Holzner Verlag. 539 S.<br />
Heise, G. 1974. Der Seggenrohrsänger- eine vom Ausstreben bedrohte Art. Der Falke 21:<br />
6-11.<br />
Hoffmann, J. 1679. Das Herzugtum Pommern wie es teils der Krone Schweden, teils<br />
Kurbrandenburg zugehörig. Nürnberg, Sanson.<br />
Jablonski, P. 2004. The conservation of the Aquatic Warbler in Pomerania/Western Poland<br />
2004. Teil II - Monitoring. Warschau: Unveröffentlichter Bericht. 26 S.<br />
Jäger, E. & Werner, K. 2002. Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland. Heidelberg,<br />
Berlin: Spektrum Akademischer Verlag. ) 948 S.<br />
Janke, W. 1996. Eustasie <strong>und</strong> Isostasie <strong>und</strong> ihre Auswirkungen auf den Meeresspiegel. In<br />
Lozan, J. L., Lampe, R., Matthäus, W., Rachor, E. & Rumohr, H. v. W. H. (Hrsg)<br />
Warnsignale aus der Ostsee: Wissenschaftliche Fakten (S. 30-35). Berlin: Parey<br />
Buchverlag.<br />
Joosten, H. & Succow, M. 2001. Hydogenetische Moortypen. In Succow, M. & Joosten, H.<br />
(Hrsg.) Landschaftsökologische Moork<strong>und</strong>e (S. 234-240). Stuttgart: Schweitzerbartʹsche<br />
Verlagsbuchhandlung.<br />
Kahrmann, M. & Haberl, A. 2005. Imnati - Ein Regendurchströmungsmoor? Moork<strong>und</strong>liche<br />
Untersuchungen in der Kolchis (Georgien). Diplomarbeit. Ernst-Moritz-<br />
Arndt Universität. <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Botanik</strong> <strong>und</strong> <strong>Landschaftsökologie</strong>. 101 S.<br />
Königl.Preuss.Landes-Aufnahme 1886.(1888).<br />
Kloskowski, J. & Krogulec, J. 1999. Habitat selection of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola<br />
in Poland: consequences for conservation of the breeding areas. Vogelwelt<br />
120: 64-71.
Literatur 71<br />
Koska, I., Succow, M. & Clausnitzer, U. 2001. Vegetationsk<strong>und</strong>liche Kennzeichnung von<br />
Mooren. In Succow, M. & Joosten, H. (Hrsg.) Landschaftsökologische Moork<strong>und</strong>e<br />
(S. 112-184). Stuttgart: E. Schweizerbartʹsche Verlagsbuchhandlung.<br />
Koska, I. & Timmermann, T. 2001. Liste der Vegetationsformen mit Angaben zur Synonymik<br />
<strong>und</strong> zur Gefährdung. In Succow, M. & Joosten, H. (Hersg.) Landschaftsökologische<br />
Moork<strong>und</strong>e (S. 156-161). Stuttgart: Schweizerbartʹsche Verlagsbuchhandlung.<br />
Kovacs, G. & Vegvari, Z. 1999. Poulation size and habitat of the Aquatic Warbler Acrocephalus<br />
paludicola in Hungary. Vogelwelt 120, 72-76.<br />
Kozulin, A. 1999. Breeding habitat, ab<strong>und</strong>ance and conservation status of the Aquatic<br />
Warbler Acrocephalus paludicola in Belarus. Vogelwelt 120: 97-111.<br />
Kozulin, A. & Flade, M. Breeding habitat, ab<strong>und</strong>ance and conservation status of the<br />
Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola in Belarus. Vogelwelt 120, 97-111. 1999.<br />
Kozulin, A., Vergeichik, L. & Stepanovich, Y. 2004. Factors affecting fluctuations of the<br />
Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola population of Byelarussian mires. Acta<br />
Ornitologica 39: 47-56.<br />
Krogulec, J. & Kloskowski, J. 1997. Wystepowanie, liczebnosc i wybiorczosc siedliskowa<br />
wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce w 1997 roku 2. Lublin <strong>und</strong> Gdansk:<br />
OTOP. 26 S.<br />
Leisler, B. 1988. Intra-<strong>und</strong> interspezifische Agression bei Schilf- <strong>und</strong> Seggenrohrsänger<br />
(Acrocephalus schoenobaenus, A. paludicola): Ein Fall von akustischer Verwechslung?<br />
Die Vogelwarte 34: 281-290.<br />
Lettner, H. 2006. Statistische Testverfahren. Download von<br />
http://www.sbg.ac.at/bio/radiooeko/biost-wilcoxon1.pdf am 27.10.2006.<br />
Maniakowski, M. 2004. All-country survey on the Aquatic Warbler distribution, habitat<br />
condition and threats at the breeding sites. Gdansk: Polish Society for the Protection<br />
of Birds OTOP. 8.S.<br />
Mühr, B. 2002. Klimadiagramme Stettin / Ückermünde. Download von<br />
www.klimadiagramme.de am 20.07.2006.<br />
OTOP 2005. Conserving Acrocephalus paludicola in Poland and Germany. An application<br />
for f<strong>und</strong>ing. Gdansk/Warsaw: OTOP. 636 S.<br />
Pain, D. J., Green, R. E., Giessing, B., Kozulin, A., Poluda, A., Ottosson, U., Flade, M. &<br />
Hilton, G. M. 2004. Using stable isotopes to investigate migratory connectivity<br />
of the globally threatened aquatic warbler Acrocephalus paludicola. Oecologica<br />
168-174.
72 Literatur<br />
Provinzverband von Pommern 1939. Die Kunst <strong>und</strong> Kulturdenkmäler der Provinz<br />
Pommern. Kreis Kammin-Land. Stettin: Kommissionsverlag L. Saunier.<br />
Schaefer, H. M., Naef-Daenzer, B., Leisler, B., Schmidt, V., Müller, J. K. & Schulze-Hagen,<br />
K. 2000. Spatial behaviour in the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) during<br />
mating and breeding. Journal <strong>für</strong> Ornithologie 141: 418-424.<br />
Schäffer, N. & Schäffer, A. 1999. Der Seggenrohrsänger – ein Schicksal am seidenen Faden.<br />
Falke 46: 180-187.<br />
Schäffer, N., Walther, B. A., Gutterridge, K. & Rahbek, C. 2006. The African migration<br />
and wintering gro<strong>und</strong>s of the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola. Bird<br />
Conservation International 16: 33-56.<br />
Schulze, H. 1989. Alexander Weltatlas: neue Gesamtausgabe. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.<br />
Schulze-Hagen, K., Swatschek, I., Dyrcz, A. & Wink, M. 1993. Multiple Vaterschaften in<br />
Bruten des Seggenrohrsängers Acrocephalus paludicola: Erste Ergebnisse des<br />
DNA-Fingerprintings. Journal <strong>für</strong> Ornithologie 134: 145-154.<br />
Schulze-Hagen, K. 1991. Acrocephalus paludicola (Vieillot 1817) - Seggenrohrsänger. In<br />
Glutz von Blotzheim, U. N. (Hrgs.) Handbuch der Vögel Mitteleuropas (S. 252-<br />
291). Wiesbaden: AULA-Verlag.<br />
Schulze-Hagen, K., Leisler, B., Schäfer, H. M. & Schmidt, V. 1999. The breeding system of<br />
the aquatic warbler Acrocephalus paludicola - a review of new results. Vogelwelt<br />
120: 87-96.<br />
Schwenkros, B. 1994. Das Klima. In Elwers, R. (Hrsg.) Die polnische Ostseeküste (S. 10-<br />
11). Berlin: Trescher Verlag.<br />
Sellin, D. 1989. Vergleichende Untersuchungen zur Habitatsstruktur des Seggenrohrsängers<br />
Acrocephalus paludicola. Vogelwelt 110: 198-208.<br />
Sieghardt, H. & Maier, R. 1985. Produktionsbiologische Untersuchungen an Phragmites-<br />
Beständen im geschlossenen Schilfgürtel des Neusiedler See. Wissenschaftliche<br />
Arbeiten aus dem Burgenland 72: 189-221.<br />
Stegmann, H., Succow, M. & Zeitz, J. 2001. Muddearten. In Succow, M. & Joosten, H.<br />
(Hrsg.) Landschaftsökologische Moork<strong>und</strong>e (S. 62-65). Stuttgart: Schweizerbart -<br />
sche Verlagsbuchhandlung.<br />
Succow, M. 1981. Landschaftsökologische Kennzeichnung <strong>und</strong> Typisierung der Moore<br />
der DDR. AdL der DDR. 256 S.<br />
Succow, M. 1988. Landschaftsökologische Moork<strong>und</strong>e. Jena: Gustav Fischer Verlag. 340 S.
Literatur 73<br />
Succow, M. 2001. Ökologisch(-phytozoenologische) Moortypen. In Succow, M. & Joosten,<br />
H. (Hrsg.) Landschaftsökologische Moork<strong>und</strong>e (S. 229-234). Stuttgart: Schweitzerbartʹsche<br />
Verlagsbuchhandlung.<br />
Succow, M. 2002. Zur Nutzung mitteleuropäischer Moore - Rückblick <strong>und</strong> Ausblick.<br />
TELMA 32: 225-266.<br />
Succow, M. & Stegmann, H. 2001. Abiotische Kennzeichnung von Moorstandorten. In<br />
Succow, M. & Joosten, H. (Hrsg.) Landschaftsökologische Moork<strong>und</strong>e (S. 58-<br />
111). Stuttgart: E. Schweitzerbartʹsche Verlagsbuchhandlung.<br />
Symon, H. 1990. Reclaw Mapa topograficzna. 331.12: Glowny Geodeta Kraju.<br />
Tanneberger, F., Bellebaum, J., Helmecke, A., Fartmann, T., Just, P. & Sadlik, J. (in Vorbereitung).<br />
Trapped between nest loss and habitat loss - the Aquatic Warbler in<br />
Lower Oder Valley National Park.<br />
Tanneberger, F., Flade, M. & Joosten, H. 2005. An Introduction to Aquatic Warbler conservation<br />
in Western Pomerania. In Kotowski, W. (Hrsg.) Anthropogenic influence<br />
on wetlands biodiversity and sustainable management of wetlands (S. 97-<br />
106). Warsaw: Warsaw Agricultural University Press.<br />
Tanneberger, F., Hahne, W. 2003. Landscape Ecology and Palaeoecology of Ob Valley<br />
Mires near Tomsk / Western Siberia. Diplomarbeit. Ernst Moritz Arndt Universität<br />
Greifswald. <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Botanik</strong> <strong>und</strong> <strong>Landschaftsökologie</strong>.<br />
Umweltb<strong>und</strong>esamt 1993. Umweltsituation in der Region Odermündung Abschlußbericht.<br />
Berlin: Umweltb<strong>und</strong>esamt.<br />
Umweltministerium der Republik Polen 2006. NATURA 2000 Standarddatenbogen SPA<br />
ʺBagna Rozwarowskieʺ.<br />
UNDP Projects 2006. Download von http://un.by/en/<strong>und</strong>p/db/00043201.html am 20.11.06.<br />
Wilm, A. 2006. 5.2 Rangtests. Download von http://www.psychologie.uni-kiel.de/methode<br />
n_nf/Inhalt/Skript/5.2_Rangtests.pdf am 27.10.2006.
Anhang<br />
Anhang 1: Karte 1676<br />
Anhang 2: Preußisches Messtischblatt 2054<br />
Anhang 3: Preußisches Messtischblatt 2154<br />
Anhang 4: Bohrprotokolle<br />
Anhang 5: Bohrprofile<br />
Anhang 6: Vegetationskarte<br />
Anhang 7: Vegetationstabelle<br />
Anhang 8: Karte der Vegetationsaufnahmepunkte<br />
Anhang 9: Vergleich der C/N-Verhältnisse zwischen den Vegetationsstruktureinheiten<br />
Anhang 10: Vergleich der pH-Werte zwischen den Vegetationsstruktureinheiten<br />
Anhang 11: C/N- Verhältnisse <strong>und</strong> pH-Werte
Anhang 1: Karte 1679<br />
Quelle: Das Herzogtum Pommern wie es teils der Krone Schweden, teils Kurbrandenburg zugehörig<br />
(Hoffmann 1679) In Graf von Flemming-Benz (1970).
Anhang 2: Preußisches Messtischblatt 2054<br />
Quelle: Karte zu : Der Kreis Cammin. In Graf von Flemming-Benz (1970)
Anhang 3: Preußisches Messtischblatt 2154<br />
Quelle: Königliche Preußische Landes-Aufnahme 1886. (1888) Ausschnitt.
Anhang 4: Bohrprotokolle – Stratigraphische Feldansprache<br />
Tiefe [cm]<br />
unter GOF<br />
Bohrung 1<br />
Substratkennzeichnung<br />
CaCO3<br />
Zersetzung [H] bzw.<br />
Konsistenz [K]<br />
0-50 Braunmoos-Schilf 0 H3<br />
50-80 Grobseggen 0 H3 Menyanthes-Same<br />
Bemerkung<br />
80-90 Grobseggen-Braunmoos 0 H2 Thelypteris palustris-Gewebe<br />
90-100 Grobseggentorf 0 H4 schwarze grosse Radizellen<br />
100-115 KV<br />
115-125 Schilftorf 0 H3<br />
125-195 Grobdetritusmudde 0 K3 5% Radizellenreste<br />
195-220 Grobdetritusmudde 2 K3 2% Radizellenreste, Muscheln indet.<br />
220-440 Mitteldetritusmudde 0 K3 2% Radizellenreste<br />
440-470 Mitteldetritusmudde 1 K3 2% Radizellenreste<br />
470-540 Mitteldetritusmudde 3 K4 Schilfreste (Rhizom)<br />
540-550 Mitteldetritusmudde 4 K4 Schilfreste (Rhizom)<br />
550-670 Mitteldetritusmudde 3 K4<br />
670-700 Mitteldetritusmudde 2 K3<br />
700-750 Mitteldetritusmudde 0 K3<br />
750-780 Mitteldetritusmudde 1 K3<br />
780-785 Mitteldetritusmudde 2 K4 mS, Cardium edule<br />
85-800 Grobdetritusmudde -Mittelsand 0 K3<br />
800-830 Mittelsand 0<br />
Bohrung 2<br />
0-40 Schilftorf 0 H3<br />
40-80 Braunmoos-Schilftorf 0 H4 Menyanthes-Same,rezentes Schilf(Rhizom)<br />
80-100 Schilftorf 0 H4<br />
100-150 Schilftorf 0 H5<br />
150-170 Schilftorf 0 H7<br />
170-250 Grobdetritusmudde 0 K3 5% Radizellenreste<br />
250-480 Mitteldetritusmudde 0 K3 bei 430 cm Holzreste<br />
480-530 Schilftorf 0 H8 Cladium mariscus? -Gewebe<br />
530-570 Grobdetritusmudde 0 K3 Schilftorf 20%<br />
570-590 Schluffmudde 0 K4 Schilftorf 10%<br />
590-600 Feinsand 0<br />
Bohrung 3<br />
0-10 Farntorf 0 H4<br />
10-65 Schilf- Braunmoostorf 0 H3<br />
65-80 Schilftorf 0 H5<br />
80-100 Schilftorf 0 H3<br />
100-130 Schilftorf 0 H4 20% Mudde<br />
130-250 Grobdetritusmudde 0 K3 10% Schilfreste (Rhizom)<br />
250-350 Feindetritusmudde 0 K4 2% Radizellenreste<br />
350-400 Feindetritusmudde 0 K3 1% Radizellenreste<br />
400-430 Feindetritusmudde 2 K4 1% Radizellenreste<br />
430-450 Grobdetritusmudde 2 K3 Cardium edule<br />
450-480 Grobdetritusmudde 0 K3<br />
480-500 Grobdetritusmudde 0 K3 10-15% Schilf (Rhizom)<br />
500-610 Schilftorf 0 H8<br />
610-620 Mittelsand 0 Kies
Tiefe [cm]<br />
unter GOF<br />
Bohrung 4<br />
Substratkennzeichnung<br />
CaCO3<br />
Zersetzung [H] bzw.<br />
Konsistenz [K]<br />
0-30 KV<br />
Bemerkung<br />
30-80 Schilf-Braunmoostorf 0 H3 rezente Schilfrhizome<br />
80-100 Braunmoos-Grobseggentorf 0 H3<br />
100-120 Schilftorf 0 H4<br />
120-150 Grobdetritusmudde 0 K3 20% Schilf (Rhizom)<br />
150-350 Grobdetr. 0 K3 5% Radizellenreste, 240 cm Holzrest<br />
350-440 Grobdetritusmudde 0 K3<br />
440-500 Grobdetritusmudde 2 K3<br />
500-675 Grobdetritusmudde 0 K3 595+ 625 cm U-Band (C1)<br />
675-800 Schilftorf 0 H8 Cardium edule, 760 cm Holzrest<br />
Bohrung 5<br />
0-25 Feinseggentorf 0 H4 Carex disticha<br />
25-80 Braunmoos-Grobseggentorf 0 H3<br />
80-100 Schilftorf 0 H8 vererdet<br />
100-170 Schilftorf 0 H3 Equisetum spec.<br />
170-200 Grobdetr,Mudde 0 K3 5% Schilfreste (Rhizom)<br />
200-425 Feindetritusmudde 0 K4 2% Schilf (Rhizom), 360 cm Schilfband 2cm<br />
425-450 Feindetritusmudde 2 K4<br />
450-520 Feindetritusmudde 2 K4 2% Schifreste (Rhizom)<br />
520-525 Feindetritusmudde 3 K4<br />
525-550 Schilf-Braunmoostorf 0 H4 530 cm Holzband<br />
550-610 Braunmooostorf 0 H6<br />
610-615 Braunmoostorf 0 H6 mS<br />
615-620 Mittelsand 0<br />
Bohrung 6<br />
0-10 Feinseggentorf 0 H4<br />
10-30 Feinseggentorf 0 H5<br />
30-70 Feinseggentorf 0 H5<br />
70-90 Schilftorf 0 H5<br />
90-150 Schilftorf 0 H4 ab 145 cm mit mS<br />
150-160 Mittelsand 0<br />
Bohrung 7<br />
0-20 Grobseggentorf 0 H4<br />
20-30 Grobseggentorf 0 H4<br />
30-70 Schilftorf 0 H4<br />
70-85 Schilftorf 0 H3<br />
85-160 Schilf-Erlentorf 0 H3<br />
160-170 Grobsand 0<br />
Bohrung 8<br />
0-20 Schilftorf 0 H3<br />
20-40 Schilftorf 0 H2 fest<br />
40-60 Schilftorf 0 H5<br />
60-80 Schilftorf 0 H4<br />
80-90 Mittelsand 0
Tiefe [cm]<br />
unter GOF<br />
Bohrung 9<br />
Substratkennzeichnung<br />
CaCO3<br />
Zersetzung [H] bzw.<br />
Konsistenz [K]<br />
0-50 Schilftorf 0 H4 Braunmoose 2%<br />
50-100 Schilftorf 0 H4<br />
100-115 Schilftorf 0 H5<br />
Bemerkung<br />
115-190 Grobdetritusmudde 0 K3 10% Schilfreste (Rhizom)<br />
190-220 Grobdetritusmudde 0 K3 5% Schilfreste (Rhizom)<br />
220-410 Feindetritusmudde 0 K4 1% Schilfreste (Rhizom)<br />
410-450 Schilftorf 0 H8 vererdet, 40%Mudde<br />
450-480 Feindetritusmudde 0 K4 1% Schilfreste (Rhizom)<br />
480-500 Schilftorf 0 H8 40% Mudde<br />
500-510 Braunmoostorf 0 H7<br />
510-530 schluffiger Mittelsand 4 Kies<br />
Bohrung 10<br />
0-30 Schilftorf 0 H3<br />
30-50 Braunmoos-Schilftorf 0 H3<br />
50-75 Braunmoostorf 0 H3<br />
75-170 Schilftorf 0 H3<br />
170-390 Grobdetritusmudde 0 K3 2% Schilfreste (Rhizom)<br />
390-420 Mitteldetritusmudde 0 K3 15-20% Schilfreste (Rhizom)<br />
420-470 Mitteldetritusmudde 2 K3<br />
470-500 Mitteldetritusmudde 2 K3<br />
500-510 Grobdetritusmudde 1 K3 Muschelstücke indet.<br />
510-550 Schilfbraunmoostorf 0 H5<br />
550-620 Schilftorf 0 H6<br />
620-640 Braunmoostorf 0 H6<br />
640-650 sandiger Schluff 1<br />
Bohrung 11<br />
0-10 Farn-Schilftorf 0 H4<br />
Okt 35 Schilf-Braunmoostorf 0 H4<br />
35-60 Braunmoos-Feinseggentorf 0 H3<br />
60-110 Schilftorf 0 H4<br />
110-145 Grobdetritusmudde 0 K3 10% Schilfreste<br />
145-150 Grobdetritusmudde 1 K3 5% Schilfreste<br />
150-290 Mitteldetritusmudde 0 K3 2% Schilfreste<br />
290-300 Mittelsand 1<br />
300-310 Mittelsand 0<br />
Bohrung 12<br />
0-20 Schilftorf 0 H4<br />
20-80 Braunmoos- Schilftorf 0 H3<br />
80-110 Schilftorf 0 H5<br />
110-180 Schilftorf, Mitteldetritusmudde 0 H3, K3 130 cm Holzreste Erle<br />
180-225 Mitteldetritusmudde 0 K3 10% Schilfreste (Rhizom)<br />
225-250 Mitteldetritusmudde 0 K4 2% Schilfreste (Rhizom)<br />
250-420 Mitteldetritusmudde 0 K3 1% Schilfreste, (Rhizom)39 Holzrest Erle<br />
420-450 Erlen-Grobseggentorf 0 H7 5% Schilfreste (Rhizom)<br />
450-460 Mittelsand 0
Tiefe [cm]<br />
unter GOF<br />
Bohrung 13<br />
Substratkennzeichnung<br />
CaCO3<br />
Zersetzung [H] bzw.<br />
Konsistenz [K]<br />
0-20 Schilftorf 0 H3<br />
20-40 Braunmoos-Schilftorf 0 H3<br />
40-85 Schilftorf 0 H5 krümelig<br />
85-185 Braunmoos-Schilftorf 0 H4<br />
185-280 Schilftorf 0 H5<br />
280-300 Erlen-Grobseggentorf 0 H7<br />
300-360 Mitteldetritusmudde 1 K4-5 2% Radizellen<br />
360-380 Erlentorf 2 H6 vererdet<br />
380-400 Feinsand 4<br />
Bohrung 14<br />
0-20 Grobseggentorf 0 H3<br />
20-45 Grobseggen-Braunmoostorf 0 H3<br />
45-50 Schilf-Braunmoostorf 0 H4<br />
50-70 Feinseggen-Schilftorf 0 H5<br />
70-100 Schilftorf 0 H5<br />
100-170 Schilftorf 0 H4<br />
170-200 Schilftorf 0 H3 40% Mudde K1<br />
200-210 Grobdetritusmudde 0 K2 20% Schilf (Rhizom)<br />
Bemerkung<br />
210-250 Grobdetritusmudde 0 K3 10% Schilfreste (Rhizom)<br />
250-285 Mitteldetritusmudde 0 K1 10% Schilfreste (Rhizom)<br />
285-300 Mitteldetritusmudde 0 K3 5% Schilfreste (Rhizom)<br />
300-390 Mitteldetritusmudde 0 K3 2% Schilfreste (Rhizom)<br />
390-410 Grobdetritusmudde 0 K4 2% Schilf (Rhizom), Radizellen erkennbar<br />
410-510 Mitteldetritusmudde 0 K4<br />
510-550 Erlen-Grobseggentorf 0 H7 muddig<br />
550-560 Erlen-Grobseggentorf 0 H8-9 muddig<br />
560-580 Erlen-Grobseggentorf, sandiger Schluff 0 H8-9 50% Us<br />
Bohrung 15<br />
0-40 Braunmoos-Schilftorf 0 H4<br />
40-55 Braunmoostorf 0 H3<br />
55-100 Schilf-Braunmoostorf 0 H3 90 cm Menyanthes_Same<br />
100-115 Erlen-Schilftorf 0 H4<br />
115-125 Schilftorf,Grobdetr.Mudde 0 H5,K3 jeweils 50%<br />
125-175 Grobdetritusmudde 0 K3 10% Schilfreste (Rhizom)<br />
175-220 Grobdetritusmudde 0 K3 5% Schilfreste (Rhizom)<br />
220-340 Mitteldetritusmudde 0 K3 2% Schilf (Rhizom), Radizellen erkennbar<br />
340-370 Mitteldetritusmudde 2 K3 2% Schilf (Rhizom), Radizellen erkennbar<br />
370-410 Erlentorf 1 H8 vererdet, Schnecke<br />
410-420 Feinseggentorf 0 H4 Holz<br />
420-445 Feinsand 0 Sapropel<br />
Bohrung 16<br />
0-10 Feinseggentorf 0 H5<br />
10-70 Braunmoostorf 0 H3<br />
70-100 Braunmoos-Feinseggentorf 0 H3<br />
100-140 Erlen-Schilftorf 0 H6<br />
140-170 Grobdetritusmudde 0 K4 15% Schilf (Rhizom), Erlenholz<br />
170-225 Lebermudde 0 K4 5% Schilfreste (Rhizom)<br />
225-230 Erlentorf 0 H6<br />
230-240 Erlentorf, Mittelsand 0 H6<br />
240-250 Mittelsand 0
0<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
55<br />
60<br />
65<br />
[dm]<br />
B16 B15 B10 B11 B9 B5 B6 B8 B7<br />
H5<br />
H3<br />
H3<br />
H6<br />
K4<br />
K4<br />
H6<br />
H6<br />
H4<br />
H3<br />
H3<br />
H4<br />
H5,K3<br />
K3<br />
K3<br />
K3<br />
K3, c2<br />
H8, c1<br />
H4<br />
H3<br />
H3<br />
H3<br />
H3<br />
K3<br />
K3<br />
K3,c2<br />
K3,c2<br />
K3,c1<br />
Anhang 5a: Bohrprofile B16, B15, B10, B11, B9, B5, B6, B8, B7<br />
H5<br />
H6<br />
H6<br />
c1<br />
H4<br />
H4<br />
H3<br />
H4<br />
K3<br />
K3,c1<br />
K3<br />
c1<br />
H4<br />
H4<br />
H5<br />
K3<br />
K3<br />
K4<br />
H8<br />
K4<br />
H8<br />
H7<br />
c4<br />
H4<br />
H3<br />
H8<br />
H3<br />
K3<br />
K4<br />
K4,c2<br />
K4,c2<br />
K4,c3<br />
H4<br />
H6<br />
H6<br />
H4<br />
H5<br />
H5<br />
H5<br />
H4<br />
Braunmoostorf<br />
Feinseggentorf<br />
H3<br />
H2<br />
H5<br />
H4<br />
Sandiger Schluff<br />
Mittelsand<br />
Schluff<br />
Feinsand<br />
Grobdetritusmudde<br />
Mitteldetritusmudde<br />
Feindetritusmudde<br />
Feinseggen-Braunmoostorf<br />
Braunmoos-Schilftorf<br />
Grobseggentorf<br />
Grobseggen-Braunmoostorf<br />
Schilftorf<br />
Grobseggen-Braunmoostorf<br />
Schilftorf-Grobdetritusmudde<br />
Holztorf<br />
Schilf-Braunmoostorf<br />
Schilf-Holztorf<br />
H4<br />
H4<br />
H4<br />
H3<br />
H3
[dm]<br />
0<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
55<br />
60<br />
65<br />
70<br />
75<br />
80<br />
B1 B2 B3 B4 B12 B13 B14<br />
H3<br />
H3<br />
H2<br />
H4<br />
KV<br />
H3<br />
K3<br />
K3,c2<br />
K3<br />
K3,c1<br />
K4,c3<br />
K4,c4<br />
K4,c3<br />
K3,c2<br />
K3<br />
K3,c1<br />
K4,c2<br />
K3<br />
Anhang 5b: Bohrprofile B1, B2, B3, B4, B12, B13, B14<br />
H3<br />
H4<br />
H4<br />
H5<br />
H7<br />
K3<br />
K3<br />
H8<br />
K3<br />
K4<br />
H4<br />
H3<br />
H5<br />
H3<br />
H4<br />
K3<br />
K4<br />
K3<br />
K4,c2<br />
K3,c2<br />
K3<br />
K3<br />
H8<br />
KV<br />
H3<br />
H3<br />
H4<br />
K3<br />
K3<br />
K3<br />
K3,c2<br />
K3<br />
H8<br />
H4<br />
H3<br />
H5<br />
H3, K3<br />
K3<br />
K4<br />
K3<br />
H7<br />
Braunmoos-Schilftorf<br />
Grobseggentorf<br />
Grobseggen-Braunmoostorf<br />
Schilftorf<br />
Grobseggen-Braunmoostorf<br />
Schilftorf-Mitteldetritusmudde<br />
Grobseggen-Holztorf<br />
Holztorf<br />
Feinseggen-Schilftorf<br />
Farntorf<br />
Schilf-Braunmoostorf<br />
H3<br />
H3<br />
H5<br />
H4<br />
H5<br />
H7<br />
K4-5,c1<br />
H6,c2<br />
c4<br />
Grobdetritusmudde<br />
Mitteldetritusmudde<br />
Feindetritusmudde<br />
Mittelsand<br />
Schluff<br />
Feinsand<br />
H3<br />
H3<br />
H4<br />
H5<br />
H5<br />
H4<br />
H3<br />
K2<br />
K3<br />
K1<br />
K3<br />
K3<br />
K4<br />
K4<br />
H7<br />
H8-9<br />
H8-9, Us
Anhang 6: Vegetationskarte<br />
<strong>Cosima</strong> <strong>Tegetmeyer</strong><br />
Legende<br />
Schilfbestände der eutrophen Grabenränder (VSE 1)<br />
Schilfbestände mit Thelypteris palustris (VSE 2)<br />
Schilfbestände mit Thelypteris palustris <strong>und</strong> Myrica gale (VSE 2)<br />
Schilfbestände mit hohem Seggenanteil (VSE 3)<br />
reine Schilfbestände (VSE 4)<br />
ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf (VSE 5)<br />
niedrige schilffreie Vegetation mit hohem<br />
Anteil an Myrica gale (VSE 6)<br />
Vegetation der Binnensalzstelle (VSE 7)<br />
Vegetation der Gräben (VSE 8)<br />
Weidengebüsch<br />
Erlengebüsch<br />
gestörte Flächen<br />
häufig wechselnde Einheiten, schwer begehbare Flächen, daher<br />
keine genaue Kartierung möglich<br />
Kartengr<strong>und</strong>lage: Symon, H. 1990
Anhang 7: Vegetationstabelle<br />
Nr. V9 V48 V11 VX2 V33 V8 V56 V46 V51 V67 V72 B14 V66 V15 V13 V12 V65 V40 V23 V25 V69 V14 B3 B6 V44 V49 V41 V45 V36 V35 V34 V39 V37 B5 B2 V31 V3 V32 V64 V71 B15 V60 V5 V21 B1 V4 B9 B12 B10 V7 V22 B11 V29 V58 V57 V53 V26 V61 V54 V27 V28 V62 V24 V59 B13 B4 B8 V55 V10 V47 V42 V63 V43 V6 V30 V70 B7 Stet.<br />
H2O [m] >1 >1 >1 >1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0<br />
GesDeck % 70 80 50 70 100 80 100 100 100 90 90 80 95 90 100 100 100 95 100 95 90 95 90 100 100 100 100 85 95 95 90 90 80 90 100 90 100 10 80 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 90 100 100 90 100 80 80 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100<br />
Deck Phr. % 0 0 0 0 100 70 100 100 100 0 0 0 50 40 25 25 40 30 70 40 50 70 40 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 80 90 70 60 80 50 80 80 70 40 90 70 80 70 90 75 60 50 70 80 50 60 80 50 60 50 90 100 100 100 100 100 100 80 100 100 70 100 90 100 100 0 0<br />
Deck Phr.+ % 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 10 0 10 5 0 5 0 7 2 0 10 3 5 0 10 3 0 0 10 0 3 0 0 0 10 10 0 0 3 0 0 0 0 0<br />
Höhe Phr. [m] 0 0 0 0 1,8 1,7 2,6 2 1,8 0 0 0 1,7 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,7 1,2 1,3 1,8 1,4 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,3 1,3 1,5 2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,9 1,6 1,5 1,7 1,5 1,8 1,4 1,4 1,5 1,3 1,6 1,8 1,6 1,8 2,5 2,5 1,7 1,8 2,5 1,9 2,5 1,8 1,6 2,5 2 2,3 2,3 0 0<br />
Höhe KS2 [m] 0 0,8 0 0 1,8 1,7 2,6 2 1,8 1,2 0 1,5 1,7 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,7 1,2 1,3 1,8 1,4 0 1,5 1 1,6 1,2 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,5 1,3 1,3 1,5 2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,9 1,6 1,5 1,7 1,5 1,8 0,4 1,4 1,5 1,3 1,6 1,8 1,6 1,8 2,5 2,5 1,7 1,8 2,5 1,9 2,5 1,8 1,6 2,5 2 2,3 2,3 0 0<br />
Höhe KS1 [m] 0 0,3 0 0 0,1 0,6 0 0,01 0,1 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 1 0,6 0,6 0,8 0,7 1 1 1 0,8 1 0,7 0,8 1 0,4 0 0,6 0,6 0,9 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 1 0,8 1 0,8 1,2 1 0,8 1 1 0,9 0,8 0,5 0,7 1,1 0,5 0,6 1 1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,6 1,8 0,7 1 0,7 1,2 1 0,2 0,3 0,3<br />
Deck KS2 % 0 10 0 0 100 70 100 100 100 5 5 2 50 50 25 25 40 30 70 50 50 70 40 0 5 3 60 5 10 5 5 80 80 3 80 90 75 60 80 50 80 80 70 50 90 70 80 70 90 75 50 50 70 80 50 70 80 50 60 50 90 100 100 100 100 100 100 80 99 100 70 100 90 99 100 0 0<br />
Deck KS1 % 0 70 0 0 5 40 20 80 3 90 90 80 70 80 75 75 70 70 50 90 70 90 70 100 100 100 80 80 90 90 100 10 5 90 90 0 25 40 70 80 50 70 20 90 70 40 90 70 90 40 90 90 60 60 70 60 40 70 50 30 40 30 5 20 20 20 10 80 1 70 50 20 10 1 10 100 100<br />
Deck MS % 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 50 50 60 20 30 60 20 20 50 40 0 20 0 50 0 30 50 70 0 80 30 60 70 0 50 0 0 0 0 50 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Höhe Streu [m] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0<br />
Bewirtschaftung geb. geb. geb. geb. g. g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. g. g. g. g. n.g. n.g. n.g. n.g n.g. n.g. n.g. n.g. g. n.g. n.g. g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. g. g. n.g. n.g. n.g. g. g. g. n.g. n.g. g. g. n.g. g. g. g. f.g. f.g.<br />
Kartiereinheit<br />
dunkelblau rot violet hellgrün<br />
lila lila orange hellgrün<br />
rot dunkelgrün pink<br />
Vegetationsform<br />
Teichsimsen-Schilf-Wasserried<br />
Rohrkolben-<br />
Schnabelseggen-<br />
Ried<br />
Spitzmoos-Großseggen-Ried Zungenhahnenfuß-Großseggen-Ried Nachtschatten-Schilf-Staudenflur<br />
(Sumpfsimsen-Salzbinsen-Rasen)/<br />
Strandastern-Salzbinsen-Rasen<br />
Wasserstufe<br />
6+ 5+ 4+ 5+-4+<br />
Wasserregimetyp<br />
T T T T<br />
T K<br />
Trophiestufe<br />
m-r za-(m) (za)-m k<br />
s m-k<br />
Trophiestufengruppe<br />
eutroph mesotroph<br />
mesotroph eutroph<br />
polytroph eutroph<br />
Säure-Basen-Stufe<br />
sub-ka sub sub sub-ka<br />
sub-ka sub-ka<br />
Anzahl der Aufnahmen<br />
4 5 3 11<br />
6 5 7 8<br />
10 9 7 2<br />
AG<br />
11 Hydrocharis morus-ranae 3 2a 2b 2b 5<br />
11 Stratiotes aloides 3 4 3<br />
44 Acorus calamus 1a 1b 3<br />
12 Spirodela polyrhiza 3 1b 3 3 4 4 1a 1b # 1a 13<br />
14 Lemna trisulca 2b 3 3 2b 5<br />
87 Phragmites australis 1a 1a 5 3 5 5 5 3 2b 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 # 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 79<br />
39 Carex elata 3 1a 2a 2a 1a 1b 2a 2a 1b 2a 3 3 3 2a 1b 1b 2b 4 3 2b 2b 2b 2a 1b 2a 2b 2b 2b 1b 2b 2b 2b 1b 2b 2a 3 47<br />
78 Lythrum salicaria 1b # # 1a 1a 1a # # 1a # 1a 1a # # 1a # # # # # # # 2a 1a 1a # 1a # # # # 40<br />
64 Epilobium palustre # # # # r # 1a # # 1a # # # 1b 1a 1b # 1b 1a 1a # 1a # 30<br />
25 Potentilla palustris 2b 2a 2b 2b 1b 1a # 1b 2a 1a 2a 1b 2a 1a # 2a 2b 2b 2b 2a 26<br />
78 Lysimachia vulgaris 1b 1a 2b 1a 2b 2a 2a 2a 2a # 2b 2b 2a 2b 2a 1a 1b 2a 1a # 2a 2a 2b 1b 2b 1a 1b 1b 1b 2a 2b 2b 2b 1b 2b 1a 47<br />
25 Calamagrostis stricta 1a 1a 1a # # 1a 1a # 1a # # 2a 2a 2a 1b # 2a 1b 1a 2b 2a 3 2b 30<br />
53 Lathyrus palustris # 1a # r # 1b 1b 1a # # 1a # # # 1a 1a 1a 1a 1a # # # # 30<br />
73 Carex disticha 1a 3 2b 2a 2a 4 4 4 1a 3 3 2a 2b 3 2b 2a 1a 2b 2b 2a 2a 27<br />
74 Calamagrostis canescens 2b 1b 2a 2a 2a 1b 3 r 1b 1b 2a 1a # # 1a # # 22<br />
Myrica gale 3 2b 3 # 3 2b 3 9<br />
54 Peucedanum palustre 1a 2a 1b 1b 2b # 3 1a # 2a 1a 1a 1b 1b 2a 2a 1b # # # 1a 27<br />
58 Carex appropinquata 1b 3 1b 1a 2b 2a 2b 1b 3 1b 2a 1b 2b 2a 18<br />
25 Carex lasiocarpa 3 1b 3 1b 2a 2a 2b 2a 10<br />
63 Mentha aquatica 1b 2a 1b 1a 1b # 2a 1b 2a 1b 1a r 16<br />
77 Fillipendula ulmaria 1b 1b 1b # 1a 1b 1b # 10<br />
64 Equisetum fluviatile 1a 2b 2a 3 2a 2b 2b 1a 2b 3 3 3 16<br />
25 Menyanthes trifoliata 4 2b 2b 2b 2b 3 2b 9<br />
55 Carex rostrata # 3 3 4 1b 1a 1a # 10<br />
24 Eriophorum angustifolium # 1a 3<br />
63 Cirsium palustre 1a # 3<br />
70 Juncus conglomeratus # 1a 1a 4<br />
64 Galium palustre 1a 1a 1a # 1b 1a 1a 1a 1a # # 1a 1a 1a 1a 1a 1b # 1a 1a # 1a 1a 1a # 1a 1a 1a 2a 1a 1b # 2b 1a 1a # 1a 1b 1a 1a 1b 1a 1a 2a 1a 2a 1a 1a 1a 1a 2b 1b 1a 1a # 1a 73<br />
74 Lycopus europeus # # # # # # # # # # # # # # # 1a 1a 1b # # # # 1a 1a # # # 1b # 38<br />
54 Lysimachia thyrsiflora 1a # 1a 1a 1a 1a # 1a 1a # 1b 1b # 1a 1b 1a 21<br />
63 Myosotis palustris 1a 1a # 1a # 1a 1a 1a # # 1a 1a 1b 1a 18<br />
42 Carex pseudocyperus 1a r 1b # 1a 1a 2a 1a 1a 1a # # # 1b # 1a # 22<br />
95 Poa pratense 1a # # 1a 1b 1a 1a 1a # 12<br />
54 Stellaria palustre # # # 2a # 1b # 1a r # r 1a 3 17<br />
14 Leptodictyum riparium 1b 1b 1a 1a 3 3 3 3 2b 1a 2a 2b 16<br />
92 Mentha arvensis 1a 1a 2a # 1b # 1b 2b 2a 1b 2a 1a # 1b 1b 2b 2b 1b 2b 1b 1a 1b 2b 30<br />
40 Cicuta virosa # r # 2a # 1a 2b 9<br />
56 Thelypteris palustris 3 3 2b 3 3 3 3 2b 3 2a 1b 3 3 # 2b 3 3 2a 2b 2b 3 1b 1a 2b 1b 1a 1a 2a 36<br />
63 Calliergonella cuspidata 2b 1a 2a 2a 2b 2a 2b 2b 1b 2b 2a 4 16<br />
44 Rumex hydrolapathum 1a 1a 1b 1b # 1a # # # # 1a 14<br />
42 Typha latifolia # 2a 1b 1b r 6<br />
75 Solanum dulcamara 1a 1a 1a # 1a 6<br />
38 Ranunculus lingua # # 1a 4<br />
38 Cardamine pratensis subsp. dentata 1a 1b 1a 1b # 1b # 1b 1a 1a 2a 1b 1b # 18<br />
40 Sium latifolium 1b # # # 5<br />
99 Urtica dioica 1a 1b 2b 1a 1b 1a 1a 9<br />
99 Poa trivialis 2a 3 1b 3 2b 1a 8<br />
99 Calystegia sepium # 1a # 1b 1a 1a 8<br />
86 Symphytum officinalis 1a # 2b # 5<br />
60 Triglochin maritimum 4 3 0<br />
72 Glaux maritima 2b 3 0<br />
72 Juncus geradii 3 1b 0<br />
72 Plantago major susp. winteri 2b 2b 0<br />
72 Plantago maritima 2a 0<br />
Atriplex spec. 1b 2a 0<br />
91 Potentilla anserina 3 3 0<br />
Trifolium fragiferum # 0<br />
59 Schoenoplectus tabernaemontani<br />
1a #<br />
1<br />
91<br />
Begleiter<br />
Agrostis stolonifera 1a 2b # 1a 1a 1a 1a 1a # 3 1b 3 1a 1a 3 r # r 1a 3 1b 3 2b 27<br />
87 Carex acutiformis 1a 1a 2a # r 6<br />
77 Eupatorium cannabinum # # # 4<br />
68 Plagiomnium ellipticum 3 1a 1b 4<br />
44 Rorippa amphibia # # 3<br />
75 Iris pseudacorus # 1b 3<br />
66 Eleocharis palustris 1b 1a 3<br />
Alnus glutinosa r 1b 3<br />
63 Caltha palustris 2a r 3<br />
65 Glyceria maxima 2a # 3<br />
99 Calamagrostis epigeios 2a 1<br />
84 Molinia cerulea 1a 1<br />
44 Alisma plantago-aquatica r 1<br />
45 Butomus umbelatus # 1<br />
54 Hydrocotyle vulgaris 1b 1<br />
70 Juncus articulatus 1a 1<br />
74 Juncus effusus 2b 1<br />
86 Stachys palustris # 1<br />
95 Lathyrus pratensis 2b 1<br />
99 Cirsium arvense 1a 1<br />
Persicaria minor 1b 1
Anhang 8: Karte der Vegetationsaufnahmepunkte<br />
Kartengr<strong>und</strong>lage: (Symon 1990)
Anhang 9: Vergleich der C/N-Verhältnisse zwischen den Vegetationsstruktureinheiten<br />
(VSE)<br />
Tab. A9: Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Test (zweiseitig),<br />
n.s. = nicht signifikant, U= statistische Prüfgröße U, Ukrit= kritischer U-Wert, <strong>für</strong> ein signifikanten<br />
Unterschied zum Signifikanzniveau 5/10 % muss die Testgröße U den jeweiligen Ukrit unterschreiten.<br />
verglichene VSE Prüfgröße U Ukrit bei α=5% Ukrit bei α=10% p<br />
VSE1 VSE2 9 3 4 n.s.<br />
VSE1 VSE3 3 0 1 n.s.<br />
VSE1 VSE4 6 0 1 n.s.<br />
VSE1 VSE5 4 0 1 n.s.<br />
VSE1 VSE6 - - - -<br />
VSE1 VSE7 - - - -<br />
VSE2 VSE3 11 3 4 n.s.<br />
VSE2 VSE4 12 3 4 n.s.<br />
VSE2 VSE5 12 3 4 n.s.<br />
VSE2 VSE6 10 - 0 n.s.<br />
VSE2 VSE7 - - - -<br />
VSE3 VSE4 5 0 1 n.s.<br />
VSE3 VSE5 7 0 1 n.s.<br />
VSE3 VSE6 - - - -<br />
VSE3 VSE7 - - - -<br />
VSE4 VSE5 6 0 1 n.s.
Anhang 10: Vergleich der pH-Werte zwischen den Vegetationsstruktureinheiten<br />
(VSE)<br />
Tab. A10: Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Test (zweiseitig),<br />
n.s. = nicht signifikant, U= statistische Prüfgröße U, Ukrit= kritischer U-Wert, <strong>für</strong> ein signifikanten<br />
Unterschied zum Signifikanzniveau 5/10 % muss die Testgröße U den jeweiligen Ukrit unterschreiten.<br />
verglichene VSE Prüfgröße U Ukrit bei α=5% Ukrit bei α=10% p<br />
VSE1 VSE2 14 3 4 n.s.<br />
VSE1 VSE3 8 0 1 n.s.<br />
VSE1 VSE4 6 0 1 n.s.<br />
VSE1 VSE5 7 0 1 n.s.<br />
VSE1 VSE6 - - - -<br />
VSE1 VSE7 - - - -<br />
VSE2 VSE3 13 3 4 n.s.<br />
VSE2 VSE4 6 3 4 n.s.<br />
VSE2 VSE5 13 3 4 n.s.<br />
VSE2 VSE6 7 - 0 n.s.<br />
VSE2 VSE7 - - - -<br />
VSE3 VSE4 7 0 1 n.s.<br />
VSE3 VSE5 8 0 1 n.s.<br />
VSE3 VSE6 - - - -<br />
VSE3 VSE7 - - - -<br />
VSE4 VSE5 6 0 1 n.s.
Anhang 11: Messwerte der C/N-Verhältnisse <strong>und</strong> der pH-Werte<br />
Tab. A11: Messwerte der C/N-Verhältnisse <strong>und</strong> pH-Werte<br />
Punkt C/N pH VSE<br />
B10 16.0 5.48 1<br />
V42 25.4 6.84 1<br />
V43 15.1 6.14 1<br />
V6 16.5 6.45 1<br />
B11 15.5 5.79 2<br />
B3 24.2 6.28 2<br />
V22 20.5 6.23 2<br />
V60 28.3 6.40 2<br />
V65 19.8 6.55 2<br />
B9 15.8 6.14 2<br />
B15 40.2 6.36 2<br />
B12 22.2 5.50 3<br />
B2 48.3 6.00 3<br />
V32 23.7 6.62 3<br />
V64 17.7 6.68 3<br />
B13 29.2 6.57 4<br />
B4 21.4 6.56 4<br />
B8 18.7 5.98 4<br />
V24 13.4 6.82 4<br />
B6 25.5 6.92 5<br />
B5 29.2 6.50 5<br />
V36 25.5 6.18 5<br />
V49 13.6 5.37 5<br />
B14 16.8 6.65 6<br />
edl 35.3 6.84 6<br />
V67 20.4 6.43 6<br />
B7 15.4 6.21 7<br />
V70 16.7 6.90 7<br />
B16 20.3 6.16 -<br />
B1 29.3 4.49 -