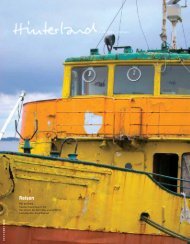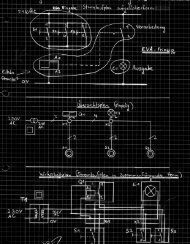Grenze - Hinterland Magazin
Grenze - Hinterland Magazin
Grenze - Hinterland Magazin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ISSN 1863-1134<br />
<strong>Grenze</strong><br />
außerdem im Heft:<br />
Schlampen Marsch! Was wir noch zu erwarten haben<br />
Verdammte Hacke! Schröders Extremismus der Mitte<br />
Wir wollen mehr! Transsexuellengesetz ungenügend<br />
Heimatkrimi abschaffen! Kluftinger ausweisen!<br />
# 18/2011 4,50 euro
Grenzschutz aus Sicht der EU<br />
uropa fährt Hochtechnologie auf, um Migrierende<br />
E davon abzubringen, dass sie die <strong>Grenze</strong>n überschreiten.<br />
Diese Grafik sowie das Infrarotbild vom Titel<br />
stammen aus aktuellen EU-Broschüren, in denen die<br />
EU-Kommission ihre technischen Errungenschaften<br />
anpreist. Die Sicherung der <strong>Grenze</strong> gerät zunehmend<br />
zur reinen Objektabwehr. Dass es sich bei den Flüchtlingen<br />
um Menschen handelt, wird ausgeblendet.<br />
Matthias Becker zeichnet in star wars ab Seite 18<br />
die Entwicklung der Genzschutz-Technologie nach<br />
und was die EU-Kommission plant und umsetzt.<br />
Das Vierteljahresheft<br />
für kein ruhiges.<br />
IMPRESSUM<br />
<strong>Hinterland</strong> #18<br />
Oktober bis Dezember 2011<br />
Titel: Infrarotaufnahme eines Flüchtlingbootes<br />
Herausgeber:<br />
Bayerischer Flüchtlingsrat<br />
Augsburgerstraße 13<br />
80337 München<br />
Verantwortlich: Matthias Weinzierl<br />
Redaktion: Andrea Böttcher, Friedrich C.<br />
Burschel, Dorothee Chlumsky, Stephan<br />
Dünnwald, Florian Feichtmeier, Stefan Klingbeil,<br />
Christoph Merk, Anna-Katinka Neetzke,<br />
Till Schmidt, Nikolai Schreiter, Sarah Stoll, Sara<br />
Magdalena Schüller<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht<br />
unbedingt die Meinung der Redaktion wiedergeben.<br />
Kontakt: redaktion@hinterland-magazin.de<br />
Gestaltung: Matthias Weinzierl<br />
Druck: Ulenspiegel Druck GmbH,<br />
Birkenstraße 3, 82346 Andechs<br />
Auflage: 1.500 Stück<br />
Website: Anton Kaun<br />
Anzeigen: anzeigen@hinterland-magazin.de<br />
Jahresabo: 21,00 Euro<br />
Abo-Bestellung: abo@hinterland-magazin.de<br />
www.hinterland-magazin.de<br />
gefördert von der UNO-Flüchtlingshilfe<br />
Eigentumsvorbehalt:<br />
Diese Zeitschrift ist solange Eigentum des Absenders, bis<br />
sie dem Gefangenen persönlich ausgehändigt worden ist.<br />
Zur-Habe-Nahme ist keine persönliche Aushändigung im<br />
Sinne des Vorbehalts. Wird die Zeitschrift dem Gefangenen<br />
nicht ausgehändigt, so ist sie dem Absender mit dem<br />
Grund der Nichtaushändigung in Form eines rechtsmittelfähigen<br />
Bescheides zurückzusenden.
4<br />
zitiert & kommentiert<br />
Von Hubert Heinhold<br />
italia brutalia<br />
5<br />
Italien liegt in Europa<br />
Die Situation von Flüchtlingen in Italien<br />
Von Domink Bender<br />
grenze<br />
12<br />
Das Abenteuer beginnt hier<br />
Der Beginn einer klandestinen Reise<br />
durch die Realitäten Europas<br />
Von Michael Westrich<br />
18<br />
Star Wars<br />
Aufrüstung an den Schengengrenzen<br />
Von Matthias Becker<br />
21<br />
Unter Zugzwang<br />
Das mexikanische Grenzregime<br />
Von Sebastian Muy<br />
28<br />
Die Guten ins Töpfchen<br />
Die Migrations- und Entwicklungspolitik der EU<br />
Von Holger Harms<br />
31<br />
Hopp oder Topp?<br />
Das entgrenzte Subjekt in digitalen Räumen<br />
Von Jana Ballenthien und Tanja Carstensen<br />
36<br />
Mauerpark Germany<br />
Geschichte und Zukunft der Residenzpflicht<br />
Von Anke Schwarzer<br />
42<br />
Die <strong>Grenze</strong>n verbrennen<br />
Über das erfolgreiche Überschreiten<br />
von europäischen Außengrenzen<br />
Von Bernd Kasparek<br />
46<br />
Wir schengen euch nix<br />
Willkommen auf dem NoBorder-Camp 2011<br />
Von Niko Schreiter<br />
49<br />
Eingeschränkte Sichtweisen<br />
Vom Märchen der „Festung Europa“<br />
Von Luise Marbach<br />
55<br />
Spiel mit <strong>Grenze</strong>n<br />
Bericht einer Aktion am Gärtnerplatz<br />
Von Julia Jäckel<br />
57<br />
<strong>Grenze</strong>n des Wachstums<br />
Über Genpflanzen und verseuchte Böden<br />
Von Barbara Brandl<br />
61<br />
Ungenügend<br />
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts<br />
zum Transsexuellengesetz<br />
Von Till Schmidt<br />
postkolonial<br />
63<br />
Mythen vom Chinesen-Maier<br />
und koloniale Propaganda<br />
Von Martin W. Rühlemann<br />
debattencaspar<br />
67<br />
Der Bauchredner aus dem Allgäu<br />
Über gefeierte regionale Kriminalromane<br />
Von Casper Schmidt<br />
bitte mitte<br />
70<br />
Herrschaft des Verdachts<br />
Bayern gegen „Extremismus“<br />
Von Fred König<br />
72<br />
Extrem unbrauchbar<br />
Kritik eines inhaltsleeren Begriffs<br />
Von Niko Schreiter<br />
fragmente<br />
74<br />
Gedicht aus dem Exil<br />
Von SAID<br />
Impressions<br />
Von Birds of Immigrants<br />
queer<br />
75<br />
Nationale Hysterie<br />
Bericht über die diesjährige Budapest Pride<br />
Von Judith Götz und Rosemarie Ortner<br />
78<br />
NEIN heißt NEIN!<br />
Chancen und Risiken einer<br />
schlampigen Protestform<br />
Von Judith Völkel<br />
lesen<br />
80<br />
Ethnographie am Ufer<br />
Von Stephan Dünnwald<br />
„Mach doch mal einer den Kulturkack aus!”<br />
Von Thomas Atzbacher<br />
Man würd doch wohl noch sagen dürfen<br />
Von Thomas Atzbacher<br />
nachgehakt<br />
85<br />
Eine deutsche Botschaft<br />
Über das Recht auf Familienzusammenführung<br />
Von Anna-Katinka Neetzke und Tobias Klaus<br />
Et voilá, liebe Lesenden,<br />
or Ihnen liegt unsere Ausgabe #18. Es ist<br />
V– wieder einmal – ein prall gefülltes Heft<br />
geworden. Auf 88 Seiten finden Sie 26 Artikel,<br />
die sich größtenteils unserem Schwerpunktthema<br />
<strong>Grenze</strong> widmen. Daneben gibt’s übrigens<br />
ein Novum, nämlich Lyrik, in Form<br />
eines Gedichtes des iranischen Exilanten<br />
SAID.<br />
Diesmal sollten Sie unser Heft auch einmal<br />
schnell durchblättern: Von hinten nach<br />
vorn! In der rechten unteren Ecke erwartet sie<br />
das Daumenkino Lampedusa von Anton<br />
Kaun. Es zeigt die Gewalt der italienischen<br />
Polizei gegen tunesische Migranten, die sich<br />
auf der Mittelmeerinsel im September abspielte.<br />
Keine leichte Kost…<br />
Unsere #19 wird übrigens wieder ein bundesweit<br />
erscheinendes Heft der Flüchtlingsräte<br />
Das Schwerpunktthema ist Abschiebung. Wir<br />
freuen uns schon jetzt auf Ihre Beiträge. Der<br />
Redaktionsschluss ist der 20. Februar 2012.<br />
…und jetzt — lesen!<br />
Ihre <strong>Hinterland</strong> Redaktion
4<br />
zitiert & kommentiert<br />
„Über den Wolken muss die<br />
Freiheit wohl grenzenlos sein ...“<br />
Hubert Heinhold<br />
ist Rechtsanwalt<br />
und im Vorstand<br />
des Fördervereins<br />
Bayerischer<br />
Flüchtlingsrat e.V.<br />
und bei Pro Asyl.<br />
Von Hubert Heinhold<br />
(Reinhard Mey)<br />
Wer teilt sie nicht, die Sehnsucht nach der<br />
grenzenlosen Freiheit? Der eine meint<br />
Repressionslosigkeit, die andere Unabhängigkeit,<br />
der nächste die geistige Freiheit, andere verstehen<br />
darunter konkrete Dinge wie „no border“,<br />
„break the wall“, keinen Knast und keine Psychiatrie et<br />
cetera. Nicht erst seit 1968 ist grenzenlose Freiheit ein<br />
Sehnsuchtsort.<br />
Dass die Freiheit der Minderheit auch die Freiheit der<br />
Mehrheit beschneiden kann, erleben wir gerade in diesen<br />
Tagen sehr schmerzhaft. Die Wirtschaft prägt die<br />
Außenpolitik der Staaten. Ob ein afrikanisches oder<br />
lateinamerikanisches Land Visumsfreiheit genießt,<br />
hängt weniger von historischen Verknüpfungen, sondern<br />
von politischen, geostrategischen und wirtschaftlichen<br />
Interessen ab. Die Ökonomie vor allem ist es,<br />
die die <strong>Grenze</strong>n erhält oder niederreißt und eine USA,<br />
eine EU oder auch nur einen Euro-Raum schafft. Jenseits<br />
dieser Interessen gibt es kein „Menschenrecht auf<br />
Reisefreiheit“, jedenfalls nicht in der Realität, sondern<br />
allenfalls in schönen Postulaten.<br />
Das Postulat „no border“ ist daher gegenwärtig nichts<br />
anderes als gut gemeint, ein Scheck auf eine Zukunft,<br />
für die zu kämpfen wir aufgefordert sind. Noch sind<br />
wir allerdings weit entfernt von einer supranationalen<br />
oder gar überkontinentalen Gemeinschaft.<br />
Auf der politisch-strategischen Ebene ist es nötig, eine<br />
offene Debatte über die interkontinentalen Wanderungen<br />
zu führen, über die <strong>Grenze</strong>n der Aufnahmebereitschaft<br />
und die Risiken und Folgen von Wanderungsbewegungen<br />
für die Länder auf der südlichen Erdhalbkugel.<br />
Eine grenzenlose Welt ist gegenwärtig ebenso<br />
wenig wünschenswert wie das eingemauerte Europa<br />
oder Amerika. Dass deren Mauern und Abwehrbollwerke<br />
geschleift werden müssen, ist klar. Welche Regelungen<br />
– und damit Begrenzungen – vernünftig und<br />
gerecht sind und wie man sie weltumspannend installieren<br />
kann, braucht noch viele Diskussionen, viel Zeit<br />
und auch die eine oder andere Revolution.
Italien liegt in Europa<br />
In Italien sind Flüchtlinge einer verheerenden Situation ausgesetzt. Aufgrund des Dublin-Systems, das<br />
festlegt, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag im EU-Einreiseland stellen müssen, werden Asylsuchende auch<br />
aus Deutschland wieder nach Italien zurückgeschoben. Eine Sammlung erschütternder O-Töne von<br />
überwiegend minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gibt Auskunft über die italienischen – und<br />
europäischen – Zustände. Von Dominik Bender<br />
Foto: Shirin Shahidi
Slumview: Streetview<br />
Das Bretterlager Comunità la Pace in Rom.<br />
Zu erkunden auch per Google Streetview.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte<br />
(EGMR) hat am 19.10.2011 (Az.<br />
64208/11) erstmals eine Dublin-Abschiebung<br />
aus Deutschland nach Italien gestoppt. Der EGMR hat<br />
der deutschen Bundesregierung in diesem Rahmen<br />
unter anderem folgende Frage zur Beantwortung vorgelegt:<br />
„Besteht angesichts der vom Beschwerdeführer<br />
vorgelegten Berichte und Schilderungen die ernstzunehmende<br />
Gefahr, dass der Beschwerdeführer im<br />
Falle einer Abschiebung nach Italien einer Verletzung<br />
in seinen Rechten aus Art. 3 Europäischen Menschenrechtskonvention<br />
ausgesetzt wird?“<br />
Dem „Statement of Facts“, das der EGMR wenige<br />
Tage später zu dem Fall veröffentlicht hat lässt sich<br />
entnehmen, dass sich in ihm die in der deutschen<br />
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung seit etwa<br />
einem Jahr kontrovers geführte Debatte über die<br />
Zulässigkeit von Dublin-Abschiebungen nach Italien<br />
in ganz besonderer Weise zugespitzt hat: Die aus<br />
Syrien stammende Familie kurdischer Volkszugehörigkeit<br />
wurde nach ihrer Einreise nach Deutschland auseinandergerissen<br />
– der Familienvater musste sich<br />
nach Nordrhein-Westfalen begeben, seine Frau und<br />
Kinder hingegen nach Sachsen-Anhalt. Auf diese<br />
Weise entstand eine für den Fall folgenreiche Aufspaltung<br />
der gerichtlichen Zuständigkeit. Da die Familie<br />
über Italien in die Europäische Union eingereist war<br />
und dort auch Fingerabdrücke hinterlassen hatte, leitete<br />
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein<br />
Verfahren zur Abschiebung der gesamten Familie<br />
dorthin ein. Alle Familienmitglieder setzten sich mit<br />
Rechtsbehelfen gegen die drohende Abschiebung zur<br />
Wehr. Und nun zeigte die Aufspaltung der gerichtlichen<br />
Zuständigkeit ihre Folgen: Während sich Frau<br />
und Kinder erfolgreich beim Verwaltungsgericht Magdeburg<br />
gegen die Abschiebung nach Italien wehrten,<br />
erklärte das für den Ehemann und Vater zuständige<br />
Verwaltungsgericht Münster die Abschiebung nach<br />
Italien für zulässig. Der Riss, der im Hinblick auf die<br />
Frage der Zulässigkeit von Italien-Abschiebungen seit<br />
2010 – ähnlich wie in den Jahren 2008 und 2009<br />
bezüglich der Griechenland-Abschiebungen – durch<br />
die unterinstanzliche verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung<br />
geht, ging nun plötzlich auch direkt durch<br />
eine Familie! Das Bundesverfassungsgericht, vom<br />
Rechtsanwalt des Familienvaters auf den ablehnenden<br />
Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster hin angerufen,<br />
hatte an der bevorstehenden Trennung der<br />
Familie und der Abschiebung des Ehemannes und<br />
Vaters nach Italien nichts auszusetzen. Wohl aber<br />
bekanntermaßen der EGMR, auf dessen endgültige<br />
Entscheidung in dem Fall nun mit Spannung gewartet<br />
werden kann.<br />
Foto: Shirin Shahidi<br />
Erschütternde Vorort-Recherchen<br />
Der Fall gibt Anlass dazu, sich noch einmal die Dramatik<br />
der Situation in Italien vor Augen zu führen<br />
und sich in Erinnerung zu rufen, warum Pro Asyl, die<br />
Schweizerische Flüchtlingshilfe zusammen mit der<br />
norwegischen Nichtregierungsorganisation Jussbuss,<br />
die norwegische Nichtregierungsorganisation NOAS<br />
sowie der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates<br />
Thomas Hammarberg, aber auch zum Beispiel das<br />
Europamagazin des SWR und die Sendung „Weltbilder“<br />
des NDR, Vorort-Recherchen in Italien unternahmen<br />
und von ihnen berichteten: Es waren die glaubhaften<br />
und erschütternden Berichte derer, die als<br />
Asylsuchende monatelang, teilweise jahrelang, in Italien<br />
um ihr Überleben gekämpft und sich schließlich<br />
zu einer Flucht aus dem italienischen Elend in ein<br />
anderes europäisches Land – darunter auch oft<br />
Deutschland, die Schweiz und Norwegen – entschieden<br />
hatten. Die Berichte dieser Menschen zu dokumentieren<br />
ist umso dringender notwendig, weil das<br />
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in<br />
Dublin-Verfahren in aller Regel auf die Anhörung<br />
(das „Interview“) der Betroffenen vollständig verzichtet,<br />
so dass es keine Kenntnis von den Hintergründen<br />
der jeweiligen Weiterflucht erhält. Es soll ja „nur“ – so<br />
die Idee hinter dem vollständigen Amtsermittlungsausfall<br />
– in ein anderes europäisches Land abgeschoben<br />
werden. An dieser Haltung des BAMF haben die<br />
zahlreichen belastbaren Belege für die dramatische<br />
Situation in Italien und auch die Vielzahl der verwaltungsgerichtlichen<br />
Aussetzungsbeschlüsse nichts<br />
ändern können – die jüngste Entscheidung des EGMR<br />
wird es wohl auch nicht tun.<br />
In der Folge sollen daher die Zitate von Betroffenen<br />
wiedergegeben werden, die teilweise auch in dem<br />
von Pro Asyl veröffentlichten Bericht zur Situation<br />
von Flüchtlingen in Italien aufgegriffen werden. Sie<br />
stammen ganz überwiegend von unbegleiteten minderjährigen<br />
Flüchtlingen, für deren rechtliche Vertretung<br />
ich als Ergänzungspfleger (d.h. als vom Familiengericht<br />
beauftragter Rechtsanwalt) verantwortlich<br />
bin. Die Zitate sind in chronologische Reihenfolge<br />
von der Flucht nach Italien bis zur Flucht aus Italien<br />
gebracht.<br />
Ankunft in Italien<br />
„Vier Tage und vier Nächte verbrachten wir auf dem<br />
Meer. Wir verloren die Orientierung, Treibstoff,<br />
Lebensmittel und Wasser gingen aus, hohe Wellen<br />
drohten das Boot zum Kentern zu bringen. Als wir<br />
ein Fischerboot sahen, flehte einer von uns, der eng-<br />
italia brutalia
8<br />
italia brutalia<br />
Foto: Shirin Shahidi<br />
Weniger geht<br />
kaum: Im besetzten<br />
Bürogebäude nahe<br />
der römischen End-<br />
lisch konnte, den Fischer an, uns zu helfen. Es seien<br />
Frauen und Kinder an Bord, einige seien ohnmächtig,<br />
wir bräuchten dringend Hilfe. Der Fischer war<br />
freundlich, er gab uns Wasser und Treibstoff, aber er<br />
hatte Angst, von der Küstenwache mit uns gesehen<br />
und der Schlepperei angeklagt zu werden. Er bot an,<br />
uns die Richtung zu zeigen, aber er bat uns, Abstand<br />
zu halten.“<br />
„Ich gehe davon aus, dass ich bei meiner Ankunft als<br />
Minderjähriger registriert wurde. Ich wies jedenfalls<br />
darauf hin, dass ich minderjährig bin. Welche Daten<br />
sie dann aber letztlich benutzten, weiß ich nicht. Das<br />
Problem war nämlich, dass bei der Registrierung nicht<br />
jeder selbst zum Namen und Geburtsdatum befragt<br />
wurde. Stattdessen wurden zwei oder drei Bootsflüchtlinge,<br />
die etwas englisch sprachen, ausgewählt<br />
und aufgefordert, für alle zu sprechen.“<br />
„Eine Person, die somalisch und italienisch sprach,<br />
musste für uns nach der Ankunft die Angaben zu den<br />
Personendaten machen, da gab es keinen Ausweg.<br />
Über die so entstandenen Personendaten erhielten<br />
wir einen Zettel, den wir um das Handgelenk gebunden<br />
bekamen. Die Daten auf meinem Zettel waren<br />
falsch. Mein Geburtsjahr lautete, soweit ich mich erinnere,<br />
auf das Jahr 1989. Danach wäre ich also mindestens<br />
18 Jahre und damit volljährig gewesen. Und das<br />
zu einem Zeitpunkt, zu dem ich in Wirklichkeit gerade<br />
mal 14 Jahre alt war!“<br />
„Ich war der Jüngste im Boot. Die Erwachsenen hatten<br />
mir gesagt, dass man mich von der Gruppe trennen<br />
werde, wenn ich sage, dass ich minderjährig bin.<br />
Ich war auf der Flucht schon so oft alleine gelassen<br />
worden, dass ich nicht schon wieder getrennt werden<br />
wollte, also sagte ich, ich sei 18 Jahre alt.“<br />
haltestelle Anagnina<br />
sind Lattenroste und Unterbringung im Erstaufnahmelager<br />
Matratzen die einzigen<br />
Möbelstücke. „Zu den Unterbringungsbedingungen in dem Lager<br />
auf Lampedusa kann ich folgendes sagen: Die Einrichtung<br />
war völlig überfüllt. Kinder, Jugendliche,<br />
Erwachsene, Frauen und Männer, Alte und Kranke –<br />
sie alle waren dort auf engstem Raum miteinander<br />
untergebracht.“<br />
„Es hieß, dass die Bürger von Turin<br />
„In Bari herrschten die gleichen<br />
sich vor Leuten wie uns fürchten.“<br />
schlimmen Unterbringungsbedingungen<br />
wie schon zuvor auf<br />
Lampedusa: Wir waren in einem<br />
überfüllten, mit Zäunen eingegrenzten Lager untergebracht,<br />
das aus Blechcontainern bestand und vom<br />
Militär bewacht wurde. Die Bewacher hatten Geweh-<br />
re geschultert, und wir fühlten uns wie in Gefangenschaft.<br />
Tagsüber war die Hitze in den Blechcontainern<br />
nicht auszuhalten, sie war unglaublich, und<br />
nachts kühlten die Temperaturen derart ab, dass wir<br />
bitter froren.“<br />
„Als einer von uns fragte, wieso wir wie Tiere von<br />
der Außenwelt abgeschirmt hier festgehalten werden,<br />
bekam er zur Antwort, dass die Bürger von Turin sich<br />
vor Leuten wie uns fürchten und das können sie<br />
ihren Mitbürgern nicht antun.“<br />
„An den Aufenthalt im Lager erinnere ich mich<br />
ungern, es war eine sehr schlimme Zeit. Das Lager<br />
wurde von Kameras und von Polizisten bewacht, ich<br />
durfte es nicht verlassen. Streit entstand oft um die<br />
wenigen Toiletten und Duschmöglichkeiten. Aber so<br />
schlimm es in dem Lager war, es war doch wesentlich<br />
besser als das, was mich danach erwartete.“<br />
Entlassung aus dem Erstaufnahmelager<br />
„Nach drei Monaten händigte man mir ein Dokument<br />
aus, das dokumentierte, dass ich für die nächste Zeit<br />
rechtmäßig in Italien bleiben dürfte. Gleichzeitig forderte<br />
man mich zum Verlassen des Lagers auf. Ich<br />
hätte einen solchen Gedanken zuvor niemals für<br />
möglich gehalten, aber plötzlich wollte ich im Lager<br />
bleiben, waren die Lebensumstände dort noch so<br />
widrig. Denn es war gerade die Zeit des Jahreswechsels<br />
2008/2009, also mitten im Winter, und ausgerechnet<br />
zu so einer Jahreszeit sollte ich einfach mir selbst<br />
überlassen werden?“<br />
„Nach einiger Zeit setzte man uns in Caltanisetta (Sizilien)<br />
vor die Tür des Flüchtlingslagers und überließ<br />
uns uns selbst. ‚Versucht es in anderen Ländern in<br />
Europa, wir wollen Euch hier nicht‘ gab man uns mit<br />
auf den Weg. Ich schloss mich mit einer Gruppe von<br />
sieben anderen minderjährigen Jungen aus Somalia<br />
zusammen. Wir alle fuhren – ohne gültiges Ticket –<br />
mit dem Zug nach Rom. Dort, so hofften wir, könnten<br />
wir Arbeit, Unterschlupf, medizinische Versorgung,<br />
Nahrung und eine Schulausbildung finden.“<br />
Ankunft in Rom<br />
„Somalische Landsleute haben mir dann angeboten,<br />
mit ihnen nach Rom zu gehen. Wir alle verbanden<br />
damit die Hoffnung, in dieser großen Metropole<br />
zumindest unsere existentiellsten Lebensbedürfnisse<br />
sicherstellen zu können. Wir hatten uns jedoch geirrt,<br />
wie wir sofort nach unserer Ankunft in Rom feststellen<br />
mussten. In dieser Stadt hat sich eine Subkultur
Cativa Italia<br />
In der Comunità la Pace leiden viele Menschen an<br />
Krankheiten, es gibt eine Dusche – ohne Wasser.<br />
der Flüchtlinge gebildet, die<br />
elend ist.“<br />
„Meistens hielt ich mich – wie<br />
die meisten Flüchtlinge – rund<br />
um den Hauptbahnhof auf. Das<br />
ist gleichzeitig der Ort, der von<br />
mafiösen Gruppen kontrolliert wird. Sie versuchen<br />
einen zu zwingen, z.B. Drogen zu verkaufen. Als ich<br />
das ablehnte, wurde ich einmal derart zusammengeschlagen,<br />
dass ich bewusstlos wurde.“<br />
„Wir haben nachts Schutz in U-Bahnhöfen und Tunneln<br />
gesucht. Aber die Sicherheitsleute haben uns<br />
verjagt, sie haben ihre Hunde auf uns gehetzt. Es<br />
wird im Winter sehr kalt in Rom und wir hatten keine<br />
Matratzen oder Decken. Wir haben auf Pappkartons<br />
geschlafen. Wenn du fünf Pappkartons hast, bist du<br />
ein reicher Mann unter den Flüchtlingen.“<br />
„Bei den gewalttätigen Übergriffen ging es aber nicht<br />
immer darum, die Betroffenen zu kriminellen Handlungen<br />
zu zwingen. Teilweise waren die Angriffe<br />
auch einfach rassistisch motiviert, und teilweise<br />
„Überall waren Kakerlaken.<br />
Ich muss heute noch würgen,<br />
wenn ich nur daran denke.“<br />
waren es sexuelle Übergriffe.“<br />
„Jede Nacht zwischen 3 und 4<br />
Uhr kamen Sicherheitsleute und<br />
verscheuchten die Menschen,<br />
die auf der Straße schliefen. Es<br />
kamen auch Fahrzeuge mit Wassertanks,<br />
die die Straße nass spritzten und auch die,<br />
die dort schliefen.“<br />
„In Rom kam ich in der somalischen Botschaft unter.<br />
Dort schlief ich auf dem Boden, nicht einmal eine<br />
warme Jacke hatte ich für den Winter. Es war<br />
unglaublich schmutzig, es gab keine Toiletten, überall<br />
waren Kakerlaken. Ich muss heute noch würgen,<br />
wenn ich nur daran denke.“<br />
„Ich hatte Somalia wegen des Krieges verlassen, aber<br />
was ich in Italien erlebte, war schlimmer. Es gab zwar<br />
keine Schießereien und Bombenangriffe, aber ich<br />
lebte auf der Straße, ich hungerte, es gab keine Schule<br />
und keinen Arzt, ich musste betteln und wurde<br />
überall verjagt.“<br />
Foto: Shirin Shahidi
10<br />
Foto: Shirin Shahidi<br />
Bürowrack<br />
Anagnina:<br />
Flüchtlinge bilden in<br />
Rom eine eigene<br />
Subkultur, zwischen<br />
Ruinen und Obdachlosigkeit.<br />
„Ein Mensch braucht drei grundsätzliche Dinge zum<br />
Leben: Essen, Wasser und Unterkunft. Man braucht<br />
auch Bekleidungen. Diese Sachen habe ich vom italienischen<br />
Staat nicht bekommen.“<br />
„Der italienische Staat hat mich aufgenommen und<br />
ohne irgendwelche Unterstützungen einfach wie<br />
Abfall zur Seite gestellt. Ein Jahr lang habe ich auf<br />
dem Busbahnhof, am Bahnhof oder auch einfach in<br />
abgestellten, kaputten Autos übernachtet. Es gab<br />
weder Essen noch Wasser. Um diese Dinge haben wir<br />
bei den Kirchen gebettelt.“<br />
„Die Probleme, die es in Italien gibt, können schrift-<br />
lich nicht ausreichend geschildert<br />
werden. Kurz gesagt, selbst<br />
wenn sich alle Blätter der<br />
Bäume zum Papier und alles<br />
Wasser zu Tinte wandeln könnten,<br />
würde es nicht ausreichen,<br />
um die Probleme in Italien<br />
schriftlich zu schildern.“<br />
„Ich war immer nur damit beschäftigt, etwas zu Essen<br />
zu finden, aber ich bekam nie mehr als eine Mahlzeit<br />
pro Tag. Ich hungerte, ich wurde krank, aber an<br />
einen Luxus wie einen Arztbesuch war nicht zu denken.<br />
Ich hätte gerne Italienisch gelernt, aber so, wie<br />
ich damals lebte, hatte ich keine Kraft dafür.“<br />
„Ich konnte mein Leben – und dabei muss ich noch<br />
einmal betonen: es war mitten im Winter und ich war<br />
gerade einmal 14 Jahre alt – nur dadurch sichern,<br />
dass ich mir Weggeworfenes von Supermärkten und<br />
Essensreste von Restaurants zusammenklaubte. Auch<br />
mit dem Verkauf von Blechdosen verdiente ich ein<br />
„Ich wachte im Krankenhaus auf,<br />
dort gab man mir etwas Traubenzucker<br />
und schickte mich sofort<br />
wieder auf die Straße.“<br />
paar Cents, für die ich mir dann Essen und Trinken<br />
kaufte.“<br />
Die Rolle der Polizei und die Ohnmacht<br />
der karitativen Einrichtungen<br />
„In Rom, wo ich im Herbst 2008 ankam, herrschte<br />
Anarchie, was die Rechte und Chancen von minderjährigen<br />
Flüchtlingen angeht. Die Polizei ist kein Ansprechpartner<br />
von uns gewesen, sondern ein Feind,<br />
vor dem man Angst hatte. Wenn ich mich hilfesuchend<br />
an die Polizei wendete, zogen die Polizisten<br />
immer sofort Gummi-Handschuhe an, zogen ihre<br />
Gummi-Knüppel und dann drohten sie teilweise nur,<br />
teilweise schlugen und bespuckten sie mich aber<br />
auch.“<br />
„Wie schon zuvor in Bari versuchte ich auch in Rom<br />
bei der Polizei Hilfe zu bekommen. Ich wies, so gut<br />
das mit meinen schlechten Italienisch- und Englisch-<br />
Kenntnissen ging, darauf hin, dass ich noch ein Kind<br />
bin und dass ich dringend Hilfe benötige. Die Reaktion<br />
der Polizisten war aber immer die gleiche: Man<br />
verscheuchte mich und gab mir noch mit auf den<br />
Weg, ich solle woanders hingehen in Europa.“<br />
„Natürlich kamen wir auf die Idee, uns statt an die<br />
Polizei an kirchliche Einrichtungen zu wenden. Ich<br />
kannte die Orte, wo es Beratung, Schlafplätze und<br />
Essen gab. Es war klar, dass immer nur die ersten in<br />
der Schlange eine Chance auf Beratung, Schlafplätze<br />
oder Nahrung hatten. So bemühte ich mich, sehr früh<br />
am richtigen Orten zu sein.<br />
Gelang mir das, kamen aber<br />
fast immer ältere, erwachsene<br />
Ausländer, schlugen uns und<br />
verdrängten uns ans Ende der<br />
Schlange. Diese Menschen<br />
waren auch Flüchtlinge, denen<br />
es ebenfalls sehr schlecht ging.“<br />
Die fehlende Gesundheitsversorgung<br />
„Besonders dramatisch wurde die Situation für mich,<br />
als ich zum ersten Mal meine Magenprobleme bekam.<br />
Ich hatte starke Schmerzen, ich krümmte mich. In<br />
den Tagen und Wochen zuvor hatte ich viele viele<br />
Kilo abgenommen und mein Stuhlgang war schwarz<br />
geworden, schwarz wie Holzkohle. Also überwand<br />
ich meine Ängste vor der Polizei und begab mich zu<br />
ihnen. Aber es geschah das gleiche, wie immer:<br />
Handschuhe, Gummiknüppel, Schläge, Beschimpfungen,<br />
Bespucken.“
„Als ich in dem besetzten Haus lebte, wurde ich<br />
krank, bekam Fieber, konnte nichts mehr essen und<br />
nahm stark ab. Mein Körper trocknete aus, meine<br />
Haut bekam Risse, juckte und ich kratzte mich blutig.<br />
Ich bekam in einer Krankenstation der Caritas Tabletten,<br />
es ging mir dann auch etwas besser, aber an den<br />
Lebensumständen, die mich krank gemacht hatten,<br />
konnte auch die Caritas nichts ändern.“<br />
„Ich wäre gern zum Zahnarzt gegangen, um die drei<br />
ausgeschlagenen Zähne ersetzen zu lassen, aber als<br />
Obdachloser hat mich kein Arzt angenommen.“<br />
„Ich lebte auf der Straße und im Winter wurde es<br />
sehr kalt. Ich wurde krank es war etwas mit der<br />
Leber, ich hatte starke Schmerzen. Wenn es schon<br />
keinen Arzt für mich gibt, dann brauche ich wenigstens<br />
ein Dach über dem Kopf, um mich dort zurückzuziehen,<br />
wenn ich krank bin.“<br />
Zuflucht in anderen europäischen Ländern und<br />
erneute Abschiebung nach Italien<br />
„Leute, die ganz früher nach Italien eingereist sind,<br />
die schaffen es. Aber die Flüchtlinge, die neu eingereist<br />
sind, haben keine Chance. Ich kannte nur die<br />
Erfolglosen, Armen, nicht die, die Erfolg hatten. Ich<br />
wäre gar nicht nach Deutschland gekommen, wenn<br />
es einen Vormund, einen Anwalt und eine Unterkunft<br />
in Italien gegeben hätte. Aber die Behörden ermuntern<br />
uns doch und fordern uns auf, unser Glück<br />
woanders zu suchen.“<br />
„In Deutschland habe ich endlich nach langer Zeit<br />
wieder zu mir gefunden. Hier wird man wie ein<br />
Mensch behandelt. Deshalb möchte ich nicht, dass<br />
man mir das bisschen Glück wegnimmt. Ich möchte<br />
nicht abgeschoben werden.“<br />
„Drei Tage vor meiner Rücküberstellung nach Italien,<br />
es muss kurz nach dem Jahreswechsel 2009/2010<br />
gewesen sein, wurde ich in der Schweiz inhaftiert.<br />
Dann flog man mich nach Rom. Ich wurde dort von<br />
der Polizei einfach an den Ausgang des Flughafen-<br />
Gebäudes gebracht. Das Zugticket vom Flughafen in<br />
die Innenstadt von Rom habe ich dann sogar selbst<br />
bezahlt. Anders wäre ich ja gar nicht weggekommen.<br />
Die folgenden vier Monate in Rom waren grausam.“<br />
„Ich habe nach meiner Abschiebung aus der Schweiz<br />
nach Rom wie vorher elend auf der Straße gelebt, das<br />
ging ein Jahr lang so. Ich war sehr schwach. Es ging<br />
nur um einen Überlebenskampf, wo finde ich Essen,<br />
wo schlafe ich, was ziehe ich überhaupt an? Das war<br />
eine lange und harte Zeit. Es ist eine Art Junkie-<br />
Leben, das man dort auf der Straße führt. Man ist 24<br />
Stunden auf der Straße und auf der Suche.“<br />
„Ich hatte in Schweden in einem Kinderheim gelebt.<br />
Wahrscheinlich deshalb wurde ich von einem Mann<br />
und einer Frau auf dem Flug begleitet. Am Flughafen<br />
wurde ich von zwei Polizisten in Empfang genommen,<br />
die Schweden flogen wieder zurück. Ich wusste<br />
nicht, wohin ich gehen sollte, also blieb ich erst einmal<br />
am Flughafen. Als es dunkel wurde, sollte ich<br />
den Flughafen verlassen. Ich fragte, wo ich schlafen<br />
solle, aber die Polizisten sagten, das sei mein Problem,<br />
sie hätten mich nicht gerufen und ich solle<br />
dahin gehen, wo ich vorher war.“<br />
„Ich hatte zwar in der Schweiz Teile von meinem<br />
Taschengeld zurückgelegt und angespart, um nach<br />
der absehbaren Abschiebung nach Italien von dort<br />
erneut fliehen zu können. Dieses Geld hatte ich mit<br />
Tesafilm in meine Unterhose eingeklebt, damit es mir<br />
nicht, wie früher meine Dokumente, geklaut würde.<br />
Nun war ich aber wieder in Rom und - das mag<br />
komisch klingen - ‚traute‘ mich nicht, es für die<br />
erneute Weiterflucht einzusetzen. Ich hatte Angst vor<br />
einem besseren Leben, weil es wieder ein absehbares<br />
Ende haben würde.“<br />
„Ich war völlig verwahrlost, ich lag mit Schüttelfrost<br />
auf dem Betonboden, ich hatte ständig Erkältungen<br />
und Grippe. Meiner Meinung nach führen Tiere ein<br />
besseres Leben als Asylsuchende. Ich will nie mehr<br />
dorthin zurück, das wird nur über meine Leiche<br />
geschehen. Ich bin in Italien fast umgekommen, tagelang<br />
habe ich nichts zu Essen gehabt, ich litt unter<br />
Unterzuckerung, ich kippte um, mitten auf der Straße,<br />
beinahe hätten mich Autos überfahren. Ich wachte im<br />
Krankenhaus auf, dort gab man mir etwas Traubenzucker<br />
und schickte mich sofort wieder auf die Straße.“<br />
„Falls man mich nach Italien abschiebt, spüre ich,<br />
dass ich nicht mehr leben kann und will. Das habe<br />
ich ebenfalls meinen Betreuern und meinem Anwalt<br />
gesagt. Ich habe gesagt: ‚Wenn sie mich nach Italien<br />
abschieben, dann bringen sie meine Leiche dorthin.‘“<<br />
italia brutalia<br />
Dominik Bender<br />
ist Rechtsanwalt mit<br />
den Schwerpunkten<br />
Ausländer- und<br />
Sozialrecht in<br />
Frankfurt am Main.
12<br />
Foto: Michael Westrich<br />
Das Abenteuer beginnt hier<br />
Michael Westrich hat<br />
mit den Flüchtlingen,<br />
von denen er<br />
im Artikel erzählt,<br />
einen Film gedreht.<br />
Der Arbeitstitel lautet<br />
„This is Europe”.<br />
Die Fotos sind Stills<br />
aus diesem Film.<br />
Watch your steps...<br />
Yolga und Klen auf dem Weg zum Frachthafen<br />
Algeciras, am südlichsten Zipfel Spaniens, ist eine wichtige Transitstadt für Migrantinnen und Migranten<br />
aus Afrika. Und für die meisten der Beginn ihrer klandestinen Reise durch die Realitäten Europas. Eine<br />
Erzählung der <strong>Grenze</strong> aus ethnographischen Fragmenten. Von Michael Westrich
Um halb fünf erwacht die Stadt aus ihrem Mittagsschlaf,<br />
durch das offene Fenster dringen<br />
die Stimmen der Nachbarn und das Lachen<br />
fussballspielender Kinder. Yolga<br />
hebt kurz den Kopf, ohne die<br />
Augen zu öffnen, horcht und<br />
dreht sich um, begleitet vom<br />
metallenen Knarren seines<br />
Hochbetts. Er wird noch eine<br />
Stunde weiterschlafen, vermutlich,<br />
vielleicht auch länger, Termine<br />
hat er nicht. Keiner hier<br />
hat heute noch Termine. Im Hintergrund säuselt das<br />
Radio unbemerkt irgendwelche Melodien, nur selten<br />
wird die Siesta für ein paar Minuten unterbrochen,<br />
weil jemand lauthals mitsingt. 17 Männer wohnen<br />
hier vorübergehend, der Großteil kommt aus Westafrika,<br />
einige aus Marokko und Algerien, wenige aus<br />
Südamerika. Die Wege der Frauen sind andere und<br />
mir als Mann schwer zugänglich. „Im Radio läuft<br />
Youssou Ndour“, ruft es aus irgendeinem Bett und<br />
jemand dreht lauter, denn auch Youssou Ndour ist<br />
ein Migrant, der seine Heimat Senegal verlassen hat,<br />
um „wie Gott in Frankreich“ zu leben. Aber trotz all<br />
seines Reichtums, heißt es, vergesse er seine Heimat<br />
nicht- deshalb singe er über sie. „Verreisen heißt bleiben,<br />
bis du weiterfahren kannst“, übersetzt Yolga mir<br />
eine Textzeile, die ich nicht verstanden habe, und sie<br />
löst breite Zustimmung im Raum aus.<br />
Transitstadt Algeciras<br />
Bei aller Unterschiedlichkeit teilen die Anwesenden<br />
hier nicht nur die Räumlichkeiten, sondern ein Schikksal:<br />
Sie reisen in Etappen, ohne Papiere und ohne<br />
Aussichten darauf, sie in den nächsten Monaten zu<br />
bekommen. Trotzdem sind sie da und wollen es bleiben,<br />
denn ebenso teilen sie einen Traum von einem<br />
besseren Leben. In Europa. Nur deshalb haben sie<br />
sich auf den Weg gemacht, haben Monate, ja Jahre<br />
ihres Lebens investiert. Und es bis Algeciras geschafft,<br />
der Hafenstadt in Südspanien, 20 Kilometer südwestlich<br />
von Gibraltar und etwa gleich weit entfernt von<br />
Tarifa, der Surferhochburg, der südlichsten Stadt<br />
Europas. Von ihren ausgedehnten, gepflegten Touristenstränden<br />
aus scheint die Bergkette zwischen<br />
Nie stehen wir zu lange an einem<br />
Punkt, bewusst sind wir in einer<br />
kleinen Gruppe losgezogen.<br />
Ceuta und Tanger zum Greifen nah, und in der Tat<br />
trennen Spanien und Marokko nur 14 Kilometer<br />
Mittelmeer. „El estrecho“, sagen die Einheimischen,<br />
die Meerenge, ein Symbol für<br />
die verwobenen Geschichten<br />
Europas, Afrikas, Lateinamerikas.<br />
Youssou Ndour stimmt den<br />
Refrain an und einige im Schlafzimmer<br />
beginnen zu tänzeln,<br />
andere bleiben liegen, schauen<br />
lächelnd zu oder ziehen sich die<br />
Decke über den Kopf. Seit<br />
Beginn meiner Feldforschung bin ich fast jeden Tag<br />
hier, am Ende werden es genau acht Monate sein.<br />
Der Ort übt eine Faszination auf mich aus, er scheint<br />
seine eigenen Zeiten und Rhythmen zu haben: Es ist<br />
ein Ort des Transits, in dem sich Reisende und ihre<br />
Geschichten treffen, ein Haus der immer offenen<br />
Türen, unscheinbar gelegen im Hinterhof eines Kirchenareals<br />
nahe des Hafens in Algeciras. Zu Zeiten<br />
Francos trafen sich hier regimekritische Zirkel, heute<br />
leben hier vor allem Menschen ohne Papiere und<br />
ohne Aussichten auf politisches Asyl.<br />
Nahe der Migration<br />
Nur 35 Minuten Schiffstransfer bis Tanger, verkünden<br />
allgegenwärtige Werbeplakate vor den Zäunen der<br />
Hafenanlagen in Algeciras, gleich neben dem Parkplatz,<br />
wo Obdachlose in aufgebrochenen Autos wohnen.<br />
Wir passieren den Hafen, um nach Jobs zu<br />
suchen, nachdem die verlängerte Siesta vorbei ist. Mit<br />
Yolga unterwegs zu sein verändert die Stadt, man<br />
sieht anders. Der Hafen ist eine sensible Gegend, im<br />
Umfeld der kleinen Ticketverkäufer, die sich wie Perlen<br />
an einer Schnur entlang der Ringstraße aufreihen,<br />
gehen informelle und formelle Geschäftspraktiken<br />
nahtlos ineinander über. Je nach Geschmack finden<br />
sich hier offizielle und gefälschte Fährtickets, mehr<br />
oder weniger gut gefälschte Markenklamotten, Drogen<br />
und Prostitution. Yolga und Klen bewegen sich<br />
vorausschauend, ich passe mich an. Nie stehen wir<br />
zu lange an einem Punkt, bewusst sind wir in einer<br />
kleinen Gruppe losgezogen. Oft reden sie über „das<br />
Abenteuer“, wie sie es nennen, und lachen, stellen<br />
zur allgemeinen Belustigung Assoziationen her zwischen<br />
dem Strand in Algeciras und der Sahara oder<br />
grenze
14<br />
grenze<br />
den Hierarchien untereinander<br />
und denen der „Ghettos“, den<br />
chaotischen Orten migrantischer<br />
Selbstorganisation entlang der<br />
Migrationsrouten. Humor hilft<br />
ihnen, sich den Erinnerungen<br />
zu nähern, die sie alle teilen,<br />
und gleichzeitig Distanz herzustellen, vermute ich.<br />
Und mir hilft die Nähe zu ihnen und die Erfahrungen<br />
die wir teilen, eine andere, menschliche Dimension<br />
der Migration kennenzulernen, einen Blick zu entwikkeln<br />
für ihre Körper, ihre Materialitäten und Machtstrukturen,<br />
zu versuchen, eine Perspektive daraus zu<br />
machen, von der aus die <strong>Grenze</strong> sich anders erzählen<br />
lässt.<br />
Bruder, hast du 50 Cent?<br />
Wir überqueren den Parkplatz und laufen am Frachthafen<br />
entlang. Yolga und Klen sind ordentlich gekleidet,<br />
die Rastalocken säuberlich geflochten, selbstsicher<br />
wirken sie. Wir passen gegenseitig auf uns auf,<br />
sie auf mich in der manchmal etwas diffusen Welt am<br />
Rande unserer Gesellschaft, ich auf sie in der Öffentlichkeit,<br />
wo ich mit meiner hellhäutigen, blonden<br />
Erscheinung vermutlich das Stereotyp einer klandestinen<br />
Flüchtlingsgruppe sprenge. Vor uns taucht ein<br />
Afrikaner auf, er trägt eine auffällige Arbeitsuniform<br />
mit Neonstreifen, „mein Bruder“, begrüßt ihn Yolga<br />
und stellt sich dann vor. Sami jobbt als Parkeinweiser,<br />
er ist stolz, Arbeit zu haben. „Ihr müsst Euch bei<br />
Vovis bewerben“, sagt er, „aber es gibt eine lange<br />
Warteliste. Manche haben Glück, andere warten sechs<br />
Monate oder ein ganzes Jahr. Ihr müsst hartnäckig<br />
sein, jeden Tag nachfragen“. Vovis ist eine NGO, die<br />
gegründet wurde, um sozial schwache Spanier und<br />
Spanierinnen zu unterstützen. Sie bietet aber auch als<br />
einzige Organisation weit und breit die Möglichkeit,<br />
ohne Papiere und trotz Arbeitsverbots Geld zu verdienen.<br />
Ein Mercedes biegt ein, Klen und zwei seiner<br />
Kollegen spurten los, winken, pfeifen, rufen „weiter,<br />
weiter, weiter“ und fuchteln mit den Armen. Das<br />
Auto folgt, die junge Frau am Steuer schaltet den<br />
Motor aus, Klen wartet neben dem Wagen. Sie steigt<br />
aus, gibt eine Münze und geht schnell davon. 60 Cent<br />
kostet das „Ticket“, ein Kinokarten-ähnlicher Abriss,<br />
auf dem die Organisation für die Spende dankt. Sami<br />
öffnet seine Hand, sagt „Seht Ihr!“ und zeigt uns eine<br />
Euro-Münze. Manche geben nichts, andere, wie die<br />
junge Frau gerade eben, runden auf. „Du kannst<br />
arbeiten so lange du willst“, wenn man Acht- oder<br />
gar Zwölf-Stunden-Schichten leiste, verdiene man bis<br />
zu 800 Euro im Monat. Yolga ist schweigsam geworden,<br />
am liebsten würde er hierbleiben und sofort die<br />
Yolga fragt seinen Bekannten<br />
nach Kontakten, die Arbeit haben<br />
könnten, doch der schüttelt den<br />
Kopf. „La crisis“, sagt er.<br />
Arbeit antreten. So hat er sich<br />
Europa doch vorgestellt: Einmal<br />
über den Hafen laufen, Arbeit<br />
finden und pro Monat 200 Euro<br />
an seine arme Mutter schicken,<br />
die er seit seiner Jugend unterstützt.<br />
Sie wartet, ohne ihn nagt<br />
sie am Hungertuch. Wir verabschieden uns, „Bruder“,<br />
sagt Klen, „gib mir ein paar Cent für eine Zigarette“,<br />
und Sami kramt 50 Cent aus seiner Tasche. Freude,<br />
Gelächter, Abschied.<br />
Vom Abenteuer in die Krise<br />
Neben einem marokkanischen Café, in dem nachmittags<br />
viele der allgegenwärtigen Schwarzhändler zu<br />
finden sind, treffen wir einen Bekannten aus dem<br />
Senegal, der sich seine eigene ökonomische Nische<br />
geschaffen hat: Er hat zwar keine Papiere, aber ein<br />
Zimmer in der Wohnung eines Bekannten, das er<br />
gegen Geld mit Touristen oder Landsleuten teilt, die<br />
er – selbst als Tourist getarnt – am Hafen kennenzulernen<br />
versucht. Yolga fragt ihn nach Kontakten, die<br />
Arbeit haben könnten, doch der Bekannte schüttelt<br />
den Kopf. „La crisis“, sagt er, ganz so wie die meisten<br />
Spanier und Spanierinnen, wenn man sie fragt, wie es<br />
ihrem Land geht. Doch in diesem Fall kommt<br />
erschwerend hinzu, dass Yolga und Klen laut Gesetz<br />
nicht arbeiten dürfen. Erst wenn sie nachweisen können,<br />
drei Jahre im Land gewesen zu sein, keinerlei<br />
Probleme mit der Justiz und einen Arbeitsvertrag in<br />
Petto zu haben, erst dann haben sie Aussichten auf<br />
eine Arbeitserlaubnis.<br />
Wenn er je Papiere haben sollte, werde er Business<br />
mit Afrika machen, meint Yolga. Oder ins Migrationsgeschäft<br />
einsteigen, denn Migrierende reisen mit<br />
Ersparnissen, und je enger die <strong>Grenze</strong>n werden,<br />
umso mehr Geld lässt sich damit verdienen. Das wissen<br />
die Polizei, die Leute die Visa und Pässe fälschen,<br />
die Schlepperbanden, die Fahrerinnen und Fahrer, die<br />
Personen die Essen verkaufen, die Banditen. Yolga<br />
hat Koffer und Kleidung verkauft, als er verstand,<br />
worauf er sich eingelassen hatte, sein Geld versteckte<br />
er außerhalb der Zelte oder Zimmer, ehe er zu Bett<br />
ging – was ihm zu Gute kam, als er in Algerien verhaftet<br />
und in die malische Wüste abgeschoben<br />
wurde. Ausgerechnet nach Tinsawaten. „Wenn du auf<br />
Abenteuer sagst, dass du in Tinsawaten warst, respektieren<br />
dich alle“, sagt Yolga und fügt hinzu: „Five<br />
kilometers to hellfire“. Er aber hatte noch genug<br />
Geld, um von dort erneut nach Nordalgerien zu fahren.<br />
Klen lacht und stimmt zu, auch er wurde mehrmals<br />
erwischt und abgeschoben, aber „weggehen
heißt Mann sein“. Ein Abenteurer müsse klug sein<br />
und viele Leute kennen – denn die Realitäten der<br />
Reise ändern sich ständig und schnell. Er muss „robben<br />
wie ein Soldat“, lernen, wann man „die Zäune<br />
angreift“ oder wie man „den<br />
Zug stiehlt“. Er darf niemandem<br />
vertrauen, muss aber gleichzeitig<br />
Allianzen bilden, um die kritischen<br />
Punkte der Reise zu<br />
überwinden. Deshalb gibt es<br />
auf diesem Weg keine Frauen,<br />
ihre Taktiken sind andere. Deshalb<br />
ist die Geschichte, die ich<br />
hier erzähle, männlich. „Wenn du ohne Geld nach<br />
Hause kommst, glauben alle, dass du es gegessen<br />
hast“. Die Frage ist daher nicht, ob man es schafft,<br />
nach Europa zu kommen, sondern wie viele Anläufe,<br />
wie viel Zeit man braucht. Wie klug die Finten, wie<br />
stark der Körper. Wenn die Entscheidung einmal<br />
gefallen ist, gibt es kein Zurück mehr, zu groß wären<br />
die eigene Scham und das Unverständnis der anderen.<br />
Das Klingeln meines Handys unterbricht uns. Am<br />
anderen Ende ist ein Bekannter, er hat mir einen<br />
Gesprächstermin mit den Beamten der Grenzpolizei<br />
organisiert – informell, denn offiziell müsste ich dafür<br />
eine Erlaubnis aus Madrid oder gar Warschau einholen,<br />
schließlich geht es um die Sicherheit Spaniens<br />
und Europas, gerade jetzt, zehn Jahre nach 09/11. Ich<br />
Mit Frontex kamen die RABIT-<br />
Teams, die Polizisten aus der<br />
gesamten EU und neueste<br />
Technik.<br />
Warten...<br />
…dass die Zeit vergeht. Transitstadt Algeciras<br />
verspreche, die Namen nicht zu veröffentlichen.<br />
Im „Kampf gegen Migration“<br />
Kurze Zeit später betrete ich das Büro eines leitenden<br />
Beamten der Guardia Civil, straff<br />
baut er sich in seiner grünlichen<br />
Uniform hinter dem Schreibtisch<br />
auf, um uns zu begrüßen. Ich<br />
habe das Gefühl, er freut sich<br />
über mein Interesse, bereitwillig<br />
und nicht ohne Stolz erzählt er<br />
vom „Kampf gegen Migration“,<br />
wie er es nennt, durchgeführt<br />
mit einer Symbiose von Radarschirmen und Wärmebildkameras,<br />
Herzfrequenzmessern und Schnelleinsatzbooten.<br />
Die Hardware des modernen „Grenzmanagements“,<br />
mit dem Sicherheit und Menschenrechte<br />
gleichermaßen garantiert werden sollen. Die<br />
Geschichte, die er erzählt, ist eine des Erfolgs, Bilder,<br />
wie sie uns aus Griechenland, Lampedusa und Malta<br />
erreichen, seien hier Vergangenheit. In zwei Linien<br />
operiere die Guardia Civil heute, an der Küste und in<br />
den umliegenden Dörfern. Er schätze, dass so gut<br />
wie niemand unbemerkt über den Estrecho gelange.<br />
Zehn Kilometer weit überwache SIVE, das „integrierte<br />
Grenz-Überwachungssystem“, den kompletten Schiffsverkehr<br />
in der Meerenge von der Küste aus; seit Mai<br />
auch aus der Luft, womit er vermutlich den eigentlich<br />
zivilen Transporthubschrauber meint, der täglich zwischen<br />
Ceuta und Algeciras verkehrt.<br />
Foto: Michael Westrich
16<br />
Bleierner Nachmittag<br />
Yolga und seine Bettnachbarn überbrücken die Zeit<br />
Foto: Michael Westrich<br />
Die die Freiheit kontrollieren<br />
Anfang 2000, zur Hochzeit der „Boat People“, war<br />
hier noch alles anders, erinnert er sich. Da es keine<br />
lückenlose Radarüberwachung gab, erkannte die<br />
Küstenwache die kleinen Boote sehr spät und musste<br />
oft mitansehen, wie acht Boote gleichzeitig landeten.<br />
Dann wurde das Budget zur Überwachung der<br />
Außengrenzen aufgestockt und Frontex gegründet,<br />
und mit Frontex kamen die RABIT-Teams, die Polizisten<br />
aus der gesamten EU und neueste Technik. Über<br />
die Zusammenarbeit der Fron-<br />
tex-Teams wisse jedoch der Chef<br />
der Policía Nacional mehr. In<br />
diesem Moment stößt auch er zu<br />
uns, ein junger, groß gewachsener<br />
Mann, sympathisch, gebildet,<br />
politisch korrekt in seiner Wortwahl.<br />
Die Bedeutung der EU-<br />
Grenzschutzagentur bestehe für<br />
ihn vor allem in der Zentralisierung von Informationen<br />
und in den regelmäßigen internationalen Einsätzen<br />
– wobei er kurz darüber klagt, wie schwierig die<br />
Zusammenarbeit zum Teil sei, da so gut wie niemand<br />
in seinem lokalen Team eine Fremdsprache und nur<br />
Yolga dreht, raucht und raunt mit<br />
tiefer Stimme, wie leid er es sei,<br />
um jede Zigarette betteln zu müssen.<br />
Und um jedes Telefonat<br />
nach Hause.<br />
wenige ausländische Kollegen und Kolleginnen spanisch<br />
sprächen. Dann erklärt er mir, wieso eine intensivere<br />
Kontrolle und ein entschiedeneres Durchgreifen<br />
an der Schengener Außengrenze alleine aus Perspektive<br />
der Menschenrechte absolut notwendig sei.<br />
Er selbst sei dabei gewesen, als ein Ruderboot mit<br />
Flüchtlingen vor einigen Jahren an Land gezogen<br />
wurde und alle 33 Insassen tot waren. Oder erst vergangene<br />
Woche, als eine Frau in einer Patera, die<br />
geborgen wurde, entbunden hatte. Um das alles zu<br />
verstehen, müsse man die Geschichten dahinter kennen,<br />
die armen Leute fielen Menschenhändlern zum<br />
Opfer – Europa aber sei ein<br />
Raum der Sicherheit und der<br />
Freiheit.<br />
Sein oder Nicht-Sein in Europa<br />
Als ich mich auf den Rückweg<br />
mache, dämmert es bereits.<br />
Yolga sitzt auf einem Plastikstuhl<br />
vor dem Haus und wartet, dass die Zeit vergeht.<br />
Nach Arbeit kann er erst morgen wieder suchen. Wieder<br />
wird er an den Hafen gehen, bei Vovis fragen,<br />
den Schwarzmarkt durchkämmen. Ich setze mich zu<br />
ihm, lege meinen Tabak auf den Tisch und warte mit
ihm. Er dreht, raucht und raunt mit tiefer Stimme, wie<br />
leid er es sei, um jede Zigarette betteln zu müssen.<br />
Und um jedes Telefonat nach Hause. Um ein Bier.<br />
Wenn ich weggehe, wird er aufhören zu rauchen, bis<br />
er selbst Geld verdient. Wenn es nach dem Gesetz<br />
geht also erst in drei Jahren. drei Jahre Stillstand, drei<br />
Jahre warten. Mindestens. Yolga, Klen und all die<br />
anderen hier sind in keinem Asylverfahren, sie haben<br />
keinerlei Anspruch auf Hilfe, schlafen in sozialen Einrichtungen<br />
oder Orten, an denen sie sich selbst organisieren<br />
können, holen sich Kleidung von der Caritas.<br />
Finanzielle Unterstützung bekommen sie von niemandem.<br />
Keinen Cent. Sie sind da und sie sind Menschen,<br />
aber „wir dürfen nicht einmal sein“, wie Yolga<br />
trocken feststellt.<br />
Die die <strong>Grenze</strong> in sich tragen<br />
Vom Zentrum aus gesehen ließen sich die kurzen,<br />
fragmentarischen Geschichten, die ich in diesem Text<br />
erzählt habe, unter „Illegalität“ subsumieren, es würde<br />
aber jeder körperlichen Dimension entbehren. Europa<br />
verteidigt an seinen <strong>Grenze</strong>n nicht nur Freiheit und<br />
Sicherheit, sondern auch die Idee, die es sich von<br />
sich selbst macht. Es vergisst dabei jedoch, was dekoloniale<br />
Denker die „koloniale Differenz“ nennen 1 ,<br />
also den Punkt, an dem Europa begonnen hat, sich<br />
zeitlich und geographisch auf Abstand zu den Anderen<br />
zu bringen. „Wir sind immer noch die Sklaven“,<br />
meint Yolga und spielt damit auf die Machtbeziehungen<br />
an, in die die Geschichten Afrikas und Europas<br />
eingewoben sind. In den Kolonien galten schon<br />
immer eigene Gesetze, und es gab eigene Gesetze für<br />
die Kolonialisierten. Jene Anderen aus der Peripherie<br />
der zivilisierten Welt wurden gebraucht, um die Idee<br />
eines weißen, christlichen, männlichen Europas zur<br />
Deckung zu bringen mit einem Territorium. Heute<br />
aber bringen die mobilen Körper der Migration<br />
Bewegung in die räumliche und zeitliche Ordnung,<br />
sie überschreiten und verändern die <strong>Grenze</strong>, die<br />
wiederum mit Ausschluss reagiert. „Some are forced<br />
to be border“, schreibt Etienne Balibar 2 , manche sind<br />
dazu gezwungen, <strong>Grenze</strong> zu sein. Grenz-Personen.<br />
Ich habe eine „Perspektive nahe der Migration“<br />
gewählt, um diese körperliche Dimension der <strong>Grenze</strong><br />
nicht aus den Augen zu verlieren. Was außerdem aus<br />
einer anderen Blickrichtung vermutlich nicht sichtbar<br />
ist, sind jene Momente der Zusammengehörigkeit und<br />
der Solidarität, die an manchen Punkten der<br />
Geschichte durchscheinen. Trotz aller Heterogenität<br />
der Migrantinnen und Migranten eint sie der Wille,<br />
etwas zu verändern. Kwame Nimako und Stephen<br />
Small 3 würden darin wohl den utopischen Horizont<br />
grenze<br />
der Diaspora erkennen, Regina Römhild 4 das Aufscheinen<br />
eines Kosmopolitismus von unten. Yolga<br />
nennt es Abenteuer, und darin schwingt ein offenes<br />
Ende mit sowie die ständige Hoffnung, es möge ein<br />
gutes sein. Doch der Alltag in Europa ist unmenschlich<br />
schwierig. „Das Abenteuer“, sinniert Yolga, und<br />
er wirkt etwas abgeklärt, „das Abenteuer endet gar<br />
nicht in Europa“, so wie er immer gedacht hatte. „Es<br />
beginnt hier“.<<br />
1 Grosfoguel, Rámon<br />
(2008): Transmodernity,<br />
border thinking, and global<br />
coloniality. Eurozine, 1-23,<br />
www.eurozine.com<br />
2 Balibar, Etienne (2002):<br />
Politics and the other<br />
scene. London, Verso<br />
3 Nimako, Kwame and<br />
Stephen Small (2009): Theorizing<br />
Black Europe and<br />
African diaspora: Implications<br />
for citizenship, nativism,<br />
and xenophobia. In<br />
Black Europe and the African<br />
diaspora. Darlene Clark<br />
Hine, Trica Danielle Keaton,<br />
et al. (Hg.), Urbana, University<br />
of Illinois Press<br />
4 Römhild, Regina (2009):<br />
Aus der Perspektive der<br />
Migration: Die Kosmopolitisierung<br />
Europas. In No integration?!Kulturwissenschaftliche<br />
Beiträge zur<br />
Integrationsdebatte in Europa.<br />
Sabine Hess, Jana Binder,<br />
et al. (Hg.), Bielefeld,<br />
transcript<br />
Besser so?<br />
Die Küste Marokkos<br />
vom spanischen<br />
Festland aus gesehen.<br />
Michael Westrich<br />
promoviert am Institut<br />
für Europäische<br />
Ethnologie der Humboldt<br />
Universität zu<br />
Berlin über Migration<br />
und soziale<br />
Bewegungen an den<br />
EU-Außengrenzen.
18<br />
Star Wars<br />
Vor knapp vier Jahren kündigte die Kommission der Europäischen Union an, man wolle ein gemeinsames<br />
europäisches Grenzüberwachungssystem entwickeln. Dieses European Border Surveillance System (EURO-<br />
SUR) hat den Zweck, den Mitgliedsstaaten eine „vollständige situative Kenntnis ihrer Außengrenzen“ zu<br />
verschaffen. Von Matthias Becker
Es ist bemerkenswert, dass dieses umfassende<br />
Grenzüberwachungssystem bereits zuvor und<br />
in einem ganz anderen Politikfeld auf den Weg<br />
gebracht wurde – nämlich als Teil der europäischen<br />
Forschungsförderung. Seit 2007 unterstützt die EU<br />
finanziell Projekte, in denen neue Techniken für die<br />
Grenzkontrolle entwickelt werden. Das Forschungsprogramm<br />
heißt „Sicherheitsforschung“, die Programmlinie<br />
„Intelligente Überwachung und Grenzsicherheit“.<br />
In diesem Rahmen arbeiten Behörden,<br />
Rüstungs- und Informationstechnikkonzerne mit staatlichen<br />
Forschungsinstituten zusammen und entwickeln<br />
Hightech für die Kontrolle der Schengen-<strong>Grenze</strong>n.<br />
Software berechnet „Migrationsbewegungen“<br />
Viele dieser Projekte klingen nach Science-Fiction,<br />
sind aber ernst gemeint. Da gibt es unbemannte<br />
Landroboter, die demnächst in Grenzgebieten patrouillieren<br />
könnten. Schwimmende „Überwachungsplattformen“<br />
für den Einsatz auf hoher See, die sich<br />
untereinander vernetzen. Software-Systeme, die quasi<br />
alle verfügbaren Daten auswerten, um vorherzusagen,<br />
wo demnächst Einwanderer eintreffen werden.<br />
Mit Wissenschaft im gängigen Sinn hat die sogenannte<br />
Sicherheitsforschung nicht viel zu tun. Beispielsweise<br />
versucht kein einziges der geförderten Projekte<br />
zu definieren, was „Sicherheit“ eigentlich bedeuten<br />
soll und wie sie also herzustellen wäre. Stattdessen<br />
handelt es sich um „Forschung und Entwicklung“,<br />
wie sie ohnehin in den entsprechenden Abteilungen<br />
der Rüstungsindustrie stattfindet. Es geht um die<br />
Beschaffung von technischen Anlagen für Polizei,<br />
Militär und Grenzschutz und darum, organisatorische<br />
Standards festzulegen, damit sie reibungslos über Landesgrenzen<br />
hinweg miteinander kooperieren können.<br />
Der Aufbau von EUROSUR soll nach dem Willen der<br />
EU-Kommission in drei Etappen vor sich gehen. In einer<br />
ersten Phase sollen die nationalen Systeme zur Grenzüberwachung<br />
zusammenfließen. Dann will die EU in<br />
einer zweiten Phase gemeinsame Mittel und Technik<br />
anschaffen. In einem Arbeitspapier von Januar 2011 verweist<br />
die Kommission ausdrücklich auf die Forschungsprojekte<br />
aus der Sicherheitsforschung, die dabei berükksichtigt<br />
werden sollten. In der letzten Phase sollen die<br />
beteiligten Organe mit einem gemeinsamen IT-System<br />
über die Meeresgrenzen Informationen teilen. Mit<br />
EUROSUR will die EU zunächst das Mittelmeer, den<br />
südlichen Atlantik und das Schwarze Meer überwachen,<br />
bei Erfolg könnte das System aber ausgeweitet werden,<br />
um dann alle maritimen Schengen-<strong>Grenze</strong>n abzudecken.<br />
Um die „vollständige situative Kenntnis der Außen-<br />
grenzen“ zu erreichen, werden<br />
die diversen Datensammlungen<br />
Entscheidend ist<br />
aus den Mitgliedsstaaten in<br />
der Austausch zwischen den<br />
einem „System der Systeme“ nationalen Behörden über neue<br />
zusammenfließen. In einer Mach- Methoden mit denen Migrierende<br />
barkeitsstudie hat die Firma ESG<br />
versuchen, nach Europa<br />
unter Beteiligung von EADS,<br />
hineinzukommen.<br />
Selex und Thales sowie der Universität<br />
der Bundeswehr dafür<br />
technische und organisatorische<br />
Standards festgelegt. Für EURO-<br />
SUR verarbeiten die Behörden unter anderem Daten<br />
aus der Satellitenaufklärung, von Überwachungssensoren<br />
im Grenzgebiet, Drohnen und Radargeräten.<br />
Entscheidend ist außerdem der Austausch zwischen<br />
den nationalen Behörden über neue Methoden, mit<br />
denen Migrierende ohne entsprechende Papiere versuchen,<br />
nach Europa hinein zu kommen.<br />
Wenig bekannt ist der letzte Baustein des EUROSUR–<br />
Lagebilds, das sogenannte Common Pre-frontier Intelligence<br />
Picture (CPIP). Die europäische Grenzschutzbehörde<br />
Frontex soll dieses europaweite Informationssystem<br />
betreuen. Seine Aufgabe ist es unter<br />
anderem, durch eine teil-automatisierte Trendanalyse<br />
„Migrationsbewegungen“ zu entdecken oder vorherzusagen,<br />
bevor sie an einer Schengen-<strong>Grenze</strong> ankommen,<br />
um entsprechende Ressourcen zur Abwehr<br />
bereitzustellen. Zu diesem Zweck verarbeitet das<br />
System Informationen über die Ströme außerhalb<br />
Europas – eben vor der <strong>Grenze</strong>. CPIP enthält neben<br />
Satellitenaufnahmen und Informationen der Nachrichtendienste<br />
auch sogenannte Open Source Intelligence<br />
(OSINT). Das sind Daten, die über das Internet (mehr<br />
oder weniger) frei zugänglich sind: Pressemeldungen,<br />
Werbeanzeigen, Einträge in Blogs, Diskussionsforen<br />
und möglicherweise auch in Sozialen Netzwerken<br />
wie Facebook.<br />
Selbstbedienungsladen der Rüstungsindustrie<br />
oder bewusste Aufrüstung?<br />
Von den Geldern für die „Sicherheitsforschung“ profitieren<br />
in erster Linie große Rüstungsfirmen und Informationstechnikkonzerne<br />
der großen EU-Mitgliedstaaten:<br />
etwa EADS, BAE, Atos Origin, Alcatel, Thales oder<br />
Finmeccanica. Weil die EU bis zu drei Viertel der Entwicklungskosten<br />
übernimmt – mit der Begründung,<br />
dass der Absatzmarkt für diese Produkte nicht gesichert<br />
sei – können diese Privatunternehmen mit Steuergeldern<br />
Grundlagenforschung betreiben, ohne die<br />
Produkte unmittelbar verwerten zu müssen. Möglicherweise<br />
kommt dabei etwas heraus, was sich auf dem<br />
Weltmarkt für Sicherheitstechnik vermarkten lässt.<br />
grenze
20<br />
Mit Aktentasche<br />
und Strickpulli<br />
So stellt die EU ihre-<br />
Technik zur<br />
Menschenabwehr<br />
auf youtube vor:<br />
http://www.youtube.c<br />
om/v/jpxZ24Daxlk<br />
Die Ausrichtung der Forschung dient offensichtlich<br />
den Interessen des „sicherheitsindustriellen Komplexes“<br />
(Ben Hayes). Die Industrie hat in weiten Teilen<br />
selbst definiert, in welchen „sicherheitsrelevanten<br />
Bereichen“ sie „Forschungsbedarf“ sieht. „Sicherheitsrelevant“<br />
sind – Überraschung! – genau die Technikfelder,<br />
in denen sie ohnehin tätig ist. Aber auch die<br />
staatlichen Behörden, die irgendwie mit dem Schutz<br />
der <strong>Grenze</strong>n befasst sind, waren an der Konzeption<br />
beteiligt.<br />
Aus der Perspektive der Behörden 2007 erhielt das Europäische<br />
und der Unternehmen ist die Forum für Sicherheitsforschung<br />
Grenzkontrolle ein taktisches, und -innovation (ESRIF) von der<br />
technisch zu lösendes EU-Kommission den Auftrag,<br />
Problem.<br />
eine umfassende Sicherheitsforschungsstrategie<br />
für die Zeit bis<br />
2030 zu entwickeln. Dieses<br />
Forum setzte sich zu gleichen<br />
Teilen aus Vertretern der Industrie und staatlicher<br />
Behörden zusammen. Leiter der „Arbeitsgruppe<br />
Grenzsicherheit“ im ESRIF war Erik Berglund, der<br />
damalige Chef der Forschungsabteilung von Frontex,<br />
heute deren „Director for Capacity Building“.<br />
Matthias Becker<br />
lebt in Berlin und „Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz des<br />
arbeitet als freier Grenzmanagements. Dazu müssen wir verstehen,<br />
Journalist für diverse welche Grenzaktivitäten es innerhalb und außerhalb<br />
Zeitungen und Europas gibt“, heißt es im 2009 veröffentlichten<br />
Radiosender. 2010 Abschlussbericht dieser Arbeitsgruppe. Als zukünftige<br />
erschien im Heise- Prioritäten nennt der Bericht unter anderem „eine<br />
Verlag sein Buch effiziente und effektive Kontrolle der Personen- und<br />
„Datenschatten. Auf Warenströme an den Grenzübergängen“ und „die<br />
dem Weg in die Überwachung der Grenzregionen“. Biometrie und<br />
Überwachungsgesell- Sensortechnik sollen vermehrt zum Einsatz kommen,<br />
schaft?“<br />
um „Anomalien in großen regulären Strömen“ zu entdecken.<br />
Utopien technischer Machbarkeit<br />
Gemeinsam ist den Vertreterinnen und Vertretern der<br />
Industrie und den Verantwortlichen in den Behörden,<br />
soweit es in den Forschungsprojekten sichtbar wird,<br />
eine technokratische Auffassung von Grenzkontrolle.<br />
Sie setzen auf Hightech – auf Kameras mit noch besserer<br />
Auflösung, auf noch bessere Sensoren, noch<br />
komplexere Algorithmen und noch schnellere Computer.<br />
Etwa Hälfte der Fördermittel wurde bisher für<br />
Anlagen zur Detektion und Überwachung ausgegeben.<br />
Der Trend geht dabei zu mobilen Überwachungsanlagen,<br />
sogenannten Drohnen. Fast alle Neuentwicklungen<br />
nutzen avancierte Sensor- und Computertechnik.<br />
Mit ihr sollen Überwachungsaufgaben<br />
automatisiert und effektiver gemacht werden.<br />
Aus der Perspektive der Behörden und der Unternehmen,<br />
die ihnen die Ausrüstung für ihre Aufgaben liefern,<br />
ist die Grenzkontrolle ein taktisches, technisch<br />
zu lösendes Problem: Wer heimlich über die <strong>Grenze</strong><br />
will, soll entdeckt und festgesetzt werden. In ihren<br />
Szenarien spielen die Beweggründe und Ressourcen<br />
der Menschen, die die <strong>Grenze</strong>n übertreten, keine<br />
Rolle. Ebensowenig die Korruption europäischer und<br />
außereuropäischer Behörden – oder auch die simple<br />
Tatsache, dass jede noch so avancierte Überwachungstechnik<br />
überlistet werden kann.
Unter Zugzwang<br />
Jedes Jahr versuchen tausende zentralamerikanische Migrantinnen und Migranten, irregulär in die USA<br />
zu gelangen. Der Weg durch Mexiko kommt dabei einem Spießroutenlauf gleich: Es drohen Kontrollen<br />
und Abschiebung, Raub und Vergewaltigung, Entführung und Mord. Trotz dieser unhaltbaren Zustände<br />
sperrt sich die mexikanische Regierung gegen eine Entkriminalisierung der Transitmigration.<br />
Von Sebastian Muy<br />
waren die Parteien, die Bürgermeister,<br />
die Gouverneure, die Bundesbe-<br />
„Wo<br />
hörden, die Armee, die Marine, die<br />
Kirchen, die Kongresse, die Unternehmer; wo waren<br />
wir alle, als die Wege und Straßen, die nach Tamaulipas<br />
führen, sich in tödliche Fallen verwandelten für<br />
schutzlose Männer und Frauen, für unsere Brüder<br />
und Schwestern, Migrantinnen und Migranten aus<br />
Zentralamerika?“, fragte der bekannte mexikanische<br />
Schriftsteller Javier Sicilia vor circa 150.000 Demonstrierenden<br />
auf der Abschlusskundgebung des „Marsches<br />
für würdevollen Frieden und Gerechtigkeit“,<br />
der am 8. Mai diesen Jahres in Mexiko-Stadt stattfand.<br />
Er nahm damit Bezug auf den Mord an 72 mittel- und<br />
südamerikanischen Migrantinnen und Migranten auf<br />
einer Ranch im Nordosten Mexikos im August 2010.<br />
Angehörige der kriminellen Gruppierung „Los Zetas “<br />
hatten sie ermordet, nachdem sie sich offenbar<br />
geweigert hatten, sich in deren Dienste zu stellen.<br />
Seitdem wurden vor allem im Norden Mexikos<br />
wiederholt Massengräber entdeckt, in denen Hunderte<br />
getötete Menschen, darunter viele Migrantinnen<br />
und Migranten, verscharrt worden waren.<br />
Foto: Ricardo Ramírez Arriola<br />
Es geht ein Zug<br />
nach Nirgendwo…<br />
Migrantinnen und<br />
Migranten versuchen<br />
auf die anfahrenden<br />
Züge aufzuspringen
22<br />
Foto: Hauke Lorenz<br />
Längst haben die Übergriffe auf<br />
Transitmigrantinnen und -<br />
migranten alarmierende Ausmaße<br />
angenommen und tragen<br />
einen gewichtigen Teil zur grausamen<br />
Bilanz des seit Jahren<br />
zunehmend eskalierenden mexikanischen<br />
„Drogenkrieges“ bei.<br />
Nach Schätzungen der nationalen Menschenrechtskommission<br />
sowie zivilgesellschaftlicher Organisationen<br />
werden seit einigen Jahren jährlich mehr als<br />
20.000 meist zentralamerikanische Migrantinnen und<br />
Migranten auf ihrem Weg durch Mexiko entführt. Hinter<br />
den Taten stehen kriminelle Gruppierungen wie<br />
die erwähnten „Zetas“; oft mit Billigung oder Zuarbeit<br />
von mexikanischem Behördenpersonal. Migrierende<br />
werden häufig unter Folter gezwungen, Angehörige<br />
anzurufen und sie um die Übersendung eines hohen<br />
Lösegeldes zu bitten. Wer sich weigert oder über<br />
keine zahlungsfähigen Verwandten verfügt, wird<br />
gefoltert, verstümmelt und häufig ermordet.<br />
Besonders dramatisch ist die Situation der migrierenden<br />
Mädchen und Frauen: Amnesty International geht<br />
davon aus, dass sechs von zehn Transitmigrantinnen<br />
während ihrer Reise durch Mexiko sexualisierte<br />
Gewalt erleben.<br />
Um dem Kontrollnetz der<br />
Migrationspolizei zu entkommen,<br />
sind die Migrantinnen und<br />
Migranten gezwungen, auf<br />
klandestine Migrationsrouten<br />
auszuweichen.<br />
Sprung ins Ungewisse…<br />
Ein Migrant wechselt den Waggon<br />
Die Rolle der Ex-Elitemilitärs<br />
Die Geschichte der Zetas steht<br />
exemplarisch für die enge Verquickung<br />
von staatlichen Institutionen<br />
mit kriminellen Gruppierungen<br />
in Mexiko. Gegründet<br />
wurden die Zetas um die Jahrtausendwende<br />
von ehemaligen Angehörigen militärischer<br />
Eliteeinheiten – sie hatten eine Spezialausbildung<br />
für den Anti-Drogen-Kampf erhalten, waren<br />
zuvor aber auch zur Aufstandsbekämpfung im Chiapas-Konflikt<br />
sowie im guatemaltekischen Bürgerkrieg<br />
im Einsatz – zunächst als militärischer Arm des Golfkartells,<br />
einer der großen Gruppen des organisierten<br />
Verbrechens in Mexiko. Von diesem spalteten sie sich<br />
jedoch 2010 ab und sind seitdem zu einem der wichtigsten<br />
– und brutalsten – Akteure im mexikanischen<br />
Drogenkrieg geworden. Über die traditionellen Aktivitätsfelder<br />
der Drogenkartelle hinaus haben die Zetas<br />
durch Entführungen, Erpressungen und Menschenhandel<br />
an Geld und Macht gewonnen. Die Entführung<br />
von Migrantinnen und Migranten stellt dabei ein<br />
lukratives Geschäft dar: Nach Schätzungen der nationalen<br />
Menschenrechtskommission CNDH verdienen<br />
kriminelle Gruppierungen jährlich etwa 50 Millionen<br />
US-Dollar durch die Erpressung von Lösegeldern.
Kein Freund und Helfer<br />
Das praktisch risikolose Agieren der Entführerbanden<br />
wird erst durch die weit verbreitete Korruption und<br />
die Verbindungen ermöglicht, die zwischen dem Per-<br />
sonal mexikanischer Behörden<br />
und der organisierten Kriminalität<br />
bestehen. Zu diesem<br />
Schluss kommt auch der UN-<br />
Sonderberichterstatter für die<br />
Rechte der Migrantinnen und<br />
Migranten, Jorge Bustamante, in<br />
einem Bericht von 2008: „Durch<br />
die Allgegenwart der Korruption<br />
auf allen Ebenen der Regierung<br />
und die enge Verbindung, die viele Behörden mit<br />
den Bandennetzwerken haben, kommt es weiterhin<br />
zu Erpressungen, Vergewaltigungen und tätlichen<br />
Angriffen gegen Migrantinnen und Migranten.“ Auch<br />
die nationale Menschenrechtskomission spricht von<br />
„mittäterschaftlichen Verbindungen zwischen der Kriminalität<br />
und einigen staatlichen Akteuren“. Die von<br />
ihr und Nichtregierungsorganisationen gesammelten<br />
Zeugenaussagen von betroffenen Migrantinnen und<br />
Migranten legen hiervon Zeugnis ab. Abgesehen von<br />
der Korruption können die Migrierenden auch sonst<br />
von den zuständigen Behörden wenig Hilfe erwarten:<br />
Cecilia Romero, bis September 2010 Direktorin der<br />
mexikanischen Migrationsbehörde INM, empfahl den<br />
undokumentierten Migrierenden, sich den Behörden<br />
freiwillig zu stellen und sich in ihre Heimatländer<br />
abschieben zu lassen, um einer möglichen Entführung<br />
zu entgehen.<br />
Mexiko als vertikale <strong>Grenze</strong><br />
In dieser Aussage spiegelt sich die Ausrichtung der<br />
mexikanischen Migrationspolitik auf ein reines Kontrollregime<br />
wieder. Während ab 1994 durch mehrere<br />
Freihandelsabkommen die <strong>Grenze</strong>n für den Warenverkehr<br />
zwischen den USA, Mexiko und den zentralamerikanischen<br />
Staaten weitgehend aufgehoben wurden,<br />
richtete Mexiko seine Migrationspolitik – einerseits<br />
unter dem Druck der USA, anderseits mit dem<br />
Argument, so die nationale Souveränität zu wahren –<br />
zunehmend auf die Versiegelung seiner Südgrenze<br />
aus. Mexiko verpflichtete sich gegenüber den USA<br />
dazu, durch strikte Kontrollen gegen die irreguläre<br />
Migration aus dem Süden vorzugehen. Mexiko wurde<br />
so zur „vertikalen <strong>Grenze</strong>“, zu einem Filter im Kampf<br />
der USA gegen illegalisierte Migration. Die <strong>Grenze</strong> ist<br />
dabei nicht auf den territorialen Grenzraum zwischen<br />
Mexiko und Guatemala reduziert, sondern befindet<br />
sich überall im mexikanischen Hoheitsgebiet, wo irre-<br />
Das Risiko, auf der Reise<br />
vergewaltigt zu werden, ist<br />
derart präsent, dass einige<br />
Migrantinnen sich vor dem<br />
Aufbruch Verhütungsmittel<br />
injizieren.<br />
gulär Reisende dem Risiko von Kontrollen und<br />
Abschiebung ausgesetzt sind. Um dem engmaschigen<br />
Kontrollnetz der Migrationspolizei (INM), etwa auf<br />
den öffentlichen Straßen vor allem im Süden des Landes,<br />
zu entgehen, sind die Migrantinnen und Migran-<br />
ten gezwungen, auf klandestine<br />
Migrationsrouten auszuweichen.<br />
Die meisten müssen die ersten<br />
300 Kilometer nach dem Grenzübertritt<br />
zu Fuß bewältigen, um<br />
dann auf einen Güterzug aufzuspringen<br />
und so zu versuchen,<br />
die (je nach Route) zwischen<br />
1800 und 3900 Kilometer von<br />
der Süd- zur Nordgrenze hinter<br />
sich zu bringen. Dabei kommt es häufig zu tragischen<br />
Unfällen, bei denen Migrierenden ums Leben kommen<br />
oder Gliedmaßen verlieren. Zudem führen die<br />
Zugstrecken durch Gebiete, in denen kriminelle<br />
Gruppierungen ihr Unwesen treiben. Sie überfallen<br />
die Reisenden, rauben sie aus, und entführen sie. Die<br />
entführten Migrantinnen und Migranten werden in<br />
sogenannte Casas de Seguridad (Sicherheitshäuser)<br />
verschleppt und dort festgehalten. Dort sind sie<br />
Erpressung, Folter, Vergewaltigung und anderen<br />
Übergriffen schutzlos ausgeliefert.<br />
Sexualisierte Gewalt als Waffe gegen Migrantinnen<br />
und Migranten<br />
Der massiven sexualisierten Gewalt gegen migrierende<br />
Frauen und Mädchen in Mexiko liegt ein gesellschaftlicher<br />
und historischer Hintergrund zugrunde.<br />
Die UN-Sonderberichterstatterin zur Gewalt gegen<br />
Frauen, Yakin Ertürk, attestierte der mexikanischen<br />
Gesellschaft 2006 die fortwährende Dominanz einer<br />
„machistischen Kultur“, die ein „hohes Aggressionsniveau<br />
gegen Frauen“ hervorrufe und aufrechterhalte.<br />
Dieses wird im brutalisierten Kontext der organisierten<br />
Kriminalität, in dem es allein um Macht und Geld<br />
– nicht um Legalität oder gesellschaftliche und moralische<br />
Legitimität geht – noch potenziert. Die undokumentierten<br />
Transitmigrantinnen sind als Frauen,<br />
Migrantinnen und Statuslose dabei gleich mehrfacher<br />
Diskriminierung und Angreifbarkeit ausgesetzt. Die<br />
gegenüber sexualisierter Gewalt ohnehin verbreitete<br />
Straflosigkeit, rassistische Diskriminierung und ihr<br />
irregulärer Status führen die Frauen in die faktische<br />
Rechtlosigkeit. Dies führt dazu, dass sie den Übergriffen<br />
der Täter – unter anderem kriminelle Banden,<br />
Schlepper, Angehörige von Polizei und Migrationsbehörde<br />
oder auch anderer Migranten und Angehörige<br />
der mexikanischen Zivilbevölkerung – meist ohne<br />
Schutz ausgeliefert sind. Das Risiko, auf der Reise<br />
grenze
24<br />
Foto: Ricardo Ramírez Arriola<br />
vergewaltigt zu werden, ist derart präsent, das einige<br />
Migrantinnen sich vor dem Aufbruch Verhütungsmittel<br />
injizieren, um nicht ungewollt schwanger zu werden.<br />
Auch irregulär migrierende Jungen und Männer sind<br />
von sexualisierter Gewalt betroffen.<br />
Entlang der gängigen irregulären Migrationsrouten<br />
gibt es nur wenige Orte, an denen die Migrierenden<br />
Unterschlupf und Unterstützung erhalten. Die katholische<br />
Kirche und lokale Gemeinden betreiben entlang<br />
der Strecken einige Herbergen, in denen die Migrierenden<br />
einige Tage kostenlos unterkommen, ihre
Kleidung waschen, zu essen bekommen und Ärzte<br />
konsultieren können. Zudem sind die Herbergen Ort<br />
des Austauschs. Migrantinnen und Migranten sprechen<br />
über ihre Erfahrungen und Strategien, über Weiter-<br />
oder Rückreise und knüpfen Netzwerke. Die<br />
Betreiberinnen und Betreiber der Herbergen versu-<br />
Rauf aufs Dach…<br />
Wer mitreisen will, muss sich notgedrungen<br />
an Leitern und Vorsprüngen festklammern<br />
chen, Menschenrechtsverletzungen gegen die Migrierenden<br />
öffentlich zu machen, weswegen sie zuweilen<br />
Einschüchterungen seitens der Polizei oder Gangs<br />
ausgesetzt sind.
26<br />
Wider die Kriminalisierung<br />
der Migration<br />
Angesichts der schockierenden<br />
Ausmaße der Übergriffe gegen<br />
Transitmigrantinnen und -migranten<br />
in Mexiko haben zahlreiche<br />
zivilgesellschaftliche und religiöse<br />
Organisationen im März dieses<br />
Jahres der Bevölkerungskommission<br />
der Abgeordnetenkammer<br />
vorgeschlagen, ein neues Visum für diese Personengruppe<br />
einzuführen: zwar sei Mexiko – angesichts von<br />
mehreren Millionen häufig ohne gültigen Papiere in<br />
den USA lebenden Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern<br />
– für seinen Einsatz für die Rechte von Migrantinnen<br />
und Migranten bekannt. Sowohl bei den Vereinten<br />
Nationen als auch im interamerikanischen Menschenrechtssystem<br />
habe Mexiko die Bemühungen vorangetrieben,<br />
mehr rechtliche Instrumente zum Schutz vor<br />
Übergriffen und Diskriminierung zu schaffen, gleichzeitig<br />
aber habe es sich in den letzten Jahren zu einem<br />
der gefährlichsten Länder für Transitmigrantinnen und<br />
-migranten entwickelt. Die Autorinnen und Autoren<br />
kritisieren den „reaktiven Fokus“ der mexikanischen<br />
Regierung, deren Engagement gegen die Entführungen<br />
sich auf meist fruchtlose Ermittlungen beschränke. Der<br />
Kern des Problems würde nicht angetastet: die Illegalisierung<br />
der Transitmigration. Sie zwinge die meist aus<br />
Zentralamerika stammenden Migrantinnen und Migranten<br />
zum Ausweichen auf die klandestinen Routen, auf<br />
Mexiko hat sichzu einem<br />
der gefährlichsten Länder für<br />
Transitmigrantinnen und<br />
-migranten entwickelt.<br />
denen sie eine leichte „Beute“<br />
für die Gruppen der organisierten<br />
Kriminalität darstellen. Die<br />
beteiligten Organisationen schlagen<br />
daher vor, ein Visum für<br />
Transitmigrantinnen und -<br />
migranten zu schaffen, das zwei<br />
Monate gültig ist und an jede<br />
Person ausgestellt wird, die die<br />
Absicht äußert, das mexikanische<br />
Territorium zu durchqueren.<br />
Zwar existiert bereits im bisher geltenden mexikanischen<br />
Bevölkerungsgesetz die Kategorie des Transitmigranten<br />
bzw. der Transitmigrantin. Die Ausstellung<br />
eines entsprechenden Visums ist jedoch ausgeschlossen,<br />
sofern keine Einreiseerlaubnis ins Zielland vorliegt.<br />
Und ein Visum für die USA zu erhalten ist an<br />
Bedingungen geknüpft, die für die große Mehrheit<br />
aller Zentralamerikanerinnen und -amerikaner unerfüllbar<br />
sind. Schon für ein US-Touristenvisum müssen<br />
Staatsangehörige zentralamerikanischer Staaten nachweisen,<br />
ihren festen Wohnsitz außerhalb der USA zu<br />
haben und dort in stabilen Lebensverhältnissen zu<br />
leben. Sie müssen glaubhaft machen, die USA nur für<br />
eine genau begrenzte Zeit besuchen zu wollen und<br />
alle Reisekosten selbst decken können. Die Entscheidung<br />
ist letztlich auch von der subjektiven Einschätzung<br />
des Konsuls oder der Konsulin abhängig. Auch<br />
die Ausstellung eines mexikanischen Touristenvisums<br />
ist für die allermeisten zur Migration entschlossenen
Menschen keine realistische<br />
Option, da die Anforderungen<br />
eng an jene für ein US-Visum<br />
geknüpft sind. Für Menschen,<br />
die von Armut betroffen sind,<br />
bleibt daher in der Regel nur<br />
die Reise ohne gültiges Visum.<br />
Die Realisierung des Vorschlags<br />
und die Ausstellung einer Durchreiseerlaubnis ohne<br />
ausschließende Kategorisierungen würde es den Transitmigrantinnen<br />
und -migranten ermöglichen, zumindest<br />
bis zur Nordgrenze legal reguläre Transportmittel<br />
zu nutzen und damit ihre Angreifbarkeit deutlich zu<br />
verringern.<br />
Gegenwind in Mexiko und aus den USA<br />
Der Einführung eines „barrierefreien“ Visums für<br />
Transitmigrantinnen und -migranten, wie vom Bündnis<br />
der zivilgesellschaftlichen und religiösen Organisationen<br />
vorgeschlagen, stehen jedoch Hindernisse im<br />
Weg: Die USA – und vor allem die an Mexiko<br />
angrenzenden Bundesstaaten, die ihre Anti-Immigrations-Gesetzgebung<br />
in den letzten Jahren massiv verschärft<br />
haben – setzen der Legalisierung der Transitmigration<br />
ihren Widerstand entgegen. Sie sind ungeachtet<br />
der vielen gewaltsamen Übergriffe vor allem<br />
daran interessiert, dass die mexikanische Politik die<br />
irregulären Migrationsbewegungen Richtung Norden<br />
„vorfiltert“, bevor sie die US-<strong>Grenze</strong> erreichen. Die<br />
Herausforderung bestehe also darin, so das an der<br />
Ausarbeitung des Vorschlags beteiligte mexikanische<br />
Menschenrechtszentrum Centro Prodh, die mexikanische<br />
Regierung davon zu überzeugen, ihre Migrationspolitik<br />
nicht an den Bedürfnissen der USA auszurichten,<br />
sondern das Leben von Tausenden von<br />
Migrierenden zu schützen. Keine einfache Aufgabe,<br />
wird Migration von der Calderón-Regierung doch vor<br />
allem im Zusammenhang mit Drogen-, Waffen- und<br />
Menschenhandel im Rahmen eines Sicherheitsdiskurses<br />
thematisiert. So ließ der Präsident 2007 verlauten:<br />
„Es ist wichtig, den Fluss an illegalem Waffen-, Personen-<br />
und Drogenverkehr/-handel zu stoppen, (...) es<br />
ist wichtig, sich um die Durchlässigkeit unserer <strong>Grenze</strong>n<br />
mit Guatemala und vor allem mit Belize zu kümmern.“<br />
Es ginge darum, „an der Südgrenze die Tür<br />
der Entwicklung zu öffnen und nicht die Tür der Kriminalität.“<br />
Wenngleich viele mexikanische „Landsleute“ in den<br />
USA ebenso unter Entrechtung und Diskriminierung<br />
zu leiden haben, kann auch in der mexikanischen<br />
Gesellschaft keineswegs von einem hegemonialen<br />
Interesse an der Verteidigung der Rechte der Migran-<br />
Es passiert selbst indigenen<br />
Mexikanerinnen und Mexikanern,<br />
dass sie von der Migrationspolizei<br />
schikaniert oder sogar<br />
abgeschoben werden.<br />
tinnen und Migranten ausgegangen<br />
werden: Xenophobe und<br />
rassistische Ideologien sind verbreitet<br />
und stehen einer Solidarisierung<br />
mit den Transitmigrantinnen<br />
und -migranten im Wege.<br />
Der anti-indigene Rassismus der<br />
Mehrheitsbevölkerung und politischen<br />
Eliten, der ein Erbe des europäischen Kolonialismus<br />
ist, verdichtet sich zusammen mit xenophoben<br />
Abwehrhaltungen gegen Zentralamerikanerinnen<br />
und -amerikaner und klassistischen Vorurteilen gegen<br />
„Armutsmigrantinnen und -migranten“ zu einem<br />
Diskurs, in dem Einwandererinnen und Einwanderer<br />
vor allem als Gefahr für die nationale Souveränität<br />
und Sicherheit wahrgenommen werden. Dieser<br />
Diskurs verleiht den Übergriffen gegen Migrantinnen<br />
und Migranten vor allem in der migrationsstrategisch<br />
wichtigen Küstenregion von Chiapas einen gewissen<br />
Grad an gesellschaftlicher Akzeptanz. Armut, Indigenität<br />
und (irregulärer) Migrationsstatus werden oftmals<br />
in eins gesetzt, so dass es zuweilen selbst indigenen<br />
Mexikanerinnen und Mexikanern passiert, dass<br />
sie von der Migrationspolizei schikaniert oder sogar<br />
abgeschoben werden.<br />
Angesichts dieses Gegenwindes verwundert es nicht,<br />
dass es bislang nicht danach aussieht, dass auf parlamentarischem<br />
Wege eine reale Verbesserung der Situation<br />
der Migrierenden erreicht würde. Zwar wurde<br />
Ende April das neue Migrationsgesetz verabschiedet,<br />
welches das Bevölkerungsgesetz ersetzen soll. Jedoch<br />
werden Migration dort weiterhin unter Gesichtspunkten<br />
der nationalen Souveränität und Sicherheit verhandelt<br />
und die Kontrollbefugnisse der Migrationsbehörden<br />
aufrechterhalten. Die Möglichkeit, mit der Einführung<br />
des neuen Gesetzes die Transitmigration de<br />
facto zu entkriminalisieren, wurde nicht genutzt. Die<br />
genaueren Ausgestaltungen zum Migrationsgesetz –<br />
etwa Anwendungshinweise – stehen noch nicht fest.<br />
Derzeit deutet jedoch alles darauf hin, dass es<br />
schlicht am politischen Willen fehlt, die freie und<br />
sichere Ein- und Durchreise gesetzlich möglich zu<br />
machen.<br />
Dabei ist eine Entkriminalisierung dringend notwendig.<br />
Irreguläre Migration wird sich nicht durch<br />
Abschiebungen, Grenzzäune und sonstige staatliche<br />
Kontrollversuche und auch nicht „mit Hilfe“ der organisierten<br />
Kriminalität aufhalten lassen. Nicht der einzige,<br />
aber der wichtigste Migrationsgrund bleibt die<br />
weitverbreitete Armut in den Ländern Mittelamerikas,<br />
die wiederum die Staaten des Nordens maßgeblich<br />
verantworten.<<br />
grenze<br />
Sebastian Muy<br />
war als freiwilliger<br />
Mitarbeiter beim<br />
mexikanischen Menschenrechtsnetzwerk<br />
„Red Todos Derechos<br />
para Todas y Todos”<br />
(Red TDT) in Mexiko-Stadt<br />
tätig. Er lebt<br />
und arbeitet derzeit<br />
in Berlin.
28<br />
Die Guten ins Töpfchen<br />
Die Migrations- und Entwicklungspolitik der EU fördert einzig die Mobilität der Elite des globalen<br />
Südens und verfolgt dabei vor allem ihre eigenen Ziele. Von Holger Harms
Migration heißt immer auch Entwicklung, so<br />
die Europäische Union. Vorbei sind die Zeiten,<br />
in denen die Mobilität von Menschen<br />
des globalen Südens hier nur als Problem wahrge-<br />
nommen wurde und mit allen<br />
Mitteln unterbunden werden<br />
musste. Denn entsprechend<br />
gesteuert könne Migration, so<br />
meint die EU, erhebliche Vorteile<br />
für Herkunfts- als auch Aufnahmeländer<br />
sowie natürlich für<br />
die Migrierenden selbst bedeuten.<br />
In dieser Konstellation profitiert<br />
die EU von den dringend benötigten Arbeitskräften<br />
und die „peripheren“ 1 Herkunftsstaaten von<br />
den Rücküberweisungen der im Ausland arbeitenden<br />
Staatsangehörigen. Und natürlich könnten die Migrierenden<br />
durch ihren Aufenthalt in der „entwickelten“<br />
Welt Kenntnisse, Fähigkeiten und Kontakte erwerben,<br />
die sie nach ihrer Rückkehr zu ihrem und zum Vorteil<br />
ihrer Angehörigen nutzen. Soweit die Vorstellung der<br />
EU zu einer entwicklungsfördernden Migrationssteuerung.<br />
Brain gain statt brain drain<br />
Die von der EU betriebene, zusehends verzahnte<br />
Migrations- und Entwicklungspolitik sieht jedoch<br />
anders aus. So entwirft die Europäische Kommission<br />
unter dem Titel „Konsolidierung des Gesamtansatzes<br />
zur Migrationsfrage: Für mehr Koordinierung, Kohärenz<br />
und Synergie“ (2008) ihre Vorstellung einer<br />
kohärenten Politik in den Bereichen Migration und<br />
Entwicklung: Die sogenannte legale Migration soll<br />
gefördert, die sogenannte irreguläre bekämpft und<br />
das Zusammenspiel von Migration und Entwicklung<br />
begünstigt werden. Dabei will die EU die euphemistisch<br />
als „Partnerländer“ bezeichneten Staaten des<br />
Südens bei den Bemühungen unterstützen „ihre<br />
Kapazitäten zur Steuerung der legalen Migration auszubauen“.<br />
Ist im Gesamtansatz zunächst noch allgemein<br />
von der Förderung der Mobilität die Rede, so<br />
zeigt sich in der Umsetzung der Politik, wessen Mobilität<br />
genau gemeint ist. Explizit nennt die EU Forschende,<br />
Studierende, Unternehmerinnen und Unternehmer<br />
sowie Fachkräfte – die Elite also. Visaerleichterungen,<br />
Anerkennung von Studienabschlüssen,<br />
Übertragbarkeit von Pensions- und Sozialversicherungsansprüchen<br />
sowie weitere unterstützende Maßnahmen<br />
sollen diese Gruppen für einen temporären<br />
Aufenthalt in der EU begeistern. Die behauptete zeitliche<br />
Begrenzung des Aufenthalts ist dabei wichtig für<br />
die Legitimation des Gesamtansatzes. Um nicht zur<br />
desaströsen Fachkräfteabwanderung im Süden beizu-<br />
Die Förderung der Mobilität<br />
der Elite der Peripherie ist nicht<br />
als entwicklungspolitische Maßnahme<br />
zu verstehen, sondern<br />
als wohlfeiles Eigeninteresse<br />
der EU.<br />
tragen, hat die EU dafür das Konzept der zirkulären<br />
Migration ersonnen: Arbeitskräfte arbeiten oder forschen<br />
für eine vorher festgelegte Zeit in der EU,<br />
unterstützen schon während ihres Aufenthalts durch<br />
Rücküberweisungen ihre Angehörigen<br />
und dadurch indirekt<br />
auch ihre Herkunftsländer. Nach<br />
ihrer Rückkehr kommen ihre<br />
Kenntnisse und Kontakte<br />
schließlich der Entwicklung<br />
ihrer Länder zugute. Der durch<br />
die Fachkräfteabwanderung verursachte<br />
brain drain würde so<br />
zu einem brain gain.<br />
Dabei blendet diese Vorstellung einer Wissensvermittlung<br />
aus der „entwickelten“ in die „zu entwickelnde“<br />
Welt nicht nur die von der westlichen Hemisphäre<br />
verursachten Krisen aus und stellt den westlichen<br />
Entwicklungsweg als „natürliches“ Endziel einer jedweden<br />
Entwicklung dar. Die Idee des brain gain<br />
macht zudem die koloniale Kontinuität der unionseuropäischen<br />
Entwicklungszusammenarbeit deutlich.<br />
Selbst wenn man diese Betrachtungen unberücksichtigt<br />
lässt, ist doch die Wahrscheinlichkeit einer (freiwilligen)<br />
Rückkehr nach Beendigung von Forschung<br />
oder Beschäftigungsverhältnis eher gering. Legal<br />
migrierte Fachkräfte mit gesicherter qualifizierter<br />
Anstellung kehren nur in den seltensten Fällen<br />
zurück. Die Aussichten auf eine vergleichbare Arbeitsstelle<br />
und auch die Anwendbarkeit der erworbenen<br />
Kenntnisse sind oft nicht gegeben.<br />
Wettbewerb um die klügsten Köpfe<br />
Ob die EU mit ihren Anreizen für die Elite des<br />
Südens die Fachkräfteabwanderung aus der kapitalistischen<br />
Peripherie tatsächlich verringern will, ist<br />
mehr als fraglich. Die Durchlässigkeit der EU-<strong>Grenze</strong>n<br />
für die Elite zu erhöhen, ist vielmehr Ausdruck des<br />
weltweit stattfindenden Wettbewerbs um die klügsten<br />
Köpfe. Die USA etwa pflegen schon lange einen präferentiellen<br />
Umgang mit Hochqualifizierten, wobei<br />
Qualifikation nicht selten mit einem überdurchschnittlich<br />
hohen Einkommen gleichgesetzt wird. Aber auch<br />
andere kapitalistische Zentren und nicht zuletzt die<br />
aufsteigenden Ökonomien China und Indien buhlen<br />
um die globale Elite und diese rekrutiert sich zusehends<br />
nicht mehr nur aus den westlichen Staaten.<br />
Durch den verschärften Wettbewerb sind nun auch<br />
Hochqualifizierte aus anderen Teilen der Welt schwer<br />
umkämpft. Und auch wenn sich die Politik noch<br />
lange mit Slogans wie „Kinder statt Inder“, so beispielsweise<br />
Jürgen Rüttgers als damaliger Ministerprä-<br />
grenze<br />
1 Der Begriff Peripherie<br />
bezeichnet<br />
hier lediglich die<br />
periphere Stellung<br />
im globalen Kapitalismus<br />
und nicht ein<br />
Defizit nicht-westlicher<br />
Regionen.
30<br />
grenze<br />
sident von Nordrhein-Westfalens, gegen diese Entwikklung<br />
zu wehren versuchte, ist auch die EU längst<br />
abhängig von der Zuwanderung vor allem von Hochqualifizierten.<br />
Die Förderung der<br />
Mobilität der Elite der Peripherie<br />
Die zugrunde liegende Argumen-<br />
ist vor diesem Hintergrund also<br />
tation läuft darauf hinaus, dass nicht als entwicklungspolitische<br />
es für den größten Teil der Maßnahme zu verstehen, son-<br />
Menschen besser sei, einfach dern als wohlfeiles Eigeninteres-<br />
zu bleiben wo sie sind.<br />
se der EU. Im Europäischen Pakt<br />
zu Einwanderung und Asyl<br />
(2008) fordert der Rat zudem,<br />
„die Attraktivität der Europäischen<br />
Union für hochqualifizierte Arbeitnehmer zu<br />
erhöhen“. Die Zuwanderung richtet sich dabei nach<br />
dem Bedarf der Europäischen Union. Das Entstehen<br />
einer lokalen Elite in den Herkunftsländern wird so<br />
oft unmöglich gemacht, was nicht nur in ökonomischer<br />
Hinsicht ein Problem ist, sondern auch Gesundheitssystem,<br />
Bildungswesen und Verwaltung des globalen<br />
Südens immens belastet. Und wo es in Europa<br />
unzählige wissenschaftliche Publikationen gibt, die<br />
sich mit der „Peripherie“ befassen, fehlt eben dort<br />
nicht nur das Geld für die Forschung, sondern auch<br />
die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.<br />
2 CIGEM steht für<br />
Centre d'Information<br />
et de Gestion<br />
des Migrations (Zentrum<br />
für Information<br />
und Migrationsmanagement).<br />
Holger Harms<br />
studierte Internationale<br />
Beziehungen<br />
und Entwicklungspolitik<br />
und engagiert<br />
sich im Café Exil in<br />
Hamburg.<br />
Entwicklungszusammenarbeit<br />
als Migrationssteuerung<br />
Die Förderung der legalen Migration, die vor allem<br />
die Elite anspricht und den Nutzen der Aufnahmeländer<br />
verfolgt, ist für die EU immer auch ein Grund,<br />
um gleichzeitig die irreguläre Migration einzudämmen.<br />
Nicht konsequent gegen die „Illegalen“ vorzugehen<br />
würde die Bemühungen der EU für mehr Mobilität<br />
nach ihrer Lesart konterkarieren. So dienen denn<br />
die Programme zur legalen Migration zur Legitimation<br />
der umso härter durchzusetzenden Abwehr gegen die<br />
ungewollte Zuwanderung. Über die Möglichkeiten,<br />
vor allem aber über die <strong>Grenze</strong>n der legalen Zuwanderung<br />
will die EU mittlerweile bereits vor Ort in den<br />
Herkunfts- und Transitländern besser informieren.<br />
Das CIGEM 2 , ein in der Folge des „Gesamtansatzes”<br />
entwickeltes Pilotprojekt der EU in der malischen<br />
Hauptstadt Bamako ist exemplarisch für die Instrumentalisierung<br />
der Entwicklungszusammenarbeit für<br />
die Belange der Migrationskontrolle. Ursprünglich als<br />
Stelle für die Arbeitsvermittlung von malischen<br />
Arbeitsuchenden in die EU konzipiert, wandelte sich<br />
das Hauptanliegen der Einrichtung schnell: Der malischen<br />
Gesellschaft wird dort nun ein neues Problembewusstsein<br />
vermittelt und die bisher positiv konnotierte<br />
Migration als Bedrohung dargestellt. Ausreisewilligen<br />
Personen werden Gefahren und Risiken der<br />
Migration und eines illegalisierten Aufenthalts verdeutlicht.<br />
Die zugrunde liegende Argumentation läuft<br />
darauf hinaus, dass es für den größten Teil der Menschen<br />
besser sei, einfach zu bleiben wo sie sind. Nur<br />
in der EU benötigte Fachkräfte werden willkommen<br />
geheißen. Für die meisten Migrierenden, also Nicht-<br />
Hochqualifizierte oder nicht benötigte Hochqualifizierte,<br />
wirkt die Migrationspolitik der EU jedoch<br />
immer restriktiver.<br />
Rückübernahmeabkommen mit den Herkunftsländern,<br />
welche die Rücknahme von in der EU aufgegriffenen<br />
Staatsbürgern garantieren, werden so zu<br />
einer entwicklungspolitischen Notwendigkeit, helfen<br />
sie doch aus Sicht der EU der Fachkräfteabwanderung<br />
entgegenzuwirken und die Glaubwürdigkeit der<br />
unionseuropäischen Bemühungen zur legalen Migration<br />
zu erhöhen. Und wirklich abstrus wird es, wenn<br />
die Grenzschutzagentur Frontex als Verbündete der<br />
Peripherie im Kampf gegen den brain drain<br />
erscheint.<br />
Die <strong>Grenze</strong> zur EU ist also durchaus nicht undurchlässig.<br />
Die entwicklungspolitisch begründeten Maßnahmen<br />
der EU fördern jedoch einzig die Mobilität<br />
einer Elite und schließen den größten Teil der Migrierenden<br />
aus oder versuchen dies zumindest. Ziel dabei<br />
ist die effektive Steuerung der Migration, welche der<br />
EU in der globalen Konkurrenz um die klügsten<br />
Köpfe eine vorteilhafte Position verschaffen soll, und<br />
nicht eine selbstbestimmte Entwicklung des Südens.
Hopp oder Topp?<br />
Mit dem Web 2.0 stehen viele Grenzziehungen der sogenannten Moderne endgültig zur Disposition,<br />
etwa zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, zwischen Nutzenden und Produzierenden, zwischen<br />
Erwerbsarbeit und anderen Lebensbereichen. Menschen, die viel mit dem Internet arbeiten, setzen sich<br />
zum Teil aktiv mit diesen Prozessen der Entgrenzung auseinander und kommen zu unterschiedlichen<br />
Lösungen. Von Jana Ballenthien und Tanja Carstensen
32<br />
grenze<br />
Im Zuge der Globalisierung und Internationalisierung<br />
von Wirtschafts- und Finanzmärkten sowie<br />
einer Vermarktlichung unternehmensinterner<br />
Beziehungen wird seit den 1990er Jahren in der<br />
Soziologie intensiv das Phänomen der Entgrenzung<br />
diskutiert. In der Erwerbsarbeit lösen sich traditionelle<br />
<strong>Grenze</strong>n und Regelungen auf, es entstehen immer<br />
mehr ungeregelte Arbeitsverhältnisse jenseits von<br />
Tarifverträgen, befristet, als Mini-Jobs oder Ich-AGs.<br />
Vormals klare Arbeitszeiten verschwimmen zunehmend<br />
mit Zeiten außerhalb von Erwerbsarbeit,<br />
bedingt durch gestiegene Anforderungen und Arbeitsverdichtung<br />
auf Unternehmensseite, aber auch eigene<br />
Ansprüche an Selbstverwirklichung im Job. Die räumlichen<br />
Strukturen von Betrieben und Büros lösen sich<br />
auf und werden von Homeoffice, international<br />
kooperierenden Teams und Co-Working-Spaces abgelöst.<br />
Klassische Ausbildungen wie Schulbildung oder<br />
Studium verlieren an Bedeutung. Wichtiger werden<br />
Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations- und<br />
Medienkompetenz. Auch nationalstaatliche <strong>Grenze</strong>n<br />
verlieren teilweise an Bedeutung. Entgrenzung wird<br />
für den Bereich der Erwerbsarbeit als ambivalenter<br />
Prozess diskutiert, der mehr Anforderungen an Selbstorganisation<br />
und Strukturierungsleistungen des Subjekts<br />
stellt und dabei Chancen größerer Autonomie<br />
innerhalb der Arbeitsverhältnisse bietet, aber auch<br />
Gefahren erhöhter Belastung und die Tendenz zur<br />
Selbstausbeutung birgt.<br />
Nicht zuletzt die technologischen Veränderungen der<br />
letzten Jahre haben diese zeitliche, räumliche, rechtliche<br />
und organisatorische Entgrenzung mit bedingt.<br />
Die digitalen Medien wie Smartphones, Tabletts, Social<br />
Networks wie Facebook oder Xing, Kurzmessages-<br />
Dienste wie Twitter und viele andere „Mitmachmöglichkeiten“<br />
des Web 2.0 (Youtube, Flickr, Foursquare…)<br />
begünstigen Entgrenzungen – welche ihre Nutzerinnen<br />
und Nutzer zudem mit Handlungsaufforde-<br />
rungen zu aktiver Partizipation konfrontieren.<br />
In unserer von der Volkswagen-Stiftung finanzierten<br />
Untersuchung „Subjektkonstruktionen und digitale<br />
Kultur“ führten wir 30 Interviews mit Menschen zwischen<br />
22 und 30 Jahren, die in den Berufsfeldern<br />
Onlinejournalismus, Webdesign, Programmierung,<br />
Online Development, Social Media Beratung und<br />
andere arbeiten. In der Befragung wird deutlich, dass<br />
die Auseinandersetzung mit <strong>Grenze</strong>n bzw. Entgrenzung<br />
eine wichtige Herausforderung im Alltag darstellt.<br />
Vier Themenkomplexe stehen dabei im Mittelpunkt:<br />
Die Entgrenzung von Erwerbsarbeit und Freizeit,<br />
die Veränderungen im Verhältnis Privatsphäre<br />
und Öffentlichkeit, der permanente technische Wandel<br />
und die Herausforderungen des Lernens zwischen<br />
„alten“ Lerninstitutionen und einem autonomeren und<br />
autodidaktischeren Lernen.<br />
Erwerbsarbeit und Freizeit<br />
Viele unserer Interviewten beschreiben, dass Erwerbsarbeit<br />
und andere Lebensbereiche nicht mehr klar<br />
voneinander zu trennen sind. Es ist den Menschen<br />
selbst überlassen, die Fähigkeit zu entwickeln, eine<br />
<strong>Grenze</strong> zwischen beiden Bereichen zu ziehen, die sie<br />
als Subjekt nicht gefährdet. Der Bereich des Webwork<br />
scheint dabei besonders entgrenzt und oftmals auch<br />
prekär. Unabhängig ob in Festanstellung oder in Selbständigkeit<br />
– Menschen, die sich in klaren Strukturen,<br />
ohne Überstunden und mit finanzieller Sicherheit<br />
befinden, sind rare Exemplare in der internetbasierten<br />
Arbeitswelt. Gleichzeitig zeigt unser Sample: Strukturelle<br />
Entgrenzung an sich gibt noch keinen Aufschluss<br />
darüber, ob sie von den Menschen negativ<br />
wahrgenommen wird. Die Menschen, mit denen wir<br />
Interviews führten, haben hohe Ansprüche an Selbstverwirklichung<br />
im Beruf. Vielen ist sie so wichtig,<br />
dass sie dafür zum Teil den Habitus einer selbstverständlichen<br />
Aufopferung an den Tag legen. Hier spaltet<br />
sich unser Sample in diejenigen, die innerhalb dieser<br />
Aufopferung selbstbewusst <strong>Grenze</strong>n ziehen können<br />
– <strong>Grenze</strong>n in der Organisation ihrer Social Networks<br />
in z.B. Freundinnen/Freunden und Kolleginnen/Kollegen,<br />
<strong>Grenze</strong>n bezüglich ihrer Arbeitszeit<br />
und <strong>Grenze</strong>n, wann sie für wen erreichbar sind –<br />
und denjenigen, die sich davon schlucken lassen. Die<br />
Belastung kann kaum höher sein in einem internationalen<br />
Startup-Unternehmen, in dem verschiedene<br />
Zeitzonen zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten<br />
bedient werden müssen, und auch bei der zeitlich<br />
selbständig und unabhängig organisierten Social<br />
Media Beratung sind Höhepunkte der Entgrenzung<br />
erreicht. Glücklich sind diejenigen, die die Erwerbsar-
eit als verlängerten Bereich ihres Hobbys begreifen:<br />
„Enjoy what you do and you’ll never work one day<br />
in your life” – dieser Satz kann natürlich nur auf die<br />
Menschen zutreffen, die für ihre Arbeit auch entlohnt<br />
werden.<br />
Der Bereich des Webwork bietet viele Chancen, aber<br />
bleibt für manche auch ein prekärer Seiltanz zwi-<br />
schen Selbstverwirklichung und<br />
finanzieller Notlage. Respekt<br />
wird von der Netzgemeinde<br />
oder von den Institutionen<br />
gewährt, die von der (auch<br />
ehrenamtlichen) Arbeit profitieren.<br />
Wenn die Chance ausbleibt,<br />
diesen Respekt zu monetarisieren,<br />
geben die Menschen früher<br />
oder später auf. Wie viel möchte<br />
ich investieren, an Zeit und<br />
Kreativität und wie viel brauche ich, um mich zu<br />
erholen und ein „Privatleben“ zu führen? Fast alle<br />
Bereiche der Webwork sind von einer ständigen<br />
Eigenmobilisierung und Ausdauer, von kontinuierlicher<br />
Kreativität, Qualität und Selbstvermarktung<br />
abhängig und von einer Spur Glück oder Zufall, dass<br />
Menschen gewillt sind, diese Arbeit finanziell zu würdigen.<br />
Das wissen auch die, die aktuell überdurchschnittlich<br />
gut finanziert sind. So formuliert ein<br />
„Großverdiener“ unseres Samples, dass er zwar sein<br />
momentanes Leben sehr genieße, seinen Job aber<br />
nicht als zukunftsträchtig einschätze, und er sich nach<br />
einer soliden Festanstellung in einem etablierten<br />
Unternehmen sehne, statt seine lukrative, aus der<br />
Freizeit entstandene webbasierte Selbständigkeit<br />
ernsthaft weiterzuverfolgen. Das traditionelle Normalarbeitsverhältnis<br />
taucht hier und da am Horizont der<br />
Wünsche unserer Befragten auf, wenn wir sie nach<br />
ihrer Zukunft fragen. Auch wenn es nur ein kleiner<br />
Job neben der Selbständigkeit wäre, so brächte er<br />
doch ein gesichertes monatliches Festeinkommen ein,<br />
und mensch könnte die Verantwortung der Selbstorganisation<br />
und -vermarktung wieder auf die Arbeitgeber<br />
verlagern. Die Vor- und Nachteile von Autonomie<br />
und Hierarchie werden hier neu gemischt.<br />
Öffentlichkeit und Privatsphäre<br />
Zur Selbstorganisation und -vermarktung gehört auch<br />
eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Privatsphäre<br />
und Öffentlichkeit. Das Sich-Äußern in<br />
Weblogs, Wikis, E-Learning-Tools, Themenforen, vor<br />
allem aber über Social Networks ist Ausdruck einer<br />
neuartigen Bekenntniskultur sowie einer neuen<br />
Selbstverständlichkeit, über sich selbst Auskunft zu<br />
Es existiert ein Selbstvermarktungs-<br />
und Selbstpräsentationsdruck,<br />
der besagt, wer nicht online<br />
präsent ist, würde beruflich und<br />
sozial abgehängt, wer nicht mitredet,<br />
hätte nichts zu sagen.<br />
geben und sich selbst als Objekt der Betrachtung in<br />
Szene zu setzen. Die Funktionen sind vielfältig. Es<br />
werden große Netzwerke gebildet, die berufliche<br />
Kontakte und private Freundschaften umfassen. Diese<br />
nutzen der Karriereplanung, spenden Trost in schweren<br />
Zeiten oder dienen einfach der routinierten<br />
Nebenbei-Kommunikation und dem Sich-gegenseitigauf-dem-Laufenden-Halten.<br />
Interessant sind aber hier-<br />
bei nicht die Funktionen an sich,<br />
sondern die Aushandlungsprozesse,<br />
wie weit die berufliche<br />
und/oder private Selbstpräsentation<br />
im Internet gehen kann,<br />
und unter welchem Ausschluss<br />
oder Miteinbezug der Öffentlichkeit<br />
sie stattfindet. Für diese<br />
Auseinandersetzung spielen wie<br />
bei keinem anderen Thema die<br />
öffentlichen Diskurse für die<br />
persönliche Positionierung eine entscheidende Rolle.<br />
Printmedien und Politik übernehmen gern den pessimistischen<br />
Teil und problematisieren, dass Personalchefs<br />
ihre Bewerberinnen und Bewerber googeln<br />
oder bei Facebook ausspionieren. Vertreterinnen und<br />
Vertreter wie Karsten Gerloff von netzpolitik.org thematisieren<br />
innerhalb der Datenschutzdiskurse die<br />
Gefahr der Reduktion der Subjekte auf das marktwirtschaftliche<br />
Produkt oder das Kapital großer Internetkonzerne<br />
und der Jugendschutz streut Bedenken<br />
über jugendliche Freizügigkeit im Netz. Diesen wirkungsmächtigen<br />
pessimistischen Diskursen steht ein<br />
Selbstvermarktungs- und Selbstpräsentationsdruck<br />
gegenüber, der besagt, wer nicht online präsent ist,<br />
würde beruflich und sozial abgehängt, wer nicht mitredet,<br />
hätte nichts zu sagen.<br />
Wie zwischen diesen widersprüchlichen Diskursen zu<br />
agieren ist, liegt nicht gerade auf der Hand. In unserer<br />
Studie äußern fast alle: ja, der gegenwärtige oder<br />
zukünftige Chef könnte mitlesen. Der Umgang mit<br />
diesem Bewusstsein ist aber sehr unterschiedlich. Die<br />
einen schränken ihr Informationsmanagement weit<br />
ein, die anderen stehen selbstbewusst zu ihrem Privatleben<br />
und vertreten die Meinung, dass es einfach<br />
nicht der richtige Chef für sie sei, wenn dieser sich<br />
über ihr Partyleben mokieren würde. Ganz diesem<br />
Umgang entsprechend sind die einen in allen Social<br />
Networks vertreten und die anderen eher schüchtern.<br />
Die Schüchternen stehen oft hinter ihren eigenen<br />
Ansprüchen zurück, möchten kommunizieren, aber<br />
gleichzeitig nicht für immer auf das festgenagelt werden,<br />
was sie einst in einem Webblog posteten. Die<br />
Mutigen und Selbstbewussten entwickeln differenziertere<br />
und sehr genau überlegte Strategien. Beispiels-<br />
grenze
34<br />
grenze<br />
weise werden die Einstellungen der Social Networks<br />
zum Sortieren des Netzwerks in Freundschaften,<br />
Bekannte, Kollegium genutzt. Damit kann sehr viel<br />
spezifischer bestimmt werden, wem welche Informationen<br />
zuteil werden. Mit Hilfe solcher Optionen ist<br />
dann auch das Problem gelöst, wie mensch der Kollegin<br />
erklärt, dass sie sie zwar bei Xing adde, nicht<br />
jedoch bei Facebook. Eine passivere Variante, eine<br />
<strong>Grenze</strong> zu ziehen ist es, wenn das jeweils andere<br />
Elternteil über das Veröffentlichen von Kinderfotos<br />
mitbestimmt, oder die Entscheidung getroffen wird,<br />
nur in dem Social Network die Partyfotos zu posten,<br />
in dem Eltern oder Chef nicht mitlesen. Die Menschen<br />
unseres Samples, die sich eine gewisse gesellschaftliche<br />
Prominenz erarbeitet haben, posten gerne<br />
pseudo-private Informationen zur Selbstvermarktung<br />
(aufregende Freizeiterlebnisse) und richten für die<br />
intimen Informationen Fake- oder Zweitaccounts ein,<br />
die tatsächlich nur von den engsten Freundinnen und<br />
Freunden mitgelesen werden können. Dabei ist nicht<br />
zu negieren, dass eine gut inszenierte Selbstvermarktung<br />
auch völlig Unprominenten zeitweilig oder raketenhaft<br />
zu einer Szeneprominenz verhelfen kann. Und<br />
schließlich gibt es die Vertreterinnen und Vertreter<br />
von Postprivacy-Positionen, die ihr Privatleben völlig<br />
öffentlich darlegen und die emanzipatorischen Chancen<br />
im „Ende der Privatsphäre“ zu erkennen glauben.<br />
<strong>Grenze</strong>nloser technischer Wandel?<br />
Zusätzlich verschärft werden die Anforderungen an<br />
die Subjekte durch die steigende Zahl an Social Net-<br />
works, vielfältige Organisations-,<br />
Präsentations- und Rezeptionstools<br />
und Unmengen an Apps<br />
und Spielereien. Der Ansprache<br />
an die Subjekte, diese zu nutzen,<br />
wird auch hier unterschiedlich<br />
entsprochen: Speziell in unserem<br />
Sample finden sich Subjekte, die<br />
die rasante Entwicklung genießen,<br />
sich in jedem Netzwerk anmelden und immer<br />
die neuesten Geräte nutzen. Sie sind immer noch fasziniert<br />
von jeder neuen technischen Möglichkeit, setzten<br />
sich spielerisch mit allen Feinheiten und Untermenüs<br />
auseinander und bewegen sich in Communities,<br />
die ihnen einen Austausch, manchmal auch einen<br />
spielerischen „Battle“ über ihre technisch gestützte<br />
Selbstperformance ermöglichen. Ein paar von ihnen<br />
sind so technikaffin, dass sie sehnsüchtig auf Möglichkeiten<br />
warten, die in ihren Köpfen schon lange<br />
existieren, bevor sie auf den Markt kommen, und die<br />
den technischen Wandel mit politischen Anliegen<br />
selbst mitgestalten. Doch es gibt auch die, die ange-<br />
Der rasante informationstechnische<br />
Wandel passt nicht zu<br />
unflexiblen Lehrplänen und<br />
starren Wahlpflichtmöglichkeiten.<br />
strengt und überfordert sind vom informationstechnischen<br />
Wandel. Sie fragen, warum sie sich denn nun<br />
auch noch bei Twitter anmelden müssen, wo es doch<br />
schon Facebook und Myspace gibt oder ob sie denn<br />
nun wirklich ein Smartphone brauchen. Die meisten<br />
tun es dann doch. Denn die wenigsten können sich<br />
diesen sich aufdrängenden Entwicklungen widersetzen.<br />
Gerade in ihrem Feld der Internetarbeit sind sie<br />
darauf angewiesen, mit ihren netzaffinen Kundinnen/Kunden,<br />
Kolleginnen/Kollegen und weiteren<br />
Netzwerken online zu interagieren und dabei die<br />
neuesten Entwicklungen mitzumachen. Zudem brauchen<br />
sie ihre Technik- und Medienkompetenz zur<br />
Imagepflege und Distinktion, es gehört zur permanenten<br />
Anforderung an ihre Qualifikation. Auch das<br />
schlechte Gewissen spielt eine Rolle. Über den x-ten<br />
Kanal nicht erreichbar zu sein ist ein „No-Go“ im<br />
Wettbewerb. So erwachsen hier neben Chancen auch<br />
große Problematiken.<br />
Lernen in Institutionen oder autodidaktisch<br />
Den Habitus, im technischen Wandel mitzuhalten,<br />
neugierig und fasziniert oder dem technischen Wandel<br />
sogar schon voraus zu sein, bringen viele der<br />
Interviewten schon aus ihrer Bildungssozialisation<br />
mit. Alle bis auf einen haben Abitur, und fast alle<br />
haben zumindest schon mal an der Universität<br />
geschnuppert. Gleichzeitig ist unser Sample voll von<br />
Schul- und Studiumsabbrüchen. An den herkömmlichen<br />
Bildungsinstitutionen zu scheitern bringt für<br />
unsere Interviewten allerdings kaum Probleme mit<br />
sich. Innerhalb der Berufsfelder<br />
sind schließlich Fähigkeiten und<br />
Praktiken nötig, die herkömmliche<br />
Bildungsinstitutionen kaum<br />
bieten. Wie auch? Der rasante<br />
informationstechnische Wandel<br />
gepaart mit seinen vielen Marktlücken<br />
und neuen Berufsfeldern<br />
passt nicht zu unflexiblen Lehrplänen<br />
und starren Wahlpflichtmöglichkeiten. Die Art<br />
und Weise der Wissensvermittlung hat sich bei unseren<br />
Befragten deutlich verschoben: Die Aneignung<br />
von Wissen erfolgt unhierarchisch, auf verschiedenen<br />
Kanälen zeitlich flexibler, in fluiden Personenkonstellationen<br />
und insgesamt sehr autodidaktisch (online in<br />
Foren, beim Chatten und in Wikis, durch Bücher,<br />
„learning by doing“ etc.). Im Durchschnitt verwehren<br />
sich die Menschen unseres Samples biographisch viel<br />
früher als andere gesellschaftliche Gruppen den Themen,<br />
die ihnen nicht liegen und suchen sich andere<br />
Wege für ihre Interessen. Ihre Art zu lernen, könnte<br />
als Mahnung für die herkömmlichen Bildungsinstitu
tionen dienen, über weitreichende Reformen nachzudenken.<br />
Andere <strong>Grenze</strong>n?<br />
Interessanterweise werden an verschiedenen Stellen<br />
in unseren Interviews auch nationalstaatliche <strong>Grenze</strong>n<br />
debattiert. In unserem fast ausschließlich weißen, gut<br />
ausgebildeten Sample, das sich zu großen Teilen aus<br />
einer oberen Mittelschicht zusammensetzt, ist die<br />
Qualifikation eines Auslandsaufenthaltes für den<br />
Lebenslauf ein biographischer Meilenstein. Meist war<br />
ein Austauschjahr der Anlass, die Beschäftigung mit<br />
dem Internet zu intensivieren. Nur vereinzelt hingegen<br />
berichten unsere Interviewten von grenzüberschreitenden<br />
Solidaritätsaktionen etwa für Freunde<br />
aus der Netzgemeinschaft, die in Bürgerkriegsländern<br />
lebten, bei denen Hilfe über das Netz organisiert<br />
wurde. Doch deutet sich hier zumindest an, dass das<br />
Internet mit seiner <strong>Grenze</strong>nlosigkeit auch dazu dienen<br />
kann, widerständige Praktiken gegenüber nationalstaatlichen<br />
<strong>Grenze</strong>n zu entwickeln.<br />
Und nun?<br />
Es ist deutlich sichtbar, dass gegenwärtig eine Reihe<br />
von <strong>Grenze</strong>n neu verhandelt werden. Innerhalb der<br />
beschriebenen Prozesse der Entgrenzung fehlen (bisher)<br />
neue gesellschaftliche Routinen oder gültige Vorgaben.<br />
Unsere Befragten füllen diese Lücke mit den<br />
unterschiedlichsten Umgangsweisen. Sie handeln zwischen<br />
Selbstvermarktungsdruck, Zeitgeist, inmitten<br />
widersprüchlicher Diskurse, sie sind damit überfordert,<br />
sie sind davon genervt, oder sie schöpfen daraus<br />
Kraft und genießen es. Die Entgrenzung fordert<br />
von den Subjekten eigenverantwortliche Lösungen<br />
und Umgangsweisen. Sie nehmen diese Herausforderung<br />
kreativ an, setzen sich aktiv auseinander und<br />
ziehen für sich neue <strong>Grenze</strong>n. Dies eröffnet einen<br />
Raum für diverse neue Grenzziehungspraktiken,<br />
Handlungsstrategien und Überlegungen. Es ist gleichzeitig<br />
aber auch eine weitere, möglicherweise belastende<br />
Anforderung und Verantwortung, die die Menschen,<br />
auf sich selbst gestellt, erledigen müssen.<<br />
grenze<br />
Jana Ballenthien ist<br />
wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin an der<br />
TU Hamburg-Harburg<br />
und arbeitet im<br />
Projekt „Subjektkonstruktionen<br />
und<br />
digitale Kultur“.<br />
Tanja Carstensen<br />
arbeitet an der TU<br />
Hamburg-Harburg<br />
und leitet dort das<br />
Hamburger Teilprojekt<br />
„Webbasierte<br />
Erwerbsarbeit“ im<br />
Verbundprojekt<br />
„Subjektkonstruktionen<br />
und digitale<br />
Kultur“.
Jede Zelle<br />
meines Körpers<br />
ist glücklich<br />
Jede Zelle<br />
an jeder Stelle<br />
Jede Zelle<br />
ist voll gut<br />
drauf
Mauerpark Germany<br />
Einige Bundesländer haben die Residenzpflicht für Flüchtlinge gelockert. Das Reiseverbot, das seinen<br />
Vorläufer in der „Ausländerpolizeiverordnung“ der Nationalsozialisten hat, verweigert Flüchtlingen elementare<br />
Rechte. Die Abschaffung der entsprechenden Bundesgesetze steht immer noch aus.<br />
Von Anke Schwarzer<br />
deutschen Gesetze haben ,minderwertige’<br />
Menschen entstehen lassen“,<br />
„Die<br />
sagt Christopher Nsoh von der Flüchtlingsinitiative<br />
Brandenburg. Und Yufanyi Mbolo von<br />
der Flüchtlingsorganisation The Voice meint: „Die<br />
Gesetze machen uns Flüchtlinge schwach und so<br />
sehen uns auch die Deutschen. Diese Gesetze sind<br />
der Nährboden für die rechte Gewalt.“<br />
„Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen<br />
Bundesgebiet“, heißt es in Artikel 11 des Grundgesetzes.<br />
Gemeint sind die Rechte auf die freie Wahl des<br />
Wohnortes und die freie Bewegung innerhalb<br />
Deutschlands. Dieser Artikel kommt in Zeiten offener<br />
<strong>Grenze</strong>n innerhalb der Europäischen Union und<br />
angesichts von Millionen von Eingewanderten altbakken<br />
daher. Wer dachte, dass es sich bei der Bewegungsfreiheit<br />
um ein garantiertes Menschenrecht handelt,<br />
wird – zumindest in Deutschland – eines anderen<br />
belehrt: Mit Freundinnen in der Großstadt flanieren,<br />
an einem Schulausflug nach Berlin teilnehmen,<br />
den Vater der Kinder im benachbarten Bundesland<br />
besuchen – all das sind „nur“ Bürgerrechte und lediglich<br />
Menschen mit deutschem Pass und bestimmten<br />
Ausländergruppen vorbehalten.<br />
Genehmigungspflichtiger Sex<br />
Insbesondere für Asylsuchende und Menschen mit<br />
einer Duldung gilt auch heute noch: Ein freies Reisen<br />
innerhalb Deutschlands ist verboten. 1 Wenn Asylsuchende<br />
den Bezirk der für sie zuständigen Ausländerbehörde<br />
verlassen möchten, und sei es auch nur für<br />
wenige Stunden, haben sie ein Problem. Wie Kinder<br />
müssen sie um Erlaubnis fragen. Ein Sachbearbeiter<br />
der Ausländerbehörde entscheidet darüber, ob und<br />
für welchen Zeitraum ein „Urlaubsschein“ ausgestellt<br />
wird. „Bei Ihrem Vortrag Ihre Frau zu treffen um mit<br />
ihr Sex zu haben, [dabei] handelt es sich nicht um<br />
einen Grund, der den (...) Voraussetzungen entspricht“,<br />
urteilte der niedersächsische Landkreis Northeim<br />
im Falle des Metallarbeiters Ghassan El-Zuhairys.<br />
Der geduldete Flüchtling sei, so schrieb die Süd-<br />
deutsche Zeitung, im Oktober letzten Jahres trotzdem<br />
nach Dessau gefahren, wo seine Frau aufgrund der<br />
Verteilungsquote lebe. Zwar habe sie ein Bleiberecht,<br />
dennoch könne sie wegen laufender „Integrationsmaßnahmen“<br />
den Ort in Sachsen-Anhalt nicht ohne<br />
weiteres wechseln.<br />
Gebietserweiterungsbescheinigung, Urlaubschein,<br />
Verlassenserlaubnis<br />
Solche Anträge müssen rechtzeitig gestellt und vor<br />
allem gut begründet werden. Sehnsucht allein hätte<br />
jedenfalls in Northeim nicht ausgereicht. Aber auch<br />
die Teilnahme an Gottesdiensten, Demonstrationen,<br />
Familienfeiern, Kongressen und Sportwettkämpfen<br />
wurde in den ungezählten Ablehnungsbescheiden<br />
versagt. Warum fahren Sie so oft zum Anwalt? Wen<br />
wollen Sie besuchen? Wie lautet die Adresse der Person?<br />
Um was für eine Demonstration handelt es sich?<br />
Wie haben Sie die Bekannte kennengelernt? Fragen<br />
über Fragen, die bis in den Intimbereich der Flüchtlinge<br />
gehen. Fragen, die demütigen und entrechten.<br />
In Beate Selders’ 2009 unter dem Titel Keine Bewegung!<br />
erschienener Studie zur Residenzpflicht erläutert<br />
der Leiter der Ausländerbehörde im baden-württembergischen<br />
Pforzheim die Vorgehensweise: „Wenn<br />
wir nicht den Eindruck haben, jemand reist in der<br />
Weltgeschichte herum, um zum Beispiel Drogen zu<br />
verkaufen, sind wir großzügiger. Wir lassen das dann<br />
schon mal zu, dass jemand den Landkreis verlässt,<br />
um Verwandtschaft oder einen Freund zu besuchen.<br />
Das Gesetz verlangt einen ganz besonderen Grund,<br />
aber den hat man ja normalerweise nicht. Nur jemanden<br />
besuchen zu wollen, das wäre kein besonderer<br />
Grund. Das Gesetz ist ja ganz streng.“<br />
Ausgeliefert sein, sich ohnmächtig, willkürlich behandelt<br />
und schikaniert fühlen – viele Flüchtlinge ersparen<br />
sich das bittere Prozedere, reisen ohne Erlaubnis<br />
und riskieren damit Strafen mit weitreichenden Folgen.<br />
Da sie im Wiederholungsfall als vorbestraft gelten,<br />
haben sie später Probleme etwa bei der Arbeits-<br />
grenze<br />
1 Für Asylsuchende:<br />
§§ 56 bis 58, 85 und<br />
86 Asylverfahrensgesetz.<br />
Es untersagt<br />
ihnen, ohne Erlaubnis<br />
das Gebiet der<br />
für sie zuständigen<br />
Ausländerbehörde<br />
zu verlassen. Für<br />
Menschen mit Duldung:<br />
§§ 12 und 61<br />
Aufenthaltsgesetz.<br />
Der Bewegungsbereich<br />
ist darin auf<br />
das Bundesland<br />
begrenzt, in dem die<br />
Geduldeten gemeldet<br />
sind. Allerdings<br />
beschneiden einige<br />
Bundesländer wie<br />
Sachsen und einzelneAusländerbehörden<br />
den Bewegungsraum<br />
noch enger.
38<br />
grenze<br />
2 „Ilm-Kreis erhebt<br />
für eine Verlassenserlaubnis<br />
für private<br />
Besuche eine<br />
Gebühr in Höhe von<br />
zehn Euro, Landkreis<br />
Weimarer<br />
Land erhebt eine<br />
Gebühr von 2 Euro<br />
und 50 Cent, wenn<br />
es einer Sachprüfung<br />
im Zuge einer<br />
Ermessensentscheidung<br />
bedarf. Landkreis<br />
Sonneberg<br />
erhebt bei erwerbstätigen<br />
Personen für<br />
eine Verlassenserlaubnis<br />
eine Gebühr<br />
in Höhe von zehn<br />
Euro. Bei Antragstellern,<br />
die Sozialleistungen<br />
empfangen,<br />
wird von der Gebührenerhebungabgesehen.<br />
Bei nur geringfügig<br />
beschäftigten<br />
Personen, die ergänzendeSozialleistungen<br />
erhalten, wird<br />
eine ermäßigte<br />
Gebühr von fünf<br />
Euro erhoben“, teilte<br />
das Innenministerium<br />
Thüringen im<br />
Oktober mit. Ob es<br />
für derartige Gebühren<br />
überhaupt eine<br />
Rechtsgrundlage<br />
gibt, ist umstritten.<br />
3 Insbesondere bei<br />
Asylsuchenden überprüft<br />
die Polizei die<br />
Herkunft des Geldes,<br />
das den kargen<br />
Betrag, den Flüchtlinge<br />
im Monat<br />
erhalten, übersteigt<br />
und beschlagnahmt<br />
es bei unklarer Herkunft.<br />
suche oder der Bleiberechtsregelung. In manchen Fällen<br />
müssten Flüchtlinge kuriose und teure Wege<br />
gehen, um eine „Verlassenserlaubnis“ überhaupt nur<br />
zu beantragen. Selders schildert<br />
in ihrer Studie ein Beispiel aus<br />
Hessen, in dem ein Flüchtling<br />
Probleme mit der Residenzpflicht<br />
bekam, weil er orthopädische<br />
Schuhe benötigte: „Das<br />
nächste Sanitätshaus war eine<br />
Bahnstation entfernt, was ihn<br />
freute, schließlich musste er ja<br />
mehrmals zur Anprobe. Untergebracht war er in Neustadt,<br />
das liegt im Regierungsbezirk Gießen. Das<br />
Sanitätshaus war im Nachbarlandkreis und im Regierungsbezirk<br />
Kassel. Um die eine Station zum orthopädischen<br />
Schuhmacher zu fahren, ohne sich strafbar zu<br />
machen, hätte der Mensch mit den kranken Füßen<br />
zunächst auf eigene Kosten 70 Kilometer nach Marburg<br />
zur Ausländerbehörde fahren müssen, um eine<br />
Verlassenserlaubnis zu beantragen.“ Nicht nur die<br />
Fahrt zur Behörde ist mit Kosten verbunden. In manchen<br />
Bundesländern, etwa Bayern und Baden-Württemberg,<br />
müssen Flüchtlinge für die Erlaubnis bezahlen.<br />
Besonders ausgereifte Gebührenlisten hat das<br />
Bundesland Thüringen erstellt. 2 Immerhin: „Die Versagung<br />
von Verlassenserlaubnissen ergeht gebührenfrei“,<br />
teilte das Innenministerium in Erfurt im Oktober<br />
auf Nachfrage mit.<br />
Racial Profiling und emsige Behördenangestellte<br />
Teurer wird es, wenn die Polizei Flüchtlinge ohne<br />
Genehmigung außerhalb der erlaubten <strong>Grenze</strong>n kontrolliert.<br />
Auf Raststätten und Demonstrationen, in<br />
Bahnhöfen und Zügen picken die Polizeikräfte –<br />
auch sie dies stets dementieren – People of Colour,<br />
„ausländisch aussehende“ Menschen heraus, um zu<br />
kontrollieren: Pass, Aufenthaltspapiere, Taschen,<br />
Geld 3 , Kofferraum. Wenn das Glück mit auf dem Weg<br />
war und es keine Polizeikontrolle gab, sorgt<br />
besonders emsiges Behördenpersonal für Ungemach:<br />
Ein Flüchtling aus Sachsen-Anhalt etwa wollte zu seiner<br />
eigenen Hochzeit nach Berlin fahren. Statt die<br />
Reise zu bewilligen, bohrte der Beamte nach und<br />
unterstellte, dass er seine zukünftige Frau nur durch<br />
heimliche Reisen kennengelernt haben könnte. Yufanyi<br />
Mbolo musste vor Gericht, weil sein Sachbearbeiter<br />
in einem Zeitungsartikel gelesen hatte, dass der<br />
Student aus Kamerun an einem Kongress teilgenommen<br />
hatte, deren Teilnahme er zuvor persönlich<br />
untersagt hatte.<br />
In manchen Bundesländern, etwa<br />
Bayern und Baden-Württemberg,<br />
müssen Flüchtlinge für die<br />
„Verlassenserlaubnis“ bezahlen.<br />
Das Gesetz sieht Geldbußen bis zu 2500 Euro vor, im<br />
Wiederholungsfall auch eine Freiheitsstrafe von bis zu<br />
einem Jahr. Und warum? Die Bundesregierung ant-<br />
wortete im Sommer letzen Jahres<br />
auf eine Kleine Anfrage der<br />
„Linken“: Residenzpflicht diene<br />
dazu, das Asylverfahren<br />
schnellstmöglich durchzuführen<br />
und die Antragstellenden jederzeit<br />
an einem bestimmten Ort<br />
erreichen zu können. Außerdem<br />
könnten damit „unzuträgliche<br />
Ballungen von Asylbewerbern“ vermieden werden. Es<br />
geht also um Kontrolle, Macht, Abschreckung und<br />
Generalprävention, wobei bei letzterem – der Rassismus<br />
lässt grüßen – per se ein kriminelles Vorgehen<br />
von Flüchtlingen unterstellt wird. Nach Ansicht der<br />
Ausländerbehörde des Landratsamts Wartburgkreis<br />
beeinträchtigen unerlaubte Reisen gar „die öffentliche<br />
Sicherheit und Ordnung maßgeblich“ und „verletzen<br />
die Interessen der Bundesrepublik erheblich“. So<br />
stand es im Ausweisungsbescheid, den sie 1999 dem<br />
Asylbewerber Jose Maria Jones wegen mehrmaligen,<br />
„vorsätzlichen“ Verstoßes gegen die Residenzpflicht<br />
zustellte. Die Behörde schrieb auch: „Gerade im<br />
Bereich der Verstöße gegen die räumliche Beschränkung<br />
des Bereichs der Aufenthaltsgestattung ist bei<br />
Asylbewerbern zunehmend und in umfangreichen<br />
Maße eine Anhäufung derartiger Straftaten im<br />
Bundesgebiet festzustellen, so dass hier eine Ahndung<br />
mit allen Mitteln durch die Behörde geboten ist,<br />
um andere Ausländer von einem ähnlichen Fehlverhalten<br />
abzuhalten.“<br />
Rund 140.000 Menschen stehen<br />
unter Gebietsarrest<br />
Zahlen, wie viele Flüchtlinge Anzeigen oder Strafen<br />
wegen Verstoßes gegen die Residenzpflicht erhalten,<br />
sind nur schwer zu ermitteln, da sie nicht gesondert<br />
in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) auftauchen.<br />
2008 wurden nach dieser Statistik fast 10.000<br />
Menschen, in den Jahren zuvor noch weit mehr,<br />
wegen Verstößen gegen das Aufenthalts- und das<br />
Asylverfahrensgesetz verurteilt. 2009 saßen deswegen<br />
229 Menschen im Gefängnis. Selders nimmt in ihrer<br />
Studie an, dass es sich 2007 und in den Jahren davor<br />
bei fast einem Viertel aller ausländerrechtlichen<br />
Deliktgruppen um Verstöße gegen die Residenzpflicht<br />
gehandelt hat. Da die meisten Flüchtlinge von den<br />
Kontrollen ein Lied singen können, kann man davon<br />
ausgehen, dass auch die meisten, die sich in Bewegung<br />
setzen, mit Verwarnungen, Bußgeldern oder<br />
Strafanzeigen zu tun haben, die nicht in der PKS auf
tauchen. Ende 2010 zählte das Ausländerzentralregister<br />
87.244 Geduldete, von denen die Hälfte länger<br />
als acht Jahre mit diesem prekären Status lebte und<br />
50.078 Asylsuchende mit Gestattung, die meisten von<br />
ihnen aus Afghanistan, Serbien, dem Irak und dem<br />
Iran.<br />
NS-„Ausländerpolizeiverordnung” und südafrikanische<br />
Passgesetze<br />
Die sozialliberale Koalition hatte die Residenzpflicht<br />
im Juli 1982 als Teil des Asylverfahrengesetzes eingeführt.<br />
Hintergrund war die steigende Zahl an Asylanträgen.<br />
Mit Ausnahme der Zeit des Prager Frühlings<br />
Ende der 1960er Jahre pendelte die Zahl der Anträge<br />
um die 5000. Spätestens mit dem Militärputsch in der<br />
Türkei 1980 begann die Zahl der Anträge auf über<br />
100.000 zu steigen. Das neue Gesetz bescherte den<br />
Flüchtlingen neben der Residenzpflicht die Lagerunterbringung,<br />
Essenspakete, Gutscheine statt Bargeld,<br />
die gesetzliche Regelung des Verteilungsverfahrens<br />
auf die Bundesländer sowie das Arbeitsverbot.<br />
Erinnert sei noch daran, dass die „räumliche<br />
Beschränkung des Aufenthalts“ ihren Vorläufer in der<br />
„Ausländerpolizeiverordnung“<br />
von 1938 hat. Diese galt faktisch<br />
bis 1965, als das Ausländerrecht,<br />
das heutige Aufenthaltsgesetz, in<br />
Kraft trat. Sowohl der Wortlaut<br />
als auch das Strafmaß in jener<br />
Verordnung der Nationalsozialisten<br />
waren fast identisch mit<br />
dem im Asylverfahrensgesetz<br />
von 1982. Der Europäischen Union gelang es 2004<br />
nicht, die Bewegungsfreiheit in den Mindestnormen<br />
für die Anerkennung von Flüchtlingen festzuschreiben<br />
– der Druck aus Deutschland, damals unter dem<br />
Innenminister Otto Schily (SPD), war zu groß. „Die<br />
Residenzpflicht – wie andere Sondergesetze auch –<br />
ordnet sich ein in die bundesdeutschen Etappen der<br />
gesetzlichen Entrechtung von Flüchtlingen und damit<br />
zu den gesellschaftlichen Produktionsbedingungen<br />
von Rassismus und Gewalt, die bis heute, bundesverfassungsgerichtlich<br />
als grundrechtkonform abgesegnet,<br />
fortdauern“, sagt Dirk Vogelskamp vom Komitee<br />
für Grundrechte und Demokratie. Mark Terkessidis<br />
weist darauf hin, dass die meisten europäischen Länder<br />
eine solche Sondergesetzgebung nicht haben. „Sie<br />
verhindert per se Integration“, so der Migrationsforscher.<br />
Genau die ist aber auch gar nicht gewollt: Die forcierte<br />
Entrechtung und gesellschaftliche Isolation von<br />
Flüchtlingen war 1982 beabsichtigt, die abschreckende<br />
Wirkung auf Flüchtlinge wurde in vielen Begründungen<br />
angeführt. Bis zum heutigen Tag können<br />
übrigens alle Eingewanderten, die einen geringeren<br />
Status als eine unbefristete Niederlassungserlaubnis<br />
haben, laut Gesetz in ihrer Bewegungsfreiheit<br />
beschränkt werden.<br />
Vereinbar mit Menschenrechten<br />
und Grundgesetz?<br />
Die deutsche Sondergesetzgebung<br />
verhindert per se Integration.<br />
Genau die ist aber auch<br />
gar nicht gewollt.<br />
Flüchtlinge wehren sich seit über 30 Jahren gegen<br />
ihren Gebietsarrest und gegen den Eingriff in die<br />
Grundrechte unbescholtener Menschen. Manche<br />
beschränken sich auf individuelle Vorgehensweisen,<br />
indem sie schlicht nicht um Erlaubnis fragen oder –<br />
seltener – auf gerichtlichem Wege eine Genehmigung<br />
erstreiten. Andere schließen sich Flüchtlingsinitiativen<br />
an, die vor rund zwölf Jahren begannen, das Thema<br />
auf ihre Agenda zu setzen. Flüchtlingsselbstorganisationen<br />
wie The Voice, die Brandenburger Flüchtlingsinitiative<br />
(FIB) und die Karawane für die Rechte der<br />
Flüchtlinge und MigrantInnen erinnerte die Residenzpflicht<br />
an die Passgesetze Südafrikas zu Zeiten der<br />
Apartheid. Der Flüchtlingskongress in Jena im Jahr<br />
2000 war der Startschuss für<br />
eine Kampagne gegen die Residenzpflicht:<br />
Flüchtlinge sollten<br />
nicht mehr um Erlaubnis betteln<br />
und nicht auch nur einen Cent<br />
an Strafe zahlen. Die Gesetzesverletzungen<br />
und Prozesse wurden<br />
in die Öffentlichkeit getragen.<br />
Es folgten Aktionstage,<br />
Anfragen, Petitionen, Memoranden und Mobilisierungen<br />
zu Gerichtsprozessen. Massenproteste hat die<br />
Residenzpflicht zwar nie ausgelöst, aber die Aktionen<br />
wirkten wie beharrliche Nadelstiche. Gleichwohl erlitten<br />
sie mit den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts<br />
1997 und des Europäischen Gerichtshof für<br />
Menschenrechte 2007 Niederlagen. Darin entschieden<br />
auch die obersten Gerichte, dass das Reiseverbot mit<br />
dem Grundgesetz bzw. mit der Europäischen Menschenrechtskonvention<br />
vereinbar sei.<br />
Minimale Lockerungen<br />
Noch vor zehn Jahren hätte kaum eine in der Politik<br />
tätige Person gewusst, was es mit der Residenzpflicht<br />
für Flüchtlinge auf sich hat. Seit einigen Jahren ist das<br />
Thema immerhin im Bundestag und in den Landtagen<br />
angekommen. Inzwischen haben einzelne Bundesländer,<br />
darunter Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz<br />
und Schleswig-Holstein, die Residenzpflicht gelockert.<br />
grenze
40<br />
grenze<br />
Anke Schwarzer<br />
ist Journalistin und<br />
lebt in Hamburg.<br />
Dort darf sich ein Teil der<br />
Geduldeten und Asylsuchenden<br />
im ganzen Bundesland bewegen<br />
oder wie in Mecklenburg-Vorpommern<br />
und Bayern in etwas<br />
größeren Gebieten als bisher.<br />
Baden-Württemberg und Niedersachen<br />
wollen folgen. Die Lokkerung<br />
ist wohl weniger der Einsicht geschuldet, dass<br />
auch Flüchtlingen Grundrechte gewährt werden müssen.<br />
Vielmehr dürfte der Grund darin liegen, dass<br />
sich viele Flüchtlinge diese Rechte schon längst<br />
genommen haben und die Residenzpflicht in Verwaltung,<br />
Behörden, Justiz und bei der Polizei Arbeit ver-<br />
Bericht von Sekou Diallo*, Oktober 2011<br />
Die Lockerung der Residenzpflicht in einigen<br />
Bundesländern ist erfreulich. Gleichzeitig<br />
erweitern sie lediglich den Gebietsarrest. Spätestens<br />
an den unsichtbaren <strong>Grenze</strong>n eines Bundeslandes<br />
wird dies deutlich: „Es sitzen so viele Menschen<br />
hier, warum kontrollieren Sie gerade mich? Weil ich<br />
schwarz bin?“ Sekou Diallo* sitzt im Regionalexpress<br />
von Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg,<br />
als wenige Stationen vor dem Hauptbahnhof<br />
drei Beamte der Bundespolizei einsteigen. Eine Antwort<br />
mit Worten erhält der junge Mann aus Westafrika<br />
nicht auf seine Frage. Kontrolliert wird aber<br />
auch eine kleine Gruppe von drei Frauen – alle mit<br />
schwarzer Hautfarbe. Die Beamten bestehen weiter<br />
darauf, seine Papiere sehen zu wollen. Diallo zeigt<br />
seinen Behindertenausweis mit Name und Foto. Die<br />
drei Beamten umringen ihn noch enger. Die anderen<br />
Fahrgäste schauen aus dem Fenster. Diallo<br />
zeigt schließlich weitere Papiere; die Beamten rufen<br />
die zuständige Ausländerbehörde an. Einer der<br />
drei möchte die Duldungsbescheinigung einbehalten,<br />
schließlich habe Diallo gegen die Residenzpflicht<br />
verstoßen. Diallo wehrt sich dagegen,<br />
schließlich braucht er das Papier für weitere Kontrollen,<br />
will er nicht gleich auf der Polizeistation<br />
landen. Einer der Beamten lenkt ein. Ja, ja, er habe<br />
vor, wieder in sein Heim zurückzukehren, antwortet<br />
Diallo auf die weiteren Fragen der Beamten. Ja,<br />
ja, er werde eine Bescheinigung seiner Hamburger<br />
Anwältin besorgen, mit der er das weitere Vorgehen<br />
in seiner Bleiberechtssache besprechen will. Offen<br />
ist für Diallo jedoch, ob diese Terminbescheinigung<br />
der Anwältin eine Strafanzeige wegen Verletzung<br />
der Residenzpflicht abwenden wird.<br />
* Name geändert<br />
Die minimalen Lockerungen der<br />
Residenzpflicht erfolgten insbesondere<br />
auf Bundesebene bislang<br />
nur nach „Nützlichkeitskriterien“.<br />
ursacht, deren Zweck offenbar<br />
nicht mehr überzeugend vermittelbar<br />
ist – schon gar nicht in<br />
Zeiten von Sparmaßnahmen.<br />
Zumindest führte dies das Brandenburgische<br />
Innenministerium<br />
– neben den grundrechtlichen<br />
Aspekten – als Grund an:<br />
„Gleichzeitig entfiel bei den Ausländerbehörden auch<br />
viel bürokratischer Aufwand, der zuvor bei der Bearbeitung<br />
und Entscheidung von entsprechenden Anträgen<br />
getrieben werden musste.“<br />
Thomas Hohlfeld, Referent für Migration und Integration<br />
der Fraktion „Die Linke“ im Bundestag, sieht verschiedene<br />
Faktoren für den Wandel am Werke. Zum<br />
einen sei es das Verdienst der Proteste, zum anderen<br />
wirkten aber einige Gesetze „unverhältnismäßig“,<br />
betrachte man die sinkende Bevölkerungszahl, die<br />
geringer werdende Zahl der Asylanträge und die<br />
geänderte Haltung der Bundesregierung in Einwanderungsfragen.<br />
Hohlfeld betont jedoch, dass die Lockerungen<br />
insbesondere auf Bundesebene bislang nur<br />
nach „Nützlichkeitskriterien“ erfolgten, etwa zum<br />
Schulbesuch oder zur Ausbildung. Auch seien weiterhin<br />
viele Flüchtlinge von der Lockerung ausgeschlossen,<br />
etwa diejenigen, die sich noch in einer Aufnahmeeinrichtung<br />
aufhalten müssen oder diejenigen, die<br />
angeblich ihren „Mitwirkungspflichten“ nicht nachgekommen<br />
oder straffällig geworden seien. Für letztere<br />
Gruppe bedeutet die Residenzpflicht übrigens eine<br />
Doppelbestrafung: Geld oder Gefängnis etwa für<br />
Diebstahl oder Drogenbesitz und zusätzlich die – oft<br />
jahrelang geltende – freiheitsbeschränkende außergerichtliche<br />
Sanktion.<br />
Keine Mehrheiten in Gesellschaft und Parlament<br />
Ende 2010 war eine Bundesratsinitiative gescheitert,<br />
die von Bremen, Brandenburg, Berlin und Nordrhein-<br />
Westfalen ausging zum Ziel hatte, die Residenzpflicht<br />
im ganzen Bundesgebiet weitgehend aufzuheben.<br />
Auch die Anträge der Linkspartei und der Grünen im<br />
Frühjahr 2011 fanden im Bundestag keine Mehrheit.<br />
Damals stimmte die SPD gegen den Antrag der Linkspartei<br />
und enthielt sich beim Antrag der Grünen.<br />
Erstaunlicherweise hat sie dann – wenn auch erfolglos<br />
– im Mai den Bundestag aufgefordert, die Residenzpflicht<br />
bis auf einige Ausnahmen abzuschaffen.<br />
„Die SPD braucht manchmal etwas länger“, so Hohlfelds<br />
Einschätzung. Die Linkspartei werde in den<br />
nächsten Monaten einen weiteren Versuch starten. Sie<br />
fordert die Abschaffung der Residenzpflicht ohne<br />
Ausschlussklauseln und ohne die Zwangsverteilung
auf bestimmte Orte.<br />
Rheinland-Pfalz kündigte zudem eine neue Bundesratsinitiative<br />
an. Doch keines der politischen Lager<br />
verfügt dort derzeit über eine eigene Mehrheit. Weder<br />
Bayern noch Hamburg, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen<br />
planen, sich an einer neuen Gesetzesinitiative<br />
zu beteiligen. „Die Gründe, die seinerzeit den<br />
Gesetzgeber mit breiter Mehrheit dazu veranlasst<br />
haben, die räumliche Beschränkung des Aufenthaltsbereichs<br />
(…) gesetzlich festzulegen, liegen weiterhin<br />
vor. Deshalb werden Gesetzesinitiativen zur Aufhebung<br />
dieser räumlichen Beschränkungen nicht unterstützt“,<br />
heißt es etwa aus dem Niedersächsischen<br />
Innenministerium. Hessen beabsichtigt ebenfalls keine<br />
weiteren Änderungen: „Selbst wenn sich beispielsweise<br />
einmal im Einzelfall ein Bedürfnis ergeben sollte,<br />
in den Aufenthaltsbereich auch ein Gebiet eines<br />
anderen Bundeslandes einzubeziehen, sind entsprechende<br />
Einzelfallregelungen ausreichend“, so das<br />
Innenministerium in Wiesbaden. Dort wird die rheinland-pfälzische<br />
Integrationsministerin Irene Alt wohl<br />
auf Granit beißen. Sie plane Gespräche, um länderübergreifende<br />
Lösungen zu diskutieren. „Es wäre<br />
schon bei der Jobsuche im Rhein-Main-Gebiet oder<br />
im Rhein-Neckar-Raum eine riesige Hilfe, wenn die<br />
Betroffenen ohne Probleme ins Nachbarland fahren<br />
könnten“, so Alt.<br />
So bleibt es wohl in der nächsten Zeit beim Herumdoktern<br />
an einzelnen Lockerungen hier und da, an<br />
ausgefeilten Ausnahmeklauseln und ausgeklügelten<br />
Gebietserweiterungen. Wenn die Flüchtlingszahlen<br />
weiter steigen und dies populistisch ausgeschlachtet<br />
wird, wird es ein Leichtes sein, die Lockerungen<br />
zurückzunehmen. Dirk Vogelskamp vom Komitee für<br />
Grundrechte und Demokratie stellt fest: „Für eine<br />
Abschaffung der Residenzpflicht scheint es in diesem<br />
Land noch keine parlamentarischen Mehrheiten zu<br />
geben, von einer gesellschaftlichen ganz zu schweigen.“
Schwester: „Er schafft es oder nicht.<br />
Er weiß, dass er sterben kann”<br />
Bruder:<br />
„Ich werde weggehen,<br />
wegen der Situation unserer Familie hier"
Die <strong>Grenze</strong>n verbrennen<br />
Tunesien, Lampedusa, Schengen<br />
In der Folge der Ereignisse in Nordafrika im Frühjahr dieses Jahres kam es zu Aufsehen erregenden und<br />
erfolgreichen Überschreitungen der europäischen Außengrenze im Mittelmeer. Es waren die ersten Ausläufer<br />
der Revolution, die Europa erreichten. Das Aufbegehren in der Krise der Staatsfinanzen hat sich<br />
danach auch im südlichen Europa formiert. Die Forderungen nach Demokratie und sozialer Gerechtigkeit<br />
sind über den Umweg Nordamerika mittlerweile auch in Nordeuropa angekommen. Doch auch die<br />
erste – nennen wir sie ruhig migrationäre – Bewegung hat grundlegende Politiken des Ein- und Ausschlusses<br />
in Europa in Frage gestellt und Reaktionen herausgefordert. Von Bernd Kasparek<br />
Harraga – die die <strong>Grenze</strong>n verbrennen – heißen<br />
die klandestinen Migrierenden in Nordafrika.<br />
Der Name kann auch gelesen werden<br />
als „jene, die die Straßen hinter sich verbrennen“, also<br />
ihre Verbindungen abbrechen und bewusst in Kauf<br />
nehmen, dass es kein Zurück gibt. Der Name charakterisiert<br />
treffend den Akt der Migration nach Europa,<br />
den undokumentierten Sprung<br />
über das Mittelmeer. Denn die<br />
<strong>Grenze</strong>n Europas werden nur<br />
selten mehrfach überschritten.<br />
Wer es schafft, setzt alles daran<br />
zu bleiben, wer einmal zurückkehrt<br />
aus Europa, der hat seine<br />
Chance verspielt. Die Effekte<br />
sind bekannt, oftmals werden sie<br />
von den Regierungen, die sie verursachen, zumindest<br />
billigend in Kauf genommen. Die Illegalisierung, der<br />
prekäre Aufenthalt, das Entstehen einer weitgehend<br />
ausbeutbaren Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse in<br />
Europa, die weitgehende Absenz von sozialen und<br />
politischen Rechten, all dies, aber auch viele kleine<br />
und größere Kämpfe dagegen wurden vielfach dokumentiert.<br />
Boualem Sansal lässt in seinem Roman Harraga von<br />
Sofiane, dem Bruder der Protagonistin, erzählen:<br />
„[Sie] enthüllten mir, dass Sofiane den Weg der Harragas<br />
genommen hatte, derer, die die Straße verbrennen.<br />
Ich kannte den Ausdruck, es ist der am meisten<br />
bekannte des Landes, aber ich hörte ihn zum ersten<br />
Mal aus dem Mund eines echten Irren, da läuft es<br />
einem kalt den Rücken herunter. Sie sprachen ihn<br />
voller Stolz aus, die Straße zu verbrennen war ein<br />
Wunder, das nur sie zu vollbringen vermochten. […]<br />
Was soll man solchen Dummköpfen entgegnen […]?<br />
Die Beweggründe sind klar:<br />
Der Armut, der Perspektivlosigkeit<br />
zu entfliehen und die Familie<br />
durch Arbeit in Europa<br />
zu ernähren.<br />
Ich hätte sie ohne weiteres bei der Polizei denunziert,<br />
wäre die nicht gerade der Grund für ihre Demenz<br />
gewesen, weil sie sie immer kontrollierte, abtastete,<br />
ihnen ins Gesicht spuckte, sie manipulierte. Auf dem<br />
Weg der Harragas kehrt man nicht um, ein Sturz<br />
zieht den nächsten nach sich, härter, trauriger, bis<br />
zum finalen Sprung. Wir bekommen es zu sehen, die<br />
Satellitensender bringen die Bilder<br />
von ihren Körpern in die<br />
Heimat zurück, auf die Felsen<br />
gespült, von den Wellen hin<br />
und her geworfen, erfroren,<br />
erstickt, zerquetscht, im Fahrwerksschacht<br />
eines Flugzeugs,<br />
im Laderaum eines Schiffes<br />
oder auf der Ladefläche eines<br />
verplombten Lastwagens. Die Harragas haben für uns<br />
neue Arten des Sterbens erfunden, als ob wir nicht<br />
schon genug hätten. Und diejenigen, denen die Überfahrt<br />
gelingt, verlieren ihre Seele im schlimmsten<br />
Königreich, das es gibt, in der Heimlichkeit. Was für<br />
ein Leben ist das Leben im Untergrund?“<br />
Doch der revolutionäre Aufbruch (im wörtlichen<br />
Sinne) aus Tunesien gen Europa war selbstbewusster,<br />
fordernder. Die Revolution in Tunesien, die das Regime<br />
Ben Alis hinwegfegte und weltweite weitere Aufstände<br />
und Revolten inspirierte, wurde im Süden<br />
gemacht, den armen ländlichen Gegenden, in denen<br />
es zwar am Zugang zu Bildung nicht unbedingt mangelt,<br />
aber an Arbeitsplätzen. Gepaart mit einem korrupten,<br />
diktatorischen Regime, welches im Alltag allgegenwärtig<br />
war, erzeugte dies die explosive<br />
Mischung, die zur Revolution führte.<br />
grenze
44<br />
grenze<br />
„Wir wollen kein Asyl. Wir wollen arbeiten“<br />
Auch die tunesische Migration nach Europa nimmt<br />
vor allem im Süden ihren Ausgang. Es sind oftmals<br />
ganze Gruppen männlicher Jugendlicher, die – häufig<br />
von der Familie gedrängt – ihr Glück versuchen, nach<br />
Zarzis oder Sfax, zwei Hafenstädte im Süden Tunesiens,<br />
gehen und dort ihre Überfahrt nach Lampedusa<br />
oder Sizilien organisieren. Die Beweggründe sind<br />
klar: Der Armut, der Perspektivlosigkeit zu entfliehen<br />
und die Familie durch Arbeit in Europa zu ernähren.<br />
Sicherlich ist auch immer ein Schuss Abenteuerlust<br />
mit dabei. Denn die Gefahr, bei der Überfahrt das<br />
Leben zu verlieren, im Mittelmeer zu ertrinken, ist<br />
bekannt. Niemand macht sich Illusionen, welch<br />
gefährliches Unterfangen die Migration ist.<br />
„Er sprach kaum, aß kaum und kam nur heim, um<br />
über seinem Zorn zu brüten. Und dann, klick, der<br />
Auslöser. Eines Morgens in aller Frühe ging er fort.<br />
Über die Westroute, die gefährlichste […]. Ich erfuhr es<br />
spät am Abend, von einem seiner Kompagnons, ebenfalls<br />
ein Selbstmordkandidat, den ich in einer geheimen<br />
Beschwörungsversammlung aufstöberte, nachdem<br />
ich wie eine Verrückte das Viertel durchsucht<br />
hatte. Sie waren zu mehreren, ein ganzes Kontingent,<br />
schon berauscht vom Gejammer, sie träumten laut<br />
und überzeugten sich gegenseitig davon, dass die Welt<br />
sie mit Blumen erwarte und ihr Exodus der Laufbahn<br />
des Despoten einen tödlichen Schlag versetzen würde.<br />
Kurz, sie hatten Fieber.“<br />
Der Sturz des Regimes Ben Alis<br />
am 14. Januar 2011 zog auch<br />
eine kurzzeitige Aufhebung des<br />
europäischen Grenzregimes im<br />
Mittelmeer nach sich. Rund<br />
25.000 Tunesier nutzten die<br />
neue Freiheit, verbrannten die<br />
<strong>Grenze</strong> und setzten nach Lampedusa<br />
über. Diese Ankunft war<br />
der italienischen Regierung<br />
Anlass, über einen „Exodus biblischen Ausmaßes“ zu<br />
fabulieren, es war die Rede von einem „menschlichen<br />
Tsunami“. Auch die deutschen Medien interpretierten<br />
die Situation als den Beginn einer neuen „Flüchtlingswelle“<br />
und machten damit Assoziationen mit der<br />
Situation nach dem Ende des Ostblocks in den 1990er<br />
Jahren auf. Damals begann als Reaktion die Verschärfung<br />
der Einwanderungs- und Asylgesetzgebung<br />
(„Asylkompromiss“) und der Aufbau des europäischen<br />
Grenzregimes.<br />
In der Demokratisierung Nordafrikas<br />
liegt auch die Chance, dass<br />
sich die neuen Regierungen letztendlich<br />
doch einer Bevölkerung<br />
verpflichtet fühlen, in der Bewegungsfreiheit<br />
– auch gen Europa –<br />
ein wichtiges Anliegen ist.<br />
Doch die tunesischen Migrierenden machten von<br />
Anfang an klar, dass es ihnen nicht um Asyl ginge,<br />
sondern dass sie Arbeit und ein Auskommen in Europa<br />
suchten. Diese klare Linie, verbunden mit der<br />
neuen Position der tunesischen Übergangsregierung,<br />
die Kooperation in Sachen <strong>Grenze</strong> und Migration mit<br />
Europa ohne weiteres fortzusetzen, zwang die italienische<br />
Regierung, sechsmonatige Aufenthaltstitel zu<br />
vergeben. Diese Titel boten zwar kein Recht auf<br />
Arbeit, ermöglichten aber immerhin die Reise innerhalb<br />
der EU. Dies führte zu einer schweren Irritation<br />
des Schengen-impliziten Vertrauens. Frankreich reagierte<br />
zunächst mit einer kurzfristigen, teilweisen<br />
Schließung der <strong>Grenze</strong> zu Italien und führte danach<br />
wieder Grenzkontrollen ein, worauf die Europäische<br />
Kommission ein Vertagsverletzungsverfahren prüfte.<br />
Auch in Deutschland wurde die Wiedereinführung<br />
von Grenzkontrollen diskutiert, und Dänemark setzte<br />
diese Pläne – bis zur Abwahl der von der rechtspopulistischen<br />
Volkspartei gestützten Regierung im<br />
Herbst – auch um.<br />
Die Migration von Tunesien nach Europa hat sich<br />
auch nach der Unterzeichnung eines Rückübernahmeabkommens<br />
zwischen Italien und der tunesischen<br />
Übergangsregierung fortgesetzt. Erst im Oktober kam<br />
es im Auffanglager in Lampedusa, aber auch an anderen<br />
Orten zu Aufständen von Migrierenden, die sich<br />
ihr Recht auf Freizügigkeit erkämpfen wollten. Auch<br />
wenn sich Italien, Frankreich und die EU bemühen,<br />
die <strong>Grenze</strong> im Mittelmeer wiederherzustellen, scheint<br />
dies nicht so leicht zu bewerk-<br />
stelligen zu sein. Mit den Aufständen<br />
in Nordafrika sind der<br />
EU wichtige autokratische Partner<br />
auf der anderen Seite der<br />
<strong>Grenze</strong> abhanden gekommen.<br />
Derzeit deutet zwar einiges darauf<br />
hin, dass die EU ihre Einflussmöglichkeiten<br />
in Nordafrika<br />
voll ausspielt. So hatte etwa der<br />
libysche Übergangsrat noch vor<br />
dem Sturz Gaddafis eine Fortführung der Zusammenarbeit<br />
in Grenz- und Migrationsfragen zugesagt. Dennoch<br />
liegt in der Demokratisierung Nordafrikas auch<br />
die Chance, dass sich die neuen Regierungen letztendlich<br />
doch einer Bevölkerung verpflichtet fühlen<br />
müssen, in der Bewegungsfreiheit – auch gen Europa<br />
– ein wichtiges Anliegen ist. Erfolgreich kann dieses<br />
Projekt der Demokratisierung der <strong>Grenze</strong> jedoch nur<br />
sein, wenn sich auch auf der anderen Seite des<br />
Mittelmeers, in Europa, eine starke Bewegung für<br />
Demokratie und Gerechtigkeit herausbildet.
Das Massengrab im Mittelmeer<br />
Der libysche Bürgerkrieg hat jedoch in der Zwischenzeit<br />
zu ganz anderen Dramen geführt. Abseits von<br />
Zerstörung und Tod im Land hat es insbesondere die<br />
Arbeitsmigrantinnen und -migranten in Libyen getroffen.<br />
Sie gerieten oftmals zwischen die Fronten und<br />
mussten – häufig nach jahrelangem Aufenthalt in<br />
Libyen – ihr Heil in der Flucht suchen. Im Süden von<br />
Tunesien existiert immer noch das Lager Choucha, in<br />
dem zeitweise mehrere Tausend Menschen in Zelten<br />
in der Wüste lebten, ohne Perspektive, da ihnen alle<br />
Wege versperrt sind. Aber auch jene, die die Überfahrt<br />
nach Europa wagten – oder von Gaddafis Truppen<br />
auf die Schiffe gezwungen wurden – mussten oft<br />
mit ihrem Leben bezahlen. Nach Schätzungen starben<br />
in diesem Jahr über 2.000 Menschen im Mittelmeer,<br />
und dies trotz einer lückenlosen Überwachung des<br />
Meeres vor Libyen aufgrund der internationalen Militärblockade<br />
im Rahmen des NATO-Einsatzes in<br />
Libyen.<br />
Schengenreform<br />
Weder in diesem konkreten Fall noch im Allgemeinen<br />
hat in Europa ein Umdenken über die Migration und<br />
die <strong>Grenze</strong> eingesetzt. Die innereuropäischen Auseinandersetzungen<br />
um die Wiedereinführung von Grenzkontrollen<br />
im Schengenraum haben zu einem Entwurf<br />
der Europäischen Kommission geführt, wie<br />
Schengen reformiert werden könnte. Zwar ist der Entwurf<br />
nach heftigem Widerstand aus Deutschland wieder<br />
in der Schublade verschwunden, aber es ist<br />
bekannt, dass Bürokratien ein langes Gedächtnis<br />
haben und den Entwurf im opportunen Moment wieder<br />
hervorzaubern können. So weist der Entwurf<br />
auch die Richtung, in die Schengen gehen könnte.<br />
Wenig überraschend fordert die Kommission erweiterte<br />
Rechte für sich selbst: Sie soll etwa die Aufsicht<br />
über die Umsetzung des Schengener Grenzkodex an<br />
sich ziehen und EU-Mitgliedsstaaten verklagen können,<br />
wenn diese, etwa durch Binnengrenzkontrollen,<br />
den Standard unterlaufen. Auch sollen die Möglichkeiten<br />
für eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen<br />
weiter eingeschränkt werden und der Zustimmungspflicht<br />
eines europäischen Gremiums unterliegen.<br />
Wie die Schengen-Freizügigkeit als Preis die verhärteten<br />
Außengrenzen mit sich bringt, so hat auch der<br />
Kommissionsentwurf, der bis hierhin eher positiv<br />
anmutet, seine Schattenseite. Aufmerksam Lesende<br />
bemerkten bald eine Klausel, die es erlaubt, einen<br />
Mitgliedsstaat des Schengenraums temporär aus dem<br />
Schengenraum auszuschließen, sollte dieser Staat seinen<br />
Anteil an der europäischen Außengrenze nicht<br />
unter Kontrolle haben. Diese „Griechenlandklausel“<br />
befördert die Erosion des europäischen Zusammenhalts,<br />
wie er sich im Umgang mit der Krise der Staatsfinanzen<br />
schon länger abzeichnet. Sie befördert Ausschlussgelüste,<br />
die nicht mehr auf einzelne Individuen<br />
(Migrierende, „Terroristinnen“ und „Terroristen“,<br />
„Kriminelle“) abzielen, sondern auf die gesamte<br />
Bevölkerung eines EU-Mitgliedsstaats. Auch wenn<br />
diese Klausel nicht die allgemeine Personenfreizügigkeit<br />
und die Niederlassungsrechte berührt, die sich<br />
aus den EU-Verträgen ergeben, so ist es doch ein<br />
hochsymbolischer Schritt. Er klingt wie ein Nachhall<br />
der Debatte um den Ausschluss Griechenlands aus<br />
der Euro-Zone, und es wäre ein weiterer Schritt in<br />
Richtung der Fragmentierung der Rechtelandschaft<br />
innerhalb der EU. Gegenüber der migrantischen<br />
Bevölkerung Europas schon lange praktiziert, würde<br />
das Prinzip des graduellen Ausschlusses nun auch auf<br />
jene Bevölkerung, die sogar eine EU-Staatsbürgerschaft<br />
innehat, ausgeweitet werden.<br />
Doch in der Rückschau bietet das Jahr 2011 immer<br />
noch Grund für Optimismus. Wer hätte im Dezember<br />
2010 ein solch turbulentes Jahr vorhergesehen? Die<br />
Revolutionen in Nordafrika haben uns allen ins<br />
Bewusstsein zurückgerufen, dass auch die zementiertesten<br />
sozio-politischen Systeme ins Wanken gebracht<br />
werden können. Im Aufbruch rund um das Mittelmeer,<br />
in den Bewegungen gegen Diktatur und Spardiktat,<br />
liegt eine Chance und äußert sich eine Hoffnung<br />
auf eine Vision der sozialen und politischen<br />
Teilhabe, die bisher nicht existierte.<<br />
Videostills aus dem Film „Liberté 302“ (2011, Walid Fellah,<br />
Zarzis TV). Der Film handelt von einem Schiffsunglück, als<br />
ein Boot mit tunesischen Harraga nahe Lampedusa von<br />
einem Schiff der tunesischen Küstenwache versenkt wurde.<br />
grenze<br />
Zum Weiterlesen<br />
bordermonitoring.eu<br />
(Hg.): Tunesien<br />
zwischen Revolution<br />
und Migration.<br />
Eindrücke und Fragmente<br />
einer Delegationsreise<br />
im Mai<br />
2011. Broschüre.<br />
Cuttitta, Dietrich,<br />
Kasparek, Speer, Tsianos:<br />
Die <strong>Grenze</strong><br />
demokratisieren!<br />
In: Kritische Justiz<br />
3/2011<br />
Bernd Kasparek<br />
ist aktiv in der Karawane<br />
für die Rechte<br />
der Flüchtlinge,<br />
Migrantinnen und<br />
Migranten und<br />
forscht zu Aspekten<br />
des europäischen<br />
Grenz- und Migrationsregimes.
Gedenken gesperrt:<br />
Schuhmahnmal für die Toten<br />
an der europäischen Außengrenze.
Wir schengen euch nix<br />
Fünf Tage für Bewegungsfreiheit, fünf Tage gegen <strong>Grenze</strong> und Nation, fünf Tage Aktionen, Demos, Workshops,<br />
Diskussionen und Selbstorganisation: Herzlich Willkommen auf dem NoBorder-Camp. Das letzte<br />
hat Ende August in Bulgarien, im kleinen Dorf Siva Reka nahe der <strong>Grenze</strong>n zu Türkei und Griechenland<br />
stattgefunden. Von Nikolai Schreiter<br />
Eine Kreuzung, eine Kneipe, ein paar Häuser,<br />
ein paar Höfe, ein kleines Dorf in der südbulgarischen<br />
Peripherie nahe der <strong>Grenze</strong> zur Türkei.<br />
Rundherum Landschaft, alle halbe Stunde ein<br />
Auto. Was dieses Dorf von so vielen anderen unterscheidet:<br />
Ein nagelneuer, großer, grüner Jeep, drei<br />
Bedienstete der Border Police sitzen daneben und<br />
essen gelangweilt Aprikosen von einem kleinen<br />
Baum. Noch haben sie offensichtlich wenig zu tun,<br />
die bulgarischen Grenzschützer. Noch, denn der<br />
Schengenbeitritt steht an und wirft seine Sicherheitsschatten<br />
voraus. Sobald Bulgarien teil des Schengenraumes<br />
sein wird, werden mehr<br />
Menschen als bisher undokumentiert<br />
über die bulgarische<br />
<strong>Grenze</strong> wollen. Das ist der<br />
Grund für die massive Präsenz<br />
der Sicherheitskräfte, für den<br />
Bau von Abschiebeknästen, für<br />
schärfere Grenzkontrollen, für<br />
die Entsendung von Experten<br />
und Expertinnen von Frontex, der Europäischen<br />
Agentur für operative Zusammenarbeit an den<br />
Außengrenzen. Und dies wiederum sind die Gründe,<br />
warum das NoBorder-Camp in Siva Reka stattgefunden<br />
hat, in einem anderen kleinen Dorf, zehn Kilometer<br />
von der Grenzstadt Svilengrad entfernt. 250 bis<br />
300 Aktive kamen dort vom 25. bis 29. August<br />
zusammen, um ihrem Protest gegen das europäische<br />
Grenzregime, gegen <strong>Grenze</strong>n, Nationen und Abschiebungen<br />
Ausdruck zu verleihen.<br />
Frontex kills!<br />
Erklärte Ziele des Camps waren es, die Aufmerksamkeit<br />
der örtlichen Bevölkerung, der Medien und der<br />
so genannten internationalen Gemeinschaft zu erregen,<br />
das NoBorder-Netzwerk auszuweiten, lokale<br />
Solidarität zu wecken und zu vertiefen und Einzelfälle<br />
von Migranten und Migrantinnen zu erfassen. Das<br />
Camp wurde von Anfang an als dezidiert gewaltfrei<br />
angekündigt und durchgeführt, um Solidarität und<br />
positive Assoziationen mit Migration zu erzeugen,<br />
Foto: Christoph Staber<br />
Aus Gedenken an die Toten des<br />
Grenzregimes, machte eine große<br />
bulgarische Zeitung den Versuch,<br />
Polizeiautos mit Kerzen<br />
anzuzünden.<br />
außerdem sind Strategien der Polizei im protestunerfahrenen<br />
Bulgarien schwer einzuschätzen – gerade<br />
kurz vor dem anstehenden Beitritt zum Schengen-<br />
Abkommen. Denn jeder Anschein von Kontrollverlust<br />
über die Sicherheit der <strong>Grenze</strong>n könnte den Beitritt<br />
weiter hinauszögern. Die Entscheidung zur Gewaltfreiheit<br />
war im Vorhinein vom Organisationsteam<br />
getroffen worden und sorgte erwartungsgemäß auf<br />
dem Camp für Diskussionen. Manche wollten<br />
gewohnte Aktionsformen angesichts der drohenden<br />
und unabschätzbaren Repression nicht ändern; im<br />
Verlauf des Camps allerdings entwickelte sich doch<br />
so etwas wie eine allgemeine<br />
Akzeptanz und Verständnis für<br />
den Verzicht auf Gewalt in diesem<br />
Kontext.<br />
Die erste Demonstration fand in<br />
Svilengrad statt, in der Fußgängerzone<br />
gab es viele kleine<br />
Aktionen. Schließlich zog die<br />
Demonstration durch die Stadt, vor das Hauptquartier<br />
der bulgarischen Grenzpolizei. Die Abschlusskundgebung<br />
mit der Aussage: „Frontex kills!“ war begleitet<br />
vom Niederlegen alter Schuhe und Teelichter in Erinnerung<br />
an die vielen Toten, die das europäische<br />
Grenzregime schon gefordert hat. Aus dem absolut<br />
gewaltfreien Gedenken machte eine große bulgarienweit<br />
erscheinende Zeitung den Versuch, Polizeiautos<br />
mit Kerzen anzuzünden und dichtete den Aktiven<br />
unter anderem den Gebrauch von Molotowcocktails<br />
an. Vor dem Hintergrund, dass dies alles frei erfunden<br />
war, schien das enorme Polizeiaufgebot mehr als<br />
übertrieben: Bei jeder der Aktionen waren martialische<br />
Riot Cops anwesend – meist versteckt, Wasserwerfer<br />
wurden in Bereitschaft gehalten und teilweise<br />
auch Hundestaffeln.<br />
„Now is the time to go back“<br />
Am zweiten Tag, bei den beiden Aktionen an der<br />
bulgarisch-türkischen und der bulgarisch-griechischen<br />
<strong>Grenze</strong>, konnte zweimal – ohne von der Gewaltfrei-<br />
grenze
48<br />
grenze<br />
heit abzuweichen – auf der Straße ein „Die-In“<br />
gespielt werden. Mehrere Dutzend der Aktivisten und<br />
Aktivistinnen stellten sich tot, eingerahmt von Transparenten<br />
mit der Aufschrift: „War Zone – This Border<br />
Kills People“. An den <strong>Grenze</strong>n fiel aber insbesondere<br />
auf, dass die Methoden der Migrationssteuerung weit<br />
über pure Kontrolle, Inhaftierungen und Abschiebungen<br />
hinausgehen. Richtiggehende Abschreckungskampagnen<br />
gegen Migrantinnen<br />
und Migranten sind im Gange.<br />
Einige hundert Meter hinter der<br />
<strong>Grenze</strong> beispielsweise steht auf<br />
einer großen Werbetafel: „If you<br />
are illegal, you‘re just a shadow.<br />
The only way is the legal way.“<br />
Den dazugehörigen Flyer, mehrsprachig,<br />
gibt’s gratis am Grenzhäuschen.<br />
Ein Auszug:<br />
„In their homeland, everyone is somebody. What do<br />
you rely on here? (…) How can we help you if you<br />
are just a shadow? And we can’t know each other.<br />
You have no documents. No money. Everything could<br />
be different. Everything could be legal.<br />
While you are wandering around, your country is<br />
getting modernized. While you are roaming around,<br />
your countrymen are building your country. Their<br />
children learn, they get treatment when they are sick,<br />
and get pension when they get old.<br />
This is what you left for, right? Now is the time to go<br />
back. There is no better way to go back to your country<br />
than the voluntary way.“<br />
Ein neues „detention centre“<br />
Am Sonntag, dem dritten Tag des Camps, standen<br />
Workshops, Vernetzung und Berichte aus den unterschiedlichen<br />
Gegenden und Aktionsfeldern auf dem<br />
Programm sowie, nach den beiden sehr anstrengenden<br />
Tagen bei brütender Hitze auf Asphalt, ein wenig<br />
Erholung. E-Mail-Adressen wurden ausgetauscht, Kontakte<br />
geknüpft und weitere Zusammenarbeit koordiniert.<br />
Die wahrscheinlich wichtigste und direkt wirksamste<br />
Aktion fand am Montag statt, dem letzten Tag des<br />
offiziellen Camps. In der nahen Kleinstadt Lyubimets<br />
wurde im März ein „detention centre“ eröffnet, dessen<br />
Mauern, Stacheldraht und Gitterstäbe weitgehend<br />
aus EU-Mitteln finanziert wurden. Die Delegation, die<br />
das Gefängnis besichtigt hatte, berichtete von Standards<br />
„wie in einer Jugendherberge“, mit Bibliothek,<br />
Fernsehräumen und grünem Gras. Das ändert aber<br />
nichts daran, dass es ein Knast ist, in dem Menschen<br />
In der Nähe des Camps wurde vor<br />
kurzem ein „detention centre“<br />
eröffnet, in dem Menschen, noch<br />
dazu ohne gerichtliche Anweisung,<br />
für bis zu 18 Monate am<br />
Stück eingesperrt werden.<br />
– noch dazu ohne gerichtliche Anweisung – für bis<br />
zu 18 Monate am Stück eingesperrt werden.<br />
Antiziganistische Pogrome nach dem Camp<br />
Zwischen den Eingesperrten und der Kundgebung<br />
war über Transparente und Megaphon eine eingeschränkte<br />
Kommunikation möglich, neben Winken,<br />
Rufen nach Freiheit und Solida-<br />
ritätsbekundungen konnten in<br />
mehreren Sprachen eine Rechtshilfenummer<br />
und ganz rudimentäre<br />
Rechte mitgeteilt werden.<br />
Unter den Protestierenden<br />
waren auch einige Ortsansässige,<br />
insbesondere Menschen aus<br />
der nahe gelegenen Roma-Siedlung,<br />
die selbst am unteren<br />
Ende der sozialen Hierarchie<br />
stehen. Einen Monat später wurde deutlich, wie ausgeprägt<br />
Antiziganismus –Teil europäischer Normalität<br />
– auch in Bulgarien ist. Am 23. September war in der<br />
Nähe von Plovdiv ein junger Mann durch die örtliche<br />
Mafia ums Leben gekommen. Daraufhin instrumentalisierten<br />
faschistische Gruppen und andere den Vorfall,<br />
um Mafiastrukturen zu ethnisieren und Proteste<br />
gegen diese in Pogrome gegen Roma umzumünzen.<br />
Es gab im ganzen Land Ausschreitungen gegen Roma,<br />
Häuser wurden angezündet und Romaviertel mit<br />
Waffen angegriffen.<br />
Minimale bulgarische Antira-Szene<br />
Trotz gewisser Differenzen, nicht nur bezüglich der<br />
Militanzfrage, muss dass NoBorder-Camp alles in<br />
allem als großer Erfolg gewertet werden. Erstmals<br />
gelang es, nicht nur auf bereits existierende Situationen<br />
hinsichtlich massenhafter informeller Grenzübertritte<br />
zu reagieren, sondern bereits im Vorfeld wahrscheinlich<br />
Kommendes zu beschreiben und zu kritisieren<br />
und darüber hinaus auch physische Präsenz zu<br />
zeigen. Ob das NoBorder-Camp dazu beigetragen hat,<br />
die minimale bulgarische Antira-Szene dauerhaft zu<br />
stärken, bleibt abzuwarten. Zu hoffen wäre es, denn<br />
sie besteht momentan aus fünf bis zehn Personen. Ihr<br />
Anteil am Erfolg des Camps ist kaum zu überschätzen.<br />
Vorbereitung und Organisation sowie Kommunikation<br />
nach außen während des Camps, Aushalten<br />
von Repression und juristische Nachbereitung wurde<br />
und wird fast ausschließlich von ihnen gestemmt.<<br />
Nikolai Schreiter arbeitete beim Bayerischen Flüchtlingsrat<br />
und studiert Internationale Entwicklung in Wien<br />
Foto: Luise Schröder
Eingeschränkte Sichtweisen<br />
Vom Märchen der „Festung Europa“ und anderen Grenzziehungen in Wort und Bild. Von Luise Marbach.
Raum oder Nicht-Raum?<br />
Die Installation der Ausstellung „re_mapping the<br />
border“ zeigt einen voll möblierten Raum von exakt<br />
fünf qm. Fünf qm entsprechen der Mindestanforderung<br />
bei der Unterbringung eines Flüchtlings ins<br />
Sachsen-Anhalt.
Die <strong>Grenze</strong>n haben sich verschoben. Deutschland<br />
thront umgeben von anderen EU-Ländern<br />
in der Mitte Europas. In der Konsequenz<br />
heißt das, legal nach Deutschland als Asylsuchende<br />
einzureisen, ist derzeit so gut wie unmöglich. In der<br />
zweiten Konsequenz bedeutet die Verschiebung der<br />
<strong>Grenze</strong>n nicht nur eine Entfernung im Raum. Sie ist<br />
auch zu einer Entfernung in den Köpfen geworden.<br />
Die (sichtbaren) <strong>Grenze</strong>n sind dem Blick der deutschen<br />
Mehrheitsgesellschaft entrückt. Und obwohl<br />
das Interesse an den Themen <strong>Grenze</strong> und Migration<br />
als solches nur noch gering erscheint, werden die<br />
Mechanismen von Ein-und Ausgrenzung im medialen<br />
Raum tagtäglich reproduziert. Um diese nachvollziehen<br />
zu können, muss gefragt werden, in welchen<br />
Bereichen, auf welche Weise und mit welchen Konsequenzen,<br />
<strong>Grenze</strong>n und Menschen in grenzüberschreitender<br />
Bewegung in der deutschen Medienlandschaft<br />
repräsentiert werden. Repräsentation ist dabei aber<br />
nicht als bloße Spiegelung oder direkte Wiedergabe<br />
einer bestehenden Wirklichkeit oder eines bestehenden<br />
Gegenstandes zu betrachten, sondern vielmehr<br />
als Herstellung einer Wirklich-<br />
keit durch die Art und Weise<br />
der Darstellung.<br />
Die Festungs-Metapher<br />
Immer wieder ist die Rede von<br />
der „Festung Europa“, wenn<br />
über den Ausbau der EU-<br />
Außengrenze und deren tödlichen Folgen berichtet<br />
wird. Geprägt wurde der Begriff „Festung Europa“<br />
1942 durch die Nationalsozialisten als Propagandaschlagwort<br />
für deren neue Großraumpolitik. Neben<br />
militärischen trug der Begriff auch rassistische Konnotationen.<br />
Eine Neubelebung erfuhr die Festungs-Metapher<br />
mit der Europäisierung der Grenz- und Migrationspolitik<br />
in den 1990er Jahren. Bedienten sich<br />
zuerst einmal vor allem linke Kritikerinnen und Kritiker<br />
dieser, um ihre Ablehnung gegenüber der voranschreitenden<br />
Abschottung Europas zu verdeutlichen,<br />
ist der Begriff heute im allgemeinen Sprachgebrauch<br />
fest verankert. Angefangen von antirassistischen<br />
Gruppierungen bis hin zu Konservativen, überall ist<br />
die Rede von der Festung, die ihre Tore geschlossen<br />
hat und ihre Mauern immer höher zieht.<br />
Die Festungs-Metapher suggeriert, dass die migrationspolitischen<br />
Strategien der EU allein auf die<br />
Abschottung gegenüber Migrationsbewegungen und<br />
die Militarisierung der Außengrenze zielt. Zweifellos<br />
gilt es diesen – zweifellos zu skandalisierenden –<br />
Aspekt der Migrationspolitik. Der Opferdiskurs, der<br />
Foto: Luise Marbach<br />
Das Bild von der „Festung Europa“<br />
suggeriert, dass die EU ein homogenes,<br />
geschlossenes Ganzes ist.<br />
dem Blick aus der „Festung Europa“ hinaus auf das<br />
Geschehen an ihren Rändern inhärent ist, stellt aber<br />
auch eine stark eingeschränkte Sichtweise auf den<br />
komplexen Zusammenhang von grenzüberschreitender<br />
Bewegung und Regulierung dar und wird den<br />
paradoxen Wirkungsweisen und Effekten des europäischen<br />
Grenzregimes nicht gerecht. Das Bild von der<br />
Festung suggeriert darüber hinaus, dass die EU ein<br />
homogenes, geschlossenes Ganzes ist und nährt die<br />
Vorstellung, einer einheitlichen Politik, obwohl gerade<br />
die EU auf vielen Ebenen von miteinander kollidierenden<br />
Interessen durchzogen ist.<br />
Mediale Berichterstattung und sprachliche<br />
Repräsentation<br />
Auffallend in Berichten zur Grenz- und Migrationspolitik<br />
sind insbesondere zwei Phänomene: zum einen<br />
die sprachliche Gleichsetzung von Migrationsbewegungen<br />
mit Naturkatastrophen und zum anderen der<br />
viktimisierende Blick. Immer wieder lässt sich von<br />
der „Welle“ oder einer „Überflutung“ lesen, die<br />
angeblich auf Europa zu rollt,<br />
von einem „Ansturm auf die<br />
Union des Wohlstands“ sprach<br />
etwa die Sueddeutsche.<br />
Der entpersonalisierte<br />
Blick drückt sich aber<br />
ebenso in der Bezeichnung von<br />
„Flüchtlingsströmen“ aus. Vermittelt<br />
wird hier der Eindruck,<br />
Migration wäre ein technisches und zu steuerndes<br />
Phänomen. Manifestiert wurde die Trope des „Stroms“<br />
auch in der von UN, UHNCR und IOM verwendeten<br />
Bezeichnung „mixed flows“ für Flüchtlingsbewegungen,<br />
die sich sowohl aus „echten“ politischen Asylsuchenden<br />
als auch aus „Wirtschaftsmigrantinnen und -<br />
migranten“ zusammensetzen. Mit der Gleichsetzung<br />
von Migration mit Naturereignissen lassen sich aber<br />
nicht nur die politischen und globalen Zusammenhänge,<br />
in denen Migrations- und Fluchtbewegungen<br />
stattfinden, einfach ausblenden. Sondern das diffuse<br />
Bild einer Katastrophe hinterlässt auch immer ein<br />
Gefühl der Bedrohung und der Angst beim Adressaten<br />
der Botschaft.<br />
Wiederkehrend bekommen wir auch Bilder präsentiert,<br />
die dokumentieren sollen, mit welchen Mitteln<br />
der „Ansturm“ auf die „Festung Europa“ versucht wird<br />
und mit welchen Mitteln ihm begegnet wird: Boote,<br />
Leitern, Handschellen auf der einen und natürliche<br />
Zäune, Mauern, Stacheldraht auf der anderen Seite.<br />
Beinhalten diese Szenarien auch Migrierende, sind sie<br />
entweder zusammengepfercht auf einem Holzkahn zu<br />
grenze
52<br />
grenze<br />
sehen, tot in einem Leichensack verpackt oder werden<br />
im Moment der Aufnahme von einer humanitären<br />
Hilfsorganisation umsorgt. Als Teil des „Stroms“<br />
werden sie „mitgerissen“ und „angeschwemmt“ und<br />
auf diese Weise zu Körpern ohne eigenen Willen<br />
kodiert. In Aktion dagegen sieht man meist nur die<br />
Helfenden oder aber das Sicherheits- und Grenzschutzpersonal.<br />
Diese tragen fast immer Mundschutzmasken<br />
und Gummihandschuhe als handle es sich<br />
bei den Ankommenden um Menschen mit einem<br />
ansteckenden Virus.<br />
Die „schönsten“ Unwörter der letzten Jahre<br />
Bleiben wir bei den Wortschöpfungen und verbalen<br />
Missgriffen aus dem deutschsprachigen Raum und<br />
schauen auf die vergangenen Wahlen zum „Unwort<br />
des Jahres“. 2004 haben es gleich zwei Ausdrücke auf<br />
die Liste geschafft, die paradigmatisch für die deutsche<br />
Migrationspolitik gelesen werden können: der<br />
„Bestandsausländer“ und das „Begrüßungszentrum“.<br />
Als „Bestandsausländer“ gelten all diejenigen, die vor<br />
dem 31. Dezember 2004 in die BRD eingereist sind.<br />
Also vor dem Inkrafttreten des neuen Zuwanderungsgesetz<br />
am 1.Januar 2005. An die zweite Stelle wählte<br />
die Jury den Begriff „Begrüßungszentrum“, womit<br />
Bundesinnenminister Otto Schily sein geplantes Auffanglager<br />
für afrikanische Flüchtlinge bezeichnete.<br />
Geistesverwandt ist diese Wortbildung zu der offiziel-<br />
len Bezeichnung „Ausreisezentrum“<br />
für Lager, in denen Menschen<br />
zwangsweise untergebracht<br />
werden, die nicht abgeschoben<br />
werden können und<br />
die durch die schlechten Lebensbedingungen<br />
in eben diesen<br />
Lagern zur „freiwilligen“ Ausreise<br />
gezwungen werden sollen.<br />
„Flüchtlingsbekämpfung“ gelangte 2009 auf den zweiten<br />
Platz, eine Wortschöpfung, mit der niemand<br />
geringeres als die christsoziale Bundeskanzlerin Angela<br />
Merkel den deutschen Beitrag an Europas <strong>Grenze</strong>n<br />
würdigte. In ihre Listung sprachlicher Missgriffe nahm<br />
die Gesellschaft für deutsche Sprache weiterhin programmatische<br />
Schlagwörter wie „freiwillige Ausreise“,<br />
„Leitkultur“, „Überfremdung“, „ausländerfrei“ oder die<br />
„durchrasste Gesellschaft“ auf.<br />
Stereotyp Flüchtling<br />
Die visuelle Repräsentation des schutzbedürftigen<br />
Flüchtlings und insbesondere des Not leidenden Kindes<br />
erfährt regelmäßig große Beachtung als preisge-<br />
kröntes Motiv der Pressefotografie. Mit diesen Bildern<br />
lässt sich nicht nur das „kosmopolitische Gewissen“<br />
Europas erschüttern, sondern sie sollen auch an die<br />
guten, alten Werte des Humanismus erinnern. Der<br />
viktimisierende Blick möchte die Betrachtenden auf<br />
das Schicksal Einzelner hinweisen; in der stetigen<br />
Wiederholung dieses Blicks aber verkehrt sich das<br />
Anliegen in sein Negativ. Der „Opferblick“ ermöglicht<br />
eine Universalisierung: die Ent-Individualisierung des<br />
Menschen auf der Flucht. Dies schafft ein Stereotyp,<br />
an dessen Anblick wir uns längst gewöhnt haben. Als<br />
politisch handlungsunfähig und hilflos abgestempelt<br />
fehlt es dem Flüchtling angeblich auch an Selbstrepräsentation,<br />
die bereitwillig durch NGOs oder die<br />
großen humanitären Organisationen wie der UNHCR<br />
übernommen wird. Der Zusammenschluss und die<br />
Proteste von Flüchtlingen gegen das Wirken des<br />
UNHCR in Ländern wie Marokko verdeutlichen, wie<br />
durch eine Selbstermächtigung im Sinne des Sprechaktes<br />
und des politischen Handelns die Monopolrolle<br />
des UNHCR als angeblich einzige rechtmäßige Interessenvertretung<br />
von den Flüchtlingen in Frage gestellt<br />
werden kann.<br />
Identitäten in bewegten Bildern<br />
Das Wort Flüchtlingsbekämpfung<br />
wurde von niemand geringeren<br />
als Angela Merkel ins Leben<br />
gerufen.<br />
Wie in der Fotografie zeigen sich solche Phänomene<br />
auch in Film- und Videoproduktionen: Die dem filmischen<br />
Bild inhärente Dynamik, Zeitlichkeit und<br />
Gleichzeitigkeit von Bild und<br />
Ton bietet aber im Gegensatz<br />
zum statischen Bild die Möglichkeit<br />
einer erweiterten<br />
Erzählperspektive, in der die<br />
Konstellationen und Interaktionen<br />
von Raum, Körper und<br />
Bewegung vielfältig gedacht<br />
und gezeigt werden können.<br />
Zwei Arten der räumlichen Verortung, der Ausgangsperspektive<br />
und der Narration kommen dabei<br />
wiederkehrend in Reportagen, Dokumentar- aber<br />
auch Spielfilmen zur Anwendung: Das ist zum einen<br />
die Fokussierung des Geschehens an der <strong>Grenze</strong><br />
(meist an den „Hot spots“ des Schengen-Raums) in<br />
TV-Formaten, wie Nachrichten-Clips und Reportagen,<br />
aber auch in unabhängigen Produktionen[FUßNOTE1]<br />
wird dabei auf die Konstellation von sich konträr<br />
gegenüberstehenden Subjekten zurückgegriffen,<br />
sprich Flüchtlinge versus Grenzschützende. Aus dieser<br />
dualistisch konstruierten Beziehung lassen sich<br />
eine Vielzahl von Kameraperspektiven generieren, mit<br />
der das „tatsächliche“ Geschehen an <strong>Grenze</strong>n in seiner<br />
Symbolik des Ein- und Ausschlusses direkt ins<br />
Wohnzimmer oder auf die Leinwand transportiert
wird. Besonders variationsreich baut sich dabei die<br />
Blickachse Zuschauer-Kamera-Grenzschützer-Kontrollobjekt<br />
auf, wie etwa der Kontrollblick in Ausweispapiere<br />
durch die Kamera. Der Blick über die Schulter<br />
des Grenzbeamten impliziert auch den Blick durch<br />
das Fernglas, das Nachtsichtgerät und die Überwachungs-<br />
und Wärmebildkamera.<br />
In seiner wiederkehrenden Rhe-<br />
torik vom „tapferen“ Grenzschützer,<br />
seiner technischen<br />
Erklärungen und Begeisterung<br />
für eben diese Technologisierung,<br />
spiegelt sich eine visuelle<br />
Kriegs-Rhetorik, die als solche<br />
kaum wahrgenommen wird, da<br />
der zu bekämpfende Feind (der Flüchtling, der „Illegale“,<br />
aber auch der Schleuser und Menschenhändler)<br />
klar ausgemacht wurde. Es gilt also nicht nur das<br />
Medium Film und seine ästhetischen Strukturen zu<br />
be- und hinterfragen, sondern auch die Medialisierung<br />
von <strong>Grenze</strong> als solches.<br />
Eine weitere gängige Form der Narration verlässt den<br />
Grenzraum und begleitet die Passage im Transit,<br />
begibt sich mit auf die Reise und in die Bewegung,<br />
um dessen Rhythmen und die subjektive Logiken von<br />
Migration aufzunehmen. Auch wenn hier die Protagonistinnen<br />
und Protagonisten die Migrierenden selbst<br />
sind, deren Routen auf „Augenhöhe“ verfolgt werden,<br />
ist der dokumentarische Migrationsfilm dem Genre<br />
des Road Movie[FUßNOTE2] und dem Reise- bzw.<br />
Abenteuerfilm nicht fern. Das authentische „Dabeisein“<br />
scheint hier Credo zu sein. Ein Anspruch, der<br />
allerdings Fragen aufwirft bezüglich des Verhältnisses<br />
von Protagonistin/Protagonist zu Produzentin/Produzent,<br />
von vorgefundener Realität zu filmischer Realität<br />
sowie von der Form der Darstellung zum Gegenstand<br />
als solchem.<br />
Die <strong>Grenze</strong> als (Kinder-)Spiel<br />
Das Thema <strong>Grenze</strong>, ihre Kontrolle sowie Grenz-<br />
Geschehnisse im Allgemeinen sind seit einigen Jahren<br />
auch in der interaktiven, multimedialen Welt der<br />
Computerspiele angekommen. Ein Spiel, beim dem<br />
sich die Spielenden in die Rolle des Grenzschutzpersonals<br />
begeben, ist das 2008 erschienene 3D-Spiel<br />
„Grenzpatrouille – Die Simulation“, das an der <strong>Grenze</strong><br />
zwischen Mexiko und den USA angesiedelt ist. Die<br />
untere Altersbegrenzung für das Spiel liegt bei 12 Jahren.<br />
Die Rolle der Migrierenden dagegen kann in<br />
dem vom UNHCR 2006 veröffentlichtem Onlinespiel<br />
„Last Exit Flucht. Das Spiel bei dem du der Flüchtling<br />
bist“ eingenommen werden. „Die Kombination von<br />
Flüchtling oder Grenzposten?<br />
Du hast die Wahl.<br />
spielerischer Erfahrung und detaillierter Information<br />
soll ein Bewusstsein für die Schutzbedürftigkeit von<br />
Flüchtlingen und die Notwendigkeit von Lösungen<br />
für deren Probleme schaffen“, heißt es auf der Homepage.<br />
„Last Exit Flucht“ ist als comichafte Flashanimation<br />
angelegt und für Spielende ab 13 Jahre gedacht.<br />
Wichtigster Teil des Spiels ist<br />
laut UNHCR das Quiz „Flücht-<br />
ling oder Einwanderer?“.<br />
Ein weiteres kostenloses 3D-<br />
Onlinespiel für Jugendliche und<br />
Erwachsene ist „Frontiers – You-<br />
've reached Fortress Europe“,<br />
entwickelt von der Künstlergruppe<br />
„gold extra“ aus Salzburg. Bei „Frontiers“ können<br />
die Spielenden zu Beginn zwischen der Rolle<br />
eines Flüchtlings und der eines Grenzposten wählen.<br />
Auf der Website der Gruppe heißt es: „Mit den<br />
Flüchtlingen sehen wir Europa von außen – den<br />
Zaun, die Mauer, die „Festung“ – und gewinnen eine<br />
neue Innenansicht von Europa. Orte, Schicksale,<br />
Hintergründe, die man in den Nachrichten längst<br />
gesehen hat, werden zum zusammenhängenden<br />
Bild.“ Zusätzlich zur Spielebene wird eine Website<br />
mit interaktiven Features und Interviews mit Migrierenden<br />
und anderen Akteuren, wie z.B. vom Verein<br />
borderline-europe angeboten. „Frontiers“ hat mit seinem<br />
„social mod“-Prinzip, das die Spielenden in die<br />
klassischen Perspektive eines Ego-Shooters versetzt,<br />
der aber bei Anwendung von Gewalt mit Punktabzug<br />
bestraft wird, für einige Furore in der Kunst- und<br />
Medienwelt gesorgt und wird von dieser gerne als<br />
Paradebeispiel für ein „serious game“ herangezogen.<br />
Während „Grenzpatrouille“ und „Last Exit Flucht“ den<br />
konzeptuellen Zusammenhang von Territorium, Staat,<br />
Nation und die Abschottung der <strong>Grenze</strong>n grundsätzlich<br />
nicht in Frage stellen, versucht „Frontiers“ zumindest<br />
zum Nachdenken über diese Verkettungen anzuregen.<br />
Dass das Spiel „Grenzpatrouille“ in keinerlei<br />
kritischem Kontext eingebettet wurde, ist weiter kein<br />
Wunder. Dagegen untermauert das UNHCR mit seinem<br />
offensichtlich pädagogischen Konzept seinen<br />
„humanitären“ Ansatz von Flüchtlingsschutz, der ohne<br />
die Funktion der <strong>Grenze</strong> als solches nicht denkbar<br />
wäre.<br />
Karte, Atlas, Globus<br />
Die Geschichte der Kartografie spiegelt nicht nur die<br />
Geschichte um machtpolitische und territoriale Kämpfe<br />
und Verschiebungen wider, sondern auch die<br />
Geschichte technischer und ästhetischer Entwicklun-<br />
grenze
grenze<br />
Die ausführlichere<br />
Version von „Die<br />
<strong>Grenze</strong> als Randnotiz“<br />
kann im <strong>Magazin</strong><br />
„re_mapping the<br />
border. Über Grenzregime<br />
und Blickbeziehungen“nachgelesen<br />
werden.<br />
Bestellbar unter<br />
re_mapping@gmx.de<br />
Luise Marbach<br />
ist Künstlerin, aktiv<br />
in antirassistischen<br />
Zusammenhängen<br />
und Herausgeberin<br />
des <strong>Magazin</strong>s<br />
„re_mapping the<br />
border.“<br />
gen und den Wandel vom Verständnis von Raum,<br />
Struktur und Fläche. Neben der angeblich immanenten<br />
Objektivität, beanspruchen Landkarten eine politische<br />
Neutralität. Eine kritische Hinterfragung dieser<br />
Behauptung kann auf drei Ebenen ansetzen: der kartografische<br />
Prozess der Entstehung der Karte, die ideologische<br />
Rolle des Endprodukts und der Aspekt, auf<br />
welche Art und Weise Karten nach ihrer Produktion<br />
innerhalb einer Gesellschaft zirkulieren und verwendet<br />
werden. Auch Karten können letztlich kein exaktes<br />
Abbild der Wirklichkeit darstellen; sie können nur<br />
ein Abbild, eine Interpretation dieser sein und als solche<br />
müssen sie auch gelesen werden.<<br />
1 Aktuell insbesonders in Filmen<br />
zum Thema Frontex,<br />
Vgl zum Beispiel „FRONTEX:<br />
the movie 2.0“, www.youtube.com/watch?v=Pk0SAPqLUJI"http://www.youtube.co<br />
m/watch?v=Pk0SAPqLUJI<br />
2 Zum Beispiel „In this<br />
world“ von Michael Winterbottom<br />
(GB, 2002) oder<br />
„Mirages“ von Olivier Dury<br />
(F, 2008).
Spiel mit <strong>Grenze</strong>n*<br />
*mit räumlichen, körperlichen, sozialen und staatlichen, mit vernünftigen, normalisierenden, wahnsinnigen.<br />
Wir sind eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, die seit einiger Zeit theoretisch und praktisch zum<br />
Thema <strong>Grenze</strong> arbeiten. Wir versuchen die Abgrenzungen, Ausgrenzungen, Eingrenzungen und Begrenzungen<br />
zu verstehen, die sich anhand unterschiedlicher Diskurse, Orte, Dinge und Praktiken manifestieren<br />
und die durch die Praxis des Überschreitens sowohl reproduziert als auch in Frage gestellt werden. Wir<br />
gehen der Frage nach, wie mit Hilfe von <strong>Grenze</strong>n Macht ausgeübt wird, Hierarchien hergestellt und Kräfteverhältnisse<br />
reguliert werden.<br />
Film: Spiel mit <strong>Grenze</strong>n<br />
Workshop Ladyfest München 2010<br />
... <strong>Grenze</strong> hat erst mal was abschreckendes ... also<br />
ich finde es gibt ja meine persönlichen <strong>Grenze</strong>n, die<br />
ich ja gewahrt haben möchte und Grenzüberschreitungen<br />
die für mich überhaupt nicht positiv sind ...<br />
das ist mein Wort: Abgrenzen – das finde ich wichtig,<br />
weil es ist wichtig sich und anderen <strong>Grenze</strong>n zu setzen,<br />
um nicht Gefahr zu laufen manipuliert zu werden<br />
... das ist meine <strong>Grenze</strong> und das ist meine Macht<br />
zu bestimmen und festzulegen wo die ist. Aber<br />
manchmal habe ich das Gefühl, dass meine <strong>Grenze</strong><br />
nicht da ist, wo ich sie gerne hin bestimmen möchte<br />
... also ich glaube, wenn man die <strong>Grenze</strong>n anderer<br />
überschreitet, dann wird einem das erst später klar<br />
und dann ist das ein extrem unangenehmes Gefühl ...<br />
ich glaube, dass <strong>Grenze</strong>n immer neu aufgemacht<br />
werden ... ich kann Menschen einteilen in Frauen<br />
und Männer aber das muss nicht unbedingt eine<br />
große Konsequenz haben ... was ist das für eine<br />
Sorge wie ich eingeordnet werde, werde ich jetzt als<br />
Frau eingeordnet oder als Mann wahrgenommen oder<br />
grenze<br />
Foto: Carl Obereisenbuchner (cc)
56<br />
grenze<br />
als Freak... <strong>Grenze</strong>n ziehen hat oft etwas mit Ausschluss<br />
von anderen zu tun ... ich fänd‘s auch schwer<br />
mir vorzustellen, was wäre, wenn es keine <strong>Grenze</strong>n<br />
geben würde. vor allem in Bezug auf Geschlechtergrenzen.<br />
Einerseits ist es schon so meine Idealvorstellung<br />
oder so ne Utopie, dass es wahnsinnig toll wäre,<br />
wenn es sie nicht geben würde, andererseits macht<br />
es mir total Spaß sie zu übertreten und damit zu spielen<br />
und zu provozieren...<br />
Der Film ist zu sehen unter:<br />
www.oeku-buero.de/grenzen.html<br />
Mach[t] Platz!<br />
Gärtnerplatz im Juni 2009<br />
Zwölf mit Warnwesten bekleidete Aktivistinnen und<br />
Aktivisten beginnen den Gärtnerplatz mit rot-weißen<br />
Bändern abzusperren. Sie wirken routiniert und gelassen.<br />
Die Aktion dauert höchstens fünf bis zehn Minuten<br />
– genug, um den kompletten<br />
Platz mit Bank, Bäumen und<br />
Bronzebüste von Friedrich von<br />
Gärtner großzügig rot-weiß zu<br />
verzieren. Erst bei näherem<br />
Betrachten fällt auf, dass die<br />
Absperrbänder beschriftet sind:<br />
„<strong>Grenze</strong>“ / „ausgrenzen“ / „entgrenzen“<br />
/ „Traust Du dich weiter?“ / „Sicherheit“ /<br />
„Rassismus“. Die Warnwesten sichern der Gruppe<br />
zunächst einen seriösen Auftritt, verweist doch die<br />
Kleidung auf das Bild von städtischen Bauarbeiterinnen<br />
und Bauarbeitern. Doch irgendwie agieren die<br />
Beteiligten seltsam. Wieso besteigen diese zwei<br />
Damen die Büste von Friedrich von Gärtner? Warum<br />
werden Mülleimer mit Flatterband umwickelt? Diese<br />
Überschreitung einer unsichtbaren Zeit-Raum-Konstante,<br />
in der die Aktivistinnen und Aktivisten Flugblätter<br />
an die vorbeigehenden Leute verteilen, führt<br />
zum Bruch mit der Erwartung hier arbeitende Personen<br />
zu beobachten. „Es gibt nichts Natürliches an der<br />
<strong>Grenze</strong>, sie ist ein höchst konstruierter Ort, der durch<br />
über-schreitende Leute reproduziert wird, denn ohne<br />
das Überschreiten haben wir keine <strong>Grenze</strong>. Dann ist<br />
sie nur eine imaginäre Linie, ein Fluss oder einfach<br />
eine Wand.“ (Bertha Jottar) – lesen Interessierte auf<br />
den zu Flyern umfunktionierten Absperrbändern. Das<br />
„Theater“ entlarvt sich selbst. Einige Passantinnen und<br />
Passanten werden aufmerksam. Die Gruppe wird<br />
angesprochen, eine Genehmigung wird gefordert. Ein<br />
Mann zückt sein Handy. Auf schnellem Wege räumen<br />
die Aktivistinnen und Aktivisten das Feld.<br />
Die Aktion „Macht Platz – Gärtnerplatz!“, die von der<br />
Es gibt nichts Natürliches an<br />
der Grenz, sie ist ein höchst konstruierter<br />
Ort.<br />
Aktion Grenzposten veranstaltet wird, beraubt den<br />
Gärtnerplatz für zwei Stunden seiner funktionalen<br />
Öffentlichkeit und stellt eine andere Öffentlichkeit<br />
bereit. Die funktionale und institutionell gekennzeichnete<br />
Öffentlichkeit (Bänke, gepflegte Blumen und<br />
Beete) wird durch die Absperrbänder verhindert. Die<br />
Bank wird als Gefahrenzone markiert, statt Beruhigung<br />
übernimmt Unruhe die Gedanken. Was machen<br />
die denn da? Verstärkt durch die Gedankenfetzen auf<br />
den Absperrbändern aktiviert diese Intervention in<br />
dem öffentlichen Raum Grenzziehungen, die man im<br />
Alltag vornimmt: Ein verliebtes Pärchen auf der Parkbank<br />
ist in Ordnung, zehn Pärchen, die Flaschenbier<br />
trinken und auf der Wiese liegen nicht mehr – ein<br />
alter Herr, der für einen halben Tag Rast auf einer<br />
Bank macht, ist in Ordnung, eine Obdachlose eine<br />
Bank weiter, die sich zum Schlafen für die Nacht<br />
bereitet, nicht usw. Zugleich stellt die Aktion den<br />
Gärtnerplatz als öffentlichen Raum in Frage. Statt Aufenthalt<br />
und Entspannung anzubieten, warnen die<br />
Absperrbänder davor, den Platz zu betreten. Die Textstücke<br />
auf den rot-weißen Bän-<br />
dern rahmen einen neuen<br />
öffentlichen Raum, der zu flüstern<br />
scheint: Wen grenzen wir<br />
jenseits des Gärtnerplatzes noch<br />
aus? Welche rassistischen <strong>Grenze</strong>n<br />
gibt es in der Gesellschaft?<br />
Welche unausgesprochenen<br />
Normen durchziehen den öffentlichen Raum und<br />
schränken unsere Bewegungsfreiheit ein?<<br />
[Auszug aus einem Text von Julia Jäckel: Von Kampffliegern<br />
in der Fußgängerzone und Piratensendern in der Tagesschau.<br />
Wie sich öffentliche Räume und Gegenöffentlichkeiten<br />
herstellen können, in: Zara Pfeiffer (Hg.): Auf den Barrikaden.<br />
Proteste in München seit 1945, München 2011]
<strong>Grenze</strong>n des Wachstums<br />
Pflanzen sind in einer vom Klimawandel gebeutelten Welt die Antwort auf alle Fragen – zumindest auf<br />
sehr viele. Pflanzliche Energie als Alternative zu fossilen Brennstoffen, gentechnisch veränderte Pflanzen,<br />
die verseuchte Böden wieder in saubere Flächen verwandeln sollen oder Pflanzen, deren Wasserverwertung<br />
effizienter ist und die so weniger zusätzliche Bewässerung brauchen. Die <strong>Grenze</strong>n des Wachstums,<br />
die sich der ökonomischen Entwicklung in Form von Natur in den Weg stellen, sollen mit effizienteren,<br />
mit ertragreicheren oder sonst wie besser angepassten Pflanzen überwunden werden.<br />
Von Barbara Brandl<br />
grenze
58<br />
grenze<br />
Sieht man sich die Geschichte der Industrialisierung<br />
der landwirtschaftlichen Produktion an,<br />
entdeckt man viele dieser <strong>Grenze</strong>n, aber auch<br />
wie es immer wieder gelang diese natürlichen <strong>Grenze</strong>n<br />
durch technische Innovationen zu überwinden.<br />
Jedoch tauchten – oft an anderen Stellen – neue,<br />
durch die Natur selbst hervorge-<br />
brachte <strong>Grenze</strong>n auf, für deren<br />
Überwindung dann erneut technische<br />
Lösungen gesucht werden,<br />
beispielsweise die Produktivität<br />
des derzeit verwendeten<br />
Saatguts, die nun mit Hilfe der<br />
Molekularbiologie gesteigert<br />
werden soll. So ist der Leitspruch<br />
vieler Projekte und Initiativen,<br />
ob sie nun den Welthunger<br />
bekämpfen oder für saubere<br />
Energie sorgen wollen: Pflanzen, fit für die Zukunft,<br />
sollen her! Für die Entwicklung von „zukunftstauglichen“<br />
Pflanzen nehmen staatliche Institutionen, globale<br />
Life-Science-Konzerne und auch die Vermischung<br />
aus beiden – mit, neutral gesagt, unklaren<br />
Interessenlagen – sowie die Private-Public-Partnerships<br />
viel Mühe und vor allem hohe Kosten in Kauf.<br />
Mit ‚zukunfts-fitten‘ Pflanzen sind landwirtschaftliche<br />
Nutzpflanzen gemeint, welche sich an durch Klimawandel<br />
oder Rohstoffknappheit veränderte Umweltbedingungen<br />
der landwirtschaftlichen Produktion besser<br />
anpassen können. Womit schlicht gemeint ist,<br />
dass die Pflanzen ohne Ertragseinbußen Ernte produzieren.<br />
So gibt es beispielsweise Programme zum Entwickeln<br />
von Maissorten, die trotz Dürre und Hitze ihren<br />
Ertrag ausbilden. Reissorten sollen gezüchtet werden,<br />
die den neuerdings stärkeren Regenfällen trotzen<br />
oder Weizensorten, die mehr von dem knapp werdenden<br />
Düngemittel Nitrat verwerten können.<br />
Umwelteinflüsse, die sich auf die Entwicklung von<br />
Pflanzen, vor allem deren Früchte, schädlich auswirken,<br />
bezeichnet die Biologie als „abiotischen Stress“.<br />
Damit sind Belastungen für die Pflanzen gemeint wie<br />
Dürre, versalzene Böden oder Hitze, die nicht durch<br />
Krankheiten (biotischer Stress) erzeugt werden. Saatgut<br />
für besonders dürre- oder hitzeresistente Pflanzen<br />
oder für Pflanzen, die trotz versalzener Böden und<br />
überfluteter Landstriche ihren Ertrag produzieren, ist<br />
in den letzten Jahren die (PR-) Strategie aller großen<br />
Saatgutkonzerne sowie das Losungswort der Entwicklungshilfe,<br />
die sich auf ländliche Gebiete spezialisiert<br />
hat.<br />
Die gesteigerte Produktivität<br />
eigneten sich fast ausschließlich<br />
die Länder des Nordens an,<br />
während die negativen Folgen der<br />
industrialisierten Landwirtschaft<br />
in den Ländern des Südens<br />
verblieben.<br />
Gigantische Ertragssteigerungen<br />
– die Industrialisierung der Landwirtschaft<br />
Die Geschichte der modernen Pflanzenzüchtung ist<br />
die Geschichte eines ungeheuren Erfolgs – wenn man<br />
diesen in quantitativen Ertragszuwächsen misst: Die<br />
Entdeckung des Stickstoffes in<br />
seiner Funktion als Kunstdünger<br />
gegen Ende des 19. Jahrhunderts<br />
sowie wegweisende<br />
Erkenntnisse aus dem Bereich<br />
der Pflanzengenetik, die maßgeblich<br />
zur Entwicklung der<br />
Hochleistungssorten beitrugen,<br />
führten dazu, dass der Ertrag bei<br />
einzelnen Fruchtarten (beispielsweise<br />
Mais) bis zu 300 Prozent<br />
gesteigert werden konnte. Diese<br />
Sorten sind somit extrem ertragreich, jedoch im Vergleich<br />
zum Wildtyp der Pflanze nicht besonders<br />
widerstandsfähig. Sie brauchen deshalb zusätzliche<br />
Input-Faktoren wie zusätzliche Bewässerung oder<br />
Agrochemie (beispielsweise Herbizide). Die größten<br />
Ertragssteigerungen erreichte man mit dem so<br />
genannten „Hybridsaatgut“. Hybridsorten sind Sorten,<br />
die durch die Kreuzung von zwei unterschiedlichen<br />
reinerbigen (homozygoten) Inzuchtlinien entstehen.<br />
Die erste Generation ist dann besonders ertragreich,<br />
die nachfolgenden Generationen jedoch in der Regel<br />
weniger. Aufgrund dieser spezifischen Eigenschaften<br />
von Hybridsorten sind Bauern und Bäuerinnen<br />
gezwungen, ihr Saatgut jedes Jahr neu zu kaufen. Bei<br />
einzelnen Fruchtarten wie zum Beispiel Mais oder<br />
Reis liegt der Anteil an Hybridsorten bei über 80 Prozent.<br />
Die Kehrseite dieser immensen Ertragssteigerungen<br />
war, dass die Bauern sich immer stärker von<br />
industriellen Gütern wie Düngemitteln, industriell<br />
hergestelltem Saatgut oder der Agrochemie (etwa in<br />
Form von Herbiziden oder Pestiziden) abhängig<br />
machten. Zudem waren sie immer stärker auf stetig<br />
knapper werdende Rohstoffe wie Wasser oder Nitrate<br />
angewiesen. Außerdem beschränkte sich die landwirtschaftliche<br />
Produktion auf immer weniger Fruchtarten,<br />
die so genannten ‚major crops‘ (Mais, Soja,<br />
Baumwolle oder Raps), da sie sich besonders für eine<br />
industrialisierte Form der Landwirtschaft eignen. Die<br />
Züchtungsforschung der Saatgutkonzerne und zunehmend<br />
auch die Forschung der staatlichen Institute<br />
konzentrieren sich nun in erster Linie auf die genannten<br />
Fruchtarten, während sie andere, kommerziell<br />
weniger interessante wie Hirse oder Hafer systematisch<br />
vernachlässigt.
Der politische Ausdruck für diese Entwicklungen, die<br />
insbesondere die Vereinigten Staaten vorantrieben, ist<br />
die „Green Revolution“. Die landwirtschaftliche Produktion<br />
in den Ländern des<br />
Südens wurde durch die Maßnahmen,<br />
die im Zuge dieser<br />
Programme ab den 1950er Jahren<br />
stattfanden, in ungeheurem<br />
Maße produktiver. Die gesteigerte<br />
Produktivität eigneten sich<br />
jedoch fast ausschließlich die<br />
Länder des Nordens an, während<br />
die negativen Folgen der industrialisierten Landwirtschaft<br />
– die ausgelaugten Böden, die Wasserknappheit,<br />
die geschwundene Biodiversität oder die<br />
von der Agroindustrie abhängig gemachte Bauernschaft<br />
– in den Ländern des Südens verblieben und<br />
in der Folge neue Ungleichheitsdynamiken bildeten.<br />
In der Grünen Revolution waren die Hochleistungssorten<br />
Teil der entscheidenden technischen Innovationen,<br />
die eine stark industrialisierte Form der Landwirtschaft<br />
möglich machten. Eine weitere Technologie,<br />
welche die Pflanzenzüchtung und damit die landwirtschaftliche<br />
Produktion nachhaltig veränderte, war<br />
die Mitte der 1980er Jahre entstehende Grüne Gentechnik.<br />
Deren molekularbiologische Methoden<br />
ermöglichten es, transgene Pflanzen herzustellen, also<br />
Pflanzen, bei denen ein einzelnes oder mehrere (in<br />
der Regel aber wenige) Gene der pflanzlichen DNA<br />
verändert wurden. Aktuell werden allerdings nur<br />
transgene Nutzpflanzen kommerziell und in großem<br />
Maßstab angebaut, die entweder resistent gegen Herbizide<br />
oder/und resistent gegen bestimmte Schadinsekten<br />
sind. Der kommerzielle Anbau von transgenen<br />
Pflanzen beschränkt sich dabei weitgehend auf die<br />
kommerziell wichtigen Pflanzen wie Mais, Soja, Raps<br />
und Baumwolle sowie fast ausschließlich auf USA,<br />
Kanada, die Länder Lateinamerikas (vor allem Argentinien<br />
und Brasilien) und teilweise auch Indien und<br />
China.<br />
Die Verwandlung von Feldern und Äckern<br />
in global vereinheitlichte Areale<br />
Die umfassende Einführung von Hochleistungssorten<br />
veränderte die landwirtschaftliche Produktion auf<br />
schwer wiegende Weise. Um die Tiefe dieses Einschnittes<br />
zu verstehen, sei darauf verwiesen, dass bis<br />
in die Mitte des 19. Jahrhunderts die Pflanzenzüchtung<br />
größtenteils in der Hand der Bauernschaft lag.<br />
Sie wählten aus den in ihren Gärten und Äckern<br />
angebauten Pflanzen diejenigen aus, welche die<br />
gewünschten Eigenschaften am stärksten ausgeprägt<br />
hatten und brachten die Samen im nächsten Jahr wie-<br />
Ende der 1980er Jahre avancieren<br />
die großen Saatgutkonzerne wie<br />
Monsanto oder Syngenta zu<br />
bedeutenden Playern.<br />
der neu aus. Durch dieses Vorgehen entstanden im<br />
Laufe der Jahrhunderte viele unterschiedliche Landsorten,<br />
die an die jeweilige lokale Region angepasst<br />
waren. In diesem Sinne brachte<br />
die Grüne Revolution nicht nur<br />
neues Saatgut mit sich, sondern<br />
auch eine andersartige Logik<br />
der landwirtschaftlichen Produktion,<br />
die ihrerseits vollständig<br />
der industriellen Produktion von<br />
Nahrungsmitteln verpflichtet<br />
war. Der Prozess der Pflanzenzüchtung<br />
hatte nun nicht mehr das Ziel, Sorten zu<br />
entwickeln, die optimal an die jeweilige Region anzupassen<br />
waren, sondern die Entwicklung verkehrte<br />
sich ins Gegenteil. Die Äcker und Felder wurden<br />
durch zusätzliche Bewässerung und durch den Einsatz<br />
von Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln<br />
für den Einsatz der in Gewächshäusern und Laboren<br />
entstanden Hochleistungssorten konfiguriert. Es fand<br />
eine Kolonialisierung der Natur durch die Technik<br />
statt, wie der Soziologe Bruno Latour sagen würde.<br />
Oder um es anders zu sagen, der Kapitalismus konfigurierte<br />
die Landwirtschaft und stellt damit seine<br />
eigene Reproduktion sicher.<br />
Kapitalistische Logik der<br />
landwirtschaftlichen Produktion<br />
Ein weiter Aspekt, den die Industrialisierung der<br />
Landwirtschaft mit sich brachte war, dass sich die<br />
landwirtschaftliche Produktion zunehmend arbeitsteilig<br />
organisierte und zugleich immer mehr Bereiche<br />
der landwirtschaftlichen Produktion einer kapitalistischen<br />
Logik unterworfen wurden. Mit der Etablierung<br />
von Märkten für Saatgut wurden Güter, die vorher<br />
– wenn überhaupt – nur unter Nachbarinnen und<br />
Nachbarn getauscht wurden, zur Ware, die auf dem<br />
Markt gekauft werden muss. Ist die Grüne Gentechnik<br />
als Fortführung der mit dieser Entwicklung verbunden<br />
Logik zu verstehen? Einerseits, und dies ist<br />
wohl die offensichtliche Antwort: Ja. Die Herbizidresistenz<br />
als erstes und (kommerziell) wichtigstes Produkt<br />
der Grünen Gentechnik entspringt voll und ganz<br />
der Logik einer bis ins Extrem getriebenen Form der<br />
industrialisierten Landwirtschaft. Durch die Einführung<br />
von herbizidresistentem Saatgut stehen sich der<br />
maximale Einsatz von Technik und der minimale Einsatz<br />
von menschlicher Arbeitskraft gegenüber. Die<br />
Felder, die mit herbizidresistentem Saatgut bestellt<br />
werden, müssen meist nicht einmal mehr gepflügt<br />
werden, was besonders im US-amerikanischen Kontext<br />
aufgrund der hohen Bodenerosion ein Vorteil ist.<br />
Durch die Komplementarität der Güter und Herbizide<br />
grenze
60<br />
grenze<br />
Barbara Brandl<br />
ist Diplom-Soziologin<br />
und wissenschaftlicheMitarbeiterin<br />
am Institut für<br />
Soziologie der LMU<br />
München.<br />
erreichte die Abhängigkeit der Bauern und Bäuerinnen<br />
von industriellen Produkten ein nie geahntes<br />
Ausmaß. War das Wissen über<br />
die Pflanzenzüchtung zur Zeit<br />
der Grünen Revolution noch<br />
hauptsächlich in staatlichen<br />
Institutionen wie Universitäten<br />
gebunden, ändert sich dies unter<br />
der global durchgesetzten neoliberalen<br />
Agenda. Nun ist auch<br />
das zur Herstellung von Saatgut<br />
nötige Wissen warenförmig organisiert. Die großen<br />
Saatgutkonzerne wie Monsanto oder Syngenta avancierten<br />
in dieser Zeit Ende der 1980er Jahre zu<br />
bedeutenden Playern. Dies gelang ihnen einerseits,<br />
indem sie in ihren Unternehmen riesige Abteilungen<br />
für Forschung und Entwicklung aufbauten und so<br />
einen großen Teil der Wissensproduktion, der vormals<br />
an öffentlichen Universitäten stattfand, in ihre<br />
Konzerne integrierten. Monsanto und Co. kauften<br />
jedoch auch die meisten mittelständischen Pflanzenzüchtungsbetriebe<br />
in den USA auf, um sich den<br />
Zugang zum genetischen Material zu sichern.<br />
Eine Fair-Use-Bewegung der Grünen Gentechnik?<br />
Anderseits, und dies ist der zweite Teil der Antwort:<br />
Ist nicht die Bewertung von Umweltfaktoren wie<br />
Hitze, Trockenheit oder Überflutung als die entscheidenden<br />
Determinanten für landwirtschaftliche Produktion,<br />
ein Hinweis auf eine Entwicklung in eine<br />
andere Richtung? Geht es bei der Entwicklung von<br />
dürre- oder hitzeresistentem Saatgut nicht darum, den<br />
regionalen oder den natürlichen Gegebenheiten wieder<br />
mehr Gewicht beizumessen, anstatt die Natur mit<br />
allen Kräften durch Technik und den übermäßigen<br />
Einsatz von Rohstoffen aus der landwirtschaftlichen<br />
Produktion auszuschließen? Auch auf diese Frage ist<br />
die Antwort: Ja, jedoch mit einem großen Aber. Denn<br />
die Entwicklung dieses Saatguts (ob gentechnisch verändert<br />
oder nicht) findet in einem vorstrukturierten<br />
Raum statt. Zum Einen ist die Saatgutbranche eine<br />
der am stärksten konzentrierten Branchen weltweit.<br />
Machten 1985 die zehn größten Saatgutkonzerne<br />
zusammen einen Anteil von unter 20 Prozent am<br />
Markt für geschütztes Saatgut aus, waren es im Jahr<br />
2007 bereits 67 Prozent. Betrug der Anteil der drei<br />
größten Konzerne Monsanto, Dupont (beide USA)<br />
und Syngenta (Schweiz) 1985 noch ungefähr 7 Prozent,<br />
war dieser bis zum Jahr 2007 auf 47 Prozent<br />
angestiegen. Zum Anderen unterwerfen sich die Universitäten<br />
zunehmend dem Regime der Wettbewerbsfähigkeit<br />
und damit dem Ziel, vor allem für den<br />
Markt verwertbares Wissen zu produzieren. So konn-<br />
Universitäten unterwerfen sich<br />
zunehmend dem Regime der Wettbewerbsfähigkeit<br />
und damit dem<br />
Ziel, für den Markt verwertbares<br />
Wissen zu produzieren.<br />
ten einige Studien aus dem US-amerikanischen Kontext<br />
zeigen, dass die Forschung an kommerziell unin-<br />
teressanten Pflanzen sowie an<br />
kommerziell uninteressanten<br />
pflanzlichen Eigenschaften in<br />
den letzten zehn Jahren stark<br />
rückläufig war und dass sich in<br />
diesem Sinne die Forschungsprofile<br />
von staatlicher und privatwirtschaftlicher<br />
Forschung<br />
stark angeglichen haben. Insofern<br />
ist zu fragen, in welchem Umfang tatsächlich an<br />
dürre- oder hitzeresistentem Saatgut geforscht wird,<br />
oder an Kulturarten, die zwar für die Ernährung<br />
wichtig sind, jedoch kommerziell wenig rentabel wie<br />
beispielsweise Hirse. Laut einer Schätzung von Nature<br />
Biotechnology über die Züchtungsziele von transgenen<br />
Pflanzen zwischen 2008 und 2015 ist die Toleranz<br />
gegenüber abiotischem Stress in nur 5 Prozent<br />
der Fälle ein Züchtungsziel, während Insektenresistenz<br />
mit 45 Prozent das wichtigste Züchtungsziel ist,<br />
gefolgt von der Resistenz gegen Herbizide mit 25 Prozent.<br />
Trotz all dem sichern sich die großen Konzerne<br />
schon mal vorsorglich die Rechte auf die so genannte<br />
klimarelevante Gene. Bereits im Jahr 2008 gab es<br />
über 500 Patentanmeldungen auf Gene oder Gensequenzen,<br />
die als „klimarelevant“ eingestuft wurden,<br />
also beispielsweise auf Gensequenzen, die den Wasserhaushalt<br />
in einer Pflanze regeln. Zwei Drittel dieser<br />
Anträge kamen, wie eine Studie der ETC-Group –<br />
eine international arbeitende NGO im Agrarbereich –<br />
zeigen konnte, von Monsanto oder BASF.<br />
Wie aber wäre es mit der Etablierung einer Fair-Use-<br />
Bewegung der Grünen Gentechnik? Also nach dem<br />
Vorbild der Fair-Use-Bewegung im Software-Bereich:<br />
Biologen und Biologinnen, Agrarwissenschaftler und<br />
Agrarwissenschaftlerinnen oder Pflanzenzüchter und<br />
Pflanzenzüchterinnen, die Saatgut entwickeln, das<br />
wirklich gebraucht wird, nicht durch Patente<br />
geschützt ist und so von allen weiterentwickelt werden<br />
kann.
Ungenügend<br />
Zu Beginn dieses Jahres wurden mit sofortiger Wirkung wesentliche Teile des sogenannten Transsexuellengesetzes<br />
außer Kraft gesetzt. Das Gesetz verletze das Recht auf körperliche Unversehrtheit, urteilte<br />
das Bundesverfassungsgericht. Gleichzeitig schwächt das Urteil aber andere wichtige Rechte transsexueller<br />
Menschen. Von Till Schmidt<br />
Im Januar 1981 führte die Bundesrepublik<br />
Deutschland das so genannte Transsexuellengesetz<br />
ein. Zustande gekommen durch eine Entscheidung<br />
des Bundesverfassungsgerichts, wurden<br />
damit zwei Verfahren für Transsexuelle – Menschen,<br />
deren eigentliches Geschlecht nicht ihrem genitalen<br />
Geschlecht entspricht, auf Grund dessen sie bei der<br />
Geburt geschlechtlich eingeordnet wurden – festgelegt:<br />
Eine „kleine Lösung“, durch die der Vorname<br />
geändert werden konnte, und eine „große Lösung“,<br />
die eine rechtliche Anerkennung als Mann beziehungsweise<br />
Frau erwirkte. Gekoppelt wurde eine<br />
Anerkennung an verschiedene Bestimmungen, die<br />
seitdem jedoch teilweise abgeschafft beziehungsweise<br />
entschärft wurden. Menschen, die unmittelbar nach<br />
der Einführung 1981 ihr eigentliches Geschlecht ins<br />
Personenstandsregister eintragen lassen wollten, mussten<br />
unter anderem älter als 25 Jahre, unverheiratet<br />
und „dauerhaft fortpflanzungsunfähig“ sein. Ein Jahr<br />
später, 1982, wurde die Altersgrenze von 25 Jahren<br />
aufgehoben, 2008 die Ehelosigkeit als Voraussetzung<br />
für die rechtliche Anerkennung. Im Januar 2011 fällte<br />
das Karlsruher Gericht ein weiteres Grundsatzurteil.<br />
Von nun an müssen Transsexuelle, die nicht nur den<br />
Vornamen ändern, sondern in ihrem eigentlichen<br />
Geschlecht auch rechtlich anerkannt werden wollen,<br />
endlich nicht mehr unter das Skalpell: Der Zwang zur<br />
geschlechtsangleichenden Operation und dauerhaften<br />
Fortpflanzungsunfähigkeit wurde mit sofortiger Wir-<br />
kung aufgehoben – wenn auch gegen die Stimmen<br />
von zwei der acht Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter.<br />
Die operative Geschlechtsanpassung, durch die etwa<br />
bei Trans-Frauen der Penisschaft und Hoden amputiert<br />
sowie äußere primäre weibliche Geschlechtsorgane<br />
hergestellt werden, sollte bisher als Garantie für<br />
„die Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit“ der Transsexualität<br />
herhalten. Mit der Operation verknüpft war<br />
eine lebenslange Hormontherapie, die gesundheitliche<br />
Risiken wie zum Beispiel erhöhtes Thrombose-<br />
Risiko, Diabetes und Leberschäden einschließt. Dieser<br />
unmenschliche Zwang verletzte das Recht auf körperliche<br />
Unversehrtheit dreißig Jahre lang.<br />
Schwule Frauen, lesbische Männer<br />
Bezeichnend ist, dass es meist von den diskriminierenden<br />
gesetzlichen Bestimmungen direkt Betroffene<br />
waren, die über eine erfolgreiche Klage vor dem Verfassungsgericht<br />
die Parlamente dazu zwangen, das<br />
„Transsexuellengesetz“ Schritt für Schritt zu reformieren.<br />
Das war auch im jüngsten Fall so. Anlass für die<br />
Entscheidung vom Januar dieses Jahres war die Klage<br />
einer 62-jährigen Trans-Frau aus Berlin. In ihrem<br />
Selbstverständnis als Homosexuelle wollte sie mit<br />
ihrer Partnerin eine eingetragene Lebenspartnerschaft<br />
eingehen. Diese wurde der Berlinerin aber durch das<br />
grenze
62<br />
grenze<br />
Zusätzliche Informationen<br />
finden sich<br />
auf der Hompepage<br />
der NGO Aktion<br />
Transsexualität und<br />
Menschenrecht,<br />
unter anderem auch<br />
deren aktueller Menschenrechtsbericht<br />
„Transsexuelle Menschen<br />
in Deutschland“:http://atmeev.de/<br />
Till Schmidt<br />
lebt und studiert in<br />
München.<br />
Standesamt verweigert. Zwar hatte sie nach den<br />
gesetzlichen Vorschriften der „kleinen Lösung“ ihre<br />
Vornamen in weibliche umändern lassen, personenstandsrechtlich<br />
galt sie jedoch<br />
immer noch als Mann. Anstatt<br />
der Lebenspartnerschaft wäre<br />
somit nur eine – hierzulande<br />
freilich heterosexuell konnotierte<br />
– Eheschließung möglich gewesen;<br />
es sei denn, die 62-Jährige<br />
hätte eine teure und nicht ungefährlichegeschlechtsangleichende<br />
Operation durchführen lassen. Das wollen entgegen<br />
gängiger Klischees allerdings nicht alle transidentitären<br />
Personen.<br />
Wie eine solche Eheschließung durchaus enden<br />
konnte, verdeutlicht der Fall einer Trans-Frau aus<br />
dem Jahr 2005. Mit der Begründung, dass es keine<br />
„lesbischen Männer“ geben könne, verwehrte ihr das<br />
Hamburger Standesamt die eingetragene Lebenspartnerschaft.<br />
Nachdem sie eine Ehe einging, um ihre<br />
Beziehung rechtlich abzusichern, wurde die Vornamensänderung<br />
– für die die Frau zwei teure, zeitund<br />
arbeitsaufwendige Gutachten aufweisen musste,<br />
die garantieren sollten, dass sie „sich dem anderen<br />
Geschlecht zugehörig empfindet“, „seit mindestens<br />
drei Jahren unter Zwang steht, ihren Vorstellungen<br />
entsprechend zu leben“ und sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />
[...] ihr Zugehörigkeitsempfinden zum<br />
anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird“ –<br />
jedoch wieder rückgängig gemacht. Die Begründung:<br />
Wenn jemand eine Frau heirate, könne sich die Person<br />
nicht mehr als Frau „fühlen“. Damit sei auch die<br />
Vornamensänderung hinfällig.<br />
Von „Neigungen“ und „Veranlagungen“<br />
Diese heteronormative Konzeption von Geschlecht<br />
und Begehren trifft sich in ihrer Logik mit der<br />
Begründung der vermeintlichen Notwendigkeit<br />
geschlechtsangleichender Operationen. Dem Entwurf<br />
des „Transsexuellengetzes“ der damaligen Bundesregierung<br />
zufolge wäre es etwa „nicht angängig [...]<br />
jemandem die Eheschließung mit einer anderen Person<br />
männlichen Geschlechts zu ermöglichen, solange<br />
er sich geschlechtlich noch als Mann betätigen kann“.<br />
Stärker transphob äußerte sich der Bundesrat in seiner<br />
Stellungnahme. Er hielt dazu an, die gesetzliche<br />
Möglichkeit einer Vornamenswahl in keinem Fall so<br />
zu konzipieren, dass sie „transsexuelle Neigungen fördert“.<br />
Ohnehin führe die „kleine Lösung“ dazu, dass<br />
„Personen, bei denen eine gewisse transsexuelle Veranlagung<br />
vorhanden ist, voreilig den ‚Umstieg’ zum<br />
Transsexuelle gelten nach wie vor<br />
als krankhaft und von der Norm<br />
abweichend.<br />
anderen Geschlecht versuchen, obwohl andere Auswege<br />
gegeben wären“.<br />
An der in diesem Statement enthaltenen<br />
Pathologisierung von<br />
Transsexualität hat sich heute,<br />
knapp dreißig Jahre später,<br />
nichts geändert – erst Recht<br />
nicht durch das jüngste Urteil<br />
des Bundesverfassungsgerichts.<br />
Menschen, deren eigentliches<br />
Geschlecht nicht ihrem genitalen<br />
Geschlecht, auf Grund dessen sie bei der Geburt<br />
eingeordnet wurden, entspricht, gelten nach wie vor<br />
als krankhaft und von der Norm abweichend. Davon<br />
zeugt nicht zuletzt die Aufführung von Transsexualität<br />
als vermeintliche „Geschlechtsidentitätsstörung“ in der<br />
„Internationalen Klassifizierung von Krankheiten“ der<br />
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Eingeordnet<br />
unter der Rubrik „psychische und Verhaltensstörungen“,<br />
war sie übrigens lange Zeit auch neben der<br />
Homosexualität gelistet, die Anfang der 1990er aus<br />
dem wichtigsten, weltweit anerkannten Diagnoseklassifikations-<br />
und Verschlüsselungssystem der Medizin<br />
entfernt wurde.<br />
Barbie und Ken<br />
Die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts<br />
ist nichtsdestotrotz natürlich ein Erfolg. Als<br />
„einen Schritt in die richtige Richtung“, wertete das<br />
Urteil auch Kim Schicklang von der Aktion Transsexualität<br />
und Menschenrecht e.V. Dennoch betonte die<br />
NGO in einer Pressemitteilung, dass das Bundesverfassungsgericht<br />
durch sein Urteil zugleich aber andere<br />
wichtige Rechte transsexueller Menschen schwäche.<br />
Neben dem eindeutigen Festhalten an der Psychopathologisierung<br />
von Transsexualität kritisierte die Menschenrechtsorganisation<br />
das stereotype Geschlechterbild<br />
des Verfassungsgerichts. Im Kleingedruckten des<br />
Urteils, das in der ohnehin dünnen Medienberichterstattung<br />
meist unberücksichtigt blieb, heißt es – ganz<br />
dem Barbie-und-Ken-Geschlechterbild verhaftet: „Für<br />
ein Leben des Betroffenen [sic!] im anderen<br />
Geschlecht ist eine Angleichung seiner äußeren<br />
Erscheinung und Anpassung seiner Verhaltensweise<br />
an sein empfundenes Geschlecht erforderlich. Dies<br />
wird zunächst nur durch entsprechende Kleidung,<br />
Aufmachung und Auftretensweise herbeigeführt, um<br />
im Alltag zu testen, ob ein dauerhafter Wechsel der<br />
Geschlechterrolle psychisch überhaupt bewältigt werden<br />
kann.“
Mythen vom Chinesen-Maier<br />
Der brutale Krieg einer multinationalen Kolonialarmee in China 1900/01 wurde als zivilisatorische europäische<br />
und nationale Mission bejubelt. Die Vereine der Kolonialkriegsveteranen spielten noch Jahrzehnte<br />
nach Verlust der Kolonien eine wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung sowohl militärischer Mythen<br />
als auch kolonialer Propaganda. Von Martin W. Rühlemann [muc]<br />
„Der Chinesen-Maier hat Geburtstag“ war die Überschrift<br />
eines Artikels im Münchner Merkur am 21.<br />
März 1964. Dass der von seinen Freunden so betitelte<br />
„rüstige alte Herr“ aus dem Münchner Westend an der<br />
Niederwerfung des Boxeraufstandes in China teilgenommen<br />
hatte und nun seinen 85. Geburtstag feierte,<br />
stand dort weiter zu lesen. 1900/01 kämpfte er als<br />
junger Mann in der bayerischen Abteilung des 4. Ostasiatischen<br />
Infanterie-Regiments an der Seite einer<br />
multinationalen Kolonialarmee: „der Amerikaner, der<br />
Franzos’, der Japanes’, der Türk’ und der Engländer“<br />
waren an dieser Streitmacht beteiligt, erzählte der<br />
„einstige Chinakrieger“ und spätere Münchner<br />
Bezirkskaminkehrermeister, was den Autor des<br />
Münchner Merkur an „eine Art vorzeitiger UN“ denken<br />
ließ.<br />
Mission: christliche Expansion<br />
Tatsächlich hatten sich 1900 etliche Kolonialmächte –<br />
darunter auch Russland, Italien und Österreich-<br />
Ungarn – verbündet, um China mit einem für diese<br />
Zeit neuartigen multinationalen Militäreinsatz zu<br />
zwingen, sich entsprechend der westlichen Vorstel-<br />
Foto: [muc] Archiv
64<br />
postkolonial<br />
lungen und Regeln zu verhalten. Die imperialistischen<br />
Mächte Europas hatten sich im „Kampf für die Sache<br />
der Zivilisation und des<br />
Christentums“ vereinigt gegen<br />
„fremdenfeindliche Boxer und<br />
Chinesen“, so lautete die zeitgenössische<br />
Propaganda. Der<br />
Name „Boxer“ leitet sich von<br />
einer Gruppe ab, die an die<br />
Traditionen verschiedener<br />
Faustkampfschulen anknüpfte.<br />
Das chinesische Kaiserreich war keine Kolonie im<br />
klassischen Sinne, vielmehr sicherten sich die verschiedenen<br />
Kolonialmächte ihren Einfluss durch kleine<br />
Stützpunktkolonien. Schon 1889 war die Deutsch-<br />
Asiatische Bank gegründet worden. Den Zugang zum<br />
chinesischen Markt sicherte sich das Deutsche Reich<br />
1897, als deutsche Truppen die nordchinesische<br />
Bucht von Kiautschou mit dem Hafen Tsingtau<br />
besetzten und die Region formal für 99 Jahre pachteten.<br />
Die 50-Kilometer-Zone um die Bucht wurde später<br />
zur „Musterkolonie“ erklärt. Die Inbesitznahme der<br />
neuen Kolonie traf in Deutschland auf breite Zustimmung.<br />
Damit erklärte die Abteilung München der<br />
Deutschen Kolonialgesellschaft etwa auch den<br />
Anstieg ihrer Mitgliederzahlen 1897/98.<br />
Boxerkrieg 1900/01<br />
Seit Sommer 1898 nahmen die Spannungen unter der<br />
bäuerlichen Bevölkerung Nordchinas zu. Hungersnöte<br />
und Auflösungsprozesse der traditionalen chinesischen<br />
Gesellschaftsordnung, vorangetrieben durch<br />
aggressive christliche Missionierung führten dazu,<br />
dass sich ab 1899 die soziale Bewegung der Boxer<br />
schnell in einigen Provinzen Nordchinas ausbreitete.<br />
Sie richtete sich hauptsächlich gegen die wirtschaftliche<br />
Betätigung von Nicht-Chinesen, aber auch gegen<br />
Chinesen christlichen Glaubens.<br />
Dem Widerstand der bäuerlich geprägten Boxerbewegung<br />
gegen die Kolonialmächte schloss sich, nach<br />
anfänglichem unentschlossenem Vorgehen gegen die<br />
Aufständischen, auch die chinesische Regierung am<br />
21. Juni 1900 an.<br />
Demütigungen und Massaker<br />
Die folgende 55-tägige Belagerung des Gesandtschaftsviertels<br />
in Peking durch Boxer und chinesische<br />
Soldaten dauerte bis zum 14. August. Nachdem<br />
Peking erobert, in einer Gewaltorgie geplündert und<br />
ganze Stadtviertel niedergebrannt worden waren,<br />
Die Züge, die die künftigen<br />
„Kolonialkrieger“ in die Hafenstädte<br />
brachten, waren mit<br />
rassistischen Karikaturen von<br />
Chinesen versehen.<br />
begannen die multinationalen Truppen militärische<br />
Strafexpeditionen gegen die Bevölkerung durchzuführen.<br />
Grobe Schätzungen gehen<br />
von 100.000 Menschen aus, die<br />
allein in Peking getötet worden<br />
sind. Der kaiserliche Hof hatte<br />
Peking verlassen und die chinesische<br />
Armee die Kampfhandlungen<br />
eingestellt. Graf von Waldersee,<br />
der deutsche Oberbefehlshaber<br />
der internationalen Armee,<br />
forcierte ab September die Strafexpeditionen, um Mitglieder<br />
der besiegten Boxer aufzuspüren. Bei den<br />
Expeditionen wurden ganze Städte und Dörfer<br />
niedergebrannt, in den schlimmsten Fällen endeten<br />
sie in Massakern. An 35 von 53 Militärexpeditionen,<br />
die zwischen Dezember 1900 und Mai 1901 stattfanden,<br />
nahmen ausschließlich deutsche Truppen teil,<br />
die von der chinesischen Bevölkerung als besonders<br />
brutal und grausam wahrgenommen wurden. Im September<br />
1901 musste die chinesische Regierung dann<br />
einen Vertrag unterzeichnen, der neben demütigenden<br />
Regelungen auch hohe Entschädigungszahlungen<br />
an die beteiligten acht Staaten vorsah.<br />
Heimatfront<br />
„Der Kampf mit den Boxern war sehr hart“, erinnerte<br />
sich der Münchner „Chinakrieger“ 1964. Als letzte<br />
Andenken präsentierte er einen „winzigen Schuh”<br />
und „eine verblichene chinesische Geldbörse und<br />
eine Schärpe“.<br />
Das deutsche Ostasiatische Expeditionskorps bestand<br />
aus Freiwilligen des Heeres, die zusammen mit Marinesoldaten<br />
und in der deutschen Kolonie Kiautschou<br />
stationierten Soldaten über 20.000 Mann der knapp<br />
90.000 alliierten Soldaten ausmachten. Die Anzahl der<br />
Freiwilligen war angeblich weit größer als der Bedarf<br />
gewesen. Die sozialdemokratische Münchener Post<br />
behauptete allerdings, dass viele Soldaten des bayerischen<br />
Bataillons sich nicht freiwillig gemeldet hätten,<br />
was zu empörten Angriffen gegen die „vaterlandslose<br />
Presse“ führte. Ebenso wurden die ersten Berichte<br />
über Plünderungen der multinationalen Truppe während<br />
der Rekrutierungsphase im Juli aufgeregt<br />
zurückgewiesen: „denn es ist bei der deutschen Disziplin<br />
[…] völlig ausgeschlossen, dass deutsche Mannschaften<br />
an solch ehrlosen Treiben theilgenommen<br />
haben! […] Sollte sich die Meldung der Plünderung<br />
Tientsins bestätigen, dann wäre das Ansehen der<br />
‚zivilisirten’ Mächte auf das Schwerste geschädigt“,<br />
stellten die Münchener Neuesten Nachrichten (MNN)<br />
am 25. Juli 1900 fest.
Ausverkauft! Ein Volksfest der Kriegsbegeisterten<br />
Die Verabschiedungen der deutschen Soldaten waren<br />
überschwänglich gefeierte nationale Ereignisse. Die<br />
Züge, die die künftigen „Kolonialkrieger“ aus ganz<br />
Deutschland in die Hafenstädte brachten, waren mit<br />
rassistischen Karikaturen von Chinesen und Aufschriften<br />
wie „Pardon wird nicht gegeben!“ oder „Li Hungtschang<br />
Du ahnst es nicht!“ versehen. In München<br />
sorgte der von Kapellen begleitete Marsch des bayerischen<br />
Bataillons von der Max-II-Kaserne zum Laimer<br />
Bahnhof am 3. August um zwei Uhr morgens für<br />
einen nächtlichen Volksauflauf. Nach einem Bericht<br />
der MNN säumten Menschenmassen mit Laternen den<br />
Weg, alle Gasthäuser auf dem Weg waren dicht mit<br />
Gästen besetzt und im „Kurgar-<br />
ten“ wurde ein Feuerwerk abgebrannt.<br />
Die Menge verabschiedete<br />
die „Chinakrieger“ am Laimer<br />
Tunnel. Am Bahnhof selbst<br />
waren Eintrittskarten für 1.300<br />
Personen ausgegeben worden,<br />
die die Abfahrt des Sonderzuges<br />
mit 40 Wagons nach Bremerhaven<br />
bejubelten. Passend zur<br />
Kriegsbegeisterung publizierte<br />
der Münchner Bruckmann-Verlag ein Album mit Porträts<br />
der Offiziere und Ärzte des bayerischen Kontingents,<br />
das für zwei Mark in allen Buchhandlungen zu<br />
erwerben war. Des Weiteren wurde ein „Bayerisches<br />
Hilfskomitee für Ostasien“ ins Leben gerufen, um die<br />
deutschen Truppen in China durch reichhaltige Spenden<br />
zu unterstützen.<br />
Lyrikpropaganda<br />
Auch der Münchner Stadtarchivar Ernst von Destouches<br />
begeisterte sich in seinem Gedicht „Die China-<br />
Heerfahrt“ für die koloniale Sache. Er dichtete den<br />
Kriegszug als heilige, christliche Mission. Überhaupt<br />
scheint die Beteiligung bayerischer Soldaten an dem<br />
Kriegszug einige Zeitgenossen zum Dichten animiert<br />
zu haben. Felix Dahn, Erfolgsautor aus Hamburg, versuchte<br />
nach Meinung von Yixu mit dem Gedicht<br />
„Bayerischer Hunnenbrief“ den Sieg des Deutschen<br />
Reiches im deutsch-französischen Krieg 1870 bei<br />
Sedan „nach China zu verpflanzen“. „Der bescheidene<br />
Beitrag der deutschen Streitkräfte […]“, so Yixu,<br />
„wurde in der Populärliteratur zu einer zweiten<br />
Sedan-Schlacht aufgebauscht, so dass die Aura eines<br />
großartigen militärischen Triumphes Deutschlands<br />
Taufe als Kolonialmacht umgab.“<br />
Kritik an der menschenverachtenden Kriegsführung<br />
des deutschen Militärs gab es von sozialdemokratischer<br />
Seite. Ab August 1900 veröffentlichte der Vorwärts<br />
Briefe deutscher Soldaten an ihre Angehörigen<br />
(ohne Namen), die auch das äußerst brutale Vorgehen<br />
gegen chinesische Gefangene und Zivilisten<br />
schilderten. Etliche Redakteure sozialdemokratischer<br />
Zeitungen, in denen die sogenannten „Hunnenbriefe“<br />
erschienen, wurden angeklagt und auch verurteilt.<br />
Der Kampf mit dem Iltis<br />
Vor allem den Vorwurf, die Deutschen<br />
wären nicht fähig gewesen,<br />
Kolonien zu betreiben, empfanden<br />
weite Kreise der Gesellschaft als<br />
Demütigung.<br />
Die Berichterstattung über China war schon vor dem<br />
Krieg geprägt von negativen Stereotypen und Klischees,<br />
die ein europäisches Überlegenheitsgefühl<br />
und Rassismus zum Ausdruck<br />
brachten. Die Auswertung von<br />
Feldpostbriefen aus China bestätigt,<br />
dass viele deutsche Soldaten<br />
schon fertige Bilder wie etwa<br />
das vom verschlagenen und<br />
hinterlistigen Chinesen mit sich<br />
herumtrugen. Auch das Reden<br />
von der „gelben Gefahr“ stammt<br />
aus dieser Zeit, weckte das riesige<br />
Land mit der großen Bevölkerung<br />
doch Begehrlichkeiten als ökonomisches<br />
Expansionsgebiet und Ängste zugleich.<br />
Einige Ereignisse des Krieges wurden zu ruhmvollen,<br />
heldenhaften Taten deutscher Soldaten verklärt: Am<br />
Angriff auf die den Zugang nach Peking sichernden<br />
„Dagu-Forts“ an der Küste am 17. Juni 1900 beteiligte<br />
sich das deutsche Kanonenboot „Iltis“. Die Eroberung<br />
der Festung wurde im Deutschen Reich euphorisch<br />
gefeiert und es gab seitenlange Berichte über die<br />
Rolle des Kanonenbootes bei den Kämpfen. Noch<br />
heute loben rechte Kreise die Eroberung als nationale<br />
Heldentat. In München-Trudering erinnern seit 1933<br />
die Taku-Fort-Straße und die Iltisstraße an die deutsche<br />
Beteiligung, wobei die Erläuterung der Iltisstraße<br />
später offiziell geändert wurde: Heute ist sie nach<br />
dem „heimischen Raubtier Iltis aus der Familie der<br />
Marder“ benannt.<br />
„The Germans To The Front!“<br />
Ein weiterer Mythos des Boxerkriegs war der angebliche<br />
Ruf des britischen Admirals Seymour: „The Germans<br />
To The Front“, der in Deutschland so interpretiert<br />
wurde, als sei das deutsche Truppenkontingent<br />
wegen besonderer Tapferkeit nach vorne beordert<br />
worden. Tatsächlich versuchte eine multinationale<br />
Einheit unter britischer Führung im Juni 1900 nach<br />
postkolonial
66<br />
postkolonial<br />
Martin W.<br />
Rühlemann<br />
ist Historiker aus<br />
München. Die Gruppe<br />
[muc] München<br />
Postkolonial setzt<br />
sich mit den Spuren<br />
des Kolonialismus in<br />
der Stadt München<br />
auseinander.<br />
www.muc.postkolonial.net<br />
Peking vorzustoßen, musste sich aber bald zurückziehen.<br />
Erst der Befehl zum Umdrehen beförderte vermutlich<br />
die deutschen Soldaten an die Spitze. Vor<br />
allem das massenhaft reproduzierte Gemälde „The<br />
Germans To The Front“ (1902) von Carl Röchling als<br />
Postkarte verbreitete in den Folgejahrzehnten die<br />
Deutung des Befehls als Anerkennung des Mutes und<br />
der Bestätigung des deutschen Strebens nach „Weltgeltung“<br />
durch das mächtige britische Empire.<br />
Besonders im Zuge des Kampfes gegen die sogenannte<br />
„Kolonialschuldlüge“ in den 1920er Jahren<br />
wurde das Bild wieder aktuell.<br />
Die „Kolonialschuldlüge“<br />
In den Jahren der Weimarer Republik sank zwar die<br />
Mitgliederzahl kolonialer Gruppen, aber dennoch<br />
hielten sie eine erstaunliche Aktivität aufrecht. Erklärbar<br />
ist dies nur vor dem Hintergrund der populären<br />
Kampagne gegen die sogenannte „Kolonialschuldlüge“<br />
und für die Rückgabe der „geraubten“ Kolonien.<br />
Deutschland musste im Versailler Vertrag 1918 alle<br />
Kolonien abgeben, mit der Begründung, das Land<br />
hätte sich als unfähig zum Führen von Kolonien<br />
erwiesen. Zudem herrschte Deutschland grausam und<br />
schlecht in den Kolonien. Vor allem den Vorwurf, die<br />
Deutschen wären nicht fähig gewesen, Kolonien zu<br />
betreiben, empfanden weite Kreise der Gesellschaft<br />
als Demütigung. Zur Widerlegung der Vorwürfe<br />
erschienen in den 1920er Jahren zahlreiche Publikationen,<br />
Romane, Erinnerungsbücher oder Filme, die<br />
ein idyllisches Bild der grausamen Kolonialherrschaft<br />
zeichneten. Diese massive Propaganda prägte in<br />
Folge lange das Selbstbild der Deutschen als „gute<br />
Kolonisatoren“.<br />
Münchens Kolonialkrieger<br />
– Münchens Kolonialstraßen<br />
Die ehemaligen Kolonialsoldaten trugen nicht unwesentlich<br />
zu dieser Propaganda bei. Die „Kriegerschaft“<br />
war eine der aktivsten Organisationen in München.<br />
Sie pflegte nicht nur Erinnerungen an die Kolonialkriege,<br />
sondern engagierte sich auch für die Rückgabe<br />
der Kolonien und popularisierte weiterhin koloniale<br />
Phantasien. 1926 feierten die ehemaligen „Kolonialkrieger“<br />
im Rahmen eines Kolonialgedenktages ihr<br />
25-jähriges Bestehen in Anwesenheit des bayrischen<br />
Innenministers und Polizeipräsidenten. Die Ansprache<br />
hielt am Abend der berüchtigte Kolonialveteran und<br />
„Chinakrieger“, Freikorpsgründer und Putschist Ritter<br />
Franz Xaver von Epp in seiner Funktion als Ehrenpräsident<br />
der „Kriegerschaft deutscher Kolonialtruppen<br />
München“. An den Gedenktagen, die die „Kolonialkrieger“<br />
veranstalteten, nahm immer viel Prominenz<br />
teil und auch wenn die einzelnen Organisationen<br />
zahlenmäßig nicht besonders stark waren, hatte die<br />
koloniale Bewegung doch einen beträchtlichen<br />
gesellschaftlichen Einfluss: Die Benennung von Straßen<br />
und Plätzen in unzähligen deutschen Städten<br />
nach Namen aus den ehemaligen deutschen Kolonien<br />
in den 1920er Jahren erfolgte beispielsweise nicht<br />
zuletzt durch anhaltenden Lobbyismus der kolonialen<br />
Gruppen. In München wurden ab 1925 Straßen mit<br />
Namen der „verlorenen“ Kolonien und nach Kolonialpolitikern<br />
und -militärs versehen, zuerst im Münchner<br />
Westen und 1932 in München-Zamdorf. Mit der<br />
Ehrung von grausamen Kriegsherren wie Hans Dominik<br />
oder Hermann von Wißmann wurde der positive<br />
Blick auf koloniale Machtverhältnisse offiziell festgeschrieben.<br />
Der Einfluss der Kolonialrevisionisten zeigte<br />
sich auch anlässlich der kolonialen Straßenbenennungen<br />
bei der Eingemeindung Truderings 1932/33.<br />
1964 lebten außer ihm noch drei China-Veteranen in<br />
München, erzählte der „Chinesen-Maier“. Er gehörte<br />
der Vereinigung der „Kolonial-Kameraden“ in München<br />
an. Die „Kolonialkrieger“ sind inzwischen längst<br />
verstorben. Die hitzige Debatte um die Umbenennung<br />
der Münchner „Kolonialstraßen“ vor einigen<br />
Jahren weist aber darauf hin, dass ein Bewusstsein<br />
über Deutschlands koloniale Verbrechen nach wie<br />
vor kaum verbreitet ist.
Der Bauchredner aus dem Allgäu<br />
Regionale Kriminalromane haben derzeit Hochkonjunktur. Besonders erfolgreich ist das Autorenduo<br />
Klüpfel und Kobr. Ihr Erstlingswerk Milchgeld mit dem mürrischen Kommissar Kluftinger führte vom Fleck<br />
weg die Bestsellerlisten an. Welche Bedürfnisse die Autoren damit befriedigen und warum das nicht auf<br />
die leichte Schulter zu nehmen ist, ermittelt Caspar Schmidt.<br />
Die aktuelle Schwemme regionaler Kriminalromane –<br />
von Hamburg bis ins Allgäu – ist überwältigend. Der<br />
Branchenprimus Emons Verlag („Wir machen alles,<br />
was die großen Verlage machen, allerdings mit regionalem<br />
Bezug“) führt mittlerweile über 40 Serien in<br />
seinem Sortiment. Regionale Kulinaria, bekannte Plätze<br />
und bewegende Ereignisse der örtlichen<br />
Geschichtsschreibung bilden die Kulisse um den<br />
jeweiligen Kriminalfall, sodass sich die Ortskundigen<br />
beim Lesen an ihrem Spezialwissen erfreuen können.<br />
Dabei wird der Charakterzug der Region stark überzeichnet,<br />
stärker noch als beim „Tatort“. Bei der<br />
öffentlich-rechtlichen TV-Krimi-Reihe begnügt man<br />
sich in der Regel damit, eine Mundart-Nebenrolle zu<br />
besetzen – einen Deppen vom Dienst sozusagen –<br />
und die Ermittelnden kommen mehrheitlich weniger<br />
verwurzelt daher. Bei den regionalen Kriminalromanen<br />
hingegen bilden der Depp vom Dienst und der<br />
zumeist männliche Kommissar eine Personalunion.<br />
Das Buch Milchgeld der Hobbyautoren Klüpfel und<br />
Kobr ist das erste Werk einer mittlerweile siebenbändigen<br />
Serie. Diese Bucherscheinung eignet sich gut,<br />
um die Erfolgsfaktoren der regionalen Kriminalroma-<br />
ne darzustellen. Milchgeld beginnt mit einer ersten<br />
Charakterstudie des ermittelnden Kommissars Kluftinger<br />
beim Verzehr von Käsespatzen, die er sich jeden<br />
Montag von seiner Frau servieren lässt. Um Essen<br />
dreht es sich auch erschöpfend auf den 300 folgenden<br />
Seiten. Kluftinger ernährt sich fast ausschließlich<br />
von regionaler Kost. Das einzige als „exotisch“<br />
beschriebene Gericht, für das er sich in Ausnahmefällen<br />
erwärmen kann, sind Spaghetti-Fertigpackungen.<br />
Rucola, Latte Macchiato und Balsamico hält Kluftinger<br />
für „Modetrends, die man mitmachen muss, wenn<br />
man den Anschein machen will, dass man beim<br />
Essen international, weltoffen und genießerisch“ ist.<br />
International, weltoffen und genießerisch ist Kluftinger<br />
aus Überzeugung nicht. Lokalpatriotismus, Argwohn<br />
gegenüber allem „Fremden“ und eine ausgesprochene<br />
Lustfeindlichkeit zeichnen ihn aus.<br />
Parmesan, der „Italiener ihr alter Bröckelkäse“, sollte<br />
seiner Meinung nach im Allgäu nicht hergestellt werden,<br />
da „man so guten einheimischen Käse im Allgäu“<br />
hat. Selbst Semmeln erscheinen Kluftinger zu<br />
abgehoben. Früher sei „man ja auch ohne Semmeln<br />
ausgekommen“, belehrt der Kommissar und zieht das<br />
debattencaspar<br />
Caspar Schmidt<br />
ist freier Journalist<br />
und Intelektueller<br />
aus München
68<br />
debattencaspar<br />
1 Im 18. Jahrhundert<br />
wurden Aufständische<br />
in den<br />
antihabsburgischen<br />
Kriegen als Kuruzen<br />
bezeichnet. Die Aufständischenunterstützten<br />
die Türken,<br />
und der Ruf „Die<br />
Kuruzen und die<br />
Türken kommen“<br />
wurde irgendwann<br />
zum Fluch „Kruzitürken!“.<br />
Schwarzbrot der Semmel vor. Wer es bis zur Seite 54<br />
des Romans geschafft hat, bekommt zu lesen, wie<br />
sich Kluftinger in eine Dönerbude verirrt. Dort rutscht<br />
dem Kommissar – da ihm der Döner zu scharf ist –<br />
ohne Hintergedanken der rassistische bayerische<br />
Fluch „Kruzitürken“ 1 heraus. Das ist ihm vor den<br />
anwesenden türkischen Bauarbeitern im Nachhinein<br />
zwar peinlich, aber sicher nicht den meisten Lesenden,<br />
denen er seinen Ruhm zu verdanken hat und<br />
die ein „Kruzitürken“ im Dönerladen vermutlich für<br />
eine gelungene Pointe halten werden.<br />
Kluftinger und die Frauen<br />
Im Roman Milchgeld gibt es zwei grundsätzlich verschiedene<br />
Frauentypen. Eine Gruppe besteht aus<br />
Mutterfiguren, die das Bestreben<br />
eint, den Kommissar mit Essen<br />
zu versorgen, sowie sie bemüht<br />
sind, dass im Kluftinger-Haushalt<br />
alles klappt. Zuvörderst ist da die<br />
Ehefrau, deren Hauptaufgabe zu<br />
sein scheint, ihr „Butzele“ zu versorgen.<br />
Selbst wenn sie auf eine<br />
Reise geht, kocht sie ihm für<br />
eine Woche vor und fühlt sich<br />
dennoch nicht wohl dabei, würde „am lieben hier<br />
bleiben, bei Dir [Kluftinger]. Du weißt doch gar nicht,<br />
wo alles ist.“ Eine weitere Frau in Kluftingers Leben<br />
ist seine Mutter, die ihm in der Zeit der Abwesenheit<br />
seiner Ehefrau die Käsespatzen zubereitet, die ihr<br />
freilich noch besser gelingen. Gleichwohl aufmerksam<br />
zeigt sich die Sekretärin Frau Henske. Sie bringt<br />
chronisch Kaffee und auch Quarktaschen. Als sie von<br />
der Abwesenheit von Kluftingers Frau erfährt, bietet<br />
sie ihm an: „Ach herrje, da müssen Sie ja jetzt selber<br />
kochen und waschen und so? Also wenn Sie wollen,<br />
nehme ich Ihnen gerne einmal einen Korb ab.<br />
Wäsche meine ich.“ Das gefällt Kluftinger. Zu Anfang<br />
hatte er Frau Henske noch für eine „Tussi“ gehalten,<br />
womit im Grunde die zweite Frauengruppe grob<br />
gefasst werden könnte.<br />
In diese Kategorie fällt zum Beispiel teilweise die<br />
„Künstlernatur“ Theresa, deren Haare „völlig chaotisch<br />
und zufällig ihrem am Hinterkopf verankert“<br />
sind und deren Kleidung Kluftinger an die „Öko-Weiber“<br />
vom alternativen Markt erinnert. Oder auch die<br />
„südländisch aussehende Surferin im knappen Bikini“,<br />
die auf einem Poster für Allgäuer Käse wirbt. „Früher<br />
hat man mit Kühen und Älplern für Käse geworben,<br />
und jetzt mit nackerte Weiber. Na dann Mahlzeit.“,<br />
kommentiert Kluftinger, seinem Schema stets treu.<br />
Sein Kampf gegen das „Fremde”,<br />
Abstrakte sowie Nicht-Konforme<br />
Die Leitmotive des Plots lassen<br />
sich auf zwei Paradigmen reduzieren:<br />
„Früher war alles besser“ und<br />
„Alles Böse kommt von Außen.“<br />
Abweichler, die aus seinem strengen Rollenschema<br />
fallen, sind Kluftinger regelrecht verhasst: „Bartsch<br />
war Kluftinger auf den ersten Blick unsympathisch. Er<br />
trug eine rosa Krawatte. Eine rosa Krawatte! Sein<br />
Vater hätte ihn früher für so etwas verprügelt. Kluftinger<br />
bremste sich selbst.“ Keinen Spaß versteht der<br />
Regionalpatriot auch bei allem Amerikanischen, insbesondere<br />
bei Anglizismen. Begriffe wie „Flipchart“<br />
korrigiert er demonstrativ und umständlich mit „die<br />
Tafel mit Papier drauf“, Kollegen ermahnt er, das<br />
Wort „auschecken“ nicht zu verwenden und am<br />
Begriff „Relaunch“ stößt sich der Kommissar ebenfalls.<br />
Er vermeidet im Allgemeinen „ausländisch zu<br />
reden“, es sei denn, es dient<br />
seiner eigenen Belustigung.<br />
Während einer langwierigen<br />
Obduktion vertreibt er sich<br />
seine Zeit beispielsweise mit<br />
der Mittelwelle: „Er musste<br />
lachen, als er offenbar eine<br />
Nachrichtensendung hörte, die<br />
wie eine Mischung aus Russisch,<br />
Chinesisch und den Lauten,<br />
die Zeichentrickfiguren im Fernsehen immer von<br />
sich gaben, klang. Er machte sich einen Spaß daraus,<br />
immer ein paar Wortfetzen nachzusprechen.“ (Das<br />
war kurz nachdem er den Sender mit „Experimentalmusik“<br />
abgedreht hatte, die er für Musik nicht halten<br />
mag). Ein Auszug:<br />
„,Weiber’ [Anm.: damit ist die Ehefrau gemeint], sagte<br />
er schließlich laut und schüttelte den Kopf [...] Er griff<br />
zur Fernbedienung und ,zappte’, wie sein Sohn es<br />
nannte. Programm zwanzig, der amerikanische<br />
Sportkanal brachte Baseball. So ein Schmarr’n, dachte<br />
er bei sich, das Spiel kapiert doch wirklich keiner, die<br />
stehen ja nur rum.“<br />
Man könnte meinen, Kluftinger würde mit seiner<br />
Feindlichkeit allem Fremden gegenüber so überspitzt<br />
dargestellt, dass die Lesenden nicht mit, sondern über<br />
ihn lachen. Dem entgegen steht aber, dass die Story,<br />
die literarische Objektive sozusagen, das Bauchgefühl<br />
des Kommissars vollends bestätigt. Der Inhalt des<br />
Buches Milchgeld ist schnell zusammengefasst: Die<br />
Käserei Schönmanger – im Zentrum der Handlung –<br />
war ein ehrwürdiges Familienunternehmen mit einem<br />
harten, aber gerechten Senior. Der alte Patriarch<br />
behandelte „seine“ Bauern und Angestellten stets gut.<br />
Seitdem sich aber sein Sohn einmischt, also die<br />
moderne Betriebswirtschaft Einzug erhält, gerät das
Familienunternehmen in Gefahr. Hinter dem Rücken<br />
des Seniors lässt der Sohn heimlich Milchpulver aus<br />
Russland importieren. Das Pulver ist billig, weil es<br />
nicht eigens produziert, sondern von Hilfslieferungen<br />
für Afrika abgezweigt wird. Ein Lebensmitteldesigner<br />
sorgt daraufhin mit viel Chemie dafür, dass der Käse<br />
mit dem beschafften Milchpulver sogar schneller reift<br />
als mit landläufiger Milch. Dank der erhöhten Grenzwerte<br />
durch die Europäische Union ist das illegale<br />
Verfahren im Käse nicht mehr nachweisbar. Jemand<br />
entdeckt die Machenschaften des Sohnes und erpresst<br />
den Lebensmitteldesigner. Als dieser die Nerven verliert,<br />
wird der alte Unternehmer eingeweiht. Getrieben<br />
von „Wut, Verzweiflung und unsäglicher Angst<br />
um sein Lebenswerk“, der Käserei, schlägt der Senior<br />
den Lebensmitteldesigner sowie den Erpresser tot.<br />
Die Leitmotive des Plots lassen sich auf zwei Paradigmen<br />
reduzieren: „Früher war alles besser“ und „Alles<br />
Böse kommt von Außen“ – womit dem Bauchgefühl<br />
Kluftingers eine ungeahnte Versachlichung zuteil<br />
wird. Gegen das feindlich gesonnene Außen wird der<br />
regional verwurzelte Unternehmer ins Feld geführt,<br />
der wertkonservative Kapitalist, der Fels in der Brandung,<br />
ein Schön manager eben, der so anständig ist,<br />
dass ihn seine positiven Eigenschaften sogar zum<br />
Mord treiben. Der Rheinische Kapitalismus eines<br />
Schönmanger wird damit positiv einem modernen, als<br />
entwurzelt markierten Kapitalismus entgegen gehalten,<br />
so als wären das wirkliche Gegensätze und als<br />
wären Betrügereien erst mit der modernen Betriebswirtschaft<br />
in die Ökonomie geraten. Dass die konkreten<br />
Feindbilder in Milchgeld dann von Russen und<br />
einer vereinten europäischen Bürokratie besetzt werden,<br />
fügt sich so nahtlos ins klischeehafte Elaborat<br />
wie Kluftingers gestandener Antiamerikanismus.<br />
Heimatkrimi und die alten Leute<br />
Das wirft die Frage auf, welche Bedürfnisse mit solch<br />
einem Buch befriedigt werden, weshalb es zum Kassenschlager<br />
wurde. Sicher haben die Autoren Klüpfel<br />
und Kobr damit ihre Vorstellung von einem<br />
„ursprünglichen“ Allgäu – scharf getrennt von einem<br />
neumodischen Allgäu – ausleben können. Als Referenzen<br />
für ihre Ursprünglichkeit zogen sie aber<br />
scheinbar die noch lebenden Alten beziehungsweise<br />
ihre Erinnerungen an ihre eigenen Großeltern heran.<br />
Sie berücksichtigten dabei nicht, dass diese Generation<br />
im Schatten des Nationalsozialismus und deren<br />
Vorfahren von völkischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts<br />
geprägt wurden, diese Anschauungen nicht<br />
das Allgäu an sich widerspiegeln, sondern eine<br />
moderne und finstere Etappe. Es könnte nämlich<br />
selbst in der Einöde des Allgäus durchaus eine Zeit<br />
gegeben haben, in der man sich „international, weltoffen<br />
und genießerisch“ gab – um Kluftingers verhasste<br />
Attribute noch einmal aufzunehmen –, als man<br />
zum Beispiel eine Allianz zusammen mit Frankreich<br />
gegen Österreich einging, aber auch schon zuvor.<br />
Das heutige Referenzieren auf das 19. und frühe 20.<br />
Jahrhundert als Quelle des vermeintlich Ursprünglichen<br />
kann als eine schlechte Angewohnheit angesehen<br />
werden. Tatsächlich herrschten im Allgäu weltoffenere<br />
sowie sehr reaktionäre Zeiten und die letzte<br />
Kriegsgeneration wurde sicher in einer sehr reaktionären<br />
geprägt. Um es kurz zu formulieren: Kommissar<br />
Kluftinger ist kein „Original“ sondern typisches<br />
Kind einer faschisierten Generation, die durch seinen<br />
Bauch weiter spricht. Dass ihn viele Lesenden gerade<br />
für dieses Bauchgefühl so lieben, ist alarmierend. Es<br />
wäre ein gutes Zeichen, wenn derlei Romane keine<br />
Erfolge zu verbuchen hätten.<<br />
debattencaspar
70<br />
bitte mitte<br />
Herrschaft des Verdachts<br />
Bayern macht mobil. Es geht gegen den „Extremismus“. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz<br />
spielt mit dem antifaschistischen Archiv a.i.d.a. Hase und Igel. Von Fred König<br />
Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s weiter ungeniert.<br />
Mit dieser scherzhaften Redewendung könnte<br />
sich auch das a.i.d.a.-Archiv<br />
über den Ärger hinwegtrösten,<br />
den es seit bald drei Jahren mit<br />
dem Bayerischen Landesamt für<br />
Verfassungsschutz (VS) hat.<br />
a.i.d.a. ist die „Antifaschistische<br />
Informations-, Dokumentationsund<br />
Archivstelle“ in München, die<br />
nach fast 20-jähriger anerkannter<br />
und mit zahlreichen Auszeichnungen bedachter Tätigkeit<br />
gegen Neonazi-Umtriebe in Süddeutschland 2009<br />
erstmals im Verfassungsschutzbericht des bayerischen<br />
Geheimdienstes für das Jahr 2008 auftauchte und dort<br />
als „linksextremistisch“ eingeordnet wurde. Am Beispiel<br />
der Münchener Faktensammler gegen Rechts<br />
lässt sich in besonders drastischer Weise nachzeichnen,<br />
was passiert, wenn man im Zuge der neuen<br />
„Extremismus“-Konjunktur als „linksextrem“ gebrandmarkt<br />
wird und wie schwer es ist, sich dagegen zu<br />
wehren und den eigenen Ruf zu retten.<br />
„Unterwanderungsversuche“<br />
zur „Beseitigung unserer Grundordnung“<br />
Es sei Abwägungssache, wann es eine Verfassungsschutzbehörde<br />
für angesagt und verhältnismäßig<br />
erachte, eine Gruppierung in den Verfassungsschutzbericht<br />
aufzunehmen, bei der „Anhaltspunkte“ für<br />
verfassungsfeindliche und „gegen die freiheitlichdemokratische<br />
Grundordnung gerichtete“ Betätigung<br />
erkannt würden. So erklärt der stellvertretende Pressesprecher<br />
des Bayerischen Innenministeriums, Peter<br />
Hutka, weshalb a.i.d.a erst 19 Jahre nach Vereinsgründung<br />
ins Visier des Landesamtes geraten sei. Innenminister<br />
Joachim Herrmann wurde, was den Zeitpunkt<br />
der Aufnahme in den VS-Bericht betrifft, bei<br />
dessen Präsentation im März 2009 deutlicher: A.i.d.a.<br />
versuche „verstärkt bei demokratisch initiierten Projekten<br />
gegen Rechtsextremismus Fuß zu fassen und<br />
hier Einfluss zu gewinnen“. In letzter Konsequenz, so<br />
Herrmann, gehe es a.i.d.a. bei solchen „Unterwanderungsversuchen“<br />
um die „Beseitigung unserer Grundordnung“.<br />
Starker Tobak. Die wahren Gründe für diese rabiaten<br />
Anwürfe des Innenministers<br />
sieht die Rechtsanwältin von<br />
a.i.d.a., Angelika Lex, ganz<br />
woanders: Sie habe mit ihrer<br />
Mandantin lange über diese<br />
Kampagne des Verfassungsschutzes<br />
gegrübelt, deren Hartnäckigkeit<br />
zumal nach einem<br />
vernichtenden Gerichtsurteil<br />
kaum noch nachvollziehbar sei. Das Innenministerium<br />
wolle sich, so Lex’ These, die Definitionsmacht<br />
über das Thema „Rechtsextremismus“ nicht von<br />
einem derart erfolgreichen Akteur wie a.i.d.a. streitig<br />
machen lassen, bei dem selbst Verfassungsschützer<br />
anderer Bundesländer wegen Informationen vorstellig<br />
würden. A.i.d.a. rede einfach dort Tacheles über Ausmaß<br />
und Strukturen der rechten Szene in Bayern, wo<br />
die Innenbehörden gerne behaupten, das Thema sei<br />
weit unbedeutender und man habe alles im Griff,<br />
vermuten die Betroffenen und ihre Anwältin. Als<br />
a.i.d.a. dann auch noch im Rahmen des Bundesprogramms<br />
„kompetent für Demokratie“ im Beratungsnetzwerk<br />
der „Landeskoordinierungsstelle Bayern<br />
gegen Rechtsextremismus“ auftauchte, war das Maß<br />
für den Verfassungsschutz wohl voll: Das Innenministerium<br />
ließ a.i.d.a. aus dem Gremium entfernen und<br />
sorgte mit der Nennung der Archivstelle im Verfassungsschutzbericht<br />
auch dafür, dass der kleine Verein<br />
mit rund dreißig Fördermitgliedern und einer Handvoll<br />
Aktiver seine Gemeinnützigkeit einbüßte.<br />
Der Verfassungsgericht sieht in<br />
einer Linksammlung auf der Website<br />
von a.i.d.a. einen „tatsächlichen<br />
Anhaltspunkt” für dessen<br />
„Linksextremismus”.<br />
Bayerische Halsstarrigkeit<br />
Seither gleicht der gerichtliche Wettlauf von a.i.d.a.<br />
mit dem Innenministerium dem Rennen zwischen<br />
Hase und Igel: Noch während das Verfahren gegen<br />
die erste Nennung im VS-Bericht 2008 lief, wiederholte<br />
der Geheimdienst den Vorwurf in seinem Bericht<br />
für 2009. Und obwohl am 23. September 2010 ein für<br />
den Verfassungsschutz vernichtendes Urteil des Verwaltungsgerichtshofes<br />
(VGH), des bayerischen Äquivalents<br />
zu einem Oberverwaltungsgericht (OVG),<br />
zum VS-Bericht 2008 erging (Az 10 CE 10.1830),
wiederholte der VS seine Vorwürfe – etwas vorsichtiger<br />
– in seinem Bericht für 2010, der im März dieses<br />
Jahres erschien. In einer detaillierten Erörterung<br />
erläutert der VGH Maß und Ziel der Unterrichtung<br />
der Öffentlichkeit über „verfassungsfeindliche Bestrebungen“<br />
und den stigmatisierenden und rufschädigenden<br />
Charakter der Nennung im VS-Bericht, der<br />
„die politische und gesellschaftliche Isolierung der als<br />
extremistisch bezeichneten Gruppierung“ bezwecke.<br />
Dieser gravierende Eingriff in die Rechte der Genannten<br />
dürfe deshalb kein „nicht durch belegbare Tatsachen<br />
gestützter ‚bloßer Verdacht’“ sein. Und dass der<br />
bayerische Verfassungsschutz a.i.d.a. hier lediglich<br />
„etiketthaft“ dem Verdacht des „Linksextremismus“<br />
aussetzt, fasst das Gericht so zusammen: „... der<br />
Bericht enthält über den Antragsteller [a.i.d.a.] ein<br />
auch nicht ansatzweise durch tatsächliche Anhaltspunkte<br />
nachvollziehbar belegtes Negativurteil“, weshalb<br />
a.i.d.a aus dem Bericht 2008 gänzlich zu entfernen,<br />
die entsprechenden Stellen in der Druckversion<br />
zu schwärzen seien.<br />
Das ficht den bayerischen Verfassungsschutz nicht an:<br />
Im Gespräch mit Pressesprecher Hutka ist kein Zweifel<br />
hörbar, dass es sich bei a.i.d.a. um eine „linksextremistische“<br />
Organisation handele. Dabei bezieht<br />
sich Hutka auch auf das jüngste, nun wieder auf den<br />
VS-Bericht 2009 bezogene Urteil des Verwaltungsgerichts<br />
(VG) München vom 26. Mai 2011, das beide<br />
Parteien als Teilerfolg reklamieren. Das VG sieht in<br />
einer Linksammlung auf der Website von a.i.d.a.<br />
einen „tatsächlichen Anhaltspunkt“ für dessen „linksextremistische“<br />
Ausrichtung, verbietet dem Innenministerium<br />
jedoch, die a.i.d.a.-Aktiven als „dem linksextremistischen<br />
Spektrum zuzurechnen“ zu bezeichnen.<br />
Gegen das Urteil haben beide Seiten Beschwerde eingelegt.<br />
Jetzt und in den kommenden Verfahren –<br />
Angelika Lex hat bereits Beschwerde gegen die<br />
Erwähnung a.i.d.a.s im VS-Bericht für 2010 eingelegt<br />
– geht es also nur noch um die Frage der Haftung für<br />
auf einer Homepage im Internet veröffentlichte Links.<br />
Die bayerische Verfassungsschutzbehörde hat mehr<br />
als 400 Mitarbeiter, a.i.d.a. ist ein kleiner, auf Spenden<br />
angewiesener Verein, dessen nun angeschlagene<br />
Reputation den Spendenfluss vermutlich nicht beflügelt<br />
hat: Warum verfolgt der Verfassungsschutz diesen<br />
Verein trotz ziemlich eindeutiger Gerichtsbeschlüsse,<br />
die a.i.d.a. vor der Etikettierung als „linksextremistisch“<br />
in Schutz nehmen, weiter so halsstarrig? Unterdessen<br />
taucht die Archivstelle mit geradezu besserwisserischer<br />
Genugtuung im Internet auch im Halbjahres-VS-Bericht<br />
2011 wieder auf : „Ick bün al dor!“<br />
ruft der VS-Igel.<<br />
Nachtrag vom Ober-Igel<br />
nach Redaktionsschluss:<br />
Die Mord- und Anschlagserie<br />
durch die rechtsextremistische<br />
Terrorzelle in Thüringen dürfe<br />
keine Verharmlosung des Linksextremismus<br />
zur Folge haben, kommentierte<br />
Bayerns Innenminister<br />
Joachim Herrmann (CSU) den<br />
aktuellen Beschluss des Verwaltungsgerichts<br />
München. Der Teil<br />
im Verfassungsschutzbericht 2010<br />
zu a.i.d.a wurde vor wenigen<br />
Tagen zum dritten Male in drei<br />
Jahren vom Verwaltungsgericht<br />
korrigiert. Die komplette Streichung<br />
des Abschnitts will a.i.d.a<br />
vor dem Verwaltungsgerichtshof<br />
erreichen.<br />
bitte mitte<br />
Fred König<br />
ist Philosoph und<br />
freier Autor. Er lebt<br />
und arbeitet in Wurmannsquick.
72<br />
bitte mitte<br />
Extrem unbrauchbar<br />
Die Bundesregierung legt Programme zur allgemeinen Extremismusbekämpfung auf, die Bayerische<br />
Staatsregierung schaltet die Website „Bayern Gegen Linksextremismus“ und auch der Kampf gegen<br />
rechts bedient sich gerne des Labels „rechtsextrem“. Doch was ist eigentlich „Extremismus”? Eine Kritik<br />
eines inhaltsleeren Begriffs der Normierung von Nikolai Schreiter<br />
Die „Extremismusklausel“ von Familienministerin<br />
Schröder hat viel Protest hervorgerufen,<br />
Bündnisse und Organisationen haben sich<br />
„gegen Misstrauen, Bekenntniszwang und Generalverdacht“<br />
gewandt, die die Zusammenlegung der Programme<br />
gegen „Links- und Rechtsextremismus“ und<br />
die Forderung nach dem Bekenntnis zum Grundgesetz<br />
hervorrufen. Gleichzeitig geht die Bayerische<br />
Staatsregierung mit der Seite „Bayern Gegen Linksextremismus“<br />
online, eine je nach Perspektive unterhaltsame<br />
oder gefährliche, in jedem Fall aber interessante<br />
Seite. Der Protest und die Auseinandersetzung mit<br />
dem Extremismusdiskurs war und ist also offensichtlich<br />
notwendig. Allerdings wird auch im Rahmen der<br />
Proteste die grundsätzliche Notwendigkeit einer<br />
„Extremismusbekämpfung“ häufig nicht hinterfragt<br />
und der Extremismusdiskurs bildet den Rahmen. Welche<br />
Folgen dieser aber eigentlich hat, wem er nützt<br />
und warum er von der Bundesregierung befeuert<br />
wird, geht unter. Um was geht es also, wenn jemand<br />
wie Kristina Schröder „Extremismus jeglicher Couleur“<br />
bekämpfen will?<br />
„Neutralität der Mitte“<br />
Kristinas kleine Fingerübung<br />
Soviel von der Mettwurst, aber bitte ohne Ende<br />
Das Wort Extremismus sagt zunächst einmal nämlich<br />
nichts aus. Es beschreibt lediglich eine Relation und<br />
kann verstanden werden als „am äußersten Rand“,<br />
„sehr weit außen“, und muss immer als Verhältnis zu<br />
einer Referenz gedacht werden. „Extremismus“ allein<br />
ist ein inhaltsleeres Wort, man könnte sagen, es gibt<br />
den „Extremismus“ nicht. Und gerade darin liegt die<br />
große Gefahr seiner Verwendung. Der Extremismusdiskurs<br />
zieht eine <strong>Grenze</strong>, sie schafft zwei Kategorien.<br />
Die „gute Mitte“ einerseits, und die „bösen Extreme“<br />
andererseits, die zu bekämpfen seien. Diese „Mitte“<br />
definiert sich selbst als „normal“, „neutral“ und „richtig“,<br />
doch es geht unter, dass die „Mitte“ nur die<br />
„Mitte“ ist, weil sie historisch so gewachsen ist,<br />
umkämpft war und sowie aus den unterschiedlichsten<br />
Gründen so hegemonial wurde, um heute ungeachtet<br />
der tatsächlichen Inhalte wirkungsvoll die eigene<br />
„Ausgewogenheit“, „Neutralität“ und „Richtigkeit“ propagieren<br />
zu können. Denn genau das tut der Extremismusdiskurs:<br />
Aus der „Mitte“ heraus wird der Status<br />
Quo zur „besten Möglichkeit“ erhoben, jegliches<br />
Nachdenken über fundamentale Probleme dieses Status<br />
Quo und radikale Kritik daran wird in die „extremistische“<br />
Ecke gestellt, mit Repression und Ausgrenzung,<br />
mit Stigmatisierung und Diffamierung belegt.
Die doppelte Leere des Hufeisens<br />
Wesentliches Merkmal des Extremismusdiskurses ist<br />
die Verhinderung inhaltlicher Auseinandersetzung<br />
sowohl mit hegemonialen Strukturen als auch mit<br />
den als „extremistisch“ bezeichneten, davon abweichenden<br />
Positionen. Ihm liegt die Vorstellung einer<br />
hufeisenförmigen Gesellschaft zugrunde; diese impliziert<br />
ein Kontinuum, etwa von „linksextrem“ über<br />
sozialdemokratisch, liberal, konservativ bis zu „rechtsextrem“.<br />
Schon diese Vorstellung macht überhaupt<br />
keinen Sinn, denn diese Kategorien sind allesamt<br />
heterogen und schwammig. In dieser Logik werden<br />
„links“ beispielsweise der Stalinismus, die „Globalisierungskritik“,<br />
Antifa-Gruppen, Anarchismus und<br />
Queer-Feminismus in eine Ecke gestellt, „rechts“ gibt<br />
es einen ähnlich willkürlich zusammengewürfelten<br />
Topf voller Widerwärtigkeiten wie dem „autonomen<br />
Nationalismus“, Burschenschaften, „Die Freiheit“ und<br />
Neonazis. Der Extremismusdiskurs führt also zu<br />
inhaltlicher Leere auf zwei Ebenen: Einerseits werden<br />
die unterschiedlichen Inhalte „innerhalb“ der jeweiligen<br />
„extremistischen“ Positionen als homogen dargestellt.<br />
Außerdem werden mit der Verwendung des<br />
Extremismusbegriffs gar alle diese nicht-hegemonialen<br />
Positionen zusammengefasst, obwohl sie selbst in<br />
der Vorstellung der Hufeisengesellschaft diametral<br />
entgegengesetzt zu einander stehen, sich gegeneinander<br />
abgrenzen und teils aktiv bekämpfen. Die Folge<br />
sind Gleichsetzung von so unterschiedlichen politischen<br />
Inhalten wie dem emanzipatorischen Streben<br />
nach der Freiheit von Herrschaft einerseits und dem<br />
Ruf nach einem Führer der Nation andererseits.<br />
Scheuklappen des Extremismusdiskurses<br />
Gleichzeitig dient der Extremismusdiskurs der „Mitte“<br />
dazu, sich selbst Kritik zu entziehen: Durch die Konstruktion<br />
des „bösen, extremistischen“ Anderen, die<br />
Abgrenzung davon und seine Verurteilung werden<br />
beispielsweise Rassismen innerhalb der „Mitte“ und<br />
der Gesellschaft als Ganzes de-thematisiert und als<br />
„rechtsextremistisch“ gelabelt. Es werden Ausgrenzungs-<br />
und Unterdrückungsmechanismen ausschließlich<br />
bestimmten „extremistischen“ Akteuren zugeschrieben,<br />
diese verurteilt und damit der Eindruck<br />
erweckt, die „Mitte“ wäre grundsätzlich frei davon. Es<br />
ist deshalb nicht zufällig, dass der Extremismusbegriff<br />
von hegemonialen Kräften benutzt wird. Damit bleibt<br />
die Deutungshoheit über die Legitimität von Positionen<br />
bei ihnen und eine inhaltliche Auseinandersetzung<br />
bleibt aus. Der Extremismusbegriff führt zu<br />
einer Norm(alis)ierung von Gesellschaft, einer Verengung<br />
des Korridors der gesellschaftlich akzeptierten<br />
Positionen; es ist der Versuch eines Auf-Linie-Bringens.<br />
Seine Verwendung unterstützt immer den Mainstream,<br />
der als „positive“ Referenz, gegen den die<br />
„negativen Extremismen“ abgegrenzt werden, fungiert.<br />
Dass nun hegemoniale gesellschaftliche Kräfte, Staat<br />
und Regierung ihre Position durch die Verwendung<br />
des Extremismusbegriffs stärken wollen, verwundert<br />
wenig. Wenn aber Gruppen, die sich gegen diesen<br />
Hegemon, gegen den Staat und seine „Mitte“, seine<br />
„Normalität“ stellen und von ihm dem „Linksextremismus“<br />
zugerechnet werden, sich des Begriffs des<br />
„Rechtsextremismus“ bedienen, agieren sie genau<br />
innerhalb des Deutungsmusters der selbsternannten<br />
„Mitte“, akzeptieren das Konzept der hufeisenförmigen<br />
Gesellschaft und machen sich damit auf die gleiche<br />
Weise angreifbar. Sie stellen sich implizit selbst in<br />
die „extremistische“ Ecke, allein durch deren grundsätzliche<br />
Akzeptanz. Außerdem wird dann auch nicht<br />
klar, ob es sich bei den „Rechtsextremen“ um Neonazis,<br />
Burschenschaftler, „Neue Rechte“, den „Ring<br />
nationaler Frauen“ oder holocaustleugnende katholische<br />
Priester handelt. Diese Unterscheidungen sind<br />
aber für die politische Arbeit von großer Bedeutung,<br />
denn werden die anzugreifenden Gruppen und ihre<br />
Inhalte näher benannt als allgemein „rechtsextrem“,<br />
kann auch deren Kritik und die eigene Argumentation<br />
genauer und individueller zugeschnitten werden.<br />
Die Bereitschaft zur exakten Benennung eigener und<br />
fremder Positionen, die Streichung von „Extremismus“<br />
aus dem eigenen Wortschatz führt zu mehr Klarheit<br />
und – wichtiger – zur Rückgewinnung der Deutungshoheit.<br />
Solidarisierung sieht anders aus<br />
Die „Extremismusklausel“, die von Organisationen die<br />
vom Familienministeriums eine Förderung möchten,<br />
unterzeichnet werden muss, hat außerdem den Effekt<br />
einer Entsolidarisierung unter Gruppen, denen diese<br />
vorgelegt wird, und deren Partnerorganisationen. Es<br />
wird wieder die <strong>Grenze</strong> gezogen zwischen denen, die<br />
sich verpflichten mit „dem Grundgesetz konforme“<br />
Politik zu machen und denen, die es verweigern. Da<br />
kann es ganz schnell passieren, dass die „gute, demokratische<br />
Mitte“ gegen den „bösen, umstürzlerischen<br />
Extremismus“ ausgespielt werden und Bündnisse zerbrechen,<br />
sich Akteurinnen und Akteure mit eigentlich<br />
ähnlichen Zielen von einander distanzieren oder<br />
unter Druck geraten, dies zu tun. Der Versuch, Kritik<br />
unter staatlicher Aufsicht zu üben wird spätestens<br />
dann ad absurdum geführt, wenn die Kritik sich, wie<br />
so oft, gegen den Staat richten muss.<<br />
bitte mitte<br />
Weiterlesen:<br />
Gegen jeden Extremismusbegriff:www.inex.blogsport.de/"http://inex.b<br />
logsport.de/<br />
Bayern Gegen<br />
Linksextremismus:<br />
www.bayern-gegenlinksextremismus.ba<br />
yern.de<br />
www.bayern-gegenlinksextremismus.ba<br />
yern.de/<br />
Nikolai Schreiter<br />
studiert Internationale<br />
Entwicklung<br />
und Politikwissenschaften<br />
in Wien.
74<br />
fragmente<br />
vom außenlicht verfolgt<br />
laufen sie in scharen<br />
unablässig nach norden<br />
zum weißgewaschenen kontinent<br />
im schatten der bestandslisten<br />
warten sie<br />
geduldig ohne schrift ohne papier<br />
bis die zähmung sie erfaßt<br />
SAID<br />
SAID wurde 1947 in Teheran geboren und kam 1965 nach<br />
München. Nach dem Sturz des Schah 1979 betrat er zum<br />
ersten mal wieder iranischen Boden, sah aber unter dem<br />
Regime der Mullahs keine Möglichkeit zu einem Neuanfang.<br />
Seither lebt er wieder im deutschen Exil. Sein literarisches<br />
Werk wurde vielfach ausgezeichnet. SAIDs Bücher sind in<br />
mehreren Sprachen erschienen.<br />
Impressions<br />
The worst thing for me is not that we get beaten by the<br />
police, but that they treat us like animals. When they<br />
arrest us, when they have to touch us or our belongings,<br />
they wear plastic gloves. After using them on us they<br />
through them into the garbage bin.<br />
We go to the toilette and they arrest us. We go to the beach<br />
to wash ourselves or our clothes and they arrest us. We go<br />
the pharmacy and they arrest us. We go to the hospital and<br />
they arrest us. We go to a phone cell to call our family and<br />
they arrest us.<br />
Today I went to LIDL to buy food, when suddenly two officers<br />
caught me. One of them was holding me while the<br />
other was beating my head and my body. Close to us<br />
some Greek people were standing and watching, but<br />
nobody said anything. Finally I could escape.<br />
We live in construction sites, on the street, in provisory nylon<br />
shelters in the middle of the jungle, in and under old trains<br />
and everywhere. We wait to see what will happen with us. If<br />
the police will come and arrest us. If they will deport or only<br />
beat some of us. The ones of us who are here now, we have<br />
no other choice. That’s how it is. This is our life.<br />
Step by step our problems rose and grew to become a<br />
huge wall separating us from you.<br />
Birds of immigrants<br />
Das Blog Birds of immigrants gibt unbegleiteten minderjährigen<br />
Flüchtlingen ein Forum. Auf griechisch, englisch oder<br />
arabisch erzählen die Flüchtlinge in Berichten, Gedichten<br />
und Zeichnungen von sich und ihren Wünschen und zeigen<br />
ihren Blick auf Europa. (http://birdsofimmigrants.jogspace.net/)
Nationale Hysterie<br />
Seit 2007 kommt es auch bei der Budapest Pride zu massiven Übergriffen. Die jährlich stattfindende Parade<br />
für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transidentitären Personen, Intersexuellen und<br />
Queers (LGBTIQ) muss von der Polizei beschützt werden. Judith Götz und Rosemarie Ortner berichten<br />
von den Ereignissen während der diesjährigen, 16. Budapest Pride.<br />
Fotos: radicalqueer.blogsport.eu
76<br />
queer<br />
Die aktuellen politischen und gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen in Ungarn erlangen, insbesondere<br />
im Nachbarland Österreich, erhöhte<br />
mediale Aufmerksamkeit. Seit ihrer Regierungsübernahme<br />
im Frühjahr 2010 betreibt<br />
die Partei Fidesz unter dem Vorsitz<br />
des Ministerpräsidenten Viktor<br />
Orbán den Abbau demokratischer<br />
Rechte. Dies ist verknüpft<br />
mit einem - in vielen Bereichen<br />
deutlich spürbaren - völkischnationalen<br />
Diskurs, der seinen<br />
Ausdruck etwa in der symbolträchtigen<br />
Umbenennung von<br />
Straßen und Plätzen, der Außenpolitik<br />
(Konflikte mit der Slowakei<br />
und Rumänien; der provokative Großungarnteppich<br />
der Ratspräsidentschaft in Brüssel) oder der Minderheitenpolitik<br />
im Land findet (Arbeitslager für Sozialhilfeabhängige,<br />
was zum Großteil Roma betrifft; vgl.<br />
<strong>Hinterland</strong> #17) findet.<br />
Dieser völkisch-nationale Diskurs wird von der neofaschistischen<br />
Oppositionspartei Jobbik tatkräftig<br />
unterstützt. Jobbik, die in ihrer Symbolik und Selbstdarstellung<br />
an die nationalsozialistischen Pfeilkreuzler<br />
anknüpft, konnte sich bei den letzten Wahlen mit<br />
knapp 17 Prozent der Stimmen als drittstärkste parlamentarische<br />
Kraft etablieren. Viktor Orbán und die<br />
Fidesz, die eine parlamentarische Zwei-Drittel-Mehrheit<br />
erlangen konnten, verdanken ihren deutlichen<br />
Wahlerfolg auch dem Spiel mit dem Feuer solcher<br />
Gruppen. Jobbik, die einen militanten Antiziganismus<br />
propagiert, gegen „raffendes, jüdisches Kapital“ wettert<br />
und den nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg<br />
unterzeichenten Friedensvertrag von Trianon annulieren<br />
und damit „Großungarn“ wiederherstellen will,<br />
grenzt sich jedoch heute vehement von der amtieren-<br />
den Regierung ab. Diese gilt den Neo-Faschist_innen<br />
als nur scheinbar national. Jobbik setzt ihre Kontakte<br />
in das gut organisierte rechtsextreme Netzwerk<br />
öffentlich in Szene und unterstützt auch die Gegenmobilisierung<br />
zur Budapest Pride.<br />
LGBTIQ-Community in Budapest<br />
In der LGBTIQ-Community in<br />
Budapest steht Zugehörigkeit von<br />
Roma ebenfalls zur Debatte.<br />
Auch die LGBTIQ-Community in Budapest steht nicht<br />
außerhalb des völkisch-nationalen Diskurses. Beim<br />
Pride-Festival 2011 kristallisierten sich die Debatten<br />
diesbezüglich um einen von den Organisator_innen<br />
verteilten Anstecker, einer Kokarde, die zur Hälfte die<br />
Farben der ungarischen Flagge, zur anderen Hälfte<br />
die Regenbogenfarben zeigte. Mit dem Anstecker soll,<br />
so eine_r der Organisator_innen, die Hegemonie<br />
einer rechten Definition von Zugehörigkeit in Frage<br />
gestellt werden, wie Fidesz sie popularisiere. Ungarisch<br />
zu sein bedeute „viel mehr“ und nicht die Regierungspartei<br />
dürfe vorgeben, wie ungarische Menschen<br />
zu leben hätten. Kritiker_innen<br />
wiesen hingegen auf die Gefahren<br />
des - immer auf Ausschlüssen<br />
basierenden - Nationenkonzepts<br />
hin. „Ich bin nicht ungarisch“,<br />
sagt ein ungarischer Aktivist<br />
und bastelt sich eine Regenbogenkokarde<br />
ohne ungarische<br />
Farben. Zwei politische Strategien,<br />
auf einen Diskurs zu reagieren,<br />
in dem LGBTIQ-Menschen<br />
mit „nem vagy magyar“<br />
(„Du bist nicht ungarisch“) beschimpft werden. Eine<br />
dritte wäre die Emigration: „Ach wenn es nur so<br />
wäre!“, meint eine an der Pride teilnehmende Person.<br />
Die ungarische Nation produziert ihre Figuren „nationaler<br />
Anderer“. Dieser Diskurs macht nicht halt vor der<br />
LGBTIQ-Community und erschwert es, sich zusammen<br />
zu tun. Dabei scheint eine Strategie der „joint forces“<br />
doch naheliegend. Auf der Parade fand sich jedoch<br />
auch eine Gruppe, die sich „Pink Block“ nannte. Einer<br />
der Slogans: „Solidarity with Roma-LGBTIQ!“ Damit<br />
reagierten sie auf einen Vorfall bei einer Festival-Party<br />
am Vorabend, wo drei Roma Transgender-Personen<br />
der Einlass verweigert wurde. Daraufhin kam es zu<br />
einem Streit in der Organisationsgruppe. Die drei Personen<br />
kommen angeblich aus dem Dorf Gyöngyöspata<br />
und haben dort sowohl die aufmarschierten Bürgerwehrtruppen<br />
zu fürchten (vgl. <strong>Hinterland</strong> #17) als<br />
auch von der Roma-Gemeinschaft wenig Unterstützung<br />
zu erwarten. In der LGBTIQ-Community in Budapest<br />
steht ihre Zugehörigkeit nun ebenfalls zur Debatte.
Antisemitismus und<br />
Homophobie<br />
Um ein solidarisches Zeichen<br />
gegen diese aktuellen und sich<br />
immer mehr zuspitzenden Entwicklungen<br />
in Ungarn zu setzen,<br />
fand sich in diesem Jahr eine Gruppe von Aktivist_innen<br />
des wiener Bündnisses radicalqueer (radicalqueer.blogsport.eu)<br />
zusammen, um die Pride in<br />
Budapest zu unterstützen. Die seit den 1990ern auch<br />
in der ungarischen Hauptstadt stattfindende Parade<br />
konnte lange Zeit ohne größere Schwierigkeiten veranstaltet<br />
werden. Erst seit 2007 ist sie zum Angriffspunkt<br />
von rechten und neonazistischen Gruppen<br />
geworden, die die Teilnehmenden physisch angriffen,<br />
mit Steinen und Eiern bewarfen und einschüchterten.<br />
Ähnlich wie in den Vorjahren wurde auch heuer<br />
bereits im Vorfeld versucht, die Pride mit Hilfe von<br />
fadenscheinigen Vorwänden und Argumenten zu verbieten.<br />
Die Parade selbst konnte nur durch ein massives<br />
Polizei- und Security-Aufgebot und weiträumige<br />
Absperrungen von Straßen entlang der Route durch<br />
Zäune ermöglicht werden. Auch in diesem Jahr nahmen<br />
Mitglieder der inzwischen eigentlich verbotenen<br />
paramilitärischen „Ungarischen Garde” an der Gegendemonstration<br />
teil, die von der Gruppe „Jugendbewegung<br />
der 64 Burgkomitate“ zusammen mit Jobbik-Parlamentarier_innen<br />
angemeldet worden war. Es kam<br />
zu Flaschen- und Steinwürfen. Einige Gegendemonstranten<br />
störten die Pride am Rand mit homophoben<br />
und antisemitischen Aktionen. Sie zeigten den „Hitler-<br />
Gruß“, hielten Plakate in die Luft, auf denen rosa<br />
Winkel mit Galgenstrick und der Text: „So gehört mit<br />
Schwulen umgegangen!“ zu sehen waren, artikulierten<br />
andere verbale Morddrohungen und Drohungen<br />
in Form von gestikuliertem Durchschneiden der<br />
Kehle. Auf Videos von der Gegendemonstration sind<br />
Sprechchöre zu hören: „Verdreckte Schwuchteln! Verdreckte<br />
Juden!“.<br />
Angriffe auf die Parade<br />
An einem zentralen Platz entlang der Route hatten<br />
zudem an die 100 Neonazis einen Durchbruchversuch<br />
gestartet, der von der Polizei durch den Einsatz von<br />
Pfefferspray abgewendet werden konnte und zu einer<br />
kurzfristigen Routenänderung der Parade führte. Nach<br />
Ende der Pride stürmten etwa 15 Neonazis aus einer<br />
Seitenstraße auf die Aktivist_innen aus Österreich.<br />
Neben einem Angriff mit einem bestialisch stinkendem<br />
Reizspray, der von zwei Frauen durchgeführt<br />
wurde, kam es erneut zu Morddrohungen und Hitlergrüßen.<br />
Beim Eintreffen der Polizei behaupteten die<br />
So gehört mit Schwulen<br />
umgegenagen<br />
Neonazis jedoch, sie wären von<br />
den LGBTIQ-Aktivist_innen angegriffen<br />
worden. Daraufhin wurden<br />
alle Aktivist_innen von der<br />
Polizei aus dem Bus gezerrt, in<br />
den sie geflüchtet waren. Ihnen<br />
wurden die Pässe abgenommen<br />
und anschließend einzeln den Neonazis vorgeführt.<br />
Diese identifizierten willkürlich zwei Teilnehmer_<br />
innen als vermeintliche Täter_innen, die in weiterer<br />
Folge auf eine Polizeistation mitgenommen, in<br />
Gefängniszellen gesperrt und in den frühen Morgenstunden<br />
vernommen und angezeigt wurden. Dass es<br />
dabei Aktivist_innen traf, die aus Österreich angereist<br />
waren, kann als reiner Zufall gesehen werden, da<br />
auch andere Teilnehmer_innen der Parade auf dem<br />
Heimweg bedroht und eingeschüchtert wurden. Der<br />
Angriff war nach weiteren Erkenntnissen eine gut<br />
geplante und vorbereitete Aktion. Involviert waren<br />
offensichtlich Mitglieder der „64 Burgkomitate Jugendbewegung“<br />
(HVIM) sowie der Abgeordnete der Partei<br />
Jobbik, Gyula Györyg Zagyva, der gleichzeitig auch<br />
als Vorsitzender der HVIM fungiert und die Anwältin<br />
Andrea Borbély vom Jobbik-Rechtshilfedienst, die<br />
auch die paramilitärische „Ungarische Garde” vertritt.<br />
Solidarität mit dem Budapest Pride!<br />
Trotz der vorangegangenen Angriffe stilisierten sich<br />
die Täter_innen als Opfer. Die Polizei behandelte die<br />
Gruppe aus Wien, offenbar aufgrund einer Intervention<br />
des Jobbik-Abgeordneten, forthin als Verdächtige.<br />
Diese Umkehrung von Schuld setzt Jobbik systematisch<br />
ein, um auch auf juristischem Wege gegen Teilnehmer_innen<br />
der Pride vorzugehen. Wenngleich die<br />
beiden Aktivist_innen aus Österreich noch in den frühen<br />
Morgenstunden wieder frei gelassen wurden, ist<br />
bislang noch unklar, ob tatsächlich ein Verfahren<br />
gegen sie eingeleitet wird. In jedem Fall zeigt sich<br />
jedoch wie in Budapest von unterschiedlichen Seiten<br />
versucht wird, Teilnehmer_innen der Pride zu kriminalisieren<br />
und einzuschüchtern und wie notwendig<br />
gleichzeitig deren Unterstützung ist.<<br />
queer<br />
Judith Goetz und<br />
Rosemarie Ortner-<br />
leben in Wien und<br />
engagieren sich<br />
queer/feministisch<br />
gegen Rechts
78<br />
queer<br />
NEIN heißt NEIN!<br />
Freizügig bekleidet und mit der stolzen Selbstbezeichnung „Schlampe” gegen Sexismus und Vergewaltigungsmythen<br />
zu demonstrieren ist umstritten. Ein Plädoyer für den „Schlampenmarsch” (SlutWalk)<br />
Von Judith Völkel<br />
Auslöser des globalen Aufstandes der „Schlampen“<br />
war die Bemerkung eines kanadischen<br />
Polizisten, Frauen sollten sich nicht wie<br />
„Schlampen“ anziehen, wollten sie nicht zu Opfern<br />
sexueller Übergriffe werden. In Folge dieses Präventionsvorschlags<br />
– der eine Mitverantwortung der Frau<br />
an der an ihr verbrochenen sexualisierten Gewalt aufgrund<br />
ihrer Kleidung behauptet und somit die Täter-<br />
Opfer-Beziehung umkehrt – fand der erste Protestmarsch<br />
im April 2011 in Toronto statt. Empörte riefen<br />
mit Hilfe sozialer Netzwerke dazu auf, weltweit<br />
Widerstand gegen eine solche Mythisierung von Vergewaltigung<br />
zu leisten. Slutwalks wurden beispielsweise<br />
in Ottawa, Vancouver, Miami, Seattle, Melbourne,<br />
Amsterdam, Stockholm, London,<br />
Paris, Glasgow, São Paulo,<br />
Tegucigalpa und Matagalpa<br />
organisiert. Nach dem ersten<br />
Slutwalk in Deutschland am 23.<br />
Juli dieses Jahres im niederbayerischen<br />
Passau fand die deutschlandweite<br />
Demonstration am 13.<br />
August städteübergreifend im<br />
Ruhrgebiet, in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main,<br />
Stuttgart und München und am 15. Oktober in<br />
Leipzig statt.<br />
Weltweit eint das Aufbegehren gegen die Schuldzuschreibung<br />
an die Opfer sexualisierter Gewalt die<br />
Teilnehmer_innen der Slutwalks. Daneben verfolgen<br />
die verschiedenen Demonstrationen auch lokale<br />
Ziele. So setzt der Slutwalk in Honduras – einem<br />
Land, in dem offene Gewalt gegen Frauen alltäglich,<br />
die Mordrate an Frauen enorm ist und Abtreibung mit<br />
Gefängnis bestraft wird – an einem anderen Punkt<br />
an, als in „westlichen“ Ländern, wo zumindest auf<br />
gesetzlicher Ebene die Gleichberechtigung von Mann<br />
und Frau weitgehend verwirklicht ist.<br />
In München demonstrierten etwa 500 Personen jeden<br />
Alters und Geschlechts – teilweise leicht bekleidet,<br />
teilweise in gewöhnlicher Alltagskleidung. Nach einer<br />
Auftaktkundgebung am Goetheplatz, bei der auch<br />
Cordula Weidner vom Frauennotruf und Maraike<br />
Der Slutwalk ist eine Nicht-<br />
Institution, die aufgrund<br />
ihrer Offenheit Raum für<br />
Engagement bietet.<br />
Stuffler zum Thema LGBT (Lesben, Schwule, Bisexuelle<br />
und Trans) sprachen, zog die Versammlung<br />
durch das Bahnhofsviertel und die Innenstadt auf den<br />
Marienplatz. Dort brachten Katharina Schulze, Vorsitzende<br />
der Münchener Grünen, Juliane von Krause,<br />
Terre des Femmes e.V., Thomas Lechner, Veranstalter<br />
des Candy Clubs, und Simone Kraft, Pressesprecherin<br />
des Antisexistischen Aktionsbündnisses München, in<br />
Redebeiträgen ihre Anliegen zum Ausdruck.<br />
This is not my I-want-you-face<br />
Slutwalk ist Grenzüberschreitung und genau deshalb<br />
eine geeignete Form des Widerstandes. Wenn Menschen<br />
als „Schlampen“ auf die<br />
Straße gehen, wird ein Spiel mit<br />
dem Begriff möglich. Die Definitionsmacht<br />
liegt nun bei den<br />
Bezeichneten selbst. Nachdem<br />
man sich den Begriff angeeignet<br />
hat, kann sich seine Bedeutung<br />
verschieben. „Schlampe“ muss<br />
nicht negativ konnotiert sein.<br />
„Schlampe“ wird zur Forderung nach (sexueller)<br />
Selbstbestimmung, körperlicher Unversehrtheit und<br />
dem Recht auf persönliche <strong>Grenze</strong>n. Allerdings gibt<br />
es auf den Slutwalks keine Kleiderordnung. Um mit<br />
dem Konzept der „Schlampe“ zu spielen muss keine<br />
Selbstidentifikation als „slut“ gegeben sein.<br />
Die große Chance des Slutwalks liegt in der Möglichkeit,<br />
breite Bevölkerungsschichten anzusprechen.<br />
Dies zeigt sich bereits im Organisationsteam, das sich<br />
aus Mitgliedern ganz verschiedener gesellschaftlicher<br />
Gruppierungen zusammensetzt, die sich zu diesem<br />
Anliegen zusammengefunden haben. Der Slutwalk ist<br />
eine Nicht-Institution, die aufgrund ihrer Offenheit<br />
auf vielfältige Art und Weise Raum für Engagement<br />
bietet. Die Demonstrierenden fungieren als Multiplikator_innen<br />
in ihrem Bekanntenkreis, verbreiten das<br />
Anliegen und unterstützen so die Dekonstruktion von<br />
Vergewaltigungsmythen. Der Charakter einer Graswurzel-Bewegung,<br />
die direkt aus der Bevölkerung<br />
erwächst, ist die große Chance die der Slutwalk mit
sich bringt. Die Slutwalk-Bewegung besitzt zudem<br />
das Potential, Menschen anzusprechen, die sich sonst<br />
vom Feminismus – aufgrund der für viele eher negativen<br />
Konnotation des Begriffes – abgrenzen.<br />
Der Slutwalk ist medienwirksam. Ein Anliegen wie<br />
das hier Beschriebene, das eine Veränderung in den<br />
Denkstrukturen der Menschen und im gesellschaftlichen<br />
Diskurs herbeiwünscht, erfordert eine auffällige,<br />
laute, kreative und provozierende Protestform,<br />
die allen Interessierten offen steht, die von Vielen<br />
gesehen und gehört wird. Er kommt jedoch an seine<br />
<strong>Grenze</strong>n, wenn Zeitungen und Online-Plattformen<br />
nur noch Fotostrecken erstellen, auf Untertitel und<br />
erläuternde Texte jedoch verzichten. Leider interpretieren<br />
die Medien den Slutwalk oft als Protest für das<br />
Recht auf Sexyness und stellen in ihren Bildern die<br />
Kleidung in den Vordergrund.<br />
Pass auf, wenn du auf die Straße gehst.<br />
queer<br />
Der Schwerpunkt des Slutwalks in München lag in<br />
der Dekonstruktion von Vergewaltigungsmythen, die<br />
sich trotz augenscheinlicher Diskrepanz zu Kriminalstatistiken<br />
und wissenschaftlicher Forschung hartnäckig<br />
in den Köpfen der Menschen halten. Vergewaltigungen<br />
werden nämlich in den seltensten Fällen<br />
von „bösen Männern“ begangen, die nachts minirocktragenden<br />
weiblichen Opfern hinter Büschen auflauern.<br />
Der Großteil der Vergewaltigungen – je nach<br />
befragter Statistik zwischen 70 und 90 Prozent – wird<br />
im nahen sozialen Umfeld oder Familienkreis begangen;<br />
die Opfer sind nicht nur Frauen, sondern genauso<br />
Kinder, Männer, Trans, alte Menschen oder Personen<br />
mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung.<br />
Die Dekonstruktion des Mythos vom fremden Täter<br />
zeigt auch die Absurdität des Gedankens, der Kleidungsstil<br />
einer Person könne das ausschlaggebende<br />
Moment für eine Vergewaltigung sein. Der Slutwalk in<br />
München spricht sich durch die Offenlegung dieses<br />
Nicht-Zusammenhangs auch ganz klar dafür aus, dass<br />
Präventionsmaßnahmen bei der Person ansetzen müssen,<br />
die das Selbstbestimmungsrecht einer anderen<br />
Person hinsichtlich Körper, Gender, Sexualität und<br />
Begehren nicht respektiert.<br />
„NEIN heißt NEIN“ lautet daher auch ein Motto der<br />
Slutwalks. Dieses Selbstbestimmungsrecht über die<br />
eigene Person ist unabhängig davon, ob Sexualität in<br />
privaten Beziehungen stattfindet oder in Berufen, in<br />
denen Sex zum Arbeitsalltag gehört. Der zum Opfer<br />
gewordene Mensch hat keinen Grund für Schuld,<br />
Scham oder Angst. Es soll ins Gedächtnis gerufen<br />
werden, dass das zentrale Element einer Vergewalti-<br />
gung Macht ist, die durch sexualisiertes Handeln über<br />
eine andere Person ausgeübt wird. Darüber hinaus<br />
richtet sich der Slutwalk gegen die patriarchalischen<br />
und sexistischen Strukturen, die Vergewaltigungsmythen<br />
stützen, Rollenbilder vorgeben und das Selbstbestimmungsrecht<br />
beschränken. Prävention bei denjenigen<br />
anzufangen, die zu Opfern gemacht werden,<br />
ihnen eine Mitschuld zuzusprechen, Tatsachen und<br />
Zusammenhänge zu verschleiern ist Unrecht. Die<br />
Unversehrtheit und das freie Selbstbestimmungsrecht<br />
jedes und jeder Einzelnen ist ein schützenswertes<br />
Ziel. Also: Empört euch!<<br />
Judith Völkel<br />
Foto: Niko (cc)<br />
ist Mitglied des Slutwalk-Organisationsteams<br />
in München<br />
und studiert Ethnologie<br />
an der Ludwig-<br />
Maximilians-Universität<br />
in München.
80<br />
lesen<br />
Silja Klepp: Europa<br />
zwischen Grenzkontrolle<br />
und<br />
Flüchtlingsschutz.<br />
Eine Ethnographie<br />
der Seegrenze auf<br />
dem Mittelmeer.<br />
Transcript Verlag.<br />
Bielefeld 2011. 424<br />
Seiten. 34,80 Euro.<br />
Stephan Dünnwald<br />
ist Ethnologe, freier<br />
Journalist und<br />
forscht derzeit in<br />
Mali.<br />
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />
Ethnographie am Ufer<br />
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />
Silja Klepp ist mit Europa zwischen<br />
Grenzkontrolle und Flüchtlingsschutz<br />
eine sehr lesenswerte Ethnographie<br />
der Seegrenze gelungen. Eine Rezension<br />
von Stephan Dünnwald<br />
Das Mittelmeer als umkämpfter<br />
Grenzraum zog in den letzten<br />
Jahren immer wieder Aufmerksamkeit<br />
auf sich. Gegen irreguläre Einwanderung<br />
nach Europa wurden<br />
zunehmend militärische Maßnahmen<br />
ergriffen. Die eingesetzten<br />
Einheiten hatten einerseits damit<br />
umzugehen, Migrantinnen und<br />
Migranten nach Möglichkeit nicht<br />
in die Nähe europäischen Territoriums<br />
gelangen zu lassen, andererseits<br />
schiffbrüchige Migrantinnen<br />
und Migranten zu retten und in<br />
den nächstgelegenen sicheren<br />
Hafen zu bringen. Dies gelingt<br />
nicht immer, und so kursieren verschiedene,<br />
aber gleichermaßen<br />
erschreckende Zahlen und Schätzungen<br />
über diejenigen, die auf<br />
See umgekommen sind, ertrunken,<br />
verhungert, verdurstet. Zu den<br />
Gründen zählt nicht allein das<br />
Unvermögen, das Mittelmeer lückenlos<br />
zu überwachen, sondern<br />
auch ein Zuständigkeitsproblem. Es<br />
liegt im Interesse aller involvierten<br />
Staaten, möglichst wenige Migrantinnen<br />
und Migranten aufnehmen<br />
zu müssen; da auf See die Zuständigkeit<br />
nicht immer deutlich geregelt<br />
werden kann, sterben immer<br />
wieder Menschen, weil ihnen niemand<br />
beherzt zu Hilfe eilt.<br />
Das Dilemma, gleichzeitig zu retten<br />
und abzuwehren, wird inzwischen<br />
häufig dadurch „gelöst“,<br />
dass zunehmend an afrikanischen<br />
Küsten und in enger Kooperation<br />
mit den jeweiligen afrikanischen<br />
Staaten Migrantinnen und Migranten<br />
schon im küstennahen Bereich<br />
zur Umkehr gezwungen werden.<br />
So kann die Bilanz der abgewehrten<br />
Flüchtlinge gleichzeitig als eine<br />
Bilanz der auch vor den Gefahren<br />
des Seewegs nach Europa<br />
geschützten Personen interpretiert<br />
werden. Auch diese Praxis zieht<br />
die Kritik von Menschenrechtsorganisationen<br />
auf sich, da unter<br />
den Zurückgewiesenen regelmäßig<br />
Personen sind, die Anspruch auf<br />
internationalen Schutz beanspruchen<br />
können, und die nicht in<br />
Staaten zurückgewiesen werden<br />
dürften, in denen dieser Schutz<br />
nicht einzufordern ist.<br />
Schwierige Recherchebedingungen<br />
Dies sind nur einige Facetten dieses<br />
umfangreichen Themas, das<br />
von Silja Klepp gekonnt aufgegriffen<br />
und beschrieben wird. Sie<br />
bedient sich dabei einer rechtsanthropologischen<br />
Perspektive, die<br />
zwar von bestehenden Rechtsnormen<br />
ausgeht, aber deren Anwendung<br />
als je lokale Aushandlungsprozesse<br />
begreift. Der Zugang<br />
zum Recht, sei es die seerechtliche<br />
Verpflichtung zur Rettung Schiffbrüchiger,<br />
das Asylrecht oder<br />
internationale Rechte zum Schutz<br />
der Menschenwürde, ist gerade<br />
auf dem offenen Meer nicht per se<br />
gegeben, sondern seine Durchsetzung<br />
wird situativ, lokal und temporär<br />
ausgehandelt, wobei Grenzschutzpersonal,Menschenrechtsorganisationen<br />
sowie Migrantinnen<br />
und Migranten über sehr unterschiedliche<br />
Möglichkeiten verfügen.<br />
Erschwerend kommt hinzu,<br />
dass der Grenzschutz über ein<br />
Beinahe-Monopol hinsichtlich der<br />
Berichterstattung über eigene Aktivitäten<br />
verfügt. In nur wenigen<br />
Fällen gelingt es Migrantinnen und<br />
Migranten oder Menschenrechtsorganisationen,<br />
alternative Darstellungen<br />
von Vorgängen auf See an<br />
die Öffentlichkeit zu bringen.<br />
In dieser Situation tut sich auch<br />
die Ethnographin schwer, an Informationen<br />
zu gelangen. Was auf<br />
See passiert, erschließt sich ihr<br />
nicht unmittelbar, weil es weder<br />
möglich ist, mit den Migrantinnen<br />
und Migranten ins lebensgefährliche<br />
Boot zu steigen, noch, auf<br />
den Patrouillebooten der Grenzwachen<br />
mitzufahren. Die Ethnographin<br />
bleibt an Land (nur ein<br />
einziges Mal darf sie mit einem<br />
Boot der italienischen Küstenwache<br />
hinaus aufs Meer), um dort<br />
das Geschehen zu verfolgen, das<br />
Vertrauen von Hafenangestellten<br />
und Matrosen zu gewinnen,<br />
Gespräche und Geschwätz zu<br />
notieren, und sich daraus eine<br />
Vorstellung dessen zu machen,<br />
was auf See vor sich geht. Sie versucht,<br />
Verantwortungstragende zu<br />
treffen, und mehr als einmal<br />
notiert Klepp, dass bei diesen<br />
Gelegenheiten peinlich darauf<br />
geachtet wurde, dass Gespräche<br />
nicht aufgezeichnet werden. So ist<br />
es verdienstvoll, dass es Silja<br />
Klepp gelungen ist, zahlreiche<br />
Interviews und Gespräche mit<br />
Marineoffizieren, Polizeipersonal<br />
und Behördenvertretungen zu führen,<br />
und von ihnen teils sehr offene<br />
Stellungnahmen zu erhalten.<br />
Auch in Libyen Kontakt mit<br />
Migrantinnen und Migranten aufzunehmen,<br />
ist keine Selbstverständlichkeit.<br />
Man kann nur erahnen,<br />
wie viel Hartnäckigkeit und<br />
Umsicht dieses Vorgehen erfordert<br />
hat, denn all die erfolglosen Kontaktversuche<br />
tragen ja nicht zum<br />
Thema bei und bleiben deshalb<br />
weitgehend unerwähnt.<br />
Vom Recht und dessen<br />
lokaler Durchsetzung<br />
Die Studie von Silja Klepp behandelt<br />
das Thema nicht erschöpfend:<br />
sie konzentriert sich auf den Raum<br />
zwischen Italien, Malta und<br />
Libyen, drei Länder, in denen sie<br />
Feldforschungen durchgeführt hat.
Aber gerade die Konzentration auf<br />
einen Ausschnitt erlaubt eine eingehende<br />
Betrachtung und Analyse<br />
der Dynamiken, die über Wohl<br />
und Wehe der Migrantinnen und<br />
Migranten entscheiden. Inhaltlich<br />
folgt das Buch dem Weg der<br />
Migration vom afrikanischen Kontinent<br />
und der Situation in Libyen<br />
über das Meer nach Süditalien,<br />
Lampedusa und Sizilien, sowie<br />
nach Malta, von einem Ufer zum<br />
anderen. Auch die Situation nach<br />
der Landung und die Unterbringung<br />
in Haftzentren werden<br />
behandelt. Doch folgt die Darstellung<br />
weniger dem linearen oder<br />
prozessualen Modell, sondern<br />
beschreibt zugleich politische<br />
Kraftfelder, die von verschiedenen<br />
Akteuren und Akteurinnen gestaltet<br />
werden. Libyen, Malta und Italien<br />
samt den dazugehörigen Seegebieten<br />
werden zueinander in<br />
Beziehung gesetzt und jeweils einzeln<br />
im Hinblick auf ihr Verhalten<br />
gegenüber Migrantinnen und<br />
Migranten sowie Flüchtlingen und<br />
gegenüber geltenden Rechten analysiert.<br />
So entsteht ein Gesamtbild,<br />
das zahlreiche Widersprüche<br />
sowohl innerhalb der einzelnen<br />
Felder als auch im Verhältnis zwischen<br />
ihnen aufzeigt. Erreicht wird<br />
dies durch die Gegenüberstellung<br />
von internationalen Rechten und<br />
Gesprächen mit Flüchtlingen und<br />
Behörden, in denen deutlich wird,<br />
dass die Geltung dieser Rechte<br />
immer auf lokale Verhältnisse heruntergebrochen<br />
wird. Das Buch<br />
lebt aus dieser Spannung zwischen<br />
Recht und den Möglichkeiten,<br />
Rechte in Grenzräumen auch<br />
durchzusetzen.<br />
Es ist für den Wert der Studie<br />
unerheblich, dass der „Arabische<br />
Frühling“ einige der autokratischen<br />
Systeme in Nordafrika hinweggefegt<br />
hat. Zwar wird sich erst zeigen<br />
müssen, wie die neuen Regierungen<br />
in Tripolis und Tunis sich<br />
zu Transitmigrantinnen und -<br />
migranten stellen, die sich in Richtung<br />
Europa einschiffen. Die<br />
grundlegende Problematik bleibt<br />
dennoch bestehen und Silja Klepp<br />
ist vom Ufer aus eine sehr lesenswerte<br />
Ethnographie der Seegrenze<br />
gelungen.<<br />
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />
„Mach doch mal einer den<br />
Kulturkack aus!“<br />
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />
… „Ach geht ja gar nicht, lass<br />
bloß an, bin ja selber drin“, sangen<br />
Blumfeld auf ihrer Platte<br />
„Ich-Maschine“ (1992). Dieses<br />
schöne Zitat ziert den Einband<br />
des kürzlich erschienenen Sammelbandes<br />
Pop Kultur Diskurs.<br />
Aber auch drinnen, in den Tiefen<br />
des Buches, wird es durchaus<br />
lesenswert – meint Thomas Atzbacher<br />
Doch zunächst der erste Eindruck:<br />
Die Comicfigur Theodor<br />
Adornos gedankenversunken<br />
und scratchend am Turntable; die<br />
Zeichnung einer jungen Frau, die<br />
sich dem muffigen Talar zum Trotz<br />
als Punkrockerin zu erkennen gibt;<br />
im farblich davon abgesetzten<br />
Hintergrund, neben anderen Produkten,<br />
ein Sammelsurium an<br />
Schallplatten unter anderem von<br />
Run DMC, den Pet Shop Boys und<br />
AC/DC; die „Kutte“ eines Bier trinkenden<br />
Fußball-Fans, auf deren<br />
Rückenseite neben einem Aufnäher<br />
mit dem Schriftzug „Südkurve“<br />
ein weiterer angebracht ist. Auf<br />
diesem ist jedoch kein FC-Bayern-<br />
Wappen, sondern eine dickrandige<br />
Brille abgebildet. Umrahmt wird<br />
das Logo vom Schriftzug „Frankfurter<br />
Schule“. Dies alles ist auf<br />
dem Einband eines kürzlich im<br />
Mainzer Ventil Verlag erschienenen<br />
Sammelbandes zu sehen.<br />
Pop Kultur Diskurs ist dem vor<br />
einem Jahr verstorbenen Autor<br />
und Verleger Martin Büsser gewid-<br />
met und setzt sich mit (Pop-)Kultur<br />
im Allgemeinen, stärker jedoch<br />
im Besonderen auseinander. Das<br />
Buch versammelt vielfältige<br />
Zugänge. Geeint werden die verschiedenen<br />
Themen und Betrachtungsweisen<br />
von gemeinsamen<br />
Fragestellungen, die eben auch<br />
schon jene Theoretiker der „Frankfurter<br />
Schule” wie Theodor Adorno<br />
und Walter Benjamin umtrieben:<br />
Wo liegen die subversiven<br />
Momente von (Pop-)Kultur? Gibt<br />
es bzw. kann es so etwas überhaupt<br />
geben? Worin sind die<br />
bestehenden Verhältnisse affirmierender<br />
Momente von (Pop-)Kultur<br />
zu sehen?<br />
Dass sich durch die Wahl der vermeintlich<br />
richtigen Produkte und<br />
Lifestyles gar ein erfülltes Leben<br />
verwirklichen lasse, wird bereits in<br />
der Einleitung von Pop Kultur<br />
Diskurs verneint. Allerdings weisen<br />
die Verfassenden darauf hin,<br />
dass popkulturelle Ereignisse und<br />
Erzeugnisse durchaus im progressiven<br />
Sinn widerständig sein können.<br />
Das müssen sie aber nicht<br />
automatisch. Ganz im Gegenteil.<br />
Die Rechtsrockband Störkraft etwa<br />
sang Anfang der 90er, als in<br />
Deutschland Unterkünfte von Asylsuchenden<br />
brannten: „Nieder mit<br />
dem Misch-Masch Blut, das tut<br />
dem Vaterland nicht gut“.<br />
„Is this it?“<br />
Was ist das eigentlich: Pop? Mit<br />
dieser Fragestellung setzt sich<br />
Roger Behrens im ersten Buch-<br />
Beitrag auseinander. Auf zugegeben<br />
nicht immer leicht zu lesende,<br />
essayistische Weise wirft er ein<br />
Schlaglicht auf die „traditionelle<br />
Poptheorie“. Die Ergebnisse der<br />
heute „fröhlichsten Wissenschaft“<br />
seien für die Rankings der neoliberalen<br />
Bachelor-Universität zwar<br />
positiv, letztlich jedoch belanglos.<br />
Dementgegen plädiert er dafür, die<br />
Thesen von Adorno und Co. nicht<br />
lesen<br />
Holger Adam, Yaflar<br />
Aydin, Zülfukar<br />
Cetin, Mustafa Doymus,<br />
Jonas Engelmann,<br />
Astrid Henning,<br />
Sonja Witte<br />
(Hg.): Pop Kultur<br />
Diskurs. Zum Verhältnis<br />
von Gesellschaft,Kulturindustrie<br />
und Wissenschaft.<br />
Ventil Verlag.<br />
Mainz 2010. 15 Beiträge.<br />
288 Seiten.<br />
14,90 Euro.
82<br />
lesen<br />
zu verwerfen, sondern zeitgemäß,<br />
als „kritische Poptheorie“ zu aktualisieren.<br />
Gerade in Zeiten von<br />
Bologna seien die Möglichkeiten,<br />
das auch tatsächlich in Angriff zu<br />
nehmen, jedoch sehr begrenzt.<br />
Behrens herausstechender Artikel<br />
hinterlässt einen deprimierenden<br />
Beigeschmack. Das spricht nicht<br />
gegen seine Thesen, sondern<br />
gegen die Verhältnisse.<br />
Anschließend stellen sich Holger<br />
Adam und Jonas Engelmann die<br />
Frage nach der Bedeutung von<br />
Popkultur für die eigene politische<br />
Sozialisation. Welche Rolle kann<br />
bzw. konnte insbesondere Musik<br />
für das politische Denken und<br />
Handeln junger linker Menschen<br />
spielen, die in deutschen Kleinstädten<br />
oder auf Dörfern leben<br />
und sich fernab von Antifa- oder<br />
Gewerkschaftszusammenhängen<br />
bewegen?<br />
„Arme kleine Deutsche“<br />
Auch wird die Frage nach dem<br />
„Pop im Dienste der Nation“<br />
gestellt. Vor diesem Hintergrund<br />
setzt sich Sonja Witte mit dem<br />
2003 erschienenen Spielfilm „Das<br />
Wunder von Bern“ auseinander.<br />
Sie vertritt die These, dass Sönke<br />
Wortmanns Film von einem Programm<br />
der nationalen Versöhnung<br />
im letztlich angeblich schuldfreien<br />
deutschen Kollektiv bestimmt sei.<br />
Witte zeigt anhand der filmischen<br />
Darstellung der Fußballweltmeisterschaft<br />
von 1954 den Wunsch<br />
nach einer Geburtsstunde eines<br />
„neuen Deutschlands“ auf. Die<br />
„Idee einer Versöhnung der Generationen<br />
und Geschlechter“ fungiere<br />
laut Witte als kollektiver Kitt.<br />
Der Beitrag ist ausgesprochen<br />
lesenswert, allerdings wäre mit<br />
einem stärker vergleichenden<br />
Ansatz, der in die Analyse zusätzlich<br />
Filme wie beispielsweise „Der<br />
Untergang“ (2004) und „Der Vorleser“<br />
(2008/2009) miteinbezieht,<br />
mehr Neues zu erfahren gewesen.<br />
Um die nationale Inanspruchnahme<br />
von Popkultur im Deutschland<br />
nach 1945 geht es auch in Martin<br />
Büssers Beitrag „Made in Germany“.<br />
Thematisiert werden der<br />
Mythos von Popmusik als genuin<br />
linker Ausdrucksform sowie die<br />
von einer antiamerikanischen<br />
Stoßrichtung bestimmten Diskussionen<br />
um eine gesetzliche Radioquote<br />
für „deutsche Musik“ Mitte<br />
der 90er und 00er. Der Lobhudelei<br />
für den „Popstandort Deutschland“<br />
und die „eigene kulturelle Identität“<br />
schlossen sich nicht nur Altbekannte<br />
wie Heinz-Rudolf Kunze<br />
an. Auch junge Kunstschaffende<br />
wie Smudo von den Fantastischen<br />
Vier oder der als politisch links<br />
geltende Jan Delay traten für die<br />
Deutsch-Quote ein. Die Quote<br />
gegen die „beispiellose Vernichtungsaktion<br />
gegen unsere einheimische<br />
Musikszene“ (Musiker<br />
Achim Reichel) und „die Allmacht<br />
des amerikanischen Kulturimperialismus“<br />
(Wolfgang Thierse) wurde<br />
nie verwirklicht. Allerdings sorgte<br />
allein das permanente Reden vom<br />
angeblich gebeutelten „Popstandort<br />
Deutschland“ für dessen immer<br />
stärkere Aufwertung.<br />
Es ging dabei weniger um rein<br />
wirtschaftliche Standortlogik, als<br />
vielmehr um den Ausdruck und<br />
die Festigung des veränderten<br />
nationalen Selbstbewusstseins in<br />
der Berliner Republik. Das zeigt<br />
Büsser insbesondere anhand der<br />
Berliner Elektropop-Band MIA auf.<br />
Diese verdeutlichen laut Büsser<br />
den „Wandel von den mit Tabus<br />
spielenden Bands wie Rammstein<br />
hin zu einem enttabuisierten<br />
Patriotismus.“ MIA veröffentlichten<br />
2003, unter dem Eindruck des<br />
„Neins“ der deutschen Bundesregierung<br />
zum Irak-Krieg, ihren<br />
Song „Was es ist“. Darin warben<br />
sie dafür, nach Jahren der angeblichen<br />
Verkrampfung ein „neues<br />
deutsches Land“ zu betreten. Im<br />
dazugehörigen Musikvideo zeigten<br />
sich die Bandmitglieder lebensfroh-augenzwinkernd,<br />
tanzend,<br />
weltoffen, flippig-individuell,<br />
irgendwie „links“ und last but not<br />
least: jeweils in die Farbe schwarz,<br />
rot oder gold gehüllt. Jetzt, wo<br />
man „nicht mehr fremd im eigenen<br />
Land“ (MIA) sei, wäre ein<br />
„unverkrampfter Patriotismus“<br />
(Roland Koch) angebracht – freilich<br />
auch wegen Ökostrom.<br />
„Ich wünschte, ich würde mich<br />
für Tennis interessieren“<br />
Darüber hinaus finden sich in Pop<br />
Kultur Diskurs weitere Beiträge,<br />
die mal mehr essayistisch, mal<br />
mehr in wissenschaftlichem Jargon<br />
verfasst sind. Unter anderem setzt<br />
sich Yaflar Aydin anhand des<br />
Romans „Su Cilgin Türkler“ mit<br />
nationalen Mythen in der türkischen<br />
Literatur auseinander. Matthias<br />
Rauch fragt nach den Identitätsentwürfen<br />
von deutschen Mainstream<br />
Rappern mit „Migrationshintergrund“<br />
(Rauch). Als Fallbeispiele<br />
wählt er Samy Deluxe, den<br />
als „Der N...“ auftretenden Aggro-<br />
Berlin Rapper B!Tight, Azad sowie<br />
Eko Fresh. Zülfukar Cetin beleuchtet<br />
auf leider oberflächliche Weise<br />
die transnationale massenmediale<br />
Darstellung von Lesben, Schwulen,<br />
Transvestiten und Transgendern.<br />
Arne Schröder setzt sich leider mit<br />
ebenso wenig Tiefgang mit der<br />
Aushandlung sexueller Identitätskonzepte<br />
in den US-Fernsehserien<br />
„Queer as Folk“ und „The L Word“<br />
auseinander. In einem spannenden<br />
Beitrag im letzten Teil des Buches<br />
fragt Jan Haut danach, „was Sport<br />
über die Gesellschaft ,verrät’“.<br />
Dabei diskutiert er die Thesen und<br />
Konzepte der „soziologischen<br />
Klassiker“ Norbert Elias, Pierre<br />
Bourdieu und Theodor Adorno.<br />
Pop Kultur Diskurs ist ganz gewiss<br />
kein Meilenstein in der Ausein
andersetzung mit (Pop-)Kultur.<br />
Welche Bedeutungen und Funktionen<br />
Pop heute im kapitalistischen<br />
Hier und Jetzt ganz grundsätzlich<br />
hat – darauf finden sich in Pop<br />
Kultur Diskurs kaum Antworten;<br />
man bleibt stattdessen oftmals rein<br />
beschreibend im empirischen<br />
Kleinklein. Immerhin entstehen<br />
durch viele Beiträge neue Fragen,<br />
die anregen, tiefer zu gehen, weiter<br />
zu denken, zu diskutieren.<br />
Auch merkt man dem Sammelband<br />
teilweise an, dass er als<br />
Ergebnis einer Promovierenden-<br />
Tagung der an den DGB angeschlossenen<br />
Hans-Böckler-Stiftung<br />
entstanden ist und weniger in den<br />
Zusammenhängen der emanzipatorischen<br />
Linken. Das Buch ist<br />
nichtsdestotrotz durchaus lesenswert.<<br />
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />
Man wird doch wohl noch<br />
sagen dürfen<br />
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />
Im August 2010 erschien Thilo<br />
Sarrazins Untergangsparanoia<br />
„Deutschland schafft sich ab“.<br />
Daraus entwickelte sich die<br />
sogenannte Sarrazindebatte,<br />
eine in ganz Deutschland virulent<br />
und medial geführte Auseinandersetzung.<br />
Der kürzlich<br />
erschienene Sammelband Rassismus<br />
in der Leistungsgesellschaft<br />
widmet sich dem „was aus<br />
Sarrazin und den Debatten<br />
sprach und spricht“. Eine Rezension<br />
von Thomas Atzbacher<br />
Thilo Sarrazins Bestseller<br />
„Deutschland schafft sich ab“ wirkt<br />
nach – nicht zuletzt auch auf die<br />
Anzahl anschließend veröffentlichter<br />
kritischer Analysen. Mit Rassismus<br />
in der Leistungsgesellschaft<br />
ist soeben ein Sammelband<br />
erschienen, der unterschiedliche<br />
theoretische Perspektiven aus verschiedenen<br />
wissenschaftlichen Dis-<br />
ziplinen versammelt. Im Zentrum<br />
der insgesamt 15 Beiträge steht<br />
weniger die Person Sarrazin oder<br />
die Widerlegung seiner Behauptungen.<br />
Zwar bilden diese den<br />
Bezugsrahmen, doch sollen vor<br />
allem die ihnen inhärenten kollektiven<br />
Vorstellungen kritisch in den<br />
Blick genommen werden, also das<br />
„was aus Sarrazin und den Debatten<br />
sprach und spricht“. Dazu<br />
unterteilt sich das Buch in vier<br />
thematische Teile: „Migration und<br />
Rassismus“, „Bevölkerungs- und<br />
Biopolitik“, „Kapital und Nation“<br />
und „Interventionen und Perspektiven“.<br />
Von „Rasse“ zu „Kultur“<br />
Ausgangspunkt eines Beitrags von<br />
Yasemin Shooman im ersten Thementeil,<br />
ist die Annahme, dass es<br />
sich bei dem in Sarrazins Behauptungen<br />
enthaltenen antimuslimischen<br />
Rassismus um eine „Form<br />
des Kulturrassismus“ handle. Vor<br />
diesem Hintergrund analysiert sie<br />
dessen Inhalte, Funktionen und<br />
Legitimationsstrategien. Dazu liefert<br />
Shooman auch statistische<br />
Daten aus repräsentativen Umfragen.<br />
Man erfährt etwa, dass knapp<br />
58% der Deutschen Ende 2010 die<br />
Forderung nach einer erheblichen<br />
Einschränkung der Religionsausübung<br />
für Menschen islamischen<br />
Glaubens befürworteten. Ein Jahr<br />
später behaupteten rund 76% der<br />
Deutschen, dass „die muslimischen<br />
Ansichten über Frauen“ „unseren<br />
Werten“ widersprechen – um zu<br />
einem Großteil im Anschluss die<br />
Meinung zu vertreten, „Frauen<br />
sollten ihre Rolle als Ehefrau und<br />
Mutter ernster nehmen“. Leider<br />
verzichtet Shooman darauf, die<br />
historischen Konstruktions- und<br />
Entstehungsprozesse der gegenwärtigen<br />
Vorstellungen von „dem<br />
Orient“ und „dem Islam“ nachzuzeichnen<br />
– ein spannender<br />
Aspekt, der wichtiger gewesen<br />
wäre, als der knappe Verweis auf<br />
Parallelen zwischen antimuslimischem<br />
Rassismus und Antisemitismus,<br />
für dessen Bestimmung sie<br />
gar nicht über das 19. Jahrhundert<br />
hinausgeht. Wenn sie in ihrem<br />
Beitrag auf Parallelen zum Antisemitismus<br />
hinweist, sollte sie auch<br />
die klar erkennbaren Unterschiede<br />
herausarbeiten.<br />
Vom Kopf auf die Füße<br />
Wie neo- bzw. kulturrassistische<br />
Begriffe und Konzepte den wissenschaftlichen<br />
Diskurs um den<br />
Themenkomplex Migration im<br />
Nachkriegsdeutschland bestimmen,<br />
verdeutlicht Sabine Hess in ihrem<br />
Beitrag „Welcome to the container“.<br />
Sie argumentiert, dass die<br />
deutsche Mainstream-Migrationsforschung<br />
Migration grundsätzlich<br />
als Problem konzipiere sowie der<br />
mythologischen, faktenresistenten<br />
Vorstellung eines „stabil-homogenen<br />
Gesellschaftscontainers“ verhaftet<br />
sei. Auch werde Migration<br />
insbesondere als „kulturelle Differenz-Erfahrung“<br />
gedeutet, womit<br />
der „Kulturalisierung der Migration“<br />
beziehungsweise der „Desozialisierung<br />
des Sozialen“ Vorschub<br />
geleistet werde. Dem stellt<br />
Hess alternative Sicht- und Herangehensweisen<br />
gegenüber. Sie tritt<br />
insbesondere dafür ein, „die bisherige<br />
Blickrichtung vom Kopf auf<br />
die Füße zu stellen“ und „aus der<br />
Perspektive der Migration“ zu forschen.<br />
Was das aber für die Forschungspraxis<br />
konkret bedeuten<br />
könnte, thematisiert Hess leider<br />
nur sehr ungenau.<br />
Wo, wie auch im Falle Sarrazins,<br />
bevölkerungspolitische Argumente<br />
Einzug in die Debatten um Migration<br />
erhalten, geht es immer auch<br />
um Frauen als Reproduzentinnen.<br />
Juliane Karakayali vertritt in ihrem<br />
herausstechenden Aufsatz die<br />
These, dass die bevölkerungspolitischen<br />
Überlegungen Sarrazins<br />
gerade nicht „Ausdruck eines<br />
lesen<br />
Sebastian Friedrich<br />
(Hg.): Rassismus in<br />
der Leistungsgesellschaft.Analysen<br />
und kritische<br />
Perspektiven zu<br />
den rassistischen<br />
Normalisierungsprozessen<br />
der „Sarrazindebatte“.Edition<br />
Assemblage.<br />
Münster 2011. 15<br />
Beiträge. 264 Seiten.<br />
19,80 Euro.
84<br />
lesen<br />
Thomas Atzbacher<br />
lebt und arbeitet in<br />
München.<br />
dumpfen Konservativismus“ seien,<br />
wie er etwa von der ehemaligen<br />
Fernsehmoderatorin Eva Herrmann<br />
vertreten wird. In seinem „Interesse<br />
am Uterus der Akademikerin“<br />
träfe er sich vielmehr mit Ursula<br />
von der Leyen; beide deuten soziale<br />
Ungleichheit „als Folge individueller<br />
oder kultureller Leistungsschwäche“<br />
– und nicht als Folge<br />
kapitalistischer Produktionsweise.<br />
Am Beispiel des 2007 eingeführten<br />
Elterngeldes, das Besserverdienende<br />
zum Kinderkriegen ermutigen<br />
und Arme davon abhalten soll,<br />
streicht Karakayali heraus, dass<br />
sich die aktuelle deutsche Bevölkerungspolitik<br />
in ihrer Logik lediglich<br />
in einem Punkt von den Überlegungen<br />
Sarrazins unterscheide,<br />
nämlich der Begründung. Denn<br />
obwohl der SPD-Politiker behauptet,<br />
Intelligenz werde durch Gene<br />
vererbt, eint beide Perspektiven<br />
ein „radikalisierter Erfolgsindividualismus“.<br />
Die von Sarrazin pauschal<br />
angenommene Traditionalität<br />
muslimischer Migrantinnen stehe<br />
mit diesem Konzept des „neoliberalen<br />
Leistungssubjekts“ in doppelter<br />
Hinsicht im Widerspruch.<br />
Mit Bevölkerungs- und Biopolitik<br />
setzt sich auch Elke Kohlmann in<br />
ihrem spannenden Beitrag „Die<br />
Ökonomie lügt doch … und zur<br />
Hölle mit Goethe!“ auseinander.<br />
Hier analysiert sie den Stellenwert<br />
der Ökonomie in „Deutschland<br />
schafft sich ab“ und wirft die<br />
Frage auf, inwieweit die dort enthaltenen<br />
Kategorisierungen noch<br />
als Form des (Neo-) Rassismus<br />
gefasst werden können und ob es<br />
nicht schon passender wäre, von<br />
Post-Rassismus zu sprechen.<br />
Was dem Buch fehlt<br />
In ihren Beiträgen unter der Rubrik<br />
„Kapital und Nation“ widmen sich<br />
Jürgen Link, Christoph Butterwege<br />
und Jörg Kronauer den nationalistischen<br />
Großmachtvorstellungen,<br />
Kapitalinteressen und den<br />
Zusammenhängen der von Sarrazin<br />
bedienten Diskurse. Es wird<br />
betont, dass dessen problematische<br />
Haltung gegenüber der „Unterschicht“<br />
in der „Sarrazindebatte“<br />
bezeichnenderweise nahezu ausgeklammert<br />
wurde. Auch wird kritisiert,<br />
dass ebenso wenig die symptomatische<br />
Aussage Christian<br />
Wulffs anlässlich des Tags der<br />
Deutschen Einheit im Oktober<br />
2010 zur Diskussion gestellt wurde.<br />
Der Bundespräsident forderte<br />
damals: „Deutschland – mit seinen<br />
Verbindungen in alle Welt – muss<br />
offen sein gegenüber denen, die<br />
aus allen Teilen der Welt zu uns<br />
kommen. Deutschland braucht sie!<br />
Im Wettbewerb um kluge Köpfe<br />
müssen wir die Besten anziehen<br />
und anziehend sein, damit die<br />
Besten bleiben.“<br />
Dass ein Großteil der Beiträge in<br />
Rassismus in der Leistungsgesellschaft<br />
in einer sehr trockenen, den<br />
universitären Darstellungskonventionen<br />
verhafteten Sprache verfasst<br />
ist, ist schade, wenn auch gewissermaßen<br />
nachvollziehbar. Mehr<br />
polemische oder essayistische<br />
Farbtupfer hätten dem Sammelband<br />
auf jeden Fall gut getan. Zu<br />
guter Letzt wäre es spannend<br />
gewesen, nach den historischen<br />
Vorläufern deutscher Untergangsliteratur<br />
vom Schlage Sarrazins zu<br />
fragen, wie dies etwa Volker Weiß<br />
in seinem 2011 erschienenen Essay<br />
„Deutschlands Neue Rechte.<br />
Angriff der Eliten – Von Spengler<br />
bis Sarrazin“ getan hat. Alles in<br />
allem ist Rassismus in der Leistungsgesellschaft<br />
aber auf jeden<br />
Fall eine Lektüre wert.
Eine deutsche Botschaft<br />
Flüchtlingsfamilien sind oftmals hunderte Kilometer voneinander getrennt. Sie verlieren einander auf der<br />
Flucht oder nur ein Teil macht sich auf den langen und gefährlichen Weg nach Europa. Wenn es ihr Aufenthaltsstatus<br />
erlaubt, haben sie das Recht, ihre Partner und minderjährigen Kinder nachzuholen. Doch<br />
die Familienzusammenführung scheitert oft an den bürokratischen und finanziellen Hürden, die in den<br />
letzten Jahren sukzessive aufgebaut wurden. Eine besonders unrühmliche Rolle spielt dabei die deutsche<br />
Botschaft in Nairobi. Von Tobias Klaus und Anna-Katinka Neetzke<br />
Seit vier Jahren ist Herr Jeylaani aus Somalia von<br />
Frau und Kindern getrennt. In Somalia war er<br />
als Goldschmied tätig bis zu dem Tag, an dem<br />
die Al-Schabab-Miliz ihm verbot, weiterhin sein<br />
Handwerk auszuüben und ihm mit Verstümmelung<br />
und Tod drohte. In Deutschland fand er Schutz, doch<br />
seine Frau und seine drei Kinder schafften es nur bis<br />
nach Nairobi, wo sie nun unter katastrophalen Bedingungen<br />
in einem Slum leben. Der somalische Flüchtling<br />
leidet sehr unter der Trennung und seine<br />
Gesundheit verschlechtert sich von Tag zu Tag. Zwei<br />
Bypass-Operationen hat er bereits hinter sich. Aufgrund<br />
seiner Flüchtlingsanerkennung hat er das<br />
Recht, seine Familie nach Deutschland zu holen und<br />
zu schützen. Dazu musste seine Frau bei der deutschen<br />
Botschaft in Nairobi die<br />
Visa beantragen. Doch einen<br />
Termin zu bekommen ist mittlerweile<br />
fast unmöglich. „Das<br />
Hauptproblem liegt ganz klar<br />
bei der deutschen Botschaft in<br />
Nairobi“, sagt die Münchner<br />
Rechtsanwältin Ingvild Stadie.<br />
„Seit geraumer Zeit ist die faktische<br />
Visaantragstellung kaum<br />
noch möglich“. Über ein Online-<br />
Terminvergabesystem wird der Anspruch auf Familienzusammenführung<br />
ausgehebelt: Neue Termine<br />
werden, wenn überhaupt, nur ab 24:00 Uhr freigeschaltet<br />
und sind innerhalb kürzester Zeit vergeben.<br />
Nur wer Glück hat erhält einen Termin. Insgesamt<br />
gibt es viel zu viele Bewerberinnen und Bewerber<br />
um einen Platz. Die Folge: Termine sind ein knappes<br />
Gut, mit dem Handel getrieben wird und die oft auf<br />
Vorrat gebucht werden. Ingvild Stadie hat das<br />
Vergabesystem beim Auswärtigen Amt angemahnt.<br />
Die Antwort: Zu viele Leute möchten einen Termin,<br />
dieser Andrang sei mit dem wenigen Personal der<br />
deutschen Botschaft einfach nicht zu bewältigen.<br />
„Seltsam ist, dass die Vergabe von Terminen für Kurzzeitvisa<br />
für die Deutsche Botschaft in Nairobi jedoch<br />
kein Problem darstellt. Dass es möglich ist, innerhalb<br />
weniger Tage hierfür einen Termin zu bekommen,<br />
steht im Gegensatz zur Argumentation des Auswärtigen<br />
Amtes, da ein Termin zur Familienzusammenführung<br />
mit 30 Minuten genau denselben Arbeitsaufwand<br />
darstellt“, sagt die Rechtsanwältin. „Außerdem<br />
könnte problemlos die Deutsche Botschaft in Addis<br />
Abeba (Äthiopien) für die Bearbeitung von Visaanträgen<br />
hinzugezogen werden“.<br />
DNA-Tests als Beweis<br />
Die deutsche Botschaft in Nairobi<br />
verlangt DNA-Tests zum Beweis,<br />
dass es sich auch tatsächlich um<br />
Familienmitglieder handelt.<br />
Für Familie Jeylaani fallen<br />
dafür etwa 500 Euro an.<br />
Über seine Rechtsanwältin hat Herr Jeylaani mittlerweile<br />
einen Termin erstritten, doch die Verschärfung<br />
der Terminvergabepraxis ist nur eine von vielen Hürden,<br />
die darauf abzielen, den<br />
Familiennachzug von somali-<br />
schen Flüchtlingen zu unterbinden.<br />
Seit geraumer Zeit verlangt<br />
die Botschaft DNA-Tests zum<br />
Beweis, dass es sich auch tatsächlich<br />
um Familienmitglieder<br />
handelt. Diese sind teuer und<br />
die Flüchtlinge müssen sie selbst<br />
bezahlen. Für Familie Jeylaani<br />
fallen dafür etwa 500 Euro an.<br />
Herr Jeylaani wird mit 350 Euro monatlich unterstützt.<br />
Davon überweist er Dank eisernen Sparens 300 Euro<br />
an seine Familie. Sie muss davon 100 Dollar Miete,<br />
das Schulgeld für die älteste Tochter sowie Schutzgelder<br />
bezahlen. Neben den DNA-Tests müssen die<br />
Anwältin und der Flug bezahlt werden. Diese immensen<br />
Kosten sind alleine kaum zu stemmen, selbst<br />
wenn Herr Jeylaani nicht mehr zum Integrationskurs<br />
muss und arbeiten dürfte.<br />
Das Scheitern an den bürokratischen Hürden<br />
Die 15-jährige Aziza steht vor demselben Problem<br />
wie die Familie Jeylaani. Aziza kommt aus Somalia<br />
und lebt seit einem Jahr in München. Ihre Tante und<br />
nachgehakt
86<br />
nachgehakt<br />
Tobias Klaus und<br />
Anna-Katinka<br />
Neetzke leben in<br />
München und arbeiten<br />
beim Bayerischen<br />
Flüchtlingsrat.<br />
ihr Onkel hatten sie auf ihrer<br />
Flucht mitgenommen, in der<br />
Hoffnung auf ein Leben in Frieden.<br />
Aziza litt an einem Tumor,<br />
der in München erfolgreich operiert<br />
wurde. Heute lebt Aziza in<br />
einer Gemeinschaftsunterkunft,<br />
sie hat eine Aufenthaltserlaubnis<br />
bekommen, darf also bleiben. Sie besucht die achte<br />
Übergangsklasse an der Hauptschule, lernt mit großem<br />
Eifer und spricht schon recht gut deutsch. Azizas<br />
Vater ist vor Jahren im Bürgerkrieg ums Leben<br />
gekommen, ihr großer Wunsch ist es, ihre Mutter<br />
nach Deutschland zu holen. Flugkosten und DNA-<br />
Tests kann sie jedoch von der Jugendhilfe, die sie<br />
erhält, nicht bezahlen.<br />
Auf private Unterstützung angewiesen<br />
Nadif A. floh vor zwei Jahren aus Somalia nach München.<br />
Er wurde als Flüchtling anerkannt und hatte<br />
damit das Recht auf erleichterten Familiennachzug.<br />
Seiner Frau und den sechs Kindern gelang die Flucht<br />
aus Somalia nach Äthiopien. Dort meldeten sie sich<br />
bei der Deutschen Botschaft in Addis Abeba, wurden<br />
aber abgewiesen: Für Visa von Somaliern sei die<br />
Deutsche Botschaft in Nairobi, Kenia, zuständig. Als<br />
Frau A. und ihre Kinder nach einer Odyssee durch<br />
mehrere afrikanische Staaten einige Wochen später<br />
endlich in Nairobi ankamen, war die Frist für den<br />
Visumsantrag um zwei Wochen überschritten. Jetzt<br />
musste der Vater die üblichen Voraussetzungen für<br />
den Familiennachzug erfüllen: Eine ausreichend<br />
große Wohnung und die eigenständige Sicherung des<br />
Lebensunterhalts. Er fing an, in zwei Jobs zu arbeiten.<br />
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Münchner<br />
Flüchtlingsrats fand eine bezahlbare Wohnung, andere<br />
sammelten Spenden für die Flugkosten. Am 1. Juli<br />
2010 kam die Familie glücklich in München an. Die<br />
vier älteren Kinder besuchen seit September die<br />
Schule. Eine ehrenamtliche Patin unterstützt die Kinder<br />
beim Deutschlernen. Der zweitälteste Sohn wird<br />
voraussichtlich im Herbst auf die Realschule wechseln<br />
könnten. Die beiden Jüngsten gehen in den Kindergarten.<br />
Die Eltern werden demnächst mit dem Integrationskurs<br />
beginnen.<br />
Ausgehöltes Grundrecht<br />
Diese Beispiele zeigen, wie schwer es ist, tatsächlichen<br />
Recht auf Familienzusammenführung Gebrauch<br />
zu machen. Durch Terminvergabeverfahren, Antragsfristen<br />
und finanzielle Hürden wird das Grundrecht<br />
auf Familieneinheit faktisch verwehrt. Das Recht auf<br />
Durch Terminvergabeverfahren,<br />
Antragsfristen und finanzielle<br />
Hürden wird das Grundrecht<br />
auf Familieneinheit<br />
faktisch verwehrt.<br />
Familienzusammenführung leitet<br />
sich aus Artikel 6 des<br />
Grundgesetzes her. Danach stehen<br />
Ehe und Familie unter dem<br />
besonderen Schutz der staatlichen<br />
Ordnung. Aus diesem<br />
Grund stellt der Wille zur Aufnahme<br />
oder Fortsetzung der<br />
Führung einer familiären Lebensgemeinschaft die<br />
Grundvoraussetzung für die Gewährung eines Aufenthaltsrechts<br />
dar. Dass dieses Grundrecht durch bürokratische<br />
Hürden sukzessive ausgehöhlt wurde, als<br />
die Zahl der somalischen Flüchtlinge, die in Deutschland<br />
Schutz suchen, kontinuierlich stieg, ist sicherlich<br />
kein Zufall. Zumindest für Familie Jeylaani besteht<br />
mittlerweile jedoch Hoffnung auf ein baldiges<br />
Wiedersehen. Als der Bayerische Flüchtlingsrat ihr<br />
Schicksal bekannt machte und einen Spendenaufruf<br />
für die Familie startete, kam tatsächlich so viel Geld<br />
zusammen, dass die Kosten für den Flug und die<br />
DNA-Tests der Familie gedeckt sind. Vier Jahre Trennung<br />
gehen nun dem Ende entgegen. Der Bayerische<br />
und der Münchener Flüchtlingsrat haben einen Fonds<br />
zur Familienzusammenführung ins Leben gerufen, mit<br />
dem auch weiteren Familien ein gemeinsames Leben<br />
ermöglicht werden soll.<<br />
Spendenfonds zur Familienzusammenführung<br />
Bayerischer Flüchtlingsrat<br />
Bank für Sozialwirtschaft<br />
BLZ: 700 205 00<br />
Konto Nr: 88 32 602<br />
Stichwort:„FZ Fonds“