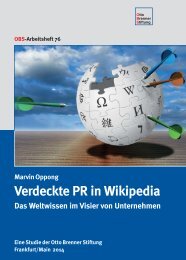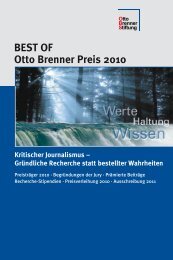BEST OF Otto Brenner Preis 2007 - Otto Brenner Shop
BEST OF Otto Brenner Preis 2007 - Otto Brenner Shop
BEST OF Otto Brenner Preis 2007 - Otto Brenner Shop
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>BEST</strong> <strong>OF</strong><br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2007</strong><br />
Kritischer Journalismus –<br />
Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten:<br />
<strong>Preis</strong>träger <strong>2007</strong> · Recherche Stipendien · Veröffentlichungen Stipendien<br />
Begründung der Jury · Ausschreibung 2008
www.otto-brenner-preis.de<br />
www. otto-brenner-stiftung.de
1<br />
<strong>BEST</strong> <strong>OF</strong><br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2007</strong><br />
Kritischer Journalismus –<br />
Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten
INHALT<br />
2
3<br />
5 Vorwort<br />
Manfred Schallmeyer<br />
8 Eröffnung<br />
Jürgen Peters<br />
16 Festrede<br />
Dr. Heribert Prantl<br />
26 Der Mechanismus<br />
der „Churnalisten“<br />
Dr. Thomas Leif<br />
Die <strong>Preis</strong>träger <strong>2007</strong><br />
33 Michaela Schießl<br />
Not für die Welt<br />
61 Ingolf Gritschneder<br />
Profit um jeden <strong>Preis</strong> –<br />
Markt ohne Moral<br />
65 Markus Grill<br />
Die Scheinforscher<br />
73 Tom Schimmeck<br />
Angst am Dovenfleet<br />
Recherche-Stipendien<br />
91 Katrin Blum<br />
95 Thomas Schuler<br />
99 Martin Sehmisch<br />
Veröffentlichungen Stipendien<br />
105 Astrid Geisler<br />
123 Boris Kartheuser<br />
129 Melanie Zerahn<br />
136 Die Jury<br />
142 Ausschreibung<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für<br />
kritischen Journalismus 2008
VORWORT<br />
4
Der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus<br />
setzt Maßstäbe für den kritischen Journalismus.<br />
Mehr als 350 Beiträge haben uns im Jahr <strong>2007</strong> erreicht, so viele wie nie zuvor.<br />
Gleichzeitig konnten wir einen deutlichen Anstieg der Qualität der eingereichten<br />
Beiträge verzeichnen. Unter den vielen herausragenden Einreichungen die<br />
Sieger zu bestimmen, war nicht einfach.<br />
Erstmals wurde dieses Jahr ein <strong>Preis</strong> in der Kategorie „Spezial“ für die beste<br />
Analyse (Leitartikel, Kommentar, Essay) vergeben. Der <strong>Preis</strong> wächst also nicht<br />
nur quantitativ durch die Anzahl seiner Bewerber, sondern es ist auch eine neue<br />
qualitative Kategorie hinzugekommen.<br />
Unverändert sind jedoch die Ziele des <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es geblieben: Beiträge<br />
zu prämieren, die sich von der breiten Masse durch eigenständige Rechercheleistung<br />
und journalistische Qualität positiv absetzen.<br />
Für die Jury waren deshalb bei der Auswahl der <strong>Preis</strong>träger folgende Kriterien<br />
maßgebend:<br />
Rechercheleistung (Aufwand, persönlicher Einsatz, Überwindung von Widerständen)<br />
Themenauswahl (Relevanz der Stoffe und Vernachlässigung in den Medien)<br />
Journalistische Qualität (Sprache und Umsetzung)<br />
Persönlicher Einsatz (Hartnäckigkeit, „Dranbleiben“ an den Themen)<br />
Unser Dank gilt Heribert Prantl für seine glänzende Festrede anlässlich der <strong>Preis</strong>verleihung<br />
sowie Sonia Mikich, die die Gäste und <strong>Preis</strong>träger mit ihrer stimmungsvollen<br />
Moderation durch den Abend führte.<br />
Ganz besonders danken wir allen Jurymitgliedern für ihr Engagement und dabei<br />
vor allem Thomas Leif, der bei der Entwicklung des <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es für<br />
kritischen Journalismus wesentliche Impulse gab und nun bereits zum dritten<br />
Mal die Regie übernahm. Der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> setzt Maßstäbe für kritischen<br />
Journalismus. Wir sind auf einem guten Weg.<br />
Manfred Schallmeyer, Geschäftsführer der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
5
ERÖFFNUNG
Jürgen Peters<br />
Zur <strong>Preis</strong>verleihung des<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es für<br />
kritischen Journalismus <strong>2007</strong>
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
ich begrüße Sie herzlich zur dritten<br />
Verleihung des <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es<br />
„Kritischer Journalismus – Gründliche<br />
Recherche statt bestellter Wahrheiten“.<br />
Dieses Jahr hatte unsere Jury noch<br />
mehr Arbeit als vor einem Jahr. Das ist<br />
eine gute Nachricht. Denn <strong>2007</strong> sind<br />
bei uns fast 350 Bewerbungen aller<br />
Mediengattungen und Genres eingegangen;<br />
das sind über 60 Prozent<br />
mehr als im vergangenen Jahr. Das<br />
zeigt, wie sich dieser doch noch junge<br />
<strong>Preis</strong> bereits etabliert hat. Das zeigt<br />
vor allem aber, dass kritischer Journalismus<br />
kein aussterbendes Handwerk<br />
ist. Viele Journalistinnen und Journalisten<br />
wollen sich nicht dem unterordnen,<br />
was man „Zeitgeist“ oder „Mainstream“<br />
nennt. Selbstverständlich wurden alle<br />
Bewerbungen gesichtet und von der<br />
Jury wie in den Vorjahren auch fachkundig<br />
bewertet.<br />
Es heißt, „Wer die Wahl hat, hat die<br />
Qual“. Aber es war, lassen Sie es mich<br />
so nennen, eine „süße Qual“. Nicht,<br />
weil wir Masochisten wären. Sondern<br />
weil wir unter vielen guten und interessanten<br />
Beiträgen auszuwählen hatten.<br />
Es war für uns mehr Leselust denn<br />
Lesefrust. Daran wollen wir Sie teilhaben<br />
lassen und werden Ihnen heute<br />
Abend die <strong>Preis</strong>träger vorstellen.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
besonders begrüße ich Heribert<br />
Prantl, den Ressortchef Innenpolitik<br />
der Süddeutschen Zeitung. Heribert<br />
Prantl wird die Festrede halten und als<br />
Mitglied der Jury den <strong>Preis</strong>träger „Spezial“<br />
vorstellen. Herzlich Willkommen.<br />
Heribert Prantl gehört zu den profiliertesten<br />
Journalisten in Deutschland, ist<br />
selbst Träger zahlreicher Journalistenpreise<br />
und hat bereits die Festrede für<br />
den ersten <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen<br />
Journalismus vor zwei Jahren<br />
gehalten. Ich denke, wir sind alle<br />
gespannt, welches Urteil heute der<br />
gelernte Jurist über Medienlandschaft<br />
und Medienpolitik fällt.<br />
Lassen Sie mich an dieser Stelle auch<br />
die anderen Mitglieder der Jury herzlich<br />
begrüßen. Sie haben den <strong>Otto</strong><br />
<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus<br />
von Beginn an tatkräftig und<br />
sachkundig unterstützt.<br />
Zunächst möchte ich an dieser Stelle<br />
Frau Sonia Mikich von der Monitor-<br />
Redaktion begrüßen. Vielen Dank Frau<br />
8
Mikich, dass Sie uns hier als Moderatorin<br />
mit Charme und Verstand durch<br />
diese <strong>Preis</strong>verleihung des <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong><br />
<strong>Preis</strong>es <strong>2007</strong> führen und dabei auch<br />
die drei <strong>Preis</strong>träger der Recherchestipendien<br />
vorstellen werden. Frau<br />
Mikich hat ihren kritischen Sachverstand<br />
und ihr präzises Urteil in den<br />
Dienst der Juryarbeit gestellt, was<br />
einer kompetenten und zielgerichteten<br />
Auswahl der <strong>Preis</strong>träger sehr förderlich<br />
war. Vielen Dank für ihre Mühe<br />
und Unterstützung Frau Mikich!<br />
Vor allem danke ich an dieser Stelle<br />
Herrn Thomas Leif, der uns mit Rat<br />
und Tat bei der Auslobung des <strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong>es<br />
stets fachkundig unterstützt<br />
hat. Er wird uns heute den <strong>Preis</strong>träger<br />
des 3. Platzes vorstellen und im<br />
Anschluss an die <strong>Preis</strong>verleihung in<br />
einer Talkrunde mit Recherchestipendiaten<br />
von 2005 und 2006 die Ergebnisse<br />
dieser Stipendien präsentieren.<br />
Herzlichen Dank Herr Leif.<br />
Begrüßen möchte ich auch Herrn Dr.<br />
Volker Lilienthal vom Evangelischen<br />
Pressedienst – Medien, der mit ruhiger<br />
und pointierter Sachkunde zur Auswahl<br />
der <strong>Preis</strong>träger beigetragen hat.<br />
Er wird heute den <strong>Preis</strong>träger des 2.<br />
Platzes vorstellen. Vielen Dank Herr<br />
Lilienthal.<br />
9<br />
Last but not least, möchte ich außerdem<br />
Herrn Harald Schumann vom Berliner<br />
Tagesspiegel herzlich begrüßen.<br />
Sie, Herr Schumann, haben in der Sitzung<br />
der Jury die <strong>Preis</strong>träger in ihrer<br />
unnachahmlichen Art vorgestellt und<br />
mit ihrem Sachverstand unsere Arbeit<br />
unterstützt. Sie werden heute den<br />
<strong>Preis</strong>träger des 1. Platzes vorstellen.<br />
Auch Ihnen herzlichen Dank!<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
wir feiern in diesem Jahr den 100. Geburtstag<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong>s. <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong><br />
war Gewerkschafter, Antifaschist, Sozialist<br />
und Demokrat. Sein politisches<br />
Wirken ging weit über die unmittelbaren<br />
gewerkschaftlichen Handlungsfelder<br />
etwa in der Lohn- und Arbeitszeitpolitik<br />
hinaus. Nur ein Beispiel: Schon früh<br />
unterstützte <strong>Brenner</strong> und die IG Metall<br />
die gesellschaftliche Bewegung gegen<br />
die Notstandsgesetze. Sein Engagement<br />
für Erhalt und Ausbau der Demokratie<br />
in Wirtschaft und Gesellschaft<br />
war für <strong>Brenner</strong> mehr als die Erfüllung<br />
der gewerkschaftlichen Beschlusslage.<br />
Es war Ergebnis seiner Erfahrungen<br />
mit dem Untergang der Weimarer<br />
Republik, der Katastrophe der
faschistischen Diktatur und des<br />
verbrecherischen Zweiten Weltkriegs.<br />
1968 sagte er: „Nicht Ruhe und Unterwürfigkeit<br />
gegenüber der Obrigkeit ist<br />
die erste Bürgerpflicht, sondern Kritik<br />
und ständige demokratische Wachsamkeit.“<br />
Diese aufrechte Haltung hat<br />
ihn, hat uns geprägt. Kritik und Wachsamkeit<br />
gegenüber Mächtigen und<br />
herrschenden Verhältnissen ist auch<br />
die Philosophie des <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es<br />
für Kritischen Journalismus. Denn<br />
kritischer Journalismus und Wachsamkeit<br />
ist heute nötiger denn je. Das<br />
zeigt eine ungeschminkte Bestandsaufnahme<br />
unserer real-existierenden<br />
Kommunikationsgesellschaft. Skandalisierung,<br />
Banalisierung und Populismus<br />
prägen zunehmend unsere<br />
Medienlandschaft. Aufklärung über die<br />
soziale Wirklichkeit wird in Nischen<br />
gedrängt. Die Massenmedien funktionieren<br />
zunehmend als Amüsierbetrieb<br />
und Ruhigstellmaschine. Der in der<br />
Öffentlichkeit stilbildende Maßstab,<br />
so der Journalist Rüdiger Suchsland,<br />
sei heute der Analphabet, der kulturfreie,<br />
politisch desinteressierte und<br />
bildungsunwillige Mensch. Statt die<br />
Befähigung des Publikums zur politischen<br />
Entscheidung zu steigern, funktioniere<br />
der Mainstream der Medien<br />
als ein kulturloser universaler Verblödungszusammenhang.<br />
Zugegeben: Zugespitzter hätte ich es<br />
auch nicht formulieren können. Aber<br />
das scheinbar unaufhaltsame Wuchern<br />
von Klatsch und Tratsch in den Medien<br />
kann niemand mehr übersehen. Erst<br />
vor kurzem beklagte sich der US-Demokrat<br />
Al Gore über den medialen „Angriff<br />
auf die Vernunft“. Wie könne es sein,<br />
fragte er, „dass wir viel mehr Zeit damit<br />
zubringen, über Britney Spears Glatze<br />
und Paris Hiltons Gefängnisaufenthalt<br />
zu reden als über wichtige Themen?“<br />
Eine Antwort ist nicht so schwer:<br />
Wenn wir, wenn die Öffentlichkeit einer<br />
medialen Dauerberieselung – ja,<br />
einem Dauerbeschuss mit Medientrash,<br />
mit Müll, unterliegen, dann kann sich<br />
kaum jemand dem Phänomen entziehen,<br />
dass Pseudoskandale oder Banalitäten<br />
plötzlich Teile der öffentlichen<br />
Kommunikation bestimmen und<br />
wichtige Themen verdrängen. Wenn<br />
Dieter Bohlens Stimmbandreizung<br />
oder Sabine Christiansens neuer Friseur<br />
wichtiger sind als etwa die Auswirkungen<br />
der Zinspolitik der Europäischen<br />
Zentralbank, dann ist das ein Versagen<br />
der Medien.<br />
Sie meinen, ich übertreibe? Dann lassen<br />
Sie mich einen Test machen? Wer<br />
10
unter den Anwesenden weiß denn,<br />
was eine Zinserhöhung um einen Prozentpunkt<br />
die öffentlichen Haushalte<br />
und damit die europäischen Steuerzahler<br />
kostet? Und wer weiß, wer der<br />
Lieblingsfriseur von Frau Christiansen<br />
ist? Die Antwort auf die erste Frage<br />
lautet: 84 Milliarden Euro. Zum Vergleich:<br />
Das ist ziemlich exakt das dreifache<br />
des deutschen Verteidigungshaushalts.<br />
Wir haben die Zahl selbst<br />
recherchiert. Sie war in keiner Zeitung<br />
zu finden.<br />
Die Antwort auf die zweite Frage finden<br />
sie in der auflagenstärksten seriösen<br />
deutschen Tageszeitung. Ich zitiere:<br />
„Die ARD-Talkerin und Promi-Friseur<br />
Walz haben einen Hundesalon eröffnet<br />
– für einen wohltätigen Zweck. Schicker<br />
Nebeneffekt: Endlich kommt auch<br />
Mischling Mona tipptopp daher wie<br />
das Frauchen“.<br />
Damit sie mich nicht falsch verstehen.<br />
Mir geht es nicht darum, dass Klatsch<br />
und Tratsch aus den Medien verbannt<br />
werden. Da könnte man auch fordern,<br />
der Rhein möge die Alpen hinauf fließen.<br />
Mir geht es darum, ob die Medien<br />
noch zwischen Wichtigem und Unwichtigem<br />
unterscheiden und gewichten.<br />
Ob sie den Bürgerinnen und Bürgern<br />
die Informationen, Zusammenhänge<br />
11<br />
und Fakten vermitteln, die mittelbare<br />
und unmittelbare Auswirkungen auf<br />
ihr Leben haben. Auch wenn das Thema<br />
trocken ist und die Fakten wenig<br />
Unterhaltungswert haben. Denn Medien<br />
haben, seien sie marktwirtschaftlich<br />
oder öffentlich-rechtlich organisiert,<br />
eine wichtige Funktion in einer demokratisch<br />
verfassten Gesellschaft. Sie<br />
prägen die öffentliche Diskussion, sie<br />
beeinflussen Wählerverhalten, ohne<br />
sie gibt es keinen demokratischen Diskurs,<br />
keine demokratische Meinungsbildung.<br />
Ob Medien aufklären oder vertuschen,<br />
ob sie das Wichtige von Unwichtigem<br />
trennen, ob sie informieren oder nur<br />
unterhalten und ablenken – das sind<br />
nicht nur Fragen des individuellen<br />
Geschmacks oder individueller Bedürfnisse.<br />
Das sind Fragen nach der<br />
Stabilität und Zukunft unseres demokratischen<br />
Gemeinwesens. Aber nicht<br />
nur die mindere Qualität des Mainstream-Medienangebots<br />
ist das Problem.<br />
In einem Beitrag für die „Süddeutsche<br />
Zeitung“ vom 16. Mai dieses Jahres<br />
wies Jürgen Habermas auf die Gefahren<br />
der zunehmenden Monopolisierung<br />
bei den Medien und ihrer Abhängigkeit<br />
von Werbeeinnahmen hin.<br />
Ein Marktversagen auf dem Medien-
Sektor, schrieb Habermas, könne sich<br />
keine Demokratie leisten. Er erinnerte<br />
daran, dass der durch die Verfassung<br />
garantierte Rechtsanspruch auf mediale<br />
Grundversorgung auch die Unabhängigkeit<br />
von Werbung und Sponsoreneinfluss<br />
einschließe. Und diese<br />
Unabhängigkeit sei heute in Gefahr.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
ich möchte heute Abend nicht die Kassandra<br />
spielen. Ich möchte uns auch<br />
nicht die gute Laune verderben. Ich<br />
möchte nur, dass wir mit der Verleihung<br />
des <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es nicht<br />
nur hervorragende journalistische<br />
Arbeiten auszeichnen, sondern auch<br />
eine Debatte über Zustand und<br />
Zukunft unserer Medien befördern.<br />
Kritischer Journalismus, gründliche<br />
Recherche und Wachsamkeit gegenüber<br />
den Mächtigen sollte nicht die<br />
Ausnahme, es sollte die Regel im journalistischen<br />
Alltag sein. Deshalb darf<br />
die Debatte über Veränderungen in der<br />
Medienlandschaft, über Konzentrationsprozesse<br />
und über die Qualität<br />
journalistischer Produkte nicht auf<br />
Expertenrunden beschränkt bleiben.<br />
Es muss eine Debatte werden, an der<br />
sich die Leserinnen und Leser, die<br />
Zuschauerinnen und Zuschauer und<br />
die Zuhörerinnen und Zuhörer beteiligen<br />
können. Kurzum: Es muss eine<br />
öffentliche Debatte über die Zukunft<br />
des Journalismus werden.<br />
Frank Schirrmacher, einer der Herausgeber<br />
der FAZ, ist da optimistisch. Er<br />
sagt: „Jeder, der Augen hat zu sehen,<br />
wird erkennen, dass das nächste Jahrzehnt<br />
das Jahrzehnt des Qualitätsjournalismus<br />
sein wird.“ Ich kann diesen<br />
Optimismus nicht teilen. Ich glaube<br />
nicht an die „Selbstheilungskräfte“<br />
der Medienmärkte. Realistisch müssen<br />
wir vielmehr von einer weiteren Kommerzialisierung<br />
und Verflachung ausgehen.<br />
Wir dürfen die Medien deshalb<br />
nicht einer Handvoll Verlegern, Investmentfonds<br />
und der werbetreibenden<br />
Industrie überlassen. Die Frage der<br />
Eigentumsverhältnisse bei den Medien,<br />
die Monopolstellung weniger Verleger,<br />
die Frage der Qualität und des Einflusses<br />
kommerzieller Interessen – das<br />
alles muss Thema der demokratischen<br />
Zivilgesellschaft werden.<br />
Und nicht zuletzt natürlich: Wohin entwickeln<br />
sich die öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunkanstalten? Werden sie zum<br />
Sklaven der Quote, passen sie sich dem<br />
Qualitäts-Downsizing der Kommerz-<br />
12
sender an oder erfüllen sie ihren<br />
öffentlich-rechtlichen Auftrag und<br />
machen den Qualitätsjournalismus zur<br />
Norm? Kürzung der Sendezeiten der<br />
ARD-Magazine, die Verlagerung von<br />
Reportagen auf den Sonntag, das<br />
Abschieben anspruchsvoller Features<br />
in die Nacht – das alles gibt zu Optimismus<br />
wenig Anlass. Auch die Tatsache,<br />
dass ein großer ARD-Sender<br />
mehr Tai-Chi-Kurse als Recherche-Kurse<br />
anbietet, stimmt mich nicht hoffnungsfroh.<br />
Damit Sie mich nicht falsch verstehen:<br />
Ich habe nichts gegen chinesisches<br />
Schattenboxen. Das Fließen der<br />
Lebensenergie soll ja der Gesundheit<br />
und Entspannung dienen. Aber ich<br />
mache mir doch Sorgen darüber, ob<br />
auch dem wichtigsten journalistischen<br />
Handwerkszeug – der Recherche – in<br />
den Rundfunkanstalten und Printmedien<br />
überhaupt noch die notwendige<br />
Aufmerksamkeit geschenkt wird.<br />
Recherche, so scheint es, gehört im<br />
Mainstream-Journalismus zu den aussterbenden<br />
Arten. Wir sollten sie auf<br />
eine rote Liste setzen, damit alle<br />
Medien-Verantwortlichen diejenigen<br />
Journalistinnen und Journalisten, die<br />
noch recherchieren, besonders schützen<br />
und ihren Lebensraum erhalten.<br />
Das wäre eine lohnende Aufgabe.<br />
13<br />
Sicher: Manche könnten jetzt die<br />
Augenbrauen hochziehen und fragen:<br />
„Wo bleibt das Positive?“ Ich möchte<br />
es sagen: Mehr Qualität im Journalismus,<br />
Verhinderung von Informationsmonopolen,<br />
Zurückdrängen kommerzieller<br />
Einflussnahme auf die Arbeit<br />
der Redaktionen – das könnten die<br />
Mittel sein, eine demokratische, vielfältige<br />
und qualitativ hochwertige<br />
Medienlandschaft zu erhalten – oder<br />
besser: wiederherzustellen.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
die eingesandten Bewerbungen für<br />
den <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> zeigen, wie es<br />
besser geht. Sie zeigen, wie gründliche<br />
Recherche, gute Sprache und Stilgefühl<br />
Maßstäbe setzen kann.<br />
Kurzum: Sie zeigen, was guter Journalismus<br />
ist. Ich freue mich, dass wir<br />
Ihnen heute Abend die <strong>Preis</strong>träger vorstellen<br />
können und wünsche allen<br />
einen angenehmen und kurzweiligen<br />
Abend.
FESTREDE
Heribert Prantl<br />
Rede zur Verleihung<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e<br />
für kritischen Journalismus
Es gibt Tage, an denen könnte man am<br />
Journalismus verzweifeln. Tage, an<br />
denen man glaubt, es würde alles<br />
immer nur schlechter. Dann kommt<br />
einem das eigene Gewerbe so kritiklos,<br />
so oberflächlich, so mainstreamig vor.<br />
An diesen Tagen journalistischer Tristesse,<br />
es sind Gott sei Dank nicht so<br />
viele, frage ich mich, warum ich vor<br />
zwanzig Jahren nicht Richter in der<br />
bayerischen Justiz geblieben bin – weil<br />
mir der Journalismus dann vorkommt<br />
wie Hochstapelei mit Grundrechtsschutz.<br />
Und das ambitionierte Reden<br />
von Pressefreiheit kriegt dann einen<br />
schalen Geschmack.<br />
An solchen Tagen kommen mir die<br />
Sätze des Bundesverfassungsgerichts<br />
über die Pressefreiheit und ihre<br />
Bedeutung für die Demokratie vor wie<br />
ein grausamer Spott; zum Beispiel<br />
dann, wenn die Bildzeitung (wie jüngst<br />
im Fall el Masri) sich mit Infamie über<br />
eine Rüge des Presserats hinwegsetzt,<br />
das Opfer ihres Rufmords gar noch<br />
einmal in den Dreck zieht, sozusagen<br />
jetzt erst recht – der Presserat aber<br />
dazu schweigt, statt vor der Bundespressekonferenz<br />
Klage zu führen und<br />
Alarm zu schlagen.<br />
Warum rede ich ausgerechnet hier und<br />
heute von meinen Tagen des Missbehagens?<br />
Weil es auch die ganz anderen<br />
Tage gibt, diejenigen, die wie Medizin<br />
sind gegen die journalistische Depression.<br />
Heute ist so ein Tag, heute ist, entschuldigen<br />
Sie das kleine Pathos, heute ist<br />
ein journalistischer Festtag – und die<br />
Tage, an denen die Jury die vielen hervorragenden,<br />
die vielen ganz hervorragenden<br />
eingereichten Arbeiten gelesen<br />
hat, waren auch solche Festtage.<br />
Ich weiß nicht, wie es den anderen<br />
Juroren ergangen ist – ich denke, so<br />
ähnlich wie mir: Ich war stolz beim<br />
Lesen, Hören, Sehen. Ich war und bin<br />
stolz darauf, einem Beruf anzugehören,<br />
der praktizierte Aufklärung ist (oder<br />
besser gesagt, der es, wie dieser Wettbewerb<br />
zeigt, sein könnte). Dafür bin<br />
ich Ihnen, liebe <strong>Preis</strong>trägerinnen und<br />
<strong>Preis</strong>träger, dankbar – ihre Arbeiten<br />
erhalten den Glauben daran, dass ein<br />
großes Grundrecht nicht verludert.<br />
Mein, unser journalistischer Urahn<br />
Philipp Jakob Siebenpfeiffer, geboren<br />
im Revolutionsjahr 1789, war ein<br />
kämpferischer Mann, einer, der sich<br />
den Mund nicht hat verbieten und den<br />
16
Schneid nicht hat abkaufen lassen. Er<br />
war Schüler des liberalen Staatsrechtslehrers<br />
Karl von Rotteck, wurde mit 29<br />
Jahren Landkommissar des Kreises<br />
Homburg in der Rheinpfalz, geriet aber<br />
bald mit dem Regime aneinander. Er<br />
trat aus dem Staatsdienst aus, wurde<br />
hauptberuflich bürgerlicher Revolutionär,<br />
demokratischer Volksmissionar,<br />
Journalist, Verleger und Streiter gegen<br />
die Zensur.<br />
„Die Zensur ist der Tod der Pressfreiheit<br />
und somit der Verfassung, welche<br />
mit dieser steht und fällt”, schrieb er<br />
vor 175 Jahren in seiner Zeitung. Als<br />
die Regierung seine Druckerpresse<br />
versiegelte, verklagte er sie mit dem<br />
Argument: Das Versiegeln von Druckerpressen<br />
sei genauso verfassungswidrig<br />
wie das Versiegeln von Backöfen.<br />
Das ist ein wunderbarer Satz, weil<br />
darin die Erkenntnis steckt, dass Pressefreiheit<br />
das tägliche Brot ist für die<br />
Demokratie. Vor 175 Jahren hat Siebenpfeiffer<br />
die Vaterlandsvereine „zur<br />
Unterstützung der freien Presse” mitgegründet<br />
und dann, im Mai 1832,<br />
zum Hambacher Fest eingeladen; dieses<br />
erste demokratische Fest war<br />
zugleich das erste große Fest der<br />
Pressefreiheit in Deutschland. Diese<br />
17<br />
Pressefreiheit galt den liberalen<br />
Meinungsführern damals als das<br />
demokratische Urgrundrecht und als<br />
Universalrezept zur Gestaltung der<br />
Zukunft; in dem Zauberwort Pressefreiheit<br />
flossen alle politischen Sehnsüchte<br />
zusammen. Kampf gegen die<br />
Zensur, das war der Kampf gegen die<br />
alte Ordnung.<br />
Ein Jahr nach dem Hambacher Fest<br />
begann der Hochverratsprozess gegen<br />
Siebenpfeiffer und zwölf weitere Angeklagte.<br />
Das außerordentliche Schwurgericht<br />
zu Landau in der Pfalz saß über<br />
die Aufrührer und über die Pressefreiheit<br />
zu Gericht. Siebenpfeiffer hat sie<br />
verteidigt wie kaum ein anderer; aber<br />
dieser Kampf ist nicht gut ausgegangen<br />
für ihn. Als der von den Bürgern<br />
gefeierte und vom Staat verfolgte<br />
Mann letztlich doch verurteilt worden<br />
war, floh er – mittlerweile kränklich –<br />
mit seiner Familie in die Schweiz. Er<br />
hatte keine Kraft mehr; und die Mitkämpfer<br />
von einst waren enttäuscht<br />
vom Aussteiger. Er wurde außerordentlicher<br />
Professor, litt unter wirtschaftlichen<br />
Nöten. Über seine letzten<br />
Jahre ist wenig bekannt. Er starb am<br />
14. Mai 1845 in der Privatirrenanstalt<br />
von Bümpliz. Man muss sich Sieben-
pfeiffer, den unbändigen Freiheitskämpfer,<br />
am Lebensende in der<br />
Zwangsjacke vorstellen. Das ist ein<br />
Symbol für den weiteren Verlauf der<br />
Geschichte bis 1945.<br />
Der große Freiheitskämpfer am Ende<br />
in der Zwangsjacke? Es ist ein unendlich<br />
trauriges Bild, ein Bild, das einen<br />
bekümmert, auch wenn man sich mit<br />
dem Journalismus von heute beschäftigt.<br />
Die Zeiten der Zwangsjacke für<br />
die Pressefreiheit sind nämlich 1945<br />
nicht ganz zu Ende gegangen. Es sind<br />
nur die Zeiten vorbei, in denen sich<br />
diese Zwangsjacken in der staatlichen<br />
Kleiderkammer regelrecht stapelten<br />
und ein staatliches Hoheitsabzeichen<br />
trugen. Staatliche Fesselungsversuche<br />
gibt es auch heute noch in Deutschland<br />
– denken wir an die Durchsuchungsaktionen<br />
in Zeitungshäusern,<br />
Redaktionen und Privatwohnungen<br />
von Journalisten; das Bundesverfassungsgericht<br />
hat die Staatsbehörden,<br />
am Beispiel der Razzia beim Monatsmagazin<br />
Cicero, heftig dafür gerügt.<br />
Aber schlimmer als Cicero-Razzien<br />
sind die geistigen Zwangsjacken, die<br />
sich der Journalismus selber anzieht:<br />
Zu beklagen ist eine Tendenz zur Ver-<br />
mischung von Information und Unterhaltung.<br />
Zu beklagen ist die Vermischung<br />
von Journalismus und PR. Zu<br />
beklagen ist die Verquickung von Journalismus<br />
und Wirtschaft – die Tatsache<br />
also, dass sich immer mehr Journalisten<br />
zu Büchsenspannern und Handlangern<br />
von Lobbyisten machen lassen.<br />
Wir verleihen hier Medienpreise für<br />
„Kritischen Journalismus”. Kritischer<br />
Journalismus – das sollte eigentlich<br />
eine Tautologie sein, ist es aber nicht.<br />
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte<br />
sprach im Jahr 2004<br />
Caroline, der Prinzessin von Monaco,<br />
eine geschützte Privatsphäre auch<br />
außerhalb ihres Hauses zu; die Öffentlichkeit<br />
könne kein legitimes Interesse<br />
daran geltend machen, zu erfahren,<br />
wo die Prinzessin sich aufhält und wie<br />
sie sich allgemein in ihrem Privatleben<br />
verhält – und zwar auch dann nicht,<br />
wenn sie sich an Orte begibt, die nicht<br />
als abgeschieden bezeichnet werden.<br />
Zumal die Verleger und Chefredakteure<br />
von bunten Blättern sahen daraufhin<br />
das Ende der Pressefreiheit nahen,<br />
weil das Caroline-Urteil das Persönlichkeitsrecht<br />
über Gebühr ausdehne.<br />
Doch was, bitte, ist die Prinzessin<br />
Caroline gegen einen Verleger wie<br />
18
Lambert Lensing-Wolff in Dortmund?<br />
Der Verleger Lambert Lensing-Wolff,<br />
ihm gehören die Ruhr-Nachrichten, hat<br />
die komplette Lokalredaktion seiner<br />
Münsterschen Zeitung vor die Tür<br />
gesetzt. Mitte Januar diesen Jahres<br />
erfuhren 19 Redakteure, dass sie ab<br />
sofort von der Arbeit freigestellt seien.<br />
Am Freitag produzierten sie die letzte<br />
Ausgabe, die Montagsausgabe wurde<br />
schon von einer neuen Mannschaft<br />
verantwortet, die der Verleger geheim<br />
und abseits der Tarifbindung aufgebaut<br />
hatte. „Damit erreicht”, so schrieb<br />
die Neue Zürcher Zeitung, „die Auslagerung<br />
journalistischer Arbeit aus den<br />
traditionellen Strukturen von Redaktion<br />
und Verlag eine neue Dimension”.<br />
Schrittweise hatte Lensing-Wolff zuvor<br />
seine einstmals tausend Mitarbeiter in<br />
Redaktionen, Druckbetrieben, Vertrieb<br />
und Verwaltung in zahlreiche Tochtergesellschaften<br />
ausgegliedert. Die<br />
näheren Umstände des letzten Coups<br />
von Münster spotten jeder Beschreibung.<br />
Wegen angeblicher „Renovierung”<br />
hatten die langjährigen Blattmacher<br />
der Münsterschen Zeitung ihr<br />
Pressehaus in der Innenstadt räumen<br />
und in die Kantine des alten Druckhauses<br />
umziehen müssen, schließlich<br />
wurden die Diensthandys abgeschaltet<br />
19<br />
und die Redaktionscomputer gesperrt.<br />
Die angebliche Renovierung des Blattes<br />
bestand also in der Einführung von<br />
Manchester-Journalismus.<br />
Es gibt mittlerweile nicht wenige solcher<br />
Verleger in Deutschland. Schlimmer<br />
als staatliche Fesseln (da kommt<br />
notfalls das Bundesverfassungsgericht<br />
zur Entfesselung) sind also heute die<br />
Zwangsjacken, die so Verleger und<br />
Verlags-Manager dem Journalismus<br />
anziehen. Der genannte Verleger<br />
Lensing-Wolff sagt dazu: „Outsourcing<br />
ist Teil einer Flexibilität, die wir zur<br />
Modernisierung brauchen.” Er redet<br />
von einem neuen Konzept des „rasenden<br />
Reporters”, der mit „Laptop und<br />
Kamera nah am Geschehen ist, der<br />
online, on air und für Print berichtet”.<br />
Der künftige Journalist, der Manchester-Journalist,<br />
könnte also, wie ich das<br />
gerne nenne, eine Art Trommelaffe<br />
sein: Mit den Händen patscht er die<br />
Tschinellen zusammen, mit den Ellenbogen<br />
schlägt er die Trommel auf seinem<br />
Rücken, an die Füße kriegt er ein<br />
paar Klappern und Rasseln, in den<br />
Mund steckt man ihm eine Trompete.<br />
Dieses Konzept hat einen Namen:<br />
Geschäftsführer und innovationsbesoffene<br />
Chefredakteure sprechen vom
„multifunktionalen Journalisten“ und<br />
meinen dazu, die Zeiten hätten sich halt<br />
geändert. So kehrt der Journalismus<br />
zurück zu seinen marktschreierischen<br />
Ursprüngen auf den Marktplätzen des<br />
Mittelalters.<br />
Die Online-Ausgaben nicht ganz weniger<br />
Zeitungen werden auf eine Art und<br />
Weise betrieben, dass man eine ganz<br />
einfache Wahrheit ganz laut sagen<br />
muss: Pressefreiheit ist nicht die Freiheit,<br />
Redaktionen auszupressen. Pressefreiheit<br />
ist auch nicht die Freiheit,<br />
sie durch redaktionelle Zeitarbeitsbüros<br />
zu ersetzen, als gelte es, ein Call-<br />
Center eine Weile am Laufen zu halten.<br />
Schon heute sagt jeder dritte Journalist,<br />
dass die Zeit fehle, „um sich über<br />
ein Thema auf dem Laufenden zu halten”.<br />
Dadurch ist eine zentrale journalistische<br />
Aufgabe gefährdet, und zwar<br />
nicht nur bei vielen kleinen lokalen<br />
Blättern – das Aufspüren von Entwicklungen,<br />
das Sammeln, Bewerten und<br />
Ausbreiten von Fakten und Meinungen.<br />
Der Online-Journalismus ist etwas<br />
Tolles, er bietet neue, wunderbare<br />
Chancen für innovative publizistische<br />
Arbeit. Wenn „Online“ aber dafür<br />
genutzt wird, den Journalismus noch<br />
billiger zu machen – dann wird es<br />
einen Sog nach unten geben.<br />
Zeitungen sind im Internet-Zeitalter<br />
mitnichten vorgestrig. Sie haben, weil<br />
Vertiefung und Orientierung wichtiger<br />
werden, ein ganz neues Gewicht. Sie<br />
werden dieses Gewicht aber nicht halten,<br />
wenn der Trend zur journalistischen<br />
Selbstzerstörung anhält. Überzogene<br />
Renditeerwartungen sind ein<br />
Schritt zur Selbstzerstörung. Götz<br />
Hamann hat dazu unlängst in der<br />
„Zeit“ (20. 9. <strong>2007</strong>) die Vorsteuerrendite<br />
etlicher Zeitungshäuser festgehalten,<br />
die weit, sehr weit über der des<br />
Thyssen Krupp Konzerns oder der des<br />
Strom- und Gaskonzerns E.on liegt. Als<br />
wichtigste Geldquelle hat die Branche<br />
die eigenen Angestellten entdeckt.<br />
„Jeder dritte Job ist gestrichen worden.<br />
Die letzte große Entlassungswelle gab<br />
es im vergangenen Jahr bei der Rheinischen<br />
Post. Insgesamt arbeiten heute<br />
nur noch rund 17 000 feste Redakteure<br />
und freie Journalisten für deutsche<br />
Zeitungen. Im Jahr 1993 waren es fast<br />
25 000. Das ergibt sich aus der bislang<br />
umfassendsten Studie über Journalisten<br />
in Deutschland.“ Sie stammt vom<br />
Hamburger Wissenschaftler Siegfried<br />
Weischenberg, der auch nachweisen<br />
konnte, dass die verbliebenen Redak-<br />
20
teure mehr organisatorische Arbeit<br />
übernommen haben. Die Zeit für<br />
Recherche und Schreiben nahm entsprechend<br />
ab.<br />
Es besteht wie noch nie seit 1945 die<br />
akute Gefahr, dass der deutsche Journalismus<br />
verflacht und verdummt, weil<br />
der Renditedruck steigt; weil an die<br />
Stelle von sach- und fachkundigen<br />
Journalisten Produktionsassistenten<br />
für Multimedia gesetzt werden, wieselflinke<br />
Generalisten, die von allem<br />
wenig und von nichts richtig etwas<br />
verstehen. Aus dem Beruf, der heute<br />
Journalist heißt, wird dann ein multifunktionaler<br />
Verfüller von Zeitungsund<br />
Webseiten. Solche Verfüllungstechnik<br />
ist allerdings nicht die demokratische<br />
Kulturleistung, zu deren<br />
Schutz es das Grundrecht der Pressefreiheit<br />
gibt. In den Redaktionskonferenzen<br />
ist das diskussionsfreudige<br />
Klima verschwunden, es verschwand<br />
vor ein paar Jahren mit den wirtschaftlichen<br />
Schwierigkeiten, in die damals<br />
viele Zeitungen gerieten und mit den<br />
Existenzängsten, die nicht wenige<br />
Redakteure damals befielen. Der alte<br />
Satz „wes Brot ich ess, des Lied ich<br />
sing“ bekommt durchaus wieder<br />
Bedeutung.<br />
21<br />
Die Presse sei ein „ständiges Verbindungs-<br />
und Kontrollorgan zwischen<br />
dem Volk und seinen gewählten Vertretern<br />
in Parlament und Regierung“<br />
heißt es im Spiegel-Urteil von 1966.<br />
Eine „freie, nicht von der öffentlichen<br />
Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfenen<br />
Presse“ sei ein „Wesenselement<br />
des freien Staates“. So schrieb<br />
das Bundesverfassungsgericht vor<br />
31 Jahren und in diesem Jahr, im Cicero-<br />
Urteil, das eigentlich ein Spiegel II-<br />
Urteil ist, hat es dieses Loblied wiederholt.<br />
Für solche Sätze haben einst<br />
Deutschlands erste Demokraten, wie<br />
Johann Georg August Wirth, auf den<br />
Barrikaden gekämpft, für solche Sätze<br />
wurde Jakob Philipp Siebenpfeiffer in<br />
Landau ins Gefängnis geworfen und<br />
musste dort, wie es den Gefangenen<br />
damals zur Auflage gemacht wurde,<br />
wöchentlich drei Paar wollene Socken<br />
stricken. Hätte er geahnt, dass sein<br />
Satz eines Tages vom höchsten Gericht<br />
so gerühmt werden würde – er hätte<br />
vor Freude sechs Paar Socken gestrickt.<br />
Das Spiegel-Urteil des Bundesverfassungsgerichts<br />
stammt von 1966. Das<br />
Spiegel-Urteil von heute wird auf<br />
diversen Medien-Tagen und auf den<br />
Redaktions-Flur-Gesprächen gefällt. Es<br />
fällt nicht mehr so feierlich und nicht
mehr so respektvoll aus, das große<br />
Leitmedium ist der Spiegel nicht mehr<br />
– und das hat damit zu tun, das Mainstreaming,<br />
das Schwimmen im Strom,<br />
wie es der Spiegel heute pflegt, eigentlich<br />
nicht zu den Hauptaufgaben des<br />
Journalismus gehört. Im Zweifel<br />
schwimmt guter Journalismus gegen<br />
den Strom. Guter Journalismus macht<br />
auch keine Verbeugungen vor großen<br />
Anzeigenkunden. Guter Journalismus<br />
ist auch etwas anderes als die gegenseitige<br />
Beweihräucherung, wie sie zwischen<br />
einigen Groß-Journalisten üblich<br />
geworden ist. Deren Motto heißt: Wir<br />
sind unglaublich gut und wir bestätigen<br />
uns das auch gegenseitig in unseren<br />
Zeitungen. Guter Journalismus<br />
macht sich nicht zum Affen. Und guter<br />
Journalismus ist sich dessen bewusst,<br />
dass Pressefreiheit nicht in erster Linie<br />
die Freiheit zum großen Geldverdienen<br />
ist.<br />
Der Bundespräsident hat in einer feinen<br />
Rede zum fünfzigsten Jubiläum<br />
des Presserats die Pressefreiheit auf<br />
hintergründige Weise hochleben lassen;<br />
er hat gefragt, was den Kern journalistischer<br />
und verlegerischer Arbeit<br />
ausmache und warum diese vom<br />
Grundgesetz geschützt sei. „Ich<br />
selbst”, antwortete Horst Köhler keck,<br />
„bin in dieser Frage konservativ. Deshalb<br />
neige ich zu Karl Marx. Der hat<br />
gesagt: ’Die erste Freiheit der Presse<br />
besteht darin, kein Gewerbe zu sein’”.<br />
Die Herstellung von Zeitungen ist eben<br />
etwas anderes als die Herstellung von<br />
Tapeten oder Plastikfolien; und die<br />
Produktion von Rundfunk- und Fernsehsendungen<br />
ist etwas anders als die<br />
Produktion von Chips oder Stanzmaschinen.<br />
Medienunternehmen dürfen<br />
und sollen zwar Gewinn machen, aber<br />
wenn sie an nichts anderem interessiert<br />
sind als daran, dann wackelt die<br />
Pressefreiheit. Für die Hersteller von<br />
Tapeten, Joghurts und Stanzmaschinen<br />
gibt es nämlich keine speziellen<br />
Garantien, kein eigenes Grundrecht.<br />
Wenn also Medienfreiheit missbraucht<br />
wird, um Schleichwerbung zu machen,<br />
wenn es eine Tendenz gibt, sie auf die<br />
Freiheit zu grundrechtsgeschützter<br />
Geldvermehrung zu reduzieren, dann<br />
wird es immer schwerer werden, sie<br />
als besonders wichtig zu verteidigen –<br />
weil sich dann die Pressefreiheit nicht<br />
mehr von der allgemeinen Gewerbefreiheit<br />
unterscheidet. Wenn das<br />
Grundrecht nicht mehr von innen<br />
glänzt, dann hilft es nichts mehr, wenn<br />
das Bundesverfassungsgericht ab und<br />
22
an mit dem Glanzspray herum hantiert.<br />
Das höchste Gericht versucht ab und<br />
zu, den Staatsbehörden die Achtung<br />
vor dem Artikel 5 Grundgesetz zu lehren.<br />
Diese Achtung setzt aber auch<br />
journalistische Selbstachtung voraus.<br />
Der Presse ist die Freiheit garantiert.<br />
Presse sind Journalisten, Verleger,<br />
Medienunternehmen. Die Pressefreiheit<br />
könnte entfallen, wenn diese Freiheit<br />
als Freiheit ohne Verantwortung<br />
missverstanden wird – und: wenn<br />
Medienunternehmen sich nur noch als<br />
Renditeunternehmen wie jedes andere<br />
auch verstehen.<br />
Es hat einen Grund, warum es das<br />
Grundrecht der Pressefreiheit gibt:<br />
Pressefreiheit ist Voraussetzung dafür,<br />
dass Demokratie funktioniert. Wird<br />
dieser Grundsatz nicht geachtet, wird<br />
das Grundrecht grundlos.<br />
Vor genau 175 Jahren ist der erste<br />
„Vaterlandsverein zur Unterstützung<br />
der freien Presse” gegründet worden.<br />
Diese Vaterlandsvereine zur Unterstützung<br />
der freien Presse waren Demokratievereine,<br />
dort trafen sich die aufgeklärten,<br />
die fortschrittlichen, die<br />
engagierten Bürger des Landes. Viel-<br />
23<br />
leicht müsste man so einen Presse-<br />
Unterstützungs-Verein heute wieder<br />
gründen. Vielleicht gibt es den Verein<br />
aber schon wieder. Die heutige Veranstaltung,<br />
diese <strong>Preis</strong>verleihung, ist<br />
nämlich so eine Art Generalversammlung<br />
dieses neuen alten Vereins.<br />
Dr. Heribert Prantl leitet die Redaktion<br />
Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung
RECHERCHEBEITRAG
Thomas Leif<br />
Der Mechanismus der<br />
„Churnalisten“
Der Mechanismus der „Churnalisten“ – die<br />
kommerzielle Logik hat die journalistische abgelöst.<br />
Nick Davies, erfahrener Sonderkorrespondent<br />
der britischen Tageszeitung<br />
„The Guardian“ hat die britische Qualitätspresse<br />
einem aufwändigen Test<br />
unterzogen. Seine Ergebnisse sind<br />
niederschmetternd und vielleicht auch<br />
eine Folie für deutsche Kommunikationswissenschaftler,<br />
die ähnliche Tendenzen<br />
in der deutschen Medienlandschaft<br />
bislang nicht erkannt haben.<br />
„Ich war gezwungen mir einzugestehen,<br />
dass ich in einer korrumpierten Profession<br />
arbeite,“ so das Fazit des 400seitigen<br />
Werks mit dem Titel „Flat<br />
Earth News.“ „Die Journalisten seien<br />
im ‘professionellen Käfig’ ihrer ‘Nachrichtenfabriken‘<br />
gefangen und zu<br />
‘Churnalisten‘ verkommen. (nach ‘to<br />
churn out‘: auswerfen).<br />
Sie schrieben Pressemitteilungen oder<br />
Agenturmeldungen nur noch schnell<br />
um, ohne selbst nachzuforschen. Dieser<br />
Zustand mache die Massenmedien<br />
äußerst anfällig für die Verbreitung<br />
von Falschmeldungen, irreführenden<br />
Legenden und Propaganda.“<br />
In seiner Buch-Rezension zitiert Henning<br />
Hoff in der Frankfurter Allgemeinen<br />
Sonntagszeitung (www.faz.net) schockierende<br />
Zahlen einer empirischen<br />
Analyse von 2000 Berichten der britischen<br />
Qualitätspresse. Untersuchungs-<br />
zeitraum war Frühjahr 2006. „Sechzig<br />
Prozent bestanden ausschließlich oder<br />
hauptsächlich aus PR-Material oder<br />
Berichten von Nachrichtenagenturen,<br />
die aber auch nur bei zwei Prozent als<br />
Quelle angegeben worden waren. (...)<br />
Nur zwölf Prozent der Texte ließen auf<br />
eigene Recherchen schließen.“ Nick<br />
Davies: „Ich fürchte, ich beschreibe<br />
nur den Tumor, der uns umbringt, ohne<br />
eine Therapie anbieten zu können.“<br />
Die Ursache für diese Entwicklung –<br />
die wohl keine britische Spezialität ist<br />
– sieht Davis so: „Das Grundproblem<br />
ist, dass eine kommerzielle Logik die<br />
journalistische abgelöst hat.“<br />
Nicht nur im online-Markt wird heute<br />
nicht mehr von Journalismus, sondern<br />
von „Geschäftsmodellen“ gesprochen.<br />
Journalismus als Ware, die mit möglichst<br />
geringem (personellen) Aufwand<br />
hergestellt werden soll – ein bitteres<br />
Fazit der britischen Studie, die auch in<br />
deutschen Verlagen und Sendern<br />
intensiv diskutiert werden müsste.<br />
„Verkrüppelter Journalismus“<br />
Was Nick Davis – gestützt auf ein<br />
empirisches Fundament – jetzt publiziert<br />
hat, beschrieb der Schriftsteller<br />
Henning Mankell schon Jahre zuvor.<br />
Seine Analyse: „Zu viele Autoren ver-<br />
26
schwenden ihr Können auf einen verkrüppelten<br />
Journalismus, der zu nichts<br />
verpflichtet,“ kritisierte er harsch.<br />
„Sie liefern Nachrichten als Unterhaltung.“<br />
Eine lebendige Demokratie<br />
brauche aber „nachforschende, detektivisch<br />
arbeitende Journalisten.“<br />
Sein Appell blieb jedoch – wie viele<br />
andere Mahnungen – ziemlich unbemerkt<br />
und verdunstete rasch. Kein<br />
Wunder: Journalistische Selbst-Kritik,<br />
die eigene Reflexion des Gewerbes<br />
oder gar medien-ethische Debatten<br />
werden in Deutschland nicht gepflegt.<br />
Nur ein paar versprengte Initiativen<br />
beschäftigen sich – oft akademisch<br />
abgeriegelt – mit Qualitätsfragen und<br />
der Bedeutung ethischer Fragen im<br />
Journalismus. Verleger und Senderverantwortliche<br />
kalmieren und beschwören<br />
meist in festlichen Fensterreden<br />
den Status, an dem es nichts zu kritisieren<br />
gäbe. Auch der deutsche Presserat<br />
beschäftigt sich gerne mit dem Splitter<br />
im Auge der anderen, ohne den Balken<br />
im eigenenen Blickfeld wahrzunehmen.<br />
Die Folge: Im Medien-Treibhaus der Unverbindlichkeit,<br />
Schnelligkeit und Oberflächlichkeit<br />
gedeihen Mythen vortrefflich.<br />
Dazu gehört auch der Mythos des<br />
„investigativen Journalismus“.<br />
Darauf hat der US-Journalist Seymour<br />
27<br />
Hersh hingewiesen. Hersh, vor kurzem<br />
noch zu Recht als „bester investigativer<br />
Journalist unserer Tage“ gepriesen,<br />
sagte ganz lakonisch in die ZDF-Kamera:<br />
das Wichtigste sei sein Informanten-<br />
Netz. Nur gute Quellen führten zu wirklichen<br />
Enthüllungen. Schon bei seinen<br />
früheren Jobs als Pentagon-Korrespondent<br />
der Nachrichten-Agentur AP beschaffte<br />
er sich Informationen lieber in<br />
der Offiziers-Cafeteria, als in den Pressekonferenzen.<br />
Neue Kontaktnummern<br />
für sein Adressbuch sammelte er in<br />
internen Hauszeitschriften oder Telefonverzeichnissen<br />
der Ministerien.<br />
Sein Augenmerk galt besonders pensionierten<br />
oder auffälligen Mitarbeitern,<br />
die eigene Positionen formulierten. Sie<br />
könnten gute Quellen sein.<br />
Erinnern wir uns: Wichtige Informationen<br />
im Dunkelfeld von Korruption und<br />
Amtsmissbrauch werden selten selbst<br />
von Journalisten „ausgegraben“, sie<br />
werden meist gesetzt.<br />
Scharpings’ verhängnisvolle Verbindung<br />
mit dem PR-Lobbyisten Hunzinger<br />
wurde zunächst dem Spiegel offeriert;<br />
anschliessend dem Stern; das Hamburger<br />
Magazin ließ sich dann auf den<br />
Deal ein. Weltekes Adlon-Ausflug wurde<br />
von seinen politischen Gegnern im<br />
Finanzministerium mit Hilfe interner
Rechnungsbelege skandalisiert.<br />
Ein Mitarbeiter des Bundes der Steuerzahler<br />
organisierte im Verbund mit der<br />
Bild-Zeitung den Aufschrei gegen den<br />
„Miles-and-More-Missbrauch“ unserer<br />
Parlamentarier. Der frühere CDU-Schatzmeister<br />
Leissler-Kiep „verkaufte“ seine<br />
Informationen in der CDU-Spenden-<br />
Affaire ganz gezielt, um im Gegenzug<br />
seine Schwarzgeld-Rolle etwas aufzuhellen.<br />
Die Kette dieser interessengeleiteten<br />
Pseudo-Enthüllungen ließe<br />
sich noch fortsetzen: sie funktioniert<br />
im Geflecht der Lokalpolitik genauso<br />
wie im Kanzleramt, Ministerien oder<br />
Behörden. Im Kampf um Machterwerb<br />
oder Machterhalt ist die Steuerung<br />
von kritischer Öffentlichkeit e i n e<br />
zentrale Ressource.<br />
Quellenpflege und Informantenschutz<br />
ermöglichen erfolgreiche Recherchen<br />
Quellenpflege und die Erschliessung<br />
neuer Quellen ist folglich einer der<br />
wichtigsten Beschäftigungen von Journalisten,<br />
die mehr sein wollen, als die<br />
Textmanager von Agentur- oder PR-<br />
Material.<br />
Mit jedem veröffentlichten Skandal<br />
wird die Luft aber dünner. Für Behörden-Chefs<br />
ist jedes (noch so kleine)<br />
Informations-Schlupfloch ein Risiko.<br />
Nachdem die WELT über interne Vermerke<br />
der hessischen Landesregierung<br />
zum Thema „NPD-Verbot“ berichtete,<br />
wurde sogar das BKA eingeschaltet,<br />
um die Quelle künftig stillzulegen.<br />
Auch in den Staatsanwaltschaften<br />
werden häufig „interne Ermittlungen“<br />
aufgenommen, wenn wichtige Schriftstücke<br />
den internen Postweg verlassen.<br />
Die EU-Anti-Korruptionsbehörde OLAF<br />
schaltete die belgische Justiz ein und<br />
beschlagnahmte die kompletten Akten<br />
des Brüsseler Stern-Korrespondenten.<br />
Ein rechtswidriger Übergriff, wie die<br />
Gerichte später urteilten. Selbst in<br />
Ministerien werden nach kritischer<br />
Berichterstattung „dienstliche Erklärungen“<br />
von potentiellen Informanten<br />
verlangt, um Angst zu schüren und<br />
den Apparat abzudichten. Die Botschaft<br />
solcher Aktionen richtet sich<br />
nicht in erster Linie an die kritisch<br />
berichtenden Journalisten; die Warnung<br />
geht an die Informanten. Zu der<br />
politischen Einschüchterung kommt<br />
oft noch die juristische Verfolgung v o r<br />
und n a c h unliebsamen Veröffentlichungen.<br />
Klaus Bednarz, der frühere<br />
Monitor-Chef hat diesen Trend schon<br />
früh erkannt und gemahnt, dass der<br />
Anteil investigativer Eigenleistungen<br />
sinke. Chefredakteure und Verlagschefs<br />
28
emsten kritische Recherchen, „da sie<br />
kostspielige Klagen oder unliebsame<br />
politische, sprich unternehmenspolitische<br />
Folgen fürchten.“ Der Autor Marc<br />
Pitzke spitzt noch zu: „Investigativer<br />
Journalismus ist bei uns eine verlernte<br />
Kunst. Intensive Recherche ist nicht<br />
gefragt.“ Mustert man die Veränderung<br />
der Medienlandschaft, kann man dieser<br />
Einschätzung nicht widersprechen.<br />
„Zu viel Recherche macht die schönste<br />
Geschichte kaputt.“<br />
Sicherlich schrumpft der Markt für<br />
soliden Hintergrund-Journalismus und<br />
für meist finanziell aufwendige Recherchen.<br />
Dies liegt jedoch nicht nur an den<br />
„äusseren“ Bedingungen sondern<br />
auch an der „inneren“ Haltung vieler<br />
Journalisten. Das Berufsbild hat sich<br />
im Laufe der Jahre im Windschatten<br />
des volljährigen Privatfunks verändert.<br />
Viele Journalisten sehen sich als Dienstleister<br />
für Service-Informationen, nicht<br />
als Aufklärer von Misständen oder<br />
Mahner gegen Korruption, Machtmissbrauch<br />
und Ämterpatronage. Die aufgemotzte<br />
Agenturmeldung ist schneller<br />
erledigt, als der aufwendige Hintergrundbericht.<br />
Der Broadway-Kolumnist<br />
Walter Winchell hat diese Haltung zynisch<br />
so beschrieben: „Zu viel Recher-<br />
29<br />
che macht die schönste Geschichte<br />
kaputt.“<br />
All diese Faktoren beeinflussen, beeinträchtigen<br />
und behindern den sogenannten<br />
„investigativen Journalismus“,<br />
der in Deutschland immer noch eine<br />
Ausnahmegattung ist.<br />
Es gibt aber keinen Grund, sich von dieser<br />
nüchternen Bilanz entmutigen zu<br />
lassen. Vielmehr sollte man den Blick<br />
auf soliden und seriösen Recherche-<br />
Journalismus richten. Wenn es gelänge,<br />
bei allen journalistischen Produkten<br />
die Quellenvielfalt zu erhöhen, wenn<br />
es gelänge gesteuerte PR-Informationen<br />
zu filtern und zu hinterfragen und<br />
wenn es gelänge, die richtigen Fragen<br />
an die richtigen Leute zu richten –<br />
dann würden die Fundamente eines<br />
verantwortlichen Journalismus erneuert<br />
werden.<br />
Und dies wäre dann vielleicht das solide<br />
und stabile Fundament, auf dem sich<br />
dann m e h r „investigativer Journalismus“<br />
entwickeln könnte. Ein investigativer<br />
Journalismus, der diesen anspruchsvollen<br />
Namen auch wirklich<br />
verdient.<br />
Dr. Thomas Leif, 1. Vorsitzender von<br />
netzwerk recherche e. V.
DIE PREISTRÄGER <strong>2007</strong>
Michaela Schießl<br />
Ingolf Gritschneder<br />
Markus Grill<br />
Tom Schimmeck
1. PREIS<br />
32
33<br />
Michaela Schießl<br />
1. <strong>Preis</strong><br />
Not für die Welt<br />
Der Spiegel, 19/<strong>2007</strong>
Not für die Welt<br />
Die Agrarsubventionen reicher Länder zerstören<br />
die Existenz afrikanischer Bauern.<br />
Es ist ein großer Tag für das kleine Kind – und doch einer, der nur trostlos enden<br />
kann. Das wissen die Fischer, aber keiner von ihnen will dem Jungen die Freude<br />
an seinem ersten Arbeitstag verderben. Aufgeregt hüpft der Achtjährige am Strand<br />
des senegalesischen Fischerorts Mbour durch die Brandung, bis ihn jemand auf<br />
eine der buntbemalten Pirogen hebt. Der 18 Meter lange Holzkahn hält sich nur<br />
mit Mühe über Wasser, zwei Dutzend Fischer drängeln sich auf den Querbalken.<br />
Kein Dach, keine Plane schützt sie vor der afrikanischen Sonne. Es ist zehn Uhr<br />
morgens und 37 Grad Celsius heiß. Endlich jault der Außenbordmotor auf, das<br />
Boot nimmt Kurs auf den Atlantik.<br />
Kapitän Badou Ndoye steht am Ruder und liest die Wellen. Ein guter Patron kann<br />
dem Meer die Fische ansehen, sagen sie im Senegal – an der Art, wie sich die<br />
Oberfläche kräuselt. Brassen machen Blasen, Stachelmakrelen winzige Wellen,<br />
Barben erzeugen kleine Buckel auf dem Wasser. Badou hat 62 Jahre Erfahrung<br />
auf See. Der 67-Jährige ist Fischer in dritter Generation, fünf seiner Söhne sind<br />
mit an Bord.<br />
„Sardinen“, sagt er und gibt Gas. Das Boot fährt einen Kreis, das Netz, 200<br />
Meter lang und 40 Meter tief, saust über den Rand. Das ist der Moment, in dem<br />
das Kind gepackt und ins Meer geworfen wird – mitten hinein in eine Zukunft,<br />
die längst keine mehr ist.<br />
Denn sosehr sich der Junge auch abstrampelt, um zum ersten Mal in seinem<br />
Leben die Fische ins Netz zu treiben – es reicht nicht mehr zum Überleben. Seit<br />
die Flotten der Toubabs, der Weißen, die Fanggründe beherrschen, sind die<br />
Kleinfischer chancenlos. In riesigen Netzen, geleitet von empfindlichen Sonargeräten,<br />
ziehen die Industrietrawler vor der Küste Westafrikas das Leben aus<br />
dem Meer. Bis zu 2.000 Tonnen Fisch fassen manche dieser schwimmenden<br />
Fabriken. Dafür brauchte Kapitän Badou Jahrzehnte.<br />
Doch selbst wenn die Einheimischen nicht mit bloßer Muskelkraft das Netz aus<br />
dem Meer ziehen würden, selbst wenn sie Eis hätten, um ihren Fang vor dem<br />
Verderben zu retten, und Schiffe, mit denen man nicht täglich zur Küste zurück-<br />
34
kehren muss – es würde immer ein ungleicher Kampf bleiben. Denn sie müssen<br />
vom Verkauf ihrer Ware leben, anders als die hochgerüsteten Konkurrenten aus<br />
dem Norden.<br />
Das ist schwer zu verstehen für die Fischer von Mbour. Die angeblich so marktorientierten<br />
Industrieländer des Nordens geben fast doppelt so viel Geld für den<br />
Fischfang aus, wie sie damit einnehmen.<br />
Die Fischer aus Europa, Japan, den USA bekommen Geld geschenkt, um ihre<br />
Boote mit modernsten Geräten vollzustopfen. Sie tanken vergünstigten Treibstoff<br />
und profitieren von billigen Darlehen. Der Transport wird bezuschusst, auch der<br />
Export. All das finanziert der Steuerzahler.<br />
Und wenn sie ihre eigenen Meere leergefischt haben, kauft man ihnen einfach<br />
neue: Vergangenes Jahr gab die Europäische Union über 200 Millionen Euro aus,<br />
damit ihre Flotten in fremden Hoheitsgewässern jagen können. Zwölf Millionen<br />
Euro jährlich zahlte die Kommission von 2002 bis 2006 allein an den Senegal für<br />
die Fangrechte. Seit Sommer letzten Jahres wird um neue Verträge gefeilscht.<br />
Das alles muss sein, heißt es, um Jobs zu sichern. Doch Kapitän Badou Ndoye<br />
sorgt sich auch um seinen Job.<br />
Die wertvollen Fische werden immer seltener, weil die Trawler der Ausländer verbotenerweise<br />
auch die Jungfische mit herausziehen. Das weiß er von den Seeleuten,<br />
die auf den Schiffen der Fremden arbeiten. Auch heute ist er nach sieben<br />
Stunden auf See fast leer heimgekehrt, hat nur billige Sardinen und Sardellen<br />
gefangen, dazu zwei Tintenfische und ein paar Rotbarsche.<br />
Die Stimmung an Bord ist gedrückt. Mehr als ein, zwei Euro bleiben nicht für<br />
jeden Fischer. Wie soll man damit eine Familie ernähren? Fisch ist das Hauptexportprodukt<br />
des Landes. Das Gewerbe sorgt für 15 Prozent aller Arbeitsplätze.<br />
Viele davon sind nun bedroht.<br />
Senegals Fischer sind nicht die einzigen Verlierer im ungleichen Kampf gegen<br />
viel zu starke Gegner. Auch die Bauern verlassen in Scharen ihre Felder, weil ihre<br />
Waren mit den Billigprodukten aus Europa, den USA und Asien nicht mithalten<br />
können. Auf den Märkten in der Hauptstadt Dakar stapeln sich Zwiebeln aus den<br />
Niederlanden. Das Tomatenmark stammt aus Italien, das Milchpulver aus Frankreich,<br />
die Hühnchenteile aus allen Regionen der EU.<br />
35
Die Landwirte im Senegal haben keine Chance. Und da geht es ihnen nicht<br />
anders als ihren Kollegen in Kenia, in Burkina Faso, in vielen Ländern Afrikas,<br />
aber auch Lateinamerikas. Sie alle könnten von ihrer Hände Arbeit leben. Sie<br />
könnten sich und ihre Familien ernähren mit dem Anbau von Mais, Soja oder<br />
Tomaten, mit dem Fischfang oder der Milchwirtschaft – wenn, ja wenn sie es<br />
nicht mit übermächtigen Konkurrenten zu tun hätten, die ihre Märkte mit hochsubventionierten<br />
Waren überschwemmen.<br />
Fairer Wettbewerb sieht anders aus. Auf der einen Seite stehen die Bauern der<br />
Dritten Welt mit ihren Hacken und Pflügen. Auf der anderen Seite die Hightech-<br />
Agrarindustrie des Nordens, die weit mehr produziert, als die Menschen in<br />
Europa, Australien, den USA selbst verbrauchen.<br />
Sie erhält Förderung, auch wenn ihre Produkte niemand braucht, im Zweifel wird<br />
der Export der Überschüsse in die Dritte Welt auch noch vom Steuerzahler<br />
gefördert.<br />
Die USA liefern ihren Überfluss kostenlos in die Hungergebiete der Welt. Doch<br />
selbst dieses vermeintlich karitative Werk schadet letztlich den Beschenkten.<br />
Die Lebensmittel landen dort oft auf den Märkten und verdrängen die heimische<br />
Produktion: Not für die Welt statt Brot für die Welt.<br />
Dass sich daran möglichst wenig ändert, dafür sorgt eine mächtige Lobby. Ihr<br />
Einfluss reicht bis in ihre Regierungen. Die wiederum dominieren die internationalen<br />
Institutionen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass auf den Weltmärkten<br />
faire Bedingungen herrschen.<br />
Den freien Wettbewerb fordern diese Organisationen – allen voran die Welthandelsorganisation<br />
WTO – ständig. Doch frei soll vor allem der Zugang der Entwicklungsländer<br />
für die Erzeugnisse des Westens sein. Ihre eigenen Märkte schotten<br />
die reichen Länder so weit wie möglich ab.<br />
Früher hielt sich auch die Dritte Welt Konkurrenz mit Hilfe hoher Einfuhrzölle<br />
vom Leib. Doch wer Kredite braucht vom Internationalen Währungsfonds oder<br />
der Weltbank, muss Zugeständnisse machen an die globalisierte Handelswelt:<br />
Zölle senken, Märkte öffnen, staatliche Unternehmen privatisieren, Staatsausgaben<br />
senken.<br />
„Strukturanpassungsmaßnahmen“ nennt sich das ganz harmlos in der Sprache<br />
36
der Washingtoner Weltorganisierer. Strukturen anpassen – aber an wen?<br />
„Sie sagen, die Welt sei ein großer Marktplatz geworden, die Schranken sollen<br />
fallen, damit der Handel seine heilsamen Kräfte entfalten kann“, sagt Samba<br />
Guèye, Präsident des nationalen Rats für ländliche Zusammenarbeit im Senegal.<br />
„Doch wir haben nicht den gleichen Blickwinkel. Diejenigen, die beim IWF, der<br />
Weltbank und der WTO die Regeln machen, sitzen im gekühlten Büro, schicken<br />
ihre Kinder auf Universitäten und fahren abends mit der Limousine in ihr Eigenheim.<br />
Es sind Reiche, die Regeln machen für die Reichen.“<br />
Er hat sie getroffen, bei den Welthandelsgesprächen im Dezember 2005 in<br />
Hongkong. Er trug sein feinstes afrikanisches Gewand und schilderte ihnen die<br />
aussichtslose Lage der senegalesischen Landbevölkerung. Es waren keine<br />
Neuigkeiten, die er da verbreitete, denn schon im Uno-Bericht zur menschlichen<br />
Entwicklung 2005 steht: „Das Grundproblem, das bei den Gesprächen der WTO<br />
über Landwirtschaft in Angriff genommen werden muss, lässt sich in drei Wörtern<br />
zusammenfassen: Subventionen reicher Länder.“ Durch sie würden die Existenzgrundlagen<br />
in einigen der ärmsten Länder zerstört.<br />
Damit sollte in Hongkong Schluss sein. Dafür wollten Samba Guèye und seine<br />
Mitstreiter kämpfen. Und tatsächlich: Erstmals mussten die Wohlhabenden<br />
Zugeständnisse machen: Alle Exportsubventionen für Agrargüter müssen bis<br />
zum Jahr 2013 fallen. Darauf wurde sich nach zähem Ringen geeinigt.<br />
„Ein Ereignis historischen Ausmaßes“, lobte sich die EU danach selbst. Für die<br />
armen Ländern allerdings gab es nichts zu feiern. Sie hatten sich den Schritt<br />
schon für 2010 erhofft. Wie nur, so fragten sie sich, sollen sie noch acht Jahre<br />
durchhalten? Was sollten sie ihren Bauern sagen?<br />
Senegal, eines der ärmsten Länder der Welt, bemüht sich seit Mitte der neunziger<br />
Jahre, mitspielen zu dürfen im Konzert der Großen. Für einen Kredit des IWF<br />
hatte das Land die Währung abgewertet und seinen Markt für ausländische<br />
Lebensmittel geöffnet. Quoten und Lizenzen fielen weg, Zölle gingen bis 2001<br />
schrittweise von durchschnittlich 34 Prozent auf 14 runter.<br />
Fast über Nacht verwandelte sich der Senegal in ein Paradies – für Länder, die<br />
ihre Überproduktion loswerden wollten.<br />
Die Tomatenbauern traf das besonders hart. Sie hatten bis dahin gut leben können,<br />
37
weil Staatsfirmen ihre Ernten kauften. Plötzlich wurde italienisches Tomatenmark<br />
ins Land gepumpt. 300 Millionen Euro an Exportsubventionen zahlten<br />
Europas Bürger 1997 dafür, dass ihre Überproduktion die ärmsten Länder der<br />
Welt überschwemmt – zu Dumping-<strong>Preis</strong>en.<br />
Die Entwicklung verlief fast zwangsläufig: Die mittlerweile teilprivatisierten<br />
Tomatenmarkfirmen Senegals kauften das billige italienische Tomatenmark und<br />
verarbeiteten es weiter. Die Importe aus der EU explodierten zeitweise auf das<br />
20fache. Die Senegalesen hatten der europäischen Konkurrenz nichts entgegenzusetzen.<br />
Ihre eigenen Beihilfen waren durch die erzwungene Liberalisierung<br />
praktisch verschwunden, ihre Tomatenproduktion brach um 70 Prozent ein, der<br />
<strong>Preis</strong> fiel auf die Hälfte.<br />
Es kam noch schlimmer. 2005 eröffnete ein Libanese eine Tomatenmarkfabrik in<br />
Dakar – und importiert Paste aus China noch unter dem <strong>Preis</strong> des EU-Produkts.<br />
Unter Senegals Farmern herrscht seither Verzweiflung. Vor der Aussaat im<br />
Sommer 2006 versammelt Ibrahim Fedior, Präsident des Tomatenbauernverbandes,<br />
seine Schicksalsgenossen zum Krisengespräch in Dagana, an der Grenze zu<br />
Mauretanien.<br />
Hier, wo der Senegal rotbraun fließt, ist das fruchtbarste Land für Gemüseanbau.<br />
Die Männer sind wütend. Einige mussten bereits ihre Kinder aus der Schule<br />
nehmen, weil sie die Gebühr, neun Euro im Monat, nicht mehr zahlen können.<br />
Was sollten sie tun? Auf Zwiebeln ausweichen? Keine Chance, seit drei Jahren<br />
überrollen niederländische Zwiebeln den Markt. Reis anbauen? Nicht konkurrenzfähig<br />
gegen die Thailänder, die ihre Abfälle spottbillig als Bruchreis verscherbeln.<br />
Baumwolle? Sinnlos, der <strong>Preis</strong> ist wegen der US-Überproduktion im Keller.<br />
Die Männer in Fediors Büro fassten einen mutigen Beschluss: Wenn die Regierung<br />
ihnen nicht garantiert, für mindestens zwei Monate nach der Ernte die<br />
Grenzen für ausländische Konkurrenz dichtzumachen, werden sie nicht pflanzen.<br />
Keine einzige Tomate. Dann werden sich die Politiker fragen lassen müssen,<br />
warum sie den Tomatenanbau fürs eigene Volk zerstört haben.<br />
Knapp 80 Prozent der Afrikaner leben wie die Männer von Dagana von der Landwirtschaft.<br />
Sie alle können sich ernähren. Doch wenn sie nichts verkaufen, fehlt<br />
38
das Geld für alles, was ihnen aus der Armut helfen kann: Schule, Medizin und<br />
Transport.<br />
Das Argument des Nordens, man helfe mit der Einfuhr billiger Lebensmittel vor<br />
allem den Armen, klingt für sie wie Hohn: Wer nichts versilbern kann, kann<br />
nichts kaufen, egal, wie billig. Statt Not zu lindern, wird alte Not konserviert und<br />
neue geschaffen. Deshalb ist es den Bauern auch egal, ob ihre Forderung nach<br />
einem Importstopp den WTO-Regeln entspricht. „Die WTO erlaubt den einen,<br />
ihre Märkte abzuschotten und ihre Landwirte zu subventionieren, und wir sollen<br />
uns schutzlos ausliefern“, klagt Ibrahim Fedior.<br />
So klingt das neue Mantra des Südens: Sich nicht länger der Doppelmoral der<br />
reichen Länder beugen, sich nicht mehr übervorteilen lassen, sich zur Wehr setzen.<br />
Es klingt nach Notwehr. Als die USA sich vergangenen Juli bei einer WTO-Krisensitzung<br />
in Genf weigerten, ihre Agrarsubventionen zu beschneiden und die<br />
eigenen Märkte für ausländische Produkte weiter zu öffnen, reichte es. Eine<br />
Gruppe Entwicklungsländer unter Führung von Indien und Brasilien ließ die<br />
Gespräche platzen – Fortsetzung ungewiss.<br />
Voller Spott blickt Fedior auf die hübsch gerahmten Fotos in seinem winzigen<br />
Büro. Sie zeigen die feierliche Übergabe neuer Traktoren an die Tomatenbauern.<br />
Traktoren, die die Regierung ohne Zweifel mit Entwicklungshilfegeldern finanziert<br />
hat.<br />
Es ist absurd: Der Westen zahlt für die Landwirtschaften der Dritten Welt, verhindert<br />
aber gleichzeitig deren Entwicklung durch den Export der eigenen Überproduktion.<br />
Die Zahlen sprechen Bände: Die gleiche Summe, die die OECD-Länder<br />
pro Jahr an Agrarbeihilfe für Afrika leisten, erhalten ihre eigenen Landwirte –<br />
täglich als Subventionen.<br />
Manchmal genügt schon der Abfall der Reichen, um arme Länder ins Wanken zu<br />
bringen. Im Jahr 2000 bewegte die Weltbank die Länder der westafrikanischen<br />
Wirtschafts- und Währungsunion dazu, ihre Einfuhrzölle auf Geflügelteile von<br />
55 auf 20 Prozent zu senken. Das Ergebnis: Praktisch über Nacht wurde die<br />
Region mit Hähnchenflügeln überschüttet.<br />
39
Die Teile gelten in den gesundheitsbewussten Industrieländern als Fast-Abfall,<br />
das Geschäft wird dort mit dem mageren Brustfleisch gemacht. Nun plötzlich<br />
bot sich die Chance, die Reste zu verscherbeln, statt sie als Tiermehldünger auf<br />
die Felder zu streuen.<br />
Den senegalesischen Geflügelzüchtern wurde damit der Garaus gemacht. Aus<br />
einem prosperierenden Sektor mit 10.000 Arbeitnehmern und einem<br />
Jahresumsatz von 3,8 Millionen Euro wurde ein Sanierungsfall. 2.000 Kleinzüchter<br />
gaben auf.<br />
Innerhalb von fünf Jahren fiel der Marktanteil einheimischer Hühnerproduzenten<br />
von 80 auf 35 Prozent, während sich der Import bis 2003 nahezu verdoppelte.<br />
Drei Viertel der Einfuhren kamen tiefgefroren aus Belgien und den Niederlanden –<br />
für die Hälfte des <strong>Preis</strong>es eines senegalesischen Huhns.<br />
Das sei kein Dumping, behauptet die EU, weil bei dieser Resteverwertung keine<br />
Exportbeihilfen fließen. Über zwei Ecken aber ist der niedrige <strong>Preis</strong> doch ein Produkt<br />
europäischer Subventionspolitik. Denn als Folge der Direktzahlungen an<br />
Getreidebauern verbilligte sich das Hühnerfutter zwischen 1990 und 2002 um zwei<br />
Drittel. Das wiederum macht bei der Aufzucht bis zu 70 Prozent der Kosten aus.<br />
Djibril Dieme, Geflügelzüchter nahe Dakar, hatte schon alle Hoffnung verloren.<br />
Er hatte alles gemacht wie immer, und doch kaufte niemand mehr sein Fleisch.<br />
Er sah das fremde Angebot auf den Märkten, aber er wusste nicht, was dahintersteckte.<br />
Nur eins war ihm klar: dass er aufgeben muss, wenn nicht ein Wunder<br />
geschieht.<br />
Das Wunder kam. Es nannte sich Vogelgrippe und begab sich in Europa. Mit dem<br />
Argument der Gesundheitsgefährdung konnte der Senegal Anfang 2006 die Einfuhren<br />
legal stoppen. Seither hat Dieme seinen Hühnerbestand wieder erhöhen<br />
können. Er weiß nicht, was er macht, wenn der Einfuhrstopp ausläuft. Er weiß<br />
nur, dass dies der Tag ist, an dem er erledigt sein wird.<br />
Dann muss auch er sich überlegen, ob er den gefährlichen Trip nach Europa<br />
wagt, von dem alle jungen Senegalesen träumen.<br />
Die meisten haben die Hoffnung auf eine Zukunft im eigenen Land längst aufgegeben.<br />
Die Hafenstädte Mbour oder St. Louis sind übervölkert mit Jugendlichen,<br />
40
die auf die Chance ihres Lebens warten: in ein Boot zu steigen, mit Kurs auf<br />
Spanien.<br />
Das Flüchtlingsgeschäft gebiert einen Teufelskreis: Der Bootspreis hat sich<br />
verdreifacht. Seine Piroge zu verkaufen bringt einem Fischer derzeit mehr als ein<br />
Jahresgehalt. Wer aber bleibt, kann sich kaum noch Ersatzteile für sein Boot<br />
leisten, weil die <strong>Preis</strong>e explodiert sind.<br />
Sechs bis zehn Tage dauert die Fahrt Richtung Europa, dichtgedrängt in einer<br />
Nussschale, die keinem Sturm standhalten kann. Trotzdem schlagen sich die<br />
Passagiere um Plätze. Sie wissen, dass sie untergehen können auf dieser Reise.<br />
Doch sie sind sicher, dass sie untergehen, wenn sie bleiben.<br />
„Sie sterben lieber, als chancenlos zu bleiben“, sagt Ngouda Ndaye, Cousin des<br />
Pirogenkapitäns Badou. Der 51-Jährige kann das verstehen, er selbst hat sich<br />
bereits vor fünf Jahren auf den Weg gemacht, allerdings auf weniger riskantem<br />
Weg. Im Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria ist er von Bord des italienischen<br />
Trawlers getürmt, auf dem er gearbeitet hat.<br />
Vom Paradies Europa spricht Ngouda nicht mehr, nach fünf Jahren als Illegaler.<br />
Beim Tomatenanbau hat man ihm einen Hungerlohn bezahlt, in der Fischfabrik<br />
hat man ihn geschunden, auf den Fangschiffen ausgebeutet. Nach einem<br />
monatelangen Fischzug vor Mauretanien schmiss ihn der Kapitän ohne einen Cent<br />
von Bord, feixend, „geh doch zur Polizei“.<br />
Über die Gewerkschaft fand er schließlich einen legalen Job auf dem Bau. Endlich<br />
bekam er auch Papiere und eine Zweizimmerwohnung in einer schäbigen Hochhaussiedlung<br />
in Las Palmas.<br />
Die Räume sind abgedunkelt, die Vorhänge zugezogen, eine Marotte nach vielen<br />
Jahren im Untergrund. Ich will nicht hier sein, sagt Ngouda, aber er muss, um<br />
das Haus in Mbour und die Ausbildung seiner vier Kinder zu bezahlen.<br />
Das fällt schwerer, als man denkt. 1.080 Euro im Monat verdient er für zehn<br />
Stunden Arbeit täglich. Das ist viel Geld im Senegal, aber nicht in Spanien.<br />
400 Euro kostet ihn die Miete, dazu kommen Essen, Kleidung, Busticket und<br />
Telefon. Da bleiben höchstens 200 Euro übrig.<br />
„Ich zahle einen hohen <strong>Preis</strong>, damit meine Familie leben kann“, sagt Ngouda.<br />
41
Seine Frau sieht er höchstens einmal im Jahr – und ein Dutzend Mal täglich auf<br />
einem Bild in seinem Foto-Handy.<br />
Lebensläufe wie die von Ngouda sind typische Folgen einer unfairen Handelspraxis,<br />
die Menschen entwurzelt, Bauern in die Städte treibt oder auf lebensgefährliche<br />
Reisen.<br />
„Man muss den Bürgern in den reichen Ländern einmal verdeutlichen, welche<br />
ungeheuren Auswirkungen ihre Agrarpolitik auf das Leben der Ärmsten dieser<br />
Welt hat“, sagt Lamine Ndiaye von Oxfam Westafrika.<br />
Genau das hat Terry Steinhour, 59, Farmer aus Greenview, Illinois, gemacht. Er<br />
ist nach Afrika gereist und hat einfach mal nachgesehen, was seine Subventionen<br />
so anrichten am anderen Ende der Welt.<br />
Nun sitzt er wieder in seinem schmucken Farmhaus, umgeben von goldgelben<br />
Feldern, auf denen stramm der Mais steht und die genmanipulierten Sojabohnen<br />
vor sich hin reifen, und sagt: „Die Reise hat mir die Augen geöffnet.“<br />
Nicht, dass er vorher nicht geahnt hätte, dass da etwas faul ist in der Agrarpolitik.<br />
Seit Jahren beobachtet er, wie die Farmer immer weniger werden und die wenigen<br />
immer größer. Er erlebt den Niedergang des ländlichen Amerika und die Fremdbestimmtheit<br />
der verbleibenden Bauern.<br />
US-Agrarmultis wie Cargill, Bunge, Con-Agra und ADM. Mit großzügigen Wahlkampfspenden<br />
setzen die Konzerne eine Politik durch, die ihnen niedrige<br />
Einkaufspreise garantiert.<br />
Den „Freedom to farm“-Act beispielsweise, der die Bauern so viel anbauen lässt,<br />
wie sie wollen, statt Überproduktion zu reglementieren. Oder ein neues Landwirtschaftsgesetz,<br />
das die Subventionen wieder stärker an die Produktionsmenge<br />
bindet statt an die bewirtschaftete Fläche wie seit 2005 in Europa. Diese Politik,<br />
sagt Steinhour, sei doch für die Multis gemacht und nicht für die Bauern.<br />
Er ist ein guter Farmer. Er ist ein guter Amerikaner. Er wählt die Demokraten.<br />
Über Afrika hatte er sich früher nie Gedanken gemacht. Bis im Mai 2006 sein<br />
Handy klingelte. Eine Frau von Oxfam Chicago fragte, ob er nach Westafrika<br />
mitkommen wolle, um die dortigen Bauern zu besuchen.<br />
Eine Woche lang hat Terry Steinhour überlegt. Er war erst zweimal im Leben<br />
geflogen, nur einmal im Ausland gewesen, vor 20 Jahren. Nun ist sein Bauch<br />
42
dick, das Haar silberfarben und sein Reisepass abgelaufen. „Du verzeihst dir<br />
nie, wenn du nicht fährst“, sagte seine Frau Phyllis.<br />
Es war ein Erlebnis, das sein Leben veränderte. „Wir haben keine Ahnung, was<br />
wir anrichten. Wir bedrohen das Leben in Afrika“, sagt er.<br />
Auf das Elend, das ihm auf seiner Reise entgegenschlug, war Steinhour nicht<br />
vorbereitet. All die bettelnden Kinder, die armseligen Hütten, die unvorstellbare<br />
Luftverschmutzung in Dakar, die stinkenden Slums, die staubigen Pisten. Und<br />
erst die erbärmlichen Weizenfelder, die in Steinhours Heimat schleunigst untergepflügt<br />
würden, damit die Nachbarn nicht reden.<br />
Sieben Tage lang trafen Steinhour und die anderen US-Bauern Minister in Mali<br />
und Senegal, diskutierten mit Bauernführern und aßen mit Farmern von einer<br />
gemeinsamen Platte. Alle hatten nur eine Bitte: Stoppt eure Subventionen!<br />
Bis ins letzte Dorf wusste jeder, weshalb die Baumwolle, von der zehn Millionen<br />
Westafrikaner abhängen, nun nichts mehr einbrachte: Weil George W. Bush<br />
seinen 25.000 Baumwollbaronen jährlich drei bis vier Milliarden Dollar schenkt.<br />
Das Vierfache von dem, was die entwickelte Welt an Agrarhilfe für die Armen<br />
spendiert.<br />
Die US-Überproduktion treibt den Marktpreis in den Keller. Eine unzulässige<br />
Praxis, beklagten vier Länder Westafrikas im Herbst 2003. Ein Schiedsgericht der<br />
WTO gab ihnen wenig später Recht. Doch das schert die USA wenig. Bis heute<br />
laufen die Beihilfen und Zuschüsse weiter.<br />
Verlierer des ungleichen Welthandels sind ausgerechnet jene armen Länder, die<br />
den Forderungen von WTO, dem Internationalen Währungsfonds und einer<br />
weltweiten Brigade industriefreundlicher Wissenschaftler folgen. Nach Uno-Zahlen<br />
hat die Armut in jenen Ländern zugenommen, die ihre Märkte am schnellsten<br />
freigaben. Länder, die sich vorsichtig öffneten, schnitten am besten ab. Jene, die<br />
sich abschotteten, am schlechtesten.<br />
„Die bisherigen Handelsabkommen waren weder frei noch fair“, urteilt der<br />
Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, „sie waren zum Nachteil der Entwicklungsländer.“<br />
Die Wirtschaftsnationen hätten eine Masse an subtilen, aber<br />
wirksamen Barrieren beibehalten, die den Zugang zu ihren Märkten behinderten.<br />
Kein Wunder eigentlich, dass die Entwicklungsländer die Welthandelsrunde<br />
43
platzen ließen. EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel aber kann das nicht<br />
verstehen: Der Stillstand sei verheerend für die Dritte Welt, eine verpasste Chance,<br />
die Vorzüge des Welthandels zu genießen. „Wir werden weiterhin alles tun, um<br />
unseren Partnern in der Dritten Welt zur Seite zu stehen“, sagt Fischer Boel.<br />
Ob die darauf Wert legen? Sogar die Vereinten Nationen kritisieren Europas<br />
Agrarpolitik scharf. Im UNDP-Bericht zur menschlichen Entwicklung 2005 steht:<br />
„Die höchsten Handelsbarrieren der Welt werden gegen einige der ärmsten<br />
Länder errichtet. So hält beispielsweise die EU große Stücke auf ihre Bemühungen,<br />
den ärmsten Ländern der Welt Märkte zu eröffnen. Doch ihre restriktiven<br />
Herkunftsbestimmungen, nach denen sich der Anspruch auf Handelspräferenzen<br />
richtet, machen die Chancen der meisten dieser Länder zunichte.“<br />
Fischer Boel bringt solche Kritik auf. Schließlich habe sich die EU deutlich<br />
gebessert – anders als die USA. US-Farmer bekommen mehr als das Doppelte an<br />
handelsverzerrenden Subventionen. 2005 stieg diese Hilfe von 5,5 auf 14,1<br />
Milliarden Dollar. Noch dazu weigert sich US-Präsident Bush, Zölle für Textilien<br />
aus Entwicklungsländern zu senken. Amerika, sagt Fischer Boel, gehört viel eher<br />
an den Pranger als Europa.<br />
Wie rücksichtslos Amerika agiert, beschreiben die Brüsseler gern an einem<br />
besonders anschaulichen Beispiel: der Nahrungsmittelhilfe.<br />
Die Vereinigten Staaten sind mit 1,2 Milliarden Dollar der größte Spender an die<br />
Hungernden dieser Welt. Von keinem Land erhält das World-Food-Programm<br />
(WFP) der Uno mehr Unterstützung. Allerdings hat das Engagement für die gute<br />
Sache einen gewaltigen Haken: Statt Geld spendiert Amerika praktisch nur Nahrung<br />
aus eigener Produktion. Die Regierung kauft ihren subventionierten Bauern<br />
Getreide ab, das dann von US-Speditionen auf US-Schiffe geladen wird.<br />
Auf diese Weise bleibt rund die Hälfte des Werts im eigenen Land – eine versteckte<br />
Subvention auf Kosten der Hungernden. Auffällig ist außerdem, dass in Zeiten<br />
höchster US-Überproduktion die Not in der Welt rapide zu steigen scheint: Dann<br />
werden auch mal Länder, die gar nicht darben, beschenkt – zum Unglück der<br />
ansässigen Bauern.<br />
44
Seit Jahren schon steht dieses egoistische Wohltätigkeitsgebaren der USA in der<br />
Kritik. 2005 wagte Alexander Natsios, damals Chef der dem Außenministerium<br />
zugeordneten Organisation USAid, einen Vorstoß: Er regte an, ein Viertel der<br />
Hilfe in bar zu leisten, damit man Nahrung in der jeweiligen Region kaufen könne.<br />
Natsios hatte mit Widerstand gerechnet: von Politikern, Bauern, der Transportlobby.<br />
Am lautesten jedoch schrien die 48 Hilfsorganisationen, die sich um die<br />
Food-Aid-Verteilung kümmern. Besonders Catholic Relief Services, der größte<br />
private Lebensmittelverteiler der Welt, sträubte sich. Die Katholiken mit Sitz in<br />
Baltimore fürchten einen Spendeneinbruch und heftige Budgetkürzungen.<br />
Michael Wiest, Geschäftsführer von Catholic Relief, ist ein ruhiger, gediegener<br />
Mann mit gütigem Lächeln und grauem Haar. Doch fällt der Name Natsios, kocht<br />
die Wut in ihm hoch, bis das Gesicht rot wird. Natsios Unterstellung, die Nichtregierungsorganisationen<br />
steckten unter einer Decke mit der Agrarindustrie und<br />
wollen nur ihr eigenes Überleben sichern, kränkt ihn bis ins Mark.<br />
„Hierum geht es, nur hierum“, ruft Wiest und hält mit beiden Händen ein rotes<br />
Buch vor sich wie ein Schild: „Gott ist Liebe“ von Papst Benedikt XVI. „Schon in<br />
der Bibel steht: ,Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben’“,<br />
erklärt der Christ. Nichts anderes will er tun. Dafür als fette Katze im Dienst der<br />
Industrie dargestellt zu werden, sei eine bösartige Missinterpretation seiner<br />
Motive.<br />
<strong>2007</strong> will Wiest nur noch 16,7 Prozent seines 580-Millionen-Dollar-Budgets für<br />
Lebensmittelhilfe ausgeben. „Glaubt Natsios wirklich, wir wären ruiniert, wenn<br />
man uns diese Aufgabe nähme?“<br />
Doch ganz so unwichtig, wie Wiest behauptet, ist der Sektor nicht. 2004 machte<br />
Food Aid die Hälfte seines Haushalts aus, 2005 rund 30 Prozent. Mit einem Teil<br />
davon finanzierte Catholic Relief ganz andere Sozialprojekte in der Dritten Welt:<br />
Die Lebensmittel, die eigentlich für Bedürftige gedacht sind, werden auf den<br />
Märkten der Dritten Welt verkauft, um mit dem Gewinn Schulprogramme, Aids-<br />
Prävention, Gesundheitsvorsorge zu bezahlen.<br />
Monetarisierung nennt man diese höchst umstrittene Praxis. Optimal sei das<br />
natürlich nicht, räumt Wiest ein, eher eine Sache der Abwägung. Die Bauern im<br />
45
Dorf Kesses im Westen Kenias würden bei dieser Abwägung sicherlich anders<br />
entscheiden.<br />
Die Region zwischen Nairobi und Uganda ist die fruchtbarste im ganzen Land.<br />
Die grünen Hügel erinnern eher an die Toskana als an ein Land, in dem Menschen<br />
verhungern. Die Maisfelder stehen in voller Frucht, Tomatenfelder leuchten rot,<br />
der Weizen wogt im Wind, und dicke Holsteiner Kühe grasen auf Wiesen. Dennoch<br />
bleiben die Bauern auf ihrer Ernte sitzen.<br />
„Wenn im Norden oder Osten eine Hungersnot droht, wartet die Regierung lieber<br />
auf die Lieferung des World-Food-Programms, als unseren Mais zu kaufen“, sagt<br />
Julius Rotich. Der Bauer hat sich mit den Landwirten von Kesses zu einer<br />
Vermarktungskooperative zusammengetan. Sie haben ein Büro bezogen und<br />
wollen ihre Produkte gemeinsam verkaufen, so wie die Kollegen in den reichen<br />
Ländern. Doch sosehr sie sich auch bemühen: Gegen Geschenke können nicht<br />
einmal sie konkurrieren.<br />
Außerdem bricht der Getreidepreis regelmäßig ein, immer dann, wenn eine neue<br />
Ladung des World-Food-Programms eintrifft. Denn davon, das wissen die<br />
Spekulanten, landet ein Teil immer auf dem freien Markt. „Die Händler drücken<br />
uns ganz offen mit der Drohung, dass sie sonst beim WFP kaufen“, klagt Rotich.<br />
Liebend gern würde Rotichs Gruppe ihre Ernte an das World-Food-Programm<br />
verkaufen. Doch deren Lagerhallen sind berstend voll mit amerikanischer Hirse,<br />
mit Mais- und Sojamehl. „Was sollen wir machen?“, sagt Peter Smerdon vom<br />
WFP in Nairobi und zuckt die Achseln. „Wir würden Bargeld bevorzugen. Aber<br />
wir können US-Lebensmittel nicht ablehnen. Sicher, sie schenken es uns aus<br />
eigennützigen Gründen, aber sie schenken es uns.“<br />
Wo die Hilfe herkommt, welche Auswirkungen sie hat, das alles muss Peter<br />
Smerdon egal sein. „Unsere Aufgabe ist es, Menschen am Leben zu erhalten.<br />
Kenia zu entwickeln, das müssen andere machen.“ Bauer Rotich lacht bitter:<br />
Mit ein wenig Hilfe, ein paar Krediten für Dünger und Gerät, wären die Ernten<br />
reichlich. „Wir könnten das Land ernähren“, sagt er.<br />
Aber das Geschäft erledigen andere. Früh am Tag, gleich nach dem Morgengrauen,<br />
macht sich ein Team vom WFP auf zur Essensverteilung. Heute geht es von<br />
Garissa aus, einer Stadt im Osten Kenias, bis an die somalische Grenze. Der<br />
46
Laster ist bis unters Dach mit Säcken voller US-Mehl, -Salz und -Pflanzenöl<br />
bepackt. Er quält sich auf Sandpisten durch wüstes, dorniges Gelände. Das einzige<br />
Zeichen von Zivilisation sind die Plastiktüten, die sich im Gestrüpp verfangen<br />
haben.<br />
Vier holprige Stunden später kommt der Transport in Welmarele Village an, ein<br />
Dorf aus Reisighütten, einer gemauerten Schule und einer von Entwicklungshelfern<br />
gestifteten Wasserpumpe. Dürre Kühe und Kamele beißen sich mit Hunderten<br />
Ziegen um einen Platz an der Tränke. Die Viehhirten laufen zum Dorfplatz,<br />
wo der Laster bereits entladen wird. Jeden Monat bekommen sie Essen vom<br />
WFP, strikt für den Eigengebrauch. Doch kaum ist die Verteilung beendet, liegt<br />
ein Sack mit US-Flagge in einem der Läden.<br />
„Die gesamte Lebensmittelhilfe ist doch pervertiert“, findet der kenianische<br />
Ökonom James Shikwati. „Es wurde eine Kultur geschaffen, die jede Eigeninitiative<br />
zerstört, korrupte Regierungen stabilisiert und längst überholte Lebensformen<br />
erhält.“<br />
Etwa die der Hirtennomaden. „Die halten sich ihr Vieh als Statussymbol – und<br />
um Frauen zu kaufen. Früher haben sie die Tiere auch geschlachtet, wenn Nahrung<br />
und Wasser knapp wurden. Heute warten sie lieber auf die Hilfslieferung.“<br />
Effekt: Viel zu viele Tiere überweiden die kargen Flächen, das Land erodiert, die<br />
Hirten ziehen auf fremdes Land, und schon kommt es zum Konflikt mit den<br />
Bauern. Wird der Streit zum Krieg, rücken die Uno-Blauhelme an und versuchen<br />
zu schlichten, was das Uno-Nahrungsmittelprogramm angerichtet hat.<br />
„Ist das nicht verrückt?“, fragt der 37-jährige Wissenschaftler entnervt. Man mag<br />
ihm kaum widersprechen: Konflikte um Landverteilung sind schließlich eine<br />
zentrale Ursache für Afrikas Kriege.<br />
Nahezu überall wird der Lebensraum der nomadisierenden Viehzüchter beschnitten,<br />
so auch im westafrikanischen Burkina Faso. Landwirte besetzen die<br />
angestammten Weideflächen der Nomaden, weil sie ihrerseits den wachsenden<br />
Städten weichen müssen. Schon kommt es zu ersten Reibereien, berichtet<br />
Wilhelm Thees, der für Misereor in der Hauptstadt Ouagadougou arbeitet. Kürzlich<br />
47
erst haben Bauern Kühe erschossen, die auf ihre Äcker gelaufen sind. Aus Rache<br />
trieben die Hirten am nächsten Tag ihre gesamte Herde über die bestellten Felder.<br />
Aus solchen Streiten können Kriege entstehen. Misereor will vorbeugen, indem<br />
es die Nomaden sesshaft macht. „Wenn sie vom Milchverkauf leben könnten,<br />
wäre der Frieden im Land gesichert“, sagt Thees. Misereor gab bei dem Missionar<br />
Pater Maurice Oudet, der schon länger mit den Viehhirten arbeitet, eine Studie<br />
in Auftrag – mit niederschmetterndem Ergebnis. Die heimische Milchwirtschaft<br />
ist chancenlos gegen das importierte Milchpulver, das zum größten Teil aus der<br />
EU stammt.<br />
Etwa 1.150 Tonnen getrocknete Vollmilch exportierte Europa 2005 nach Burkina<br />
Faso. Für den größten Milchproduzenten der Welt nur Peanuts, für Gariko<br />
Krotoumou bedeutet das einen täglichen Kampf ums Überleben.<br />
Die 50-Jährige aus Burkina Faso hat acht Milchkühe. Die beste ihrer Zebus gibt<br />
vier bis fünf Liter am Tag – ein Achtel der Leistung einer europäischen Turbokuh.<br />
In der Trockenzeit, wenn die Tiere kein Futter finden, versiegt der Milchfluss<br />
gänzlich. Gariko müsste zufüttern, Baumwollsaatkuchen und Hirse, aber das<br />
kann sie sich nicht leisten.<br />
Sie kennt den Grund für ihre Misere, sie sieht ihn überall, an jeder Ecke, auch<br />
vor dem kleinen Laden neben ihrem Haus: Es sind Plakate, auf denen lachende<br />
Comic-Kühe für importierte Milch werben.<br />
Das Milchpulver der Ausländer ist allgegenwärtig, die Regale der Supermärkte<br />
und Eckläden biegen sich unter dem Angebot: Familienportionen von France Lait<br />
und Nestlé, Großpackungen von Bridel und Lacstar aus Frankreich, Vivalait und<br />
Kerrygold aus Irland, Bonnet Rouge aus den Niederlanden, Cowbell aus Neuseeland.<br />
Ein Liter aufbereitetes Milchpulver kostet 30 bis maximal 60 Cent. Gariko muss,<br />
wenn sie ihre Milch gemolken und in heißem Wasser pasteurisiert hat, 90 Cent<br />
verlangen. Sie verkauft sie in kleinen Beuteln am Straßenrand.<br />
Gariko kommt aus einem Beamtenhaushalt, sie kann lesen und schreiben. Sie<br />
weiß, weshalb sie die <strong>Preis</strong>e der Ausländer nicht unterbieten kann. „Die kriegen<br />
Geld vom Staat, damit sie ihre Milch hierherbringen.“ Auf Einladung von Misereor<br />
war sie in Deutschland und warb beim Bauernverband für ein Ende der Ausfuhren.<br />
48
Doch auch die deutschen Landwirte wollten nichts davon wissen.<br />
Schließlich profitieren sie davon, dass die EU für den Export von Milchprodukten<br />
jährlich zwischen einer und 1,6 Milliarden Euro ausschüttet, 25 bis 30 Prozent<br />
des Warenwerts. Die Regierung von Burkina Faso verlangt nur fünf Prozent<br />
Einfuhrzoll, damit die städtische Bevölkerung billig versorgt wird. Die Eliten sind<br />
aufgewachsen mit Milchpulver, Frischmilch hat ein schlechtes Image – sie riecht<br />
anders, nach Kuh und nach Armut. „Schon die Kinder sehen die Werbespots im<br />
Fernsehen und verlangen nach Danone-Joghurt“, sagt Pater Oudet.<br />
Nur der traditionelle Dégué, ein gesüßter Joghurt mit beigemischter Hirse, ist<br />
nach wie vor beliebt. In Koudougou, eineinhalb Stunden entfernt von Oaugadougou,<br />
hat sich eine Gruppe Milchbäuerinnen zu eine Molkereigenossenschaft<br />
zusammengetan, um Dégué herzustellen. Täglich kaufen sie Frischmilch an,<br />
doch selbst sie benutzen hin und wieder das Importpulver – weil es billiger ist.<br />
„So kann keine Wertschöpfung stattfinden“, schimpft Thees. „Wenn man die<br />
Afrikaner auf Selbstversorger-Level halten will, kann man sich die ganzen<br />
Armutskonferenzen gleich sparen.“<br />
François Traoré wird noch deutlicher. Der Bauernpräsident von Burkina Faso ist<br />
eine gewaltige Erscheinung. Seine tiefe Stimme dröhnt, wenn er zu schimpfen<br />
beginnt. Seine Fäuste donnern auf die Tischplatte in seinem Besprechungszimmer<br />
in Ouagadougou. Er weiß, wie furchteinflößend er wirkt, seit er beim<br />
WTO-Treffen in Cancún die Welt von der Unlauterkeit amerikanischer Baumwollsubventionen<br />
überzeugt hat. „Und was hat das gebracht?“, poltert er. „Die USA<br />
subventionieren und exportieren fröhlich weiter, und die Welt schaut zu.“<br />
Traoré ist nicht gut zu sprechen auf die internationalen Institutionen. Der IWF?<br />
Ein Club der Reichen, der Märkte für die Reichen öffnen will. Die Weltbank?<br />
Steht nicht für Wohltätigkeit, sondern fürs Geschäft. Die WTO? Lügt der Welt vor,<br />
dass sie zugunsten der Armen agiert. „Die Wahrheit ist: Keiner von denen will<br />
etwas abgeben.“<br />
Also muss man sie zwingen: mit hohen Schutzzöllen aus dem Land halten, damit<br />
sich eigene Märkte entwickeln können; ihre Bürger über die unfaire Politik<br />
informieren, damit die Verantwortlichen in Erklärungsnot kommen; Proteste<br />
organisieren, damit die Welt von der Ungerechtigkeit erfährt.<br />
49
Das beste Druckmittel aber ist der Strom der Migranten, die sich zu Hunderttausenden<br />
in die Paradiese des Nordens aufmachen. Europa ist schon jetzt nervös,<br />
das weiß Traoré von seinen Reisen. Und die Anspannung wird weiter steigen.<br />
Denn wer in der Heimat keine Existenzgrundlage mehr hat, lässt sich auf Dauer<br />
nicht von Zäunen, Küstenschutzbooten oder Soldaten aufhalten.<br />
„Wenn die reichen Länder jede Entwicklungschance in unseren Ländern zerstören,<br />
dann müssen wir uns eben in ihren entwickeln“, sagt Samba Guèye, Traorés<br />
Amtskollege im Senegal. Das klingt wie eine Drohung. Und so ist es auch gedacht:<br />
„Wir haben Erdnüsse exportiert, das wurde uns kaputtgemacht. Wir exportierten<br />
Fisch, der wurde uns weggefangen. Nun exportieren wir eben Menschen.“<br />
50
Begründung der Jury<br />
»Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihr gesamtes Geld zusammen, Sie leihen<br />
sich bei Freunden und Kredithaien alles, was Sie kriegen können, sind bis an<br />
die Halskrause verschuldet, setzen Ihre ganze Existenz aufs Spiel, um eine<br />
neue Firma aufzubauen. Software für Handys zum Beispiel.<br />
Das Geschäft fängt grade an zu laufen, da tauchen plötzlich überall Wettbewerber<br />
auf, die ganz ähnliche Ware bringen – jedoch für ein Zehntel des <strong>Preis</strong>es.<br />
Sie fragen sich: Wie machen die das? Sie recherchieren und kommen<br />
dahinter, dass die chinesische Regierung Ihrer Konkurrenz die gesamte Produktion<br />
und das Marketing gezahlt hat. Die russische Regierung hat es für<br />
einen anderen Konkurrenten getan. Sie protestieren bei Ihrer eigenen Regierung,<br />
sie verlangen, dass Zölle gegen diesen Dumpingwettbewerb erhoben<br />
werden. Doch Ihre Regierung sagt Ihnen: Es tut uns leid. Wir können Ihnen<br />
nicht helfen. Wir haben Verträge mit Russland und China und die erlauben<br />
uns nicht, dass wir dagegen etwas tun können.<br />
Das ist eine absurde Geschichte, die ich da konstruiere, oder? Doch genau<br />
das ist das Schicksal von vielen Millionen Männern und Frauen in Afrika und<br />
Lateinamerika. Sie tun alles um Nahrungsmittel für ihre Länder zu produzieren<br />
und dann kommen Wettbewerber aus Übersee mit Weizen, Reis, Mais,<br />
Milch und Hühnerfleisch oder was auch immer und unterbieten jeden <strong>Preis</strong>,<br />
zu dem sie jemals selbst produzieren könnten.<br />
Mit diesem System untergraben Amerika und Europa systematisch die Entwicklung<br />
armer Staaten. Die Landwirtschaft ist das Rückgrat der afrikanischen<br />
Ökonomie. Doch dieses Rückgrat wird jeden Tag gebrochen. Und zwar<br />
mit unserem Steuergeld.<br />
Gewiss, dieser Skandal ist schon Jahrzehnte alt. Aber Michaela Schiessl ist<br />
mit ihrer Geschichte etwas gelungen, das es in dieser Form so noch nie zu<br />
lesen gab. Sie hat die Skrupellosigkeit und die Ignoranz der Verantwortlichen<br />
in Regierungen und Konzernen anschaulich gemacht, indem sie<br />
51
Opfern und Tätern, Verlierern und Gewinnern ein Gesicht gegeben hat. Da<br />
erzählt sie von dem senegalesischen Fischer Badou Ndoye, der nichts mehr<br />
fängt, weil seine eigene Regierung die Fangrechte für die Fische im Küstenmeer<br />
an die EU Fischindustrie verkauft hat. Jetzt überlegt er, ob er sein Boot<br />
an die Schleuser verkauft, die wiederum Flüchtlinge illegal nach Spanien<br />
bringen. Sein Cousin ist schon dort und verdingt sich für 1.000 Euro im<br />
Monat und 60 Stunden die Woche auf dem Bau, um zu Hause seine vier Kinder<br />
zu ernähren.<br />
Oder Schiessl berichtet vom amerikanischen Farmer Terry Steinhour, der bei<br />
einer Reise nach Mali lernt, dass die Subventionen für 25.000 amerikanische<br />
Baumwollfarmen in Westafrika 10 Millionen Menschen um Lohn und Brot<br />
bringen. Zu Wort kommt auch die EU Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel<br />
vor, die allen Ernstes behauptet: „Wir tun alles, um unseren Partnern in der<br />
dritten Welt zur Seite zu stehen“. Oder Peter Smerdon vom World Food Programm<br />
in Kenia, der mit dem Verschenken von US-Lebensmitteln die gesamte<br />
kenianische Landwirtschaft regelrecht zerstört und dazu nur sagt: „Unsere<br />
Aufgabe ist es, die Menschen am Leben zu halten. Kenia zu entwickeln, das<br />
müssen andere machen!“.<br />
Dies und noch viel mehr enthält diese Geschichte. Allein daran kann man<br />
sehen, welch enormer Rechercheaufwand dort hinein geflossen ist. Michaela<br />
Schiessl ist auf drei Kontinenten unterwegs gewesen und hat Monate ihrer<br />
Arbeitszeit aufgewandt, um diese Informationen zusammen zu tragen.<br />
Zudem war es eine ganz erhebliche zusätzliche Leistung, diese Geschichte<br />
dann auch im Spiegel unterzubringen. Der kritische und ausführliche Report,<br />
ehedem ein Markenzeichen des Blattes, stand bei den Hamburger Blattmachern<br />
zuletzt nicht mehr hoch im Kurs. Insofern gibt es gleich zwei gute<br />
Gründe für diese Auszeichnung.<br />
Unsere Gratulation für Michaela Schiessl!«<br />
Vorgetragen von Harald Schumann<br />
52
Recherchebericht von Michaela Schießl (veröffentlicht in message 1/08)<br />
Senegal, Kenia, Brüssel, USA, Burkina Faso<br />
Exportsubventionen und Nahrungsmittelhilfen der reichen Länder machen<br />
die Märkte in der Dritten Welt kaputt. Unsere Autorin berichtet, wie sie<br />
dieses Thema aus Sicht der Betroffenen recherchierte.<br />
Das Thema entstand, ganz unspektakulär, auf einer Konferenz im Wirtschaftsressort<br />
des Spiegel. In Genf waren in jenem Juli 2006 gerade die Welthandelsgespräche<br />
geplatzt; 20 Entwicklungs- und Schwellenländer hatten sich zusammengetan<br />
und ihre Verhandlungsbereitschaft in der Welthandelsorganisation WTO<br />
aufgekündigt. Der Grund: Die Industriestaaten, allen voran die USA, hatten sich<br />
geweigert, ihre Agrarsubventionen massiv herunterzufahren. So sahen die<br />
armen Länder keine Möglichkeit, ihre eigenen Märkte am Leben zu erhalten.<br />
Gegen die hoch subventionierten Produkte der Konkurrenz, so klagten sie, seien<br />
ihre Bauern chancenlos.<br />
Es war keine neue Beschwerde: Schon auf den WTO-Ministerkonferenzen in<br />
Cancun 2003 und Hongkong 2005 ging es – unterstützt von lautstarken Protesten<br />
der Globalisierungsgegner – vor allem um die Abschaffung marktverzerrender<br />
Subventionen. Die Presse berichtete ausführlich über die verschiedenen Standpunkte,<br />
doch fast immer wurde das Problem »von oben« analysiert: Die Berichte<br />
handelten von der WTO und TRIPS, vom Internationalen Währungsfonds und der<br />
Weltbank, von Strukturanpassungsmaßnahmen und Marktliberalisierung, von<br />
der US-Farm-Bill und der EU-Marktordnung – Worte allesamt, die selbst geneigte<br />
Leser in die Flucht schlagen.<br />
Ich beschloss, das Thema »von unten« anzugehen. Wie beeinträchtigen die<br />
westlichen Landwirtschaftsbeihilfen das Leben der Menschen in der Dritten Welt?<br />
Wie sind die konkreten Folgen vor Ort? Ist es möglich, die anonyme Politik von<br />
IWF, WTO, Weltbank, der EU und den USA anhand von Schicksalen anschaulich<br />
zu machen?<br />
Die ersten vier Wochen las ich, neben dem üblichen Archivmaterial und Büchern,<br />
vor allem Studien, Massen von Studien. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen<br />
(NGOs) hatten sich dem Thema gewidmet: die Hilfsorganisation Oxfam, die<br />
Menschenrechtsorganisation FIAN, Germanwatch, Third World Network, die<br />
Globalisierungskritiker von Attac und Focus on Global South, der Evangelische<br />
53
Entwicklungsdienst, das katholische Hilfswerk Misereor und viele mehr. Ich durchforstete<br />
die Berichte nach Fallbeispielen, an die man anknüpfen konnte, verglich<br />
die Ergebnisse und überprüfte telefonisch, ob die beschriebene Situation der<br />
Realität entsprach.<br />
Ich entschied, mich auf Nahrungsmittel zu beschränken und andere Agrarprodukte<br />
wie Baumwolle – weil bereits bestens dokumentiert – außen vor zu lassen. Fisch<br />
sollte dabei sein, Huhn, Getreide, Milch, Gemüse – die Hauptnahrungsmittel in<br />
armen Ländern eben. Ich wollte zu jedem Beispiel einen Akteur finden, an dem<br />
man die Geschichte sehr persönlich erzählen und damit leichter nachvollziehbar<br />
machen kann.<br />
Es begann auf den Kanaren<br />
Ich wählte zunächst den Senegal aus, ein Land, von dem aus zu diesem Zeitpunkt<br />
ein lebensgefährlicher Exodus verzweifelter Menschen übers Meer in Richtung<br />
reicher Westen stattfand. Die Recherche begann auf den Kanaren. Eine spanische<br />
Kollegin machte einen senegalesischen Fischer ausfindig, der sein Geld auf den<br />
hochsubventionierten europäischen Fischtrawlern verdient hatte, die die einheimischen<br />
Fanggründe vor der afrikanischen Küste leerfischen. Der Mann schilderte,<br />
wie senegalesische Kleinstfischer immer öfter mit leeren Netzen heimkehren –<br />
und deshalb ihre Boote vermehrt für die Flucht in den Westen zweckentfremdeten.<br />
In Mbour, Senegal, fuhr ich wenig später mit seinem Onkel auf Fischfang. Die<br />
Ausbeute war mickrig und der 70-jährige Kapitän, ein hochrangiger Funktionär<br />
im Fischereiverband, schilderte den Niedergang der traditionellen Fischerei, die<br />
neben den hochgerüsteten EU-Fangflotten nicht überleben könne.<br />
Auf dem Markt der senegalesischen Hauptstadt Dakar suchte ich tags darauf<br />
westliche Produkte. Und fand Zwiebelberge aus Holland, Milchpulver aus Frankreich,<br />
Kartoffeln und jede Menge Tomatenmark aus der EU – zu ortsüblichen<br />
<strong>Preis</strong>en, manche sogar darunter. Der Grund: üppige EU-Exportsubventionen.<br />
Ich traf den Präsidenten der Bauernvereinigung, den Chef der Gemüseanbauer,<br />
den Vorsitzenden des Geflügelzüchterverbandes, die Experten von Oxfam Senegal;<br />
ich reiste in den Norden zu den Tomatenfarmern, die gerade beschlossen,<br />
54
wegen der westlichen Konkurrenz in den Streik zu treten; ich traf einen Hühnerbaron,<br />
der zwei Drittel seiner Produktion verlor, weil EU-Hühnerbeine unschlagbar<br />
billig den Markt überschwemmten.<br />
Von den Verbänden, der EU und senegalesischen Regierungsstellen holte ich mir<br />
die dazugehörigen Zahlen und Konditionen: Exportsubventionen, Zollbestimmungen,<br />
Handelsbeschränkungen, Marktbeobachtungen etc., um meine Beobachtungen<br />
mit Daten abzusichern.<br />
Brüssel: die Welt der »Täter«<br />
Danach reiste ich nach Brüssel zum Gespräch mit der EU-Agrarkommissarin<br />
Mariann Fischer Boels. Sie beschrieb die führende Rolle der EU beim Abbau der<br />
Subventionen, beschuldigte die USA, mit ihrer unnachgiebigen Haltung für das<br />
Scheitern der Doha-Runde verantwortlich zu sein und warb für eine Wiederaufnahme.<br />
Es war die erwartbare politische Stellungnahme, das typische Brüsseler<br />
Polit-Sprech. Ich beschloss, diesen Ausflug in die Welt der »Täter« zu beenden<br />
und mich wieder auf die Betroffenen zu konzentrieren.<br />
Eine wichtige Anregung jedoch nahm ich aus Brüssel mit. Ein Diplomat der deutschen<br />
Botschaft wies mich auf einen für die Märkte der Dritten Welt fatalen<br />
Mechanismus hin: die amerikanische Hungerhilfe. Die US-Regierung kauft die<br />
Produkte ihrer subventionierten Farmer zu Marktpreisen auf und spendet sie in<br />
die Hungergebiete der Welt. Dort konkurrieren sie mit einheimischen Produkten,<br />
denn die Regierungen warten lieber auf die kostenlose Ware aus den USA als<br />
einheimische Ware zu kaufen.<br />
Ich besorgte mir Material zu diesem Thema und stieß auf eine relativ aktuelle<br />
Auseinandersetzung. Der Chef der zuständigen US-amerikanischen Agentur<br />
USAID, Andrea Natsios, hatte Ende 2005 dieses Gebaren zum Thema gemacht.<br />
Er hatte angeregt, dass man, statt US-Agrarüberschüsse teuer zu verschiffen,<br />
doch lieber Bargeld zur Verfügung stellen solle, um bei afrikanischen Bauern vor<br />
Ort Lebensmittel zu kaufen. Gleichzeitig prangerte er die Hilfsorganisations-<br />
Industrie an, die von dieser Verteilungsaufgabe bestens lebt.<br />
Ich verabredete ein Interview mit Natsios , der mittlerweile als Professor an der<br />
Georgetown University in Washington D.C. lehrte. Doch als ich in D.C. ankam,<br />
55
war er gerade von der Regierung Bush zum Darfur-Beauftragten bestimmt worden<br />
und wollte sich nicht mehr äußern. Glücklicherweise gab es eine ausführliche<br />
Berichterstattung über Natsios damalige Haltung und eine Studie zum Thema<br />
Food Aid.<br />
Ich besuchte in D.C. noch mehrere Think-Tanks wie das International Food Policy<br />
Research Institute, die zum Thema arbeiteten, und besorgte mir Hintergrundund<br />
Zahlenmaterial.<br />
Kämpferischer Katholik<br />
Damit auch dieses Thema ein Gesicht bekommt, besuchte ich die größte private<br />
Lebensmittel-Hilfsorganisation der Welt, die Christian Relief Services (CRS) in<br />
Baltimore. Der Geschäftsführer Michael Wiest gab sich extrem kämpferisch,<br />
stellte das katholische Helfermotiv in den Vordergrund und verwahrte sich<br />
gegen Natsios‘ Verdacht, der CRS lebe von den Hilfslieferungen. Ein Blick in<br />
den Geschäftsbericht jedoch zeigt, dass immer noch ein beträchtlicher Teil des<br />
CRS-Budgets an der Lebensmittelhilfe hängt.<br />
Außerdem wendet die Organisation eine seit langem heftig kritisierte – und von<br />
der EU verbotene – Methode an: Sie verkauft US-Lebensmittelhilfe auf den<br />
Märkten der Dritten Welt, um an Bargeld zu kommen, mit dem dann andere<br />
Hilfsprojekte – und damit auch CRS-Arbeitsplätze – finanziert werden. Monetarisierung<br />
nennt sich das, und ich beschloss, der Sache in Afrika nachzugehen.<br />
Denn die geschenkte US-Ware kann auf den Märkten der armen Länder deutlich<br />
billiger als die einheimische angeboten werden und die ortsansässigen Bauern<br />
vom Markt drängen.<br />
Die Lokalzeitung als Inspiration<br />
Zuvor jedoch reiste ich nach Illinois. Denn ich hatte im Internet einen interessanten<br />
Artikel aus der Lokalzeitung von Springview, Illinois, entdeckt: Darin wurde<br />
die Reise einer Gruppe US-Farmer beschrieben, die auf Einladung von Oxfam<br />
nach Senegal gereist war, um die Verheerungen anzusehen, die ihre subventionierten<br />
Produkte auf den dortigen Märkten auslösten.<br />
Oxfam Chicago nannte mir die Namen aller Farmer, und ich wählte nach einigen<br />
56
Telefonaten Terry Steinhour aus, einen Getreidefarmer und Viehzüchter aus<br />
einem Dorf namens Greenview. Der Mann war einst in der Demokratischen Partei<br />
aktiv gewesen und verstand es, Dinge sowohl auszudrücken als auch einzuordnen.<br />
Zwei Tage verbrachte ich mit Steinhour auf seiner Farm nahe Springfield.<br />
Er war sichtlich erschüttert von seinem Afrika-Erlebnis und kritisierte die hoch<br />
subventionierte amerikanische Landwirtschaftspolitik, die den kleinen US-Farmer<br />
auf Dauer ebenso wie den afrikanischen in Abhängigkeit und Armut treibe und<br />
einzig der Großindustrie diene.<br />
Meine nächste Reise führte mich nach Kenia. Ich wollte mir dort die Aktivitäten<br />
des UN-World Food Programms (WFP) und der CRS ansehen und Bauern besuchen.<br />
Das WFP, dessen größter Spender die USA ist, würde Cash den Warenspenden<br />
vorziehen, wenn sie die Wahl hätten. Haben sie aber nicht, und so<br />
verteilen sie auch die US-Agrarüberschüsse in die Hungergebiete.<br />
Ich begleitete einen WFP-Konvoi zu Nomaden an die sudanesische Grenze – und<br />
konnte den Mechanismus prompt beobachten. Kaum waren die Lebensmittel<br />
verteilt, landeten die ersten Säcke in den Einkaufsläden. Auch auf den Märkten<br />
von Nairobi finden sich immer wieder Waren vom WFP zu <strong>Preis</strong>en, die einheimische<br />
Farmer nicht bieten können.<br />
Bei einem Treffen bestätigt der Präsident des Bauernverbandes, dass die<br />
Hilfslieferungen zeitweilig den Markt verzerren. Er forderte die Regierung auf,<br />
während der Ernte in Kenia keine WFP-Lieferungen zuzulassen, damit die Landwirte<br />
ihre Waren verkaufen können. Er vermittelte mir ein Treffen mit einer Vermarktungsgenossenschaft<br />
im fruchtbaren Westen des Landes, nahe der Grenze<br />
zu Uganda.<br />
Mittelsmänner kassieren ab<br />
Die Reise in den Westen Kenias war – nach dem Ausflug in die kargen Hungerzonen<br />
– eine Überraschung. Die Landschaft ist fruchtbar, geschwungene Hügel<br />
erinnern an die Toskana, die Felder sind bestellt und die Tiere wohl genährt. Und<br />
doch leben die Bauern dort in Armut. Sie bleiben auf ihrem Mais sitzen, weil die<br />
Regierung lieber auf Geschenke der Industrieländer wartet als von ihnen zu kaufen.<br />
Selbst wenn das WFP ihnen etwas abkauft, merken sie das kaum, denn das<br />
57
Geschäft läuft über Mittelsmänner und die streichen den Gewinn ein. Die meisten<br />
Bauern können kaum lesen, nicht schreiben. Vom WFP hätten sie noch nie<br />
jemanden zu Gesicht bekommen, sagten sie. Sie merken nur: Ihre Waren sind<br />
Ladenhüter.<br />
Hinzu kommt, dass Organisationen wie der CRS Monetarisierung betreiben, wie<br />
die Leiterin der Zweigstelle Nairobi zugab. So würde man etwa die Aids-Projekte<br />
finanzieren. Auf dem Rücken der einheimischen Landwirte?<br />
Ich traf mich mit James Shikwati, Leiter des Inter Region Economic Networks in<br />
Nairobi. Ein Kontakt, den mein Kollege in Nairobi, Thilo Thielke, hergestellt hatte.<br />
Der Selfmade-Ökonom Shikwati – er war ursprünglich Lehrer – würde am liebsten<br />
sämtliche Entwicklungshelfer aus dem Land werfen. Seine These: Die Hilfe<br />
von außen nütze nur den Initiatoren und stabilisiere korrupte Systeme. Fest<br />
steht: Halb Nairobi besteht aus Hilfsorganisationen, die besseren Wohnviertel<br />
werden von Entwicklungshelfern bevölkert, und der Kampf gegen Armut und<br />
Hunger ist ein riesiges Geschäft.<br />
Letzte Station: Burkina Faso<br />
Meine letzte Reise führte mich nach Burkina Faso. Das katholische Hilfswerk<br />
Misereor hatte dort untersucht, wie sich der Export von EU-subventioniertem<br />
Milchpulver auf die einheimische Milchwirtschaft auswirkt, und förderte ein<br />
Genossenschaftsprojekt. Ich traf mich mit dem Misereor-Vertreter vor Ort, mit<br />
dem Pater Maurice Oudet, der das Projekt durchführte, und den Milchbäuerinnen.<br />
Diese stellten in ihrer Genossenschaft aus dem Milch ihrer Kühe Joghurt<br />
her. Gleich nebenan befand sich ein Supermarkt, der in langen Gängen jede Art<br />
von Milchpulver und Industrie- Joghurt aus Frankreich vertreibt. Ironischerweise<br />
gaben die Frauen zu, manchmal das EU-Milchpulver in ihren Joghurt zu mischen<br />
statt die Milch ihrer Tiere, einfach weil es billiger ist.<br />
Den städtischen Eliten ist einheimische Kuhmilch ohnehin ein Gräuel – schon die<br />
Kinder möchten die Milchprodukte aus der Fernsehwerbung. Und die stammen:<br />
von westlichen Milchmultis, gesponsert vom europäischen Steuerzahler.<br />
In den Gesprächen mit den Misereor-Projektleitern, anderen Entwicklungshelfern<br />
und dem Chef des Bauernverbandes erfuhr ich, wie stark sich die Milchimporte<br />
58
in ihrem Land auswirken. In Burkina Faso herrschen – wie in weiten Teilen Afrikas<br />
üblich – heftige, oft grausame Verteilungskämpfe um Land zwischen nomadisierenden<br />
Viehzüchtern und Farmern. Um die einzudämmen, wird versucht, die<br />
Nomaden zu sesshaften Milchbauern zu machen. Doch wenn deren Milch nicht<br />
wettbewerbsfähig ist gegen die Dumpingpreise aus Europa, können sie keine<br />
Existenz aufbauen und kehren ins Nomadenleben zurück.<br />
Ressortleiter schauten nicht aufs Geld<br />
Die Recherche zog sich über mehrere Monate hin und war wegen der vielen<br />
Reisen außerordentlich teuer. Kostendiskussionen gab es dennoch zu keinem<br />
Zeitpunkt, im Gegenteil: Meine Ressortleiter ermutigten mich, lieber noch eine<br />
Facette mehr zu beleuchten, den Koffer noch einmal zu packen.<br />
Tatsächlich werden Tiefenrecherchen wie diese für den Spiegel in Zukunft wichtiger<br />
sein denn je. Der schnelle Nachrichtenjournalismus wandert ins Internet ab,<br />
und das genaue Hinschauen, die exakte Analyse und der recherchierte Hintergrund<br />
wird die Nische sein, in der sich Print behaupten kann.<br />
Michaela Schießl ist Redakteurin im Wirtschaftsressort des Spiegel.<br />
59
2. PREIS<br />
60
61<br />
Ingolf Gritschneder<br />
2. <strong>Preis</strong><br />
Profit um jeden <strong>Preis</strong> –<br />
Markt ohne Moral<br />
„tag 7“ WDR, 28. Februar <strong>2007</strong>
Profit um jeden <strong>Preis</strong> – Markt ohne Moral<br />
Globalisierung, Konkurrenzdruck und extreme Renditeerwartungen – heute herrschen<br />
andere Gesetze im Wirtschaftsleben als früher. Manager kennen ihre<br />
Angestellten längst nicht mehr persönlich. Für sie ist der Mensch oft nur noch<br />
eine betriebswirtschaftliche Rechengröße.<br />
Ein Beispiel dafür ist die Demontage eines großen Zuliefererbetriebs für die<br />
Automobilindustrie der Dräxlmaier-Group in Böblingen, Baden-Württemberg.<br />
Ohne die Belegschaft oder den Betriebsrat zu informieren, wurden die Werkshallen<br />
des Zweigbetriebs während eines langen Wochenendes leergeräumt.<br />
Material und Maschinen waren verschwunden, als am Montag die 150 Arbeiter<br />
ihrer normalen Tätigkeit nachgehen wollten. Dieses kaltschnäuzige und rücksichtslose<br />
Vorgehen der Geschäftsleitung ist rechtswidrig und unmoralisch,<br />
doch symptomatisch für die zunehmend raueren Sitten im Wirtschaftsleben.<br />
In dem Film „Profit um jeden <strong>Preis</strong> – Markt ohne Moral“ begleitete Ingolf<br />
Gritschneder die Arbeiter aus Böblingen ein halbes Jahr in ihrem Kampf um<br />
den Arbeitsplatz. Anhand dieses Beispiels greift er die aktuelle Diskussion um<br />
verbindliche Ethikrichtlinien und die Moral der Manager auf.<br />
62
Begründung der Jury<br />
»Sozialkritik in den Medien heute – manchmal findet sie ihren Platz im Kirchenfernsehen,<br />
hoffentlich nicht nur. Ingolf Gritschneders Film „Profit um<br />
jeden <strong>Preis</strong> – Markt ohne Moral“ ist so ein Fall: Es war die WDR-Redaktion<br />
„tag 7“, früher auch „Gott und die Welt“ geheißen, die diesen notwendigen<br />
und präzisen, leisen und beharrlichen, in jedem Detail rühmenswerten Film<br />
ins Erste Programm gehievt hat.<br />
Gritschneder, studierter Jurist und freier Journalist, hat sich des Werteverfalls<br />
im Wirtschaftsleben angenommen. Was er an etlichen Schauplätzen des<br />
sozialen Umbruchs in Deutschland vorfand, waren Empörung und Ratlosigkeit<br />
der Betroffenen, aber auch deren einfallsreiche Gegenwehr. Und manchmal<br />
entdeckte er sogar die Verlegenheit derer, die Rationalisierung und<br />
Globalisierung ohne Rücksicht auf die Menschen durchsetzen wollen. Dabei<br />
kommt Gritschneder ohne lautstarke Anklage aus und trifft die Verantwortlichen<br />
umso härter. Von seinen Befunden geht eine lehrreiche Beschämung<br />
aus.<br />
Sein Film ist klug komponiert, seine Reportage über das Versagen der<br />
Sozialen Marktwirtschaft erweitert sich dank nachdenklicher Reflexionen<br />
zum geistreichen Fernseh-Essay. Eine bezwingende, dabei auch analytische<br />
Dokumentation ist das, ein Sittengemälde des radikalisierten Kapitalismus,<br />
eine journalistische Qualitätsarbeit, die bei bloßer Kritik und Negation nicht<br />
stehen bleibt, sondern in der Kürze von 45 Minuten auch Alternativen aufzeigt.<br />
Das bessere, das verantwortliche Unternehmertum – auch dieses<br />
kommt bei Gritschneder zu Wort. Gemeinsam können wir nur hoffen, dass<br />
die Skrupel, die mancher Manager im Interview mit unserem <strong>Preis</strong>träger<br />
zeigte, deutschlandweit Schule machen.<br />
Herzlichen Glückwunsch zum <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2007</strong>!«<br />
Vorgetragen von Dr. Volker Lilienthal<br />
63
3. PREIS<br />
64
65<br />
Markus Grill<br />
3. <strong>Preis</strong><br />
Für seine Gesamtleistung zu<br />
pharmakritischer Berichterstattung
Die Schein-Forscher<br />
Der nachfolgende Artikel, veröffentlicht im „stern“ am 25. Januar <strong>2007</strong>,<br />
ist einer von vielen Beiträgen des Autors.<br />
Die Pharmaindustrie bezahlt Ärzte dafür, dass sie teure Medikamente in den<br />
Markt drücken. Der „stern“ zeigt die geheime Liste der Hersteller, die dabei<br />
mitmachen.<br />
Hat Ihnen Ihr Arzt in den vergangenen Monaten zufällig eines der folgenden<br />
Medikamente verschrieben:<br />
• gegen Magenschmerzen: Nexium oder Pantozol?<br />
• gegen Bluthochdruck: Emestar, Diovan, Atacand, Votum oder Olmetec?<br />
• gegen zu hohe Cholesterinwerte: Locol oder Cranoc?<br />
Wenn ja, dann hat Ihr Arzt vielleicht gedacht, es sei das beste Medikament für Sie.<br />
Vielleicht war es aber auch nur das beste für ihn. Denn für die Verordnung all dieser<br />
Präparate konnten Ärzte in den vergangenen Monaten Geld von der Pharmaindustrie<br />
bekommen. Selbstverständlich nicht direkt, das wäre ja Bestechung.<br />
Geld unter dem Deckmantel einer Studie<br />
Das Geld erreicht den Arzt unter dem Deckmantel einer Studie. Konkret läuft das<br />
so: Ein Pharmareferent kommt in die Praxis und fragt den Arzt, ob er nicht an einer<br />
sogenannten Anwendungsbeobachtung (AWB) teilnehmen möchte. Offiziell sind<br />
das Studien mit Patienten über Arzneimittel, die längst zugelassen sind. Wenn der<br />
Arzt mitmacht, kann er für jeden Patienten, dem er das Mittel verordnet, ein Honorar<br />
erhalten, meist 50 € pro Patient. Gelegentlich, wie im Fall des teuren Krebsmedikaments<br />
Glivec der Firma Novartis, können es für den Arzt auch 1.000 € pro<br />
Patient sein. Nach Berechnungen des Wissenschaftlichen Instituts der Techniker<br />
Krankenkasse kosten die AWBs in Deutschland „Jahr für Jahr 930 Mio €“.<br />
Anwendungsbeobachtungen stehen schon lange in dem Verdacht, vor allem teure<br />
Medikamente unter die Patienten zu bringen. Doch wie problematisch diese<br />
Scheinstudien wirklich sind, zeigt jetzt erstmals eine Untersuchung der Kassenärztlichen<br />
Bundesvereinigung (KBV), die die Interessen der niedergelassenen<br />
Ärzte vertritt. Die Studie mit dem sperrigen Titel „Evaluation der wissenschaftlichen<br />
Qualität von Anwendungsbeobachtungen in Deutschland“ enthält auf 101<br />
Seiten eine Menge brisanter Statistiken. Doch die Kassenärztliche Vereinigung hält<br />
das Werk unter Verschluss. KBV-Sprecher Roland Stahl: „Erst wenn der Endbericht<br />
bei uns eintrudelt, werden wir entscheiden, ob und was wir veröffentlichen.“<br />
66
Dem „stern“ liegt die Untersuchung vor – und die Ergebnisse zerstören den von<br />
der Pharmaindustrie genährten Mythos, dass es bei AWBs stets um wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse über Arzneimittel geht. Nach Sichtung aller im 2. Halbjahr 2005<br />
angemeldeten AWBs kommen die Autoren der KBV-Studie zu dem Ergebnis: „Der<br />
überwiegende Teil der AWBs fungiert vordergründig als Marketinginstrument und<br />
stellt damit wissenschaftliche Ansprüche oftmals infrage.“ Im Klartext: Die Studien<br />
sind Bluff, tatsächlich geht es vor allem darum, den Absatz bestimmter Medikamente<br />
zu fördern. So fand sich nur bei 19% aller AWBs in den Unterlagen überhaupt<br />
ein Hinweis auf eine geplante Veröffentlichung der Studienergebnisse. Gerade<br />
die fehlende Publikation ist nach Ansicht der Autoren ein klares Indiz, dass die<br />
AWB „als Marketinginstrument“ anzusehen ist. Schon im Jahr 2002 hatten Experten<br />
der KBV eine interne Einschätzung abgegeben, dass „nur zwischen 10 und<br />
20% der AWBs der Gewinnung von wissenschaftlicher Erkenntnis“ dienen. Von<br />
den nun analysierten AWBs enthielten nur 28% beispielsweise einen Studienplan,<br />
die Liste der teilnehmenden Ärzte, Fachinformationen und den Erfassungsbogen,<br />
den der Arzt ausfüllen soll. Bei 67% der AWBs war nicht einmal klar, welche Ergebnisse<br />
sie überhaupt liefern sollten, „da entweder keine Ziele benannt wurden oder<br />
kein Studienplan vorhanden war“, wie es in der KBV-Studie heißt.<br />
Was ist schlimm an Scheinstudien?<br />
Was ist aber so schlimm daran, kann man sich fragen, wenn ein Arzt an einer<br />
Scheinstudie teilnimmt und dadurch sein Honorar ein bisschen aufbessert? Das<br />
Problem ist, dass dafür vor allem die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen und<br />
die Medikamente, die in den AWBs verordnet werden, meist hochpreisige Präparate<br />
sind. Dazu kommt, dass die Patienten nach Beendigung der AWB das teure<br />
Präparat jahrelang weiter nehmen – für die Pharmafirmen also eine lange sprudelnde<br />
Geldquelle. Im Juni dieses Jahres erschien im angesehenen amerikanischen<br />
Ärzteblatt „JAMA“ ein Aufsatz von Forschern der dänischen Universität in Odense.<br />
Sie hatten zehn Arztpraxen untersucht, die an AWBs teilnahmen, und sie verglichen<br />
mit 165 anderen Arztpraxen. Das Ergebnis: Die AWB-Ärzte verordneten noch nach<br />
zwei Jahren 26% mehr das entsprechende Medikament, für das sie Honorar von<br />
der Pharmafirma erhalten hatten.<br />
67
In Deutschland muss jede AWB der Kassenärztlichen Vereinigung gemeldet werden.<br />
Doch die hält nicht nur ihre eigene Untersuchung zu dem Thema unter Verschluss,<br />
sondern weigert sich auch, die Namen der Arzneimittel, die Zahl der Ärzte, der<br />
Patienten und die Pharmafirmen, die AWBs durchführen, zu nennen. „Wir können<br />
keine Statistiken herausgeben“, wimmelt KBV-Sprecher Stahl eine Anfrage des<br />
„stern“ ab. „Die Liste der 30 teilnehmerstärksten Patientenbeobachtungen können<br />
und dürfen wir nicht rausgeben.“<br />
Doch auch diese Liste liegt dem stern vor. Die Daten stammen aus den Anmeldungen,<br />
die die Pharmahersteller in den vergangenen beiden Jahren bei den zuständigen<br />
Behörden und Institutionen eingereicht haben. Die Daten machen klar, zu<br />
welch einem Massenphänomen AWBs mittlerweile geworden sind: So sind seit<br />
August 2004 weit mehr als eine Million Patienten in Deutschland „beobachtet“<br />
worden und haben damit ihrem Arzt eine zusätzliche Einnahmequelle verschafft.<br />
Dabei werden gerade bei den AWBs mit den meisten Patienten oft ältere und unwirtschaftliche<br />
Medikamente getestet. Beispiel Nexium: ein Magensäureblocker, für<br />
den die Firma Astra Zeneca mehr als 30.000 Ärzte gewonnen hat. Das heißt: Jeder<br />
vierte niedergelassene Arzt in Deutschland hat wohl von dieser AWB profitiert.<br />
465.000 Nexium-Kunden<br />
Nach Berechnungen des „Arzneiverordnungsreports“ nehmen in ganz Deutschland<br />
durchschnittlich 465.000 Patienten regelmäßig Nexium ein, 121.900 als<br />
Objekt einer Nexium-AWB zwischen Nov. 2004 und Sept. 2006. Dabei ist Nexium<br />
nach Ansicht von Peter Sawicki, Leiter des unabhängigen Instituts für Qualität und<br />
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), nicht besser als das günstigere<br />
Omeprazol – nur eben teurer. Während eine Jahresdosis Nexium pro Patient 558 €<br />
kostet, schlägt das Generikum Omeprazol laut „Arzneiverordnungsreport“ nur mit<br />
347 € zu Buche. Würden die Ärzte konsequent Omeprazol statt Nexium verordnen,<br />
könnten die Krankenkassen nach Berechnungen des Heidelberger Pharmakologen<br />
Ulrich Schwabe jedes Jahr<br />
99 Mio Euro sparen – nur bei diesem einen Medikament. Für Astra Zeneca, die<br />
Herstellerfirma von Nexium, lohnt es sich dennoch, viel Geld in AWBs zu stecken:<br />
Allein im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit Nexium bei Astra Zeneca um 23%.<br />
68
Neben Nexium stehen auf der Liste der größten AWBs noch weitere Präparate, die<br />
man nach Ansicht von Pharmakologe Schwabe durch gut erforschte, günstigere<br />
ersetzen kann. Im Jahr 2005 hätten sich nach seinen Berechnungen folgende Einsparpotenziale<br />
ergeben:<br />
• Pantozol (Mehrausgaben der Krankenkassen gegenüber Omeprazol AL:<br />
105,2 Mio €)<br />
• Torem (Mehrausgaben gegenüber Furosemid-1A: 25,3 Mio €)<br />
• Actonel (Mehrausgaben gegenüber Fosamax: 7,7 Mio €)<br />
• Apidra (Mehrausgaben gegenüber Actrapid human: 4,3 Mio €)<br />
• Travatan (Mehrausgaben gegenüber Lumigan: 2,7 Mio €)<br />
• Locol (Mehrausgaben gegenüber Simvadura: 38,2 Mio €)<br />
• Oxygesic (Mehrausgaben gegenüber Morphanton: 62,2 Mio €)<br />
• Cranoc (Mehrausgaben gegenüber Simvadura: 15,8 Mio €).<br />
Bei all diesen Medikamenten, die im vergangenen Jahr ein kräftiges Umsatzplus<br />
verzeichneten, handelt es sich nach Professor Schwabe um sogenannte Analogpräparate,<br />
die keine oder nur marginale Unterschiede zu bisherigen Medikamenten<br />
zeigen. Würden die Ärzte die jeweils günstigeren Medikamente verordnen,<br />
könnten die Krankenkassen allein bei diesen neun erwähnten Arzneimitteln jedes<br />
Jahr 363 Mio € einsparen, ohne dass die Patienten schlechter versorgt wären als<br />
bisher.<br />
Pantozol 60% teurer als Omeprazol<br />
Wie bedrohlich aber für manche Pharmakonzerne eine solche wirtschaftliche<br />
Arzneiverordnung wäre, zeigt sich am Beispiel der Firma Altana und ihres Magenmittels<br />
Pantozol. Pantozol liegt in der Liste der umsatzstärksten Arzneimittel in<br />
Deutschland auf Platz zwei. Es ist 60% teurer als Omeprazol – ohne besser zu<br />
sein, wie Peter Sawicki vom IQWiG sagt. Altana macht 75% seines Umsatzes mit<br />
diesem einen Medikament. Würden die Ärzte aufhören, das teurere Pantozol zu<br />
verschreiben, käme der Pharmakonzern Altana in größte Schwierigkeiten. Auskunft<br />
darüber, wie viele Ärzte durch die Pantozol-AWB Honorar erhalten und in<br />
welcher Höhe, verweigert Altana: „Einzelheiten von Anwendungsbeobachtungen,<br />
die über die Anzeigepflichten hinausgehen, werden von uns nicht veröffentlicht.“<br />
69
Ähnlich zugeknöpft reagierten die meisten Pharmakonzerne. Essex Pharma, die für<br />
den Cholesterinsenker Inegy eine AWB mit 38.678 Patienten machte, verweist auf<br />
„vertragliche Geheimhaltungsverpflichtungen“. Die Pharmafirma Trommsdorff, die<br />
ihren Bluthochdrucksenker Emestar an 67.000 Patienten beobachten ließ, teilte<br />
gleich per Rechtsanwaltskanzlei mit, „dass die Honorare der beteiligten Ärzte<br />
nicht offengelegt werden können“. Die Firmen Astellas Pharma, Berlin-Chemie und<br />
Sankyo Pharma antworteten überhaupt nicht.<br />
Gesundheitsministerium hat genug von den Geheimhaltungen<br />
Im Gesundheitsministerium hat man von den Geheimhaltungen allmählich genug.<br />
Im derzeit geplanten Gesundheitsgesetz soll deshalb ein Absatz „zur weiteren<br />
Optimierung der Transparenz von Anwendungsbeoachtungen“ eingefügt werden,<br />
der „eine Erweiterung der Meldepflicht pharmazeutischer Unternehmer um die Art<br />
und Höhe der an die beteiligten Ärzte geleisteten Entschädigungen“ vorsieht –<br />
eine der wenigen positiven Neuerungen der ansonsten vermurksten Reform, die<br />
<strong>2007</strong> in Kraft treten soll. Außerdem würden, wie Ministeriumssprecherin Ina Klaus<br />
erläutert, „Ärzte, die an Anwendungsbeobachtungen teilnehmen, bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen<br />
künftig besonders durchleuchtet“.<br />
Eine deutlich radikalere Lösung schlägt der Heidelberger Pharmakologe und Herausgeber<br />
des „Arzneiverordnungsreports“, Ulrich Schwabe, vor. Er will vergütete<br />
AWBs ganz verbieten: Sie haben anscheinend wenig mit Wissenschaft, aber viel<br />
mit Marketing zu tun. Selten wird das so offensichtlich wie im Fall der Bluthochdruckmedikamente<br />
Diovan und Codiovan der Firma Novartis. In einem firmeninternen<br />
Marketingkatalog mit der Nummer 06/600 heißt der entsprechende Punkt:<br />
„Marktführerschaft: Mehr Patienten durch AWBs“. Novartis-Chef Peter Maag empfahl<br />
seinen Mitarbeitern diese „Maßnahme“, „um angesichts einer negativen<br />
Marktentwicklung den Trend noch in diesem Jahr umzukehren“. Im November<br />
berichtete der „stern“ erstmals über den Fall. Anschließend schrieb der Novartis-<br />
Chef seinen Mitarbeitern erneut eine E-Mail: „Es ist weder strafbar noch verstößt<br />
es gegen den Verhaltenskodex, wenn die durchgeführten AWBs auch zu Umsatzsteigerungen<br />
führen. Lassen Sie uns (...) die geplanten Aktivitäten in der gewohnt<br />
professionellen und ethischen Weise umsetzen.“<br />
70
Begründung der Jury<br />
»Ich darf Ihnen Markus Grill als ein großartiges Talent vorstellen. Die Regie<br />
hat mir hierzu 120 Sekunden eingeräumt und Sie können sich vorstellen,<br />
dass das kaum ausreicht, um ihn zu würdigen.<br />
Ich möchte Ihnen aus seinem Buch eine kleine Parabel präsentieren:<br />
Marcia Angell, die frühere Herausgeberin der bedeutenden medizinischen<br />
Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“ hat einmal gesagt, die<br />
Pharma Industrie sei wie ein 800 Pfund Gorilla, der macht, was er will.<br />
Markus Grill hat sich diesen Gorilla vorgenommen, ihn in sehr intensiver Form<br />
besichtigt, ihn analysiert und ihn mitunter auch mit Medikamenten behandelt.<br />
Dieser „Gorilla Pharmaindustrie“ ist das Objekt seiner journalistischen Begierde.<br />
Sein größter Verdienst aber ist, dass er diese – bewusst – undurchschaubare<br />
Branche transparenter macht. Er zeigt uns als Verbrauchern, als<br />
Patienten, als Betroffenen die Risiken und Nebenwirkungen auf und hält dieser<br />
großen Pharmabranche mit ihrer kriminellen Energie einen Spiegel vor. Das<br />
kann mitunter schmerzhaft sein.<br />
Sein wesentlicher Verdienst ist die journalistische Arbeit der Kontinuität. Mit<br />
dieser Kontinuität bildet er den Gegenentwurf zur weit verbreiteten Seuche<br />
der Oberflächlichkeit in den Medien, die oft von einem Thema zum anderen<br />
springen.<br />
Was sind die Vorteile seiner Kontinuität? Er versammelt dadurch mehr Expertise,<br />
er bildet Vertrauen bei Informanten und er baut ein Quellensystem auf,<br />
das nicht nur produktive Recherche ermöglicht sondern auch Kompetenz Dinge<br />
zu beurteilen. Das ist der Gegenentwurf zum mainstream- Journalismus.<br />
Sein journalistisches Credo lautet: Wer recherchiert hat Recht. Gleichzeitig<br />
sagt er: Man darf nicht alles glauben, was einem vorgesetzt wird.<br />
Markus Grill ist vielleicht eine moderne Form eines Tierpflegers. Er widmet<br />
sich diesem großen Gorilla. Und es wäre schön, wenn er damit Vorbild<br />
wäre für andere Journalisten, die sich andere Gorillas vornehmen, sie zähmen<br />
und kontrollieren. Glückwunsch an Herrn Grill: er könnte sicher auch ein<br />
grosses Tierheim leiten.«<br />
Vorgetragen von Dr. Thomas Leif<br />
71
OTTO BRENNER PREIS<br />
„SPEZIAL“<br />
72
Tom Schimmeck<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“<br />
73<br />
Angst am Dovenfleet<br />
die tageszeitung (taz), 30. Dezember 2006
Angst am Dovenfleet<br />
Was ist bloß aus dem „Sturmgeschütz der Demokratie“ geworden?<br />
Aus jener publizistischen Waffe, die „Der Spiegel“ heißt und am 4. Januar<br />
vor sechzig Jahren erstmals erschien? Deren Enthüllungen man genoss. Und<br />
die Coolness, die das Blatt verströmte. Der Hausbesuch eines Ehemaligen.<br />
Da trat hervor ein Zweiter,<br />
der hatte in seiner Hand einen blitzenden Spiegel,<br />
den hielt er zwischen Aufgang und Niedergang und sprach:<br />
Dieser Spiegel ist Wahrheit; Heuchelei und Larven bestehen nicht<br />
Da erschrak ich und alles Volk,<br />
denn wir sahen Schlangen- und Tiger- und Leopardengesichter<br />
zurückgeworfen aus dem entsetzlichen Spiegel.<br />
Friedrich Schiller: Die Räuber<br />
Noch einmal diesen Fahrstuhl nehmen. Edelstahl, schmucklos. Auf die 11<br />
drücken – der höchstmögliche Ausstieg in diesem grauen Turm. Die Tür gleitet<br />
auf. Tastend den Gang hinunter. Ins Licht der Kommandobrücke. Frauen im<br />
Sekretariat, Herren in den Chefzimmern. So zäh fließt die Zeit. Das Führungstrio<br />
ist komplett an Bord.<br />
Vize Joachim „Jockel“ Preuß flegelt wie immer grinsend hinter seinem Schreibtisch,<br />
hüllt seinen Schmerz in winterdicke Schichten von Sarkasmus. Vize Martin<br />
Doerry, stets akkurat, kommt zum Anstandsgruß aus seiner Kammer gestelzt.<br />
Wir waren mal Kumpels in sehr grauer Vorzeit, in einem Klüngel, der sich „Club<br />
der hungrigen Herzen“ nannte und unten in der Kantine von einem besseren<br />
Spiegel träumte. Der Hunger ist allen längst vergangen, manchem hat es sogar<br />
der Appetit verdorben.<br />
Eigentlich doch ganz nett hier. Es gibt Kaffee. Als Ex-Insasse darf man sogar<br />
Witze reißen. Der Chef ist noch beschäftigt. Nun geht die Tür auf. Zwei Interviewer<br />
raus, einer rein, auf der Couch zurechtruckeln, Fragezettelchen hervorholen,<br />
Bandgerät an. Jedes Wort muss hinterher vorgelegt werden. Führungskräfte<br />
handhaben das heute so.<br />
Er steht in der Mitte des Raumes, sortiert sich sekundenschnell. Alles Routine,<br />
74
Herr Aust? Er verneint. „Eigentlich ist es ständig ziemlich aufregend.“ Der Hanseat<br />
Aust, unpompös, nüchtern, effizient. Der Mund lächelt schmal, smile on the rocks.<br />
Seit zwölf Jahren blickt er durch diese breiten Fensterfronten gen Südwesten,<br />
auf die Stadt, den Sandtorhafen, auf die Kräne und die Elbe. Jeden Tag justiert<br />
Kapitän Aust den Kurs nach, ordnet die ganze wirre Welt, entscheidet, welche<br />
Stückchen der großen Wirklichkeit „ins Blatt gehievt“ werden, wie man in diesem<br />
Hause sagt. Ja, das findet er „spannend“.<br />
Seemannsgarn? Wer weiß? Man bekommt die Antworten, die man erfragt. Was<br />
treibe ich hier eigentlich? Warum werde ich überhaupt empfangen? Als ich vor<br />
Jahren anfragte, mutmaßte Aust schon am Telefon, ich hätte wohl einen „Schlachtauftrag“.<br />
Kein Termin. Er war auf der Hut. Schließlich hatten sie in den unteren<br />
Stockwerken seines Hauses nicht gerade auf den Tischen getanzt, als er hier<br />
oben einzog. Da hält man besser die Flanken dicht.<br />
Heute ist solche Vorsicht überflüssig. Dem „Kleinen König“, wie sie ihn hier ehrfürchtig<br />
nennen, kann keiner mehr was. Sein Vertrag geht bis Ende 2008, mit<br />
einer Option für weitere zwei Jahre. Die Lage des Spiegel sei „stabil, mit einer<br />
steigenden Tendenz“, sagt er. Nicht ohne darauf zu verweisen, dass der Laden,<br />
als er anfing, „ein bisschen in der Krise“ war – bedroht vom neuen Focus,<br />
diesem bunten Bayern-Spiegel, und vom Internet. Doch 1998 habe der Spiegel<br />
den Stern überholt. Focus wie Stern würden heute verlieren, während der<br />
Spiegel sich „gut behauptet“, spricht Aust. Und verrät auch gleich gern sein<br />
Rezept: „Back to the roots!“ „Wir sind heute viel authentischer, nutzen viel mehr<br />
Originalquellen, gehen sehr viel mehr an Originalschauplätze.“<br />
Sein Selbstbild steht, die Aust-Story ist rund. Jetzt kann jeder kommen, hören,<br />
staunen. Hinter dem Schreibtisch hängt riesig die Auflagenstatistik, viele kleine<br />
Titelbildchen tanzen an einer Kurve auf und ab. Da sieht er gleich, was Top war<br />
und was Flop. Ob die Mischung stimmt, zwischen hart und weich, nah und fern,<br />
Medizin, Religion, Skandal und Sex. „Die Angst, dass die Auflage schlecht läuft,<br />
ist jede Woche da“, erklärt der Chefredakteur. „Aber wir sind im Augenblick auf<br />
sichererem Terrain. Im Augenblick.“ Will sagen: Nur Treibsand da draußen. Doch<br />
seid ohne Furcht. Aust weiß den Weg.<br />
Der Spiegel bleibt ein einzigartiges Medium, das dickste Ding in Deutschland.<br />
75
Gewiss, die Bild-Zeitung hat mehr Auflage, das Fernsehen mehr Publikum. Der<br />
Spiegel aber entwickelt die größte Wucht, trillert mit der Pfeife des Schiedsrichters,<br />
liefert gern finale Urteile über diesen, jenes und alles. Er wird noch immer<br />
gefürchtet. Zwar hört man rundum öfter: „Den lese ich kaum mehr“ und „Das<br />
brauche ich nicht mehr“. Viele schütteln den Kopf ob der politischen Irrungen<br />
und Wirrungen des Blattes. Doch selbst bei Ex-Lesern schwingt oft ein Erstaunen<br />
darüber mit, dass sie sich gelöst haben von der Droge namens Spiegel.<br />
Ich gestehe: Auch ich war ein Junkie. Schon als Knabe verschlang ich das Blatt.<br />
Nicht so sehr, weil der Spiegel besonders klug, analytisch und weitblickend war.<br />
Mehr wegen seiner Grundhaltung. Der Spiegel entzauberte die Wichtigtuer, er<br />
war die freche Antimacht, die das allzu zwielichtige, dreiste und bigotte Personal<br />
im Land bloßstellte. Wenn Deutschland Montag morgens erwachte, lag da ein<br />
Magazin, das Parteichefs, Manager und Bischöfe zum Stammeln brachte. Wer<br />
log oder sich die Taschen vollmachte, wurde verlässlich abgewatscht. In besten<br />
Zeiten war der Spiegel der wöchentliche Einlauf fürs stinkende Gedärm der<br />
Republik. Ein Akt der Hygiene. Und insofern tatsächlich, wie Herausgeber Rudolf<br />
Augstein einst prahlte, ein „Sturmgeschütz der Demokratie“.<br />
Ich hatte tiefen Respekt vor so viel Respektlosigkeit, fand dieses Blatt so bewundernswert,<br />
dass ich mich als junger Mann in den Siebzigern des Nachts regelmäßig<br />
in den Haufen der Hamburger Altpapiersammlung wiederfand. Nach<br />
langem Suchen und Wühlen hatte ich eine fast komplette Sammlung, bis zurück<br />
in die Fünfziger, hübsch sortiert, mit Jahresregistern. Die Freunde hassten mich,<br />
weil sie den schweren Papierkram bei jedem Umzug von Dachwohnung zu Dachwohnung<br />
schleppen mussten. Doch der Sammler war unbelehrbar. Ein Fan.<br />
Der Spiegel war einfach einzigartig. Er hatte die kesseste Lippe.<br />
Natürlich war ein Trick dabei. Eine Masche, den Leser in den Text hineinzuziehen.<br />
„Sanft anschneiden und dann zustechen“ hieß die Regel, wie ich später lernen<br />
durfte. Die Architektur ist eigentlich simpel: Ein guter erster Satz, ein hübscher<br />
szenischer Einstieg. Im dritten Absatz dann der Kern des Themas, gefolgt von<br />
allerlei Beispielen, gewürzt mit Einsprengseln wie „vielerorts“ und „immer<br />
mehr“, und einem flotten Für und Wider voller Zitatkonfetti, das den Anschein<br />
von Abgewogenheit wahrt, letztlich aber nur das Ziel verfolgt, die im Vorspann<br />
76
formulierte These zu untermauern. Zum Schluss ein Gag. Fertig ist der Artikel.<br />
Oder die „Geschichte“, wie es beim Spiegel heißt.<br />
So entsteht eine hochverdichtete Endlosschleife. Ein längst vergangener Chefredakteur<br />
sagte einmal, in einer typischen Spiegel-Story könne man an einer<br />
beliebigen Stelle den Rotstift ansetzen, über viele Absätze hinweg kürzen und<br />
dann mit einem „jedoch“ anschließen.<br />
Der Spiegel war nie links. Das zu glauben wäre ein Riesenmissverständnis.<br />
Obschon hier viele Rote und Grüne dienten. Er war allenfalls, wie Augstein einst<br />
erklärte, „im Zweifel links“. Was aber eigentlich nicht passieren durfte, da der<br />
Spiegel keinen Zweifel an sich selbst zulässt. Eher schon ist er, was man heute<br />
„cool“ nennen würde. Er legt sich niemals fest. Nach Gutdünken kürt und verfeuert<br />
er seine Helden, hebt sie himmelhoch, um sie irgendwann umso tiefer<br />
plumpsen zu lassen. Wer diesen Montag Superstar ist, kann nächste Woche zum<br />
Trottel der Nation absteigen. Der Vorgang ist nicht berechenbar. Die Konstante in<br />
diesem Spiel ist der Spiegel selbst: Er wusste es immer schon. Und zwar besser.<br />
Im Zweifel sind alle doof außer ihm.<br />
Der Mehrwert für den lieben Leser: Er darf sich mit dem Spiegel schlau fühlen.<br />
Das tut zuweilen gut. Man blickt gemeinsam durch Schlüssellöcher und guckt<br />
zu, wie sich die Deppen abzappeln.<br />
Als Hans Magnus Enzensberger noch eigensinnig war, schrieb er nicht nur bewegende<br />
Gedichte, sondern auch eine berühmt gewordene Spiegel-Kritik. Schon<br />
damals sprang offenbar eine gewisse Beliebigkeit des Magazins ins Auge: „Die<br />
Stellung, die es von Fall zu Fall zu beziehen scheint, richtet sich eher nach den<br />
Erfordernissen der Story, aus der sie zu erraten ist: als deren Pointe. Sie wird oft<br />
wenige Wochen später durch eine andere Geschichte dementiert, weil diese<br />
einen anderen ,Aufhänger’ verlangt.“ Auch diese eigentümliche Spiegel-Sprache,<br />
die „unkenntlich macht, was sie erfasst“, analysierte der Dichter trefflich: „Es<br />
handelt sich um eine Sprache von schlechter Universalität: Sie hält sich für kompetent<br />
in jedem Falle. Vom Urchristentum bis zum Rock and Roll, von der Poesie<br />
bis zum Kartellgesetz, vom Rauschgiftkrawall bis zur minoischen Kunst wird<br />
alles über einen Leisten geschlagen. Der allgegenwärtige Jargon überzieht alles<br />
77
und jedes mit seinem groben Netz: Die Welt wird zum Häftling der Masche.“<br />
Die Welt hat offenbar lebenslänglich. Der Text ist fünfzig Jahre alt. Und passt<br />
noch. Selbst der Spiegel druckte ihn mit vierzigjähriger Verspätung. Enzensberger<br />
aber hat sich wohl stärker verändert als der Spiegel, publiziert längst auch<br />
dortselbst. Etwa, wenn er uns mitteilen muss, dass Saddam der neue Hitler sei<br />
und ganze Völker „ewige Verlierer“. Es sind düstere, kaltherzige Essays, die<br />
recht gut zum Spiegel passen.<br />
Es wird zu gemütlich. Bin schon wieder zu zahm. Wir müssen zu den Inhalten<br />
kommen. Auch wenn sie schwer zu greifen sind. Stefan Aust schaut aus dem<br />
Fenster. Er droht sich zu langweilen. Unten funkelt der Dovenfleet. „Wir vom<br />
Dovenfleet“, sagten Spiegel-Leute früher bei Anfällen von Selbstironie. Andere<br />
nannten das eigene Blatt gerne Bild am Montag.<br />
Man spürt die Gereiztheit, die dieser Etage innewohnt. Auch wenn man Jahre<br />
nicht hier oben war. Es ist ein hochgespannter Ort. Obwohl: Erich Böhme<br />
schenkte am Freitagabend schon mal Champagner aus, wenn es richtig rund<br />
gelaufen war. Doch die Dramen überwogen. Zumal, wenn mehrere Kapitäne auf<br />
der Brücke waren. Sie hassten und sie schlugen sich. Bei einer Visite vor vielen<br />
Jahren sagte mir ein bitterer Chef, den Blick auf die Zimmerwand des benachbarten<br />
lieben Kollegen geheftet: „Er ist ein Schwein und kann nicht anders.“<br />
Die Macht ist voller Tücken. Und Qualen. Aber Inhalte? Warum, Stefan Aust,<br />
schreiben Sie eigentlich nie? Er lächelt wie der Beißer bei Bond. „Ich bin ja ein<br />
bescheidener Mensch, wie du weißt“, sagt Aust, nun mit einem fast schon treuherzigen<br />
Augenaufschlag. „Viele können besser schreiben als ich.“ Außerdem<br />
habe er gar keine Zeit dazu, beschränke sich auf gelegentliche Moderationen für<br />
„Spiegel-TV“. Kennen wir: Aust mit Stakkato und Großinquisitormiene.<br />
Aber Moment. Der Mann hat hunderte Filmbeiträge gemacht, etliche Bücher<br />
geschrieben. Er ist ein Vollblutjournalist, ein Enthüller, ein Trüffelschwein, und<br />
meinungsfreudig obendrein. „Dafür werd ich nicht bezahlt“, sagt Aust. „Ich werde<br />
dafür bezahlt, den Kurs des Blattes zu bestimmen und dafür zu sorgen, dass wir<br />
von größeren Katastrophen verschont bleiben.“ Der Satz gefällt ihm, er lehnt<br />
78
sich zurück. „Ach“, seufzt der Chefredakteur, „ich schreibe ja wenige Zeilen.<br />
Aber die finden sich meistens vorne auf dem Titelbild.“ Ja, der Titel – das ist sein<br />
Ding. Weil man in so einem dicken Heft „nicht jede Geschichte selber recherchieren<br />
und schon gar nicht schreiben, ja nicht einmal in Auftrag geben“ kann.<br />
Also musste sich Aust „Schwerpunkte suchen, wo die Hebelkraft am größten ist,<br />
mit denen das Gesicht des Blattes am ehesten bestimmt ist. Das ist die Titelgeschichte,<br />
das Titelbild, die Titelzeile.“ Der Aust’sche Dreiklang.<br />
Der Kurs? Ist so einfach nicht auszumachen. Der Spiegel, sagt Aust, sei „Aufklärung.<br />
Und Realitätscheck. „Was aber die Meinung angeht, ist der Spiegel ein<br />
Kuriosum: Europas größtes Nachrichtenmagazin hat offiziell keine Meinung.<br />
Früher durfte meist nur der Herausgeber kommentieren. Was Aust bestätigt:<br />
„Zu der Zeit, als Rudolf Augstein noch lebte, wäre kein Chefredakteur gut beraten<br />
gewesen, sich anzumaßen, neben Rudolf Augstein Kommentare zu schreiben.“<br />
Seit er tot ist, ist es ganz aus mit der Meinung, findet sich keine dezidierte Haltung,<br />
keine ausformulierte Position mehr im Blatt.<br />
Umso stärker stehen vor allem Produkte der Ressorts Wirtschaft und Deutschland<br />
unter ideologischem Dampf. Wenn es etwa wider die Windkraft oder das<br />
Dosenpfand geht, gegen die ganze rotgrüne oder, neuerdings, die großkoalitionäre<br />
Richtung. Und sowieso gegen all diese nervigen Verlierer: Arbeitslose,<br />
Gewerkschafter, Ökos, Flüchtlinge, Moslems und andere Geringverdiener.<br />
Der Spiegel ist das einzige Blatt, bei dem ich mich je beworben habe, so richtig<br />
schriftlich. Das war gleich nach der Flickaffäre, journalistisch eine große Zeit. Die<br />
Einvernahme des Spiegel-Aspiranten fand in einem schummrigen Restaurant<br />
unweit des Hamburger Rathauses statt. Ich saß zwei echten Politressortleitern<br />
gegenüber und war aufgeregt. Dann verblüfft: Die Herren versuchten mir meine<br />
Bewerbung auszureden. Sie schilderten Spiegel-Tristesse, malten den typischen<br />
Spiegel-Redakteur als über die Flure schlurfenden Faulpelz, der missmutig die<br />
Reichtümer aus seiner Gewinnbeteiligung verwaltet, am Dienstapparat die Mieter<br />
seiner Eigentumswohnungen zusammenstaucht und ansonsten kleine Gemeinheiten<br />
gegen den Zimmernachbarn ausheckt. Erschüttert wankte ich hinaus ins<br />
Tageslicht.<br />
79
Später wurde ich dennoch Redakteur; Arbeitsbiene im neunten Stock. Als ich den<br />
Dienstantritt wegen einer Bandscheiben-OP verschieben musste, diagnostizierte<br />
mein Ressortleiter trocken: „Ist ja gut, wenn vorher was am Rückgrat gemacht<br />
wird.“ Ich fand den Scherz ganz gelungen, kaufte mir eine schicke Schreibtischlampe<br />
und war stolz wie Bolle.<br />
So golden funkelte die Galeere, die Bänke schienen gut gepolstert. Es ist keine<br />
Strafe, beim Spiegel zu arbeiten: Feiner Lohn, hohes Sozialprestige, Kaffee und<br />
Archivmaterial werden gebracht. Man trifft viele gute, sogar einige richtig sympathische<br />
Leute. Sobald man seinem Namen am Telefon ein „Der Spiegel“ folgen<br />
lässt, hört man, wie am anderen Ende die Hacken zusammengeschlagen werden.<br />
Das kann dem Selbstwertgefühl förderlich sein. Ich hatte es gut.<br />
Nach wenigen Wochen aber war mir elend. Zunächst gab ich der Klimaanlage die<br />
Schuld. Dann dämmerte mir: Es ist das Binnenklima; diese obskuren, altmaskulinen,<br />
vordemokratischen Umgangsformen. Das durchritualisierte Weitpinkeln.<br />
Ich war in eine Burschenschaft geraten. Unter Männer, die beim Witz warteten,<br />
bis der Chef lacht. Die sich gegenseitig Wunden schlugen und sie dann stolz<br />
herzeigten. Die niemals die geringste Blöße zeigen durften.<br />
Als ich einem Kollegen, der über einem schwierigen Thema brütete, einen interessanten<br />
neuen Artikel zeigte, riss er ihn mir aus der Hand, stopfte ihn ins Jackett<br />
und krähte: „Kenn ich schon!“ Ich fragte einen der Superstars um Rat, einen Mann<br />
mit Herz. Der nickte wissend und erklärte mir, solches Befremden sei normal am<br />
Anfang. Er zum Beispiel habe das erste halbe Jahr „jeden Morgen gekotzt“.<br />
Eines Tages saß ich bei einem jener perfekten Redakteure, die immer vor einem<br />
leeren Tisch saßen, den Moment erwartend, da ein Leitender ins Zimmer tritt,<br />
einen Zeitungsschnipsel mit einem Thema in der Hand fallen lässt und spricht:<br />
„Neun Blatt fürs Vorprodukt.“ Der Redakteur erzählte mir seinen Traum: Er sei<br />
mitten im Text tot vom Stuhl gefallen. Nach einiger Zeit sei der Ressortleiter ins<br />
Zimmer gekommen, über seinen Leichnam gestiegen, habe das Manuskript aus<br />
der Maschine gezogen und es zur Vollendung ins Nachbarzimmer gegeben.<br />
Ich schenkte uns einen Whisky ein und beschloss, vor Beginn der Gewinnbeteiligung<br />
die Biege zu machen. In die weite Welt zu gehen, ohne Spiegel. Als ich es<br />
später tat, kam es zu komischen Szenen. Alte Haudegen traten im langen Flur<br />
80
auf mich zu, guckten sich um, ob die Luft auch rein sei, drückten mir kräftig die<br />
Hand und sagten: „Glückwunsch!“<br />
Als ideologische Kampfzentrale fungiert, das ist hinlänglich dokumentiert und<br />
nahezu allwöchentlich nachlesbar, das Berliner Spiegel-Büro unter Gabor Steingart,<br />
Austs kongenialem Partner, der die Lage der Nation in düstersten Farben zu<br />
malen pflegt, wenn es sein muss, buchdick. Er wollte Schröder weghaben. Nun<br />
klagt er über Merkels „Selbstverrat“: „Die Ausweitung der sozialen Zone kommt<br />
noch hinzu. Die aufgestockten Hartz-IV-Zahlungen für Ostdeutsche und ein großzügig<br />
in Aussicht gestelltes Elterngeld für alle nähren einmal mehr jene Ansprüche<br />
des Einzelnen an die Gesellschaft, die Merkel einst aus gutem Grunde begrenzen<br />
wollte. Nun versucht auch sie eine Wohlstandsillusion zu verlängern, die Schröder<br />
als solche schon enttarnt hatte.“ Das ist Friedrich Merz pur.<br />
Steingarts Arbeitsmotto heißt: Alarmstufe rot. Neuerdings recycelt er sogar die<br />
alte „Gelbe Gefahr“, entdeckt in China die Hauptbedrohung unseres Lebensstandards<br />
und ruft nach transatlantischem Protektionismus. Seine neoliberalen<br />
Freunde verwirrt das ein wenig. Roger Köppel beispielsweise, der damalige Chefredakteur<br />
der „Welt“, fühlte sich in seinem Blatt gar zu einer rettenden Brandrede<br />
für den Kapitalismus bemüßigt, die in einem zackigen Tod-den-Bürokraten endete.<br />
In just jenem Organ fand sich auch ein höchst skurriles Streitgespräch zwischen<br />
Steingart und dem FDP-Grafen <strong>Otto</strong> Lambsdorff, einst Schlüsselfigur in der Flickaffäre<br />
und damals sehr erbost über die „journalistische Todesschwadronen“ des<br />
Spiegel. Wie anders tickt heute die Spiegel-Welt: „Reformstau“-Steingart klagt,<br />
dass Lambsdorffs berühmtes „Wendepapier“, mit dem die Kanzlerära Helmut<br />
Schmidts endete und jene von dessen Nachfolger Helmut Kohl begann, noch<br />
immer nicht umgesetzt sei. Während Lambsdorff die armen Chinesen rettet:<br />
„Herr Steingart, Sie verwenden in Ihrem Buch in erheblichem Umfang militärische<br />
Ausdrücke, bis hin zum Titel. Allein diese Sprache führt zwangsläufig zu<br />
defensiven Vorschlägen.“<br />
Man ist überfordert, dies alles noch vollkommen ernst zu nehmen. Innenpolitisch ist<br />
der „Spiegel“ von „Focus“ und „Bild-Zeitung“ nur mehr schwer zu unterscheiden.<br />
Wohin also des Weges, Herr Aust? Warum macht der Spiegel einen auf neoliberal?<br />
81
„Ehrlich gesagt“, sagt Aust, „das ist so ein bisschen wie früher der Satz ,Geh<br />
doch nach drüben’. Neoliberal? Ich weiß gar nicht, was das eigentlich heißt.<br />
Realistisch zu sein, zwei und zwei zusammenzählen zu können? Was ist daran<br />
neoliberal?“ Simpel gesagt: Wenn man den Schwachen ordentlich Druck macht<br />
und den Mächtigen devot den Bauch krault. Wenn man ständig Tsunamis publizistischer<br />
Aufgeregtheit auslöst, um eine bestimmte politische Agenda voranzutreiben.<br />
Das müsste Aust doch kapieren. Steckte er nicht bis zum Hals in der<br />
APO, war er nicht bei den wilden St. Pauli Nachrichten, bei Konkret, bei „Panorama“,<br />
bei Demos gegen alles und jeden?<br />
Er sei vielerlei Einflüssen ausgesetzt gewesen, meint Aust – „ohne diesen Einflüssen<br />
jemals erlegen zu sein. Ich bin ja in keiner Sekte gewesen, gar nix. Ich<br />
hab mich sehr wenig verändert. Das ist einfach ein Fakt. Ich habe bei Konkret<br />
nicht anders gedacht, als ich heute denke. Ich war immer mit den Füßen ziemlich<br />
auf dem Boden.“<br />
Wiewohl, findet er, sich das Grundklima der Republik „ein Stück verändert“<br />
habe. Es deshalb „ziemlich komisch“ wäre, „wenn der Spiegel als einziger noch<br />
mit ,Ho-ho-Ho-Tschi-Minh’ über die Straßen galoppieren würde“.<br />
Was der Spiegel ohnehin nie tat – nun aber „Me-Me-Merkel blöd“ skandiert.<br />
Weil Aust von der Kanzlerin enttäuscht ist. Deren Koalition sei „in ihrem Reformwillen<br />
weit hinter die rotgrüne Regierung zurückgefallen“. Das Familiengeld<br />
etwa sei „eine kolossal falsche Entscheidung“. Er reckt sein Haupt: „Ich habe<br />
Frau Merkel gesagt, dass ich das für Quatsch halte.“<br />
Was ist der Kern des Austismus-Steingartismus? Haben sie die Rotgrünen etwa<br />
nicht in die Tonne getreten? „Wir waren sehr kritisch mit den Regierenden. Das<br />
hat auch damit zu tun, dass wir die ja alle lange kannten, schon bevor sie Würdenträger<br />
waren.“ Aust ruft die Schröder-Memoiren in den Zeugenstand. Der kritisiere<br />
nicht die Medien, sondern „die Linke in der SPD und in den Gewerkschaften.<br />
Und ich glaube, da ist was dran. Gerhard Schröder wurde von seiner eigenen<br />
Partei gestürzt.“<br />
Also kein Kurswechsel? „Rudolf Augstein ist für die FDP im Bundestag gewesen.<br />
Ich bin nicht in der FDP“, sagt Aust. Aber war das nicht zu sozialliberalen Zeiten,<br />
in der Bürgerrechts-FDP eines Karl Hermann Flach? „Das“, er wird eine Spur lauter,<br />
82
„ist die FDP gewesen, die anschließend Kohl zum Kanzler gemacht hat. Rudolf<br />
Augstein ist bis zu seinem Tode FDP-Mitglied gewesen. Ich bin in keiner Partei<br />
und werde auch nie eintreten.“<br />
Ergüsse wie diese Geschichte über den Spiegel haben immer einen Hautgout.<br />
Man ist nie nüchtern. Es geht um das eigene Metier. Hier obendrein um ein<br />
Stück eigener Geschichte. Will der etwa nachtreten? Sich rächen? Ich erklärte<br />
hiermit: Ich hatte es gut. Keiner hat mir persönlich etwas getan. Ich ging in Frieden.<br />
Sogar mit „Rückkehrgarantie“. Ich erkläre weiter: Der Spiegel ist wichtig für<br />
dieses Land. Sein Niedergang betrübt mich als Bürger und Leser.<br />
Das zweite Problem: Bei der Beobachtung deutscher Chefredakteure ist die<br />
Pressefreiheit eingeschränkt. Sie sind alle Kumpels. Sie verabscheuen sich wie<br />
die Pest. Aber sie schützen sich. Wie Chefärzte. Früher gab es Lager in der deutschen<br />
Presse. Verdarb man es sich mit dem einen Haufen, mochte der andere<br />
einen umso mehr. Heute sind alle in einem Boot. Und singen: „Was du nicht<br />
willst, das man dir tu’, das füg auch keinem andern zu.“<br />
Wenn da irgendein Unterling frech wird, ist das Sperrfeuer sofort gewaltig.<br />
Franziska Augstein, Tochter und Erbin, bekam das zu spüren, als sie es wagte,<br />
Aust zu kritisieren: „Er hat das Magazin zu einem geschwätzigen Blatt unter<br />
anderen gemacht. Der Fisch stinkt vom Kopf.“ Da war was los! Die Spiegel-<br />
Ressortleiter verfassten eine Ergebenheitsadresse für den Chefredakteur. In den<br />
Medien erschienen bittere Artikel. Aust, der „überaus erfolgreiche“, das „Multitalent“,<br />
das „Wunderkind“, dieser „journalistische Berserker“, hieß es etwa in<br />
der Zeit, sitze jetzt „fester denn je auf seinem Stuhl als Spiegel-Chefredakteur“<br />
und sei „noch ein bisschen stärker geworden“. Selbst ihr Bruder Jakob putzte<br />
Franziska Augstein runter. Man sollte die Mappe mit den Texten an allen Journalistenschulen<br />
verteilen und draufschreiben: Lernt lieber was Anständiges, Leute!<br />
Aust hat die ganz große Allianz mitgeschmiedet: Die Schirrmacher-Aust-Döpfner-<br />
Allianz. Vorbei die fruchtbaren Zeiten, als der Spiegel über die „Bertelsmann-<br />
Kumpanei mit Springer“ schrieb und sich über die „heilige Vielfalt der Springer-<br />
Ideologie“ mokierte. Als Axel Springer daraufhin empört ein Interviewbegehren<br />
des Spiegel abschmetterte: „Offen gesagt verwundert es mich, mit welcher<br />
83
scheinbar nahtloser Glätte der Spiegel einen Mann mit unqualifizierten Mitteln<br />
verhöhnt und verteufelt und ihn dann mit kaum zu begreifender Unbefangenheit<br />
zu einem Gespräch einlädt.“<br />
Springers Zorn gipfelte damals in dem bezaubernden Satz: „Natürlich bringt es auf<br />
die Dauer gar keinen Spaß, den Kakao immer zu trinken, durch den man gezogen<br />
wird.“ Die Medienberichterstattung des Spiegel, einst ein Markenzeichen, ist tot.<br />
Spiegel-Aust, FAZ-Schirrmacher, Springer-Döpfner sind sich einig. Man feiert sich<br />
gegenseitig, hat Freude aneinander. Auch wenn der gemeinsame Kampf gegen<br />
die Rechtschreibreform schiefgegangen ist. Austs Kumpels lancieren gerne die<br />
Idee, nach Dienstschluss auf der Spiegel-Brücke könnte er einen TV-Vorstandssessel<br />
bei Springer erklimmen.<br />
Und die Redaktion? Wie kann man sich sein Leben so zur Hölle machen? Unter –<br />
zumindest theoretisch – beinahe idealen journalistischen Bedingungen? In<br />
einem Blatt, das obendrein zur Hälfte der Belegschaft gehört? Ist die Kehrseite<br />
des Klugschisses der Komplex? Als der Spät-Thatcherist Matthias Matussek zum<br />
Kulturchef ernannt wurde, sagte mir ein alter Spiegel-Mann: „Wir haben ein neues<br />
Rekrutierungsprinzp für Ressortleiter: ,Das größte Arschloch wird’s.’“<br />
Der Schlüssel heißt Angst. Ihr ursprünglicher Erzeuger, wohl Rudolf Augstein,<br />
dieser hochbegabte Menschenfeind, der wirkte wie einer, der an vielem litt: an<br />
den Verhältnissen, an der Dummheit, an sich selbst. Je älter man wird, desto<br />
besser versteht man das. Welch eine Tragödie. Er saß ganz oben, im zwölften<br />
Stock, spottete über sein „komfortables Gefängnis“ und schaute mit wachsender<br />
Verachtung auf sein Fußvolk. Auf all die alerten Jungs, die ihn nicht zu stürzen<br />
vermochten, nicht einmal zu kritisieren wagten. Keiner traute sich, dort hinaufzusteigen<br />
und zu sagen: Rudolf, das ist jetzt Mist. Augstein spuckte auf sein<br />
Schloss. Er säte Misstrauen und erntete Feigheit. Wer ihn erlebte, schrieb Dieter<br />
Wild, langgedienter Spiegel-Offizier, „war oft verblüfft über seine Angst, die vor<br />
allem eine Angst vor Nähe war, der seiner Freunde oft mehr als der seiner Feinde“.<br />
Es herrscht die Omertà, das Schweigegebot der Mafiosi. Wobei sich immer<br />
wieder Leute finden, die Angst und Feigheit eingestehen. Ehemalige.<br />
Und Spiegel-Leute, die in innerem Exil verharren. Ganz offen, aber nie öffentlich.<br />
84
Als Spiegel-Redakteur hatte ich oft den verrückten Gedanken: Da einfach mal<br />
hoch gehen, anklopfen und reden. Doch so weit reichte der Mut nie. Jahre später,<br />
kurz vor seinem Tod, war ich zu Besuch im Spiegel, latschte von Büro zu Büro,<br />
plaudernd und Kaffee schlürfend. Irgendwann saß ich bei einem leitenden Mitarbeiter,<br />
fragte nach Augsteins Befinden und der Zukunft des Spiegel. „Ich weiß<br />
nicht, wann der Alte die Rosette zusammenkneift“, sprach der Mann, „aber das<br />
ist eigentlich auch scheißegal.“ Bald darauf erschien ein ganzes Spiegel-Heft<br />
voll salbungsvoller Nachrufe.<br />
Wäre Augstein zufrieden mit dem Spiegel heute? (Einmal angenommen, ihm sei<br />
die Kategorie „zufrieden“ bekannt.) „Ich bin ganz sicher“, sagt Aust und holt tief<br />
Atem. Er wiederholt den Satz dreimal. Bis zu seinem Tode, berichtet Aust, habe<br />
er viel mit Augstein geredet. „Ich bin ganz sicher, dass er es heute kein bisschen<br />
anders machen würde.“ Fast ist es, als ginge ein Engel durchs Büro.<br />
Fehlt er? „Er fehlt. Er hat mir den Rücken freigehalten.“ Ist sein Leben härter<br />
ohne Augstein? „Man ist da natürlich noch ein Stück einsamer.“<br />
Auch der Chefredakteur hat schon zu hören bekommen, er herrsche mit Willkür,<br />
verbreite ein „Klima der Angst“. Doch ist es nicht ratsam, dies im Hause laut zu<br />
sagen. Man wird zügig weggebissen. Als Augstein fort war, hat Aust schnell gehandelt.<br />
Flugs befand er, dessen Fußstapfen seien zu groß für jeden denkbaren<br />
Nachfolger. Weg war der Herausgeberposten. Die Erben verloren ihre Macht ob<br />
einer komplizierten Vertragsklausel.<br />
Ich“, meint Aust fröhlich, „habe mit den Erben nie einen Zwist gehabt.“ Nur die<br />
Mitarbeiter-KG als größter Anteilseigner kann ein Problem werden. Wurde es<br />
auch schon. Auch wenn Aust beteuert: „Das war immer nett und freundlich. Für<br />
die Inhalte ist die Mitarbeiter-KG nicht zuständig.“<br />
Was ist eigentlich aus der Augstein-Etage geworden? Ein Spiegel-Mann nimmt<br />
mich mit die Treppe hinauf, in den zwölften Stock. Im Flur in schlichten Holzrahmen<br />
zwei Titel mit dem Kopf Augsteins darauf. Einer aus der Zeit der Spiegel-<br />
Affäre, einer zu seinem Tod. Ansonsten alles voll mit Konferenzzimmern diverser<br />
Größen. „Das hat der Kleine doch clever hingekriegt“, sagt mein Begleiter feixend.<br />
„Hier passt kein Herausgeber mehr rein.“<br />
85
Begründung der Jury<br />
»Wenn man hier ans Mikrofon tritt, dann gehört es sich, zu sagen, dass man<br />
sich sicher sehr, ja ganz riesig freut, den <strong>Preis</strong>träger vorstellen zu können.<br />
Aber es stimmt wirklich – und ich sage Ihnen auch warum: Meine sehr verehrten<br />
Damen und Herren, ich unterrichte an den Journalistenschulen in<br />
München und Hamburg Meinungsjournalismus, Leitartikel, Kommentar.<br />
Bei diesen Gelegenheiten sage ich gern und ein wenig hochtrabend: Der<br />
Leitartikel, das Essay, der Meinungsjournalismus – das ist der Diamant des<br />
Journalismus. Ich weiß genau, dass es in der Praxis nicht so ist. In der Praxis<br />
ist der Kommentar der Kaugummi des Journalismus: Durchgekaute Vorurteile,<br />
vorgekaute Bewertungen. Das ganze Elend des deutschen Journalismus kann<br />
man am Kommentar und am Leitartikel in ganz besonderer Weise erleben.<br />
Wenn Sie sich täglich die Pressestimmen, die Kommentarstimmen durchschauen,<br />
schlagen Sie die Hände über dem Kopf zusammen und beginnen zu<br />
schreien darüber, was Sie da an Floskeln, an Dummheiten, an Phrasen lesen<br />
müssen.<br />
Deswegen haben wir, die Jury, diesen Spezial <strong>Preis</strong> angeregt, die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong><br />
Stiftung hat mitgemacht – und jetzt gibt es ihn und seinen ersten <strong>Preis</strong>träger.<br />
Wir haben gesagt: Wir brauchen einen Journalistenpreis, der den Meinungsjournalismus<br />
stärkt; der den Kommentar wieder zum funkeln bringt; der<br />
den Leitartikel wieder zu dem macht, was er sein kann: der Diamant des<br />
Journalismus. Wir verleihen diesen <strong>Preis</strong> für Meinungsjournalismus zum<br />
ersten Mal. Ich könnte mir keinen besseren <strong>Preis</strong>träger vorstellen als Tom<br />
Schimmeck. Er ist derjenige, auf den dieser <strong>Preis</strong> beinahe zugeschnitten ist.<br />
Wenn man seine Texte liest, denkt man sich: Karl Kraus ist ja eigentlich tot,<br />
Kurt Tucholsky auch. Tom Schimmeck erinnert an sie, an die ganz großen<br />
unseres Metiers, aber Tom Schimmeck ist Tom Schimmek. Er ist er selber. Er<br />
ist Essayist, er ist Kommentator, er ist auch Prophet. Er hat geschrieben, als<br />
noch keiner über die Defizite, Malaisen und Katastrophen im Magazin<br />
„Spiegel“ geschrieben hat, die jetzt in jeder Gazette vorgestellt werden, abgebildet<br />
werden. Er hat geschrieben, als sich das noch keiner getraut hat.<br />
86
Man fragt sich immer wieder: Braucht es denn Mut, um guten, klugen,<br />
gedankenreichen, pointierten Meinungsjournalismus zu machen?<br />
Schimmeck ist ein Beispiel dafür, dass es gewissen Mut braucht: Weil Denkund<br />
Schreibverbote bestehen; weil zumal der Medienjournalismus daraus<br />
besteht, sich gegenseitig zu beweihräuchern, weil sich kaum einer sagen<br />
traut, was wirklich mistig läuft und wo. Und was mistig lief und wo – Tom<br />
Schimmeck hat sich getraut es zu sagen in seinem berühmten Stück „Arschlochalarm“.<br />
Er hat darin die Konformität und die Uniformität des politischen<br />
Journalismus in Grund und Boden geschrieben. Die gesamte Branche hat<br />
gejault. Es gibt ganz wenige Stücke in unserem Gewerbe, die man immer und<br />
immer wieder lesen mag. Die man wie ein gutes Lied, wie einen Protestsong<br />
immer wieder gern hört. „Arschlochalarm“ war und ist ein solches Stück.<br />
Man mag es immer wieder lesen, weil so viele scharfe Wahrheiten darin<br />
stehen.<br />
Frau Schiessl, unsere <strong>Preis</strong>trägerin für die Reportage, hat gerade zu Recht<br />
neben mir gesagt: „Göttlich!“. Ja – so sieht toller Meinungsjournalismus aus.<br />
So sind Diamanten: hart, glänzend, funkelnd. So sieht aufrüttelnder Journalismus<br />
aus.<br />
Der Meinungsjournalismus steht ja immer in der Gefahr belehrend zu sein,<br />
oberlehrerhaft daher zu kommen. Tom Schimmeck ist das allerbeste Beispiel<br />
dafür, dass das überhaupt nicht sein muss. Wenn man seine Sache gut macht,<br />
ist überhaupt nichts Oberlehrerhaftes dabei. Dann liest man, glucksend vor<br />
Vergnügen.<br />
Lieber Kollege Schimmeck, Sie sind ein Kommentarissimus und dazu<br />
beglückwünsche ich Sie sehr.«<br />
Vorgetragen von Dr. Heribert Prantl<br />
87
RECHERCHE-STIPENDIEN
Katrin Blum<br />
Thomas Schuler<br />
Martin Sehmisch
91<br />
Katrin Blum<br />
Was kostet das Leben –<br />
oder sind wir vor dem Tode<br />
wirklich alle gleich?
Zitat aus dem Exposé:<br />
Was kostet das Leben – oder sind wir vor dem Tode wirklich alle gleich?<br />
„Zwei Menschen bekommen eine Nachricht: Sie haben nur noch kurze Zeit zu<br />
leben. Sie haben die gleiche Krankheit, die gleiche Diagnose, beide haben Familie<br />
– und auf beide wartet der Tod. Der Unterschied: Der eine ist reich, der andere<br />
arm. Wie reagieren beide auf diese Nachricht? Was wünschen sie in den letzten<br />
Wochen oder Monaten ihres Lebens zu tun? Und was tun sie letztendlich wirklich?<br />
Die zentralen Fragen:<br />
• Ist Gesundheit das höchste Gut?<br />
• Kann man Gesundheit kaufen?<br />
• Wird der reiche Mensch länger leben?<br />
• Wird das Leben im Angesicht des Todes anders gestaltet?<br />
In den letzten Jahren hat sich die Versorgung durch die Krankenkassen erheblich<br />
verändert. Versicherte müssen immer mehr selbst zahlen und eine Zweiklassengesellschaft<br />
hat sich etabliert. Schlagworte wie Unterschicht und Oberschicht<br />
werden in diesem und anderen Zusammenhängen des gesellschaftlichen Lebens<br />
immer wieder benutzt.<br />
Meine Arbeit, eine Reportage, soll dieses Problem anhand von echten Menschen<br />
– keinen Statistiken – darstellen. Dabei will ich herausfinden, wie sich Geld auf<br />
Leben und Tod auswirkt.“<br />
92
Katrin Blum<br />
Geboren 1977 in Hannover<br />
Werdegang:<br />
• freie Mitarbeit bei NEON, Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung<br />
• 2005 - 2006 Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule,<br />
München<br />
• 2005 - 2006 Aufbaustudium zur „Diplom-Journalistin postgrad.“<br />
an der Ludwigs-Maximilians-Universität, München<br />
• 1999 - 2004 Studium der Anglistik , Kommunikationswissenschaft und<br />
Psychologie an den Universitäten Bamberg, Duisburg-Essen,<br />
Essen und Düsseldorf<br />
• 1999 Hospitanz bei der „Akademie Bildsprache“, Hamburg<br />
Praktika:<br />
Westdeutsche Zeitung, Lift (Stuttgart), Online-Redaktion der Herald Sun<br />
(Australien), The West Australian (Australien), freundin, Stuttgarter Zeitung, GEO<br />
93
95<br />
Thomas Schuler<br />
Softpower –<br />
zum Einfluss der Stiftungen<br />
in Deutschland
Zitat aus dem Exposé:<br />
Softpower – zum Einfluss der Stiftungen in Deutschland<br />
„Die Bertelsmann Stiftung ist einflussreich und mächtig. Sie ist die größte operative<br />
Stiftung in Deutschland. Operativ heißt, sie fördert kaum Projekte anderer<br />
Einrichtungen und Personen, sondern sie ist selbst aktiv. Sie ist mit ihrer Arbeit<br />
nicht nur führend in Deutschland; sie sieht sich als einzigartig und das zu Recht.<br />
Sie verfügt über ein Monopol. Sie ist eng verzahnt mit Politik, Wirtschaft und<br />
Gesellschaft. Ihre rund 300 Mitarbeiter spüren weltweit Trends auf, analysieren<br />
sie und geben Empfehlungen, die sie – in Berlin oder Brüssel – mit Spitzenbeamten<br />
und Politikern aller Parteien in exklusiven Zirkeln diskutieren (ausgenommen<br />
die Linkspartei).<br />
Die Stiftung bringt alle Einflussreichen an einen Tisch und bestimmt die Tagesordnung.<br />
Sie macht Politik, sei es in der öffentlichen Verwaltung, in der<br />
Bildungs-, der Arbeitsmarkt-, der Gesundheits-, der Stiftungs- oder in der<br />
Außenpolitik. Sie nennt es aber Beratung und übernimmt deshalb für Fehler keine<br />
Verantwortung. Unabhängigkeit in inhaltlicher und finanzieller Sicht ist ihr<br />
wichtig. Sie behauptet, das sei die Voraussetzung für den Erfolg ihrer Arbeit.<br />
Aber sie ist auch unabhängig von Aufsicht und Kontrolle. Sie ist steuerbegünstigt,<br />
aber sie ist nicht demokratisch legitimiert. [...]<br />
Wie könnten Stiftungen demokratischer werden ohne ihre Unabhängigkeit aufzugeben?<br />
Wie könnten die Bürger, von denen die Leiter der Bertelsmann Stiftung<br />
gerne sprechen, an ihrer Arbeit und Aufsicht beteiligt werden?“<br />
Diesen und mehr Fragen möchte Thomas Schuler nachgehen und die Bertelsmann<br />
Stiftung mit ihrem Einfluss auf Staat, Politik und Gesellschaft darstellen.<br />
Seine Arbeit soll jedoch nicht auf einer Ablehnung des Stiftungsgedankens<br />
fußen und sie strebt keine Generalabrechnung mit dem Stiftungswesen an, sondern<br />
ihr liegt der Gedanken zugrunde, dass Stiftungen wichtige Arbeit leisten,<br />
die mehr Aufmerksamkeit, Kontrolle und Debatte verdient.<br />
96
Thomas Schuler<br />
geboren 1965 in Ingolstadt,<br />
Journalist<br />
Werdegang:<br />
• Ab 2000 zusätzlich Medienkolumnist der „ZEIT“<br />
• Ab 1999 Medienredakteur der Berliner Zeitung<br />
• 1996/97 Abschluss an der Journalism School,<br />
Columbia University of New York City<br />
• 1994 bis 1996 Stipendium der Süddeutschen Zeitung für eine<br />
wissenschaftliche Arbeit über die Reform der UN und UN-Korrespondent für<br />
diverse Publikationen<br />
• 1992/93 Redakteur der Süddeutschen Zeitung (Medien) in München<br />
• 1989 Studium der Politikwissenschaften in München und Mitarbeit bei ZDF<br />
und BR<br />
• 1986/87 Volontariat beim Donaukurier (Ingolstadt)<br />
Veröffentlichungen:<br />
• 1999 „Die Dorfbewohner des Big Apple. New Yorker Sidesteps“<br />
• 1999 „Boulevard der tausend Kulturen. Szenen aus Los Angeles“<br />
• 2000 „Das Leben war ein Pfeifen. Kubanische Fluchten“<br />
• 2002 „Selbst der Friseur ist Diplomat. Die UNO in New York“<br />
• 2003 „Immer im Recht. Wie Amerika sich und seine Ideale verrät“<br />
• 2004 „Die Mohns. Die Familie hinter Bertelsmann“<br />
• 2006 „Strauß – Biografie einer Familie“<br />
• <strong>2007</strong> Einer der Autoren des Sammelbandes „Die Alphajournalisten“<br />
97
Martin Sehmisch<br />
Unkontrollierte Macht?<br />
Wie die Monopolstellung einer lokalen<br />
Tageszeitung die politische Landschaft verändert –<br />
und wie sich Widerstand formiert.<br />
99
Zitat aus dem Exposé:<br />
Unkontrollierte Macht? Wie die Monopolstellung einer lokalen Tageszeitung<br />
die politische Landschaft verändert – und wie sich Widerstand formiert.<br />
„Als im August <strong>2007</strong> der Altverleger der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen<br />
(HNA), Rainer Dierichs, im Alter von 68 Jahren einer Krankheit erlag,<br />
schalteten dutzende Kasseler Bürger aus dem Kulturleben und der politischen<br />
Öffentlichkeit eine gemeinsame Todesanzeige: ,Wir trauern um einen großen<br />
Freund und Förderer des kulturellen und sozialen Lebens in Kassel.’ Auch der<br />
Betriebsrat kondolierte und betonte den zeitlebens fairen Umgang des Verlegers<br />
mit der Belegschaft. Dierichs hatte sich bei vielen einen Namen gemacht – und<br />
hielt die HNA bis zu ihrem Verkauf an ihren neuen Verleger Dirk Ippen auf<br />
ausgewogenem Kurs.<br />
Fraglich, ob Ippen, der die Tageszeitung im Jahr 2002 übernahm und seitdem<br />
einen eisigen Sparkurs fährt, ähnliche Sympathien entgegenschlagen, wie sie<br />
Dierichs stets genoss. Das liegt nicht nur an der von ihm forcierten inhaltlichen<br />
Ausdünnung der HNA – bunte Bilder von Volksfesten wurden immer wichtiger,<br />
während soziale Fragen lange ignoriert wurden und die politische Berichterstattung<br />
hauptsächlich im Skandalisieren der Verfehlungen Einzelner besteht.<br />
Das Misstrauen, dass Ippen und der HNA-Redaktion in Diskussionen entgegenschlägt<br />
hängt auch mit der Medienmacht zusammen, die sein Verlag in der Hand<br />
hält. [...]<br />
Es gilt als unmöglich, sich mit der HNA anzulegen. Kein Wunder, ist in der<br />
unmittelbaren Göttinger Nachbarschaft doch gerade ein Versuch gescheitert,<br />
das Zeitungs-Monopol zumindest in der als alternativ geltenden Studentenstadt<br />
zu durchbrechen. [...]<br />
Wie weit reicht die Macht einer lokalen Monopol-Tageszeitung? Welche Strategien<br />
entwickeln mit der Berichterstattung unzufriedene Akteure angesichts dieser<br />
Macht? Welche Formen der Infragestellung und der Gegeninformation werden<br />
angewendet und wie wirksam sind sie? Warum scheitern trotz offensichtlicher<br />
Unzufriedenheit alternative Projekte scheinbar von vorne herein?“<br />
100
Martin Sehmisch<br />
Geboren 1978 in Darmstadt<br />
Beruflicher Werdegang:<br />
• Seit Juli 2005: Chefredakteur der Nordhessischen Neuen Zeitung<br />
• April 1999 bis November 2001: Freie Mitarbeit bei der Hessischen/Niedersächsischen<br />
Allgemeinen (HNA)<br />
• Januar 2000 bis April 2005: Ehrenamtliche Mitarbeit im Freien Radio Kassel<br />
• November 2001 bis März 2002 und April 2003 bis Februar 2004:<br />
Öffentlichkeitsarbeit für den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der<br />
Universität Kassel<br />
• Seit Oktober 2000: Magisterstudium der Politik- und Sozialwissenschaft an<br />
der Universität Kassel<br />
• August 2000: Erlangung der fachgebundene Hochschulreife durch erfolgreiches<br />
Grundstudium Sozialwesen an der Universität Kassel<br />
Berufserfahrungen:<br />
• Redaktionsleiter bei der IG Metall-Publikation Nordhessische Neue Zeitung<br />
• Freie Mitarbeit bei der Hochschulzeitung Publik und dem Hessischen Landesdienst<br />
der dpa<br />
• Medienpädagogische Tätigkeit für das Bildungszentrum Bürgermedien<br />
101
VERÖFFENTLICHUNGEN<br />
STIPENDIEN
Astrid Geisler<br />
Boris Kartheuser<br />
Melanie Zerahn
104
105<br />
Astrid Geisler<br />
Das vergessene Land<br />
die tageszeitung (taz), 8./9. April 2006<br />
Interview mit Astrid Geisler
Das vergessene Land<br />
Recherchestipendium 2005<br />
In Ostvorpommern sind Neonazis die netten Jungs von nebenan. Ihr Kapital:<br />
Bürger, die vom Staat nichts mehr erwarten.<br />
Am Ende der Sackgasse wird renoviert. Wer über die buckelig gepflasterte Allee<br />
ins Dorf holpert, erkennt es von weitem. Grau liegt die Siedlung da unter dem<br />
fahlen Mittagshimmel, nur eine einzige Fassade leuchtet. Ein kleiner Flachbau<br />
aus DDR-Zeiten, himmelblau, frisch gestrichen – das Jugendhaus von Bargischow.<br />
Auf dem Nachbargrundstück geht die Tür auf. Eine junge Frau blickt herüber<br />
aus der stillgelegten Dorfkita. „Das haben die Glatzen gemacht“, sagt sie. „Das<br />
Jugendhaus ist deren Ding.“ Es klingt nebensächlich. Hinter ihr im ehemaligen<br />
Gemeinschaftssaal sitzt ein Mann um die zwanzig und schweigt. Er ist tief in den<br />
Stuhl gerutscht, sieht nach unten auf seine kräftigen, tätowierten Arme.<br />
Die beiden sind Kollegen und bei der Arbeit hier, den ganzen Tag schon: sie als<br />
1-Euro-Jobberin, er als ABM-Kraft. Aber was heißt das schon? Ab und zu rauchen<br />
sie eine Marlboro aus Polen, trinken roten Saft aus der Einwegflasche. „Unsere<br />
Arbeit“, sagt die junge Frau zögernd, „im Moment ist unsere Arbeit, dass wir gar<br />
nichts machen.“ Ihr Kollege sagt nichts. Gut zwei Stunden noch, dann haben<br />
beide ihr Tagessoll erfüllt. Gewartet bis zum Feierabend.<br />
Beim Nachbarn kläfft der Hund. Sonst ist es still in Bargischow. Selbst der Platz<br />
vor der gotischen Feldsteinkirche liegt verlassen da. Eine Katze springt über die<br />
Straße, verschwindet zwischen Dorflinde und Kriegerdenkmal. Warum sollten<br />
Menschen auch vor die Tür gehen? Es gibt keinen Bäcker, keine Schule, keine<br />
Vereine mehr. Selbst das Wirtshaus macht nur noch ein paar Stunden die Woche<br />
auf. Hinter der Gemeinde beginnt das Stettiner Haff und dahinter Polen. Urlauber<br />
rauschen nur vorbei an dieser Gegend auf der Fahrt nach Usedom.<br />
Verfassungsschützer und Kriminalisten aber kennen den Ort. Bargischow ist<br />
eine jener Gemeinden im äußersten Nordosten, wo die NPD seit gut zwei Jahren<br />
einen Rekord nach dem anderen feiert. Bei der Bundestagswahl im Herbst<br />
106
kamen die Rechtsextremen auf 17,2 Prozent. So stark wollen sie überall werden<br />
in der Region. Die NPD arbeitet an einer weiteren Zone wie der Sächsischen<br />
Schweiz, jenem Landstrich südöstlich von Dresden, wo sie sich etabliert hat in<br />
Dörfern und Kleinstädten. Das soll auch in Ostvorpommern gelingen.<br />
Karl-Heinz Thurow versteht die Aufregung nicht. Der ehrenamtliche Bürgermeister<br />
von Bargischow sagt es noch auf dem Weg von der Haustür zum Küchentisch,<br />
bevor seine Frau den Kaffee angeboten hat. „Glauben Sie nicht, dass es rechtes<br />
Gedankengut immer gibt?“, fragt er gereizt. „Das ist eben eine Strömung. Die<br />
muss man akzeptieren. Es ist nun mal so. Die Rechten sind da.“<br />
Thurow sitzt in der Wohnküche seines reetgedeckten Hauses hinter der Dorfkirche.<br />
Auf dem Fensterbrett unter der Häkelgardine schnurrt die Katze. Als es<br />
die DDR noch gab, waren die Thurows überzeugte CDU-Mitglieder. Heute, mit<br />
49 Jahren, ist der Bürgermeister parteilos. Die Partei, die nicht mehr seine ist,<br />
hat eine große Initiative für Demokratie und Toleranz ausgerufen. Alle Bürgermeister<br />
sollen mithelfen, damit die NPD nicht in den Landtag einzieht bei den<br />
Wahlen im Herbst. Thurow hat es aus der Zeitung erfahren. Er fragt sich, was das<br />
soll. Über Hartz IV müssten die reden! „Das wird sich bei der Wahl durchschlagen.„<br />
Für wen, ist klar.<br />
Bargischow liegt fünf Kilometer östlich von Anklam. 420 Menschen, verteilt auf<br />
vier Dörfer. Jahrhunderte lebten die Weiler von dem, was Äcker und Wiesen hergaben,<br />
bis die Marktwirtschaft kam mit ihren neuen Gesetzen. Seither siechen<br />
sie. Man kann ebenso gut einige Kilometer weiter nach Westen fahren bis nach<br />
Postlow. In Postlow gewannen die Rechtsextremen bei der Bundestagswahl<br />
17,4 Prozent – mehr als in irgendeiner anderen Gemeinde Mecklenburg-<br />
Vorpommerns, mehr sogar als die örtliche SPD. In Schwerin war man entsetzt.<br />
In Postlow nicht mal überrascht. Norbert Mielke nimmt die braune Lederkappe<br />
ab und wiegt verzweifelt den Kopf. Landwirt ist er, Geflügelzüchter und nebenbei<br />
auch Bürgermeister von Postlow. „Frust ist das hier“, ruft Mielke. „Frust! Die Leute<br />
haben allen Parteien eine Chance gegeben. Aber es hat doch nicht eine mal<br />
107
einen Lösungsansatz fertig gebracht. Das haben die Leute hier auch kapiert.“ Er<br />
holt tief Luft. Das Thema, sagt er entschuldigend, das könne ihn „heiß machen“.<br />
Wer die Dorfstraße entlang geht, immer geradeaus, bis ganz ans Ende, bis zu<br />
Mielkes Hof, der ahnt, was den Bürgermeister umtreibt. Von der Landstraße<br />
führt der Weg vorbei an einer Villa mit Erker und Turmzimmer. In Bahnen blättert<br />
die Farbe ab. Aus den zerborstenen Fenstern wird niemand mehr herunterblicken<br />
auf die leere Straße. Viele solcher Fenster gibt es im Ort. Es sieht aus,<br />
als sei die Zeit weitergezogen und hätte Postlow zurückgelassen.<br />
Ein Mann zieht im Handkarren den Einkauf nach Hause. Kartoffeln, Apfelsinen,<br />
eine Kiste Bier. Gut drei Kilometer sind es von hier bis zum nächsten Supermarkt<br />
in Anklam, ein Klacks mit dem passenden Gefährt. Aber das Sozialgesetzbuch<br />
kennt keinen Anspruch auf ein Auto. Und die Postlower kennen den Aushang an<br />
der Bushaltestelle. Da steht: Abfahrt nach Anklam um 6.39 Uhr und um 16.53 Uhr.<br />
Früher gab es einen Konsum gegenüber. Das Schaufensterglas ist zur Hälfte herausgebrochen.<br />
„Laden geschlossen“, hat jemand auf einen Zettel geschrieben.<br />
Im Nachbarhaus der Mielkes, Dorfstraße 26, sind die Eingangstüren von Hand<br />
gearbeitet. Das Holz fault von unten weg. Die Bewohner beschweren sich nicht:<br />
Es sind nur noch Hühner.<br />
„Schauen wir uns doch mal um: Wer hat denn noch Arbeit hier?“, ruft Mielke.<br />
„Diese Statistiken, das ist doch Trickserei. Wir liegen hier inzwischen bei über<br />
50 Prozent Arbeitslosen, über 50 Prozent!“ Und dieses Gerede von Investoren,<br />
die kommen sollen mit viel Geld und viel Arbeit. „Vergessen Sie’s!“ Mielkes<br />
Familie lebt seit Generationen in Postlow. Früher, sagt Mielke, da sei Leben im<br />
Dorf gewesen, die Leute bekamen einen Besen in die Hand, mussten wenigstens<br />
den Hof fegen. „Heute, da gehen sie zur Sozialagentur und lassen sich von dem<br />
frischen Geld am nächsten Imbiss den Hals voll laufen.“<br />
Seine Lebensgefährtin kommt zur Tür rein, sie hat eine Schrippe in der Hand<br />
108
– für Mielkes Blutzuckerspiegel. Mielke beißt ab, schluckt hastig. Wo war er<br />
gleich stehen geblieben? „Der normale Mensch hier, der sagt sich – ja, die DDR<br />
war gut. Die war nur zu sozial, daran ist sie gescheitert.“ Er klingt matt. „Ich<br />
sag’s Ihnen, wir kriegen hier noch ‘nen neuen Kaiser. Dieser Staat, der geht<br />
schneller kaputt als die DDR.“<br />
Ostvorpommern zählt zu den Gegenden Deutschlands, die man in Statistiken<br />
meist am schlechten Ende findet. Mindestens jeder Vierte ist offiziell arbeitslos,<br />
Tendenz steigend. Die Einkommen liegen weit unter dem Bundesdurchschnitt. In<br />
den vergangenen fünf Jahren verlor der Kreis mehr als 3.500 Einwohner. Wer<br />
jung ist und anderswo eine Chance hat, der geht. Es bleiben die Alten und die<br />
aussichtslosen Fälle.<br />
Michael Andrejewski freut sich daran – wo sonst ist die Lage schon so schön<br />
trostlos? Der NPD-Politiker zog vor drei Jahren nach Anklam. Damals hatte er<br />
gerade das Jura-Examen bestanden. Nach 36 Studiensemestern und Jahren in<br />
ausländerfeindlichen Gruppen suchte er sein persönliches Testfeld, das ideale<br />
Gebiet für rechtsextreme Politik. Er entschied sich für Ostvorpommern. Die<br />
Gegend sei „freies Pionierland“ mit idealen Standortfaktoren, schwärmt der<br />
Lehrerssohn aus dem Schwarzwald: „Wenige Regionen sind so heruntergewirtschaftet.<br />
In kaum einer gibt es eine geringere Systembindung als hier. Die Leute<br />
hatten mal riesige Erwartungen, jetzt sind sie wahnsinnig enttäuscht.“ Die Enttäuschten<br />
sind seine Hoffnung. Er will ihr Vertrauen gewinnen, ihre Stimmen,<br />
ihre Region. Spätestens 2018 soll ein NPD-Bürgermeister ins Anklamer Rathaus<br />
einziehen. Das ist sein Ziel.<br />
Andrejewski sitzt im Einkaufszentrum am Markt. Ein Großteil der Ladenflächen<br />
steht leer. Sogar „Pfennigland“ hat kapituliert. An den Tischen des Bistros in der<br />
Eingangshalle warten schon vormittags Menschen vor leeren Gläsern, auf dass<br />
der Tag preisgünstig vorbeiziehe. Niemand schaut sich um nach dem schmächtigen<br />
Mann im grauen wattierten Anorak, der sein grob gemustertes Hemd bis<br />
zum obersten Knopf geschlossen trägt. Andrejewski kippt ordentlich Zucker in<br />
109
den Kaffee. Seine Augen flackern hinter den Brillengläsern. „Vermutlich ist das<br />
für Sie ein Kulturschock hier.“ Er grinst schräg: „War es für mich anfangs auch<br />
– nur eben positiv!“<br />
2004 gewann der Wessi bei der Kommunalwahl auf Anhieb acht Prozent der<br />
Stimmen und zwei Sitze im Stadtrat. Einer der Posten blieb unbesetzt. Außer ihm<br />
war kein NPDler angetreten. Dafür zog er gleich auch in den Kreistag ein. Bei der<br />
Bundestagswahl 2005 lief es noch besser. „Für das System muss das gruselig<br />
sein“, sagt er. „Es hat die Hauptarbeit schon gemacht. Wir müssen uns nur noch<br />
hinstellen und sagen: Da sind wir.“<br />
Nicht ganz. Intelligent und äußerst strebsam sei Andrejewski, sagen selbst seine<br />
Gegner im Stadtrat. Der Jurist arbeitet Vollzeit, staatlich finanziert. Er lebt in<br />
einer Plattenbausiedlung, oberster Stock, wo der Blick auf ein Heizwerk geht,<br />
auf ein Beerdigungsinstitut und die Wiese davor. Allein, von Hartz IV. Grundsätzlich,<br />
sagt der NPD-Mann, unterstütze er als Politiker alles, was „den Kollaps<br />
noch ein bisschen beschleunigt“. Je überschuldeter eine Gemeinde, desto besser.<br />
Zugleich wolle er „jeden Fußbreit Heimat“ verteidigen, jedes Krankenhaus, jede<br />
Stadtbibliothek, jeden Schulbus. Das kommt an bei den Wählern. Und, sagt<br />
Andrejewski: „Es soll noch möglichst viel Substanz übrig sein, wenn eines Tages<br />
das System weg ist.“<br />
Als Andrejewski nach Anklam kam, war die NPD unbedeutend. Aber es gab<br />
ambitionierte rechtsextreme Kameradschaften. Andrejewski suchte die Freundschaft<br />
der militanten Neonazis. „Ideologisch sind wir doch sowieso identisch“,<br />
sagt der NPD-Politiker. „Also habe ich mich einfach integriert.“ Im Namen der<br />
Kameraden leite er deren „Spezialtruppe für den Parlamentskram“.<br />
Verfassungsschützer halten die Neonazis für die wichtigste Größe im rechtsextremen<br />
Spektrum der Region. Ihre Strategien gelten in der deutschen Kameradschaftsszene<br />
als wegweisend. Die Wortführer begnügen sich nicht mehr mit der<br />
Arbeit in Untergrundzirkeln. Sie haben einen Volkstanzverein gegründet und<br />
110
eine Jugendgruppe, die Wanderungen und Ferienlager organisiert. Sie verlegen<br />
ein lokales Nachrichtenblatt, das kostenlos an 30.000 Haushalte verteilt wird.<br />
Sie treten bei Neonazi-Demonstrationen im ganzen Bundesgebiet auf. Der Dachverband<br />
„Soziales und Nationales Bündnis Pommern“ präsentiert auf einer<br />
schicken Internetseite beinahe täglich aktuelle Nachrichten. Wer die Website der<br />
CDU besucht, bekommt nur eine Fehlermeldung.<br />
Der Jurist aus dem Westen und die Landjugend – inzwischen nehmen auch die<br />
Volksparteien in der Gegend das Bündnis ernst. SPD, CDU und PDS kriegen in<br />
ganz Ostvorpommern gemeinsam etwa 15 junge Leute zusammen. In den rechtsextremen<br />
Kameradschaften der Region und ihren Satellitengruppen sind 200<br />
Nachwuchskräfte aktiv, schätzen Szenebeobachter. Die Jugendlichen ziehen von<br />
Haus zu Haus, stecken Informationshefte in die Briefkästen, besuchen Bürgerversammlungen.<br />
Andrejewski muss nicht über die Dörfer tingeln, nicht an<br />
Gartenzäunen für sein Projekt werben. Das erledigt die Jugend. Und niemand<br />
stört sie. Warum sollte er sie auch stören, fragt Karl-Heinz Thurow, der Bürgermeister<br />
von Bargischow. Die „rechten Jungs“ hätten bisher keinen Ärger gemacht.<br />
Und die NPD sei nicht verboten, sondern „eine Partei wie jede andere“.<br />
Umsturzpläne? Parteiengeschwätz, glaubt Thurow. Die einen schwafelten von<br />
Gerechtigkeit, die anderen vom Ende des Systems – was daraus werde, wisse<br />
man ja. Unlängst stellte Thurow den Jugendlichen den Flachbau am Dorfrand<br />
neben der stillgelegten Kita zur Verfügung. Damit sie nicht an der Bushaltestelle<br />
herumgammeln, sagt er. Auch seine Frau findet das richtig. Sie hat bis vor kurzem<br />
das Anklamer Sozialamt geleitet. Diese „Jungs“, sagt Frau Thurow, seien „wirklich<br />
keine dummen Leute“, es seien Jugendliche, die etwas erreichen wollten, und<br />
das Clubhaus hätten sie sich ganz alleine renoviert.<br />
Der Flachbau ist inzwischen über den Ort hinaus bekannt – als Neonazi-Treff. Die<br />
Neonazis haben natürlich auch einen Schlüssel. Er liegt gegenüber im Haus der<br />
Familie Roser. Das weiß jeder, auch die junge 1-Euro-Kraft, die nebenan in der<br />
stillgelegten Kita herumsitzt. Sie muss nur eine SMS schreiben, dann erscheint<br />
vor dem Haus der Roser-Sohn, ein kleiner, kräftiger Kerl um die zwanzig. Er will<br />
111
mit Journalisten eigentlich nichts zu tun haben, behält seinen Namen lieber für<br />
sich. „Egal, was wir hier machen. Ihr schreibt doch wieder nur: Da laufen braune<br />
Sachen“, brummelt er. „Dass wir auch den Rasen von der Kita im Sommer<br />
mähen, das würdet ihr doch zum Beispiel nie erwähnen.“ Dabei könne in den<br />
Jugendclub jeder rein: „Jeder, der will.“ Zum Beweis schließt er die Eingangstür<br />
auf, führt in einen unbeheizten Bar-Raum. Ein Kumpel mit lockigem Pferdeschwanz<br />
und ein Mädchen in Jeans und Rollkragenpulli folgen ihm. Fremde, die<br />
spontan an der Tür klopfen? Was soll das? Die drei wirken misstrauisch.<br />
Wer die Wortführer der Neonazi-Szene anruft und um ein Gespräch bittet, ahnt<br />
warum. Keine Chance, sagt selbst Tino Müller, der für die NPD in den Landtag<br />
einziehen will und als Sprecher der Bürgerinitiative „Schöner und sicherer wohnen“<br />
im benachbarten Ueckermünde offene Briefe unterzeichnet. Interviews mit<br />
der „Feindpresse“ sind in seinen Kreisen verpönt. Deren „Hetzjournalisten“,<br />
warnte das Neonazi-Magazin Volk in Bewegung kürzlich, seien „bewusst ausgewählte<br />
geistig-seelisch und körperlich minderwertige Menschen“. Jedes Gespräch<br />
mit ihnen unterstütze die „Totengräberarbeit am deutschen Volk“.<br />
Der Roser-Sohn macht sich erst mal eine Cola auf, lehnt sich an den Tresen, lässt<br />
den Schlüssel an einer groben Metallkette zappeln. Er trägt kurze braune Haare,<br />
Jeans, Turnschuhe. Ein unverdächtiges Outfit, stünde auf dem Pulli nicht „Die<br />
Liebenfels Kapelle“. Die Band hieß früher „Skalinger“, dann gab sie sich den<br />
Namen des Rassetheoretikers Jörg Lanz von Liebenfels. Auf ihren CD-Hüllen geht<br />
schon mal ein Hakenkreuz hinter dem Brandenburger Tor auf, sie singt Texte<br />
wie: „Auch mit Geld erkauft ihr keinen Freispruch für eure liebe Demokratie. Es<br />
wird nun nicht mehr lange dauern, bis der große Vorhang fällt. Nichts wird eure<br />
Ärsche retten, wenn sich das Volk gegen euch stellt.“<br />
Rechts und links, erklärt der Roser-Sohn, das spiele hier in der Gegend längst<br />
keine Rolle mehr. Im Übrigen sei das Problem doch, dass Jugendlichen nichts<br />
geboten werde. Früher, da habe es wenigstens beim Dorffest noch die ein oder<br />
andere Attraktion gegeben, Wettkämpfe wie „Aal-Greifen“. Selbst das sei vorbei.<br />
112
„Aber wenn jemand mal was organisiert, dann heißt es gleich: die rekrutieren!“,<br />
wirft der Kumpel ein. „Dabei – singen, tanzen, wandern, das ist doch nicht<br />
schlecht, oder?“<br />
Die Jungs blicken sich grinsend an. Singen, tanzen, wandern? Es gibt Fotos von<br />
Neonazi-Demos, wo man sie anders sehen kann: den Roser-Sohn im blauen<br />
T-Shirt mit dem Logo des Kameradschaftsbundes Ducherow. Auch den Zopfträger<br />
im Kapuzenpulli.<br />
Natürlich wird in den Dörfern über die „Jungs“ geschwatzt – so wie über jeden<br />
geschwatzt wird: Haben sie Arbeit? Wie laufen sie herum? Saufen sie zu viel?<br />
Prügeln sie sich? Rüdiger Thieme aus Postlow redet darüber. Offen. Das ist<br />
ungewöhnlich. Denn die meisten wollen ihre Meinung über den rechten Nachwuchs<br />
lieber nicht in der Zeitung lesen, schon gar nicht mit Namen. „Weiß ich<br />
nicht. Interessiert mich auch nicht“, sagen sie. „Man ist doch damit beschäftigt,<br />
über den Monat zu kommen.“ Oder: „Ich kenn’ viele, klar. Aber das ist deren<br />
Sache, ich sag da nichts zu.“<br />
Rüdiger Thieme, 35, bittet gleich ins Wohnzimmer. Mit seiner Bau- und Abrissfirma<br />
zählt der Unternehmer zu den Erfolgreichen im Ort, ein Kerl, groß und<br />
wuchtig, wie gemacht fürs harte Geschäft in harten Zeiten. Zupacken, machen,<br />
weitermachen, da hält er was drauf. Er findet, die „Jungs“ haben sich verändert<br />
in den letzten Jahren. Er meint: zum Positiven.<br />
Früher, da habe man kahle Schädel gesehen, Springerstiefel, Schlägereien. Das<br />
gebe es kaum noch. „Heute ist das friedlicher geworden. Normaler.“<br />
Die Thiemes haben es sich schön gemacht in ihrem blanken Neubau am Dorfrand.<br />
Blumengestecke zieren den Wohnzimmertisch, Tüllpüppchen die Couch.<br />
Einmal, erzählt Thieme, da hatte er einen Praktikanten. „Top Typ, sag ich ihnen.<br />
Der sagte mir irgendwann: Ick steh dazu. Der ging mal zu diesen Demos mit und<br />
so. Aber der sagte auch ganz klar: Keine Gewalt.“ Am Ende der Anekdote schaut<br />
113
Thieme zufrieden. „Das ist jetzt lockerer. Man spricht drüber und gut ist.“ Wie<br />
viele der Jugendlichen inzwischen so denken? „Über die Hälfte“, sagt er. Und<br />
nach einer kurzen Pause: „Ich bin überzeugt, das wird noch mehr.“<br />
Wenn man den Hausherren nach den Ursachen der politischen Entwicklung<br />
fragt, zögert er. Er sagt auch, warum: er will nicht als Rechtsradikaler dastehen.<br />
Schließlich erzählt er doch. Von den Umzügen, die seine Firma erledigt, einige<br />
auf Rechnung der Sozialkasse, auch für Ausländer. „Wenn ich das sehe“, sagt<br />
der Unternehmer: „Da sind Neger – die schönsten Klamotten, die Taschen voller<br />
Geld. Ich meine, die lassen sich den Bauch in der Sonne braun werden und kriegen<br />
noch den Umzug bezahlt.“ Für ihn steht fest, die NPD hat teilweise einfach<br />
Recht. „Ich sag mal: Ausländer raus!“, sagt Thieme.<br />
In Postlow kann Thieme das unbesorgt sagen. Es ist eine Meinung, die niemanden<br />
erstaunt. Wenige Kilometer weiter in Ducherow, wo die NPD zuletzt auf gut<br />
zwölf Prozent kam, verkauft der Dorfbäcker dunkelbraunes Mischbrot der Sorte<br />
„Glatze“. Auch normal. Der Bäcker denkt sich nichts dabei. „Keine Frage“, sagt<br />
der Postlower Bürgermeister Norbert Mielke. „Ich hab nix gegen Ausländer.<br />
Niemand hier hat etwas gegen einen Asylbewerber. Niemand. Aber irgendwann<br />
muss ja mal Schluss sein.“ Dass Leute jahrelang staatliche Unterstützung<br />
bekämen, ohne dafür zu arbeiten – wie solle er das Hartz-IV-Empfängern aus<br />
dem Dorf erklären, gestandenen Männern mit 30 Jahren Dienst im Kreuz?<br />
Im Landkreis leben kaum zwei Prozent Ausländer. Was aber sind Zahlen gegen<br />
ein Gefühl? Das Gefühl, abgeschrieben zu sein. Unverstanden. Die Fernsehnachrichten<br />
bestätigen es jeden Abend: Die Welt da draußen ist eine andere. Da wird<br />
gestritten, wie schnell Schröder wieder viele Jobs annehmen darf. Da eröffnet<br />
die Kanzlerin in der vorpommerschen Nachbarschaft die A 20, schwärmt von den<br />
großartigen Perspektiven für die Region. Perspektiven? Postlow liegt abseits der<br />
Strecke. Und es ist einfach, Postlow zu vergessen. Warum sollten die Menschen<br />
aus den Nachrichten ausgerechnet nach Postlow kommen? Es gibt ja nicht mal<br />
mehr etwas zu eröffnen.<br />
114
„Hier verwahrlost ein ganzer Landstrich“, sagt Günther Hoffmann. „In dieses<br />
Vakuum stoßen die Rechten. Die bürgerlichen Parteien haben versagt. Aber<br />
nicht nur die. Das Problem wird in Berlin völlig unterschätzt.“ Hoffmann kennt<br />
die rechtsextreme Szene in der Gegend wie kein Zweiter. Bis Januar hat er das<br />
Anklamer Büro des „Civitas“-Netzwerks geleitet, das von der Bundesregierung<br />
gefördert die Arbeit gegen Rechtsextremismus in Ostdeutschland unterstützen<br />
soll. Dann flog der Familienvater raus. Auch das ist Teil der Geschichte.<br />
Günther Hoffmann, ehemals Produktionsleiter am Berliner Schillertheater und<br />
Fachmann für Ökobaustoffe, kam Ende der Neunziger mit Frau und Kind nach<br />
Bugewitz, einen Weiler südlich von Bargischow. Nicht etwa, weil er Neonazis<br />
bekämpfen wollte. Er hatte sich bei einem Ausflug ans Haff verliebt – in die<br />
Landschaft und die Einheimischen, die ihn so offen empfingen. „Die Mentalität<br />
der Leute hier gefällt mir ausgesprochen gut“, sagt Hoffmann. „Das ist nach wie<br />
vor so.“ Es klingt trotzig. Er zieht kräftig an seiner Zigarette, Schwarzer Krauser<br />
selbst gedreht.<br />
Hoffmann sitzt im Dorfgasthof. Wie verkrüppelte Wachen säumen Bäume die<br />
Straße dorthin. Wildgänse schnattern. Harter Wind vom Haff drückt die Gräser<br />
zur Erde. Drinnen riecht es nach Zigarettenqualm und Bratfett. Man erkennt<br />
Hoffmann sofort zwischen den Einheimischen: ein hagerer Herr mit kinnlangem,<br />
grau meliertem Haar und Cordsakko. Er spricht halblaut.<br />
Hoffmann fallen auf Anhieb dutzende Gründe ein, warum es Neonazis in der<br />
Gegend so leicht haben. „Nach der Wende wurde versäumt, hier eine demokratische<br />
Kultur aufzubauen“, sagt er. Die Schule habe sich nach 1989 völlig entpolitisiert.<br />
Die Kirchen seien ein hermetischer Raum. Professionelle Jugendarbeit<br />
könne sich kaum ein Ort leisten. „Und die demokratischen Parteien“, sagt er,<br />
„sind in einem desolaten Zustand.“ Man hört unterdrückte Wut in seiner Stimme.<br />
„Eigentlich wäre hier ein Reeducation-Programm nötig.“ Sein süddeutscher<br />
Akzent gibt den Worten eine besondere Würze.<br />
115
Hoffmann wird als Fachmann für Rechtsextremismus auf dem Land inzwischen<br />
bis nach Bayern geladen. Ein Thema: „Allein auf weiter Flur“. Allein?<br />
Es gibt natürlich andere in der Region, die den Aufstieg der Rechtsextremen<br />
stoppen wollen. Aber außer dem gemeinsamen Gegner verbindet sie alle wenig.<br />
Zu wenig. Günther Hoffmann lebt bald zehn Jahre in Bugewitz. Er macht in der<br />
Freiwilligen Feuerwehr mit, er war Elternrat an der Schule, engagiert sich im<br />
örtlichen Kulturverein und in der Bürgerinitiative „Bunt statt Braun“ in Anklam.<br />
Er bleibt einer von außen. Hoffmann hat sich Feinde gemacht. Er war lästig. Er<br />
glaubt: es ging nicht anders. In vielen kleinen Orten sei inzwischen fast jeder mit<br />
einem Neonazi verwandt. „Das geht bis hinein in die Amtsverwaltungen. Oft sind<br />
die Überschneidungen zu groß, als dass die Bürgermeister offen agieren könnten.<br />
Die haben mir regelmäßig ganz deutlich gesagt: Das jetzt bitte nicht bekannt<br />
machen!“ Hoffmann aber hält nichts vom Verschweigen.<br />
Als Anfang des Jahres die Civitas-Stelle in Anklam wackelte, rettete der Landkreis<br />
das Projekt. Und warf als erstes Hoffmann raus. Sein Nachfolger sagte<br />
der Lokalzeitung, ihm sei von rechtsextremen Strukturen „wenig bekannt“. Die<br />
Neonazis frohlockten. Inzwischen ist die Stelle wieder ausgeschrieben.<br />
Über die Gründe schweigt der zuständige Vizelandrat. Er muss nichts fürchten.<br />
Bisher hat sich niemand in der Gegend lautstark für Hoffmann eingesetzt. Kein<br />
Pfarrer, kein Parteichef. Auch der Anklamer Bürgermeister nicht.<br />
Der heißt Michael Galander und sagt: „Ich will der NPD nicht die Plattform bieten,<br />
die sie gerne hätte. Ich kümmere mich lieber um Wirtschaft und Arbeit.“ Galander<br />
wurde 2002 als parteiloser Jungunternehmer ins Anklamer Rathaus gewählt.<br />
Seine Verheißung: er wollte die insolvente Kreisstadt sanieren, so erfolgreich<br />
wie er seine Baufirma in Anklam hochgezogen hatte. Seine Firma meldete kürzlich<br />
Insolvenz an. Im Rathaus ist die Lage kaum erfreulicher. „Wir sind hier nicht<br />
in Pessimismushausen“, sagt Galander. Aber wenn er vom Schreibtisch aus dem<br />
Fenster blickt, sieht er: vor dem Einkaufszentrum gegenüber kippen sich Männer<br />
116
Dosenbier in den Rachen. Rechts fehlt die gesamte Häuserflanke. Abgerissen.<br />
Dahinter Wohnblocks mit leeren Fenstern, die aussehen, als warteten sie nur<br />
noch auf die Bagger.<br />
Galander spottet über das ausländerfeindliche Gerede seiner Wähler: „Hier haben<br />
17 Ausländer eine Dönerbude, 15 putzen Toiletten. Da können doch keine Jobs<br />
freiwerden!“ Im Stadtparlament hat er die meisten Abgeordneten inzwischen<br />
gegen sich. Sie werfen ihm vor, er habe tausende Euro für Dienstreisen verschleudert.<br />
Er fühlt sich ausgebremst von ihrem „fast grenzenlosen Halbwissen“.<br />
Galander lacht gallig, wenn er an die Stadtratssitzungen denkt. Da sitzt der NPD-<br />
Mann Andrejewski im Rund – und profitiert von den Feindseligkeiten. Die Mehrheiten<br />
sind knapp, notfalls nehmen die Kollegen auch mal seine Stimme mit.<br />
Andrejewski trete „gepflegt, relativ sachlich, relativ zurückhaltend“ auf, sagt der<br />
Bürgermeister. „Es wäre schön, wenn die anderen wenigstens kurze, knappe<br />
Stellungnahmen halten könnten. So wie der.“ Galander verzieht gequält das<br />
Gesicht. „Manchmal träume ich hier inzwischen von einer Demokratur.“<br />
Er muss sich kurz entschuldigen. Sein Telefon bimmelt. Es spielt das Deutschlandlied.<br />
117
Interview mit Astrid Geisler, Theodor Wolff-<strong>Preis</strong>trägerin ‘08<br />
Ist Rechtsextremismus ein vergessenes Thema?<br />
Sie sind „die best informierte NPD-Expertin des Landes“ genannt worden, die<br />
die „Tricks der Rechten“ durchschaue. Ist das für Sie nun Ansporn oder Bürde?<br />
Das ist zunächst mal übertrieben und missverständlich. Es stimmt, dass ich gern<br />
recherchiere und generell den Ehrgeiz habe, mehr herauszufinden als andere.<br />
Weil die taz Rechtsextremismus sehr prominent behandelt, konnte ich mich<br />
dem Thema stärker widmen als viele andere Journalisten. Mein Fokus liegt aber<br />
nicht auf der NPD. Viel spannender finde ich die sozialen und gesellschaftspolitischen<br />
Fragen, die das Thema birgt. Und ich schreibe ebenso gern auch über<br />
andere Themen.<br />
Den prämierten und in der taz veröffentlichten Artikel haben Sie „Das vergessene<br />
Land“ genannt. Ist Rechtsextremismus auch das vergessene Thema?<br />
Nein. Es ist aber stark von Hypes abhängig, ob und wie groß darüber berichtet<br />
wird. Insgesamt finde ich die Berichterstattung zu stark auf Ereignisse fixiert, die<br />
auf den ersten Blick empörend und dramatisch wirken: Jemand wird ins Koma<br />
geprügelt oder ein NPD-Mann sagt etwas, das als skandalös gilt. So gehen die<br />
eigentlich brisanten Entwicklungen leicht unter. Denn die taugen häufig nicht für<br />
knallige Berichte. Im Gegenteil: die Realität ist oft sehr unaufgeregt. Genau das<br />
wollte ich auch mit meiner Reportage zeigen.<br />
Sie haben zusammen mit dem Fotografen Christian Jungeblodt vier Wochen lang<br />
in Ostvorpommern für Ihren Artikel recherchiert. Wie haben Sie sich den Menschen<br />
dort genähert? Wo haben Sie Ihre Gesprächspartner gefunden?<br />
Wir hatten beide ein Stipendium und mussten deshalb nicht mit dem knappen<br />
Zeit- und Geldbudget klarkommen, das einem normalerweise bei einer Tageszeitung<br />
zur Verfügung steht. Deshalb konnten wir anders recherchieren. Wenn man<br />
in der Gegend wohnt, jeden Morgen am gleichen Kiosk die Zeitung holt, wenn<br />
man die Zeit hat, einfach mal so mit ABM-Kräften am Kaffeetisch zu schwatzen,<br />
dann ergeben sich daraus eigene Möglichkeiten. Jemand ruft seinen Nachbarn<br />
118
an und sagt: „Du, die von der Zeitung sind wieder da, dürfen die auch mal mit<br />
Dir reden?“ Wichtig war auch der örtliche Mitarbeiter des Civitas-Netzwerks<br />
gegen Rechts. Der konnte uns Informationen geben, die wir vom Verfassungsschutz<br />
nie bekommen hätten.<br />
Wie haben Ihre Gesprächspartner auf die taz-Redakteurin aus Berlin reagiert?<br />
Viele Leute waren absolut überrascht, dass sich jemand aus der Hauptstadt<br />
wirklich für ihre Lage interessiert und länger als ein paar Stunden bleibt. Deren<br />
Erfahrung war: Aus Berlin oder Schwerin kommt bestenfalls mal wer, wenn Wahlkampf<br />
ist oder ein Minister irgendetwas eröffnen darf. Für wen wir arbeiten, war<br />
vielen gar nicht so wichtig. Eine Ausnahme war die Anklamer Polizei, die wollte<br />
bis zuletzt überhaupt nicht mit mir über das Thema reden.<br />
Entwickelt man während einer solch langen Recherche so etwas wie Verständnis<br />
für Menschen, die aus Protest oder auch Resignation bei Wahlen ihr Kreuz bei<br />
der NPD machen?<br />
Der Blick verändert sich, wenn man ein paar Wochen in Bugewitz bei Ducherow<br />
bei Anklam lebt. Ich habe irgendwann selbst gedacht: Wieso kommt nicht mal<br />
jemand aus Berlin vorbei und schaut sich das hier an? Ich konnte die Wut der<br />
Leute verstehen, die sich von der Bundes- und Landespolitik vergessen fühlen.<br />
Deshalb muss man trotzdem nicht die NPD wählen.<br />
In welcher Rolle sehen Sie sich selbst? Sie halten sich im Text mit Werturteilen ja<br />
weitgehend zurück und lassen viele Aussagen für sich stehen.<br />
So war das auch gedacht. Christian Jungeblodt und ich wollten gemeinsam ein<br />
Panorama der Gegend zeichnen, in dem die Menschen möglichst für sich selbst<br />
sprechen. Unser Ziel war: Gerade die so genannten einfachen Menschen, die<br />
also kein Amt innehaben, sollen sich nicht bloßgestellt fühlen.<br />
119
NPD-Lokalpolitiker wie Michael Andrejewski haben mit Ihnen ganz offen über<br />
ihre Ziele und Visionen gesprochen. Ist das Unbedarftheit oder Kalkül?<br />
Ich würde sagen: Kalkül und Selbstbewusstsein. Andrejewski kann ruhig sagen,<br />
er arbeitet auf den Umsturz hin. Es passiert ihm nichts deswegen. Im Übrigen<br />
zeigt der Text ja, wie erfolgreich die Rechtsextremen in Ostvorpommern sind.<br />
Ganz unabhängig davon gilt bei vielen NPDlern aber auch die Maxime: Besser<br />
schlechte Presse als gar keine Presse.<br />
Die Mitglieder der rechtsextremen Kameradschaften haben sich Ihnen dagegen<br />
entzogen. Gab es auch Drohungen oder Einschüchterungsversuche Ihnen gegenüber?<br />
Einige Neonazikameradschaften verfolgen die Strategie zusammen, die ‚Feindpresse’<br />
zu boykottieren und stattdessen über eigene Kanäle an ihre Klientel<br />
heranzutreten. Wir wurden aber absolut in Ruhe gelassen – auch aus Kalkül,<br />
würde ich sagen. Der lokale NPD-Mann hat explizit gesagt: Die Medien warten<br />
doch nur darauf, dass einer von uns gewalttätig wird. Den Gefallen tun wir Euch<br />
nicht. Trotzdem war ich froh, meist mit einem 1,90 m großen Fotografen unterwegs<br />
zu sein.<br />
Ihr Artikel wurde erst mit Hilfe eines Stipendiums der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
unter Begleitung von „netzwerk recherche e. V.“ ermöglicht, die „taz“ selbst<br />
hätte das Projekt wohl nicht finanzieren können. Sparen Medien heute am<br />
falschen Ende?<br />
Der taz kann man das kaum vorwerfen, die muss an allen Enden sparen. Aber<br />
bei den meisten Tageszeitungen ist es ja ähnlich undenkbar, mal einige Wochen<br />
für eine Recherche abzutauchen. Das hat gar nichts mit dem Thema zu tun. So<br />
fehlen bestimmte Texte und das ist schlecht. Immerhin hatte die taz aber den<br />
Mut, mit dem damals absolut exotischen Thema Ostvorpommern die Seite eins<br />
aufzumachen. Das hätten sich andere Redaktionen nie getraut.<br />
120
Sind Sie nach Erscheinen des Artikels noch einmal in die Orte, in denen Sie<br />
recherchiert haben, zurückgekehrt?<br />
Bisher einmal. Zur Landtagswahl im letzten Herbst war ich in Postlow. Dort hatte<br />
die NPD schon bei der Bundestagswahl den Vogel abgeschossen. Dass das Resultat<br />
wieder heftig würde, war absehbar. Trotzdem war außer mir kein Reporter da.<br />
Es war beinahe familiär im Wahllokal, der Bürgermeister hat dem Fotografen und<br />
mir sogar Schokoladenpudding spendiert. Just Postlow sollte dann alle Rekorde<br />
brechen mit mehr als 38 Prozent NPD-Stimmen. Daraufhin setzte der übliche<br />
Medienansturm ein. Einige Zeitungen schrieben, die Leute seien zugeknöpft und<br />
abweisend. Mir kam das ungerecht vor.<br />
Das Interview führte Christian Meier.<br />
Veröffentlicht im „Jahrbuch für Journalisten 2008“,<br />
Verlag Johann Oberauer GmbH, A-Salzburg<br />
zum Theodor Wolff-<strong>Preis</strong> ‘08.<br />
121
122
123<br />
Boris Kartheuser<br />
Der gläserne Fan<br />
Die Zeit, 07. Februar 2008
Der gläserne Fan<br />
Recherchestipendium 2006<br />
Beim FC Bayern bezahlen viele Stadionbesucher per Funkchip.<br />
Was passiert mit den Daten?<br />
Tom Sesto ist ein ruhiger Mensch. Wenn der 35-jährige Religionslehrer spricht,<br />
dann wählt er seine Worte mit Bedacht. Es fällt schwer zu glauben, dass derselbe<br />
Mensch Woche für Woche von einer Leidenschaft gepackt wird, die ihn schreien,<br />
jubeln und manchmal auch verzweifeln lässt. Sesto ist seit 28 Jahren Fan des<br />
Fußballvereins FC Bayern München. Deshalb hat er auch eine Dauerkarte für die<br />
Südkurve der Allianz-Arena. Dort, wo die Stimmung während der Spiele hochkocht,<br />
wo singende Fans, Fahnen und Transparente das Stadionbild prägen.<br />
Seit der FC Bayern seine Spiele in der Arena austrägt, seit zweieinhalb Jahren<br />
also, hat sich einiges geändert. Manches davon lässt sich schwer greifen, anderes<br />
umso mehr. Mit dem Umzug hat sich der FC Bayern nämlich an die Spitze einer<br />
technischen Revolution gesetzt, für die die Abkürzung RFID steht. Die sogenannte<br />
Radiofrequenz-Identifikation ist eine Funktechnik, die ein berührungsloses Auslesen<br />
winziger Computerchips ermöglicht. Genau deshalb ist diese Technik unter<br />
Datenschützern sehr umstritten.<br />
Bier oder Fanschal: Wer etwas kauft, kann elektronisch erfasst werden<br />
Beim FC Bayern wurde der nach außen nicht sichtbare Chip unter anderem in<br />
1,4 Millionen sogenannte ArenaCards eingebaut. Diese erinnern vom Aussehen<br />
an eine ec-Karte. Einmal an einer der zahllosen „Aufwertstationen“ aufgeladen,<br />
ermöglicht sie in der gesamten Arena bargeldlosen Geldverkehr. Dazu muss der<br />
Stadionbesucher die Karte lediglich auf eins der mausgrauen Lesegeräte legen,<br />
und schon wird der entsprechende Betrag abgebucht. Jeder Getränkeausschank,<br />
Fanshop oder sonstige Laden ist an das System angeschlossen. Zusätzliche Verwendung<br />
findet es beim Park- und Kassensystem. Nur im stadioneigenen<br />
„Restaurant à la Carte“ ist sie nicht einsetzbar. Für die Allianz Arena Payment GmbH<br />
gehören damit Wechselgeldprobleme oder Kassendifferenzen der Vergangenheit<br />
an. Jeder Zahlvorgang wird präzise erfasst, verbucht und ausgewertet. Auch die<br />
Warteschlangen sind kürzer geworden, weil das Suchen nach Kleingeld entfällt.<br />
124
Ausgereifte RFID-Systeme in der Industrie können Informationen annähernd<br />
zehn Meter weit übertragen. Bei der Münchner Karte beträgt die Reichweite des<br />
eingesetzten Transponders rund zehn Zentimeter. Da jeder Chip eine weltweit<br />
nur einmal vergebene Seriennummer erhält, sind Verwechslungen so gut wie<br />
unmöglich.<br />
Dauerkartenbesitzer wie Tom Sesto benötigen die ArenaCard nicht. Bei ihnen ist<br />
der Bezahlchip in die persönliche Jahreskarte integriert. Das wirft datenschutzrechtliche<br />
Probleme auf. Schließlich lassen sich durch die Kombination von<br />
Dauerkarte und Chip komplette Konsumbilder erstellen – und in begrenztem<br />
Maße auch Bewegungsprofile. Der FC Bayern kann seine 36.000 Dauerkartenkäufer<br />
durchleuchten: Wer erwirbt welches Produkt? Und wo kauft er es? Für die<br />
Betreiber des Bezahlsystems wäre es ein Leichtes, derartige Daten zu sammeln.<br />
Und sie anschließend an Sponsoren zu veräußern. Oder künftig nur den<br />
konsumstärksten Kunden Dauerkarten zu geben.<br />
Patentanträge für ein solches Ausspionieren der Kunden liegen seit Jahren vor.<br />
So möchte sich IBM in den USA die Idee schützen lassen, sämtliche Konsumgewohnheiten<br />
einer Person mit Hilfe von RFID zu erfassen. Dazu sollen alle Chips,<br />
die einer bestimmten Person zugeordnet werden können, konstant ausgelesen<br />
werden. Ganze Städte würden zu diesem Zweck mit Lesegeräten versehen. Von<br />
der Einkaufsmeile bis zur Bushaltestelle. Auch „Sportarenen“ sind im Patentantrag<br />
vorgesehen. Der Wert der dabei gewonnenen Daten wäre enorm. Wie das<br />
Wirtschaftsmagazin Capital errechnete, liefern heute allein die vier größten<br />
Auskunfteien der Wirtschaft jährlich mehr als 140 Millionen Datensätze über<br />
Verbraucher an die Werbeindustrie. Die Ausgaben für das darauf aufbauende<br />
Direktmarketing beliefen sich in Deutschland im Jahr 2005 auf gut 45 Milliarden<br />
Euro. Der Grundgedanke dahinter: Je besser man die Kunden kennt, desto<br />
gezielter kann man sie ansprechen.<br />
Das ebenfalls mögliche Erstellen von Bewegungsmustern sorgt gerade im Fußball<br />
für hitzige Diskussionen. So hatte das Organisationskomitee der Fußballwelt-<br />
125
meisterschaft 2006 in Abstimmung mit dem Bundesinnenministerium sämtliche<br />
Eintrittskarten mit einem Funkchip versehen lassen. „Der Sicherheit halber“,<br />
sagte der damalige Minister <strong>Otto</strong> Schily. Der Chip unterstütze die Trennung<br />
rivalisierender Fangruppen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar ist<br />
anderer Meinung: „Im Nachhinein ist festzustellen, dass die Personalisierung<br />
der WM-Tickets kaum mehr Sicherheit gebracht hat.“ Er rate deshalb davon ab,<br />
so etwas auch für andere Sportveranstaltungen einzuführen.<br />
Doch wie sieht es konkret aus im Fall der Allianz-Arena? Vom Vorstand des Vereins<br />
eine Antwort auf diese Frage zu erhalten scheint unmöglich. E-Mails werden<br />
nicht beantwortet, in Telefonaten wird um Sendung weiterer EMails gebeten,<br />
und gesendete Faxe sind nicht mehr auffindbar. Terminabsprachen werden<br />
mehrmals gebrochen. Das aktuelle Tagesgeschäft lasse für ein Befragen des Vorstands<br />
keine Zeit, teilt die Presseabteilung letztlich mit. Auf erneute Nachfrage<br />
erklärt man sich bereit, ein paar Fragen von der Abteilung für Ticketsysteme und<br />
den Mitgliederservice schriftlich beantworten zu lassen. Nein, die Chipkartenanwendung<br />
werde für keinerlei Marketinganalysen oder jegliche andere Auswertung<br />
von Käuferaktivitäten genutzt, teilt Abteilungsdirektor Manfred Angermeyer<br />
mit. Und nein, zusätzliche Funktionen zu den bekannten Bezahlmöglichkeiten<br />
seien auch nicht geplant – zumindest derzeit.<br />
Ob dies den Tatsachen entspricht, ist Manfred Ilgenfritz von der zuständigen<br />
bayerischen Datenschutzaufsichtsbehörde nicht bekannt. Man habe weder<br />
Kenntnisse über die Position der Lesegeräte noch über die Verwendung der Daten.<br />
Eine Prüfung vor Ort sei nicht erfolgt und auch nicht vorgesehen. Wenige Tage<br />
später teilt die Behörde mit, man habe den Datenschutzbeauftragten der Allianz-<br />
Arena kontaktiert. Der habe versichert, dass die Zahlungsdaten der ArenaCard<br />
weder zur Profilbildung herangezogen noch an Sponsoren weitergegeben würden.<br />
Der Religionslehrer sieht einen Fall von Sippenhaft<br />
Eine zumindest fragwürdige Vorgehensweise ist das, wenn sich der Betreiber<br />
der Arena seine Unbedenklichkeit selber bescheinigen darf. Die entscheidende<br />
126
Frage umgeht der FC-Bayern-Mann Angermeyer: Die anonym nutzbare Arena-<br />
Card ist weniger heikel als die personalisierte Dauerkarte. Dazu aber sagt<br />
Angermeyer der Datenschutzbehörde nichts.<br />
Tom Sesto ist verunsichert. „Es fällt mir schwer zu glauben, dass der Verein oder<br />
die Betreibergesellschaft der Allianz-Arena mit Hilfe des RFID-Chips Daten<br />
sammeln. Andererseits ist mir bekannt, dass der FC Bayern München bereits seit<br />
Jahren auffälliges Interesse an den persönlichen Daten seiner Fans zeigt. So<br />
wurden alle bedeutenden Fanvereinigungen mehrmals aufgefordert, ausführliche<br />
Mitgliedslisten einzureichen.“<br />
Diese habe der Verein dann genutzt, um Hunderten Fans die Dauerkarte zu<br />
kündigen, weil einige wenige Mitglieder im Verdacht standen, randaliert zu haben.<br />
Für den Religionslehrer ein Fall von Sippenhaft. Er hofft, dass der Verein in<br />
Zukunft mehr Fingerspitzengefühl zeigt – sowohl bei der Kommerzialisierung als<br />
auch bei der Behandlung seiner Fans.<br />
127
128
129<br />
Melanie Zerahn<br />
Wir sind alle Praktikanten<br />
die tageszeitung (taz), 31. Januar <strong>2007</strong>
Wir sind alle Praktikanten<br />
Recherchestipendium 2006<br />
Die Generation Praktikum ist nicht das Risiko einer kleinen randständigen<br />
Gruppe prekärer Akademiker. Sie ist Vorbote einer Globalisierung, die auch<br />
das ganze westliche Lebens- und Erwerbsmodell auf den Kopf stellen wird:<br />
Beruf, Geld und Liebe.<br />
Svenja rollt mit den Augen, „das Thema nervt! Sie kann die Frage nicht mehr<br />
hören. Die Frage nach ihrer Arbeit, ihrer Finanzierung, ihrem Lebensgefühl. Zu viel<br />
ist schon geschrieben worden. Die 32-jährige Berlinerin verkörpert als selbständige<br />
Texterin, Fotografin und Designerin die Generation Praktikum – aber sie will<br />
nicht mehr dazu gehören. Sie kann sich über Wasser halten und das bedeutet in<br />
ihrer Branche Erfolg. Kreative sind Patchwork-Biografien gewöhnt. Darüber<br />
reden: Nein. Die Generation Praktikum ist von sich selbst genervt.<br />
Das mag so sein. Aber deswegen ist das Phänomen nicht verschwunden. Der<br />
Soziologe Hand-Peter Blossfeld warnt davor, das Problem Praktikum zu bagatellisieren.<br />
Seine These geht genau in die andere Richtung: Die Risiken der Generation<br />
Praktikum sind keine Randerscheinung, sondern ein Phänomen, das die<br />
Gesellschaft als Ganzes betrifft. Der Bamberger Professor hat sich die Lebensverläufe<br />
des akademischen Prekariats in ganz Europa angesehen. Er sagt: Es geht<br />
um die Arbeits- und Lebensbedingungen im Zeitalter der Globalisierung.<br />
Betroffen sind nicht mehr nur die Arbeitsverhältnisse der Praktikanten. Auch<br />
befristete Verträge, Teilzeit, Werk- und Honorarverträge, schlecht bezahlte<br />
Volontariate und Traineestellen, selbständige Existenzgründungen und Gelegenheitsjobs<br />
gehören zu den Bedingungen der Globalisierungskinder. „Standen in<br />
den 70er-Jahren noch Wertefragen wie Wohlstand und Selbstverwirklichung im<br />
Vordergrund, so ist der Schlüssel heute Unsicherheit.“ Die Übergangsphase<br />
dauere in der Regel drei bis fünf Jahre, „danach finden die meisten ihren Platz“.<br />
Verpasst man den Anschluss, besteht die Gefahr, den Weg in die Leistungsgesellschaft<br />
nicht mehr zu finden.<br />
Längst hat das Globalisierungsrisiko auch etablierte Berufe erfasst. Bei den<br />
130
Juristen stieg die Arbeitslosenzahl von 2000 bis 2004 um fast das Doppelte<br />
auf knapp 10.000 Joblose. Die 30-jährige Juristin Juliane aus München schleppt<br />
Möbel in ihr Büro. Sie gehört zu denen, die sich lieber selbständig machen, als<br />
lange auf den Traumjob zu warten. „Die Mandanten kommen erst langsam zu<br />
mir“, sagt sie. Leben kann die Rechtsanwältin nicht von ihrer Mini-Kanzlei. „Meine<br />
Eltern schießen immer wieder was dazu, damit ich die Rechnungen alle bezahlen<br />
kann.“<br />
Damit ist sie nicht allein: Laut „Soldan-Gründungsbarometer“ können 31 Prozent<br />
der jungen Kanzleigründer ihren Lebensunterhalt lediglich mit Einschränkungen<br />
bestreiten. Mehr als die Hälfte muss auf Einnahmen zurückgreifen, die nicht aus<br />
ihrer Anwaltstätigkeit stammen. Ein Drittel der jungen Rechtsanwälte wählt den<br />
Weg in die Selbständigkeit, weitere 11 Prozent arbeiten zunächst als freie Mitarbeiter.<br />
Der Anteil der Gründer, die staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen,<br />
hat sich seit 1997 verdreifacht. Über die Hälfte der Einzelanwälte üben ihre<br />
Anwaltstätigkeit in der eigenen Wohnung aus, Tendenz steigend.<br />
Wer die konkrete Situation der westlichen Globalisierungskinder verstehen will,<br />
muss eine umfassende politische Analyse vornehmen. Dazu gehören, so Blossfeld,<br />
sowohl „Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik als auch die Familienpolitik“.<br />
Denn die Unsicherheiten der jungen Generation machen an Ressortgrenzen<br />
nicht halt: Berufseinsteiger müssen Studienschulden oder künftig -gebühren<br />
abbezahlen – und sich gleichzeitig um die Altersvorsorge kümmern; gleichzeitig<br />
wird das Kindergeld auf 25 Jahre beschränkt. Die verunsicherten Hochschulabsolventen<br />
reagieren auf ihre Situation, indem sie kurzfristiger denken. Langfristig<br />
bindende Entscheidungen schieben sie auf, die Jugendphase wird verlängert<br />
und der Übergang in das Erwerbsleben verläuft chaotisch. Mansche hüpfen von<br />
Praktikum zu Praktikum, andere bleiben länger im Bildungssystem. Eine Promotion<br />
als Warteschleife ist heute gang und gäbe.<br />
Zunehmend entwickeln sich auch geschlechtsspezifische Strategien im Umgang<br />
mit der Unsicherheit. Männer sind in immer geringerem Maße in der Lage, als<br />
131
„Ernährer“ eine langfristige Einkommenssicherheit für den Haushalt zu übernehmen.<br />
Sie schieben die Familiengründung auf. Umgekehrt hängt der Wunsch<br />
hochqualifizierter Frauen, Kinder zu bekommen, davon ab, dass sie ihre Berufschancen<br />
durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf wahren können. „Die langfristige<br />
Selbstbindung an Kinder übernehmen die meisten erst mit gesichertem<br />
Status“, beschreibt Blossfeld die Auswirkungen. „Frauen, die mehrere Jahre<br />
unsichere Jobs hinter sich haben, überlegen es sich zweimal, ob sie die einmal<br />
erreichte berufliche Stellung aufs Spiel setzen möchten.“ In Deutschland ist der<br />
Karriereknick mit Kind Realität. Junge Erwachsene verschieben den Kinderwunsch<br />
oder geben ihn sogar ganz auf.<br />
In Italien und Spanien sorgte die „Generation Mille Euro“, die „1.000-Euro-Generation“,<br />
in den letzten Jahren für Schlagzeilen. Dort, wo die „Insider-Outsider“-<br />
Märkte mit am stärksten ausgeprägt und befristete Verträge für Hochschulabsolventen<br />
an der Tagesordnung sind, machten junge Aktivisten mit ungewöhnlichen<br />
Mitteln auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Politisch herausgekommen ist nicht<br />
viel: Zwei junge, findige „Precari“ haben einen Internet-Roman über das Leben<br />
der modernen Tagelöhner initiiert, ihn als Buch verlegt und die Filmrechte<br />
verkauft. Die Lockerung des Kündigungsschutzes, die in Frankreich für Empörung<br />
sorgte, wurde in Italien ohne größere Proteste in Gesetz gegossen. In Frankreich<br />
polterten die Praktikanten so lange durch die Straßen, bis sie eine geplante<br />
Regelung zu einer zweijährigen Probezeit für Berufseinsteiger verhindern konnten.<br />
Heute ist das Thema verebbt. In Brüssel diskutiert man jetzt das Modewort<br />
„Flexisecurity“, das seinen Ursprung in den skandinavischen Ländern hat.<br />
Flexibilität und Sicherheit sind danach keine unvereinbaren Gegenpole, sondern<br />
in Balance zu bringen. Anders als in einigen Nachbarländern steht die Diskussion<br />
hierzulande erst am Anfang.<br />
Dass das Thema Generation Praktikum fachlich und politisch schwer einzuordnen<br />
ist, bemerkten auch die deutschen Parlamentarier. Zunächst landete das Thema<br />
beim Bildungsministerium, anschließend machte Arbeitsminister Franz Müntefering<br />
(SPD) das Thema zur Chefsache, inzwischen ist wieder Bildungsministerin<br />
132
Annette Schavan (CDU) zuständig. Ihre Partei will erst einmal verlässliche<br />
Zahlen, bevor sie weiter debattiert. Bundeskanzlerin Merkel reagiert gereizt,<br />
wenn man sie zum Thema befragt.<br />
Die Unsicherheit, mit dem Thema umzugehen, ist gerade bei den jungen Abgeordneten<br />
mit Händen zu greifen. „Wenn wir ehrlich sind, wissen wir überhaupt<br />
nicht, was wir mit der Generation Praktikum machen sollen“, sagt Swen Schulz.<br />
Der SPD-Bundestagsabgeordnete ist wenigstens ehrlich. Andere schwanken<br />
zwischen der Entschlossenheit, etwas tun zu wollen und der Unsicherheit, „mit<br />
gut gemeinten Gesetzen der Generation Praktikum die letzten Arbeitsplätze<br />
wegzunehmen“. Die Formel, auf die sich die jungen Parlamentarier einigen<br />
könnten, ist wohl die des Grünen Kai Gehring: „Die Generation Praktikum ist<br />
kein Medienhype, sondern für Tausende junger Menschen prekäre Realität.“<br />
Ein kämpferischer Beitrag der Betroffenen bleibt aus. „Man hofft ja doch immer,<br />
dass man einen Job bekommt und sich die ganze Situation auszahlt“, erwidert<br />
ein junger Berufseinsteiger auf die Frage, warum seine Generation denn nicht<br />
auf die Straße gehe und demonstriere. Die Betroffenen begreifen ihren eigenen<br />
Weg als individuell. Sich einzugestehen, dass sie Teil eines großen Ganzen sind,<br />
würde diesem Verständnis zuwiderlaufen. Wenn ihnen die Generation Praktikum<br />
auf die Nerven gehe, dann, weil sie sich von ihr distanzieren wollen. Ihr Individualismus<br />
verbietet ihnen, eine andere Geschichte zu erzählen.<br />
133
DIE JURY
Sonja Mikich<br />
Dr. Heribert Prantl<br />
Harald Schumann<br />
Dr. Volker Lilienthal<br />
Dr. Thomas Leif<br />
Jürgen Peters
Sonia Mikich<br />
Geboren 1951 in Oxford, in London aufgewachsen<br />
Redaktionsleitung des ARD-Politmagazins Monitor<br />
Werdegang<br />
Von Februar 2004 bis April <strong>2007</strong>: Redaktionsleitung der ARD/WDR-Dokumentationsreihe<br />
„die story“<br />
Seit Januar 2002: Redaktionsleitung und Moderatorin des ARD-Politmagazins Monitor, WDR Köln<br />
1998 bis 2001: Korrespondentin und Studioleitung des Deutschen Fernsehens in Paris<br />
Ab 1995: Studioleitung<br />
1992 bis 1998: Korrespondentin des Deutschen Fernsehens in Moskau<br />
1982 bis 1984: Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk, Redakteurin und Reporterin in der<br />
Programmgruppe Ausland Fernsehen des WDR.<br />
1979 bis 1981: wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arnold-Gehlen-Forschungsgruppe am<br />
Institut für Soziologie an der RWTH Aachen. Freie Journalistin für Zeitschriften, Tageszeitungen<br />
und Aufsatzsammlungen.<br />
1972 bis 1979: Studium Politologie, Soziologie und Philosophie an der RWTH Aachen mit<br />
Magisterabschluss Februar 1979<br />
1970 bis 1972: Volontariat bei der Aachener Volkszeitung<br />
Auszeichnungen<br />
1998 erhielt Sonia Mikich für ihre Arbeit als ARD-Korrespondentin in Russland das Bundesverdienstkreuz.<br />
Für ihre Russlandberichterstattung erhielt sie 1996 den Telestar, 2001 für ihre Berichterstattung<br />
aus Tschetschenien, Afghanistan und anderen Krisengebieten sowie für ihre Zeit als<br />
Leiterin des ARD-Studios Moskaus den Kritikerpreis 2001.<br />
Veröffentlichungen<br />
„Der Wille zum Glück“ Lesebuch über Simone de Beauvoir (1986)<br />
„Planet Moskau – Geschichten aus dem neuen Russland“ (1998)<br />
136
Dr. Heribert Prantl<br />
Geboren 1953 in Nittenau/Oberpfalz<br />
Ressortchef Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung<br />
Werdegang<br />
Seit 1995: Ressortchef Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung<br />
Seit 1992: stellvertretender Ressortleiter<br />
1992: leitender Redakteur<br />
Seit 1988: politischer Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Zunächst innenpolitischer<br />
Kommentator und innenpolitischer Redakteur mit Schwerpunkt Rechtspolitik<br />
1981 bis 1987: Richter an verschiedenen bayerischen Amts- und Landgerichten sowie<br />
Staatsanwalt<br />
Studium der Philosophie, der Geschichte und der Rechtswissenschaften. Erstes und Zweites<br />
Juristisches Staatsexamen, juristische Promotion bei Professor Dr. Dieter Schwab in<br />
Regensburg, juristisches Referendariat. Parallel dazu journalistische Ausbildung<br />
Auszeichnungen<br />
Thurn und Taxis-<strong>Preis</strong> für die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/Universität Regensburg<br />
(1982); Franz Karl Meier Leitartikelpreis der Pressestiftung Tagesspiegel Berlin (1989); Pressepreis<br />
des Deutschen Anwaltvereins (1992); Geschwister-Scholl-<strong>Preis</strong> der Landeshauptstadt München<br />
(1994); Kurt-Tucholsky-<strong>Preis</strong> für literarische Publizistik (1996); Siebenpfeiffer-<strong>Preis</strong> (1998/99);<br />
Theodor-Wolff-<strong>Preis</strong> für essayistischen Journalismus (2001); Rhetorikpreis für die Rede des Jahres<br />
2004 der Eberhard-Karls-Universität Tübingen<br />
137
Harald Schumann<br />
Geboren 1957<br />
Redakteur für besondere Aufgaben bei „Der Tagesspiegel“, Berlin<br />
Werdegang<br />
Seit Oktober 2004: Redakteur „Der Tagesspiegel“ Berlin<br />
2003 bis 2004: Redakteur im Berliner Büro des SPIEGEL<br />
2000 bis 2002: Ressortleiter Politik bei SPIEGEL ONLINE<br />
1992 bis 2000: Redakteur im Berliner Büro des SPIEGEL<br />
1990 bis 1991: Leitender Redakteur beim Ost-Berliner „Morgen“<br />
1986 bis 1990: Wissenschaftsredakteur beim SPIEGEL<br />
1984 bis 1986: Redakteur für Umwelt und Wissenschaft bei der Berliner tageszeitung, Studium<br />
der Sozialwissenschaften in Marburg, Landschaftsplanung an der TU Berlin, Abschluss als<br />
Diplom-Ingenieur<br />
Auszeichnungen<br />
Bruno-Kreisky-<strong>Preis</strong> für das politische Buch, 1997<br />
Medienpreis Entwicklungspolitik, 2004<br />
Gregor Louisoder-<strong>Preis</strong> für Umweltjournalismus, <strong>2007</strong><br />
Veröffentlichungen<br />
Futtermittel und Welthunger, Reinbek, 1986<br />
Die Globalisierungsfalle (gemeinsam mit Hans-Peter Martin), Reinbek 1996<br />
attac – Was wollen die Globalisierungskritiker? (Gemeinsam mit Christiane Grefe und Mathias<br />
Greffrath), Berlin 2002<br />
138
Dr. Volker Lilienthal<br />
Geboren 1959 in Minden/Westfalen<br />
Verantwortlicher Redakteur von „epd medien“<br />
Im Wintersemester <strong>2007</strong>/08 Vertretung der Rudolf Augstein Stiftungsprofessur für Qualitätsjournalismus<br />
an der Universität Hamburg<br />
Werdegang<br />
Seit 2005: Verantwortlicher Redakteur von<br />
„epd medien“<br />
1997 bis 2005: stellv. Ressortleiter „epd medien“<br />
Seit 1989: Redakteur beim Evangelischen<br />
Pressedienst (epd)<br />
Seit 1999: Lehrbeauftragter für Medienkritik<br />
und Medienjournalismus an der Goethe-Universität<br />
Frankfurt am Main.<br />
1996 bis 1998: journalistischer Berater und<br />
Auszeichnungen<br />
Leipziger <strong>Preis</strong> für die Freiheit und Zukunft der Medien 2006; Nominierung zum Henri Nannen <strong>Preis</strong><br />
2006 in der Sparte „Bestes investigatives Stück“; „Fachjournalist des Jahres 2005“; „Reporter des<br />
Jahres 2005“; „Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen“ der Journalistenvereinigung<br />
„Netzwerk Recherche“ 2004; zweiter <strong>Preis</strong> „Bester wissenschaftlicher Zeitschriftenaufsatz“ der<br />
Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) 2004; „Besondere<br />
Ehrung“ beim Bert-Donnepp-<strong>Preis</strong> für Medienpublizistik 2002; Hans-Bausch-Mediapreis des<br />
Süddeutschen Rundfunks Stuttgart 1997; Deutscher <strong>Preis</strong> für Medienpublizistik der Freunde des<br />
Adolf-Grimme-<strong>Preis</strong>es 1991.<br />
Veröffentlichungen<br />
„Literaturkritik als politische Lektüre, Am Beispiel der Rezeption der ,Ästhetik des Widerstands’<br />
von Peter Weiss“ (Volker Spiess: Berlin 1988) und „Sendefertig abgesetzt. ZDF. SAT.1 und der Soldatenmord<br />
von Lebach“ (Vistas-Verlag: Berlin 2001), TV-Dokumentation „Der Giftschrank des<br />
deutschen Fernsehens“ 1994 auf VOX/DCTP.<br />
139<br />
ständiger Autor der Hamburger Wochenzeitung<br />
„DIE ZEIT“, dort Kolumnist für „Zeit-Takte“.<br />
1988: Redakteur von „COPY“ (Handelsblatt-<br />
Verlag)<br />
1988: fr. Fachautor für Hörfunk u. Zeitschriften<br />
1983: Diplom-Journalist der Universität Dortmund<br />
1987: Dr. phil. in Germanistik der Universität-<br />
GH Siegen
Dr. Thomas Leif<br />
Geboren 1959<br />
Werdegang<br />
1978 bis 1985: Studium der Politikwissenschaft, Publizistik und Pädagogik an der Johannes<br />
Gutenberg-Universität Mainz. Bis 1989: Promotion<br />
Seit Mai 1985: fester freier Mitarbeiter beim Südwestrundfunk Mainz in den Redaktionen<br />
Politik, ARD Aktuell, Report u.a.<br />
Seit März 1995: Redakteur/Reporter beim SWR-Fernsehen<br />
Seit Januar 1997: Chefreporter Fernsehen beim SWR in Mainz<br />
Seit 2001: Vorsitzender der Journalistenvereinigung netzwerk recherche e. V.<br />
Ausgewählte Buchveröffentlichungen (Auswahl)<br />
Die strategische (Ohn)-Macht der Friedensbewegung. Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen<br />
in den achtziger Jahren, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990<br />
Rudolf Scharping, die SPD und die Macht, (zus. mit Joachim Raschke), Rowohlt Verlag,<br />
Reinbek, 1994<br />
Leidenschaft: Recherche. Skandal- Geschichten und Enthüllungs-Berichte (Hrsg.) Westdeutscher<br />
Verlag, Opladen, 1998<br />
Mehr Leidenschaft: Recherche. Skandal-Geschichten und Enthüllungsberichte. Ein Handbuch<br />
zu Recherche und Informationsbeschaffung. (Hrsg.), Westdeutscher Verlag, Opladen, 2003<br />
Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland (Hrsg.), Wiesbaden, 2006<br />
Beraten und Verkauft. McKinsey & Co. – der große Bluff der Unternehmensberater, C. Bertelsmann<br />
Verlag, Gütersloh, <strong>2007</strong>, 10. Auflage, Aktualisierte Neuauflage 3/2008 – Goldmann<br />
Verlag, München (Taschenbuch)<br />
Mail: thomas.leif@netzwerkrecherche.de<br />
www.netzwerkrecherche.de<br />
140
Jürgen Peters<br />
Geboren 1944 in Bolko/Oppeln, Oberschlesien<br />
Vorsitzender des Verwaltungsrats der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Werdegang:<br />
2003 bis <strong>2007</strong>: 1. Vorsitzender der IG Metall<br />
Seit 2003: Präsident des Internationalen Metallerbundes (IMB)<br />
1998 bis 2003: 2. Vorsitzender der IG Metall<br />
1988 bis 1998: Bezirksleiter des Bezirks Hannover der IG Metall<br />
1976 bis 1988: Vorstand der IG Metall, Zweigbüro Düsseldorf<br />
1971 bis 1976: Lehrer IG Metall Bildungsstätte Lohr<br />
1969 bis 1971: Lehrerassistent in der IG Metall Bildungsstätte Lohr<br />
1968 bis 1969: Besuch der Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main<br />
1964 bis 1968: Maschinenschlosser bei Rheinstahl Hanomag AG<br />
1961 bis 1964: Ausbildung als Maschinenschlosser bei Rheinstahl Hanomag AG in Hannover,<br />
in dieser Zeit: Besuch der Berufsaufbauschule mit Abschluß der Fachschulreife<br />
seit 1961 Mitglied der IG Metall, seit 1966 Mitglied der SPD, Aufsichtsratsmandate:<br />
Volkswagen AG, Salzgitter AG<br />
141
OTTO BRENNER PREIS 2008<br />
FÜR KRITISCHEN JOURNALISMUS
„Nicht Ruhe und Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit ist die erste<br />
Bürgerpflicht, sondern Kritik und ständige demokratische Wachsamkeit.“<br />
Ausschreibung<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> 2008<br />
(<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> 1968)<br />
Es werden Beiträge prämiert, die für einen kritischen Journalismus<br />
vorbildlich und beispielhaft sind und die für demokratische und gesellschaftspolitische<br />
Verantwortung im Sinne von <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> stehen.<br />
Vorausgesetzt werden gründliche Recherche und eingehende Analyse.<br />
Der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> ist mit einem <strong>Preis</strong>geld<br />
von 45.000 Euro dotiert, das sich wie folgt aufteilt:<br />
1. <strong>Preis</strong> 10.000 Euro<br />
2. <strong>Preis</strong> 5.000 Euro<br />
3. <strong>Preis</strong> 3.000 Euro<br />
Zusätzlich vergibt die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung:<br />
für die beste Analyse (Leitartikel, Kommentar, Essay)<br />
den <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“ 10.000 Euro<br />
in Zusammenarbeit mit „netzwerk recherche e. V.“<br />
drei Recherche-Stipendien von je 5.000 Euro<br />
und für Nachwuchsjournalisten<br />
den „Newcomer-Sonderpreis“ 2.000 Euro<br />
Einsendeschluss: 15. August 2008<br />
Die Bewerbungsbögen mit allen erforderlichen Informationen erhalten Sie unter:<br />
www.otto-brenner-preis.de<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Wilhelm-Leuschner-Str. 79<br />
60329 Frankfurt am Main<br />
E-mail: obs@igmetall.de<br />
Tel.: 069 / 6693 - 2808<br />
Fax: 069 / 6693 - 2786
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Wilhelm-Leuschner-Straße 79<br />
60329 Frankfurt / Main<br />
Verantwortlich<br />
Manfred Schallmeyer<br />
Redaktion<br />
Anne Böttcher, Christine Meltzer,<br />
Dr. Burkard Ruppert<br />
Artwork<br />
N. Faber de.sign, Wiesbaden<br />
Druck<br />
ColorDruck Leimen GmbH<br />
144
www.otto-brenner-preis.de<br />
www. otto-brenner-stiftung.de
www.otto-brenner-preis.de<br />
www. otto-brenner-stiftung.de