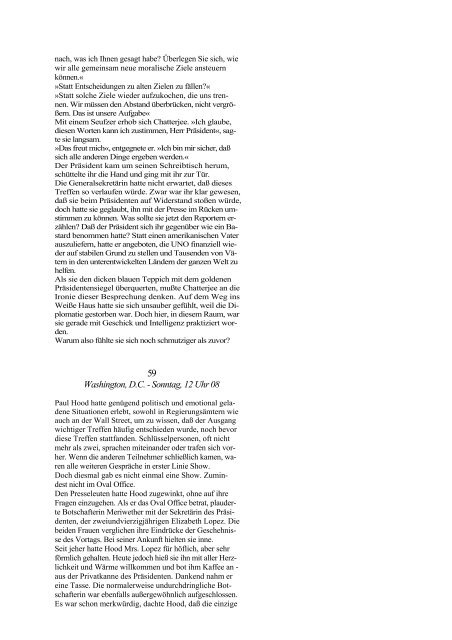TOM CLANCY'S AUSNAHMEZUSTAND
TOM CLANCY'S AUSNAHMEZUSTAND TOM CLANCY'S AUSNAHMEZUSTAND
legierten der Vereinten Nationen sich allzu lange darum scheren werden.« »Wir sind nicht der amerikanische Kongreß, Herr Prä- sident. Unterschätzen Sie nicht unsere Fähigkeit, eine Angelegenheit konzentriert weiterzuverfolgen.« »Das würde ich mir nie erlauben«, erwiderte der Präsi- dent. »Ich bin überzeugt davon, daß die Delegierten sich äußerst konzentriert der Aufgabe widmen werden, geeig- nete Schulen und Wohnungen zu finden, wenn sich diese Regierung für die Verlegung der Vereinten Nationen von New York in eine andere Stadt einsetzt, sagen wir Khartum oder Rangun.« Chatterjee fühlte, wie sie errötete. Der Bastard, der unverschämte Bastard. »Herr Präsident, ich reagiere nicht auf Drohungen.« »Ich glaube doch«, sagte der Präsident. »Sie haben auf diese Drohung sofort und deutlich reagiert.« Sie sah ein, daß er recht hatte. »Niemand wird gern gegen seinen Willen zu etwas ge- zwungen«, fuhr der Präsident fort, »und darum geht es hier. Wir müssen für dieses Problem eine Lösung finden, die keine Konfrontation und keine Bedrohung darstellt und die für alle Beteiligten akzeptabel ist.« »Und was schlagen Sie vor?« Trotz aller Frustration war Chatterjee doch in erster Linie Diplomatin. Sie würde zu- hören. »Es wäre sicherlich eine konstruktivere Methode, die aufgebrachten Delegierten zu besänftigen, wenn die Vereinigten Staaten damit beginnen würden, ihre Schulden in Höhe von zwei Milliarden Dollar zu bezahlen«, sagte der Präsident. »Dann hätten die Delegierten mehr Geld für Projekte der UNO in ihren Heimatländern, wie zum Beispiel für den Welternährungsrat, UNICEF, das Ausbil- dungs- und Forschungsinstitut. Und wenn wir es richtig anstellen, werden sie sich als Sieger fühlen. Sie werden die Kapitulation der amerikanischen Regierung in der Schul- denfrage erreicht haben. Ihr persönliches Ansehen wird in keiner Weise beeinträchtigt werden«, erklärte er. Chatterjee warf ihm einen kalten Blick zu. »Herr Präsi- dent, ich danke Ihnen für Ihre Überlegungen zu diesem Thema. Dennoch gibt es rechtliche Aspekte, die nicht ein- fach ignoriert werden können.« Der Präsident lächelte. »Frau Generalsekretärin, vor na- hezu fünfundzwanzig Jahren hat der russische Schriftstel- ler Alexander Solschenizyn etwas ausgesprochen, das ich als Anwalt nie wieder vergessen habe. >Ich habe mein gan- zes Leben unter einem kommunistischen Regime ver- brachtund ich kann sagen, daß eine Gesell- schaft ohne einen objektiven rechtlichen Maßstab wirklich schrecklich ist. Doch eine Gesellschaft, die sich einzig und allein am rechtlichen Maßstab orientiert, ist auch nicht menschenwürdig.« Chatterjee beobachtete den Präsidenten aufmerksam. Es war das erstemal seit ihrer Ankunft im Oval Office, daß sie in seinen Augen und seinem Gesichtsausdruck einen ehrlichen Zug entdeckte. »Frau Generalsekretärin«, fuhr der Präsident fort, »Sie sind völlig erschöpft. Darf ich Ihnen einen Vorschlag ma- chen?« »Bitte«, erwiderte sie. »Warum fliegen Sie nicht nach New York zurück, ent- spannen sich ein wenig und denken in aller Ruhe darüber
nach, was ich Ihnen gesagt habe? Überlegen Sie sich, wie wir alle gemeinsam neue moralische Ziele ansteuern können.« »Statt Entscheidungen zu alten Zielen zu fällen?« »Statt solche Ziele wieder aufzukochen, die uns trennen. Wir müssen den Abstand überbrücken, nicht vergrö- ßern. Das ist unsere Aufgabe« Mit einem Seufzer erhob sich Chatterjee. »Ich glaube, diesen Worten kann ich zustimmen, Herr Präsident«, sag- te sie langsam. »Das freut mich«, entgegnete er. »Ich bin mir sicher, daß sich alle anderen Dinge ergeben werden.« Der Präsident kam um seinen Schreibtisch herum, schüttelte ihr die Hand und ging mit ihr zur Tür. Die Generalsekretärin hatte nicht erwartet, daß dieses Treffen so verlaufen würde. Zwar war ihr klar gewesen, daß sie beim Präsidenten auf Widerstand stoßen würde, doch hatte sie geglaubt, ihn mit der Presse im Rücken um- stimmen zu können. Was sollte sie jetzt den Reportern er- zählen? Daß der Präsident sich ihr gegenüber wie ein Ba- stard benommen hatte? Statt einen amerikanischen Vater auszuliefern, hatte er angeboten, die UNO finanziell wieder auf stabilen Grund zu stellen und Tausenden von Vätern in den unterentwickelten Ländern der ganzen Welt zu helfen. Als sie den dicken blauen Teppich mit dem goldenen Präsidentensiegel überquerten, mußte Chatterjee an die Ironie dieser Besprechung denken. Auf dem Weg ins Weiße Haus hatte sie sich unsauber gefühlt, weil die Di- plomatie gestorben war. Doch hier, in diesem Raum, war sie gerade mit Geschick und Intelligenz praktiziert wor- den. Warum also fühlte sie sich noch schmutziger als zuvor? 59 Washington, D.C. - Sonntag, 12 Uhr 08 Paul Hood hatte genügend politisch und emotional gela- dene Situationen erlebt, sowohl in Regierungsämtern wie auch an der Wall Street, um zu wissen, daß der Ausgang wichtiger Treffen häufig entschieden wurde, noch bevor diese Treffen stattfanden. Schlüsselpersonen, oft nicht mehr als zwei, sprachen miteinander oder trafen sich vor- her. Wenn die anderen Teilnehmer schließlich kamen, wa- ren alle weiteren Gespräche in erster Linie Show. Doch diesmal gab es nicht einmal eine Show. Zumin- dest nicht im Oval Office. Den Presseleuten hatte Hood zugewinkt, ohne auf ihre Fragen einzugehen. Als er das Oval Office betrat, plauder- te Botschafterin Meriwether mit der Sekretärin des Präsi- denten, der zweiundvierzigjährigen Elizabeth Lopez. Die beiden Frauen verglichen ihre Eindrücke der Geschehnis- se des Vortags. Bei seiner Ankunft hielten sie inne. Seit jeher hatte Hood Mrs. Lopez für höflich, aber sehr förmlich gehalten. Heute jedoch hieß sie ihn mit aller Herz- lichkeit und Wärme willkommen und bot ihm Kaffee an - aus der Privatkanne des Präsidenten. Dankend nahm er eine Tasse. Die normalerweise undurchdringliche Bot- schafterin war ebenfalls außergewöhnlich aufgeschlossen. Es war schon merkwürdig, dachte Hood, daß die einzige
- Seite 135 und 136: 39 New York/New York - Samstag, 23
- Seite 137 und 138: und Chatterjee antwortete. »Hier s
- Seite 139 und 140: »Sie lügen.« »Mike, was ist?«
- Seite 141 und 142: den Sanitätern gesprochen. Wenn er
- Seite 143 und 144: langen - die Geiseln werden sich in
- Seite 145 und 146: Hood wollte sie nicht wissen lassen
- Seite 147 und 148: Augen zu Schlitzen. »Sie lügt«,
- Seite 149 und 150: viele Veteranen durch, wenn sie nac
- Seite 151 und 152: ihm befehlen würde, ihren Wünsche
- Seite 153 und 154: 45 New York/New York - Sonntag, 0 U
- Seite 155 und 156: die Rodgers ihm gegeben hatte, wäh
- Seite 157 und 158: Schnellstraße und legte dann sein
- Seite 159 und 160: den Sicherheitskräften zu zeigen,
- Seite 161 und 162: durchfuhr. »Licht an!« rief jeman
- Seite 163 und 164: August war immer noch zwei Reihen e
- Seite 165 und 166: New York/New York - Sonntag, 0 Uhr
- Seite 167 und 168: war er merkwürdig ruhig gewesen. E
- Seite 169 und 170: zinischen Personal aufgenommen und
- Seite 171 und 172: Mailman zögerte. Abrupt änderte R
- Seite 173 und 174: Terroristen überzeugte, daß sie i
- Seite 175 und 176: esten Freundinnen. Sie selbst wäre
- Seite 177 und 178: ter das Ohr. Seit Jahren hatte er d
- Seite 179 und 180: von Chevy Chase kontaktiert und um
- Seite 181 und 182: »Ich weiß«, entgegnete sie. »Un
- Seite 183 und 184: in einem Schlachthaus hatte sterben
- Seite 185: holt?« »Es muß nicht sofort sein
- Seite 189 und 190: Zwischen dem Ende des Hauptkorridor
nach, was ich Ihnen gesagt habe? Überlegen Sie sich, wie<br />
wir alle gemeinsam neue moralische Ziele ansteuern<br />
können.«<br />
»Statt Entscheidungen zu alten Zielen zu fällen?«<br />
»Statt solche Ziele wieder aufzukochen, die uns trennen.<br />
Wir müssen den Abstand überbrücken, nicht vergrö-<br />
ßern. Das ist unsere Aufgabe«<br />
Mit einem Seufzer erhob sich Chatterjee. »Ich glaube,<br />
diesen Worten kann ich zustimmen, Herr Präsident«, sag-<br />
te sie langsam.<br />
»Das freut mich«, entgegnete er. »Ich bin mir sicher, daß<br />
sich alle anderen Dinge ergeben werden.«<br />
Der Präsident kam um seinen Schreibtisch herum,<br />
schüttelte ihr die Hand und ging mit ihr zur Tür.<br />
Die Generalsekretärin hatte nicht erwartet, daß dieses<br />
Treffen so verlaufen würde. Zwar war ihr klar gewesen,<br />
daß sie beim Präsidenten auf Widerstand stoßen würde,<br />
doch hatte sie geglaubt, ihn mit der Presse im Rücken um-<br />
stimmen zu können. Was sollte sie jetzt den Reportern er-<br />
zählen? Daß der Präsident sich ihr gegenüber wie ein Ba-<br />
stard benommen hatte? Statt einen amerikanischen Vater<br />
auszuliefern, hatte er angeboten, die UNO finanziell wieder<br />
auf stabilen Grund zu stellen und Tausenden von Vätern<br />
in den unterentwickelten Ländern der ganzen Welt zu<br />
helfen.<br />
Als sie den dicken blauen Teppich mit dem goldenen<br />
Präsidentensiegel überquerten, mußte Chatterjee an die<br />
Ironie dieser Besprechung denken. Auf dem Weg ins<br />
Weiße Haus hatte sie sich unsauber gefühlt, weil die Di-<br />
plomatie gestorben war. Doch hier, in diesem Raum, war<br />
sie gerade mit Geschick und Intelligenz praktiziert wor-<br />
den.<br />
Warum also fühlte sie sich noch schmutziger als zuvor?<br />
59<br />
Washington, D.C. - Sonntag, 12 Uhr 08<br />
Paul Hood hatte genügend politisch und emotional gela-<br />
dene Situationen erlebt, sowohl in Regierungsämtern wie<br />
auch an der Wall Street, um zu wissen, daß der Ausgang<br />
wichtiger Treffen häufig entschieden wurde, noch bevor<br />
diese Treffen stattfanden. Schlüsselpersonen, oft nicht<br />
mehr als zwei, sprachen miteinander oder trafen sich vor-<br />
her. Wenn die anderen Teilnehmer schließlich kamen, wa-<br />
ren alle weiteren Gespräche in erster Linie Show.<br />
Doch diesmal gab es nicht einmal eine Show. Zumin-<br />
dest nicht im Oval Office.<br />
Den Presseleuten hatte Hood zugewinkt, ohne auf ihre<br />
Fragen einzugehen. Als er das Oval Office betrat, plauder-<br />
te Botschafterin Meriwether mit der Sekretärin des Präsi-<br />
denten, der zweiundvierzigjährigen Elizabeth Lopez. Die<br />
beiden Frauen verglichen ihre Eindrücke der Geschehnis-<br />
se des Vortags. Bei seiner Ankunft hielten sie inne.<br />
Seit jeher hatte Hood Mrs. Lopez für höflich, aber sehr<br />
förmlich gehalten. Heute jedoch hieß sie ihn mit aller Herz-<br />
lichkeit und Wärme willkommen und bot ihm Kaffee an -<br />
aus der Privatkanne des Präsidenten. Dankend nahm er<br />
eine Tasse. Die normalerweise undurchdringliche Bot-<br />
schafterin war ebenfalls außergewöhnlich aufgeschlossen.<br />
Es war schon merkwürdig, dachte Hood, daß die einzige