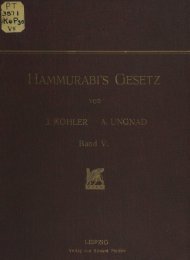•-***!:* :li2H jIEÜ~ 1 1 1 - JScholarship
•-***!:* :li2H jIEÜ~ 1 1 1 - JScholarship
•-***!:* :li2H jIEÜ~ 1 1 1 - JScholarship
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>•</strong>-<strong>***</strong>!:* :<strong>li2H</strong><br />
<strong>jIEÜ~</strong><br />
1<br />
1 1
Ar^j^SSSStTS^"
Erinnerungen an Indien.<br />
Von<br />
Paul Deussen.
Indien mit der Reiseroute<br />
ar- "\etieto-ute
E r i n n e r u n g e n a n Indien.<br />
Von<br />
Dr. Paul Deussen,<br />
Professor der Universität Kiel.<br />
Mit einer Ksrte, 16 Abbildungen und einem Anhsnge:<br />
,On the philosophy of the Vedänta in its relations to occidental<br />
Metaphysics".<br />
Kiel und Leipzig.<br />
Verlag von Lipsius & Tischer.<br />
1904.
m - f f ?<br />
Mit Vorbehalt aller Rechte.<br />
M<br />
? V i o s<br />
. D 4-i
Inhalt.<br />
Seite<br />
I. Vorbereitungen 1—5<br />
Englisch. Hindostani. Sanskrit. Der Vedänta. Empfehlungsbriefe.<br />
Dhruvs und Ns2ar.<br />
II. Von Marseille nach Bombay 6—18<br />
Buchung in London. Über Land nach Marseille. Einschiffung.<br />
Ssrdinien und Korsika. Messins und Reggio. Aufenthslt vor<br />
Krets. Port Ssi'd. Sue2k3n3l. Rotes Meer. Psnkhs. Schlafen<br />
auf Deck. Kinder. Leben auf dem Schiff. Tropenkoller.<br />
Aden. Indischer 02ean. Ankunft in Bombay.<br />
III. Bombay 19—43<br />
Reisebetten. Hotelwesen. Reisekosten. Mün2Sorten. Das<br />
indische Hotel. Verpflegung in ihm. Reisediener. Lalu.<br />
Kastenvorurteile. Wstsons Hotel. Treiben vor ihm. Nächtliche<br />
Ruhestörungen. Besuch Eingeborener. Fshrgelegenheiten.<br />
Auf Mslsbsr Hill. Audien2 bei einem Heiligen. Venirsm.<br />
Indische Lebensweise und Kleidung. Morgensps2iergsng.<br />
Morgen suf Mslsbsr Hill. Ausflug nsch Elephanta.<br />
Leichenverbrennung. Semitischer Typus der Parsi's. Schulen<br />
der Psrsi's. Die Türme des Schweigens. Ein sltvedisches<br />
Opfer. Ein indisches Thester. Eine Theatervorstellung. Einladung<br />
nsch Bsroda.<br />
IV. Von Bombay bis Peshawar 44—95<br />
Abreise von Bombay. Einrichtung der indischen Eisenbahnen.<br />
Bsrods. Fürstliche Aufnshme. Besichtigungen. Ritt<br />
nach Macka. Grosse Cour. Sanscrit College. Exsmen.<br />
Kronjuwelen. Dhruva's Heim. Musikmeister. Photographische<br />
Aufnahme in Barods. Fahrt nach Ahmedsbad. Klima<br />
Indiens. Pflan2enwuchs. Ahmedabsd. Sanitäre Verhältnisse.<br />
Religiöse Vorurteile. 2snkende Weiber. Die Jaina's. Teppichwirkerei.<br />
Tierhospitäler. Schlsngen. Pinjrs Pol. Sädhu's.
VI.<br />
Ksstendiner. Abreise. Ankunft in Jsipur. Wanderung durch<br />
die Stadt. Echte und falsche Asketen. Elephsntenritt nach<br />
Amber. Krokodilfütterung. Seelenwanderungsglaube. Kinderheiraten.<br />
Für und gegen die Kinderheiraten. Professorenverssmmlung.<br />
Meine Kaste. Fahrt nsch Agrs. Morgenstimmung.<br />
Der Täj Mshsl. Lsl Bsij Näth. Der Yog3. Akbsrs<br />
Grabmonument. Abendgesellschaft bei Läl Baij Näth.<br />
Hindumshl2eiten. Betelksuen, Rsuchen. Ein kostbsres Andenken.<br />
Indischer Winter. Hei2m3terisl. Die Mohammedsner.<br />
Die indische Stsdt. Sps2iergang in Lahore. Die Irävsti.<br />
DerÄryassmäj. Dr. Stein. Kaschmirerinnerungen. Der<br />
Indus. Hotel in Peshawsr, Fort Jsmrud. Der Khsibsr-Pass.<br />
Independent tribes. Colonel Wsrburton und der eingeborene<br />
Oberst. Die Philosophie in Indien. Abfshrt von Peshswar.<br />
V. Von Peshawar bis Calcutta 96—151<br />
Eine verdorbene Nscht. Die Flüsse des Pendschäb. Klims<br />
des Pendschäb. Lahore. Sanscrit College. Abschied von<br />
Lahore. Amritsar. Mr. Summers. Pockengefshr. Vipsc und<br />
Cutudri. Delhi. Sehenswürdigkeiten Delhis. Umgebung von<br />
Delhi. Indrsprasthsm. Eine Dorfwohnung. Ein indisches<br />
Gelehrtenheim. Mathurs und Umgebung. Die Krishnslegende.<br />
Vrindsbsn. Affen. Bettelei. Armut der Psndits. Msthurä.<br />
Indische Naivitäten. Ein Heilkünstler. Die Ghatta's. Krishns's<br />
Geburtshsus. Die Ysmunäbrücke. Mahsbsn. Vortrag in Msthurä.<br />
Lslus Sünden. Cswnpore. Lslu entlsssen. Herrn<br />
Bssslers Heim. Schsuergeschichten. Die Moschusrstte. Pursn.<br />
Lucknow. Die Residency. Eine Opernvorstellung. Ein Ekks.<br />
Tonfiguren. Fyzsbsd und Ayodhyä. Ayodhyä. Affen, Tempel,<br />
Sehenswürdigkeiten. Bensres. Clsrk's Fsmily Hotel. Bsden<br />
im Gsnges. Leichenverbrennung. Besuch beim Mahäräja.<br />
Mit dem Mshäräjs zu Bhäskaränanda Svämin. Ein Asketenheim.<br />
Das Sanscrit College. Lehrweise im Sanscrit College.<br />
Mittelslterlicher Standpunkt. Professor Rämsmigra. Govind<br />
Das. Die Theosophisten. Colonel Oleott. Rundgang mit<br />
Raghunsndana Prssäd. Tsnzmädchen. Drei Psnditfreunde.<br />
Abschied von Benares. Bankipore. Fahrt nach Gayä.<br />
Buddha-Gayä. Ein Sädhukloster. Gays. Bankipore. Candranagarsm.<br />
VI. Calcutta und der Himälaya 152—183<br />
Calcutts. Jung-England in Indien. Der Brshmasamäj. P. L.
VII.<br />
Roy und P. K. Ray. Calcuttaer Professoren. Mr. Mullik's<br />
Werft und Haus. Eine schwere Sitzung. Hara Pfasäda.<br />
Naihsti. Ein Kokils. Der Toddy. Auf 2um Himälsys. Die<br />
Himälayabahn. Die Region der Terai. Korscheong Bazar.<br />
Goom. Darjeeling. Land und Leute des Himälaya. Der<br />
Buddhismus. Der Gaurigankar. Ein nepalesischer Freund.<br />
Der Kanchinjinga in seiner Herrlichkeit. Rückfahrt. Mrs.<br />
Dsvidson und ihr Missionsr. Tierschau in Dum Dum. Eine<br />
indische Haushsltung. Audien2 bei einer Heiligen. Die sechs<br />
Systeme. Meine Ksste. Besuch bei Jivänsnds Vidyäsägara.<br />
Der botanische Garten. Der Nyagrodhabsum. Abschied von<br />
Cslcutts. Der Huqqa.<br />
VII. Von Calcutta über Allahabad nach Bombay 184—208<br />
Von Calcutta nach Allahabad. Professor Thibaut. Mr. Gough.<br />
Besuch von Prayäga. Das Fort. Vortrag in Allshsbsd. Eine<br />
Lesehslle. Indische Musik. Abschied. Über die Narmads.<br />
Indore. Ujjsyini. Die Ctprä. Eine Sitzung im Dak Bungalow.<br />
Freundlichkeit des Gouverneurs. Alt-Ujjayini. Das Haus des<br />
Bhartrihari. Unser Elefant. Diner beim Gouverneur. Padre<br />
Pio. Abdul. Ankunft in Bombay. Der Cosmopolitan Club.<br />
Vortrag in der Asiatic Society. Eine Hochzeitsfeier. Besuch<br />
bei Telang. Abschied von Peterson.<br />
VIII. Von Bombay nach Madras und Ceylon . . 209—230<br />
Programm der Theosophisten. Apte in Poona. Das Holifest.<br />
Bhandarkar. Von Poona nach Madras. Die Sprachen Indiens.<br />
Professor Oppert. Mückenplage. Eine Sanskritklasse. Ein<br />
edler Fürst. Beim Mahäräjs von Vijayanagaram. Tanj-ore.<br />
Trichinopoly. Msdura. Tuticorin. Eine ungemütliche Bootfshrt.<br />
Ankunft in Colombo. Konsul Freudenberg. Nsch<br />
Ksndy. Ein Buddhistenkloster. Heutiger Buddhismus. Peradeniys.<br />
Eine Theeplsntsge. Der Brotbsum. Eine Schlsnge.<br />
Bettelnde Buddhistenmönche. Ceylon und Indien.<br />
IX. Die Heimreise 231—238<br />
Die Britsnnia. Zweierlei Prediger. Aden. Eine trostlose<br />
Landschsft. Sue2. Abenteuer im Ksnsl. Eine Fsta Morgsna.<br />
Port Said. Der Taygetos. Brindisi.<br />
Anhang: 239—251<br />
On the Philosophy of the Vedsnts in its relations to Occidental<br />
Metaphysics.
VIII.<br />
Verzeichnis der Abbildungen.<br />
1. Psnorama von Bombay mit dem Hafen (vom Clock Tower aus)<br />
2. Gruppe von Freunden in Bombay . .<br />
3. Strasse in Bombay (Kalkadevi Road)<br />
4. Gruppe junger Parsi-Dsmen .<br />
5. Die Türme des Schweigens . .<br />
6. Ein Mahäräja mit Ministern . .<br />
7. Gruppe mit dem Elefanten (Baroda) .<br />
8. Der Täj Mahal (Agra)<br />
9. Bettler im Aufzuge eines Asketen<br />
10. Ein Ekka („Einspänner")<br />
11. Leichenverbrennung am Dagsgvamedha Ghatta (Benares)<br />
12. Bajaderen (Tanzmädchen) mit Musikern<br />
13. Badende im Hughli (Calcutts)<br />
14. Dsrjeeling und der Ksnchinjings<br />
15. Der Nyagrodhabaum im botsnischen Garten zu Calcutta<br />
16. Khandsls, eine Reversing Ststion in den westlichen Ghstts's<br />
Aussprache.<br />
Seite<br />
18<br />
28<br />
34<br />
38<br />
40<br />
50<br />
56<br />
76<br />
116<br />
126<br />
132<br />
144<br />
152<br />
170<br />
182<br />
202<br />
In indischen Wörtern ist<br />
c, eh wie tsch und j, jh wie dsch<br />
zu sprechen (also Maharadscha, Kantschindschinga); c ist ein mittlerer<br />
Lsut zwischen s (stets scharf) und sh (= seh).
Vorbereitungen.<br />
Erstes Kapitel.<br />
r^vem Wunsche meiner Freunde willfahrend, will ich einige<br />
Eindrücke meiner Reise nach Indien im Winter 1892—93 hier<br />
aufzeichnen und dadurch auch weiteren Kreisen zugänglich<br />
machen, teils weil es mir, trotz der Kürze meines Aufenthaltes<br />
in Indien, infolge besonders günstiger Umstände möglich<br />
wurde, tiefere Einblicke in das Leben der Eingeborenen zu<br />
tun, als sie sonst dem Europäer zuteil zu werden pflegen,<br />
teils weil meine Auffassung indischer Verhältnisse mehrfach<br />
eine von der gewöhnlichen abweichende ist, namentlich da<br />
ich nicht wie so viele andere das indische Land und Volk<br />
nur durch die Augen und Interessen der Engländer ansehe,<br />
auch nicht gewohnt bin, vor dem goldenen Kalbe des Erfolges<br />
zu knieen und eine Sache darum für schlecht zu halten, weil<br />
sie die unterliegende ist.<br />
Als es mir endlich möglich wurde, langjährige Hoffnungen<br />
zu verwirklichen, meine akademische Tätigkeit für ein halbes<br />
Jahr zu unterbrechen und in Gesellschaft meiner Frau dem<br />
Lande zuzueilen, welches mir schon seit Jahrzehnten zu einer<br />
Art geistiger Heimat geworden war, da traf mich diese glück<br />
liche Fügung nicht unvorbereitet. Von den drei Sprachen,<br />
die man in Indien nötig hat, Englisch, um mit den Gebildeten,<br />
Hindostani, um mit dem Volke, und Sanskrit, um mit den<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 1
2 I. Vorbereitungen.<br />
Pandits, d. h. den indischen, des Englischen in der Regel<br />
völlig unkundigen, ja dasselbe pefhorreszierenden Gelehrten<br />
zu verkehren, — war mir und meiner Frau das Englische<br />
durch wiederholten Aufenthalt in England geläufig. Vom<br />
Hindostani, zu dessen Erlernung die Lehrmittel noch sehr<br />
unvollkommen und, namentlich in Deutschland, schwer zu<br />
gänglich sind, konnten wir uns erst auf der Reise und in<br />
Indien selbst so viel zu eigen machen, um nachgerade mit<br />
den Leuten auch ohne Vermittlung des Dieners verhandeln<br />
zu können. Was endlich das Sanskrit betrifft, so war dessen<br />
Studium in den letzten zwanzig Jahren so sehr mein tägliches<br />
Brot gewesen, dass ich hoffen durfte, dasselbe nach einiger<br />
Vorübung im Lande selbst nicht nur sprechen, sondern auch,<br />
was das Schwerste ist, das schnell und mit dialektischer<br />
Färbung gesprochene Sanskrit verstehen zu können, — eine<br />
Hoffnung, die sich durchaus verwirklicht hat. Der bequeme<br />
Gebrauch des Sanskrit aber als Umgangssprache vermag mehr<br />
als jeder Empfehlungsbrief in die sonst dem Europäer so<br />
verschlossenen höheren Kreise der Eingeborenen einzuführen.<br />
Und nicht nur die Gelehrten von Fach, wie namentlich die<br />
einheimischen Sanskritprofessoren der indischen Universitäten,<br />
sprechen Sanskrit mit grosser Eleganz, nicht nur ihre Zu<br />
hörer wissen dasselbe ebenso gut zu handhaben wie bei uns<br />
ein Studierender der klassischen Philologie das Lateinische,<br />
auch die zahlreichen Privatgelehrten, Heiligen, Asketen, ja selbst<br />
weitere Kreise sprechen und schreiben Sanskrit mit Leichtig<br />
keit; mit dem Mahäräja von Benares habe ich mich wieder<br />
holt stundenlang darin unterhalten; Fabrikanten, Industrielle,<br />
Kaufleute sprechen es zum Teil oder verstehen doch das<br />
Gesprochene; in jedem kleinen Dorfe war meine erste Frage<br />
nach einem, der Sanskrit spreche, worauf sich denn alsbald<br />
der eine oder andere einstellte, der gewöhnlich mein Führer,<br />
ja nicht selten mein Freund wurde. Öfter gab ich den Bitten<br />
der Eingeborenen nach, ihnen einen Vortrag zu halten. Dies
Englisch, Hindostsni, Sanskrit. 3<br />
geschah natürlich in englischer Sprache, aber fast überall<br />
wurde ich gebeten, das Gesagte für diejenigen, welche dem<br />
Englischen nicht hätten folgen können, nochmals in Sanskrit<br />
zu wiederholen. Nachdem dies geschehen, folgte eine Dis<br />
kussion, bei der die einen Englisch, die anderen Sanskrit,<br />
noch andere Hindi sprachen, welches sich denn auch der<br />
Hauptsache nach verstehen liess, da das reine Hindi sich<br />
vom Sanskrit kaum durch viel mehr als durch den Verlust<br />
der Flexionsendungen unterscheidet. Daher versteht jeder<br />
Hindu vom Sanskrit ungefähr ebensoviel wie ein Italiener<br />
vom Lateinischen, namentlich da im eigentlichen Hindostan<br />
die Schrift die nämliche geblieben ist; und ein Anflug des<br />
Sanskrit lässt sich bis hinab in die Kreise der Dienerschaft<br />
und des geringen Volkes antreffen; daher auch ein Brief<br />
nach Benares mit blosser Sanskritadresse durch jeden Post<br />
boten ohne Schwierigkeit seine Bestellung findet. Manche<br />
Inder scheinen der Meinung zu sein, dass es in der ganzen<br />
Welt ebenso sei. Denn unter den zahlreichen Sanskritbriefen,<br />
die mir auch jetzt noch von Zeit zu Zeit zugehen, fand sich<br />
auch wohl einmal einer, bei dem mit allem andern auch die mit<br />
überschwenglichen Lobtiteln gespickte Adresse ganz in Sans<br />
krit geschrieben war, auch mein Name nur in der sanskriti-<br />
sierten Form Devasena erschien und die Bezeichnung des<br />
Wohnortes fehlte, und der trotzdem — zum Lobe unserer<br />
Postverwaltung sei es gesagt — glücklich in meine Hände ge<br />
langte, nachdem er vorher unter anderm nach Leipzig gelaufen<br />
und dort entziffert worden war.<br />
Mehr noch vielleicht als die Kenntnis der alten heiligen<br />
Sprache des Landes sollte mir in Indien der zufällige Um<br />
stand von Nutzen sein, dass ich die beste Kraft einer Reihe<br />
von Jahren dazu verwendet hatte, mich in die Upanishad's<br />
und den auf ihnen beruhenden Vedänta einzuleben. Wenn<br />
im allgemeinen der Veda für den Inder dieselbe Bedeutung<br />
hat, wie für uns die Bibel, so entsprechen die unter dem<br />
1*
4 I. Vorbereitungen.<br />
Namen Upanishad's gesammelten Schlusskapitel der einzelnen<br />
Veden nach Haltung und Gesinnung dem Neuen Testamente;<br />
und wie auf dem Neuen Testamente die christliche Dogmatik,<br />
so baut sich auf den Upanishad's das religiöse und philo<br />
sophische System des Vedänta auf, welches ich mit zu dem<br />
Besten rechnen muss, was metaphysischer Tiefsinn im Laufe<br />
der Jahrtausende unter den Menschen hervorgebracht hat.<br />
Jedenfalls bildet der Vedänta für Indien noch jetzt wie in alter<br />
Zeit die Grundlage alles höheren geistigen Lebens. Während<br />
das niedere Volk an der Verehrung der Götterbilder sein<br />
Genüge findet, so wird jeder Hindu in dem Masse, wie er<br />
ein denkendes Wesen ist, zu einem Anhänger des Vedänta<br />
in einer seiner verschiedenen Schattierungen und betrachtet<br />
alle Götter, deren Kultus er seiner Familie überlässt, nur als<br />
Symbole des einen, die ganze Welt durchdringenden und in<br />
jedem Menschen verkörperten Ätman. Die genauere Kenntnis<br />
und entsprechende Hochschätzung dieser Lehre von meiner<br />
Seite hat gar sehr dazu beigetragen, die Scheidewand zu be<br />
seitigen, welche sonst den Europäer von den Indern trennt:<br />
mit Verwunderung sahen sie den Fremden an, welcher besser<br />
in ihren heiligen Schriften zu Hause war, als sie es selbst<br />
wohl sein mochten, und mit Entzücken lauschten sie der<br />
Darlegung, wie Europa in der Kantischen Philosophie eine<br />
dem Vedänta auf das engste verwandte Lehre und den diesem<br />
selbst fehlenden wissenschaftlichen Unterbau besitzt.<br />
Aber auch an äusseren Anknüpfungspunkten für alle Teile<br />
Indiens sollte es uns nicht fehlen. Ein günstiger Zufall hatte<br />
es gefügt, dass im September 1892, unmittelbar vor unserer<br />
Reise nach Indien, der neunte Orientalistenkongress in London<br />
tagte. Hier und in Oxford, wo wir mehrere Tage die Gast<br />
freundschaft des Max Müller'schen Hauses genossen, war es<br />
leicht, eine grosse Zahl Empfehlungsbriefe von Gelehrten,<br />
höheren Beamten, Offizieren usw., die lange Jahre in Indien
Der Vedänta. Empfehlungsbriefe. Dhruva und Nazar. 5<br />
gelebt hatten, zu erhalten, welche zum grössten Teil benutzt<br />
worden sind und uns den Zugang zu den gastfreien Kreisen<br />
hochgestellter Engländer in Indien mehr als wir bedurften<br />
eröffnet haben.<br />
Für den näheren Verkehr mit den Eingeborenen freilich,<br />
den wir vor allem wünschten, hätten diese Empfehlungs<br />
schreiben oft mehr hinderlich als fördernd sein können. Hier<br />
kam uns die früher gemachte Bekanntschaft zweier Inder zu<br />
Hülfe, welche uns hundert andere im Lande selbst erschliessen<br />
sollte. Drei Jahre vorher nämlich hatte ich auf dem Orien-<br />
talistenkongress zu Stockholm und Christiania die Bekannt<br />
schaft der beiden dort anwesenden Inder, H. H. Dhruva, zu<br />
letzt Richter in Baroda, und Mansukhläl Nazar gemacht, eines<br />
Kaufmanns, der zusammen mit zwei Brüdern, Ätmaräm und<br />
Utsavläl, ein Importgeschäft in Bombay besitzt, während ein<br />
vierter Bruder, Behariläl, damals noch die Schule besuchte.<br />
In Stockholm hatte ich Dhruva und Nazar eingeladen, mich<br />
auf der Durchreise in Berlin, wo ich damals wohnte, zu be<br />
suchen; sie kamen und haben mich seitdem wiederholt durch<br />
Briefe und andere Zusendungen aus Indien erfreut, deren<br />
Beantwortung sich verschob, bis ich ihnen schliesslich durch<br />
eine Postkarte melden konnte, dass ich am 7. November zu<br />
gleich mit meiner Frau selbst in Bombay einzutreffen hoffe.<br />
Dieser Anknüpfungspunkt sollte für uns von der grössten<br />
Bedeutung werden.
4 I. Vorbereitungen.<br />
Namen Upanishad's gesammelten Schlusskapitel der einzelnen<br />
Veden nach Haltung und Gesinnung dem Neuen Testamente;<br />
und wie auf dem Neuen Testamente die christliche Dogmatik,<br />
so baut sich auf den Upanishad's das religiöse und philo<br />
sophische System des Vedänta auf, welches ich mit zu dem<br />
Besten rechnen muss, was metaphysischer Tiefsinn im Laufe<br />
der Jahrtausende unter den Menschen hervorgebracht hat.<br />
Jedenfalls bildet der Vedänta für Indien noch jetzt wie in alter<br />
Zeit die Grundlage alles höheren geistigen Lebens. Während<br />
das niedere Volk an der Verehrung der Götterbilder sein<br />
Genüge findet, so wird jeder Hindu in dem Masse, wie er<br />
ein denkendes Wesen ist, zu einem Anhänger des Vedänta<br />
in einer seiner verschiedenen Schattierungen und betrachtet<br />
alle Götter, deren Kultus er seiner Familie überlässt, nur als<br />
Symbole des einen, die ganze Welt durchdringenden und in<br />
jedem Menschen verkörperten Ätman. Die genauere Kenntnis<br />
und entsprechende Hochschätzung dieser Lehre von meiner<br />
Seite hat gar sehr dazu beigetragen, die Scheidewand zu be<br />
seitigen, welche sonst den Europäer von den Indern trennt:<br />
mit Verwunderung sahen sie den Fremden an, welcher besser<br />
in ihren heiligen Schriften zu Hause war, als sie es selbst<br />
wohl sein mochten, und mit Entzücken lauschten sie der<br />
Darlegung, wie Europa in der Kantischen Philosophie eine<br />
dem Vedänta auf das engste verwandte Lehre und den diesem<br />
selbst fehlenden wissenschaftlichen Unterbau besitzt.<br />
Aber auch an äusseren Anknüpfungspunkten für alle Teile<br />
Indiens sollte es uns nicht fehlen. Ein günstiger Zufall hatte<br />
es gefügt, dass im September 1892, unmittelbar vor unserer<br />
Reise nach Indien, der neunte Orientalistenkongress in London<br />
tagte. Hier und in Oxford, wo wir mehrere Tage die Gast<br />
freundschaft des Max Müller'schen Hauses genossen, war es<br />
leicht, eine grosse Zahl Empfehlungsbriefe von Gelehrten,<br />
höheren Beamten, Offizieren usw., die lange Jahre in Indien
Der Vedänta. Empfehlungsbriefe. Dhruva und Nazar. 5<br />
gelebt hatten, zu erhalten, welche zum grössten Teil benutzt<br />
worden sind und uns den Zugang zu den gastfreien Kreisen<br />
hochgestellter Engländer in Indien mehr als wir bedurften<br />
eröffnet haben.<br />
Für den näheren Verkehr mit den Eingeborenen freilich,<br />
den wir vor allem wünschten, hätten diese Empfehlungs<br />
schreiben oft mehr hinderlich als fördernd sein können. Hier<br />
kam uns die früher gemachte Bekanntschaft zweier Inder zu<br />
Hülfe, welche uns hundert andere im Lande selbst erschliessen<br />
sollte. Drei Jahre vorher nämlich hatte ich auf dem Orien-<br />
talistenkongress zu Stockholm und Christiania die Bekannt<br />
schaft der beiden dort anwesenden Inder, H. H. Dhruva, zu<br />
letzt Richter in Baroda, und Mansukhläl Nazar gemacht, eines<br />
Kaufmanns, der zusammen mit zwei Brüdern, Ätmaräm und<br />
Utsavläl, ein Importgeschäft in Bombay besitzt, während ein<br />
vierter Bruder, Behariläl, damals noch die Schule besuchte.<br />
In Stockholm hatte ich Dhruva und Nazar eingeladen, mich<br />
auf der Durchreise in Berlin, wo ich damals wohnte, zu be<br />
suchen; sie kamen und haben mich seitdem wiederholt durch<br />
Briefe und andere Zusendungen aus Indien erfreut, deren<br />
Beantwortung sich verschob, bis ich ihnen schliesslich durch<br />
eine Postkarte melden konnte, dass ich am 7. November zu<br />
gleich mit meiner Frau selbst in Bombay einzutreffen hoffe.<br />
Dieser Anknüpfungspunkt sollte für uns von der grössten<br />
Bedeutung werden.
Zweites Kapitel.<br />
Von Marseille nach Bombay.<br />
\17er nach Indien reisen will, namentlich im Herbste, wo<br />
immer ein grosser Touristenschwarm diesem Lande zu<br />
strebt, der wird wohl tun, sich drei Monate vorher einen<br />
Platz auf einer der verschiedenen englischen, französischen,<br />
italienischen, norddeutschen, östreichischen Dampferlinien<br />
durch Einzahlung des halben Preises zu sichern, wobei die<br />
nach Norden gekehrte Seite des Schiffes, weil kühler, vor<br />
der südlichen den Vorzug verdient, wie auch, aus demselben<br />
Grunde, die höher gelegenen Kabinen vor denen des unteren<br />
Decks, namentlich da die Fenster der letzteren so tief zu<br />
liegen pflegen, dass sie nur bei sehr ruhigem Seegange<br />
geöffnet werden dürfen.<br />
Wir hatten den besten Zeitpunkt versäumt, und als wir<br />
Ende September 1892 uns in London in Fenchurch Street<br />
und Umgebung, wo die Dampferlinien der verschiedenen<br />
Nationen ihre Bureaus haben, anfingen nach Plätzen umzu<br />
sehen, da wollte sich zuerst nirgend etwas Zusagendes<br />
bieten. Namentlich waren die Schiffe der Peninsular &<br />
Oriental Company, welche die englische Post beförderte,<br />
am schnellsten fuhr und für die sicherste galt, auch keine<br />
Zwischendeckspassagiere aufnahm, sondern nur solche der<br />
beiden ersten Klassen, bis weit in den November hinein
Buchung in London. Über Land nach Marseille. 7<br />
schon vollständig besetzt; und auch das neueste und grösste<br />
Schiff dieser Gesellschaft, der Himälaya, welcher, als Extra<br />
schiff eingeschoben, am 15. Oktober zum ersten Male die<br />
Fahrt nach Bombay machen sollte, hatte zu unserem Leid<br />
wesen keine Kabine mehr frei, da doch der Name und die<br />
Grösse des Schiffes, der Gedanke, noch ungebrauchte Räume<br />
zu bewohnen, sowie die Erwartungen, die man von diesem<br />
neuen Dampfer hegte, uns den Himälaya als besonders be<br />
gehrenswert erscheinen Hessen; und als durch einen Zufall<br />
eine besetzt gewesene und wieder frei gewordene Kabine<br />
desselben sich uns anbot, freilich nur zweiter Klasse, im<br />
unteren Deck und nach Süden gelegen, da fassten wir nach<br />
längerem Schwanken einen herzhaften Entschluss, lösten<br />
sechsmonatliche, von Marseille nach Bombay und zurück<br />
von Colombo nach Brindisi gültige Billets und schrieben<br />
uns, nicht ganz leichten Herzens, in der frei gewordenen<br />
Kabine ein. Über die zu erwartende Hitze tröstete uns der<br />
Gedanke, dass man ja doch von Suez ab auf dem Deck<br />
schlafen werde; eine etwas geringere Kost fiel um so<br />
weniger ins Gewicht, als auch die der ersten Klasse auf den<br />
Peninsular-Dampfern nicht gerade berühmt ist, und die Er<br />
wartung, statt mit dem eleganteren Touristenpublikum, mit<br />
Geschäftsleuten, Subalternbeamten, Missionaren und dgl. für<br />
vierzehn Tage zusammen zu sein, war nicht ohne besonderen<br />
Reiz. Auch war die Ersparnis beträchtlich: statt 1600 Mk.<br />
in der ersten Klasse kostete das sechsmonatliche Retour-<br />
billet zweiter Klasse für jede Person nur 1000 Mk. Wir<br />
schafften unser grösseres Gepäck schon in London auf den<br />
Himälaya und Hessen es auf dem stets unruhigen Atlantischen<br />
Ozean allein die Reise um Gibraltar herum machen, während<br />
wir selbst noch einmal unseren Lieben in Deutschland Lebe<br />
wohl sagten, in Genf einen erquickenden Tag mit Freund<br />
Oltramare, meinem ältesten Schüler in der Philosophie und<br />
im Sanskrit, zubrachten, um dann über Lyon nach Marseille
8 II. Von Marseille nach Bombay.<br />
zu eilen, wo wir unsere Ausstattung durch einen auf dem<br />
Schiffe sehr brauchbaren Deckstuhl (eine aus Stroh ge<br />
flochtene Chaiselongue) und namentlich durch zwei Sonnen<br />
hüte aus Kork vervollständigten. Die letzteren sind zwar auf<br />
der Seefahrt überflüssig, können aber schon beim Aussteigen<br />
in Bombay nicht ohne Gefahr entbehrt werden. Am 22.<br />
Oktober 1892, nachmittags vier Uhr, begaben wir uns in<br />
Marseille an Bord des Himälaya.<br />
Nichts gleicht dem Durcheinander, welches auf einem<br />
grossen Seedampfer während der letzten Stunden vor der<br />
Abfahrt herrscht. Kohlen werden eingeladen, Gepäckstücke<br />
aus- und eingeschifft, der Koch und seine Gehülfen sind<br />
beschäftigt, grosse Körbe mit Geflügel oder Gemüse zu<br />
übernehmen, die Matrosen machen sich an dem Tauwerk zu<br />
schaffen, die Kellner haben alle Hände voll zu tun, um den<br />
mit mancherlei Gepäck einströmenden und sich gegenseitig<br />
den Weg versperrenden Ankömmlingen ihre Kabinen anzu<br />
weisen, während Händler und Trödler das Schiff durch<br />
schwärmen, um Früchte, Schmuckgegenstände, Photographien<br />
und allerlei Plunder 2um Verkauf anzubieten. Endlich be<br />
ruhigt sich das Gewühl, Händler und abschiednehmende<br />
Freunde müssen das Schiff verlassen, als letzter der Agent<br />
der Gesellschaft und der Postbote mit den in der Abschieds<br />
stunde eifrig geschriebenen Briefen, die Dampfpfeife ertönt<br />
einige Male, die mächtige Sehraube setzt sieh langsam und<br />
dann immer schneller in Bewegung, wir verlassen den Hafen,<br />
und bald sind wir im offenen Meere und sehen die Küste<br />
hinter uns in der Abenddämmerung versinken.<br />
Es zeigte sich, dass wir wohlgetan hatten, den Dampfer<br />
erst in Marseille und nicht schon in London zu besteigen,<br />
denn der schneidende Nordwind, der uns bis nach Genf als<br />
Bise, bis nach Marseille als Mistral begleitete, hatte auf dem<br />
Atlantischen Ozean als Sturm gewirtschaftet, derselbe Sturm,<br />
dem die gleichzeitig mit dem Himälaya von London abge-
Einschiffung. Sardinien und Korsika. Messina und Reggio. 9<br />
gangene und ebenfalls nach Indien bestimmte Rumania an<br />
der portugiesischen Küste zum Opfer gefallen war. Jetzt<br />
aber legte sich der Wind, die noch bei der Abfahrt von der<br />
französischen Küste aufgeregten Wogen glätteten sich, und<br />
wir behielten die schönste, ruhigste See bis nach Bombay<br />
hin. Als ich am nächsten Morgen — es war Sonntag, der<br />
23. Oktober — aus der engen Kajüte drei Treppen hinauf<br />
aufs Deck kletterte, um die ozonreiche Seeluft in tiefen<br />
Zügen einzuatmen, da sah ich rechts von uns die lang<br />
gestreckte Küste Sardiniens, links die ragenden Gebirge<br />
Korsikas von der aufgehenden Sonne beleuchtet liegen.<br />
Schon hier machte sich die Kraft der südlichen Sonne be<br />
merkbar, und als ich gegen Mittag, nach der Kirche, mit<br />
einem leichten Hut auf dem Kopfe eine Zeitlang in der Sonne<br />
gesessen, war mir nachher der Kopf so eingenommen, dass<br />
ich beschloss, dieses als ein Warnungszeichen anzusehen und<br />
mich nicht wieder ohne gehörigen Schutz der Sonne auszu<br />
setzen. Am nächsten Morgen in der Dämmerung grüssten<br />
mich rechts die Lichter von Messina mit seinem Leuchtturm,<br />
den ich ein Jahr zuvor noch bestiegen hatte, ohne Hoffnung,<br />
ihn so bald und mit so beglückenden Aussichten für die<br />
nächste Zukunft wiederzusehen, während links die Lichter<br />
des kleinen Reggio uns an ein kümmerliches und übereiltes<br />
Mahl und eine darauf folgende lange Nachtfahrt auf der Eisen<br />
bahn erinnerten, bei der ich um ein Uhr nachts im Halb<br />
schlafe die Station Cotrone, das ehemalige Kroton, die<br />
berühmte Pflanzstätte des Pythagoreismus, hatte ausrufen<br />
hören. Jetzt konnte uns das alles nicht locken, und auch<br />
dem Ätna nahmen wir es nicht übel, dass er sein Haupt<br />
in dichte Wolken gehüllt hatte, nachdem wir ein Jahr zu<br />
vor von Taormina aus im schönsten Sonnenglanze seine<br />
mächtigen Schneefelder und den in kräuselnden Wölkchen<br />
aus seinem Krater aufsteigenden Rauch hatten beobachten<br />
können.
10 II. Von Marseille nach Bombay.<br />
Rasch entschwand Siciliens Küste unsern Blicken; immer<br />
farbenreicher wurde das Meer, immer glänzender strahlte die<br />
Sonne vom dunkelblauen Himmel herab; endlich versank sie,<br />
nicht unerwünscht, im westlichen Ozean, und als wir sie am<br />
nächsten Morgen wieder aus der Purpurglut des Ostens auf<br />
steigen sahen, da streckte sich.schon zu unserer Linken mit<br />
ihren herrlichen Bergformen die südliche Küste Kretas hin.<br />
Ausgezeichnet. schien sich der Himälaya zu bewähren, und<br />
schon prophezeite man sich, dass unsere Fahrt die schnellste<br />
sein werde, die je nach Indien gemacht worden, — aber es<br />
sollte anders kommen. Eben hatten wir gegen Mittag zur<br />
Linken immer noch Kreta und zur Rechten eine kleine Insel,<br />
vermutlich Klauda, wo das Schiff de.s Apostels Paulus, nach<br />
dem es gegen dessen Rat Kreta verlassen hatte, ver<br />
gebens zu landen suchte (Apostelg. 27,16), da geschah das<br />
gänzlich Unerwartete: die. Maschine, deren gleichmässiges<br />
Arbeiten bei Tag und Nacht uns schon zur Gewohnheit<br />
geworden war, stand plötzlich still, und eine unheimliche<br />
Ruhe trat ein. Allgemeine Aufregung bemächtigte sich der<br />
Mitfahrenden, allerlei Vermutungen wurden laut, niemand<br />
wusste etwas Bestimmtes zu sagen, denn aus den Schiffs<br />
offizieren, denen in solchen Fällen Schweigen Pflicht ist,<br />
war nichts herauszubekommen. Nur so viel war klar, dass<br />
der unwillkommene Aufenthalt seine triftigen Gründe haben<br />
musste; denn der Himälaya verbrauchte, wie mir einer seiner<br />
Offiziere mitgeteilt hatte, täglich 110 Tonnen Kohlen, die<br />
Tonne zu 30 Schillingen, also täglich für 3300 Mk., sodass<br />
jeder Aufenthalt sehr kostspielig war. Endlich, nach, fünf<br />
stündigem Hämmern im Maschinenräume, ging es weiter, aber<br />
mit verminderter Geschwindigkeit, sodass wir erst nach etwa<br />
dreissig Stunden abends spät in Port Sai'd Anker warfen, wo wir<br />
dann am andern Morgen zum Frühbade statt des klaren Meer<br />
wassers eine trübe Flüssigkeit sich ergiessen sahen. Bis<br />
Mittag lagen wir hier still, durch Reparaturen aufgehalten,
Aufenthalt vor Kreta. Port Said. Suezkanal. 11<br />
sahen uns gegenüber das mittelmässige Hotel, wo wir drei<br />
Jahre früher übernachtet hatten, sahen das Treiben auf den<br />
Strassen und auf dem Hafen, ohne dass doch jemand das<br />
Schiff hätte verlassen oder betreten können, da wir, weil<br />
von dem choleraverdächtigen Marseille kommend, unter<br />
Quarantäne lagen. Die einzigen, welche den Bann brachen<br />
und als sehr unwillkommene Mitreisende sich einstellten,<br />
waren eine grosse Menge Fliegen, die wir erst im Indischen<br />
Ozean nach und nach wieder los wurden. Endlich, gegen<br />
ein Uhr mittags, ging es von Port Said weiter und in den<br />
Suezkanal hinein. Zur Linken Asien, zur Rechten Afrika,<br />
beiderseits flaches Wüstenland, soweit das Auge reicht, und<br />
dazwischen der Kanal, gelegentlich durch Landseen führend,<br />
in der Regel aber nur eine schmale Wasserrinne, doppelt<br />
so breit wie das Schiff selbst, bildend, darüber der wolken<br />
lose ägyptische Himmel, um uns die warme, trockne, reine<br />
Wüstenluft, bei deren Durchsichtigkeit alle Gegenstände von<br />
energischen Farben belebt erscheinen, — das waren die<br />
wesentlichen Eindrücke der Kanalfahrt, welche auch die<br />
Nacht durch geht, aber doch neunzehn Stunden beansprucht,<br />
da nur langsam gefahren werden darf, auch wohl ein halbes<br />
Dutzend mal gehalten werden muss, um andere Schiffe vorbei<br />
zu lassen, wobei das Schiff, wegen der herrschenden<br />
Strömungen, jedesmal am Ufer mit Tauen festgebunden wird.<br />
Am andern Morgen lag Suez vor uns und die dahinter liegen<br />
den höhen Berge im Westen, alles in ein wunderbares Frührot<br />
getaucht. Freilich ist die ganze Gegend vegetationslos, bis<br />
auf die Umgebung des bei Suez mündenden Süsswasser-<br />
kanals, welche im herrlichsten Grün prangt. Nach kurzem<br />
Aufenthalte ging es ins Rote Meer hinein; zur Linken konnten<br />
wir den ganzen Nachmittag die zerklüfteten Gebirgsmassen<br />
der Halbinsel Sinai beobachten, bis deren Südspitze erreicht<br />
ist, das Meer sich verbreitert und nun sehr bald alles Land<br />
bis auf ein paar vereinzelte Inselchen für drei Tage dem
12 II. Von Marseille nach Bombay.<br />
Auge völlig entschwindet. Dass man aber in einem ge<br />
schlossenen Meere zwischen zwei ungeheuren Wüstenländern<br />
durchfährt, macht sich durch die hier herrschende grosse<br />
Hitze jedem bemerkbar. Gleich nach Suez legen die<br />
Schiffsoffiziere ihre dunkle Uniform ab und erscheinen in<br />
weissen Anzügen, und alles beeilt sich ihrem Beispiele zu<br />
folgert. Bei den Mahlzeiten in der Kajüte schwingt unablässig<br />
die Pankha; d. h. über jedem Tische hängt, ihn in seiner<br />
ganzen Länge begleitend, ein fussbreiter Streifen von dickem<br />
Zeug, durch Stangen und Angeln an der Decke befestigt;<br />
alle diese Streifen sind durch Stricke verbunden, welche auf<br />
Rollen nach aussen leiten und von dort, durch ziehende Diener<br />
in Bewegung gesetzt, ziemlich schnell unmittelbar über den<br />
Köpfen der Sitzenden hin und her schwingen und eine starke<br />
Zugluft veranlassen. Ohne Pankha zu essen würde kaum<br />
möglich sein; selbst bei den sonntäglichen Gottesdiensten<br />
begleitet sie mit ihrem eintönigen dumpfen Geräusch die<br />
Stimme des Geistlichen. In den Kabinen war es vollends<br />
nicht auszuhalten. Ein Aufenthalt von wenigen Minuten<br />
genügte, um die heftigste, jeden neu angelegten Kragen so<br />
gleich wieder entstellende Transpiration hervorzurufen. Ein<br />
Schlafen in derselben, obgleich alle Türen, Fenster und<br />
Luken geöffnet waren, wurde nachgerade zur Unmöglichkeit.<br />
Zuletzt legte ich mich auf den Boden, die harte Schwelle<br />
der geöffneten Tür als Kopfkissen benutzend, und als auch<br />
so keine Ruhe zu finden war, beschlossen wir, den Wider<br />
stand des etwas faulen und stets Ausflüchte suchenden<br />
Kellners zu brechen, und gaben strikten Befehl, für die<br />
nächste Nacht unsre Betten nach oben aufs Deck zu<br />
schleppen. Dieses Verfahren, so sehr es auch seine Schatten<br />
seiten hatte, wurde bald von allen eingeschlagen und bis<br />
ans Ende der Reise festgehalten. Abends gegen zehn Uhr,<br />
wenn Mrs. Shakespeare (eine Offiziersfrau mit drei hübschen<br />
Töchtern) sich von dem auf dem Verdeck stehenden Pianino
Rotes Meer. Pankha. Schlafen auf Deck. Kinder. 13<br />
erhob, die tanzenden Paare sich trennten, und endlich eine<br />
gewisse Ruhe eintrat, da kamen die Kellner mit den Matratzen<br />
und Kissen aus den verschiedenen Kajüten heraufgekeucht;<br />
eine Barrikade aus Deckstühlen markierte die Grenze zwischen<br />
der Herren- und Damenseite, und im übrigen konnte jeder<br />
sich ein Plätzchen je nach Wunsch, auf den Bänken oder<br />
daneben, hinter einer Kajütenwand oder in der freien Zugluft,<br />
aussuchen, dort sich auf seine Matratze strecken und abwarten,<br />
bis das Geplapper verstummte und das eintönige Ächzen der<br />
Maschine anfing, sich in seine Traumbilder zu verweben.<br />
An ein Ausschlafen war freilich nicht zu denken. Denn<br />
allmorgendlich um fünf Uhr erschienen mit Eimern und Besen<br />
die schwarzbraunen Matrosen, um das Deck mittels eines<br />
transportablen Schlauches unter Wasser zu setzen und<br />
gründlichst zu scheuern. Dann war es ein Hauptvergnügen,<br />
nur von der Paijama (Nachtanzug, bestehend in Hose und<br />
Jacke aus ganz dünnem Wollstoff) bekleidet, mit nackten<br />
Füssen in dem kühlen Nass spazieren zu gehen, bis gegen<br />
halb acht nach und nach die Damen auf dem Deck erschienen,<br />
und das Feld geräumt werden musste. Ein kleiner Imbiss,<br />
bestehend aus Thee, Kaffee und Butterbrot, die sogenannte<br />
Chota Hdziri, stand nach indischer Weise schon um 6 Uhr<br />
bereit. Um neun Uhr folgte ein substantielles Frühstück,<br />
Thee mit Fisch, Eiern, Fleisch u. dgl. Der weitere Vormittag<br />
wird natürlich allgemein auf dem Deck zugebracht. Die<br />
einen sitzen und liegen auf den Stühlen umher, hier bilden<br />
sich plaudernde Gruppen, dort sind andere mit Lesen be<br />
schäftigt, und wieder andere gehen emsig auf und ab, um<br />
dem schlimmsten Übel einer langen Seefahrt, dem Mangel<br />
an Bewegung, nach Kräften abzuhelfen. Freilich muss man<br />
dabei vermeiden, auf die zahlreichen, überall umherkrabbelnden<br />
Kinder zu treten. Kleine Kinder etwa bis zu sieben Jahren<br />
werden nämlich von ihren Familien ohne Bedenken mit nach<br />
Indien genommen. Werden sie grösser, so müssen sie in
14 II. Von Marseille nach Bombay.<br />
der Regel nach Europa geschickt werden, da die indische<br />
Hitze, vermutlich weil sie den Appetit benimmt und den Schlaf<br />
beeinträchtigt, ein gedeihliches Wachstum verhindert. Um<br />
zwei Uhr folgte in der zweiten Klasse das Mittagessen, um<br />
vier Uhr Wieder Thee, um fünf Uhr war es ein amüsantes<br />
Schauspiel, dem Abendessen der von ihren Müttern oder<br />
Bonnen bedienten Kinder zuzusehen, um sieben Uhr folgte<br />
das Abendessen der Erwachsenen und um neun Uhr abends<br />
nochmals Thee. Die Quantität war immer ganz, genügend,<br />
die Qualität Hess des öfteren sehr zu wünschen übrig. Eine<br />
besondere Wohltat war das allezeit sehr liberal gespendete<br />
Eis. Dasselbe wird in dem unter einem eignen Offizier<br />
stehenden Freezing Room bereitet, in welchem bei aller<br />
tropischen Hitze eine derartige Kälte herrscht, dass, wie man<br />
erzählte, einstmals ein zufällig in einem solchen Freezing Room<br />
eingeschlossener Matrose erfroren sein soll. Die Stunden nach<br />
dem Abendessen brachten mancherlei Unterhaltung, gewöhnlich<br />
einen Tanz auf dem Deck, gelegentlich ein Konzert, zu dem<br />
die andere Klasse feierlich eingeladen wurde, ja einmal ver<br />
stieg man sich sogar zu einem Kostümball mit Masken, da<br />
die nach Indien übersiedelnden Familien allen dazu nötigen<br />
Plunder mit sich führen. Im ganzen war die Reisegesellschaft<br />
nicht gerade sehr angenehm, weit weniger als auf dem<br />
Rückwege, wo wir ein von Australien kommendes Schiff<br />
bestiegen und mit Leuten zusammen waren, die dort ihre<br />
Geschäfte abgeschlossen und ihre Erfahrungen gemacht<br />
hatten und nun zum Ruhestande oder zur notwendigen Er<br />
holung in die Heimat zurückkehrten. Im Gegensatze dazu<br />
bestand das Publikum auf der Hinreise zumeist aus jüngeren,<br />
turbulenten Elementen. Schon hier machte sich der Übermut<br />
bemerklich, der sich des jungen Engländers zu bemächtigen<br />
pflegt, wenn er als Kaufmann oder angehender Beamter mit<br />
verhältnismässig hohem Gehalte nach Indien geht. Die<br />
jungen Leute, von denen das Schiff vollgepfropft war, mit
Leben auf dem Schiff. Tropenkoller. Aden. 15<br />
ihrem lärmenden Treiben, kamen mir vor wie Raubvögel, die<br />
sich auf ihre Beute stürzen. Ihre geräuschvollen Spiele, ihr<br />
Zechen und Tanzen Hess keine gesammelte Stimmung, kein<br />
gehaltvolleres Gespräch aufkommen; die Trivialität behielt die<br />
Oberhand. Es musste ertragen werden, es ging ja bald<br />
vorüber. Nur das wiederholte Stillstellen der Maschine, auch<br />
während der heissen Fahrt durch das Rote Meer und mit<br />
unter für den ganzen Tag, erregte ernstliche Besorgnis darüber,<br />
wann und wie wir wohl das Ziel erreichen würden. Endlich,<br />
nach dreitägiger Fahrt auf dem Roten Meere, nachdem wir<br />
Mekka und Medina mit ihrem Seehafen Yeddo zur Linken,<br />
Suakin mit Massaua nebst so mancher unwirtlichen und<br />
gefährlichen Gegend zur Rechten, ohne von dem allen irgend<br />
etwas zu sehen, hinter uns gebracht hatten, erschien links<br />
das kaffeeberühmte Mokka, und nun durften wir hoffen, in<br />
Kürze Aden zu erreichen und aus dem Glutkessel des Roten<br />
Meeres in den luftigen und frischen Indischen Ozean zu<br />
gelangen. Glücklich wurde das Tor der Tränen, Bab el<br />
Mandeb, passiert, wo schon so manches stolze Schiff ge<br />
scheitert ist und hier und da das memento mori einiger aus dem<br />
Wasser hervorragender Mastbäume sich den Blicken zeigte.<br />
Vor Aden warfen wir abends spät für einige Stunden Anker<br />
und sahen die Gebäude am Ufer und die sonnenverbrannten<br />
öden Gebirge dahinter im zauberhaften Glänze des Mondes<br />
vor uns liegen. Vor dem Schlafengehen auf Deck war ich<br />
noch einmal in meine Kabine heruntergestiegen und hatte<br />
das elektrische Licht derselben aufgedreht, als ich, durch das<br />
geöffnete Fenster blickend, unmittelbar neben mir ein paar<br />
schwarze Gesichter mit glänzenden Augen und schneeweissen<br />
Zähnen auftauchen sah. Es waren Somalineger, welche, unter<br />
dem Schutze der Nacht der Quarantäne trotzend, in ihrem Boot<br />
an das Schiff herangefahren waren und durch die wenige<br />
Fuss über dem Wasserspiegel liegenden Kabinenfenster allerlei<br />
Kuriositäten zum Kaufe hereinreichten. Ich kaufte zu massigen
16 II. Von Marseille nach Bombay.<br />
Preisen eine Flasche aus buntfarbigem Stroh und ein statt<br />
liches Antilopengeweih, deren ich mich später durch Ver<br />
schenken entledigte, nachdem ich sie noch eine Weile mit<br />
mir in Indien herumgeschleppt hatte.<br />
Der nächste Morgen fand uns in der freieren Region<br />
des Indischen Ozeans. Links begleiteten uns noch einen<br />
halben Tag, immer mehr zurückweichend, die schöngeformten<br />
Berge der Südküste Arabiens; dann verschwand für sieben<br />
Tage lang alles Land. Ein beruhigendes Gefühl war es, dass<br />
der Himälaya die Postsachen nach Indien nicht an einen<br />
anderen der zwischen Aden und Bombay verkehrenden<br />
Dampfer abgegeben hatte; wir schlössen daraus, dass man<br />
trotz der gehabten und noch zu erwartenden Verspätung<br />
mit Sicherheit die Post wenigstens vor dem Verfalltermine<br />
in Bombay einzubringen hoffen durfte, da für den entgegen<br />
gesetzten Fall die Gesellschaft eine sehr hohe Konventional<br />
strafe zu zahlen hat. Im übrigen fuhr man langsam und<br />
immer langsamer, und wiederholt musste der Dampfer<br />
für einige Stunden stillgelegt werden, während der Ozean<br />
in Spiegelglätte um uns lag, und zahlreiche Haifische das<br />
Schiff umspielten und gierig nach den Küchenabfällen<br />
schnappten. Eines Nachmittags, als wir wieder einmal gerade<br />
still lagen, amüsierten sich die sportlustigen Engländer, mit<br />
einer in einen grossen Haken auslaufenden Ankerkette, an<br />
die man ein Stück Fleisch befestigt hatte, nach Haifischen<br />
zu angeln, und wirklich gelang es, eines dieser Ungetüme<br />
an Bord zu ziehen. Es schlug beim Heraufwinden so furcht<br />
bar mit dem Schwänze um sich, dass derselbe abgehackt<br />
werden musste, ehe man den Fisch aufs Deck zu bringen<br />
wagte. Da lag nun das Monstrum, wohl mehr als sechs<br />
Fuss lang und dick wie ein gemästetes Schwein, und fing<br />
erst nach und nach an sich zu beruhigen, umstanden in<br />
respektvoller Entfernung von der Corona der neugierigen<br />
Zuschauer. Schon hatte man ihn ausgeweidet, das Herz,
Indischer Ozean. Ankunft in Bombay. 17<br />
nicht grösser als eine Taschenuhr, ging, immer noch pak<br />
tierend, von Hand zu Hand, und trotzdem hatte das Unge<br />
heuer noch Lebenskraft genug, sich zuweilen von einer Seite<br />
auf die andere zu wälzen, zum Entsetzen der zurück<br />
weichenden Zuschauer. Endlich lag der Hai tot und regungs<br />
los da. Man zog ihm zum Andenken ein grösseres Stück<br />
Haut ab und wollte den Rest dem Meere wiedergeben, da<br />
traten einige Neger aus der Schiffsmannschaft hervor und<br />
erbaten sich das Fleisch als Geschenk. Gerne wurde dies<br />
bewilligt, und sie schleppten den Fisch davon, wobei man<br />
sie in ihrem Negerenglisch sagen hörte: „Hai frisst Neger,<br />
warum soll nicht auch Neger fressen Hai?"<br />
Unter diesen und ähnlichen Belustigungen verging die<br />
Zeit, bis wir endlich am Sonntag, dem 6. November gegen<br />
Mittag im Osten die hochragenden Kämme des Ghatta-<br />
Gebirges auftauchen sahen. Wenige Stunden später ver<br />
wandelte sich das azurne Blau des Ozeans in ein schmutziges<br />
Gelb, immer deutlicher erschienen links die Villen von<br />
Malabar Hill und vor uns die palmenumgebenen Türme und<br />
Prachtgebäude von Bombay, gegen Abend umschifften wir<br />
Colaba Point und warfen Anker in dem meilenbreiten Hafen<br />
von Bombay, der im Westen vom offnen Ozean durch die<br />
mächtige Landzunge oder Insel getrennt ist, auf der die Stadt<br />
Bombay liegt. Bald waren wir von Dampfbarkassen, Segel<br />
booten, deren hohej Rahen aus Bambusrohr bis auf unser<br />
Deck ragten, und allerlei anderen Fahrzeugen umschwärmt,<br />
und nun entstand bei hereinbrechender Dämmerung auf dem<br />
Schiff ein unbeschreibliches Getümmel. Beamte vom Lande<br />
und Kommissionäre der Hotels, Bootsleute und Gepäck<br />
träger und zur Begrüssung heraufkommende Freunde, dazu<br />
die 340 Passagiere des Schiffes mit ihren Gepäckstücken<br />
und die 361 Angestellten, welche die Bemannung des Schiffes<br />
bildeten, vom Kapitän bis herab zu den untersten Aufwärtern,<br />
Heizern und Kohlenschleppern, alles das wogte und lärmte<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 2
18 II. Von Marseille nach Bombay.<br />
in einem unglaublichen Wirrwarr durcheinander. Auch unsre<br />
Freunde waren an Bord gekommen, ohne jedoch uns heraus<br />
zufinden. Da wir nicht, wie so viele andere, noch am selben<br />
Abend mit der Bahn landeinwärts zu reisen gedachten, so<br />
entschlossen wir uns, die Nacht noch in gewohnter Weise<br />
auf dem Deck zu schlafen. Es war, nachdem so viele<br />
lärmende Gesellen uns verlassen hatten, der erquicklichste<br />
Abend, den wir auf dem Himälaya zugebracht, trotz der<br />
drückenden Schwüle, die beim Stillstehen des Schiffes so<br />
gleich doppelt fühlbar war. Am andern Morgen übergaben<br />
wir unser Gepäck dem Hoteldiener, bestiegen ein Boot, sagten<br />
dem Koloss, der uns so lange beherbergt hatte, mit dank<br />
baren Gefühlen Lebewohl, betraten mit unbeschreiblichen<br />
Empfindungen bei Apollo Bandar den heiligen Boden Indiens<br />
und waren eine Viertelstunde darauf wohlbehalten in einem<br />
vorausbestellten geräumigen Zimmer des Esplanade-Hotels<br />
untergebracht.
Seite 18.<br />
0><br />
o<br />
i-<br />
E<br />
o<br />
><br />
cB<br />
X<br />
cd<br />
.a<br />
E<br />
o<br />
CQ<br />
c<br />
o<br />
><br />
CS<br />
E<br />
1h<br />
o<br />
c<br />
C3<br />
CL
Bombay.<br />
Drittes Kapitel.<br />
VlZatson's Esplanade-Hotel, in dem wir für einige Wochen<br />
unsren Wohnsitz aufschlugen, gilt für das erste Hotel in<br />
Bombay und ist eines der grössten, wenn nicht das grösste,<br />
in ganz Indien. Es hat aber, wie so vieles in Bombay und<br />
Calcutta mit ihren nahen Beziehungen zu Europa, keinen<br />
so ausgeprägt indischen Typus wie die zwanzig bis dreissig<br />
weiteren Hotels, die wir später in allen Teilen Indiens be<br />
wohnt haben, und von denen eine kurze Charakteristik hier<br />
folgen mag. Vprausbemerkt sei, dass wir grundsätzlich,<br />
schon aus Gesundheitsrücksichten, immer im ersten Hotel des<br />
Orts abstiegen. Häufig freilich war dies zugleich das einzige,<br />
und manche Orte, wie Ujjayini (Ujjain), Gayä und andre,<br />
waren ganz ohne Hotel. In diesem Falle pflegt die Regierung<br />
ein Absteigehaus, Dak Bungalow (Posthaus) genannt, zu unter<br />
halten, in welchem man Anspruch auf ein Zimmer mit Bett<br />
für eine Rupie (damals 1,25 Mk., jetzt 1,33 Mk.) die Person<br />
hat, mit der Bedingung, in der nächsten Nacht das Zimmer<br />
zu räumen, wenn ein Neuangekommener, der sonst nicht<br />
unterzubringen ist, dasselbe beanspruchen sollte. In der<br />
Regel jedoch ist man, der einzige Gast des kleinen Hauses.<br />
Die Einrichtung der Zimmer ist ganz primitiv, die Betten,<br />
in der Regel insektenfrei, sind mittelmässig, wenn auch lange
20 IH. Bombay.<br />
nicht so schlecht wie. in Griechenland, und "meistens ohne<br />
Mückennetz, welches man daher wohl tut mit sich zu führen.<br />
Die Oberbetten, d. h. Kissen, dicke Steppdecke als Unter<br />
lage (Razai) und Reisedecke zum Zudecken führt jeder<br />
Reisende zusammengerollt als Gepäckstück mit sich, da sie<br />
weder auf den Eisenbahnfahrten, noch in den Hotels, viel<br />
weniger in den Dak Bungalows entbehrt werden können.<br />
Mitunter sind die Zimmertüren der letzteren ohne richtig<br />
funktionierende Schliessvorrichtung; so in Amritsar, wo uns<br />
nichts übrig blieb, als die Tür mit unseren sämtlichen<br />
Gepäckstücken zu verbarrikadieren. Die Verpflegung in den<br />
Dak Bungalows ist meist sehr mittelmässig. Ein Koch oder<br />
der Verwalter selbst liefert die Mahlzeiten. Die Preise dafür<br />
sind von der Regierung vorgeschrieben, aber die Qualität<br />
hängt von der Fähigkeit, dem guten Willen und dem Ehr<br />
geize des fast ausnahmslos mohammedanischen Koches ab.<br />
Gelegentlich kam es vor, dass er uns auf die Empfehlung<br />
eines befreundeten Einwohners hin ein recht gutes Mahl<br />
lieferte, aber oft trafen wir es auch anders, wie noch zu<br />
berichten sein wird. Ungefähr auf gleicher Stufe mit den<br />
Dak Bungalows stehen die Refreshment Rooms der kleineren<br />
Eisenbahnstationen, auf denen man auch an Orten, wo kein<br />
Dak Bungalow vorhanden oder ein solches zu fern Hegt, im<br />
Waiting Room übernachten kann. Ist dasselbe schon besetzt,<br />
so stellt der gefällige Station Master wohl auch einen Eisen<br />
bahnwagen zur Verfügung. Beides geschieht unentgeltlich,<br />
ist aber doch wenig zu empfehlen; denn der Lärm des<br />
Rangierens hört selten auf, und wenn ein Zug spät abends,<br />
früh morgens oder in der Nacht fährt, so kommen stunden<br />
lang vorher die Eingeborenen in grossen Scharen und<br />
hocken nach indischer Weise in schwatzenden Gruppen<br />
auf der blossen Erde um das Stationsgebäude herum;<br />
die Luft wird sehr schlecht, und der Lärm ist kaum auszuhalten.
Reisebetten. Hotelwesen. Reisekosten. Münzsorten.. 21<br />
Indessen kommt man selten in die Lage, von diesen<br />
Notbehelfen Gebrauch zu machen, da an allen besuchteren<br />
Orten ganz gute, fast durchweg von Engländern gehaltene<br />
Hotels bestehen. Ihre Preise sind sehr massig. Wie in<br />
Spanien, Palästina und Ägypten, besteht die Sitte, dass man<br />
die Pension für den ganzen Tag nimmt. Diese betrug für<br />
Zimmer und drei reichliche Mahlzeiten, mit Ausnahme von,<br />
Bombay, Calcutta und Darjeeling, in den ersten Hotels nie<br />
weniger und nie mehr als fünf Rupien (gleich 6,25 Mk., jetzt<br />
6,66 Mk.). Diese Gleichmässigkeit des Preises macht es<br />
möglich, die Kosten einer Reise nach Indien ziemlich genau<br />
voraus zu berechnen. Das sechsmonatliche Retourbillet, die<br />
Beköstigung einbegriffen, beträgt II. Klasse 1000 Mk., die<br />
Eisenbahnfahrt durch ganz Indien I. Klasse ungefähr 500 Mk.,<br />
vier bis fünf Monate Hotelleben werden sich auch auf tausend<br />
Mark belaufen, und rechnet man hierzu 500 Mk. für Getränke,<br />
Gepäck, Wagen, Trinkgelder und Diener, so ergibt sich,<br />
dass man die Reise nach Indien bei sparsamer Einrichtung<br />
mit 3000 Mk. und bei höheren Ansprüchen mit 4000 Mk. ganz<br />
bequem unternehmen kann. Als Reisegeld dient ein Kredit<br />
brief, auf den man, wie in allen grösseren Städten Europas, in<br />
Bombay, Calcutta, Madras und Colombo Geld erheben kann.<br />
Die landesübliche Münze ist die Rupie, ein Silberstück in der<br />
Grösse von zwei Mark, welche in Indien in 16 Ana's, in Ceylon<br />
in 100 Cents zerfällt. Die Ana zerfällt weiter in vier Paisa's<br />
(Kupferstücke von der Grösse eines Sou), die Paisa in drei<br />
Pie's, und als kleinste Münze kursieren von alters her kleine<br />
Muscheln, auf Sanskrit Kapardikä, jetzt Kauri genannt, deren<br />
man mir auf dem Markte zu Benares für eine Paisa achtzig<br />
einwechselte, was auf die Rupie 5120 Stück machen würde.<br />
Gold kommt nicht vor; hingegen hat man Banknoten zu 10,<br />
25, 50, 100, 500 Rupien und höher; ja auf der Bank in<br />
Lahore habe ich selbst eine Banknote von 10000 Rupien<br />
in Händen gehabt, welche sich von den Zehn-Rupien-Scheinen
22 III. Bombay.<br />
kaum anders als durch den Aufdrück der Summe unter<br />
schied.<br />
Das indische Hotel liegt in der Regel, wie alle besseren<br />
Wohnungen, ausserhalb der engen Eingeborenenstadt an einer<br />
sehr breiten und wohlgepflegten Landstrasse, und ist, wie<br />
alle dort liegenden Privat- und Geschäftshäuser, von einem<br />
geräumigen Garten umgeben. Das Hotel ist gewöhnlich<br />
einstöckig; der grosse Speisesaal liegt in der Mitte, kühl,<br />
bisweilen sehr dunkel, um denselben herum die Schlafzimmer<br />
mit Eingängen, sowohl nach dem Speisesaal als auch nach<br />
aussen ins Freie führend. Um die Schlafzimmer herum auf<br />
der Aussenseite läuft eine Veranda, auf der die mitreisenden<br />
Diener zu schlafen pflegen. Bei kaltem Wetter wickeln sie<br />
Kopf und alles dermassen in die mitgeführten Decken ein,<br />
dass sie einem langen, vollgestopften Sacke gleichen, den<br />
man nur an dem kräftigen Schnarchen als einen vermummten<br />
Menschen rekognosziert. Die Schlafzimmer sind meist sehr<br />
geräumig; die Möblierung ist dürftig, Gefässe und Tücher,<br />
wie alles in Indien, alt und verschlissen. Zu jedem Schlaf<br />
zimmer gehört ein eigner Nebenraum mit Waschtisch, Bade<br />
vorrichtung und sonstiger Bequemlichkeit versehen, welcher<br />
ausser von dem zugehörigen Schlafzimmer nur noch von<br />
aussen von dem Wasserträger und dem Sweeper betreten<br />
wird, die jeden Augenblick bei der Hand sind, alles nach<br />
Gebrauch sogleich wieder in Ordnung zu bringen. Die<br />
Badevorrichtung besteht selten in einer Wanne, meist nur<br />
in einer cementierten Fläche mit erhöhtem Rande und<br />
einer Öffnung nach aussen, welche' gegen Schlangen mit<br />
unter durch ein Sieb geschützt ist. Glasfenster sind spärlich<br />
und fehlen stellenweise ganz. Die Glasfabrikation war, wie<br />
man uns versicherte, in Indien noch nicht eingeführt. Auch<br />
alle Flaschen stammen aus Europa, und oft konnte man auf<br />
der Strasse einen Händler sehen, welcher alle Arten gebrauchter<br />
Flaschen für Wein, Bier, Limonade usw., wohl assortiert, feil
Das indische Hotel. Verpflegung in ihm. 23<br />
bot. Die Türen entbehren, wie schon bemerkt, fast immer<br />
der Schlösser; an ihre Stelle treten grosse eiserne Riegel,<br />
nach aussen wie nach innen. Man kann also beim Ausgehen<br />
sein Zimmer schliessen, nicht aber so, dass es nicht jeder<br />
öffnen könnte. Dennoch ist die Sicherheit in Indien eine<br />
grosse, zumal jedes Haus bei Tag und Nacht mehr oder<br />
weniger von Dienerschaft umlagert zu sein pflegt.<br />
Die Verpflegung in den Hotels ist meist sehr reichlich<br />
und gut, und viel grösser als die Gefahren von Tigern,<br />
Schlangen, Sonnenstich usw. ist die Gefahr, durch zu üppige<br />
Nahrung seiner Gesundheit zu schaden, zumal wenn man,<br />
wie die Engländer, tagtäglich seinen Whisky mit Soda trinkt<br />
und dabei den Zusatz des letzteren Elementes möglichst<br />
beschränkt. Französischer Rotwein und weisser Rheinwein<br />
sind überall, die halbe Flasche zu l1^ Rupien, zu haben,<br />
eine halbe Flasche bayrisch Bier kostet eine halbe Rupie.<br />
Am besten enthält man sich bei dem heissen Klima aller<br />
alkoholischen Getränke; wir nahmen zu den Mahlzeiten in<br />
der Regel nur Brauselimonade und haben uns sehr wohl<br />
dabei befunden. Die Mahlzeiten sind ähnlich wie schon auf<br />
dem' Schiffe: morgens beim Aufstehen Chota Häziri (Thee<br />
und Butterbrot), welches der Diener ins Schlafzimmer bringt,<br />
zwischen neun und zehn Uhr ein opulentes Frühstück mit<br />
Thee und allerlei Fleischgängen an der Wirtstafel, mittags<br />
ein Uhr eben daselbst Tiffin, das englische Luncheon, mit<br />
verschiedenen kalten Fleischgängen, und gegen Abend ein<br />
reichliches Diner, bestehend aus Suppe, Fisch, Fleisch,<br />
Geflügel, Gemüse, süsser Speise und dgl. Bei keiner Mahl<br />
zeit fehlt das Obst: im Winter meist Bananen und Apfelsinen,<br />
zuletzt in Ceylon Anfang März erschienen auch Ananas und<br />
die köstlichen Mango's, eine Art Pflaume von der Grösse<br />
eines Gänseeies, welche man durch zwei Querschnitte zu<br />
beiden Seiten des Kerns in drei Stücke zerlegt, um dann<br />
mit dem Löffel das saftreiche gewürzige Fleisch auszuschöpfen.
24 HI. Bombay.<br />
Was am meisten in den indischen. Hotels zu wünschen<br />
übrig lässt, ist die Bedienung. Zwar sind Diener bei Tisch<br />
und auch für die Zimmer in reichlicher Anzahl vorhanden,<br />
aber sie sind wenig daran gewöhnt, für den Fremden zu<br />
sorgen, da fast jeder seinen eignen Diener auf Reisen mit<br />
sich führt. Ein solcher erhält monatlich etwa 20 Rupien,<br />
wofür er sich selbst kleidet und beköstigt und doch wohl<br />
noch die Hälfte ersparen und seiner Familie schicken kann.<br />
Ausser dieser Gage bezahlt man für ihn nur noch das Eisen-<br />
bahnbillet dritter Klasse, welches erstaunlich billig ist, etwa<br />
ein Siebentel der ersten Klasse kostet und für wenige Rupien<br />
von einem Ende Indiens zum andern in einer freilich nicht<br />
beneidenswerten Zusammenpferchung befördert. Ein solcher<br />
Diener ist sehr nützlich, ja dem Neuling ganz unentbehrlich.<br />
Er kennt in der Regel ganz Indien, vermittelt den Verkehr<br />
mit den Eingeborenen, besorgt Wagen und Gepäckträger<br />
und hilft bei Einkäufen, wobei er freilich vom Verkäufer<br />
seine Provision ganz offen beansprucht, und erhält. Auf<br />
der Eisenbahn besorgt er Erfrischungen, macht abends die<br />
Betten zurecht und rollt sie morgens wieder zusammen.<br />
In den Hotels macht er im Zimmer die Betten und bedient<br />
seinen Herrn bei Tische, wabei er ganz ungeniert in der<br />
Küche ein- und ausgeht und das Beste für seine Herrschaft<br />
zu erlangen sucht. Nachts schläft er auch bei der Winter<br />
kälte, die freilich nicht gross ist, im Freien auf der Erde<br />
vor der Tür seines Herrn und ist morgens auf dessen ersten<br />
Ruf bei der Hand. Er begleitet diesen auf seinen Ausgängen,<br />
zeigt sich mit allen Verhältnissen vertraut und spricht ein<br />
gebrochenes, mitunter sehr drolliges Englisch. Dies ist<br />
das Ideal eines indischen Reisedieners, hinter welchem die<br />
Wirklichkeit allerdings oft erheblich zurückbleibt.<br />
Wir hatten versäumt, uns durch Freunde oder andre<br />
vertrauenswürdige Personen einen zuverlässigen Diener<br />
besorgen zu lassen, und trafen es infolgedessen nicht sehr
Reisediener. Lalu. Kastenvorurteile. 25<br />
glücklich. Schon bei unserem Eintritt in Watson's Hotel<br />
machte sich ein sauber in Eingeborenentracht gekleidetes<br />
Individuum mit uns zu schaffen, führte uns in unser Zimmer<br />
ein und wich seitdem nicht mehr von uns. Es war Lalu,<br />
unser erster Reisediener. Wir hielten ihn anfangs für einen<br />
Bediensteten des Hotels und durchschauten die Sachlage<br />
erst, als seine Verdienste in der Bemühung um unser Wohl<br />
sein so gross geworden waren, dass es mir unbillig schien,<br />
ihn ohne triftigen Grund zu verabschieden, der sich dann<br />
im Verlaufe der Reise einstellte, wie noch zu berichten sein<br />
wird. Was mich für Lalu besonders einnahm, war der<br />
Umstand, dass er kein Mohammedaner, sondern ein wirk<br />
licher Hindu war. Ich übersah, dass sich zu Dienern der<br />
Europäer nur die allerniedrigsten Kasten der Hindus her<br />
geben, welche von den höheren Kasten mehr noch als<br />
Christen und Mohammedaner gemieden werden. Unser<br />
Lalu durfte es nicht wagen, das Haus unserer Hindufreunde<br />
zu betreten, denn ein allgemeiner Hausputz wäre die not<br />
wendige Folge der Verunreinigung gewesen, in welche seine<br />
blosse Gegenwart das Haus gebracht haben würde. Einer<br />
Berührung mit dem ganz sauberen und hübschen Burschen<br />
wichen alle ängstlich aus. Eines Tages sass ich mit meinem<br />
Pandit, Veniräm, zu Bombay in meinem Hotelzimmer und<br />
hatte Sanskrit-Konversationsstunde, während Lalu sich im<br />
Zimmer hin und her mit Aufräumen zu schaffen machte.<br />
Es fiel mir auf, dass der Pandit ängstlich um sich blickte<br />
und hin und her rückte. Auf meine Frage, was es gebe,<br />
erwiderte er: „Wenn jener Mensch mich berühren sollte,<br />
so könnte ich mein Haus nicht betreten, ohne vorher ein<br />
Bad genommen und alle meine Kleider gewechselt oder<br />
gewaschen zu haben." — Diese Furcht der orthodoxen<br />
Hindus, durch Berührung mit einem Cüdra verunreinigt zu<br />
werden, erstreckt sich eigentlich auch auf alle Europäer,<br />
da sie im Prinzip sämtlich Qüdras sind. Indessen hat die
26 III. Bombay.<br />
Macht der Gewohnheit so weit gesiegt, dass fast alle Hindus<br />
dem Europäer zur Begrüssung die Hand reichen; selten<br />
geschah es, dass sie ihre Hände zurückhielten. Ängstlicher<br />
sind darin die weniger aufgeklärten Kreise, namentlich die<br />
Weiblein, welche gewöhnlich, wenn man ihnen in den engen<br />
Strassen begegnet, ihr Gewand fester über Gesicht und<br />
Busen zusammenziehen und den Europäer in vorsichtigem<br />
Bogen zu umgehen pflegen.<br />
Doch nun zurück zu Watson's Hotel, welches sich von<br />
den oben geschilderten Hotels des innern Indiens haupt<br />
sächlich dadurch unterscheidet, dass es einen mehr europä<br />
ischen Eindruck macht. Frei gelegen in der schönsten<br />
Gegend Bombays, in der Nähe der grossen Regierungs<br />
gebäude und des Meeres, macht es mit seinen vierzehn<br />
Fenstern in der Front und acht in der Breite, vier Stock<br />
werke hoch sich auftürmend, von aussen wie von innen<br />
einen stattlichen Eindruck. Im Erdgeschoss sind Läden,<br />
Post und die Bureauräume, eine Treppe hoch befinden sich<br />
die grossen Speisesäle, in denen Sommer wie Winter<br />
die Pankha über den Häuptern der Speisenden schwingt;<br />
die Flügeltüren weit geöffnet nach einer grossen Terrasse<br />
hin, auf der man, nach Tische seinen Kaffee einnehmend,<br />
unten auf dem freien Platze vor dem Hotel das bunteste<br />
Bild orientalischen Lebens hin und her wogen sieht. Da<br />
sind Hindus aus allen Kasten und allen Gegenden Indiens,<br />
dem Eingeweihten nach Stand, Geschäft und Heimat sofort<br />
an der Kleidung erkennbar; da sind Parsi's, Mohammedaner<br />
und Europäer, Halbkasten, Juden, zum Christentum Über<br />
getretene, alle durch ihre Tracht charakteristisch unter<br />
schieden. Auch fehlt es nie an Schaustellungen; Schlangen<br />
bändiger, Menschen mit Affen, Hunden und anderen Tieren<br />
produzieren sich unter dem Klang der Trommel und dem<br />
Rasseln der Geidbüchse, in der sie die von oben ihnen<br />
zugeworfenen Silber- und Kupfermünzen sammeln.
Watsons Hotel. Treiben vor ihm. Nächtliche Ruhestörungen. 27<br />
Trotz dieser vielen Unterhaltungen, trotz der schönen<br />
Lage, der komfortabeln Einrichtung und der vorzüglichen<br />
Küche, kann man nicht sagen, dass der Aufenthalt in<br />
Watson's Hotel ein besonders angenehmer gewesen wäre.<br />
Es war ein ewiges Kommen und Gehen; jede Woche, wenn<br />
ein neuer Dampfer von Europa ankam, füllte sich das Hotel<br />
mit unruhigen Gästen, die dann wenige Tage darauf wieder<br />
verschwanden, um landeinwärts zu fahren. Selbst nachts<br />
wollte keine rechte Ruhe eintreten. Das war ein unaufhör<br />
liches Trampeln auf den Korridoren, Werfen der Türen,<br />
lautes Rufen nach dem „Boy" (so pflegen die Engländer<br />
den Diener zu nennen), bis Mitternacht und noch später.<br />
Schloss man die Tür des Schlafzimmers und öffnete nur die<br />
grossen Flügelfenster, so war es, bei dem Mangel an Zugluft,<br />
die Hitze (in der Nacht meist 20°, bei Tage 25° R.), welche<br />
das Einschlafen erschwerte; öffnete man Tür und Fenster<br />
so weit wie möglich, so wurde man durch das Schwatzen<br />
oder Schnarchen der Diener auf den Korridoren und die<br />
Rücksichtslosigkeit der Gäste immer wieder aufs neue<br />
geweckt. Wir zogen es daher vor, bei unserem zweiten<br />
Aufenthalte in Bombay, namentlich auch um unseren Freunden<br />
näher zu sein, in einem Klub der Eingeborenen Wohnung<br />
zu nehmen, wovon noch zu berichten sein wird.<br />
Wir waren kaum zwei Stunden im Hotel, als ein halbes<br />
Dutzend Eingeborener uns zu sprechen wünschte. Zwar<br />
unser einziger Bekannter in Bombay, Mansukhläl Nazar, war<br />
nach Calcutta gereist, wo wir ihn später trafen, aber er hatte<br />
seine Brüder, den würdigen, gesetzten Atmaräm und den<br />
liebenswürdig heiteren Utsavläl beauftragt, für uns zu sorgen.<br />
Sie erschienen, begleitet von einem indischen Prinzen, Baldevi,<br />
der zwar ebenso wie die anderen in europäischer Kleidung<br />
auftrat, nur dass sein Haupt von einem mächtigen Turban<br />
bedeckt und seine Finger und Ohren mit kostbaren Ringen
28 HL Bombay.<br />
geziert waren. Da er des Englischen nicht hinreichend<br />
mächtig war, um der Unterhaltung zu folgen, so pflegte er<br />
sich mit Kauen des Tämbülam zu beschäftigen, dessen ver<br />
schiedene Ingredienzien er in einer grossen, silbernen Dose<br />
immer mit sich führte. Ihm folgten sein junger Neffe und<br />
einige andere Personen, sodass unser Wunsch, in Verkehr<br />
mit den Eingeborenen zu treten, sogleich in schönster Weise<br />
in Erfüllung ging.<br />
Es wurden nun zunächst die Empfehlungsbriefe nach<br />
Städten geordnet, die für Bombay bestimmten herausgeholt,<br />
die Gelegenheit der verschiedenen Besuche besprochen, allerlei<br />
Ausflüge projektiert und interessante Personen bezeichnet,<br />
welche unsere Freunde uns zuzuführen versprachen. Im<br />
ganzen lieben es die Eingeborenen nicht, dass man sie in<br />
ihren Wohnungen besucht, teils weil dieselben oft etwas<br />
dürftig ausgestattet sind, teils noch aus einem Reste von<br />
religiöser Bedenklichkeit. Um so bereitwilliger sind sie, den<br />
Fremden im Hotel aufzusuchen, und so verging kein Tag, an<br />
dem wir nicht morgens und nachmittags einen Kreis von<br />
Eingeborenen um uns gehabt hätten. Manche waren europäisch<br />
gekleidet; die meisten, namentlich die Pandit's, erschienen in<br />
einheimischer Tracht. Den Turban oder sonstige Kopfbe<br />
deckung pflegen sie nie abzusetzen, schon weil dabei aus<br />
dem, übrigens kurz geschorenen, Haare eine lange Locke, die<br />
aus religiösen Gründen getragen wird, herunterfallen würde.<br />
Hingegen ziehen die national Gekleideten ihre Schuhe stets<br />
vor der Türe aus und erscheinen im Zimmer in Strümpfen<br />
oder auch mit nackten Füssen. Da sie gewohnt sind, auf<br />
dem Boden mit untergeschlagenen Beinen zu hocken, so ist<br />
ihnen das Sitzen auf dem Stuhle nicht sehr bequem, und oft<br />
konnte ich beobachten, wie sie, im Läufe der Unterhaltung,<br />
ein Bein nach dem andern in die Höhe zogen, bis sie beide<br />
auf der Sitzfläche des Stuhles zu der ihnen gewohnten,<br />
Padmäsanam genannten, Stellung in einander schlugen. In
Seite 28.<br />
cd<br />
E<br />
> <br />
Ol<br />
2<br />
ca
Besuch Eingeborener. Bombay. Fahrgelegenheiten. 29<br />
der Unterhaltung sind sie lebhaft und angenehm, stets wiss<br />
begierig, naiv und mitunter geistreich. Sind ihrer viele zu<br />
sammen,, so wird das Gespräch leicht überlaut und geht sehr<br />
durcheinander.<br />
Eine Schilderung von Bombay, dieser neben Calcutta<br />
grössten und elegantesten Stadt Indiens, wird man uns er<br />
lassen. Die herrliche Lage der Stadt auf einer Landzunge<br />
zwischen dem offenen Meer im Westen und dem seeartig<br />
ausgebreiteten Hafen im Osten,, das südliche europäische<br />
Viertel mit seinen zahlreichen Prachtgebäuden, die nördlich<br />
davon sich ausbreitende Eingeborenenstadt mit ihren engen<br />
Strassen und dem unglaublichen Gewimmel, welches die<br />
selben belebt, — das alles. ist oft genug beschrieben worden.<br />
Wie die meisten indischen Städte dehnt sich Bombay<br />
nach Norden hin weit aus, die Entfernungen zwischen den<br />
einzelnen Punkten sind oft. sehr gross, und mancherlei Fahr<br />
gelegenheiten bieten sich, dar. Da sind zahlreiche Pferde<br />
bahnen, deren Pferde richtige Sonnenhüte zum Schutz gegen<br />
den Sonnenstich tragen, und deren nach allen Seiten offene<br />
und stets sehr besetzte Wagen die interessantesten Studien<br />
über Völkertypen und Kostüme aus unmittelbarer Nähe ge<br />
statten. Da sind zahllose Wagen, mit denen durch die engen,<br />
volkreichen Gassen mitunter schwer durchzukommen ist, vor<br />
nehme Privatwagen, zu denen die Pferde meist aus Australien<br />
importiert werden, ferner die verschiedensten Arten von<br />
Droschken, von den elegantesten an bis herunter zu der<br />
billigen und bescheidenen, nur von Eingeborenen benutzten<br />
Ekka, welche als einzigen Sitz die Bodenfläche des Wagens<br />
bietet und meist von Ochsen gezogen wird, die, mit einem<br />
durch die Nase laufenden Strick gelenkt, in ziemlich raschem<br />
Tempo durch die Strassen traben. Endlich läuft auch eine<br />
Lokaleisenbahn westlich von Bombay am Meere entlang mit<br />
einem halben Dutzend Stationen für die Stadt nach Norden
30 HI. Bombay.<br />
hin, an Malabar Hill vorbei,; in die Gegend hinaus. Malabar<br />
Hill ist ein nördlich von Bombay in das westliche Meer aus<br />
laufender Bergrücken, welcher auf: seinen schöngeformten und<br />
bewaldeten Höhen ausser den Türmen des Schweigens, dem<br />
berühmten Bestattungsplatze der Parsi's, zahlreiche Villen und<br />
Tempel trägt. Dorthin war der erste Ausflug gerichtet, den<br />
wir unter Leitung unserer Freunde gegen Abend unternahmen.<br />
Der gefürchtete Sonnengott war in dem westlichen Meere<br />
verschwunden, rasch und fast ohne Dämmerung folgte die<br />
Nacht, als wir auf Malabar Hill anlangten, wo im Eingeborenen<br />
viertel gerade ein kleines Volksfest stattfand. Überall hockten<br />
die Menschen vor den Häusern, zahlreiche Lämpchen mit<br />
Kokosöl brannten bei der, wie gewöhnlich in Indien, ganz<br />
unbewegten Luft auf offener Strasse, und mit Erstaunen sahen<br />
wir die vielfach beinah völlig nackten Menschen sich zwischen<br />
denselben hindurch und um uns her bewegen. Unsere Ab<br />
sicht war, einen Heiligen zu besuchen, welcher zahlreiche Ver<br />
ehrer hatte und von ihnen als ein geistlicher Gewissensrat<br />
vielfach in Anspruch genommen wurde., Eben kehrte er von<br />
einer Ausfahrt heim, ehrerbietig machte die Menge seinem<br />
Wagen Platzj auf dem er mit seinem Begleiter sass, der. vor<br />
ihm mit leisem Gesang einige Verse des Veda rezitierte. Der<br />
Wagen bog in einen geräumigen Hof ein, und einer der<br />
Freunde folgte, um eine Audienz für uns zu erwirken. Sie<br />
wurde nach einigen Unterhandlungen bewilligt, unter der<br />
Bedingung, dass wir unser Schuhwerk ablegten. Dies ge<br />
schah, wie. in der Folge noch sehr oft bei ähnlichen Gelegen<br />
heiten, und bald empfand ich diesen Brauch bei, der indischen<br />
Hitze so sehr als eine Wohltat, dass ich auch unaufgefordert<br />
gern die schweren Stiefel wegwarf und mich, in Strümpfen<br />
auf dem Teppich unter den Eingeborenen niederliess, welche<br />
diese Achtung vor ihrer Sitte immer sehr hoch aufnahmen.<br />
Der Heilige sass mit untergeschlagenen Beinen auf einem,er<br />
höhten Diwan, um ihn herum ein grösserer Kreis von Ver-
Auf Malabar Hill. Audienz bei einem Heiligen. Veniräm. 31<br />
ehrern, und ihm gegenüber in angemessener Entfernung nahm<br />
ich mit meiner Frau auf dem Teppiche Platz. Die Unter<br />
haltung begann, aber der heilige Mann sprach sein Sanskrit<br />
so schnell, dass mir vieles entging und wiederholt einer der<br />
Anwesenden den Faden des wie gewöhnlich um Veda-<br />
Fragen sich drehenden Gespräches auf englisch wieder an<br />
knüpfen musste. Professor Peterson, dem ich am anderen<br />
Tage mein Leid klagte, tröstete mich damit, dass diese<br />
Heiligen oft ein sehr schlechtes Sanskrit sprächen und die<br />
Fehler desselben durch Schnelligkeit des Sprechens geschickt<br />
zu verstecken suchten. Übrigens besorgte er mir einen jungen<br />
Pandit, der nun täglich in mein Hotel kam und mit mir Kon<br />
versationsübungen abhielt.<br />
Veniräm, so hiess der junge, fünfundzwanzigjährige Ge<br />
lehrte, war der vollkommene Typus eines indischen Pandit.<br />
Von Europa und europäischen Dingen wusste er gar nichts.<br />
Die englische Sprache war ihm, so nahe dem heutigen Inder<br />
ihr Studium liegt, völlig unbekannt, ja er verabscheute die<br />
selbe offenbar als etwas Unheiliges, Unreines, und diese<br />
Furcht, sich durch Ausländisches zu beflecken, erstreckte<br />
sich sogar auf die lateinischen Buchstaben. Wenn ich mit<br />
ihm meine in Aussicht stehende Reise durch Indien besprach<br />
und die Karte entfaltete, so. war er nicht im stände, einen<br />
Namen selbst zu lesen. Um so vertrauter war er in seiner<br />
eigenen Welt, wenn er auch mit manchem, als zu heilig für<br />
mich, zurückhielt. Wie alle erwachsenen Inder, war er ver<br />
heiratet, hatte aber Frau und Kinder in seinem Heimatsdorf<br />
zurückgelassen und war nach Bombay gekommen, um auf<br />
der Bibliothek von Elphinstone College mit Vergleichen von<br />
Handschriften und Anfertigen von Katalogen mühsam seinen<br />
Lebensunterhalt zu verdienen; Sein Vater hatte; wie so viele<br />
Inder in höherem Alter, sich von allen Banden des Lebens<br />
gelöst und war nach Benares gegangen, um dort als Asket<br />
zu leben. Veniräm. gab mir einen Empfehlungsbrief an den-
32 III- Bombay.<br />
selben mit, der jedoch durch einen Zufall nicht in die Hände<br />
des Adressaten, sondern in die eines anderen Asketen ge<br />
langte, wovon noch zu erzählen sein wird. In Bombay lebte<br />
Veniräm streng, nach den Vorschriften seiner Religion. Er<br />
stand allmorgendlich um vier Uhr auf, und nachdem er einen<br />
Augenblick an seine Schutzgottheit gedacht, nahm er das<br />
Morgenbad, trug mit roter Farbe das Sektenzeichen auf die<br />
Stirn auf, verrichtete seine Morgenandacht, die sogenannte<br />
Päjä, über deren Inhalt er nähere Auskunft verweigerte, las<br />
ein Kapitel aus den Upanishad's und wandte sich dann, ohne<br />
etwas genossen zu haben, den Geschäften des Tages zu.<br />
Seine beiden Mahlzeiten nahm er des Morgens etwa um elf<br />
und abends um acht Uhr ein. Er bereitete dieselben selbst,<br />
da kein anderes Mitglied seiner Kaste ihm zur Hand war,<br />
wie er auch seine Hausarbeiten und das Waschen und In<br />
standhalten seiner Kleidung allein besorgte. Seine Kleidung<br />
war natürlich rein indisch: ausser dem stattlichen Turban<br />
und den stets vor der Türe gelassenen Schuhen bestand sie<br />
aus einer Anzahl von Zeugstücken aus dünnem, meist weissem<br />
Baumwollenstoff. Am meisten charakteristisch für den indischen<br />
Anzug ist das gänzliche Fehlen der Hose, welche durch einen<br />
langen, kunstvoll um Lenden und Beine geschlungenen Zeug<br />
streifen ersetzt wird. In ähnlicher Weise war der Oberkörper<br />
eingehüllt, und den Abschluss bildete ein stattliches Plaid aus<br />
Kaschmirwolle. Viele Hindus bedürfen zu ihrer Kleidung<br />
gar keines Schneiders. Die Mehrzahl allerdings bedient sich<br />
zur Bedeckung des Oberkörpers bei kühlerem Wetter eines<br />
überzieherartigen Rockes mit Ärmeln. Von diesem abgesehen,<br />
wird die ganze Kleidung täglich neu gewaschen. Die Hindus<br />
erscheinen daher meist sehr sauber und appetitlich, auch<br />
bei dem täglich zweimaligen Baden völlig geruchlos, hingegen<br />
machen sie sich garnichts daraus, wenn ihre Gewandstücke<br />
hier und da kleine Risse zeigen. Noch einfacher ist die<br />
Tracht der Weiber im südlichen Indien. Sie soll sich oft
Indische Lebensweise und Kleidung. Morgenspaziergang. 33<br />
auf ein einziges weisses, rotes oder bei den Witwen schwarzes<br />
Stück Zeug beschränken, welches für gewöhnlich den ganzen<br />
Körper, namentlich auch den Kopf überdeckt, bei der Arbeit<br />
aber so in die Höhe geschlungen wird, dass die Arme und<br />
Beine von den Schenkeln abwärts ganz nackt bleiben, was<br />
den Inderinnen bei ihren zarten und schönen Körperformen<br />
ein sehr graziöses Aussehen gibt.<br />
Mein Pandit erschien täglich, nachdem ihm in der ersten<br />
Zeit von den Bediensteten des Hotels der Zutritt einige Male<br />
verweigert worden war. Wir lasen und sprachen miteinander<br />
eifrig Sanskrit, und für diese Vorübung bin ich ihm vielen<br />
Dank schuldig. Am Schluss des Kursus überreichte ich ihm<br />
fünfundzwanzig Rupien, was auf die Sitzung etwa eine Rupie<br />
ausmachen mochte. Aus der Anhänglichkeit, die er auch<br />
weiterhin und bei meinem zweiten Aufenthalte in Bombay<br />
bezeigte, glaubte ich entnehmen zu dürfen, dass er diese<br />
massige Entschädigung für eine reichliche ansah.<br />
Unsere Lebensführung in Bombay regelte sich durch die<br />
Natur des Klimas ganz von selbst. Morgens um sechs, wenn<br />
die ersten Sonnenstrahlen durch die mächtigen, im herr<br />
lichsten Grün prangenden Bäume glitzerten, wenn das Krächzen<br />
der von Baum zu Baum fliegenden Krähen sich in das süsse<br />
Gezwitscher der kleinen grünen Papageien und der anderen<br />
überaus zahlreich in Indien vorhandenen Vögel mischte, wurde<br />
schnell aufgestanden und in der Morgenfrische ein Spazier<br />
gang gemacht, meistens an dem westlich gelegenen Meere<br />
entlang, wo zwischen Stadt und See ein weiter, prächtige<br />
Promenaden bietender Landstreifen sich hinzieht, den die<br />
Betriebsamkeit der Engländer dem Meere abgerungen, was<br />
sie mit keckem Worte eine Reclamation nennen, — als<br />
wenn ihnen der Ozean diesen Landstreifen schuldig gewesen<br />
wäre. Hier konnte man namentlich die an ihren hohen<br />
schwarzen randlosen Mützen sofort kenntlichen Parsi's bei<br />
ihrer Morgenandacht beobachten, wie sie, Gebete murmelnd,<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 3
34 HL Bombay.<br />
sich auf den Boden warfen und mit dem heiligen Nass die<br />
Stirn und andere Körperteile besprengten. Oder wir ge<br />
langten hinauf bis Malabar Hill, wo die Hindus in zahl<br />
reichen Tempeln vor ihren Göttern knieten, ihren für sie die<br />
Gebete sprechenden Priestern einige Kupferstücke spendeten<br />
und in den anstossenden Teichen badeten. Unter anderen<br />
kuriosen Religionsübungen bemerkte ich, wie eine alte Frau<br />
unter Gebeten aus einem Gefässe Wasser sprengte und dabei<br />
unverwandt in die Sonne starrte. Meine Freunde versicherten,<br />
dass sie dies schon seit zwanzig Jahren betreibe, ohne dass<br />
es ihren Augen geschadet habe. Credat Judaeus Apella! —<br />
Um neun Uhr war man froh, bei zunehmender Hitze im<br />
Hotel zum Frühstück zurück zu sein. Der weitere Vormittag<br />
wurde dann, soweit nicht Besucher sich einstellten, der Arbeit<br />
gewidmet. O wie belebt sich, in einer solchen Umgebung,<br />
das Studium des Sanskrit! Welche konkrete Gestalt nehmen<br />
hier, wo das alles noch so lebendig ist, der Rigveda und<br />
die Upanishad's, die indischen Dramen und Romane an!<br />
Ich hoffe, dass die Zeit kommen wird, wo jeder deutsche<br />
Sanskritgelehrte es möglich machen kann, wenigstens einmal<br />
in seinem Leben Indien zu besuchen.<br />
Mittags nach eingenommenen Tiffin wurde während der<br />
grössten Tageshitze geruht, und nur ungern Hessen wir uns<br />
durch Besuche stören. Gegen vier Uhr aber erschienen<br />
unsere Freunde, der schwere Sonnenhelm konnte mit einem<br />
leichten Filzhute vertauscht werden, und nun ging es hinaus<br />
in die Stadt oder die Umgegend. Einer der reizendsten<br />
Ausflüge geht nach Elephanta, einer in dem östlichen Hafen<br />
see gelegenen, von Bombay eine gute Stunde entfernten Insel<br />
mit den berühmten in den Felsen hineingearbeiteten und so<br />
halb unterirdischen Tempeln, von deren Säulen und Skulpturen<br />
trotz der Zerstörungswut der Mohammedaner noch stattliche<br />
Reste übrig geblieben sind. Wir bestiegen eines Sonntags<br />
nachmittags, zwölf Mann hoch, ausser mir und meiner Frau
Seite 34.<br />
T3<br />
cd<br />
o<br />
cd<br />
"cd<br />
>><br />
cd<br />
.a<br />
E<br />
o<br />
CQ
Morgen auf Malabar Hill. Ausflug nach Elephanta. 35<br />
lauter Eingeborene, ein Segelboot; der heitere Utsavläl hatte<br />
alle Bestandteile einer Hindu-Mahlzeit in Körben aufs Boot<br />
bringen lassen, er selbst schleppte sich mit einem Harmo<br />
nium, und nun trieb uns der Wind, während allerlei Hindu-<br />
Lieder gesungen und gespielt wurden, über die glatte Fläche<br />
an den Häusern, Fabriken und Schiffswerften der Stadt ent<br />
lang auf die hochragende Insel zu. Ein schöner Treppen<br />
weg führte vom Ufer empor zu den auf halber Höhe ge<br />
legenen Tempelhöhlen. Vergebens sah ich mich nach den<br />
Schlangen um, die nach Freund Garbe's Schilderung hier zu<br />
erwarten waren. Ohne Schwierigkeit und Gefahr erreichten<br />
wir die Tempel und betrachteten die in die Wände ge-<br />
meisselten Kolossalbilder, welche dem Leser gewiss aus<br />
Abbildungen bekannt sind, bis das von einer Seite herein<br />
fallende Licht abnahm, und die Abenddämmerung diese<br />
steinernen Zeugen indischer Religion und Kunst einhüllte.<br />
Dann wurde draussen vor dem Tempel das Hindu-Mahl ein<br />
genommen, und auch der durch widrigen Wind erschwerte<br />
Rückweg wurde uns bei der herrschenden fröhlichen Stimmung<br />
nicht zu lang. In der Heimat wird ein ernster Mann sich<br />
zu solchem harmlosen Zeitvertreib nicht leicht hergeben, hier<br />
aber bot er eine willkommene Gelegenheit, das eigenartige<br />
Treiben des fremden Volkes in seinem fernen Lande zu be<br />
obachten. Und so wurden wir von Tag zu Tag mehr mit<br />
Sitten und Denkungsart der Hindus bekannt und werden<br />
nach und nach noch manches davon unserer Darstellung ein<br />
flechten.<br />
Hier wollen wir zunächst der Totenbestattung gedenken,<br />
welche für die drei Religionen, aus denen hauptsächlich die<br />
Bevölkerung Bombay's sich zusammensetzt, eine charakteristisch<br />
verschiedene ist. Während nämlich die Mohammedaner ähnlich<br />
wie wir ihre Toten begraben, so werden dieselben von den<br />
Hindus verbrannt und von den Parsi's den Geiern zum<br />
Frasse ausgesetzt. Beides verdient eine nähere Schilderung.<br />
3*
36 HI. Bombay.<br />
Der Verbrennungsplatz der Hindus liegt in Bombay<br />
westlich von der Stadt bei der Station Marine Lines in der<br />
Nähe des Meeres. Es ist ein grosses, von hohem Zaun<br />
umfriedigtes Grundstück, von dem man schon von aussen bei<br />
Tage den Rauch, bei Abend einen Funkenregen aufsteigen sieht.<br />
Der Zutritt ist auch Fremden, wenn sie eingeführt werden,<br />
gestattet, und man kann von einem für die Träger und<br />
Leidtragenden abgeteilten Raum aus bequem den Ver-<br />
brennungsprozess in seinen verschiedenen Stadien beobachten.<br />
Die völlige Verbrennung einer Leiche nimmt vier Stunden in<br />
Anspruch, aber in der Regel trifft man mehrere Leichen an,<br />
an denen sich Anfang, Mitte und Ende der Ceremonie<br />
gleichzeitig betrachten lässt. Bei der durch die Hitze be<br />
schleunigten Verwesung wird der Leichnam meist schon<br />
wenige Stunden nach eingetretenem Tode vom Kopf bis zu<br />
den Füssen in weisse Tücher gewickelt und von Trägern<br />
zum Friedhofe gebracht. Zwischen vier eisernen in der Erde<br />
steckenden Stangen werden ein bis zwei Meter lange dicke<br />
Holzscheite einen Meter hoch aufgeschichtet, der Leichnam<br />
wird darauf gelegt und über ihn wieder eine Lage Holz.<br />
Inzwischen wird daneben ein kleines Feuer vorbereitet; in<br />
Bombay wird dasselbe von dem häuslichen Herde des Ver<br />
storbenen mitgebracht; in Benares, wo viele auswärtige, oft<br />
von weit her kommende Leichen verbrannt werden, muss das<br />
Feuer von einer stets gegenwärtigen niederen Kaste gekauft<br />
werden. Es folgen noch einige Ceremonien; namentlich muss<br />
der nächste Angehörige des Verstorbenen, oft ein junger<br />
Knabe, aus einem Kruge Wasser um den Scheiterhaufen<br />
herum und auf denselben giessen und dann den Krug<br />
zerbrechen. Hierauf wird das kleine vorbereitete Feuer in<br />
den grossen Scheiterhaufen eingefügt, bald prasseln die<br />
Flammen hoch empor und ergreifen ein Glied des Toten nach<br />
dem andern. In drei bis vier Stunden ist der Leichnam bis<br />
auf einige Knochen völlig verbrannt. Diese nebst der Asche
Leichenverbrennung. Semitischer Typus der Parsi's. 37<br />
werden in Benares in den unmittelbar daneben fliessenden<br />
Ganges gestossen; was an anderen Orten damit geschieht,<br />
ist mir nicht bekannt. Ein Priester, der einige Sprüche<br />
murmelt, auch wohl eine kleine Ansprache hält, ist nur aus<br />
nahmsweise gegen besondere Bezahlung zugegen. Die<br />
Stimmung ist nicht sehr andächtig, nur einmal hörte ich eine<br />
Frau über ihren verstorbenen Gatten wehklagen; meist sehen<br />
die Leute anscheinend gleichgültig zu, mitunter plaudern<br />
sie dabei ganz vergnügt miteinander. Die Inder nehmen es<br />
mit dem Sterben weniger schwer; der Tod ist nur eine<br />
einzelne Station auf der grossen Reise für die wandernde<br />
Seele.<br />
Ganz anders sind die Gebräuche bei den Parsi's, welche<br />
in Bombay einen beträchtlichen und angesehenen Teil der<br />
Bevölkerung ausmachen. Die Parsi's sind die Nachkommen<br />
der alten Perser, welche, als der Islam mit Feuer und Schwert<br />
Persien eroberte, sich mit ihrer Religion und dem Reste<br />
ihrer heiligen Bücher, dem Avesta, nach dem toleranten<br />
Indien retteten, wo sie unter gewissen Bedingungen auf<br />
genommen wurden und gegenwärtig zu den reichen Kauf<br />
leuten Bombay's ein bedeutendes Kontingent stellen. Die<br />
Perser sind, wie die Sprache des Avesta beweist, ursprüng<br />
lich unzweifelhaft Indogermanen, und dieser Tatsache gegen<br />
über ist es sehr befremdlich, dass die Parsi's in Bombay<br />
vielfach einen ausgeprägt semitischen Typus tragen und<br />
nicht nur in Gesicht und Körperbildung sondern auch in<br />
Wesen und Manieren stark an unsere Juden erinnern. Unter<br />
meiner Sammlung von Photographien befindet sich eine<br />
Gruppe junger Parsi-Damen, welche, von üppigen Körper<br />
formen und zum Teil von hoher Schönheit, ein deutlicher<br />
Ausdruck dessen sind, was wir eine beaute juive zu nennen<br />
pflegen. Und so finden wir bei den Parsi's dieselbe Be<br />
triebsamkeit und Freude am Erwerb, dieselbe liebenswürdige<br />
Zugänglichkeit und mitunter etwas lästige Aufdringlichkeit,
38 HI. Bombay.<br />
wie bei unseren Juden. Woher diese Erscheinung? Ich<br />
kann sie mir nur daraus erklären,. dass die Perser nach der<br />
Eroberung von Babylonien und Assyrien durch Cyrus mit<br />
der dort einheimischen semitischen Bevölkerung eine weit<br />
gehende Vermischung eingegangen sind, und dass die<br />
zähe Lebenskraft der semitischen Rasse sich bis zu den<br />
heutigen Parsi's herab behauptet hat. Auch das haben die<br />
Parsi's mit den Juden gemein, dass sie im Gegensatze zu<br />
den höchst konservativen Hindus fortschrittlich gesinnt und<br />
zu Reformen geneigt sind. Sie haben vortrefflich organisierte<br />
Schulen, nicht nur für Knaben sondern auch für Mädchen,<br />
in denen auf Gujerati allerlei Wissensdisziplinen gelehrt, auch<br />
der Unterricht in der Gymnastik nicht versäumt wird. Die<br />
Hindus folgen ihnen hierin langsam nach, aber wiederholte<br />
Besuche derartiger Anstalten haben in mir den Eindruck<br />
hinterlassen, dass die Schulen der Hindus hinter denen der<br />
Parsi's zurückstehen. Auch darin sind die Parsi's von dem<br />
Herkommen abgewichen, dass sie die Verheiratung der Kinder<br />
abgestellt haben, doch ist es vielen unter ihnen zweifelhaft,<br />
ob sie mit dieser Neuerung nicht zu rasch und unvermittelt<br />
vorgegangen sind.<br />
Wir hatten das Glück, in Herrn Chichgar einen sehr<br />
liebenswürdigen älteren Parsi-Gentleman kennen zu lernen,<br />
der uns nicht nur in seine Familie einführte sondern auch<br />
sonst alles Mögliche tat, uns gefällig zu sein. Zwar den<br />
Parsi-Tempel, in dessem Inneren das nie verlöschende<br />
heilige Feuer brennt, behauptete er nicht zeigen zu dürfen;<br />
dafür aber erbot er sich, uns nach Malabar Hill zu den<br />
Türmen des Schweigens, dem berühmten Begräbnisorte der<br />
Parsi's zu geleiten. In Gesellschaft eines Parsi-Priesters<br />
holte er uns eines Morgens früh mit seinem Wagen im Hotel<br />
ab; rasch war Malabar Hill erreicht, und nun führte ein an<br />
mutiger Fussweg zu dem Bergrücken hinauf. Auf der Höhe,<br />
mit wundervoller Aussicht auf Bombay und das Meer, liegt
Gruppe junger Parsi-Damen. Seite 38.
Schulen der Parsi's, Die Türme des Schweigens. 39<br />
hier weit sich erstreckend der Friedhof der Parsi's; mit Ge<br />
büsch und Blumen verziert, von wohlgepflegten Wegen<br />
durchzogen, hat er ganz die weihevolle Stille eines christ<br />
lichen Kirchhofs, nur dass hier keine Gräber sich finden,<br />
sondern an Stelle derselben in ziemlicher Entfernung von<br />
einander eine Anzahl runder Türme, nicht höher als ein<br />
zweistöckiges Haus, aber so breit wie ein grosser Circus.<br />
Eine einzige, stets verschlossene Eisenpforte führt in das<br />
Innere, welches sich zu einer tellerartigen, ringsum von<br />
mannshohen Mauern eingeschlossenen, nach oben offenen<br />
Fläche ausbreitet. Durch zwei konzentrische Kreise ist diese<br />
Fläche in drei Teile zerlegt, in deren jeder zahlreiche Rillen<br />
rund herumlaufen zur Aufnahme der Leichen, die innere Kreis<br />
fläche für Kinderleichen, die beiden sie umgebenden für<br />
solche von Erwachsenen. Ein Modell im Wartehause am<br />
Eingang zeigt die ganze Einrichtung. Das Innere der Türme<br />
selbst darf niemand betreten, auch kein Parsi, mit Ausnahme<br />
der gut bezahlten, aber als unrein gemiedenen Leichenträger.<br />
Diese bringen die in Tücher eingewickelte Leiche auf ihren<br />
Schultern herauf, gefolgt von dem Zuge der Leidtragenden.<br />
In angemessener Entfernung von den Türmen machen alle<br />
Halt, die letzten Ceremonien werden vollzogen, und dann<br />
bringen die Träger allein den Leichnam durch die geöffnete<br />
Eisenpforte in den Turm, wodurch sie für immer den Blicken<br />
der Menschen entzogen ist. Sofort stürzen sich mächtige<br />
Geier, deren man stets eine Anzahl um den Rand des Turmes<br />
sitzen sieht, auf die Leiche los, und es soll keine halbe<br />
Stunde dauern, bis alles bis auf die Knochen verzehrt ist.<br />
Die übrigen Gebeine werden nach einiger Zeit in ein<br />
Loch in der Mitte hinabgestossen, hier noch einem Des<br />
infektionsprozesse unterworfen und dann vom Regen<br />
wasser in das Meer hinausgespült. Der ganze Vorgang,<br />
in der würdigen und weihevollen Weise, wie er sich<br />
hier abspielt, hat durchaus nichts Abschreckendes, viel
40 III- Bombay.<br />
weniger jedenfalls als die christliche Gewohnheit des<br />
Begrabens.<br />
Es versteht sich, dass wir in Bombay, wie überall in<br />
Indien, fleissig die Tempel der Hindus besuchten. Doch<br />
geben sie mit ihren Götterbildern, denen vom Volke durch<br />
Vermittelung des den Tempel bedienenden Priesters unter<br />
Gebeten allerlei Blumen, Milch, Getreidekörner usw. dar<br />
gebracht werden, keinen Begriff von dem altindischen<br />
Opferkultus zur Zeit des Veda, welcher weder Tempel noch<br />
Götterbilder kannte und den unsichtbaren Himmlischen die<br />
Opfergaben durch Vermittelung des Gottes Agni, d. h. des<br />
Opferfeuers, darbrachte. Nur vereinzelt und unter Ausschluss<br />
der weiteren Öffentlichkeit werden auch jetzt noch solche<br />
vedische Opfer veranstaltet. Mein grosser Wunsch war, ein<br />
solches zu sehen. Die Sache war nicht ohne Schwierigkeit,<br />
da die von meinen Freunden darum angegangenen Brahmanen<br />
ihre Einwilligung aus religiösen Bedenklichkeiten wieder<br />
holt rückgängig machten. Endlich fanden sich ihrer viere<br />
bereit, am frühen Morgen im Garten unserer Freunde ein<br />
kleines Opfer zu veranstalten, bei dem ich mit meiner Frau<br />
vom Balkon des Hauses aus zusehen durfte und dafür als<br />
Yajamäna die Kosten der Opfermaterialien, sowie die<br />
Dakshinä (Opferlohn) an die Priester, zu entrichten hatte.<br />
Als wir ankamen, war die Sache bereits im Gange. Im<br />
Garten vor unseren Augen war ein viereckiges Loch in die<br />
Erde gegraben und etwas ausgemauert worden. In demselben<br />
flammte ein helles Feuer, und um dasselbe hockten drei<br />
Brahmanen, welche angeblich den Hotar, Adhvaryu und<br />
Udgätar vorstellten, während ein vierter als Brahmdn abseits<br />
sitzend die Handlung regierte. Um das Feuer herum be<br />
fanden sich ein grosser Topf mit geschmolzener Butter,<br />
welche, löffelweise in das Feuer geschöpft, dasselbe hoch<br />
aufprasseln machte, ferner ein Bündel mit Kuca-Gras und
Seite 40.
Ein altvedisches Opfer. Ein indisches Theater. 41<br />
auf Blättern als Unterlage allerlei Körner von Getreide und<br />
Früchten. Die ganze Handlung beschränkte sich darauf, dass<br />
die drei Brahmanen alle drei ohne Unterschied unter Ab<br />
singen von Vedaversen, aus denen ich das Purusha-Lied<br />
deutlich heraushörte, und Verneigungen gegen das Feuer<br />
immer in hockender Stellung die genannten Materien ins<br />
Feuer warfen. In einer halben Stunde war alles beendigt,<br />
und mir blieb nur noch die Ehre, 25 Rupien zu zahlen für<br />
ein Schauspiel, welches mit dem wirklichen altvedischen<br />
Opfer doch nur eine geringe Ähnlichkeit haben mochte, immer<br />
hin aber der Phantasie einigen Anhalt bot, da das Gesehene,<br />
wenn auch stark reduziert, doch auf alte Traditionen zurück<br />
gehen dürfte.<br />
Mehr Ursprüngliches mag das nationale Theater der<br />
Hindus sich erhalten haben, namentlich wenn antike oder<br />
der Antike nachgebildete Stücke gespielt werden. Der<br />
Dichter eines solchen war unser Freund Vicvanäth, dessen<br />
Stück die übertriebene, allen Versuchungen Trotz bietende<br />
Wahrheitsliebe des Hariccandra zum Gegenstand hatte und<br />
eben in Bombay gespielt wurde. Der Dichter lud uns ein,<br />
einer Vorstellung beizuwohnen; zwei Ehrenplätze unmittelbar<br />
vor der Bühne waren für uns reserviert; neben uns sass der<br />
Dichter, um den Gang der Handlung zu erklären, hinter<br />
uns ein zahlreiches Publikum, lauter Eingeborene; ein<br />
europäisches Gesicht habe ich nicht bemerkt. Zuschauerraum,<br />
Vorhang und Bühne waren von den Einrichtungen eines<br />
bescheidenen europäischen Theaters, wie man sie z. B. in<br />
Italien oder Spanien findet, nicht erheblich verschieden.<br />
Auf der Bühne, rechts und links vor dem Vorhange, hockten<br />
zwei Musiker; der eine spielte die Melodien auf einem<br />
Harmonium, der andere begleitete ihn auf mehreren Trommeln,<br />
die er in kunstvoller Weise mit dem Ballen und der Kante<br />
der blossen Hände zu schlagen wusste und dabei seinen
42 III- Bombay.<br />
von stattlicher Mütze gezierten Kopf nach dem Takte aufs<br />
zierlichste bewegte. Selten habe ich einen Menschen ge<br />
sehen, der so ganz in seiner Beschäftigung aufging wie<br />
dieser Trommelschläger. Der Vorhang hob sich; ein Chor<br />
von Knaben, als Mädchen gekleidet, sang die Nändt. Hierauf<br />
folgte das übliche Zwiegespräch zwischen dem Sütradhära<br />
und der Primadonna, sodann das Stück, der Dialog in<br />
Gujerati, die häufig eingestreuten lyrischen Partien gesungen.<br />
Alle Rollen wurden von Männern und Knaben gespielt. Es<br />
ist eine besondere, geringere brahmanische Kaste, welche<br />
die Schauspielkunst als ihren angeborenen Beruf betreibt.<br />
Das Spiel war sehr sicher und von vortrefflicher Schulung;<br />
die Stimmen der Knaben in Dialog und Gesang waren<br />
frisch und hätten nur etwas weniger schrill sein dürfen.<br />
Die eigens zu dem Stücke komponierte Musik war ganz<br />
national indisch und hatte ihren eigentümlichen Reiz. Nur<br />
hier und da hatte der Komponist sich verleiten lassen, ein<br />
europäisches Motiv einzuflechten, was sich sofort störend<br />
bemerkbar machte und in dem Ganzen fast wie ein falscher<br />
Ton hervortrat. Das Stück, welches von edelmütigen Ge<br />
sinnungen strotzte, spielte natürlich zum Teil im Himmel,<br />
der Rat der Götter versammelte sich; Agni, Indra, Varuna<br />
und viele andere Götter, an ihren traditionellen Kostümen<br />
leicht kenntlich, waren versammelt, der weise Närada trat<br />
zu ihnen, wurde höchst respektvoll empfangen, berichtete<br />
über die Verhältnisse auf Erden und wurde mit den Auf<br />
trägen der Götter an die Menschen betraut. Andere Scenen<br />
spielen auf der Erde, am Hofe der Könige, wo der an<br />
konventioneller Kleidung leicht kenntliche Vidüshaka seine<br />
stets mit vielem Beifalle aufgenommenen Spässe macht, im<br />
Harem der königlichen Frauen, in den Hütten der Armen<br />
und in den Einsiedeleien des Waldes; und der Hauptgewinn<br />
von einer solchen Vorstellung ist vielleicht, dass viele<br />
Scenen des indischen Familienlebens, die dem Fremden
Eine Theatervorstellung. Einladung nach Baroda. 43<br />
stets verschlossen bleiben, hier auf der Bühne, ohne Zweifel<br />
in naturgetreuer Nachbildung, der Betrachtung offen gelegt<br />
werden. Einen Zwischenakt benutzte Vicvanäth, um uns<br />
auf die Bühne zu führen; wir wurden dem Direktor (Manager)<br />
vorgestellt, sahen, wie die Knaben die Ringe durch die Nase,<br />
welche sie als Prinzessinnen und andere indische Damen<br />
zu tragen hatten, und die nur durch eine Feder eingeklemmt<br />
waren, ablegten, wurden mit einigen Erfrischungen bewirtet<br />
und mussten es uns gefallen lassen, dass wir, wie in der<br />
Regel bei Besuchen in indischen Kreisen, mit mächtigen<br />
Blumenkränzen behangen, wieder zu unseren Parkettplätzen<br />
herabstiegen. Wir haben noch öfter in Baroda, Lucknow,<br />
Calcutta und wiederum in Bombay indische Theater besucht,<br />
aber der Eindruck des ersten Stückes war der tiefste und<br />
wird mir unvergesslich bleiben.<br />
Die Zeit rückte heran, wo wir Bombay zu verlassen<br />
gedachten. Wieder einmal sassen wir, von Besuchern<br />
umgeben, im Zimmer unseres Hotels, als ein neuer An<br />
kömmling hinzutrat. Ich bat ihn, wie gewöhnlich in solchen<br />
Fällen, ohne mich weiter in meiner Unterhaltung stören zu<br />
lassen, Platz zu nehmen, als er freudig ausrief: „Kennen<br />
Sie mich nicht mehr? Ich bin Dhruva aus Baroda, den<br />
Sie damals in Berlin so freundlich aufnahmen. Ich<br />
habe in der Zeitung von Ihrem Hiersein gelesen und bin<br />
froh, Sie aufgefunden zu haben. Sie müssen," fuhr er fort,<br />
„mir auf der Durchreise ein paar Tage in Baroda schenken,<br />
wo ich als Richter angestellt bin. Richten Sie es ein, dass<br />
Sie auf einen Sonntag dort sind, dann bin ich frei und kann<br />
mich Ihnen ganz widmen." Gern sagten wir zu und ver<br />
abredeten das Nähere. Einige Tage darauf schrieb uns Dhruva<br />
aus Baroda, dass der Fürst von Baroda zwar abwesend sei,<br />
dass aber der Premierminister des kleinen Ländchens sich<br />
freuen würde, uns als Gäste des Staates dort aufzunehmen.
Viertes Kapitel.<br />
Von Bombay bis Peshawar.<br />
p\er Abend unserer Abreise war gekommen. Unsere Freunde<br />
hatten uns die noch nötigen kleinen Koffer, einen<br />
Tiffin-Basket und die Betten, ohne welche man in Indien<br />
nicht reist, besorgt, sie hatten einpacken helfen und waren<br />
zahlreich in der letzten Stunde um uns. Dann ging es zur<br />
Bahn; der eine begleitete uns in seinem Wagen, der andere<br />
fuhr mit dem Gepäck, und wieder andere begaben sich<br />
nach dem Bahnhofe, um uns dort noch zum letzten Male<br />
die Hand zu drücken. Von den fünf Bombay-Stationen, an<br />
welchen der Nachtschnellzug hält, hatte ich die Ausgangsstation<br />
Colaba gewählt und war schon mit Sack und Pack eine<br />
Stunde vor Abgang dort, in der Erwartung, so am sichersten<br />
ein Coupe allein für mich und meine Frau zu erlangen.<br />
Diese Hoffnung erwies sich als eitel. Zwar waren wir mit<br />
die ersten Reisenden, und da stand der Zug, alle Türen<br />
geöffnet. Aber indem wir ihn abschritten, zeigte sich, dass<br />
kein Coupe erster Klasse mehr war, in welchem nicht schon<br />
einer oder mehrere Plätze durch Zettel als reserved bezeichnet<br />
waren. Für diesmal mussten wir vorlieb nehmen und<br />
richteten uns mit unseren acht Gepäckstücken, die man in<br />
Indien sämtlich in den geräumigen Coupes mitzunehmen<br />
pflegt, in einem Coupe ein, in das dann noch ein junger
Abreise von Bombay. 45<br />
Engländer einstieg, um seinen reservierten Platz einzunehmen.<br />
Die Freunde umdrängten die Tür unseres Wagens, der eine<br />
oder andere überreichte uns noch eine Erfrischung. In der<br />
Regel wählt man dazu eine Schachtel mit Trauben, welche<br />
in Indien selbst nicht wachsen, aber aus Afghanistan ein<br />
geführt werden, und zwar in runden Holzschächtelchen, in<br />
denen, durch Watte getrennt, drei Schichten Beeren über<br />
einander zu liegen pflegen. Das Signal zur Abfahrt ertönte,<br />
noch einmal streckten sich alle Hände uns entgegen, dann<br />
fiel der Vorhang über dem lebensvollen Bilde. „Mit allen<br />
diesen Eingeborenen bin ich in den wenigen Wochen meines<br />
Aufenthaltes in Bombay befreundet geworden," sagte ich zu<br />
dem Engländer. „Wohl möglich; wir aber haben sie zu<br />
regieren, und das ist ganz etwas anderes," versetzte er mit<br />
Selbstgefühl und Bedeutung. Dann streckte er sich auf<br />
seiner unteren Bank; meine Frau nahm die gegenüberliegende<br />
ein, ohne für diese Nacht sich auskleiden zu können, und<br />
mir blieb nichts übrig, als nach oben zu klettern. Das<br />
Schlafen war unter diesen Umständen keine leichte Sache,<br />
zumal die Hitze, trotz dem Öffnen aller Fenster und Luken,<br />
noch sehr gross war. Aber es ging gegen Norden und auf<br />
den Dezember zu; man durfte also auf kühlere Tage hoffen.<br />
Lassen wir nun unsere Reisenden im Halbschlafe über<br />
Surat und die Narmadä durch viele herrliche ungesehene<br />
Gegenden dahineilen, um sie am frühen Morgen in Baroda<br />
wiederzufinden, und beschäftigen wir uns inzwischen mit<br />
den indischen Eisenbahnen. Ganz Indien ist mit einem<br />
Netz von Eisenbahnen durchzogen, welche, wie alles, was<br />
die Engländer von äusserlichen Dingen und Verhältnissen<br />
anfassen, vortrefflich organisiert sind. Wie in Russland, ist<br />
auch in Indien die Schienenweite grösser als bei uns, und<br />
schon dadurch sind die Wagen geräumiger und bequemer.<br />
Es gibt drei Wagenklassen und noch eine Intermediate Class
46 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
zwischen der zweiten und dritten. Alle Wagen haben die<br />
Farben der entsprechenden Billets, sodass man die weiss<br />
angestrichenen Wagen der ersten Klasse auf den ersten<br />
Blick und schon von fern herausfindet. Die Fahrpreise sind<br />
so abgestuft, dass jede höhere Klasse ungefähr das Doppelte<br />
der nächstfolgenden kostet. Erstaunlich billig, aber auch<br />
furchtbar überfüllt, ist die dritte Klasse. Sie wird nur von<br />
Eingeborenen benutzt, und es ist ein unterhaltendes Schau<br />
spiel zu sehen, wie Männer, Weiber und Kinder mit grossen<br />
Packereien auf dem Kopfe, und die kleinsten Kinder rittlings<br />
auf den Hüften der Mütter sitzend, mit vielem Lärm sich um<br />
die geschlossenen Wagentüren drängen, von denen eine<br />
neue immer erst geöffnet wird, wenn das vorige Coupe<br />
gänzlich vollgepfropft ist. Doch gibt es auch hier besondere<br />
Abteilungen für die Frauen. Etwas besser ist die Intermediate<br />
Class, in der man bisweilen schon weisse Gesichter sieht;<br />
zuweilen sind hier die Coupes mit den Inschriften Natives<br />
oder Europeans only versehen. Die zweite Klasse wird von<br />
den besten Eingeborenen, soweit sie nicht als Fürsten eigene<br />
Wagen haben, und auch stark von den Europäern benutzt.<br />
Die Wagen der ersten Klasse enthalten nur vereinzelte Per<br />
sonen und laufen meistens leer mit. Fast immer hatten wir<br />
ein Coupe allein und befanden uns bei Tag wie bei Nacht<br />
sehr komfortabel. Ein solcher Wagen erster Klasse besteht<br />
nur aus zwei geräumigen Coupes, in der Mitte durch eine<br />
meist verschlossene Tür getrennt; zu jedem Coupe gehört<br />
ein eigenes Waschzimmer mit allen Bequemlichkeiten, welches<br />
den Kopf des Wagens bildet. An beiden Längsseiten des<br />
Coupes befinden sich zwei gepolsterte, mit Leder überzogene<br />
Bänke, die am Tage zum Sitzen dienen, während bei Nacht<br />
die Betten auf denselben gemacht werden. Zwei ebensolche<br />
sind an der Decke befestigt und können erforderlichen Falls<br />
herabgelassen werden. Da für die Nacht sleeping accommo-<br />
dation garantiert ist, so dürfen nachts nicht mehr als vier,
Einrichtung der indischen Eisenbahnen. 47<br />
tags nicht mehr als sechs Personen in das geräumige Coupe<br />
gesetzt werden. In der Regel ist man darin, wie gesagt,<br />
ganz allein. Ausser dem Guard, der den Zug begleitet,<br />
bekommt man keine Schaffner zu sehen. Die Billets<br />
werden äusserst selten beim Halten auf den Stationen kon<br />
trolliert, gewöhnlich sind es Halfcastes (Mischlinge von<br />
Europäern und Eingeborenen), welchen dieses Geschäft ob<br />
liegt, da sie zu viel anderem nicht zu brauchen sind. Die<br />
Süffisance, mit der sie auftreten, macht bei der sonstigen<br />
Schlaffheit ihres Wesens oft einen lächerlichen Eindruck.<br />
Sie sind nicht gerade geeignet, eine allmähliche Mischung<br />
englischen und indischen Blutes als wünschenswert erscheinen<br />
zu lassen. Noch ist zu bemerken, dass auch die Verpflegung<br />
beim Eisenbahnfahren eine wohlgeregelte ist. Breakfast, Tiffin<br />
und Dinner werden vom Guard telegraphisch auf den dazu<br />
bestimmten Stationen vorausbestellt, wo dann 15—20 Minuten<br />
Aufenthalt zu sein pflegen. So kann man es denn ganz wohl<br />
aushalten, Tage und Nächte (z. B. von Bombay nach Calcutta<br />
mit dem Schnellzuge drei Nächte und zwei Tage) im Coupe<br />
zuzubringen, namentlich da gegen die Sonnenglut durch weit<br />
überragende Schutzdächer und Holzjalousien Vorsorge ge<br />
troffen ist.<br />
Es war ein Sonntagmorgen gegen acht Uhr, als wir in<br />
Baroda ausstiegen, der Hauptstadt eines kleinen Fürstentums,<br />
dessen Beherrscher, der Gaikwar von Baroda, sich gerade<br />
in England befand, was jedoch seiner Gastfreundlichkeit<br />
gegen uns keinen Eintrag tat. Am Bahnhofe war Dhruva,<br />
der uns in einem herrlichen Hofwagen zunächst zu dem<br />
Palaste führte, welcher, fünf Minuten von dem Hauptpalaste<br />
des Gaikwar entfernt, uns als Wohnung dienen sollte. Hier<br />
empfing uns Herr Maier, ein junger Süddeutscher, der als<br />
Manager den verschiedenen Schlössern des Gaikwar vor<br />
stand. Während seine Person und Sprache uns an die
48 IV. Von Bombay bis Peshawsr.<br />
Heimat erinnerte, so war das, was er uns zeigte und zur<br />
Benutzung anwies, von der Art, dass wir uns in ein orien<br />
talisches Märchen hineingezaubert glaubten. Ein herrlicher<br />
Empfangssaal mit Teppichen, Diwanen und Sesseln, ein weiter<br />
und hoher und doch höchst behaglicher Speisesaal, zwei<br />
geräumige Schlafsäle mit Betten und Möbeln von erster<br />
Güte, alles neu, peinlich sauber und in auserlesenem Ge<br />
schmack, eine von Säulen und Gewölben gebildete, rings<br />
um das Haus laufende Veranda, das war das Feenreich, in<br />
welchem wir für einige Tage als alleinige Herrscher schalten<br />
durften. Der Koch mit seinen Gehülfen, verschiedene Diener<br />
für die mannigfachen Anforderungen des Lebens, im ganzen<br />
wohl ein Dutzend, alle in sauberster nationaler Kleidung, be<br />
dienten geräuschlos das Haus und waren jedes Winkes von<br />
uns gewärtig: Die herrlichste Zugluft durchströmte bei Tag<br />
und Nacht die kühlen Hallen des nach allen Seiten frei<br />
gelegenen Hauses, alle Türen und Fenster blieben auch bei<br />
Nacht geöffnet, wussten wir uns doch genugsam bewacht<br />
und beschützt, und das ferne Geheul der Schakale, die hier<br />
wie überall in Indien allnächtlich ihr vielstimmiges Konzert<br />
abhalten, diente nur, das Behagen dieses Zauberschlosses zu<br />
erhöhen. Diese Tiere, etwa von der Grösse und Gestalt<br />
unserer Füchse, sind sehr scheu und daher ausser in Museen<br />
und zoologischen Gärten, nie sichtbar, um so mehr aber hör<br />
bar; ihr Geheul klingt, als wenn ein Dutzend junger Hunde,<br />
ein Dutzend Katzen und ein Dutzend kleiner Kinder ihre<br />
bellenden, miauenden und schreienden Töne zu einem Konzerte<br />
vereinigten.<br />
Fürstiich, wie unsere Wohnung, war auch die uns ge<br />
botene Verpflegung. Es war nicht das erste Mal in meinem<br />
Leben, dass ich an einem Fürstentische speiste, aber eine<br />
auserlesenere Küche, als sie hier herrschte, habe ich kaum<br />
je angetroffen. Auch bedurfte es nur eines Wortes, und der<br />
beste französische Champagner, die edelsten Rheinweine
Baroda. Fürstliche Aufnahme. Besichtigungen. 49<br />
standen auf dem Tisch, eine Liberalität, von der wir teils<br />
aus Rücksicht auf das Klima, teils weil uns derartige Genüsse<br />
von der Heimat her nichts Neues waren, nur einen diskreten<br />
Gebrauch machten.<br />
Die Frühstunden des Sonntags benutzten wir, um mit<br />
Herrn Maier die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Residenz<br />
in Augenschein zu nehmen. Ein seltsames Kuriosum waren<br />
ein halb Dutzend Kanonen, welche angeblich aus gediegenem<br />
Golde bestanden und, wenn es wahr ist, einen ungeheuren<br />
Wert repräsentieren müssen und ein beredtes Zeugnis des<br />
fabelhaften Reichtums der früheren indischen Herrscher<br />
sind. Interessanter war noch ein Marstall voll edler Rosse,<br />
die unter überdachten Schuppen im Freien gehalten wurden,<br />
und eine Gesellschaft von zwanzig oder mehr Elefanten.<br />
Dieselben sind vollkommen zahm und umgänglich. Nur<br />
einige von ihnen, bei denen die Brunstzeit eingetreten war,<br />
waren von den anderen isoliert und mit starken Ketten an<br />
den Füssen gefesselt. Man warnte uns davor, denselben zu<br />
nahe zu kommen, und so sah ich nur aus einiger Entfernung<br />
ihre aufgebrochenen und einen klebrigen Saft ausschwitzenden<br />
Schläfen, von denen in der indischen Poesie so viel die<br />
Rede ist.<br />
So ging der Tag teils mit Besichtigung der Sehens<br />
würdigkeiten, teils mit notwendigen Besuchen bei Ministem<br />
und anderen Würdenträgern in der angenehmsten Weise hin.<br />
Am Abend wurde uns zu Ehren eine Theatervorstellung<br />
gegeben, bei der wir wieder die Ehrenplätze einnahmen,<br />
während unter Ausschluss des allgemeinen Publikums nur<br />
ein auserlesener Kreis von Geladenen uns umgab, wobei<br />
denn mancherlei Vorstellungen und Begrüssungen stattfanden.<br />
Als Stück hatte man diesmal, auf meinen Wunsch, ein<br />
antikes Drama zu sehen, die Priy'adarcikä gewählt, und<br />
Dhruva war so aufmerksam gewesen, für uns den Gang der<br />
Handlung in einem englischen Programm drucken zu lassen,<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 4
50 IV. Von Bombay bis Pestiawar.<br />
sodass wir Scene für Scene ganz bequem folgen konnten.<br />
Das Stück wurde natürlich in Gujerati-Übersetzung gegeben,<br />
aber Bühneneinrichtung, Kostüme und Ausführung der Chöre,<br />
Dialoge usw. schlössen sich so vollkommen dem Sanskrit<br />
texte an, dass ich vermuten möchte, dass das heutige Hindu<br />
theater in allem Wesentlichen noch das des Kälidäsa ge<br />
blieben ist. Am andern Morgen, in der Frühe wurde ein<br />
Ritt auf einem Elefanten zu dem eine Stunde entfernten Lust<br />
schlosse Mackä unternommen, welches eben für die Rückkehr<br />
des Gaikwar in Stand gesetzt wurde. Unter Führung des<br />
Herrn Maier, der diese Arbeiten unter sich hatte, besichtigten<br />
wir die verschiedenen Prachtsäle, und mit Befremden hörte<br />
ich, dass, wenn der Gaikwar hier seine Hoffeste gibt, seine<br />
Gemahlin nicht teilnimmt. Die indischen Frauen lieben es<br />
eben nicht, aus dem engen Kreise ihres Hauswesens heraus<br />
zutreten, und befinden sich, wie es scheint, ganz wohl dabei.<br />
Übrigens waren die Gemächer der Fürstin mit allem Komfort<br />
ausgestattet; es fiel mir auf, dass verschiedene prachtvolle<br />
Spieldosen, aber nur ein noch dazu recht mittelmässiger<br />
Flügel vorhanden war. Zuletzt besichtigten wir noch die das<br />
Schloss umgebenden Gärten- und Parkanlägen, welche noch<br />
jung sind, aber unter dem indischen Himmel einstmals gewiss<br />
sich zu einem Paradiese entwickeln werden. Dann zogen<br />
wir auf unserem Elefanten wieder heimwärts, die Morgen<br />
sonne brannte schon heiss auf unserem Rücken, und Freund<br />
Dhruva erklärte mir die am Wege stehenden Bäume. Nament<br />
lich der Unterschied von Nyagrodha (ficus Indica) und<br />
Agvattha (ficus religiosa) würde mir hier zum erstenmal klar.<br />
Beide sind nach Wuchs und Aussehen der Blätter sehr verschiedene<br />
Bäume.<br />
Den Nachmittag hatte der Minister für ein Zusammen<br />
sein mit den Hauptwürdenträgern des Landes bestimmt.<br />
Durch zufällige Umstände wurde auch dieses in unser Palais<br />
verlegt, und so 'gewann es den Anschein, als wenn das
Seite 50.<br />
c<br />
3
Ritt nach Macka. Grosse Cour. Sanscrit College. 51<br />
ganze Ministerium und die halbe Universität bei uns zur<br />
grossen Cour angetreten wäre. Es waren alles intelligente,<br />
würdevolle und verbindliche Männer, welche sich von<br />
europäischen Grossen durch ihre malerische und kostbare<br />
Kleidung sehr unterschieden, aber an feinem, taktvollem Auf<br />
treten denselben, wie mir schien, nicht im mindesten nach<br />
standen. Die Unterhaltung bewegte sich einige Stunden lang<br />
in der angenehmsten Weise um indische und europäische<br />
Verhältnisse, und wir schieden sehr befriedigt von einander.<br />
Für den folgenden Tag wurde ein Besuch des Sanscrit<br />
College beschlossen, welches Gymnasium und Universität<br />
vereinigt und ein gutes Bild von dem Bildungsgange der<br />
indischen Gelehrten bot. Die beneidenswerte, dem Europäer<br />
unerreichbare Fertigkeit im Sanskrit, welche die Pandits in<br />
der Regel besitzen, beruht darauf, dass sie schon im Alter<br />
unserer Sextaner das Sanskrit zu lernen anfangen und meistens<br />
ein langes, fleissiges Leben hindurch nichts als Sanskrit treiben.<br />
Der Unterricht beginnt mit Auswendiglernen von Wortern<br />
und Grammatik. Als erstes grösseres Dichterwerk wird sodann<br />
Raghuvahca studiert, dem Kumärasambhava, Meghadüta sowie<br />
die Dramen Kälidäsas und anderer folgen. Für eine höhere<br />
Stufe dienen die Romane Dagakumäracaritam, Kädambari<br />
sowie die schwierigeren Kunstepen. Für die Universitäts<br />
stufen spaltet sich der Unterricht; die einen treiben ihr<br />
ganzes Leben durch Grammatik, Literatur und Poetik, während<br />
andere Astronomie, Medizin, Jurisprudenz oder Philosophie<br />
studieren, alles nach den alten Sanskritlehrbüchern, .daher<br />
z. B. die Lehrer der Astronomie die Erde als in der Mitte<br />
ruhend und alles als um sie im Kreise sich drehend annehmen;<br />
nur wenige wagen sich das Kopernikanische System anzu<br />
eignen, noch wenigere, sich offen zu demselben zu bekennen.<br />
Als wir in die stattlichen Räume des College eintraten,<br />
waren die verschiedenen Klassen mit ihren Lehrern bereits<br />
in einer grossen, nach der Seite offenen Halle versammelt.<br />
4*
52 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
Es wurden, wie dies gewöhnlich üblich ist, verschiedene<br />
Begrüssungsgedichte in Sanskrit vorgetragen und mir sodann<br />
überreicht. Ebenso händigte man mir ein langes, schön in<br />
Sanskrit geschriebenes Lehrprogramm ein, in welchem die<br />
Lehrpensa der verschiedenen Klassen spezifiziert waren. Ich<br />
wurde aufgefordert, Fragen zu stellen und musste, um keine<br />
der Abteilungen zu verletzen, wohl oder übel aus allen Dis<br />
ziplinen, Grammatik, Literatur, Astronomie und Philosophie,<br />
Juristerei und Medizin, eine Frage stellen, die dann von ein<br />
zelnen Schülern, und wo diese sich nicht zu helfen wussten,<br />
von den Lehrern beantwortet wurden. Auffallend war mir,<br />
dass immer nur die besten Schüler zu antworten bereit waren,<br />
auch dann, wenn ich meine Frage nicht an sie, sondern an<br />
andere gerichtet hatte. Im ganzen lief also die Sache doch<br />
mehr auf eine Schaustellung hinaus, und wenn ich später in<br />
Indien Schulen besuchte, pflegte ich zu bitten, dass man sich<br />
durch meinen Besuch nicht stören lassen, sondern ruhig im<br />
Unterricht fortfahren möge. Schon in Baroda hatten wir das<br />
später noch so oft genossene Schauspiel vor Augen, wie<br />
Lehrer und Schüler sämtlich mit untergeschlagenen Beinen<br />
auf dem Boden hockten. Beim Schreiben wird das Heft<br />
frei in der linken Hand gehalten, während die, rechte die<br />
Feder führt. Die Hindus sind so an diese Art des Schreibens<br />
gewöhnt, dass sie eine Unterlage, auch wenn man sie ihnen<br />
anbietet, zu verschmähen pflegen.<br />
Weniger interessant als das College war uns die Be<br />
sichtigung eines benachbarten Palastes mit allerlei Waffen<br />
und den Kronjuwelen. Ich überzeugte mich dabei, dass, so<br />
viele Kostbarkeiten auch schon aus Indien ihren Weg nach<br />
England gefunden haben, doch noch immer genug übrig<br />
bleibt, was die englischen Gouverneure und Residenten, oder,<br />
wo dies bedenklich erscheinen sollte, ihre Damen sich ge<br />
legentlich schenken lassen können. Ich bin weit davon ent<br />
fernt, alles zu glauben, was mir in dieser Beziehung erzählt
Examen. Kronjuwelen. Dhruva's Heim. Musikmeister. 53<br />
wurde, will aber doch bemerken, dass die Schilderungen, welche<br />
mir von der Reise eines englischen Prinzen und der Herren<br />
in seinem Gefolge gemacht wurden, mitunter einigermassen<br />
an das aus Cicero bekannte Auftreten des Verres in Sicilien<br />
erinnerten.<br />
Mit besonderem Interesse folgten wir noch in Baroda<br />
einer Einladung Dhruvas in sein Haus, um so lieber, als die<br />
indischen Gelehrten nicht immer gern Besucher bei sich<br />
empfangen. Hier, wie später noch oftmals, wurde ich an<br />
das Wort des wackeren Javeriläl erinnert: simplicity is the<br />
type of our life. Wir trafen eine Einfachheit der Ausstattung<br />
an Möbeln und dergleichen an, wie sie bei uns etwa im<br />
Mittelalter die Regel gewesen sein mag. Auch Frau Dhruva<br />
mit den Kindern erschien, während wir über den Gang hin<br />
andere weibliche Gestalten halb sichtbar nach indischer Ge<br />
wohnheit auf der Erde sitzen sahen. Es ist charakteristisch<br />
für die Inder, dass sie überall, im Hause wie im Freien, sich<br />
ohne Umstände auf die Erde setzen, welche freilich durch<br />
ihre grosse Trockenheit dafür ganz anders geeignet ist, als<br />
bei uns. Noch ein anderer Gast stellte sich bei Dhruva ein,<br />
ein indischer Musikmeister, ein ernster Mann, der seiner<br />
Kunst mit grosser Hingabe obzuliegen schien. Er überreichte<br />
ein Werk von sich über die Theorie der indischen Musik<br />
auf Hindostani mit eingeflochtenen Stellen aus Sanskrit<br />
gedichten, sprach aber leider weder Englisch noch Sanskrit,<br />
sodass die Unterhaltung mit ihm sehr beschränkt war. Indes<br />
bestätigte der Eindruck seiner gediegenen, wissenschaftlich<br />
ernsten Persönlichkeit die schon früher von mir gefasste<br />
Überzeugung, dass in der indischen Musik viel mehr liegt,<br />
als unser ungeschultes Ohr herauszuhören vermag. Sie<br />
besitzt eine komplizierte Theorie, und die Hingebung, mit<br />
der ich oft Musikstücke aufführen hörte, scheint dafür zu<br />
zeugen, dass sie in ihrer Art ebenso sehr wie unsere Musik<br />
imstande ist, die Seele eines Menschen auszufüllen.
54 IV. Von Bombsy bis Peshswsr.<br />
Der Aufenthalt in Baroda war so reich an schönen<br />
Erinnerungen, dass wir beschlossen, nicht von dort zu<br />
scheiden, ohne vorher1 durch eine photographische Aufnahme<br />
das Andenken an unser Zusammensein dauernder zu machen.<br />
Ein leidlicher Photograph war vorhanden, und er versprach,<br />
am Tage vor unserer Abreise nachmittags vier Uhr mit<br />
seinem Apparate vor unserem Palaste zu erscheinen, der<br />
natürlich den Hintergrund abgeben sollte. Alle Personen<br />
waren rechtzeitig versammelt; als grosse Hauptperson zu<br />
nächst der riesige Elefant, der uns nach Macka getragen<br />
hatte, und welcher, mit einer kostbaren Decke geschmückt<br />
und am Rüssel, den Wangen und sogar an den Ohren auf<br />
das schönste bemalt, mit seiner aus fünf Mann bestehenden<br />
Dienerschaft erschien. Eine zweite Hauptperson, für deren<br />
Mitaufnahme namentlich Herr Maier lebhaft plaidiert hatte,<br />
war der Citra (im Sanskrit „der buntfarbige"), d. h. der zahme<br />
Leopard des Fürsten, welcher für die Jagd auf Antilopen<br />
abgerichtet war. ' Seine Kunst besteht darin, die aufgespürte<br />
Antilope in schnellen Sätzen einzuholen und ihr die Gurgel<br />
durchzubeissen, sodass sie, im übrigen an Fell und Fleisch<br />
unbeschädigt, vom Jäger in Empfang genommen werden<br />
kann. Herr Maier war beim Minister sehr ins Zeug gegangen,<br />
um eine Jagd mit dem Citra für uns zu inscehieren; es wurde<br />
aber nichts daraus, namentlich da ich für meine Person auf<br />
das grausame Schauspiel durchaus keinen Wert legte. Dafür<br />
erschien jetzt der Citra, um mit uns photographiert zu werden.<br />
Er wurde auf einem kleinen eleganten Wagen herangefahren,<br />
mit einer Kappe über den Augen und auch sonst stark<br />
gefesselt. Drei Diener machten seinen Hofstaat aus, und<br />
man warnte mich, dem Tiere nicht allzu nah zu kommen.<br />
Ausser Elefant und Leopard waren ich selbst mit meiner<br />
Frau, Dhruva mit Frau und drei Kindern, Herr Maier mit der<br />
Reitpeitsche als steter Begleiterin und einige Nebenpersonen<br />
vorhanden. Alles war vollkommen bereit, nur eine Person
Photographische Aufnahme in Baroda. 55<br />
fehlte noch, ohne die wir nicht anfangen konnten, — und<br />
das war der Photograph. Es wurde nach ihm geschickt,<br />
aber er war nirgends zu finden. Vergebens warteten wir<br />
bis zum Dunkelwerden, der Photograph hatte uns einfach<br />
vergessen. Unter diesen Umständen und da alle sich sehr<br />
auf das Photographieren gefreut hatten, blieb uns nichts<br />
anderes übrig, als unsre Abreise bis auf den Mittag zu<br />
verschieben und für den anderen Morgen früh ein neues<br />
Zusammentreffen anzuberaumen, worauf dann endlich das<br />
Bild glücklich zu stände kam. Indem ich es in der Hand<br />
halte, ruft es mir die ganze Situation bis in die kleinsten<br />
Einzelheiten wieder ins Gedächtnis zurück.<br />
Den Hintergrund bildet unser Palais mit seiner stattlichen<br />
Einfahrt und seinen hohen Säulenhallen. Vor ihnen steht<br />
der Elefant, so ruhig und verständig, als wisse er, worum<br />
es sich handle. Vier Leute seines Gefolges stehen an seinem<br />
Kopfe, ihre langen Lanzen in der Hand. Der Elefantenführer<br />
sitzt vorne auf dem Nacken, als Symbol den kleinen Eisen<br />
haken haltend, mit welchem das kolossale Tier gelenkt und<br />
zum schnelleren Schritt, zum Halten oder Niederknieen ver<br />
anlasst wird. Letzteres geschieht, wenn Personen auf- oder<br />
absteigen wollen. Ein kräftiger Stoss mit dem Lenkhaken<br />
auf den Kopf veranlasst das Tier mit einem leisen Grunzen<br />
des Unbehagens langsam niederzuknieen; die Diener setzen<br />
eine kleine Treppe an, welche der Elefant zu diesem Zwecke<br />
stets an der Seite mit sich trägt. Man steigt hinauf und<br />
findet oben eine breite Fläche, auf welcher vier bis sechs<br />
Personen Platz haben, und die mit einem eisernen Geländer<br />
umgeben ist. Dort oben sitzen die Damen, d. h. Frau<br />
Dhruva mit kunstgerecht untergeschlagenen Beinen und meine<br />
Frau, der man das unbequeme ihrer Stellung wohl ansieht.<br />
Jede hält ein Dhruvakind auf dem Schosse, während der<br />
älteste Sohn, zwischen beiden, sitzend, voll Spannung der<br />
Begebenheit zuschaut. Vor dem Elefanten in der Mitte stehe
56 ^V. Von Bombay bis Peshawar.<br />
ich, sehr durch die ins Gesicht scheinende Sonne geniert,<br />
indem der Photograph im letzten Augenblicke mich auf<br />
forderte, den Sonnenhut abzunehmen. Mir zur Rechten steht<br />
Dhruva im Nationalkostüme, zur Linken ein Schulvorsteher<br />
und Herr Maier im Reitkostüme, die Reitpeitsche in der<br />
Hand, seinen Blick auf den Leoparden gerichtet, welcher,<br />
von drei Wärtern gehalten, die Gruppe nach links abschliesst.<br />
Leider hat das Untier den Kopf bewegt und dadurch drei<br />
Köpfe erhalten, sodass man es für den Cerberus halten<br />
könnte. Die tropische Sonne ist an den hellen Lichtern<br />
und den scharf umgrenzten Schatten leicht erkennbar.<br />
Das war der Schluss unseres Aufenthaltes in Baroda.<br />
Nach einem solennen Abschiedsmahle schieden wir dankbar<br />
von der trefflichen Wohnung und fuhren, von reichem<br />
Gefolge, begleitet, zum Bahnhofe.<br />
Unser nächstes. Ziel, Ahmedabad, wird von Baroda aus<br />
durch eine Eisenbahnfahrt von wenigen Stunden erreicht.<br />
Es war das erste Mal, dass wir bei Tage durch die indische<br />
Landschaft fuhren und noch dazu durch eine besonders<br />
reiche Gegend, welche wegen ihrer Fruchtbarkeit von den<br />
Indern Cämtara genannt wird. Es war der 28. November,<br />
und mit Entzücken sahen wir die herrlich grünende und<br />
blühende Landschaft mit ihren Riesenbäumen und ihrer<br />
tropischen Pflanzenfülle an uns vorüberziehen, während hier<br />
und da eine Anzahl Affen, ohne sich durch den vorbei<br />
sausenden Zug stören zu lassen, auf den Bäumen und im<br />
Grase ihre Männerchen machten. Wir wollen diese Gelegen<br />
heit benutzen, um einiges über Klima und Boden Indiens<br />
im allgemeinen zu sagen.<br />
Die tropischen Länder sind keineswegs immer die<br />
fruchtbarsten; vielmehr lehrt ein Blick auf die Karte, dass<br />
sich von der Westküste Afrikas an durch die Sahara, Ägypten,<br />
Arabien und Centralasien bis nach China hinein ein breiter
Seite 56.
Fahrt nach Ahmedabad. Klima Indiens. 57<br />
Ländergürtel hinzieht, in welchem es, vermöge einer Art<br />
Wechselwirkung zwischen der durch den wolkenlosen<br />
Himmel gesteigerten Hitze und der durch eben diese Hitze<br />
verhinderten Wolkenbildung, selten oder nie regnet, und<br />
die daher trotz der herrlichsten Sonnenkraft von der Natur<br />
dazu verurteilt sind, Wüste zu bleiben. Diesem Schicksale<br />
würde auch Ägypten verfallen, wäre nicht die Über<br />
schwemmung des Nils, und ebenso würde fast das ganze<br />
herrliche Indien eine Wüste sein, wären nicht die Monsun's,<br />
welche im Winter aus Nordosten wehen und daher nur<br />
wenigen Orten an der Ostküste die Feuchtigkeit bringen,<br />
in den Sommermonaten hingegen von Juni bis September,<br />
aus Südwesten wehend, eine so reiche Fülle von Regen<br />
über Indien ausschütten, dass das Land daran für das ganze<br />
Jahr genug hat Denn den ganzen Winter durch regnet es<br />
in Indien so gut wie gar nicht, und wir haben, von einem<br />
Regentag in Benares und zweien in Calcutta abgesehen,<br />
während unsres viermonatlichen Aufenthalts in Indien selten<br />
den Himmel bewölkt und kaum je einen Tropfen Regen<br />
gesehen. Die Regel war, dass die Sonne von sechs Uhr<br />
morgens bis sechs Uhr abends ihren majestätischen Lauf<br />
am völlig wolkenlosen Himmel vollendete. Bei uns würde<br />
unter diesen Umständen nach wenigen Wochen alles anfangen<br />
zu verwelken; in Indien behalten Bäume und Pflanzen den<br />
ganzen Winter durch ihr saftiges Grün; so gross ist die<br />
in der Regenzeit angesammelte und den Boden durch<br />
tränkende Feuchtigkeit.<br />
Eine weitere Folge dieser klimatischen Verhältnisse ist,<br />
dass der Ackerbau in Indien weniger als bei uns an be<br />
stimmte Jahreszeiten gebunden ist. Denn die Kulturpflanzen,<br />
wie Korn, Weizen und dergleichen, bedürfen, um sich vom<br />
Samenkorn bis zur reifen Frucht zu entwickeln, einige Monate<br />
hindurch Feuchtigkeit, Bodenwärme, Sonnenschein u. dergl.<br />
Welche Monate dabei im Kalender stehen, darnach fragt die
58 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
Pflanze nicht, und wo ihr, wie in Indien, jene Bedingungen<br />
das ganze Jahr durch mit Ausnahme der Regenzeit geboten<br />
werden, da ist sie bereit, zu jeder Zeit, sobald sie ausgesäet<br />
worden, zu wachsen und zu reifen. Wir konnten daher oft<br />
mals beobachten, wie auf dem einen Felde das Getreide ge<br />
erntet wurde, während es auf einem anderen Felde daneben<br />
eben erst in die Halme schoss und auf einem dritten Felde<br />
in frischem Grün aus der Erde aufkeimte. Inzwischen hat,<br />
wie man mir sagte, Indien im allgemeinen zwei Jahresernten,<br />
die eine im Winter, die andere, für Gewächse, die der Feuchtig<br />
keit weniger bedürfen, im Sommer vor Eintritt der Regenzeit.<br />
Nach der Regenzeit, die im Hochsommer einsetzt, zeigen die<br />
Bäume das herrlichste Grün und behalten es den ganzen<br />
Winter durch. Eine Landschaft mit Bäumen, welche, wie<br />
bei uns im Winter, der Blätter beraubt, ihre nackten Äste<br />
und Zweige gleichsam hülfeflehend zum Himmel strecken,<br />
habe ich in Indien nirgendwo gesehen. Erst im Frühling<br />
sollen, wie man mir sagte, die alten Blätter teilweise ab-<br />
gestossen und alsbald durch neu aufkeimende ersetzt werden.<br />
So genossen wir denn, während zu Hause alles in<br />
Schnee und Eis starrte, des herrlichsten Sommerwetters und<br />
können nicht in die Klage eines pessimistisch angehauchten<br />
und alles in Indien schlecht machenden Mitreisenden ein<br />
stimmen, welcher behauptete, dass man dieses fortwährenden<br />
schönen Wetters zuletzt ganz müde würde.<br />
Die schöne Fahrt von Baroda nach Ahmedabad, welche<br />
diese Abschweifung veranlasste, war vollendet, und wir Hefen<br />
in den Bahnhof dieser einstmals, zur Zeit der Moguls, grössten<br />
und schönsten Stadt des westlichen Indiens ein. Heute zählt<br />
dieselbe nach langen Zeiträumen des Verfalls wieder 148,000<br />
Einwohner, besitzt aber kein Hotel und nur ein entfernt<br />
liegendes Dak Bungalow, daher wir es vorzogen, ein Zimmer<br />
im Bahnhofsgebäude zu beziehen. Eben erst hatten wir uns<br />
in dem dürftig ausgestatteten Räume, so gut es gehen wollte,
Pflanzenwuchs. Ahmedabad. Sanitäre Verhältnisse. 59<br />
eingerichtet, da erschienen auch schon vier junge Leute, denen<br />
wir von Bombay aus empfohlen waren, und zu denen sich<br />
bald der Vater des einen, der alte, reiche und würdige<br />
Randiodläl gesellte, welcher als Mitglied des Magistrates<br />
manchen schätzbaren Aufschluss zu geben wusste. So er<br />
zählte er, dass Ahmedabad neuerdings eine teilweise schon<br />
durchgeführte Wasserleitung erhalten habe, dass aber das<br />
Unternehmen Widerstand finde infolge der Abneigung der<br />
Hindus, das Wasser aus künstlichen Leitungen zu benutzen.<br />
Sie halten nämlich das Wasser nur dann für rein (in reli<br />
giösem Sinne), wenn es unmittelbar aus den Händen der<br />
Natur entgegengenommen wird, und so trinken sie oft das<br />
stagnierende Wasser von Teichen, in welchen gleichzeitig<br />
gebadet und Küchengerät, Wäsche u. dergl. gewaschen wird.<br />
Nur diesen Missständen ist es zuzuschreiben, dass die Cholera<br />
in Indien nicht auszurotten ist und alljährlich in der heissen<br />
Jahreszeit ihren verheerenden Lauf durch die indischen Städte<br />
hält. Indes wütet sie zumeist nur in den ärmeren Volks<br />
schichten und pflegt, wie man mir öfter versicherte, einen<br />
„Gentleman" (d. h. wohl einen vernünftig lebenden Menschen)<br />
nicht anzugreifen. „Wir haben," so äusserte sich Ranchodläl,<br />
„in unserer Stadt die merkwürdige Erfahrung gemacht, dass<br />
diejenigen Viertel, in welchen die Wasserleitung schon durch<br />
geführt ist, auffallend wenig von der Cholera gelitten haben,<br />
und so dürfen wir hoffen, des Übels mit der Zeit Herr zu<br />
werden."<br />
Unter diesen und anderen Gesprächen machten wir eine<br />
Rundfahrt durch die Stadt, besuchten den im Südosten der<br />
selben gelegenen, von lieblich umwaldeten Hügeln umkränzten<br />
Kankariya-See, besichtigten auf dem Rückwege einige der<br />
zahlreichen erhaltenen Moscheen, deren Wände vielfach aus<br />
Steinen mit wunderfeinem Schnitzwerk und durchbrochener<br />
Arbeit bestehen, und endigten den Tag mit einem Spazier<br />
gange nach der hohen und langen Brücke über die Sabar-
60 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
matt Hier war es, wo der wackere junge Hariläl mir sein<br />
Leid klagte. Es ist nämlich eine grausame Einrichtung der<br />
Engländer, dass die höheren Stellen im indischen Staats<br />
dienste nur denjenigen offen stehen, welche ihre Examina<br />
in England abgelegt haben. „Ich traue mir wohl," sagte<br />
Hariläl, „den Fleiss und die Fähigkeit zu, diese Examina zu<br />
bestehen; auch bin ich durch die Gnade Gottes mit reich<br />
lichen Mitteln ausgestattet; aber die Reise nach England<br />
würde für mich die Ausstossung aus meiner Kaste zur Folge<br />
haben, und diesen Schmerz kann ich meinen Eltern und Ver<br />
wandten nicht antun. Ich sehe mich daher dazu verurteilt,<br />
zeitlebens eine untergeordnete Stelle zu bekleiden." Ich er<br />
munterte ihn, diese Schwierigkeit zu überwinden und wies<br />
auf das Beispiel Dhruvas in Baroda hin, welcher in Europa<br />
gewesen und, nachdem er in aller Stille und ohne damit zu<br />
prunken, zurückgekehrt sei, durch Zahlung von ein paar<br />
hundert Rupien und einige leichte Bussübungen sich die<br />
Mitgliedschaft seiner Kaste erhalten habe. Hoffentlich gelingt<br />
es dem Hariläl und vielen jungen Hindus in seiner Lage,<br />
nachdem sie selbst den religiösen Vorurteilen entwachsen<br />
sind, auch die ihrer Familie soweit zu brechen, um nicht<br />
alle besseren Stellen des Landes den Engländern allein über<br />
lassen zu müssen.<br />
Als ich, zum Bahnhofe zurückgekehrt, noch eine Weile<br />
vor demselben die Abendkühle genoss, hatte ich das ergötz<br />
liche Schauspiel, zu sehen, wie zwei Hinduweiber sich zankten.<br />
Jede derselben sass ruhig vor ihrer Hütte, und während die<br />
eine mit lauter Stimme und leidenschaftlicher Beredsamkeit<br />
ihre Sache entwickelte, hörte die andere aufmerksam und<br />
ohne sie zu unterbrechen bis zu Ende zu, um dann in der<br />
selben Weise ihre Gegenargumente weitläufig auseinander<br />
zusetzen. So wurde der Ball der Unterredung mehrere Male<br />
herüber- und hinübergeworfen, bis mit der Ermüdung der<br />
Lungen auch eine Beruhigung der Gemüter allmählich eintrat.
Religiöse Vorurteile. Zankende Weiber. Die Jaina's. 61<br />
Der folgende Tag, der einzige, den wir noch auf Ahmedabad<br />
verwenden wollten, brachte viele Eindrücke. Zunächst führten<br />
uns unsere Freunde wieder zur Sabarmatt, um dort das<br />
Treiben der badenden Hindus zu sehen, ein Schauspiel,<br />
welches wir nachmals noch in manchen Städten und am<br />
besten in Benares genossen; davon später ein Mehreres. Es<br />
folgte sodann die Besichtigung des grossen Jaina-Tempels,<br />
eines der schönsten und prunkhaftesten in ganz Indien. An<br />
Stelle der Götterbilder treten, da der Jainismus ebenso wie<br />
der Buddhismus bekanntlich eine atheistische Religion ist,<br />
die sitzenden Statuen des Jina und seiner vierundzwanzig<br />
Vorläufer, denn ohne Idole kann das Volk nun einmal nicht<br />
fertig werden. Vom Buddhismus, der seit Jahrhunderten in<br />
Indien völlig ausgerottet worden, und dem wir daher nur an der<br />
Nord- und Südgrenze, im Himälaya und auf Ceylon begegnen<br />
werden, unterscheidet sich der Jainismus namentlich darin,<br />
dass er nicht international geworden, sondern mehr hinduisch<br />
national geblieben ist, daher er sich in Bombay, Ahmedabad<br />
und anderen Orten behauptet hat. Aber der -Brahmanismus<br />
hat seine erstaunliche' Lebenskraft auch darin betätigt, dass<br />
er sich den Jainismus fast völlig assimiliert hat. Daher die<br />
Jainas beinahe ebenso sehr wie die Brahmanen die Be<br />
rührung mit den Fremden und namentlich das Zusammen<br />
essen mit ihnen scheuen, auch gegen ihr ursprüngliches<br />
Prinzip bei Besichtigung ihrer Tempel und Festlichkeiten<br />
dem Fremden gelegentlich Schwierigkeit machen, während<br />
man in den buddhistischen Tempeln überall ganz ungeniert<br />
umhergehen kann.<br />
Übrigens sind die Jainas vielfach im Besitze grossen<br />
Reichtums, und wir besuchten im weiteren Verlaufe des<br />
Morgens die Werkstätte eines Jaina, in welcher herrliche Holz<br />
schnitzereien und wundervolle Teppiche angefertigt wurden.<br />
Bei der Teppichwirkerei ist die Kette von oben nach unten<br />
gespannt; hinter derselben sitzt eine Reihe Knaben. Ihnen
62 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
gegenüber auf der andern Seite der Kette steht mit dem<br />
Muster in der Hand ein Mann, auf dessen Kommandoworte<br />
die Knaben abwechselnd kurze buntfarbige Wollten durch<br />
die Kette flechten, sodass die Enden der Fäden nach ihnen<br />
zu herausstehen und eine rauhe, wollige Masse bilden, welche<br />
nachmals glatt geschoren als die rechte Seite des Teppichs<br />
die schönsten Muster zeigt. Teppiche wie Schnitzereien<br />
wurden auf Bestellung für Amerika und andere Gegenden<br />
angefertigt. Die Preise waren so hoch, dass wir darauf ver<br />
zichteten, irgend etwas anzukaufen. Der noch jugendliche<br />
Besitzer, in dem ich durch einige Fragen den von Freund<br />
Garbe beschriebenen Jüngling wiedererkannte, schien auch<br />
gar nicht zu erwarten, dass wir etwas erstanden. Wie<br />
üblich, legte,er uns zum Schluss das Fremdenbuch vor, in<br />
dem wir das. Vergnügen, mit welchem wir in der Tat die<br />
Arbeiten besichtigt hatten, r gerne bescheinigten. ,<br />
Von hier ging's zu dem Pinjra-Pol („Käfigbrücke") ge<br />
nannten Tierhospitale, wie deren in Bombay, Ahmedabad<br />
und manchen anderen Städten Indiens bestehen. Diese mehr<br />
der Absicht als der Wirkung nach anerkennenswerten Institute<br />
haben den Zweck, kranke und alte Tiere bis an ihr Ende zu<br />
verpflegen, sowie auch, gesunde, namentlich. Kühe, den<br />
mohammedanischen Schlächtern abzukaufen und so am Leben<br />
zu erhalten. Man findet in denselben meist Pferde und Kühe,<br />
Ziegen und Hunde. In Bombay bemerkten, wir in dem<br />
Hospital einen Wagen mit aufgesetztem Käfige, in dem sich<br />
mehrere Affen befanden. Es waren dies, bösartige Tiere,<br />
welche von den Familien, die sie hielten, eingeliefert wurden<br />
und bestimmt waren, in den Wald abgeführt und dort los<br />
gelassen ,zu werden. Der strenggläubige Hindu tötet kein<br />
Tier, auch kein Insekt, ja nicht einmal eine Schlange. Trifft<br />
er eine solche an Orten,. wo sie gefährlich werden kann, so<br />
fängt er sie ein und transportiert sie in eine Gegend, wo<br />
sie nach seiner Meinung unschädlich ist, um, sie. dort in
Teppichwirkerei. Tierhospitäler. Schlangen. 63<br />
Freiheit zu setzen. Es gibt viele alte Häuser in Indien, in<br />
deren Mauerwerk Schlangen hausen. Das niedere Volk ver<br />
schont dieselben, weil es in ihnen die Geister der Vorfahren<br />
verkörpert glaubt. Öfter wurde mir versichert, dass diese<br />
Schlangen niemals einen Insassen des Hauses schädigten.<br />
Tatsache ist wohl, dass die Schlange dem Menschen aus<br />
dem Wege geht und nur dann beisst, wenn man sie reizt,<br />
also namentlich, wenn man unbehutsam oder im Dunkeln<br />
darauf tritt. Übrigens sind die Schlangen im Winter selten;<br />
sie bleiben dann zumeist in ihren Löchern. unter der Erde,<br />
und wir haben, ausser in den Händen der Gaukler und in<br />
den zoologischen Gärten, während unsres viermonatlichen<br />
Aufenthalts in Indien in der freien Natur nur einmal eine<br />
Schlange angetroffen. In der heissen Zeit und noch mehr<br />
in der Regenzeit sollen sie nicht selten sein und erscheinen<br />
manchmal an Orten, wo man sie ganz und-gar nicht ver<br />
mutet, wie denn z. B. Frau Dr. Hörnle auf dem Balkon, ihrer<br />
mitten in Calcutta eine Treppe hoch gelegenen Wohnung<br />
eines Tages eine Schlange antraf; wie dieselbe dorthin ge<br />
kommen, blieb allen ein Rätsel; sie mag wohl im Gemüse<br />
versteckt gewesen sein. Eine schöne Überraschung erlebte<br />
auch, wie Frau Dr. Hörnle erzählte, ein Freund dieser Familie,<br />
welcher eine Partie Schlangeneier in seinem Koffer ge<br />
sammelt hatte und, als er denselben eines Tages öffnete,<br />
eine Gesellschaft munterer kleiner Schlangen vorfand, welche<br />
dank der tropischen Hitze aus den Eiern ausgekrochen waren.<br />
Um auf das Tierhospital in Ahmedabad zurückzukommen,<br />
so befanden sich in ihm nur die bereits genannten Haus<br />
tiere. Manchem derselben, welches krank oder verstümmelt<br />
umherschlich, wäre der Todesstoss gewiss eine Wohltat ge<br />
wesen, sodass der erreichte Zweck hier in seltsamem Kon<br />
traste zu der grossen und edlen Absicht steht. Erhalten<br />
werden diese Institute durch reichliche Beiträge, wie denn<br />
z. B. in Bombay die Baumwollenhändler bestimmte Prozente
64 IV. Von Bombay bis Peshawar,<br />
vom Gewinn an das Pinjra-Pol abzugeben sich verpflichtet<br />
haben. Nur als einen schlechten Witz kann man es an<br />
sehen, wenn in Büchern erzählt wird, dass die Tierhospitäler<br />
auch eine Abteilung für Insekten hätten, und dass Neger ge<br />
halten würden, um denselben ihre Köpfe als Weide darzu<br />
bieten. Die Hindus versicherten mir, dass dergleichen nie<br />
vorgekommen, und doch hatte einmal ein Missionar in<br />
Bombay die Stirn, mir gegenüber zu behaupten, dass die<br />
Sache auf Wahrheit beruhe, worauf wir später noch zurück<br />
kommen werden. Vorläufig sei nur bemerkt, dass alles, was<br />
die Missionare von Indien erzählen und schreiben, sehr mit<br />
Vorsicht aufzunehmen ist. Ihr gewöhnlicher Kunstgriff be<br />
steht darin, ganz seltene Ausnahmefälle so in den Vorder<br />
grund zu stellen, dass dieselben als die Regel erscheinen,<br />
wodurch dann ein ganz verzerrtes Bild des indischen Volks<br />
lebens entsteht.<br />
Wir beschlossen den Morgen mit einem Besuche bei<br />
den Sädhu's, worunter eine Art indischer Mönche zu ver<br />
stehen ist, die in einem wohlfundierten Kloster zusammen<br />
leben. Sofort wurde in einer geräumigen Halle eine Ver<br />
sammlung derselben veranstaltet, zu der sich wohl 50 bis 60<br />
einfanden, von welchen jedoch kaum einer oder der andere<br />
ein noch dazu sehr kümmerliches Sanskrit sprach. Die in<br />
dischen Pandits sprechen von diesen wohlgenährten Müssig-<br />
gängern mit Verachtung und mögen wohl Recht darin haben.<br />
Am Nachmittage hatten wir zwei grosse Versammlungen<br />
hintereinander, die eine mit Pandits, in der Sanskrit gesprochen<br />
wurde, die andere in einem Klub, wo in englischer Sprache<br />
mancherlei Themata berührt und namentlich Aufschluss über<br />
das Erziehungswesen in Europa verlangt wurde. Dann<br />
wurden Lieder aus Gitagovinda und anderen Dichtungen<br />
gesungen und mit den nationalen Instrumenten begleitet. Für<br />
den Abend entschuldigten sich meine Freunde, weil sie einem<br />
Diner ihrer Kaste beiwohnen mussten. Ich bat, mir den
Pinjra Pol. Sädhu's. Kastendiner. Abreise. 65<br />
Anblick desselben zu verschaffen, und sie sagten es zu, holten<br />
mich aber, wohl absichtlich, erst dazu ab, als die Hauptsache<br />
schon vorbei war. In einer langen, engen Strasse, die nur<br />
von dieser Kaste bewohnt wird, waren hier mehrere Hundert<br />
in langen Reihen auf der Strasse hockend gespeist worden.<br />
Ich sah nur noch einige Nachzügler und die Spuren der<br />
beendigten Mahlzeit, namentlich die zahllosen kleinen Ton-<br />
gefässchen, in welchen die Gerichte vor jeden einzelnen be<br />
sonders hingesetzt werden, und die nach einmaligem Ge<br />
brauche weggeworfen werden müssen. Man nimmt zu jeder<br />
Mahlzeit wieder neue, da ein ganzes Tausend derselben, wie<br />
man uns sagte, nur eine Rupie kostet. Ich hatte noch das<br />
Vergnügen, mit dem Gastgeber und einigen seiner Freunde<br />
bekannt zu werden und musste von allen Speisen nachträglich<br />
kosten und dieselben natürlich für vorzüglich erklären.<br />
Am andern Morgen brachen wir von Ahmedabad auf<br />
und waren froh, von unserm engen und geräuschvollen<br />
Bahnhofszimmer Abschied zu nehmen. Die Freunde fanden<br />
sich auf dem Bahnhofe ein; einer derselben, der jüngere<br />
Dhruva (Bruder des Dhruva in Baroda), welcher in Ahmed<br />
abad eine Stelle als Lehrer des Sanskrit bekleidete, erklärte<br />
mir im Meghadüta, den ich stets zum Memorieren auf der<br />
Eisenbahn mit mir führte, mit Hülfe der Karte sehr sach<br />
kundig die verschiedenen Örtlichkeiten, welche die Wolke<br />
als Bote auf ihrer Reise durch Indien berührte, und von<br />
denen auch wir einige zu besuchen hofften. Dann brauste<br />
der Zug heran, ein rascher Abschied von den Freunden, und<br />
nordwärts ging es hinein in unbekannte Gegenden, welche<br />
im weiteren Verlaufe einen mehr sterilen Charakter annahmen<br />
und die Nähe der Wüste Maru bekundeten, welche links von<br />
uns, das Industal von der Gangesebene scheidend, sich in<br />
einer Breite von 300 Kilometern erstreckt. Am Nachmittage<br />
tauchten einzelne Bergrücken auf, unter ihnen Mount Abu,<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 5
66 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
berühmt als Sommerfrische und durch seine Jaina-Tempel;<br />
wir konnten ihn nur vorüberfahrend betrachten. Die Nacht<br />
trat ein, und am nächsten Morgen um 5 Uhr sollten wir<br />
Jaipur, unser nächstes Reiseziel, erreichen. Vorsorglich bat<br />
ich den Guard des Zuges, uns rechtzeitig vor Jaipur zu<br />
wecken. Er versprach es, wir kleideten uns wie gewöhnlich<br />
aus und schliefen ruhig ein. In der Nacht erwachte ich;<br />
das Licht in unserm Coupe war erloschen, um uns her war<br />
die tiefste Finsternis. Ich zündete ein Streichholz an und<br />
sah nach der Uhr: 15 Minuten vor fünf; in einer Viertel<br />
stunde mussten wir in Jaipur sein, wo der Zug nur sieben<br />
Minuten hält. Der Guard hatte sein Versprechen vergessen.<br />
Jetzt ging es darum, in fliegender Eile und im Dunkeln, denn<br />
Kerzen, wie später jederzeit, führten wir damals noch nicht<br />
bei uns, Strümpfe und Stiefel und alle Kleidungsstücke zu<br />
finden und anzulegen, wobei in den verzweifeltesten Fällen ein<br />
angezündetes Streichholz helfen musste. Nur die Weste mit<br />
all unserem Barvorrat wollte sich längere Zeit nicht finden<br />
lassen. Endlich waren wir fertig, und es war auch höchste<br />
Zeit; der Zug hielt bereits, und mit Hülfe des Dieners ge<br />
langten wir mit allen sieben Sachen noch rechtzeitig heraus<br />
und fuhren zu dem nur massigen Hotel Kaiser-i-Hind. In<br />
zwischen war die Morgenröte erschienen, und wir genossen<br />
von den Hotelfenstern aus den herrlichsten Sonnenaufgang,<br />
doppelt erfreulich nach dem tiefen Dunkel der Nacht und<br />
den Beängstigungen, die es diesmal für uns gehabt hatte.<br />
Die Häuptsehenswürdigkeiten von Jaipur sind das alte<br />
Königsschloss mit seinem Marstall und die zwei Stunden<br />
entfernt liegende Sommerresidenz Amber. Gleich nach der<br />
Ankunft wird dem Fremden ein Formular überreicht, auf dem<br />
er Tag und Stunde einträgt, wann er diese Dinge zu sehen<br />
wünscht, worauf dann alles Weitere von selbst besorgt und<br />
namentlich für die Tour nach Amber ein Elefant aus dem
Ankunft in Jaipur. Wanderung durch die Stadt. 67<br />
fürstlichen Marstall zur Verfügung gestellt wird. Nachdem<br />
wir diese Frage geordnet hatten, unternahmen wir einen<br />
Morgenspaziergang in die leider etwas entfernte und nur auf<br />
staubigen Wegen erreichbare Stadt, welche mit ihren schönen<br />
breiten Strassen und ihren rosa angestrichenen Häusern einen<br />
heiteren Eindruck macht, während ihre Bewohner, die<br />
Räjputen, mit ihren grossen, kräftigen Gestalten die stattlichsten<br />
Erscheinungen bilden, die man in Indien antrifft. In der<br />
Mitte der Stadt liegt ein grosser Marktplatz, auf dem, ähnlich<br />
wie in Venedig und Florenz, eine Anzahl Tauben gehalten<br />
werden. Wir kauften ein Körbchen mit Körnern und hatten<br />
bald das Vergnügen, die zarten Tierchen um Haupt und<br />
Schultern flattern und die Körner vertrauensvoll aus der<br />
Hand aufpicken zu sehen, bis ein zudringlicher Ziegenbock<br />
die Scene störte, den ich mit Rücksicht auf die Gefühle der<br />
umstehenden Eingeborenen nicht nach Gebühr abzufertigen<br />
wagte.<br />
Von hier wandten wir uns zu den fürstlichen Gärten,<br />
in denen, wie üblich, Tiger, Löwen und andere bissige Tiere<br />
in Käfigen gehalten wurden, während die Affen mit Kettchen<br />
an hohen Stangen angeschlossen waren, an denen sie beliebig<br />
nach oben zu ihrem kleinen Käfige oder nach unten zur<br />
Erde klettern konnten, um hier innerhalb des Spielraums,<br />
den die Kette gestattete, mit dem ihnen eignen possierlichen<br />
Ernste den Boden auf seine Bestandteile hin zu untersuchen.<br />
Nicht weit davon liegt in schönen Gartenanlagen das Museum<br />
von Jaipur, ein eleganter Bau mit sehr reichem Inhalte.<br />
Besonders fesselte mich eine Sammlung von Tonfiguren,<br />
welche die indischen Asketen in ihren mannigfaltigen selbst<br />
quälerischen Übungen veranschaulichten. Ursprünglich wurzelt<br />
die indische Askese in der hohen und wahren Erkenntnis von<br />
der Sündlichkeit des Daseins, aus welcher das Bestreben<br />
erwächst, durch Entsagungen und Quälereien aller Art das<br />
Fleisch abzutöten. Indessen ist diese echte Askese selten
68 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
zu finden. Im Himälaya, oberhalb Haridvär, wo die Gangä<br />
aus dem Gebirge hervorbricht, sollen viele Asketen zu finden<br />
sein. Freund Candrikäprasäd wollte auf der Reise zu uns<br />
stossen, um mich dort einzuführen, war aber leider verhindert,<br />
und so unterblieb die Sache, da der Europäer allein schwer<br />
lich dort viel zu sehen bekommen hätte. Denn die echten<br />
Asketen suchen die Einsamkeit auf und machen sich aus<br />
dem Europäer gar nichts. Sehr verschieden von ihnen sind<br />
diejenigen Asketen, welche die Städte aufsuchen und ihre<br />
Bussübungen zur Schau stellen. Von ihnen traf ich in Cal<br />
cutta am Ufer des Hugli eine ganze Anzahl. Jeder sitzt für<br />
sich an seinem Feuer fast ganz nackt, mit Wasserkrug, einigen<br />
Lumpen und anderen dürftigen Habseligkeiten umgeben und<br />
von einer Anzahl Neugieriger umstanden, die ihn in der<br />
Ausübung seiner Spezialität bewundern und ihm einige Al<br />
mosen spenden. Ihre Kunst, läuft meistens auf eine höchst<br />
unbequeme Art zu sitzen hinaus, in der sie möglichst lange<br />
auszuharren suchen. Einen sah ich, der auf einem Beine<br />
stand, während das andere an einer Stange hochgebunden<br />
war; ein anderer lag auf einem Bette mit spitzen Holznägeln,<br />
noch andere abenteuerliche Posituren konnte man an den<br />
Modellen in Jaipur beobachten. Fast alle haben den nackten<br />
Leib mit Asche beschmiert, die langen Haare hängen wüst<br />
über das Gesicht herunter, und die Nägel sind lang wie<br />
Adlersklauen. Der Gesichtsausdruck ist brutal und vertiert<br />
und zeigt schon, wie wenig ihre Askese auf geistigen Motiven<br />
ruht. Sie sind in der Tat nichts anderes als Bettler, welche<br />
sich das Ansehen von Asketen geben, und stehen mit ihren<br />
Künsten auf einer Linie mit den Kerlen in unsern Jahrmarkts<br />
buden, welche Feuer essen oder sich Schwerter bis in den<br />
Magen hinunterschieben. Wie diese, ruinieren sie durch ihr<br />
elendes Gewerbe sehr bald ihre Gesundheit.<br />
Das Museum von Jaipur, welches diese Abschweifung<br />
veranlasste, gewährt von der Terrasse auf seinem Dache
Echte und falsche Asketen. Elefantenritt nach Amber. 69<br />
eine herrliche Rundsicht auf die Stadt und umliegende Ebene,<br />
welche nach drei Seiten hin von schönen Bergen einge<br />
schlossen wird. Auf einem derselben befindet sich ein dem<br />
Prinzen von Wales zu Ehren in turmhohen Buchstaben ein<br />
gegrabenes WELCOME, — vielleicht die grösste Inschrift<br />
der Welt, welche über die ganze Ebene hin sichtbar ist und<br />
wohl noch für viele Jahrhunderte Zeugnis ablegen wird von<br />
der Unterwürfigkeit gegenüber den fremden Beherrschern<br />
des Landes.<br />
Im Gebirge nach Norden zu liegt die Sommerresidenz<br />
Amber, die wir am folgenden Tage besuchten. Wir fuhren<br />
im Wagen bis zum Anfang der Berge, wo der Elefant bereit<br />
stand, welcher uns auf einem zwischen den Bergen anstei<br />
genden und dann wieder sich senkenden Wege, an welchem<br />
links und rechts in Nischen allerlei Götterbilder standen,<br />
nach Amber führte. Der ganze Weg hatte grosse Ähnlich<br />
keit mit der von Athen nach Eleusis führenden Strasse; wie<br />
auf dieser nach der Senkung des Weges die Bucht von<br />
Salamis sich öffnet, so liegt Amber an einem reizenden See,<br />
malerisch um eine Anhöhe herum gelagert. Die Häuser sind<br />
vielfach verlassen und allerlei Asketen haben sich in den<br />
selben eingenistet. Auf der Höhe liegt das stattliche Schloss,<br />
welches mit seinen verschiedenen Sälen, Frauengemächern,<br />
Badezimmern usw. den gewöhnlichen Eindruck der moham<br />
medanischen Paläste macht.<br />
Nach Jaipur zurückkehrend, kamen wir an einem Teiche<br />
vorbei, in welchem Krokodile gehalten wurden, deren Füt<br />
terung ein seltenes Schauspiel bot. Unser Diener kaufte für<br />
eine halbe Rupie in einem Schlächterladen in der Nähe ein<br />
grosses Konglomerat von Fleischabfällen, bestehend aus<br />
Lunge, Leber und Eingeweiden; dieses wurde dem Wächter<br />
übergeben, der alles an einen Strick band und ins Wasser<br />
hinunterliess, worauf er mit lauten Rufen die Krokodile
70 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
lockte. Lange Zeit blieb die weite sumpfige Wasserfläche<br />
ganz still. Endlich machte er uns auf eine Bewegung des<br />
Wassers in der Ferne aufmerksam; es war ein riesengrosses<br />
Krokodil, welches langsam unter der Oberfläche des Wassers<br />
heranschwamm. Bald kamen noch andere, und zuletzt sahen<br />
wir zu unsern Füssen in der Tiefe ihrer viere, welche phleg<br />
matisch ihre Mäuler aufklappten und nach den Fleischteilen<br />
schnappten. Nach und nach gelang es ihnen, ein Stück<br />
nach dem anderen loszureissen, bis schliesslich eines der<br />
Ungetüme sich der ganzen übrigen Masse bemächtigte und<br />
sie hinunterschlang.<br />
Eine Besichtigung des Schlosses mit seiner grossen<br />
offenen Audienzhalle, des schönen Gartens und der benach<br />
barten Marställe mit ihren Pferden und Elefanten vervoll<br />
ständigte die Eindrücke dieser indischen Residenzstadt.<br />
Wir eilten nach Hause, wo verschiedene Pandits ihren<br />
Besuch angekündigt hatten. Sie erschienen und mit ihnen<br />
noch mehrere andre, darunter ein alter blinder Pandit, kaum<br />
mit dem Notdürftigsten bekleidet, dem jedoch die Natur,<br />
wie so oft den Blinden, ein fröhliches Herz verliehen hatte.<br />
Nicht wissend, dass er schon von Geburt blind war, fragte<br />
ich ihn teilnehmend, welcher Unfall sein Leiden herbeigeführt<br />
habe. Seine Antwort war echt indisch: „Irgend eine in einer<br />
früheren Geburt begangene Sünde ist die Ursache," versetzte<br />
er in zufriedener Heiterkeit. Der Glaube an die Seelen<br />
wanderung ist heute wie in alter Zeit die Grundlage der<br />
ganzen indischen Religion. Er tröstet den Inder über die<br />
Leiden des Lebens, weil er sie als die notwendige Folge<br />
früher begangener Sünden begreift, und er ist ein starker<br />
Sporn, ein rechtschaffenes Leben zu führen, weil jeder Fehl<br />
tritt seine Sühnung in einem künftigen Dasein unvermeidlich<br />
im Gefolge hat. Auch lehrt eine tiefere Betrachtung, die wir<br />
jedoch hier nicht anstellen wollen, dass derSeelenwanderungs-
Krokodilfütterung'. Seelenwanderungsglaube. Kinderheiraten. f\<br />
glaube der allegorische Ausdruck einer für unsere Fassungs<br />
kraft unerreichbaren Wahrheit, dass er somit die Wahrheit<br />
im Gewände des Mythus ist. Die eigentliche Wahrheit,<br />
welche dieser Mythus vertritt, können wir wegen der an<br />
Zeit und Raum gebundenen Organisation unseres Intellektes<br />
nicht fassen und würden sie auch dann nicht fassen, wenn<br />
ein Engel vom Himmel käme, sie uns zu lehren.<br />
Am Abende folgten wir einer Einladung in das Haus<br />
des Colonel Jacob, wo wir den englischen Komfort in seiner<br />
Anpassung an die indischen Lebensverhältnisse beobachten<br />
konnten und beim Diner eine kleine, auserlesene englische<br />
Gesellschaft zusammenfanden. Colonel Jacob ist einer der<br />
nicht sehr zahlreichen Engländer, welche nicht schlecht von<br />
den Eingeborenen sprechen, und von denen, wie ich zuver<br />
sichtlich annehme, auch die Eingeborenen nicht schlecht<br />
sprechen werden. „Ich pflege," sagte er, „die Eingeborenen<br />
ähnlich zu behandeln wie Kinder, und bin dabei stets sehr<br />
gut mit ihnen ausgekommen." Als nach dem Essen die<br />
Damen, wie üblich, sich in den Salon zurückzogen, und die<br />
Herren ihre Cigarre anzündeten, kam das Gespräch auf eine<br />
wichtige Frage, nämlich auf die frühen Heiraten der Ein<br />
geborenen. Bekanntlich herrscht heutzutage in den meisten<br />
indischen Kasten das Gesetz, dass alle Mädchen vor dem<br />
elften Jahre verheiratet werden müssen. Zu diesem Zwecke<br />
hält der Vater einer Tochter unter den Mitgliedern seiner<br />
Kaste — denn nur diese kommen in Frage — frühzeitig<br />
Umschau. Er sucht zunächst vorsichtig Fühlung zu gewinnen,<br />
es knüpfen sich Unterhandlungen zwischen den beiderseitigen<br />
Eltern an, die Vermögensverhältnisse, die Zusammenstimmung<br />
der Charaktere werden sorgfältig erwogen, und zuletzt wird<br />
zwischen den Eltern der Bund geschlossen, der ihre Kinder,<br />
das Mädchen von elf, den Knaben von etwa sechszehn Jahren,<br />
für das ganze Leben unauflöslich bindet. Unter grossen<br />
Feierlichkeiten, von denen wir später noch einiges mitteilen
72 IV. Von Bombay bis Peshawsr.<br />
wollen, wird die Hochzeit abgehalten; die kindliche Gattin<br />
bleibt nach wie vor im Hause ihrer Eltern, und der Knabe-<br />
Ehemann besucht seine Schule weiter und wird, wenn<br />
er artig ist, gelegentlich von seinen Schwiegereltern zum<br />
Essen eingeladen, wobei er dann auch seine Gattin zu sehen<br />
bekommt. Eine effektive wird die Heirat erst, sobald bei<br />
dem Mädchen etwa mit vierzehn Jahren die Periode der<br />
Reife eintritt. Unter erneuten, aber weniger feierlichen Cere-<br />
monien wird es alsdann seinem Gatten übergeben und lebt<br />
mit ihm zusammen im Hause der Schwiegereltern; denn<br />
dass die Eltern und ihre verheirateten Kinder einen gemein<br />
samen Hausstand bilden, ist bei den Indern ganz gewöhnlich.<br />
Diese Kinderheiraten haben vieles gegen sich und auch<br />
manches für sich. Im ganzen läuft die Sache darauf hinaus,<br />
dass in Indien die Eltern die Ehe stiften, während bei uns<br />
das junge Paar sich mehr oder weniger selbständig zusammen<br />
findet. Bedenkt man nun die zahllosen Missgriffe, welche<br />
das Liebesleben bei uns mit sich bringt, und die oft durch<br />
ein langes Leben schwer gebüsst werden, so wird man die<br />
indische Methode nicht so übel finden. Freilich fehlt dort<br />
der Zauber des Verliebtseins, das Langen und Bangen, und<br />
ein Liebesdrama, wie das der (Takuntalä, ist unter den<br />
heutigen Verhältnissen in Indien nicht mehr möglich. Dafür<br />
fehlt aber auch das ungestillte Sehnen, das trostlose Gefühl,<br />
welches bei uns ein alterndes Mädchen erfüllt, das Kokettieren,<br />
Schmeicheln und was die Künste alle sind, die von Mutter<br />
und Tochter geübt werden, um glücklich einen Mann zu<br />
kapern. Es fehlt die innere Leere des Daseins, welche so<br />
oft bei uns das Los der alten Jungfern ist, denn alte Jungfern<br />
gibt es in Indien nicht, und sollten in einer Kaste mehr<br />
Mädchen als Männer sein, so nehmen die letzteren zwei<br />
Frauen, denn untergebracht müssen sie alle werden. Dem<br />
gegenüber steht in Indien der grosse Übelstand der jungen<br />
Witwen. Denn ist ein Mädchen mit elf Jahren verheiratet,
Für und gegen die Kinderheiraten. Professorenversammlung. 73<br />
und stirbt der ihr angetraute Gatte, so bleibt das arme Kind<br />
fürs ganze Leben Witwe, kann nie wieder heiraten und führt<br />
im Hause der Eltern ein zurückgesetztes, mehr oder weniger<br />
trauriges Dasein. Der Witwer hingegen kann so oft wieder<br />
heiraten, wie er will, nur bleibt ihm dabei nichts übrig, und<br />
wäre er sechzig Jahre alt, als ein Kind von elf Jahren zur<br />
Gattin zu wählen, denn andere sind eben nicht da. Das<br />
grösste Übel dieser frühen Ehen aber ist, was eben an jenem<br />
Abend bei Colonel Jacob zur Sprache kam, dass die effektive<br />
Heirat bei den Mädchen eine viel zu frühe ist und statt<br />
findet, ehe noch der Körper die erforderliche Widerstands<br />
kraft besitzt. Die Folge davon ist nicht nur, dass die jungen<br />
Frauen oft sehr schnell verblühen, hinwelken, hinsiechen und<br />
sterben, sondern auch dass sie schwächlichen Kindern das<br />
Leben geben, und dieser Umstand zusammen mit der fehlen<br />
den Fleischnahrung ist wohl der Hauptgrund, weswegen die<br />
Inder zwar nicht weniger intelligent, aber doch im Körper<br />
lichen wie im Geistigen so viel weniger leistungsfähig sind,<br />
als wir Europäer. Übrigens sind die vorurteilsfreieren Ein<br />
geborenen selbst von der Bedenklichkeit der frühen Heiraten<br />
überzeugt, wissen aber noch nicht, wie sie hier Abhülfe<br />
schaffen können, ohne in andre Übelstände zu verfallen.<br />
Wie in anderen Städten, statteten wir auch in Jaipur<br />
dem Sanscrit College einen Besuch ab. Ich fand das ganze<br />
Kollegium der Lehrer versammelt und auf der Erde hockend,<br />
und wir Hessen uns, an diesen Brauch bereits gewöhnt, als<br />
bald zwanglos in ihrer Mitte auf einem mit Tintenflecken<br />
reichlich gezierten Polster nieder. Sie verlangten Auskunft<br />
über den Kaiser Wilhelm und Bismarck, über Deutschland,<br />
und ob es auch dort Kasten gäbe, ob alle Deutsche Sanskrit<br />
verständen usw. Ich musste ihnen über meine Lebensstellung,<br />
meinen Namen, der sich im Sanskrit als Devasena sehr glück<br />
lich wiedergeben Hess, meine Titel usw. berichten und wurde
74 IV. Von Bombsy bis Peshawar.<br />
schliesslich gefragt, zu welcher Kaste ich gehöre? Ohne<br />
Zögern gab ich die vollkommen korrekte Antwort, dass ich<br />
ein Cüdra sei, denn alle Ausländer sind nach dem brahma-<br />
nischen System Qüdras, las aber auf den Gesichtern meiner<br />
Hörer ein solches Befremden über diese Antwort, dass ich<br />
mir vornahm, künftig etwas mehr mich dem Ideenkreise der<br />
Fragenden anzupassen. Ich pflegte daher späterhin bei der<br />
oft an mich gerichteten Frage nach meiner Kaste zu ant<br />
worten, dass ich in meiner vorigen Geburt ein Brahmane ge<br />
wesen sei, aber infolge irgend einer Sünde als Europäer,<br />
d. h. als Cüdra, habe wiedergeboren werden müssen und<br />
nunmehr nach dem Studium von Veda und Vedänta, nach<br />
dem Besuche Indiens und so vieler heiligen Orte und Männer<br />
hoffen dürfe, das nächste Mal mit Ueberspringung der<br />
zwischenliegenden Kasten wieder als Brahmane auf die Welt<br />
zu kommen. Dieses Märchen pflegte bei meinen Zuhörern<br />
viele Heiterkeit zu erregen, wurde aber auch einmal von<br />
einer Büsserin in Calcutta ernst genommen, wovon weiter<br />
unten noch die Rede sein soll.<br />
Am Morgen des fünften Dezember fanden wir uns in<br />
tiefem Dunkel vor fünf Uhr auf dem Bahnhofe ein, hatten<br />
die Freude, noch einmal Colonel Jacob zu begrüssen, den<br />
die unbequeme Zeit nicht abgehalten hatte, einer abreisenden<br />
Dame das Geleit zu geben, und bestiegen den Zug, der uns<br />
in neun Stunden nach Agra bringen sollte. Das Frühauf<br />
stehen auf Reisen ist ja mit mancherlei Beschwerden ver<br />
bunden, hat aber auch viele Vorzüge, namentlich in Indien<br />
und an jenem Morgen, wo wir von den Eisenbahnfenstern<br />
aus schrittweise den Übergang des nächtlichen Dunkels zur<br />
Dämmerung und zur Morgenröte verfolgen konnten. Lebhaft<br />
ergriff mich die Erinnerung an den Hymnus an die Morgen<br />
röte, Rigveda 6,64, den ich als ersten Vedahymnus 1865 noch<br />
bei Lassen gelesen hatte, und dessen Worte mir schon so
Meine Kaste. Fahrt nach Agra. Morgenstimmung. 75<br />
oft zu einem Inbegriff des Zaubers geworden waren, mit dem<br />
der Orient uns umstrickt. Jetzt sah ich sie wirklich einmal,<br />
die Lichtwellen, wie sie aus dem zartesten Rosa durch eine<br />
Reihe von Zwischenstufen zu Gelb und Weiss übergjngen,<br />
bis dann am wolkenlosen Horizont blitzartig der oberste<br />
Streifen des Sonnenballs erschien und wenige Augenblicke<br />
später die vollaufgegangene Sonne eine Lichtflut über die<br />
Natur ergoss, von der wir uns unter unserem bleiernen<br />
nordischen Himmel schwer eine Vorstellung machen können.<br />
Erhöht wurde die Stimmung durch den Gedanken, dass wir<br />
uns jetzt der heiligen Yamunä näherten, welche mit ihrem<br />
Schwesterflusse, der Gangä, so grosse Erinnerungen wach<br />
ruft, wenn dieselben auch durch die nachfolgende moham<br />
medanische Epoche in ähnlicher Weise übertüncht erscheinen,<br />
wie in Italien die Denkmäler des klassischen Altertums durch<br />
das nachfolgende christliche Mittelalter. Um zwei Uhr er<br />
reichten wir Agra, welches neben Delhi der Mittelpunkt der<br />
Erinnerungen an die Zeit der mohammedanischen Herrschaft<br />
bildet und von Denkmälern derselben ganz angefüllt ist.<br />
Wir Hessen unseren Diener allein mit dem Gepäck zum Hotel<br />
fahren und begaben uns vom Bahnhof sofort zu dem nahe<br />
liegenden Fort. Von den in ihm eingeschlossenen Moscheen<br />
und mohammedanischen Palästen aus, die jetzt den Eng<br />
ländern als Arsenale dienen, genossen wir den ersten Blick<br />
auf die Yamunä, die jenseits weit ausgebreitete Landschaft<br />
und den eine Viertelstunde unterhalb am Flusse liegenden<br />
weltberühmten Täj Mahal. Unwiderstehlich zog es uns zu<br />
diesem von Shahjehan seiner Lieblingsgattin Mumtaz-i-Mahal<br />
(„Erwählte des Palastes") errichteten Grabpalaste hin, wir<br />
achteten wenig des staubigen Weges und der glühenden<br />
Nachmittagsonne, bald war die tempelartige Eingangspforte<br />
erreicht, und da lag er vor uns, von seinem üppig grünendem<br />
Parke umgeben, der herrliche Täj Mahal. Der überwältigende<br />
Eindruck, den dieser Anblick, auch nach allen vorhergesehenen
76 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
Abbildungen, auf den Beschauer übt, beruht wesentlich auf<br />
der Wirkung der Kontraste. Der glitzernde Wasserstreifen<br />
mit seinen Lotosblumen, der sich von der Eingangspforte<br />
durch den Garten bis zum Täj Mahal hinzieht, der stolze<br />
Bau aus schneeweissem Marmor, die üppiggrünenden Park<br />
anlagen, die ihn umgeben, und darüber das dunkle Blau des<br />
indischen Himmels, das alles vereinigt sich zu einem Bilde,<br />
welches für einen Augenblick in der Seele des Beschauers<br />
alle Sorgen und Nöten des Erdendaseins verschwinden macht<br />
und in dieser übermächtigen Wirkung auf der Welt nicht<br />
leicht seines Gleichen findet. Hingegen kann ich der<br />
Meinung derer nicht beistimmen, welche den Täj Mahal für<br />
das schönste Bauwerk der Erde erklären. Wer den Kölner<br />
Dom, die Peterskirche in Rom, die freilich nur von innen<br />
schöne Hagia Sophja in Konstantinopel und vor allen den<br />
Parthenon in Athen gesehen hat, der wird in dem Täj Mahal,<br />
trotz der edlen Einfachheit seiner Formen, und Verhältnisse,<br />
gewiss nicht den höchsten Typus architektonischer Schön<br />
heit finden. Namentlich kann sich die mohammedanische<br />
Kuppel weder in der Form noch in der Art ihrer Aufsetzung<br />
mit der romanischen messen. Allerdings ist die Verjüngung,<br />
welche die erstere an ihrer Grundlage zeigt, wohl motiviert;<br />
sie soll das ungeheure Gewicht der Kuppel zur Anschauung<br />
bringen, ähnlich wie beim dorischen Tempel durch die An<br />
schwellung des Säulenkapitäls das Gewicht des Architravs<br />
uns zum Bewusstsein gebracht wird. Aber während die<br />
dorische Säule dem Drucke von oben kraftvoll Widerstand<br />
leistet, so erscheint die Einknickung am Fusse der moham<br />
medanischen Kuppel vielmehr als eine Schwäche.<br />
In diesen und ähnlichen Betrachtungen ging der Nach<br />
mittag hin, und schon vergoldete die untergehende Sonne<br />
mit ihren letzten Strahlen die Kuppeln und Minarets des<br />
stolzen Grabpalastes, als ein wohlgekleideter junger Mann<br />
auf uns zutrat und uns unter Nennung unseres Namens be-
Seite 76.<br />
<<br />
cd<br />
Der Täj Mshal. Läl Bsij Näth. Der Yoga. 77<br />
grüsste. Es war Läl Baij Näth, Richter in Agra, welchem<br />
unsere Ankunft brieflich gemeldet worden war, und der,<br />
nachdem er uns im Hotel vergeblich gesucht, nicht in Zweifel<br />
sein konnte, wo er uns finden würde. Wir schickten unsere<br />
Wagen voraus und traten in der Abendkühle zu Fuss den<br />
Rückweg an. Das Gespräch wendete sich bald geistigen<br />
Dingen zu, und ich glaubte an meinem Begleiter eine etwas<br />
hochmütige Stimmung durchzufühlen. In seinen ersten Ant<br />
worten lag so etwas, wie eine Frage, was wohl ich als<br />
Europäer über solche Dinge mitzureden habe. Wenige Aus<br />
einandersetzungen genügten, um seine Stimmung umzu<br />
wandeln, und nun zeigte er eine von Stunde zu Stunde zu<br />
nehmende warme Anhänglichkeit, und er wurde nicht müde,<br />
über diesen oder jenen Punkt immer neue Aufschlüsse zu<br />
verlangen. Er nahm es wirklich ernst mit seinem Vedänta-<br />
Glauben; sein Erbauungsbuch, in dem er täglich las, war der<br />
umfangreiche Yogavasishtha, und er zeigte eine gewisse<br />
Tendenz, nicht bei dem Räja-Yoga, der intellektuellen Hin<br />
gebung an das Göttliche stehen zu bleiben, sondern auch<br />
zum Hatha-Yoga überzugehen, welcher auf mehr oder weniger<br />
gewaltsamen Wegen die Abtötung der Weltlichkeit anstrebt.<br />
Er zeigte also ähnliche Neigungen wie bei uns der Pietismus,<br />
sofern man dessen Wesen darein setzen kann, dass er sich<br />
nicht begnügt, die Zeit der Gnade abzuwarten, sondern be<br />
müht ist, durch geflissentliches Aufsuchen von Busse und<br />
Bekehrung gleichsam um dieselbe zu ringen. Was bei uns<br />
dem Pietismus entgegen zu halten ist, dass die Wiedergeburt<br />
nur dann echt ist, wenn sie durch den heiligen Geist und<br />
gleichsam ohne unser Zutun gewirkt wird, dasselbe konnte ich<br />
dem jungen Inder in seiner Sprache begreiflich machen durch<br />
Hinweisung auf die Vedastellen, in denen es heisst, dass der<br />
Ätman nur in dem, welchen er sich selbst erwählt, Wohnung<br />
nimmt, und dass alle Werke, die guten wie die bösen, wo<br />
es sich um das Höchste handelt, nichtig sind.
78 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
Die Tage in Agra wurden wesentlich in Gesellschaft<br />
mit Läl Baij Näth verbracht. Am andern Morgen in der<br />
Frühe holte er uns in seinem Wagen im Hotel ab und fuhr<br />
mit uns nach dem eine Stunde von Agra entfernten Sikandra,<br />
um das Grab des Kaisers Akbar zu besuchen. Auch dieses<br />
ist ein mächtiger Palast mit vielen Türmen, Säulen und Auf<br />
gängen. Auf dem Dache breitet sich eine grosse Terrasse<br />
aus, von der man einen herrlichen Rundblick auf den um<br />
gebenden Park und die weite indische Landschaft geniesst,<br />
und wo nichts die tiefe Ruhe stört, als das liebliche Ge<br />
zwitscher der kleinen grünen Papageien, welche oft in ganzen<br />
Scharen auf den Kronen der unter uns Hegenden mächtigen<br />
Bäume sassen. „Hierher," sagte Läl Baij Näth, „begebe ich<br />
mich oft, um meinen Gedanken nachzuhängen;" und in der<br />
Tat, für die Sammlung der Seele konnte es keinen günstigeren<br />
Ort geben, als dieses Denkmal des grossen indischen Kaisers<br />
in seiner weltvergessenen Einsamkeit. Weiterhin besuchten<br />
wir mit unserem Freunde noch manche Erinnerungsstätte<br />
mohammedanischer Herrlichkeit, schenkten auch der Stadt<br />
mit ihren Kunstindustrien und Kaufläden die gebührende<br />
Beachtung und fanden uns am Abende in dem ausserhalb<br />
der Stadt gelegenen Hause unsres Freundes zusammen. Er<br />
hatte mich ersucht, ihm an diesem Abende die Gedanken,<br />
welche den Inhalt unserer Gespräche bildeten, einmal im<br />
Zusammenhang zu entwickeln und bat um die Erlaubnis,<br />
noch einige Freunde zuziehen zu dürfen. Gern willigte ich<br />
ein, war aber nicht wenig überrascht, als eine ansehnliche<br />
Versammlung sich einfand, vor der sich denn meine Rede<br />
zu einem zusammenhängenden Vortrage über alle Hauptpunkte<br />
des Vedänta-Systems gestaltete. In der darauf folgenden<br />
Diskussion, die teils in Englisch, teils in Sanskrit stattfand,<br />
fiel mir schon damals die theistische Neigung auf, welche<br />
viele heutige Vedäntisten zeigen, und auf die wir noch in<br />
einem anderen Zusammenhange zurückkommen wollen. Die
Akbars Grsbmonument. Abendgesellschaft bei Läl Baij Näth. 79<br />
Freunde, welche bei diesem ersten, durch zufällige Umstände<br />
veranlassten Vortrag zugegen waren, müssen wohl, ich weiss<br />
nicht ob mündlich, brieflich oder durch die Zeitungen, davon<br />
weiter erzählt haben; an mehreren Orten, die wir später<br />
berührten, wusste man darum und bat mit Berufung darauf<br />
um Haltung eines Vortrages, welches ich denn je nach<br />
Umständen bewilligte oder ablehnte.<br />
Die Gesellschaft bei Läl Baij Näth zog sich zurück, und<br />
wir blieben mit unserem Wirt allein, der uns zum Essen<br />
dahielt. „Heute," sagte er, „bekommen Sie eine europäische<br />
Mahlzeit, morgen abend aber will meine Frau für Sie eine<br />
Mahlzeit nach Hinduweise zubereiten; bei der ersten werde<br />
ich bloss Zuschauer sein, an der zweiten aber, wenn auch<br />
in einiger Entfernung, um die Pflicht meiner Kaste nicht zu<br />
übertreten, teilnehmen." Wir wollen diese Gelegenheit be<br />
nutzen, um über die Mahlzeiten der Hindus, wie wir sie<br />
nachmals noch oft mitgemacht haben, einiges Nähere mit<br />
zuteilen.<br />
Der orthodoxe Inder nimmt, wie es schon der Veda<br />
vorschreibt, zwei Mahlzeiten täglich zu sich, die eine morgens<br />
um elf Uhr, die andere abends um acht Uhr. Die Speisen<br />
werden von den Frauen des Hauses selbst zubereitet, welche<br />
in der Regel auch (natürlich nicht wenn Europäer zugegen<br />
sind) ihren Gatten beim Essen bedienen. Erst wenn<br />
die Männer gegessen haben, setzen sich die Frauen zu Tisch.<br />
Die Nahrungsmittel sind durchaus auf Milch und Vegetabilien<br />
beschränkt; Fleisch, Fische sowie auch Eier sind nicht er<br />
laubt. Ebenso sind alle geistigen Getränke ausgeschlossen;<br />
der gesetzlich lebende Inder trinkt ausser Milch nur klares<br />
Wasser. Selbst gegen Thee und Limonade haben sie meist<br />
Bedenken. Weder Tische noch Stühle werden beim Essen<br />
gebraucht. In einer luftigen Halle des Hauses werden nach<br />
der Zahl der Gäste viereckige Holzbretter, etwa wie unsere<br />
Zeichenbretter, gelegt, vor welchen die Speisenden, nachdem
80 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
ihnen ein Diener Wasser über die Hände gegossen hat, sich<br />
mit kreuzweise untergeschlagenen Beinen niederlassen. So<br />
dann werden die Speisen vor jeden einzelnen in ganz<br />
kleinen Näpfchen aus Ton oder Bananenblättern auf die<br />
Bretter gestellt. Die Zahl der Gerichte ist gross; zwölf bis<br />
zwanzig Gänge sind etwas ganz Gewöhnliches. Sie bestehen<br />
zur Hälfte aus verschiedenen, meist stark gewürzten Ge<br />
müsen, Milchspeisen, Reis, zubereiteten Früchten usw. und zur<br />
Hälfte aus allerlei Süssigkeiten. Brot gibt es nicht, sondern<br />
nur sogenannte Chapäti's, dünne, in der Pfanne gebackene<br />
Fladen, von denen ein ganzer Stoss vor jedem Gaste steht.<br />
Sie dienen zugleich als Löffel, um die halbflüssigen Milch<br />
speisen zu schöpfen. Irgend welche Werkzeuge, wie Messer<br />
und Gabel, werden nicht gebraucht, man isst, nur mit der<br />
rechten Hand, indem man nach Belieben bald in den einen,<br />
bald in den anderen Napf greift und das Erfasste vorsichtig<br />
von oben in den Mund schiebt. Die Überreste werden nie<br />
aufgehoben, sondern an Mohammedaner oder Qüdras weg<br />
gegeben oder auch weggeworfen. Alles, was vorgesetzt<br />
wird, ist an demselben Tage frisch zubereitet. Da die ge<br />
brauchten Rohstoffe sehr billig sind, so kann man für zwei<br />
Anas (20 Pf.) schon ein opulentes Mahl haben. Am Schlüsse<br />
wird wieder Wasser über die Hände gegossen und sodann<br />
das Tämbülam gereicht. Dieses besteht aus einem Betel<br />
blatte, in welches kleine Stückchen der Arekanuss und<br />
andere Gewürze (Cardamum, Cinnanum und Nelke) ein<br />
gewickelt sind. Man schiebt das Päckchen in den Mund<br />
und lässt es langsam zergehen, bis das Ganze herunter<br />
geschluckt ist, worauf dann viele eine zweite Dosis nach<br />
folgen lassen. Ja, manche halten sich den ganzen Tag am<br />
Betelkauen. Dasselbe soll die Verdauung befördern; der<br />
Geschmack ist scharf pikant und nicht unangenehm. Es<br />
vertritt für den Inder die Stelle der Cigarre. Hingegen ist<br />
das Tabakrauchen, abgesehen etwa von Bengalen, sehr wenig
Hindumahlzeiten. Betelkauen, Rauchen. Ein kostbares Andenken. 81<br />
eingeführt. Die meisten Inder enthalten sich desselben, weil<br />
es im Veda nicht erlaubt wird, während die wenigen Rauchen<br />
den ihr Gewissen damit beschwichtigen, dass es im Veda<br />
ja doch auch nicht verboten werde. Übrigens produziert<br />
Indien selbst viel Tabak, der zu einer guten Mittelsorte ganz<br />
rauchbarer, wenn auch nicht feiner Cigarren verarbeitet wird.<br />
Die besten kosten 3, 4 oder höchstens 5 Rupien das Hundert;<br />
dann springt der Preis gleich auf 15 Rupien und höher für<br />
importierte Cigarren. Nach dem Essen greift der Inder gern<br />
zur Musik, wie an jenen Abenden auch Läl Baij Näth,<br />
welcher, auf dem Teppich kauernd und behaglich an ein<br />
grosses Rollkissen gelehnt, einige Lieder vortrug und sich<br />
dabei auf der Laute begleitete.<br />
Als wir am Abend Abschied nahmen, überreichte mir<br />
Läl Baij Näth zum Andenken einen Stock aus Ebenholz,<br />
von oben bis unten mit schönen Schnitzereien bedeckt und<br />
mit eingelegten edlen Steinen verziert, ein altes Stück, das<br />
er einst auf einer Auktion in Benares erstanden hatte. An<br />
dem Griff befinden sich in eingelegter Elfenbeinarbeit die<br />
wunderlich verschlungenen Züge eines arabischen Namens,<br />
welchen mein Freund und Kollege Hoffmann als Osman<br />
Elias Muhammed Padischah entzifferte und dazu die Ver<br />
mutung äusserte, dass, nach dem letzten Titel zu schliessen,<br />
der Stock wohl einmal einem indischen Kaiser angehört<br />
haben könne. Im Laufe der Zeiten mag er denn durch<br />
viele Hände gegangen sein, bis er endlich in diejenigen<br />
kam, die ihn gewiss nicht wieder loslassen werden. Ich<br />
habe denselben durch alle Fährlichkeiten der Reise glücklich<br />
nach Hause gerettet, und er dient mir als wertes Andenken<br />
an den Geber, an die in Agra verbrachten Tage und an<br />
das herrliche Land, das wie ein verlorenes Paradies in<br />
unserer Erinnerung lebt.<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien.
82 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
Mittlerweile war der achte Dezember herangekommen,<br />
und der Winter fing an, sich so weit fühlbar zu machen,<br />
dass die Hindus morgens und abends um ihr kleines Feuer<br />
chen hockten, sei es vor den Häusern, sei es in denselben,<br />
wobei dann in Ermanglung der Schornsteine der Rauch<br />
durch Tür und Fenster und alle Ritzen der mit Stroh oder<br />
Ziegeln bedeckten Dächer quillt. Das Heizmaterial ist, wie<br />
schon im Rigveda, in der Regel Kuhdünger, welcher sorg<br />
fältig gesammelt, zu kleinen Kuchen geformt und an die<br />
Aussenwände der Hütten angeklatscht wird, um in der<br />
Sonne zu trocknen. Derselbe verbreitet beim Verbrennen<br />
einen eigentümlichen Ammoniakgeruch, der sich weithin<br />
bemerkbar macht. Sollte ich ihn je wieder riechen, so wird<br />
es mir sein, als wenn ich wieder in Indien wäre.<br />
Auch uns gemahnte der Winter, unsere Fahrt nach dem<br />
hohen Norden, d. h. nach dem Pendschäb, dem ältesten<br />
Sitze der indischen Kultur, nicht länger aufzuschieben, und<br />
wir beschlossen, Delhi und alles andere für die Rückkehr<br />
zu verschieben und von Agra über Lahore direkt nach<br />
Peshawar, dem nordwestlichen Endpunkte des anglo-<br />
indischen Reiches, durchzufahren.<br />
Am Morgen des achten Dezembers nahmen wir herz<br />
lichen Abschied von Läl Baij Näth und von dem schönen<br />
Agra, um in zweiundzwanzigstündiger Fahrt gleich durch<br />
nach Lahore, der Hauptstadt des Pendschäb, zu fahren. Das<br />
Pendschäb, im Nordwesten des indischen Reiches gelegen,<br />
wird von den Reisenden gewöhnlich nicht besucht, war<br />
aber für mich von besonderem Interesse, weil es der Sitz<br />
der ältesten indischen Kultur gewesen ist, wie sie uns noch<br />
heute nach drei- bis viertausend Jahren in den frischesten<br />
Farben aus den Hymnen des Rigveda entgegenleuchtet.<br />
Seitdem ist freilich über das Pendschäb eine Völkerwelle<br />
nach der anderen geflutet; hierher brachte der Alexanderzug<br />
die griechische Kultur; von hier aus waren auch die Moham-
Indischer Winter. Heizmaterial. Die Mohammedaner. 83<br />
medaner hereingebrochen, und hier haben sie noch heute<br />
ihren Hauptsitz, indem die Hälfte der Bevölkerung oder<br />
mehr in den nordwestlichen Provinzen mohammedanisch<br />
ist. Freilich sind diese Mohammedaner nur teilweise ein<br />
gewanderte Araber; ein grosser Teil derselben sind zum<br />
Islam bekehrte Hindus, und es wäre für die Beurteilung des<br />
Einflusses, welchen die Religion auf den Menschen ausübt,<br />
von grossem Interesse, festzustellen, inwieweit die islami-<br />
sierten Hindus den Hinducharakter oder den Charakter der<br />
Mohammedaner im allgemeinen zeigen, welcher ein sehr<br />
verschiedener ist. Die Grundzüge des letzteren lassen sich<br />
als Fanatismus, Neigung zu Gewalttätigkeiten und Habgier<br />
bezeichnen. So wird sich jeder, der Ägypten oder Palästina<br />
besucht hat, noch lebhaft an die unverschämte Bettelei, das<br />
ewige Bakschisch-Geschrei und die Unzufriedenheit erinnern,<br />
mit der auch die reichlichste Gabe entgegengenommen zu<br />
werden pflegt. Ähnliche Züge, wenn auch nicht in so hohem<br />
Grade, zeigen die Mohammedaner in Indien. Aber trotz<br />
ihrer Habgier haben sie doch keinen eigentlichen Erwerbs<br />
trieb und unterscheiden sich dadurch von ihren Rassen<br />
brüdern, den Juden, sehr merklich. Der Jude ist auch<br />
gewinnsüchtig, aber er ist dabei massig und sparsam und<br />
bringt es daher nicht selten zu einem Wohlstande, der für<br />
die christlichen Mitbürger etwas Beängstigendes hat. Der<br />
Mohammedaner hingegen, wie man mir in Indien oft ver<br />
sicherte, rafft nur zusammen, um das Errungene alsbald<br />
wieder zu vergeuden. Daher er selten zu grösserem Wohl<br />
stande und einer dementsprechenden einflussreicheren Stellung<br />
in der Gesellschaft gelangt. Als Diener ist der Moham<br />
medaner, weil die Kastenvorurteile wegfallen, brauchbarer<br />
als der Hindu. Die Köche in den Hotels und Dak Bunga<br />
lows sind fast durchweg mohammedanisch. Bekannt ist<br />
die starke Sinnlichkeit dieser Rasse. Eine Folge derselben<br />
ist die ängstliche Abschliessung der Weiber, und nichts ist<br />
6*
84 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
belustigender, als zu sehen, wie ein Mohammedaner mit<br />
seinem weiblichen Anhange zu reisen pflegt. Wenn er aus<br />
dem Eisenbahnwagen aussteigt, so muss jedes Weiblein<br />
aus dem Coupe unmittelbar in eine von allen Seiten ver<br />
schlossene Sänfte schlüpfen und wird in dieser bis zum<br />
Wagen getragen. Ist keine Sänfte vorhanden, so stülpt der<br />
Gatte einer Frau nach der anderen einen langen, bis auf<br />
die Füsse reichenden Sack über und geleitet sie zu einer<br />
entlegenen Stelle des Bahnhofs, wo sie unbeweglich stehen<br />
bleibt oder niederhockt, bis auf diese Weise alle weiblichen<br />
Mitglieder der Familie ausgeladen worden sind und dann<br />
mittels Wagen weitertransportiert werden.<br />
Diese und ähnliche Scenen konnten wir oftmals auf<br />
unserer Fahrt nach Norden beobachten, die uns von Agra<br />
in vierzehn Stunden nach Umballa und sodann die Nacht<br />
durch in weiteren acht Stunden nach Lahore führte, wo wir<br />
am anderen Morgen früh um sieben Uhr ankamen.<br />
Da wir am selben Abend weiter zu fahren gedachten,<br />
so Hessen wir unser Gepäck unter Obhut des.Dieners auf<br />
dem Bahnhofe und machten einen Morgenspaziergang in<br />
die Stadt, die uns von einem Modell im India Museum in<br />
London her bekannt war und allerdings eine gute Vorstellung<br />
von der Anlage der indischen Städte gibt.<br />
Die indische Stadt im allgemeinen lässt sich vergleichen<br />
einem Kreise und einer an denselben gelegten Tangente.<br />
Die Kreisfläche wird gebildet durch die enge, mit krummen,<br />
winkligen Gässchen durchzogene Eingeborenenstadt, die<br />
Tangente besteht in einer schönen breiten Chaussee, ge<br />
wöhnlich the Mall genannt, an welche sich ein System von<br />
Querstrassen und Parallelstrassen anschliesst, alle sehr breit,<br />
gerade und wohl gepflegt, welche die von den Europäern<br />
bewohnten Stadtteile bilden und häufig noch als Civil Lines<br />
und Cantonment unterschieden werden. Der letztgenannte
Die indische Stadt. Spaziergang in Lahore. 85<br />
Teil ist eigentlich für die Offizierswelt bestimmt, doch findet<br />
man in ihm auch viele Civilistenwohnungen. Die genannten<br />
breiten Chausseen, welche sich oft stundenlang erstrecken<br />
und der Stadt eine ungeheure, nur durch Wagen zu bewäl<br />
tigende Ausdehnung geben, werden nun nicht etwa von<br />
Häusern eingerahmt, sondern von grossen Grundstücken mit<br />
Gärten und parkartigen Anlagen, in denen in erheblicher<br />
Entfernung von der Strasse wie von einander sich grosse<br />
Villen und palastartige Gebäude mit Säulengängen und<br />
schönen Hallen erheben. Teilweise sind dieselben Privat<br />
wohnungen, teilweise dienen sie auch als Hotels, Bank<br />
häuser, Verkaufsläden u. dgl. Auch die europäischen Hand<br />
werker scheinen in Indien sehr komfortabel zu leben. Gerade<br />
in Lahore war es, wo ich eines Abends im Hotel nach ein<br />
genommenem Diner meine Cigarre rauchend mit einigen<br />
Herren um das in der abendlichen Kühle willkommene<br />
Kaminfeuer sass. Einer derselben, von eleganter Kleidung<br />
und vornehmen Manieren, wusste über allerlei recht gute<br />
Auskunft zu geben, und ich war ein wenig überrascht, als<br />
sich im Laufe der Unterhaltung herausstellte, dass er nichts<br />
anderes als ein Militärschneider war.<br />
An jenem Morgen unserer Ankunft durchschritten wir<br />
die geschilderten Anlagen des europäischen Viertels und<br />
gelangten sodann in die Eingeborenenstadt, in deren engen<br />
Strassen die Menge hin- und herwogte, während die meisten<br />
Häuser nach der Strasse zu sich zu Verkaufsläden öffneten,<br />
in denen in Säcken, Fässern und Kisten die mannigfachsten<br />
Produkte feilstanden, während der Verkäufer in gravitätischer<br />
Ruhe hinter denselben auf dem Boden kauerte.<br />
Nachdem wir das Vergnügen, uns in dem Labyrinth der<br />
Gassen zu verlieren und wieder zurechtzufinden, genugsam<br />
durchgekostet hatten, stieg in mir der Wunsch auf, den Fluss<br />
zu sehen, an welchem Lahore liegt. Es ist die schon im<br />
Rigveda vorkommende Irävati („die Labungsreiche"), heute
86 IV. Von Bombsy bis Peshswsr.<br />
Rävi genannt, der mittlere von den fünf Zuflüssen des Indus,<br />
welche dem Pendschäb den Namen gegeben haben. Die<br />
indischen Flüsse pflegen in der Regenzeit ihr Bett häufig zu<br />
verändern, und selbst der Ganges wühlt sich immer neue<br />
Wege und gibt dadurch den Besitzern der umliegenden<br />
Felder vielen Anlass zu Streitigkeiten und mühsamer Arbeit.<br />
Und so fliesst denn auch die Irävati heute eine Viertelstunde<br />
entfernt von Lahore vorüber. Wir fanden einen Knaben, der<br />
eben mit seinem Sanskrit-Abcbuch aus der Schule kam und<br />
sich sehr freute, als wir einen Wagen nahmen und ihm er<br />
laubten, mitzufahren. Rasch ging es nun zur Stadt hinaus,<br />
an Feldern und unbebauten Strecken vorüber, und bald war<br />
der Fluss erreicht. Wir überschritten denselben auf einer<br />
Schiffbrücke, die, wie gewöhnlich in Indien, höchst primitiv<br />
war, und genossen einen Blick in die freie Landschaft. Der<br />
Reiz der südlichen Natur kam weniger zur Geltung, weil das<br />
umliegende Land, wie überhaupt das ganze Hindostan, eine<br />
vollkommene Ebene bildet, während die gewaltigen Gebirgs-<br />
massen des Himälaya viel zu fern liegen, um dem Auge<br />
sichtbar zu werden. Etwas enttäuscht fuhren wir zur Stadt<br />
zurück, hielten bei einer Schule an und Hessen uns durch<br />
den Lehrer zum Vorsitzenden des Äryasamäj führen, eines<br />
über ganz Indien verbreiteten religiösen Vereins, welcher<br />
seinen Hauptsitz in Lahore hat.<br />
Solcher Vereine haben sich in Indien neuerdings mehrere<br />
gebildet. Sie beruhen alle auf dem Bestreben, der entarteten<br />
und in äusserlichem Ceremoniell erstarrten Volksreligion<br />
gegenüber zu älteren und würdigeren Anschauungen zurück<br />
zukehren. Aber während der Brahmasamäj vielfach aus<br />
ländische und namentlich auch christliche Elemente auf<br />
genommen hat, und während der Dharmasamäj nach der<br />
anderen Seite extravagiert und die Verehrung der Idole duldet,<br />
so hält der Äryasamäj, der in Indien wohl die grösste Ver<br />
breitung und die meiste Aussicht für die Zukunft haben
Die Irävati. Der Äryasamäj. Dr. Stein. 87<br />
dürfte, zwischen beiden eine massvolle Mitte. Er hält einer<br />
seits alles Ausländische von sich fern, verwirft aber ander<br />
seits auch den Dienst der Götterbilder und ist bestrebt, von<br />
ihnen zurück zur Religion des Veda zu gelangen. Unter den<br />
denkenden Hindus ist diese Richtung weit verbreitet, und<br />
wenn man auf dem Bahnhof am Billetschalter oder im Ge<br />
päckraum einen Beamten sieht, auf dessen Angesicht hinter<br />
der selten fehlenden Brille liebreiches Wohlwollen und ein<br />
gewisser kontemplativer Zug sich ausprägt, so wird man<br />
selten fehl gehen, wenn man in ihm einen Anhänger des<br />
Äryasamäj sieht und ihn als solchen anspricht, worauf sich<br />
dann alsbald die freundlichsten Beziehungen entwickeln.<br />
In grösseren Städten besitzt der Äryasamäj ein eigenes Haus,<br />
in welchem regelmässig gottesdienstliche Versammlungen<br />
stattfinden. Götterbilder enthält dasselbe nicht; hingegen<br />
lodert in der Mitte in einem kleinen viereckigen Raum, so<br />
gross wie die Öffnung eines Schornsteins, ein Feuer. Den<br />
Versammlungssaal habe ich irgendwo gesehen; dem Gottes<br />
dienste beizuwohnen, wozu man mich freundlich einlud, hatte<br />
ich keine Gelegenheit. Nach dem, was ich darüber gehört,<br />
werden dort Hymnen des Veda und Stellen der Upanishad's<br />
verlesen, über welche sodann gepredigt wird. In Lahore<br />
steht gegenwärtig an der Spitze des Äryasamäj ein noch<br />
junger Mann, Hans Räj, von freundlichem Aussehen und be<br />
scheidenem Wesen, mit dem ich eine kurze Unterredung<br />
hatte. Er wird sehr hoch geschätzt, namentlich weil er alles<br />
aufgegeben hat, um sein ganzes Leben ohne Entgelt in den<br />
Dienst des Äryasamäj zu stellen. Ich verliess Hans Räj, um<br />
mich zu Dr. Stein geleiten zu lassen, einem noch jungen,<br />
aber sehr verdienten Sanskrit-Gelehrten, der damals noch<br />
Vorsteher des Sanscrit College in Lahore war. Er empfing<br />
uns sehr freundlich und entriss uns mit einer gewissen<br />
Hebenswürdigen Eifersucht den Äryasamäj-Leuten, um uns<br />
für sich allein in Anspruch zu nehmen. Wir mussten sogleich
88 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
an seinem Frühstück teilnehmen und tranken dazu eine<br />
Flasche Kaschmirwein, welcher ganz vortrefflich war. Von<br />
Indien zeigte sich Freund Stein wenig erbaut; um so mehr<br />
von Kaschmir, welches er viel bereist und zum Zweck seiner<br />
Herausgabe der Räjatarnagini fleissig durchforscht hat. Er<br />
erzählte viel von der Schönheit des Alpenlandes und von<br />
der primitiven Art, wie man dort reise, indem z. B. oft zum<br />
Überschreiten von Strömen als einzige Brücke nur drei<br />
Stricke gespannt seien, der eine für- die Füsse, die beiden<br />
anderen, um sich mit den Händen daran zu halten.<br />
Indem wir in Gesellschaft von Dr. Stein, der vorzüglich<br />
in allem Bescheid wusste, noch diese und jene Sehens<br />
würdigkeit der Stadt besuchten, ging der Tag in der an<br />
genehmsten Weise hin, und nachdem wir am Abend noch<br />
seiner Einladung zum Diner im Hotel Folge geleistet, be<br />
stiegen wir, mit dem Versprechen, auf dem Rückwege einige<br />
Tage in Lahore zu verweilen, den Nachtzug, in welchem wir<br />
am andern Morgen in Rawal Pindi erwachten. Zahlreiche<br />
Soldaten auf dem Bahnhofe, viele militärische Baulichkeiten<br />
und Einrichtungen in der Umgegend deuteten darauf hin,<br />
dass hier die Engländer einen besonders starken Waffen<br />
platz haben. Nach einem trefflichen Frühstück, wie es sonst auf<br />
den Bahnhöfen selten geboten wird, fuhren wir weiter und<br />
erreichten gegen Mittag den Indus, da wo im Westen der<br />
Kabulfluss in ihn hineinströmt, während im Osten vom Flusse<br />
das stark befestigte Attock in malerischer Lage an dem Ab<br />
hänge eines Berges lehnt. Eine prächtige Eisenbahnbrücke<br />
führt über den Indus, welcher hier anmutig zwischen Bergen<br />
strömt, übrigens aber die Erwartung eines grossen Stromes<br />
nicht erfüllte; in meiner Erinnerung erscheint er kaum grösser<br />
als der Rhein bei Basel. In der Regenzeit, wenn die Berg<br />
wasser von allen Seiten zuströmen, mag er wohl einen an<br />
deren Anblick gewähren. Die Bahn zieht sich von hier<br />
weiter westlich in der kesselartig von Bergen umgebenen
Kaschmirerinnerungen. Der Indus. Hotel in Peshawar. 89<br />
Ebene des Kabultals hinauf, bis sie in Peshawar ihren End<br />
punkt findet. Hier langten wir im Laufe des Nachmittags<br />
an und begaben uns sogleich in das einzige Hotel des<br />
Ortes. Wir hätten wohl besser getan, das Dak Bungalow zu<br />
wählen. Schon auf den ersten Blick zeigte es sich, dass<br />
dieses Hotel, das schlechteste, welches wir in Indien an<br />
getroffen haben, in hohem Grade verwahrlost war. Gäste<br />
waren ausser uns nicht vorhanden, und das Fremdenbuch<br />
wies aus, dass nur selten Fremde sich hierher verloren hatten<br />
und dann baldmöglichst wieder verschwunden waren. Eine<br />
alte Frau erschien, welche sich als die Besitzerin des Hotels<br />
vorstellte. Sie wies uns ein sehr primitives Zimmer an und<br />
setzte mich nicht wenig in Erstaunen, als sie für den Tag<br />
und die Person sechs Rupien forderte, während wir sonst<br />
überall, mit drei berechtigten Ausnahmen, in den ersten Hotels<br />
nur fünf Rupien bezahlt hatten. Als ich dies geltend machte,<br />
ermässigte sie ihre Forderung sofort auf fünf Rupien, ver<br />
suchte dann aber nochmals zu betrügen, indem sie später<br />
auf der Rechnung das Diner besonders anschrieb, mit der<br />
monströsen Behauptung, dass dasselbe im Pensionspreise<br />
nicht einbegriffen sei. Natürlich ging ihr dieses nicht durch,<br />
und so blieb ihr nichts anderes übrig, als wenigstens in<br />
allerlei Kleinigkeiten, über welche zu markten sich nicht der<br />
Mühe lohnte, uns möglichst zu überfordern. Wir begaben<br />
uns in den sogenannten Salon, in welchem mancherlei Haus<br />
rat wunderlich zusammengewürfelt war, und da der Abend<br />
kühl wurde, so bemühte ich mich längere Zeit vergebens,<br />
das kümmerliche Kaminfeuer mittels eines zerbrochenen<br />
Blasebalges neu zu beleben.<br />
Inzwischen hatten wir an Colonel Warburton, die Haupt<br />
person in Peshawar, einen Brief mit der Bitte gesandt, uns<br />
die Besichtigung von FortJamrud zu gestatten. Jamrud liegt<br />
zwei Stunden westlich von Peshawar, da, wo die indische<br />
Ebene ihr letztes Ende erreicht, und die grosse Heerstrasse
90 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
sich durch den berühmten Khaibar-Pass im Gebirge hinauf<br />
windet, um nach Kabul in Afghanistan zu führen. Hier ist<br />
auch der letzte Endpunkt der britischen Herrschaft, deren<br />
Autorität wir es zu verdanken hatten, dass wir durch ganz<br />
Indien ebenso sicher reisen konnten, wie in der Heimat.<br />
Anders ist es jenseits von Fort Jamrud. Hier hört der eng<br />
lische Einfluss auf, aber zwischen dem englischen Terri<br />
torium und Afghanistan erstreckt sich ein zwanzig Kilometer<br />
breiter neutraler Landstreifen, welcher von sogenannten<br />
independent tribes bewohnt wird. So eifersüchtig diese<br />
Stämme auf ihre Unabhängigkeit sind, so wenig beneidens<br />
wert ist dieselbe. Eine allgemeine Anarchie ist die Folge,<br />
und in den einzelnen Dörfern stehen sich die verschiedenen<br />
Parteien gegenüber, wie die Montecchi und Capuletti in<br />
Shakespeare's Romeo und Julia. Eine öffentliche Sicherheit<br />
gibt es nicht, jedermann geht bewaffnet, und alle Augen<br />
blicke kommt es zu Streitigkeiten und Blutvergiessen. Ein<br />
Fremder kann diese Gegend nicht betreten ohne die Gefahr,<br />
als Spion betrachtet und ohne weiteres niedergeschossen zu<br />
werden. Immer wieder kommt von Zeit zu Zeit ein der<br />
artiger Unglücksfall vor, worauf dann die Engländer als<br />
Repressalien ein paar Dörfer niederzubrennen pflegen. Um<br />
diese Vorkommnisse zu vermeiden, gestattet die englische<br />
Regierung niemandem, den Khaibar-Pass zu betreten, aus<br />
genommen am Dienstag und Freitag, wo derselbe offen ist<br />
und durch genügende Besetzung mit Soldaten für die Sicher<br />
heit der Reisenden Und Karawanen Sorge getragen wird.<br />
Um diese Dinge in der Nähe zu sehen, bedurfte es der<br />
Erlaubnis des Colonel Warburton, und zu diesem Zwecke<br />
hatte ich vom Hotel aus einen Brief nach seiner Wohnung<br />
in Peshawar gesandt. Der Bote kam zurück mit der Nach<br />
richt, dass der Colonel sich auf Fort Jamrud befinde. So<br />
beschlossen wir, ihn dort am nächsten Morgen auf<br />
zusuchen.
Fort Jamrud. Der Khaibar-Pass. Independent tribes. 91<br />
Es war ein wunderschöner Sonntagmorgen, an dem wir<br />
dies ausführten. Die Sonne strahlte herrlich auf die Ebene<br />
des Kabulflusses, welche als solche durch die umliegenden<br />
ragenden blauen Berge auf das schönste zur Geltung kam.<br />
Die nördliche Lage und die Nähe des Gebirges verbreitete<br />
Frische, und so rollten wir auf einem Tam-tam (einem<br />
leichten zweiräderigen Wäglein, welches für Fahrgäste und<br />
Kutscher vier mit dem Rücken gegeneinander stehende Sitze<br />
bietet) auf Jamrud zu. Die Natur war diesen Winter im<br />
Kabultale besonders schön, da man hier, wie wir hörten,<br />
ungewöhnlich reichen Regen und freilich auch infolge dessen<br />
mehr Fieber als sonst gehabt hatte. Immer näher kamen die<br />
Berge heran, und wir freuten uns zu denken, dass wir hier<br />
den Punkt erreichten, wo wir nach der Luftlinie gemessen<br />
in Indien der Heimat am nächsten waren. Praktisch be<br />
trachtet waren wir ihr hier freilich ferner, als irgendwo.<br />
Denn welch ein Unternehmen wäre es gewesen, von hier<br />
der Luftlinie nach durch Afghanistan, Persien und das tür<br />
kische Kleinasien oder Russland nach Hause zu kommen!<br />
Indes kommt das englische Bahnnetz dem russischen immer<br />
näher, und zuletzt werden alle politischen und technischen<br />
Schwierigkeiten nicht mehr hindern können, dass sie sich<br />
zusammenschliessen und man in etwa zehn Tagen und<br />
Nächten von Berlin bis Calcutta direkt mit der Eisenbahn<br />
gelangen kann. Unter solchen Träumereien waren wir bis<br />
an den Fuss des mächtig ansteigenden Gebirges gelangt, und<br />
da lag auch schon Jamrud auf einem Hügel zur Linken, das<br />
erste Dorf ausserhalb des britischen Reiches, und ihm gegen<br />
über zur Rechten auf englischem Boden das kleine, aber<br />
respektabel befestigte Fort Jamrud, während zwischen beiden<br />
die Landstrasse die waldbewachsenen Berge hinauf sich nach<br />
dem Khaibar-Passe hinzog. Wir hielten vor dem Fort und<br />
Hessen uns bei Colonel Warburton anmelden. Er empfing<br />
uns sehr freundlich in seinem Arbeitszimmer, wo er gerade
92 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
mit einem eingeborenen Obersten konferierte, den er uns<br />
vorstellte, dessen Name mir aber leider entfallen ist. Einen<br />
eingeborenen Obersten! gewiss ein seltener Fall, dass ein<br />
Eingeborener zu einer so hohen Würde in Indien gelangt.<br />
Es waren aber auch besondere Verhältnisse, die ihn dazu<br />
befördert hatten. Dieser Mann stammte aus der Umgegend<br />
und hatte sich durch hervorragende Charaktereigenschaften<br />
eine solche Autorität unter den Eingeborenen zu verschaffen<br />
gewusst, dass die Engländer froh waren, bei den endlosen<br />
Verwickelungen, wie sie an einer solchen Grenzstation vor<br />
zukommen pflegen und denen ein Engländer nie gewachsen<br />
sein würde, eine energische, der Sprache, des Landes und<br />
der Bevölkerung kundige Kraft dem englischen Befehlshaber<br />
zur Seite stellen zu können. Dem entsprach auch die äussere<br />
Erscheinung des Mannes; englisch sprach er so gut wie<br />
garnicht, aber seine hohe, kraftvolle Gestalt flösste Achtung<br />
ein, sein Blick Hess auf Mut und klaren Verstand, seine<br />
Gesichtszüge auf Entschlossenheit und eine Energie schliessen,<br />
der sich niemand so leicht zu widersetzen wagen mochte.<br />
Er verabschiedete sich von uns mit einem kräftigen Hände<br />
druck, und nun entwarf Colonel Warburton von den herr<br />
schenden Verhältnissen ein Bild, welches durchaus das be<br />
stätigte, was wir auch von anderen gehört hatten und hier<br />
bereits mitgeteilt haben. „Den Khaibar-Pass", sagte er,<br />
„können Sie ausser am Dienstag und Freitag ohne Lebens<br />
gefahr nicht betreten. Auch das Dorf Jamrud würde ich<br />
Ihnen zu besuchen nicht raten. Sie würden nichts anderes<br />
antreffen, als was sie schon oft gesehen haben, und die Ein<br />
geborenen sind den Fremden nicht hold, als Mohammedaner<br />
sehr eifersüchtig auf ihre Weiber und dazu alle bewaffnet.<br />
Hingegen liegt unmittelbar vor dem Dorfe ein Teich, welcher<br />
noch heute der Teich des Jemschid heisst, worin Professor<br />
Darmesteter eine Erinnerung' an die iranische Sage sah.<br />
Wollen Sie diesen besuchen, so werde ich Sie unter Be-
Colonel Warburton und der eingeborne Oberst. 93<br />
deckung dorthin geleiten lassen." Wir nahmen das Anerbieten<br />
dankbar an, zehn Soldaten, alles braune Hindugesichter,<br />
traten mit dem Gewehr an und geleiteten uns an den fast<br />
gänzlich ausgetrockneten Teich, von wo wir eine gute Aus<br />
sicht auf die Hauptstrasse des Dorfes, die davor sitzenden<br />
Leute und die mit Flinten hin- und hergehenden Menschen<br />
hatten. Mit diesem Blick in die verworrenen Verhältnisse<br />
der iranischen Grenzländer begnügten wir uns und kehrten<br />
zurück in Unterhaltung mit einem des Englischen kundigen<br />
Hindu, welchen der Oberst uns gleichfalls mitgegeben hatte.<br />
Er war zuerst reserviert, wurde aber warm und mitteilsam,<br />
als wir auf unsere Beziehungen zum Äryasamäj zu sprechen<br />
kamen, welchem er als Mitglied angehörte. Sein Amt war,<br />
von den Karawanen den üblichen Eingangszoll — zwei<br />
Rupien für jedes Kamel — zu erheben.<br />
Nachdem wir noch innerhalb des Forts unter dem<br />
Schatten unseres Wagens das mitgebrachte Frühstück ver<br />
zehrt, traten wir den Heimweg an. Die schnelle Fahrt wurde<br />
plötzlich dadurch unterbrochen, dass der Kutscher bei einem<br />
kleinen Hause an der Landstrasse hielt, vor welchem ein<br />
Eingeborener sass und seinen Huqqa (indische Pfeife) rauchte.<br />
Unser Kutscher sprang vom Bock, bat den Rauchenden, ihm<br />
seine Pfeife zu erlauben, tat daraus einige kräftige Züge und<br />
schwang sich neugestärkt wieder auf den Bock. Nun ging<br />
es munter weiter und gegen halb drei Uhr war unser Hotel<br />
wieder erreicht. Hier hatte sich unterdessen ein junger<br />
Hindu eingefunden, dem wir brieflich empfohlen worden<br />
waren. Es war ein sanfter, lieber Jüngling von zarter, wie<br />
es schien, schwindsüchtiger Konstitution, welcher mit Vor<br />
liebe Philosophie studierte und darüber klagte, dass ihm<br />
durch die englischen Professoren der Philosophie die Freude<br />
daran fast ganz benommen worden sei. Ich konnte diese<br />
Klage um so mehr verstehen, als bei uns ja ganz ähnliche<br />
Verhältnisse bestehen. Was sich heutzutage in Deutschland,
94 IV. Von Bombay bis Peshawar.<br />
England und, soweit der englische Einfluss reicht, auch in<br />
Indien als Philosophie breit macht, das ist nicht mehr die<br />
Wissenschaft des Piaton und Aristoteles, sondern ein<br />
psychologisches Experimentieren, bei dem es sehr fraglich<br />
ist, ob etwas dabei herauskommt, und welches im besten<br />
Falle doch nur für eine Vorhalle der Philosophie gelten kann,<br />
heute aber die wahre Philosophie verdrängt, um sich an<br />
deren Platz zu setzen. Ich verwies den jungen Mann auf<br />
die einheimische Philosophie des Vedänta und die Ge<br />
dankenschätze, welche sie enthält, und das Wenige, was ich<br />
ihm in der Kürze sagen konnte, schien ihm neuen Mut ein<br />
zuflössen. Er zeigte grosse Anhänglichkeit und begleitete<br />
uns auf einer Spazierfahrt in die Stadt. Der Basar, den wir<br />
hier zunächst besichtigten, war von besonderem Interesse,<br />
nicht nur wegen der Waren, die hier aus dem Gebirge jen<br />
seits der Grenze zusammenflössen, sondern noch mehr wegen<br />
der halbwilden Gebirgsbewohner, welche, in , Tierfelle ge<br />
kleidet, sich hier einfanden, um die Rohprodukte ihres Landes<br />
gegen die Erzeugnisse der Civilisation umzutauschen. „Sehen<br />
Sie diese Gestalten", sagte unser Begleiter, indem er auf<br />
eine abenteuerlich in Schaffelle gekleidete Gruppe hinwies,<br />
„sie gehören zu den unabhängigen Stämmen jenseits der<br />
Grenze; wenn sie hierher kommen, um ihre Schafhäute und<br />
ihren Käse abzusetzen, so sind sie ziemlich zahm, aber<br />
droben im Gebirge möchte ich ihnen nicht begegnen". Vom<br />
Basar führte uns der Freund auf das flache Dach eines<br />
öffentlichen Gebäudes, von wo man eine schöne Rundsicht<br />
auf die ganze Stadt genoss. Überall aus den Strassen und<br />
den Dächern der Häuser quoll der Rauch hervor von den<br />
Feuern, die man bei der Kühle des herannahenden Abends<br />
angezündet hatte. Peshawar ist berüchtigt durch seine<br />
häufigen Feuersbrünste, und diese sind sehr begreiflich.<br />
Sah ich doch selbst vor einem Hause auf der Strasse ein<br />
Feuer, dessen lodernde Flammen dem Holzwerke des Aussen-
Die Philosophie in Indien. Abfahrt von Peshawar. 95<br />
geländers und der Dachsparre ziemlich nahe kamen. So<br />
kam der Abend heran und mit ihm die Zeit, welche wir für<br />
unsere Abreise festgesetzt hatten. Wir hatten bis Lahore<br />
eine lange Fahrt vor uns, und ich hatte vorsichtig die beiden<br />
unteren Plätze eines Coupes erster Klasse reservieren lassen,<br />
in der Hoffnung, die Nacht wie gewöhnlich allein bleiben<br />
zu können. Aber es sollte anders kommen.
Fünftes Kapitel.<br />
Von Peshawar bis Calcutta.<br />
r\er freundliche Hindujüngling, der uns so schön in Peshawar<br />
geführt hatte, Hess es sich natürlich nicht nehmen, uns<br />
zum Bahnhof zu begleiten. Er war uns behülflich beim Ein<br />
steigen, reichte noch eine ganze Anzahl von Schachteln mit<br />
köstlichen Trauben als Abschiedsgeschenk in unser Coupe,<br />
nahm herzlichen Abschied, und der Zug setzte sich in Be<br />
wegung. Wir waren allein geblieben und hofften in ruhigem<br />
Schlafe die Gegenden des Industales, die wir schon bei<br />
Tage gesehen hatten, zu durchfahren, um dann den nächsten<br />
Tag lang alle seine fünf östlichen Zuflüsse, welche dem<br />
Pendschäb den Namen geben, zu geniessen. Wir kleideten<br />
uns aus und legten uns zum Schlafen nieder; da hielt der<br />
Zug auf der nächsten Station, die Coupetür wurde aufge<br />
rissen, und hereinstiegen ein Herr und eine Dame. Es war<br />
verdriesslich, aber es war nicht zu ändern. Die beiden<br />
Betten über uns wurden heruntergelassen, und unsre beiden<br />
Reisegefährten kletterten hinauf. Ein Trost war es noch für<br />
uns, dass sie in Rawal Pindi um drei Uhr nachts auszusteigen<br />
gedachten. Bis dahin war an ein ruhiges Schlafen freilich<br />
nicht zu denken. Denn unsre Gefährten da oben verhielten<br />
sich zwar durchaus rücksichtsvoll und ruhig, konnten es aber<br />
in dem berechtigten Wunsche, ihre Station nicht zu ver-
Eine verdorbene Nacht. Die Flüsse des Pendschäb. 97<br />
säumen, nicht unterlassen, hin und wieder bei den Stationen<br />
das Fenster zu öffnen und sich zu erkundigen, wo wir seien,<br />
oder dann und wann ein Streichholz anzuzünden, um nach<br />
der Uhr zu sehen. Endlich kam Rawal Pindi, und wir wurden<br />
unsere Einquartierung los. Aber schon auf der nächsten<br />
Station stiegen zwei Jäger zu uns ein und nahmen von den<br />
oberen Betten Besitz. Am Morgen nach dieser verdorbenen<br />
Nacht erreichten wir Jhelum, welches an dem ersten Zuflüsse<br />
des Indus von Osten liegt, der heute ebenfalls den Namen<br />
Jhelum führt, während er bei den Griechen Hydaspes, im<br />
Veda aber die Vitastä, d. h. die Ausgebreitete heisst. Er<br />
macht diesem Namen auch alle Ehre, denn eine nicht enden<br />
wollende Eisenbahnbrücke führte über die zahlreichen Wasser<br />
rinnen, in welche er sich während der trockenen Jahreszeit<br />
spaltet. Während der Regenzeit mögen sie wohl alle sich<br />
zu einer Wasserfläche verbinden und einen majestätischen<br />
Anblick gewähren, zumal da im Norden das Panorama hier<br />
durch die Vorberge des Himälaya seinen Abschluss findet,<br />
welche diese mächtige Wasserfülle aus sich ergiessen. Weiter<br />
ging es mit der Bahn über das zwischen Jhelum und dem<br />
Chenäb Hegende Doab, ein Name, mit dem man im Pendschäb<br />
die zwischen zwei Flüssen gelegenen Hochebenen bezeichnet,<br />
die stellenweise einen ziemlich sterilen Anblick bieten. Über<br />
haupt entspricht das Pendschäb keineswegs den Vorstellungen,<br />
wie sie uns in dem Rigveda entgegentreten, von einem an<br />
Wäldern und Grasplätzen reichen Lande, sodass Dr. Stein die<br />
Meinung äusserte, die Inder des Rigveda möchten wohl viel<br />
mehr in dem nördlichen Gebirgslande gesessen haben. Dem<br />
widerspricht aber der Tatbestand. Denn wenn z. B. in dem<br />
bekannten Liede an die Flüsse, Rigveda 3,33, Vigvämitra die<br />
Vipäg. und die (Tutudri zusammen feiert, so kann dieses Lied<br />
kaum anderswo als an dem Zusammenflusse von Bias und<br />
SutleJ, mithin südlich von Amritsar entstanden sein, wo das<br />
Gebirge schon über hundert Kilometer entfernt Hegt. Wir<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 7
'98 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
werden daher vielmehr annehmen müssen, dass das Land<br />
erst infolge der Abholzung so trocken geworden ist. Welchen<br />
Einfluss diese auf das Klima hat; das sieht man, wenn man<br />
nach Griechenland und Palästina kommt und die kahlen,<br />
nicht einmal mit Gras bedeckten Berge mit den Schilderungen<br />
aus dem biblischen und klassischen Altertum vergleicht. Was<br />
hier die Türken, das werden im Pendschäb die Araber be<br />
sorgt haben; beide sind ja gewohnt, in den Tag hinein zu<br />
leben und für die Zukunft ihren Allah sorgen zu lassen.<br />
Weiter ging es dann über den: Chenäb,die alte Candrabhägä,<br />
und nachmittags um vier Uhr langten wir glücklich wieder<br />
in Lahore an. Schon am Bahnhofe hatte sich ein Pandit ein<br />
gefunden, uns zu begrüssen, mit dem ich zu Fuss nach dem<br />
Hotel wanderte, wo sich bald darauf Dr. Stein und gegen<br />
Abend, nachdem er uns verlassen, noch mehrere Pandits ein<br />
stellten. Das Gespräch kam auf Astronomie, und "mit Er<br />
staunen bemerkte ich wiederum, wie diese gelehrten Männer,<br />
gestützt auf ihre einheimischen, aus dem Altertume über<br />
kommenen Lehrbücher, den ganzen Himmel mit allen seinen<br />
Sonnen in 24 Stunden mit undenkbaren Geschwindigkeiten<br />
sich um die kleine Erde drehen lassen. Der gestirnte Himmel<br />
über uns hatte diese Betrachtung angefegt, und1 hier, wie<br />
öfter in Indien, fiel mir seine Verschiedenheit von unserem<br />
nordischen Himmel auf. Der Wagen steht so tief, dass er<br />
in der Regel gar nicht zu finden ist, da er ganz oder teil<br />
weise durch die Dünste des Horizontes verdunkelt wird, so<br />
weit er nicht völlig unter letzterem verschwindet. Auch der<br />
Polarstern ist unter diesen Umständen oft schwer zu er<br />
mitteln, und hat man. ihn glücklich herausgefunden, so-ist<br />
man erstaunt über den tiefen Stand desselben.<br />
Da wir vier Nächte hinter uns hatten, von denen drei<br />
im Eisenbahncoupe und teilweise unter erschwerenden Um<br />
ständen zugebracht worden waren, so gingen wir frühzeitig<br />
zu Bette. An den folgenden Tagen pflegte Dr. Stein uns
Klima des Pendschäb. Lahore, Sanscrit College. 99<br />
um sieben Uhr früh zum erquickenden Morgenspaziergang<br />
abzuholen. Wir besichtigten dann die Parkanlagen mit inter<br />
essanten, aber armselig unterhaltenen Tieren, die einfachen<br />
Steindenkmäler, welche die Inder zu setzen pflegten, wo<br />
vormals eine Witwe mit ihrem Gatten sich hatte verbrennen<br />
lassen, die Schöpfräder und anderen Vorrichtungen, welche<br />
zur künstlichen Bewässerung des Landes dienen. Nachher<br />
besuchten wir dann in der Regel unseren Freund in seinem<br />
Sanscrit College. Mit Freuden sah ich, wie er mit seinen<br />
Hindustudenten namentlich auch die Hymnen des Rigveda<br />
las. Es ist dies um so anerkennenswerter, als gerade die<br />
Behandlung des Rigveda von Seiten der Eingeborenen, wie<br />
mich ein spätererer Fall lehrte, eine höchst ungenügende ist.<br />
Auch wüsste ich nicht, wo in der Welt diese ältesten Denk<br />
mäler der indischen Kultur mehr verdienten gelesen zu wer<br />
den, als in dem Lande, wo sie zuerst gesungen wurden, an<br />
den Ufern der Irävati. Übrigens docierten unter der Aufsicht<br />
von Dr. Stein auch mehrere treffliche Pandits, deren Lehr<br />
stunden ich mit Genuss beiwohnte. Einen anderen Pandit<br />
lernte ich näher kennen, der an einer Missionsanstalt Sanskrit<br />
lehrte. Derselbe hatte grosse Lust, nach Europa zu kommen,<br />
und erkundigte sich angelegentlich danach, ob es Wohl mög<br />
lich sein werde, sich dort durch Sanskrit-Vorlesungen seinen<br />
Lebensunterhalt zu verdienen. Leider musste ich ihm eröffnen,<br />
dass dazu jetzt und in absehbarer Zukunft nicht die mindeste<br />
Aussicht ist. Gehen wir doch einer Zeit entgegen, wo selbst<br />
die Kenntnis des-Griechischen nur noch den Vorzug ganz<br />
enger Kreise ausmachen wird. An Griechenland wurden wir<br />
gerade in Lahore lebhaft erinnert,' als wir mit Dr. Stein das<br />
dortige Museum besuchten. Die daselbst aufbewahrten<br />
Skulpturen bekundeten vielfach unzweifelhaft griechischen<br />
Einfluss und standen dadurch zu den Erzeugnissen der ein<br />
geborenen Plastik in einem sehr merklichen Gegensatze.<br />
So gingen mit Besichtigung der Stadt und ihrer Um-<br />
7*
100 Von Peshawar bis Calcutta.<br />
gebung einige Tage in angenehmer Weise dahin. Weniger<br />
wollte es gelingen, mit der Gesellschaft des Äryasamäj unter<br />
diesen Umständen nähere Fühlung zu gewinnen. Sie bat<br />
mich, ihr einen Vortrag zu halten, welches ich auch bereit<br />
willig zusagte. Aber durch irgend ein Missverständnis waren<br />
für den betreffenen Abend keine Vorbereitungen getroffen<br />
worden. Es fanden sich nur eine geringe Anzahl in der<br />
Eile herbeigeholter Mitglieder zusammen, und ich begnügte<br />
mich, ihnen eine kurze Ansprache zu halten. Um so reicher<br />
wurde ich beim Abschiede mit Büchern beschenkt. Es waren<br />
meist Ausgaben der bekannteren Upanishad's mit Erklärungen<br />
und englischen Übersetzungen, welche allerdings auf einen<br />
noch sehr primitiven Stand der Veda-Exegese schliessen lassen.<br />
Am Nachmittag des 14. Dezember verliessen wir Lahore,<br />
um die kurze Strecke bis Amritsar zu fahren. Der berühmte<br />
sogenannte goldene Tempel dieser Stadt lohnte wohl eine<br />
Unterbrechung ,der Fahrt, wenn auch die Nacht in einem sehr<br />
mittelmässigem Dak Bungalow zugebracht werden musste.<br />
Nachdem unsere Sachen dort untergebracht, fuhren wir sofort,<br />
denn der Abend rückte heran, zum goldenen Tempel, welcher<br />
den Sikh's angehört, deren Religion aus indischen und<br />
mohammedanischen Elementen gemischt ist, und die in Am<br />
ritsar ihren Hauptsitz haben. Der Tempel ist nur klein, liegt<br />
aber wunderschön von der Stadt umgeben mitten in einem<br />
grossen Teiche, in dem sich seine vergoldeten Kuppeln spie<br />
geln. Der Zugang ist über eine lange Brücke, auf welcher<br />
zur Zeit unserer Ankunft ein erstaunliches Menschengewimmel<br />
hin- und herwogte. Jedem fremden Besucher werden von<br />
geschäftigen, auf ihr Trinkgeld lüsternen Knaben ein paar<br />
Sandalen untergebunden. Auch ein eingeborener Policefnan<br />
hat den Fremden vorschriftsmässig zu begleiten, was in Indien<br />
sonst ganz ungewöhnlich ist und auf einen stark entwickelten<br />
Fanatismus schliessen lässt. Das Innere des Tempels, in
Abschied von Lahore. Amritsar. Mr. Summers. 101<br />
\<br />
welchem die Verehrer sich dicht durcheinander drängten,<br />
durfte von uns natürlich nicht betreten werden, doch Hess es<br />
sich von den weit geöffneten Pforten aus vollkommen über<br />
sehen. Ein Führer geleitet den Fremden auf das flache Dach,<br />
wobei man die vergoldeten Kupferplatten, mit denen die<br />
Kuppeln und andere Teile bedeckt sind, und von welchen<br />
der Tempel den Namen hat, aus nächster Nähe betrachten<br />
kann. Die eintretende Dämmerung mahnte zur Rückkehr.<br />
Wir hatten ein Gewirr volkreicher Strassen zu passieren. Die<br />
Zudringlichkeit der Händler, welche den Wagen überall auf<br />
zuhalten suchten, Hess auf einen stark entwickelten Fremden<br />
verkehr schliessen. Beim Dinner im Dak Bungalow waren nur<br />
wenige Gäste vorhanden, und es entspann sich eine ganz<br />
angenehme Unterhaltung; namentlich ein Mr. Summers, ein<br />
Mann in den besten Jahren, der sich nachher als Member of<br />
Parliament vorstellte, zeigte durch seine Fragen eingehenderes<br />
Interesse, als man es sonst bei dem Durchschnittsengländer<br />
zu finden pflegt. Wir sassen noch lange mit ihm zusammen<br />
und haben ihn noch mehrere Male wieder getroffen; so in<br />
Delhi, wo er eifrig die Schulen besuchte, und am heiligen<br />
Abend in Lucknow, wo ich ihm, um die possenhafte Vor<br />
stellung einer Bande von schottischen Musikanten zu ver<br />
wischen, einige deutsche Weihnachtslieder vorspielte. Das<br />
sollte unser Abschied für dieses Leben sein. Am nächsten<br />
Morgen fuhr er nach Allahabad [zum nationalen Kongress,<br />
und zwei Tage später hörten wir, dass er dort, man wusste<br />
nicht an welchem Leiden, hoffnungslos erkrankt darnieder<br />
liege. Wenige Tage darauf lasen wir in der Zeitung seine<br />
Todesanzeige. Als wir dann später nach Allahabad kamen,<br />
hörten wir in dem Hotel, in welchem er gestorben war, das<br />
Nähere. Er war an den Pocken erkrankt, und man vergass<br />
nicht hervorzuheben, dass er im Parlamente als ein Gegner<br />
des Impfzwanges bekannt war.<br />
Wir haben es versäumt, uns vor unserer Reise nach
102 Von Peshawar bis Calcutta.<br />
Indien nochmals impfen zu lassen, und die Sache ist ja gut ge<br />
gangen; aber wie die Dinge liegen, ist diese Vorsichtsmassregel<br />
jedem, der nach Indien reist, entschieden anzuraten. Die Cholera,<br />
wie schon oben bemerkt, pflegt, wie die Hindus sagen, einen<br />
Gentleman nicht zu befallen; die Fieber treten vorwiegend<br />
nur in der Regenzeit auf, aber einer Ansteckung durch die<br />
Pocken ist man durch jedes Hotelbett, ja durch jeden Wagen<br />
ausgesetzt, in dem vorher ein Pockenkranker gesessen hat.<br />
Nachdem wir uns an jenem Abend in Amritsar von Mr.<br />
Summers und der übrigen Gesellschaft verabschiedet, suchten<br />
wir unser Schlafzimmer auf, dessen Tür wir bei dem Fehlen<br />
jeder Schliessvorrichtung durch Vorbau aller unserer Koffer<br />
und Effekten notdürftig verrammelten.<br />
Der frühe Morgen fand uns wieder auf dem Bahnhofe,<br />
zu einer langen Eisenbahnfahrt, die uns abends nach zehn<br />
Uhr nach Delhi führen sollte. Viele von Sage und Poesie<br />
verherrlichte Orte flogen an uns vorüber. Zunächst ging es<br />
über die Vipäg. (die fessellose, heute Bias) und fiutudrt (die<br />
hundertläufige, heute Sutlej), beide sachgemäss benannt, nicht<br />
weit oberhalb ihres Zusammenflusses, an welchem vor mehr<br />
als dreitausend Jahren Vigvämitra das schon erwähnte Lied<br />
dichtete, welches uns im Rigveda mit solcher Frische ent<br />
gegentritt, als wäre es gestern entstanden, und über so weite<br />
Zeiten und Räume hinweg eine uralte, ferne Vergangenheit<br />
wieder aufleben lässt. Indem wir dann weiter die kleine,<br />
in der Wüste unterhalb sich verlierende und doch so hoch<br />
gefeierte Sarasvati überschritten, traten wir gleichsam aus<br />
dem Sagenkreise des Rigveda in den des Mahäbhäratam<br />
hinüber, berührten bei Station Karnal die Gegend, in welche<br />
das grosse Schlachtfeld von der Sage verlegt wird, und<br />
kamen spät abends in Delhi an, der Hauptstadt des Reiches der<br />
Grossmogule, welche neben der Stätte des alten Indraprastham,<br />
der Residenz der Helden des Mahäbhäratam, erbaut ist.
Pockengefahr. Vipäc, und Cutudri. Delhi. 103<br />
Man hat Delhi sehr treffend mit Rom verglichen. Wie<br />
Rom ist Delhi heute eine gewerbfleissige Handelsstadt, nur<br />
dass in Rom Toga und Tunica dem Rock und der Hose<br />
gewichen sind, während in Delhi wie überall in Indien die<br />
alten malerischen Kostüme sich erhalten haben. Wie in Rom<br />
allenthalben die Denkmäler der päpstlichen Herrschaft ent<br />
gegentreten, so in Delhi die nicht minder grossartigen Über<br />
reste der mohammedanischen Herrlichkeit. Und wie in Rom<br />
durch Kirchen und Kapellen die Überbleibsel des klassischen<br />
Altertums in störender Weise zugedeckt werden, so verdecken<br />
auch in Delhi die Moscheen, Paläste und Grabmäler der<br />
mohammedanischen Periode eine ältere und für uns interes<br />
santere Vergangenheit, die Erinnerungen an Indraprastham,<br />
die Hauptstadt der Mahäbhärata-Helden; nur dass das<br />
moderne Rom unmittelbar auf dem antiken steht, während<br />
sich südlich von Delhi das alte Indraprastham wenigstens<br />
in seiner Ringmauer vollständig erhalten hat. Denn so wie<br />
südlich von Rom die Campagna mit ihren zahlreichen Resten<br />
aus dem Altertume sich ausbreitet, so erstreckt sich im<br />
Süden von Delhi zwei Stunden weit eine Gegend, welche<br />
bis zum Kutb Minar hin mit Denkmälern aus der moham<br />
medanischen und zum Teil auch aus der altindischen Zeit<br />
übersäet ist. Eine Beschreibung aller dieser Herrlichkeiten äst<br />
an vielen Orten zu finden, wir müssen uns darauf beschränken,<br />
einige persönliche Eindrücke wiederzugeben. Auch für Delhi<br />
fehlte es uns nicht an Empfehlungen, die uns die Kreise<br />
der Eingeborenen erschlossen. Diesmal waren es einige<br />
reiche Kaufleute, denen unsre Ankunft vorher brieflich<br />
gemeldet war, und die sich denn auch gleich am Morgen<br />
nach unserer Ankunft im Hotel zu unserer Begrüssung ein<br />
fanden. Wir durchwanderten mit ihnen den südlich vom<br />
Bahnhofe innerhalb der Stadt gelegenen Park, warfen einen<br />
Blick in das dort befindliche Museum und wandten uns<br />
dann nach der Chandni Chauk, der Silberstrasse, welche in
104 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
ansehnlicher Breite die Stadt durchzieht und mit ihren statt<br />
lichen Läden und dem davor auf- und abwogenden Verkehre<br />
emsiger Menschen Zeugnis davon ablegt, dass wir uns hier<br />
an einem Mittelpunkte des industriellen und kaufmännischen<br />
Indiens befinden. Besonders interessant war es uns, von<br />
unsern freundlichen Begleitern in das Innere ihres Waren<br />
hauses eingeführt zu werden. Den Mittelpunkt desselben<br />
bildete, wie gewöhnlich in Indien, ein von dem Hause um<br />
schlossener Hofraum, der als Empfangszimmer dient, und in<br />
welchem die Geschäfte abgewickelt werden. Um denselben<br />
herum zieht sich das an jedem Stockwerke mit Veranden<br />
versehene Haus, welches sich in offenen Rundgängen nach<br />
dem Hofe zu öffnet, während im Innern die mannigfachen<br />
Waren lagern. Wie die meisten Kaufleute in Indien, wo<br />
die Kultur noch nicht bis zum Begriffe der Arbeitsteilung<br />
gelangt ist, waren auch unsere Freunde General Merchants,<br />
d. h. sie befassten sich mit Export, Import und Verkauf aller<br />
möglichen Artikel. Im übrigen waren die Interessen zwischen<br />
uns doch zu verschieden, als dass es zu innigen Beziehungen<br />
hätte kommen können.<br />
Die oben genannte Hauptstrasse Chandni Chauk, welche<br />
Delhi von Westen nach Osten laufend durchschneidet, mündet<br />
am östlichen Ende in dem Fort, der Festung, welche, zwischen<br />
Stadt und Yamunä auf einer Erhöhung prachtvoll gelegen,<br />
eine Anzahl höchst interessanter Hallen und Prachtbauten ein-<br />
schliesst und zur Blütezeit der mohammedanischen Herrschaft<br />
wohl eine märchenhafte Herrlichkeit zeigen mochte, während<br />
heutzutage die Benutzung vieler Bauten zu Militärzwecken,<br />
die in Pyramiden aufgetürmten Kanonenkugeln, die auf den<br />
Wällen aufgepflanzten Kanonen, die hin- und hergehenden<br />
Schildwachen einen seltsamen Kontrast zu den noch erhaltenen<br />
Denkmälern der Grossmogule bilden. Die hervorragendsten<br />
sind die herrliche, nach drei Seiten offene allgemeine Audienz<br />
halle (Divan-i-'Am) und die noch schönere, an der Yamunä-
Sehenswürdigkeiten Delhis. 105<br />
Seite gelegene und von Gartenanlagen umgebene private<br />
Audienzhalle (Divan-i-Khas), welche bei ihrem Reichtum von<br />
marmornen, mit Gold verzierten Säulen und bei der entzücken<br />
den Natur, die sie umgibt, wohl die Inschrift rechtfertigen<br />
mag, die in persischer Sprache an der Wand prangt:<br />
GIBT ES AUF ERDEN EIN PARADIES,<br />
SO IST ES DIESES, JA DIESES GEWISS.<br />
Dass es freilich auf Erden kein Paradies gibt, das zeigen<br />
deutlicher als irgend etwas die furchtbaren Schicksale des<br />
Shah Jehan, welchen alle diese Herrlichkeiten nicht davor<br />
schützen konnten, von seinen eigenen Söhnen verraten und<br />
bekriegt zu werden und sein Leben im Kerker zu enden.<br />
Unweit des Divan-i-Khas und ebenfalls an dem zur<br />
Yamunä führenden Abhänge liegt die kleine, aber kostbare,<br />
aus weissem und grauem Marmor errichtete Moti Musjid,<br />
d. h. Perlmoschee. Sie ist in der Tat in ihrer Art eine Perle<br />
und bekundet, wie in ihrem Namen, so auch in ihrer Bauart<br />
die Verschmelzung des indischen und islamischen Elementes,<br />
welche die Signatur des Zeitalters war, aus der sie stammt.<br />
Abgesehen von dem, was das Fort enthält, ist das gross<br />
artigste Gebäude Delhis die herrlich auf der Höhe gelegene<br />
Jumna Musjid, vollendet im Jahre 1658, demselben Jahre, in<br />
welchem der düstere Fanatiker Aurengzaib seinen Vater Shah<br />
Jehan des Thrones entsetzte. Von drei Seiten führen pracht<br />
volle Freitreppen empor zu einem grossen, mit Mauern und<br />
Türmchen eingefassten Platze, während an der vierten Seite<br />
die Moschee selbst sich befindet, wie gewöhnlich in Indien<br />
nur aus einer offenen überwölbten Halle bestehend. In einem<br />
der kleinen Ecktürme des Vorplatzes werden einige kostbare<br />
Reliquien gezeigt, ein Pantoffel und ein Haar aus dem Barte<br />
des Propheten; daneben auch ein Abdruck seines Fusses in<br />
Stein, welcher für die Echtheit der beiden anderen Stücke<br />
gerade kein günstiges Vorurteil erweckt. Interessanter sind
106 Von Peshawar bis Calcutta.<br />
einige alte Koränhandschriften, darunter eine aus der Zeit des<br />
Ali, aus dem VII. Jahrhundert n. Chr.<br />
Zweimal verwendeten wir in Delhi einen Tag dazu, um<br />
die südlich von der Stadt sich erstreckende Gegend mit ihren<br />
zahlreichen, zum Teil wohlerhaltenen Grabpalästen und anderen<br />
Denkwürdigkeiten zu besuchen; das eine Mal begleitete uns<br />
einer von den jungen Kaufleuten unserer Bekanntschaft, das<br />
andre Mal ein Lehrer, den wir in der Schule kennen gelernt<br />
hatten und zufällig mit seinem Hündchen auf der Strasse auf<br />
gabelten. Bei Humayun's Grab, zu welchem der Köter keinen<br />
Zutritt hatte, kam er uns abhanden, worüber der Hindulehrer<br />
sich höchlich beunruhigte, bis wir nach langem und vergeb<br />
lichem Pfeifen, Herumlaufen und Suchen den Rückweg an<br />
traten und schliesslich das Hündchen ganz ruhig auf einem<br />
Steinhaufen an der Chaussee im Schatten eines Mangobaumes<br />
sitzend fanden. Wir nahmen es in den Wagen und die<br />
Harmonie der Gemüter war wieder hergestellt.<br />
Auf diesen Rundfahrten im Süden von Delhi traten uns<br />
eine solche Fülle merkwürdiger Gegenstände entgegen, dass<br />
wir hier nur das Wenigste davon erwähnen können. Gleich<br />
nachdem man Delhi durch eines der südlichen Tore verlassen<br />
hat, bietet sich den über ein Trümmerfeld schweifendenBHcken,<br />
an der Stelle der nur aus einem hohen Steinhügel bestehenden<br />
ehemaligen Befestigung Ferozabad, die von ihrem ursprüng<br />
lichen Standorte im 16. Jahrhundert hierher verpflanzte Säule<br />
des Agoka dar, welche, nebst einer Anzahl ähnlicher Säulen<br />
um das Jahr 250 v. Chr. von König Acoka errichtet, noch<br />
heute, neben später angebrachten anderen Inschriften, die be<br />
rühmte Paliinschrift. an ihrem oberen Teile zeigt. Sie enthält<br />
ein Edikt des Königs A?oka und gilt für das älteste inschrift<br />
liche Denkmal Indiens. Aber eine noch viel ältere Erinne<br />
rung ruft der südlich davon gelegene Puräna Qila (die alte<br />
Festung) wach, welcher auch Indrapat genannt wird und<br />
sonach die Stätte bezeichnet, auf welcher die Stadt des alten
Umgebung von Delhi. Indraprastham. 107<br />
Bharata-Königs Yudhishthira stand. Sie besteht aus einem<br />
Hügel, der von einer uralten, meist noch wohl erhaltenen<br />
Mauer umgeben ist, während in dem Inneren sich ein Hindu<br />
dorf behaglich eingenistet hat. Der Eingang erinnert sehr an<br />
die Porta Marina, durch die man in das wieder ausgegrabene<br />
Pompeji tritt. Jedesmal, wenn ich Pompeji besuchte, war ich<br />
bemüht, in meiner Phantasie den alten Zustand der Strassen<br />
und Häuser wieder herzustellen und dieselben durch die<br />
Gestalten alter Römer zu beleben. Was hier nur unvoll<br />
kommen in der Einbildungskraft geschah, das zeigte Indra<br />
prastham bis zu einem gewissen Grade in Wirklichkeit. Es<br />
war, als wenn Pompeji wieder lebendig geworden wäre; denn<br />
kaum waren wir durch den an die Porta Marina erinnernden<br />
Torweg geschritten, da hockte links bei seiner Arbeit ein nur<br />
mit Schurz und Turban bekleideter Schuster, da lehnten rechts<br />
an der Säule zwei Gestalten, welche bis auf die braune Farbe<br />
ganz aus dem klassischen Altertum hätten stammen können.<br />
Da spielten um die nach der Strasse zu offenen Hütten und<br />
Läden halb oder ganz nackte Kinder, und als uns gar zwei<br />
Männer begegneten, welche, bis auf die Lenden unbekleidet,<br />
über den Schultern eine Stange trugen, an welcher in der<br />
Mitte zwischen beiden ein grosses Tongefäss hing, wie man<br />
es so oft auf antiken Vasenbildern sieht, da war die Illusion<br />
nahezu vollständig, und die Freude eine nicht geringe. Wir<br />
bestiegen mit dem erwähnten Lehrer einen noch erhaltenen<br />
Turm aus alter Zeit, von welchem aus man das ganze Dörfchen<br />
übersah, und der einen bequemen Einblick in die inneren<br />
Hofräume und die Zimmer der Hütten gewährte. Gewöhn<br />
lich bestand eine solche Wohnung aus einem kleinen, vier<br />
eckigen, rings eingeschlossenen Hofraume. An der Vorder<br />
seite war der torartige Eingang; ihm gegenüber lag eine über<br />
dachte, nach dem Hofe zu offene Halle, in der die Haus<br />
bewohner ihr Wesen hatten. In der einen Ecke war eine<br />
Feuerstätte zum Kochen angebracht; links und rechts bestand
108 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
die Umfassung des Hofes aus kleinen, verschliessbaren, stall<br />
artigen Räumen, welche die Schlafstellen auf der einen Seite<br />
für die Männer, auf der anderen für die weiblichen Bewohner<br />
bildeten. Nachdem wir eine der Wohnungen näher besichtigt<br />
und die Dame des Hauses durch einige Kupferstücke glück<br />
lich gemacht hatten, warfen wir noch einen Blick in die un<br />
bedeutende Moschee und unternahmen dann einen Rundgang<br />
ausserhalb der Mauer um die Stadt herum, indem wir mit<br />
Ehrfurcht die hoch aufsteigende, zum Teil gewiss aus sehr<br />
alter Zeit stammende und fast durchweg wohl erhaltene Stadt<br />
mauer betrachteten.<br />
Ein besonderer Glanzpunkt ist noch der zwei Stunden<br />
südlich von Delhi gelegene Kutb Minar mit einem gewaltigen,<br />
fünf Stockwerke hohen Aussichtsturm und einer Moschee, die<br />
zum Teil aus Säulen und anderen Resten von Hindutempeln<br />
errichtet sind. In der Mitte des Hofes ist eine höchst merk<br />
würdige Säule, deren Schaft ganz aus Schmiedeeisen 23 Fuss<br />
hoch aufragt und in einer Sanskritinschrift den Sieg eines<br />
Königs Dhava, wahrscheinlich aus dem vierten Jahrhundert<br />
p. C, verkündigt.<br />
Auch in Delhi versäumten wir nicht, verschiedene Sans<br />
kritschulen zu besuchen, und wurden dadurch mit einigen<br />
sehr liebenswürdigen Pandits bekannt. Namentlich einer der<br />
selben, mit Namen Bankeläl, zeigte grosse Anhänglichkeit an<br />
uns. Da er von seinem verstorbenen Vater, einem der nam<br />
hafteren indischen Gelehrten, eine grosse Sammlung von<br />
Handschriften geerbt hatte, so lud er uns an einem Morgen<br />
früh zur Besichtigung derselben ein. Meine Frau sollte bei<br />
dieser Gelegenheit mit der seinigen bekannt gemacht werden.<br />
Daraus wurde nun freilich nichts, denn als wir, von ihm ab<br />
geholt und geleitet, in seiner engen und winkligen, aber darum<br />
nicht unbehaglichen Wohnung eintrafen, und ich ihm vor<br />
schlug, dass er, der Absprache gemäss, meine Frau der<br />
seinigen zuführen möge, so bat er davon abzustehen mit der
Eine Dorfwohnung. Ein indisches Gelehrtenheim. 109<br />
Begründung: lajjate, „sie schämt sich". Wir wandten uns der<br />
Besichtigung der Bibliothek zu; sie bestand aus einer Art von<br />
Wandschrank, in welchem eine nach dem Katalog, den er auf<br />
wies, zu schliessen sehr reichhaltige Sammlung zum Teil alter<br />
und vielleicht wertvoller Handschriften aufgestapelt lag. Jede<br />
derselben war in einen alten Lappen grünen Tuches sorg<br />
fältig eingewickelt, namentlich wohl zum Schutze gegen die<br />
Insekten, und es war ein umständliches Verfahren, diese kost<br />
baren Schätze jedesmal aus der anspruchlosen Hülle heraus<br />
zuschälen. Den Vorschlag, etwas davon zu verkaufen, lehnte<br />
er bescheiden, aber mit Bestimmtheit ab. Hingegen schenkte<br />
er mir mehrere Handschriften, darunter eine sehr alte des<br />
ersten Buches des Amarakoga. Auch bei unserer Abreise<br />
von Delhi stellte sich Bankeläl auf dem Bahnhofe ein. Er<br />
überreichte meiner Frau eine von seiner Gattin für dieselbe<br />
zierlich gearbeitete Börse, und als wir ins Coupe stiegen,<br />
nahm er von dem hinter ihm schreitenden Diener ein auf<br />
mehreren Tabletts zusammengestelltes Hindu-Diner und schob<br />
es uns in den Wagen nach. Da waren mancherlei Gemüse,<br />
in kleinen Blätternäpfchen zierlich angerichtet, da war ein<br />
grosser Topf mit Milchreis, eine hohe Schicht aufeinander<br />
getürmter Fladen und eine grössere Anzahl von süssen Speisen<br />
und mancherlei Backwerk.<br />
Wieder einmal fuhr der Zug ab, und wieder einmal fiel<br />
damit der Vorhang über dem lebensvollen Bilde einer grossen<br />
und merkwürdigen Stätte der Erinnerung, belebt von so<br />
schnell gewonnenen und, ach! schon nach so wenig Tagen<br />
wieder verlassenen Freunden, die meisten wohl auf Nimmer<br />
wiedersehen. Indessen fuhren wir getrosten Herzens in die<br />
im herrlichsten Sonnenschein und — es war am 20. Dezember<br />
— im üppigsten Sommerschmucke prangende indische Land<br />
schaft hinaus und freuten uns, in dem heiligen Lande zwischen<br />
Yamunä und Gangä zu fahren und einer der allerheiligsten
HO V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
Städte zuzustreben, dem sagenumwobenen Mathurä,. dem<br />
Geburtsorte des Gottes Krishna, welches man füglich als das<br />
indische Bethlehem bezeichnen kann. Wir langten gegen<br />
Mittag auf einem kleinen, ziemlich öden Bahnhofe.an* Hessen<br />
uns, da das Dak Bungalow zu entfernt war, von dem freund<br />
lichen Station Master die Zusicherung geben, dass er uns<br />
entweder im Waiting Room oder in einem Eisenbahnwagen<br />
für die Nacht unterbringen werde, und fuhren dann, um Zeit<br />
zu sparen, mit demselben Zuge eine Station weiter nach Vrin-<br />
daban, welches eine Stunde nördlich von Mathurä liegt und<br />
zugleich mit Mathurä und dem eine Stunde südlich davon<br />
gelegenen Mahäban den Schauplatz der Jugendgeschichte<br />
des Gottes Krishna bildet. Krishna, ursprünglich ein mensch<br />
licher Held der indischen Sage, erscheint schon im Mahä<br />
bhäratam als Inkarnation des Gottes Vishnu. Als der Wagen<br />
lenker des Arjuna teilt er diesem, während beide Heere<br />
kampfgerüstet gegenüberstehen, in der Geschwindigkeit, um<br />
ihn zum Kampfe zu ermutigen, ein philosophisches Lehrgedicht<br />
in nicht weniger als achtzehn Gesängen mit. Es ist dies die be<br />
rühmte Bhagavadgitä, welche lehrt, dass alles zeitliche Ent<br />
stehen und Vergehen, Leben und Sterben im Hinblick auf das<br />
Ewige bedeutungslos ist. Weiter fortgebildet findet sieh die<br />
Krishna-Sage in den Puräna's, und.namentlich wird seine<br />
Jugendgeschichte in dem Bhägavata-Puränam in einer Weise<br />
erzählt, welche höchst auffallend an die Kindheitsgeschichte<br />
Jesu erinnert. Da prophezeit der Seher Närada dem Könige<br />
Kansa von Mathurä, dass Vasudeva und Devaki ein Kind<br />
erzeugen werden, welches ihn töten wird. Er lässt die Eltern<br />
in einem Hause einschliessen, welches noch heute gezeigt<br />
wird; Krishna wird daselbst geboren, aber die Wächter fallen<br />
in einen wunderbaren Schlaf, die Eltern entfliehen mit dem<br />
Kinde über die Yamunä nach Mahäban, der König befiehlt,<br />
alle männlichen Kinder, welche -Heldenkraft versprechen, zu<br />
töten, Krishna entgeht ihm, verbringt seine weitere Jugend in
Mathurä und Umgebung. Die Krishnalegeude. 11 ]<br />
Vrindaban, bis er heranwächst und den König Kansa erschlägt.<br />
Die Ähnlichkeit dieser spätindischen Legende mit der christ<br />
lichen kann nicht zufällig sein, und so werden wir wohl an<br />
nehmen müssen, dass zwischen der Zeit des Heldenepos und<br />
der Puräna's ein christlicher Einfluss stattgefunden hat. Diese<br />
Annahme wird noch wahrscheinlicher, wenn man, Krishnas<br />
Geburtshaus besuchend, die drei dort auf einer Erhöhung<br />
stehenden plumpen Puppen betrachtet, das Krishna-Kind in<br />
der Mitte und zu beiden Seiten sein Vater Vasudeva und<br />
seine Mutter Devaki. Es ist ganz die Art, wie in katholischen<br />
Ländern Maria und Joseph mit dem Christuskinde zusammen<br />
dargestellt werden.<br />
Die Besichtigung von Mathurä auf den folgenden Tag<br />
verschiebend, fuhren wir, unser Gepäck mit dem Diener<br />
zurücklassend, gleich weiter nach Vrindaban, dem Orte, wo<br />
Krishna seine Jugend verbracht und seine mutwilligen Streiche<br />
mit den Hirtenmädchen verübt haben soll, indem er z. B.,<br />
während sie badeten, ihre Kleider auf einen Baum hinauf be<br />
förderte und dieselben erst nach eindringlichen Bitten zurück<br />
gab, — ein Vorgang, den man in Indien vielfach abgebildet<br />
sieht. Es entspricht ganz der Naivität, mit der in Indien<br />
Religion und Sport überall verwachsen sind, wenn dieser<br />
mutwillige Krishna in vielen prachtvollen Tempeln als Gott<br />
verehrt wird. In Vrindaban (eigentlich Vrindävanam, Wald<br />
der Vrindä, d'. i. Rädhä) angelangt, schickten wir nach zwei<br />
Pandits, an die wir Empfehlungsbriefe hatten, und schlügen<br />
inzwischen den Weg nach der Stadt ein, würden aber gleich<br />
in der Nähe des Bahnhofs durch den Anblick eines im Bau<br />
begriffenen Tempels gefesselt, welchen hier ein reicher Inder<br />
in überaus prunkvoller Weise errichten lässt. Wir besichtigten<br />
die marmornen Treppen und Hallen und die kostbaren, durch<br />
bunte Edelsteine hergestellten Ornamente und wurden dabei<br />
mit einem Brahmanen-Jüngling in himmelblauem Gewände be<br />
kannt, der sich uns anschloss. Gutmütig, wie wir immer sind,
112 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
gestatteten wir ihm einen Sitz in unserem Wagen, waren aber<br />
nachher sehr enttäuscht, als er uhs beim Abschiednehmen um<br />
eine Gabe ansprach und, als das Gegebene ihm zu gering schien,<br />
auf seine Dienste hinwies, die wir gar nicht gefordert und<br />
die er auch nicht geleistet hatte. Denn gleich nachdem wir<br />
den Tempel verlassen, stellten sich unsere beiden Pandits<br />
Rädhägarana und Madhusudana ein und übernahmen unsere<br />
Führung durch die Stadt. Zunächst wurden drei oder vier<br />
sehr wohl unterhaltene Tempel besichtigt; einer derselben war<br />
auf seinem Giebel mit einem ganzen Wald von Statuen ge<br />
schmückt; Krishna, wie er seine Heldentaten verrichtet oder<br />
vor der tanzenden Rädhä, seiner Geliebten, die Flöte spielt,<br />
trat überall hervor. Ein weiterer Schmuck der Tempel und<br />
Häuser, wenn man ihn so nennen will, bestand in einer Un<br />
zahl lebender Affen, welche, an den Wänden sich empor<br />
schwingend und auf den Zinnen und Dächern sitzend, allerlei<br />
Kurzweil übten. Eine ähnliche Belebung einer Stadt durch<br />
Affen, wie hier in Vrindaban, haben wir nur noch in Ayodhyä,<br />
der heiligen Stadt des Räma, wiedergefunden, nachdem man<br />
in Benares die possierlichen, aber bei grösserem Verkehr un<br />
bequemen Tiere beseitigt und auf einen einzigen Tempel<br />
Durgakund beschränkt hat, den die Engländer zum grossen<br />
Verdruss der Eingeborenen den Monkey Temple nennen.<br />
Lästiger als diese harmlosen Bewohner der Dächer wurde<br />
uns in Vrindaban eine grosse Anzahl von Bettlern; man<br />
merkte wohl, dass man sich in einem von Fremden vielbe<br />
suchten Wallfahrtsorte befand. Obgleich das Geleit der<br />
beiden Pandits einigen Schutz gewährte, wurden wir beinahe<br />
so sehr wie in Granada und Jerusalem jeden Augenblick<br />
durch Bettler aufgehalten, unter denen manche gesunde und<br />
kräftige Burschen in den besten Jahren waren. Wiederholt<br />
sah ich mich zu Ansprachen genötigt, wie: „Ich gebe den<br />
Alten, den Kranken, den Hülflosen, Dir aber gebe ich nichts."<br />
Diese Worte, im klarsten Sanskrit gesprochen, fanden nicht
Vrindabsn. Affen. Bettelei. Armut der Pandits. H3<br />
nur den vollen Beifall unserer Pandits, sondern verfehlten<br />
auch auf die neugierig herumstehende Menge ihre Wirkung<br />
nicht. Es bedarf keiner Erinnerung, dass in kleineren Orten<br />
Indiens ein paar weissfarbige Europäer eben so viel Aufsehen<br />
erregen, wie bei uns etwa ein Neger und eine Negerin, wenn<br />
sie über die Strasse gehen. Und so wurden wir denn, nach<br />
dem wir die Sehenswürdigkeiten des Ortes genugsam durch<br />
gekostet, von unsern Panditfreunden selbst als Sehenswürdig<br />
keit behandelt und in ihre Häuser, sowie in die einiger be<br />
rühmter Heiligen eingeführt. Wir suchten möglichst kurz<br />
loszukommen, denn der Abend brach herein und die Abfahrts<br />
zeit des Zuges nahte. Schliesslich sassen wir denn mit un<br />
seren Pandits in der wohltuenden Kühle des Abends auf<br />
einer Bank am Bahnhof und harrten des Zuges. Zur Er<br />
frischung Hess einer der Pandits einen Teller mit Früchten<br />
von äusserst zweifelhaftem Aussehen anbieten. Ich wählte<br />
schliesslich eine Banane, als am wenigsten bedenklich; sie<br />
zeigte sich als völlig unreif, an Härte und Geschmack einer<br />
rohen Kartoffel vergleichbar; ich konnte mich nicht ent-<br />
schliessen, den Bissen im Munde herunter zu schlucken und<br />
musste um die Ecke gehen, um ihn und die Reste meiner<br />
Banane zu beseitigen. Ich erwähne dies, weil es zeigt, wie<br />
bedürftig und wie anspruchslos diese indischen Pandits sein<br />
müssen. Da der Zug auf sich warten Hess, so hatte ich noch<br />
eine längere Unterredung mit dem jüngeren Pandit Madhu-<br />
südana, welcher Philosophie trieb und natürlich ein Anhänger<br />
des Vedänta, jedoch in der realistischen Richtung des<br />
Madhva war. Seine Auffassungen hatten dadurch, wie auch<br />
sein Wesen, etwas nüchternes, waren aber im übrigen so<br />
klar und präzis, wie man es selten bei den Hindus findet.<br />
Als ein Typus des idealen, enthusiastischen, aber auch vielfach<br />
ins Vage sich verlierenden Hindu kann ich ihn nicht gelten<br />
lassen, aber für alle praktischen Zwecke möchte ich ihm vor<br />
einem solchen den Vorzug geben.<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 8
114 V. Von Peshawsr bis Cslcutta.<br />
Doch da rollte unser Zug heran, wir bestiegen den an<br />
seiner weissen Farbe erkenntlichen vollständig leeren Wagen<br />
erster Klasse, bemerkten im Halbdunkel nicht, dass alles in<br />
ihm mit einer dicken Staubschicht überzogen war, und ge<br />
langten in zehn Minuten nach Mathurä.<br />
Hier war durch das Bahnhofspersonal unsere Ankunft<br />
ruchbar geworden, und so wurden wir von einer Deputation<br />
empfangen, welche mit echt indischer Naivität berichtete, dass<br />
der ganze Äryasamäj in der Stadt versammelt sei, dass ein<br />
Wagen bereit stehe, um mich sofort dorthin zu bringen; man<br />
hoffe, dass ich ihnen heute Abend, wie ich es in Agra getan<br />
habe, einen Vortrag halten werde. „Aber, liebe Freunde,"<br />
erwiderte ich, „es ist acht Uhr abends, wir haben seit Mittag<br />
nichts gegessen und sind beide müde von der Reise. Der<br />
Koch, den ihr dort in seiner weissen Schürze seht, drängt<br />
zum Abendessen; so wartet, bis wir schnell gegessen haben,<br />
dann will ich mit euch kommen, um eure Versammlung<br />
wenigstens in der Kürze zu begrüssen." Dieser Vorschlag<br />
fand Zustimmung; in fliegender Hast verzehrten wir unser<br />
Dinner und rollten sodann in dem höchst eleganten Wagen<br />
des reichen greshth Lakshman Das zur Versammlung.<br />
Unterdessen war es neun Uhr geworden; ich begrüsste<br />
die Anwesenden, lobte ihren Eifer und musste wohl oder<br />
übel versprechen, morgen nachmittag um fünf Uhr den ge<br />
wünschten Vortrag zu halten. Nach kurzem Abschiede führte<br />
uns der Wagen, der auch für den ganzen folgenden Tag uns<br />
zur Verfügung gestellt wurde, nach dem Bahnhofe zurück, und<br />
totmüde sanken wir auf die improvisierten Betten des Waiting<br />
Room. Am andern Morgen, als wir uns eben zum Frühstück<br />
setzen wollten, wurde eine neue Deputation gemeldet, welche<br />
von uns empfangen zu werden wünschte. Sie kämen, sagten<br />
sie, vom Dharmasamäj, welcher in dieser Stadt viel zahl<br />
reichere und angesehenere Mitglieder zähle. Ich möchte<br />
daher den für den Äryasamäj angekündigten Vortrag nicht
Mathurä. Indische Naivitäten. Ein Heilkünstler. H5<br />
dort, sondern im Dharmasamäj halten. „Es mag ja sein",<br />
erwiderte ich, „dass eure Gesellschaft in dieser Stadt die<br />
angesehenere ist, und hätte ich es früher gewusst, so hätte<br />
das meine Entschliessungen beeinflussen können; jetzt aber<br />
kann ich nicht daran denken, das den andern gegebene Ver<br />
sprechen zu brechen." — Dann möchte ich, so meinten sie,<br />
noch einen zweiten Vortrag in dem Dharmasamäj halten. —<br />
„Es fällt mir nicht ein", antwortete ich, „wo ich Indien nur<br />
zu meinem Vergnügen bereise, in einer Stadt zwei Vorträge<br />
zu halten. Wollt ihr mich hören, so kommt heute um fünf<br />
Uhr zum Äryasamäj; ihr sollt alle willkommen sein."<br />
Damit schieden sie, und wir machten uns auf, um in<br />
Gesellschaft des Pandit Bäla Krishna, dem wir brieflich em<br />
pfohlen waren, und an den sich nachher noch andere schlössen,<br />
die Stadt zu besehen. Unterwegs befragte ich den Pandit<br />
nach seinem Studium. Er war Mediziner, d. h. er hatte den<br />
Ayurveda studiert und übte daraufhin eine ausgedehnte Praxis<br />
in der Gegend aus. „Was ist das Fieber?" fragte ich ihn.<br />
— „Das Fieber", sagte er, „ist eine falsche Mischung der<br />
drei Körpersäfte, Wind, Schleim und Galle." — „Wie heilt<br />
man dasselbe?" — Hier nannte er mit grosser Geläufigkeit<br />
eine erschreckende Menge von Drogen, welche zerkleinert<br />
und gemischt dem Kranken einzugeben seien.<br />
Unter diesen Gesprächen waren wir bei der Hauptsehens<br />
würdigkeit der Stadt, den Ghatta's, angelangt. Sie bestehen<br />
aus einem schön gepflasterten Promenadenwege und von ihm<br />
überall zum Flusse herabführenden, wohlbehauenen Treppen<br />
stufen und ziehen sich zwischen Fluss und Stadt in deren<br />
ganzer Länge hin. Treppen und Treppchen führten überall<br />
herab ins Wasser und zu den Badenden, anmutige Pavillons<br />
luden zum behaglichen Niedersitzen ein, Sagenreiche Bauten<br />
begleiteten das Ufer der Länge nach, wie denn z. B. ein<br />
stattlicher Turm an der Stelle gezeigt wurde, wo Kansa's<br />
Weib, nachdem Krishna diesen erschlagen, ihre Satt beging.
116 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
Satt, ursprünglich „die gute Gattin", d. h. diejenige, welche<br />
sich lebend mit dem Leichnam ihres Gatten verbrennen lässt,<br />
bedeutet dann zweitens weiter den Akt der Witwenverbren<br />
nung und endlich drittens den durch ein Denkmal bezeich<br />
neten Ort, an dem eine solche stattgefunden hat. Eine Strecke<br />
weiter zeigte man uns die Stelle, auf welcher der gegen<br />
wärtige Mahäräja von Benares Prabhunäräyana, von dem<br />
noch weiter unten zu erzählen sein wird, bei seinem Besuche<br />
in Mathurä sich wiegen Hess und sein volles Körpergewicht<br />
in Gold an die Brahmanen verteilte. Dieser Scherz kostete<br />
ihm, wie mir später in Benares erzählt wurde, über 100000<br />
Rupien. Diese Grosstat begeisterte dann weiter den Professor<br />
Gangädhara, dessen treffliche Vorlesungen über indische<br />
Dichter ich später in Benares mit grossem Genuss hörte, zu<br />
einem Gedichte, welches er mir selbst überreicht hat; auf<br />
dem Titelblatt ist eine Wage gemalt, in deren Balken und<br />
Fächern die Namen Prabhunäräyana, Mathurä usw. silbenweise<br />
verteilt sind und auf der folgenden Seite zu einem Gedichte<br />
in komplizierten Versmassen verarbeitet werden, so kunstvoll<br />
und schwierig, dass der Dichter selbst geraten fand, einen<br />
gelehrten Kommentar beizufügen.<br />
Weiter führten uns unsre Freunde zur Stadt hinaus,<br />
vorüber an Brunnen, deren Steinwände in buntesten Farben<br />
mit abscheulich schönen Bildern aus der Krishnageschichte<br />
bedeckt waren, dann ging es durch ein Wäldchen zu einer<br />
Anhöhe, auf der das schon erwähnte Geburtshaus des<br />
Krishna stand. Es war eine nach vorn offene Halle, und<br />
die in ihrer Mitte auf einer Steinerhöhung aufgestellten drei<br />
Puppen in bunter Bemalung erinnerten, wie bereits bemerkt,<br />
lebhaft an das Christuskind mit Maria und Joseph, wie man<br />
sie so oft im südlichen Europa aufgestellt findet. Inzwischen<br />
hatte sich allerlei Volk um uns versammelt und jeder war<br />
bemüht, zu unserer Belehrung sein Scherflein beizutragen.<br />
Am hervortretendsten war die Gestalt eines Bettlers; es war
Bettler im Aufzuge eines Asketen.<br />
Seite 116.
Die Ghatta's. Krishna's Geburtshaus. Die Yamunäbrücke. 117<br />
ein junger, kräftiger Mensch mit schönem, so gut wie ganz<br />
nacktem Körper, die Haare lang und zottig wild um den<br />
Kopf herum, der ganze Leib scheusslich mit Asche beschmiert.<br />
Es ist dies der Aufzug der Asketen, welcher heutzutage von<br />
vielen Bettlern kopiert wird, um Eindruck beim Publikum<br />
zu machen. Beim Abschied gab ich dem Ältesten der An<br />
wesenden eine Rupie mit der Weisung, dieselbe gerecht zu<br />
verteilen, musste aber erleben, dass einige mir nachkamen<br />
und sich beklagten, dass man sie bei der Verteilung über<br />
gehen wolle. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zurück<br />
zukehren, die Rupie wieder einzufordern, in der Nähe wechseln<br />
zu lassen und dann jedem je nach Verdienst und Würdig<br />
keit ein paar Anas einzuhändigen. Dieser Akt der Ge<br />
rechtigkeit wurde mit grossem Beifall aufgenommen. Wir<br />
kehrten zu unserem Wagen zurück und fuhren der Absprache<br />
gemäss zu dem Eigentümer desselben, einem reichen Vaicya,<br />
namens (freshth Lakshman Das, der uns zu Ehren eine<br />
Panditversammlung anberaumt hatte. Statt der üblichen<br />
Blumengirlanden wurden uns diesmal Ketten aus Goldpapier<br />
umgehängt, welche wir noch jetzt besitzen, während wir die<br />
sonst von Ort zu Ort gespendeten herrlichen Blumenkränze<br />
und Bouquets wohl oder übel dahinten lassen mussten.<br />
Der Nachmittag war zu einem Ausfluge nach Mahäban<br />
bestimmt. Der Weg führte über die Yamunä, wo eine<br />
Eisenbahnbrücke auch Wagen passieren lässt, jedoch nur<br />
gegen Erlegung einer Gebühr von zwei Rupien, was uns<br />
sehr hoch schien. Hier sah ich eine grosse Muschel, wie<br />
sie den alten Indern als Kriegstrompete diente, und die an<br />
der Brücke zu Signalen benutzt werden mochte. Man blies<br />
in dieselbe durch ein in die Spitze gebohrtes Loch. Ich<br />
vermochte keinen Ton zu erzeugen und äusserte den Wunsch,<br />
die Muschel blasen zu hören. Man holte ein altes Weib<br />
herbei, welches die Muschel an den Mund setzte und ihr<br />
mehrere gellende, gequetschte Töne entlockte von über-
118 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
raschender Stärke und weithin hörbar. Endlich fuhren wir<br />
über die Brücke der Yamunä und sodann durch angenehme<br />
Landschaft nach Mahäban, wo in verschiedenen Häusern<br />
wieder allerlei Erinnerungen an die Kindheit des Krishna<br />
gezeigt wurden. Auch hier merkte man den schädigenden<br />
Einfluss des Fremdenverkehrs auf den Charakter des Volkes;<br />
die Leute zeigten sich als geldgierig und mit dem Ge<br />
botenen nicht zufrieden. Nach kurzer Besichtigung wandten<br />
wir dem wenig bedeutenden Ort den Rücken, bestiegen<br />
unsern Wagen und langten rechtzeitig um fünf Uhr in der<br />
Versammlungshalle des äryasamäj an. Die Lichter wurden<br />
angezündet, der Saal füllte sich zusehends, ich Hess die<br />
grossen, nach einer geräuschvollen Strasse gehenden Flügel<br />
türen schliessen und begann meinen Vortrag über den<br />
Vedänta. Nachdem ich denselben in englischer Sprache<br />
beendigt, wurde ich, wie schon erwähnt, gebeten, die Haupt<br />
punkte nochmals in Sanskrit zu rekapitulieren, da viele des<br />
Englischen nicht mächtig seien. Es geschah, und nun folgte<br />
eine Diskussion, halb Englisch halb Sanskrit, in welcher<br />
mehrfach theistische Neigungen sich kundgaben. Ich schloss<br />
die Versammlung unter dem reichen Beifalle der Anwesenden<br />
und wurde von einer grösseren Anzahl derselben nach dem<br />
Bahnhof geleitet, wo wir bald müde auf die aus geflochtenen<br />
Rohrbänken hergestellten Betten sanken und so gut schliefen,<br />
wie es unter dem nächtlichen Lärm ankommender und<br />
abgehender Züge möglich war. Grössere Scharen von<br />
Pilgern hatten die Nacht ausserhalb des Bahnhofs nach<br />
indischer Sitte in Gruppen auf der Erde hockend zugebracht,<br />
und unser Diener Lalu erzählte mir am andern Morgen,<br />
wie er unter ihnen Bekannte aus seinem Heimatsort ge<br />
funden habe, wie sie ihn gefragt hätten, ob er auch nicht<br />
versäumt habe, für seine Sünden ein Bad in der Yamunä<br />
zu nehmen, und wie er ihnen erklärt habe, dass er dazu<br />
keine Zeit finde, und dass er sich durch die Last seiner
Mahäban. Vortrag in Msthurä. Lslus Sünden. H9<br />
Sünden nicht sonderlich bedrückt fühle. Lalu war also<br />
freigeisterisch angehaucht, aber er hatte noch schlimmere<br />
Eigenschaften, die sich noch am selbigen Tage offenbaren<br />
sollten. Schon öfter war es vorgekommen, dass er die<br />
Ankunft des Zuges verschlief und ich ihn mir erst aus<br />
seinem Coupe dritter Klasse herausholen musste. Auch fiel<br />
mir mitunter auf, dass ein eigentümlicher Geruch von ihm<br />
ausströmte; aber wenn ich fragte: „Lalu, Sie trinken<br />
doch nicht?", so antwortete er mit Bestimmtheit: „Nein,<br />
Herr!"<br />
Wir bestiegen den Zug, der uns in einer Tagesfahrt<br />
aus dem Tal der Yamunä in das der Gangä führen sollte<br />
bis nach Fatehgarh, wo wir an den Clerk der Eisenbahn<br />
station brieflich schon vorher empfohlen waren und über<br />
nachten wollten. Gegen Abend langten wir daselbst an,<br />
und nach einigem Rufen und Warten stellte sich denn auch<br />
Lalu ein, um das Gepäck zu besorgen, konnte aber mit dem<br />
Zusammenwickeln und Verschnüren der Decken gar nicht<br />
zu stände kommen, bis ich näher zusah und entdeckte, dass<br />
er völlig betrunken war. „Lalu", sagte ich, „Sie sind be<br />
trunken." „Ja, Herr," sagte er, „warum soll ich die Wahr<br />
heit nicht gestehen? Ich habe mitunter etwas Fieber unt<br />
dann nehme ich wohl einen Trunk, um es zu bekämpfen."<br />
Ich schwieg, aber sein Schicksal war beschlossen. Mit<br />
Hülfe des Clerk schafften wir das Gepäck ins Waiting<br />
Room, wo wir auch diesmal übernachten sollten, während<br />
Lalu in irgend einer Ecke unter mächtigem Schnarchen<br />
seinen Rausch verschlief. Unter angenehmen Gesprächen<br />
mit dem Clerk, der ein geistig sehr empfänglicher Mann<br />
war, verbrachten wir den Abend. Zugleich war derselbe<br />
bemüht, uns einen anderen Diener zu besorgen es wollte<br />
sich aber an dem kleinen Orte nicht gleich etwas Passendes<br />
finden. So mussten wir uns am andern Tage noch mit<br />
Lalu behelfen. Er erschien am nächsten Morgen scheu
120 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
und verkatert; ich würdigte ihn keines Wortes mehr und<br />
nahm für uns alle drei Billets nach Cawnpore.<br />
Als wir nach einer Eisenbahnfahrt von sechs Stunden,<br />
auf der ich mich vergeblich bemühte, die in der Nähe fliessende<br />
Gaiigä zu sehen, in Cawnpore anlangten, wurden wir gleich<br />
am Bahnhofe in deutscher Sprache begrüsst. Es war Herr<br />
Bassler, ein wackerer junger Kaufmann, dessen Bekanntschaft<br />
wir auf dem Schiffe gemacht hatten, und dem wir hatten<br />
versprechen müssen, ihn in seinem Wohnorte Cawnpore zu<br />
besuchen. Dementsprechend hatten wir ihn von unserer An<br />
kunft brieflich benachrichtigt, und so war er mit seinem<br />
Wägelchen am Bahnhofe und bestand darauf, dass wir die<br />
Nacht in seinem Bungalow zubrächten. Obwohl er Jung<br />
geselle sei, so werde es uns dort an nichts fehlen. Wir<br />
nahmen das freundliche Anerbieten an, und ich bat nur noch<br />
so lange am Bahnhofe zu warten, bis ich mit Lalu Ab<br />
rechnung gehalten hätte. Ich Hess den Sünder vor mich<br />
kommen und hielt ihm mit milden, aber ernsten Worten sein<br />
Vergehen vor und eröffnete ihm, dass ich ihn entlassen<br />
müsse. Er legte sich aufs Bitten und Versprechen, aber es<br />
gelang ihm nicht, mich umzustimmen. Ich zahlte ihm seinen<br />
rückständigen Lohn sowie die Rückreise nach Bombay, beides<br />
reichlich, und die lange Reihe von Silberstücken schien ihn<br />
über sein Schicksal zu trösten. Freundlich und mit einigen<br />
Ermahnungen für die Zukunft reichte ich ihm die Hand und<br />
er verschwand auf Nimmerwiedersehen.<br />
Meine Frau bestieg mit Herrn Bassler dessen leichtes,<br />
von ihm selbst gelenktes Tamtam, ich selbst folgte mit dem<br />
Gepäck in einem zweiten Wagen, und so fuhren wir zu<br />
Basslers Bungalow, indem wir unterwegs die Hauptsehens<br />
würdigkeiten des Orts in Augenschein nahmen. Sie bestehen<br />
in einer Gedächtniskirche, einem ehemaligen mit dem schönen<br />
Standbilde eines Engels gezierten Brunnen und anderen<br />
Denkmälern, welche sich sämtlich auf den Aufstand des
Cawnpore. Lalu entlassen. Herrn Basslers Heim. 121<br />
Jahres 1857 beziehen. Die Engländer nennen denselben<br />
the mutiny und brandmarken dadurch das Andenken derer,<br />
die ihn anstifteten. Wären die Aufständischen zum Ziele<br />
gelangt, wozu ja eine Zeitlang alle Aussicht war, so würden<br />
sie heute bei ihrer Nation eine ähnliche Verehrung geniessen,<br />
wie bei uns Schill, Scharnhorst, Blücher und andere Helden<br />
der Freiheitskriege. Jetzt, wo sie unterlegen sind, heissen<br />
sie die Meuterer, und ihr Andenken wird verunglimpft. So<br />
sehr machen die Menschen ihre Wertschätzung von dem<br />
äusseren Erfolge abhängig, den doch oft nur der Zufall<br />
regiert. Nachdem wir noch zum Ufer der Gaiigä gewall<br />
fahrtet, die schon hier, wo wir sie zum erstenmale sahen, sich<br />
in majestätischer Breite dahinwälzt, langten wir in Herrn<br />
Basslers Bungalow an. Dasselbe gab uns eine willkommene<br />
Vorstellung davon, wie ein deutscher Junggeselle, der nach<br />
Indien verschlagen worden, sich dort behaglich einzurichten<br />
weiss. Von der Strasse aus gelangte man in ein weitläufiges<br />
Grundstück, in dessen Mitte sich das einstöckige quadratische<br />
Haus erhob, welches mehrere stattliche Säle und an beiden<br />
Seiten Schlafzimmer enthielt. Das Mobiliar war einfach aber<br />
ausreichend, in unserem Schlafzimmer fanden wir zwei gute<br />
Betten, und sogar ein Spiegel wurde noch hinterher be<br />
schafft. In diesen Räumen also thronte Herr Bassler und<br />
zwar für gewöhnlich ganz allein. Für seine Sicherheit hatte<br />
er nichts zu befürchten, denn in seinem Schlafzimmer sah<br />
ich ein kleines Arsenal von Waffen solidester und elegantester<br />
Art. Diese werden von der englischen Regierung dem in<br />
Indien wohnenden Europäer kostenlos geliefert, während den<br />
Eingeborenen das Halten von Waffen durch hohe Eingangs<br />
zölle und andere Schwierigkeiten fast zur Unmöglichkeit<br />
gemacht wird. So würde im Falle eines Aufstandes ein<br />
kleines, aber wohlbewaffnetes und auch eingeübtes Heer von<br />
Europäern gleichsam aus der Erde wachsen.<br />
Natürlich war Herr Bassler von einem halben Dutzend
122 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
Dienern umgeben, welche ausserhalb des Gebäudes in kleinen<br />
Häuschen in der Nähe wohnten. Solche Diener leisten nicht<br />
viel, da jeder nur seine besondere Arbeit verrichtet, kosten<br />
aber auch sehr wenig, denn sie erhalten weder Wohnung<br />
noch Kleidung noch Beköstigung, sondern 5—10 Rupien im<br />
Monat, mit denen sie den ganzen Unterhalt für sich und<br />
ihre Familie bestreiten. Einige derselben servierten mit<br />
Geschick ein recht gutes Essen, wurden aber dabei von<br />
ihrem Herrn mehr als nötig zurechtgewiesen und überhaupt<br />
sehr streng gehalten. Er behauptete, dies sei notwendig,<br />
da die Kerle sonst unausstehlich werden würden. Nach dem<br />
Essen kommandierte Herr Bassler: „boyl cheroot!" und so<br />
gleich brachten die Diener die gewünschten Cigarren, welche<br />
wir, die Beine behaglich über Stühle und Diwans gestreckt,<br />
in den Mund nahmen, worauf die Diener in demütiger<br />
Stellung das Feuer präsentierten; die Mühe des Ziehens war<br />
das einzige, was den Herrschaften nicht abgenommen werden<br />
konnte. Gemütlich plaudernd sassen wir noch lange; Herr<br />
Bassler erzählte von seiner Heimat, einem Städtchen in<br />
Sachsen, und wie er als Vertreter eines dortigen Geschäfts<br />
hauses in Indien wohne, um die Einkäufe von Getreide und<br />
Tierhäuten zu besorgen. Er erzählte von den Krokodilen,<br />
die er im Ganges zu schiessen pflege, von den Gefahren<br />
des indischen Klimas, und wie ein Freund nachts an der<br />
Cholera gestorben sei, mit dem er am Abend vorher noch<br />
gemütlich Karten gespielt habe usw. Im ganzen, glaube ich,<br />
hat er uns bei seinen Erzählungen etwas mehr als Neulinge<br />
behandelt, als wir es in Wirklichkeit waren. Natürlich wurde<br />
auch das Kapitel der Schlangen gebührend durchgesprochen,<br />
wie ihr Biss in wenigen Minuten töte, wie sie nachts ihren<br />
Eingang in die Häuser und wohl gar in die Betten fänden;<br />
und so gingen wir mit ziemlich aufgeregter Phantasie schlafen.<br />
Mitten in der Nacht wurde ich wach und hörte in der Ecke<br />
ein Rascheln; ich hörte, wie es näher kam und schnuppernd
Schauergeschichten. Die Moschusratte. Purän. 123<br />
und fauchend sich um mein Bett herum zu schaffen machte.<br />
Ich wagte nicht Licht anzuzünden, um nicht durch irgend<br />
eine Bewegung das unheimliche Wesen zu reizen; angstvoll<br />
verfolgte ich das Geräusch und atmete erleichtert auf, als<br />
dasselbe sich entfernte und alles wieder ruhig wurde. Herr<br />
Bassler, dem ich die Sache am andern Morgen erzählte,<br />
meinte, es werde wohl eine Moschusratte gewesen sein,<br />
welche sich öfter in den Häusern fänden, übrigens aber<br />
ganz harmlos seien.<br />
Am nächsten Morgen, als wir mit Herrn Bassler von<br />
einem in die umliegenden Anlagen unternommenen Spazier<br />
gang zurückkehrten, stellte sich der neue Diener vor, welchen<br />
Herr Bassler für uns ermittelt hatte. Er hiess Purän, d. h.<br />
„der Alte," und war auch wirklich schon gegen 60<br />
Jahre alt, infolgedessen wohl etwas träge und schwerfällig,<br />
aber reich an Erfahrung und sicher in seinem Auftreten.<br />
Auch sein Englisch war bedeutend besser als dasjenige,<br />
welches Lalu zu radebrechen pflegte. Der Religion nach<br />
war er Mohammedaner, wiewohl er in einem seiner Zeugnisse<br />
als Christ bezeichnet wurde. Diese bedenkliche Doppel<br />
konfession erklärte Purän damit, dass er einst mit einem<br />
Herrn in Kaschmir gereist sei, dem es gefallen habe, seinen<br />
Diener als Christen zu produzieren. Wahrscheinlicher dürfte<br />
es wohl sein, dass Purän selbst seine Rechnung dabei ge<br />
funden haben mochte, sich gelegentlich bei irgend einem<br />
hochfrommen Engländer als Christen einzuführen. Meine<br />
Frau erklärte ohne Zögern, dass sie den Mann für brauch<br />
bar halte und engagieren wolle. Dies war mir sehr erfreu<br />
lich, da sie in betreff der Dienerschaft nicht leicht zu be<br />
friedigen ist, wie sie sich denn auch über Purän später<br />
hin noch oft und bitter beklagte. Purän wurde also enga<br />
giert, wir nahmen noch ein eiliges Frühstück im Hause des<br />
Herrn Bassler ein und fuhren dann die kurze Strecke bis<br />
Lucknow, wo wir weder durch die sommerliche Natur noch
124 V. Von Peshawsr bis Calcutta.<br />
durch das Gebahren der Menschen daran erinnert wurden,<br />
dass es der Abend vor Weihnachten war; denn das konnte<br />
man ja keine Weihnachtsfeier nennen, dass am Abend nach<br />
dem Dinner eine Bande phantastisch kostümierter Schotten<br />
vor dem Hotel eine humoristische Musik zum besten gaben.<br />
Ich zog mich in den Salon zurück, wo sich auch Mr.<br />
Summers einfand, dem ich einige deutsche Weihnachtslieder<br />
auf dem Klavier vorspielte. Er wollte am nächsten Morgen<br />
zum nationalen Kongress nach Allahabad reisen, wo er, wie<br />
bereits berichtet wurde, wenige Tage darauf an den Pocken<br />
gestorben ist.<br />
In Lucknow befanden wir uns in der Lage eines Mannes,<br />
der für gewöhnlich eine Brille trägt und diese dann plötzlich<br />
verlegt hat und nicht finden kann. Alles erscheint undeutlicher,<br />
nebelhafter und weniger schön. Die Brille, die uns in Lucknow<br />
fehlte, war die sonstin der Regel uns zu Gebote stehende Führung<br />
durch befreundete Eingeborene. Zwar hatten unsre Bombayer<br />
Freunde nicht unterlassen, uns auch in Lucknow an einen<br />
trefflichen Mann, Mathurä Prasäd, zu empfehlen; unglück<br />
licherweise aber war derselbe die beiden Weihnachts<br />
tage über verreist und stellte sich erst am Abend vor<br />
unsrer Abreise (am 26. Dezember) in unserm Hotel ein,<br />
zugleich mit seinem zehnjährigen Sohne, mit dem ich, infolge<br />
meines unlängst erwachten Interesses für das Hindostani,<br />
eine kleine Unterredung über diese seine Muttersprache<br />
hatte, die ich sonst nur im Munde von Kutschern und Dienern<br />
hörte, während ich mich hier an der reinen Art, wie der<br />
Knabe dasselbe sprach, erfreuen konnte.<br />
Nachdem wir am Nachmittage unsrer Ankunft in der<br />
grossen Stadt, zu welcher überdies kein Plan aufzutreiben<br />
war (Constable's trefflicher Hand-Atlas of India war leider<br />
noch nicht erschienen), ziemlich planlos umhergeirrt, be<br />
schlossen wir, am folgenden Morgen systematischer vorzu-
Lucknow. Die Residency. Eine Opernvorstellung. 125<br />
gehen und zunächst die ziemlich inmitten der Stadt belegene<br />
Residency zu besuchen. Dieselbe besteht aus einem Kom<br />
plex halb zerstörter Gebäude und Befestigungen, welche in<br />
diesem Zustande erhalten werden, da sie die denkwürdige<br />
Stätte bilden, wo von Juli bis September 1857 tausend Eng<br />
länder, Männer, Frauen und Kinder, unter furchtbaren Ge<br />
fahren und Entbehrungen die Belagerung der aufständischen<br />
Sepoys auszuhalten hatten. Alle Einzelheiten dieser denk<br />
würdigen Episode traten beim Anblicke der halbzerstörten<br />
Gebäude und ihrer Umgebungen lebendig vor Augen. Hier<br />
war der unterirdische Raum, in welchem Frauen und Kinder,<br />
zusammengepfercht, Schutz vor den einschlagenden Kugeln<br />
suchten. Dort war das Zimmer, in welchem Sir Henry<br />
Lawrence, von einem Granatsplitter getroffen, sein Leben<br />
aushauchte. Dort drüben stand das Haus des Johannes, von<br />
welchem aus ein Afrikaner den Belagerten furchtbare Verluste<br />
beibrachte; und da war der Kirchhof mit seinen Denkmälern,<br />
auf welchem an zweitausend Opfer der Katastrophe be<br />
graben liegen.<br />
Als wir von diesen wehmütigen Betrachtungen auf<br />
längerer Wanderung durch die weitausgedehnte, von grossen<br />
Anlagen, Gärten und freien Plätzen durchzogene Stadt zum<br />
Hotel zurückkehrten, bemerkte ich im Vorbeigehen in einer<br />
Vertiefung eine grosse Bretterbude, in welcher, wie die An<br />
schläge kundgaben, heute abend von einer Parsi-Truppe die<br />
Qakuntalä des Kälidäsa gespielt werden sollte. Ich beschloss,<br />
diese Vorstellung zu besuchen. Abends nach dem Dinner<br />
zog sich meine Frau, welche ermüdet war, in unser Schlaf<br />
zimmer zurück, welches, wie gewöhnlich in Indien, einen<br />
Ausgang direkt auf die Veranda ins Freie hatte. Bei dem<br />
Mangel von Schloss und Schlüsseln, welche selten in Indien<br />
vorhanden sind, verrammelte ich mit Hülfe des Dieners die<br />
Tür so gut es ging und machte mich mit demselben auf<br />
den Weg. Der Musensitz lag von unserm Hotel eine halbe
126 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
Stunde entfernt. Vergebens rief und pfiff der Diener nach<br />
einem Wagen; es wollte sich keiner einstellen. Endlich ge<br />
lang es uns, einen Ekka aufzutreiben; es war das armseligste<br />
Gefährt, auf welchem ich je in meinem Leben gesessen habe."<br />
Wir lagerten uns auf der Fläche des Wagens und Hessen<br />
die Beine heraushängen. Das kümmerliche Pferdchen setzte<br />
sich in Trab im tiefen Dunkel der indischen Nacht. Eine<br />
Laterne war vorhanden, aber immer wieder und wieder er<br />
losch dieselbe; öffnete man die Laternentür, so wehte sie<br />
der Wind aus; schloss man sie, so erstickte die Flamme<br />
aus Mangel an Luft. Endlich kamen wir an und befahlen<br />
dem Kutscher, bis zum Ende der Vorstellung zu warten. Er<br />
breitete eine Decke über sein Ross, kauerte vor den Vorder-<br />
füssen desselben nieder, wie die indischen Kutscher zu tun<br />
pflegen, und schlief ein. Wir stiegen hinunter, und ich nahm,<br />
mit grosser Zuvorkommenheit behandelt, meinen Platz auf<br />
den vordersten Bänken ein, wo ich ziemlich allein sass,<br />
während die hinteren Plätze recht gut besetzt waren. Meinen<br />
Dioner Hess man ohne Bezahlung herein. Das Publikum<br />
bestand nur aus Eingeborenen; ich war der einzige Europäer,<br />
der sich hierher verlaufen hatte. Das Stück ging an; es war<br />
Qakuntalä, aber, o weh! Qakuntalä als Oper! Es war ver<br />
mutlich dieselbe Aufführung, welche Freund Garbe in Bombay<br />
sah und so abschätzig beurteilt. Ich muss ihm recht geben:<br />
die Sache war lang und wurde nachgerade langweilig.<br />
Mühsam bekämpfte ich den Schlaf und suchte mich in den<br />
Zwischenakten durch eine Tasse Thee aufzumuntern, welche<br />
draussen im Freien verabreicht wurde. Als man gegen ein<br />
Uhr noch nicht über die ersten Akte hinaus war, verzichtete<br />
ich auf die Fortsetzung und trat mit Purän den Heimweg an.<br />
Unser Kutscher sass noch ruhig zu den Füssen seines<br />
Pferdes und schlief. Nachdem wir ihn geweckt, begann ein<br />
grosses Gejammer; man hatte ihm die Decke vom Pferde<br />
weggestohlen. Es war wohl das einzige, was an diesem
Seite 126.<br />
c<br />
c<br />
:C3<br />
tü D.<br />
cd<br />
c<br />
E
Ein Ekka. Tonfiguren. Fyzabad und Ayodhyä. 127<br />
Wagen zu stehlen war. Wir trösteten ihn durch einige<br />
Münzen und Hessen uns nach Hause haudern.<br />
Die folgenden Tage benutzten wir teils, um mohamme<br />
danische Prachtbauten zu besuchen, deren es in und um<br />
Lucknow eine ganze Anzahl gibt, teils machten wir Be<br />
kanntschaft mit mehreren Fabrikanten von Tonfiguren, welche<br />
die indischen Volkstrachten und Gewerbe darstellen und in<br />
Lucknow sehr schön angefertigt werden. Freilich waren die<br />
Preise nicht billig; für eine gut gefertigte, etwa 20 cm hohe<br />
Figur wurden 10 Mark und mehr gefordert.<br />
Erst am Abend vor unserer Abreise stellte sich in unserem<br />
Hotel der Hindufreund ein, an den wir empfohlen worden<br />
waren. Er widmete uns einige freundliche Stunden und ver<br />
sah uns mit einer Empfehlung für Fyzabad, die Eisenbahn<br />
station für das benachbarte Ayodhyä, die Stadt des Räma,<br />
welche das nächste Ziel unserer Reise bildete.<br />
Am frühen Morgen legten wir die kurze Strecke von<br />
Lucknow nach Fyzabad zurück und suchten dort, nachdem<br />
wir im Hotel Wohnung genommen, das Haus des Mannes<br />
auf, an den wir empfohlen waren. Leider war auch er in<br />
folge der Feiertage verreist, und nachdem wir mit einem<br />
zu Besuch in seinem Hause anwesenden Freunde eine<br />
längere Unterhaltung gehabt und uns über die Verhältnisse<br />
in Ayodhyä einigermassen orientiert, beschlossen wir, den<br />
Weg dorthin allein anzutreten. Ein Wagen war schnell be<br />
schafft, unser Diener schwang sich zum Kutscher auf den<br />
Bock, und wir rollten der berühmten Stadt des Räma zu.<br />
Ausser einigen kolossalen Säulentrümmern, die wir unter<br />
wegs hier und da bemerkten, gemahnte nichts daran, dass<br />
wir uns auf der Stätte so vieler verklungener Herrlichkeit<br />
befanden. In weniger als einer Stunde war Oudh, auf der<br />
Stätte des alten Ayodhyä, erreicht, welches sich lang an dem
128 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
Ufer der sehr stattlichen Sarayu hinzieht und, ähnlich wie<br />
Mathurä, sich als heilige Stadt durch eine grössere Anzahl<br />
von Tempeln dokumentierte, sowie auch durch eine Menge<br />
von Affen, welche auf allen Dächern und Plätzen ihr<br />
Wesen hatten, an den Wänden der Häuser herumkletterten<br />
und von den Verkäufern von Esswaren in rücksichtsvoller<br />
Weise fern zu halten gesucht wurden. Auf einem freien<br />
Platze unter Bäumen schüttete jemand einen Rest von<br />
Getreidekörnern aus, und sofort machten sich viele Affen<br />
darüber her, zerrieben die Körner in den Händen, besichtigten<br />
prüfend ihren Inhalt und führten ihn zum Munde. Da kamen<br />
des Weges einige Schafe, voran ein ungestümer Widder,<br />
welcher mit Kopf und Hörnern die Affen rücksichtslos bei<br />
Seite stiess und anfing unter den Körnern aufzuräumen.<br />
Vergeblich suchten die Affen durch die furchtbarsten<br />
Grimassen die Eindringlinge zu verscheuchen, und mussten<br />
sich schliesslich begnügen mit den wenigen Körnern, die sie<br />
ohne Gefahr erreichen konnten, indem sie dieselben in<br />
possierlichster Weise zwischen den Hinterbeinen der Schafe<br />
hervorscharrten. Wir wandten uns von diesem Schauspiele<br />
einem benachbarten Tempel zu, der von vielem Volke um<br />
drängt wurde, während an dem erhöhten Eingange einige<br />
Priester postiert waren, die von den Leuten Gefässe mit<br />
Milch, Früchten usw. entgegen nahmen, einen Teil des<br />
Inhaltes in grössere Gefässe zusammengössen und das<br />
übrige wieder zurückgaben. Leider war niemand da, der<br />
mir diesen eigentümlichen Brauch hätte erklären können.<br />
Wir erstiegen eine Anhöhe, auf der sich eine moham<br />
medanische Moschee, wie gewöhnlich in Indien aus einer<br />
offenen Halle bestehend, befand; unser Diener beurlaubte<br />
sich für eine Viertelstunde, um an heiliger Stätte ein Bad<br />
zu nehmen, während wir uns einiger indiskreter Frager, es<br />
waren Mohammedaner, zu erwehren hatten. Auf der anderen<br />
Seite der Anhöhe stiegen wir durch Tabakspflanzungen hinab,
Ayodhyä. Affen, Tempel, Sehenswürdigkeiten. 129<br />
begrüssten im Vorbeigehen einen alten Gelehrten, der die<br />
Sän£/zva-Philosophie studierte, und lustwandelten dann an<br />
dem schönen Ufer des Flusses entlang zur Stadt zurück.<br />
Auf unserm Wege lag ein grosser Tempel des Räma. Ich<br />
trat ein, und man verwehrte mir ziemlich unfreundlich den<br />
Zutritt. Vergeblich setzte ich in Sanskrit auseinander, dass<br />
ich das Rämäyanam studiert habe und, wenn auch ein Aus<br />
länder, doch gewiss würdiger als viele andere sei, dem<br />
Helden Räma meine Verehrung zu zollen. Man Hess sich<br />
nicht erweichen, vielleicht weil man mich nicht verstand;<br />
ich wurde heftig, Hess noch eine kleine Strafpredigt vom<br />
Stapel und wandte mit dem Ausrufe: kruddho 'smi! („ich<br />
zürne euch") den ungastlichen Pforten den Rücken.<br />
Die tropische Sonne neigte sich schon dem Horizonte<br />
zu, als wir unsern Wagen bestiegen und von der Stätte der<br />
alten Rämastadt Abschied nahmen. Eine Fahrt von zehn<br />
Minuten führte uns in die Nähe eines Hügels, auf dem einst<br />
Buddha gepredigt haben soll. Wir stiegen hinan und fanden<br />
oben ein halb verfallenes Haus, von einem anmutigen Gärt-<br />
chen umgeben, und als Wächter des Ortes ein freundliches<br />
altes Ehepaar, mit dem wir einige Worte wechselten und<br />
uns an der weiten Aussicht über Stadt und Ebene und den<br />
in der Abendsonne silbern glänzenden Strom erquickten.<br />
Dann gewannen wir unseren Wagen wieder und rollten auf<br />
Fyzabad zu. Mit der Dämmerung erreichten wir unser Hotel,<br />
wo beim Dinner noch ein Gast ausser uns zugegen war, ein<br />
Maler, der uns eine schöne Sammlung von Gemälden indischer<br />
Landschaften zeigte. Der Horizont auf denselben war, wie<br />
gewöhnlich in Indien, wolkenlos. „Aber hier ist einmal ein<br />
Stück mit Wolken", sagte ich, „welches an die Landschaften<br />
unserer Heimat erinnert." — „Sagen Sie das nicht," versetzte<br />
er, „diese Wolken sind von denen des nordischen Himmels<br />
sehr verschieden."<br />
Der nächste Morgen sah uns wieder auf dem Bahnhofe.<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 9
130 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
Wir lösten unsere Billets nach Benares, wo wir nach einer<br />
Fahrt von drei Stunden in der grössten Mittagshitze eintrafen<br />
und in Clark's Family Hotel Wohnung nahmen, zuerst par<br />
terre links, dann, nachdem Platz geworden war, in einem<br />
grösseren und besseren Zimmer parterre rechts, welches wir<br />
drei Wochen lang innegehabt haben. Das Hotel lag an der<br />
Landstrasse. Auf der andern Seite derselben befand sich<br />
eine Kirche, von einem geräumigen Grundstücke mit wohl<br />
gepflegten Wegen und Blumenbeeten umgeben. Auch einiges<br />
Schatten gebende Gebüsch war vorhanden. Die niedrige<br />
Mauer war von der Landstrasse her mit Hülfe der Steine<br />
eines verfallenen Brunnens bequem zu übersteigen, und wir<br />
benutzten täglich diese Gelegenheit, um auf dem Kirchhofe<br />
zu lustwandeln oder auch unsere Besucher dorthin zu führen,<br />
namentlich, wenn mehrere zusammen kamen und die Dis<br />
kussion lebhaft und laut zu werden drohte, wie das mit den<br />
Indern als naiven Naturkindern leicht zu geschehen pflegt.<br />
Wenn wir dann, umgeben von national gekleideten Professoren<br />
oder Pandits, auf der Veranda des Hotels verweilten, so<br />
konnten wir wohl aus den Blicken der Ein- und Ausgehenden<br />
lesen, dass wir nicht ganz angenehm auffielen, und so<br />
pflegten wir uns lieber jenseits der Landstrasse mit den<br />
Stühlen des Hotels im Gebüsche des Kirchhofes zu postieren,<br />
wo dann dem Redefluss freiester Lauf gelassen werden<br />
konnte.<br />
Jenseits der Kirche kamen zuerst grosse, freie Grasplätze;<br />
hier lag die Wohnung des Professors Venis, etwas weiter<br />
die Buchdruckerei und der Buchladen seines Schwieger<br />
vaters Lazarus, dann folgte unter anderm das Postbureau, und<br />
endlich kam man zu den Anfängen der Stadt, welche sonach<br />
ziemlich weit, wohl eine Viertelstunde, von uns entfernt lag.<br />
Die Stadt selbst, am linken Ufer des Ganges im Halb<br />
kreise gelegen, ist ein Labyrinth von engen, winkligen<br />
Strassen und Gässchen, in denen man sich nicht leicht ohne
Benares. Clark's Family Hotel. Baden im Ganges. 13]<br />
Führer zurechtfindet, zumal da kein detaillierter Plan von<br />
der Stadt existiert. Diesen ganzen Wirrwarr von Strassen<br />
mussten wir jedesmal durchkreuzen, um zum Ganges zu<br />
kommen, welcher die Hauptsehenswürdigkeit von Benares<br />
bildet. Die Ufer sind hier hoch und steil. Auf der Höhe<br />
an ihnen entlang haben viele auswärtige Fürsten und Vereine<br />
ihre Versammlungshäuser. Von dieser Häuserreihe bis hinab<br />
zum Ganges führen viele Treppen, die sogenannten Ghatta's.<br />
Auf ihnen bis zum Ufer hin und in den Fluss hinein ent<br />
wickelt sich allmorgendlich im Winter wie im Sommer ein<br />
sehr unterhaltendes Schauspiel. Morgens gegen 7 Uhr ist<br />
das Ufer belebt von badenden Gruppen, für welche das<br />
tägliche Bad im Ganges einerseits religiöse Pflicht, ander<br />
seits ein sehr willkommener Zeitvertreib ist. Wenn man<br />
früh am Morgen sich bei Dagägvamedha Ghatta einfindet<br />
und eines der zahlreich vorhandenen, hohen und breiten<br />
Schiffe mietet, um sich am Ufer entlang fahren zu lassen,<br />
so kann man in nächster Nähe und in voller Bequemlichkeit<br />
die Gruppen der Männer und, etwas getrennt von ihnen,<br />
solche von Weibern beobachten, wie sie lustig im Wasser<br />
herumplätschern, indem sie zugleich ihre Kleider und Gefässe<br />
waschen. Die dünnen Kleider werden auf den Steinen des<br />
Ufers der prallen Morgensonne ausgesetzt und sind, wenn<br />
der Inhaber sein Bad genommen hat und aus dem Wasser<br />
steigt, schon hinreichend trocken, um wieder angezogen<br />
werden zu können. Weiter am Ufer entlang fahrend, ge<br />
langt man an eine Stelle, wo vom Morgen bis an den Abend<br />
die Leichen von solchen verbrannt werden, welche im hohen<br />
Alter nach Benares gezogen sind, um dort ihr Leben zu<br />
beschliessen, oder auch erst nachdem sie gestorben sind,<br />
ihren Leib auf Grund letztwilliger Verfügung nach Benares<br />
haben transportieren lassen. Da hier in der Regel mehrere<br />
Verbrennungen gleichzeitig erfolgen, so kann man den<br />
ganzen Hergang in kurzer Zeit an ihnen beobachten.<br />
9*
132 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
Zunächst bringen Träger die mit Tüchern umwickelte und<br />
mit Blumen geschmückte Leiche herbei, und das erste ist,<br />
dass dieselbe mitsamt dem Brett, auf welchem sie befestigt<br />
ist, halb in den Fluss geschoben wird, von wo sie dann,<br />
nachdem der Scheiterhaufen fertig gestellt worden, auf die<br />
mannslangen, grossen Holzscheite gelegt wird, aus denen<br />
er besteht. Einige weitere Holzscheite werden über die<br />
Leiche gelegt, worauf von privilegierten, einer besonderen<br />
Kaste angehörigen Leuten, in deren Händen die ganze Cere-<br />
monie liegt, der Scheiterhaufen angezündet wird. Die Flamme<br />
prasselt empor und ergreift immer weitere Holzteile und<br />
zuletzt den Leichnam, während die Angehörigen des Verstor<br />
benen, in einiger Entfernung stehend, meist mit dumpfem<br />
Schweigen dem Schauspiel folgen. In einigen Stunden ist,<br />
wie schon oben bemerkt wurde, die Leiche bis auf einige<br />
Knochenteile vollständig verbrannt; die Reste werden in den<br />
Ganges geschürt, dessen träge fliessende Wasser noch längere<br />
Zeit mit Kohlen, Blumenkränzen u. dgl. überzogen bleiben.<br />
Unterdessen ist bereits auf der leergewordenen Stelle ein<br />
neuer Scheiterhaufen errichtet worden, der für die folgende<br />
Leiche bestimmt ist. Selten besucht man den Ort, ohne<br />
dass nicht mehrere Scheiterhaufen gleichzeitig brennten.<br />
Der Zudrang ist ein grosser, da die Inder glauben, dass<br />
derjenige, dessen Leiche in Benares verbrannt wird, sofort<br />
in die Erlösung eingeht. Weniger belebt sind die Ufer<br />
Weiter unterhalb; folgt man ihnen, so gelangt man nach<br />
halbstündiger Wanderung, vom Mittelpunkte an ge<br />
rechnet, an die Stelle, wo die Varanä, ein Flüsschen<br />
von etwa 10 Metern Breite, in den Ganges mündet.<br />
Ebenso bildet an der entgegengesetzten Seite oberhalb der<br />
Stadt die meist ganz wasserlose Ast die Stadtgrenze. Von<br />
beiden Flüssen hat die Stadt den Namen Väranäsi, das ist<br />
Benares.<br />
Auf dem anderen Ufer, oberhalb der Stadt, liegt auf
Seite 132.<br />
DD<br />
O<br />
cd<br />
<strong>•</strong>a<br />
B<br />
cu
Leichenverbrennung. Besuch beim Mahäräja. 133<br />
einer Erhöhung Rämanagaram, die Residenz des Mahäräja<br />
von Benares, bestehend aus einem weitläufigen Palast mit<br />
Nebengebäuden und einem unweit davon befindlichen<br />
Tempel der Durgä.<br />
Unsere Empfehlungsbriefe an den Mahäräja hatten wir,<br />
wie üblich, bei unserer Ankunft in Benares übersandt und<br />
um eine Audienz gebeten. Am folgenden Tage erschien<br />
der Sekretär des Mahäräja im Hotel, und der Besuch wurde<br />
für den nächsten Tag — es war der 31. Dezember — ver<br />
abredet. Zur festgesetzten Stunde holte uns der Wagen<br />
des Mahäräja im Hotel ab und führte uns zum Ganges.<br />
Eine Sänfte mit Trägern stand für meine Frau bereit, um<br />
sie den Abhang hinunter bis ans Wasser zu tragen, ein<br />
fürstliches Boot setzte uns über, dann wieder Sänfte bis<br />
ins Palais. Hier empfing uns der Mahäräja im Kreise seines<br />
Gefolges, welches zumeist aus Pandits bestand. Nachdem<br />
die politische Herrschaft derindischenFürsten fast überall an die<br />
Engländer übergegangen ist, sind die meisten Mahäräjas nicht<br />
vielmehr als reiche und angesehene Privatleute. Manche von<br />
ihnen ergeben sich dem Wohlleben und gehen in Schlemmerei<br />
unter, andere benutzen ihren Einfluss, um Religion und<br />
Wissenschaft zu pflegen. Dies war der Fall des gegen<br />
wärtigen Mahäräja von Benares, Prabhunäräyana, welcher<br />
einige Jahre vorher seinem Vater gefolgt war. Obgleich er<br />
schon einen erwachsenen Sohn hat, der auch nachher in<br />
der Versammlung erschien, macht der Mahäräja den Ein<br />
druck eines jüngeren Mannes von sanftem und bescheidenem<br />
Wesen. Er spricht leidlich gut Englisch und ebenso Sanskrit.<br />
Die Unterhaltung, an der sich auch die anwesenden Pandits<br />
lebhaft beteiligten, wurde mit Rücksicht auf diese vorwiegend<br />
in Sanskrit geführt. Von Zeit zu Zeit Hess sich der<br />
Mahäräja eine kostbare Pfeife reichen, aus der er einige Züge<br />
rauchte und sie dann dem Diener zurückgab. Meine Bitte,<br />
mir täglich einige Pandits zur Unterhaltung im Sanskrit zu
134 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
schicken, wurde bereitwilligst gewährt. Ausserdem stellte<br />
uns der Mahäräja für die ganze Zeit unseres Aufenthaltes<br />
in Benares einen schönen Wagen mit Kutscher und zwei<br />
Dienern zur Verfügung. Von dem Reichtum und der Frömmig<br />
keit des Mannes mag es einen Begriff geben, dass er, wie<br />
schon früher erwähnt, in Mathurä an heiliger Stelle sich<br />
wiegen Hess und sein Gewicht in Gold — es sollen über<br />
100000 Rupien gewesen sein — an die Brahmanen schenkte.<br />
Auch das Sanskritgedicht, in welchem Professor Gahgädhara<br />
an der Universität zu Benares dieses Ereignis in überaus<br />
künstlichen Versen feierte, wurde schon erwähnt.<br />
Nach längerer Unterhaltung in einem prunkvollen Saale<br />
lud uns der Mahäräja zur Besichtigung des Palastes ein.<br />
Wir bemerkten kostbare Elfenbeinschnitzereien und andere<br />
Kunstwerke, denen wir die gebührende Bewunderung zollten.<br />
Am interessantesten war das Cakuntalä-Zimmer, in welchem<br />
alle Hauptscenen des Dramas Qakuntalä in einer Reihe von<br />
Gemälden sehr anmutig dargestellt waren. Wir schieden<br />
höchst befriedigt, und noch lange dufteten unsere Hände<br />
von dem Rosenöl, welches man beim Abschied aus einer<br />
kostbaren Vase in dieselben geträufelt hatte.<br />
Einige Tage darauf stattete uns der Mahäräja seinen<br />
Gegenbesuch ab, wozu ein in der Nähe des Hotels ge<br />
legenes Palais gewählt wurde. Diesmal war die Anzahl der<br />
umgebenden Pandits noch grösser. Wir sprachen u. a. von<br />
Deutschland, und ich hatte Mühe, in Sanskrit eine Schilderung<br />
des nordischen Klimas mit Eis und Schnee zu machen;<br />
denn die allermeisten Inder haben nie in ihrem Leben Schnee<br />
gesehen, und es ist schwer, ihnen einen Begriff davon zu<br />
geben. Plötzlich brach der Mahäräja auf und lud mich ein,<br />
mit ihm in seinen Wagen zu steigen, während meine Frau<br />
einige Minuten später in einem anderen Wagen, von einigen<br />
Ministern begleitet, folgte. Die Unterhaltung während der<br />
Fahrt, teils in Englisch, teils in Sanskrit, drehte sich um
Mit dem Mahäräja zu Bhäskaränanda Svämin. 135<br />
die Reisen, welche der Mahäräja zu Elefant öfter nach<br />
seinen südlich gelegenen Besitzungen unternahm. Meine<br />
Frage, ob er nicht einmal nach Europa kommen möchte, ver<br />
neinte er mit Entschiedenheit. Als ich darauf hinwies, dass<br />
ja auch der Mahäräja von Baroda gegenwärtig in Europa<br />
weile, antwortete er kurz: „Ja, der ist ein Cüdra." Unsere<br />
Fahrt ging zu Bhäskaränanda Svämin, einem berühmten<br />
Heiligen, bei welchem der Mahäräja persönlich mich ein<br />
führen wollte. Durch einen Zufall hatte ich ihn allerdings<br />
schon früher kennen gelernt. Der junge Pandit Veniräm<br />
nämlich, mit dem ich in Bombay Sanskritkonversation trieb,<br />
erzählte mir, dass sein Vater in Asisanga bei Benares<br />
Askese übte und hatte mir auch einen Sanskritbrief an den<br />
selben mitgegeben. Mit diesem hatten wir uns bald nach<br />
unserer Ankunft in Benares nach Asisanga begeben, wo<br />
man uns nach mehrfachem Fragen in einen Garten wies,<br />
in welchem ein nackter Büsser lebte. Ein kleines Tuch<br />
um die Lenden bildete sein einziges Bekleidungsstück. Er<br />
nahm den Brief an, überblickte ihn flüchtig und empfing<br />
uns aufs freundlichste. Er war aber nicht Veniräms Vater,<br />
den ich auf diese Weise nie zu sehen bekommen habe,<br />
sondern Bhäskaränanda Svämin, und zu diesem führte<br />
mich nun auch der Mahäräja. Diesmal war er vollständig<br />
nackend; es ist mir ein unvergesslicher Eindruck, wie dieser<br />
arme, nichts auf der Welt sein eigen nennende Asket den<br />
vornehmen und reichen Mahäräja, der sich ihm mit demütiger<br />
Verneigung nahte, mit herablassender Leutseligkeit empfing,<br />
während er mich ohne Umstände als alten Bekannten und<br />
Mitarbeiter auf dem Gebiete des Vedänta begrüsste. Er<br />
lud uns zum Sitzen auf einer Steinplatte ein, setzte sich<br />
selbst daneben, wobei er seine Blosse geschickt zu be<br />
decken wusste, und fing lustig an, mit mir über die Upanishad's<br />
zu perorieren, während ich das peinliche Gefühl hatte, dass<br />
meine Frau jeden Augenblick nachkommen konnte und ihn
136 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
in diesem Zustande sehen würde. Ich erwähnte wiederholt,<br />
dass auch meine Frau sogleich eintreffen würde, aber er<br />
Hess sich nicht stören, und erst als meine Frau mit Gefolge<br />
hinter den Bäumen erschien, Hess er sich ein kleines<br />
Lümpchen reichen, und so war er auch für diesen Besuch<br />
hinreichend gerüstet. Der Mahäräja verabschiedete sich,<br />
Bhäskaränanda Hess sich die Druckbogen einer von ihm<br />
unternommenen und seitdem auch erschienenen Ausgabe<br />
der Upanishad's reichen, und so fehlte es nicht an Stoff<br />
für die Unterhaltung.. Im weiteren Verlaufe Hess er eine<br />
Frucht bringen, zerlegte sie und bestand darauf, die ein<br />
zelnen Stückchen mir und meiner Frau aus seinen braunen<br />
Händen direkt in den Mund gelangen zu lassen. Beim<br />
Abschiede schenkte er uns eine Mangofrucht, die ein Ver<br />
ehrer ihm aus dem fernen Süden mitgebracht hatte, wo<br />
alles früher reif ist als in dem nördlichen Indien. Obwohl<br />
nämlich dieser Heilige das Gelübde völliger Besitzlosigkeit<br />
befolgte und ihm zum guten Teile die Verehrung verdankte,<br />
mit der die Menge zu ihm aufblickte, obwohl er schlechter<br />
dings nichts auf der Welt sein eigen nannte, so fehlte es<br />
ihm doch keineswegs an dem Notwendigen. Da sein Ge<br />
lübde völliges Nackendgehen erforderte, und dieses in den<br />
Strassen der Stadt polizeilich untersagt ist, so hielt er sich<br />
in einem grossen und schönen Garten auf, den ihm irgend<br />
ein Verehrer zur Verfügung gestellt hatte. Hier wandelte<br />
er zwischen schattigen Bäumen, verfasste seine Werke und<br />
empfing die Besuche seiner. Verehrer. Viele derselben<br />
schickten ihm regelmässig Essen, andere sahen es als eine<br />
besondere Gnade an, ihn bedienen zu dürfen. Als ich ihn<br />
ein anderes Mal mit meiner Frau und Herrn und Frau Aus<br />
dem Winkel, einem jungen Dresdener Ehepaare, besuchte,<br />
führte er uns überall umher, nannte die beiden Damen<br />
seine Mütter und war in rührender Weise bemüht, ihnen<br />
beim Herabsteigen der steinernen Treppe behülflich zu sein,
Ein Asketenheim. Das Sanscrit College. 137<br />
obgleich er mit seinen nackten Füssen und Gliedern viel<br />
mehr exponiert war als wir anderen. Ich fragte ihn, wo<br />
er schliefe? Er zeigte uns einen kleinen stallartigen Raum,<br />
dessen Boden mit Stroh bedeckt war. Hier schlief er<br />
ohne weitere Unterlage und ohne Decken im Winter wie<br />
im Sommer. Dann führte er uns in einen tiefer gelegenen<br />
Schuppen, wo ein Bildhauer beschäftigt war, eine sitzende<br />
Kolossalstatue unseres Heiligen für einen seiner Verehrer<br />
in Marmor auszuführen. Der Bildhauer hatte als Vorübung<br />
ein paar Miniaturstatuetten in Stein geschnitten; ich kaufte<br />
ihm eine derselben ab, welche Bhäskaränandas Gestalt und<br />
Gesichtszüge ganz richtig wiedergibt, und bin froh, dieses<br />
Unicum noch heute zu besitzen.<br />
Mit Ungeduld erwartete ich den 4. Januar 1893 als den<br />
Tag, an welchem nach den Weihnachtsferien die Vorlesungen<br />
an der Universität wieder beginnen sollten. Von nun an<br />
besuchte ich täglich von 7-—9 Uhr morgens die Vorlesungen<br />
des Sanscrit College in der Universität. Es ist dies eine<br />
Abteilung derselben, in welcher für die Eingeborenen die<br />
verschiedenen Wissenschaften in alter Weise auf Grund der<br />
klassischen Sanskritlehrbücher vorgetragen werden. Die Vor<br />
tragssprache war, soweit ich die Vorlesungen besucht habe,<br />
stets Sanskrit. Hier hörte ich mit grossem Genüsse die<br />
Vorträge der Professoren Gangädhara über Grammatik und<br />
Literatur, Sudhäkara über Astronomie, Rämamigra über<br />
Philosophie und andere mehr. Die Räume der Universität<br />
sind gross und hoch, von Hallen umgeben und in einem<br />
Garten liegend. Alle Türen stehen während des Unterrichts<br />
offen. Zwei bis drei Professoren lehren oft gleichzeitig in<br />
demselben Räume, wo jeder mit seinem Häuflein von Schülern<br />
eine Ecke einnimmt. Wie bei uns am Eingang der Auditorien<br />
eine Reihe von Hüten hängt, so sieht man in Indien vor<br />
jedem Auditorium eine Sammlung von Schuhen, denn Pro-
138 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
fessoren wie Studenten behalten während der Vorlesung ihre<br />
Turbane auf, ziehen hingegen die Schuhe aus und finden es<br />
sehr wunderlich, dass der Europäer die Kopfbedeckung, die<br />
Zierde des Mannes, ablegt, wenn er ins Zimmer tritt, wo es<br />
doch kühler ist als draussen, hingegen die vom Gehen auf<br />
der Strasse bestaubten Schuhe anbehält. Wie sollte man<br />
aber auch in Schuhen bleiben können, ohne den Boden des<br />
Zimmers und die eigenen Kleider beim Sitzen mit unter<br />
geschlagenen Beinen zu beschmutzen? Denn von Stühlen,<br />
Bänken oder Tischen ist ja keine Rede; der Professor wie<br />
die Studenten ihm gegenüber sitzen mit untergeschlagenen<br />
Beinen auf dem Boden. Wenn nachzuschreiben ist, so tun<br />
sie dies auf der flachen Hand und weisen eine Unterlage,<br />
wenn man sie ihnen anbietet, als unbequem zurück. Die<br />
Pünktlichkeit wird nicht sehr streng beobachtet. Manche<br />
kommen nach Beginn der Vorlesung, andere verlassen sie<br />
vor dem Schlüsse, indem sie geräuschlos eintreten und sich<br />
zu den Füssen des Lehrers niederlassen und ebenso sich<br />
wieder entfernen. Mehr als ein halbes Dutzend waren selten<br />
um einen Lehrer versammelt. Am Schlüsse der Vorlesung<br />
spricht der Lehrer das Wort alam, „genug", manchmal<br />
kommen ihm auch die Schüler zuvor mit dem Ruf alam.<br />
Während im allgemeinen auch die Universität oder viel<br />
mehr das College (denn university bedeutet in Indien nur<br />
eine examinierende, nicht eine lehrende Korporation) zu<br />
Benares einen englischen Charakter trägt, so ist das einen<br />
Teil derselben bildende Sanscrit College ganz national indisch<br />
geblieben. Die verschiedenen Wissenschaften, Grammatik und<br />
Literatur, Rechtslehre, Philosophie, ja sogar die Astronomie<br />
und die Medizin werden hier auf Grund der alten, ein<br />
heimischen Lehrbücher vorgetragen. Die völlige Abhängig<br />
keit vom indischen Altertum, die Lösung jeder Streitfrage<br />
durch Zurückgehen auf die antiken Autoritäten und Dis<br />
kussionen ihrer Aussprüche erinnert gar sehr an die Lehr-
Lehrweise im Sanscrit College. Mittelalterlicher Standpunkt. 139<br />
weise, wie sie in Europa während des Mittelalters üblich<br />
war; und so ist ganz mittelalterlich auch das Festhalten an<br />
allerlei Aberglauben, welcher auch den Vorstellungskreis ge<br />
lehrter und scharfsinniger Männer in wunderlicher Weise<br />
einschränkt und beherrscht. Die Erde steht still, und die<br />
Sonne mit allen Sternen dreht sich um die Erde; die<br />
Schlangen, welche mitunter in dem alten Mauerwerke be<br />
wohnter Häuser ihre Schlupfwinkel haben, gelten für Ver<br />
körperungen von Seelen der Vorfahren; das Sterben in Be<br />
nares hat unmittelbaren Eingang in die Erlösung zur Folge;<br />
diese und andere abergläubische Vorstellungen kann man<br />
mitunter bei den gelehrtesten Pandits antreffen. So sehr<br />
daher auch die Arbeiten der indischen Gelehrten der Be<br />
richtigung durch die europäische Wissenschaft bedürfen, so<br />
wenig kann ein Europäer jemals jene wunderbare Beherrschung<br />
des Sanskrit erreichen, welche bei den indischen Gelehrten<br />
etwas ganz Gewöhnliches ist. Sie sprechen das Sanskrit<br />
so geläufig, als hätten sie nie etwas anderes gesprochen,<br />
und sie lesen die Texte, welche sie interpretieren, so schnell,<br />
dass man kaum mit den Augen zu folgen vermag. Gangä-<br />
dhara erklärte in einer Sitzung von zwei Stunden einen<br />
ganzen Akt des Dramas Mälatimädhavam; auf meine Frage,<br />
ob es auch Texte gebe, die er nicht beim ersten Lesen ver<br />
stehe, erwiderte er, dass ihm dies nur selten vorkomme. Der<br />
Astronom Sudhäkara entwickelte die schwierigsten mathe<br />
matisch-astronomischen Vorstellungen mit Hülfe höchst<br />
primitiver Instrumente in beredtem Sanskrit, und Rämamigra<br />
interpretierte die Sänkhya-kärikä nebst dem Kommentare des<br />
Väcaspatimigra, indem er dabei kaum ins Buch blickte; er<br />
schien nicht nur die Kärikä sondern auch den ganzen weit<br />
läufigen Kommentar so ziemlich auswendig zu wissen. „Das<br />
Sanskrit", sagte er zu mir, „ist für mich wie meine Mutter<br />
sprache." Gegen die Geläufigkeit, mit der er es sprach,<br />
stach sehr ab sein unbeholfenes Englisch, mit welchem er
140 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
mir gegenüber mit Vorliebe kokettierte, sodass ich ihn bei<br />
unseren zahlreichen Disputationen immer wieder zum Sanskrit<br />
zurückholen musste. Den Inhalt seiner Philosophie bildete<br />
freilich nur der spätere zum Säiikhyam entartete Vedänta,<br />
nicht die reine Lehre der älteren Upanishad's und ihrer<br />
Wiedererneuerung durch (Jankara. Eine Vorlesung wurde<br />
zur Besprechung dieser Fragen anberaumt, wobei es mir be<br />
greiflicherweise nicht gelang, ihn von seinem aus Rämänuja<br />
geschöpften und eingewurzelten Realismus zu bekehren. Als<br />
ich von dieser Vorlesung nach Hause ging, schloss sich mir<br />
einer der anwesenden Schüler an und bekannte, dass er<br />
meiner Anschauungsweise viel näher stehe, als der seines<br />
Lehrers Rämamicra.<br />
An einem. Sonntag Nachmittag sass ich mit Rämamicra<br />
unter den Rosenpflanzungen des Kirchhofs gegenüber unserem<br />
Hotel im philosophischen Gespräch über die Natur der<br />
Seele, welche er sich als eine im Körper wohnende immaterielle<br />
Substanz, etwa in der Weise des Cartesius, vorstellte, und<br />
ich hatte ihn gerade vor das Dilemma gestellt, dass seine<br />
Seele, entweder pratighäta (Repulsionskraft) besitze und<br />
dann nicht durch die Schädelwand und andere materielle<br />
Hindernisse durchgehen könne, oder nicht pratighäta besitze,<br />
und dann weder die Glieder des Leibes zu bewegen noch<br />
von einem Orte zum anderen zu wandern imstande sein<br />
würde, — da gesellte sich zu uns ein vornehm gekleideter<br />
junger Inder, der unser Gespräch mit lebhaftem Interesse<br />
verfolgte. Sein Name war Govind Das, und er bewohnte<br />
ein elegantes Haus nahe bei Durgakund, oberhalb der Stadt.<br />
Wie alle besser situierten Hindus hatte er Wagen und Pferd,<br />
mit denen er uns öfter zu.Spazierfahrten abholte. Er sprach<br />
nicht Sanskrit, aber um so besser Englisch, und bezeichnete<br />
sich selbst als a busy idler, „einen geschäftigen Müssig-<br />
gänger", d. h. als einen Mann, der seine materielle Unab<br />
hängigkeit zu literarischer Tätigkeit benutzte.
Professor Rämamicra. Govind Das. Die Theosophisten. 141<br />
Govind Das führte uns in sein von einem schönen<br />
Garten umgebenes Haus ein. In einem der Zimmer waren<br />
die Hochzeitsgeschenke ausgestellt, welche eine Neuvermählte<br />
aus der Familie erhalten hatte, und wir bemerkten mit Ver<br />
wunderung anstatt der bei uns üblichen Statuen, Uhren,<br />
Lampen und Prunkstücke eine Sammlung von Säcken mit<br />
mancherlei Getreide, Schalen mit Früchten und ähnlichen<br />
Naturgaben, die zum Teil wohl eine symbolische Bedeutung<br />
haben mochten. Weiter führte er uns in seine Bibliothek;<br />
rings an den Wänden standen die Bücher, während fast der<br />
ganze Innenraum des Zimmers von einem sehr langen und<br />
breiten Arbeitstisch nach indischer Weise eingenommen<br />
wurde, nicht um sich daran zu setzen, sondern um darauf<br />
zu sitzen, da er nur um einen Fuss höher als der Boden<br />
und mit grauer Leinwand überzogen ist. Der Arbeitende<br />
sitzt mit untergeschlagenen Beinen auf der Mitte des Tisches,<br />
dessen grosse Breite und Länge es ihm bequem ermöglicht,<br />
mancherlei Bücher um sich herum aufzustapeln. Wie wir<br />
zur Sommerzeit mitunter in Hemdärmeln bei der Arbeit<br />
sitzen, so macht auch der indische Gelehrte es sich bequem,<br />
indem er das Obergewand bis an den Gürtel herunterstreift,<br />
und so mit völlig nacktem Oberkörper dasitzt. So interessant<br />
dieses alles für uns war, so wenig erbaut war ich von der'<br />
Zusammenstellung dieser Bibliothek. Der Vedänta war zu<br />
meist in seiner spätesten entartetesten Form vertreten, welchem<br />
sich eine grosse Reihe moderner theosophistischer Produkte<br />
anschloss. Denn Freund Govind Das war eifriger Theosophist,<br />
und mit der grössten Ehrfurcht breitete er vor mir mehrere<br />
dicke Bände aus, welche in elegantestem Einbände die<br />
wüsten Phantasien der Madame Blawatski enthielten. Es ist<br />
bedauerlich zu sehen, wie das den Indern einwohnende edle<br />
philosophische Streben durch den überall in Indien grassieren<br />
den Theosophismus in falsche Bahnen gelenkt wird. Das<br />
Haupt dieser Richtung ist gegenwärtig Colonel Oleott in
142 V. Von Peshawar bis Calcutts.<br />
Calcutta. Ich habe ihn dort nicht besucht, traf aber später<br />
zufällig mit ihm zusammen. Als wir nämlich von Calcutta<br />
nach Bombay zurückfuhren, hatten wir in Moghal Sarai, der<br />
Eisenbahnstation, welche am südlichen Ufer des Ganges,<br />
Benares gegenüber, liegt, zehn Minuten Aufenthalt. Ich trat<br />
auf den Perron und blickte zum letzten Abschiede nach dem<br />
so viele schöne Erinnerungen umschliessenden Benares<br />
hinüber, als plötzlich Govind Das zu mir trat, mich mit lebhafter<br />
Freude begrüsste und zugleich anbot, mich mit dem<br />
zufällig anwesenden Colonel Oleott bekannt zu machen.<br />
Wir begrüssten uns wie zwei, die schon längere Zeit von<br />
einander wissen und das Gefühl haben, dass zwischen ihren<br />
Anschauungen wohl schwerlich jemals eine geistige Brücke<br />
sich schlagen lässt. Die Abfahrt meines Zuges erlaubte kein<br />
eingehenderes Gespräch und machte unserer kurzen, reser<br />
vierten, doch nicht unfreundlichen Berührung ein Ende.<br />
Von den übrigen reichen Eindrücken, die unser zwanzig<br />
tägiger Aufenthalt in Benares uns bot, wollen wir nur noch<br />
einiges erwähnen. Eine sehr willkommene Ergänzung unserer<br />
gelehrten Bekanntschaften war Raghunandana Prasäd, ein<br />
Advokat am Gerichtshofe von Benares und zugleich ein Mit<br />
glied der städtischen Verwaltung. Als solchem standen ihm<br />
alle Türen offen, und die Art, wie er uns in Benares herum<br />
führte, war ebenso interessant wie lehrreich. Am frühen<br />
Morgen bestiegen wir mit ihm ein Schiff und Hessen uns<br />
an den fröhlichen Gruppen der Badenden beiderlei Geschlechts<br />
vorbeirudern. Dann gelangten wir durch ein Labyrinth enger<br />
Gässchen zu einer heiligen Stätte, dem Inänakäpa oder<br />
„Brunnen der Erkenntnis", einem wenig einladenden Orte, wo<br />
die zudringliche Bettelei einen fast an Ägypten streifenden Grad<br />
erreicht. Auch können die Hindus es nicht lassen, Blumen<br />
und andere Spenden in den tiefen Ziehbrunnen hinabzuwerfen,<br />
welche dort in Verwesung übergehen und die Luft verpesten.
Colonel Oleott. Rundgsng mit Raghunandana Prasäd. 143<br />
Unser Freund zeigte uns die auf seine Anordnung ange<br />
brachten Vorrichtungen zum Auffangen der hinabgeworfenen<br />
Gegenstände, durch welche dem Unfuge wenigstens teil<br />
weise gesteuert wurde. Von hier führte unser Weg zu den<br />
beiden grossen Minarets, welche Benares als Wahrzeichen<br />
der Stadt überragen. Sie wurden von den übermütigen<br />
mohammedanischen Eroberern als Symbol ihrer Herrschaft<br />
über die heiligste Stadt Indiens aufgerichtet, zum grossen<br />
Verdruss der Hindus, bis sie lernten, sich in das Unabänder<br />
liche zu fügen und die beiden Minarets ihrem Religions<br />
system einzuverleiben, indem sie dieselben für zwei Säulen<br />
des Krishna erklärten. Eines der Minarets ist wegen Bau-<br />
fälligkeit jetzt geschlossen. Das andere bestiegen wir auf<br />
einer im Innern emporführenden Wendeltreppe und genossen<br />
von hier aus eine grossartige Übersicht auf das am Ganges<br />
im Halbkreise sich ausbreitende Benares und die umliegende,<br />
mit Gärten und Landhäusern übersäte Gegend. Weiter wurden<br />
wir von unserem kundigen Freunde durch die ärmeren Stadt<br />
viertel geführt. Wir sahen die Weber bei ihrer Arbeit, welche die<br />
schönsten Webearbeiten auf den primitivsten Webstühlen<br />
hervorbrachten. Wir sahen den Töpfer, wie er, auf dem<br />
Boden kauernd, ein grosses, auf einer Spitze laufendes Rad<br />
in Umschwung versetzte, eine unförmige Tonmasse auf die<br />
Mitte warf und in wenigen Augenblicken daraus ein zier<br />
liches Gefäss verfertigte. Wir nahmen ein solches, welches<br />
an dem daneben brennenden Feuer hart gebrannt war, zum<br />
Andenken mit und besitzen es noch heute. Weiter führte<br />
uns noch unser Weg durch enge Gassen, vorüber an zahl<br />
reichen Tempeln, deren Benares 5000 besitzen soll, und von<br />
denen manche freilich nur die Grösse einer Hundehütte<br />
haben. Gegen Abend besuchten wir ein Hochzeitsfest; die<br />
Ceremonie war vorüber, und die Unterhaltung hatte be<br />
gonnen, um die ganze Nacht durch zu dauern. Sie bestand<br />
darin, dass die männlichen Gäste, es mochten ihrer einige
144 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
hundert sein, in einem grossen Saale auf dem Boden hockten<br />
und den Aufführungen der zu diesem Zwecke gedungenen<br />
Tanzmädchen mit gespannter Aufmerksamkeit lauschten. Es<br />
trat immer nur ein Mädchen auf, mit einem goldgestickten<br />
Gewände bis auf die Füsse bekleidet, welches in eintöniger<br />
Weise Liebeslieder sang und sie mit ebenso eintönigen Be<br />
wegungen der Arme und des Oberkörpers begleitete. Das<br />
Höchste war, dass sie sich gelegentlich um sich selbst herum<br />
drehte; sonst war von Tanzen keine Rede. Wenn sie müde<br />
war, wurde sie durch eine frische Kollegin abgelöst, welche<br />
es auch nicht anders machte. Wir fanden die Produktion<br />
in hohem Masse langweilig, und der Bräutigam, ein Knabe<br />
von fünfzehn Jahren, schien diesen Eindruck zu teilen. Er<br />
war auf seinem Ehrenplatze in der Mitte der Versammlung<br />
friedlich eingeschlafen. Gegen elf Uhr abends verabschiedeten<br />
wir uns und konnten auf dem Heimwege beobachten, wie<br />
auf den Strassen in allen dazu geeigneten Winkeln Obdach<br />
lose ihre Nachtruhe hielten.<br />
Wir können Benares nicht verlassen, ohne noch der<br />
Beziehungen zu gedenken, die wir zu einigen jüngeren Pandits<br />
unterhielten. Ich hatte den Mahäräja gebeten, mir den einen<br />
oder andern seiner Pandits zum Sanskritsprechen zu schicken,<br />
und seitdem fanden sich deren täglich drei bald zusammen,<br />
bald abwechselnd in unserm Hotel ein, um einen grossen<br />
Teil des Nachmittags uns zu widmen. Es waren der fromme<br />
und weichmütige Priyanätha, sein Bruder, der kernige, klare<br />
und feste Pramathanätha und der jüngere und leichter ange<br />
legte Bahuvallabha: Die einzige Möglichkeit mit ihnen zu<br />
verkehren, war in Sanskrit (meine Frau pflegte sich durch<br />
Zeichen und einiges Hindostani mit ihnen zu verständigen),<br />
aber auch dieses Medium ermöglichte es, in Geist und Herz<br />
dieser Männer die interessantesten Blicke zu tun. Priyanätha,<br />
der am regelmässigsten kam, war, obgleich er einige
Seite 144<br />
c<br />
<strong>•</strong>G<br />
o<br />
T3<br />
:cd<br />
E cd<br />
E-<br />
<strong>•</strong>a<br />
cd<br />
'räT<br />
CO
Tanzmädchen. Drei Panditfreunde. 145<br />
Schriftchen über Säiikhyam u. dgl. verfasst hatte, eine treue<br />
gläubige Seele, und gerade an ihm hatte ich Gelegenheit zu<br />
beobachten, dass die indische Religiosität auf das Gemüts<br />
leben ganz ebenso einwirkt, wie bei uns die christliche.<br />
So wehrte er meinen Vorschlag, nach England zu gehen, mit<br />
der Bemerkung ab, dass die Religion es ihm verbiete, und<br />
als ich darauf hinwies, dass er durch das Bestehen der allein<br />
in England ablegbaren Examina zu höheren Stellungen in<br />
seiner Heimat gelangen werde, erwiderte er einfach und<br />
ruhig, dass die ewigen Interessen wichtiger seien, als die<br />
zeitlichen. Auch er teilte den Glauben, dass durch ein<br />
Sterben in Benares ein unmittelbarer Eingang in die Erlösung<br />
gesichert sei, und als ich daran erinnerte, dass nach den<br />
heiligen Schriften erlöst werde, wer die Erkenntnis besitze,<br />
wo er auch immer sterbe, nicht aber, wer sie nicht besitze,<br />
auch wenn er in Benares stürbe, so erteilte er mir die Be<br />
lehrung, dass eben durch eine besondere Gnade des Civa<br />
allen in Benares Sterbenden im Augenblicke des Sterbens<br />
das vollkommene Wissen geschenkt werde. Gelegentlich<br />
streifte unser Gespräch auch die politische Lage des Landes,<br />
und hier trat mir ein tiefer und fast hoffnungsloser Schmerz<br />
entgegen, den die geistigen und zartfühlenden Inder darüber<br />
empfinden, dass sie unter der Fremdherrschaft der so ganz<br />
heterogenen Engländer stehen.<br />
Als ein noch grösseres Zeichen des Vertrauens mussten<br />
wir es ansehen, dass Priyanätha eines Tages unserer Bitte<br />
willfahrte und mich und meine Frau in sein Haus und seine<br />
Familie einführte, natürlich mit dem Vorbehalte, dass nur<br />
meine Frau zu den Damen des Hauses geführt wurde, mit<br />
denen sie eine kümmerliche Unterhaltung in Hindostani zu<br />
führen suchte. Die Wohnung des Pandit lag im oberen<br />
Stockwerke eines jener grossen Mietshäuser,-welche einen<br />
engen Hofraum durch rings an den Stockwerken herum<br />
gehende hölzerne Veranden umschliessen. Die Ausstattung<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 10
146 V. Von Peshawsr bis Cslcutts.<br />
der Wohnung war äusserst bescheiden; die Möbel erinnerten<br />
an diejenigen, welche man im Lutherzimmer auf der Wartburg<br />
findet, das Ganze machte einen durchaus mittelalterlichen<br />
Eindruck. Es war dies am letzten Abend, den wir in Benares<br />
verbrachten, und wir beschlossen ihn, indem wir ein den<br />
Pandits oder vielleicht ihrem Herrn, dem Mahäräja, gehörendes<br />
Boot bestiegen und uns über den Ganges rudern Hessen.<br />
Von den Feldern aus, die das gegenüberliegende Ufer ein<br />
nehmen, genossen wir den vollen Anblick der heiligen Stadt<br />
mit ihren beiden Minarets, ihren treppenartigen Aufstiegen<br />
vom Ganges aus und den zahlreichen Palästen und<br />
Tempeln, welche dieselben krönen.<br />
Am Dienstag dem 17. Januar 1893 fuhren wir, von den<br />
drei Pandits begleitet, zum Bahnhofe, wo ich in einem letzten<br />
Gespräche mit ihnen noch die Geschmeidigkeit der Sanskrit<br />
sprache bewunderte, welche es möglich macht, über alle<br />
Errungenschaften der modernen Kultur, wie Eisenbahn,<br />
Lokomotive u. dgl. sich in Sanskrit auszudrücken.<br />
Eine Eisenbahnfahrt von wenigen Stunden führte uns<br />
nach Bankipore, welches, am Ganges in unmittelbarer Nähe<br />
des alten Pätaliputra jetzt Patna gelegen, den Knotenpunkt<br />
mehrerer Eisenbahnlinien bildet. Wir hatten hier eine<br />
Empfehlung an Mahega Näräyana, den Redakteur der Wochen<br />
schrift „the Behar Times". Wir fanden ihn nach längerem<br />
Suchen, und er widmete sich uns in liebenswürdigster Weise,<br />
gab mancherlei Aufschlüsse über Stadt und Gegend und<br />
führte uns auf meinen Wunsch auf lehmigem Landwege an<br />
das Ufer des Ganges, welcher zwischen Abhängen, die mit<br />
Kornfeldern bedeckt waren, seine gelben Fluten dahinwälzte.<br />
Mit Staunen nahmen wir die Spuren der Verwüstungen<br />
wahr, welche der Fluss anrichtet, wenn er alljährlich sein<br />
Bett verändert und dadurch zu einer neuen Verteilung der<br />
Äcker nötigt. Gegen Abend verliess uns Mahega Näräyana.<br />
Was wir dann weiter vornahmen, und wo wir für die Nacht
Abschied von Benares. Bankipore. Fahrt nach Gayä. 147<br />
unterkamen, darauf kann ich mich merkwürdigerweise gar nicht<br />
mehr besinnen, während doch sonst alle Einzelheiten der<br />
indischen Reise mir noch heute nach zehn Jahren so ziemlich<br />
gegenwärtig sind. Vielleicht war es die Spannung, mit der<br />
wir dem nächsten Tag entgegensahen, welche die Auf<br />
merksamkeit auf die Gegenwart abschwächte. Denn am<br />
andern Morgen lösten wir unsere Billetts für eine kleine<br />
Sekundärbahn, welche nach Süden in drei Stunden nach<br />
Gayä und zu den heiligen Stätten des Buddhismus führt.<br />
Die Fahrt führte durch Niederungen, häufig vorüber an<br />
Palmenwäldern, an deren jungen nur fünf Meter hohen<br />
Stämmen oben unterhalb der Krone Töpfe angebunden<br />
waren, in welche aus einem oberhalb gemachten Einschnitte<br />
der Palmsaft (Täli, heute Toddy genannt) rieselt, mit dem<br />
wir in Calcutta noch nähere Bekanntschaft machen sollten.<br />
An den kleinen Stationen der Sekundärbahn bemerkten wir<br />
hinter einem absperrenden Gitter viel bettelndes Volk.<br />
Ein Mann steht mir noch vor Augen, welcher, nur mit einem<br />
Schurz bekleidet, auf verkrümmten und gelähmten Glied<br />
massen herankroch und seine abgezehrten Arme flehend<br />
durch das Gitter streckte. Es war vielleicht der elendeste<br />
Mensch, den ich je gesehen habe. Er erinnerte an die Er<br />
scheinungen, welche den Buddha aus einem Fürstensohne<br />
zum heimatlosen Bettler machten.<br />
Gayä ist ein kleines Landstädtchen, welches im fernen<br />
Indien und unter den entsprechenden Änderungen denselben<br />
Familientypus wie so viele kleine Städte in Deutschland<br />
und im übrigen Europa aufweist. Ein Hotel ist nicht vor<br />
handen, dafür besteht, wie überall, wo ein solches fehlt, ein<br />
von der Regierung unterhaltenes Logierhaus, Dak Bungalow,<br />
wo jeder Ankommende wenigstens für eine Nacht ein Zimmer<br />
mit Bett für eine Rupie beanspruchen kann. In der Regel<br />
ist auch ein Koch vorhanden, welcher auf Bestellung nach<br />
Vorschrift für 11ji Rupie ein Tiffin (Luncheon), für 2 Rupien<br />
10*
148 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
ein Dinner mit zwei Fleischgängen zu liefern hat. Wir be<br />
stellten ein solches auf den Abend, belegten ein Zimmer<br />
und sassen bald darauf in einer der jämmerlichsten Land<br />
kutschen, um uns auf breitem, gutem Wege durch Felder<br />
und Waldungen nach dem 1 Va Stunden entfernten Buddha-<br />
Gayä haudern zu lassen. Der Ort besteht aus wenigen an<br />
der Strasse liegenden Häusern; weiter liegt auf der linken<br />
Seite der Landstrasse ein Kloster brahmanischer Sädhu's,<br />
während auf der rechten Seite in einer von der Aufhöhung<br />
des Bodens durch den Kulturschutt der Jahrhunderte frei<br />
gehaltenen Niederung der grosse Buddhatempel liegt,<br />
sicherlich an derselben Stelle (denn Buddha lebte lange<br />
genug, um sie noch oft seinen zahlreichen Schülern zeigen<br />
zu können), wo der Erhabene in jener grossen Nacht unter<br />
dem Feigenbaume sass, als ihm die Buddhaschaft zu teil<br />
wurde. An der Stelle, wo er sass, steht jetzt im Innern<br />
des Tempels eine vergoldete Kolossalstatue des Buddha,<br />
mit hinterindischem Typus, und auch heute sitzt er, nur<br />
durch die hintere Tempelwand davon getrennt, unter einem<br />
Feigenbaum, der vielleicht ein Abkömmling des ursprüng<br />
lichen ist. Auf Treppenstufen steigt man ein Stockwerk<br />
hoch zu einer ringsherumlaufenden Veranda hinauf, von<br />
welcher aus man einen Überblick über die zahlreichen<br />
ringsum zerstreuten Denkmäler hat, welche die Buddhisten<br />
der verschiedensten Länder dem Siegreichvollendeten an<br />
dieser für sie heiligsten Stätte der Welt geweiht haben.<br />
Alles atmet hier grosse Erinnerungen, nur dass in Buddha-<br />
Gayä so wenig wie im ganzen übrigen Indien auch nur<br />
ein einziger Buddhist aufzutreiben war, mit dem wir unsere<br />
Empfindungen hätten austauschen können. Einen Ersatz<br />
suchten wir vergebens nach vollendeter Besichtigung in dem<br />
erwähnten Kloster der Brahmanenmönche. Wir Hessen uns<br />
melden; man führte uns durch einen weiten Hofraum, in<br />
dem die Mönche einen schwunghaften Handel mit Korn
Buddha-Gayä. Ein Sädhukloster. 149<br />
und Öl betrieben. Auf einer Treppe gelangten wir zu einer<br />
hochgelegenen, breiten und langen, in Stufenform ansteigenden<br />
Terrasse, auf der alsbald der Prior an der Spitze der<br />
Klosterbrüder uns feierlich empfing, worauf die ganze Ge<br />
sellschaft, es mochten dreissig Personen sein, im Halbkreise<br />
um uns her sich lagerte, in der Mitte natürlich der Prior,<br />
und zu seinen Füssen hockend ein junger Mensch, dessen<br />
Gegenwart allerdings sehr notwendig war; denn es zeigte<br />
sich bald, dass er der einzige in der ganzen Gesellschaft<br />
war, der eine Unterhaltung in Sanskrit zu führen vermochte.<br />
Der Prior, an den natürlich meine Worte sich richteten,<br />
hörte sie an, nickte, lächelte, brachte das eine oder andere<br />
Wort hervor, aber die Beantwortung überliess er dem<br />
Jüngling zu seinen Füssen. Dieser begleitete uns auch nach<br />
beendigter Audienz und zeigte uns die Klostergebäude. Dann<br />
durchschritten wir ein Feld und sahen in der Ferne die<br />
Hügelkette, an welche Räjagriha sich lehnt. Ein steiniger,<br />
lehmiger Boden, den wir betreten hatten, schien die Nähe eines<br />
Flussbettes zu verraten, und so fragte ich unseren Begleiter<br />
nach dem in buddhistischen Schriften so viel genannten<br />
Flüsschen Nairanjanä, worauf der junge Mann antwortete:<br />
„Sie befinden sich eben mitten darin." Wie so viele kleine<br />
Flüsschen Indiens war auch die Nairanjanä schon im Januar<br />
gänzlich ohne Wasser.<br />
Der herannahende Abend mahnte zum Aufbruch. Wir<br />
nahmen Abschied von dem geweihten Boden Büddha-Gayä's,<br />
bestiegen unsere elende Kutsche und rollten auf Gayä zu.<br />
So unerträglich langsam und holpernd war die Fahrt, dass<br />
ich es vorzog, in der Abendkühle den Weg zu Fuss zu<br />
machen, immer ein Stück vorauslaufend und dann wieder<br />
wartend, bis der Wagen mit meiner Frau nachkam. Mit<br />
einiger Furcht vor Schlangen, die auf dem Wege lagern<br />
mochten, genoss ich doch, umgeben von herrlichen Wal<br />
dungen, den indischen Abend, wo die Sonne nicht mehr
150 V. Von Peshawar bis Calcutta.<br />
ihre glühenden Pfeile entsendet und ein sanfter Windhauch<br />
mit Wohlgerüchen uns umschmeichelt. Weniger harmonisch<br />
waren die Eindrücke in Gayä. Der Kutscher, wiewohl durch<br />
aus hinreichend bezahlt, zeigte sich unzufrieden und schimpfte<br />
noch lange Zeit aus der Ferne über den weiten Platz weg,<br />
an dem unser Logierhaus lag. In diesem war das Dinner<br />
bereitet. Die zwei vorschriftsmässigen Fleischgänge bestanden<br />
darin, dass man uns als ersten Gang ein halbes Huhn und<br />
als zweiten die andere Hälfte desselben vorsetzte, beide reich<br />
lich zähe, weil das Tier offenbar erst eben geschlachtet war.<br />
Am anderen Morgen benutzte ich die Zeit vor Abgang<br />
des Zuges, um einen grösseren Tempel oberhalb der Stadt<br />
zu besuchen; da ich allein kam, so sah man mich mit Miss<br />
trauen an, die Unterhaltungen, die ich anknüpfte, wollten<br />
nicht recht in Fluss kommen, und als ich in der Nähe einer<br />
Seitennische stehen blieb, um eine dort vor sich gehende<br />
Ceremonie zu beobachten, wurde ich sogar weggewiesen<br />
mit der Bemerkung, dass hier ein Cräddham (Totenopfer)<br />
gebracht werde, bei dem die Gegenwart eines Fremden un<br />
zulässig sei.<br />
Am Nachmittag langten wir wieder in Bankipore an,<br />
leider ohne unseren Freund von vorgestern nochmals zu<br />
sehen, wie er versprochen hatte, da ihn ein unvorhergesehenes<br />
Geschäft in Anspruch nahm. So lösten wir unsere Billetts<br />
nach Calcutta und bestiegen gegen Abend den dort hin<br />
führenden Nachtschnellzug. Ausnahmsweise war auch die<br />
erste Klasse stark besetzt, und schon machten wir uns darauf<br />
gefasst, eine unruhige Nacht zu verbringen. Da hörte ich,<br />
dass unser Zug auf der direkten Linie Calcutta schon<br />
morgens um 5 Uhr erreichen werde, während von einer der<br />
nächsten Stationen ein Zug, auf einer Loop Line nördlich im<br />
Bogen herumlaufend, um 10 Uhr morgens in Calcutta ein<br />
treffe. Schnell entschlossen stiegen wir aus und verbrachten<br />
in dem anderen Zuge in einem Coupe erster Klasse, welches
Gayä. Bankipore. Candrsnsgaram. 151<br />
wir allein hatten, eine gute Nacht. Am Morgen waren wir<br />
in Candranagaram, welches neben Pondidierry im Süden die<br />
einzige Stadt Indiens ist, die noch den Franzosen gehört<br />
und wohl nur aus Eitelkeit behalten wird, da ein Nutzen<br />
aus dem Besitze dieser Enklave wohl schwerlich erspriesst.<br />
Hier sahen wir auch die ersten bengalischen Pandits, grosse<br />
schöne Gestalten mit üppigem schwarzem Haar und einem<br />
Gewand, dessen Zipfel vorn wie eine Art Schurz bis auf die<br />
Füsse niederhängt. Trotz der Glut der bengalischen Sonne<br />
gehen sie ganz ohne Kopfbedeckung. Eine gewisse Eitel<br />
keit spricht aus ihrer Kleidung, ihren Reden, ihrem Gebaren;<br />
es ist nicht unzutreffend, wenn man mir die Bengalen als<br />
die Franzosen Indiens schilderte.<br />
r r ^ o
Sechstes Kapitel.<br />
Calcutta und der Himälaya.<br />
/^egen elf Uhr lief unser Zug in den Bahnhof von Calcutta<br />
ein. Er liegt auf der andern Seite des Hughli, eines<br />
breiten Armes des Ganges, über welchen eine lange Dreh<br />
brücke nach der Stadt führt. Sie war gerade ausgefahren,<br />
aber die Zeit des Wartens war uns nicht zu lang; ganz in<br />
unserer Nähe konnten wir die Gruppen der badenden<br />
Männlein und Weiblein beobachten, während am anderen<br />
Ufer am Flusse entlang eine Anzahl sogenannter Asketen<br />
ihre Lagerstätte hatte; dies sind, wie wir schon in einem<br />
früheren Zusammenhange erwähnten, allerdings wohl viel<br />
mehr Bettler, welche eine billige Askese zur Schau tragen,<br />
um dem Volke zu imponieren. Jeder treibt seine Spezialität;<br />
der eine reckt die Arme beständig in die Höhe, ein anderer<br />
hat sich ein Bein hochgebunden, ein dritter Hegt auf einem<br />
Bette von hölzernen Nägeln. Jeder ist von Zuschauern um<br />
standen, wie bei uns die arbeitenden Kesselflicker; hin und<br />
wieder wird ihnen eine Kupfermünze zugeworfen, und dies<br />
scheint auch der eigentliche Zweck bei der Sache zu sein.<br />
Es war Mittag geworden, als wir endlich die Brücke<br />
überschritten hatten und nach einigem Suchen in einem<br />
der Boarding Houses der Mrs. Monk Unterkommen fanden.<br />
Die Pension kostet hier 7 Rupien, also noch etwas mehr als<br />
in dem Great Eastern Hotel, soll aber auch besser als die
Seite 152.<br />
cd<br />
U<br />
b.<br />
tu<br />
XI M<br />
:3 cU<br />
J3 M<br />
cd<br />
<strong>•</strong>ö<br />
cd<br />
CO
Calcutta. Jung-England in Indien. 153<br />
dortige sein. Das Essen war in der Tat recht gut, aber die<br />
Gesellschaft war die unbehaglichste, welche wir in Indien<br />
gefunden haben. Sie bestand überwiegend aus jungen<br />
Männern, welche den Sport, und jungen Weibern, welche<br />
den Putz als eigentliches Endziel des Daseins zu betrachten<br />
schienen. Eine gehaltvolle Unterhaltung war nicht in Gang<br />
zu bringen. Das Gespräch drehte sich meistens um Cricket<br />
und Croquet, um Jagd und Tennis-Spielen; daneben war<br />
es das Hauptthema dieser vom Tropenkoller ergriffenen<br />
jungen Engländer, in allen Tonarten auf die Eingeborenen<br />
zu schimpfen. Ein Gespräch der Art will ich mit historischer<br />
Treue referieren. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob ein<br />
englischer Klub die Herausforderung (challenge) zum Wett<br />
kampfe (match) annehmen müsse, wenn dieselbe von einem<br />
Native Club ausgehe. Die einen verneinten die Frage; die<br />
Eingeborenen ständen zu tief unter dem Engländer, als dass<br />
dieser sich auf irgend welche Wettspiele mit ihnen einlassen<br />
könne. Von anderer Seite wurde das Prinzip vertreten, dass<br />
jede Herausforderung angenommen werden müsse, selbst die<br />
der Eingeborenen, denn, so fügte ein Redner bezeichnender<br />
Weise hinzu: „wenn der Schornsteinfegerklub in London<br />
uns eine Herausforderung zukommen lässt, so darf auch<br />
diese nicht abgelehnt werden." Wie die Gespräche, so<br />
waren auch die Manieren dieser jungen Kaufleute sehr selt<br />
same. So lange die Damen zugegen waren, war das Be<br />
nehmen ein sehr respektvolles. Standen diese nach dem<br />
Essen auf, um hinaus zu gehen, so sprang die ganze Gesell<br />
schaft in die Höhe, als käme das Venerabile, und blieben<br />
stehen, bis die letzte Dame den Saal verlassen hatte, auch<br />
dann, wenn irgend ein Gänschen auf dem Wege zur Tür<br />
im Vorbeigehen noch eine kleine Unterhaltung anzuknüpfen<br />
für gut fand. Sobald die Damen das Lokal verlassen hatten,<br />
entschädigte sich Jung-England für den erlittenen Zwang;<br />
man rekelte sich und flegelte sich in aller Weise, man steckte
154 VI. Calcutts und der Himälsya.<br />
nicht Cigarren, sondern die kurzen qualmenden Stummel<br />
pfeifen an, und einer meiner Nachbarn ging so weit, dass<br />
er, auf seinem Stuhle sitzend und sich nach hinten wiegend,<br />
auf den Tisch, von dem wir soeben gegessen hatten, beide<br />
Beine legte. Im übrigen fanden und suchten wir auch keine<br />
Beziehung zu dieser Tischgesellschaft, da unser ganzer Tag<br />
von Eindrücken anderer Art ausgefüllt wurde.<br />
Da war zunächst die Stadt selbst, die grösste in Indien,<br />
welche, im Gegensatze zu so vielen anderen von uns be<br />
suchten Städten, keinen rein indischen, sondern einen halb<br />
europäischen Charakter trägt. Alles, die Anlage der Strassen<br />
und Plätze, die Namen und vieles andere erinnert an London;<br />
und so sind auch die Bewohner mehr als anderswo von<br />
europäischer Kultur angeweht und übertüncht. Namentlich<br />
ist dies auf dem Gebiete der Religion bemerkbar. Wie im<br />
westlichen Indien der Äryasamäj, worüber wir bei Lahore<br />
sprachen, so herrscht hier der Brahmasamäj, eine religiöse<br />
Gemeinschaft, welche ebenso wie jener auf das Altertum<br />
zurückzugehen bemüht ist, dabei aber, im Gegensatz zu dem<br />
rein nationalen Äryasamäj, vieles aus dem biblischen Vor-<br />
stellungskreise und dem christlichen Ritus herübergenommen<br />
hat. Unsere Freunde führten uns an einem der ersten<br />
Abende zu einer gottesdienstlichen Feier; sie fand in einem<br />
grossen Gebäude statt, welches schon durch die Anlage mit<br />
Kanzel, Gallerien usw. an eine christliche Kirche erinnerte.<br />
Gedruckte Blätter wurden verteilt und abgesungen. Sie<br />
enthielten Verse aus dem Rigveda, aber gerade solche,<br />
namentlich aus den Hymnen an Varuna, welche an die<br />
biblischen Busspsalmen anklingen. Dann wurde eine richtige<br />
Predigt gehalten über einen vedischen Text, und so merkte<br />
man überall den europäischen Einfluss. Dasselbe gilt vom<br />
Familienleben. Unsere nächsten Freunde, der Advokat<br />
P. L. Roy und der Professor der Philosophie am Sanscrit<br />
College P. K. Ray leben mit ihren Familien ganz in euro-
Der Brahmasamäj. P. L. Roy und P. K. Ray. 155<br />
päischer Weise. Sie kleiden sich europäisch; sie sitzen bei<br />
Tisch auf Stühlen, sie essen Fleisch und trinken Wein und<br />
sind dabei von höchster Toleranz. Unsere liebenswürdige<br />
Freundin Mrs. Roy gehörte der brahmanischen Religion in<br />
der Form des Brahmasamäj an. Ihre unverheiratete Schwester<br />
Miss Cakravartt war in England in einer Pension erzogen<br />
und dort in der Stille zu einer Protestantin umgemodelt<br />
worden, und eine dritte Schwester, die ich nur aus Erzählungen<br />
kenne, war in Calcutta zum grossen Schmerz der Familie<br />
von den katholischen Patres umgarnt und als Braut des<br />
Himmels in ein Kloster gesteckt worden, denn sie hatte ein<br />
grosses Vermögen. Trotz dieser Polyphonie der religiösen<br />
Bekenntnisse herrschte in der Familie die schönste Harmonie<br />
und wurde auch nicht gestört durch einen jungen moham<br />
medanischen Gentleman, der als Freund der Familie öfter<br />
erschien und freilich durch sein etwas rohes und ungestümes<br />
Wesen von dem sanften, feinfühlenden, intellektuellen Mr.<br />
Roy sehr merklich abstach. Zum Teil mag daran wohl die<br />
Religion schuld haben, welche ja nicht nur dem Individuum,<br />
sondern auf dem Wege der Vererbung ganzen Geschlechtern<br />
ihren Stempel aufdrückt.<br />
Ebenso frei wie die Familie P. L. Roy's stand auch ein<br />
zweiter Freund mit Frau und Kindern den religiösen Vor<br />
urteilen gegenüber. Es war dies der Professor der Philosophie<br />
am Sanscrit College P. K. Ray. Er lud uns zu Tisch ein;<br />
dann hatte ich mit ihm in seinem Studierzimmer, von wo<br />
die Frauen ab und zu vergebens versuchten, uns zurück<br />
zuholen, eine lange Unterredung über Piaton, Kant und<br />
Schopenhauer, über die er gut orientiert war und viele<br />
Fragen zu stellen wusste. Für den weiteren Nachmittag<br />
hatte er uns zu Ehren eine Versammlung von etwa zwanzig<br />
Pandits anberaumt, unter denen sich mehrere hervorragende<br />
Professoren des Calcuttaer Sanscrit College befanden. Ich<br />
besuchte in den nächsten Tagen fleissig ihre Vorlesungen.
156 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
Drei Männer sind mir noch in bester Erinnerung, wenn mir<br />
auch ihre Namen entfallen sind, der Principal, ein wohl<br />
beleibter, stattlicher Mann von vornehmer Haltung, welcher<br />
nach einem antiken Sanskrit-Kompendium die Logik vortrug,<br />
ein jüngerer Professor, der mit grossem Ernst und Eifer die<br />
Käthaka-Upanishad erklärte, und ein von allen mit besonderer<br />
Hochachtung behandelter älterer Professor der Literatur,<br />
dessen schön geformte Stirn an Kant erinnerte, und der sich<br />
nicht nur als Gelehrter durch sein eminentes Wissen, sondern<br />
auch als Dichter eigener Dramen ausgezeichnet hatte. Er<br />
interpretierte die Kädambari und ich erinnere mich noch,<br />
wie er anfing einen Satz zu lesen, der kein Ende nahm, und<br />
dann weiterblätternd sagte: „Um das Ende des Satzes zu<br />
finden, müssen wir zwölf Seiten weitergehen." Wie in<br />
Benares, wurde auch hier die ganze Stunde durch nur<br />
Sanskrit gesprochen; doch sass man nicht wie dort auf der<br />
Erde, sondern auf Stühlen an einem Tisch, welcher für alle<br />
genügend Platz bot, denn mehr als fünf oder sechs Zuhörer<br />
habe ich nie dabei zusammen gesehen.<br />
Ausser den Familien P. L. Roy und P. K. Ray wurden<br />
wir noch besonders befreundet mit zwei Brüdern Mullik,<br />
welche jenseits des Hughlistromes eine Schiffswerft besassen.<br />
Bei Besichtigung derselben sah ich mit Erstaunen, .wie die<br />
zahlreichen Arbeiter ganz wie bei uns die glühenden Eisen<br />
stangen walzten und schmiedeten, nur dass sie dabei fast<br />
nackt waren und daher gewiss sehr oft Brandwunden durch<br />
das herumspritzende Eisen erleiden mussten. Man war<br />
gerade damit beschäftigt, ein grosses Güterschiff zu reparieren,<br />
welches mit seiner Ladung auf der See in Brand geraten<br />
war. Hierbei hatten sich alle Stangen des aus Eisen be<br />
stehenden Rumpfes mehr oder weniger verbogen. Es war<br />
sehr mühsam und kostspielig, dieses alles so wieder her<br />
zustellen, wie es ursprünglich gewesen war, während es un<br />
verhältnismässig weniger Kosten verursacht haben würde,
Calcuttaer Professoren. Mr. Mullik's Werft und Haus. 157<br />
das Schiff mit Verzicht auf die Schönheit wieder in brauch<br />
baren Zustand zu bringen. Aber das Schiff war bei einer<br />
Gesellschaft versichert gewesen, und der Eigentümer konnte<br />
die Wiederherstellung desselben in den ursprünglichen Zu<br />
stand verlangen und hatte kein Interesse daran, an den<br />
Kosten zu sparen. Die Brüder Mullik bewohnten mit ihrer<br />
Mutter ein palastartiges Haus in der Stadt; oft holten sie<br />
uns dorthin in ihrem eleganten Wagen oder fuhren, wenn<br />
ich verhindert war, meine Frau allein spazieren. Wiederholt<br />
luden sie uns ein, bei ihnen zu speisen, das eine Mal<br />
europäisch, das andere Mal indisch. Die erste Art unter<br />
schied sich von einem opulenten englischen Dinner nur durch<br />
diejenigen Änderungen, welche das Klima gebietet. Man<br />
sitzt auf Stühlen, man isst Fleisch und trinkt Wein wie bei<br />
uns. Der indische Gesellschaftsanzug besteht aus Hose und<br />
elegantem, bis zu ihr herabreichendem Hemde. Hemd und<br />
Hose werden durch einen seidenen Gürtel zusammengehalten;<br />
die Weste kommt ganz in Wegfall und ein sehr weit offenes<br />
kurzes Jackett vollendet den malerischen Anzug. Wer keinen<br />
solchen besitzt, der hat die Wahl, entweder in seinem<br />
europäischen Frack fürchterlich zu schwitzen oder einfach im<br />
Promenadenanzug aus dünner Leinwand oder Seide zu er<br />
scheinen. In Indien ist man, vielleicht abgesehen von den<br />
Engländern, in Bezug auf Toilette sehr nachsichtig. Professor<br />
Petersen pflegte in Abendgesellschaften, wenn erst die Sonne<br />
untergegangen ist, ganz ohne Kopfbedeckung über die Strasse<br />
zu gehen, und so werden es wohl noch viele machen.<br />
Höchst originell war ein Diner im Eingeborenenstile,<br />
welches uns einer der Herren Mullik offerierte. Zunächst<br />
wurden wir getrennt, meine Frau speiste oben bei den<br />
Damen aus silbernem Geschirr; mir wurde unten serviert,<br />
während Mr. Mullik mich unterhielt, selbst aber nichts<br />
anrührte, angeblich weil er heute seinen Fasttag habe. Ein<br />
indisches Diner aus zwanzig Gängen, zur Hälfte nicht süss,
158 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
zur anderen Hälfte süss, bestehend aus den mannig<br />
fachsten Zubereitungen von Milch, Butter, Reis, Gemüsen,<br />
Kartoffeln, Mehlspeisen und Früchten, mit Ausschluss von<br />
Fleisch, Fisch und Eiern, ist etwas ganz Gewöhnliches.<br />
Diesmal aber wollte Mr. Mullik mir zeigen, was die vege<br />
tarische Küche alles zu leisten vermag, und so folgten auf<br />
einander nicht weniger als achtzig verschiedene Gerichte,<br />
welche alle mein liebenswürdiger Gastgeber mir im einzelnen<br />
erklärte, während ich von jedem der späteren Gerichte nur<br />
ein ganz kleines Teilchen zu kosten vermochte. Merk<br />
würdigerweise befand sich darunter ein einzelner sehr<br />
appetitlich zugerichteter Fleischgang. Es wird nämlich in<br />
dem eine halbe Stunde von Calcutta entfernt gelegenen<br />
Tempel zu Kältghatta, dessen Protektor Mr. Mullik war,<br />
der furchtbaren Göttin Kalt jeden Morgen um 10 Uhr eine<br />
Ziege geschlachtet, indem ihr Kopf in eine eiserne Gabel<br />
eingespannt und mit einem Schwertstreiche vom Rumpfe<br />
getrennt wird. Das Fleisch dieser Ziege darf gegessen<br />
werden und gilt als besonders heilsam, ist aber wohl nur<br />
sehr wenigen erreichbar. Ich habe mit Andacht davon ge<br />
gessen, und es ist mir, wie auch die ganze übrige ungeheure<br />
Mahlzeit, sehr wohl bekommen.<br />
Ein lieber Freund ausser den genannten war auch<br />
Hara Prasäda, ein frischer offener Charakter von gediegener<br />
Bildung. Er war früher Professor des Sanskrit gewesen,<br />
hatte aber dann diese Stellung mit der lukrativeren und<br />
einflussreicheren eines Rates in der Verwaltung der Provinz<br />
Bengalen vertauscht. Als solcher hatte er die Aufgabe, über<br />
alle in Bengalen erscheinende Schriften je nach Bedarf der<br />
Regierung mehr oder weniger eingehend Bericht zu erstatten.<br />
Ich verhandelte viel mit ihm über das Sähkhyasystem, ohne<br />
dass auch er es vermocht hätte, mir über dieses vertrackteste<br />
aller philosophischen Systeme Klarheit zu geben. Erst nach<br />
Jahren habe ich, vom Studium der Upanishad's kommend,
Eine schwere Sitzung. Hara Prasäda. Naihati. 159<br />
das Sähkhyasystem, wie auch dessen epischen Vorläufer, be<br />
griffen und erwiesen als eine realistische Umbildung des<br />
reinen Idealismus der ältesten Upanishadtexte. Die stufen<br />
weise fortschreitende Degeneration dieses ursprünglichen<br />
Idealismus durch die Stadien des Pantheismus, Kosmogonismus,<br />
Theismus bis zum Atheismus des Sähkhyam hin, habe ich<br />
in der zweiten Abteilung des ersten Bandes meiner Ge<br />
schichte der Philosophie nachgewiesen.<br />
Hara Prasäda wohnte mit seiner Familie in idyllischer<br />
Abgeschiedenheit in dem in halbstündiger Eisenbahnfahrt<br />
erreichbaren Dorfe Naihati. Dort befinden sich noch heute<br />
viele brahmanische Schulen, oder besser gesagt Pensionen.<br />
Ganz in alter Weise wohnt hier eine Anzahl von Schülern<br />
in der Hütte eines Guru (Lehrer), für welchen sie die häus<br />
lichen Arbeiten verrichten, vielleicht auch betteln gehen und<br />
als Entgelt im Veda und anderen Disciplinen unterrichtet<br />
werden. Hara Prasäda nahm uns eines Tages mit nach<br />
Naihati, führte uns bei den Lehrern und in ihren Wohnungen<br />
ein und veranstaltete zum Schlüsse eine Zusammenkunft von<br />
etwa 60 Schülern. Ich musste derselben präsidieren und<br />
an die Schüler mancherlei Fragen richten, natürlich in Sanskrit,<br />
welche sie in derselben Sprache, zum Teil recht gut, zu<br />
beantworten wussten. Zum Schlüsse brachte man mir die<br />
üblichen Ovationen dar, und es geschah dabei das Un<br />
glaubliche, dass mir Hara Prasäda vor allen Lehrern und<br />
Schülern die heilige Opferschnur (yajnopavttam) über die<br />
Schulter hängte, welches sogar ein Frevel am Heiligen ge<br />
wesen wäre, hätte man nicht einen der Fäden, aus denen<br />
die Opferschnur besteht, weggelassen. Nachdem die Ver<br />
sammlung aufgelöst war, zeigte uns Hara Prasäda die schönen<br />
Umgebungen von Naihati, führte uns in sein Haus und<br />
stellte uns sein Söhnchen vor, einen lebhaften achtjährigen<br />
Knaben von grosser Schönheit, welche um so deutlicher<br />
hervortrat, weil der Knabe völlig unbekleidet seinem Vater
160 VI. Calcutta und der Himälays.<br />
auf der Strasse entgegensprang, und auch uns mit einem:<br />
„Good morning, sir!" begrüsste. Sein Vater erzählte uns,<br />
dass er schon jetzt den Knaben die wichtigsten Sanskrit<br />
worte aus dem Amarakoca lernen lasse. Hiernach ist es<br />
begreiflich, dass die Inder eine Fertigkeit im Gebrauche des<br />
Sanskrit besitzen, welche kein Europäer jemals erreicht.<br />
Noch manche andere Eindrücke verdanke ich dem stets<br />
gefälligen und überall trefflich orientierten Hara Prasäda.<br />
So hatte ich den Wunsch geäussert, einmal einen Kokila in<br />
der Nähe zu sehen, welches nicht leicht ist, da dieser indische<br />
Kuckuck sehr scheu ist. Er wird von den indischen Dichtern<br />
wegen der Schönheit seines Gesanges, ähnlich wie bei uns<br />
die Nachtigall, gefeiert. An Klarheit und Stärke der Stimme<br />
ist er dieser wohl noch überlegen, nicht aber an Mannig<br />
faltigkeit, da er, so oft ich ihn hörte, immer nur zwei Motive<br />
auf seinem Repertoir hatte. Das eine besteht darin, dass er<br />
unermüdlich vom Grundtone in die Quart geht, das andere<br />
darin, dass er von Zeit zu Zeit die Tonleiter vom Grundton<br />
bis zur Oktave ohne deutliche Scheidung der ganzen und<br />
halben Töne durchläuft. Gesehen hatte ich einen Kokila<br />
noch nie, und so war meine Freude nicht gering, als Hara<br />
Prasäda eines Morgens in unser Zimmer trat, gefolgt von<br />
einem Diener, der in der einen Hand einen Käfig mit einem<br />
Kokila und in der anderen einen grossen Topf mit frisch<br />
gezapftem Toddy (Palmsaft) trug. Wir bewunderten den<br />
Kokila, welcher schwarz wie unsere Raben war, im übrigen<br />
aber mehr an eine Taube erinnerte, nur dass der Kokila viel<br />
schlanker und feiner gebaut ist als diese. Hierauf wurde<br />
von dem Palmsaft getrunken, welcher, so lange er frisch ist,<br />
wie eine etwas fade Limonade schmeckt und ein bei den<br />
Indern sehr beliebtes, ganz unschuldiges Getränk ist. Hebt<br />
man ihn auf, so verwandelt er sich in wenigen Stunden<br />
durch die Gärung in ein schnapsartiges, scharfschmeckendes,<br />
sehr berauschendes Getränk. Wir beschlossen, den Versuch
Ein Kokila. Der Toddy. Auf zum Himälaya. 161<br />
zu machen, Hessen in einer benachbarten Apotheke vier<br />
Fläschchen davon abfüllen und hermetisch verkorken. Diese<br />
legten wir in unsere Koffer, um sie mit nach Europa zu<br />
nehmen. Dann reisten wir für vier Tage in den Himälaya<br />
und fanden bei unserer Rückkehr, dass das perfide Getränk<br />
bei der Gärung durch Pfropfen und alle Verpackungen durch<br />
gedrungen war und an den benachbarten Sachen allerlei<br />
Unheil angerichtet hatte, sodass uns nichts übrig blieb, als<br />
die fast leeren Flaschen wegzuwerfen und uns an den An<br />
denken genügen zu lassen, welche der Palmwein an Büchern<br />
und sonstigen Effekten hinterlassen hatte.<br />
Die erwähnte viertägige Reise in den Himälaya gehört<br />
mit zu den originellsten Episoden unseres Aufenthaltes in<br />
Indien, und ich bereue es nicht, die vierundzwanzig Stunden<br />
von Calcutta nach Darjeeling auf der Eisenbahn verbracht<br />
zu haben, nur um eine Himälayalandschaft zu sehen und<br />
dann desselbigen Weges zurückzukehren, ähnlich wie wenn<br />
einer von Norddeutschland nach Interlaken reisen wollte,<br />
um einige Stunden lang den Anblick der Jungfrau zu ge<br />
messen und dann wieder nach Hause zu fahren. Gewöhnlich<br />
fährt man allerdings aus dem Glutkessel Bengalens nach<br />
dem 7000 Fuss hoch gelegenen Darjeeling hinauf, um dort<br />
mehrere Monate zu verweilen und die angegriffene Gesund<br />
heit in der herrlichen frischen Gebirgsluft wieder herzustellen,<br />
welche das ganze Jahr durch nie weniger als -f- 2 und nie mehr<br />
als -f- 14° R. hat. Retourbilletts geben die klugen Engländer<br />
gerade auf dieser Strecke nicht, vermutlich, weil sie sicher sind,<br />
dass, wer dort hinauffährt, auch ohne Preisermässigung auf<br />
demselben Wege zurückkehren wird, da es keinen anderen gibt.<br />
Nachdem wir unser Gepäck zu Mr. Roy befördert, der<br />
uns eingeladen hatte, nach unserer Rückkehr weiterhin bei<br />
ihm zu wohnen, begaben wir uns am 1. Februar 1893 nach<br />
Sealdah Station, beurlaubten unsern Diener für vier Tage und<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 11
162 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
traten um drei Uhr nachmittags allein die Fahrt nach dem<br />
Norden an. Um acht Uhr abends waren wir am Ganges, über<br />
welchen, bei seiner grossen Breite, hier keine Brücke mehr<br />
führt. Ein Dampfer brachte die Reisenden hinüber. Auf<br />
dem Verdeck wurde ein gutes Abendessen serviert. Am<br />
anderen Ufer angelangt, beeilten wir uns, in dem bereit<br />
stehenden Zuge ein leeres Coupe zu erobern, und waren<br />
auch so glücklich allein zu bleiben.<br />
Während wir auf den mitgebrachten Betten vortrefflich<br />
schliefen, eilte der Zug die ganze Nacht durch nach Norden.<br />
Als wir nach Tagesanbruch zum Fenster hinausschauten,<br />
sahen wir zum ersten Male und mit Entzücken die hoch<br />
ragende blaue Kette der Himälayaberge, welche nicht kokett<br />
zerrissen wie die Alpen, sondern in ruhigeren Formen ernst<br />
und gross sich über die Ebene erheben. In Siliguri endet<br />
die Bahn, und während wir frühstückten, konnten wir in<br />
Müsse die niedlichste Puppenbahn betrachten, welche be<br />
stimmt war, uns in achtstündiger Fahrt von hier nach Darjeeling<br />
hinaufzubringen. Das Prinzip beim Bau dieser Eisenbahn<br />
war, alle Tunnels zu vermeiden und die Ersteigung der<br />
Höhe durch zahllose Windungen zu bewerkstelligen. Nur<br />
einige Male wird eine allzu schroffe Steigung dadurch über<br />
wunden, dass der Zug im Zickzack, abwechselnd vorwärts<br />
und rückwärts fahrend, in kurzer Zeit sich beträchtlich höher<br />
hebt. Wegen der vielen, oft kurzen Windungen mussten<br />
die Schienen möglichst nah zusammen sein. Sie liegen in<br />
der Tat nur zwei Fuss von einander entfernt, während die<br />
Wagen vier Fuss breit sind. Um auf dem halb so schmalen<br />
Geleise sicher zu fahren, musste der Schwerpunkt möglichst<br />
tief gelegt werden, und wirklich liegt auch der Fussboden<br />
des Wagens kaum einen Fuss höher als der Erdboden. Die<br />
Räder laufen also im Innern der Wagen, wo eine Ver<br />
schalung Schutz gegen sie gewährt. Die meisten Wagen<br />
der ersten Klasse sind nach oben überdeckt, sonst aber
Die Himälayabahn. Die Region der Terai. 163<br />
nach allen Seiten offen, und enthalten nur zwei Vordersitze<br />
und zwei Rücksitze. Wir bestiegen einen solchen Wagen,<br />
nachdem wir vorsorglich alle Mäntel, Schlafröcke und Reise<br />
decken um uns geschlagen, denn da oben auf der Höhe<br />
ist es empfindlich kalt. Das kleine, tapfere Lokomotivchen,<br />
welches uns hinaufbefördern sollte, setzte sich zischend und<br />
fauchend in Bewegung, jagte zuerst noch eine Stunde lang<br />
durch die mit Theepflanzungen bedeckte Ebene dahin, und<br />
dann begann die Region der Terai, — so heissen die<br />
untersten Abhänge des Gebirges, in denen das herabfliessende<br />
Wasser sich vielfach zu Sümpfen staut. Sie sind mit ihren<br />
Fieberlüften für Menschen ebenso gefährlich, wie für die<br />
Vegetation erspriesslich. In unglaublicher Fülle drängen<br />
sich hier Riesenbäume und hochklimmende Schlingpflanzen<br />
durcheinander; das Auge vermag stellenweise nicht, sich in<br />
dem Wirrwarr der nebeneinander, durcheinander, umeinander<br />
wuchernden Vegetation zurecht zu finden, und hoch über<br />
die höchsten Bäume schiessen gewaltige Farnkräuter empor<br />
und vollenden den Eindruck eines Bildes, welches der nie<br />
sich vorstellen kann, welcher es nicht gesehen hat, und<br />
der, welcher es sah, nie vergessen wird. Eine Stunde<br />
etwa dauert die Durchfahrt dieser ungesunden Region,<br />
dann steigt der Zug immerfort zischend in unzähligen<br />
Windungen wie eine feuerspeiende Schlange höher und<br />
höher empor. Immer deutlicher hebt sich beim Zurück<br />
blicken die weite bengalische Ebene vom Gebirge ab; jeden<br />
Augenblick wechselt das Panorama, man möchte keinen<br />
Blick verlieren und jeden für immer festhalten. Die Vor<br />
berge, die von unten als mächtige Gebirgsmassen sich auf<br />
türmten, liegen jetzt wie im Abgrunde tief unter uns, auf<br />
ihre höchsten Gipfel blicken wir hoch von oben hinab.<br />
Doch sind die Abhänge des Himälaya viel sanfter als die<br />
der Alpen. Seltener als dort kriecht der Zug unmittelbar<br />
am Rande des Abgrundes hin. Nur ein Punkt dieser Art,<br />
ll*
164 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
von den Engländern sensational point genannt, ist mir in<br />
lebendigster Erinnerung verblieben. Weiter arbeitet sich<br />
der Zug in die Höhe, indem er sich an die rechte Wand<br />
eines ungeheuren Gebirgstales anklammert und dabei alle<br />
Vorsprünge dieser Gebirgswand durch zahllose Windungen<br />
umgeht. Hin und wieder zeigen sich zwischen den Waldungen<br />
die armseligen Hütten eines Gebirgsdorfes; einige Bewohner<br />
stehen an den Stationen und betteln. Im schärfsten Gegen<br />
satze zu den Indern der Ebene zeigen sie durchaus den<br />
mongolischen Typus: gelbe Hautfarbe, breite Gesichter,<br />
platte Nasen und hervorstehende Backenknochen. Wir<br />
atmen mit Entzücken die reine, stärkende Bergluft. Zugleich<br />
aber fängt es an, empfindlich kalt zu werden. So gelangen<br />
wir gegen Mittag nach Korscheong Bazar, der Frühstücks<br />
station mit zwanzig Minuten Aufenthalt, und in weiteren drei<br />
Stunden nach Goom, dem höchsten Punkte der Bahn. Hier<br />
lag auf dem Gemäuer in unserer Nähe zu Anfang Februar<br />
wirklicher echter Schnee, der einzige, den wir in diesem<br />
Winter aus der Nähe zu sehen bekamen. Ein altes häss-<br />
liches Weib mit närrischen Gebärden geht bettelnd von<br />
Wagen zu Wagen. Sie wird jedem Darjeelingfahrer als die<br />
Witch of Goom in Erinnerung sein. Fröstelnd nehmen wir<br />
wieder unsere Sitze ein. Die Bahn senkt sich ein wenig,<br />
umläuft noch einen Gebirgsknoten und fährt um vier Uhr<br />
auf der Endstation im Bahnhofe von Darjeeling ein. Hier<br />
gibt es nur drei Arten von Wegen, entweder steil bergauf<br />
oder steil bergabführende, oder in Windungen auf gleicher<br />
Höhe sich haltende. Von Wagen haben wir nichts gesehen;<br />
einige Weiber bemächtigten sich unseres Gepäcks, um es<br />
hinauf nach Woodland's Hotel zu tragen, und wir kletterten<br />
ihnen nach. Wir fragen nach Zimmern; der Manager macht<br />
ein bedenkliches Gesicht und fragt, wie lange wir zu bleiben<br />
gedächten. Ich glaubte schon der Abweisung sicher zu<br />
sein, als ich antwortete, dass wir allerdings nur zwei Tage
Korscheong Bazar. Goom. Darjeeling. 165<br />
bleiben könnten. Aber wider Erwarten hellen sich die<br />
Mienen des Mannes auf und er spricht: „Dann kann ich<br />
Ihnen die besten Zimmer geben. Hier von der grossen<br />
Terrasse ist der Eingang, und Sie können von der Terrasse<br />
oder aus dem Zimmer, ja von dem Bette aus, durch die<br />
Fenster und Glastüren den vollen Anblick des Gebirges<br />
gemessen. Aber von übermorgen an muss ich das Zimmer<br />
wieder haben, denn diese ganze Flucht von Zimmern ist<br />
für den österreichischen Prinzen und sein Gefolge bestimmt."<br />
Bei Erwähnung des österreichischen Prinzen musste ich<br />
lachen, denn schon unten in Calcutta hatten wir darüber<br />
spötteln hören, dass er nicht nur kein Sanskrit, kein Hindostani,<br />
sondern auch so wenig Englisch konnte, dass er sich selbst<br />
in dieser Sprache eines Dolmetschers bedienen musste. Und<br />
das reist nach Indien! Wir bezogen das Zimmer, Hessen<br />
einheizen, etwas ganz Neues in diesem Winter, und wandten<br />
uns der Aussicht auf den zweithöchsten Berg der Welt zu,<br />
sahen aber nichts als eine dichte Nebelwand, während die<br />
näheren Berge und das malerisch um einen solchen gelagerte<br />
Darjeeling deutlich zu übersehen waren. Da lag zu unseren<br />
Füssen der Bahnhof, wo die wackere kleine Lokomotive so<br />
eben ihre letzten Seufzer für heute ausstiess, da lag weiter<br />
nach unten der Marktplatz, auf dem die Gebirgsbewohner<br />
von Sikkim, Bhutan und Nepal ihre Produkte gegen einander<br />
austauschten, und dann ging es tief, tief hinunter, wo der<br />
Weg, immer steil absteigend, am botanischen Garten und<br />
an Theeplantagen vorüber sich in unverfolgbarer Tiefe verlor.<br />
Aber was war das alles, wenn uns der Blick auf die Schnee<br />
berge verhüllt bleiben sollte? Man tröstete uns damit, dass<br />
die Aussicht gegen sechs Uhr morgens für eine Stunde sich<br />
aufzuhellen pflege. Für heute blieben wir zu Hause in der<br />
Hoffnung, dass einer der beiden Inder, denen wir unsere<br />
Empfehlungsbriefe ins Haus sandten, uns im Hotel aufsuchen<br />
würde. Aber der Bote brachte die Antwort, dass der eine
166 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
verreist sei und der andere eine Stunde weit von Darjeeling<br />
wohne und erst am nächsten Morgen zur Bureaustunde<br />
in die Stadt kommen werde. Etwas enttäuscht legten wir<br />
uns beizeiten schlafen, um am nächsten Morgen das gross<br />
artige Naturschauspiel nicht zu versäumen.<br />
Unser erster Blick nach dem Erwachen galt den Schnee<br />
bergen; aber gegen die Erwartungen, die man uns gemacht<br />
hatte, zeigten sie sich ganz in Wolken gehüllt. Wir standen<br />
auf und gingen spazieren, immer in der Hoffnung, dass das<br />
Gebirge während des Tages seine Nebelkappe für einen<br />
Augenblick lüften werde, eine Hoffnung, deren Vergeblich<br />
keit uns jeder Erfahrene voraussagen konnte. Für die<br />
mangelnde Fernsicht musste die Nähe uns schadlos halten.<br />
Das Wetter war schön; von den an den Abhängen entlang<br />
führenden Wegen tauchte der Blick in abgründliche Täler,<br />
in denen die Nebelmassen, auf- und abwogend, allerlei<br />
gespenstige Formen annahmen. Wir erreichten einen Hügel,<br />
auf dem ein buddhistisches Heiligtum lag, welches schon<br />
von aussen durch die zahllosen bunten Fähnchen, mit denen<br />
es besteckt war, mehr den Eindruck einer Jahrmarktsbude<br />
als eines Tempels machte und im Innern allerlei Teufels<br />
fratzen, aber nichts enthielt, was die Seele hätte erheben<br />
können. Das also sind die Mittel, welche hinreichen, um<br />
die metaphysischen Bedürfnisse dieser einfachen Gebirgs-<br />
menschen zu befriedigen. Denn im Gegensatze zu Indien,<br />
wo es keine Buddhisten mehr gibt, huldigt hier alles dem<br />
Buddhismus, freilich einem Buddhismus, der die ursprüngliche<br />
reine ethische Lehre zu einem Wüste abergläubischer und phan<br />
tastischer Vorstellungen fortentwickelt hat. Bescheiden, wie die<br />
religiösen Ansprüche, sind auch die übrigen Anforderungen,<br />
welche die Bewohner dieses Gebirgslandes an das Leben stellen.<br />
Ihr Los ist harte Arbeit und karger Gewinn, und dabei sind<br />
sie lustig wie die Sperlinge. Überall sieht man sie schwatzen,<br />
singen und lachen, im scharfen Gegensatz zu den ernsten,
Land und Leute des Himälays. Der Buddhismus. 167<br />
schwermütigen Indern dort unten in der Ebene. Wenn in<br />
Darjeeling ein Haus gebaut werden soll, so müssen, bei<br />
dem Mangel an Fahrwegen, die Steine dazu alle in Kiepen<br />
auf dem Rücken von Weibern hinaufgetragen werden. Wir<br />
sahen sie, drall und rüstig, mit ihren Lasten emporsteigen.<br />
Mit einer derselben machten wir Bekanntschaft. Als sie mit<br />
einem halben Dutzend schwerer Steine in der Tragkiepe<br />
auf ihrem Rücken an uns vorbeistieg, fiel ein Stein herunter.<br />
Sie konnte sich nicht bücken, wollte sie nicht noch mehr<br />
Steine verlieren, und sie konnte nicht die ganze Kiepe ab<br />
setzen, da sie dieselbe ohne Hülfe nicht wieder über die<br />
Schultern bekommen hätte. In dieser Not leistete ich ihr<br />
den kleinen Ritterdienst, den Stein wieder in die Kiepe zu<br />
bringen und wurde dafür mit einem dankbaren Blicke be<br />
lohnt. Ich konnte sie nun ganz aus der Nähe betrachten<br />
und bemerkte, wie sie nicht nur all ihren Schmuck, sondern<br />
auch ihr Vermögen mit sich trug, bestehend aus einer<br />
Anzahl durchlöcherter Silber- und Kupfermünzen, welche<br />
als Guirlanden um den Hals und bis zum Gürtel herab<br />
hingen.<br />
So vertrieben wir uns den Vormittag und traten bei<br />
unserem Rückwege noch in den Curiosity Shop des Herrn<br />
M. ein. Dieser war sichtlich erfreut, deutsche Landsleute bei<br />
sich zu sehen. Er zeigte uns alle seine Herrlichkeiten, als<br />
da waren: Teufelsmasken, Fähnlein, Schädel als Trinkbecher<br />
und buddhistische Gebetsmühlen. In diese braucht man nur<br />
die geschriebenen Gebete hineinzustecken und mit der Trommel<br />
zu drehen, so leistet dies ganz ebenso viel, als wenn man<br />
die Gebete so viele Male wie die Umdrehung war gesprochen<br />
hätte. Die Buddhisten sind also noch um einiges praktischer<br />
als unsere Katholiken, welche bei Wallfahrten und Prozessi<br />
onen immer fort und fort ihre Gebete wiederholen. Jesus<br />
hat es verboten, beim Beten zu plappern wie die Heiden,<br />
die da meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte
168 VI. Cslcutts und der Himälsya.<br />
machen und stellt als Beispiel eines kurzen, einfachen, herz<br />
lichen Gebetes das Vaterunser auf. Was würde er sagen,<br />
wenn er sähe, wie sein Vaterunsergebet von den Schafen<br />
seiner Herde so und so oft hinter einander gedankenlos ab<br />
geleiert wird! Der Buddhismus von heute ist ein Ver-<br />
grösserungsspiegel der Fehler des Katholizismus.<br />
Gegen Mittag erschien unser indischer Freund im Hotel.<br />
Er war ein grosser, stattlicher Mann mit vollem schwarzem<br />
Haar und Bart, die in Ringelungen sein ausdrucksvolles<br />
braunes Gesicht umspielten. Natürlich blieben wir für den<br />
Rest des Tages zusammen. Er führte uns auf den Markt<br />
platz, der nicht nur für die Provinz Sikkim, in welcher er<br />
liegt, sondern auch für die Völker des östlich gelegenen<br />
Bhutan und des nach Westen sich erstreckenden Nepal<br />
die Centrale bildet, Sikkim und Bhutan haben buddhistische<br />
Bevölkerung mongolischer Rasse, die Nepaler aber, zu denen<br />
eben auch unser Freund gehörte, sind indischen Blutes. Sie<br />
sind die einzige Bevölkerung Indiens, welche, dank ihrer<br />
Lage im Hochgebirge und ihrer Vorsicht, sich von dem<br />
Joch der englischen Fremdherrschaft bis jetzt freigehalten<br />
haben. Sie erlauben den Europäern nicht den ungezwun<br />
genen Verkehr in ihrem Lande, welcher dem übrigen Indien<br />
so schlecht bekommen ist. Wer in Nepal zu tun hat, der<br />
wird mit seinem Passe nach der Hauptstadt Khatmandu ge<br />
leitet, darf dort seine Geschäfte besorgen und muss das Land<br />
sodann wiederum verlassen. Nepal kann sich rühmen, den<br />
höchsten Berg der Welt, den 8800 Meter hohen Gaurtgankar<br />
zu besitzen. Die Engländer haben die Unbescheidenheit ge<br />
habt, diesen Berg, der nicht einmal ihr Eigentum ist, nach<br />
dem Namen eines englischen Geometers, der dort Ver<br />
messungen vornahm, Mount Everest zu nennen. Sollte dieser<br />
Mr. Everest hierdurch, wenn auch nur in England, eine ge<br />
wisse Unsterblichkeit behalten, so ist es eine traurige, der<br />
des Herostratus vergleichbar. Denn wer kann es ohne In-
Der Gauricankar. Ein nepalesischer Freund. 169<br />
dignation hören, wenn die Engländer an den Wirtstafeln in<br />
Indien die Fragen: „Did you see Mount Everest? Where<br />
can we get a view of Mount Everest?" etc. verhandeln, nicht<br />
wissend, die Unglücklichen, dass dieser Berg von alters her<br />
seinen schönen und hochheiligen Namen hat, nämlich von<br />
Cankara d. i. Civa, der schon von Kälidäsa als der höchste<br />
Gott, die höchste Inkarnation des Ätman gefeiert wird, und<br />
seiner Gemahlin Gauri, deren Vermählung mit Qankara in dem<br />
wunderschönen Gedicht Kumärasambhava von Kälidäsa mit<br />
den glühenden Farben der Tropenwelt und des Orientes ge<br />
schildert wird. In dem höchsten Doppelgipfel verehrten die<br />
Inder ihr höchstes Götterpaar, Gauri und Qankara, die Eng<br />
länder aber nennen ihn Mount Everest!<br />
Vom Marktplatz zu Darjeeling führte uns der nepalesische<br />
Freund immer stark bergab bis zum botanischen Garten,<br />
welcher für die Vegetation des Himälaya höchst lehrreich<br />
ist. Er wollte uns noch weiter bergab zu einer Theeplan-<br />
tage führen, aber ein schneidend kalter Wind, der grosse<br />
Massen Staubes aufwirbelte, gemahnte zur Rückkehr. Von<br />
den Schneebergen war diesen ganzen Tag durch nichts zu<br />
sehen, aber die Unterhaltung mit dem edlen Hindu in un<br />
serem Hotelzimmer am behaglichen Kaminfeuer konnte uns<br />
wohl einigermassen entschädigen. Dieser Mann war, wie alle<br />
besseren Inder, von tiefem Schmerze über die Knechtung<br />
seines Vaterlandes, denn der Nepalese fühlt sich durchaus<br />
als Inder, erfüllt. Er hoffte mit der Zuversicht und dem weihe<br />
vollen Tone eines Propheten auf einen künftigen Heiland,<br />
eine Art von Messias, welcher die Fremdherrschaft brechen,<br />
die Mohammedaner vertreiben und Indien in seiner alten Grösse<br />
und Herrlichkeit wiederherstellen werde, die freilich wohl<br />
niemals bestanden hat. Denn die Inder waren von jeher zu<br />
hochsinnig und geistig veranlagt, um nicht von der brutalen<br />
Superiorität der Wollenden über die Erkennenden unter die<br />
Füsse getreten zu werden, zuerst von den Brahmanen und
170 ' VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
Königen des eigenen Stammes, dann von den Griechen<br />
Alexanders, von den Baktrern, den Skythen, den Arabern und<br />
Mongolen und zuletzt von den Europäern. Wir plauderten<br />
bis zum späten Abend, worauf unser Freund Abschied nahm,<br />
wohl auf Nimmerwiedersehn. „Denn wir können nicht",<br />
sagte ich zu meiner Frau, „Tag für Tag hier versitzen in der<br />
unsichern Hoffnung, an einem günstigen Morgen die Schnee<br />
berge zu sehen. Morgen um zehn Uhr fahren wir hinunter<br />
nach Calcutta!"<br />
Am nächsten Morgen beim Erwachen sehe ich schon<br />
vom Bett aus eine ungewöhnliche Helle; ich springe zur<br />
Glastür der Veranda, und wer beschreibt unser Entzücken,<br />
als wir die ganze Bergkette des Kanchinjinga, des zweit<br />
höchsten Berges der Welt, mit all ihren Schluchten, Abhängen<br />
und Gipfeln bis hinauf zu den in der Sonne strahlenden<br />
Goldhörnern (käncana-gringa, woraus die Pandits den Namen<br />
erklären) in wolkenloser Klarheit vor uns ausgebreitet sahen.<br />
Wohl wissend, dass das Schauspiel nicht lange zu geniessen<br />
sein werde, sprang ich selbst nach den Stiefeln in die noch<br />
menschenleere Küche. In fliegender Hast kleideten wir uns<br />
an und eilten durch die leeren Strassen des Städtchens nach<br />
Observatory Hill, um die Aussicht noch voller zu geniessen.<br />
Unterwegs trafen wir den uns schon bekannten Kuriositäten<br />
händler M., der mit seinem Hunde soeben einen Morgen<br />
spaziergang machte; wir luden ihn ein mitzukommen, und<br />
er führte uns an den vorteilhaftesten Aussichtspunkt. Hier<br />
wurde der Eindruck des Gebirges nicht wie auf der Wengern-<br />
alp durch die zu grosse Nähe abgeschwächt, sondern vor uns<br />
gähnte in ungeheurer Weite und Tiefe ein abgründliches Tal,<br />
und unmittelbar jenseits desselben erhob sich, sichtbar vom<br />
Fusse bis zu den unglaublich hoch empordringenden Gipfeln,<br />
der ganze mit ewigem Schnee bedeckte Gebirgsstock. Ich<br />
unterschied den höchsten Gipfel in der Mitte, der links und<br />
rechts von zwei weniger hohen, wie diese wieder von zwei
Seite HO.<br />
c<br />
!sä
Der Kanchinjinga in seiner Herrlichkeit. 17]<br />
noch niedrigeren Hörnern flankiert war. Herr M. erwies<br />
sich sehr nützlich, wenn ich auch wegen der Zuverlässigkeit<br />
der folgenden Angaben, die ich ihm verdanke, die Verant<br />
wortung ihm selbst überlassen muss. „Sie sehen dort rechts",<br />
sprach er, „zwischen den beiden letzten Hörnern einen<br />
schwarzen Einschnitt. Das ist der Pass, welcher 21000 Fuss<br />
hoch durch ewigen Schnee nach Tibet führt. Ich selbst bin<br />
schon bis zu 20000 Fuss Höhe vorgedrungen, musste aber<br />
umkehren, da diese Reise durch völlig unbewohnte Gletscher<br />
gegenden ohne einen grösseren Apparat von Trägern und<br />
Führern nicht durchzuführen ist. Von dem Pass bis zum<br />
höchsten Gipfel sind volle 8000 Fuss, die Sie hier mit einem<br />
Blick des Auges umspannen. Den andern noch höheren Berg,<br />
nach dem Sie fragten, und den ich- mit Ihrem Verlaub<br />
Mount Everest nennen muss, da ich den andern Namen<br />
nicht behalten kann, diesen allerhöchsten Berg der Welt<br />
können Sie von Darjeeling aus nicht sehen. Zu diesem<br />
Zwecke müssten Sie sich auf Tiger Hill, eine gute Stunde<br />
von hier, bemühen; ich würde es Ihnen aber nicht raten, denn<br />
auch dort würden Sie wegen der vorliegenden Berge nur<br />
die höchsten Gipfel wie drei kleine aufgesetzte Zuckerhüte<br />
bemerken. Aber jetzt beeilen Sie sich, denn die Sonne steigt<br />
höher, und bald wird die ganze Aussicht sich für heute<br />
schliessen." Was wir jetzt sahen, war ein wunderbares Schau<br />
spiel. Die Nebel und Wolkenmassen, welche wie schläfrige<br />
Tiere tief unten in den Tälern geruht hatten, fingen, von der<br />
Sonne geweckt, an, sich zu bewegen. Langsam und träge<br />
leckten sie an den Bergen empor, um wieder matt in sich<br />
zusammenzufallen. Aber immer erfolgreicher und dazu von<br />
allen Seiten griffen sie die höchsten Gipfelriesen an. Jetzt<br />
erreichten einzelne Nebelmassen von den seltsamsten Formen<br />
schon den obersten Gipfel, sanken wieder herab, bis sie,<br />
durch die nachrückenden Massen unterstützt, das Feld be<br />
haupteten. Da sehen wir nur noch die drei höchsten Spitzen
172 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
aus dem Nebel herausschauen, und jetzt sind auch sie in<br />
dem Wolkenmeere ertränkt. „Vielleicht wird es noch einmal<br />
wieder klar", sagte ich zu meinem Begleiter. „Darauf ist für<br />
heute nicht mehr zu hoffen", erwiderte er. Wir kehrten sehr<br />
befriedigt zum Hotel zurück. Der Eindruck war uns um so<br />
kostbarer, je mehr der Berg mit seiner Gunst gekargt, und<br />
je gemessener er sie uns schliesslich zugeteilt hatte. Wer<br />
länger in Darjeeling weilt, dem wird wahrscheinlich auch<br />
diese, vielleicht grösste Gebirgsaussicht der Welt zuletzt zur<br />
Gewohnheit werden und nicht mehr viel zu sagen haben.<br />
Vor diesem Schicksal waren wir bewahrt geblieben. Nicht<br />
wir nahmen von dem Berge Abschied, sondern der Berg von<br />
uns, und das ist eigentlich das Schönere.<br />
Um zehn Uhr morgens sagten wir dem lieblichen Dar<br />
jeeling Lebewohl, und wieder führte uns eine kleine tapfere<br />
Lokomotive in demselben Tempo, mit dem wir emporgestiegen<br />
waren, nicht schneller und nicht langsamer, bergabwärts,<br />
nur dass die Fahrt etwas mehr beunruhigte, weil wir jetzt<br />
stets nach unten blickten. Auf der Mittelstation in Korscheong<br />
Bazar, wo die Züge von oben und unten sich begegnen,<br />
sahen wir in flüchtigen Minuten eine alte Bekannte, die<br />
hinauffahren wollte. Es war Mrs. Davidson, eine gute alte<br />
Dame aus Schottland, welche wohl eine ähnliche Rundtour<br />
durch Indien machen wollte, wie wir, nur dass sie in erster<br />
Linie immer diejenigen Leute aufsuchte, welche wir am<br />
meisten zur Seite Hessen, nämlich die Missionare. Von<br />
ihnen geleitet und inspiriert, hat sie ohne Zweifel ein ganz<br />
anderes Bild von Indien mit nach Hause gebracht, als wir<br />
es aus dem Verkehr mit den Eingeborenen gewannen. Wir<br />
hatten in Watson's Hotel zu Bombay zu dreien denselben<br />
Tisch bei den Mahlzeiten, und gelegentlich brachte sie einen<br />
Missionar als vierten Partner mit. Eine solche Gelegenheit<br />
benutzte ich dann wohl, um mich an dem frommen Mann<br />
ein wenig zu reiben. „Ich habe", so erzählte ich, „früher in
Rückfahrt. Mrs. Davidson und ihr Missionar. 173<br />
einem Buche, — vielleicht sind es Grubes geographische<br />
Charakterbilder, — gelesen, dass in den indischen Tier<br />
hospitälern (Pinjra Pol) auch eine besondere Abteilung für<br />
Ungeziefer bestehe, und dass man einige Neger eigens dazu<br />
halte, um auf ihren Köpfen diesen Verkörperungen der<br />
ewigen Weltseele die nötige Nahrung zu bieten. Als ich<br />
kürzlich," so fuhr ich fort, „mit meinen indischen Freunden<br />
das Pinjra Pol besuchte und vergeblich, wie ich schon<br />
denken konnte, nach einer solchen Abteilung fragte, da<br />
lachten mir meine Hindufreunde ins Gesicht und erklärten,<br />
dass es nie dergleichen gegeben habe, und dass das Ganze<br />
nur eine Erfindung der Herren Missionare sei." Erwartungs<br />
voll sah ich den Glaubensboten an meiner Seite an. Als<br />
er mir aber ganz unbefangen entgegnete, dass es wirklich<br />
eine derartige Abteilung im Pinjra Pol gebe oder doch<br />
gegeben habe, da schwieg ich, um nicht zu beleidigen.<br />
Mrs. Davidson also, der wir diese interessante Bekanntschaft<br />
verdankten, war in Bombay unsere Tischgenossin, und als<br />
wir uns zum Abschied die Hände schüttelten, da sagten wir<br />
„auf Wiedersehen", ohne doch an ein Wiedersehen im mindesten<br />
zu glauben. Und da ist es wirklich merkwürdig, dass wir<br />
auf unserem Wege durch Indien mit dieser guten alten Dame<br />
nicht weniger als dreimal, und immer eiligst an einander<br />
vorbei zu gehen genötigt, uns wieder begrüssen konnten.<br />
Das erste Mal war in Korscheong Bazar, das zweite Mal in<br />
Madura im Süden Indiens, und das dritte Mal am Tage vor<br />
unserer Heimreise, in Colombo vor dem Postschalter.<br />
In Siligari am Fusse des Gebirges angelangt, fanden<br />
wir eine weniger gute Verbindung als bei der Hinauffahrt,<br />
sodass wir erst nach Mitternacht über den Ganges setzten,<br />
dessen mächtige Flutmassen in der zauberhaften Beleuchtung<br />
des indischen Vollmondes glitzerten. Halb verschlafen fragte<br />
ich nach der eigentümlichen Bauart der am Ufer dem Ver<br />
kehre dienenden Hallen und Schuppen, welche alle aus
174 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
dünnen Latten bestanden und so. aussahen, als habe man<br />
sie von oben her in den Boden hineingepflanzt. Ich erfuhr,<br />
dass der Fluss sein Bette hier sehr oft ändere, und dass<br />
aus diesem Grunde der ganze Bahnhof mit all seinen<br />
Baulichkeiten leicht transportabel sein müsse. Weiter fuhren<br />
wir durch die tiefe indische Nacht, begrüssten die auf<br />
gehende Sonne hier an dem östlichsten Punkte der ganzen<br />
Reise und liefen am Nachmittag wohlbehalten in Dum Dum,<br />
der letzten Station vor Calcutta, ein. Hier trafen wir mit<br />
Mr. Roy und dessen Familie der Absprache nach zusammen,<br />
um die hier eröffnete landwirtschaftliche Ausstellung in<br />
Augenschein zu nehmen. Da gab es Pferde, Ochsen, Kühe<br />
mit ihren Kälbern, landwirtschaftliche Maschinen usw. Das<br />
alles hatte wenig Reiz für mich, und ich wunderte mich,<br />
dass der Strom der Besucher, in dem wir fortgetragen<br />
wurden, mehr Interesse für diese Trivialitäten zeigte als für<br />
die wunderbare Umgebung des- Tropenlandes, und mehr<br />
Interesse für uns europäische Blassgesichter als für die<br />
braunen Gesichter und die malerischen Trachten ihres<br />
eigenen Volkes.<br />
Mit der Familie Roy zogen wir in Calcutta ein, um<br />
weiterhin die Gastfreundschaft ihres Hauses zu geniessen<br />
und zum ersten Male den Reiz des indischen Familienlebens<br />
kennen zu lernen. Die Schwester von Mrs. Roy, die zarte<br />
liebliche Miss Cakravarti (von den Engländern in Chucker-<br />
butty verquatscht), — dieselbe, welche man in England<br />
meuchlings zur Christin umgeknetet, ohne dass es der lieb<br />
reizenden Unschuld ihres Wesens geschadet hätte, — diese<br />
räumte uns ihr Zimmer ein, wo wir denn unter Nippsachen,<br />
Photographien und zierlichen Malereien uns ausbreiten<br />
durften. Ausser ihr und dem Ehepaar Roy waren noch<br />
deren Kinder, zwei reizende kleine Hindumädchen vorhanden,<br />
welche, wie gewöhnlich in Indien, von einer zahlreichen<br />
Dienerschaft umgeben waren; denn ohne ein Dutzend Diener
Tierschau in Dum Dum. Eine indische Haushaltung. 175<br />
kann ein wohlgeordneter Haushalt in Indien nicht bestehen.<br />
Da ist zunächst als oberster der Kammerdiener, der die<br />
Garderobe des Herrn in Ordnung hält und auch bei Tisch<br />
aufwartet, sodann eine Kammerjungfer zur Bedienung der<br />
Frau des Hauses und eine Kinderfrau für die Kleinen.<br />
Letztere wird auch häufig nach Europa mitgenommen, und<br />
in London ist sie unter dem Namen Äyä wohlbekannt und<br />
überall anzutreffen. Weiter folgt in der Hierarchie der<br />
Dienerschaft der Koch (Bävarchi), eventuell mit Gehülfen, der<br />
Pförtner, der Kutscher, der Waschmann, deren jedes Haus<br />
schon wegen der Ansteckungsgefahr seinen eigenen hat, der<br />
Gärtner (Mali), der Wasserträger oder Bhisti und endlich,<br />
als unterster in dieser Klimax, der Mehtar (von den Eng<br />
ländern auch Sweeper genannt), welcher immer auf der Lauer<br />
liegen muss, um alle Exkremente sofort in den hierzu<br />
dienenden Porzellaneimern zu beseitigen. Ein indisches<br />
Haus ist daher in der Regel sehr sauber, appetitlich und<br />
geruchlos, zumal auch die Küche nicht im Hause, sondern<br />
in einem Nebengebäude zu sein pflegt. An Gehalt erhalten<br />
diese Diener von 20 bis herab zu 5 Rupien monatlich, also<br />
zwischen 30 und 7 Mark. Ausser diesem gewiss sehr<br />
niedrigen Lohn bekommen sie gar nichts, weder Essen, noch<br />
Kleidung oder Wohnung. Sie wohnen irgendwo in der<br />
Nachbarschaft mit ihrer Familie, kommen nur, um die ihnen<br />
obliegenden Dienste zu verrichten, und gehen dann wieder<br />
nach Hause. Im ganzen mögen die Kosten der Bedienung<br />
für ein Haus sich auf etwa 150 Mark monatlich belaufen.<br />
Mr. Roy hat uns alle die folgenden Tage in Calcutta<br />
nicht nur in der freigebigsten Weise logiert, gespeist und<br />
getränkt, sondern er war auch unablässig darauf bedacht,<br />
uns neue und wertvolle Eindrücke zu verschaffen. Einer der<br />
interessantesten war der folgende.<br />
Es hielt sich damals in Calcutta eine hochheilige Büsserin<br />
auf, und ein Freund von Mr. Roy erbot sich, mir eine Audienz
176 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
bei ihr um acht Uhr morgens zu verschaffen. Ein Diener holte<br />
mich und meine Frau früh morgens ab und erzählte von der<br />
Heiligen allerlei Wunderdinge. Sie sei eine Prinzessin aus<br />
dem Süden, besitze 6 Laksha (6 x 100 000) Rupien, habe<br />
aber alles weggegeben, um als Sannyäsint zu leben; niemand<br />
kenne ihr Alter, man glaube, sie sei hundert Jahre alt, und dabei<br />
sehe sie aus wie ein junges Mädchen etc. Unter diesen<br />
Gesprächen kamen wir zum Hause des Freundes und Hessen<br />
uns melden, mussten aber geraume Zeit in dem von dem<br />
Hause umschlossenen, geräumigen und wohnlichen Hofraume<br />
warten. Der Herr, hiess es, verrichte eben seine Pujä<br />
(Morgenandacht), und darin dürfe ihn niemand stören. Wir<br />
waren also aus dem in dem Roy'schen Hause herrschenden<br />
Freisinn in die Region des frommen Indiens gelangt. Endlich<br />
kam der Freund, und nun ging es zur Büsserin. Wir wurden<br />
eine Treppe hoch in ein geräumiges, aber vollkommen leeres<br />
Zimmer geführt; nur ein einfacher Teppich überdeckte den<br />
ganzen Fussboden. Die Heilige erschien, und ich verneigte<br />
mich, wagte aber nicht, ihr die Hand zu reichen. Sie war<br />
durchaus einfach aber anständig gekleidet, von den schwarzen<br />
aufgelösten Haaren an, welche lang auf beide Schultern<br />
herunterfielen, bis herab zu den Strümpfen, auf denen sie<br />
mich empfing. Ihr Wesen war ruhig und anspruchslos; alles<br />
an ihr machte den Eindruck einer gutherzigen, mütterlichen<br />
Matrone zwischen 40 und 50 Jahren. Sie sprach ganz gut<br />
Sanskrit, und ich legte ihr unter anderem die Frage vor,<br />
welches von den sechs philosophischen Systemen das beste<br />
sei. Sie antwortete, dass alle miteinander gut seien, eine<br />
Äusserung, welche mich jetzt weniger überraschen würde als<br />
damals. Denn in gewissem Sinne ergänzen sich die sechs philo<br />
sophischen Systeme zu einer einheitlichen Weltansicht. Die<br />
Mimähsä steht in der Vorhalle der Philosophie, da sie nur<br />
das Ritual logisch verarbeitet und alle dabei auftauchenden<br />
Pro's und Contra's dialektisch verfolgt. Der Vedänta ist die
Audienz bei einer Heiligen. Die sechs Systeme. 177<br />
eigentliche Metaphysik Indiens, das Säiikhyam nur eine re<br />
alistische Umgestaltung eben dieser, schon in den ältesten<br />
Upanishad's vorliegenden Vedänta-Metaphysik. Zwischen<br />
diesen beiden Systemen ist der Gegensatz noch am grössten,<br />
ohne doch die innere Verwandtschaft aufzuheben. Der Yoga<br />
ist die praktische Seite der Ätmanlehre, nicht Moral, denn<br />
wer diese Welt als Illusion erkannt hat, ist über gute und<br />
böse Werke hinaus, sondern der Yoga ist eine eigentümliche<br />
Technik, durch Vertiefung in das eigne Innere dort das<br />
Brahman, den Ätman unmittelbar zu ergreifen. Was endlich<br />
den Nyäya und das Vaigeshikam betrifft, so bietet der erstere<br />
einen allgemein gültigen Kanon der Logik und noch mehr<br />
der Eristik, das letztere eine naturwissenschaftliche Klassi<br />
fikation alles Seienden unter sechs Kategorien.<br />
Die Antwort der Büsserin auf meine Frage lässt sich also<br />
von dem unhistorischen Standpunkte, auf dem alle Inder<br />
stehen, ganz wohl begreifen. Unhistorisch war freilich auch<br />
die Antwort, die sie mir gab, als ich es wagte, das hundert<br />
jährige junge Mädchen nach seinem Alter zu befragen;<br />
najnäyate, „das ist nicht bekannt," war ihre einfache Antwort.<br />
Nun aber kam das Fragen auch an sie, und ihre Haupt<br />
frage war, aus welcher Kaste ich sei? Da alle nicht brah-<br />
manischen Inder eo ipso zur Kaste der Cüdra's, der Ver<br />
worfenen, gehören, so hatte ich mich früher, wie schon be<br />
richtet wurde, des öfteren für einen Qüdra erklärt, begegnete<br />
aber dabei einem solchen Befremden in den Mienen der<br />
Hörer, dass ich weiterhin ein anderes Märlein erfand, indem<br />
ich mich für einen Brahmanen ausgab, der durch eine in<br />
der früheren Geburt begangene Sünde zum Qüdra, zum Eu<br />
ropäer herabgesunken sei und hoffen dürfe, in einer nächsten<br />
Geburt wieder zum Brahmanen zu werden. Diesen Scherz,<br />
der viel belacht zu werden pflegte, beschloss ich auch vor<br />
der Büsserin zum besten zu geben, kam aber dabei nicht<br />
an die rechte. Kaum hatte ich mich dafür erklärt, in meiner<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 12
178 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
vorigen Geburt ein Brahmane gewesen zu sein, als sie mich<br />
unterbrach und in strengem Tone fragte, woher ich das<br />
wisse? Ich antwortete: „Es werde gehört! Der erlauchte<br />
Kälidäsa sagt in der Cakuntalä:<br />
Wenn bei dem Anblick schöner Gegenstände,<br />
Bei süssen Tönen Sehnsucht unsern Geist,<br />
Auch wenn wir glücklich sind, oft übermannt,<br />
So kommt dies, weil wir, wenn auch unbewusst,<br />
An Freundschaften, noch wurzelnd tief im Innern,<br />
Aus früheren Geburten uns erinnern."<br />
„Seit meinem ersten Bekanntwerden mit der Sanskrit<br />
sprache," fuhr ich fort, „fühlte ich mich zu ihr in so starker<br />
Freundschaft hingezogen, dass ich glauben muss, in einer<br />
früheren Geburt schon Sanskrit gesprochen zu haben, also<br />
ein Brahmane gewesen zu sein."<br />
Diese Argumentation war für die gute Matrone über<br />
zeugend, und als ich weiter schilderte, wie ich durch eine<br />
schwerere Sünde zum Cüdratum, zum Europäertum, herabge<br />
sunken sei, da malte sich in ihren Zügen das tiefste Mitleid;<br />
und als ich mit gehobener Stimme fortfuhr: „Jetzt aber, nach<br />
dem ich Indien besucht, in Benares geweilt, Dich, o Heilige,<br />
gesehen habe, darf ich hoffen, bei der nächsten Geburt wieder<br />
ein Brahmane zu werden", — da rollten der frommen Frau<br />
die hellen Tränen über Wangen und Brust, welche sie von<br />
beiden Seiten mit den herabhängenden Haaren abtrocknete.<br />
Endlich war die Audienz zu Ende; die hohe Frau ver<br />
abschiedete sich, und als auch wir die Türe gewonnen, da<br />
stand dort ein Diener und belud uns mit einer Menge kost<br />
barer indischer Süssigkeiten, mit welchen wir für die Welt<br />
nichts anzufangen wussten, und froh waren, sie den Roy'schen<br />
Kindern zum Geschenk machen zu können.<br />
Am Nachmittage dieses glorreichen Tages machte ich<br />
mit Mr. Roy einen Besuch bei dem auch in Europa wohl<br />
bekannten, aber mehr berüchtigten als berühmten Heraus-
Meine Kaste. Besuch bei Jivänanda Vidyäsägara. 179<br />
geber zahlreicher Sanskrittexte, Jivänanda Vidyäsägara, und<br />
fand ihn, ganz wie er sich auf dem Bilde vor seinen Aus<br />
gaben zeigt, mit untergeschlagenen Beinen auf einem niedrigen,<br />
aber sehr langen und breiten Tisch sitzend, von Manuskripten<br />
und Büchern umgeben. Sein Vater, Väcaspatimigra, ist der<br />
Herausgeber eines überaus reichhaltigen, vier dicke, engge<br />
druckte Lexikonbände füllenden, encyklopädischen Sanskrit<br />
wörterbuches, welches in Europa fast ganz unbekannt ist, da<br />
es meines Wissens auch in Böhtlingk's und Roth's Wörter<br />
buch nirgendwo citiert wird, während sie doch auf den<br />
Cabdakalpadruma, das grosse aber viel weniger reichhaltige<br />
Parallelwerk, des öfteren verweisen. Beide Encyklopädien<br />
werden in Indien viel gebraucht und suchen bei einer neuen<br />
Auflage das Schwesterwerk zu benutzen und zu überbieten.<br />
Eben erschien eine neue Ausgabe des Cabdakalpadruma, auf<br />
welche ich für den geringen Preis von 70 Rupien subskri<br />
bierte, und die auch späterhin bis zum Letzten vollständig<br />
in meine Hände gelangt ist. Neben diesem wollte ich auch<br />
das Väcaspatyam haben und erstand es in vier sehr starken,<br />
gut gebundenen Bänden für 100 Rupien (damals 125, jetzt<br />
133,3 Mk.). Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich von Jivänanda,<br />
wie unglaublich billig in Indien der Buchbinderlohn ist, so<br />
dass er auch bei starken Bänden noch nach Pfennigen be<br />
rechnet werden kann. Weiter kaufte ich noch eine Menge<br />
Bücher aus der Offizin des Jivänanda, deren Gebrauch wegen<br />
ihrer Unkorrektheit zwar nicht anzuraten ist, die aber in Er<br />
mangelung anderer Ausgaben doch gute Dienste leisten können,<br />
zumal die schwierigen Texte von Jivänanda mit einem<br />
kurzen, von ihm selbst verfassten oder kompilierten Kom<br />
mentare versehen zu sein pflegen. Der Mann mag ein ganz<br />
bedeutender Polyhistor sein und war als solcher nicht frei<br />
von Eitelkeit. „Ich habe", sagte er, „in meine Ausgaben mehr<br />
als 600000 Rupien gesteckt; jeden Tag lasse ich über vierund<br />
sechzig Seiten drucken und schreibe deren wohl gegen vierzig."<br />
12*
180 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
Ich erwiderte, dass man ihn in Europa höher schätzen würde,<br />
wenn er weniger und das Wenige um so korrekter drucken<br />
lassen wollte. Er antwortete: das.komme daher, dass er<br />
oft durch Überarbeitung krank sei und dann die Arbeit frem<br />
den Händen überlassen müsse. Zuletzt kamen wir auf das<br />
Versemachen im Sanskrit, und er sprach: „jetzt will ich<br />
Ihnen einen Vers aufschreiben, und ich wette, dass Sie den<br />
Sinn nicht herausbekommen sollen, wie Sie sich auch<br />
immer stellen". Er schrieb den Vers, den ich noch unter<br />
meinen Papieren aufbewahre, und ich erwiderte nur, dass<br />
man es bei uns höher schätze, wenn jemand Verse schreibe,<br />
die jeder, als solche, die niemand verstehe. Wir füllten die<br />
grosse Kiste bis an den Rand mit Büchern, und ich bezahlte<br />
das Ganze wie" auch die Fracht, welche von Calcutta bis<br />
Hamburg nur 7 Rupien kostete. Ungefähr ebensoviel betrug<br />
dann noch die Fracht von Hamburg bis Kiel, wobei<br />
eine lange Rechnung für Ausbootung, Landung, Zollrevision<br />
etc. etc. aufgestellt war. Aber wovon,sollten wohl die Ham<br />
burger Agenten, Joller und Jobber leben, wenn sie es nicht<br />
auf diese Weise anfingen?<br />
Wir wollten Calcutta nicht verlassen, ohne seinem welt<br />
berühmten botanischen Garten einen Besuch abzustatten.<br />
Schon früher hatten wir einen solchen mit Frau Dr. Hörnle ge<br />
plant, deren Gemahl damals Prinzipal des mohammedanischen<br />
Madrasa College in Calcutta war, aber begreiflicherweise<br />
seine Hauptinteressen im Sanskrit stecken hatte. So zeigte<br />
er mir nach einem angenehm in seinem Hause verbrachten<br />
Abende auch die beiden buddhistischen Handschriften medi<br />
zinischen Inhaltes aus dem vierten Jahrhundert p. C, welche<br />
damals vor kurzem gefunden worden waren und wegen ihres<br />
hohen Alters Aufsehen erregten. An diesem Abende wurde<br />
auch für den folgenden Tag ein Ausflug in den botanischen<br />
Garten verabredet, der aber- nicht zu stände kam, weil es in<br />
der Nacht ziemlich stark geregnet hatte, und der Aufenthalt
Der botanische Garten. Der Nyagrodhabaum. 181<br />
in einer feuchten Pflanzenluft in Indien leicht Fieber nach<br />
sich ziehen kann. Erst kurz vor unserer Abreise kamen wir<br />
nun doch noch dazu, mit der Familie Roy den botanischen<br />
Garten zu besuchen. Derselbe Hegt nördlich von der Stadt,<br />
jenseits des Hughli, und da auch Roy's Wohnung im Norden<br />
von Calcutta lag, so konnten wir uns den langen Umweg<br />
nach Süden über die Hughlibrücke und wieder nach Norden<br />
ersparen, wenn wir direkt im Boot über den Strom fuhren<br />
und am botanischen Garten landeten. Ein Boot mit einem<br />
Dutzend uniform gekleideter Ruderer wurde von Freund<br />
Mullik zur Verfügung gestellt, und so fuhren wir in vor<br />
nehmster Weise über die gelben Fluten der Gaiigä, deren<br />
einen Arm der Hughli bildet, und landeten an einem kleinen<br />
Treppchen, welches direkt in den schönsten Teil des weit<br />
ausgedehnten botanischen Gartens führte. Gleich beim Ein<br />
tritte gelangten wir in eine breite und lange Allee, welche<br />
auf beiden Seiten von hohen Palmbäumen umgeben war,<br />
die, alle von gleicher Grösse, gleicher Art und gleichem<br />
Wüchse, einen Anblick von überwältigender Schönheit boten.<br />
Aber auch weiter trat dem Beschauer überall, wohin er das<br />
Auge richtete, die Herrlichkeit der tropischen Pflanzenwelt<br />
in ihrer vollsten Entfaltung entgegen. Vorüber an geschmack<br />
vollen Anlagen mit Baumgruppen, Schlingpflanzen, Blumen<br />
beeten gelangten wir zu der grössten Sehenswürdigkeit des<br />
Gartens, dem grossen Nyagrodha-Baum. Dieser Baum, ficus<br />
Indica, dessen Sanskritname, „der nach unten Wachsende"<br />
bedeutet, sendet seine Zweige nach unten, wo sie unter<br />
günstigen Umständen den Boden erreichen, dort Wurzel<br />
schlagen und zu neuen Stämmen erstarken, sodass schliess<br />
lich aus dem einen Baume ein ganzer Wald wird. Jedoch<br />
ist dieses Resultat selten, so häufig auch der Nyagrodha<br />
baum ist, den man in Gärten und an der Landstrasse überall<br />
antrifft. Gewöhnlich erreichen die nach unten strebenden<br />
Zweige gar nicht den Erdboden und treiben ihre Wurzeln
182 VI. Calcutta und der Himälaya.<br />
in der Luft, wo sie dann verkümmern. Nur bei einigen<br />
Nyagrodhabäumen, die in ganz Indien als Sehenswürdig<br />
keiten berühmt sind, ist die Entwicklung des Hauptstammes<br />
zu einem Komplex von Stämmen gelungen. Das berühmteste<br />
Beispiel ist der Baum, von dem wir reden, im botanischen<br />
Garten zu Calcutta. Nicht nur beim Anblicke einer Abbildung<br />
desselben, sondern auch wenn man persönlich unter seinen<br />
Stämmen umherspaziert, ist es schwer, den Zusammenhang<br />
des Ganzen aufzufassen. Von dem durch seine Dicke leicht<br />
erkenntlichen Hauptstamme geht ein mächtiger Ast nach<br />
der Seite hin, dieser wiederum sendet seine Nebenäste seit<br />
wärts, und von allen diesen Ästen und Nebenästen laufen<br />
neue Stämme nach unten in den Boden. Eine Anzahl<br />
derselben ist schon zu stattlichen Baumstämmen erstarkt,<br />
viele andere sind noch in der Entwickelung begriffen und<br />
werden künstlich in Hülsen von Bambusrohr nach dem<br />
Boden geleitet.<br />
Wir verzichten darauf, die übrigen zahlreichen Sehens<br />
würdigkeiten von Calcutta zu besprechen. Der zoologische<br />
Garten, die weite Maidan-Ebene, auf der wir in der Morgen<br />
frühe spazieren gingen, bis die Sonne, uns vertrieb, das<br />
Antiquitätenmuseum, der Edengarten mit seiner aus Hinter<br />
indien importierten siamesischen Pagode, das Museum der<br />
asiatischen Gesellschaft, welches ich auf dem Umschlag<br />
der Hefte der Bibliotheca Indica so oft mit Sehnsucht be<br />
trachtet hatte, das alles mag hier nur genannt werden.<br />
Auch so manche freundliche, ja herzliche Berührungen mit<br />
Eingeborenen verschiedener Stände, die sich von Tag zu<br />
Tage mehrten, müssen hier übergangen werden. Am 8.<br />
Februar 1893 packten wir unsere Koffer, um am Abend ab<br />
zureisen. Als sinniges Andenken an Calcutta schenkte mir<br />
Mrs. Roy einen Huqqa (Wasserpfeife), bestehend aus einer<br />
Kokosnuss, in welche von oben her der Rauch bis ins<br />
Wasser geleitet wird. Ein zweites Loch in der oberen,
Seite 128.<br />
cd<br />
*s<br />
3<br />
O<br />
u<br />
cd<br />
o<br />
c<br />
tu<br />
J3<br />
O<br />
cd<br />
cd<br />
<strong>•</strong>a<br />
o<br />
cd<br />
I?
Abschied von Calcutta. Der Huqqa. 183<br />
wasserfreien Hälfte der Kokosnuss wird art den Mund ge<br />
bracht, um den Rauch herauszusaugen. Da der brennende<br />
Tabak in einem tönernen Kopfe senkrecht über der Kokos<br />
nuss balanciert, so darf das Ganze nicht aus derperpendikulären<br />
Lage gebracht werden, und es sieht äusserst possierlich<br />
aus, wenn der Rauchende sich bei jedem Zuge mit Mund,<br />
Kopf und Hals an die Kokosnuss anschmiegt. Ein hinein<br />
gestecktes Röhrchen würde diese Unbequemlichkeit heben;<br />
aber die wenigsten erlauben sich einen solchen Luxus. Der<br />
gewöhnliche Raucher, wie man ihn in Calcutta vor der Tür<br />
seiner Hütte an der Strasse sitzen sieht, trinkt den Rauch<br />
unmittelbar aus dem in die Kokosnuss gebohrten Loch.<br />
Anders und viel künstlicher mit Glasbehälter und Schlauch<br />
ausgestattet sind die Wasserpfeifen in den türkischen Ländern.<br />
Sie heissen dort Nargileh, welcher Name aus dem Persischen<br />
stammen soll. Indes gebe ich zu bedenken, dass närikela<br />
im Sanskrit die Kokosnuss bedeutet, und dass die indische<br />
Wasserpfeife statt der in der Türkei üblichen Glaskaraffe.<br />
noch heute als Hauptbestandteil eine wirkliche Kokosnuss<br />
hat. Es dürfte also der Name und mit ihm der ganze Ge<br />
brauch aus Indien stammen und von dort erst nach den<br />
westlichen Ländern gelangt sein.
Siebentes Kapitel.<br />
Von Calcutta über Allahabad nach Bombay.<br />
Am Abend des 8. Februar brachte uns Freund Roy zum<br />
Bahnhofe, und dort hatte sich noch ein grösserer Kreis<br />
der in Calcutta gewonnenen Bekannten und Freunde ein<br />
gefunden. Leider war die Abschiedsstunde eine sehr un<br />
behagliche, denn der Zug war ein mail train, "d. h. ein<br />
solcher, der in Bombay (bis wohin er drei Nächte und zwei<br />
Tage braucht) an den Postdampfer nach Europa anschliesst,<br />
und diese Züge sind in der Regel sehr überfüllt. Eine<br />
ungeheure Menge wogte auf dem Perron auf und nieder.<br />
Auch in der ersten Klasse war kaum unterzukommen, sodass<br />
ich meine Frau im Damencoupe placierte und für mich<br />
anderswo einen Liegeplatz eroberte, denn ein solcher wird<br />
für die Nacht den Reisenden der ersten Klasse von der<br />
Gesellschaft garantiert. Schon auf einer der nächsten<br />
Stationen wurde mehr Platz, indem zwei junge Engländer,<br />
welche die oberen Lager einnahmen, ausstiegen. Während der<br />
Zug einlief, krochen sie gemächlich herunter und fingen an,<br />
ihre Toilette zu ordnen. Der Zug hielt; sie zogen die Stiefel<br />
an, banden die Cravatte vor, — erstes Zeichen zur Abfahrt,<br />
sie setzten die Hüte auf und schlössen ihre Koffer, — zweites<br />
Zeichen, der Zug setzte sich langsam in Bewegung, — der<br />
eine stieg aus, nahm nebenher laufend das Gepäck an, der
Von Calcutta nach Allahabad. Professor Thibaut. 185<br />
andere aber, ganz kaltblütig, tappte noch nach diesem und<br />
jenem, und der Zug bewegte sich schon mit einer ziemlichen<br />
Geschwindigkeit, als der junge Mann ganz pomadig hinaus<br />
kletterte und noch glücklich unten ankam. Eine gewisse<br />
Verwegenheit ist den Engländern eigen, und doch läuft alles<br />
gut ab, denn sie wissen sehr genau, wie viel sie riskieren<br />
können.<br />
Am andern Morgen hielt der Zug in Moghal Sarai,<br />
gegenüber von Benares, und hier begrüsste mich, wie bereits<br />
erzählt, noch einmal Govind Das und lief, den Colonel Oleott<br />
zu holen, um uns mit einander bekannt zu machen. Die<br />
Scene war nur von kurzer Dauer, denn sie blieben, und ich<br />
musste weiter. Ich warf noch einen verehrungsvollen Blick<br />
auf die heilige Stadt, die sich drüben jenseits des Ganges<br />
im Morgenglanz auftürmte, und einen zweiten weniger ver<br />
ehrungsvollen auf den gefeierten Häuptling der Theosophisten<br />
und seinen getreuen Adepten, und weiter ging es am süd<br />
lichen Ufer des Ganges hin, bis wir um drei Uhr nachmit<br />
tags in Prayäga einliefen, einer Stadt, deren heiliger Name<br />
von den Mohammedanern getilgt und durch das persische<br />
Allahabad ersetzt wurde, ähnlich wie ihre Brüder im Westen<br />
in der Hagia Sophia die Gesichter der Engel auskratzten<br />
und dafür Sterne aufpinselten.<br />
Wir verliessen den Zug und fuhren in Laurie's Hotel.<br />
Eben überlegte ich, was zu tun sei, um hier den mir be<br />
kannten Professor Thibaut, mit dem ich im Sommer 1866 bei<br />
Weber Qakuntalä gehört, aufzusuchen; da las ich auf der Hotel<br />
tafel unter anderen Namen auch die Worte: Professor Thibaut<br />
und Familie. Er lebte bis zum Auffinden einer passenden<br />
Wohnung mit seiner Frau und zwei Kindern hier im Hotel,<br />
während er sein Amt als Professor des Sanscrit College in<br />
Allahabad versah. Er lehrte dort als geborener Deutscher<br />
merkwürdigerweise Englisch, während sein prineipal und<br />
philosophischer Berater Gough das Sanskrit vertrat. Beide
186 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
sind sehr achtbare Forscher auf dem Gebiete der indischen<br />
Philologie, aber ein tieferes Verständnis für die Philo<br />
sophie der Inder kann ich weder dem einen noch dem an<br />
dern zusprechen, so sehr sie sich auch beide um dieselbe<br />
bemüht haben. Ihre persönliche Erscheinung war so ver<br />
schieden wie möglich: Mr. Gough, ein hochgewachsener,<br />
wohlbeleibter Engländer, immer vergnügt, lachend und jovial,<br />
während Thibaut ein ernstes und in sich gekehrtes Wesen<br />
zeigte. Thibaut erzählte mir, dass er täglich vier Stunden<br />
zu unterrichten habe. Hiernach werden, wie es scheint, die<br />
in Indien wirkenden Professoren zwar viel höher bezahlt, aber<br />
auch viel mehr ausgenutzt, als ihre deutschen Kollegen.<br />
Ich beeilte mich, der Familie Thibaut, ehe wir beim<br />
Abendessen im Hotel zusammentrafen, noch meinen Besuch<br />
zu machen, und so setzten wir uns auch zu den Mahlzeiten<br />
an einem isolierten Tische zusammen. Unsere Auffassungen<br />
von Indien waren sehr verschieden. Thibaut segnete die<br />
englische Fremdherrschaft, da durch sie erst Ordnung und<br />
Zustände, mit denen sich leben lasse, ins Land gebracht<br />
worden seien. Auch die Schönheit des Landes fand in ihm<br />
keinen rückhaltlosen Bewunderer. So stehe Indien, meinte<br />
er, darin gegen Europa zurück, dass es zwar Gartenblumen,<br />
aber keine wilden Blumen habe, eine Behauptung, die in<br />
dieser Ausdehnung doch wohl nicht verstanden sein wollte;<br />
denn wo es keine wilden Blumen gibt, woher sollen da die<br />
Gartenblumen kommen? Oder haben vielleicht erst die Eng<br />
länder diese hereingebracht, sodass die in der altindischen<br />
Poesie so häufigen, vom Himmel herabfallenden Blumen<br />
regen von irgend einem anderen Planeten herabgekommen<br />
wären? — Noch schwerer wurde es mir, mich mit Mrs.<br />
Thibaut zu verständigen. Wenn wir auf die Eingeborenen<br />
zu sprechen kamen, so äusserte sie sich in so scharfer, weg<br />
werfender Weise, dass ich auf Grund meiner persönlichen<br />
Erfahrungen nicht umhin konnte, ihr entschiedener entgegen-
Mr. Gough. Besuch von Prayäga. 187<br />
zutreten, als man es sonst einer blossen Vertreterin des<br />
schönen Geschlechts gegenüber zu tun pflegt.<br />
Neben diesen etwas kühlen Berührungen machte sich<br />
die Wärme, mit der die Inder mir auch hier entgegenkamen,<br />
um so mehr fühlbar. Kaum war unsere Ankunft ruchbar ge<br />
worden, so stellten sich am ersten Abend noch vor Ende<br />
der Table d'hote ein halbes Dutzend Besucher ein, und da<br />
ich übermorgen schon Weiterreisen musste, so wurde für den<br />
folgenden Tag ein sehr reiches Programm entworfen. Der<br />
erste Besuch sollte natürlich der hochheiligen Stätte des Zu<br />
sammenflusses von Gangä und Yamunä gelten, darauf der<br />
Besichtigung der übrigen Sehenswürdigkeiten, und gegen<br />
Abend sagte ich dann zu, einen Vortrag über die Vedänta-<br />
philosophie zu halten, zu welchem ein junger Advokat,<br />
Roshan Läl, in der Eile Einladungszettel drucken und ver<br />
breiten Hess, wie er denn auch für alles Weitere zu sorgen<br />
übernahm. Krishna Joshin hinwiederum hatte sich erboten,<br />
uns am andern Morgen früh mit einem Wagen abzuholen,<br />
und so eilig geschah unser Aufbruch, dass ich meine ganze<br />
Barschaft, bestehend in einem fingerdicken Pack von Zehn-<br />
Rupien-Scheinen, unter dem Kopfkissen liegen Hess. Ich Hess<br />
nochmals zurückfahren, angeblich, um meinen Diener Purän,<br />
mehr aber noch, um mein Banknotenpäckchen zu holen und<br />
durch Mitnahme beider beide vor einander in Sicherheit zu<br />
bringen. Purän hatte die Betten schon gemacht, und das<br />
Vermisste lag anscheinend unberührt unterm Kopfkissen. Ich<br />
musste daraus schliessen, dass Purän sehr ehrlich war, oder<br />
dass er seine Betten sehr schlecht zu lüften pflegte. Er<br />
leichterten Herzens fuhren wir durch die grosse volkreiche<br />
Stadt über die Yamunä und kamen endlich nach Prayäga,<br />
dem „Opferplatz", der auch Triveni heisst, d. h. „die drei<br />
fache Locke", weil hier drei Flüsse ihre Wasser vereinigen,<br />
die Gangä, die Yamunä und als dritter die nur in der Ein<br />
bildung bestehende himmlische Gangä. Die letzte vor-
188 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
springende Landzunge zwischen beiden Flüssen ist zwar un<br />
bewohnt und unbebaut, hat aber doch nichts von der schauer<br />
lichen Erhabenheit, wie man sie etwa in Delphi oder am<br />
Herthasee empfinden mag. Die schon öfter erwähnte Nei<br />
gung der Inder, Religion und Sport zu kombinieren, kommt<br />
auch hier zum Ausdrucke. Eine bunte, fröhliche Menge<br />
tummelt sich zur morgendlichen Badezeit auf Prayäga. Die<br />
einen plätschern lustig im Wasser, die andern trocknen am<br />
Ufer ihre Kleider, plaudern, lachen und scherzen; allerlei<br />
Messbuden sind aufgeschlagen, an Blumen und Süssigkeiten<br />
ist kein Mangel, Bettler und Gaukler drängen sich durch die<br />
festlich gestimmte Menge und halten reichliche Ernte. Wir<br />
nahmen eines der zahlreichen Boote und Hessen uns zu der<br />
Stelle rudern, wo die blauen Wasser der Yamunä mit den<br />
gelben Fluten der Gangä zusammenstossen, um dann in<br />
trüberem Gemische zusammen fortzugleiten. Die fröhlichen<br />
Gruppen am Ufer, die weite sonnebeglänzte indische Land<br />
schaft, die hochragende Stadt als Abschluss in der Ferne,<br />
das alles wäre ein Schauspiel für Götter gewesen; denn der<br />
Mensch erträgt eine solche Fülle von Eindrücken, wie sie unsere<br />
Reise bot, nicht, ohne zuletzt in etwas abgestumpft zu werden.<br />
Unsern Rückweg nahmen wir über das Fort und be<br />
sichtigten hier, wie vormals bei Delhi, die berühmte Säule,<br />
welche mit den Edikten des buddhafreundlichen, aber gegen<br />
alle Religionen toleranten Königs Agoka geschmückt ist, an<br />
die sich verschiedene Inschriften aus späterer Zeit anschliessen.<br />
Ganz in der Nähe stiegen wir in ein Gewölbe hinunter, um<br />
den wunderbaren Akshaya Bata, den „unvergänglichen Feigen<br />
baum" zu beschauen, welcher in einem kellerartigen Räume<br />
unter Ausschluss von Licht und freier Luft wächst und doch<br />
nie abstirbt, unzweifelhaft ein Wunder, — wenn nicht viel<br />
leicht von Zeit zu Zeit ein wenig nachgeholfen werden sollte.<br />
Der Rest des Vormittags wurde mit Besichtigung der<br />
Stadt und Besuchen ausgefüllt. Gleich nach dem Tiffin nahm
Das Fort. Vortrag in Allahabad. 189<br />
mich eine Anzahl Pandits in Beschlag, bis um vier Uhr Roshan<br />
Läl erschien, um mich zum Thee in seinem Hause abzuholen<br />
und von dort in die Vorlesung zu geleiten. Der geräumige<br />
Saal füllte sich erst allmählich, während ich, auf meinem<br />
Katheder zwischen zwei Kandelabern thronend, mich ruhig<br />
von den Versammelten betrachten Hess und in der Geschwin<br />
digkeit Anfang, Mitte und Ende meines Vortrags überdachte.<br />
Zur "Vorbereitung hatte ich keine Zeit gehabt, aber der<br />
Gegenstand war mir in seiner allgemeinen Gliederung und<br />
in allen Einzelheiten so vertraut, dass ich mich ruhig der<br />
Gunst des Augenblickes anbefehlen konnte. Diese Hess mich<br />
denn auch nicht im Stiche. Als der Saal sich mit Sitzenden<br />
und Stehenden ganz gefüllt hatte, Hess ich Türen, Fenster<br />
und Läden schliessen und entwickelte mit dem Feuer und<br />
Nachdruck eines Überzeugten den Vedänta in seiner allein<br />
ernst zu nehmenden monistischen Advaita-Form, indem ich,<br />
unbekümmert um die Standpunkte meinet Zuhörer, alle an<br />
deren Formen, wie denn namentlich auch die theistische,<br />
als empirische Entartungen charakterisierte. Auch hier wurde<br />
mir, nachdem ich geendet, mit echt indischer Naivität die<br />
Bitte unterbreitet, mit Rücksicht auf diejenigen Anwesenden,<br />
welche des Englischen unkundig seien, meinen Vortrag noch<br />
einmal auf Sanskrit zu wiederholen. Ich willfahrte in der<br />
Kürze, und nun begann die Diskussion, welche für den Ernst<br />
und Eifer, mit dem man in Indien die Philosophie treibt, ein<br />
sprechendes und für Europa beschämendes Zeugnis ablegte.<br />
Die einen sprachen Englisch, die anderen Sanskrit, noch<br />
andere Hindi. Neben zustimmenden Äusserungen stiess ich<br />
auch auf ernsten Widerspruch, namentlich von Seiten derer,<br />
welche sich an einem unpersönlichen Brahman nicht genügen<br />
lassen und seine Personifikation als Igvara nicht als blosse<br />
Akkomodation an das auf empirische Anschauungen be<br />
schränkte menschliche Erkenntnisvermögen gelten lassen<br />
wollten. Ihnen wurde wiederum von anderen widersprochen,
190 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
und so wogte der Kampf der Meinungen hin und her, bis<br />
sich schliesslich alles vereinigte in dem begeisterten Aus<br />
drucke des Dankes für die gewährte Belehrung. Ein Redner<br />
überbot sich in Lobpreisungen und fasste alles zusammen<br />
in den Schlussworten: dhanyo 'si, dhanyo 'si, dhanyo 'si!<br />
d. h. „du bist ein glückseliger Mann". Ein anderer, in<br />
englischer Sprache, kam auf meine nahe bei mir sitzende<br />
Frau zu sprechen, stellte mich als Ideal der Männer und<br />
meine Frau als Muster der Frauen hin und verstieg sich<br />
bis zu dem Wunsche: „Möchten alle indischen Männer dem<br />
Professor Deussen, und alle indischen Frauen der Frau<br />
Deussen gleichen!" — Nun war es denn doch Zeit aufzubrechen.<br />
Man geleitete uns im Triumphe in unser Hotel, und wir<br />
gingen zu Bette mit dem Bewusstsein, einen reichen Tag<br />
durchlebt zu haben.<br />
Ich hatte den Wunsch geäussert, indische Musik zu<br />
hören. Diesem willfahrte Krishna Joshin, indem er am<br />
nächsten Morgen ein kleines Konzert für uns veranstaltete.<br />
Früh morgens holte er uns mit seinem Sohne im Hotel ab.<br />
Unterwegs gab es manches zu sehen und zu erklären. So<br />
war da eine aus freiwilligen Beiträgen errichtete und unter<br />
haltene geräumige Lesehalle, in der jeder ohne Entgelt vom<br />
Morgen bis zum Abend Bücher, Zeitschriften und Zeitungen<br />
lesen durfte. Ich konnte nicht umhin, über das ganze<br />
Institut meine höchste Anerkennung auszusprechen und trug<br />
gern eine entsprechende Sanskritnotiz in das mir vorgelegte<br />
Fremdenbuch ein. Wir kamen zu unseren Musikern, die<br />
sich im Freien an einem schattigen Orte gelagert hatten<br />
und nach unserer Ankunft verschiedene Stücke zum besten<br />
gaben. Über den Eindruck der indischen Musik wollen<br />
wir dem früher Gesagten nur noch hinzufügen, dass sie bei<br />
jedem neuen Anhören an Reiz gewinnt. Die Art, wie die<br />
ohne harmonische Begleitung nur vom Rhythmus gezügelte<br />
Melodie vom Grundton rasch bis zur Septime und Oktave
Eine Lesehalle. Indische Musik. Abschied. 191<br />
ansteigt und dort wie ein vom Springbrunnen empor ge<br />
triebener Ball sich in leidenschaftlichen Molltönen hin und<br />
herwiegt, bis sie endlich wieder melodisch herabsinkt, dieses<br />
Gaukelspiel hat etwas in sich, was bis in die innerste<br />
Seele dringt. Besonderes Interesse erregte auch die ge<br />
nauere Besichtigung und Erklärung der Instrumente; es sind<br />
teils Streichinstrumente wie die Vinä, zur Wiedergabe der<br />
Melodie, teils paukenartige Instrumente, wie z. B. der<br />
Mirdanga, welche als Träger des Rhythmus dienen.<br />
Den Rest des Morgens benutzten wir, um eine Schule<br />
zu besuchen, in der speziell der Rigveda gelehrt wurde.<br />
Sie lag in einer schmutzigen und verwahrlosten Gegend<br />
der Eingeborenenstadt und hatte äusserlich wenig Anziehendes.<br />
Um so interessanter war es mir, einmal den in Indien stark<br />
in den Hintergrund getretenen Rigveda von den Schülern<br />
recitieren zu hören. Sie taten dies, indem sie auch die<br />
Accente durch Bewegungen mit der Hand genau markierten.<br />
Ungern schieden wir von Allahabad, einem Orte, wo<br />
indische Wärme und europäische Kühle so unmittelbar<br />
neben einander uns fühlbar geworden waren. Herzerfreuend<br />
war noch die letzte halbe Stunde am Bahnhofe, wo sich<br />
ein grösserer Kreis der gestern gewonnenen Freunde ein<br />
gefunden hatte. Ich sage Freunde, denn wenn auch unsere<br />
Bekanntschaft erst von vorgestern her war, so verkehrten<br />
wir doch und schieden schliesslich von einander mit einer<br />
Herzlichkeit, als hätten wir uns schon seit Jahren gekannt.<br />
Von Allahabad an verliess der Zug das Gangestal und<br />
strebte dem Süden Indiens zu, um nach einer weiteren Fahrt von<br />
vierzig Stunden in Bombay einzulaufen. Aber wir konnten<br />
uns nicht entschliessen, dorthin zurückzukehren, ohne vorher<br />
einen Ort besucht zu haben, der ziemlich weit von der<br />
grossen Verkehrsstrasse abseits liegt und daher fast nie<br />
von Europäern aufgesucht wird, obgleich er einen Besuch
192 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
in erster Linie verdient. Es ist das die oben im Vindhya-<br />
gebirge gelegene alte Königsstadt Ujjayint, die Vaterstadt<br />
Kälidäsa's, des grössten indischen Dichters. Sein Geist<br />
schien uns die Worte des Meghadüta zuzurufen:<br />
Wenn du such nordwärts strebend nicht magst weilen,<br />
So lass dich doch den Umweg nicht verdriessen,<br />
Ujjayini's Palästen zuzueilen<br />
Und ihrer Dächer Freundschaft zu geniessen.<br />
Unser Ziel war allerdings noch nicht die nordische<br />
Heimat, sondern zunächst Bombay und der Süden Indiens,<br />
aber gerade darum mussten wir ein gutes Stück auf einer<br />
Nebenlinie den Vindhya hinauf nach Norden zurückfahren,<br />
wollten wir auch einmal in dem Dunstkreise der Stadt ver<br />
weilen, welche in alten Zeiten eine von Kälidäsa in so<br />
glühenden Farben beschriebene Herrlichkeit gehabt haben<br />
muss. Nach einer Eisenbahnfahrt von zwanzig Stunden ge<br />
langten wir von Allahabad nach Khandwa, welches ungefähr<br />
gleich weit von Allahabad und Bombay entfernt liegt,<br />
und von wo die schmalspurige Vindhyabahn nach Norden<br />
abzweigt. Hier verliessen wir gegen Mittag den Bombayer<br />
Zug und nahmen zunächst in der Bahnhofshalle das Tiffin<br />
ein, konnten aber nur mit Mühe etwas geniessen; so gross<br />
war hier, zwanzig Eisenbahnstunden südlicher als Allahabad,<br />
bereits die Hitze. Wir trösteten uns damit, bald wieder<br />
nach Norden und ins kühlere Hochgebirge zu kommen,<br />
bestiegen einen etwas engen, aber dafür auch während der<br />
ganzen Fahrt uns allein verbleibenden Wagen der Sekundär<br />
bahn und rollten nordwärts. Höchst malerisch präsentierte<br />
sich beim Überschreiten die am Südabhange des Viiidhya-<br />
gebirges hinströmende Narmadä, indem sie durch' vor<br />
springende Felspartien und Geröll ihren Weg suchte, bald<br />
ihre ungestümen Fluten zur Umgehung der Hindernisse zer<br />
teilend, bald sie wieder zur Einheit zusammenleitend, daher<br />
sie mit Recht von Kälidäsa „der Malerei (bhüti), welche
Über die Narmadä. Indore. 193<br />
man durch Einteilung von Feldern (bhakti-chedais) auf dem<br />
Rüssel des Elefanten anbringt," (Meghadüta 19) verglichen wird.<br />
Weiter ging es in gemächlicher Steigung den Vindhya hinan, bis<br />
wir gegen Abend die GarnisonstadtMhow und bald darauf Indore,<br />
die Residenz des Holkar, erreichten, um hier zu übernachten.<br />
Ein Hotel ist in Indore nicht vorhanden. Das Dak<br />
Bungalow Hegt ziemlich weit von der Bahn. Unter diesen<br />
Umständen zogen wir es vor, das Ladies Waiting Room des<br />
Bahnhofs zu beziehen und dort unsere Reisebetten ausbreiten<br />
zu lassen. Leider war aber ein Büffet mit dem Bahnhofe<br />
nicht verbunden, sodass wir zum Abendessen doch den<br />
weiten Weg nach dem Dak Bungalow unter Führung eines<br />
Knaben hin und her zurücklegten. Weniger unbequem war<br />
die Sache am andern Morgen, wo wir die Besichtigung der<br />
Stadt mit dem Frühstück im Dak Bungalow verbinden<br />
konnten. Wir machten dort die Bekanntschaft eines Hand<br />
lungsreisenden, eines jungen Parsi, der mit der Ungeniertheit,<br />
welche die Parsis so merklich von den Hindus unterscheidet,<br />
uns zumutete, ihm nach unserer Rückkehr einen German<br />
Primär (Elementarbuch des Deutschen für Engländer) zu<br />
schicken. Wir begnügten uns, ihm einige Titel anzugeben<br />
und verwiesen ihn im übrigen an die Buchhändler.<br />
Eine flüchtige Besichtigung der Stadt, des Marktplatzes<br />
nebst dem blauen Palaste, des Lal Bagh, eines öffentlichen<br />
Gartens mit wilden Tieren, füllte den Vormittag aus. Im<br />
Vorbeigehen sah ich etwas, was mir aus indischen Märchen<br />
wohl bekannt, aber in Wirklichkeit noch nie vorgekommen, näm<br />
lich den Kampf zweier Widder gegen einander. Wie auf Ver<br />
abredung erhoben sich die Tiere gleichzeitig auf die Hinter<br />
beine und Hessen ihre Köpfe mit solcher Heftigkeit gegen<br />
einander prallen, dass sie wohl nur durch die grosse Dicke<br />
ihrer Schädel vor Schaden bewahrt blieben. Dies wieder<br />
holten sie fort und fort ganz phlegmatisch und ohne eine Spur<br />
von Gemütsbewegung, als sei es ihnen ein angenehmer Sport.<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 1.5
194 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
Um zehn Uhr verliessen wir Indore, stiegen auf der<br />
nächsten Station um und gelangten so endlich auf einer<br />
Zweigbahn der Zweigbahn bald nach Mittag nach Ujjayini.<br />
Der kleine Bahnhof sowie, ganz in seiner Nähe, das Dak<br />
Bungalow liegen ausserhalb der Stadt. Nicht eine halbe<br />
Minute weit davon liegt das heutige Ujjayini, umgeben von<br />
einer gut erhaltenen zierlichen Mauer mit Türmchen, Zinnen<br />
und Toren, aus dem Mittelalter stammend. Ujjayini hat<br />
33 000 Einwohner, beherbergt aber nur drei europäische<br />
Familien, die des Gouverneurs, des Steuererhebers und eines<br />
Ingenieurs, ist also eine durch und durch indische Stadt<br />
geblieben, ohne Hotels und ohne jeden europäischen Kom<br />
fort. Da es hier auf dem Gebirge nicht so heiss ist wie in<br />
der Ebene, so unternahmen wir, um unsere erste Neugierde<br />
zu befriedigen, auf gut Glück eine Wanderung durch die<br />
Hauptstrasse vom nördlichen Tore neben dem Bahnhof und<br />
Dak Bungalow bis zum südlichen hin. Da wir niemand<br />
kannten und auch keine Empfehlungsbriefe hatten, so fragten<br />
wir uns nach dem College durch und verlangten den Vor<br />
steher zu sprechen. Wir wurden etwas kühl empfangen,<br />
aber ich hatte nun schon einige Übung darin, den Weg zum<br />
Herzen der Inder zu finden. Bald wurde auch der eine<br />
oder andere Sanskritkundige herbeigeholt, und in einer<br />
halben Stunde war eine ganze Gesellschaft beisammen und<br />
die Unterhaltung im besten Fluss. Es wurde verabredet,<br />
gegen Abend im Dak Bungalow zusammenzutreffen; unter<br />
dessen sollte ein jüngerer Lehrer uns einiges von der Stadt<br />
zeigen. Unser erster Besuch galt dem ganz in der Nähe<br />
befindlichen, weithin leuchtenden Mahäkäla-Tempel, der<br />
zwar nicht mehr der von Kälidäsa gefeierte und später<br />
zerstörte sein kann, aber auf derselben Stelle wie der alte<br />
errichtet sein soll. Man habe, so hiess es, in alten Auf<br />
zeichnungen die Maasse noch vorgefunden und sich genau<br />
nach diesen gerichtet. In der Tat wird das turmartig auf-
Ujjayini. Die Qiprä. Eine Sitzung im Dak Bungalow. 195<br />
steigende Bauwerk gekrönt von einem Bilde des Civa mit<br />
einem Wald von Armen, ähnlich wie es Kälidäsa beschreibt.<br />
Sollte der Tempel wirklich auf der Stelle des alten stehen,<br />
so muss er, vielleicht durch Gärten getrennt, über eine halbe<br />
Stunde südlich von der Stadt gelegen haben; denn das alte<br />
Ujjayini lag, wie wir noch sehen werden, nicht auf der Stelle<br />
der jetzigen Stadt, sondern über eine halbe Stunde weiter<br />
nach Norden. In das unterirdische Innere des Tempels<br />
wollte man uns nicht einlassen, versicherte aber, dass dort<br />
nichts zu sehen sei als ein grosses steinernes Lihgam als<br />
Symbol des Civa. Nicht weit vom Tempel und an der<br />
neuen Stadt wie auch an der alten vorüber strömt die viel<br />
gepriesene Ciprä. Sie war auch im Februar noch ein statt<br />
liches Wasser, so breit wie die Mosel bei Koblenz, aber<br />
nicht sehr tief, da wir sie am folgenden Tage auf dem Ele<br />
fanten durchwateten. Eine Brücke erinnere ich mich nicht<br />
gesehen zu haben; weiter unten, bei Alt-Ujjayini, kann man<br />
sich mittels einer Fähre übersetzen lassen. Wir wanderten<br />
nun zwischen Fluss und Stadt auf der Höhe hin und ge<br />
langten mit Einbruch der Dämmerung glücklich in unser<br />
Bungalow. Dort waren schon unsere Bekannten von vorhin<br />
und einige mehr eingetroffen. Zum Glück waren keine<br />
Logiergäste ausser uns vorhanden. So konnte das eine der<br />
beiden Zimmer des einstöckigen Hauses zu unserem Schlaf<br />
zimmer eingerichtet werden, während wir im andern unsere<br />
Gäste empfingen. Eine Bewirtung derselben ist in Indien,<br />
wo jeder nur mit seiner Kaste isst und trinkt, nicht möglich;<br />
hingegen sprachen sie meinen Cigarren gern und fleissig zu.<br />
Ich bestellte das Abendessen; da stellte sich heraus, dass<br />
es zwar dabei die üblichen Pfannkuchen, hingegen kein Brot<br />
geben werde. Meine Frau bestand darauf, sie könne dieses<br />
Zeug nicht essen und müsse Brot haben. Ich befahl, in der<br />
Stadt welches zu holen. Verlorene Mühe! In der Stadt, wie<br />
man mir von allen Seiten versicherte, gibt es kein Brot. „Wenn<br />
13*
196 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
Sie Brot haben wollen", bemerkte ein kluger Kopf, „so müssen<br />
Sie nach Indore schreiben, dann kann es morgen noch ein<br />
treffen." Ein anderer schlug vor, an den Gouverneur zu<br />
schreiben und ihn um ein Brot zu bitten. „Ich kenne den<br />
Gouverneur nicht", sagte ich, „und habe keine Empfehlung<br />
an ihn." — „Das tut nichts", hiess es, „als Europäer sind<br />
Sie schon genugsam empfohlen. Und wie wollen Sie ohne<br />
den Gouverneur die Stadt und Umgebung besehen?" —<br />
„Ich werde einen Wagen nehmen und mich herumfahren<br />
lassen." — „Einen Wagen? In Ujjayini gibt es nur Ochsen<br />
karren." — „Nein", fuhr der Erfahrenste fort zu sprechen,<br />
„folgen Sie meinem Rat, schreiben Sie an Sir Michel Filose,<br />
den Gouverneur, und bitten Sie ihn, dass er Ihnen für<br />
morgen einen Führer und ein Vehikel stellt; er wird Ihnen<br />
dann voraussichtlich einen Elefanten schicken. Der Gouver<br />
neur wohnt zwanzig Minuten von hier; in einer Stunde kann<br />
der Bote mit der Antwort zurück sein."<br />
Der Rat schien gut, und ich schrieb in dem entsprechen<br />
den Sinne und fügte die Bitte hinzu, uns etwas Brot zu<br />
schicken. Die Antwort war die denkbar liebenswürdigste.<br />
Morgen um sieben Uhr solle ein Elefant wie auch ein orts<br />
kundiger Führer an unserer Tür sein. Wir möchten aber<br />
lieber, um alles zu sehen, zwei Tage bleiben und übermorgen<br />
Abend seine, des Gouverneurs, Gäste sein. Ein Wagen<br />
werde uns zur rechten Zeit abholen. Zugleich überbrachte<br />
der Bote ein Brot nebst einem zierlichen Arrangement von<br />
Butter und Früchten.<br />
Pünktlich um 7 Uhr morgens stand vor unserer Tür ein<br />
stattlicher Elefant nebst seinem Lenker. Zugleich aber hatte<br />
der Gouverneur einen seiner Sekretäre als Führer für uns<br />
bestimmt. Er hiess Abdul, war über alles sehr wohl unter<br />
richtet und für einen Mohammedaner ausserordentlich be<br />
scheiden und taktvoll. Viel weniger gefiel uns Vinäyaka, der<br />
junge Hindulehrer, der uns gestern geführt hatte, und dem
Freundlichkeit des Gouverneurs. Alt-Ujjayini. 197<br />
wir, um ihm eine Freude zu machen, einen leeren Sitz neben<br />
uns auf dem Elefanten anboten. Wiederholt begegneten uns<br />
kleine Mädchen und auch alte Weiber, welche sich mehr<br />
oder weniger tief verneigten, mitunter sogar platt auf den<br />
Boden warfen. „Diese Verehrung", sagte Vinäyaka, „gilt<br />
nicht Ihnen, sondern dem Elefanten. Dieses dumme Volk ist<br />
dazu abgerichtet worden, vor jedem Bilde des Ganega, des<br />
Gottes mit dem Elefantenkopfe, seine Verehrung zu bezeigen.<br />
Kommt ihnen nun einmal ein wirklicher Elefant zu Gesicht,<br />
der in unserer Stadt eine ziemlich seltene Erscheinung ist,<br />
so machen sie auch vor ihm mechanisch und ohne sich da<br />
bei viel zu denken ihre Reverenz."<br />
Unser erster und wichtigster Ritt galt natürlich der<br />
Stätte des alten Ujjayini. Dasselbe Hegt eine halbe Stunde<br />
nördlich von der heutigen Stadt gleichfalls an der Ciprä, da<br />
wo sie sich in einem prachtvollen Bogen nach Nordosten<br />
hinwendet und ein hügeliges Gelände umströmt, auf dem<br />
die alte Stadt lag. Sehr deutlich sieht man noch heute an<br />
und auf den Hügeln lange gerade Linien sich hinziehen,<br />
welche wohl Spuren der ehemaligen Strassen sind. „Bei<br />
jedem Regengusse", sagte Abdul, „spült das herabströmende<br />
Wasser Münzen und andere Reliquien der alten Stadt los.<br />
Ausgrabungen würden im höchsten Grade lohnend sein, aber<br />
der Holkar von Indore, dem das Land gehört, interessiert sich<br />
nicht dafür". „Warum", so fragte ich, „hat man die so schön<br />
gelegene alte Stadt aufgegeben und sich weiter südlich im<br />
flachen Lande angesiedelt?" — „Man weiss es nicht," ver<br />
setzte Abdul, „die einen meinen, es sei in Folge einer Pest<br />
geschehen, die andern behaupten, ein Erdbeben habe die<br />
alte Stadt zerstört." — „Ist gar nichts mehr davon übrig?" —<br />
„Nur noch ein einziges Haus. Sie werden es nachher sehen.<br />
Das Volk nennt es das Haus des Dichters Bhartrihari". —<br />
„Aber was ist denn das," rief ich, „was bedeuten alle diese<br />
aus Steinen zierlich geschichteten kleinen Denkmäler, und
198 VII. Von Calcutta nach Bombay,<br />
was die niedlichen Füsschen, die jedem derselben einge-<br />
meisselt sind?" — „Diese Denkmäler bezeichnen die Stelle,<br />
wo eine Witwe sich lebend mit ihrem verstorbenen Gatten<br />
hat verbrennen lassen." — „Also eine Satt," ergänzte ich,<br />
„oder, wie der Engländer in seinem Jargon sagt, eine Suttee."—<br />
Das Wort satt bedeutet, wie schon oben bemerkt wurde,<br />
„die Seiende", „die Gute", d. h. die Frau, welche ihrem Gatten<br />
in den Tod folgt, dann auch den Akt der Witwenverbrennung und<br />
endlich die Stelle, wo einesolche Verbrennung stattgefunden hat.<br />
Wir wanderten weiter fort über die Stätte des alten<br />
Ujjayini, und überall bemerkten wir durch die mit Rasen und<br />
Buschwerk überdeckte Bodenfläche hindurch eigentümliche<br />
Bildungen, welche für künftige Ausgrabungen ein lohnendes<br />
Objekt sein werden und einstweilen der kombinierenden<br />
Phantasie viele Unterhaltung boten. Wir gelangten zu einer<br />
Anhöhe mit schönem Blick auf die in der Tiefe unten dahin-<br />
fliessende Ciprä, und hier oben stand das einzige, irgend<br />
einem Zufalle seine Erhaltung verdankende Haus der alten<br />
Stadt, heute ohne erkennbaren Grund das Haus des Bhar-<br />
trihari genannt. Es mochte einer jener von Kälidäsa ge<br />
feierten Paläste gewesen sein mit flachem Dach, mit ge<br />
räumigem Hofe, aussichtsreichen Terrassen, das Ganze durch<br />
eine wohl erhaltene Mauer nach aussen hin abgeschlossen und<br />
verwahrt. Wir traten in den Hofraum durch ein Tor, dessen<br />
oberen Abschluss ein mächtiger Stein bildete. Ein durch<br />
wachsender Baum hatte ihn in der Mitte gesprengt, aber die<br />
beiden Stücke lehnten gegen einander und schützten sich so<br />
gegenseitig vor dem Herabfallen. Vom Hofe aus eröffnete<br />
sich eine herrliche Aussicht auf die in der Tiefe strömende<br />
Qiprä und das jenseitige Land. Nach der bevorzugten Lage<br />
durften wir schliessen, dass das erhaltene Haus eines der<br />
vornehmsten der Stadt gewesen sein muss. Dem entsprach<br />
auch sein Aufbau in mehreren, teilweise erhaltenen Etagen,<br />
von denen die eine, durch eindringende Erdmassen ver-
Das Haus des Bhartrihari. Unser Elefant. 199<br />
schlämmt, einen kellerartigen Eindruck macht, während die<br />
darüberliegende einen Begriff der vornehmen Wohnungen im<br />
alten Indien geben kann. Das ganze Stockwerk stellte sich<br />
dar als eine einzige sehr lange und breite, aber sehr niedrige<br />
Halle. Zahlreiche zierlich in Stein gehauene Säulen von<br />
wenig mehr als Mannshöhe trugen die Decke. Man konnte<br />
in aufrechter Haltung darunter stehen und gehen. Vielleicht<br />
bezweckten diese niedrigen Zimmerdecken ein besseres Fest<br />
halten der Kühle. Das Ganze erinnerte mich an das gleich<br />
falls ziemlich alte Haus in Mahävan bei Mathurä, in welchem<br />
der junge Krishna erzogen worden sein soll. Auch hier wird<br />
das sehr niedrige Plafond von Säulen getragen, an deren<br />
eine der junge Gott von seiner Pflegemutter angebunden<br />
wurde, als er unartig war.<br />
Die höhersteigende Sonne mahnte zum Aufbruch. Wir<br />
bestiegen unsern Elefanten, verliessen die jetzt so verein<br />
samten Stätten einer grossen Vergangenheit und gelangten<br />
durch wohlangebaute Felder zurück zur Neustadt, deren<br />
Strassen jetzt so belebt waren, dass kaum durchzukommen<br />
war. Der Elefant schien gewohnt zu sein, dass ihm alles<br />
auswich. Er ging ungestört seinen bedächtigen Schritt<br />
weiter und verschmähte es nicht, von den vorüberfahrenden<br />
Wagen aus der Höhe herab einen Tribut für sich zu nehmen.<br />
Schliesslich holte er von einem mit Rohrbündeln beladenen<br />
Karren, der eben vorbeifuhr, mit seinem Rüssel eine ganze<br />
Garbe herunter, welche er quer im Rüssel behielt, sodass<br />
ein grosser Teil der Strasse dadurch gesperrt wurde.<br />
„Was will er nur damit machen?" fragte ich Abdul.<br />
„Sie werden es sogleich sehen," sagte er, und wirklich<br />
machte sich der Elefant daran, während des Weitermarsches<br />
mit Rüssel und Mund das Bündel zu lösen und ein Rohr<br />
nach dem anderen behaglich zu verspeisen. Beim Mar<br />
schieren beobachtete der Elefant stets grosse Vorsicht. Als<br />
er mit uns durch die Qiprä watete, tat er keinen Schritt,
200 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
ohne sich vorher durch Tasten des Bodens unter dem<br />
Wasser zu versichern. In einer wenig bebauten Gegend<br />
der Stadt hatten wir einige Teiche besucht, von denen noch<br />
heute einer den Namen Gandhavatt, wie bei Kälidäsa, trägt,<br />
und wollten von hier quer durch eine Niederung den Hügel<br />
in der Mitte der Stadt ersteigen, der eine Rundsicht nach<br />
allen Seiten gewährt. Der Führer lenkte den Elefanten quer<br />
über die Wiese, als dieser nach dem ersten Schritt mit<br />
seiner Tatze einen halben Meter tief einsank. Schnell be<br />
freite er sich aus dieser gefährlichen Lage, und wir be<br />
wunderten und belachten alle das riesige Loch, welches der<br />
eine Elefantentritt geschaffen hatte.<br />
So "genossen wir zwei Tage lang von der Höhe unseres<br />
Elefanten herab und in der angenehmen Gesellschaft Abdul's<br />
die alte Königsstadt und ihre Umgebung, besichtigten das<br />
in früherer Zeit hoch berühmte Observatorium, von dem nur<br />
noch die Mauern erhalten sind, besuchten Kalideh mit seiner<br />
Wasserleitung und den Resten palastartiger Bauten und<br />
kehrten am Nachmittag des zweiten Tages sehr befriedigt<br />
zurück, um uns zum Diner bei Sir Michel Filose anzukleiden.<br />
Pünktlich holte uns der Wagen ab und führte uns zu dem<br />
fern von der Stadt liegenden Landhause des Gouverneurs.<br />
Dieser war von Geburt ein Italiener, aber völlig anglisiert,<br />
sodass er mit seiner imposanten Gestalt und seinen weissen<br />
Haaren sich in nichts von einem alten englischen Gentleman<br />
unterschied. Es waren einige erwachsene Töchter und<br />
Verwandte des Hauses zugegen, dazu ein katholischer<br />
Geistlicher, Padre Pio, welcher mit Plänen herumreiste, um<br />
Propaganda für den Bau einer katholischen Kirche in<br />
Gwalior zu machen. Wir gingen zu Tisch; der Pater sprach<br />
das Gebet; ich bemerkte, wie im Hause ein strenger<br />
Katholicismus herrschte. Meine Tischnachbarin war unlängst<br />
aus Italien zurückgekehrt; ich sprach mit ihr italienisch und<br />
fühlte, wie ihr das wohltat. Denn in der Familie Filose,
Diner beim Gouverneur. Padre Pio. Abdul. 201<br />
die schon seit Generationen in Indien lebte, schien der<br />
Gebrauch des Italienischen schon ziemlich ausgestorben zu<br />
sein. Die Unterhaltung war lebhaft, die Stimmung die<br />
denkbar beste. So standen wir nach Tische noch in<br />
animiertem Gespräche, als der Pater anfing sich zu verab<br />
schieden, da er mit dem Nachtzuge nach Gwalior wollte.<br />
Um dem Wagen des Gouverneurs nicht zweimal die weite<br />
Fahrt zuzumuten, beschloss ich gleichfalls aufzubrechen und<br />
sprach eben zum Gouverneur ein paar freundliche Abschieds<br />
worte, als plötzlich die ganze Gesellschaft auf die Kniee<br />
sank. Betroffen trat ich zurück und sah im Hintergrunde<br />
stehend respektvoll zu, wie der Pater den Anwesenden den<br />
Segen erteilte. Wir verabschiedeten uns mit herzlichem<br />
Danke für alle uns erwiesene Freundlichkeit und fuhren mit<br />
Padre Pio zum Bungalow, wo er, da bis zur Abfahrt des<br />
Zuges noch über eine Stunde Zeit war, mir an den mit<br />
geführten Plänen seinen Kirchenbau erläuterte, auch gern eine<br />
Cigarre sowie eine zweite mit mir rauchte. Mein freund<br />
liches Zureden, einige Cigarren mit auf den Weg zu nehmen,<br />
lehnte er dankend ab. Als man den Zug in der Ferne<br />
hörte, ging er zum Bahnhof hinüber, und wir legten uns schlafen.<br />
Wir hatten unsere Abfahrt auf zehn Uhr des andern<br />
Morgens festgesetzt. Mehrere Bekannte waren an der Bahn,<br />
auch Abdul, der mir noch dies und jenes von seinen Kurio<br />
sitäten zeigen wollte. Er hatte uns diese Tage geführt und<br />
sehr artig behandelt. Da ich nicht wagte ihm Geld anzu<br />
bieten, so schenkte ich ihm einen kleinen Taschenatlas, wie<br />
man sie in London in gefälligster Ausstattung für 2l/2 Shilling<br />
kauft. Selten habe ich einen Menschen sich mehr freuen<br />
sehen, als Abdul über dieses kleine Geschenk, welches frei<br />
lich in Ujjayini eine grosse Seltenheit sein mochte.<br />
Nun folgte eine lange Fahrt von Ujjayini bis Bombay,<br />
welche mit geringen Ruhepausen den Tag, die Nacht und<br />
noch den ganzen folgenden Tag bis zum Abend in Anspruch
202 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
nahm. Wieder ging es an Indore vorbei den Vindhya<br />
herunter über die Narmadä nach Khandwa, wo wir den Nacht<br />
zug bestiegen, am andern Morgen das berühmte Nasik vor<br />
überfahrend grüssten und gegen Nachmittag in das höchst<br />
romantische Bergland der westlichen Ghatta's gelangten,<br />
welche aus imposanten Gebirgsmassen bestehen, die dem<br />
Hochplateau von Dekhan an dessen Westrande gleich wie<br />
Mauerzinnen aufgesetzt sind. Von diesen Höhen nach Bom<br />
bay herunter zu kommen ist für die Bahn keine leichte Arbeit.<br />
Da gibt es Kehren, an welchen der Zug im Zickzack vor<br />
wärts und rückwärts läuft, da fehlt es nicht an Tunnels,<br />
Brücken und kühnen Windungen, alles dies mit herrlichen<br />
Aussichten auf das Gebirge und auf Ebene und Meer in der<br />
Tiefe. Um 9 Uhr abends liefen wir nach einer herrlichen<br />
Rundreise von mehr als zwei Monaten in Bombay ein, wo<br />
uns niemand erwartete. Wir nahmen einen Wagen, der, wie<br />
alles in Bombay, merklich eleganter und besser war, als man<br />
es in Calcutta zu finden pflegt, und fuhren direkt zu Tri-<br />
bhuvandäs, dem wir versprochen hatten, seinen Cosmopolitan<br />
Club dadurch in die Mode zu bringen, dass wir in demselben<br />
Wohnung nahmen. Da noch nichts vorgesehen war, so<br />
brachte er uns für die erste Nacht in einem bescheidenen<br />
Zimmer seines prächtigen Palastes unter.<br />
Von seinem Vater Sir Mangaldäs, einem Manne von be<br />
deutenden und anerkannten Verdiensten, hatte Tribhuvandäs,<br />
wenn auch nicht dessen Verstand, so doch seinen Reichtum<br />
geerbt und war als echter Vaicya bemüht, denselben beständig<br />
zu mehren. Er war sehr dienstbeflissen und gutmütig, und<br />
seine nicht geringe Eitelkeit fühlte sich auch darin noch ge<br />
schmeichelt, wenn man ihn zur Zielscheibe des Witzes nahm,<br />
wozu er nur zu viel Anlass bot. Er besass nördlich von der<br />
Stadt in Girgaum Road ein palastartiges Haus mit herrlichem<br />
Garten, in welchem Lotosblumen, Betelpflanzen und mancher<br />
lei seltene Gewächse zu finden waren. Im Hintergrunde des
Seite 202.<br />
o<br />
1<br />
a<br />
tu<br />
J3<br />
<strong>•</strong>73<br />
a<br />
c<br />
o<br />
CA)<br />
Di<br />
x:
Ankunft in Bombay. Der Cosmopolitan Club. 203<br />
geräumigen Gartens war ein zweites Haus, in welchem un<br />
sere Freunde, die vier Brüder Nazar, zur Miete wohnten.<br />
Durch sie wurden wir mit Tribhuvandäs bekannt und haben<br />
manchen köstlichen Abend mit ihm und seiner Familie in<br />
der kühlen, geräumigen Vorhalle seines Palastes unter Plaudern,<br />
Scherzen und Musizieren zugebracht. Auch das grosse Grund<br />
stück gegenüber auf der anderen Seite von Girgaum Road ge<br />
hörte Tribhuvandäs. Hier hatte er in einer verschämten Ecke<br />
eine Schnapsbude für Arbeiter angelegt, während er in dem<br />
geräumigen Hauptgebäude seine Lieblingsschöpfung, den<br />
Cosmopolitan Club, begründet hatte. Dieser sollte, wie schon<br />
der Name besagt, den Bedürfnissen aller Nationen entgegen<br />
kommen. Hier konnte man vegetarisch auf Hinduweise oder<br />
auch europäisch mit Fleisch und geistigen Getränken bedient<br />
werden, und eine Gesellschaft dem europäischen Komfort zu<br />
neigender Inder fand sich bei den täglichen Mahlzeiten hier<br />
zusammen. Eifrigst strebte Tribhuvandäs danach, auch ein<br />
mal Europäer in seinem Klub zu beherbergen, und so Hessen<br />
wir uns dazu einfangen, teils um unsere Freunde bei der Hand<br />
zu haben, teils um dem indischen Volksleben etwas näher zu<br />
treten, als es von der Terrasse des Esplanadehotels aus mög<br />
lich gewesen war. Die Zimmer konnten wir nach Belieben<br />
wählen und wechseln. Bei der Einfachheit ihrer Ausstattung<br />
waren sie mit drei Rupien täglich für uns beide reichlich be<br />
zahlt. Dafür konnten wir uns in den weiten, leeren Räumen<br />
des ersten Stockes nach Herzenslust ausbreiten und genossen<br />
eine für Bombay seltene Ruhe. Diese war uns in der Tat<br />
jetzt sehr erwünscht, denn ich hatte dem ehrwürdigen und<br />
liebenswerten Javeriläl Umiagankar, dem Sekretär der Asiatic<br />
Society, versprochen, in dieser am 25. Februar einen Vortrag<br />
zu halten, und ich beschloss, denselben gleichzeitig im Druck<br />
erscheinen zu lassen und zu einem kleinen Vermächtnisse für<br />
Indien zu gestalten. In der Tat hat er dort seine Wirkung<br />
getan, da er nicht nur in englischer Sprache als Broschüre
204 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
und durch vollständige Wiedergabe in den Hauptzeitungen,<br />
sondern auch durch Übersetzung in das Mahratti, Guzerati,<br />
Bengali und vielleicht noch andere indische Dialekte eine<br />
grosse Verbreitung gefunden hat. In der Einleitung warf ich<br />
einen kurzen Blick auf den gegenwärtigen Zustand der<br />
Philosophie in Indien und entwarf dann in gedrängten Zügen<br />
ein Bild der allein ernst zu nehmenden und konsequenten<br />
Philosophie Indiens, der Advaita-Lehre der ältesten Upani-<br />
shads und ihres grossen Interpreten Caiikara (geboren 788,<br />
gerade tausend Jahre vor dem ihm geistig so nahe verwandten<br />
Schopenhauer). Ich versäumte nicht, auf die tiefe innere<br />
Übereinstimmung dieser Lehre nicht nur mit der kantisch-<br />
schopenhaüer'schen Philosophie, sondern auch mit dem<br />
Piatonismus und den Grundanschauungen des Christentums<br />
hinzuweisen und ermahnte zum Schlüsse die Inder, an diesem<br />
Vedänta als der ihnen angemessenen Form der einen, allge<br />
meinen, ewigen philosophischen Wahrheit festzuhalten.<br />
Die Ausarbeitung dieses Vortrages sowie seine schnelle<br />
und sorgfältige Drucklegung beschäftigte mich und meine<br />
Freunde während der folgenden Tage, und als der 25.<br />
Februar erschien, war es mir möglich, vor einem zahlreichen<br />
Publikum nicht nur die erwähnten Gedanken in freier Rede<br />
zu entwickeln, sondern auch die gedruckte Broschüre an die<br />
Anwesenden zu verteilen und an alle unsere Freunde über ganz<br />
Indieh zu versenden.<br />
Als ein kurzer und zuverlässiger Inbegriff der noch heute<br />
in Indien vorherrschenden religiös-philosophischen Weltan<br />
schauung bildet der erwähnte Vortrag eine wesentliche Ergän<br />
zung unserer Mitteilungen über Indien und mag daher anhangs<br />
weise auch hier seine Stelle finden (unten, Seite 239—251).<br />
Voraus geht ihm ein von mir verfasster poetischer Abschieds-<br />
gruss an so viele in Indien gewonnene Freunde, welcher<br />
ihnen zugleich mit der Abhandlung überreicht oder übersandt<br />
wurde.
Vortrag in der Asiatic Society. Eine Hochzeitsfeier. 205<br />
Von den mancherlei Ereignissen, welche sich in den<br />
;tzten Tagen unseres Aufenthaltes in Bombay zusammen-<br />
rängten, wollen wir noch einer Hochzeit gedenken, zu der<br />
ns ein befreundeter Hindu einlud. Es wurde schon erwähnt,<br />
ass in vielen Kasten die Mädchen bis zum elften Jahre<br />
erheiratet sein müssen. Rückt dieser Zeitpunkt heran, so<br />
alt der Vater des Mädchens Umschau unter den verfüg-<br />
iaren Knaben, natürlich nur innerhalb seiner eigenen Kaste,<br />
robei Rang, Ansehen, Lebensstellung und Vermögen ge-<br />
lührend berücksichtigt werden. Zeigt sich bei den beider-<br />
eitigen Eltern Geneigtheit, so werden die Brahmanen be<br />
ragt, und diese lassen sich die Horoskope der Kinder<br />
inreichen. Ähnlich nämlich, wie bei uns jeder seinen<br />
"aufschein hat, wird jedem indischen Kinde in. frühester<br />
ugend das Horoskop gestellt. Ein solches besteht aus<br />
iner langen Rolle, die mit Figuren, Zeichen und Sanskrit-<br />
ersen beschrieben ist. Die Anfertigung eines derartigen<br />
)okumentes kostet zehn Rupien; auch uns wollte man für<br />
liesen Preis das Horoskop stellen, aber wir waren nicht so<br />
ehr neugierig, unser Schicksal aus den Sternen zu lesen.<br />
Soll also eine Heirat zu stände kommen, so werden<br />
on den Brahmanen die Horoskope beider Kinder ver<br />
liehen. Sind dieselben dem Unternehmen günstig, so wird<br />
viederum aus ihnen der Zeitpunkt der Hochzeit nach Tag,<br />
Hunde und Minute ausgerechnet. Das Resultat kann für<br />
lie Geladenen oft unbequem werden, wenn sie etwa die<br />
;anze Nacht warten müssen, weil die Hochzeit auf drei<br />
ider vier Uhr morgens angesetzt wurde. Bequemer war<br />
;s in unserem Falle, denn aus den Horoskopen hatte sich<br />
ergeben, dass die Hochzeit um sieben Uhr dreiundfünfzig<br />
Minuten abends stattzufinden habe. Nach sechs Uhr fand<br />
ich eine distinguierte Versammlung im Hause des Hochzeits-<br />
;ebers ein. Wir wurden eingeladen, in den Hofraum zu<br />
reten, wo hinter einem Gitter die Ceremonie stattfand, so
206 VII. Von Calcutts nach Bombay.<br />
jedoch, dass wir alles aus nächster Nähe beobachten konnten.<br />
Die Vorbereitungen zogen sich lang hin. Bald war es der<br />
Bräutigam, bald die Braut, um welche sich die Ceremonien<br />
drehten; zuweilen sprachen die Eltern ihnen zu, zuweilen<br />
murmelte ein Brahmane über ihnen seine Sprüche und<br />
Verse. Unterdessen wurden Kokosnüsse unter die Zuschauer<br />
verteilt, und auch wir nahmen aus Höflichkeit einige der<br />
selben an. Mittlerweile rückte die Zeit der Eheschliessung<br />
heran; jedermann beobachtete die Uhr. Noch zehn Minuten,<br />
noch fünf Minuten, und die Zeit war da. Jetzt wurde<br />
innerhalb des Gitters ein Teppich wie ein Vorhang aus<br />
gespannt. Auf der einen Seite erschien der Vater des<br />
Sohnes, auf der anderen der der Tochter, beide mit den<br />
Kindern an der Hand, die sich wegen des Teppichs nicht<br />
sehen konnten. Da rückt der Moment heran, und in dem<br />
Augenblick, wo es 53 Minuten nach sieben ist, werden die<br />
Hände der Kinder über dem Vorhang zusammengebracht;<br />
sie fassen sich, der Vorhang fällt herunter, und damit ist<br />
das Ehepärchen fürs Leben mit einander verbunden. Es<br />
folgen, wie bei uns, Glückwünsche, Umarmungen und all<br />
gemeine Rührung. Dann gibt sich alles der Festfreude<br />
hin. In einem Saale werden den Männern, in einem anderen<br />
den Frauen die ganze Nacht durch Speisen angeboten, in<br />
einem dritten Räume finden die Produktionen der Tanz<br />
mädchen statt, die wir schon früher einmal beschrieben haben.<br />
Zu den Männern, bei welchen Freund Ätmaräm uns<br />
während der letzten Tage in Bombay noch einführte, gehörte<br />
auch der rühmlichst bekannte Sanskritforscher und Ober<br />
richter Telang, einer der wenigen Eingeborenen, welche eines<br />
jener exorbitanten Gehälter bezogen, die sonst nur den<br />
europäischen Beamten in Indien erreichbar sind. Wir<br />
trafen ihn des Morgens früh um acht im Studierzimmer<br />
seines eleganten Hauses, im Eingeborenenkostüm, von Büchern<br />
und Papier umgeben. Eine angenehme Unterhaltung über
Besuch bei Telang. Abschied von Peterson. 207<br />
wissenschaftliche Gegenstände entspann sich, und zum Schluss<br />
begleitete er uns, um uns sein Haus zu zeigen. Merkwür<br />
diger als alle die schönen Säle und Hallen war eine stille<br />
Ecke, in der allerlei Götterbilder standen, deren Kultus hier<br />
offenbar betrieben wurde, wie eine Anzahl frischer Blumen<br />
bewies, die vor ihnen lagen. Ich drückte Herrn Telang<br />
meine Verwunderung darüber aus, dass er als philosophisch<br />
gebildeter Mann auf dergleichen Wert legte. „Es geschieht",<br />
sagte er, „um der Frauen des Hauses willen. Jeden Morgen<br />
kommt ein Brahmane, spricht einige Gebete und setzt frische<br />
Blumen auf, wofür er monatlich eine massige Summe bezieht."<br />
Wir schritten dem Ausgang zu und sahen hinter einer Säule<br />
einige Frauengestalten, die uns neugierig nachblickten. Ich<br />
hielt sie für Dienerinnen und erfuhr erst später von Ätmaräm,<br />
dass es die Frauen des Hauses, Mutter und Gattin des Ober<br />
richters, gewesen waren. Da meine Frau uns begleitete, so<br />
hätte es für unser Gefühl nahe gelegen, dass man wenigstens<br />
sie den Damen des Hauses zuführte. Aber wir erwähnten<br />
schon öfter die Scheu der indischen Frauen, mit Europäern<br />
in Berührung zu treten. Diese wird erst schwinden, wenn<br />
es gelingt, durch Hebung der Mädchenschulen die religiösen<br />
und nationalen Vorurteile zu beseitigen und auch beim weib<br />
lichen Geschlechte eine allgemeinere Kenntnis der englischen<br />
Sprache anzubahnen. Wie anregend und erfreulich unter<br />
diesen Voraussetzungen der Umgang mit indischen Frauen<br />
sein kann, das hatten wir zu Calcutta im Hause Roy zur Ge<br />
nüge erfahren.<br />
Zum Abschied suchten wir nochmals Professor Peterson<br />
auf, der alljährlich dreimal umzuziehen pflegte; in der heissen<br />
-Zeit wohnte er mit seiner Familie im Gebirge, während der<br />
Regenzeit in einem städtischen Hause und den Winter durch<br />
in einem Zelte. Solche Zelte werden auf einer grossen<br />
Wiese fern von dem Geräusch und den Dünsten der Stadt<br />
aufgepflanzt, und man kann sie mieten wie ein Haus. Wie
208 VII. Von Calcutta nach Bombay.<br />
ein solches enthalten diese Zelte Eingänge mit Türen,<br />
Salons, Schlafzimmer und andere Räume, welche weder an<br />
Grösse noch an Eleganz hinter den städtischen Wohnungen<br />
zurückstehen. Der Rasen des Bodens ist von einem Teppich<br />
überdeckt, an den Wänden hängen Spiegel und Bilder,<br />
Hängelampen hängen von dem Leinwanddach herunter, Tische,<br />
Sofas, Stühle, Betten und anderes Hausgerät sind vollständig<br />
vorhanden. Vor Dieben schützt ein Wächter die Zelte,<br />
welche oft zu mehreren zusammen stehen und eine kleine<br />
Strasse bilden. Das ganze System des Zeltwohnens ist eben<br />
so gesund wie angenehm, lässt sich aber nur da durchführen,<br />
wo, wie in Bombay, den ganzen Winter hindurch kein Wind<br />
und keine Kälte und nur ein Minimum von Regen zu er<br />
warten ist.
Achtes Kapitel.<br />
Von' Bombay nach Madras und Ceylon.<br />
F^Ver Tag der Abreise kam immer näher. Die verschiedenen<br />
Abschiedsfeste, welche von den Besuchern des Cosmo<br />
politan Club, vom Prinzen Baldevi, von Herrn Chichgar im<br />
Parsiklub usw. über uns verhängt wurden, waren glücklich<br />
überstanden, alle Abschiedsbesuche gemacht, die Andenken<br />
eingekauft und die Koffer gepackt. Schon früh hatten sich<br />
einige Dutzend Freunde und Bekannte in unserer geräumigen<br />
Wohnung eingefunden und sahen zu, wie wir frühstückten.<br />
Schmunzelnd strich Tribhuvandäs eine lange Reihe von<br />
Silberrupien ein; mit der scherzhaften Versicherung, seinen<br />
Cosmopolitan Club in allen Ländern Europas rühmen und<br />
empfehlen zu wollen, bestiegen wir den Wagen und rollten<br />
nach dem palastartigen Bahnhof von Victoria Station. Dort<br />
hatten sich auch alle vorher Anwesenden und noch viele<br />
andere eingefunden. Des Abschiednehmens war kein Ende,<br />
und ein theosophistischer Parsijüngling namens Ardeshir,<br />
d. h. Artaxerxes, fuhr einige Stationen mit, um mich über<br />
die Theosophie zu befragen. Ich konnte ihm nur wieder<br />
holen, was ich oftmals bei ähnlicher Veranlassung gesagt<br />
habe. „Ihr Theosophisten", sagte ich, „verfolgt anerkannter-<br />
massen drei Hauptzwecke: 1) Erneuerung der glorreichen<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. I4
210 VIII. Von Bombay nach Ceylon,<br />
Traditionen des Altertums; das ist sehr löblich, nur muss es<br />
von Kennern der Sache ausgehen und nicht, wie so oft,<br />
von solchen, die nichts davon verstehen; 2) allgemeine Verbrü<br />
derung der Menschen; wer wollte dem nicht von Herzen<br />
zustimmen; 3) Erforschung der geheimnisvollen Tiefen der<br />
menschlichen Seele, wie es in Euren Programmen heisst.<br />
Durch diesen Punkt verderbt Ihr Eure ganze Sache und<br />
öffnet dem Schwindel, dem Betrug und allen Arten von Täu<br />
schung Tür und Tor. Wohl gibt es Tiefen der menschlichen<br />
Seele, die noch nicht erforscht sind; Somnambulismus, Wahr<br />
träumen und zweites Gesicht kommen vor, wenn auch<br />
seltener als man glaubt; aber, um hier nicht irre zu gehen,<br />
sind Männer erforderlich, wie es deren heute noch nicht<br />
gibt, solche nämlich, welche die genaueste Kenntnis der Natur<br />
wissenschaften, namentlich der Medizin, mit einem völligen<br />
Eingelebtsein in die wahre Philosophie, ich meine die<br />
Kantisch-Schopenhauersche, verbinden."<br />
Unter solchen Gesprächen hatte der Zug die Ebene<br />
durcheilt, welche Bombay von dem Hochgebirge der west<br />
lichen Ghatta's trennt. Der Parsijüngling empfahl sich und<br />
wir konnten.uns dem vollen Genüsse der Gegend hingeben.<br />
Hoch und höher hob sich durch alle Mittel des modernen<br />
Eisenbahnbaues die Bahn; immer weiter und herrlicher<br />
öffnete sich der Blick auf die grüne Ebene, die reiche Stadt,<br />
das weite Meer, bis die Berge sich wie ein Vorhang über<br />
dieser Scenerie zuzogen und der Zug dem auf der Hoch<br />
ebene gelegenen Poona zueilte. Hier empfing uns am Bahn<br />
hofe der jüngere Apte, dem uns sein meistens in Bombay<br />
weilender Onkel von dort aus anbefohlen hatte. Dieser<br />
Onkel, der seitdem verstorbene alte Apte, war ein sehr<br />
reicher und ebenso frommer Mann. Er begründete in Poona<br />
das Änandägrama (Einsiedelei der Wonne) genannte Institut,<br />
welches wertvolle Manuskripte religiösen und philosophischen<br />
Inhaltes sammelt und in feuerfesten Räumen von vorzüg-
Programm der Theosophisten. Apte in Poona. 211<br />
jicher Konstruktion aufbewahrt. Eine weitere Abteilung des<br />
viele Baulichkeiten umfassenden Instituts ist die Änandä-<br />
grama-Presse, welche jahraus jahrein mit der Herausgabe<br />
der entsprechenden Werke beschäftigt ist. Andere Räume<br />
enthielten Hörsäle und Wohnungen für die zahlreichen Mit<br />
arbeiter, boten auch sonst armen Gelehrten ohne Entgelt<br />
ein zeitweiliges Unterkommen.<br />
In Bombay hatte ich mit dem alten frommen Apte und<br />
seinen Pandits eine Zusammenkunft gehabt, war, wie nach<br />
solchen Besuchen üblich, mit herrlichen, über Schultern und<br />
Brust herabhängenden Blumenkränzen, den zugehörigen<br />
Blumensträussen in der einen und dem Rosenöltropfen in<br />
der anderen Hand verabschiedet worden, hatte mich aber<br />
auch dadurch nicht übel empfohlen, dass ich auf die ganze,<br />
zur Ansicht vorgelegte Änandäcrama-Serie subskribierte, deren<br />
Fortsetzungen ich noch gegenwärtig regelmässig von Freund<br />
Apte beziehe, dem jüngeren natürlich, den sein Onkel zum<br />
Erben des ganzen Unternehmens einsetzte, als er vor einigen<br />
Jahren aufhörte sterblich zu sein. Kurz vorher noch hatte<br />
er sich, wie viele fromme Inder im Alter pflegen, zum<br />
Sannyäsin (Entsager) gemacht, hatte, der Sitte gemäss, einen<br />
neuen Namen angenommen und wurde dementsprechend<br />
nach dem Tode nicht verbrannt, sondern, was nur bei<br />
Sannyäsins und ganz kleinen Kindern Brauch ist, begraben.<br />
Beide machen eine Ausnahme von der Sitte des Verbrennens,<br />
die einen, weil sie noch nicht,, die anderen, weil sie nicht<br />
mehr als Menschen gelten. So ruht denn Apte inmitten der<br />
geistigen Schätze, die er selbst in Poona aufgestapelt, und<br />
die jetzt nach und nach, dank der Betriebsamkeit des Neffen,<br />
ihren Weg in alle Welt finden.<br />
Dieser Neffe traf uns also auf dem Bahnhofe zu Poona<br />
und stellte sich für die Tage unseres Aufenthalts ganz zur<br />
Verfügung. Sein Wort hat er treulich gehalten. Er zeigte<br />
uns das gesamte Änandäcrama-Institut, beraumte dort uns zu<br />
14*
212 VIII. Von Bombay nsch Ceylon.<br />
Ehren eine Versammlung von Pandits an, begleitete uns durch die<br />
Stadt, zu den Gärten und zu dem berühmten Saiiga, d. h. dem<br />
Zusammenflusse der Flüsse Muta und Mula. Das Endziel<br />
unserer Wanderung war dann wiederholt der im Süden der<br />
Stadt gelegene Pärvati-Hügel mit einem Tempel der Durgä<br />
oder Pärvatt, auch Gauri genannt, der Gemahlin des Civa.<br />
Von der Höhe geniesst man eine herrliche Aussicht auf die<br />
Stadt und weite.Umgegend. Hier sassen wir lange Stunden<br />
und führten manches angenehme Gespräch. Apte als gebil<br />
deter und gelehrter Mann hatte natürlich keine andere Reli<br />
gion als den Vedänta, erklärte aber, ähnlich wie Telang in<br />
Bombay, um seiner Familie willen an dem Kultus der Götter<br />
bilder festzuhalten. Für ihn seien alle Götterbilder nur Inkar<br />
nationen des Ätman, aber er hüte sich, ein Gemüt irre zu<br />
machen, welches sich nicht zur Reinheit dieses Standpunktes<br />
zu erheben vermöge. Hier wie so oft hatte ich den Ein<br />
druck, dass der denkende Teil der Bevölkerung in Indien<br />
ebenso gut wie in Europa den Priesterlehren frei gegenüber<br />
steht, aber nur um der Familien willen nicht auf den Götter<br />
kultus verzichtet, wie wir nicht auf die kirchliche Trauung,<br />
Taufe und Beerdigung, auch wenn wir uns von allen aber<br />
gläubischen Vorstellungen frei gemacht haben.<br />
Es war Nacht geworden, als wir den Parva/z-Hügel<br />
verliessen und den Rückweg durch die Stadt antraten. Hier<br />
war gerade das Holt genannte Volksfest im Gange. Auf<br />
der Strasse vor den Häusern waren kleine Scheiterhaufen<br />
mit hellem, flammendem Feuer zu sehen; fröhliche Gestalten<br />
sassen oder standen um dieselben herum und warfen Blumen<br />
oder Körner in die Flamme. Andere zogen in Gruppen um<br />
her und trieben allerlei Mutwillen. Ein Hauptspass bestand<br />
darin, dass man sich gegenseitig mit Erde bewarf; viele<br />
trugen, um die Kleider zu schonen, einen sackartigen Über<br />
wurf, welchem die Spuren der auf den Eigentümer gewor<br />
fenen Erdschollen ein buntscheckiges Ansehen gaben. Das
Das Holifest. Bhandarkar. Von Poona nach Madras. 213<br />
Ganze erinnerte an unseren Karneval oder die Saturnalien<br />
der Römer, und welches auch immer die religiösen Motive<br />
des Festes sein mögen, jedenfalls beruht seine gegenwärtige<br />
Form auf dem auch bei uns bestehenden Bedürfnis, ge<br />
legentlich einmal der strengen Herrscherin Vernunft zu ent<br />
laufen und ein Kind oder ein Narr zu sein: dulce est desipere<br />
in loco.<br />
Wir verfehlten natürlich nicht, in Poona den um das<br />
Sanskrit so hoch verdienten Professor Bhandarkar zu be<br />
suchen, von dem wir in seiner höchst anmutigen, in edelstem<br />
Geschmack ausgestatteten Villa auf das freundlichste<br />
empfangen wurden. Von Bombay aus hatte ich meinen<br />
Vedäntavortrag gleichsam als Visitenkarte vorausgeschickt.<br />
So wandte sich das Gespräch naturgemäss der Philosophie<br />
zu, und auf einem längeren Abendspaziergang erwärmte ich<br />
mich an dem lebendigen Interesse, welches dieser geistes<br />
klare und warmherzige Inder an Schopenhauers Philosophie<br />
nahm.<br />
So verflossen die drei Tage unseres Aufenthaltes in<br />
Poona in der angenehmsten Weise und stärkten uns für die<br />
lange und heisse, achtundzwanzigstündige Eisenbahnfahrt,<br />
die wir um drei Uhr nachts begannen und die Nacht, den fol<br />
genden Tag und die ganze nächstfolgende Nacht fortsetzten,<br />
bis wir am 5. März morgens um acht Uhr im Bahnhofe zu<br />
Madras einliefen. Hiermit waren wir von dem westlichen<br />
nach dem östlichen Meer, von Malabar nach Koromandel<br />
gelangt, zugleich aber aus dem mittleren nach dem süd<br />
lichen Indien, und eine ganz bedeutende Steigerung der<br />
Hitze machte sich schon auf dem kurzen Spaziergang in der<br />
Morgenfrühe vom Bahnhofe bis zum Hotel bemerklich.<br />
Die klimatischen Verhältnisse- sind hier andere und<br />
weniger günstige als im nördlichen und westlichen Indien.<br />
Dort ist die Regenzeit im Hochsommer und schützt vor<br />
den schärfsten Pfeilen der senkrecht herabstrahlenden Sonne;
214 VIII. Von Bombay nsch Ceylon.<br />
Madras hingegen unterliegt der Einwirkung des im Winter<br />
wehenden Nordwest-Monsun, hat seine eigentliche Regen<br />
zeit im Winter, und im Sommer die strengste, nur durch<br />
den Einfluss des Meeres gemässigte Tropenhitze.<br />
Wie das Klima, so war auch die Bevölkerung nach<br />
Farbe, Typus und Sprache sehr von der des nördlichen und<br />
nordwestlichen Indiens verschieden. Dort war die Sprache<br />
und mithin wohl auch die Bevölkerung arischen Ursprungs;<br />
hier im Südosten und Süden Indiens werden Sprachen ge<br />
sprochen, welche mit dem Sanskrit gar keine Verwandt<br />
schaft haben. Zieht man eine Linie von Bombay oder süd<br />
licher nach Orissa, so trennt dieselbe die sieben arischen<br />
Sprachen von den vier nichtarischen, welche im Süden<br />
Indiens gesprochen werden. An der Spitze der ersteren<br />
steht das in der ganzen Gangesebene vom Pendschäb bis<br />
Bengalen herrschende Hindostani. Dasselbe zerfällt in das<br />
von der Bevölkerung gesprochene Hindi und in das Urdu<br />
(auch Hindostani im engeren Sinne genannt), welches nichts<br />
anderes als ein durch zahlreiche persische und arabische<br />
Wörter verunstaltetes Hindi ist. Diese Eindringlinge, ver<br />
gleichbar den französischen Wörtern im Englischen, er<br />
schweren das Studium des Hindostani erheblich, während<br />
das reine Hindi dem Sanskritkundigen sehr leicht wird, da<br />
es im Grunde nur ein die Endungen abstreifendes und<br />
durch Partikeln ersetzendes Sanskrit ist. Durch die mo<br />
hammedanischen Eroberer wurde das Hindostani in der er<br />
wähnten entstellten Form eine Art lingua franca, welche<br />
mehr oder weniger in ganz Indien verstanden wird. An das<br />
im Gangestale gesprochene Hindi schliessen sich östlich da<br />
von das Bengali und Orissa, westlich das Pendschabi im<br />
Pendschäb, das Sindi am unteren Laufe des Indus, das<br />
Gujerati nördlich von Bombay und das Mahratti, welches<br />
von Bombay aus nach Nordosten sich weit über das Plateau<br />
von Dekhan erstreckt. Das sind die sieben arischen Sprachen
Die Sprachen Indiens. Professor Oppert. 215<br />
Indiens, welche sich zum Sanskrit verhalten, wie die roma<br />
nischen Sprachen zum Lateinischen, und ungefähr ebenso<br />
weit wie diese von einander abstehen mögen. Hingegen<br />
haben die folgenden vier Sprachen des Südens nichts mit<br />
dem Sanskrit gemein: 1. an der Ostküste Indiens das Telugu<br />
von Orissa bis Madras und 2. das Tamil von Madras bis<br />
auf Ceylon, wo es an das für eine arische Sprache gehaltene<br />
Singhalesische grenzt, endlich im äussersten Südwesten Indiens<br />
3. das Kanaresische und 4. das Malayälam. Das sind die<br />
zwölf Volkssprachen, welche heutigen Tages in Indien und<br />
Ceylon gesprochen werden. Wir befanden uns also in<br />
Madras schon im Telugulande. Die dunkelfarbige Bevöl<br />
kerung der Eingeborenenstadt, von den Engländern the black<br />
town genannt, und ihre Sprache mutete uns fremdartig an;<br />
auch einzelne vom Ohr aufgefangene Worte Hessen sich<br />
nicht deuten.<br />
Um so wertvoller war es mir, in dem damals noch in<br />
Madras das Sanskrit vertretenden Professor Oppert einen<br />
alten Bekannten begrüssen zu können. Er bewohnte als<br />
Junggeselle ein mehrstöckiges Haus und bestand darauf, dass<br />
wir bei ihm wohnen sollten. Erst am folgenden Tage nahm<br />
ich dieses Anerbieten an, nachdem wir im Hotel bei sehr<br />
<strong>•</strong> grosser Hitze in einem kleineren Zimmer eine recht schlechte<br />
Nacht verbracht hatten. Aber auch die Nacht bei Oppert<br />
sollte uns keine Ruhe gewähren. Er hatte für den Abend<br />
einige Gäste gebeten und brachte uns, nachdem diese sich<br />
zurückgezogen, in ein geräumiges, luftiges Schlafzimmer,<br />
dessen Betten aber keine Mückennetze hatten. Freund<br />
Oppert tröstete uns mit der vorhandenen Pankha, einem von<br />
aussen gezogenen, über den Betten hin- und herschwingenden<br />
Vorhang. Ich hatte viel von diesen, während der Nacht von<br />
Pankhaziehern mittels eines Seiles gezogenen, Pankhas ge<br />
hört und beschloss, einen solchen für die Nacht anzustellen.<br />
Für diesen Nachtdienst erhält er 50 Pfennig. Er versah
216 VIII. Von Bombay nach Ceylon.<br />
seinen Dienst ohne einzuschlafen; ich brauchte nicht Wasser<br />
nach ihm zu spritzen oder ihn mit Stiefeln zu werfen, wie<br />
viele zu tun pflegen, wenn er einschläft und man, in Schweiss<br />
gebadet, erwacht, denn ich schlief überhaupt nicht ein son<br />
dern lag die ganze Nacht im Kampfe mit den Mücken, welche<br />
uns trotz der Pankha keine Ruhe Hessen. Übrigens war<br />
Oppert nicht nur gegen uns liebenswürdig, sondern hatte<br />
auch eine ausnahmsweise nette Art, mit den eingeborenen<br />
Studierenden umzugehen. Er ging mit ihnen spazieren, lud<br />
sie in sein Haus und nahm sich ihrer in jeder Weise an.<br />
Er nahm mich mit in seine Sanskritklasse und überliess mir<br />
dort das Regiment. Es war eine erhebende Stunde; vor mir<br />
sassen wohl dreissig schwarzbraune Jünglinge, welche meinen<br />
Worten lauschten, und rechts schweifte mein Blick auf den<br />
roten Sand und das ganz in der Nähe brandende Meer, von<br />
welchem eine erquickende Kühle durch die weit geöffneten<br />
Fenster hereindrang.<br />
Madras hat einen herrlichen Strand aber, wie die ganze<br />
Ostküste von Indien, keinen Hafen. Mit ungeheuren Kosten<br />
hatte man durch Einsenken von Steinmassen in das Meer<br />
einen solchen erbaut, da kam eine Sturmflut und schwemmte<br />
die ganze Arbeit weg. Eben war man damit fertig geworden,<br />
ein noch stärkeres Bollwerk in die See hinauszuschieben.<br />
Hoffen wir, dass dieses allen Stürmen trotzen wird.<br />
Auf ein sonderbares Schauspiel machte man mich auf der<br />
Seewarte des Fort George aufmerksam. Durch ein scharfes<br />
Fernrohr sah ich weit im Meere, wohl eine Stunde vom Ufer<br />
entfernt, zwei Männer auf einem Fahrzeug treiben, welches<br />
nur aus einigen durch Querhölzer zusammengehaltenen Balken<br />
bestand. Grosse, wüste Wellenberge gingen über sie weg,<br />
das Fahrzeug war bald unter, bald über Wasser. Die Sache<br />
sah wohl gefährlicher aus als sie war. So lange diese<br />
Fischmenschen nicht von ihrem Balkengefüge weggespült<br />
werden, haben sie nichts zu befürchten, denn das andauernde'
Mückenplage. Eine Sanskritklasse. Ein edler Mahäräja. 217<br />
Bad ist bei den dortigen Temperaturverhältnissen nur eine<br />
Erquickung.<br />
Auf dem Fort in Madras sah ich unter vielen Büchern und<br />
Handschriften auch ein Exemplar des aus unübersehbar vielen<br />
Bänden bestehenden Indian Gazetteer. Es ist dies eine von Jahr<br />
zu Jahr fortschreitende statistische Sammlung aller möglichen<br />
Tatsachen, welche für jede Provinz aufgezeichnet und der Nach<br />
welt aufbewahrt werden. Auch hier, wie in so vielem, kann<br />
die englische Verwaltung allen anderen als Muster dienen.<br />
Durch einen Zufall hörte ich in Madras, dass der<br />
Mahäräja von Vijayanagaram, einem kleinen Reiche an der<br />
Ostküste südlich von Orissa, für kurze Zeit auf einem seiner<br />
Schlösser in der Nähe von Madras sich aufhalte. Der Name<br />
dieses Mannes war uns von dem vor sechs Monaten in<br />
London abgehaltenen Orientalistenkongresse her in guter<br />
Erinnerung. Als nämlich Max Müller zu einem Neudruck<br />
seiner Rigveda-Ausgabe in vier starken Bänden schreiten<br />
musste, und die englische Regierung es ablehnte, die grossen<br />
Kosten des Druckes, wie bei der ersten Auflage, auch diesmal<br />
zu tragen, da war der Mahäräja von Vijayanagaram für sie<br />
eingetreten. „Und dieser edle Fürst," so sagte Max Müller<br />
in einem Vortrage auf dem Kongresse, „hat nicht nur die<br />
sämtlichen Kosten für die Herstellung des Werkes getragen,<br />
sondern auch eine so grosse Anzahl von Freiexemplaren mir<br />
zur Verfügung gestellt, dass jeder von Ihnen, welcher ernstlich<br />
mit dem Studium des Rigveda beschäftigt ist, ein Exemplar<br />
gratis erhalten kann." Diese Liberalität bei einem Werke,<br />
dessen Ladenpreis 160 Mark ist, machte auf alle Anwesenden<br />
tiefen Eindruck. Ich selbst konnte davon keinen Vorteil ziehen,<br />
da ich das Werk durch die Güte Max Müllers schon längst be-<br />
sass, habe aber wiederholt für würdige jüngere Freunde und<br />
Freundinnen von Max Müller ein Exemplar erbeten und erhalten.<br />
Die Nachricht von der Anwesenheit dieses Mahäräja auf<br />
seinem Schlosse bei Madras erfüllte mich mit um so grösserer
218 VIII. Von Bombay nach Ceylon.<br />
Freude, als ich nicht gehofft hatte, auch diesem edlen Förderer<br />
der Wissenschaft in Indien zu begegnen. Nach dem Tiffin<br />
nahm ich einen Wagen und fuhr mit meiner Frau nach dem<br />
von herrlichen Gartenanlagen umrahmten Schlosse. Auf der<br />
Veranda sass, von Schreibsachen umgeben, ein alter, schwer<br />
höriger und von Gicht geplagter Engländer, welcher mir<br />
ziemlich mürrisch erwiderte, dass Seine Hoheit der Mahäräja<br />
nicht zu Hause sei und auch nach seiner Rückkehr zu be<br />
schäftigt sein werde, um mich zu empfangen. „Das werden<br />
wir ja sehen," sagte ich, „wenn er erst meinen Namen ge<br />
lesen haben wird. Einstweilen werde ich sein Eintreffen<br />
hier abwarten." Ein unbestimmtes Knurren ward mir zur<br />
Antwort. Ich wartete geduldig eine halbe Stunde und knüpfte<br />
unterdessen eine Unterhaltung mit einem indischen Sekretär<br />
an, der abseits auf der Veranda sass, und wir waren schon<br />
ein wenig warm geworden, als ein Diener erschien und uns<br />
zum Mahäräja geleitete. Dieser war ein feiner, schmächtiger,<br />
etwas schüchterner junger Mann von vornehmer Haltung.<br />
Ich berichtete ihm vom Orientalistenkongress in London,<br />
und wie dankbar wir alle für seine Tat seien. Er hörte<br />
mit grossem Interesse zu und fragte nach meiner Reise.<br />
Inzwischen wurde in kostbaren silbernen Tassen der Thee<br />
serviert. Ich erzählte von meinen Eindrücken, überreichte meinen<br />
Bombayer Vortrag, und als hierbei auch das unten (S. 242)<br />
mitgeteilte Gedicht Farewell to India zur Sprache kam, bat<br />
er mich dasselbe vorzulesen und war sichtlich gerührt, als<br />
ich es ihm überreichte. Mit den angenehmsten Empfindungen<br />
verabschiedeten wir uns und rollten nach Madras zurück.<br />
Statt mit dem Dampfer von Madras um Ceylon herum<br />
(denn durch Räma's Brücke, bedauerlicherweise Adam's<br />
Bridge genannt, können keine Dampfer fahren) nach Colombo<br />
zu reisen, zogen wir es vor, auch noch die südlichste Spitze<br />
des geliebten Landes auf der Bahn zu durchfahren und<br />
hierbei im Fluge den Städten Tanjore, Trichinopoly und
Beim Mahäräjs von Vijsyanagaram. Tanjore. Trichinopoly. 219<br />
Madura mit ihren Tempeln und Palästen einen flüchtigen<br />
Besuch abzustatten. Es war dies möglich, wenn wir die<br />
Nächte zum Fahren benutzten und Tags über die Städte<br />
besuchten. Die erste Nacht brachte uns von Madras nach<br />
Tanjore, wo wir von 8—10 Uhr morgens auf einem über<br />
spannten Ochsenkarren, dem einzigen vorhandenen Fuhr<br />
werk, lang ausgestreckt Hegend und wieder einmal Mrs.<br />
Davidson im Fluge begrüssend, zu den Sehenswürdigkeiten,<br />
vor allem zu dem grossen Tempel fuhren. Der Brahmanismus<br />
ist in Südindien importiert und hat hier seinen Göttern,<br />
gleichsam zum Schutze im fremden Lande, riesige Tempel<br />
erbaut, welche ganze Stadtviertel einnehmen und wohl<br />
verwahrten Festungen gleichen. Um das Allerheiligste,<br />
welches keinem Europäer zugänglich ist, ziehen sich drei, vier,<br />
fünf oder mehr Umwallungen, welche die zum Tempel ge<br />
hörigen Priesterwohnungen und andere Baulichkeiten ent<br />
halten. Durch diese Umwallungen führen die sogenannten<br />
Gopura's, hohe Torbogen, welche sich zu gewaltigen Türmen<br />
zuspitzen. Die Torbogen und überragenden Türme sind<br />
übersät von einem Gewimmel mythologischer Figuren, welche<br />
plastisch hervortreten und in ihrer farbigen Ausführung<br />
manche Gruppen von hoher Schönheit zeigen.<br />
Nach zweistündiger Weiterfahrt erreichten wir Trichino<br />
poly, wo wir wieder einen solchen Riesentempel mit hoch<br />
ragenden Gopuras besichtigten und dann, als es kühler<br />
geworden war, einen die Stadt hoch überragenden Felsen<br />
mit eingeschnittenen Wegen, Betstationen und einem die<br />
Spitze krönenden Tempel bestiegen. Die Aussicht von hier<br />
oben auf Stadt, Landschaft und Gebirge war von wunder<br />
barer Schönheit. Wir genossen sie mit dem Bewusstsein,<br />
in 24 Stunden den heiligen Boden Indiens verlassen zu müssen.<br />
Wieder verbrachten wir eine unruhige Nacht auf der<br />
Eisenbahn, die wir am frühen Morgen in Madura verliessen,<br />
um uns von einem Führer zu den Sehenswürdigkeiten geleiten
220 VIII. Von Bombay nach Ceylon.<br />
zu lassen. Als wir unterwegs einige Erfrischungen zu uns<br />
nahmen und davon auch dem Führer anboten, lehnte er sie<br />
dankend ab, mit der Begründung, dass seine hohe Kaste<br />
ihm die Annahme nicht gestatte. Er führte uns zu dem be<br />
rühmten Nyagrodhabaume, der an Schönheit dem in Cal<br />
cutta nahe, wenn auch nicht gleich kommt. Dann wurden<br />
Palast und Tempel mit ihrem reichen Inhalte besichtigt, und<br />
um 12 Uhr sassen wir wieder auf der Bahn, der letzten<br />
Südspitze Indiens zustrebend, wo in Tuticorin der Dampfer<br />
nach Ceylon uns aufnehmen sollte. Da dieser von Bom<br />
bay kommende Dampfer Tuticorin um 6 Uhr abends anlief,<br />
unser Zug aber erst 5 Minuten später eintraf, so hatten wir<br />
telegraphisch ersucht, auf uns zu warten. Am Bahnhofe von<br />
Tuticorin war denn auch bei unserer Ankunft ein unter<br />
geordneter Vertreter derDampfschiffsagentur anwesend, welcher<br />
zur Eile aufforderte, da der Dampfer schon draussen in der<br />
See auf uns warte. „Haben Sie", fragte ich, „die von mir<br />
telegraphisch gewünschte Steam-launch (Dampfpinasse) be<br />
sorgt?" — „Ja wohl, mein Herr." Wir eilten zum Ufer<br />
und fanden dort statt der versprochenen Dampfpinasse nur<br />
ein ganz ordinäres Segelboot, ohne Bänke und ohne Verdeck,<br />
die Wände so hoch, dass man jedesmal hinaufklettern<br />
musste, wenn man etwas sehen wollte. In diesem elenden<br />
Obstkahn sollten wir bei hereinbrechendem Dunkel nach<br />
dem Dampfer befördert werden, welcher so weit im Meere<br />
lag, dass man ihn kaum sehen konnte. Ich war über diese<br />
Zumutung höchst aufgebracht und bestand darauf, dass der<br />
Kommissionär zu unserer Sicherheit mit zum Dampfer fahren<br />
müsse. Wir Hessen also meine Frau und unsere zahlreichen<br />
Gepäckstücke vorsichtig an den hohen Wänden des Fahr<br />
zeugs auf den schmutzigen Boden herunter, kauerten selbst<br />
auf demselben nieder, und die Fahrt begann. Der Wind<br />
war konträr; es musste laviert werden. Der Wind wurde<br />
stärker, die See immer unruhiger. Meine Frau wurde see-
Madurs. Tuticorin. Eine ungemütliche Bootfshrt. 221<br />
krank, die Situation immer ungemütlicher. Wie gewöhnlich<br />
in den Tropen war auf eine kurze Dämmerung tiefdunkle<br />
Nacht gefolgt. Immer wieder kletterte ich an der Bootswand<br />
hinauf und spähte nach dem Licht des Dampfers, aber es<br />
wollte und wollte nicht näher kommen. Plötzlich stiess der<br />
Mann am Steuerruder mit dem Ausdruck des Schreckens<br />
einige mir unverständliche Worte hervor. „Was hat er ge<br />
sagt?" fragte ich. „Er sagte", hiess es, „auf dem Wrack,<br />
das auf unserem Wege liege, sei kein Licht." Wie, wenn<br />
wir in der Dunkelheit dagegen rannten! „Das wäre," sagte<br />
mir später der Schiffskapitän, „Ihre letzte Stunde gewesen."<br />
Endlich kam das Licht des Dampfers näher und näher, und<br />
gegen 8 Uhr erreichten wir nach zwei qualvollen Stunden<br />
das Schiff. Die See war so wüst, dass man nicht wagte,<br />
die Schiffstreppe herunterzulassen. Zwei Schiffsoffiziere<br />
kletterten an einer Strickleiter herunter und brachten schie<br />
bend und ziehend meine Frau auf das Verdeck, während<br />
das Boot an der Seite des Schiffes ungestüm auf- und<br />
niedertanzte. Jetzt wurden die verschiedenen Kollis und<br />
Köfferchen an Stricken in die Höhe gezogen. Mit Angst<br />
sah ich sie über dem Wasser schweben. Es brauchte nur<br />
ein Schloss aufzugehen, und der ganze Inhalt wäre im<br />
Meere verschwunden. Endlich war nun alles oben. Ich<br />
stieg auf der Strickleiter hinauf, bezahlte die Leute, und der<br />
Dampfer setzte sich in Bewegung. Es war ein grosser, mit<br />
allem Komfort ausgestatteter Dampfer der von Eingeborenen<br />
unterhaltenen Asiatic Society. Nur wenige Passagiere, meist<br />
Eingeborene der besseren Stände, waren an Bord. Man<br />
empfing uns äusserst liebenswürdig, gab uns reichlich zu<br />
essen und zu trinken und wies uns eine für uns reservierte<br />
grosse, luftige und saubere Kabine an, in der wir zum ersten<br />
Male seit langer Zeit wieder eine gute Nachtruhe hatten.<br />
Der andere Morgen fand uns noch zwischen Himmel und<br />
Wasser; erst gegen Mittag tauchten die Umrisse von Ceylon
222 VIII. Von Bombay nsch Ceylon.<br />
aus dem Meere auf, und nun kam das wundervolle Eiland<br />
mit seinem Kranze von Palmenwäldern und seinen hoch<br />
ragenden Bergen immer näher heran. Um drei Uhr warfen<br />
wir Anker, lasen beim Aussteigen eine in den grössten<br />
Buchstaben dem Reisenden entgegentretende Warnung vor<br />
den grossen Gefahren des Sonnenstichs, und bald darauf<br />
waren wir in dem Zimmer eines guten Hotels behaglich unter<br />
gebracht. Da hier nicht wie in Indien ein Pensionspreis für<br />
den Tag, sondern wie bei uns .alles einzeln bezahlt wurde,<br />
so war vorauszusehen, dass die Hotelkosten doppelt so hoch<br />
wie in Indien sein würden. Wir bestellten das Dinner für den<br />
Abend und Hessen zwei der an allen Strassenecken zu fin<br />
denden Jinrikisha herbeiholen. Es sind das allerliebste<br />
kleine Kärrchen von eleganter Ausstattung, deren zwischen<br />
zwei hohen Rädern befindlicher Sitz nur für eine Person<br />
Platz gewährt, und welche nicht von Pferden, sondern von<br />
einem chokoladenfarbigen, bis auf Kopftuch und Lendentuch<br />
vollkommen nackten Manne gezogen werden. Die Sitte<br />
stammt aus Japan, wie auch der Name, der auf Japanisch<br />
„Mannwagen" bedeutet. Dieses Beförderungsmittel steht<br />
der Droschke an Schnelligkeit wenig nach und ist dabei<br />
bedeutend billiger. Unser Besuch galt einem meiner ältesten<br />
Jugendfreunde, dem Kaiserlich deutschen Konsul Philipp<br />
Freudenberg, der ebenso wie ich vom Westerwald stammte.<br />
Unsere Eltern waren dort befreundet gewesen, und wir selbst<br />
hatten als Kinder uns oft besucht und zusammen gespielt,<br />
aber seit 1853, also seit 40 Jahren, uns nicht mehr gesehen.<br />
Unsere beiden Menschenpferde trabten tapfer darauf los,<br />
doch bedurfte es längeren Herumfahrens in der von duftigen<br />
Gärten durchzogenen Villengegend Colombos, bis wir das herr-<br />
liche,von Veranden und Gärten umgebene Haus Freudenbergs<br />
erreichten. Auf der Veranda brannte Licht, und kaum hatten wir<br />
unsere Karten hineingeschickt, als von dorther der kräftige<br />
deutsche Ausruf hörbar wurde: „Na, endlich!" Freudenberg
Ankunft in Colombo. Konsul Freudenberg. 223<br />
empfing unsern längst erwarteten Besuch auf das freund<br />
lichste. Er sei ganz allein zu Hause, da seine Frau mit den<br />
vier Söhnen in Deutschland weile, und sein Bruder sich eben<br />
auf der Hochzeitsreise im Gebirge befinde. Wir müssten<br />
ohne Widerrede, so lange wir in Colombo weilten, bei ihm<br />
wohnen. Ich sagte es für den nächsten Tag zu, aber er<br />
bestand darauf, dass wir noch am selbigen Abend bei ihm<br />
unseren Einzug halten müssten, und so blieb mir nichts<br />
übrig, als ins Hotel zurückzufahren, die Bestellung der<br />
Zimmer wieder rückgängig zu machen und in später Abend<br />
stunde mit Sack und Pack in dem schönen Hause Freuden<br />
bergs einzutreffen, welches den Namen Sirinivesa, d. h.<br />
„Wohnsitz des Glückes" führte. Hier konnten wir uns in der<br />
oberen Etage nach Herzenslust ausbreiten und genossen mit<br />
Behagen die Gastfreundschaft des reichen und vornehmen<br />
Hauses. Eine zahlreiche Dienerschaft, die Haare nach singha-<br />
lesischer Sitte mit einem Kamme nach Weiberart hinten<br />
aufgesteckt, bediente uns bei Tische, zum Schlüsse der Mahl<br />
zeit erschienen die köstlichsten Früchte, Ananas, Bananen,<br />
Mangos, und als wir über diese Fülle der Gaben des Landes<br />
unsere Bewunderung aussprachen, äusserte Freudenberg mit<br />
Bescheidenheit: „Es ist unser gewöhnliches Dessert!"<br />
Aber auch für unsere geistigen Bedürfnisse sorgte unser<br />
liebenswürdiger Wirt, indem er, soweit es seine Zeit erlaubte,<br />
mit uns in die Stadt und zu den Sehenswürdigkeiten fuhr.<br />
Das reichhaltige Museum, der grosse Buddhatempel mit<br />
seiner Kolossalstatue des liegenden Buddha, der herrliche<br />
Strand mit seiner erfrischenden Brise sind mir noch in<br />
bester Erinnerung. Mit besonderem Interesse besuchten wir<br />
auch die weitausgedehnten Anlagen der Kokosölfabrik<br />
unseres Freundes. Er führte uns durch das Lager, in<br />
welchem das von überall her angekaufte Rohmaterial, näm<br />
lich das zwischen der hölzernen Schale und dem inneren<br />
Saft sich zu einer Schicht ablagernde Fleisch der Kokos-
224 VIII. Von Bombay nach Ceylon.<br />
nüsse, getrocknet wurde. Wir sahen die Vorrichtungen,<br />
durch welche dieses Material zerschnitten, zerstampft, zer<br />
rieben wurde, bis aus ihm unter dem Drucke gewaltiger<br />
Pressen ein breiter Strom goldig klaren Kokosöls in mäch<br />
tigem Sprudel emporquoll. In einer besonderen Abteilung<br />
wurden die 500 Liter haltenden Fässer gebaut, dicht gemacht<br />
und schliesslich gefüllt, um nach allen Himmelsgegenden<br />
versandt zu werden. Mit diesem Hauptgeschäfte war früher<br />
ein Handel mit Kaffee verbunden. Neuerdings war an seine<br />
Stelle der Thee getreten, seit der Kaffee in Ceylon'den Ver<br />
heerungen durch ein gewisses Insekt ausgesetzt ist, sodass<br />
der Anbau sich nicht mehr lohnt.<br />
Wir verliessen den Freund für einige Tage, um der oben<br />
im Gebirge Hegenden Stadt Kandy, der alten Hauptstadt des<br />
Reiches, einen Besuch abzustatten. Die dort hinführende Ge<br />
birgsbahn durchläuft längere Zeit die dichten Palmenwälder<br />
des Küstensaumes, bis sie dann, am Gebirge emporsteigend,<br />
in fünf Stunden nach Kandy führt. An einer Haltestelle bot<br />
ein Mann als Erfrischung Kokosnüsse, das Stück zu zehn<br />
Pfennig, an. Ich kaufte eine solche; er schlug mit einem<br />
wohlgezielten Hiebe die obere Decke ab, und so empfing ich<br />
das kühle, wie eine matte Limonade schmeckende Getränk<br />
mitsamt seinem natürlichen Becher. Gegen Abend erreichten<br />
wir das von bewaldeten Bergen umgebene, reizend an einem<br />
See gelegene Kandy. An den Ufern desselben liegen mehrere<br />
Buddhistenklöster, denen wir am folgenden Tage einen Be<br />
such abstatteten. Um einen bescheidenen Hofraum herum zog<br />
sich das Gebäude, welches die Zellen für die Mönche enthielt.<br />
Wir besichtigten eine solche, welche gerade leer stand. Ein<br />
Tisch mit einem Wasserkrug und ein ärmliches Lager machten<br />
den ganzen Inhalt aus. Die übrigen Zellen durften wir nicht<br />
betreten, weil, wie es hiess, die Mönche darin mit Studieren<br />
beschäftigt seien. Da es gerade um die heisse Mittagszeit<br />
war, so werden sie wohl über ihren Palmblatthandschriften
Nach Kandy. Ein Buddhistenkloster. Heutiger Buddhismus. 225<br />
ein wenig eingenickt sein. Das Studieren der Mönche, so<br />
weit es überhaupt statt hat, besteht wohl überwiegend im<br />
Abschreiben von Handschriften. Das Schreiben geschieht auf<br />
Streifen von Palmblättern. Mit einer Nadel, die sich dabei<br />
auf den immer weiter vorangeschobenen Daumennagel der<br />
linken Hand stützt, werden die rundlichen Schriftzüge von<br />
der rechten Hand mit grosser Geschwindigkeit dem Blatte<br />
eingegraben und durch eine hinterher eingeriebene Schwärze<br />
sichtbar gemacht. Solche Handschriften sind sehr billig zu<br />
haben. Von einem Händler auf der Strasse erstand ich für<br />
ein paar Rupien ein ganzes Bündel solcher beschriebener<br />
Palmblätter und habe daraus manchen Buddhaschwärmer in<br />
Europa beschenkt.<br />
Gegen Abend besuchten wir den berühmten Buddha<br />
tempel, in welchem wir uns unter den Schwärm der aus- und<br />
eingehenden Verehrer mischten. Ein junger Mönch erkannte<br />
uns als Fremde und machte sich mit uns zu schaffen, indem<br />
er unaufgefordert uns auf dieses und jenes im Tempel auf<br />
merksam machte. Ich Hess es mir gefallen, war aber nicht<br />
wenig überrascht, als mich der Mönch zum Schlüsse um ein<br />
Trinkgeld bat. „Ich denke, Ihr Buddhisten dürft kein Geld<br />
nehmen", sagte ich. „Ich will es auch nicht für mich", er<br />
widerte er, „sondern für meine Bücher". Der Buddhismus<br />
scheint in der Tat von seiner alten Strenge so ziemlich alles<br />
verloren zu haben, wenn ich auch die Geschichte dahinge<br />
stellt sein lassen will, welche mir unser Führer erzählte, dass<br />
aus dem Kloster drüben am See vor einigen Jahren ein Mönch<br />
gehenkt worden sei, weil er, in einen Liebeshandel verwickelt,<br />
seinen Rivalen aus Eifersucht ermordet habe.<br />
Am Nachmittag fuhren wir nach Peradeniya, um den<br />
dortigen weltberühmten botanischen Garten zu besuchen.<br />
Wir wurden, dank einem Empfehlungsbriefe Freudenbergs,<br />
sehr zuvorkommend empfangen und herumgeführt. Während<br />
es unten in der Ebene von Colombo für viele Pflanzen zu<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien. 15
226 VIII. Von Bombay nach Ceylon.<br />
heiss ist, so gedeiht hier oben alles, was wir von Jugend auf<br />
zu schätzen wissen, Kaffee, Zucker, Vanille, Kampfer, Kakao,<br />
Zimt und alle möglichen Gewürze in freier Luft. Einige<br />
Schuppen dienen zum Schutze gegen Wind und Regen; Ge<br />
wächshäuser gibt es im übrigen nicht, denn was hier nicht<br />
im Freien fortkommt, das würde wohl überhaupt nirgendwo<br />
wachsen. Auch viele edle Baumarten wurden uns teils als<br />
lebende Pflanzen, teils als Holz im Querschnitt gezeigt, und ich<br />
bemerkte beim Ebenholz, dass nur der innere Kern des<br />
Stammes schwarz ist, während die umgebenden Schichten<br />
sich von denen anderer Bäume nicht merklich unterscheiden.<br />
Nachdem wir beim Direktor des botanischen Gartens<br />
den Nachmittagsthee eingenommen, folgten wir gern seiner<br />
Einladung, eine benachbarte Theeplantage zu besichtigen.<br />
Man führte uns durch die nur niedrigen, in regelmässigem<br />
Abstände von einander entfernten Theesträuche, an denen<br />
wir viele Weiblein mit Tragkörben auf dem Rücken be<br />
schäftigt sahen. Sie sammelten die einzelnen Blätter, wobei,<br />
wie man mir sagte, die Vorschrift besteht, dass von sieben<br />
Blättern drei gepflückt werden dürfen und vier stehen bleiben<br />
müssen. Wir wandten, uns dem auf der Plantage stehenden<br />
Hause zu. In einem Zimmer war gerade Ablöhnung. Die<br />
Weiber drängten sich mit ihren Körben heran, ein Knabe<br />
setzte jeden Korb auf die Wage, und ein junger Engländer<br />
beobachtete den Zeiger und warf jeder Sammlerin einige<br />
Kupferstücke aus einem vor ihm liegenden Haufen zu. Dies<br />
alles war das Werk eines Augenblicks, und so wurden viele<br />
in kurzer Zeit abgefertigt, einige auch dadurch, dass sie<br />
kein Geld, sondern den Korb mit den Blättern zurück erhielten.<br />
Das alles geschah, ohne dass ein Wort dabei gesprochen<br />
wurde. Weiter sahen wir die künstlichen Vorrichtungen<br />
zum Rollen und nachfolgenden Dörren der Blätter. Vierund<br />
zwanzig Stunden nach dem Abpflücken der Theeblätter können<br />
sie bereits zum Getränke verwendet werden.
Peradeniya. Eine Theeplantage. Der Brotbaum. Eine Schlange. 227<br />
Unter Donner, Blitz und Regen eines tropischen Ge<br />
witters, wie sie auf Ceylon häufig sind, kehrten wir nach<br />
Kandy zurück. Am nächsten Morgen machten wir vor der<br />
Abreise noch einen Spaziergang auf den bewaldeten Hügeln<br />
der Umgebung. Beim Heraufsteigen vom See aus kamen<br />
wir an einem Brotbaum vorbei, dessen unförmige Früchte<br />
ungefähr die Grösse und Form eines Schwarzbrotes haben.<br />
Ich Hess von einem Knaben eine Frucht herunterholen. Sie<br />
enthielt eine schwammige Masse, in welcher eine grosse<br />
Zahl von Kernen eingebettet liegt. Nur diese Kerne sind<br />
es, welche gegessen werden und um derentwillen die Frucht<br />
geschätzt wird. Anmutige Promenadenwege führten höher<br />
hinauf und gewährten Durchblicke auf den See und die<br />
'Stadt von überraschender Schönheit. Alle diese Wege<br />
waren nach dem Namen irgend einer englischen Lady,<br />
Lady Hortoris Walk usw., benannt, als wenn diese Dämchen<br />
erst diese paradiesische Herrlichkeit geschaffen hätten. Noch<br />
stand die Sonne tief und glitzerte horizontal durch die<br />
Blätter der Bäume; eine herrliche Morgenfrische umwehte<br />
uns; der Gesang der Vögel, das Summen der Insekten, der<br />
ganze Zauber des tropischen Waldes umstrickte uns. Unter<br />
angenehmen Gesprächen schritten wir auf einem teilweise<br />
mit Blättern bedeckten Waldwege dahin, als ich eben noch<br />
zur rechten Zeit bemerkte, wie meine Frau im Begriff war,<br />
ihr Füsschen auf eine gerade über den Weg kriechende<br />
schwarze Schlange zu setzen. Mit einem Aufschrei riss ich<br />
sie zurück; ich war erschrocken, sie war erschrocken, aber<br />
auch die Schlange war erschrocken und schlängelte sich<br />
eiligst ins Gebüsch, wo sie verschwand. Das war die<br />
einzige Schlange, die wir im freien Zustande in Indien<br />
während unseres Aufenthaltes vom November bis zum März<br />
angetroffen haben. Für den Europäer, der mit guten Stiefeln<br />
versehen ist und seine Wege wählen kann, ist die Schlangen<br />
gefahr nicht gross. Anders bei den Eingeborenen, wenn<br />
15*
228 VIII. Von Bombay nach Ceylon.<br />
sie mit nackten Füssen und Beinen in den Feldern arbeiten<br />
oder zur Nachtzeit wandern. Hierbei kann es gar leicht<br />
vorkommen, dass sie unversehentlich auf eine Schlange<br />
treten, und das können die Schlangen nun einmal nicht leiden.<br />
Zwei Stunden später waren wir auf dem Bahnhofe und<br />
sahen in der benachbarten Strasse eine vielbeschriebene<br />
Scene. Drei buddhistische Mönche mit kahl geschorenem<br />
Kopfe und langem gelben Gewände hielten in den Händen<br />
ihre durch das Obergewand halbverdeckten Almosenschalen.<br />
Sie gingen von Haus zu Haus und blieben schweigend auf<br />
der Strasse gegenüber der Haustür stehen, bis jemand<br />
heraustrat und ihnen drei Klösse, oder was es sonst sein<br />
mochte, in den Topf legte. Dann gingen sie weiter. Be<br />
kannt ist, dass alle Nahrung der buddhistischen Mönche<br />
erbettelt sein muss. Was sie im Laufe des Vormittags von<br />
Haus zu Haus gesammelt haben, das verzehren sie noch<br />
vor Mittag in ihren Klöstern und dürfen nach zwölf Uhr<br />
mittags den ganzen Tag keine feste Speise mehr zu sich<br />
nehmen. Nach allem, was ich gesehen habe, ist die Lage<br />
eines buddhistischen-Mönches noch weniger zu beneiden<br />
als die eines christlichen, womit doch schon viel gesagt ist.<br />
Auf der Rückfahrt nach Colombo genoss ich noch ein<br />
mal die herrliche' Landschaft und kam mit mir zu dem Schlüsse,<br />
dass die Natur in Ceylon viel schöner ist als in Indien,<br />
dass aber die Bevölkerung Ceylons lange nicht so interessant<br />
ist wie die indische. Denn in Ceylon herrscht der Buddhis<br />
mus, welcher eine grosse Toleranz, aber, als Kehrseite der<br />
selben,, eine ebenso grosse Indifferenz zeigt. Wie der<br />
religiöse, so ist auch der politische Fanatismus den<br />
Singhalesen fremd. Freilich ist Ceylon nicht, wie Indien,<br />
ein von England aus beherrschtes und ausgesogenes Land,<br />
sondern eine englische Kolonie, und das ist ein grosser<br />
Unterschied. In Indien zehrt die sehr kostspielige Ver<br />
waltung das Mark des Landes auf. Wiederholt hat man mir
Bettelnde Buddhistenmönche. Ceylon und Indien. 229<br />
versichert, dass alljährlich 15 Millionen Pfund Sterling, gleich<br />
300 Millionen Mark, für Pensionen und Verwaltungskosten<br />
nach England abgeführt werden, ohne dass ein materieller<br />
Ersatz dafür zurückflösse. Das ist ein Aderlass, den auf<br />
die Dauer auch das reichste Land nicht ertragen kann. „Da<br />
hatten wir es doch noch besser," sagten meine indischen<br />
Freunde, „zur Zeit der Mohammedaner. Diese plagten und<br />
schunden uns auf alle Weise, aber sie vergeudeten auch<br />
das Erpresste wieder, und das Geld blieb im Lande. Aber<br />
die Engländer verzehren ihre Pensionen in England, und<br />
das Land wird immer ärmer." — Ich kann nicht beurteilen,<br />
wie weit diese Klagen begründet sind; ich weiss nur, dass ein<br />
Freund von mir, ein noch nicht sehr alter Mann, als Colonel aus<br />
Indien schied und jetzt, in England lebend, als Pension die<br />
Kleinigkeit von 1100 Pfund Sterling gleich 22000 Mark bezieht.<br />
Was aber den Buddhismus betrifft, der diese Abschweifung<br />
veranlasste, so kann ich <strong>•</strong> nicht umhin, dem Urteile meines<br />
Freundes Garbe beizustimmen, dass diese Religion der Liebe und<br />
Barmherzigkeit zugleich die der Trägheit und Unwissenheit ist.<br />
Dieser ungünstige Eindruck konnte auch nicht durch<br />
den Besuch verwischt werden, den ich mit Freudenberg zu<br />
sammen kurz vor meiner Abreise bei Samangala, dem Ober<br />
haupte des Buddhismus in Ceylon machte. Ich fand in ihm<br />
einen liebenswürdigen Greis von kleiner Gestalt, aber voll<br />
Würde und mit einem schönen beschaulichen Ausdrucke des<br />
Angesichts. Er sprach leidlich gut Sanskrit, und unser Zu<br />
sammensein verlief aufs beste. Aber von einem Feuer, einer<br />
Begeisterung, wie ich sie von Indien her gewohnt war, konnte<br />
keine Rede sein. Die umgebenden Mönche griffen nicht in<br />
die Unterhaltung ein, vielleicht weil sie des Sanskrit nicht<br />
hinreichend mächtig waren. Dies bestätigte sich auch, als<br />
sie mir auf einen Wink des Oberpriesters die schon auf<br />
Tischen bereitgestellten Handschriften zeigten, wobei wir uns<br />
mühsam durch ein Gemisch von Sanskrit und Pali verständigten.
230 VIII. Von Bombay nach Ceylon.<br />
So rückte der 16. März heran, an welchem die von<br />
Australien kommende Britannia uns aufnehmen und in die<br />
Heimat zurückführen sollte. Der Gedanke, von Indien zu<br />
scheiden, hatte etwas Wehmütiges, und doch kehrte ich nicht<br />
ungern zurück. Ich sehnte mich nach einer geregelten Tätig<br />
keit, auch hatte ich in diesem Winter eine Überfülle von<br />
Eindrücken eingesogen und verlangte nach Ruhe, um das<br />
alles in mir zu verarbeiten. Dazu kam, dass um die Mitte<br />
des März die Sonne über Ceylon bei seinen acht Grad nörd<br />
licher Breite fast senkrecht stand. Der eigene Schatten be<br />
schränkte sich zur Mittagszeit auf ein kleines Klümpchen<br />
unter den Füssen. Man kam sich vor wie Peter Schlemihl,<br />
der seinen Schatten verloren hatte. Ein glänzendes Diner,<br />
welches Freudenberg uns zwei Tage vor der Abreise gab,<br />
musste im Frack überstanden werden und .brachte durch furcht<br />
bares Schwitzen den Unterschied der Temperaturen hier und<br />
in Deutschland recht fühlbar zum Bewusstsein. Meinen<br />
Diener Purän bezahlte ich aus, fügte ein reichlich bemessenes<br />
Reisegeld zur Rückkehr nach Cawnpore hinzu und Hess ihn<br />
in Frieden ziehen, denn "die zahlreichen Diener des Hauses<br />
Freudenberg machten seine Hilfe entbehrlich. Eingedenk<br />
der Knappheit des Obstes auf den Seeschiffen übergab ich<br />
einem der Diener drei Rupien mit dem Auftrage, Obst da<br />
für zu kaufen. Er kam zurück mit einem grossen Korbe voll<br />
Ananas und Mangos, Bananen und Apfelsinen. Unsere Freude<br />
über diesen Schatz sollte nicht von langer Dauer sein. Ob<br />
gleich wir das Obst auf dem Schiff sogleich in den Gefrier<br />
raum bringen und nur zu den Mahlzeiten herbeiholen Hessen,<br />
so zeigten sich doch nach den ersten Tagen schon solche<br />
Spuren der Fäulnis, dass wir die Hoffnung aufgaben, das<br />
Obst auch nur bis Aden zu bringen, und uns beeilten, nach<br />
links und rechts davon auszuteilen, zur grossen Freude un<br />
serer Tischnachbarn.
Neuntes Kapitel.<br />
Die Heimreise.<br />
"\17ir hatten die ungünstige Lage unserer Kabine auf dem<br />
Himälaya noch zu lebendig in der Erinnerung, um nicht<br />
für die Rückreise bessere Vorkehrungen zu treffen. Schon von<br />
Bombay aus hatten wir auf der am 16. März von Colombo<br />
abfahrenden Britannia eine Kajüte auf der rechten Seite des<br />
oberen Decks bestellt, und die Agentur hatte diese Bestellung<br />
angenommen. Als wir aber in Colombo auf der Agentur uns<br />
einfanden, behauptete man, dort nichts von der Bestellung zu<br />
wissen, und konnte uns eine bessere Kabine nur bis Aden<br />
zur Verfügung stellen, da sie von dort ab reserviert sei. Am<br />
Donnerstag früh zeigte sich vor Ceylon der Koloss der<br />
Britannia; wir frühstückten noch ein letztes Mal zusammen,<br />
nahmen mit warmem Danke Abschied von Freudenberg und<br />
wurden auf seinen Befehl in dem Kaiserlich deutschen Boote<br />
von zwölf Blaujacken mit schwarzbraunen Gesichtern zur<br />
Britannia gerudert. Dies gab uns von vornherein schon ein<br />
Ansehen, welches auch nicht gestört wurde, indem wir dafür<br />
sorgten, dass man auf dem zurückkehrenden Boote nur zufriedene<br />
Gesichter sah. Die Anker wurden gelichtet, und
232 IX- D'e Heimreise.<br />
mit Wehmut sahen wir das herrliche Land ferner und fer<br />
ner rücken und zuletzt in der Abenddämmerung ver<br />
schwinden.<br />
Die Britannia war nicht so neu wie der Himälaya, da<br />
für aber um vieles besser eingefahren. Der Kapitän war ein<br />
pflichttreuer, wackerer Mann, der auch für seine Passagiere<br />
ein freundliches Wort übrig hatte. Die Mannschaft tat pünkt<br />
lich ihren Dienst und die Stewards waren nicht so faul, wie<br />
die auf dem Himälaya. Auch die Passagiere hatten ein an<br />
deres Gepräge als das junge, turburlente, übermütige, ver<br />
gnügungssüchtige Volk, das uns auf dem Hinwege begleitet<br />
hatte. Unsere jetzigen Mitreisenden kamen meist aus Austra<br />
lien und waren zum grösseren Teile gesetzte, ältere Leute,<br />
die ihre Geschäfte dort abgeschlossen haben mochten und<br />
in die Heimat zurückkehrten. Zwei wackere freidenkende<br />
Geistliche und ein Arzt, Dr. Jameson — nicht der berüchtigte —<br />
mit seinem reizenden Töchterchen Violet hingen enger zusammen<br />
und wir wurden bald näher mit ihnen bekannt. Vier junge Inder<br />
schlössen sich naturgemäss an uns an. Sie waren für uns<br />
der letzte Nachhall indischer Herrlichkeit. Natürlich fehlte<br />
es auch nicht an weniger sympathischen Elementen.<br />
Am Sonntag war zweimal Gottesdienst, und wir hörten<br />
gern die praktischen, zu Herzen dringenden Reden der er<br />
wähnten Geistlichen an. Da war nichts von Dogmatik; da<br />
wurden die Verhältnisse des wirklichen Lebens mit seinen<br />
Bestrebungen und Sorgen durchgesprochen,, und das alles in<br />
einer Weise, welche diskret und darum wirksam auf das<br />
Ewige, Unnennbare hinwies. „Viele Leute", sagte der Geist<br />
liche, „müssen bei allem klagen und murren. Sie wohnen<br />
in einer schlechten Gegend, in Grumbling Street; wir aber<br />
wollen sie zu uns herüberlocken, damit sie ihre Wohnung mit<br />
uns in Thanksgiving Street nehmen und alles, was ihnen zu-<br />
stösst, mit Gelassenheit, ja mit Dank gegen die Vorsehung<br />
entgegennehmen".
Die Britannia. Zweierlei Prediger. Aden. 233."<br />
Am nächsten Sonntag hielt ein Missionar die Predigt..<br />
Die befreundeten Geistlichen erklärten, dass sie nicht hin<br />
gehen würden und rieten auch mir davon ab. Dies reizte<br />
meine Neugierde, und ich ging erst recht hin. Der Text<br />
war aus dem Hohen Lied: „Du bist die Rose von Saron<br />
und die Lilie in den Tälern." Diese Rose, diese Lilie sollte<br />
dann Jesus sein, und die rote Farbe, der Duft und wer<br />
weiss was sonst noch wurde in der geschmacklosesten,<br />
Weise auf das süsse Jesulein angewendet, welches unser<br />
Redner hätschelte und liebkoste, ja aus welchem er geradezu<br />
ein Idol machte. Von moralischen Gedanken war in der<br />
ganzen Predigt keine Spur zu entdecken.<br />
Während dieser und anderer Erlebnisse hatte sich die<br />
Schraube unseres Dampfers Tag und Nacht unermüdlich/<br />
gedreht, und eine Woche nach der Abfahrt, am Donnerstag,<br />
dem 23. März, ankerten wir am südwestlichen Ende von<br />
Arabien vor Aden. Hier müssten wir die Post von Bombay<br />
an Bord nehmen, die erst gegen Abend eintreffen konnte,<br />
und so durften wir ans Land gehen und uns umsehen.<br />
Am Hafen liegen nur die zu ihm gehörenden Gebäude und<br />
ein elendes Hotel; das Städtchen Aden liegt eine Stunde.<br />
entfernt auf der anderen Seite eines hohen Bergrückens.<br />
Die Umgebung von Aden ist das Trostloseste, was man<br />
von Landschaften sehen kann. Da gibt es keinen Baum,.<br />
keinen Strauch, ja nicht einmal ein Grashälmchen ist zu<br />
finden; alles ist sonneverbrannte, ausgedörrte Wüste. Es<br />
soll hier nur alle drei Jahre einmal regnen. Dann wird das<br />
Wasser in einem System von trichterförmig nach unten.<br />
zugespitzten Cisternen aufgefangen, in deren Tiefen wir eine<br />
armselige Wasserlache bemerkten. Neben diesen Cisternen<br />
befindet sich der „Park von Aden". Es ist eine kümmer<br />
liche Anpflanzung kleiner Bäume mit verstaubten, halb<br />
welken Blättern, welche schlaff und ohne Lebenslust herab<br />
hängen. Diese mühsam unterhaltene Anlage ist das Einzige,.
234 IX- D'e Heimreise.<br />
was man an Vegetation in der Umgegend von Aden zu<br />
sehen bekommt. Wir stiegen ans Land, da wo, als Mittel<br />
punkt des Verkehrs, das schmutzige Hotel liegt. Vor dem<br />
selben gingen jüdische Geldwechsler in langem Kaftan und<br />
von den Schläfen herabhängenden Judenlocken, unaufhörlich<br />
mit dem Gelde in ihren Händen klappernd, hin und her.<br />
Ich wechselte eine Rupie, indem ich mich darauf gefasst<br />
machte, betrogen zu werden. Diese Erwartung bestätigte<br />
sich; unter dem Wechselgelde befand sich ein falsches<br />
Stück, wie, ich erst durch andere und zu spät erfuhr. Ich nahm<br />
einen elenden Wagen, um auf die Passhöhe zu fahren, von<br />
welcher es auf der anderen Seite zu den Cisternen und<br />
nach Aden heruntergeht. Der Kutscher, ein frecher Araber<br />
von entsprechendem Äusseren, erhob jeden Augenblick Ein<br />
wendungen gegen die von mir gewählte Fahrt. Am liebsten<br />
hätte ich auf den ganzen Wagen verzichtet, wenn nur ein<br />
anderer zu haben gewesen wäre. Endlich rappelte unser<br />
Wagen durch die öden Strassen von Aden und auf den mit<br />
Säulenhallen umgebenen Markt zu. Hier kaufte ich einiges<br />
Obst, aber es war wenig Geniessbares darunter. Wie in<br />
Ägypten und Palästina, so lauerten auch hier überall hungrige<br />
Arabergesichter, immer darauf bedacht, den Fremden aus<br />
zubeuten. Wir kehrten über den Bergrücken zum Hafen<br />
zurück, und ich war froh, den widerspenstigen Kutscher los<br />
zu werden. Wir sassen einen Augenblick in dem stark<br />
besuchten Hotel, aber weder die Umgebung noch die<br />
Speisen und Getränke luden zu längerem Verweilen ein.<br />
So fuhren wir schon gegen Mittag wieder auf das Schiff.<br />
Welch ein Trost ist es, in wilden, gefährlichen, verkom<br />
menen Gegenden ein mit allem Komfort ausgerüstetes Schiff<br />
als Zuflucht zu haben! Gegen Abend langte die Post von<br />
Bombay an, und es dauerte mehrere Stunden, bis alle die<br />
tausend Gepäckstücke aus dem einen Dampfer in den anderen<br />
hinüber geworfen waren.
Eine trostlose Landschaft. Suez. Abenteuer im Kanal. 235<br />
Die dreitägige Fahrt durch das rote Meer war lange<br />
nicht so heiss, wie auf dem Hinwege, da wir beständig<br />
einem kräftigen Nordwinde entgegenfuhren. In Suez wurde<br />
Proviant eingenommen, und es kamen Händler an Bord mit<br />
Photographien, Obst, Naschwerk, Schmucksachen und allerlei<br />
Kram. Die Langeweile einer Seereise bewirkt es, dass sie<br />
ein gutes Geschäft machen. Ein Knabe bot einen Korb mit<br />
Muscheln von seltsamer Bildung feil. Eine besonders.schöne<br />
Muschel lag obenauf. „Was kostet diese?" fragte ich. —<br />
„Six pence, Sir." — „Und der ganze Korb?" — „Zwei<br />
Shilling." — „Ich gebe dir einen dafür." — „Take it." —<br />
So wurde die Zahl unserer Gepäckstücke noch um eines<br />
vermehrt.<br />
Wir fuhren in den Kanal ein; es wurde Nacht, und wir<br />
legten uns schlafen. Am frühen Morgen erwache ich und<br />
bemerke mit Verwunderung, dass die Maschine still steht.<br />
Es ist vielleicht wegen des Ausweichens, dachte ich und eilte<br />
hinauf; aber welcher Anblick bot sich hier! An einer ziem<br />
lich engen Stelle des Kanals hatte sich die grosse Britannia<br />
mit dem Schnabel in die sandigen Böschungen des Ufers<br />
eingebohrt, und die Wasserströmung, welche stets im Kanal<br />
vorhanden ist, hatte das Hinterteil bis ans andere Ufer ge<br />
trieben. Vor uns und hinter uns in der Ferne hielten schon<br />
eine Anzahl von Schiffen, denen wir die Durchfahrt sperrten.<br />
Auf unserem Verdeck war alle Mannschaft in fieberhafter<br />
Tätigkeit, der Kapitän mit hochrotem Kopfe eilte hin und<br />
her und erteilte seine Befehle. Der englische Geistliche be<br />
gegnete mir und rief mit triumphierendem Patriotismus:<br />
„Britannia bars the Suez Canal!" — „Pull her off", erwiderte<br />
ich gelassen. Die Ursache des Unfalls wurde bald bekannt.<br />
Der französische Lotse, den jedes Schiff an Bord zu nehmen<br />
verpflichtet ist, hatte befohlen, langsamer zu fahren. Der<br />
Kapitän hatte eingewendet, dass das grosse Schiff dann<br />
nicht mehr dem Steuerruder gehorchen werde. Der Lotse
236 'X. Die Heimreise.<br />
hatte auf seinem Willen bestanden, und die Folge war, dass<br />
wir feststeckten. Eine solche Lage kann sehr unangenehm<br />
werden, denn wenn ein Schiff binnen vier Stunden nicht<br />
wieder flott wird, so muss es nach dem Verkehrsreglement<br />
ausladen, und was das bedeutet, das hatten wir in Aden bei<br />
Übernahme der Bombayer Post gesehen. Inzwischen waren<br />
Kapitän und Mannschaft eifrig damit beschäftigt, das Schiff<br />
wieder <strong>•</strong> flott zu machen. Starke Eisentaue wurden von der<br />
Spitze und ebenso vom Hinterteil des Schiffes cjuer über den<br />
Kanal nach denjenigen Uferseiten gezogen, von welchen das<br />
Schiff sich abgewandt hatte, und dort an Pflöcken befestigt.<br />
Diese Taue wurden von der Schiffsmaschine gleichzeitig nach<br />
der Mitte des Schiffes hin angezogen, und die Folge war,<br />
dass der Koloss sich wieder gerade legte und seine Fahrt<br />
mit einigen Stunden Verspätung fortsetzen konnte.<br />
Es war ein herrlicher Morgen. Die reine Wüstenluft<br />
Ägyptens umfing uns, und der Nordwind gewährte erquickende<br />
Kühle. Da zeigte sich in der umgebenden Wüste bald links,<br />
bald rechts eine von mir nie vorher gesehene Erscheinung,<br />
nämlich eine immer schöner sich entwickelnde Fata Morgana,<br />
worunter hier nicht das Sichtbarwerden einer entfernten Stadt<br />
durch Luftspiegelung zu verstehen ist, — denn östlich vom<br />
Kanal gibt es nah und fern keine Stadt, — sondern eine<br />
Illusion, welche entsteht, wenn im Sonnenschein die heissen<br />
Wüstendämpfe aufsteigen. Zuerst hatte man den Eindruck<br />
einer Chaussee mit lauter gleichen Akazienbäumen; dann<br />
wieder schien eine Reihe von Pelikanen unbeweglich in der<br />
Ferne zu sitzen, und endlich sah man mitten in der Wüste<br />
ein flutendes, wallendes, wogendes Wasser, und in demselben<br />
baute es sich auf in wagerechten und senkrechten Linien wie<br />
eine Stadt mit hohen Häusern und Türmen, mit mancherlei<br />
Haupt- und Querstrassen. Die Illusion war vollkommen, und<br />
auch das schärfste Opernglas vermochte nicht, sie zu heben,<br />
sondern nur noch zu verstärken. Das einzige Unnatürliche
Eine Fata Morgana. Port Said. Der Taygetos. Brindisi. 237<br />
dabei war, dass die Stadt mitten in dem wogenden Wasser<br />
gleichsam zu schweben schien. Über eine Stunde lang<br />
konnten wir diese Erscheinung in aller Ruhe beobachten.<br />
Gegen Mittag erreichten wir Port Said, und da wir<br />
einige Stunden Aufenthalt hatten, so nahm ich unsere vier<br />
indischen Schützlinge mit mir in die Stadt, um ihnen ein<br />
freilich nur ärmliches Stück Ägyptens zu zeigen. Gegen<br />
Abend stachen wir in See, und jetzt war es nicht mehr die<br />
Spiegelglätte des indischen Ozeans und des roten Meeres,<br />
die uns trug, sondern das mittelländische Meer mit seiner<br />
lebhaften und stellenweise wüsten Wellenbewegung. Die<br />
Stimmung der Passagiere war denn auch wesentlich beein<br />
trächtigt; viele verschwanden; hier und da drückte sich eine<br />
weibliche Gestalt in die Ecke eines Strandstuhls, einer<br />
welkenden Lilie vergleichbar, und zum ersten Male wies<br />
der Mittagstisch erhebliche Lücken auf. In der folgenden<br />
Nacht passierten wir Kreta, und am nächsten Morgen hatten<br />
wir die Südspitze des Peloponnes erreicht und konnten den<br />
hochragenden, schneebedeckten Taygetos zwischen Sparta<br />
und Messenien in seiner ganzen Herrlichkeit übersehen.<br />
Dann ging es den Tag über nach Norden, während ein<br />
Felseneiland der griechischen Inselwelt nach dem anderen<br />
auftauchte und in respektvoller Ferne liegen blieb. „Ich<br />
fahre sonst wohl zwischen den Inseln durch," sagte mir der<br />
Kapitän, „aber bei dem jüngsten Erdbeben könnte irgend<br />
etwas in die Höhe gekommen sein, und so ziehe ich es vor,<br />
das offene Meer zu halten." Der Abend kam, und mit ihm<br />
begann das Abschiednehmen, denn viele wollten wie wir um<br />
drei Uhr nachts in Brindisi aussteigen. An ein Schlafen<br />
gehen dachten in dieser unruhigen Nacht die wenigsten.<br />
Um ein Uhr nachts wurde noch ein kräftiges englisches Früh<br />
stück serviert, und bald nach zwei Uhr nahmen wir von dem<br />
trefflichen Schiffe Abschied und betraten, nicht wie sonst<br />
immer in Booten hinübergerudert, sondern stolz über die
238 IX. Die Heimreise.<br />
Landungsbrücke schreitend, welche die englische Gesell<br />
schaft für ihre Schiffe hier gebaut hat, den Boden Italiens.<br />
Derselbe Tag brachte uns nach Neapel, wo uns Hebe Freunde<br />
eine warme Aufnahme bereiteten. Einige Tage weilten wir<br />
hier und bei unseren Freunden in Rom und eilten dann<br />
über Mailand, Basel und Mainz der Heimat zu, wo wir um<br />
die Mitte des April wohlbehalten eintrafen.<br />
Über den folgenden Anhang vgl. Seite 204.
ON<br />
The Philosophy of the Vedänta<br />
IN ITS RELATIONS TO OCCIDENTAL<br />
METAPHYSICS.<br />
An address, delivered before the Bombay Branch of the Royal Asiatlc<br />
BY<br />
Society, Saturday, the 25th February, 1893.<br />
Dr. PAUL DEUSSEN,<br />
Professor of Philosophy at the University of Kiel, Germany.<br />
BOMBAY:<br />
PRINTED AT THE EDUCATION SOCIETY'S STEAM PRESS.<br />
1893.<br />
Price: One Ana.<br />
To be had ot JYESHTARAM MUKUNJI and Co, Booksellers,.<br />
Kalkadevi Road, Bombay.
Whose kindness<br />
TO<br />
All my Indian Friends,<br />
has made my journey through india<br />
from November 1892 till March 1893<br />
in all parts of the peninsula<br />
so delightful, instructive, and heart-<br />
elevating,<br />
i dedicate these few pages,<br />
P. D.<br />
Deussen, Erinnerungen an Indien.<br />
in recommending them<br />
TO THEIR<br />
SERIOUS CONSIDERATION<br />
16
FAREWELL TO INDIA.<br />
O, sun of India, what have we committed,<br />
That we must leave thee and thy children now,<br />
Thy giant-trees, thy flowers, so well befitted<br />
To thy blue heaven's never-frowning brow?<br />
And you, our Indian friends, whose hearty feeling<br />
Deep sympathy with you has fast obtained—<br />
From Ceylon to Peshawar and Darjeeling,<br />
Are you now lost to us, so soon as gained?<br />
Farewell! Now Space and Time, in separating<br />
Our bodies, will create a cruel wall;<br />
Until forgetful darkness over-shading,<br />
Like Himalayan fog, beöims you all.<br />
Did we but dream of your brown lovely faces,<br />
Of your dark eyes, and gently touching hands ?<br />
Was it a dream, that le'ft such tender traces,<br />
Accompanying us to foreign lands?<br />
0, yes, a dream is all that we are living,<br />
And India be a dream in this great dream;<br />
A dream, repose and recreation giving,<br />
Under a paler heaven's fainter beam.<br />
But what are Time and Space, whose rough intrusion,<br />
Will separate what is so near allied!<br />
Are they not taught to be a mere illusion ?<br />
May we not be against them fortified ?<br />
0, yes, this thought shall be our consolation,<br />
When we are severed soon by land and sea!<br />
Your sun and ours is one ! no Separation!<br />
Keep friendship, friends, let it eternal be.<br />
Colombo, Uth March, 1893.<br />
P. D.<br />
M. D.
On my journey through India I have noticed with satisfaction, that<br />
in philosophy tili now our brothers in the East have maintained a very<br />
good tradition, better perhaps, than the more active but less contemplative<br />
branches of the great Indo-Aryan family in Europe, where Empirism,<br />
Realism and their natural consequence, Materialism, grow from day<br />
to day more exuberantly, whilst metaphysics, the very centre and heart<br />
of serious philosophy, are supported only by a few ones, who have<br />
learned to brave the spirit of the age.<br />
In India the influence of this perverted and perversive spirit of our<br />
age has not yet overthrown in religion and philosophy the good traditions<br />
of the great ancient time. It is true, that most of the ancient dargana's<br />
even in India find only an historical interest; followers of the Sänkhya-<br />
System occur rarely; Nyäya is cultivated mostly as an intellectual sport<br />
and exercise, like grammar or mathematics,—but the Vedänta is, now as<br />
in the ancient time, living in the mind and heart of every thoughtful Hindoo.<br />
It is true, that even here in the sanctuary of Vedäntic metaphysics, the<br />
realistic tendencies, natural to man, have penetrated, producing the<br />
misinterpreting variations of Caiikara's Advaita, known under the names<br />
Vigishtädvaita, Dvaita, Cuddhädvaita of Rämänuja, Madhva, Vallabha,—but<br />
India tili now has not yet been seduced by their voices, and of hundred<br />
Vedäntins (I have it from a well informed man, who is himself a zealous<br />
adversary of Qafikara and follower of Rämänuja) fifteen perhaps adhere<br />
to Rämänuja, five to Madhva, five to Vallabha, and seventy-five to<br />
Qankarächärya.<br />
This fact may be for poor India in so many misfortunes a great consolation<br />
; for the eternal interests are higher than the temporary ones;<br />
and the System of the Vedänta, as founded on the Upanishads and<br />
Vedänta Sütras and accomplished by Qahkara's commentaries on them,<br />
—equal in rank to Plato and Kant—is one of the most valuable products<br />
of the genius of mankind in his researches of the eternal truth,—as I<br />
propose to show now by a Short sketch of Qahkara's Advaita and comparison<br />
of its principal doctrines with the best that occidental philosophy<br />
has produced tili now.<br />
Taking the Upanishads, as Cahkara does, for revealed truth with<br />
absolute authority, it was not an easy task to build out of their<br />
materials a consistent philosophical System, for the Upanishads are in<br />
Theology, Kosmology and Psychology füll of the hardest contradictions.<br />
So in many passages the nature of Brahman is painted out in various<br />
and luxuriant colours, and again we read, that the nature of Brahman<br />
16*
244 On the philosophy of the Vedänta.<br />
is quite unattainable to human words, to human understanding;—so we<br />
meet sometimes longer reports explaining how the world has been created<br />
by Brahman, and again we are told, that there is no world besides<br />
Brahman, and all variety of things is mere error and illusion;—so we<br />
have fanciful descriptions of the Sanisära, the way of the wandering soul<br />
up to heaven and back to earth, and again we read, that there<br />
is no Samsära, no variety of souls at all, but only one Atman, who is<br />
fully and totally residing in every being.<br />
Carikara in these difficulties created by the nature of his materials, in<br />
face of so many contradictory doctrines, which he was not allowed to<br />
decline and yet could not admit altogether,—has found a wonderful way<br />
out, which deserves the attention, perhaps the Imitation of the Christian<br />
dogmatists in their embarrassments. He constructs out of the materials<br />
of the Upanishads two Systems, one esoteric, philosophical (called<br />
by him nirgunä vidyä, sometimes päramärthikä avasthä) containing the<br />
metaphysical truth for the few ones, rare in all times and countries, who<br />
are able to understand it; and another exoteric, theological (sagunä<br />
vidyä, vyävahärikt avasthä) for the general public, who want images,<br />
not abstract truth, worship, not meditation.<br />
I shall now point out briefly the two Systems, esoteric and exoteric,<br />
in pursuing and confronting them through the four Chief parts, which<br />
Qankara's System contains, and every complete philosophical System<br />
must contain:— -<br />
I. Theology, the doctrine of God or of the philosophical principle.<br />
II. Kosmology, the doctrine of the world.<br />
III. Psychology, the doctrine of the soul.<br />
IV. Eschatology, the doctrine of the last things, the things after death.<br />
I.—Theology.<br />
The Upanishads swarm with fanciful and contradictory descriptions of<br />
the nature of Brahman. He is the all-pervading äkäca, is the purusha in<br />
the sun, the purusha in the eye; his head is the heaven, his eyes are sun<br />
and moon, his breath is the wind, his footstool the earth; he is infinitely<br />
great as the soul of the universe and infinitely small as the soul in us; he is<br />
in particular the tcvara, the personal God, distributing justly reward and<br />
punishment according to the deeds of man. All these numerous descriptions<br />
are collected by Carikara under the wide mantle of the exoteric.theology,<br />
the sagunä vidyä of Brahman, consisting of numerous "vidyäs"<br />
adapted for approaching the eternal being not by the way of knowledge
I. Theology. II. Kosmology. 245<br />
but by the way of worshipping, and having each its particular fruits.<br />
Mark, that also the conception of God as a personal being, an tgvara,<br />
is merely exoteric and does not give us a conform knowledge of the<br />
Ätman;—and indeed, when we consider what is personality, how narrow<br />
in its limitations, how closely connected to egoism, the counterpart of<br />
godly essence, who might think so low of God, to impute him personality<br />
?<br />
In the sharpest contrast to these exoteric vidyäs Stands the esoteric,<br />
nirgunä vidyä of the Ätman; and its fundamental tenet is the absolute<br />
inaccessibility of God to human thoughts and words;<br />
and again:<br />
yato väco nivartante<br />
apräpya manasä saha,<br />
avijnätam vijänatäm,<br />
vijnätam avijänatäm,<br />
and the celebrated formula occurring so offen inBrihadäranyaka-Upanishad:<br />
neu! neu! viz., whatever attempt you make to know the Ätman, whatever<br />
description you give of him, I always say: na iti, na iti, it is not so, it<br />
is not so ! Therefore the wise Bähva, when asked by the king Väshkalin,<br />
to explain the Brahman, kept silence. And when the king repeated his<br />
request again and again, the rishi broke out into the answer: "I teil it<br />
you, but you don't understand it; fänto 'yam ätmä, this Ätmä is silence ! "<br />
We know it now by the Kantian philosophy, that the answer of Bähva<br />
was correct, we know it, that the very Organisation of our intellect (which<br />
is bound once for ever to its innate forms of perception, space, time, and<br />
causality) excludes us from a knowledge of the spaceless, timeless, godly<br />
reality for ever and ever. And yet the Ätman, the only godly being is<br />
not unattainable to us, is even not far from us, for we have it fully and<br />
totally in ourselves as our own metaphysical entity; and here, when<br />
returning from the outside and apparent world to the deepest secrets of<br />
our own nature, we may come to God, not by knowledge, but by anubhava,<br />
by absorption into our own seif. There is a great difference between<br />
knowledge, in which subject and object are distinct from each other, and<br />
anubhava, where subject and object coincide in the same. He who by<br />
anubhava comes to the great intelligence, " aham brahma asmi," obtains<br />
a State called by Qankara Samrädhanam, accomplished satisfaction; and<br />
indeed, what might he desire, who feels and knows himself as the sum<br />
and totality of all existence!<br />
II.—Kosmology.<br />
Here again we meet the distinction of exoteric and esoteric doctrine,<br />
though not so clearly severed by Cankara as in other parts of his<br />
System.
246 On the philosophy of the Vedänta.<br />
The exoteric Kosmology according to the natural but erroneous realism<br />
(avidyä) in which we are born, considers this world as the reality, and<br />
can express its entire dependency of Brahman only by the mythical way<br />
of a creation of the world by Brahman. So a temporal creation of the<br />
world, even as in the Christian documents, is also taught in various and<br />
well-known passages of the Upanishads. But such a creation of the material<br />
world by an immaterial cause, performed in a certain point of time after<br />
an eternity elapsed uselessly, is not only against the demands of human<br />
reason and natural science, but also against another important doctrine<br />
of the Vedänta, who teaches and must teach (as we shall see hereafter)<br />
the "beginninglessness of the migration of souls," samsärasya anäditvam.<br />
Here the expedient of Qahkara is very clever and worthy of imitation.<br />
Instead of the temporary creation pnce for ever of the Upanishads, he<br />
teaches that the world in great. periods is created and reabsorbed by<br />
Brahman (referring to the misunderstood verse of the Rigveda: süryacandramasau<br />
dhätä yathäpürvam akalpayat); this mutual creation and<br />
reabsorption lasts from eternity, and no creation can be allowed by our<br />
System to be a first one, and that for good reasons, as we shall see just<br />
now.—If we ask: Why has God created the world ? the answers to this<br />
question are generally very unsatisfactory. For his own glorification ?<br />
How may we attribute to him so much vanity!—For his particular amusement<br />
? But he was an eternity without this play-toy!—By love of mankind?<br />
How may he love a thing before it exists, and how may it be called love,<br />
to create millions for misery and eternal pain!—The Vedänta has a better<br />
answer. The never ceasing new-creation of the world is a moral necessity<br />
connected with the central and m
II. Kosmology. 247<br />
our understanding. So the Samsära is just so far|from the truth, as the<br />
sagunä vidyä is from the nirgunä vidyä; it is the eternal truth itself,<br />
but (since we cannot conceive it otherwise) the truth in allegorical<br />
form, adapted to our human understanding. And this is the character<br />
of the whole exoteric Vedänta, whilst the esoteric doctrine tries to find<br />
out the philosophical, the absolute truth.<br />
And so we come to the esoteric Kosmology, whose simple doctrine<br />
is this, that in reality there is no manifold world, but only Brahman, and<br />
that what we consider as the world, is a mere illusion (mäyä) similar to<br />
a mrigatrishnikä, which disappears when we approach it, and not more<br />
to be feared than the rope, which we took in the darkness for a serpent.<br />
There are, as you see, many similes in the Vedänta, to illustrate the<br />
illusive character of this world, but the best of them is perhaps, when<br />
Qahkara compares our life with a long dream;—a man whilst dreaming<br />
does not doubt of the reality of the dream, but this reality disappears<br />
in the moment of awakening, to give place to a truer reality which we<br />
were not aware of whilst dreaming. The life a dream! this has been the<br />
thought of many wise men from Pindar and Sophocles to Shakspere and<br />
Calderon de la Barca, but nobody has better explained this idea, than<br />
Cankarä. And indeed, the moment when we die may be to nothing so<br />
similar as to the awakening from a long and heavy dream; it may be,<br />
that then heaven and earth are blown away like the nightly phantoms<br />
of the dream, and what then may stand before us ? or rather in us ?<br />
Brahman, the eternal reality, which was hidden to us tili then by this<br />
dream of life!—This world is mäyä, is illusion, is not the very reality,<br />
that is the deepest thought of the esoteric Vedänta, attained not by calculating<br />
tarka but by anubhava, by returning from this variegated world<br />
to the deep recess of our own Seif (Ätman). Do so, if you can, and you<br />
will get aware of a reality very different from empirical reality, a timeless,<br />
spaceless, changeless reality, and you will feel and experience that whatever<br />
is outside of this only true reality is mere appearance, is mäyä,<br />
is a dream!—This was the way the Indian thinkers went, and by a similar<br />
way, shown by Parmenides, Plato came to the same truth, when knowing<br />
and teaching that this world is a world of shadows, and that the reality<br />
is not in these shadows, but behind them. The accord here of Platonism<br />
and Vedäntism is wonderful, but both have grasped this great metaphysical<br />
truth by intuition; their tenet is true, but they are not able to<br />
prove it, and in so far they are defective. And here a great light and<br />
assistance to the Indian and the Greek thinker comes from the philosophy<br />
of Kant, who went quite another way, not the Vedäntic and Piatonic<br />
way of intuition, but the way of abstract reasoning and scientific<br />
proof. The great work of Kant is an analysis öf human mind, not in the<br />
superficial way of Locke, but getting to the very bottom of it. And in
248 On the philosophy of the Vedänta.<br />
doing so, Kant found, to the surprise of the, world and of himself, that<br />
three essential elements of this outside world, viz. space, time, and<br />
causality, are not, as we naturally believe, eternal fundamentals of an<br />
objective reality, but merely subjective innate perceptual forms of our own<br />
intellect. This has been proved by Kant and by his great disciple<br />
Schopenhauer with mathematical evidence, and I have given these proofs<br />
(the base of every scientific metaphysics) in the shortest and clearest<br />
form in my „Elemente der Metaphysik"—a book which I am resolved<br />
now to get translated into English, for the benefit not of the Europeans<br />
(who may learn German) but of my brothers in India, who will be greatly<br />
astonished to find in Germany the scientific substruction of their own<br />
philosophy, of the Advaita Vedänta! For Kant has demonstrated, that<br />
space, time and causality are not objective realities, but only subjective<br />
forms of our intellect, and the unavoidable conclusion is this, that the<br />
world, as far as it is extended in space, running on in time, ruled throughout<br />
by causality, in so far is merely a representation of my mind<br />
and nothing beyond it. You see the concordance of Indian, Greek<br />
and German metaphysics; the world is mäyä, is illusion, says Cankara;<br />
—it is a world of shadows, not of realities, says Plato;—it is "appearance<br />
only^ not the thing in itself," says Kant. Here we have the same doctrine<br />
in three different parts of the world, but the scientific proofs of it are<br />
not in Carikara, not in Plato, but only in Kant.<br />
III.—Psychology.<br />
Here we cohvert the order and begin with the esoteric Psychology,<br />
because it is closely connected with the esoteric Kosmology and its<br />
fundamental doctrine: the world is mäyä. All is illusive, with one<br />
exception, with the exception of my own Seif, of my Ätman. My Ätman<br />
cannot be illusive, as Carikara shows, anticipating the "cogito, ergo<br />
sum" of Descartes,—for he who would deny it, even in denying it, witnesses<br />
its reality. But what is the relation between my individual soul,<br />
the Jtva-Ätman, and the highest soul, the Parama-Ätman or Brahman?<br />
Here Qarikara, like a prophet, foresees the deviations of Rämänuja, Madhva<br />
and Vallabha and refutes them in showing, that the Jiva cannot be<br />
a part of Brahman (Rämänuja), because Brahman is without parts (for<br />
it is timeless and spaceless, and all parts are either successions in time<br />
or co-ordinations in Space,—as we may supply),—neither a different<br />
thing from Brahman (Madhva), for Brahman is ekam eva advitiyam,<br />
as we may experience by anubhava,—nor a metamorphose of<br />
Brahman (Vallabha), for Brahman -is unchangeable (for, as we know<br />
now.by Kant, it is out of causality). The conclusion is, that the Jiva,<br />
being neither a part nor a different thing, nor a Variation of Brahman, must<br />
be the Paramätman fully and totally himself, a conclusion made
III. Psychology. 249<br />
equally by the Vedäntin Carikara, by the Piatonic Plotinos, and by the<br />
Kantian Schopenhauer. But Carikara in his conclusions goes perhaps<br />
further than any of them. If really our soul, says he, is not a part of<br />
Brahman but Brahman himself, then all the attributes of Brahman, allpervadingness,<br />
eternity, all-mightiness (scientifically spoken: exemption<br />
of space, time, causality) are ours; aham brahma asmi, I am Brahman,<br />
and consequently I am all-pervading (spaceless), eternal (timeless), almighty<br />
(not limited in my doing by causality). But these godly qualities<br />
are hidden in me, says Carikara, as the fire is hidden in the wood, and<br />
will appear only after the final deliverance.<br />
What is the cause of this concealment of my godly nature? The<br />
Upädhi's, answers Qarikara, and with this answer we pass from the<br />
esoteric to the exoteric psychology. The Upädhi's are manas and indriya's,<br />
präna with its five branches, sükshmam gariram, — in Short, the<br />
whole psychological apparatus, which together with a factor changeable<br />
from birth to birth, with my karman, accompanies my Ätman in all his<br />
ways of migration, without infecting his godly nature, as the crystal is<br />
not infected by the colour painted over it. But wherefrom originate<br />
these Upädhi's? They form of course part of the mäyä, the great worldillusion,<br />
and like mäyä they are based in our innate avidyä or ignorance,<br />
a merely negative power and yet strong enough to keep us from our<br />
godly existence. But now, from where comes this avidyä, this primeval<br />
cause of ignorance, sin, and misery? Here all philosophers in India<br />
and Greece and everywhere have been defective, until Kant came to<br />
show us that the whole question is inadmissible. You ask for the cause<br />
of avidyä, but she has no cause; for causality goes only so far as<br />
this world of the Samsära goes, connecting each link of it with another,<br />
but never beyond Samsära and its fundamental characteristic, the avidyä.<br />
In enquiring after a cause of avidyä with mäyä, Samsära and Upädhi's,<br />
you abuse, as Kant may teach us, your innate mental organ of causality<br />
to penetrate into a region for which it is not made, and where it is no more<br />
available. The fact is, that we are here in ignorance, sin and misery, and<br />
that we know the way out of them, but the question of a cause for them<br />
is senseless.<br />
IV.—ESCHATOLOGY.<br />
And now a few words about this way out of the Samsära, and first<br />
about the exoteric theory of it. In the ancient time of the hymns<br />
there was no idea of Samsära, but only rewards in heaven and (somewhat<br />
later) punishments in a dark region (padam gabhiram), the precursor<br />
of the later hells. Then the deep theory of Samsära came up,<br />
teaching rewards and punishment in the form of a new birth on earth.<br />
The Vedänta combines both theories, and so he has a double
250 On the philosophy of the Vedänta.<br />
expiation, first in heaven and hell, and then again in a new existence<br />
on the earth. This double expiation is different (1) for performers of<br />
good works, going the pitriyäna, (2) for worshippers of the sagunam<br />
brahma, going the devayäna, (3) for wicked deeds, leading to what is<br />
obscurely hinted at in the Upanishads as the trittyam sthänam, the third<br />
place. (1) The pitriyäna leads through a succession of dark spheres to<br />
the moon, there to enjoy the fruit of the good works and, after their<br />
consumption, back to an earthly existence. (2) The devayäna leads<br />
through a set of brighter spheres to Brahman, without returning to the<br />
earth (teshäm na punar ävrittih). But this Brahman is only sagunam<br />
brahma, the object of worshipping, and its true worshippers, though<br />
entering into this sagunam brahma without returning, have to wait in it<br />
until they get moksha by obtaining samyagdarganam, the füll knowledge<br />
of the nirgunam brahma. (3) The trittyam sthänam, including the later<br />
theories of hells, teaches punishment in them, and again punishment<br />
by returning to earth in the form of lower castes, animals, and plants.<br />
All these various and fantastical ways of Samsära are considered as true,<br />
quite as true as this world is, but not more. For the whole world and<br />
the whole way of Samsära is valid and true for those only who are in<br />
the avidyä, not for those who have overcome her, as we have to show<br />
now.<br />
The esoteric Vedänta does not admit the reality of the world nor<br />
of the Samsära, for the only reality is Brahman, seized in ourselves as<br />
our own Ätman. The knowledge of this Ätman, the great intelligence:<br />
"aham brahma asmi," does not produce moksha (deliverance), but is<br />
moksha itself. Then we obtain what the Upanishads say:<br />
bhidyate hridaya-granthih,<br />
chidyante sarva-samgayäh,<br />
kshtyante cäsya karmäni,<br />
tasmin drishte parävare.<br />
"When seeing Brahma as the highest and the lowest everywhere, all<br />
knots of our heart, all sorrows are split, all doubts vanish, and our works<br />
become nothing." Certainly no man can live without doing works, and<br />
so also the Jivanmukta; but he knows it, that all these works are illusive,<br />
as this whole world is, and therefore they do not adhere to him nor<br />
produce for him a new life after death.—And what kind of works may<br />
such a man do ?—People have öften reproached the Vedänta with being<br />
defective in morals, and indeed, the Indian genius is too contemplative<br />
to speak much of works; but the fact is nevertheless, that the highest<br />
and purest morality is the immediate consequence of the Vedänta. The<br />
Gospels fix quite correctly as the highest law of morality: "love your<br />
neighbour as yourselves." But why should I do so, since by the order
IV. Eschatology. 251<br />
of nature I feel pain and pleasure only in myself, not in my neighbour?<br />
The answer is not in the Bible (this venerable book being not yet quite<br />
free of Semitic realism), but it is in the Veda, is in the great formula<br />
"tat tvam asi," which gives in three words metaphysics and morals<br />
altogether. You shall love your neighbour as yourselves,—because you<br />
are your neighbour, and mere illusion makes you believe, that your<br />
neighbour is something different from yourselves. Or in the words of<br />
the Bhagavadgitäh : he, who knows himself in everything and everything<br />
in himself, will not injure himself by himself, na hinasti ätmanä<br />
ätmänam. This is the sum and tenor of all morality, and this is the<br />
Standpoint of a man knowing himself as Brahman. He feels himself<br />
as everything,—so he will not desire anything, for he has whatever<br />
canbehad;—he feels himself as everything,—so he will not injure<br />
anything, for nobody injures himself. He lives in the world, is surrounded<br />
by its illusions but not deceived by them: like the man suffering from<br />
timira, who sees two moons but knows that there is one only, so the<br />
JTvanmukta sees the manifold world and cannot get rid of seeing it, but<br />
he knows, that there is only one being, Brahman, the Ätman, his own<br />
Seif, and he verifies it by his deeds of pure uninterested morality. And<br />
so he expects his end, like the potter expects the end of the twirling<br />
of his wheel, after the vessel is ready. And then, for him, when death<br />
comes, no more Samsära: na tasya pränä utkrämanti; brahma eva san<br />
brahma apyeti! He enters into brahman, like the streams into the ocean:<br />
yathä nadyah syandamänäh samudre<br />
astam gacchanti nämarüpe vihäya,<br />
tathä vidvän namarüpäd vimuktah<br />
parät param purusham upaiti divyam;<br />
he leaves behind him näma and rüpam, he leaves behind him individuality,<br />
but he does not leave behind him his Ätman, his Seif. It is<br />
not the falling of the drop into the infinite ocean, it is the whole ocean,<br />
becoming free from the fetters of ice, returning from his frozen State to<br />
that what he is really and has never ceased to be, to his own all-pervading,<br />
eternal, all-mighty nature.<br />
And so the Vedänta, in its unfalsified form, is the strongest support<br />
of pure morality, is the greatest consolation in the sufferings of life<br />
and death, — Indians keep to it! —
Zusätze und Verbesserungen.<br />
S. 13. Z. 22 und S. 23 Z. 21: diota haziri wird von den in Indien<br />
lebenden Engländern gewöhnlich gesagt; richtiger wäre chott häzirt.<br />
Hingegen sind pankha, ekka, paijama, für welche der Usus im Abendlande,<br />
soweit ein solcher besteht, sich dem Femininum zuneigt, im Hindostani<br />
Maskulina.<br />
S. 75. Z. 17: statt der lies den.<br />
S. 81. Z. 21: statt Osman Elias Muhammed Padischah lies Muhammed<br />
Elias Osman Padischah (der erste Name ist der eigene, der<br />
zweite der des Vaters, der dritte wohl der des Grossvaters).<br />
S. 88. Z. 5: statt Räjatarnagint lies Räjatarangini.<br />
S. 100. Z. 6: statt betreffenen lies betreffenden.<br />
S. 113. Z. 31: statt ein lies einen.<br />
S. 119. Z. 22: unt lies und.<br />
S. 130. Z. 28: Schwiegervaters lies Pflegevaters.<br />
S. 142. Z. 28: statt Ihänaküpa lies Jhänaküpa.<br />
Die Schreibung indischer Wörter wurde tunlichst an die bei uns<br />
für das Sanskrit übliche angeschlossen, während für anglisierte Ausdrücke<br />
die englische Transskription befolgt werden musste. (Daher<br />
z. B. Sanskrit neben Sanscrit College). Für die modernen Ortsnamen,<br />
deren Schreibung in Reisebüchern und auf Landkarten eine sehr schwankende<br />
ist, war Thacker's Railway Guide for the whole of India massgebend.<br />
Eine völlige Konsequenz war nicht zu erreichen.
Aberglaube 34. 63. 139. 145.<br />
Aden 15. 233.<br />
Affen 56. 62. 112. 128.<br />
Agra 75 flg.<br />
Ahmedabad 58 flg.<br />
Akbar 78.<br />
Allahabad 185 flg.<br />
Amber 66. 69.<br />
Amritsar 100 flg.<br />
Änandägrama-Institut 210 flg.<br />
Äryasamäj 86 flg.<br />
Register.<br />
(Die Zahlen verweisen auf die Seiten.)<br />
Asketen 67 flg. 135 flg. vgl. 117. 152.<br />
Ayodhyä 127 flg.<br />
Baden (religiöses) 25. 34. 61. 118.<br />
131. 152.<br />
Bankipore 146.<br />
Baroda 47 flg.<br />
Benares 130 flg.<br />
Betelkauen 28. 80.<br />
Bettler 68. 112. 116 flg. 152.<br />
Bombay 19 flg. 202 flg.<br />
Brahmasamäj 86. 154.<br />
Britannia (Schiff) 232.<br />
Brot 195 flg.<br />
Brotbaum 227.<br />
Buddha-Gayä 148 flg.<br />
Buddhatempel 166. 225.<br />
Buddhismus 61. 148. 166. 167. 225.<br />
228. 229.<br />
Buddhistenklöster 224.<br />
Calcutta 152 flg. 174 flg.<br />
Candranagaram 151.<br />
Cawnpore 120 flg.<br />
Ceylon 221 flg. 228 flg.<br />
Chapäti 80. 195.<br />
Cholera 59. 102. 122.<br />
Qiprä 197. 198. 199.<br />
Citra 54. 56.<br />
Colombo 222 flg. 229 flg.<br />
Cosmopolitan Club 202 flg. 209.<br />
Qräddham 150.<br />
Dak Bungalow 19 flg. vgl. 147. 150.<br />
195 flg.<br />
Darjeeling 164 flg.<br />
Delhi 102 flg.<br />
Dharmasamäj 86. 114 flg.<br />
Dum Dum 174.<br />
Eisenbahnen 44. 45 flg.<br />
Ekka 29 126<br />
Elefanten 49.' 50. 54 flg. 66. 69. 196.<br />
199 flg.<br />
Elephanta 34 flg.<br />
Everest, Mount s. Gaurigankar.<br />
Farewell to India 242. vgl. 204. 218.<br />
Fata Morgana 236 flg.<br />
Fatehgarh 119.<br />
Frauen 37 flg. 50. 53. 79. 108. 145.<br />
155. 207.<br />
Fyzabad 127. 129.<br />
Gangä (Ganges) 121. 131 flg. 146.<br />
187 flg.<br />
Gauricankar 168 flg.<br />
Gayä 147 flg. 149 flg.<br />
Gazetteer 217.<br />
Geldwesen 21.<br />
Ghatta's 115. 131. 202.<br />
Götterbilder 40. 207. 212.<br />
Goom 164.<br />
Gopura's 219.<br />
Haifisch 16 flg.<br />
Haushaltung 174 flg.<br />
Heilige 30 flg. 135 flg. 175 flg.<br />
Heilkunde 115.<br />
Himälaya 161 flg.<br />
Himälaya (Schiff) 7 flg.<br />
Hochzeiten 143 flg. 205 flg.<br />
Holifest 212 flg.<br />
Hotelwesen 19. 21 flg.<br />
Hughli 152. 181.<br />
Huqqa (Wasserpfeife) 93. 182 flg.<br />
Independent tribes 90. 94.<br />
Indore 193.<br />
Indus 88<br />
Jaina's 61.<br />
Jaipur 66 flg.<br />
Jamrud 91 flg.<br />
Kalideh 200.<br />
Kandy 224 flg.
254<br />
Register.<br />
Kaschmir 88.<br />
Peradeniya 225 flg.<br />
Kanchinjinga 170 flg.<br />
Peschawar 89 flg. 93 flg.<br />
Kasten 25 flg. 32. 60. 64 flg. 74. 177. Philosophie 93. 176. 213. 243 flg.<br />
195. 220.<br />
Pinjra Pol 62. 63 flg. 173.<br />
Khaibar-Pass 90. 91. 92.<br />
Pockengefahr 101 flg.<br />
Khandwa 192. 202.<br />
Pondicherry 151.<br />
Kinderheiraten 71 flg.<br />
Poona 210 flg.<br />
Kleidung 32.<br />
Port Said 10. 237.<br />
Klima 56 flg.<br />
Prayäga 185. 187 flg.<br />
. Kokila 160.<br />
Professoren 51 flg. 73 flg. 137 flgi<br />
Korscheong Bazar 164.<br />
155 flg.<br />
Krishnalegende 110 flg.<br />
Räjagrihä 149.<br />
Krokodilfütterung 69 flg.<br />
Rauchen 80 flg. 195.<br />
Lahore 82. 84 flg. 98 flg.<br />
Rawal Pindi 88. 96.<br />
Leichenverbrennung 36 flg. 131 flg. Reisediener 24 flg. 118 flg.^120. 123.<br />
Lesehalle 190.<br />
Reisekosten 21.<br />
Lucknow 123 flg.<br />
Sädhu's 64. 148 flg.<br />
Macka 50.<br />
Sänkhyasystem 158 flg. 177. vgl. 129.<br />
Madras 213 flg.<br />
243.<br />
Madura 219 flg.<br />
Sannyäsin's 135 flg. 211.<br />
Mahäräja von Baroda 47. 135. Sannyäsini's 176 flg.<br />
„ „ Benares 133 flg. vergl. Sarasvati 102.<br />
116.<br />
Schakale 48.<br />
Mahäräja von Vijayanagaram 217 flg. Schlangen 35. 62 flg. 122. 227 flg.<br />
Mahävan 110. 117.<br />
Schulen 38. 51 flg. 159. 191.<br />
Mahlzeiten 79 flg.<br />
Seelenwanderungsglaube 70. 246 flg.<br />
Malabar Hill 30. 34.<br />
Sikandra 78.<br />
Mathurä 114 flg.<br />
Siliguri 162. 173.<br />
Mhow 193.<br />
Sprachen Indiens 214 flg.<br />
Missionare 64. 172 flg.<br />
Suez 11. 235.<br />
Moghal Sarai 185.<br />
Suezkanal 11. 235 flg.<br />
Mohammedaner 83 flg. 123. 128. Täj Mahal 75 flg.<br />
155. 196.<br />
Tanjore 219. - <strong>•</strong><br />
Moschusratte 123.<br />
Tanzmädchen 144.<br />
Mückenplage 215 flg.<br />
Terai 163.<br />
Muschelblasen 117.<br />
Theater 41 flg. 49 flg. 125 flg.<br />
Musik 53. 190 flg.<br />
Theeplantage 226.<br />
Naihati 159 flg.<br />
Theosophisten 209 flg. vgl. 141 flg.<br />
Nairanjanä 149.<br />
185.<br />
Narmadä 192 flg.<br />
Toddy 147. 160.<br />
Nepal 165. 168 flg.<br />
Trichinopoly 219.<br />
Nyagrodha 181 flg. 220.<br />
Tropenkoller 14 flg. 153 flg. ,<br />
Opfer (vedisches) 40 flg.<br />
Türme des Schweigens 38 flg.<br />
Opferschnur 159.<br />
Tuticorin 220.<br />
Paijäma 13.<br />
Ujjayini 194 flg.<br />
Pandit's 2. 31 flg. 98. 99.108 flg. 113. Unterrichtswesen 51.<br />
144 flg.<br />
Vedänta 3 flg. 243 flg.<br />
Pankha 12. 215.<br />
Vrindaban 111 flg.<br />
Parsi's 37 flg.<br />
Widderkampf 193.<br />
Pätaliputra 146.<br />
Witwenverbrennung 116. 198.<br />
Pendschäb 82 flg.<br />
Yamunä 75. 187.<br />
Flüsse des P. 97 flg. 102. Yoga 77. 177.<br />
Klima des P. 97.<br />
Zeltwohnen 207 flg.
Von demselben Verfasser sind erschienen:<br />
255<br />
Commentatio de Piatonis Sophistae compositione ac doctrina.<br />
Bonn, Marcus, 1869. 1 Mk. 20 Pf.<br />
Das System des Vedänta nach den Brahma-Sütra's des Bäda-<br />
räyana und dem Commentare des Cankara über die<br />
selben als ein Compendium der Dogmatik des Brahma-<br />
nismus vom Standpunkt des Cankara aus dargestellt.<br />
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1883. 12 Mk.<br />
Die Sütra's des Vedänta oder die Cänraka-Mimärisä des<br />
Bädaräyäna nebst dem vollständigen Commentare des<br />
Qankara. Aus dem Sanskrit übersetzt. Leipzig, F. A.<br />
Brockhaus, 1887. 18 Mk.<br />
On the philosophy of the Vedänta in its relations to Occi<br />
dental Metaphysics, an address delivered before the<br />
Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, the 25th<br />
February 1893. Bombay 1893. One Ana. Leipzig,<br />
F. A. Brockhaus. 10 Pf.<br />
Zur Erinnerung an Gustav Glogau, geboren am 6. Juni 1844<br />
zu Laukischken (Ostpreussen), gestorben als Professor<br />
der Philosophie an der Universität Kiel am 22. März<br />
1895 zu Laurion (Attika). Gedächtnisrede, gehalten an<br />
der Christian-Albrechts-Universität am 11. Mai 1895.<br />
Kiel, Lipsius & Tischer, 1895. 50 Pf.<br />
Über die Notwendigkeit, beim mathematisch-naturwissenschaft<br />
lichen Doktorexamen die obligatorische Prüfung in der<br />
Philosophie beizubehalten. Kiel, Lipsius & Tischer, 1897.<br />
50 Pf.<br />
Jakob Böhme. Über sein Leben und seine Philosophie.<br />
Rede, gehalten (in kürzerer Fassung) zu Kiel am 8. Mai<br />
1897. Kiel, Lipsius & Tischer, 1897. 50 Pf.
256<br />
Sechzig Upanishads des Veda, aus dem Sanskrit überse z<br />
und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen.<br />
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1897. Geh. 20 Mk., geb-<br />
22 Mk.<br />
Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung<br />
der Religionen (2 Bände in 6 Abteilungen).<br />
Erster Band, erste Abteilung: Allgemeine Einleitung<br />
und Philosophie des Veda bis auf die Upanishad's.<br />
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1894. 7 Mk.<br />
Erster Band, zweite Abteilung: Die Philosophie der<br />
Upanishad's. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1899. 9 Mk.<br />
Erinnerungen an Friedrich Nietzsche. Mit einem Porträt und<br />
drei Briefen in Faksimile. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1901.<br />
Geh. 2 Mk. 50 Pf., geb. 3 Mk. 50 Pf.<br />
Die Elemente der Metaphysik. Als Leitfaden zum Gebrauche<br />
bei Vorlesungen sowie zum Selbststudium zusammen<br />
gestellt. Dritte, durch eine Vorbetrachtung Über das<br />
Wesen des Idealismus vermehrte Auflage. Leipzig,<br />
F. A. Brockhaus, 1902. 5 Mk. (Englisch, London,<br />
Macmillan & Co., 1894. Französisch, Paris, Perrin<br />
et Cie, 1899.)<br />
Outlines of Indian Philosophy. Bombay 1902.<br />
(Indian Antiquary).<br />
Discours de la Methode pour bien etudier l'histoire de la<br />
Philosophie et chercher la verite dans les systemes. Paris,<br />
Armand Collin, 1902.<br />
Der kategorische Imperativ. Rede. Zweite Auflage. Kiel,<br />
Lipsius & Tischer, 1903. 50 Pf.<br />
Druck von G. Reichardt, Groitzsch i. S.