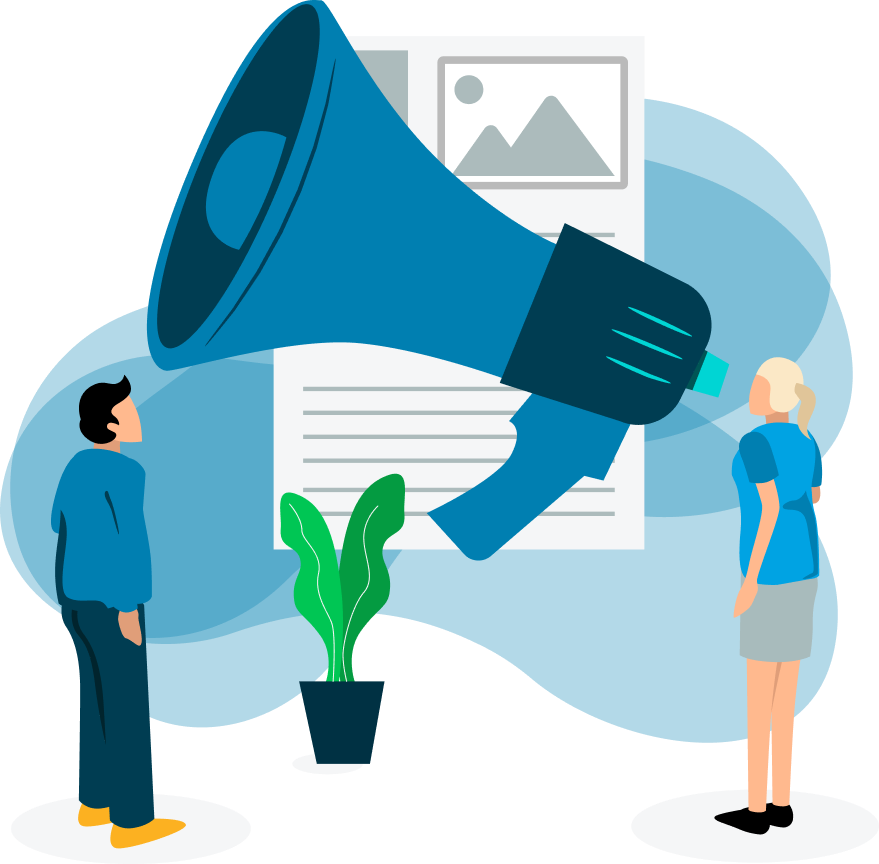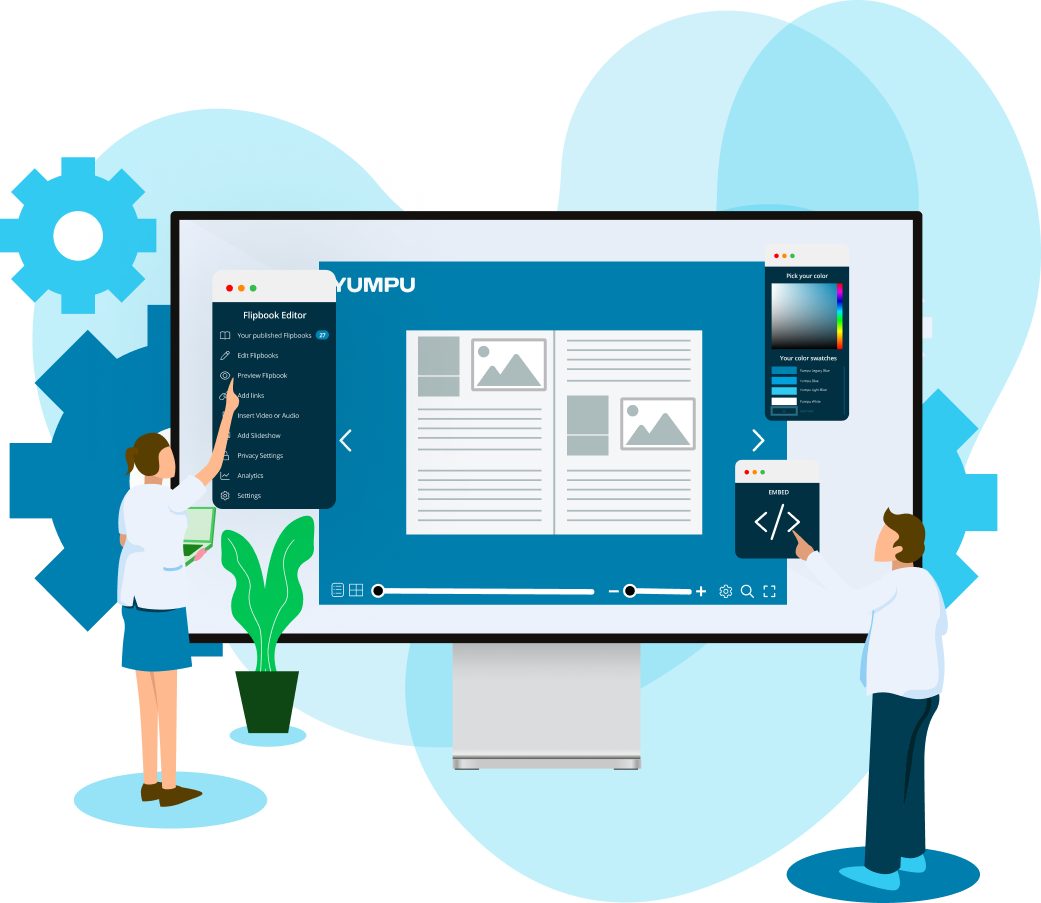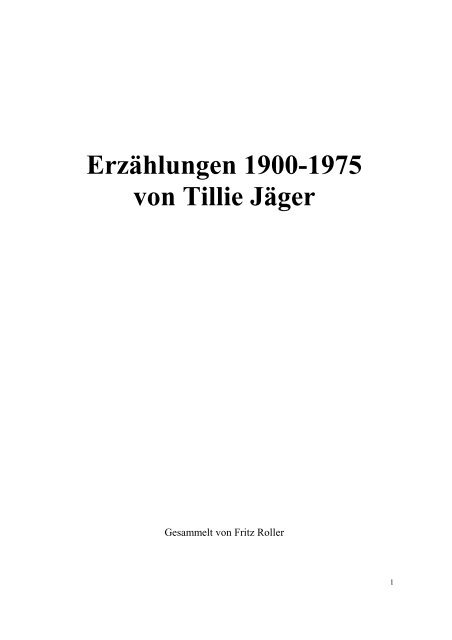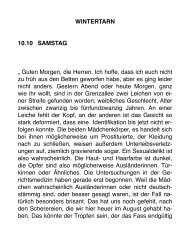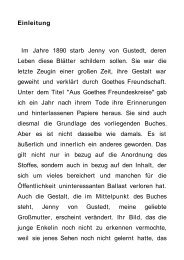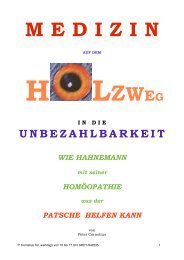Erzählungen 1900-1975 von Tillie Jäger - BookRix
Erzählungen 1900-1975 von Tillie Jäger - BookRix
Erzählungen 1900-1975 von Tillie Jäger - BookRix
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Erzählungen</strong> <strong>1900</strong>-<strong>1975</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Tillie</strong> <strong>Jäger</strong><br />
Gesammelt <strong>von</strong> Fritz Roller<br />
1
<strong>Tillie</strong> <strong>Jäger</strong> - eine Skizze ihres Lebens<br />
Ottilie <strong>Jäger</strong>, <strong>von</strong> Kind an "<strong>Tillie</strong>" genannt, kam am 2. 10. 1898<br />
zur Welt. Ihre Mutter, Pauline Ottilie geb. Böttinger, stammte<br />
aus Gechingen und war das einzige Kind ihrer Eltern, der<br />
Vater war Prokurist in Stuttgart, die Familie lebte dort. Die<br />
kleine <strong>Tillie</strong> wurde in das gehobene bürgerliche Milieu<br />
hineingeboren. Es ist schwierig geworden, sich in die Zeit um<br />
die Wende zum 20. Jahrhundert auch nur annähernd<br />
hineinzudenken. Gerade die "Höhere Tochter", die <strong>Tillie</strong> ihr<br />
Leben lang blieb, gilt heute geradezu als Witzfigur. Die<br />
Mädchen bekamen aber eine sorgfältige, wenn auch einseitige<br />
Ausbildung, die sie auf ihre zukünftige Stellung als Leiterin<br />
eines gutgeführten Haushalts vorbereiten sollte, was auch die<br />
Pflege kultivierter Geselligkeit einschloss. Daß die Frauen<br />
dazu erzogen wurden, in ihren Vätern oder Ehegatten<br />
Beschützer und Ernährer zu sehen, haben die meisten nicht<br />
als "Ausgrenzung aus dem realen Leben" empfunden, sie<br />
überließen den Männern einfach ein Gebiet, für das sie nicht<br />
zuständig waren. Es gab innerhalb der typischen<br />
Frauenbereiche genug Möglichkeiten, Fähigkeiten und<br />
Liebhabereien zu entwickeln, oft viel mehr als heute. Freilich<br />
lehnten sich auch immer wieder Frauen gegen die Tradition<br />
auf, es wird aber in allen Lebensbereichen, in denen man <strong>von</strong><br />
Geburt an festgelegt ist, Menschen geben, die ausbrechen<br />
wollen. Vor allem die Stellung lediger Frauen war eben doch<br />
oft unbefriedigend.<br />
In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg war nicht vorauszusehen,<br />
daß eine Epoche unwiderruflich zu Ende gehen würde.<br />
Schlimm war, daß die jungen Frauen und Mädchen aus<br />
"gutem Haus" in dem felsenfesten Glauben erzogen worden<br />
waren, daß Maßstäbe und Werte, aber auch die äußeren<br />
Umstände ihres Lebens unverrück-<br />
bar feststanden, und daß sie die Traditionen nur zur<br />
unbedingten Richtschnur ihres Lebens machen mußten, um<br />
Sicherheit und Lebensglück zu gewinnen. Man muß aber<br />
bedenken, daß sich diese Haltung über viele Generationen hin<br />
bewährt hatte. <strong>Tillie</strong> hat sie sich vollständig zu eigen gemacht.<br />
2
Sie erlebte Kindheit und frühe Jugendzeit in der Stadt als<br />
einziges, verwöhntes Kind ihrer Eltern. Auf alten Fotos sieht<br />
sie aus wie eine Prinzessin, die Kleider, die sie trägt, passen<br />
zu dem feinen Gesichtchen und der zierlichen Gestalt. Nicht<br />
ohne Rührung, liest man in ihren ersten Gedichten, wie<br />
glücklich sie damals war. 1912 beendete der jähe Tod ihres<br />
Vaters, der sie und ihre Mutter wie ein Schock traf, diese Zeit.<br />
Die Mutter suchte wohl instinktiv wieder den Schutz ihres<br />
Elternhauses und kehrte mit der Tochter nach Gechingen<br />
zurück. Es kann auch sein, daß sie, die Bauerntochter,<br />
wiewohl begütert, <strong>von</strong> den Verwandten ihres Mannes nie so<br />
recht akzeptiert worden war. Jedenfalls mußte <strong>Tillie</strong> die<br />
Höhere Töchterschule verlassen und noch ein paar Monate<br />
lang die Dorfschule besuchen, da sie noch schulpflichtig war.<br />
Wahrscheinlich entstand zu dieser Zeit schon der Zwiespalt<br />
der Gefühle den Bewohnern ihres Heimatdorf-<br />
es gegenüber, der in <strong>Tillie</strong> immer präsent blieb. Sie fühlte sich<br />
oft abgelehnt und mißverstanden, fand aber liebevolle<br />
Zuwendung und uneingeschränkte und völlig unkritische<br />
Bewunderung und Aner kennung daheim bei Mutter und<br />
Großeltern. Die starke Bindung an sie, das großelterliche Haus<br />
und das Dorf, das sie als "Ahnenhei-<br />
mat" bezeichnete, verfestigte sich immer mehr und blieb<br />
ebenfalls bestimmend für ihr ganzes Leben.<br />
Vielleicht wäre ihre Mutter mit ihr, wie eigentlich vorgesehen, in<br />
die Stadt zurückgekehrt, wenn der Ausbruch des ersten<br />
Weltkriegs dies nicht verhindert hätte. So blieb <strong>Tillie</strong><br />
abgeschnitten <strong>von</strong> jeder weiteren Ausbildung. Sie versuchte<br />
zwar, sich weiterzubilden durch Lesen und Klavierspielen, sie<br />
fing auch schon damit an, Gedichte und Texte zu schreiben,<br />
aber in diesem Alter hätte sie einfach noch Anleitung und<br />
Umgang mit Gleichaltrigen aus ihrem eigenen Milieu<br />
gebraucht. Die Großmutter starb 1914 und 1917 auch der<br />
Großva-<br />
ter. <strong>Tillie</strong>s ständige Klage, daß ihre Mutter und sie seither<br />
hätten ohne männlichen Beistand auskommen müssen,<br />
deutet, wie noch vieles andere, darauf hin, daß sie<br />
Veränderungen, die die Zeit mit sich brachte, nicht wahrhaben<br />
3
wollte, ja, Angst davor hatte. Die finanzielle Zukunft der Frauen<br />
schien gesichert, <strong>Tillie</strong>s Vater hatte sein Vermögen in<br />
mündelsicheren Papieren für sie angelegt. In der Inflationszeit,<br />
die <strong>Tillie</strong> später "lnflationsverbrechen" nannte, verloren sie<br />
dann ihr ganzes Geld. Während Renten und Ähnliches<br />
erhalten blieben, verschwand das dem Staat anvertraute<br />
Kapital einfach spurlos. <strong>Tillie</strong> und ihre Mutter lebten <strong>von</strong> dieser<br />
Zeit an in bescheidenen, ja dürftigen Verhältnissen. <strong>Tillie</strong><br />
wurde nach und nach verbittert und misstrauisch, was ihr<br />
Leben auf dem Dorf noch mehr erschwerte. Die Mutter trieb<br />
die kleine Landwirtschaft um, die ihr geblieben war, und<br />
vernietete ab und zu ein Zimmer. <strong>Tillie</strong> gab Klavieruntericht,<br />
manchmal konnte sie auch ein Gedicht oder einen Text in der<br />
Zeitung veröffentlichen, aber viel brachte das alles nicht ein. In<br />
den zwanziger Jahren verfaßte <strong>Tillie</strong> ihre Heimatspiele, die<br />
damals mit Erfolg aufgeführt wurden und ihren Ruf als<br />
Heimatdich- terin mit begründeten. Auch unterhielt sie eine<br />
umfangreiche Korre-<br />
spondenz, teils mit recht hochstehenden Leuten.<br />
Ihre Stärke und ihre Bedeutung für das Dorf liegen aber<br />
meines Erachtens weniger auf literarischem Gebiet, sondern<br />
beruhen auf ihren Leistungen als Chronistin. Sie sah sich,<br />
gerade weil sie sich <strong>von</strong> der Dorfgemeinschaft nach<br />
Möglichkeit isolierte, ihre Vorfahren aber verehrte, als" Hüterin<br />
der Traditionen", interessierte sich für die Geschichte des<br />
Dorfes und schrieb auf, was mündlich überlief-<br />
ert worden war und ihr bekannt wurde. Sie fühlte sich nicht in<br />
der bestehenden Gemeinschaft geborgen, sondern in der<br />
Reihe der Ahnen. Sie war stolz auf ihre Abstammung und<br />
immer bestrebt, die Verdienste ihrer Vorfahren ins richtige<br />
Licht zu rücken. Vieles aus dem einstigen Alltagsleben des<br />
Dorfes wäre für immer vergessen, wenn sie nicht über größere<br />
und kleinere typische Begebenheiten berichtet hätte. Es ist<br />
und bleibt aber traurig, daß sie ihr Leben lang weit hinter ihren<br />
Möglichkeiten zurückbleiben mußte. Das war aber damals das<br />
Los vieler begabter Frauen.<br />
Der Rest ist schnell erzählt. Sie blieb auf dem Dorf und das<br />
Leben wurde immer schwieriger für sie. Die Mutter starb 1956,<br />
4
damit fiel auch ihre geringe Rente weg. <strong>Tillie</strong> kämpfte, wie<br />
schon vorher, verbissen weiter um den Ertrag ihres in der<br />
Inflationszeit verlorenen Vermögens und wehrte sich gegen<br />
den Vorwurf, sie lebe auf Kosten der Gemeinde. Es gelang ihr<br />
dann auch, sich als eine Art Kompensation für ihr Vermögen<br />
eine winzige Rente zu sichern. Dennoch mußte sie die ihr<br />
noch verbliebenen landwirtschaftlich nutzbaren Grundstücke<br />
nach und nach verkaufen, um <strong>von</strong> dem Erlös ihren<br />
Lebensunterhalt mit zu bestreiten.<br />
Zum Schluß konnte sie jahrelang nicht aus dem Haus und<br />
wurde <strong>von</strong> Verwandten <strong>von</strong> ihrer Mutter Seite her versorgt. So<br />
durfte sie doch noch die Hilfsbereitschaft und die<br />
Unterstützung der Verwandten aus dem Dorf in reichem Maß<br />
erfahren. Nach einem Krankenhausaufenthalt kam sie in ein<br />
auswärtiges Pflegeheim. Die Nichten besuchten sie dort noch<br />
regelmäßig, bis sie nach acht Monaten am 15.11.<strong>1975</strong> starb.<br />
Sie hat sich, finde ich, Anspruch auf ehrendes Gedenken<br />
erworben, enn side war "getreu bis in den Tod".<br />
Das evangelische Töchterinstitut, dessen Anfänge ins Jahr<br />
1841 zurückgehen, befand sich <strong>von</strong> 1865 an in der Tübinger<br />
Straße und zog 1873 in das Gebäude Paulinenstraße um, das<br />
es bis 1929 benützte. Dieses alte Haus war so eng für die<br />
vielen Schülerinnen und Lehrkräfte, daß man sich mit dem<br />
Vers tröstete: "Und ist der Raum auch noch so klein - `s geht<br />
immer noch mal eine rein!"<br />
5
Das Töchterinstitut, wurde auch respektlos "Lämmerstall"<br />
genannt, nach dem Spruch über der Schulpforte: "Weide<br />
meine Lämmer."<br />
Erika Albert<br />
6
Das Heilandskissen 1929<br />
Vor dem Palast des römischen Landpflegers Pontius Pilatus zu Jerusalem staute sich eine<br />
aufgeregte Volksmenge. Hinzutretenden Pilgern, deren müder Gang eine weite<br />
Wanderschaft vermuten ließ, wurde die widersprechendsten Erklärungen zuteil. Eines aber<br />
wußte man bestimmt, ein Gefangener wurde dort festgehalten, welchen man Jesus <strong>von</strong><br />
Nazareth nannte und welcher für einen Propheten und Wundertäter galt. - In dem Hofe,<br />
welcher im Viereck <strong>von</strong> dem Gebäude eingeschlossen war, zerrten rohe Kriegerfäuste den<br />
schweigenden Gefangenen hin und her. Der Vierfürst Herodes hatte den Missetäter wieder<br />
an den Landpfleger zurückgesandt. Vielleicht mochte die Erinnerung an den Sohn der<br />
Wüste, an Täufer Johannes, in seiner Seele ein Grauen geweckt haben, nicht zum zweiten<br />
Mal eine Blutschuld auf sich zu nehmen. Jedenfalls aber stellte der rätselhafte Mann, Jesus<br />
<strong>von</strong> Nazareth, ungewollt wieder die Freundschaft zwischen den Beiden her, die sich<br />
jahrelang Feind gewesen.<br />
Ein Purpurmantel, welchen die Söldlinge irgendwo aufgestöbert hatten, wurde dem<br />
Gemarterten um die Schulter gelegt. Ein besonders Spottlustiger rannte in den Garten hinter<br />
dem Hause, wo Klaudia, die Gattin des Landpflegers ihren Safran pflanzte und wo ihr<br />
Söhnlein an warmen Tagen mit seinem Lämmlein spielte.<br />
Dort schnitt er ein paar starke Zweige <strong>von</strong> den Wildrosenbüschen, die zum Schutz gegen<br />
Eindringlinge ihr noch kahlen Zweige in den blauen Frühlingshimmel reckten. Rasch wurde<br />
aus ihnen ein Kranz gewunden und dem sanften Dulder auf die wirren, verstaubten Locken<br />
gedrückt. Die scharfen Dornen rissen alsbald blutende Wunden in die Stirne und langsam<br />
rannen die roten Tropfen über das leidgequälte Gesicht. Die Schöpfung Gottes hatte längst<br />
die Schwere der Ereignisse in sich aufgenommen, während den tobenden, lärmenden<br />
Menschen die Sinne verschlossen waren. Selbst die Dornen an der Krone empfanden die<br />
Schmerzen des Gottessohnes und zogen ihre scharfen Spitzen zurück. Da zitterten an ihnen<br />
noch ein paar weiche Flöckchen Wolle, welche die Schäflein <strong>von</strong> Klaudias Bübchen beim<br />
Streifen an der Hecke verloren hatten. Die weißen Bällchen legten sich lindernd an die<br />
Schläfe des Mannes, wo die schärfsten Dornen saßen und zogen das rinnende Blut ein.<br />
Jesus <strong>von</strong> Nazareth, der Weltheiland ging dann seinen Leidensweg, aller Menschheit zum<br />
Segen. Die Dornenkrone aber blieb auf seinem Haupt bis der Kampf vollendet war und treue<br />
Freundeshände ihn in die Felsenkammer legten bis zum Ostermorgen. Den Kranz mit den<br />
Wollflöckchen, nahmen die Frauen an sich, er soll heute noch in den Kammern des Vatikans<br />
aufbewahrt sein.<br />
In der Nacht auf den Rüsttag, ging ein Engel Gottes durch das Gelände und segnete die<br />
unvernünftige Kreatur, welche seinem göttlichen Meister so große Treue gehalten. Und er<br />
kam auch an die Rosenbüsche beim Palast des Landpflegers, deren schwanke Zweige noch<br />
zitterten vor Schmerz über all die Schmach. Und der Engel sprach: "Weil du mitgetragen<br />
hast am Schmerze des Schöpfers, sollst du ein Zeichen haben für alle Zeiten. Kahl sollst du<br />
stehen am Ostermorgen, aber die weichen Kissen der barmherzigen Liebe sollst du<br />
behalten!"<br />
Und so geschah es.<br />
Wenn wir nun an milden Frühlingstagen an Busch und Haag vorbeiwandern, darunter die<br />
ersten Veilchen blühen und in denen ein Fink schlägt, so sehen wir wohl an den Zweigen des<br />
Rosenbusches ein weiche, vergilbtes Bällchen, welches rötlich schimmert. Der Volksmund<br />
sagt, daß es die Hülle werdender Käferlein ist und daß, wenn man es nach Hause nimmt und<br />
siedet, man ein heilend Wässerlein daraus gewinnt für eitrige Wunden. Wir aber wissen es<br />
besser. Es ist ein Zeichen der Treue für die wilden Rosen, welche der Herr bei seinem<br />
Erdenwallen so liebte und welch ihm den Schmerz zu lindern suchten, als er so unsäglich<br />
litt. Das wissen wir und deshalb nennt man die seltsamen Gebilde auch "Heilandskissen."<br />
7
Der Riese Weberus 1933<br />
Ein seltsames Menschenschicksal aus alter Zeit aus Großvaters Schriftstücken.<br />
Man kann sich gut vorstellen, daß das nachstehend geschilderte Schicksal unsere<br />
Altvorderen auf Jahrmärkten als Bänkelsängerlied vorgetragen wurde und daß es nicht selten<br />
ungläubiges Kopfschütteln hervorrief, wie heute noch, über dieses Menschenlos, das auf<br />
einem vergilbten Blättchen zu lesen war.<br />
Seinen Geburtsort kennt man nicht, aber wahrscheinlich lag er im deutschen Süden, wo<br />
Anton Weberus am Neujahrstag 1701 als Sohn armer Leute zur Welt kam. Anfangs fiel an<br />
ihm nur sein unstetes, wildes Gemüt auf, bald aber schoss er gewaltig in die Höhe. Schon<br />
mit 15 Jahren hatte er die Ausmaße eines stattlichen Mannes, war fast 2 Meter groß und trug<br />
einen wallenden Bart. Mit seinen Bärenkräften hielt er es in keiner Lehre aus. Alles zerbrach<br />
unter seinen Riesenfingern. Auch seinen Lehrherren hätte es so ergehen können, wenn sie<br />
nicht den jähzornigen Lehrling schnellstens abgeschoben hätten. Seltsamerweise gelang es<br />
einem Barbier, mit dem Riesen fertig zu werden. Als ihn dann der Drang in die Ferne packte,<br />
war er einigermaßen kunstfertig im Scheren und Haarekräuseln. Das geschah im Jahre 1716.<br />
Weberus nannte außer seiner Barbierkunst nur noch zwei Silbergulden sein eigen. Nach<br />
mancherlei Wanderungen ließ er sich in Leitmeritz in Böhmen als wohlbestallter<br />
Haarkünstler nieder. Inzwischen hatten seine Kräfte noch zugenommen und mit seinen<br />
zweieinhalb Meter Länge wurde er allgemein der "Goliath Bader" genannt, was aber seinen<br />
Geschäften nicht abträglich war.<br />
Doch blieb es nicht lange dabei und Weberus mußte das Rasiermesser mit dem<br />
Kriegsschwert vertauschen. Das Schicksal warf ihm zunächst ein Paar gleichaltrige<br />
unbesonnene Gesellen in die Quere, die mit dem Riesen Streit anfingen. Nur mit Mühe<br />
konnte man die Burschen vor dem Ärgsten bewahren und Weberus in den Kerker <strong>von</strong><br />
Leitmeritz schaffen. Doch dieser hielt seinen Kräften nicht stand. Weberus ließ Messer und<br />
Barbierbecken im Stich und floh noch Niederösterreich. Hier irrte er durch die Wälder und<br />
mied die Menschen, weil er glaubte, die Häscher seien ihm auf den Fersen. Soldaten fanden<br />
ihn erschöpft an einem Waldrand, gaben ihm zu essen und zu trinken. Weberus lebte auf, der<br />
Wein stieg ihm zu Kopf und er war guter Dinge. Wieder nüchtern, merkte er, daß er<br />
Werbern in die Hände gefallen war und schon das Handgeld genommen hatte. Als ihm die<br />
Uniform angemessen war, stellte sich heraus, daß er der größte Mann der kaiserlichen<br />
Armee war. Man zeigte ihn sogar dem Prinzen Eugen <strong>von</strong> Savoyen. Mit diesem ging er nach<br />
Ungarn gegen die Türken.<br />
Weberus stand schwitzend seinen Mann, denn man hatte ihn zum Schanzgrenadier<br />
bestimmt. Als er aber die Schaufel mit dem Paukenschlegel vertauschen mußte, spielte ihm<br />
abermals sein Jähzorn einen Streich. Er warf den Schlegel seinem Tambourmajor an den<br />
Kopf, der ihn kujonierte und verwirkte dadurch den eigenen. Zwar wurde er begnadigt, doch<br />
drohte nun statt des Henkers, der Türke. Bei Temesvar nahm er wohl einen Aga gefangen,<br />
verlor aber dabei sein linkes Auge. Als Einäugiger kämpfte er bei Belgrad und Peterwardein,<br />
bekam plötzlich Heimweh und schlug sich, wie ein Wunder unbehelligt, geradewegs nach<br />
Stuttgart durch. Herzog Eberhard Ludwig <strong>von</strong> Württemberg hörte <strong>von</strong> dem seltsamen<br />
Riesen, ließ ihn an den Hof kommen und gab ihm die Stelle eines Schlossaufsehers.<br />
Weberus bekam ein gutes Gehalt, ließ sich <strong>von</strong> einem Granatschleifer ein künstliches Auge<br />
machen und hätte in Muse seine Tage verbringen können, wenn es das Schicksal nicht<br />
anders bestellt hätte. Der Herzog gab einen Maskenball. Weberus wurde als Neptun<br />
kostümiert, auf ein Postament gestellt und hatte als lebender Saalschmuck zu dienen. Doch<br />
die Damenwelt trieb mit dem stattlichen Meeresgott Unfug und der hitzige Wassermann<br />
gebrauchte seinen Dreizack, um sich der Mutwilligen zu erwehren. Die Baronin Graevenitz,<br />
8
die allmächtige Favoritin des Herzogs, stürzte dabei zu Boden. Es entstand ein Tumult und<br />
Hals über Kopf entfloh Weberus aus dem Ballsaal und dem ganzen Schwabenland. Nun<br />
begann die unruhigste Zeit seines Lebens.<br />
In Halle machte er beim Zunftumzug der Schuhmacher den “Heiligen Christopherus" und<br />
betrank sich dabei so sehr, daß er erst in einem Turmverlies des Schlosses Gebichenstein zur<br />
Besinnung kam. In geschlossenem Wagen brachte man ihn nach Berlin, denn die Agenten<br />
König Friedrich Wilhelm <strong>von</strong> Preußen hatten Weberus kurzerhand für die Garde der langen<br />
Kerls gekapert.<br />
Als Riesengrenadier wider Willen wurde er ständiger Begleiter des Königs und als solcher<br />
ein 0pfer der Friedensverhandlungen <strong>von</strong> Königsberg zwischen Schweden und Rußland.<br />
Fürst Menschikow war beim Anblick des Riesen so begeistert, daß er sich ihn vom König<br />
erbat. Weberus erhielt 6 Monate Urlaub und kam im Sommer 1722 nach Petersburg. Peter<br />
der Große teilte die Begeisterung seines Gesandten Menschikow. Weberus wurde<br />
Leibtrabant, erhielt mehrere Diener und eigenen Wagen. Das üppige Leben war sein Element<br />
und er vergaß seinen Urlaub und den König <strong>von</strong> Preußen. Doch die Herrlichkeit dauerte<br />
nicht lange.<br />
Als Zar Peter starb, erhielt Weberus seinen Abschied und zog betrübt nach Mitteleuropa<br />
zurück. Zuerst versuchte er es wieder bei seinem früheren Herrn in Stuttgart, wurde aber<br />
vom Herzog ungnädig abgewiesen. Nach kurzer Dienstzeit als Portier am Römer in<br />
Frankfurt, fasste er sich ein Herz und zog reumütig nach Berlin. Dort ging es ihm weniger<br />
glimpflich, denn der König gab ihm neuerdings Urlaub, aber diesmal in der Festung Küstrin.<br />
Weberus gefiel es dort nicht lange. Er brach aus und kam zum Zirkus Cowley, bei dem er als<br />
starker Mann und Menschenfresser viel Beifall fand. In Bremen brannte der Zirkus ab.<br />
Cowley verunglückte dabei tödlich, seine Frau wurde wahnsinnig. Weberus brachte sie nach<br />
England zurück. Er kam dadurch in Geldnöte und wurde in den Schuldturm gesteckt.<br />
Jemand, der einen starken Knecht brauchte, kaufte ihn los. Er diente seine Schuld ab und<br />
ging über den Kanal nach Holland. Dort wurde er Drillmeister bei den Kolonialtruppen, um<br />
schließlich nach Sumatra als Korporal eingeschifft zu werden. Im Mittelmeer erlitt er<br />
Schiffbruch, geriet in die Hände der Mauren, die ihn als Sklaven verkauften. Als eines Tages<br />
der Sultan Muley Abduallah an ihm vorüberritt, warf sich Weberus nicht in den Staub. Er<br />
wurde darauf als Rudersklave an eine Galeere geschmiedet. Als diese einen sardinischen<br />
Kauffahrer angriff, riss sich Weberus los und half mit, die Mauren niederzukämpfen.<br />
Seiner Ketten ledig, ging er nach Neapel und gründete dort eine Gemüsegärtnerei, in der er<br />
1741 als erster in Süditalien Kartoffeln anpflanzte. Von Neapel kam er nach Wien an den<br />
Hof der Kaiserin Marie Theresia. Dort diente er besonders dem kleinen Kronprinzen Joseph<br />
als Trabant. 10 Jahre blieb er in Österreich, machte die schlesischen Kriege mit und kämpfte<br />
unter anderem auch bei Hohenfriedberg. Nach Friedensschluss kehrte er nach Stuttgart<br />
zurück, und wurde Aufseher am herzoglichen Eselstall.<br />
Als Kaiser Joseph nach Stuttgart kam, entdeckte er das Riesenspielzeug seiner Kinderzeit<br />
und nahm ihn wieder mit nach Wien. Weberus erhielt einen Ruheposten in der Hofburg. Als<br />
jedoch Erzherzog Leopold 1783 seine Schwester, die Königin Maria Antoniette in Paris<br />
besuchte, nahm er den Greis als Begleiter mit. Dort wurde Weberus krank und mußte<br />
zurückbleiben. Nach seiner Genesung wurde er Bediensteter in Versailles, wo sich die<br />
Königin gerne <strong>von</strong> dem nunmehr 85jährigen aus seinem bewegten Leben erzählen ließ. Nun<br />
mußte aber der Hochbetagte noch alle Schrecken der französischen Revolution mitmachen.<br />
Er wurde in die Abtei Saint-German gesperrt und entkam nur durch Zufall aus dem Kerker.<br />
Alt und schwach kam er mit 96 Jahren nach Stuttgart. Der Herzog <strong>von</strong> Württemberg<br />
bewilligte ihm eine Gnadenpension <strong>von</strong> 4 Gulden im Monat, so daß der Riese, um seinen<br />
Hunger zu stillen, noch selber die Hände rühren mußte. Er war darum nicht verlegen, denn<br />
9
das Leben hatte ihn gelehrt, sich in jeder Lage zurecht zu finden. So machte sich der fast<br />
100jährige daran, hölzerne Wäscheklammern zu schnitzen und sie durch die Straßen<br />
Stuttgarts ziehend, den Hausfrauen zu verkaufen. Man kann sich denken, daß er gute<br />
Geschäfte machte. Bevor er, im Jahr 1804 im Alter <strong>von</strong> 103 Jahren endlich den Stab seiner<br />
mühseligen Wanderschaft niederlegen durfte, fand er noch Muse, den wirren Faden seines<br />
Schicksals zu ordnen und seine vielfältigen, unglaublichen Erlebnisse niederzuschreiben.<br />
Septuagesimä<br />
(Aus einer alten Familienchronik)<br />
Es sah trübe aus in deutschen Landen. Die jahrelange Feindseligkeit hatte große Armut in<br />
das Volk getragen. Was nicht vor dem Feinde geblieben war und in den Kriegshändeln<br />
verschollen, das hatte Krankheit und Seuchen dahingerafft. Die wenigen Überlebenden<br />
gingen im Stumpfsinn durch die Tage. Nur der drohende Einfall feindlicher Scharen oder<br />
überhaupt das Nahen kriegerischer Horden ließ ein wenig Mut und Lebenswillen in den vom<br />
Schicksal so sehr heimgesuchten Menschen wach werden. -<br />
So senkte sich an einem Februartag des Jahres 1637 der feurige Sonnenball über der<br />
leidmüden, blutgetränkten deutschen Erde. Dort, wo heute die Bahn Stuttgart - Calw in<br />
scharfem Bogen <strong>von</strong> der alten Reichsstadt Weil der Stadt dem Schwarzwalde zufährt, liegt<br />
und lag schon damals das Pfarrdorf Dätzingen. Wo hohe Bäume einen kleinen Teich<br />
umstehen, trat aus den Büschen ein schlankes, junges Weib. An der rechten Hand führte sie<br />
einen blonden vierjährigen Knaben, während die linke ein Bündel saftig-grünes Waldmoos<br />
trug. -<br />
"Mutter, gucket, der Himmel hanget voll rosa Kränz für die heilig Jungfrau", sagte der<br />
Kleine mit kindlich hoher Stimme, "Ihr brauchet keine Mooskränz mehr zu machen."<br />
"Weisch Josefle, "die Stimme der jungen Frau klang wie eine helle Glocke, "die Kränz<br />
kommet auf am Atte sei Grab und auf der Annamamme ihres." "Worum machet ihr denn die<br />
Kränz ?", forschte der Kleine weiter. "Weil ihr jetzt fortgangat, über den Berg nüber?" "Eba<br />
deshalb", bestätigte seine Begleiterin und ein Abglanz des Abendgoldes schien über ihre<br />
blassen Züge zu huschen. "Jo, ond wenn no dia Kaiserliche kommet ond die Schweda, hänt<br />
ihr jo so weit uff Weil der Stadt" meinte der arme, kleine Bub, der in seinem Leben noch<br />
nichts anderes gesehen hatte als Not und Tod und Tränen. "Weisch, Josefle, i hau jetzt an<br />
guata Mann, dein Brackenhammer-Vetter, der hütet mi au wohl, daß mir kei Mensch ebbas<br />
duat." "Aber i mag ehn net", ruft der Kleine heftig, "wenn er mir au Weißbrot brengt on<br />
Wurscht. Überhaupt, Ihr solltet bei ons bleiba ond net uff des langweilig Gechinga gau, des<br />
sait aus's Madele. Do glaubet se jo nemme an de heilig Jongfrau".<br />
Das junge Weib war ob den kindlichen Worten blass geworden. Bargen sie doch die tiefe<br />
Wahrheit, die Elisabeth Leyer in stillen Stunden, ungeachtet der großen Liebe zu ihrem<br />
Verlobten, selbst mit leisem Bangen sich vorhielt. Aber das kaum 20jährige Menschenkind,<br />
dem der böse Krieg schon so unsäglich viel geraubt hatte, sehnte sich nach einem Stück<br />
Erdenglück mit der ganzen Kraft eines tief empfindenden Frauenherzens.<br />
Wie war es doch gewesen, als teuflische Kroaten die einzige, geliebte Schwester zu Tode<br />
gemartert hatten. Wie war sie selbst, noch ein halbes Kind, den wimmernden Säugling im<br />
Arm, den schätzenden Mauern der bewehrten Stadt zugeflüchtet. Was war näher gelegen, als<br />
daß der verwitwete Schwager, den das Kriegsgesetz immer wieder zu Fuhrdiensten forderte,<br />
seines Kindes Wohl in ihre Hände legte und sie, sobald es anging, an der Schwester Stelle<br />
trat. Aber schon nach einem halben Jahr hatte man ihr den toten Gatten ins Haus gebracht.<br />
Nicht weit vom Dorfe hatte ein scheuendes Pferd den Fuhrmann an der Schläfe getroffen,<br />
daß sie eingedrückt wurde und der Tod auf der Stelle eintrat. Neunzehn Jahre war Elisabeth<br />
10
alt gewesen, als sie Witwe wurde. Nun hatte sie niemand mehr auf der ganzen Welt als die<br />
greisen Schwiegereltern und das kleine Waisenkind.<br />
Das junge Herz krampfte sich oft zusammen unter dem Leid der Tage und dem Drucke der<br />
Zukunft. Wohl gab es Monate, wo tiefer Friede übet der Gegend lag, aber der Schreck<br />
vergangener Zeiten steckte jedem in den Gliedern. So war es wieder Herbst geworden und<br />
die ersten Fröste fielen, gerade wie damals, als man den toten Mann, der ihr zuerst Schwager<br />
und dann Gatte gewesen war, ins Haus brachte. Dreimal war des Jahres Kreislauf an der<br />
jungen Witwe vorübergegangen, doch Elisabeth Leyer tat ihre Pflicht und fühlte sonst nichts.<br />
Da sollte ihr aber einmal, ein einziges Mal, ein kurzer karger Liebesfrühling beschieden sein.<br />
An den Toren des alten Weils war es gewesen, am Herbstmarkt, der besonders bunt war,<br />
weil keine feindlichen Scharen in der Nähe waren. Da hatte das kleine Kälbchen, welches sie<br />
mit dem Schwiegervater zum Markte brachte, gar wilde Sprünge gemacht und Elisabeth fast<br />
zu Boden geworfen. Eine kräftige Männerfaust hatte den Wildling gebändigt und eine<br />
fröhliche Stimme hatte gerufen, "He, Jungferle, mit dem werdet Ihr net Meister, den laßt nur<br />
mich vollends zu Markte führen." So hatte Elisabeth ihren zweiten Gatten kennengelernt.<br />
Dem armen, scheuen Wesen schienen die sonnigen Augen und der ganze Frohsinn des<br />
Liebsten wie ein Himmelsgeschenk. Hatte doch der Himmel dem Jakob Brackenhammer<br />
einen unerschütterlichen Mut und eine große Tatkraft geschenkt. Und mit diesem überwand<br />
er auch die Besorgnisse der alten Eltern. Nicht, daß diese ihrer Schwiegertochter nicht <strong>von</strong><br />
Herzen ein bescheidenes Glück in karger Zeit gegönnt hätten. Aber die Bedenken, die sogar<br />
Klein-Josef <strong>von</strong> der Base Magdalene gehört hatten, erschütterten die beiden Alten doch.<br />
Elisabeth Leyer war katholisch; ihr Verlobter dagegen auf Luthers Lehre getauft.-<br />
"Ist's net genug, daß all deutsches Land in zwei Lager gespaltet ist, soll ich auch noch mein<br />
Herz in zwei Stücke teilen, daß es verblutet und der Lisbeth ihres nähm ich am Ende ganz<br />
mit", hatte er damals gesagt. "Steht nicht in meiner Bibel: Dein Gott ist mein Gott und dein<br />
Volk ist mein Volk. Also legt ruhig Euer Geschick in meine und des Herrgotts Hand. Es soll<br />
Euch net gereuen." Wie treu und fest seine Stimme geklungen hatte, wie ehrlich seine Augen<br />
waren, das vergegenwärtigte sich die junge Frau, als sie, das Knäblein an der Hand, den<br />
wenigen ganzen Häusern des Dorfes zuschritt, um in der niedrigen Stube, welche seither ihre<br />
Heimat gewesen, die Kränze für der Geschwister Grab zu winden. Denn seit sie selbst die<br />
Liebe empfunden, schien Elisabeth Leyer der tote Gatte wie der Bruder, der er ihr zu<br />
Lebzeiten der Schwester gewesen war. -<br />
Am Spätnachmittag des anderen Tages wanderte sie mit ihrem zukünftigen Gatten über<br />
Hügel und durch die Heide der neuen Heimat zu. Tags zuvor hatte der Bote die wenigen<br />
Habseligkeiten der jungen Frau auf seinen Wagen geladen, als er <strong>von</strong> Weil der Stadt über<br />
Ostelsheim wieder heimwärts fuhr. Der Abschied war sehr schwer gewesen. Namentlich<br />
Josefle, welcher bis zuletzt gehofft hatte, daß die Mutter denn doch dableibe, hatte<br />
mörderisch geschrien. Nur der Trost des Gechinger Vetters, daß er den Osterhasen bei ihm<br />
suchen dürfe, hatte ihn getröstet und er war mit seinem Madele abgezogen, um vom<br />
jenseitigen Hügel noch lange nachwinken zu können. Nun war auch das letzte Zipfele der<br />
wehenden Tücher verschwunden. Elisabeth wischte sich verstohlen die Augen, machte am<br />
letzten Kreuz, das schon an der Markungsgrenze stand, ein frommes Zeichen. Dann schritt<br />
sie getrost an des Liebsten Hand in die neue Heimat und in eine andere, fremde Welt.<br />
Am Sonntag Septuagesimä 1637 schrieb der alte Pfarrer <strong>von</strong> St. Martin zu Gechingen in das<br />
Ehebuch seiner Gemeinde: "Jakob Brackenhammer und Elisabeth Leyer, Witwe <strong>von</strong><br />
Dätzingen."<br />
Und so war sie aufgenommen in die Gemeinschaft des Dorfes und seiner Gemeinde. Ob sie<br />
ihrem alten Glauben treu blieb, ob ihr Luther's Lehre mehr war, danach forschte niemand.<br />
Sie tat treu ihre Pflicht und stand ihrem Haus als gute Hausmutter vor. Wie sie den Eltern in<br />
11
Dätzingen ein treues Schwiegerkind gewesen war, so war sie es auch über dem Berge, im<br />
Tal der raschen, hellen Irm.<br />
So heiter ihr Jakob trotz der schweren Zeit, so still und ernst blieb sie selbst. Nicht, daß etwa<br />
das Glück die lieben Züge verschönte, aber in den lieben Blauaugen lag oft ein dunkler<br />
Schein. Der Pfarrer, der manchmal auf dem Weg durch das Dorf mit ihr plauderte, fragte sie<br />
einmal, ob sie sehr an Heimweh leide. "0 nein, Hochwürden," sagte sie freundlich, "ich bin<br />
ja nach eigenem Willen und mit dem Segen der Eltern gegangen, es ist etwas anderes." "Was<br />
denn" sagte der alte Herr, dem die junge Frau leid tat. "Septuagesimä", entgegnete sie, "nur<br />
70 Tage, bis der Herr aufersteht. Ich habe nicht lange Zeit. " Verwundert schüttelte der Greis<br />
das weiße Haupt. Seine Befürchtung, daß die junge Frau mit ihrer feinen Seele sich fremd<br />
fühlte, schien wahr zu sein. Mit doppelter Liebe suchte er in den wenigen Feierstunden, die<br />
sie hatte, ihr Trost und Erbauung zu gewähren. Aber es schien, daß das Wesen Elisabeths<br />
immer lichter und ferner wirken würde.<br />
Der Josefle kam auf geraume Zeit. Es brachte viel Lärm und Lachen mit und hatte sich bald<br />
mit ganz Gechingen angefreundet. Als es wieder Herbst wurde und die ersten Fröste fielen,<br />
bekamen Elisabeth's Wangen Farbe. Doch die greise Schwiegermutter schüttelte den Kopf<br />
und sagte "Kirchhofsprossen". Aber sie sagte es nur leise, daß es ihr Sohn nicht hörte. Als<br />
man das Josefle heimbrachte, es war gerade zum Herbstmarkt in Weil, da schickte sie der<br />
alten Leyerin eine Botschaft, die Elisabeth gefalle ihr nicht. -<br />
Der Jakob aber war immer wohlgemut. Sein Weib klagte nicht und hatte rote Backen.<br />
Insgeheim hoffte er auf einen springlebendigen Erben, so wie der Josefle war. Den wollte er<br />
Jörg nennen, nach seinem Oheim, dessen er sich noch dunkel erinnerte. Martini war vorbei<br />
und die ersten Flocken fielen nieder. Die Dorfjugend probierte Schneeballen und ihr heller<br />
Jubel tönte in die Stube, wo Elisabeth die Spindel tanzen ließ. Ein halbes Jahr schon war sie<br />
hier und sie, die sich so sehr nach einem Krümlein Erdenglück gesehnt hatte, spürte eine<br />
neue Sehnsucht, die sie hinaushob über die irdische Heimat, nach ewigen Zielen. Sie wußte<br />
nicht, warum ihr gerade der Abend einfiel, an welchem sie mit Josefle vom Moos holen nach<br />
Hause wanderte und warum ihrem wachgewordenen Geist plötzlich Bilder vergangenen<br />
Tage auftauchten. Alles schien in goldene Glut getaucht. Draußen hatte das Flockengestöber<br />
aufgehört. In lichtem Schein strahlte der Abendhimmel in die niedrige Stube. "Die<br />
Rosenkränze" flüsterten die blassen Lippen. Als Jakob einige Zeit nach ihr die Stube betrat,<br />
war Elisbeth ohnmächtig vom Stuhl gesunken. Er rief die Mutter, und mit deren Hilfe<br />
brachte er sie noch aufs Lager. Dann holte er den Pfarrherrn, dessen geübtes Auge sofort den<br />
nahenden Tod erkannte.<br />
Elisabeth war nicht bei Bewusstsein und trotzdem flüsterten die blassen Lippen immer und<br />
immer wieder ein Wort "Septuagesimä". Erschüttert hörte es der Geistliche, dann trat er an<br />
das Fußende des Bettes, wo Jakob in fassungslosem Jammer saß. "Ihr müßt mit dem Ende<br />
rechnen, Jakob", sagte er leise. "Warum ist Gott so umbarmherzig?" rief hadernd der Mann.<br />
"Gott ist barmherziger, als ihr denkt" entgegnete der Pfarrer," er holt eine zarte Blume in<br />
seinen himmlischen Garten." Als ob die Sterbende es hörte, öffnete sie die Augen und suchte<br />
mit unendlicher Liebe den Gatten. "Jakob", flüsterte sie, "ich dank dir, o wie sehr. Vergiß<br />
nicht, Ostern ist nahe. Der Herr ist da." Dann schloss sie die Augen und das Herz stand still.<br />
Jakob sank in die Knie und verbarg seinen Kopf in den Kissen. Er wollte mit seinem<br />
Schmerz allein sein. Der geistliche Herr gab den übrigen Anwesenden ein Zeichen und<br />
verließ geräuschlos die Stube.<br />
Am Abend, als schon die Sterne am Himmel standen und die Kerze in seiner Stube brannte,<br />
holte der Pfarrer sein Ehebuch, ach es war ja nicht groß, und schlug die Seite auf, wo er den<br />
Namen der jungen Toten wußte. Da er zu den Menschen gehörte, die in den Seelen der<br />
anderen lesen können, so trat ihm noch einmal ihr Bild vor die Augen. Über die Hügel<br />
12
hinweg und in fremden Glauben hinein hatte der Herr sein gläubiges Kind geschickt. Es<br />
hatte ihn auch gefunden, nicht im Grabe, sondern über den Sternen. Der Geistliche fuhr sich<br />
über die Augen. Dann holte er den Federkiel und setzte unter das Wort "Septuagesimä" das<br />
Bibelwort: "Was suchet Ihr den Lebendigen unter den Toten, siehe, er ist nicht hier. Er ist<br />
auferstanden."<br />
Es deuchte ihm aber, daß selige Sabattruhe über der friedlosen Welt Einkehr halte.<br />
(Anmerkung <strong>von</strong> F. Roller: Die Eheschließung ist nicht feststellbar. Wahrscheinlich hat<br />
<strong>Tillie</strong> ihren Vorfahren Jakob Brackenhammer und seine Frau Maria Agnes Hecker damit<br />
gemeint, die mit 26 Jahren 1748 gestorben ist.)<br />
Ernst Brackenhammer 1932<br />
"Tief ist die Mühle und Berg verschneit, still stehen die Räder und still die Zeit!"<br />
So mochte es manchem Dorfgenossen durch den Sinn gehen, der den schmalen Wiesenpfad<br />
hinabschritt zur Mühle, um noch ein letztes Mal den toten Mühlenbesitzer zu sehen, den<br />
man heute aus seinem stattlichen Anwesen hinaustragen wird zum Gottesacker.<br />
Im Alter <strong>von</strong> nahezu 59 Jahren ist in der Gechinger Mühle Mühlenbesitzer Ernst<br />
Brackenhammer gestorben. Er übernahm als jüngster Sohn des Hauses die väterliche Mühle,<br />
nachdem sein älterer Bruder diejenige seines Schwiegervaters in Deufringen übernommen<br />
hatte. Seine Zugehörigkeit zu einem alten Geschlecht, die Freude am angestammten<br />
Gewerbe und der geliebten Heimat haben dem wortkargen, aber wohlwollenden<br />
Entschlafenen einen großen Idealismus erhalten.<br />
Mit Treue und Hingabe hat er seiner Mühle alle technischen Neuerungen zukommen lassen,<br />
um nun viel zu früh sein Werk in die Hände seiner beiden Söhne zu legen.<br />
Die Vorfahren des Verstorbenen sitzen schon seit 190 Jahren auf der Mühle. Damals<br />
verheiratete sich der Gechinger Schultheiß Johann Jakob Brackenhammer mit der einzigen<br />
Tochter des damaligen Müllers Aaron Hecker. Das Schicksal des alten Geschlechtes war<br />
jedoch bereits früher mit dem Geschick des Dorfes Gechingen aufs innigste verknüpft. Bis<br />
zurück zum Jahr 1575 läßt sich die Ahnenreihe verfolgen und immer wieder legte man des<br />
Dorfes Wohl in die Hände eines Brackenhammer. So war ein Vorfahre des Verstorbenen<br />
erster Schultheiß nach dem Dreißigjährigen Kriege, obwohl dieser ihm im Pestjahr 1643<br />
neun Glieder seiner Familie raubte. Sein eigenes Söhnlein erhielt die Taufe kurz vor<br />
Friedensschluss im Jahr 1648 auf der Flucht <strong>von</strong> Gechingen nach Calw. Aber auch dieses<br />
Kind ist später in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hat als Schöffe seinen Mann<br />
gestellt. Der bedeutendste aus den Reihen der Vorfahren ist wohl der einzige Bruder des<br />
Großvaters des Verstorbenen, Generalsuperintendent Karl Friedrich <strong>von</strong> Brackenhammer,<br />
weiland Prälat der Diözese Heilbronn. Dieser bedeutende Prediger hat seiner idyllischen<br />
Schwarzwaldheimat und auch dem nunmehr Entschlafenen als seinem Großneffen stets<br />
Liebe und Anhänglichkeit bewahrt. Das fleißige Mühlrad steht nun ein paar Tage still und<br />
die große Ewigkeit hat das Wort.<br />
13
Von den Schwarzwälder Siedler in der Mark 1934<br />
"Mutter und Kind", so heißt das große, neue Liebeswerk der Regierung. Jedes denkt bei<br />
diesem Wort zuerst an seine Mutter und an seine eigene Kindheit, absonderlich dann, wenn<br />
sie sonnig und liebeerfüllt war und noch zurück reicht in die Zeit vor dem großen<br />
Weltenbrand.<br />
"Mutter und Kind", wie innig mag das besonders dort sein, wo die beiden hineingestellt sind<br />
in eine neue Heimat, losgelöst <strong>von</strong> der altvertrauten Umgebung, wie es zum Beispiel bei den<br />
Siedlern im Osten, in Mecklenburg und in der Mark ist.<br />
Wenn der Reichsbauernführer einmal sagte, daß nur der Bauer siedeln kann, der eine<br />
geeignete Frau hat, so trifft er den Nagel auf den Kopf. Muß doch die Siedlerfrau neben ihrer<br />
vielen Arbeit in Hof und Feld und Flur auch noch die höchste Würde germanischen<br />
Frauentums bewahren: die Hüterin des Feuers zu sein. Nicht nur am stillen Herd zur<br />
Winterszeit, nicht nur um Speise und Trank zu bereiten, sondern noch viel mehr, die Wärme<br />
und Güte eines verstehenden Herzens zu haben.<br />
So ist es denn kein Wunder, daß neulich in einem Brief <strong>von</strong> unseren märkischen Siedlern ein<br />
Zweiglein Rotdorn zu finden war, das eine junge Mutter <strong>von</strong> der Blumenfülle ihres<br />
Ehrentages in einen Heimatbrief legte. "In dem Park des Herrenhauses blüht Rotdorn und<br />
Flieder" schreibt sie dazu, "und die Kinder haben mir mächtige Sträuße gepflückt. Zuerst<br />
bekam ich <strong>von</strong> den beiden Großen je einen Brief, voll Kindesliebe, und dann kamen alle vier<br />
mit ihren Blüten, Rotdorn und Flieder! Ich habe mich riesig gefreut!"<br />
Sie wissen dort, was sie an der Mutter haben, die kleinen, Uckermärker Schwaben, die ihnen<br />
die fremde Gegend zum traulichen Dasein macht. Und wenn auch manchmal noch in einem<br />
Herzen verborgen die Sehnsucht aufsteigt nach dem Waldesrauschen und den<br />
Wildrosenbüschen im schwäbischen Heckengäu, schön ist die neue Heimat mit ihren blauen<br />
Weiten, ihren blitzenden Flussläufen und dem ganzen Zauber einer neufriederizianischen<br />
Landschaft. Ja, und dazu haben sie eine Mutter, die Herd und Herz warm hält für ihr Kleinen<br />
und tapfer den Weg geht als schwäbische Siedlerfrau, altmärkische Erbhofbäuerin und echte<br />
deutsche Frau.<br />
Drei schwäbische Bauerndichter 1935<br />
Daß das Schwabenland viele große und kleine Dichter hervorbrachte, ist bekannt. Viele der<br />
"kleinen" sind aber selten über den engen Kreis ihres Heimatbezirkes hinaus bekannt<br />
geworden. Auch das nahe Gechingen hat drei solcher Musensöhne besessen, die aus dem<br />
Kreislauf des Jahres und aus ihrer täglichen Beschäftigung mit der Mutter Erde die Kraft zu<br />
Liedern und Reimen fanden. Der erste <strong>von</strong> ihnen war der im Jahre 1831 geborene, 1896<br />
gestorbene Jakob Adam Gehring. Neben einer großen Schlagfertigkeit besaß der<br />
"Maieradam", wie er nach dem Geschlechtsnamen seiner Frau genannt wurde, auch einen<br />
goldenen Humor, der in seinen Balladen zum Ausdruck kam. Seine beiden Söhne Christian<br />
und Bernhard, <strong>von</strong> denen der erstgenannte als Professor in Stuttgart wirkte, haben das Erbgut<br />
des Vaters treulich verwaltet. Ganz anders geartet war der im Jahre 1843 geborene und 1817<br />
gestorbene Heinrich Schwarzmaier, der in seinem freundlichen Hause am Bergeshang mit<br />
Frau und sieben Kindern das bescheiden-ehrbare Leben eines schwäbischen Kleinbauern<br />
führte. Körperlich etwas schwach, fand er aber bis ins hohe Alter immer wieder die Kraft zu<br />
ernsten, ihn selbst befreienden Liedern.<br />
Sein "Schwanengesang", der ein halbes Jahr vor seinem Tode einem Jugendgefährten und<br />
Vetter galt, brachte noch einmal die innige Heimatliebe und das Wissen um die ewigen<br />
Gesetze des Lebens rührend zum Ausdruck. Der jüngste des Dichterkleeblattes war der<br />
Landwirt und Gemeinderat Johannes Böttinger, geboren 1874, gestorben 1922. Schlicht und<br />
14
klar, wie sein ganzes Wesen waren auch die Lieder des Mannes, der viel zu frühe seiner<br />
Gattin und sechs Kindern entrissen wurde. Hoffen wir, daß aus dem Umbruch der Zeit, aus<br />
dem Geschlecht der jungen Bauern, wieder Menschen erstehen, die den Rhythmus der Natur<br />
und Schönheit in Reime und Lieder fassen können.<br />
Zur großen Armee eingegangen 1936<br />
Im Alter <strong>von</strong> 88 Jahren ist am Sonntag der Dorfälteste der Gemeinde Gechingen, der<br />
schwerkriegsbeschädigte Altveteran Heinrich Böttinger verstorben. Am 30. Januar 1848<br />
erblickte er das Licht der Welt, und in seine ersten Lebenstage herein fiel der<br />
"Franzosensamstag" an welchem sein Vater als Bürgerwehrkommandant mit seinen Leuten<br />
den "Calwer Weg" hinauszog, da Alarmnachrichten das Nahen badischer "Freischärler"<br />
ankündeten. Der Heimgegangene, wie sein älterer Bruder wurden vom Vater in soldatischem<br />
Sinne erzogen.<br />
So ist der Greis, der in der Schlacht bei Champigny den rechten Unterschenkel einbüßte, bis<br />
ins höchste Alter Soldat geblieben. Noch vor wenigen Wochen erzählte er immer wieder<br />
seinen Angehörigen <strong>von</strong> jenem für ihn so bedeutsamen 3. Dezember, als der Kommandeur<br />
des 7. württenbergischen Infanterieregimentes 125 und der beiden <strong>Jäger</strong>bataillone 2 und 3,<br />
zu seinen Soldaten die geschichtlichen Worte sprach: "Soldaten, ihr habt die schöne, aber<br />
schwere Aufgabe, Champigny zu stürmen!" Immer leuchteten dann die Augen des Greises in<br />
soldatischem Feuer, und nie hörte man <strong>von</strong> seinen Lippen eine Klage, daß er am gleichen<br />
Tage seinen Fuß verloren.<br />
Es ist ein schlichtes Leben, das mit dem Heimgang des Dorfältesten erlosch, doch es trägt<br />
heldischen Einschlag. Heinrich Böttinger ist der letzte Enkel des in vielen Familien<br />
weiterblühenden Stammes Bernhard Böttinger. Er hinterlässt drei Töchter, einen Sohn, 10<br />
Enkel und 6 Urenkel!<br />
Gechinger Brief Mai 1934<br />
Wie sie ihr Lustgeschmetter durch den sonnigen Frühlingstag ertönen lassen, die kleinen,<br />
gefiederten Sänger! Wohl haben sie ein ordentliches Loch in den goldgelben Hafervorrat<br />
gefressen und noch mehr in die spärliche Mohnernte des trockenen Sommers 1933. Dafür<br />
aber tönt einem jetzt eine wahre Jubelkantate entgegen, wenn man sich unter dem<br />
Blütenblust der Pflaumenbäume zeigt. Ja, neulich ist sogar ein Blaumeislein durchs offene<br />
Fenster geflogen und hat dem gelben Kanari einen Besuch abgestattet. Vielleicht wollte es<br />
ihn zur "Vogelhoch- zeit" oder gar zur Lenzmusik einladen, daß es viel hundertstimmig<br />
durchs grünende Tal erschallt: "Der Lenz ist da!" Aber nicht nur für die Vogelwelt ist`s hohe<br />
Zeit, auch durchs Dorf erschallen wieder im Dreiklang die Hochzeitsglocken, die so lange<br />
schwiegen, weil keines der jungen Paare den Mut zum gemeinsamen Wandern fand. Die alte<br />
Sitte des "Maien", des Polterabends, wo Haushaltsgegenstände am Vorabend der Hochzeit<br />
ins Heim der jungen Paare gebracht wurden, hat die Notzeit abgeschafft. Da es Sitte ist, daß<br />
die "Gesellen", die Brautführer und die "Gespielinnen", die Brautjungfern, zu allen<br />
Jahreszeiten einen Strauß künstlicher Blumen an Brust oder Haar tragen, hatte die Führerin<br />
des hiesigen BDM ein Schaufenster recht sinnig mit prächtigen Erzeugnissen ihrer<br />
Bindekunst geschmückt. An diesem Fenster hat sich oftmals die Kinderwelt die Näslein<br />
plattgedrückt, um die Pracht zu bestaunen. Und ein kleiner Blondkopf hat beim Anblick des<br />
Schmucks ganz unbewusst festgestellt, daß die Mädle, wenn sie heiraten, unter "die Haube"<br />
kommen. Sein deutsches Herzlein hat ihm dieses wunderfeine Wort <strong>von</strong> der "Haozichhaub"<br />
für den Blumenschmuck gesagt. Vom deutschen Denken und Fühlen gab der Sprechabend<br />
15
im "Rössle" und die Heimfeier der jungen Schar auf dem Gaisbügel kund. Schön und<br />
ergreifend war der Vereinsabend des in die Reichsbauernschaft eingegliederten Landwirt-<br />
schaftlichen Hausfrauenvereins gestaltet. Im Saale des Leiters Hirschwirt Gehring kamen die<br />
Hausfrauen nach des Tages Arbeit zusammen, um den Geburtstag der langjährigen, rührigen<br />
Vorsitzenden Frau Käthe Weiß zu feiern. In der Eröffnungsansprache begrüßte Frau<br />
Schwarz die Erschienenen und überreichte der Vorsitzenden ein praktisches Geschenk. Die<br />
Mädchen ehrten mit ihren Darbietungen die Frauen und Mütter. Nach einem Sprechchor<br />
ergriff Fräulein Breitling das Wort, um die Ziele und Pläne der Mädchenschar in fröhlicher<br />
und herzlicher Weise zu erläutern. Gemeinsame Lieder, Gedichte und eine längere<br />
Ansprache der Heimatdichterin ließen die wehmütige Stimmung der Trennung rasch<br />
verschwinden. Als schließlich Frau Weiß selbst das Wort ergriff, um in humorvoller Weise<br />
<strong>von</strong> dem nahezu 20jährigen Schicksal des Vereins zu erzählen, der als ältester und stärkster<br />
LHV des Bezirkes Calw übernommen wird, da konnte ihr jedes mit vollem Herzen<br />
zustimmen.<br />
In letzter Zeit hat hier ein großer Häuserhandel stattgefunden. Über ein halbes Dutzend<br />
Gebäude, die zum Teil durch Wegzug frei wurden, sind in andere Hände gekommen. Zwei<br />
auswärtige Familien sind hierher gezogen. Durch die eine derselben ist unser Dorf in den<br />
Besitz eines echten Künstlerheimes gekommen. Herr Kielwein ist nicht nur selbst ein<br />
ausgezeichneter Künstler, wo<strong>von</strong> zahlreiche herzerquickende Stillleben, Blumenbilder und<br />
Dorfidyllen Zeugnis ablegen, sondern er hat auch eine schöne Sammlung seines<br />
hochbegabten Bruders ernst Kielwein in Gutach mitgebracht. Die Bilder aus dem<br />
malerischen Schwarzwaldwinkel zwingen wirklich zum andächtigen Beschauen.<br />
Gechinger Brief Sept. 1934.<br />
"Nun ist das Korn geschnitten, die Felder leuchten kahl, ringsum ein tiefes Schweigen im<br />
heißen Sonnenstrahl. Das ist, oh Menschenseele, des Sommers heilger Ernst, daß du, noch<br />
eh er scheidet, dich recht besinnen lernst!"<br />
Dieses schöne Lied Ferdinand <strong>von</strong> Saars, des deutsch-österreichischen Dichters, kommt<br />
einem wohl in den Sinn, wenn man an einem lichtdurchfluteten Sommerabend über die<br />
abgeernteten Fluren der Heimat geht.<br />
Wahrlich, an Selbstbestimmung und stiller Einkehr durfte es einem nicht fehlen in der<br />
verflossenen Woche, als wir alle mit dem gesamten deutschen Volke Leid trugen über den<br />
Heimgang des Reichspräsidenten und Generalfeldmarschalls. So schwangen auch über<br />
unserem Dorf die Fahnen auf Halbmast oder in Trauerflor. Wie die anderen Volksgenossen<br />
hatten auch wir am 5. August einen feierlichen Trauerzug zum Gotteshause, an welchem<br />
sich alle Gliederungen, sämtliche Vereine und zahlreiche Gemeindemitglieder beteiligten.<br />
Wem es irgend die Zeit erlaubte, hörte am Lautsprecher die ergreifende Feier am<br />
Tannenberg - Nationaldenkmal an. Die aber, die draußen im wogenden Ährenmeer an der<br />
Arbeit waren, harrten in jener feierlichen Minute in stillem Gedenken an den großen Toten,<br />
an die Helden des Weltkrieges, unter denen ein halbes Hundert Gechinger Söhne war. Am<br />
selben Abend, dem 7. August feierten alle am Kriegerdenkmal unsere gefallenen Helden und<br />
hörten anschließend die Schallplattenübertragung des Rundfunks.<br />
Und so sind wir ganz unvermerkt hinüber geglitten in eine frühherbstliche Zeit, mit den<br />
letzten knarrenden Erntefuhren und mit den ersten Astern und leuchtenden Georginen in den<br />
Bauerngärten. Schon zieht der goldene Sonnenwagen eine kürzere Bahn, die Dämmerung<br />
bricht früher herein. Die Schwalben sammeln sich zwitschernd auf den Leitungsdrähten und<br />
proben in großen Scharen den Flug zur weiten Reise. Um die fernen Berge liegt auch an<br />
klaren Tagen schon der feine Duft wehmutsvollen herbstlichen Abschiednehmens. Aber<br />
noch ist ein großer Teil des bäuerlichen Jahresplans <strong>von</strong> den emsigen Landleuten zu<br />
16
ewältigen. Schon hat die blinkende Pflugschar wieder zahlreiche Stoppelfelder zur braunen<br />
Scholle umgebrochen. Die Oehmdernte steht vor der Tür und die Brachäcker, durch<br />
zahlreiche Regengüsse doch noch ansehlich geworden, harren des Einheimsens.<br />
Aber auch eine bauliche Arbeit an der Straße Deufringen - Gechingen ist in Angriff<br />
genommen. Als vor etwa 35 Jahren diese "Neue" Deufringer Straße gebaut wurde, da war<br />
sie, nicht nur im Unterschied zur "alten krakeligen Steige, ein Musterbeispiel des<br />
Straßenbaues. In anmutigen Windungen, am Rande des lieblichen Irmtales, umsäumt <strong>von</strong><br />
Wiese, Wald, Acker und Heide, bildete sie das Entzücken naturliebender Wanderer. Die<br />
erste Verrbreiterung kam durch die Kraftwagenlinie Gechingen - Ehningen. Nunmehr hat<br />
sich diese den stetig wachsenden Verkehr wiederum als unzulänglich erwiesen. Jetzt wird<br />
die Straße nochmals um einen halben Meter verbreitert und zugleich geteert, da die<br />
Staubentwicklung geradezu verkehrshinderlich wurde. Sollte die Straße den Anforderungen<br />
wieder nicht genügen, müssen die anliegenden Ackerbesitzer einen Meter Grund hergeben,<br />
daß die Böschung weiter abgegraben werden kann. Ob dann nicht mit der Zeit im Dorfe<br />
selbst der schon vor Jahren in diesen Spalten erwähnte Durchbruchsplan am sogenannten<br />
Gaisbügel in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten.<br />
Der Hauch der Ewigkeit 1934 (Reise nach Thüringen)<br />
Wer am Rundfunk Zeuge war <strong>von</strong> der Begeisterung, mit der die Jugend des neuen<br />
Deutschlands zur Sommer-Sonnen-Wende unsern großen Landsmann Friedrich Schiller in<br />
seinem Geburtsort Marbach am Neckar feierte, der ahnt, was gerade dieser schwäbische<br />
Große für eine Sendung im deutschen Geistesleben zu erfüllen hatte. Nicht als Einer, der tot<br />
ist, sondern dessen Geiste heute noch die Herzen erheben kann. Wie stark und mächtig, dazu<br />
mag dieses kleine Erlebnis eines Weimarer Herbsttages dienen.<br />
Auf dem weiten Viereck des Marktplatzes, zeigten sorgfältig abgesperrt, Weimarer Mädel<br />
zeigten ihre anmutige Volkstänze. Das Ganze war umsäumt <strong>von</strong> einer dichtgedrängten,<br />
sonntagsfrohen Menge. Da es aber dieselben Tänze waren, die Sonntags zuvor schwäbische<br />
Mädle beim dörflichen Erntedankfest ebenfalls getanzt hatten, da sich außerdem die<br />
Sehenswürdigkeiten Altweimars in acht knappen Ferientagen kaum erschöpfen ließen, so<br />
lockte das "Schillerhaus" denn noch mehr als Jung - Thüringens Anmut und Beweglichkeit.<br />
Durch feierlich stille Straßen ging es zur Herzkammer der Stadt: der baumumstandenen<br />
Schillerstraße. Durch einen schmalen Hausgang tritt man im Schillerhaus in das bescheidene<br />
Museum ein. Als größte Kostbarkeit birgt dasselbe wohl eine handschriftliche Aufzeichnung<br />
der Flucht Schillers aus dem Schwabenland. Gerade die Seite ist aufgeschlagen, auf welcher<br />
man liest, daß Schiller beim Überschreiten der Grenze mit Tränen in den Augen ausrief: "Oh<br />
meine Mutter!"<br />
Daneben befindet sich die vom Wiener Schillerverein gestiftete Büste des Schilderers und<br />
Leidensgefährten jener tiefernsten Periode: Andreas Streicher. Sie trägt die Widmung: Dem<br />
Helfer in der Not, dem auf jeder Probe ausharrenden, treuen Freunde Schillers. Streicher war<br />
geboren zu Stuttgart im Jahre 1761, und starb 1833 in Wien.<br />
Ein vergilbtes Kinderbrieflein aus dem Schwabenlande ist auch noch vorhanden, ein solches<br />
<strong>von</strong> Schillers Schwester Nanette an ihren Schwager, den Bibliothekar Reinwaldt in<br />
Meiningen, den Gatten <strong>von</strong> Christophine Schiller. In rührenden Worten bittet das Kind, ja<br />
recht gut zu der (<strong>von</strong> ihm selbst so schmerzlich vermissten) Schwester zu sein. Diese<br />
Nanette starb 19jährig, ein hochbegabtes Mädchen, auf Schloss Solitude, wo Schillers Vater<br />
herzoglicher Beamter war. Sein Grab, sowie dasjenige der früh verstorbenen Tochter<br />
befindet sich auf dem Friedhofe zu Gerlingen bei Leonberg. Vor etlichen Jahren wurden<br />
17
diese längst vergessenen Ruhestätten wieder aufgesucht und mit einer Gedenktafel versehen.<br />
Doch nun zurück nach Weimar! Wenn man bedenkt, daß nahezu ein halbes Jahrhundert<br />
verstrich, ehe Schillers Wohn und Sterbehaus zu einer würdigen Gedenkstätte umgewandelt<br />
wurde, so freut man sich, mit welcher großen Ehrfurcht das heutige Geschlecht durch die<br />
wieder wie ehedem eingerichteten Räume wandert. Es gibt wohl wenig Fremde, die nicht<br />
neben dem schier unerschöpflichen Goethe-National-Museum am Frauenplan, die ungleich<br />
bescheidenere Wohnstätte des Feuergeistes Schiller aufgesucht hätten, den heute noch<br />
Deutschlands Jugend den Ihren nennt.<br />
Oben im ausgebauten Dachstock befindet sich das Arbeits- und Schlafzimmer, gleich<br />
demjenigen des alten "Olympiers", <strong>von</strong> spartanischer Einfachheit. Und doch ist Schiller<br />
hochbefriedigt über sein Besitztum. Besonders der prächtige Ausblick auf die damalige<br />
Esplanada, die heutige Schillerstraße, hatte ihn begeistert. Diese, <strong>von</strong> Herzogin Anna Amalie<br />
auf dem zugeschütteteten Stadtgraben angelegte Promenade war damals wie heute der<br />
Mittelpunkt des städtischen Verkehrs. Nur hatte man damals noch freien Durchblick auf<br />
grüne Gärten.<br />
Ein wolkenverhangener Oktoberhimmel grüßte zu den Fenstern herein, als wir an dem<br />
schmalen Lager standen, auf welchem Friedrich <strong>von</strong> Schiller im Maien 1805 seine große<br />
Seele aushauchte. Wie das Geburtszimmer in Marbach ist auch das Sterbezimmer in<br />
Weimar, trotz aller Dürftigkeit, umweht <strong>von</strong> einer geheimen Hoheit. Dazu paßt am besten<br />
das schöne Wort: "Wie kann eines Augenblicks Frist Ewigkeit sein? Wenn es ein Augen-<br />
Blick ist in das Ewige hinein!"<br />
Heller Marschgesang tönte da durchs offene Fenster <strong>von</strong> der Straße herauf. Jugend<br />
marschierte vom Marktplatz durch die Stadt. Das Licht der seither verhüllten Sonne flutete<br />
jetzt in goldenen Strahlen durch den Raum. Von demselben Fenster, an dem er so oft<br />
gestanden, blickten nun wir hinab auf die Schar, die da mit Fahnen und Wimpeln mit dem<br />
Festabzeichen vom großen Rudolstädter-Jugend-Tag durch das Blätterbraun der Baumallee<br />
zog. Und man fühlte nicht nur den warmen Sonnenglanz in dem geweihten Raume, nein,<br />
man spürte das Wehen eines starken und hohen Geistes. Es wurde einem zur sieghaften<br />
Gewißheit: Friedrich <strong>von</strong> Schillers Geist lebt!<br />
Er segnete die junge Schar, die das vollenden darf, was er im Weitblick seines<br />
vorausschauenden Geistes sah, wofür er sich trotz vieler Widerstände zeitlebens einsetzte:<br />
die Herzkraft des deutschen Volkes zur Entfaltung zu bringen! Dieses frohe und schöne<br />
Wissen wird für immer die Erinnerung an das Weimarer Schillerhaus begleiten. Es hätte<br />
beim Verlassen des Raumes nicht einmal des Blickes bedurft, der auf die vergilbte<br />
Handschrift in dem schmalen schwarzen Rahmen fiel. Allein der Dichter Ernst <strong>von</strong><br />
Wildenbruch, der Enkel des bei Saalfeld gefallenen, tapferen Louis Ferdinand <strong>von</strong> Preußen,<br />
scheint 40 Jahre zuvor ähnliches empfunden zu haben, wenn er dem Schillerhause folgende<br />
Verse widmet:<br />
Klein ist die Stadt. Du kannst sie wenn du willst<br />
<strong>von</strong> einem Tor zum andern bald durcheilen,<br />
doch wunderbar, durcheilen wirst du nicht,<br />
oft wirst du stehn und sinnend wirst du weilen.<br />
Denn es wird sein, als ginge hinter dir<br />
ein Unsichtbarer, flüsternd leise Worte:<br />
Geh hier nicht durch im Handwerk-Reiseschritt.<br />
Nicht ziemt es sich an dem geweihten Orte,<br />
nicht fahnde hier nach Sehenswürdigkeit,<br />
was Neugier reizt, du wirst es nicht erblicken,<br />
dein Herz tu auf und aus der Ewigkeit<br />
18
wird Hauch der Ewigkeit dein Herz erquicken!"<br />
Und dieser Hauch der Ewigkeit, der "Unsichtbare", er füllte an jenem golddurch- leuchteten<br />
Herbstmorgen das alte Haus und blickte segnend herab auf Jung- Thüringen, auf Weimars<br />
frische Schar.<br />
125 Geburtstag 1935<br />
Ich möchte nicht versäumen, Ihnen, Herr Pfarrer, durch meine Mutter mitzuteilen, dass am<br />
morgigen 13. Januar 1935 der 125. Geburtstag unseres Onkels Prälat, des Herrn<br />
Generalsuperintendent Carl Friedrich Brackenhammer ist. Gerade unsere Zeit, die wieder<br />
zur Quelle des Erbgutes zurück kehrt, dürfte dafür aufgeschlossen sein, wie es möglich war,<br />
daß der einfache Gechinger Müllersohn die höchste Stufe der geistlichen Laufbahn errang.<br />
Neben der göttlichen Gnade, die dieses Knäblein leitete, war es die Zähigkeit der väterlichen<br />
Ahnen, (schon um 1557 urkundlich erwähnt) und vor allem die mit reichen Gaben des<br />
Herzens und Geistes ausgestattete Mutter Magdalene geb, Reutter, den Lieblingskind er,<br />
trotz aller Fürsorge für die beiden anderen Kinder, "Ihr Fritz" immer war. Ich besitze noch<br />
drei Briefe an meinen Urgroßvater, welche ein treues Spiegelbild seines Wesens und<br />
Wirkens sind. 1871 wurde er zum Prälaten <strong>von</strong> Ulm vorgeschlagen, lehnte aber ab, weil er<br />
wegen eines beginnenden Halsleiden das Predigen in dem riesigen Münster fürchtete. "Ob<br />
ich nochmals Prälat werden kann, weiß ich nicht" schreibt er, "man kann sich nicht melden,<br />
sondern wird vom König vorgeschlagen."<br />
Kurze Zeit nachdem mein Urahne gestorben war, wurde sein Bruder Prälat <strong>von</strong> Heilbronn.<br />
Dort wirkte er ein Jahrzehnt, immer mit großer Liebe an seiner Schwarzwaldheimat und<br />
seinen, zum größten Teil bäuerlichen, Verwandten hängend. Er starb 1889 in Tübingen, wo<br />
er im Ruhestand lebte. Stets aber, das war sein größter Stolz und wohl im Grunde echte<br />
Demut, wollte er nichts anderes sein als "ein Kind seines Volkes". Das wurde noch an<br />
seinem Grabe gesagt.<br />
Aus diesem Grunde dürfte ich Sie vielleicht bitten, dieses treuen Sohnes Gechingens in<br />
kurzen Worten zu gedenken am morgigen Sonntage!<br />
19
Alt-Stuttgarter Bilderbogen 1936<br />
Der alte Schuhmacher<br />
Eines Tages sagte die Mutter beim Mittagessen: "Wir sollten dem Kind neue Schuhe<br />
anmessen lassen, sie ist aus den alten hinausgewachsen". Der Vater legte das Gesicht in<br />
strenge Falten und sagt: "Was einen seine Tochter aber Geld kostet, das kann nett werden,<br />
bis zu vollends tausend Wochen alt bist!" Aber das war nicht ernst gemeint. Das kleine<br />
Hasenherz frug nur: "Tut das Anmessen weh?" "Nein, es tut nicht weh" sagte die Mutter.<br />
"Nicht wie bei Aschenputtel?" wurde weiter gefragt. Die hätten die falschen Schuhe<br />
angezogen, meinte der Vater, der Meister Binder nehme das rechte Maß. Und damit kam die<br />
Schuhgeschichte in Rollen.<br />
Nachmittags gingen Mutter und Kind die stille Neefstraße hinauf, wo über einem Pferdestall<br />
im Hinterhaus der Meister wohnte. Es roch nach Zirkus, wie das Kind feststellte, nach<br />
Sägemehl und Pferdedung. Über eine schmale Stiege ging es und das kleine Herzlein klopfte<br />
ängstlich, denn so unverhüllt war ihm Dürftigkeit in seinem vierjährigen Leben noch nie zu<br />
Gesicht gekommen. In einer weißgetünchten Kammer standen rotgewürfelte Betten und<br />
daneben war ein schmales Gelass, an dessen Fenster der alte Meister seinen Schusterschemel<br />
und sein Werkzeug hatte. Er riesterte gerade ein Paar Männerstiefel, stand aber gleich auf,<br />
um zwei Stühle zu holen. In einem kleinen Ofen brodelte der Nachmittagskaffee und eben<br />
kam Frau Binder mit einem Korb voll der Reparatur bedürftigen Schuhen zurück. "Das<br />
Geschäft scheine gut zu gehen", meinte die Mutter. Man seis zufrieden, sagte die gute Alte.<br />
Währendes holte der Meister braunes Packpapier, man mußte draufstehen und der Meister<br />
nahm das Maß. Es wurden dann ein Paar gute feste Stiefel geliefert, die aber leider das<br />
Missfallen <strong>von</strong> allen Onkel und Tanten erregten. "So derbe Dinger, so plump, ihr habt doch<br />
bloß das Einzige", so bekamen die Eltern zu hören. Vater schüttelte den Kopf, als ob das was<br />
ausmachte! "Ich bin mit Kommisbrot groß geworden, man siehts mir heute nicht mehr an",<br />
führte er ins Feld. Mutter meinte, die Schuhe seien schon recht, überhaupt wenn wir in den<br />
Schwarzwald führen, zu den Großeltern, da könnte ich springen wie ich wollte. Aber eines<br />
Tages, als ich bei den Großeltern am Hegelplatz war, nahm mich kurzerhand eine Tante in<br />
einen schönen, neumodischen Schuhladen und kaufte mir ein Paar weiße Stiefelchen, mit<br />
feinem roten Leder besetzt, die ich mit Stolz aber schlechtem Gewissen trug. Denn Meister<br />
Binder hatte es doch recht machen wollen! Und ich war so froh, daß er wenigstens unser<br />
Flickschuster bleiben durfte.<br />
Als wir schon in der neuen Wohnung waren, und die großen Schuhläden in der Innenstadt<br />
emporschossen wie die Pilze nach dem Regen, kam noch die alte Frau Binder mit ihrem<br />
Bogenkorb, der wahrscheinlich ein Geschwister vom "Gagele" dem seinigen war, und frug,<br />
ob wir Flickarbeit hätten. Sie war nicht mehr so zuversichtlich wie früher, und als ich einmal<br />
mit ihr die Treppe hinunterging, sagte sie mit zitternder Stimme: "Mir passet nemme en de<br />
nei Zeit, mir net!"<br />
Eines Tages blieb sie auch aus, vielleicht war der alte Meister gestorben oder sie selbst.<br />
Stuttgart aber wurde mehr und mehr eine moderne Großstadt, und die idyllischen<br />
Überbleibsel wurden zu Grabe getragen mit den alten Leutlein, die sie noch gewollt oder<br />
ungewollt betreut hatten.<br />
20
Ein erloschener Stern.<br />
Es war in der Weihnachtszeit, der Christbaum stand in der guten Stube, da kam der Vater<br />
eines Tages mit geheimnisvoller Miene nach Hause. "Es gibt noch eine nachträgliche<br />
Weihnachtsüberraschung für dich," sagte er, "aber du mußt selbst erraten, was es ist" sagte er<br />
zu mir. "Ist es was zum Essen?" "Nein." "Ist es was zum Anziehen?" "Nein." "Dann etwas<br />
zum Lesen?" "Auch das nicht." "Was kann es dann sein?" Vater lachte: "Es ist die Erfüllung<br />
eines alten Wunsches." Pause. "Ich habe zwei Billets für morgen Abend ins Hoftheater." "Ins<br />
Thea---." Mutter in der Küche erschrak, als plötzlich die Jubelfanfare erscholl: "Ich darf ins<br />
Hoftheater!" Sie war schon vorher in das Geheimnis eingeweiht worden.<br />
Die "Bretter welche die Welt bedeuten", hatten für uns Kinder des südlichen Stadtteiles aus<br />
gelegentlichen 20 Pfennig-Vorstellungen im "Residenztheater", das der alte Max Samst<br />
leitete, bestanden. Diese Mittwochmittag-Aufführungen waren ja unbeschreiblich gemütlich<br />
gehalten, aber es fehlte ihnen der Nimbus des Hofes, den jedes echtes Stuttgarter Kind der<br />
Vorkriegszeit mit Herzklopfen erfüllte. Wohl befriedigte auch das Interimtheater nicht völlig<br />
die Bedürfnisse der kunstgewöhnten Residenzler, aber der alte Bau war abgebrannt und der<br />
neue an den Anlagen erst im Grundriss fertig. Also Interimtheater hin oder her, es war eben<br />
das "Hoftheater".<br />
Als der große Abend da war und wir im Vorraum standen, da war es mir, als stehe ich vor<br />
einem Tempel, ein Gefühl, das sich auch später immer wieder auslöste. "Hänsel und Gretel"<br />
wurde gegeben, die Märchenoper <strong>von</strong> Humperding und hernach das Ballett "Puppenfee".<br />
So recht ein Stück Weihnachtspoesie. Besonders aber der vergnügte Hänsel tat es mir an, der<br />
hernach die böse Hexe in den Ofen schob. Auf dem Zettel las ich zum ersten Mal den<br />
Namen, der heute noch in den Annalen der Theatergeschichte strahlt: Anna Sutter, deren<br />
Leben kurze Zeit hernach erlosch wie ein Meteor nach flimmerndem Leuchten. Das ahnten<br />
wir freilich nicht, als wir die silberne Stimme bewunderten, der alle Herzen zuflogen.<br />
Es war im Frühling und die Blütenbäume prankten um Stuttgart, als wir bei einem fröhlichen<br />
Geburtstagskaffee in der Nähe des Hasenbergs beisammen saßen. Da trat die älteste Tochter<br />
des Hauses ein, ein blonder Backfisch, welcher der damaligen Mode entsprechend, eine<br />
große Haarschleife trug, heute, trotz des strahlenden Wetters eine schwarze! "Kläre trägt<br />
Hoftrauer" sagte ihre jüngere Schwester zu mir. "Ja, warum denn?" frug ich. "Anna Sutter ist<br />
tot," bekam ich zur Antwort, "sie wurde heute früh erschossen." "Ein Stern ist erloschen",<br />
fügte der Backfisch melancholisch hinzu. Mir war, als sei ein Stück Himmel herabgefallen,<br />
Anna Sutter, dieser strahlende Liebling <strong>von</strong> uns allen, tot! Zum ersten mal kam dem Kinde<br />
eine Ahnung <strong>von</strong> der Welt des Scheines, die neben viel Licht und Harmonie auch dunkle<br />
Stellen birgt.<br />
Abends, als mir Mutter die Tür öffnete, wollte ich ihr die große Neuigkeit mitteilen, aber es<br />
hatte schon in der Zeitung gestanden. Wie der tragische Tod zwei Menschen dahin gerafft<br />
hatte, das war eigentlich nichts für Kinderohren, trotzdem sprach ganz Stuttgart, das<br />
unbeschwerte Stuttgart der Vorkriegszeit lange <strong>von</strong> nichts anderem, als Anna Sutter und<br />
Alois Obrist. Es war eine jener Tragödien, die wir später in hundertfältiger Form erlebten,<br />
ein Mensch zerbricht am Leben und reißt einen Anderen mit. - Unter den vielen<br />
Blumengrüßen, die auf den Pragfriedhof getragen wurden, befand sich auch einer aus<br />
Kinderhand, der galt dem fröhlichen "Hänsel" einer Weihnachtszeit, der unvergessenen<br />
Anna Sutter.<br />
21
Das "Gagele".<br />
Das "Gagele" war ein verhuzeltes, altes Weiblein, das seinen bescheidenen Lebensunterhalt<br />
mit Treppenputzen und Botengängen verdiente. Es hieß eigentlich Kathrina, auf schwäbisch<br />
"Kathrele", was ein zweijähriger Kindermund eben nach seiner Weise umwandelte. So ist<br />
das "Gagele" schließlich im ganzen Bekanntenkreis so genannt worden und wäre ein<br />
würdiges Glied geworden in Marie Josenhans "Meine alten Weiblein". Aber damals war es<br />
ja schon lange schon in der Ewigkeit drüben, denn es war schon um die Jahrhundertwende<br />
alt und gebeugt. Immer trug es ein getüpfeltes Blaudruckkleid und eine große<br />
Barchentschürze und ein noch größeres Umschlagtuch. Immer hatte es etwas zu trippeln und<br />
zu krusteln. Eigentlich, so richtig ruhig habe ich das "Gagele" nie gesehen. Vielleicht<br />
machten das die vielen großen und kleinen Sorgen, die es in all "seinen" Häusern zu hören<br />
bekam und die es in seinem ehrlichen, kleinen Herzlein mittrug. Jedenfalls hatte es sich in<br />
unsrer Dobelstraße auf gute und tapfere Weise bewährt.<br />
Einmal kamen wir vom Hegelplatz, vom Großelternhaus und die kleinen Beinchen wollten<br />
nicht mehr richtig gehen. Dazu hatte man sich die Mitnahme des Puppenwagens ertrotzt<br />
gehabt und hatte auch den noch zu schieben. In der Charlottenstraße herrschte im<br />
Abendsonnenschein ein reger Verkehr und in diesem stand plötzlich ein gutes Geistlein, das<br />
"Gagele" in seinem getüpfelten Blaudruckkleid und dem Umschlagtuch. Es schlug die<br />
Hände zusammen: "O due mei, ja Kend, hosch du dein Dockewage bei de Großeltern g`hätt,<br />
so weit?" "Ja, Kathrin" sagte die Mutter, "wer eine Sache beginnt, muss sie auch<br />
durchführen."<br />
Das "Gagele" wußte gegen dieses mütterliche Argument nichts anzuführen, trotzdem packte<br />
es kurz entschlossen die Puppe am Arm, zog sie heraus und setzte statt seiner das Kind<br />
hinein. Man denke, das gute Weiblein schob den Wagen mit seinem nun beträchtlichen<br />
Gewicht über die belebte Olgaecke und die Hohenheimerstraße mit der größten<br />
Selbstverständlichkeit der Welt. Die Mutter stellte zwar später fest, daß der Wagen aus den<br />
Fugen geraten war, aber sie schalt nicht. Und das "Gagele" hatte mit dieser Liebestat in dem<br />
Kinderherzen ein klein wenig Beschämung und eine ganz unerklärliche Achtung hervor-<br />
gerufen. Es setzte sich auch manchmal an das braune Gitterbettchen, wenn man krank war<br />
und erzählte im schönsten Bohnenviertelschwäbisch eine Geschichte.<br />
Später kam Kindergarten und Schulzeit, man zog in einen anderen Stadtteil und bekam<br />
"Gagele" nicht mehr zu Gesicht. Nur einmal noch, um Ostern, machte man mit einer, ein<br />
wenig wilden Freundin einen Spaziergang durch die Stadt. Am Wilhelmspalais kam es<br />
beinah zu einer Heulerei, denn die Hermine behauptete, sie sei mit der Königin verwandt<br />
und nur mit Bitten und Betteln konnte man sie vom Betreten des Gartens bewahren. Etwas<br />
verstimmt gingen dann zwei Mädelchen die Charlottenstraße aufwärts, bis eine mit hellem<br />
Lachen stehenblieb: "Sieh, hier hat mich mal das "Gagele" in den Puppenwagen gepackt."<br />
Da rief die andre begeistert, denn sie kannte das "Gagele" vom Hörensagen: "Du, wir gehen<br />
in die Dobelstraße, vielleicht sehen wir`s." "Wer weiß, ob es noch am Leben ist?" "Probieren<br />
wir`s mal." Gesagt, getan.<br />
Und als ob die Wunschkraft zweier kleinen Herzen stark genug wäre, kam über die<br />
Hohenheimerstraße mit eiligen Schrittlein, im Blaudruckkleid und Barchentschürze mit dem<br />
wohlvertrauten Bogenkorb die alte, gute Kathrin. Wir werfen sie fast um, die eine vor<br />
Freude, die andre vor Übermut. Und obwohl schon eine Reihe <strong>von</strong> Jahren darüber gegangen<br />
waren, kannte sie mich sofort, und sagte mir, daß alle kleinen Kinder sie "Gagele" nennen<br />
müßten, weil ihr das so gut gefiel. Dieweil wir nun an dem Bäckerladen stehen geblieben<br />
waren, nahm sie mich kurzerhand mit hinein und kaufte mit - man denke, das arme, alte<br />
Weiblein - einen schönen braunen Hasen aus Hefeteig mit Rosinenaugen und der Freundin<br />
ein "Dreipfennigstückle". Der gute Herr Bäckermeister, der mich auch noch kannte, legte ein<br />
22
paar bunte Eier in die Tüte dazu. Wir bedankten uns viele Mal bei dem guten Weiblein. Ihre<br />
Stimme zitterte ein bißchen, als sie sagte: "B`hüt de Gott, liebs Kind, sag ao an schena<br />
Gruaß an deine Leut." Und dann schritt sie eilig die Dobelstraße hinauf. Damals habe ich<br />
mein "Gagele" zum letzten mal gesehen. Ob sie hernach noch pflegebedürftig in ein Spital<br />
kam, oder ob man sie eines Morgens in ihrer Dachkammer fand, das erfuhren wir nicht.<br />
Jedenfalls aber, wenn die vertrauten Gestalten der Kinderzeit an meinem Auge vorüberzieht,<br />
so fehlt das "Gagele" nicht. Manchmal denke ich, wenn ich sie in der Ewigkeit wiedersehen<br />
könnte, ob sie dann nicht wieder ein blaues Kleid anhätte und eine Barchentschürze, ob sie<br />
mich nicht an der Hand nähme und sagte: "Komm, Kind, i kauf dr an Hase." Dann wäre<br />
sicher manches Leid ausgelöscht, das einem das harte Leben brachte.<br />
Weil der Stadt 1936<br />
Im Glast und Glanz des letzten Maienmorgens lag das weite Land. In den Dörfern, die wir<br />
durchwandert hatten, begann das geschäftige Leben des Alltags. Als wir uns aber dem<br />
altehrwürdigen Weil der Stadt näherten, über dem sich erst die Morgennebel des Würmtals<br />
verteilten, schienen wir in eine Atmosphäre <strong>von</strong> tiefer Feierlichkeit zu kommen, wozu nicht<br />
nur die seltsam festliche Ausschmückung der wohlbekannten Gassen und Straßen beitrug.<br />
Die Luft schien erfüllt <strong>von</strong> der Weihe des Tages. Nikolaus Lenau mußte einem einfallen, der<br />
österreichische Dichter:<br />
"Da sind, soweit die Blicke gleiten, Altäre festlich aufgebaut,<br />
und all die vielen Herzen läuten zur Frühlingsfeier dringend laut."<br />
Mit unendlicher Liebe und Sorgfalt waren die einzelnen Altäre vorbereitet und geschmückt,<br />
daß sie der fremde Wanderer mit Ehrfurcht betrachten mußte. Die Herrgottswinkel der<br />
Stuben schienen allerorts in die Fenster gewandert zu sein, denn nahezu alle Häuser hatten<br />
neben reichlichem Blumen und Blütenschmuck ein paar Statuen und Bilder in den Fenstern<br />
prangen. Die Hauswände waren durch viel Laubwerk in einen grünen Hain verwandelt. Die<br />
Straßen waren gleich einem Wiesenteppich, der noch den feinen, zarten Duft ersterbender<br />
Blumenseelen aushauchte und die wandermüden Schritte dämpfte. Leise erklang der<br />
Orgelklang in dem prächtigen Münster; schon sammelten sich die Gläubigen zur Prozession<br />
und dem Beschauer bot diese ein Bild wundersamer mittelalterlicher Schönheit. Die vielen<br />
weißgekleideten Mädchen, die kleinen Chorknaben, die wehenden Fahnen, die andächtige<br />
Menge und inmitten der Priester unter goldgewirketem Baldachin mit der seltsam<br />
überirdisch geformten Monstranz. In feierlichem Ritus vollzog sich die Handlung, zu tiefst<br />
den Segen erflehend vom Welterlöser für die Menschen dieser oft so leidmüden Erde.<br />
Geheiligt sollte sie wieder sein durch die Menschwerdung Jesu Christi, durch sein Leiden,<br />
Sterben und Auf- erstehen. Langsam wanderte der lange, lange Zug um den Rand der Stadt,<br />
vorbei an vielen Bauwerken der Gegenwart und Vergangenheit, um in die Stadtkirche<br />
wiederum einzumünden. Ludwig Richter, der tieffromme Dresdener Maler, hat unter seinen<br />
vielen Holzschnitten einen, der uns wie ein großes, geistiges Bild die Schau der Weil der<br />
Städter Fronleichnamsprozession zu überragen schien. Die Himmelskönigin mit dem kleinen<br />
Jesusknaben thront inmitten tiefer Waldeinsamkeit, inmitten musizierender Engel und der<br />
scheuen Tiere des Waldes. Ganz in der Ferne winkt eine menschliche Behausung und vom<br />
Himmel, herab bringen zwei Engel die Botschaft: "Denn dies ist das Brot Gottes, das vom<br />
Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Johannes 6.33." Zu ihren Füßen rauscht ein<br />
Brünnlein, <strong>von</strong> Blumen umgeben.<br />
23
Gechinger Brief September 1938<br />
Wer ersinnt sich nicht aus fernen Jugendtagen des frommen Wunsches, daß eines schönen<br />
Morgens das Schulgebäude vom Erdboden verschwunden wäre und dann eine<br />
unwahrscheinlich schöne Ferienzeit beginnen würde! Das nun gerade das beim Gechinger<br />
Schulhaus nicht der Fall ist, wird es doch so schmuck und neu hergerichtet, daß es sich<br />
während der Sommerferien nicht ganz bewerkstelligen ließ. Noch weiter 14 Tage Ferien<br />
mussten gegeben werden, die <strong>von</strong> dem jungen Volk auch wacker ausgenützt wurden. Wohl<br />
müssen unsrer Landkinder schon frühe den Eltern in der Erntezeit behilflich sein, doch<br />
geschieht das gern und freudig.<br />
Denn sie werden ja alle mit ihren Feldern und Wiesen groß, und wenn gar so ein Bub oder<br />
Mädle einmal "den Wagen bringen" darf, kennt sein Stolz keine Grenzen, besonders wenn es<br />
ohne Unfall abgeht. Man hat damit ein bäuerliches Reifezeugnis bekommen. Man kann auch<br />
sicher sein, daß sich die Mutter nicht lange bitten läßt, sondern allerfeinsten Hefenkranzteig<br />
macht: zur "Sichelheekat", das heißt zu der glücklich abgeschlossenen Getreideernte, nach<br />
der die Sichel aufgehängt wird. Man bäckt an diesem Tag Hasen, und jedes Kind bekommt<br />
einen <strong>von</strong> diesen drolligen Langohren, mit den schwarzen Augen <strong>von</strong> "Raosaila" (Rosinen).<br />
Es handelt sich dabei um Reste altgermanischen Brauchtums. Die "Pflegelheekat" als der<br />
Schluss des Dreschens wurde <strong>von</strong> alters her festlich begangen. Heute, wo das Getreide <strong>von</strong><br />
den großen Dampfdreschmaschinen in wenigen Stunden erledigt wird, ist dieser Brauch<br />
verschwunden. Das Hopfenzopfen, auch eine sittlich-ländliche Arbeit, hat jetzt begonnen.<br />
Sie verläuft noch in dem Zeitmaß <strong>von</strong> ehedem, es sei denn, daß der Bauer eine Drahtanlage<br />
in seinem Hopfengarten hat, oder eine Hopfendarre in seinem Hof. Doch ist der Anbau so<br />
stetig zurückgegangen, daß verschiedene hiesige Mädchen alljährlich ins Oberland nach<br />
Tailfingen im Oberamt Rottenburg fahren, wo man ihre Geschicklichkeit im Hopfenzopfen<br />
gut gebrauchen kann. Einige Male ist sogar die Gechinger Musikvereinigung in das<br />
schwäbische Hopfengebiet gefahren.<br />
Im übrigen läßt sich der Ertrag der Felder denn doch nicht so schlecht an, wie man im<br />
Vorsommer durch die große Trockenheit befürchtete. Der Lagervorrat ist allerdings sehr<br />
gering, jedoch das Druschergebnis ist nicht so übel. Kartoffel und Futterrüben wachsen zu<br />
einer beträchtlichen Größe heran und auch der Obstertrag ist befriedigend. Wenn man<br />
bedenkt, welch verheerendes Unwetter vor drei und vor zwei Jahren über unsere Fluren<br />
hinwebrauste, ist man dankbar für das, was man heuer ernten durfte. Namentlich der<br />
Pflaumensegen will kein Ende nehmen. Es war bald so, daß sich Bekannte statt des üblichen<br />
Grußes zuriefen: "Henn dr ao Pflomma?", um im Bedarfsfalle vom eigenen Überfluss<br />
abzugeben. Es ist auf dem Lande viel zu wenig bekannt, daß man aus Pflaumen einen<br />
wohlschmeckenden Brotaufstrich bereiten kann. Man hält sie der bitteren Haut wegen für<br />
unbrauchbar. Wenn man jedoch die Früchte zuvor mit heißem Wasser übergießt, läßt sich<br />
die Haut mühelos abziehen und der Stein entfernen. Die Hausfrau kann sich in ihrem<br />
bescheidenen Reich an der großen Aufbauarbeit beteiligen, wenn sie das gewissenhaft<br />
verarbeitet, was unser Herrgott wachsen ließ.<br />
24
Schwäbische Bauern siedeln in der Mark 1938<br />
Im Park des Herrenhauses <strong>von</strong> Wall in der Uckermark blühten Rotdorn und Flieder. Die<br />
schwäbischen Siedlerkinder, die dorthin verpflanzt wurden, holten Sträuße für die Mütter.<br />
Längst verwischt in den kleinen Köpfen ist die Erinnerung an das Hügelgelände und die<br />
Tannenwälder des schwäbischen Gäues. Es ist je für die Kleinen so schön in der neuen<br />
Heimat mit ihren weiten Auen und dem blickenden Wasser des Havelkanals. Schon mischt<br />
sich in die breiten Laute des Schwäbischen die genaue Betonung aus der fruchtbaren<br />
Landschaft des großen Friedrich. Der Plan, einen schwäbischen Lehrer in die Schule im<br />
Waller Herrenhaus zu bekommen, ist zunichte geworden an dem Umstand, daß die Siedlung<br />
auch Preußen und Schlesier unter ihren Bauern hat. Nichtsdestoweniger aber wachsen die<br />
Kinder dort fröhlich heran. Für die Nichtschulpflichtigen gab`s im vorigen Sommer sogar<br />
einen Erntekindergarten, betreut <strong>von</strong> einer Kindergärtnerin.<br />
Das soll ein gar fröhliches Leben allenthalben gewesen sein. Was müssen das für prächtige<br />
Mädels gewesen sein, die kurzerhand die großen Universitätsferien benutzten, um sich im<br />
Arbeitslager einzureihen. Die Gemeinschaft mit den Berliner arbeitslosen Kontoristinnen,<br />
Arbeiterinnen und Hausangestellten gab den Mädchen gegenseitig manchen neuen<br />
Lebenseinblick. Und was für ein anderes Gesicht bekam überhaupt die Welt, wenn man<br />
durch den Tau blitzenden Morgen mit einem schwäbischen Bauern ins Heu ging oder zum<br />
Distelstechen oder zum Kartoffel und Rübenhacken. Als dann die weiten Felder zur Ernte<br />
reiften, da wussten die jungen Städterinnen schon, wie unseres lieben Gottes Ackerland zu<br />
bebauen ist. Hing einmal ein grauer Regenhimmel über dem märkischen Land, dann stellte<br />
man sich mit der Siedlerfrau mutig an den Waschzuber. Man half beim Aufhängen und<br />
Plätten der Wäsche und flickte den wilden Buben ihre zerrissenen Hosen. Lachte die Sonne<br />
dann wieder, dann ging`s hinaus in Feld und Flur, je zwei und zwei, und jeden Tag zu einem<br />
anderen Siedler. Das Mittagsmahl und der Abend vereinigte die freiwilligen<br />
Arbeitsdienstlerinnen wieder in den schönen Räumen des Herrenhauses. Was Wunder, dass<br />
sich all die freundlichen Helferinnen auf den Erntekranz freuten, der alt und jung vor ihrem<br />
Weggang zu frohem Tanz und Schmaus vereinigte.<br />
Nun sind also die kleinen Uckermärker Schwaben durch den duftenden Schlosspark<br />
gestrichen und haben Rotdorn und Flieder gepflückt. Ein Zweiglein da<strong>von</strong> hat die beglückte<br />
Mutter in einen Heimatbrief gelegt. Sie hat dazu geschrieben, daß sie nun Erbhofbauern sind<br />
und ja auch die Erben dazu haben. Jetzt weht auch Heuduft über die weiten Ebenen und all<br />
die bunten Blumen fallen unter den scharfen Messer der Maschinen. Und wenn auch kein<br />
wohlvertrauter Glockenschlag durch den Arbeitstag tönt und am Abend kein Sensendengeln,<br />
wie hier landauf, landab in der schwäbischen Heimat - dem unverdrossenen Fleiß der Siedler<br />
tut das keinen Abbruch. Wenn auch manchmal im Herzen der Erwachsenen die Sehnsucht<br />
nach dem verlassenen Heimattal aufsteigt, die frohen Augen der Kinder leuchten desto<br />
heller. Sie singen mit dem alten Moritz Arndt: "Mein Vaterland muß größer sein, das ganze<br />
Deutschland soll es sein!" Da finden sich auch die Mütter mit ihren so vielen, so<br />
erantwortungsvollen Aufgaben zurecht, als tapfere deutsche Frauen den Weg zu gehen <strong>von</strong><br />
der schwäbischen Siedlerfrau zur märkischen Erbhofbäuerin.<br />
Ja, das kleine Heinzelmännchen - nun hat es seine letzte Weihnachten im Schwabenlande<br />
verlebt. Übers Jahr ist sein Vater ein pommerischer Erbhofbauer, hoch droben im Norden,<br />
bei Stralsund. Und das kleine Schwabenbüblein, das fröhliche Heinzelmännchen eines<br />
Christabends, wird bald die Heimat im schwäbischen Schlehenwinkel vergessen haben, und<br />
das kleine Plappermäulchen wird im ungewohnten Dialekt des pommerischen Landmanns<br />
sprechen lernen. Es kann sein, daß es vielleicht einmal später mit seinem Bruder<br />
hinüberwandern wird zur nahen Ostsee und dort einen Sommersonntag verträumt. dann wird<br />
25
vielleicht mit den Wellen des Meeres die Stimme seines Blutes singen und wird ihn mahnen<br />
an die Altvorderen weit drunten im deutschen Süden. Von der Moldau stammen sie her,<br />
diese Ahnen, und der Wandertrieb hat sie fortgelockt. Im Schwabenlande sind sie sesshaft<br />
geworden, des Heinzelmännchens Ahnen, die auch die meinen sind. Zuerst waren sie<br />
Lehensleute der mächtigen Klosterherren und hernach freie Bauern auf der schwäbischen<br />
Scholle. Des Heinzelmännchens Urahn hieß Salomo und war ein witziger, heller Kopf. Das<br />
wußte auch der Pfarrer vom Ort und er frug den Alten, ob er fleißig lese? "Oh ja", sagte der<br />
Greis spitzfindig. Was er denn lese? wollte der Pfarrer wissen. "Erbsen und Linsen, Herr<br />
Pfarrer,“ war die Antwort des Alten. Zwei Brüder hat der Salomo noch gehabt und der eine<br />
war mein Urahne, der im Elternhaus wohnte, bis da Haus bei dem schrecklichen Brand des<br />
Dorfes im Jahre 1881 eingeäschert wurde. Das alles weiß natürlich das Heinzelmännchen<br />
noch nicht, obgleich es ein wissbegieriges Mändle ist. Aber das weiß es, und davor hat es<br />
einen Heidenrespekt, daß die Herren dort drinnen in Stralsund alles wissen wollten, wie der<br />
Vater heißt und die Mutter, der Aehne, der erst gestorben ist und die Ahne, die soviel weint,<br />
weil nun das Heinzelmännchen und seine Geschwister so weit, weit fortziehen. Und noch<br />
<strong>von</strong> viel weiter zurück wollen die Herren wissen. Noch etwas aber ist, was man wohl<br />
beachten muß, nun zieht der Letzte seines Stammes fort, nach mehr als 600 Jahren erlischt<br />
dieser Zweig im Mannesstamm. Wohl gibt es im Dorfe noch mehr dieses Namens, aber die<br />
Hauptträger sind bis auf diesen letzten, den Vater vom Heinzelmännchen, tot. Warum der<br />
nun Haus und Hof verläßt und sich dort droben im Norden ansiedelt? Warum das<br />
Heinzelmännchen nun ein pommerischer Schulbub wird und kein schwäbischer? Warum<br />
nun schon das zweite, wohlvertraute Nachbarhaus leer und verödet wird? Weil der<br />
Blutstrom der Vorfahren erneut zu locken beginnt. Schwaben das heißt Sueven - die<br />
Schweifenden.- Also, viel Glück, kleines Heinzelmännchen in der neuen Heimat. Wenn nun<br />
die Mutter droben im Norden zu Weihnachten das schwäbische Hutzelbrot bäckt, dann wird<br />
sie die vielleicht einmal die Verslein zeigen und das lustige Bildchen, das ich <strong>von</strong> dir<br />
gemacht, <strong>von</strong> damals - dem Weihnachten im Schwabenland.<br />
Aber - wie eure Kamerädlein, die nun in der Mark herumspringen, sich an alles gewohnt<br />
haben, so wird es auch bei euch nicht fehlen. Wie es unseren Schwabenkindern in der<br />
Uckermark geht, wollt ihr wissen? Nun da<strong>von</strong> erzählen wir dann ein andermal.<br />
Die Mainlinie 1938<br />
Sie hat sehr lange in den Köpfen gespuckt, die Ansicht, daß der Main Alldeutschland in<br />
Nord und Süd trenne. Aber mehr als alle literarischen, kulturellen, ja sogar politischen<br />
Bestrebungen, die Zwecklosigkeit einer solchen Idee zu beweisen, haben die Siedler zu<br />
Wege gebracht. Die haben Haus und Hof und Heimat verlassen, und haben droben im<br />
Norden auf einem der großen Rittergüter eine neue gefunden. Da sind sie dann bunt<br />
zusammengewürfelt, Schwaben, Preußen, Mecklenburger, Pommern, kurzum aus allen<br />
Gauen Deutschlands. Da treiben sie am Morgen ihr Vieh auf die Weide, da schaffen sie im<br />
Heuet und in der Erntezeit, da ist die Kartoffel und Rübenernte, da ist der fröhliche<br />
Erntetanz, die Winterstille zur Weihnachtszeit, und da ist als stärkste Band die Liebe zum<br />
großen Vaterlande Man geht zum Viehmarkt wie in der schwäbischen Heimat, und wenn<br />
auch die Verständigung mitunter etwas schwieriger ist, ein Schwabe schwäbelt eben im<br />
deutschen Norden besonders flink, ein Handel wird immer ins Geleise kommen. Und wenn<br />
dann so ein märkischer oder Mecklenburger Erbhofbauer einmal im Winter in die alte<br />
Heimat kommt, dann freut er sich wohl an den altvertrauten Gesichtern und Geschichten,<br />
aber wieder hierher - nein, wider zurück möchte er nicht mehr.<br />
Vielleicht hat kein Bauer je ein schöneres Wort gefunden, wie jener Dorfgenosse, der auf<br />
einige Zeit bei seinem Siedlerbruder in der Uckermark gewesen war. Der sagte nämlich auf<br />
26
meine Frage, welches Gefühl er in der fremden Gegend als schollenverbundener Landmann<br />
gehabt habe? "Woascht" sagte er, "wenn oserois mit am Pflug durch da Boda fährt, no isch<br />
iberall Hoimat!" Darin steckt wohl die Kraft des Bauerntums, und dadurch die Fähigkeit<br />
besonders unserer schwäbischen Siedler. Weil aber die Herzen allenthalben im gleichen<br />
Takte schlagen, wenn ein Fest das ganze Volk vereint, so ist schon manches Gedicht, das in<br />
der "Selbsthilfe" erschien, und auch manche "Selbsthilfe" in den Norden gewandert. Als<br />
neulich gar die Siedlungsfeuerwehr ihr erstes Stiftungsfest beging, da wollten sie dort zum<br />
Vortrag ein eigenes verfertigtes Gedicht und dieses mag nachstehend dazu dienen, den<br />
letzten Zweifel der Mainlinie zu beseitigen:<br />
Zwar habe ich dieses Land noch nie gesehen, d<br />
as Havelland im fernen Norden.<br />
Doch weils den guten, alten Nachbar Heimat ist geworden,<br />
wurd mir vertraut der Kiefernwälder würzig Wehn.<br />
Zwar hört ich nie des klaren Flusses Rauschen,<br />
doch wachsen Schwabenkinder fröhlich dort heran.<br />
Die noch des Schwarzwalds Wiegenlied umfang,<br />
und jetzt mit den Silberwellen Grüße tauschen.<br />
Zwar sah ich nie des Roggenfeldes Breiten<br />
im Glanz der reifen Sommerwonne.<br />
Doch strahlt auch uns dieselbe Sonne,<br />
wenn Erntesegen liegt auf deutschen Weiten.<br />
Zwar weiß ich nicht, wie ihr dort Feste feiert,<br />
doch weiß ich, daß das Wunder allerorts geschah,<br />
daß man dich wieder ehrt, Mutter Germania,<br />
und daß das Band <strong>von</strong> Land zu Lande sich erneuert.<br />
Zwar weiß ich nicht, wer in den Häusern wohnet,<br />
und wie traulich sind gereiht,<br />
doch weiß ich, daß da Zeichen großer Zeit,<br />
das Kreuz als Siegesfahne drüber thronet!<br />
Und das weiß ich, der gute Gott beschützet<br />
die Fluren und die Häuser, hier wie dort<br />
und Einigkeit und Treue heißt der Hort,<br />
den auch die Siedlung in Mark besitzet.<br />
So mög sie blühen und gedeihn im Frieden.<br />
Wall bleib verschont <strong>von</strong> jedem,<br />
auch dem kleinsten Brand.<br />
Gott schütze unser liebes, schönes deutsches Land!<br />
Dies nehmt als Festtagsgruß vom deutschen Süden.<br />
27
Die alte Buche 1940<br />
Es war an einem der letzten Juliabende des Jahres 1914. Weit wogten die Ährenfelder um<br />
das Dorf, das im Kranz seiner fruchtschweren Obstbäume, im Glanz der scheidenden<br />
Abendsonne lag. Aus dem hohen Buchenwald, der südwärts Hügel anstieg bis zum<br />
Bergfried eines alten, halbverfallenem Schlösschens, trat eine kleine Gesellschaft froher, hell<br />
gekleideter Menschen.<br />
Die Sommergäste der Lindenwirtin waren es, die seit einigen Jahren die zahlreichen Stuben<br />
ihres geräumigen Hauses für die erholungsbedürftigen Stadtleute eingerichtet hatte.<br />
Wohlgemerkt, die Lindenwirtin war der Mittelpunkt der ganzen Angelegenheit, nicht der<br />
Lindenwirt, denn er war ein stiller Mann, der seine Felder bebaute und seinen Stall versah<br />
und wohl hin und da den Gästen in der Wirtstube einen "Schoppen" oder ein "Viertele"<br />
hinstellte. Im übrigen hatte die Lindenwirtin die Zügel in der Hand, sie war eine Frau aus<br />
den ff, und es war gut so!<br />
An jenem golddurchleuchteden Juliabend nun schritt die frohe Gesellschaft den sauberen<br />
Gassen des Dorfes zu, wo die "Linde" <strong>von</strong> zwei mächtigen Lindenbäumen flankiert, in ihrem<br />
rosenroten Kleide mit weißen Fensterläden prangte und die Frau Wirtin in frischen Wasch-<br />
kleid mit freundlichem Lächeln ihre Pflegebefohlenen unter der Türe begrüßte. "Wo isch<br />
denn der Erich?" rief sie, denn sie vermisste ihren Einzigen, den fröhlichen Tübinger<br />
Studenten. "Ach," sagte die Frau Ministerialrat, "Mein Heinz und der Herr Student haben<br />
sich noch im Walde verweilt, sie kerben ihre Namen ein." "Als ob das nicht noch vier<br />
Wochen Zeit hätte," sagte der Herr Ministerialrat stirnrunzelnd. Er hatte ein etwas heftiges<br />
Wesen und geriet gleich in Erregung. Deshalb hob seine Frau beschwichtigend die Hand und<br />
der Fabrikbesitzer Neumann nahm den Faden des politischen Gespräches wieder auf, das die<br />
Herren zuvor geführt hatten.<br />
Inzwischen bekam die Frau Neumann <strong>von</strong> ihrer unverheirateten Schwester, dem Fräulein<br />
Antonie Holderied eine sanfte Belehrung, daß nun richtig die Susi, das 16jährige Töchterlein<br />
der Neumanns auch mit den beiden jungen Leuten zurückgeblieben war. Doch Frau<br />
Neumann beruhigte sie dahin, daß auch die Kinder der zwei anderen Familien dabei seien.<br />
Außerdem war es noch 1/4 Stunde bis zum Abendessen, das gemeinsam im Saale der Linde<br />
eingenommen wurde. Inzwischen waren die Jungen und Mädels noch frisch und munter um<br />
die Burg herumgestrichen. Die fünf Jüngsten hatten nochmals einen kühnen Sturmangriff<br />
auf die unsichtbaren Verteidiger der Burg unternommen und kurzerhand den 18jährigen<br />
Heinz zum Feldherrn erkoren. Der Student Erich aber kerbte mit sicherer Hand in die glatte<br />
Buche des Bergfrieds den Namen Susanne Neumanns ein, die unterdessen feingefiederte<br />
Farnkräuter zusammen suchte, die im kühlen Waldesschatten wuchsen.<br />
Nun trat sie wieder zu dem jungen Mann, der einige Schritte weggetreten war und prüfend<br />
sein Werk übersah. "Aber, Herr Erich, welche Dummheit," rief sie, und eine helle Röte<br />
schoss ihr ins Gesicht, denn statt den Anfangsbuchstaben ihres Namens, die sie erwartet<br />
hatte, grüßte sie ein kunstvolles "Susi" vom glatten Stamm und darüber ein <strong>von</strong> einem Pfeil<br />
durchbohrtes Herz, aus dem einige Tropfen rieselten. Es war eigentlich ein kleines<br />
Kunstwerk, das Ganze. Erichs Ahn war ein kunstvoller Holzschnitzer gewesen. Der Enkel<br />
schien, trotz seiner beginnenden Gelehrsamkeit, die Handfertigkeit nicht verlernt zu haben.<br />
Erich sollte aber jeglicher Antwort erspart bleiben, denn aus dem Gebüsch brach Heinz<br />
Imhof, gefolgt <strong>von</strong> der johlenden Schar der kühnen Burgeroberer. "Himmel, das ist eine<br />
Bande," rief er, den Schweiß <strong>von</strong> der Stirne wischend. "Rein aus den Fugen bin ich geraten."<br />
Die beiden Schwestern Sybille und Brigitte hingen sofort bei Susanne ein und die Buben<br />
liefen zwischen den jungen Männern hin und her. So kam es denn zu keiner<br />
Auseinandersetzung mehr wegen des kleinen Kunstwerkes am Stamm der alten Buche. In<br />
großer Harmonie traten die Jungen wie vorher ihre Eltern, den Heimweg in die "Linde" an.<br />
28
Zwei Tage später, es war am Samstag, begann der Amtsdiener des Dorfes seinen<br />
Ausschellweg mit seltsam verschlossenem Gesicht. Die Herren Sommerfrischler hatten<br />
schon etliche fernmündliche Anrufe erhalten. Es herrschte eine große Unruhe in dem kleinen<br />
Kreis. Selbst die Kinder waren da<strong>von</strong> angesteckt. Die Frau Ministerialrat begann die Koffer<br />
zu packen und auch die beiden sächsischen Familien sprachen <strong>von</strong> der Abreise. Das<br />
fröhliche Gesicht der Frau Lindenwirtin trug einen erschrockenen Ausdruck und sogar ihr<br />
Mann schien seinen gewohnten Gleichmut zu verlieren.<br />
An jenem Samstagabend, dem 1. August 1914 nun, brach die Schicksalsstunde der ganzen<br />
Welt herein. Der alte Amtsdiener schien wie der Herold einer gewaltigen Macht, als er mit<br />
brüchiger Stimme verkündete: Der Kriegszustand ist erklärt, der erste Mobilmachungstag ist<br />
der 2. August.....<br />
Niemand, der diese Tage miterlebt hat, wird je die Macht der Stunden vergessen, die über<br />
die Heimat hinbrausten in jenen Augustwochen. Bereits am Sonntag fuhren die Reservisten<br />
zusammen mit den sächsischen Familien zur Bahn. Und während die Sensen in den<br />
wogenden Ährenfeldern zu blinken begannen, rückten die grauen Heere im Westen und<br />
Osten vor. Feind um Feind sah sich Deutschland gegenübergestellt.<br />
Der Herr Fabrikant Neumann war sofort in die Landeshauptstadt abgereist, er war<br />
Oberleutnant bei der Landwehr, und hatte sich zu stellen. Seine Frau hatte ihn begleitet.<br />
Aber Fräulein Holderied zur Betreuung des Backfischleins Susi zurückgelassen. Doch diese<br />
hatte keine Betreuung nötig, sie hatte bei der Lindenwirtin alle Hände voll zu tun. Bereits<br />
hatte das Rote Kreuz die ersten Sammlungen eingeleitet. Nun kochte die Lindenwirtin den<br />
halben Tag mit Susi für dieses Pflaumen ein, während Fräulein Holderied an der<br />
Nähmaschine saß und Bettücher nähte, aus dem gewaltigen Leinenvorrat der Frau<br />
Lindenwirtin. Erich und Heinz aber hatten sich ganz in den Dienst der Landwirtschaft<br />
gestellt und saßen abends wortkarg und braungebrannt am Tisch. Die ganze fröhliche Idylle<br />
der ländlichen Sommerfrische war jäh vernichtet. Klar tönte vom Westen herüber<br />
Kanondonner durch das sommerliche Land.<br />
Schon kamen die ersten Kriegsnachrichten vom Westen, kam die Botschaft des<br />
Russeneinfalls im Osten; da war eines Morgens der Student Erich verschwunden. Die Frau<br />
Lindenwirtin sorgte sich, als der Abend hereinbrach und der Sohn nicht da war. Da, gegen 9<br />
Uhr Abends, kam ein Telegramm an Fräulein Holderied: "Erich wohlbehalten angelangt, hat<br />
sich freiwillig gestellt. Später mehr. Mina." Das war die Frau Fabrikant Neumann, die die<br />
erste Sorge <strong>von</strong> der "Linde" nahm. Die Frau Lindenwirtin war sehr bleich geworden, aber<br />
entgegen ihrer Art sagte sie kein Wort. Sie nahm nur Susanne in den Arm, welche wie<br />
versteinert dastand und flüsterte ihr ins Ohr: "Der liebe Gott wird ihn behüten, wir wollen<br />
ihn bitten." Da schossen dem Mädchen die Tränen in die Augen. Von der Stunde an hatte sie<br />
ein Geheimnis mit der Frau, und war sich doch selbst nicht klar, was es war. Der August<br />
ging zu Ende, als Erich noch einmal in feldgrauer Uniform in die heimatliche "Linde" kam.<br />
Es waren nur wenige Stunden noch und es sollten die letzten sein. Bereits im Oktober, als<br />
die Linde ihre goldenen Blätter verlor, kam die Nachricht vom Heldentod Erichs. Der tapfere<br />
Kriegsfreiwillige war beim Sturmangriff in den Argonnen gefallen, nachdem er zwei Tage<br />
zuvor das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhalten hatte. Es war das erste Saatkorn aus dem Dorfe<br />
im Feindesland geworden.<br />
Als Susanne diese Nachricht erhielt, sie war längst wieder in der großen Stadt, da fielen ihr<br />
plötzlich jene Stunden ein bei der alten Buche. Es war zwischen den jungen Menschen keine<br />
Erklärung gefallen. Aber Susi fühlte plötzlich, daß Erich mit der Hellsichtigkeit der vom<br />
frühen Tod gezeichneten ihr und sein Schicksal vorausgesehen und deshalb jene Rune in den<br />
alten Stamm geritzt hatte. Nun wußte sie mit dem Feingefühl der deutschen Seele, daß sie<br />
eingereiht war in die Kette derer, die Leid und Stolz zugleich tragen sollten um die toten<br />
29
Helden. Sie wußte, wenn sie wieder einmal in das stille Dorf kommen sollte, jene alte Buche<br />
ihr ein Heiligtum sein würde, für immer....<br />
Zwanzig Jahre sind seitdem verstrichen. Susanne geht den tapferen Weg einsam gebliebener<br />
Frauen. Die "Linde" ist verkauft, nachdem die beiden Eltern kurz vor Kriegsende<br />
nacheinander an der bösen Grippe <strong>von</strong> 1918 starben. Die alte Buche aber steht immer noch.<br />
Und ihre Zweige wissen das Geheimnis, sie erzählt es wohl einem einsamen Wanderer. Aber<br />
der muß ein Sonntagskind sein.......<br />
Nach der Heimat möcht ich wieder 1941<br />
Der junge Feldgraue, der da auf dem kleinen Bahnhof dem entschwindenden Zug nachsah,<br />
hatte nicht nur sein Soldatengepäck bei sich, sonder - sorgfältig verpackt - seine<br />
Hohnerhandharmonika.<br />
Als sie in jenen Maitagen über den Rhein marschierten, hatte er versucht, die treue Gefährtin<br />
der langen Wintermonate in Böhmen noch nach Hause zu schicken. Doch der Major -<br />
höchstpersönlich - hatte die Versicherung für das wertvolle Instrument übernommen, und so<br />
zog es, bei der Feldküche verstaut, tief nach Frankreich hinein.<br />
Jetzt aber strömten die Leute <strong>von</strong> den nahen Feldern herein und es fanden sich hilfreiche<br />
Hände, die das Gepäck zusammenfassten, und es, samt seinem Besitzer, im Triumph nach<br />
Hause brachten. Dort bereiteten ihm Frau und Kinder nach dem ersten fassungslosen<br />
Staunen einen jubelnden Empfang. Nach dem Abendessen, die Kinder waren schon zu Bett<br />
gebracht und die Hausfrau hantierte noch in der Küche, kam der Bruder. Vorsichtig lugte er<br />
zur Tür herein, da fand er den Heimhehrer im Lehnstuhl eingeschlafen. Leise stimmte er vor<br />
der Tür die geliebte Geige, die er zum Willkommgruß mitgebracht hatte und weich und zart<br />
klang es zu dem Schläfer: "Nach der Heimat möcht ich wieder, nach dem teuren Vaterort."<br />
Der war in seinen Träumen weit in Frankreich drinnen, er brauchte erst eine Weile, sich<br />
zurechtzufinden, dann stieß er die Türe auf und die Brüder lagen sich im Arm. Die junge<br />
Frau hat mir`s selbst erzählt, lange nach Mitternacht erst haben die Zwei sich <strong>von</strong> ihren<br />
Instrumenten getrennt. Lied um Lied haben sie zusammen gespielt, wie immer am Sonntag,<br />
in froher Friedenszeit.<br />
Und wie war er zu Ehren gekommen, in Frankreich, wenn Rast und Ruhe war, nach dem<br />
Waffenstillstand. Wo irgend es möglich war, scharten sich Offiziere und Mannschaft um den<br />
jungen Spielmann. Gerade in der Zeit des Tages <strong>von</strong> Compiere waren sie in einem Dorf mit<br />
einer schönen Kirche. Da trat erst zaghaft, dann entschlossen ein, stimmte die Bässe seiner<br />
Ziehorgel, die beiden andern fingen an zu singen: "Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund<br />
und Händen." Andere Kameraden kamen dazu. Sie fingen noch einmal vorn an, dann kamen<br />
auch Offiziere und schließlich tönte durch die französische Kirchenhalle, unvergessen aus<br />
Kindertagen, die schönen, gewaltigen Kirchengesänge: "Großer Gott, wir loben dich," "Eine<br />
feste Burg ist unser Gott" und "Lobet den Herrn." Es fand sich auch ein Geistlicher, der im<br />
Heere diente, der zu diesem improvisierten Gottesdienst ein paar Worte des Dankes für den<br />
Sieg sprach.<br />
Die Dorfbewohner haben nicht schlecht gestaunt über das Verhalten der deutschen Barbaren.<br />
Aber der junge Spielmann hat sich herzlich gefreut, daß ein einziges frommes Lied ihm und<br />
den Kameraden zu einer Feierstunde verhalf. Nun ist er wieder hinausgezogen, obwohl ihn<br />
sein fünfjähriger Sohn bat, dazubleiben, "daß er später auch noch was zu tun habe." Aber<br />
Arbeit wird er schon noch bekommen. Wenn auch anderer Art als das Kriegshandwerk des<br />
Vaters. Und hoffentlich in recht langen und gesegneten Friedensjahren.<br />
30
Albumblicke 1941<br />
Die freundliche Gastgeberin ließ mit raschem Griff die Vorhänge herab. Der graue<br />
Wintertag war ausgesperrt, und das warme Licht einer Leselampe hüllte den großen Raum in<br />
Behaglichkeit. Dem breiten Bücherschrank, der die ganze Seite des Doppelfensters einnahm,<br />
entnahm sie mit raschem Griff zwei große Alben und legte sie vor uns hin: "Jetzt sind sie<br />
aus ihrer Verborgenheit wieder zu Ehren gekommen," sagte sie mit leichtem Lächeln.<br />
Ich schlage eines auf: Daressalam 1913, steht zu Anfang. Dann fällt eine Speisekarte heraus,<br />
ein Festessen anlässlich der Äquatortaufe auf dem Passagierdampfer der Wörmannlinie.<br />
Eine vornehm gehaltene Einladungskarte des kaiserlichen Gouverneurs <strong>von</strong> Daressalam<br />
enthüllt die ganze Sorglosigkeit der Vorkriegszeit, und dann Bilder und Postkarten.<br />
Aufnahmen <strong>von</strong> Negersiedlungen und vornehmen Villen der Europäer. Schwarze<br />
Schuljugend mit den Missionaren und schneidige Offiziere der Schutztruppe. Seltsame<br />
Tropengewächse, und eine Mondnacht am Meer. Wie ein "Sesam öffne dich" läßt die<br />
Erzählerin ihre Erinnerungen hervorsprudeln. "Wir bekommen es wieder, dieses herrliche<br />
Land, wir bekommen es sicher wieder, „ sagt sie zuversichtlich.<br />
Nun folgt das zweite Album. Ein Abgrund scheint dazwischen zu gähnen, doch es ist<br />
derselbe Mensch, der in ihm Erinnerungen aufgestapelt sieht: Grodno, Kriegsjahr 1915.<br />
Hohenstein, der Marktplatz, angefüllt mit Bahren <strong>von</strong> Verwundeten und Sterbenden.<br />
Einsame Grabhügel mit einem Holzkreuz und dem Stahlhelm. Eine stille Nonne mit<br />
weltentrücktem Gesichtsausdruck steht zwischen den tiefverschneiten Hügeln eines<br />
Friedhofs. Bilder <strong>von</strong> Offizieren mit feinen und klugen Gesichtern, neben manchem ist ein<br />
Kreuz gezeichnet. Da fällt ein Bogen heraus. Unwillkürlich klingt ein Lachen auf: Der Rote<br />
Kreuzschwester Anni Link wird bestätigt, daß sie entlaust ist, mit keinerlei ansteckenden<br />
Krankheit behaftet und daher berechtigt ist, in sämtlichen Militärzügen in Abteilen zweiter<br />
Klasse zu fahren. "War das nötig?" fragen wir. "Ja, das war sehr nötig, „ bestätigte die<br />
Erzählerin, "dafür waren wir ja auch in Polen."<br />
Und nun, ein Laut der Überraschung. Das war doch? Ja wahrhaftig, es ist eine echte<br />
Aufnahme des unseligen russischen Kaiserpaares und seiner schöner Töchter. "Sehen Sie,<br />
das kam so: Vielleicht 14 Tage ehe unsere Truppen Grodno besetzten, weilte das Kaiserpaar<br />
dort zu Besuch und kam auch in das Lazarett, in welchem ich nachher tätig war, dort konnte<br />
man noch solche Karten haben, da noch russische Ärzte und Pfleger da waren, mit denen wir<br />
uns rasch verständigten und in die Arbeit teilten." Einige Aufnahmen aus dem OP bestätigen<br />
dies.<br />
Lange aber weilten die Blicke auf den anmutigen Töchtern des Kaiserpaares. Einer der<br />
Augenzeugen <strong>von</strong> Jektarinenburg, der später nach Deutschland kam, hat das verlassene<br />
Bergwerk gesehen, das ihre entseelten Leiber aufnahm. "Sic transit gloria mundi," sagte<br />
jener Mann am Schluß seiner Erzählung.<br />
Weiter wenden wir Blatt um Blatt. Bilder folgen vom westlichen Kriegsschauplatz. Immer<br />
wiederkehrend, ein fröhliches, junges Gesicht, ein Leutnant der Olga-Grenadiere, der später<br />
an der Spitze seiner Kompanie in den Argonnen fiel.<br />
Jetzt ein junger Generalstäbler mit seinem seidenhaarigen Wachtelhund, der ihn während des<br />
ganzen Krieges begleitete und auf allen Bildern dabei ist. Eine Zeit, schon durch ein<br />
Vierteljahrhundert vom Heute getrennt, läßt die Erzählerin aufleben. Und ihre Augen<br />
leuchten auf, als sie schließt, so waren sie damals, so sind sie heute wieder.<br />
Die kleine Pendüle verkündet die sechste Stunde, als wir uns verabschieden und die wenigen<br />
Schritte dem Heimathaus zuwandern, nicht ohne herzlichen Dank an die Herrin des Hauses.<br />
Es war ein Griff in verborgene Fächer, in die geheimen Schatzkästlein der Erinnerung. Kann<br />
nicht gerade unsere Zeit diesen Hort an Lebenserfahrung und Lebensbewährung wieder<br />
hervorholen?<br />
31
Einkehr 1941<br />
Als Napoleon Bonaparte, der große Korse und Gegenspieler Englands, auf der Höhe seines<br />
Ruhmes stand, schrieb ihm einer seiner Generale in das, in der damaligen Zeit übliche<br />
Stammbuch, einen Vers des größten deutschen Dichters Wolfgang <strong>von</strong> Goethe:<br />
"Der Mensch erlebt, er sei auch, wer er mag, ein letztes Glück und einen letzten Tag!"<br />
Es ist nicht geschichtlich erwiesen, doch die Legende behauptet, Napoleon habe in seinen<br />
letzten Lebensstunden noch dieses Wort vor sich hingeflüstert. War es ihm ein Trost oder<br />
eine Mahnung? Wer kann die Tiefen einer menschlichen Seele ergründen?<br />
Schon oft und oft haben wir gehört und gelesen, daß wir in einer Zeit <strong>von</strong> ungeheuren,<br />
geschichtlichen Ausmaßen leben. Ganz bestimmt werden erst künftige Geschlechter die<br />
großen Zusammenhänge der letzten Jahre und Jahrzehnte recht erfassen können. Für uns<br />
aber, die heute Lebenden, läßt der Alltag mit seinen großen und kleinen Sorgen und Nöten,<br />
mit Verpflichtungen und Aufgaben mitunter wenig Zeit zur Einkehr und Selbstbesinnung.<br />
Und doch, wenn wir in diesen zweiten Kriegswinter hineingehen, fühlen wir, daß ungeachtet<br />
der sicheren Leitung, ungeachtet der großen Einsatzbereitschaft jedes einzelnen Kämpfers,<br />
unser eigenes kleines Schicksal für uns und unsere Umgebung eine gewisse Tapferkeit<br />
erfordert. Vielleicht ist dies der tiefste und echteste Sinn der Volksgemeinschaft.<br />
Gerade der Vorwinter mit seinen Nebeltagen, mit seinen rauen Stürmen und mancherlei<br />
Krankheitserscheinungen, stellt dem Menschen die Hinfälligkeit seines eigenen Seins<br />
deutlich vor Augen. Da wandert man an einem stillen Sonntag durch den Friedhof an ein<br />
liebes Grab. Man liest da und dort einen bekannten Namen. Ist`s möglich, schon so viele<br />
Jahre ist hier sein letztes Plätzchen? Oder - da und dort steht auf einem Stein zu lesen: "Fern<br />
der Heimat ruht".... Da fliegen die Gedanken über die Marken des Vaterlandes hinaus zu den<br />
Soldatenfriedhöfen in Ost und West, in Süd und Nord: "Darunter liegt blühende Jugend,<br />
darunter liegt reife Kraft, darunter liegt Deutschlands heilige Heldenschaft."<br />
All die gewaltige Größe der geschichtlichen Wende und all das winzigkleine<br />
Menschenschicksal unseres eigenen Lebens, es liegt letztlich in der Hand des ewigen<br />
Weltenlenkers, den wir Gott-Vater nennen dürfen:<br />
Der Einkehr stille Stunde macht ruhig des Herzens Schlag,<br />
bringt sie zugleich die Kunde vom letzten Glück und Tag.<br />
Einst schien der Himmel offen, die Welt in Blüten stand,<br />
ein Leid hat dich getroffen, das keinen Tröster fand.<br />
Dem Andern ging es besser, es war sein Glück ihm hold,<br />
dich traf des Schicksals Messer, du kamst um deinen Sold.<br />
Doch längst vom Leid genesen fühlst du des Ew`gen Spur,<br />
es ist ein Traum gewesen, ein arger, böser nur.<br />
Dem Andern mag frommen, was ihn nur freuen mag,<br />
doch Jeglichem wird kommen: das letzte Glück, der letzte Tag.<br />
Es bleibt ein lichter Schimmer auch in der trüben Zeit<br />
dahinter steht doch immer: Die große Ewigkeit!<br />
32
Kameraden 1941<br />
Vor dem abendlichen Sammelpunkt des dörflichen Lebens, der Sammelstelle der<br />
Milchverwertungsgenossenschaft, kurzweg die Molkerei genannt, stehen größere und<br />
kleinere Gruppen plaudernder Menschen beisammen. Dazwischen rattern die kleinen<br />
zweiräderigen Milchkarren der alten und jüngsten Ablieferer, die ohne ein Verweilen wieder<br />
heimwärts kehren. Für die Jugend selbst bedeutet ja dies Geschäft den fröhlichen Ausklang<br />
zum Feierabend. Da sitzen sie auch zum Teil auf dem Geländer, das die Straße gegen den<br />
Dorfbach abschließt. Gut und klar grüßen die Sterne der Frühlingsnacht hernieder. Drin in<br />
dem weißgekachelten Raum herrscht blitzende Helle, so daß sich das Auge erst an das<br />
Dämmerlicht draußen gewöhnen muß. Deshalb fährt auch der junge Unteroffizier etwas<br />
verblüfft herum, als sich eine Hand grüßend auf seine Schulter legt: "Auch wieder daheim,<br />
alter Junge?" "Jawohl, drei Wochen Heimaturlaub hat`s gegeben, weil der zu Weihnachten<br />
ausgefallen ist." Nun ist man bald vier Jahre Soldat, wie einst der große Bruder im<br />
Weltkrieg. In Polen ist man gewesen, in Frankreich, zuletzt an der Silberküste. Deshalb<br />
sticht auch das braungebrannte Gesicht so seltsam <strong>von</strong> dem Blondhaar ab. Und jetzt? – Je<br />
nun, das mögen die Götter wissen. Vielleicht bleibt man ein Weilchen in Deutschland, oder<br />
kommt man auf den Balkan. Ein rechter Soldat ist man geworden, dort daheim, wo einen das<br />
Schicksal hinweht.<br />
Und dann, plötzlich die Frage: "Ja gelt, der Ludwig? Sie haben mir`s geschrieben."<br />
Wenn die Soldaten <strong>von</strong> ihren toten Kameraden sprechen, geschieht das zögernd und<br />
ungelenk. Es brennt da irgend etwas und tut weh, was man als Mann nicht sagen kann und<br />
will. Und diese Frage gilt dem Gefährten ein paar fröhlicher Ferientage in dem stillen Dorf.<br />
Die beiden Nestküken, der Bauernbub und der Großstädter, verloren sich bald wieder aus<br />
den Augen. Nur die gemeinsamen Verwandten waren ein Bindeglied und so haben sie`s ihm<br />
an die Silberküste geschrieben, daß auf dem alten Fangelsbachfriedhof ein neues<br />
Soldatengrab liegt, auf dem zur Weihnachtszeit schon ein Tannenbäumlein stand.<br />
"Ach, „ sagt die ernste junge Stimme "und das Leben ist doch so schön. Und der Frühling<br />
kommt, der Frühling....." Was sollen die da sagen, die Älteren, deren Jugend der Weltkrieg<br />
verschlungen hat, und viel junges, lachendes, blühendes Leben dazu? Daß man das braucht,<br />
dies größte und heiligste Opfer todbereiten Menschentums. Ach nein, das wissen sie ja alle<br />
selbst und handeln danach.<br />
Noch ein Gruß und allein gehe ich heim durch die stillen Straßen. Weich und lind weht der<br />
Wind vom nahen Walde. Irgendwo klingt ein Lied auf: Antje, Antje hörst du nicht <strong>von</strong><br />
Ferne. Wie lauschend stehen die Bäume am Weg. Tragen sie nicht ein Grüßen weit hinein in<br />
die Lande, vom Kommenden und Gehenden, <strong>von</strong> Zeit und Ewigkeit:<br />
Du, der fallend siegte, du, der sterbend sank,<br />
eure Opfer segnend sagt mein Herz euch Dank.<br />
Die ihr - treu der Heimat euer Blut geweiht,<br />
tapfere Kameraden aus der Jugendzeit.<br />
33
Der Kriegsjunge 1941<br />
Es war ein schneereicher Wintertag des Kriegsjahres 1916, als er zum ersten mal in der<br />
buntbemalten Wiege strampelte, in den Generationen vor ihm die ersten Lebenswochen<br />
durchschliefen und durchschrien. Er war das Nestküken und Mutters ganzer Stolz. Der große<br />
Bruder, der damals schon den feldgrauen Rock trug, prophezeite ihm, daß er bestimmt<br />
einmal ein guter Soldat würde, sogar Unteroffizier, er habe schon die Stimme dazu. Wir<br />
haben alle gelacht ob dieser Prophezeiung, aber es ist schon so gekommen, nur hat es die<br />
Mutter nicht mehr erlebt.....<br />
Wieder ist es ein schneereicher Wintertag, wieder ist Krieg und die Glocken des<br />
Jahresabends läuten ihren kurzen, eindringlichen Gruß. Aus den zahlreichen Urlaubern, die<br />
die Dorfstraße beleben, tritt einer hervor, die Hacken klappen zusammen und eine Hand<br />
streckt sich ganz unmilitärisch entgegen: "Grüß Gott!"<br />
Ja, es ist noch dasselbe frische Jungengesicht <strong>von</strong> einst. Nur liegt ein Zug <strong>von</strong><br />
unauslöschlichem Ernst in den jungen Augen. Die 18 Tage Polenfeldzug, <strong>von</strong> Königsberg<br />
her begonnen, haben die erste Feuertaufe gebracht und die silbernen Litzen am Kragen.<br />
Einmal nur gab`s dann einen kurzen Heimaturlaub. Und jetzt erst kann er wieder einmal<br />
"daheim sein“, daheim beim alten Vater, bei der mütterlichen Schwester und bei des Bruders<br />
Familie, der nun wieder als Landser im Westen steht.<br />
Wie es denn gewesen sei, damals in Polen? Gewehrt hätten sie sich schon, die Kerle. "Ja,<br />
und unsere deutschen Brüder?" Ein Leuchten fliegt über das ernste Gesicht, geweint hätten<br />
alle vor Freude. "Ja, und das Land?" Die ehemals deutschen Gebiete, die neuen Reichsgaue,<br />
seien eben wie alles deutsche Land. Aber die Polen, die lebten gar arm, die kleinen Bauern,<br />
in der Nähe <strong>von</strong> Warschau. "Ja, und sonst?" Man könne das nicht so sagen, es sei tief da<br />
drinnen, alles, das Frohe und das Traurige, der Sieg und das Bild der toten Kameraden. Man<br />
wisse nur eines: "Deutschland!"<br />
Der da mit uns sprach im letzten Sonnenglanz des scheidenden Jahres, war nicht mehr der<br />
sorglose Gymnasiast <strong>von</strong> einst, war auch nicht mehr der junge Angestellte des großen<br />
Handelshauses, er war ein Frontkämpfer, wie die vom großen Krieg und er wird es sein - bis<br />
zum "guten Ende." Der Kriegsjunge <strong>von</strong> einst - ein Frontsoldat <strong>von</strong> heute. Und mit ihm noch<br />
viele Tausende. Bald ist der Urlaub wieder abgelaufen, dann geht es wieder hinaus.<br />
Irgendwo gilt es Wache zu halten. Wo? Das sagt uns heute keiner mehr. Aber sie sind da, in<br />
Treue, wie die vor 25 Jahren.....<br />
Sorglos schlummern wieder kleine Kriegsjungen in ihren Wiegen.<br />
Feldpostbriefe einst und heute! 1941<br />
Da liegen sie vor uns, ein wenig vergilbt an den Rändern, die Feldpostkarten und Briefe aus<br />
den Jahren 1914-18. Im Unterschied zu den heutigen hat der Absender, pünktlich ausgefüllt,<br />
Armeekorps, Division, Regiment und Kompanie hingeschrieben. Heute haben wir uns schon<br />
die fünfstelligen Zahlen gemerkt, wie die Fernsprechnummer unserer Geschäfte, falls es<br />
nicht über die "Deutsche Dienstpost" im Osten geht.<br />
Der 2. Mai 1915 steht auf einer Karte mit fein gestochenen Schriftzügen. der Schreiber war<br />
Landwehrmann in einem schwäbischen Regiment am Hartmannsweilerkopf, dem<br />
heißumkämpften Berg in den Vogesen. Es mutet uns heute seltsam an, wenn er in<br />
nachstehenden Reimen seine Gedanken niederlegt: "Melde gehorsamst, bin noch gesund,<br />
Dank dafür Gott <strong>von</strong> Herzensgrund. So nehmt, meine Lieben, dies Kärtchen hin, als<br />
Zeichen, daß ich am Leben bin. - Ich hab schon oft an Euch gedacht, auch wenn ich Posten<br />
stand in einsamer Nacht. Wenn so die Stern am Himmel da stehn so bitt ich, sie möchten<br />
erhören mein Flehn. - Schaut auf die Sterne, sie wünschen Euch Glück, sie tragen die Grüße<br />
<strong>von</strong> uns Euch zurück, sie helfen knüpfen ein inniges Band, mit uns, den Kriegern im<br />
34
Elsaßland."<br />
Schon früher findet sich eine Kriegsspeisekarte vom selben Schreiber. Die "englische<br />
Lügenbrühe", "deutschgezwiebelte Engländer mit gedämpftem französischen Siegeskohl",<br />
sowie der "französische Kriegsaufschnitt" muten ganz zeitgemäß an. Weiter sind da Karten<br />
mit Ansichten aus dem heute neutralen Belgien, mit Gent, Brügge und sofort. Karten aus<br />
Grodno im Osten und einer besonders ergreifenden: ein zerschossenes Kruzifix, an dem nur<br />
die Gestalt des Gekreuzigten unversehrt blieb, die nun, wie mit jammernd ausgebreiteten<br />
Armen, auf dem hohen Sockel in die zerschossene Gegend ragt. All diese Grüße, sorgfältig<br />
verwahrt, nun werden sie wieder hervorgeholt: Seht ihr Jungen, so war es damals, als eure<br />
Großväter und Väter vier Jahre lang vor dem Feinde standen.<br />
Und dann holen wir die andern, die <strong>von</strong> gestern und <strong>von</strong> heute. Schon die Schriftzüge sind<br />
anders, freier gelöster. Aber auch in ihnen spiegelt sich eine Zeit wieder. Und eines ist gleich<br />
geblieben: die Liebe zur Heimat und die Treue zum Vaterland. Da schreibt ein Gefreiter der<br />
Panzerschützen, dessen Vater an der Somme blieb: "Hier oben, bei den verlausten Polen,<br />
habe ich erst gemerkt, wie lieb ich meine Heimat hab, nun werde ich sie schützen, mehr<br />
denn je." Da schreibt ein Soldat aus dem Westwallbunker seiner verwitweten Mutter, die<br />
vier Söhne draußen hat: "Liebe Mutter, laß den drei Enkeln nichts abgehen, wenns auch<br />
Krieg ist. Und gönne auch dir etwas extra Gutes, ich leg dir einen Schein dazu bei." (Es<br />
waren 5 Mark seiner Löhnung)<br />
Da sind Karten aus dem Protektorat mit wundervollen Bauten auf ragenden Bergen.<br />
Ungleich sorgloser klingen diese Grüße als die eines tapferen, blauen Jungen, der auf einer<br />
Vorpostenflottille seinen treuen, aber nicht gefahrlosen Dienst tut. "Wie freu ich mich, „<br />
schreibt er, "daß auch meine einstige Lehrerin an mich denkt, an ihren Schüler, der jederzeit<br />
bereit ist, sich voll und ganz einzusetzen, bis uns den Sieg niemand mehr entreißen kann.<br />
Dabei bewegen uns freilich allerlei Gedanken, draußen auf hoher See, denn wir wissen, daß<br />
es auf jeden <strong>von</strong> uns ankommt." Wem käme beim lesen solcher Zeilen nicht das alte<br />
Kriegslied in den Sinn: "Knaben wurden Helden, eisern war die Zeit!"<br />
Feldpostgrüße einst und jetzt. Wieviel Sorge und Mühe, wieviel Liebe und Dankbarkeit ist<br />
in sie eingeschlossen. Was der laute, sorglose Alltag der Friedensjahre nicht zu Worte<br />
kommen ließ, draußen, auf wogender See, auf einsamer Wacht in verschneitem Gelände,<br />
kommt es aus der Tiefe des Herzens: "Leben ist Opfer und Tat!" Und Altmeister Goethe<br />
mag diese Betrachtung schließen: "Nur der verdient die Freiheit und das Leben, der täglich<br />
sie erobern muß!"<br />
Versunkene Glocken 1947<br />
Unter der oft verwirrenden Fülle <strong>von</strong> Geschehnissen und Meinungen, die heute die<br />
deutschen Zeitungen für ihre Leser bringen, war es eine unscheinbare Nachricht, die wie ein<br />
ferner Glockenton aus Vineta kam, jener rätselhaften Stadt im Norden, welche die Sturmflut<br />
der See jäh verschlungen haben soll. Das war die Mitteilung, daß bei Aufräumungsarbeiten<br />
an der Stuttgarter Stiftskirche das berühmte "Silberglöckle" unversehrt geborgen werden<br />
konnte. Das Silberglöckle, <strong>von</strong> dem Karl Gerok so traulich-schlicht erzählte:<br />
"Vom Turme schlägt es Mitternacht, das Kindlein ist vom Schlaf erwacht,<br />
zwölf mächtige Schläge sind summend verhallt. Da horch! das silberne Glöcklein<br />
erschallt. Es jammert so schrill und wimmert so fein, als ob ein Kind um die Mutter<br />
wein'. Ach Mutter, ach Mutter, es wird mir so bang, das silberne Glöcklein, es läutet so<br />
lang. Schlaf ruhig, drück dich ins Kissen, mein Kind. Das silberne Glöcklein verhallt ja<br />
geschwind. Und kämm ich dir morgen die Löcklein, erzähl ich vom silbernen Glöcklein.<br />
Und dann erfahren wir, daß die wohltätige Burgherrin der Weißenburg am Palmtag 1348<br />
<strong>von</strong> dem gewohnten Gang zur Kreuzkapelle (spätere Stiftskirche) nicht mehr heimkehrte.<br />
35
Drei Wochen lang suchte die verzweifelte Tochter mit dem Burggesinde die ganze<br />
Umgebung Stuttgarts ab, ohne nur die geringste Spur zu finden. Darauf ließ sie alles<br />
Silbergeschirr zusammentragen und zum Glockengießer bringen. Die daraus gegossene<br />
Glocke ließ allnächtlich, <strong>von</strong> der Hand der treuen Tochter gezogen, ihr silbernes Stimmlein<br />
weit über Stuttgarts Höhen erschallen. Nach ihrem Tode wurde es <strong>von</strong> den Angehörigen der<br />
Heilig-Kreuz -Kapelle übergeben, die die Tradition getreulich fortsetzte.<br />
Noch einmal, um 1567, zog Prinzeß Sibyll Elisabeth, <strong>von</strong> Denkendorf kommend, durch die<br />
dunkle Herbstnacht stadtwärts. In dem weiten Wäldermeer hatte sie bald die Richtung<br />
verloren, und auch die begleitende Kammerfrau fasste das Grauen, als dazu die Wölfe in der<br />
Ferne zu heulen begannen. Da horch, da horcht herauf vom Tal das silberne Glöcklein<br />
klinget zumal. Es klingt so hell durch Nacht und Sturm herüber vom Stiftskirchenturm. Es<br />
jammert so schrill und wimmert so fein, als ob ums Kind eine Mutter wein. Und freudig<br />
folgen die Frauen dem Ton und sind am Saume des Waldes schon. Da schimmern drunten<br />
'in goldenem Schein vom Herzogsschloss die Fensterreihen.<br />
Am andern Morgen soll dann das Fräulein selbst den Turm der Stiftskirche bestiegen 'haben,<br />
um mit einer feinen Nadel den Spruch einzuritzen:<br />
Du Stimme aus der dunklen Nacht, die mich auf rechten Pfad gebracht,<br />
als ich fern drüben in dem Wald in Angst und Not umhergewallt.<br />
Dank sei der, die dich gestift`t. O, daß dein Ton auch Sünder trifft,<br />
damit sie auf dein fromm Gemahn, umkehren <strong>von</strong> der finsteren Bahn.<br />
Allerdings fügt Karl Gerok dieser sinnigen Alt-Stuttgarter Sage hinzu, dass es sich um ein<br />
früheres Silberglöckchen gehandelt haben muß, da das jetzige erst im Jahre 1605 gegossen<br />
wurde. Wie dem auch sei. Wer einmal zur mitternächtigen Stunde, etwa auf dem Weg über<br />
den Schlossplatz, den nächtlichen Glockengruß vernahm, dem wird er ein unvergessener<br />
Heimatruf bleiben.<br />
Allda sind 140 Bürger gewesen... 1950<br />
Unweit der Grenzscheide zwischen Neckar - und Schwarzwaldkreis, zwischen Deufringen<br />
und Gechingen, im Tal der raschen hellen Irm, wo sich vor einigen Jahren noch ein<br />
Schlagbaum, mit Französischen Grenzposten befand, erhebt sich auf waldiger Höhe, dem<br />
sogenannten Schlossberg, die Ruine einer kleinen Burg. Heute noch erfreut sie sich eines<br />
regen Besuches. Nach der kärglichen geschichtlichen Kunde dürften um das Jahr 1000 die<br />
Grafen <strong>von</strong> Calw die Erbauer gewesen sein. Später kamen sie mit einigem Grundbesitz in<br />
das Eigentum der Truchsesse <strong>von</strong> Waldeck. Die <strong>von</strong> Rudolf <strong>von</strong> Habsburg vorgenommene<br />
Racheaktion gegen dieses mächtige Grafengeschlecht im 13. Jahrhundert mag auch das<br />
Schicksal des kleinen Gebäudekomplexes besiegelt haben. Noch 700 Jahre später, Anfang<br />
dieses Jahrhunderts fanden aber spielende Knaben allerhand verrostete Waffen, Speerspitzen<br />
und anderes. Im Jahre 1928 unternahm auf Veranlassung des württembergischen<br />
Schwarzwaldvereins, Burgenforscher Koch eine Grabung. Entgegen der vorherigen Meinung<br />
zeigte es sich, daß der Burgfried eine Rundmauer gehabt hatte und nicht viereckig gewesen<br />
war. Sein äußerer Durchmesser betrug 10 Meter, die Mauerstärke 2 Meter 70 Centimeter.<br />
Die Aussicht <strong>von</strong> ihm auf Schönbuch, Alb und Schwarzwald mag einzig schön gewesen<br />
sein. Die Ringmauer und diejenige des Hauptgebäudes konnte ebenfalls festgestellt werden.<br />
Nicht entdeckt wurde die Tür zu dem unterirdischen Gelasse des "Geheimen Ganges", der<br />
sich bis zum Schlösslein in Deufringen, dem heutigen evang. Pfarrhaus hinziehen soll.<br />
Etwa 1/2 Stunde entfernt liegt am Ursprung der Irm Gechingen, das uralter Kulturboden ist.<br />
36
da<strong>von</strong> gibt nicht nur die keltische Kultstätte am Dachtler Berg und die zahlreich in den<br />
Wäldern vorhandenen Keltengräber Zeugnis, sondern auch die Reihengräber der Alamannen<br />
auf dem Engel- und Kappellenberg, sowie die Bezeichnung "Römersträssle" und die<br />
Hochstraße. Die eindringenden Alamannen, deren Sippe der Gacher, dem Dorf Gachingen<br />
den Namen gegeben, hatten zwar die Römerverdrängt, wurden aber durch die nachziehenden<br />
Franken wiederum angegriffen. Die sprachliche Grenze zwischen Alamannen und Franken<br />
geht nicht nur durch den Kreis, sondern nahe am Dorf vorbei, Seit 1100 wird Gechingen<br />
erwähnt. Ein gewisser Marquard <strong>von</strong> Gechingen hat im 13, Jahrhundert dem Kloster Hirsau<br />
zwei "Huten" (einzelne Höfe) geschenkt. Ein Graf Gottfried <strong>von</strong> Böblingen-Tübingen, ein<br />
Enkelsohn das letzten Grafen <strong>von</strong> Calw gab im Jahre 1295 "Villa Gachingen" seiner<br />
Gemahlin Elisabeth, geborene Gräfin <strong>von</strong> Fürstenberg, als Ersatz für den Ort Möhringen.<br />
Doch hatte für sie Gechingen keinen Bestand. Sie gab es 1333 mit Dagersheim und<br />
Darmsheim gegen Entschädigung an ihren Gemahl zurück. Das Kloster Herrenalb kaufte am<br />
4. Dezember 1305 noch <strong>von</strong> Konrad Mönchinger, Stölzlin <strong>von</strong> Häsingen, Reinhard <strong>von</strong><br />
Gärtringen und am 30. April 1309 <strong>von</strong> Graf Gottfried <strong>von</strong> Tübingen alle Rechte und<br />
Nutzungen und kam in den Besitz des Dorfes.<br />
Die uralte Gechinger Mühle, 800 Meter talabwärts, verkaufte Heinrich <strong>von</strong> Tübingen am 10.<br />
Dezember 1333 zum Teil an das Kloster Hirsau. Vorher hatte er diesen Teil allerdings <strong>von</strong><br />
den Kindern des Stadelherrn Konrad <strong>von</strong> Waldeck erworben. Einen Anteil an der Kirche,<br />
dem Kirchensatz und den Widdumhof (heutige Widem) erkaufte die Herrschaft<br />
Württemberg <strong>von</strong> Heinrich, Truchsess <strong>von</strong> Waldeck und dessen Brudersohn Konrad 1417<br />
und 1419, sowie <strong>von</strong> Tristam und Wilhelm, Truchsessen <strong>von</strong> Waldeck im Jahr 1428.<br />
Die heutige Kirche wurde im Jahre 1481 in spätgotischem Stil erbaut und dem großen<br />
fränkischen Heiligen Martin <strong>von</strong> Tour geweiht. 1561 wurde der Turm vom Blitz zerstört,<br />
1586 wieder aufgebaut und die Kirche renoviert. Eine zweite Renovation geschah im Jahre<br />
1743. Nachdem 1874 der Turm wieder durch Blitzschlag geschädigt wurde. erfolgte der<br />
Umbau des oberen Turmteils in der heutigen achteckigen Form. Die zwei kostbaren. aus<br />
dem Jahre 1499 stammenden. <strong>von</strong> dem berühmten Reutlinger Glockengießer, Bernhard<br />
Lachamann gegossenen Glocken stehen unter Denkmalschutz. Die dritte Glocke fiel<br />
erstmals 1918 der Beschlagnahmung zum Opfer, die im Jahre 1923 wieder beschaffte<br />
Glocke fiel dem zweiten Weltkrieg zum Opfer. Bei dem Bombenabwurf vom 20. April 1945<br />
durchschlug eine Bombe das Kirchendach und richtete im Chor, namentlich an der Orgel<br />
und den rautengefassten Kirchenfenstern großen Schaden an, der in Gemeinschaftsarbeit<br />
wieder behoben wurde. Die prächtige Steinrosette am Hauptportal mit ihren Rubingläsern<br />
blieben erfreulicherweise unbeschädigt.<br />
Um die Kirchengerechtsame gab es in alter Zeit manche Kämpfe. Nachdem das Kloster<br />
Herrenalb ansässig geworden war, - verlor 1388 die Markgrafschaft Baden die Schirm -<br />
Vogtei an die württembergischen Grafen. Diese behielten sie auch trotz eines nahezu<br />
150jährigen Kampfes. 1535 säkularisierte Württemberg das Kloster Herrenalb. Zwischen<br />
1428 und 1453 verkaufte Württemberg an die Markgrafschaft Baden, den Meßnereizehnten<br />
und den halben Fruchtzehnten. Als 1453 ein badischer Markgrat das Chorherrenstift Baden-<br />
Baden stiftete, wurde diesem auf besonderen Wunsch seines Stifters der Meßnereizehnte und<br />
der halbe Fruchtzehnte durch den Heiligen Stuhl selbst einverleibt. Bis zum Jahre 1806 blieb<br />
es so, daß Baden die Gechinger Pfarrherren ernannte, diese aber <strong>von</strong> Württemberg bezahlt<br />
wurden. Erst durch einen 1806 abgeschlossenen Staatsvertrag wurde Baden <strong>von</strong> diesem<br />
Recht abgelöst.<br />
Die Reformation drängte die Herrschaft der Klöster etwas zurück. Die Kriege setzten ein. Da<br />
Gechingen nicht an einer großen Heerstraße lag, war es Raub und Brandschatzung weniger<br />
ausgesetzt. Wie groß die Teilnahme am Bauernkrieg war (1325) meldet die Chronik nicht.<br />
37
Auch spätere Zeiten sind kaum deutbar. Obwohl die hiesigen Kirchenbücher bis 1569 fast<br />
lückenlos vorhanden sind so meldete doch keine dazwischen gefügte "Chronik" <strong>von</strong> anderen<br />
Geschehnissen als Taufen, Hochzeiten, und Todesfällen. Allerdings am 8, Februar des<br />
Jahres 1647 steht bei einer Eintragung im Taufbuch: "Getauft, auf der Flucht <strong>von</strong> Gechingen<br />
nach Calw", Dabei ist der Name nicht leserlich. Das Totenbuch des Jahres 1635 meldet in<br />
den Monaten August und September - als der "schwarze Tod" umging - das Aussterben<br />
ganzer Familien. Zu Ende des 30jährigen Krieges, also 1648, meldet der Vogt des<br />
Klosteramtes Merklingen: "Allda sind vorher in Friedenszeit 140 Bürger gewesen, aber nit<br />
mehr als 48, mangeln 97. Liegen wüst 610 Morgen Land. Item seyen an Gebäuden<br />
verbrannt und abgebrochen worden Häuser 26 und 10 Scheuren."<br />
Auch unter den pracht- und Jagdliebenden Fürsten der kommenden Jahrhunderte hatte das<br />
Dorf manches zu erdulden. Bis zum 16 Jahrhundert hatten noch Bären. bis zum 17.<br />
Jahrhundert noch Wölfe in den Wäldern gehaust. Trotzdem 1700 <strong>von</strong> 30 Mann 47 Nächte<br />
lang die Felder bewachten, wurden durch Wildschaden alles zerstört. Zu den großen,<br />
herzoglichen Jagden mußten die Bauern Frondienste leisten.<br />
Zu Ausgang des 18. Jahrhunderts waren wieder kriegerische Handlungen in der Nähe, und<br />
zogen 1794 durch Franzosen und Österreicher. 1792 lagen über 2 Monate 876 Russen im<br />
Quartier. 1799 war ein französisches Lager im Ort in welches Proviant geführt wurde. erst<br />
mit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde, trotz napoleonischer Herrschaft, die<br />
Lebensverhältnisse erfreulicher. Frondienst und Leibeigenschaft hatten aufgehört und die<br />
kleinbäuerlichen Betriebe begannen zu erstehen.<br />
Vom Feldzug 1813 gegen Russland kehrten nicht alle Teilnehmer zurück. 1870/71 blieben<br />
<strong>von</strong> den Ausmarschierten drei in fremder Erde, für sie befindet sich eine Gedenktafel in der<br />
Kirche, ebenso zwei für die 49 Gefallenen des ersten Weltkriegs. In alphabetischer<br />
Reihenfolge sind sie auf dem Ehrenmal vor der Kirche zu finden. Für die Gefallenen des<br />
zweiten Weltkrieges sind Namenstafeln, <strong>von</strong> Kränzen umrahmt, an Empore und im<br />
Kirchenraum angebracht. Da das Schicksal <strong>von</strong> mehr als zwei Dutzend Vermissten noch<br />
immer Dunkel liegt, ist noch keine Gedenktafel möglich.<br />
Vom weiteren Schicksal des Dorfes ist noch große Brand vorn 11./12., August 1881 zu<br />
nennen, der 51 Gebäude vernichtete. aber das Dorf in seiner freundlichen heutigen Gestalt<br />
neu stehen ließ. 1902103 wurde die vielbefahrene Straße nach Deufringen erbaut. 1906<br />
entstand die Hochdruckwasserleitung im oberen Tal, der im Jahre 1949 die elektrische<br />
Pumpstation im unteren Tal dazu kam. 1910 wurde Gemeinde. mit elektrischem Strom<br />
versehen. Seit 1919 besitzt das Dorf ein, vom Kreisbauamt und Gemeinderat genehmigtes<br />
Siedlungsgelände für 20 Häuser.<br />
38
Si-Un, die Hügel des Friedens<br />
Ein Frühlingsgang zu den Keltengräbern 1950<br />
Was kann es in diesen Ostertagen für ein schöneres Wanderziel geben, als die mehr als 2000<br />
Jahre alte Kultstätte aus der Keltenzeit? Zur Erforschung derselben wurde im November<br />
1948 ein Vertreter des Württembergischen Landesamtes für Denkmalpflege mit der Grabung<br />
beauftragt.<br />
Hügel aufwärts, die freundliche Steige zum Nachbarort Dachtel führt der Weg, durch Feld<br />
und Heide und Föhrenwald, beinahe bis zum Dreimarkstein der Dörfer Gechingen, Dachtel-<br />
Deufringen. In diesem "Heiligen Hain" befindet sich die Kultanlage, die nach den<br />
Messungen Zahlen der Mondlaufbahn enthält. Die ehedem kreisrunden Hügel waren im<br />
Unterschied zu den berühmten keltischen Kultstätten in Frankreich und Iro-Schottland dem<br />
Mondgott der Kelten geweiht. Die Messungen ergaben Zahlen, wie sie ähnlich in der Saros-<br />
Periode der Ägypter vorhanden sind. Beim Öffnen eines der Hügel, die aus fast reinem, wohl<br />
aus dem nahen Talgrund herbeigeschafften Lehm bestehen und mit einer einem halben<br />
Meter hohen Kalksteinpackung umgeben sind, fand man die Reste eines Frauenskelettes. Bei<br />
der geringen Tiefe, in welcher die Tote bestattet gewesen war, war nur noch wenig<br />
vorhanden. Einige Bronzeringe und eine Nadel zum Befestigen des Kopftuches war alles. Im<br />
Unterschied zu den <strong>von</strong> Pfarrer Klinger im Jahre 1841 geöffneten Keltengräber waren<br />
keinerlei wertvolle Beigaben vorhanden, auch keine der üblichen Unterlagen, so dürfte es<br />
sich um das Grab einer Dienerin handeln.<br />
Die Schulweisheit vergangener Zeiten befasste sich mit dem genialen, aber charakterlich<br />
zuletzt ziemlich degenerierten Volk der Kelten nicht sonderlich. Sie waren als Nachfolger<br />
der Höhlenbewohner und Pfahlbauern mehrere Jahrhunderte die Bewohner unseres Landes.<br />
Ein Volk stattlicher, hochgewachsener Menschen mit meist flammendroten Haaren, deren<br />
Farbe sie noch künstlich nachhalfen, lassen sich ihre Spuren verfolgen <strong>von</strong> Griechenland<br />
(Galater) über Oberitalien, das Neckar-, Nagold - und Rheintal. Als an dem Wasgenwald<br />
(Vogesen) ihre schweren Kämpfe gegen die <strong>von</strong> Ost und Nordost eindringenden Alemannen<br />
zu deren Gunsten ausfielen, traten manche Kelten, denen ebensoviel Tapferkeit wie<br />
Wankelmut nachgewiesen wurde, in feindliche Heeresdienste. Das Volk selbst wandte sich<br />
west und südwestwärts. Die einen durch die Normandie bis an die Küste und <strong>von</strong> dort über<br />
den Kanal zu den britischen Inseln. Die anderen gegen den atlantischen Ozean, wo noch<br />
heute bei Chartres-Auray gegen das Meer die gigantischen Steinheere der "Menhire" vom<br />
Wesen dieses hohen Volkes künden. Denn Kelte heißt ja der "Hohe" oder "Erhabene".<br />
Dieses Land ist ein Stück des alten "Galliens"l (gälisch, wie es am längsten in Iro-Schottland<br />
gesprochen wurde, ist die Sprache der Kelten).<br />
Die "Menhire" sind säulenförmige Altarsteine, deren größter 21,30 Meter hoher König aller<br />
Langsteine heute bei Locmariaquer in Stücken am Boden liegt. Er war kaum kleiner als die<br />
"Nadel der Kleopatra", der berühmte, ägyptische Obelisk auf dem Pariser Konkordienplatz,<br />
einem Beutestück Napoleon Bonapartes <strong>von</strong> seinem ägyptischen Feldzug. Zahlreich sind<br />
dort auch die "Dolmen", die riesigen tafelförmigen Steinplatten, die ebenso Grabkammern<br />
wie Altäre sind. In allem spricht aus den Anlagen der keltischen Kultstätten, ob sie sich in<br />
Frankreich, Schottland oder im deutschen Süden befinden, einige innige Naturverbundenheit,<br />
aber auch eine ebensolche Verbundenheit mit den Toten, denen man meist eine<br />
Wegzehrung ins "andere Leben" mitgab. Dann aber auch vor allem ein tiefer Glaube an die<br />
Harmonie des Ewigen.<br />
Die keltischen Priester, die Druiden fassten bei der Anlage ihrer Kult- und Grabstätten die<br />
Himmelsmaße der Astronomen in ihre Erdanlagen ein. In ihren Meditationen und Riten<br />
suchten sie dabei nach den Maßen der Sonnen, Planeten oder Mondlaufbahn an das Rätsel<br />
39
der Gottheit heranzukommen. Es geschah dies nicht, wie man heute oberflächlich annimmt,<br />
in heidnischer und wilder Form, sondern auf eine so hohe Art, daß um die Zeitwende<br />
mancher Druide eine geheimnisvolle Botschaft künden konnte, <strong>von</strong> der Geburt eines<br />
"Sonnensohnes."<br />
Findet man im Walde Brecaliande bei der Halbinsel Quiberon die Stelle, wo der berühmte<br />
keltische Barde Merlin "schläft", so liegt hier eine geheime Verbindung mit dem<br />
schottischen Hochland, das dieses des Gründers <strong>von</strong> König Arthur berühmter Tafelrunde,<br />
geliebte Heimat war. Dort ist die zweite große Keltenstätte, wo die Angelsachsen in harten<br />
Kämpfen die keltischen Edelinge vernichteten.<br />
Man stößt aber bei den Namen des keltischen Barden "Merlin" auf den Genius des deutschen<br />
Volkes Johann Wolfgang <strong>von</strong> Goethe: Bei einer Tischrunde in Dornburg am 29.April 1818,<br />
so berichtet Kanzler <strong>von</strong> Müller, ist Goethe fast 70-jährig, anwesend. In der höheren<br />
Richtung des Gespräches schließt der Greis sein Inneres willig auf. Er spricht über<br />
"Religion" als der schönsten Bürgschaft unseres übersinnlichen Seins. Er spricht über "die<br />
geheimnisvolle Mitgabe in das Leben", nämlich über das Vorhandensein großer Urelemente<br />
oberhalb und innerhalb des Irdischen. Formeln, ewig wiederkehrend, ewig unter tausend<br />
Verbrämungen dieselben. Wohl übersetzt sich jeder diese Formeln in seine Sprache, paßt sie<br />
auf mannigfache Weise seinen beengten, individuellen Zuständen an. Dadurch wird oft auch<br />
Unlauteres darunter gemischt, daß die Formeln kaum mehr ihre ursprüngliche Bedeutung<br />
erkennen lassen. Aber dieses Unlautere taucht doch immer wieder unter, daß bald diesem,<br />
bald jenem Volke durch einen aufmerksamen Forscher die wahre Formel als eine Art<br />
Alphabet des Weltgeistes zusammengesetzt wird ....<br />
Am Schluß des Berichtes heißt es: "Goethes Gedanken schienen wie in einem reinen Äther<br />
auf und nieder zuwogen. Er sagte, plötzlich aufstehend: Kinder, laßt mich einsam zu meinen<br />
Steinen dort unten eilen. Denn nach solchen Gesprächen ziemt dem alten Merlin, sich mit<br />
den Urelementen wieder zu befreunden. Der "alte Merlin", so nennt sich Goethe selber, wie<br />
er an andrer Stelle ausruft: "Merlin, der Alte, im leuchtenden Grabe, drinnen als Jüngling<br />
gesprochen habe." Man behauptet nicht umsonst, daß Goethe durch seine Lektüre des<br />
"Ossian" und "Merlin", es war, der deutsche Dichter und Denker veranlasste, sich mit<br />
keltischer Kult und Wesen zu befassen, wo sich viel Wunderbares fand! Einer der<br />
begeisterten, nach der Ansicht seiner Freunde ein echter Kelto-Romano, war der vor 20<br />
Jahren verstorbene Elsässer und weimarsche Literatur-Professor Friedrich Lienhardt. In<br />
seinem Epos "Wasgauschlacht" schildert er den Zusammenprall zwischen Kelten und<br />
nachdrängenden Alemannen in anschaulicher Weise:<br />
Die Enkel jener, die <strong>von</strong> diesen kämen, den unwillkommenen Alemannenstämmen,<br />
Felsblöcke rollten auf den Eberschild, noch lebt in ihren dunklem Hochlandblut in Haß und<br />
Liebe, süß und heiß und wild die alte Waldlust und die Höhenglut. Im Abendrot dort oben<br />
ist ihr Haus und zogen sie in alle Welt hinaus, niemals vergessen sie in Sturm und Wind, daß<br />
sie im Hochland nur, daß sie in Licht und Gold zuhause sind.<br />
Hier sind in einfachen, zeitnahen Versen die keltischen Riten zusammengefasst: Licht und<br />
Gold und Einsamkeit. Wenn man nun hört, wie droben in Merlins schottischer Heimat mach<br />
der Einführung des Christentums durch die Angelsachsen die letzten Kelten aus ihren<br />
"Menhiren" die ersten Hochkreuze schufen und als christliche Missionare über das Meer<br />
wieder rheinaufwärts zogen, so ahnt man, welche Sehnsucht sich ihnen mit dem Kommen<br />
des Welterlösers erfüllt hatte. Trotzdem vergessen sie ihre Vorzeit nie ganz. Im Epos <strong>von</strong><br />
Parzival, dem reinen Toren, lebt noch ein gutes Stück Keltentum. Der Tonschöpfer Richard<br />
Wagner läßt in seinem "Karfreitagszauber" die tiefen Worte aufklingen: "Ich sah sie welken,<br />
die mir lachten, ob heut sie nach Erlösung schmachten. Auch deine Träne wird zum<br />
Segenstaue. Du weinest, sieh, es lacht die Aue."<br />
40
Nicht nur den Menschen, sondern die ganze Natur erlöst zu wissen, kann es für unseren, <strong>von</strong><br />
völliger Vernichtung bedrohten Planeten etwas Größeres geben? Und dies allein ist zutiefst<br />
der Sinn der keltischen Religion gewesen. Das spricht heute noch erschütternd aus den<br />
Kultstätten ihrer Zeit, ob sie im Hochland <strong>von</strong> Kaledonien liegen oder bei Locmariaquer am<br />
atlantischen Ozean, oder in einem weltfernen Winkel des Schwabenlandes. Es sind<br />
"Tumulus", die Grabstätten, welche die Kelten "Si-Un" nannten, Hügel des Friedens.<br />
Grabstätte und Kultstätte zugleich. Von ihnen, sagt ein Forscher, geht eine feine Strahlung<br />
aus, sie sind wie Sonnenbarken, die zum Lichte ziehen, in jenes sagenhafte Avalun, die<br />
Raststätte der Toten, ins andere Leben." Der Schriftleiter einer großen Berliner Zeitung<br />
sandte Friedrich Lienhardt einmal zu seinem Geburtstag im ersten Weltkrieg folgende<br />
Zeilen: "Aufwärts die Seele, zu ewigen Sternen. Dort wo die Wünsche, die heißesten, ruhn.'<br />
Dort in der Blautiefe seligster Ferne, liegt unser Heimatland, liegt Avalun."<br />
Wenn einen nun während der Ostertage der Weg zu den Keltenhügeln und in den Bannkreis<br />
eines "Cramlech" (geheiligter Steinwall) führt, so mag man denken, daß hier ein<br />
jahrtausende altes Gottessuchen zu uns spricht, das auch in unserer Zeit voll Mühsal und<br />
Bedrängnis noch Gültigkeit hat. In tiefem Schweigen ruhen die großen, steingefassten Hügel<br />
und man mag an die Frauen des Ostermorgens denken und an die Engelsworte am Grabe des<br />
Welterlösers: "Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Siehe, er ist nicht hier, er ist<br />
auferstanden!" So trägt diese Stunde ihre Festtagsweihe.<br />
Der Einkehr stille Stunde macht still des Herzens Schlag,<br />
Bringt sie zugleich die Kunde vom letzten Glück und Tag.<br />
Einst schien der Himmel offen, die Welt in Blüten stand,<br />
Ein Leid hat uns betroffen, das keinen Tröster fand.<br />
Einmal, vorn Leid genesen, fühlt man des Ew'gen Spur,<br />
Ein Traum schien es gewesen, ein arger, böser nur.<br />
Den anderen mag frommen, was sie nur freuen mag,<br />
Doch jeglichen wird kommen sein letztes Glück, sein letzter Tag...<br />
Nun bleibt ein Lichter Schimmer auch in der kargen Zeit,<br />
Dahinter steht doch Immer die große Ewigkeit!,<br />
41
Friedrich Brackenhammer<br />
Der Seniorchef eines alten Müllergeschlechtes 1953<br />
Am Landesbußtag entschlief nach längerem Leiden im Alter <strong>von</strong> 81 Jahren Mühlebesitzer<br />
Friedrich Brackenhammer in Deufringen. Aus einem alten Gechinger Geschlecht und dessen<br />
Mühle stammend, übernahm er vor fast 56 Jahren die schwiegerelterliche Mühle in<br />
Deufringen. Mit Tatkraft und unermüdlichem Fleiß stand der Verstorbene seinem Betrieb<br />
vor, fand aber daneben noch Zeit, der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinde seiner zweiten<br />
Heimat mit Rat und Tat beizustehen. Doch mit ganzem Herzen war er Müller, <strong>von</strong> seinem<br />
einzigen Sohn und später auch einem Enkel unterstützt. So galt auch seine Anhänglichkeit<br />
bis zuletzt seiner elterlichen Mühle, die vor 200 Jahren durch Heirat des Gechinger<br />
Schultheißen Brackenhammer in Besitz der Familie gekommen war, die schon vorher, wie<br />
aus Kirchenbüchern ersichtlich, seit l575 in Gechingen ansässig war. Gerade zum Fest<br />
seiner silbernen Hochzeit konnte ihm seine älteste Tochter ein im württembergischen<br />
Staatsarchiv entdecktes, Wappen seiner Gechinger Vorfahren überreichen, das<br />
folgendermaßen beschrieben wird: "Ein gülden Krönlein, ein kleiner Hund, ein silbernen<br />
Mühlrad auf blauern Grund, ein eiserner Helm mit geschlossnem Visier, das stellet der<br />
Ahnen Wappen für."<br />
Mit seiner Gattin Maria, geb. Schuster, mit welcher der Verstorbene mehr als fünfeinhalb<br />
Jahrzehnte verbunden war, seinem Sohn und zwei Töchtern sowie neun Enkelkindern<br />
trauern drei hochbetagten Schwestern und die ganz verwaiste Familie seines vor 19 Jahren<br />
verstorbenen Bruders Ernst um ein ehrwürdiges Familienoberhaupt. Sind doch dessen beide<br />
Söhne, die Besitzer der Gechinger Mühle, in Russland verschollen. So löst In seinem<br />
Geburtsort wie in seiner zweiten Heimat Deufringen sein Hinscheiden jene tiefe Teilnahme<br />
aus, die stets bei heimattreuen, schollenverbundenen Menschen, wie Friedrich<br />
Brackenhammer es war, der Fall ist.<br />
0 Schwarzwald, o Heimat (1956)<br />
Die Mühle im Schwarzwald! Sie ist berühmt, die obere Kapfenhardter Mühle, in welcher<br />
Ludwig Auerbach sein prächtiges Lied "O Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön"<br />
verfaßte, welches Franz Abt vertonte. Und wenn nicht vor fast 100 Jahren man eine<br />
blühende junge Frau mit ihrem toten Kind im Arme auf dem Kapfenhardter Friedhof<br />
getragen, so wären heute die Nachkommen der dritten Tochter Luise (geb.1832) des<br />
Gechinger Müllers Johann Jakob Brackenhammer und der Eva Katharina Maier, auf dieser<br />
prächtig gelegenen und ebenso prächtig restaurierten Mühle ansässig.<br />
Doch hat dem damaligen Besitzer Mönch seine zweite Frau gesunde Kinder geschenkt, die<br />
den ererbten Sitz so gut führen, daß er ums der Gastlichkeit willen auch als Erholungsort<br />
weiterhin bekannt ist. Trotzdem ist die Verbindung zur Gechinger Mühle nicht abgebrochen<br />
und auch sonstigen hiesigen Gästen wird gerne bestätigt, daß vor 100 Jahren ein Gechinger<br />
Müller hier kurze Zeit schaltete und waltete!<br />
Die liebe Großmutter hat es mir selbst erzählt, wie der Schwager Mönch, nachdem der erste<br />
große Schmerz und das Trauerjahr verflossen war, sich wieder bei dem Schwiegervater<br />
einstellte und um eine seiner Schwägerinnen Hand bat. Doch da war guter Rat teuer. Drei<br />
dieser 5 noch lebenden Schwestern waren bereits seit Jahren verheiratet. Die älteste, zu<br />
Ehren der Weimarer Tante Charlotte geheißen, saß bereits seit mehreren Jahren als Frau des<br />
42
<strong>von</strong> Calw gebürtigen Schultheißen Karl Imanuel Naschold und als Mutter <strong>von</strong> vier Buben im<br />
nahen Althengstett. Die Ahne in der Mühle muß sich an den Sonntagen sehr nach ihrer<br />
Ältesten gesehnt haben, denn sie stand oft am Fenster und verkündete dann den Anwesenden<br />
voller Freude: "Jetzt kommt die Lotte mit dem Kinderwagen!" Dies scheint auf meine<br />
Großmutter, die ja als Jüngste nur 4 Jahre älter war als ihr Neffe Karl, der nochmalige<br />
Bezirksgeometer Naschold, größten Eindruck gemacht haben, daß sie es noch vergnügt dem<br />
Enkelkind erzählte.<br />
Die zweite der Schwestern, Christiane, lebte damals mit ihrem Mann Jakob Luz <strong>von</strong><br />
Deckenpfronn als Lehrersfrau in Unterhaugstett. Großmutter machte oft die Kindbettmagd.<br />
Die vierte der Schwestern, Amalie, hatte schon mit 18 Jahren und unter heißen Tränen ihren<br />
Vetter, den hochmusikalischen Johann Georg Gehring auf der Mauer in Gechingen<br />
geheiratet. Sie hatte damals schon einen Sohn, dem sich im Jahre 1869 noch eine Tochter<br />
zugesellte. Sie selbst starb auch sehr jung, 1871, an Nervenfieber.<br />
Hatte meine Großmutter ihre drei älteren Schwestern, Lotte, Nane und Luise in den<br />
Sammelnamen "Oosere Grauße" zusammengefasst, die alle drei noch <strong>von</strong> ihrer Großmutter<br />
Friederike Magdalena in feinen Handarbeiten unterrichtet worden waren, so blieben nur<br />
noch zwei, das kleine Rösle und Riekele. Doch das Rösle, das scheinbar einen beachtlichen<br />
Dickkopf hatte, erklärte rundweg: "On wenn i dreimol am Tag a o'gschmälzte Wassersupp<br />
essa muaß, so nemm ich koan andere als mei Hannesle!" So schlimm wurde es allerdings<br />
nicht, denn besagter Johannes Kühnle war ein wohlhabender Bauer. Trotzdem dauerte auch<br />
dieses Glück nicht lange. Als der einzige 9jährige Sohn Fritz ein Schwesterle bekam,<br />
welches im Jahre 1876 geboren, den Namen seiner 5 Jahre zuvor verstorbenen Tante Amalie<br />
bekam, da holte der Tod schon 3 Tage nach ihrer Geburt die junge Mutter heim. Das haben<br />
ihre Eltern nicht mehr erleben müssen, da die Urahne, die 14 Kinder, 8 Mädchen und 6<br />
Buben, das Leben gab, 1870 gestorben war. Der Müllerähne hatte seine Frau nur um ein Jahr<br />
überlebt, er starb 1871.<br />
Damals aber, als sein Kapfenhardter Schwiegersohn als Brautwerber zum zweiten Mal<br />
auftrat, erfreute er sich noch ziemlicher Rüstigkeit, konnte aber nur den Bescheid geben, daß<br />
er ja nur noch sein Riekele habe. Und als diese mutig rief, daß sie ihn gleich nehmen tät und<br />
an der geliebten Schwester Stelle träte, da sagte der Vater mit wehmütigem Lächeln: "Guck,<br />
mei Riekel, die däd di nemma, aber dia ko i dr doch net gäa, denn se isch jo grad erschd<br />
konfirmiert." Aber das Band war trotzdem nicht gerissen.<br />
Als meine Mutter und meine Patin Anna Brackenhammer, die die Tochter <strong>von</strong> Großmutters<br />
einzigem Bruder war, dem nunmehrigen Gechinger Müller, in Calw das Weißnähen<br />
erlernten, so um 1890 herum, durften sie oft abends mit ihren beiden Nähfräulein spazieren<br />
gehen. Dem gleichen Zweck frönten auch die damals wie heute berühmten Handelsschüler.<br />
Als zwei derselben immer wieder mit höflichem Gruß in der Nähe der Spaziergängerinnen<br />
auftauchten, wurde die gute Fräulein Wiedmann darob etwas zappelig. Sie fürchtete wohl<br />
um den Seelenfrieden ihrer Zöglinge. Doch die beruhigten sie lachend: "Da brauchen Sie<br />
keine Angst zu haben, das sind doch die Buben <strong>von</strong> unserem Onkel Mönch <strong>von</strong> der oberen<br />
Kapfenhardter Mühle!"<br />
Mehr als 1 1/2 Jahrzehnte waren vergangen. Meine Eltern weilten mit mir in den<br />
Sommerferien im geliebten Gechinger Großelternhaus. Da planten meine Eltern einen<br />
Besuch bei den Kapfenhardter Verwandten. Mir hatten sie versprochen, mitzudürfen. Aber,<br />
wie schon Prälat Gerok sagte: "die immersorgliche Großmutter" fürchtete die etwas<br />
unsichere Witterung und sagte: "Laßt des Kend do, wenns Wetter guat bleibt, ganget dr<br />
Vatter on i mit ihr nach Hengstett ond au zur Tante Lotte. No kommet mr an da Bahnhof."<br />
Die Wanderung mit den beiden, die mit so herzlicher Liebe an ihrem einzigen Enkelkind<br />
hingen, lebt noch wie auf Goldgrund in meiner Erinnerung. Kaum waren die Eltern dem Zug<br />
43
entstiegen, sagte meine Mutter zur Großmutter: "Mutter, ich soll dir viele Grüße <strong>von</strong> der<br />
alten Frau Mönch sagen. Und sie habe einen arg guten Mann gehabt. Aber so wie seine<br />
Luise habe er sie eben doch nicht mögen ...“<br />
Nun sind sie alle drüben, die wir selbst oder durch liebevolle <strong>Erzählungen</strong> kannten, alle , die<br />
lieben Gestalten und Gesichter. Langsam sinkt der Abend eines einsamen Alters herab. Aber<br />
- Gott weiß es - wie meiner leidgeprüften Mutter Lieblingsspruch hieß und wie ich es auf<br />
ihren Grabstein meißeln ließ - "daß wir uns wiedersehen." "Und kommt einst mein<br />
Stündlein, bei dir nur allein, <strong>von</strong> dir überwölbt will begraben ich sein. Wo Waldvöglein<br />
jubeln <strong>von</strong> frühroten Höhn, o Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön<br />
Komm mit ins Kapfenhardter Tal 1953<br />
Darf ich dich einmal mitnehmen ins Kapfenhardter Tal? Die Sonne scheint, es ist<br />
Sonntag, und du und ich, wir gehen zum Turnplatz oder zum Bahnhof je nach Laune und<br />
Belieben. Am Turnplatz wartet ein bequemer Omnibus auf uns und trägt uns in einer<br />
halbstündigen Fahrt hinauf nach Salmbach. Von dort aus wandern wir auf einem<br />
kurzweiligen Waldweg hinüber nach Kapfenhardt. Wenn wir Glück haben, stehen auf den<br />
Waldwiesen ein paar Rehe und sind gar nicht scheu. Bestimmt aber treffen wir etliche<br />
Eichhörnchen die ein Stück mit uns, wandern hoch in den Ästen der Fichten, und dabei mit<br />
leeren Tannenzapfen oder kleinen, Rindenstücken auf uns werfen, als wollten sie uns<br />
necken. Am Waldrand hälst du mich staunend am Arm und zeigst freudig hinüber auf die<br />
wunderbare Aussicht ins Gäu. Kein Wunder! Es ist einer der schönsten Aussichtspunkte in<br />
der Umgegend.<br />
Nach etlichen hundert Metern bergab sind wir unversehens plötzlich mitten im Dorf. Die<br />
Wege sind alle sonntäglich sauber gekehrt. In den Gärten blühen die gelben Glocken und die<br />
ersten Tulpen. Vier saubere und gepflegte Gasthäuser warten im Dorf auf die hungrigen und<br />
durstigen Wanderer. In wenigen Minuten erreicht man auch berühmte und vielbesuchte<br />
Kapfenhardter Tal und seine gemütlichen "Mönche."<br />
Wir hätten auch in Pforzheim zum Bahnhof gehen können und mit dem Zug nach<br />
Unterreichenbach fahren. Von dort wandert man bequem in 45 Minuten, durchs<br />
Kapfenhardter Tal, hinauf zu den Mühlen. Diesen Weg haben viele Pforzheimer gemacht<br />
und sind deshalb vor uns bei den Mönchen eingekehrt. Wenn wir uns gestärkt haben, ladet<br />
das geschwätzige Mühlbächlein zu einem kleinen Spaziergang ins Eulenloch. Dort treffen<br />
wir Bekannte. Eine ganze Anzahl Pforzheimer verbringen ihr Wochenende regelmäßig in<br />
Kapfenhardt und haben sich hier wie zünftige Wald- und Wandervögel eingenistet. Sie<br />
singen fröhliche Wanderlieder und begleiten sie auf ihren bändergeschmückten Klampfen.<br />
Auf moosigen, schattigen Waldwegen, entlang an fetten, grünen Talwiesen, in denen gelbe<br />
Butterblumen blühen und Schmetterlinge gaukeln, wandern wir dahin. Wir ruhen uns aus am<br />
Waldrand auf schwellendem Moos, du lehnst deinen Kopf an meine Schulter und wir<br />
träumen selig wie einst Berthold Auerbach in der oberen Mühle sein Lied erträumt und<br />
geschrieben hat: "0 Schwarzwald, o Heimat!"<br />
44
„Nur einen Grenzstein hat die Mutterliebe, und dieser Grenzstein steht auf Mutters Grab!"<br />
Schmetterlingsreigen (1957)<br />
Zum diamantenen Hochzeitstag meiner Eltern am 8.7.1957<br />
Es war noch früh am Morgen, die Sonne stand in goldner Pracht über dem Bergwald. Aber<br />
im Westen stiegen schon drohend Wetterberge auf. Würde der Tag ein Gewitter bringen?<br />
Mit Gießkanne und einem großen Blumenstrauß bewaffnet, ging in den oft begangenen Weg<br />
zum Friedhof, zu meiner lieben Mutter Grab. Man begegnete wenig Menschen. Die Gänge<br />
zur Molkerei waren beendet und die großen Kinder schon in der Schule. Die Kleinen, die<br />
Kindergärtler, würden erst später kommen.<br />
So waren meine Gedanken einzig und allein auf den Gang gerichtet und auf den festlichen<br />
Tag vor 60 Jahren als meine lieben Eltern in der Gechinger Kirche getraut wurden. Was ich<br />
aus den <strong>Erzählungen</strong> meiner früh verwitweten Mutter wußte, suchte ich in meinen Gedanken<br />
zu gestalten.<br />
Es gelang mir! Ich sah alle deutlich in dem lieben, alten Haus. Meine beiden<br />
Großelternpaare, die hiesigen etwas aufgeregt, wie sich das Fest wohl anlassen würde und<br />
wie es sein würde, wenn ihr "Odile" in der schwäbischen Hauptstadt ihre Heimat hatte. Dass<br />
sie allerdings schon 15 Jahre später als junge Witwe mit ihrem Waislein wohlgeborgen ins<br />
Elternhaus zurückkehren würde, ahnte niemand. Und welches Schicksal ihrer dann wartete,<br />
noch viel weniger. Es war eine stattliche Hochzeitsgesellschaft, und die Brautleute zwei<br />
schöne, edle Menschen! Dann war da die Großmutter in ihrem ebenfalls neuen, seidenen<br />
Kleid, das noch vier weitere Hochzeiten aushielt. Da war der Großvater, stattlich im<br />
Schmuck der breiten Ordensschnalle. Da waren die Schwestern und Brüder, welche nachher<br />
das Engelsterzett aus dem "Elias" singen würden. "Hebet eure Augen auf zu den Bergen, <strong>von</strong><br />
welchen euch Hilfe kommt."<br />
Dies alles stand vor meiner Seele, als ich mich Mutters Grab näherte, in welchem sie mit<br />
ihrer Mutter ruhte, während mein Vater bei seinen Eltern und Geschwistern in Stuttgart seine<br />
letzte Ruhestätte fand.<br />
Da blieb ich überrascht stehen, das Grab hatte einen wunderlichen Blumenschmuck erhalten.<br />
Viele kleine, weiße Schmetterlinge saßen wie ein Beet zitternder Blüten auf den Blumen des<br />
Grabes. Lange stand ich da, um das liebliche Wunder zu bestaunen. Psyche, die Seele, wie<br />
sie die Griechen erfühlten. Hatten meine Lieben <strong>von</strong> drüben in meine Einsamkeit diesen<br />
Gruß gesandt? Noch einen Schritt trat ich näher, die schienen die Blütenkinder sich empor<br />
zu richten und als ich wieder näher trat, flogen sie in einem anmutigen Reigen um den<br />
Hügel, dann lösten sie sich auf und flogen in raschem Flug weit über das sonnige Tal hinaus.<br />
Aber niemals vorher oder nachher erlebte ich solch wunderbares Geschehen wie den<br />
Schmetterlingsreigen am diamantenen Hochzeitsmorgen meiner lieben Eltern, Eugen und<br />
Ottilie <strong>Jäger</strong>.<br />
45
Beim Abendschein (1957)<br />
Ein weicher Sommerwind wehte vom Mühltal herauf, als die Großmutter zu mir vors Haus<br />
trat. "Komm", sagte sie und nahm mich 16jährige an der Hand, wie einst als Kind, wenn wir<br />
bei ihr in den Ferien waren. "Komm, ich will doch sehen, was der Fritz (der Mühlenbesitzer,<br />
ihr einziger Bruder) an die Mühle gebaut hat." Langsam, wie es die zittrigen Füße noch<br />
leisten konnten, gingen wir unseren Mühlweg hinunter, den selben Weg, den die 69jährige<br />
so oft gegangen, als Kind, als junges Mädchen in die heimatliche Mühle, bis sie sich als<br />
25jährige mitten ins Dorf herauf mit meinem Großvater, Jakob Friedrich Böttinger,<br />
verheiratete, 1870, kurz vor dem Krieg. Kurz bevor die Mutter <strong>von</strong> ihr, und 13 weiteren<br />
Geschwistern und 1871 auch der Vater, Johann Jakob Brackenhammer, starben.<br />
Da der Vater des damals zu erwartenden Kindleins in den ersten Tagen schon eingerückt<br />
war, hatte er die kleine Luise nicht einmal gesehen, die nach kurzem Erdentag starb. Auch<br />
das zweite Mädchen, Amalie, wurde nur 1 1/2 Jahre alt und starb an Gehirnhautentzündung.<br />
Ein Verlust, den die Mutter nie verschmerzte. Erst das 3.Mädchen, Ottilie Pauline, 3 Tage<br />
nach dem Einzug in das neu erbaute Haus geboren, blieb den Eltern erhalten. Doch für die<br />
Mutter, die in jungen Jahren als Jüngste ein heiteres, fröhliches Mädchen war, begann eine<br />
lange und schwere Leidenszeit. Erst körperlich, mit einer hart am Tode vorbeigehenden<br />
Halsoperation und dann mit jahrelanger religiöser Schwermut, die sich erst mit<br />
zunehmendem Alter ganz verlor, so daß die Greisin mit liebem Lächeln sagen konnte: "I<br />
hans müasse durchstao om meines Heilands Willen!"<br />
Die zweifellos glücklichsten Jahre waren wohl die für Großmutter und Großvater <strong>von</strong> 1896 -<br />
1912, als ihr "Odile" meinen geliebten Vater in Stuttgart kennenlernte und ihm bald als seine<br />
Gattin in die Schwabenresidenz folgte! Wenn man die Briefe las, welche die Brautleute<br />
wechselten, so fühlte man, mit welch herzlicher Liebe und Dankbarkeit der Schwiegersohn<br />
Eugen <strong>Jäger</strong> die Aufnahme in die Familie seiner Lebensgefährtin lohnte.<br />
Das, was er immer und immer versicherte und auch in der Tat bewies, hat er, ich kann es als<br />
sein einziges Kind bezeugen, bis in den Tod gehalten. Bis zu jenem strahlend schönen<br />
Sommertag, den 13. Juni 1912, als er im schönsten Alter <strong>von</strong> 43 Jahren jäh und plötzlich<br />
starb.<br />
Es war so, wie Stadtpfarrer Gerok an seinem Grab auf dem Prag sagte: "Auf der goldnen<br />
Höhe des Sommers, mit der Hoffnung auf einen Ferienaufenthalt im Haus der<br />
Schwiegereltern!" Und nun kehrte eine erst 37jährige Witwe mit ihrem Waislein<br />
wohlgeborgen ins Elternhaus zurück, wie es im Schluß der Grabrede hieß, und uns, die wir<br />
zum Wochenschluss (es war der Samstag, der 15.Juni 1912) mit ernsten Gedanken<br />
heimkehren, soll das Wort im Herzen nachklingen: "Sollt es die letzte Woche sein, so führ<br />
mich, Herr, zum Himmel ein!"<br />
Wieviel <strong>von</strong> dem allen der lieben Großmutter durchs Herz und Sinn gezogen war, weiß ich<br />
nicht. Jedenfalls hat sie ihren letzten Gang auf Erden noch einmal bis zum "Mühlwegle"<br />
gemacht und das wunderschöne Bild ihrer Kinderheimat im "Abendschein" noch einmal<br />
gegrüßt.<br />
5 Wochen später trug man sie hinaus, kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges, am 7.Juni<br />
1914. Am 15. Juni 1912 war ihr Schwiegersohn Eugen <strong>Jäger</strong> in Stuttgart zur Erde bestattet<br />
worden und am 22.Juni 1914 folgte ihnen Großvater Jakob Friedrich Böttinger nach, mit 74<br />
Jahren, genau wie sein eigener Vater, Johannes Böttinger, und wie er ahnend immer wieder<br />
vorhergesagt hatte.<br />
Lange hatte ich mit meinem Grossmütterle am Mühlwegle gestanden und schweigend hatte<br />
sie das durch den Neubau kaum veränderte Bild in sich aufgenommen. Auf dem Heimweg<br />
sagte ich: "Gelt, Großmutter, vom Mühlwegle an konntet ihr als verschnaufen?" Denn sie<br />
hatte mir oft erzählt, wie die Burschen des Dorfes sie in gutmütigem Necken hinter den<br />
46
längst den Häusern gewichenen Hecken, schreckten und auch verfolgten.<br />
Sie lächelte so lieb, wie es für mich nur noch ein Mensch konnte, meine eigene, geliebte<br />
Mutter, die nach 44jähriger schwerer Witwenschaft zu ihren Lieben heim durfte, und bei<br />
ihrer Mutter am 7. Oktober 1956 zur letzten Ruhe gebettet wurde. Damals aber sagte meine<br />
Großmutter, 42 Jahre zuvor: "Ja, ja, so isch emmer gewäa, wo mir jung waret. Aber jetzt,<br />
jetzt isch grad, als ob i eimal der Flecka nuff on nonder sei."<br />
Erinnerung an die 80er Jahre 1959<br />
Immer wenn in den verflossenen Jahrzehnten die reifenden Erntefelder sich weit<br />
sich weit um das Dorf dehnten wurde die Erinnerung an jene Katastrophe wach,<br />
die sogar in die hiesige Zeitrechnung aufgenommen wurde: "Vor und nach dem großen<br />
Brand." Und als neulich wieder eine Heimstätte dem Feuer zum Opfer fiel, wurde vor allem<br />
bei den noch lebenden Zeitgenossen die Erinnerung an jene Schreckensnacht vom 11. und<br />
12. August 1881 geweckt.<br />
Nach einem arbeitsreichen Erntetag lag das Dorf im nächtlichen Frieden, da trafen sich<br />
unweit der Kirche zwei erbitterte Gegner, Männer des Dorfes, der eine vom Wirtshaus, der<br />
andere <strong>von</strong> einem verbotenen Waldgang kommend. Was dabei verhandelt wurde, wird ein<br />
ewiges Geheimnis bleiben. Denn die Hoffnung, daß einmal der nahende Tod versiegelte<br />
Lippen öffnen werde, erfüllte sich nicht.<br />
Plötzlich gellte der Schreckensruf: "Feuer, Feuer!" durch die Stille. Aus der in der Dorfmitte<br />
liegenden Scheuer des Metzgers Gehring stieg Rauch und bald auch loderndes Feuer empor.<br />
Es war die gleiche Stelle, an der beim Fliegerangriff des 20.4.1945 die Scheuer <strong>von</strong><br />
Metzgermeister Ayasse in Flammen aufging.<br />
In jener Augustnacht 1881 griff das Feuer trotz sofortiger Hilfe durch die hiesige Feuerwehr<br />
und später auch durch die zahlreichen, <strong>von</strong> Feuerreitern herbeigerufenen Nachbarwehren mit<br />
rasender Schnelle um sich. Es fand ja in den dicht zusammengebauten und mit Erntevorräten<br />
gefüllten Scheunen reiche Nahrung.<br />
So mußte man in erster Linie den Hausrat und das Vieh der bedrohten Häuser in Sicherheit<br />
bringen. Schon brannte das ganze Viertel zwischen Metzger- und Hohe Gasse und griff dann<br />
auch auf die Häuser des "Gäßle" über. Der Wind hatte sich gedreht und fuhr nun in starken<br />
Stößen, gleich einem riesigen Blasbalg in das Flammenmeer, es hoch aufwirbelnd, um dann<br />
in feurigem Regen brennende Strohhalme, Schindel und Glut weit über das Tal hinweg in<br />
das Land zu tragen. Sogar im damaligen Böblinger Oberamt fanden sich noch Spuren des<br />
Gechinger Brandes. Es muß ein wahres Inferno gewesen sein: das Toben des Sturmes, das<br />
Knistern der Flammen, das Krachen des einstürzenden Gebälks, das Brüllen des<br />
erschreckten Viehs und das Jammern der Menschen. Um das Chaos zu vergrößern, geriet<br />
auch noch der im Freien abgestellte Hausrat in Brand. Mit nassen Tüchern gelang es aber,<br />
hier wenigstens weiteren Schaden zu verhüten. Des Feuers Macht schien dann endlich an<br />
einer Scheuer im Mühlweg gebrochen zu sein.<br />
Doch wie sah im Morgengrauen das einst so blühende Dorf aus! Der ganze südöstliche Teil<br />
mit 52 Gebäuden war dem Feuersturm zum Opfer gefallen. Weinend standen die Menschen<br />
"an dem Grabe ihrer Habe." Aber es fügte sich reibungslos, daß alle Obdachlosen in der<br />
Dorfgemeinschaft ihre Bleibe fanden. Man rückte zusammen und begann mit den<br />
Aufräumarbeiten. Der Schuttplatz im Gailer, längst überbaut und als Halde überwachsen, ist<br />
heute noch Zeuge, welche Arbeit geleistet werden musste. Dann sollte die Anlage des Dorfes<br />
47
aufgelockert werden. Hohe Gasse und Metzgergasse sollten in gleicher Weise wieder<br />
erstehen, aber das enge und krumme "Gäßle" sollte eine breite Dorfstraße werden. Der<br />
größte Plan aber war die neue Straße die parallel zum Mühlweg angelegt werden sollte, mit<br />
einer einheitlichen Häuserfront. Hier hatte der tatkräftige Schultheiß Ziegler bei seinem<br />
Gemeindekollegium in einer vielstündigen Dauersitzung großen Widerstand zu brechen.<br />
Und was war damit geschaffen worden? Unsere Gartenstraße, die schon viele Jahre mit<br />
ihrem fast kleinstädtischen Gepräge der Stolz des Dorfes ist, die auch dem ständig<br />
wachsenden Verkehr volle Genüge bietet, obwohl ihr beim neuerlichen Bau der Kanalisation<br />
der Platz zu zwei Gehwegen weggenommen wurde.<br />
Wie der Vogel Phönix aus der Asche, so entstand das Dorf zu neuem Leben. Das war kein<br />
Wunder, denn neben dem großen Fleiß der Bevölkerung trugen auch die sonstigen Umstände<br />
dazu bei. Zehn Jahre waren verstrichen, seit in Versailles die Einigung der deutschen<br />
Stämme erfolgt und daraus des "Reiches Macht und Herrlichkeit" erblüht war. Es war die<br />
Zeit der "Gründerjahre", die allerdings mit den 90er Jahren ihren Höhepunkt überschritten<br />
hatten und auch mancherlei Verluste nach sich zogen. Für das Dorf aber floss ein reicher<br />
Gabensegen. Viele Wagen Heu und Stroh wurden eingeführt, auch Korn und Mehl, Kleider<br />
und Haushaltsgegenstände, und vor allem auch reiche Geldspenden <strong>von</strong> nah und fern. Unter<br />
den letzteren war auch eine solche des königlichen Hauses. Und zwar <strong>von</strong> der jugendlichen<br />
Gattin des künftigen Thronfolgers, Prinz Wilhelm, einer geborenen Prinzessin <strong>von</strong> Waldeck-<br />
Pyrmont.<br />
Heute, wo der Leser in den Zeitschriften mit einer Überfülle <strong>von</strong> Schilderungen der<br />
Scheidungs- und Liebesaffären ausländischer Potentaten gefüttert wird, darf doch auch<br />
einmal das Bild eines deutschen Fürstenpaares gezeichnet werden, das nicht in sinnlosem<br />
Luxus seine Zeit verbrachte, sondern auch für das einfache Volk ein fühlendes Herz, und<br />
wenn es galt, eine offene Hand hatte. Vor den Toren Ludwigsburgs, in seinem Landhaus<br />
"Marienwahl" führte das fürstliche Paar ein vorbildliches Familienleben. Man konnte die<br />
jugendliche Fürstin sogar häufig im Garten die Wäsche ihrer Kinder aufhängen oder<br />
abnehmen sehen! Sie scheute sich auch nicht, an Markttagen sich mit ihrer Köchin unter die<br />
Ludwigsburger Hausfrauen zu mischen, um die Güte der feilgebotenen Butter oder die<br />
Festigkeit der Kraut- und Salatköpfe selbst zu prüfen. Daß sie dabei die ehrerbietigen Grüße<br />
der Marktbesucher freundlich erwiderte, versteht sich <strong>von</strong> selbst. Ebenso konnte es sein, daß<br />
sie mit mütterlichem Lächeln einem der eifrig knicksenden Ludwigsburger Kinder die<br />
Wange streichelte und nach seinem Namen fragte. "Ich habe auch zwei zu Hause", sagte sie<br />
wohl voller Mutterstolz zu den Zuschauern. Doch das war im ganzen Schwabenländle<br />
bekannt, das bestimmt auf die Fürstenkinder Pauline und Ulrich genau so stolz war wie jetzt<br />
Old-England auf die Königskinder Charles und Anne.<br />
Doch für das königliche Haus auch Prinzeß Katharina, eine Tochter Wilhelms I. lebte noch -<br />
kam ein erster schwerer Schlag. Der kleine Prinz starb nach kurzer Krankheit. Der Schmerz<br />
darüber war so groß, daß sogar Stimmen laut wurden ob der Kleine eines natürlichen Todes<br />
gestorben sei. Doch das stand außer Zweifel. Dadurch war ihm freilich das harte Los erspart<br />
geblieben, im Jahr 1918 zusammen mit seinem, königlichen Vater der württembergischen<br />
Krone entsagen zu müssen, die seine Vorfahren in Ruhm und Ehren getragen haben. Doch<br />
da<strong>von</strong> hatte man ja in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch keine Ahnung.<br />
jedenfalls traf vor allem die junge Mutter dieser Schlag aufs tiefste. Schon im April des<br />
folgenden Jahres ging sie ihrem Büblein im Tode nach. Sie wurde an seiner Seite auf dem<br />
alten Friedhof in Ludwigsburg beigesetzt, wo vier Jahrzehnte später ein müde gewordener<br />
Mann, Württembergs letzter, so gütiger König auch seine letzte Ruhestätte fand. Noch heute<br />
ist diese Grabstätte das Ziel vieler Besucher, die mit Wehmut einer versunkenen Zeit<br />
gedenken. Auch in Gechingen scheint der frühe Tod der Prinzeß Marie Teilnahme ausgelöst<br />
48
zu haben. Schon im Jahr 1883 entschloss sich das Gemeindekollegium - und diesmal<br />
natürlich einstimmig der Dahingeschiedenen ein würdiges Denkmal zu setzen. Dies geschah<br />
in Form einer Dorflinde, die am Zusammenschluss <strong>von</strong> Mühlweg und Gartenstraße nebst<br />
einem zierlichen Brunnen ihren Platz fand und Marienlinde getauft wurde. Sie hat schon viel<br />
erlebt, diese zum stattlichen Baum gewordene Dorflinde. Chor- und Instrumentalkonzerte<br />
fanden unter ihr statt, Preisverteilungen usw. Des Dorfes sportfreudige Jugend hat im Lauf<br />
der Jahrzehnte die abschließenden eisernen Stangen so heftig benutzt, daß sie zum Teil aus<br />
den Fugen geraten sind.<br />
Wenn nun die Gemeindeverwaltung die längst geplante Renovierung dieses Plätzleins<br />
vornehmen läßt, sei der Vorschlag gemacht, am Lindenbaum eine Gedenktafel anzubringen,<br />
etwa mit der Aufschrift: "Marienlinde - In dankbarer Erinnerung an Prinzeß Marie <strong>von</strong><br />
Württemberg und ihre hochherzige Spende bei der Brandkatastrophe im August 1881." Denn<br />
einem edleren Zweck kann keine Dorflinde dienen, auch wäre es ein echter Beweis der<br />
Verbundenheit zum Heimatgeschehen. Und wenn die Linde dazu noch unter Denkmalschutz<br />
gestellt wird, dann wird es hoffentlich keinem Menschen mehr einfallen ausgerechnet dort<br />
alte Büchsen und Scherben wegzuwerfen! Also Glückauf zum guten Werk!<br />
Hat uns der Weg in die Vergangenheit geführt, so wollen wir zum Schluß noch einiger über<br />
80jährigen Geburtstagskinder gedenken, die in Lauf des kommenden Vierteljahres<br />
hoffentlich in der seitherigen Rüstigkeit ihr Wiegenfest feiern dürfen. Ende August begeht<br />
Frau Luise Schneider geb. Class ihr 93. Wiegenfest in erfreulicher geistiger Frische, wenn<br />
auch körperlich etwas behindert. Außer dem in den 90er Jahren lebenden Simon Schneider,<br />
genannt der "Semmele", weiß kein Kirchenbuch <strong>von</strong> einem solch patriarchalischem Alter zu<br />
berichten. Anfang September feiert Kunstmaler Adolf Kielwein im Pauline-Krone-Heim in<br />
Tübingen noch sehr frisch und munter seinen 90. Geburtstag. Durch seinen hier geborenen<br />
Vater und seine Gattin ist der Künstler dem Dorf innig verbunden, zumal er auch viele Jahre<br />
seinen Lebensabend hier verbrachte.<br />
Anfang Oktober kann Altmesnerin Rösle Kneipp-Kaufmann auf 84 Jahre zurückblicken;<br />
leider ist sie schon jahrelang ans Haus gefesselt. Der Dorfälteste, Ferdinand Breitling, feiert<br />
Mitte Oktober seinen 87. Geburtstag. Noch heute kann man ihn, wie vor Zeiten, zusammen<br />
mit seiner Tochter die Kunden bedienen sehen in dem <strong>von</strong> seiner Mutter übernommenen<br />
Laden. Ende Oktober dürfen wir ein ebenfalls hochbetagten Geburtstagskind<br />
beglückwünschen; es ist Frau Luise Ziegler geb. Günther, eine Schwiegertochter des<br />
eingangs erwähnten Schultheißen Ziegler, die sich vor mehr als 60 Jahren hierher<br />
verheiratete. Die Frau Alt-Hirschwirtin zählt 94 Jahre; sie lebt jetzt im Altenstift in<br />
Herrenberg und weilte zuvor anderthalb Jahre bei ihrem Sohn in den USA. Die alte Frau läßt<br />
es sich aber nicht nehmen, je und dann ihr hiesiges Heim aufzusuchen und wie ehedem ihre<br />
Einkäufe zu machen. Den Abschluss unserer Jubilare bildet Anfang November<br />
Schreinermeister Christian Rüffle, der 84 Lebensjahre zählt und noch immer nach besten<br />
Kräften tätig sein will.<br />
Haben wir mit leuchtenden Tagen und einer flammenden Nacht begonnen, so sollen diese<br />
Zeilen ausklingen mit einem stillen Abendfrieden, den wir den greisen Geburtstagkindern<br />
wünschen.<br />
49
Ein Erinnerungsblatt zum 5. Todestag des<br />
Gechinger Heimatforschers<br />
Oberlehrer Karl Friedrich Essig, Dagersheim 1961<br />
"Mein Dörfchen du am Schwarzwaldrand, dich hab ich stets geliebt, wie wohl`s im schönen<br />
Schwabenland noch manches solche gibt. Doch Ferienfreude lachte mir in dir gar freundlich<br />
zu, vertraut war Wald- und Feldrevier, Heimat, wie schön bist Du!“<br />
Wenn er noch leben würde, unser Freund und Vetter, er werde bestimmt, wie schon öfters<br />
sagen: Dieser Vers ist mir aus dem Herzen gesprochen. Und wir würden darin<br />
übereinstimmen, dass es in unsrer Kinderferienzeit nichts Schöneres gegeben hatte, als wenn<br />
uns das Dampfross der Schwabenresidenz entführte zum unbeschwerten Aufenthalt in den<br />
Elternhäusern in unserem Gechingen. Wenn wir alle die Schulsorgen zurücklassen durften<br />
und uns hier <strong>von</strong> der taufrischen Morgenfrühe bis zum blinkenden Abendrot an all dem<br />
erfreuen durften, was das sommerliche Land an Freude für ein Kinderherz zu bieten hatte,<br />
und was liebe Angehörige für es bereit hielten. Das würden wir alles hervorheben, wenn - ja<br />
wenn nicht der 3. August des Jahres 1956 gewesen an welchem Karl Friedrich Essig die<br />
Augen zum letzten Schlummer schloss, erst 54.jährig! Als er die treue Gattin, seine vier<br />
blühenden Kinder und die greise Mutter allein lassen mußte, in einer Welt, die auch ihm<br />
manches Schwere aufgelegt hatte, die er aber so innig liebte und im kleinen Kreis seiner<br />
geliebten Heimat, gründlich zu erforschen suchte und auch erforscht hat.<br />
Wenn nun in nächster Zeit das Gechinger Heimatbuch herausgegeben wird, so wird man<br />
sehen, mit welcher Hingabe er an diesem Werk hing, wie weit er den "Weg zurück" ging,<br />
um das Schicksal der Heimat zu ergründen, das seine Gattin, übernahm. Es war ein<br />
kostbares Vermächtnis, das seine Gattin, Frau Hedwig Essig übernahm, aus der Fülle <strong>von</strong><br />
Geschehnissen und Feststellungen ein handliches und erschwingliches Buch<br />
zusammenzustellen. Dankbar betont sie immer wieder die hervorragend fachkundliche<br />
Bearbeitung die ihr Herr Landrat Hess, Böblingen, bei dieser Arbeit zuteil werden ließ. Aber<br />
einer weiteren Persönlichkeit soll gedacht sein, die mit inniger Anteilnahme und warmem<br />
Herzen an diesem Werk hing, nämlich' die Mutter, Frau Marie Gehring-Essig, die nach<br />
bestem Ermessen der Schwiegertochter zur Seite stand, bis ein jäher Tod sie vor Jahresfrist-<br />
am 3. August 1960, im Gespräch mit der Schreiberin dieses, heimholte, ein letztes<br />
freundliches Lächeln ging in einem großen fragenden Staunen unter. Wir dürfen sicher sein,<br />
so sehr Karl Friedrich im Äußeren seinem in Frankreich im 1. Weltkrieg gefallenen Vaters,<br />
Buchhändler Friedrich Essig glich, so sehr hat ihm die Mutter die Heimatliebe ins Herz<br />
gegeben. "Wenns an die Heimatliebe geht, dann bist du eine Maiere" pflegte sie die<br />
geborene Maier, mir zu sagen, "und dann erinnerst du mich an meinen Karl." Wir bedauern<br />
nun sehr daß sie das abgeschlossene Werk ihres einzigen Sohnes nicht mehr erleben durfte.<br />
"Der Weg zurück!" Die Erinnerung und das Gedenken vergangener Zeiten haben in unseren<br />
lauten und raschlebigen 'Tagen wenig Raum, und doch sind sie ein starker Halt für jedes<br />
Menschenherz. Das hat der Verfasser - vielleicht in der Ahnung seines früh vollendeten<br />
Lebens - wohl gewusst! Man muß nur zum Beispiel einmal den Abschnitt gelesen haben,<br />
den er dem Stolz der alten Dorfleute, unserer Gechinger Mühle und ihrer, wie er selbst<br />
schreibt, nicht zu vergessenden schönen Lage widmet, um zu wissen, wie er die Heimat<br />
empfand, jene Ahnenheimat, in die im Jahre 1827 eine "Maier" einzog, die erste der<br />
Brackenhammerfrauen aus dem Dorf und die Tochter eines unsrer gemeinsamen Ahnen.<br />
Dem Schicksal dieses Hauses und Geschlechts ist in der überreichen Fülle des Gebotenen<br />
ein besonderes Kapitel gewidmet.<br />
Aber verlassen wir die Zeit unserer eigenen Erinnerung und wandern wir gleichsam in die<br />
tiefste Vergangenheit zurück, nicht ohne vorher einen Abstecher in den Lebensraum unsrer<br />
Feldmark zu machen mit allem was heute noch unser Dasein umgibt, die<br />
50
Wasserverhältnisse, der Boden und seine Güte (daß wir seit alters das Schlehengäu sind,<br />
werden wir wohl auch hören) die Pflanzen, Tiere, das Klima die Witterung. Ja, und die<br />
Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte! Was wird es da nicht zu lesen geben, unser<br />
Ortschronist hat vor 10 Jahren das Landesamt für Denkmalpflege veranlasste, im<br />
Dachtelerbergwald eine fachkundige Grabung vornehmen zu lassen, die interessante<br />
Ergebnisse zeitigte. Wir sind seit damals "hellsichtig" geworden und haben plötzlich eine<br />
Menge Keltengräber entdeckt, die wir vorher für inhaltslose Steinriegel hielten. Aber nicht<br />
nur mit den Kelten, die sich später in die Bretagne und über Meer nach Schottland und Irland<br />
wandten, sondern auch mit den Alamannen und Franken befasst sich die Chronik. Mit dem<br />
Hause Württemberg, dem Ortsadel. mit den Grundherren, den Lasten der Bauern und<br />
Leibeigenen. mit den Kriegsschicksalen und den Heimsuchungen. Es ist eine reiche Fülle,<br />
die uns erwartet.<br />
Es folgt das Dorf mit seiner Entwicklung, mit Straßen und Gassen, Schule und Kirche,<br />
Rathaus und öffentlichen Gebäuden, die sicher uralten Fleckenbücher, die alten Gebräuche,<br />
kurzum die ganze "alte Zeit".<br />
Es kommt die Familienkunde mit den alten Gechinger Geschlechtern und den heutigen<br />
Bürgern, die Ehrenbürger ebenso wie die Auswanderer. Es erscheinen Persönlichkeiten und<br />
Originale, besondere Namen und Einzelschicksale. Mancher Leser wird auf unbekannte<br />
Ahnen stoßen.<br />
Vom "Weg zurück" kommen wir wieder zum Ausgangspunkt, zum Schöpfer dieses Werks<br />
Karl Friedrich Essig. Es ist der Wunsch seiner Angehörigen, sein Werk und Wesen mit<br />
diesen Zeilen zu ehren. Und in einem Abschnitt wird er uns noch einmal, und hoffentlich<br />
auch in seiner humorvollen Art, als Erzähler geschildert.<br />
Zuletzt kommt die Neuzeit zu Wort. Zu der "ewig stille stehenden Vergangenheit" gesellt<br />
sich das "pfeilschnell-entflogene Jetzt". Wie die treue Sachwalterin, Frau Hedwig Essig<br />
einmal schrieb: "Eine Ortschronik läßt sich nie vollenden, weil das Leben ständig<br />
weitergeht." So hat auch das letzte Halbjahrzehnt dem geliebten Heimatdorf ein völlig<br />
anderes Gesicht gegeben. Die Kreuzform des Dorfes hat sich mit Baulichkeiten, nach Osten<br />
und Westen wesentlich erweitert. Für neue Siedlungen werden im Süden und Norden große<br />
Vorbereitungen getroffen. Neue Aussiedlungshöfe entstanden und entstehen im Osten,<br />
Norden und Süden der Feldmark.<br />
So ist Gechingen mächtig auseinandergezogen und wir sind es dem Dorfe schuldig, das uns<br />
allen - auch den Neubürgern - schützende Heimat ist, daß wir seine Tradition in unserer<br />
traditionslosen Zeit ehren. Wir sind sie aber auch dem Heimgegangenen schuldig, der den<br />
Seinen und uns allen solch kostbares Vermächtnis hinterließ.<br />
In diesem Sinne wünschen wir dem Gechinger Heimatbuch den verdienten Erfolg und<br />
grüßen den stillen Hügel des Verfassers auf unserm "Weg zurück".<br />
51
Briefe des Prälaten, (Auszug <strong>von</strong> TJ 1961)<br />
239.12.1869: "Daß ich diesen Herbst beinahe Prälat <strong>von</strong> Tübingen geworden wäre, hast du<br />
wohl auch erfahren, da es wenigstens Herr Kopp (Lehrer in Gechingen) wußte. Ich war der<br />
Zweite im Vorschlag, Dekan Georgii <strong>von</strong> Tübingen der Erste! Der Minister Härlich hat mich<br />
wollen. Georgii aber hatte unmittelbare Verbindungen mit dem königlichen Haus. (Der Prinz<br />
Wilhelm wohnte in seinem Haus) Und dies wurde dahin wirksam, daß der König ihn<br />
ernannte. Um diese Stellen kann man sich nicht melden, ich hätte es daher auch nicht getan.<br />
Die Sache kam ganz ungesucht an mich, wohl in Folge meiner Tätigkeit bei der<br />
Landessynode. Es wäre für mich gar zuviel gewesen, so sollte es nicht sein. Ich hätte nun<br />
leicht Dekan in Tübingen werden können, aber ich meldete mich nicht, weil ich bei meinem<br />
Gesundheitszustand dieses schwere, ausgedehnte Amt in der großen Stadt und Diezöse nicht<br />
mehr übernehmen könnte."<br />
Auszug aus Brief vom Dezember 1870:<br />
"Um auch noch einiges <strong>von</strong> uns beizufügen, kann ich sagen, daß es mit unserer Gesundheit<br />
erträglich, wenn auch nicht ohne Anstoß geht. Vorigen Sommer hatte ich keinen Vikar, bin<br />
daher gar nicht <strong>von</strong> hier fortgekommen, mit Ausnahme <strong>von</strong> 6 Tagen, die ich beim<br />
Landessynodal - Ausschuss in Stuttgart verbringen musste. Jetzt habe ich wieder einen<br />
Vikar, Kolb aus Basel, einen lieben jungen Mann.<br />
Der schreckliche Krieg, dessen Ende ich auch mit herbeisehnen möchte, hat mir auch in<br />
meinem hiesigen Amt mit besonderen Predigten und Reden und mit dem<br />
Unterstützungswesen in der Stadt und dem Bezirk viel Geschäfte gebracht.<br />
In den Verlustlisten aus den Kämpfen des 30. Nov. und 2.Dez. habe ich auch mehrere<br />
Gechinger als tot oder verwundet gelesen. Heute habe ich eine Trauerpredigt für die<br />
Gefallenen gehalten. In der vorigen Woche bewegte mich eine wichtige Sache. Das<br />
Konsistorium ließ mich durch Prälat Mehring, des deswegen hierher kam, anfragen, ob ich<br />
nicht die erledigte Stelle eines Prälaten in Ulm, wenn der König mich benennen würde,<br />
annehmen könnte und wollte. Die Antwort solle sogleich oder bis zum anderen Morgen<br />
erfolgen, da der König schnell, wegen des Landtages einen Prälaten ernennen wollte. Ich<br />
stand vor einer schweren Entscheidung. Aber mit dieser Stelle ist auch die, des ersten<br />
Frühpredigers im Münster in Ulm, der größten Kirche Deutschlands, verbunden und ich<br />
könnte es bei meinem Halsübel, das zwar größtenteils, aber nicht ganz geheilt ist und<br />
besonders im Winter mich hindert, auch nicht wagen, eine Predigerstelle in diesen weiten,<br />
kahlen Hallen auf mich zu nehmen. Auch ist Ulm ungesund, rauh und kalt im Winter. Es ist<br />
eine uns ganz fremde Stadt und mein Sprengel wäre Oberschwaben gewesen, ein mir auch<br />
ganz unbekanntes Land. So konnten wir uns nicht entschließen hinzugehen und ich<br />
telegraphierte am anderen Morgen "Nein" nach Stuttgart. Auf jede andere Prälatur wäre ich<br />
gerne gegangen. Ob mir noch eine solche zu Teil wird, steht dahin. Es ist seitdem Dekan<br />
Lang <strong>von</strong> Heilbronn ernannt."<br />
Im Jahre 1871, dem Todesjahr seines einzigen Bruders, wurde Karl Friedrich<br />
Brackenhammer die Prälatur <strong>von</strong> Heilbronn übertragen. Er trat in ein großes und weites<br />
Arbeitsgebiet ein, als ihm nun das Mitraten und Taten in der Ordnung der kirchlichen<br />
Verhältnisse anvertraut waren. Bis zu seinem 70. Lebensjahr stand er in der treuen Arbeit<br />
des Dienstes. Seine Gesundheit gebot ihm dann, die Ruhe aufzusuchen. Nach kurzem<br />
Aufenthalt in Stuttgart nahm er seinen Wohnsitz in Tübingen, der Vaterstadt seiner Frau. Im<br />
Jahre 1889 suchte er noch Bad Liebenzell auf und dabei auch seine alte Heimat, die<br />
Gechinger Mühle. Er konnte auch noch sein 50. jähriges Ehejubiläum feiern, aber dann<br />
nahmen seine Kräfte ab und am 20.Okt. desselben Jahres ist er sanft und ohne Schmerzen<br />
eingeschlafen.<br />
Jakobus 3.Vers 18 II. Samuel 7 Vers 18.<br />
52
Die vorgenannten letzten, in Familienbesitz befindlichen Briefe hatte vom Pfarramt<br />
Gechingen die Gattin des verstorbenen Heimatforschers Frau Hedwig Essig in Verwahr. In<br />
dem Brief vom Jan.1870 ist mit PS ein Geschenk an seine jüngste Nichte, die im Sommer<br />
geheiratet hatte beigefügt. "Ich bitte dich daher, ihr den inliegenden 10 Guldenschein noch<br />
nachträglich als solches zu übergeben. Gerne würde ich auch bald wieder erfahren, wie es dir<br />
geht. Ich bitte um Nachricht, wenn auch in Kürze."<br />
(Wappen des Hauses Brackenhammer 1961)<br />
Dem Andenken meiner lieben Großmutter Friederike Böttinger geb. Brackenhammer 1845-<br />
1914<br />
Das Wappen: Ein gülden Krönlein, ein kleiner Hund.<br />
Ein silbernes Mühlrad auf blauen Grund,<br />
ein eiserner Helm mit geschlossnem Visier.<br />
Das stellt der Ahnen Wappen für!<br />
(Ahnenliste siehe Familienbuch Gechingen, Fritz Roller)<br />
Von silbernen Brunnen einsamen Wegen und blühenden Linden 1962<br />
(Bächle em Wiesatal)<br />
Es war ein strahlend schöner Frühsommerabend vor mehr als 40 Jahren, als auf einer Höhe<br />
über Gechingen diese Weise entstand, die lange Zeit das Gechinger Heimatlied der Kinder<br />
war, barg sie doch alles was eine geruhsamere Zeit für ein Kinderlied brauchte. Die ganze<br />
schlichte Schönheit des Irmtales mit seinem blitzenden Wasser, den grünen Wiesen, den<br />
weiten Feldern und den rauschenden Wäldern. "Waldumrauscht und traumumschlungen<br />
liegst du Heimat mir im Grund", beginnt das Gechinger Heimatlied, welches einst<br />
Chormeister Unger seiner Sängerschar widmete. Aber <strong>von</strong> all der Poesie und Stille hat vieles<br />
die neue Zeit mit ihrer Materialisierung und Motorisierung endgültig beseitigt. Wer heute<br />
<strong>von</strong> der Höhe das Dorf betrachtet, der findet nicht nur große bauliche Veränderungen, nein,<br />
durch die Hauptstraßen flutet zu Zeit ein Verkehr <strong>von</strong> Bussen, Auto und Treiben das fast<br />
städtisch anmutet. Und wer nach dem "Bächle em Wiesatal" schaut, liebe Zeit! Im Dorf ist<br />
es seit einigen Jahren ganz verschwunden und nur wo es, bei den Krautgärten wieder zu<br />
Tage tritt, ist es ein gar trüber Geselle geworden, muß es doch seit der Kanalisation all die<br />
vielen Abwässer des Dorfes aufnehmen, so daß die vorbereitete Kläranlage einem<br />
dringendem Bedürfnis entspricht.<br />
Und doch gab es einmal eine Zeit, da war die rasche helle Irm, die auch den weniger<br />
schönen Namen Sau trägt, mit ihren vielen Quellen der ganze Stolz der Dorfleute. Gewiss,<br />
schon 1906 wurde aus dem oberen Tal der Stöckbrunnen für die Hochdruckwasserleitung als<br />
natürlicher Zufluss gewonnen und dem Reservoir am Calwer Weg zugeleitet. So floss nur<br />
noch ein dünnes Rinnsal als Furtbach bis zur Wette am Kasernenhof, wo, in Scheune und<br />
Keller entsprungen, neue Wasser zuflossen. Im unteren Tal aber, unweit des Mühlweges<br />
traten die starken Wasser des Weiherbrunnen zu Tage, die den Mühlbach stärkten und fast<br />
53
ein Jahrtausend den Gang des Mühlrades bestimmten, <strong>von</strong> der Klostermühle der Hirsauer<br />
Mönche bis in die 50ger Jahre dieses Jahrhunderts. Als vor 90 Jahren mein Urgroßvater<br />
Johann Jakob Brackenhammer die Augen zum letzten Schlummer am 8.7.1871 schloss, hatte<br />
er seinem einzigen Sohn und Erben das Vermächtnis hinterlassen, seinen Weiherbrunnen<br />
sorglich einzufassen, was denn auch geschah. So konnte man sich lange Zeit, auf wenigen<br />
Stufen abwärtssteigend, an dem würzigen Wasser erfrischen. In trockenen Jahren holten sich<br />
auch manche Dorfbewohner dort ihren Wasservorrat. Kam aber einmal ein starker<br />
Wolkenbruch, dann konnte die ganze Gesellschaft <strong>von</strong> Quellen und Quellchen recht<br />
übermütig werden, es strömten <strong>von</strong> den Höhen und vom sogenannten Bettelgraben, der jetzt<br />
auch kanalisiert ist, reißende Wasser herein, überfluteten die am Bach gelegenen Dorfstraßen<br />
und wenn sie unsere Mühle erreicht hatten, half keine Falle mehr, Hof und Brücke waren<br />
ohnehin überflutet, aber auch <strong>von</strong> oben, wo die Wasser sonst brav das Mühlrad drehten,<br />
schwappten sie über, liefen den Mühlebewohnern durch Flur und Wohnstube und munter die<br />
Haustreppe hinab in den Hof.<br />
Diesem Übermut wurde in den 20ger Jahren ein Ziel gesetzt. Der Bach wurde, vom Zufluss<br />
des Weiherbrunnen an kanalisiert, so daß das nicht mehr zum Mahlen benötigte Wasser<br />
ablief. Es gab damals ängstliche Gemüter, die für die Schönheit unseres Wiesentals<br />
fürchteten. Aber dies traf nicht zu! Zwar fiel das Mühlwegle am Bach entlang aus, doch war<br />
das kein Fehler, es kam niemand mehr in zappendusterer Neumondnacht in Gefahr ein<br />
unfreiwilliges Fußbad zu nehmen.<br />
Nun war also das "Bächle em Wiesatal" zeitgemäß versorgt und Gechingens Kinder konnten<br />
wie eh und je im sonnigen Frühjahr ihre Schlüssel- und Schmalzblumensträuße nach Hause<br />
tragen und das kleine fröhliche Liedlein singen. Aber auch die Mühle ging mit der Zeit, sie<br />
wurde modernisiert und das Mühlrad abgebrochen. Wenn die beiden, im Osten vermissten<br />
Müller, Eugen und Richard Brackenhammer ihre heimatliche Mühle betreten würden, sie<br />
müßten sich wohl erst <strong>von</strong> ihrem Sohn und Neffen Jörg die nötigen Handgriffe lehren lassen.<br />
"Die Mühle am rauschenden Bach" ist auch ein verklungenes Idyll!<br />
Dabei sind es im Jahre 1964 genau 200 Jahre, daß der Schultheiß und Lammwirt Johann<br />
Jakob Brackenhammer für seinen Sohn gleichen Namens den Teil der Mühle erwarb, der<br />
noch seinem Schwager Weinbrenner gehört hatte. Wir werden <strong>von</strong> dem wechselvollen<br />
Schicksal unserer Mühle einmal im Heimatbuch nachlesen können. Jedenfalls aber geht<br />
schon der 7. Müller Brackenhammer seinem uralten und doch so neuzeitlich orientierten<br />
Gewerbe nach.<br />
Aber was war nun das Los des so sorglich gehegten Weiherbrunnen? Die Gemeinde<br />
Gechingen erwarb die uralte "Wassergerechtsame" <strong>von</strong> der Mühle und baute eine<br />
Pumpanlage und sprach auch schon <strong>von</strong> einem Freibad. Aber es kam etwas ganz, ganz<br />
anderes. Und wenn das Wasser ein ruheloser Wanderer ist, so trifft das bei unserem<br />
Weiherbrunnen zu. Droben auf stolzer Bergeshöh bei der "Eisengrube" und in der<br />
fruchtbaren Einsamkeit der "Weitenselte" entstanden 5 neuzeitliche Höfe, denen der<br />
Weiherbrunnen sein Wasser spendete. Auf dem Hohen Angel wird bald ein Wasserturm<br />
entstehen. Schon aber frisst sich der Bagger hinüber in die Dachtgrube wo drei weitere<br />
Siedlungshöfe versorgt werden müssen. Dort hat unser Weiherbrunnen aber fast sein<br />
unterirdisches Bachbett, das <strong>von</strong> Simmozheim herführt, wieder erreicht und dort, ganz in der<br />
Nähe im Pfaffengrund, nahe der Ostelsheimer Markung, soll auch die Quellstube des<br />
Hungerbrunnen sein, der in nassen Jahren - unheilverkündend - durchs Ösental fließt. Und<br />
damit sind wir mitten drin in einer mündlich überlieferten Dorfsage, der Geschichte vom<br />
"verfluchten Heidacker", vom versunkenen Kloster und vom Mönchweg. Dort beginnt er,<br />
der sagenhafte Weg, der sich dann quer durchs Tal, nun in den Ortsplan eingefügt, hügelab<br />
und hügelauf bis zum Dachtler Weg zieht. Zuvörderst aber gilt es an dem Bannfluch des<br />
54
"Heideacker" zu rätseln, <strong>von</strong> dem kein Mensch etwas Sicheres weiß. Tatsache ist nur, daß<br />
inmitten <strong>von</strong> Acker und Wiesen, nahe am Ostelsheimer Wald ein Stück echtes Heideland ist,<br />
auf welchem, auf unserer Markung einmalig, im Spätsommer die blauen Glöckchen der<br />
Erika blühen. Dort gab es auch, bis vor wenigen Jahren, zwei steinerne Pfosten, die auf eine<br />
menschliche Behausung in uralten Zeiten schließen lassen. Aber ein Mönchskloster ist es<br />
kaum gewesen, eher eine Waldbruderklause oder ein Rasthaus. Denn der Mönchweg diente<br />
nicht zum freundnachbarlichen Besuch der Nonnen in unserem fruchtbaren Nonnental,<br />
sondern es war ein Wanderweg Weilderstätter Klosterknechte, welche in jenem Tal die<br />
Güter der Weiler Klosterfrauen bebauten. Dies wird bestätigt durch einen Vermerk in<br />
Sauters "Die Klöster <strong>von</strong> Württemberg" welcher lautet: "Im Jahre 1308, 12. Januar,<br />
verkaufte eine Weilderstätter Frauensammlung all ihr Gut zu Gechingen an das Kloster<br />
Bebenhausen um 25 Pfund Heller". So ist es also nichts mit einem Weg zwischen Mönch-<br />
und Nonnenkloster, weil diese nie existierten. Dann wird auch der Bannfluch des Heidackers<br />
nicht mit Klosterleuten zusammenhängen. Den frommen Weiler Frauen wird jedenfalls der<br />
Gechinger Besitz zu entfernt und unsicher gewesen sein. Denn auch das Gechinger<br />
Heimatbuch wird einmal <strong>von</strong> einer hiesigen Edelfrau berichten, einer Judel <strong>von</strong> Gechingen,<br />
die sich mit ihrem Besitz in Weil der Stadt ankaufte.<br />
Dem Mönchweg aber, der seinen Namen durch so viele Jahrhunderte treu bewahren konnte,<br />
wurde neue Aufgabe zugewiesen, welche mit der des Weiherbrunnen eng zusammenhängt.<br />
Er birgt nun in seinem Schoße die Rohre für das Wasser zur Bergwaldsiedlung und die<br />
Telefonkabel. Er hat dort wo er das östliche Dorf durchschneidet schöne Tafeln mit seiner<br />
Namensbezeichnung bekommen und führt <strong>von</strong> dort als bequeme, wenn auch steile Straße bis<br />
zu den Friedenslinden <strong>von</strong> 1879/71.<br />
Unsere Friedenslinden! Wie haben sich unsere lieben Alten immer gefreut, wenn sie <strong>von</strong><br />
jener stolzen Feier erzählen konnten, bei welcher nach dem Friedensschluss die 12 Bäume<br />
gesetzt wurden und die einsame Heide zum stolzen Festplatz ernannt wurde. Was mag das in<br />
dieser noch so bescheidenen Zeit bedeutet haben, als dort oben in großen Kesseln Suppe<br />
gekocht wurde und heiße Würste und Wecken und Brezeln verteilt wurden. Aber auch der<br />
Ernst kam zu seinem Recht in begeisterten Ansprachen <strong>von</strong> Pfarrer, Schultheiß und alten<br />
Soldaten. Pfarrer Stortz muß ein banges Ahnen erfasst haben, trotz der fröhlichen Menschen<br />
und des wunderbaren Bildes das sich vor ihm ausbreitete: Im Süden die blauen Albberge, im<br />
Westen Höhen des Calwer Waldes, unten im Tal sein Dorf, umrahmt <strong>von</strong> einer vielfältigen<br />
Landschaft. Er sprach die inhaltsschweren Worte: "Wenn diese Linden sterben, wird das<br />
Reich vergehen!"<br />
Es gingen viele Jahre in ruhigem Gleichmaß. Der Festplatz sah zwar keine fröhlichen Feste,<br />
höchstens turnende Kinder, aber er gehörte zum Dorf wie seine Kirche. Dann erlebte er noch<br />
ein einziges Mal einen stolzen Tag, im Oktober 1913. Man feierte die 100jährige<br />
Wiederkehr der Völkerschlacht bei Leipzig, welche Napoleons Macht brach. In Leipzig hatte<br />
sich der Deutsche Kaiser und alle Bundesfürsten mit den russischen und österreichischen<br />
Verbündeten zur Weihe des Völkerschlachtdenkmals versammelt: Und <strong>von</strong> der Maas bis an<br />
die Memel wurde gefestet und gefeiert. Allein im Hofe des Stuttgarter Schlosses fanden sich<br />
24 000 Schulkinder versammelt. Und abends loderten allenthalben mächtige Flammenstöße<br />
zum Himmel. So auch bei den Friedenslinden auf dem Gechinger Festplatz und mehr als 30<br />
Feuer konnte man zählen. Aber es war das letzte leuchtende Fanal des Friedens im<br />
Deutschen Reich <strong>von</strong> 1870.<br />
Ein Jahr später tobte schon der Krieg in Ost und West, das Deutsche Volk begann seinen<br />
ersten Opfergang. Noch immer standen die Linden unversehrt. Da, am Ende des 2.<br />
Weltkriegs, zum Abzugsgefecht, hatte sich eine Artilleriestellung in ihren Kreis eingebaut<br />
und ballerte des Abends noch ins Nagoldtal. Dann machte sich ein Teil der Linden zum<br />
55
Sterben bereit, das Reich war ja zerstört............<br />
Aber nun beginnt dort oben neues Leben. Die Menschen wollen sich aus dem motorisierten<br />
Lärm des Wirtschaftswunderlandes in die kühle Einsamkeit der Bergwelt mit ihren<br />
Bungalow flüchten. Die wenigen Friedenslinden, deren Bedeutung fast vergessen ist, werden<br />
als treue Wächter am Eingang stehen und die silbernen Wasser des Weiherbrunnen werden<br />
auch den Menschen trotz ihrer langen Wanderschaft, Erquickung bedeuten und die einsamen<br />
Wege Frieden in unsere laute Welt.<br />
Barmherzigkeit 1963<br />
Wie bei uns sind auch in Frankreich gerade die Alten und Ärmsten Opfer der unersättlichen<br />
Löhne und Preise, <strong>von</strong> denen sie überfahren werden. Auch in Frankreich macht es den<br />
Rentnern schlaflose Nächte, wenn sie ihre Wohnungen herrichten sollen. Allein 1 Zimmer<br />
kostet sie mehr als eine Monatsrente. Die neue Ausbeutung gibt ihnen keinen Rabatt der<br />
Barmherzigkeit, sondern zieht den höchsten Lohn aus ihnen heraus.<br />
Die jungen Menschen der "Operation Pinsel" kommen aus allen Berufen: Angestellte,<br />
Handwerker, Studenten, Arbeiter. Sie gaben, indem sie ihr Wochenende den Bedürftigen<br />
und Hilflosen schenkten, eine gute Antwort auf die Frage: "Wer ist denn mein Nächster?"<br />
Von diesen Bedürftigen gibt es auch in unserer Zeit des Wohlstands mehr, als man weiß.<br />
Sie sind nicht nur arm an Geld, sondern noch ärmer an körperlicher Kraft, also buchstäblich<br />
hilflos, wenn sich niemand um sie annimmt. Aber der Mensch <strong>von</strong> heute verkauft seine<br />
Dienstleistung den andern hartherziger und teurer als je, und macht keine Ausnahme. Zwar<br />
hat er durch Arbeitszeitverkürzung mehr <strong>von</strong> diesem kostbaren Rohstoff zur Hand als je.<br />
Aber nur selten teilt er den Rohstoff-Überschuss mit denen die ihn nicht haben.<br />
Gedanken zum Volkstrauertag 1964<br />
In diesem Jahr erhält der Volkstrauertag einen besonderen Akzent, sind doch jetzt 25 Jahre<br />
seit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und 50 Jahre seit dem Ersten Weltkrieges vergangen.<br />
Und wir blicken in stillem Gedenken zurück auf die 0pfer dieser beiden Kriege.<br />
Unübersehbar ist dieses Totenheer. Seine stumme Mahnung offenbart sich jedem, der den<br />
Mut hat, ihm ins Antlitz zu sehen. Da sind Jünglinge und Männer, die, in Freiwilliger<br />
Begeisterung oder dem harten Gesetz der Pflicht folgend, auf den Schlachtfeldern verblutet<br />
sind, abgehärmte Gefangene die sich hinter Stacheldraht im Heimweh verzehrten, Greise,<br />
Frauen und Kinder, die in apokalyptischen Feuernächten oder auf den Wegen gehetzter<br />
Flucht umgekommen sind, Menschen, die, um Ihres Glaubens, ihrer Rasse oder innerer<br />
Überzeugung willen den Tod erlitten haben.<br />
Es waren 6 1/2 Millionen deutscher Menschen. Aber Schmerz und Trauer lassen sich nicht<br />
in Zahlengrößen ausdrücken und nicht ermessen. Sie waren grenzenlos und sind noch immer<br />
nicht verstummt! Zu all denen, die durch das Lebensopfer liebster Menschen tief in der<br />
Wurzel ihres Daseins getroffen wurden, soll heute still unser Gruß gehen, nicht mit lauten<br />
und tönenden Worten, sondern mit einem schlichten Hände druck, der ihnen allen beweisen<br />
56
soll: Wir ahnen Euer Leid, wir kennen Eure Sorgen! Wenn wir Euch helfen können in<br />
irgendeiner Form, so laßt es uns tun!<br />
Darüber hinaus aber muß noch etwas anderes heute am Volkstrauertag gesagt werden. Aus<br />
besonderem Grunde wurde der Gedenktag für die Männer und Frauen, die Leben im Kriege<br />
dahingaben, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder wie zuallererst "Volkstrauertag" genannt.<br />
Wir begehen heute keinen Heldengedenktag mehr wie seinerzeit in den Jahren vor dem<br />
Zweiten Weltkrieg. Die Teilnehmer des letzten Krieges wissen, wie leidvoll und schwer das<br />
Sterben auch für die Tapfersten war. Alle, die ihr Leben hingaben, sei es an der Front, sei es<br />
in den zusammenstürzenden Städten, auf den Flüchtlingstrecks oder in<br />
Konzentrationslagern, waren Kriegsopfer. Auch heute wird genau so brennend und ringend<br />
wie gleich nach dem Kriege die noch ungelöste Frage nach dem Sinn dieser unzähligen<br />
Opfer gestellt.<br />
Unser Volk hatte, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, in einen gähnenden Abgrund<br />
geschaut. Wir sind nicht hinabgestürzt, sondern haben wieder aufgebaut. Aber wir haben<br />
noch einiges nachzuholen, um dem Vermächtnis der Opfer gerecht zu werden. Es genügt<br />
nicht, ihr Andenken in Ehren zu halten. Es genügt nicht, die gedankliche Verbundenheit mit<br />
den Angehörigen zu erneuern, deren Väter, Männer und Söhne nicht mehr nach Hause<br />
kamen. Das Millionenopfer wird nur dann als sinnvoll in die Geschichte eingehen, wenn<br />
feststeht, daß wir aus der Vergangenheit zu lernen und eine bessere Zukunft zu gestalten<br />
entschlossen sind.<br />
Gemeinsam wandern wir mit unseren Gedanken heute zu den letzten Ruhestätten unserer<br />
Kriegstoten. Jede Familie, die das kleine Fleckchen Erde kennt, das die Überreste ihres<br />
liebsten Menschen beherbergt, kann allein in dieser Tatsache schon ein, wenig Trost finden.<br />
Wir wissen aber, daß es für viele Hunderttausende diesen Trost nicht gibt, wenn ihnen das<br />
Wort "vermisst" ein schweres Schicksal auferlegte oder wenn das Meer, das größte<br />
Soldatengrab aller Zeiten, und Länder, ihren Sohn, den Mann oder ihren Bruder<br />
verschlungen hat. Wir wissen, daß sehr viele gerade am heutigen Tag in ungestillter<br />
Sehnsucht nach Osten blicken, wo irgendwann auf der weiten russischen Erde einmal ein<br />
schlichtes Birkenkreuz mit einem Stahlhelm darauf gestanden hat, das den Namen des Toten<br />
trug. Und wir können die ganze Bitternis wohl ermessen, die diese Menschen bewegt, wenn<br />
ihnen heute noch, so viele Jahre nach Kriegsende, eine der natürlichsten und<br />
selbstverständlichsten Menschenrechte, der Besuch der Gräber ihrer Angehörigen,<br />
vorenthalten wird.<br />
Dieses Streben, an die Gräber unserer Toten treten zu können, sie zu pflegen mit den<br />
Zeichen unserer Liebe, ist ebenfalls ein den Menschen tief eingeborener Wunsch, der seinen<br />
Ausgangspunkt in der alten Erfahrung hat, daß Gräber Trost und Kraft vermitteln können.<br />
Es geht <strong>von</strong> den Gräbern unserer Toten ein Segen aus, den schon viele, viele haben spüren<br />
können und der hoffentlich auch über den Volkstrauertag hinaus sich auf alle die erstrecken<br />
wird, die mit offenen Herzen und in ehrlicher Trauer auf die Stimme unserer Toten des<br />
Krieges hinhören, die überall und zu jeder Stunde vernehmbar sind. Denn unsere Zukunft<br />
wird weitgehend dadurch bestimmt werden, wie wir uns zu der Mahnung dieser Toten<br />
stellen. Diese Mahnung aber - darüber gibt es wohl bei keinem <strong>von</strong> uns einen Zweifel - heißt<br />
immer <strong>von</strong> neuem: Bewahret der Welt den Frieden!<br />
57
Die Glocken der Heimat 1965<br />
Wenn die Glocken der Martinskirche den Dreiklang ihrer ehernen Stimmen über die<br />
nächtliche Landschaft erschallen lassen, so bietet sich ein anderes Bild als wir es seit<br />
Jahrzehnten gewohnt waren. Das traulich im Tal liegende Dorf hat sich nicht nur sehr<br />
erweitert, nein, die Häuser sind gleichsam die Höhe hinaufgeklettert. Wo in vergangenen<br />
Zeiten sich Feld und Heide dehnten bis zu den Wäldern mit ihren Zeugen fernster Tage,<br />
grüßen jetzt freundliche Lichter ins Tal herab. Zu der etwas kalt wirkenden Straßenbeleuchtung<br />
gesellt sich der rotgoldene Schein der Lampen aus den vielen neuen Häusern,<br />
mit denen die Neubürger ihr Schicksal mit dem Dorf und seinen Alteingesessen verknüpft<br />
haben.<br />
So gilt der Gruß der Heimatglocken nicht nur dem Tal, sondern auch den Höhen und darüber<br />
hinaus der Feldmark, wo Gechinger Bauern ihre neuen Höfe, besitzen.<br />
Unsere Glocken haben ein ehrwürdiges Alter, wenigstens die beiden großen, die dritte ist<br />
schon zweimal der Rüstung der großen Kriege zum Opfer gefallen.<br />
Doch damals, im Jahre -1495 mag es ein frohes und stolzes Gefühl gewesen sein, als die<br />
Gemeinde unter ihrem Schultheiß Konrad Schneider (1475 - 1505) die <strong>von</strong><br />
Bernhard Lachamann gegossenen prächtigen Glocken in Empfang nehmen durfte und sie<br />
dem damals stumpfen Turm unterbrachte. Wie dieser Turm einst und sogar bis zum Jahre<br />
1876 aussah, kann man auf Seite 64 unseres Buches "Heimat Gechingen" feststellen, wo sich<br />
auch der Grundriss der bedeutenden Hallenkirche befindet.<br />
Die Beschriftung der der Glocken, die natürlich aus der vorreformatorischen Zeit stammen,<br />
lautet bei der größten: "Osanna heiß ich, in unserer Fraven Ehr leut ich, Bernhardt<br />
Lachamann goß mich 1495." Die mittlere Glocke bekam folgende Inschrift: "Jesus<br />
Nazerenus, Rex indeorum" (Jesus <strong>von</strong> Nazareth, der Juden König) "Bernhardt Lachamann<br />
goß mich 1495".<br />
Da diese Beschriftung eine hervorragende Kenntnis der lateinischen Kirchensprache<br />
voraussetzt, geht man nicht fehl, anzunehmen, daß der damalige Ortspfarrer Berthold<br />
Dieringer sie verfasst hat. Denn er hatte 14 Jahre zuvor die Neugestaltung der Kirche<br />
geleitet. An deren Südseite, über dem hinteren Eingang hat Karl Essig die Inschrift<br />
festgestellt: "In honorem St. Martini est delikata illa ecclesia anno domini 1481 (Zu Ehren<br />
des Heiligen Martin ist diese Kirche im Jahre des Herrn 1481 geweiht worden), Heinrich<br />
Wieland. Steinhauer, Berthold Dieringer, Pfarrer. Das ehrwürdige Gotteshaus kann also in<br />
eineinhalb Jahrzehnt sein halbtausendjähriges Jubiläum feiern.<br />
Doch nun zurück zu den Glocken und ihrem Läuten!<br />
Die kleine Glocke war also noch Im Jahre 1918 abgeliefert worden, die 1923 <strong>von</strong> der<br />
Zinngießerei Kurtz (Stuttgart) verfertigte zweite Glocke wurde im zweiten Weltkrieg geholt.<br />
Ein drittes Mal wurde im Jahre 1950 die kleine Glocke <strong>von</strong> Kurtz geliefert. Unter dem<br />
damals noch frischen Eindruck des unseligen Kriegsausgangs bekam sie die Inschrift: "Herr,<br />
hilf an tiefer Not, gegossen ward ich in schwerer Zeit, um die gefallenen Helden trag ich<br />
Leid. Kurtz, Stuttgart." Mög sie nun mit ihren großen Schwestern viele Jahre ungefährdet<br />
des Dorfes Geschehnisse begleiten.<br />
Da ist denn in der Dorfchronik und auch im Gedächtnis seiner betagten Bewohner ein etwas<br />
turbulentes Ereignis um die Glocken festgehalten. Und zwar in einem<br />
Gedicht <strong>von</strong> Johannes Böttinger, dem jüngsten aus dem Triumphirat der Gechinger<br />
Dorfdichter Adam Gehring (gest. 1898) Heinrich Schwarzmaier (gest. 1917)<br />
Johannes Böttinger (gest. 1921).<br />
In der Nummer vom 6. Januar <strong>1900</strong> des "Calwer Wochenblattes" wurde es veröffentlicht<br />
und in der Heimatchronik auf Seite 107 hat es den gebührenden Ehrenplatz gefunden. "Das<br />
Neujahrsläuten <strong>von</strong> Gechingen". Eine Strophe des Gedichts ging sogar in den Sprachschatz<br />
58
der älteren Generation ein. "Simon Krauß, der alte Recke, läutet sie mit Riesengwalt."<br />
Der Glöckner jener Stunde zog zur Jahrhundertwende den Strang der großen Glocke so<br />
kraftvoll, daß die Gechinger Musikanten, die in ihr Turmblasen eine Verschnaufpause<br />
eingelegt hatten, plötzlich zur ihrem Schrecken, den Klöppel der Glocke an sich<br />
vorbeisausen sahen. Dem Gedicht ist eine Erklärung vorangestellt, welche die Schilderung<br />
erklärt und dem Gechinger Reporter C. F. Moerk zu verdanken ist. Es war der sogenannte<br />
"Glockenstreit" entstanden, soll man in der Neujahrsnacht <strong>1900</strong> oder 1901 die<br />
Jahrtausendwende einläuten? Man einigte sich auf <strong>1900</strong> - aber plötzlich hörte die große<br />
Glocke zu läuten auf. Da meinten nun manche Leute, die streikende Glocke sei der gleichen<br />
Meinung wie sie, die, das Ende des 19. Jahrhunderts auf das vollendete Jahr <strong>1900</strong> festlegen<br />
wollten. Der Dorfdichter schließt seine Arbeit mit heiterer Gelassenheit:<br />
"Wenn selbst Glocken Streike machen, sind es doch erwiesne Sachen, daß noch nicht zu<br />
Ende ist das Jahrhundert mit dem Jahre (<strong>1900</strong>) daß die Rechnung nicht die wahre, jeder<br />
glaubts hier zu der Frist".<br />
Solches glaubten unsere guten Alten um die Jahrhundertwende! Und was sollen wir<br />
Heutigen glauben <strong>von</strong> der Wende der Zeit? Es wird so viel gerätselt und prophezeit. Und<br />
Dinge tun sich im Großen wie im Kleinen, die man um die Jahrhundertwende noch für<br />
Phantastereien gehalten hatte. Die Welt hat eine grundlegende Änderung erfahren, deren<br />
Tragweite eigentlich noch gar nicht erfasst ist, wenn sich auch der Gesichtskreis des<br />
Einzelnen geweitet hat und wir sebst die, Errungenschaft der Technik allmählich für<br />
selbstverständlich halten.<br />
Und doch, wenn die Glocken zur Jahreswende tönen, stehen wir an einer dunklen Pforte, ob<br />
wir sie im frohen Verwandten- und Freundeskreis begehen oder in einsamer Klause. Die<br />
Schicksalsfäden laufen nicht durch unsere Hand.<br />
Auch für unser Dorf ist eine neue Zeit angebrochen. Die Behaglichkeit eines<br />
altschwäbischen Bauerndorfes ist über die Arbeiterwohngemeinde nunmehr bei der<br />
Akurattes eines kleinstädtisch anmutenden Gemeindewesens angelangt. Tief einschneidende<br />
Maßnahmen werden im Laufe der Tage nicht nur das äußere, sondern auch das innere<br />
Dorfbild wenden. Und viele. seiner Bewohner, namentlich die ältere Generation können dem<br />
Rhythmus der Zeit nur schwer folgen.<br />
Doch da tönen immer noch unsere Glocken tröstend und mahnend über dem Lärm des Tages<br />
und der Besinnlichkeit des Abends. und wir wollen hoffen und wünschen, daß sie es<br />
ungefährdet tun –<br />
Die Glocken der Heimat, euch gilt mein Sang.<br />
weil der Heimat Seele in euch erklang.<br />
Ihr tönet so ruhig in Freud und Weh<br />
und ziehet das Herz zu himmlischer Höh.<br />
Ihr Glocken der Heimat, wie liegt das weit,<br />
ward schon mein Sehnen zur Kinderzeit.<br />
Von eurer Höhe durft ich einmal<br />
vom Turme schauen das grüne Tal.<br />
Ihr Glocken der Heimat. und als ich fern,<br />
da dacht ich eures Dreiklangs so gern,<br />
da schwoll mit das Herz ob den hehren Akkorden,<br />
so seid ihr mir lieb und heilig geworden.<br />
So klinget denn mächtig fort und fort<br />
Ihr ehernen Stimmen vom Heimatort.<br />
Friedeverkündend - fern jedem Sturm,<br />
ihr Glocken der Heimat, ihr Kinder vom Turm.<br />
59
Zum Totensonntag 1965<br />
Vielleicht hat mancher beim Blättern im Buch "Heimat Gechingen" auf Seite 63 erfreut die<br />
Abbildung Alt-Gechingens betrachtet, die aus einem Forstlagerbuch <strong>von</strong> 1681 stammt.<br />
Gewiss ist es kein stolzer Merian, keine minutiöse Zeichnung, wie wir sie <strong>von</strong> vielen Städten<br />
kennen. Aber bestimmt hat sich der Zeichner alle Mühe gegeben, uns eine kleine Übersicht<br />
zu schaffen. Wir Menschen der Neuzeit sind die tadellosen Aufnahmen durch Fotoapparate<br />
gewöhnt. An einer solchen Aufnahme hätte sich der Zeichner leicht orientieren können. So<br />
mußte er, etwa <strong>von</strong> der Schafgasse aus, das ganze Gewirr der Gassen und Gäßlein festhalten.<br />
Die Kirche, die wie ein treuer Hirt im Hintergrund steht, ist sehr eigenwillig festgehalten, der<br />
Turm ist seitlich gedreht und schiebt das Schiff in den Hintergrund. Aber die Mauern und<br />
Zäune des Etters und auch die Mauer des Kirchhofes geben doch ein Bild <strong>von</strong> dem Dorf<br />
unserer Ahnen.<br />
So mag es für sie nicht leicht gewesen sein, den Plan, die Toten nicht mehr im Schatten der<br />
Martinskirche zu bestatten, sondern auf freier Feldmark einen geeigneten Platz zu finden.<br />
Der war nun am südlichen Hang oberhalb der Wolfswiesen gefunden und bald mit einer<br />
festen Mauer <strong>von</strong> Kalksteinen umgeben. Der Eingang wurde wohl erst später erweitert und<br />
war zum Anfang jedenfalls ein festes Holztor, wie es auch beim Kirchenplatz zu finden ist.<br />
Wenn die erste Grablegung stattgefunden hat, ist vielleicht noch in dem großen<br />
unveröffentlichten Teil der Chronik unseres Heimatforschers Karl Friedrich Essig<br />
zu finden. Nach den ältesten Grabplatten ist scheinbar schon ein 1761 geborener Schultheiß<br />
Johannes Georg Kappis dort bestattet.<br />
Unser Friedhof, oder wie ihn die Alten nannten, unser "Kirchhof" hat manche Neuerung<br />
erfahren und auch im westlichen Teil eine Erweiterung, welche durch die ständig steigende<br />
Einwohnerzahl bedingt ist. Er ist nicht mehr reich an historischen Grabstätten, daß es doch<br />
nicht ohne Interesse sein dürfte, diese wenigen nur deshalb doppelt wertvollen Zeugen<br />
dörflicher Vergangenheit festzustellen.<br />
Da sind am westlichen Mauerrest, wo jetzt der freie Durchblick die Anlage für den Besucher<br />
feierlicher macht, zwei Gedenkplatten eingelassen, <strong>von</strong> denen die eine die lapidare Inschrift<br />
trägt: Vater Klinger gest. 1830 (im Heimatbuch 1828).<br />
Wenn je einmal ein Seelsorger sich diesen Namen verdient hat, dann ist es der Magister (ein<br />
akademischer Lehrertitel) Christoph Heinrich Klinger, der 56 Jahre hier seines Amts<br />
waltete.<br />
Heimatliches 1966<br />
Wenn der Schlehdorn blüht, zieht der Lenz ins Land,<br />
jede Hecke trägt dann ein Festgewand.<br />
Es ist doch ihr Hochzeitskleid,<br />
wenn es auch noch in die Blüten schneit!<br />
Solche Reime können einem in den Sinn kommen, wenn man <strong>von</strong> seinem Giebelfenster aus<br />
betrachten kann, wie die neue Schule im Abendsonnenschein mit leuchtenden Fensteraugen<br />
über den Dächern Alt-Gechingens steht. Ein ungewohnter Anblick und das Symbol einer<br />
neuen Zeit.<br />
Daß es eine Schlehengäuschule ist, beweist noch ihre Verbindung auf die ursprüngliche<br />
Landschaft, wenngleich hierzulande im Dialekt nicht <strong>von</strong> Schlehen sondern <strong>von</strong> "Schlaien"<br />
gesprochen wird. Und diese Schlaien waren ehedem im Herbst ein begehrtes Objekt. Man<br />
60
enutzte den purpurroten Saft vielfach zum Färben <strong>von</strong> Most und Wein. Und dann, wie<br />
einfach die Lebensweise unserer Altvorderen waren, die schönsten Beeren wurden auf dem<br />
Ofen getrocknet und im Winter, als eine Art Kaugummi so lange mit den Zähnen bearbeitet,<br />
bis der letzte Rest des Fleisches vom Kern verschwunden war. Wobei nicht vergessen<br />
werden darf, daß den Schlehen ein heilkräftiger Wert zugemessen wird. Solcherart ist es also<br />
um den Strauch bestellt, dessen Namen Gechingens stolze Schule trägt.<br />
Aber sie hat auch viel lärmendes, lachendes Leben mit auf ihre Höhe genommen, nachdem<br />
schon vorher das ebenso attraktive Sportheim den einst so einsamen Angel die Jugend der<br />
Gemeinde in seinen Bann schlug.<br />
Wenn erst das neue Rathaus vor das einstige Althengstetter Tor gezogen ist, <strong>von</strong> dem noch<br />
das "Uffamergamännle" am Gebäude des Konsums als treuer Wächter Kunde gibt, dann mag<br />
wohl jene Mutter fortschrittlicher Kinder recht behalten, die etwas bekümmert sagte: "Wenn<br />
erst die alte Leut vollends weg sind, no woiß mer iberhaupt nix mai vo früher. De Jonge<br />
wellet nix mai davo wissa!"<br />
Alte Leute hat es ja zu allen Zeiten gegeben und alle nahmen das Wissen um ihre Zeit ins<br />
Grab. Aber diesmal ist es wesentlich anders, denn was jetzt zu den Alten zählt, das sind die<br />
vor der Jahrhundertwende und im 1. Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Geborene. Ihre Kindheit<br />
fiel noch in eine heile Welt, die dann durch 2 Weltkriege für immer verloren ging. Daran<br />
ändert auch das Wohlstandsdenken mit all seiner Bequemlichkeit nichts. In den Spalten des<br />
"Blättle" fand sich einmal die Ansicht eines jungen Skribenten: "Die Alten waren<br />
nonchalant!"<br />
Nochalant heißt nachlässig, vieleicht ist das aber nicht der richtige Ausdruck, man sollte<br />
eher sagen, sie waren "betulich." Sie hatten mehr Zeit für sich und auch für die Andern. Man<br />
kannte noch keine Fließbandarbeit und kein Computer, man fuhr auch noch keine Traktoren<br />
und erst recht nicht zum Mond! Das alles sind stolze Errungenschaften, aber der<br />
schwäbische Lyriker Gerhard Schumann sagt es in seiner "Stachelbeerauslese", sie verlangen<br />
den Frieden der Seele.<br />
So bringt der Anblick der Schlehengäuschule für die im Tale allerhand Gedanken. Und wenn<br />
man dann im Dorfe etwa <strong>von</strong> der Post durch den Appeleshof zum SB-Laden geht, bleibt man<br />
zum Verwundern der Vorübergehenden, beim Rathaus eine gute Weile stehen, nicht nur zum<br />
Verschnaufen, sondern man betrachtet noch einmal den Platz, den man vor vielen, vielen<br />
Jahren den "Gechinger Schlossplatz" nannte. Denn natürlich sollten sie hier genau solch<br />
einen Platz haben, wie wir daheim in Stuttgart. Natürlich hätte der keine Jubiläumssäule,<br />
kein Neues Schloss mit einer goldenen Krone, aber es ragte der Kirchturm mit seinem<br />
schönen Geläute stolz empor. Davor war die Staffel, die für viele Generationen <strong>von</strong><br />
Gechingern Kindern eine prächtige Staffage für Aufnahmen der Schulklassen gab. Ich fand<br />
kürzlich zwischen alten Fotos ein solches aus dem Jahr 1928. Es ist eine Aufnahme <strong>von</strong> der<br />
ganzen damaligen Schülerzahl. Sie hat fast historischen Wert und entstand bei der<br />
Verabschiedung des damaligen Hauptlehrers Grötzingers. So ist dieser samt seiner Gattin<br />
darauf zu sehen, die Familie siedelte damals nach Blaubeuren über. Im zweiten Weltkrieg<br />
verloren sie ihren einzigen Sohn und weilen, soviel ich unterrichtet bin, nicht mehr unter den<br />
Lebenden. Ferner findet man auf dem Bild den damaligen Oberlehrer Karl Heckeler mit<br />
Gattin, der während des zweiten Weltkriegs hier starb. Dann ist Pfarrer Reusch dabei mit<br />
zwei Ortschulräten und ein Unterlehrer. Sie alle stellten sich bereitwillig auf die Treppe.<br />
Oben im Staketenzaun sind noch einige Buben, die zum Teil heute im Dorfleben ihren festen<br />
Platz haben. Da ist es zuerst Otto Weiß, Gechingens heutiges Gemeindeoberhaupt und sein<br />
im Osten verschollener Vetter, Wilhelm Weiß. Dieser war der jüngste Sohn des "Vaters der<br />
Gemeinde" Ludwig Weiß, der viele Jahre stellvertretender Schultheiß und Gemeinderat war.<br />
Die beiden Vettern und auch der Kaufmannssohn Eugen Schwarz, heute Beamter der<br />
61
Landespolizei in Freudenstadt, besuchten damals das Gymnasium Calw. Aber bei dieser<br />
Aufnahme wollten sie doch auch dabei sein. Ferner entdeckt man den jetzigen<br />
Gemeindepfleger Richard Vetter und den Hirschwirt Otto Heim. Wirklich, es war damals<br />
wie heute gut bestellt um das Dorfleben.<br />
Aber nicht nur der Kirchstaffel sondern dem alten Schulhaus gilt diese Reverenz. Mein<br />
Ururahne, der damalige Zimmermann Schwarzmaier hatte es erbaut und, wie aus unserem<br />
Heimatbuch zu erfahren ist, in Erinnerung an Vater Klinger, der <strong>von</strong> 1772-1828 an unserer<br />
Martinskirche seines Amtes waltete, sein Sohn übernahm dieses Amt 1828-1862. Gewiss ein<br />
gutes Zeichen für den Frieden unseres Dorfes, wenn 90 Jahre lang das Seelsorgeramt in der<br />
gleichen Familie bleibt. So stammt ja auch eine Zeichnung aus der Zeit Vater Klingers,<br />
welche die Kirche, das Pfarrhaus, welches im Parterre noch Wirtschaftsräume enthielt, und<br />
die Pfarrscheuer zeigt, die längst dem Verkehr weichen musste und den stillen Frieden des<br />
Pfarrhofes zunichte machte. Die Karte die zuerst über das Mesneramt und jetzt auch im<br />
Freiverkauf zu haben ist, zeigt im Hintergrund auch noch andere, unverputzte Gebäude.<br />
Auch die Kirche hat noch nicht das Ebenmaß ihrer gotischen Fenster, der Kirchturm ist noch<br />
nicht aufgestockt. Aber die Mauer des Pfarrgartens ist mit großer Akribie in Backsteinform<br />
gezeichnet, obwohl sie nach der damaligen Bauweise aus Feldsteinen besteht. Aber das<br />
Törchen zur "Wittem" fehlt nicht, ebenso wenig wie das kleine Waschhaus.<br />
Damit ist aber die Gebäulichkeit des Gechinger "Schlossplatzes" noch nicht erschöpft, die<br />
der Schule mit ihren hohen, lichten Räumen muss doch besonders gedacht werden. Trotz des<br />
kritischen Blicks der treuen Residenzlerin, der Mutter Schule, (auch die lieben Großeltern<br />
gehören ja einst zu ihren Besuchern) sie hielt sogar den Vergleich mit der eigenen Stuttgarter<br />
Schule stand, dem guten alten Töchterinstitut, respektlos "Lämmerstall" genannt, nach dem<br />
Spruch über der Schulpforte: "Weide meine Lämmer." Diese ging in einer Bombennacht als<br />
Stiftskirchenzimmerhaus in Flammen auf. Die Gechinger Schule hat dieses Inferno<br />
überstanden, obwohl in ihrer Nähe am 20 April 1945 noch einige Bomben fielen, welche den<br />
Erker der Kirche beschädigten und einige Menschen das Leben kostete. Damals in dem<br />
stillen Frieden des Bauerndorfes ahnte man <strong>von</strong> diesem Geschehen noch nichts. Die beiden<br />
Bauernhäuser die sich dem Pfarrhof anschlossen, haben auch schon allerlei Neuerungen<br />
erfahren. Über der Brunnengasse, das Schulhausbeckenhaus hat die Erbtochter verlassen und<br />
sich mit ihrer Familie auf dem "Heidehof" eine neue Heimat gegründet. Auch der andere<br />
Vertreter dieser alten Bäckerfamilie, der "Gaisbügelbeck" wohnt mit einem Sohn und seiner<br />
Familie auf der beherrschenden Höhe des "Hasenhofes". Und das Schulhausbeckenhaus, wo<br />
in alter Zeit die Kinder stolz ihre Einkäufe an Wecken und "Bregetzen" tätigten, hat schon<br />
lange seine Bestimmung verloren. Dann bald immer eher als städtisch anzusehen, das<br />
schmale Wohnhäuschen des Schneiders Riehm. Und dann, in der Ferienzeit oft zum<br />
Empfang der Postsachen, besonders der Kreuzbandsendung vom "Schwäbischen Merkur"<br />
und "Neues Stuttgarter Tagblatt" aufgesucht, die Post. In dem Doppelwohnhaus der Brüder<br />
Gottlieb und Ludwig Weiß hatte der Letztere die Poststelle mit Telephon eingerichtet und<br />
mit seiner geschäftstüchtigen Frau verwaltet. Daß er daneben noch Gemeindepfleger war,<br />
beweist seine Vielseitigkeit. Ihr einziger Sohn, Fotograph Otto Weiß hat mit seinen<br />
Aufnahmen neben seiner Arbeit als Landwirt für seine Gemeinde viel wertvolle Arbeit<br />
geleistet. Sein jüngster Sohn, also der Enkel <strong>von</strong> Posthalter Weiß, leitet seit 1946 die<br />
Geschicke des Dorfes als Bürgermeister. Sein bald "altes" Rathaus war die letzte<br />
Gebäulichkeit des "Gechinger Schlossplatzes".<br />
62
Unsere Marienlinde und das Haus Württemberg 1966<br />
Noch streckt unsere über 80 Jahre alte Dorflinde ihre noch kahlen Zweige zum blassen<br />
Frühlingshimmel und um sie reißt tagsüber der schnelle Durchgangsverkehr nicht ab. Wie<br />
gut ist es, daß die Gemeindeverwaltung, an ihrer Spitze der tatkräftige Schultheiß Ziegler,<br />
nach dem Feuersturm des Jahres 1881 die neue Gartenstraße so großzügig anlegte, daß sie<br />
auch dem modernen Verkehr gewachsen ist. Als das große Werk gelungen war und die<br />
beiden östlichen Durchgangsstraßen, der alte, nun zur oberen Dorfstraße degradierte<br />
'Mühlweg" und die blitzsaubere Gartenstraße sich in der Dorfmitte teilten, da dachte man,<br />
den schmalen Streifen mit einer Linde zu bepflanzen und mit einem zierlichen Brünnlein zu<br />
schmücken. In dem heutigen, rasenden Leben kann man sich gar nicht mehr vorstellen, mit<br />
wieviel Interesse das Wachsen und Gedeihen des Bäumleins, das in den ersten zehn Jahren<br />
<strong>von</strong> einem Zaun umgeben war, betrachtet wurde. Auch hatte die Dorfjugend durch<br />
Jahrzehnte die "Eisestang", die den Platz gegen die tiefer gelegene Gartenstraße abschirmte,<br />
zu ihren turnerischen Übungen benutzt, so daß sie wie geschliffener Stahl glänzte. Mit den<br />
Jahren, als die Linde zum stattlichen Baum heranwuchs, schwand das Interesse. Man<br />
versuchte zwar die Linde in das kulturelle Leben einzubeziehen, durch Platzkonzert,<br />
Liedersingen und Preisverteilung vom Sportplatz. Aber der Raum war zu schmal und der<br />
Verkehr schon damals zu lebhaft, so daß man dieses Bestreben wieder fallen ließ. So zeigte<br />
die Umgebung bald ein wenig freundliebes Bild, weil unverständige Leute glaubten, sich<br />
ausgerechnet hier ihrer Blechdosen und ähnlichem entledigen zu können.<br />
Da griff das Rathaus wieder ein. Der Platz wurde eingebaut und mit Rasen bepflanzt,<br />
rundum mit Kalksteinen ummauert. Statt des gusseisernen Brünnleins, das schon jahrelang<br />
abgestellt war, wurde ein Steinbassin angelegt, welches auf seinem Sims im Sommer<br />
Blumenkästen mit Geranien trägt. Aber trotzdem griff der moderne Verkehr auch in den<br />
Platz der Linde ein. Weil sonst keine Möglichkeit vorhanden war, wurde eine kleine<br />
Wartehalle eingebaut, welche seit neuesten auch in den Verkehr des Postomnibusses<br />
einbezogen ist. Aber einmal, vor 8 Jahren, nahm auch die Erinnerung <strong>von</strong> dem alten Baum<br />
Besitz. Man entsann sich, daß der Baum einen Namen hatte, sogar einen königlichen<br />
Namen, für eine edle Spenderin für das durch Großbrand heimgesuchte Gechingen. Die<br />
Jungen hatten keine Ahnung, daß ihre "Lenna" eine "Prinzess-marien-linde" war. Und dann<br />
ging bei den Beteiligten ein Rätselraten an.<br />
Schon 40 Jahre waren verstrichen, daß der letzte König Wilhelm der Zweite "Württemberg<br />
geliebter Herr" seiner Väter Thron verlassen hatte, und nachdem er mehrere Jahre im Kloster<br />
Bebenhausen seinen Wohnsitz hatte, neben seiner ersten Gemahlin, einer Prinzeß Marie <strong>von</strong><br />
Waldeck-Pyrmont, und seinem klein verstorbenen Söhnlein Ulrich auf dem alten Friedhof in<br />
Ludwigsburg seine letzte Ruhestätte gefunden hatte. Nun wäre dem Buch "Heimat<br />
Gechingen" fast ein Anachronismus passiert. Wir dachten alle, diese "Prinzeß Marie", die<br />
sich im Schwabenlande um ihrer schlichten, gütigen Gesinnung willen großer Beliebtheit<br />
erfreut hatte, sei sozusagen die Namenspatronin der Dorflinde. Jetzt meldete sich ein<br />
inzwischen verstorbener Bürger und erzählte <strong>von</strong> einer Schilderung, die sein Vater gegeben<br />
hatte, <strong>von</strong> einem Leichenkondukt, der <strong>von</strong> Stuttgart aus auf dem Rotenberg, zur Grabkapelle<br />
König Wilhelms des Ersten und seiner russischen Gemahlin Katharina Paulowna geführt<br />
worden war. Dabei handelte es sich um eine Tochter des königlichen Paares "Prinzeß Marie<br />
<strong>von</strong> Württemberg" verehelichte Gräfin Neipperg. Sie war es, der unsere Linde gewidmet<br />
war, eine Stieftante und nicht die erste Gattin des letzten württembergischen Königs.<br />
Allerdings muß man wissen, daß sie mit großer Liebe an diesem Neffen hing, er war, durch<br />
seine Mutter, Prinzeß Katharina, der einzige Enkel Wilhelms des Ersten. In den<br />
Niederlanden, wo vor wenigen Wochen eine prunkvolle königliche Hochzeit gefeiert wurde,<br />
waren noch zwei Enkelsöhne gewesen, Wilhelm und Alexander, aber sie starben schon kurz<br />
63
nach ihrer Mutter, der Prinzeß Sophie <strong>von</strong> Württemberg, der leiblichen Schwester unsrer<br />
"Prinzeß Marie". Es wurden in diesen Tagen viele alte Chroniken geöffnet und viele<br />
halbvergessene Gemälde hervorgeholt. Die sonst so modern denkenden Kolumnisten traten<br />
sichtbar erfreut eine Wanderung in längstvergangene Zeiten an, um zu beweisen wie viel<br />
deutsches Blut durch die Jahrhunderte in die niederländische Königsfamilie <strong>von</strong> Oranien-<br />
Nassau gekommen ist. Da dürfen auch wir Schwaben uns melden, denn nicht nur die<br />
Königin Sophie war vorn schwäbischen Stamm, sondern auch ihr Gatte und leiblicher Vetter<br />
Wilhelm der Dritte der Niederlande, hatte durch seine Mutter Anna Paulowna eine<br />
schwäbische Großmutter; nämlich die Zarin Maria Feodorwona, eine geborene Prinzeß Sofia<br />
Dorothea <strong>von</strong> Württemberg, eine Tochter des berühmt-berüchtigten Herzog Karl Alexander,<br />
kaiserlicher Generalfeldmarschall, Ritter des goldenen Vlies und 4 Jahre Regent <strong>von</strong><br />
Württemberg.<br />
Damit haben auch wir eine Fürstenchronik aufgeschlagen und stehen dabei im Jahre 1733.<br />
In seinem prächtigen Schloss in Ludwigsburg hatte Herzog Eberhard Ludwig die Augen zum<br />
letzten Schlummer geschlossen und war an Seite seiner Gemahlin und des jung verstorbenen<br />
Erbprinzen in die Gruft unter seinem Schloss bestattet worden. Mehr als 50 Jahre hatte seine<br />
Regierung gedauert und das erste, was die Stände und die Landschaft (der damalige<br />
Landtag) tat, war, die Grävenitz mit Anhang des Landes zu verweisen. dem sie als Favoritin<br />
des Herzogs übel mitgespielt hatte.<br />
Vom fernen Wien zog nun Herzog Karl Alexander in sein Stammland ein. Mit ihm kam<br />
seine Frau, eine Fürstin Thurn & Taxis und die drei Söhne Karl Eugen, Ludwig Eugen und<br />
Friedrich Eugen. Allen drei war Prinz Eugen <strong>von</strong> Savoyen "der edle Ritter" Pate. In<br />
unzähligen Kampfhandlungen hatte er den tapferen Württemberger schätzen gelernt, der<br />
aber dann so gar kein Talent zum Regent des kleinen Alt-Württemberg mitbrachte. Dazu<br />
kam, daß der Herzog konvertiert war, daß heißt, mit seinen Söhnen den katholischen<br />
Glauben angenommen hatte. Die besorgte Landschaft ließ sich dieserhalb die<br />
Religionsreversalien ausstellen, welche die ungestörte Ausübung der Konfessionen<br />
gewährleistete. So war wenigstens in dieser Hinsicht etwas Sicherheit. Dann aber wählte der<br />
Herzog einen Finanzberater und nachmals Minister, den Mannheimer Joseph Süß<br />
Oppenheimer, der bald der meistgehasste Mann vom Schwabenland war, skrupellos im<br />
Steuerpressen und Ämterhandel. Man schrieb inzwischen den März 1737. Da griff das<br />
Schicksal selber ein. Der Herzog war an jenem 12. März <strong>von</strong> einer Fahrt nach Stuttgart<br />
heimgekehrt, hatte nach der Abendmahlzeit noch mit Süß Karten gespielt und ihm die<br />
verlorenen Golddukaten geschenkt. Als er in seinem Kabinett beim Auskleiden war, griff er<br />
plötzlich an den Hals und rief: "Herr Jesus, wie wird mir!" Ehe der bestürzte Kammerdiener<br />
helfen konnte, brach sein Herr zusammen. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod<br />
feststellen. Um diesen Tod entstanden bald die unsinnigsten Gerüchte, welche tief in das 19.<br />
Jahrhundert hinein lebendig blieben. Mein eigener Vater, der im Schatten des Schlosses, in<br />
der Kriegsschule aufwuchs, erzählte mir, daß in seiner Kindheit und Jugend, so in den 80er<br />
und 90er Jahren sich hartnäckig das Gerücht festhielt, den Herzog habe der Gottseibeiuns<br />
geholt und es sei noch das Zimmer vorhanden. das Spuren des Kampfes zeige. Tatsächlich<br />
war Karl Alexander, an einem Schlagfluss gestorben, in aller Stille beerdigt worden. Erst im<br />
Mai 1737 wurde mit 2000 Mann kaiserlicher Truppen eine, dem hohen Rang des<br />
Verstorbenen angemessene Trauerparade abgehalten. Weniger gut ging es Süß<br />
Oppenheimer, er wurde sofort inhaftiert und später zum Tod durch Erhängen verurteilt.<br />
Nun kam der unmündige Herzog Karl Eugen, zuerst unter Vormundschaft, an die Regierung,<br />
die 50 Jahre dauerte und seinem Lande viel Opfer abforderte. Er war aber auch der Erbauer<br />
des Schlosses Solitude und später Hohenheims. Er gründete die Hohe Karlsschule für die<br />
begabten Söhne seines Landes, der auch Friedrich Schiller angehörte, der in seinen<br />
64
"Räubern" den Hass gegen die Tyrannen zum Ausdruck brachte und schließlich den Staub<br />
Württembergs <strong>von</strong> den Füßen schüttelte. Als er bei Illingen mit seinem Freund Streicher die<br />
Grenze überschritt, grüsste die Solitude in festlichem Schimmer durch die Nacht. Sie war<br />
illuminiert aus Anlass des Besuches des Großfürsten Thronfolgers Paul und seiner Gattin,<br />
einer Bruderstochter Karl-Eugens. Schiller, der hinter dem Schloss die Wohnung seiner<br />
Eltern Kaspar Schiller, Obristwachtmeister und Frau Dorothea geh. Kodweiß wußte, rief<br />
nach Streichers Aussage noch schmerzlich aus: "O meine Mutter!". Er konnte nicht ahnen,<br />
daß nach vielen kargen Jahren der Fremde ihm noch des Glückes Stern strahlte und er als<br />
wohlbestallter Professor der Geschichte und Reichfreiherr einer Tochter des großfürstlichen<br />
Paares Maria Paulowa, Erbgroßherzogin <strong>von</strong> Sachsen-Weimar-Eisenach, seine Aufführung<br />
"Die Huldigung der Künste" widmen würde.<br />
Denn die Zeit stand nicht stille. Als nach 50jähriger Regierung Karl Eugen in Schloss<br />
Hohenheim starb und auch sein Bruder Ludwig Eugen nach 2 Jahren das Zeitliche segnete,<br />
kam <strong>von</strong> Stettin der dritte Alexandersohn nach Württemberg, Friedrich Eugen, königlichpreußischer<br />
Generalfeldmarschall und mit einer Nichte Friedrich des Grossen verheiratet.<br />
Seine Ehe war mit fünf Söhnen gesegnet. Da das herzogliche Paar in einer Mischehe lebte<br />
und seinen Söhnen die freie Wahl ließ, waren Friedrich, Ludwig und Eugen evangelisch,<br />
Wilhelm und Alexander aber katholisch. Die einzige Tochter und Schwester hatte den<br />
orthodoxen Glauben ihrer neuen Heimat angenommen und ihre neun Kinder, fünf Söhne und<br />
vier Töchter, wurden darin erzogen. Wie denn die Großfürstin und nachmalige Kaiserin eine<br />
vorbildliche Erziehung für notwendig hielt und inmitten der russischen Ausschweifungen<br />
ein tadelloses und mit Hochachtung betrachtetes Leben führte und ihrem nicht immer leicht<br />
zu behandelnden Gatten eine vorbildliche Ehefrau war.<br />
Damit sind wir unversehens an die Persönlichkeiten gekommen, <strong>von</strong> denen einige zu den<br />
Ahnen der Oranier gehören. In den Befreiungskriegen hatte sich der Kronprinz der<br />
Niederlande, Wilhelm, besonderen Ruhm erworben. Er war durch seine Mutter ein Enkel<br />
König Friedrichs des Zweiten <strong>von</strong> Preußen. Zar Alexander hatte <strong>von</strong> dem mutigen<br />
Waffengefährten gehört und wollte ihn persönlich kennenlernen. Da er ihm sehr gut gefiel,<br />
bestimmte er ihn zum Gatten für seine jüngste Schwester Anna Paulowna. Der Oranier fügte<br />
sich, aber er nahm hernach wenig Rücksicht auf seine Gattin. Wo sollte er es auch gelernt<br />
haben? Sein Vater, Wilhelm der Erste, ließ die Mutter, die feine zarte Preußenprinzessin<br />
auch wenig Wärme fühlen. Ja, bald tauchte ein Name auf: Henriettte, Gräfin d'Outremont.<br />
Obwohl sich ein Schleier des Schweigens über die ganze Affäre legte. Als die Königin<br />
Friederike-Wilhelmine 1737 nach einem einsamen Leben, aber geliebt <strong>von</strong> ihrem Volke,<br />
starb, wollte der Witwer rasch seine Henrietta ehelichen, stieß aber bei der Regierung auf<br />
beträchtlichen Widerstand, zumal die Gräfin katholisch war. Da entsagte Wilhelm kurz<br />
entschlossen seinem Thron und zog mit seiner Henrietta und einem nicht unbeträchtlichen<br />
Vermögen in sein geliebtes Berlin, wo er als Graf <strong>von</strong> Nassau betulich lebte. Nun war für<br />
Kronprinz Wilhelm die Krone bestimmt und Anna Paulowna wurde Königin. Aber für sie<br />
gab es eine Dornenkrone. Wie ihre Schwiegermutter und hernach ihrer Schwiegertochter<br />
Sofie <strong>von</strong> Württemberg widmete sie sich den schönen Künsten und der Wohltätigkeit. Mit<br />
Wehmut mag sie des fernen Petersburg gedacht und der Verwandten an den Höfen <strong>von</strong><br />
Weimar und namentlich Stuttgart. Dort hatten die vier Brüder ihrer Mutter, Friedrich und<br />
Eugen, Wilhelm und Alexander mit ihren Familien ein ungezwungenes frohes Leben, wenn<br />
auch die beiden Bruderpaare der verschiedene Glauben trennte. Kein Wunder, daß Königin<br />
Sofie ihren Sohn, ebenfalls einen Wilhelm, aufforderte, die württembergischen Verwandten<br />
zu besuchen. War doch der Gatte ihrer frühverstorbenen Schwester, Wilhelm der Erste, ihr<br />
eigener Vetter. So fühlte sich der niederländische Kronprinz im großen Familienkreis sehr<br />
wohl, tat es ihm doch die Cousine Sofie, die Schwester unsrer "Prinzeß Marie" besonders an.<br />
65
Sie hatte die strahlenden Blauaugen und die ganze Anmut ihrer Mutter geerbt und sie war<br />
sehr klug und belesen. Der Oranier bat seinen Onkel Wilhelm um die Hand Sofiens und sie<br />
wurde ihm freundlich gewährt. Aber da hatten sie nicht mit dem Widerstand Sofiens<br />
gerechnet. Vielleicht wußte sie um das traurige Los ihrer Tante Anna, vielleicht fürchtete sie<br />
sich vor einer Geschwisterkinderehe, wie sie auch ihre Eltern Wilhelm und Katharina<br />
geschlossen hatten. Außerdem hatte sie ihr Herz schon an einen Herzog <strong>von</strong> Braunschweig<br />
geschenkt. - Kurz und gut, die reizende Prinzeß Sofie wollte ihren holländischen Vetter<br />
nicht. Da sprach König Wilhelm ein Machtwort. Man nannte ihn nicht um sonst den Bauer<br />
unter den Königen und den König der Bauern. Er war ja auch der Initiator des, vom<br />
Landwirtschaftlichen Hauptfest zum Allgemeinen Volksfest ausgewachsenen<br />
Schwabenfestes. Also König Wilhelm sprach, was jedem anderen schwäbischen Hausvater<br />
auch eingefallen wäre: "Das sind Mädchenphantastereien. Du heiratest den Holländer!"<br />
Sofie fügte sich schließlich, obwohl sie wusste, dass es keine ruhige Ehe geben würde. Sie<br />
schenkte ihrem Gatten 3 Söhne, <strong>von</strong> denen die anfangs erwähnten Wilhelm und Alexander<br />
heranwuchsen. Aber sie scheinen nicht viel Lebensmut besessen zu haben, denn sie starben<br />
beide, schon über dreißig in den Jahren 1879 und 1884 unvermählt. Ihre Mutter Königin<br />
Sofie war ihnen 1877 im Tode vorangegangen. Der Gemahl und Vater ging aber schon im<br />
Jahre 1879 auf die Brautschau. In Waldeck-Pyrmont, wo auch sein Vetter, König Wilhelm<br />
<strong>von</strong> Wiirttemberg, seine erste Frau Prinzeß Marie, die Tochter einer Prinzessin aus dem<br />
Hause Württemberg freite, fand er schließlich seine um 40 Jahre jüngere Lebensgefährtin<br />
Emma, die ihm im Jahre 1880 das einzige Kind dieser Ehe, <strong>von</strong> den Eltern und dem Volk<br />
zärtlich "ons Wilhelmtje" genannt, schenkte. Mit diesem Prinzesschen verschob sich das<br />
Haus Oranien -Nassau um eine Generation. Da der König nun allmählich doch in die Jahre<br />
kam, bestellte er sein Haus und führte, da mit ihm der Mannesstamm erlosch, die weibliche<br />
Thronfolge ein. Als Wilhelmine 8 Jahre alt war, starb der Vater. Mutter Emma führte die<br />
Regierung und erzog ihr Kind mit aller Güte und Strenge, die es für sein künftiges hohes<br />
Amt benötigte. Mit 18 Jahren war sie mündig. Immer kehrten die königlichen Damen gern<br />
nach Deutschland und zu den großen Verwandten zurück. Das Altersbild <strong>von</strong> Königin<br />
Emma zeigt eine große Ähnlichkeit mit den württembergischen Verwandten. Königin<br />
Juliane, die aus der Ehe der Königin Wilhelmine mit dem deutschen Prinzen Heinrich <strong>von</strong><br />
Mecklenburg -Schwerin entstammt, pflegte zu sagen: "Meine Großmutter ist ein Engel an<br />
Liebe und Güte und meine Mutter ist eine große Dame". Trotzdem ließ sie ihre Juliane den<br />
Mann ihres Herzens heiraten, wie jetzt Kronprinzessin Beatrix in fast märchenhafter Weise<br />
ihren Prinz Claus der Niederlande bekam. Da dürfen doch auch wir ihr Glück wünschen,<br />
denn unsere Dorflinde gehörte doch ihrer Urgroßtante, weil diese nicht nur die Schwester<br />
der Königin Sofie war, sondern auch die leibliche Base des letzten Königs der Niederlande -<br />
unsere Prinzeß Marie!<br />
66
UNSER SCHLOSSBERG 1966<br />
Es müssen doch poetische Seelen gewesen sein, unsere Altvorderen, daß sie dem Standort<br />
der ehemaligen und sicher sehr bescheidenen Gechinger Burg das Prädikat "Schlossberg“<br />
verliehen und die gemauerte Quelle unten im Tal, die ihre Bewohner mit Wasser versorgte,<br />
der "Schlossbrunnen" hieß. Freilich, obwohl schon mehr als ein halbes Jahrtausend zerfallen<br />
und heute nur noch ein regelloser Trümmerhaufen, im Leben des Dorfes hat sie lange Zeit<br />
als Ziel sonntäglicher Spaziergänge gedient und in den winterlichen Lichtgängen war <strong>von</strong><br />
"schwebenden Geistern und wandernden Lichtern" die Rede, so wie die heutige Generation<br />
vor dem Fernsehapparaten mitunter das Gruseln erlernt.<br />
Man wird aber erstaunt sein, daß nicht nur das schlichte Landvolk, sondern auch hoch<br />
gebildete Menschen, wie der Sänger des deutschen Waldes Freiherr <strong>von</strong> Eichendorff, eine<br />
solche innige Verbundenheit zu den Geheimnissen des Waldes hatte, dass er <strong>von</strong> einem<br />
nächtlichen Ritt vom väterlichen Schloss Lubowitz nach Ratibor schildert: "Es begleitete<br />
uns allerlei Waldgesindel und auch über eine Meile ein feuriger Mann." Dafür hat ja der<br />
moderne Mensch nur ein spöttisches Lächeln. Doch wird die Gesinnung dieses preußischen<br />
Geheimrats und letzten Romantikers <strong>von</strong> den heimatvertriebenen Schlesien erfreulich<br />
gehütet. Droben, in Wangen im Allgäu, ist alles zusammengetragen, was man <strong>von</strong> diesem<br />
schönen und einst so deutschen Lande retten konnte. Allerdings das väterliche Schloss<br />
wurde im letzten Krieg zerstört und seine Ruine ist vom Grün überwuchert.<br />
Wenn wir aber am Waldrand entlang bis zum "'Torwartsgrund" wandern, vorbei an der<br />
einstigen Badstube, so ist es doch ein rechter Burgpfad der uns aufnimmt. Mit der rechten,<br />
der schildfreien, Seite, ritten einst die Besucher zur Burg.<br />
Man schrieb das Jahr 1929. ein Gechinger Bürgersohn, der später als Hauptmann am Mius<br />
gefallener, musikalisch hochbegabter Eugen Rüffle machte den bekannten Burgenforscher<br />
K. A. Koch auf seine heimatliche Burg aufmerksam. Mit der Intensität, die diesen Forschern<br />
eigen ist, machte dieser sich mit bescheidenen Mitteln ans Werk, um einige Merkmale<br />
festzustellen. Da fand sich denn auf der Bergseite die Rundmauer eines mächtigen<br />
Bergfrieds mit 2,7 m dicker Mauer. Nach einer früheren Oberamtsbeschreibung waren auch<br />
Mauern eines viereckigen Turmes vorhanden, wohl des Torturms.<br />
Trotzdem der Forscher feststellte, daß der Raum der Burg mehr wie bescheiden war, ließ er<br />
sich nicht nehmen, einen Grundriss der Anlage herzustellen und eine mutmaßliche<br />
Zeichnung der Burg selbst. Diese ist so minutiös, daß man unwillkürlich an die<br />
Spielzeugkataloge der Weihnachtszeit erinnert wird, wo immer noch, inmitten technischer<br />
Neuheiten, romantische Ritterburgen mit Zugbrücke und blitzender Besatzung angeboten<br />
und jedenfalls auch gekauft werden. Vielleicht <strong>von</strong> Vätern, die sich und ihren Söhnen in<br />
unserer materialistischen Zeit noch ein wenig Romantik bewahren wollen.<br />
Unsere Burg Gechingen aber war sicher keine Raubritterburg, sondern eher eine befestigte<br />
Grenzwarte. Wer sich für das Resultat der Forschung interessiert, der findet auf Seite 18 - 20<br />
den aufschlussreichen Artikel des Forschers im Buch Heimat Gechingen.<br />
Dass dieser Artikel noch einmal ans Tageslicht kam, ist der Initiative des Schwarz-<br />
waldvereins Böblingen zu verdanken. Dieser brachte im Jahr 1956 die Abbildung einer<br />
Beschreibung in den Blättern für den Schönbuch. Wie Herr Landrat Heß, Böblingen, auch<br />
dem stillen Winkel und unserem Heimatbuch wärmstes Interesse entgegenbrachte, und<br />
letzteres als Jahresgeschenk für die Mitglieder erwarb.<br />
Vielleicht hängt dieses Interesse auch mit der Legende <strong>von</strong> dem "Geheimen Gang"<br />
zusammen, der sich vom Schlösslein der Gültlingen in Deufringen, dem jetzigen ev.<br />
Pfarrhaus, bis zum Schlossberg ziehen soll.<br />
Dieser "Geheime Gang" beschäftigte die Menschen schon immer. Noch in den -50er Jahren<br />
wurde <strong>von</strong> Deufringen her ein Vorstoß unternommen, wobei man tatsächlich auf einen<br />
67
Geheimen Gang stieß, der aber bald zusammengefallen war.<br />
So wird dies wohl für immer ein ungelöstes Rätsel bleiben, zumal auch noch die<br />
Unterwanderung des Bachlaufes ein Problem für sich wäre. Vielleicht wäre es da auch<br />
gegangen, Wie im August 1939, als eine Einheit Cannstatter Nachrichtenabteilung, die in<br />
Gechingen ihren Standort hatte, beim Stellen <strong>von</strong> Stangen für eine Telefonleitung in der<br />
Nähe des Schlossbergs, allerdings auf der anderen Bachseite, auf eine starke Quelle stieß,<br />
die sofort das gegrabene Loch mit Wasser füllte. Als einer der jungen Soldaten dem<br />
diensttuenden Unteroffizier die Meldung machte: "Herr Wachtmeister, hier können wir<br />
unmöglich eine Stange stellen, hier ist alles voll Wasser," leistete sich dieser, ob bewusst<br />
oder in Geistesabwesenheit, den nachher vielbelachten Kalauer:" Nun, dann grabt ihr eben<br />
noch tiefer, bis trockener Boden kommt."<br />
Trotzdem ließ der Forschungsdrang die Geister nicht ruhen. Im Frühling der 50er Jahre kam<br />
die Pressemeldung mit einem Foto: Am Schlossberg wird ein Bagger eingesetzt, um den<br />
"Geheimen Gang" zu finden. Wer das Datum las, war im Bild, es war der 1. April.<br />
Auch 1929 tauchte plötzlich eine Mär auf, die starke Zweifel erweckte. In Herrenberg wäre<br />
aus einer Menagerie ein Bär ausgebrochen, welcher zuerst an der Hodlenburg bei Dachtel<br />
aufgetaucht sei und jetzt an der Burg Gechingen sein Unwesen triebe. Was den Meister Petz<br />
gerade zu alten Burgen getrieben haben soll, konnte niemand sagen,<br />
Die Sache, verlief im Sand. Allerdings, bei einem Gang zum Schlossberg war am äußeren<br />
Grabenrand eine Einbuchtung zu sehen, in welcher ein Bär gerade Platz gehabt hätte. Es soll<br />
ein eingestürzter Dachsbau gewesen sein.<br />
So ist es um die alte Burg nicht immer so langweilig gewesen, wie es den Anschein hatte.<br />
Unsere guten Alten haben auch ihren Spaß gehabt.<br />
Wenn man nun den Weg über die obere Riedhalde nimmt, stößt man auf eine Mauer roh<br />
behauener Bausteine. Ein alter Heimatfreund meinte, es könnten Steine <strong>von</strong> der Burg sein.<br />
Doch diese wurden meist gleich zu Bauzwecken abgeführt. Eher ist anzunehmen, daß hier<br />
noch einige Wirtschaftsgebäude standen für Pferde u. Vorräte, welche nur im Falle einer<br />
Belagerung, wenn die Zugbrücke hochging, in die engen Räume der Burg genommen<br />
wurden.<br />
Mittlerweile tauchen nun hinter den Bäumen die ersten Häuser der Bergwaldsiedlung auf<br />
und bald stehen wir am Waldrand und vom Tal und jetzt auch <strong>von</strong> den Höhen grüßt das<br />
Dorf.<br />
Im Sonnenglanz die alten Bäume stehen,<br />
der Abendhauch lässt würzgen Heuduft wehen,<br />
Ein Lied klingt auf, leis, wie im Traum,<br />
Die wilden Rosen blühn am Waldessaum!<br />
Es ist ein Gruß aus fernen Zeiten,<br />
Durch Glanz und Duft ein trautes Heimwärtsschreiten<br />
Bis zu dem klaren Bach im Wellenschaum,<br />
Die wilden Rosen blühn am Waldessaum.<br />
Die Ahnen schon, sind hier gegangen,<br />
So wie wir jetzt im goldenen Sommerprangen<br />
Wer warn sie, man weiß es heute kaum,<br />
Die wilden Rosen blühn am Waldessaurn.<br />
Die Blütenpracht wird bald verwehen,<br />
Und andere Menschen werden diese Wege gehen,<br />
Doch Immer rauscht noch Busch und Baum<br />
Und wilde Rosen blühn am Waldessaum.<br />
68
Wenn diese Linden sterben 1967<br />
Wenn man zwei wackere Gechinger "Schultes" zu seinen Ahnen zählt, dann ist man zu jeder<br />
Zeit interessiert, was auf dem Rathaus sich tut. Diese zwei Schultes sind durch meine<br />
Großmutter nicht nur meine, sondern, wie schon früher bemerkt wurde, auch die Vorfahren<br />
des derzeitigen Bürgermeisters.<br />
Es ist der, im Heimatbuch an 16. Stelle stehende Hans Brackenhammer (1644-1666), der<br />
also noch während des 30 jährigen Krieges und unter schwersten persönlichen Schicksalen<br />
seines Amtes waltete. Auch der Aufbau des schwer zerstörten Dorfes mit seinen fast 100<br />
verlorenen Bürgern war sicher schwierig. Er wurde nur 56 Jahre alt. Er war ein Ahne, und<br />
nicht wie im Heimatbuch vermerkt ist, ein Onkel des an 26. Stelle genannten Johann Jakob<br />
Brackenhammer (1768-1796) der nicht nur Schultheiß, sondern auch Schöffe, Lammwirt,<br />
Bäcker und Bauer war. Gewiss, ein sehr vielseitiger Mann, der außerdem noch für seinen<br />
einzigen Sohn aus erster Ehe 1767, also vor genau 200 Jahren, die Gechinger Mühle erwarb.<br />
Er wollte dem Enkel die Mühle seines Großvaters Aaron Hecker zur Lebensgrundlage<br />
machen, und heute ist sie noch im Familienbesitz.<br />
Aus solchem Wissen wächst ein starkes Heimatgefühl, Gechingen verdankt ihm auch das<br />
erste meiner drei Heimatspiele "Furchtlos und treu", welches natürlich keine geschichtliche<br />
Forschung ist, sondern in dichterischer Freiheit die Persönlichkeiten in die damalige Zeit<br />
hineinstellte. Wenn man dann einmal ein Pressebericht wichtige Entscheidungen bringt,<br />
drängt sich unwillkürlich der Gedanke auf, welche Probleme gab es zu lösen Und wie<br />
würden unsere Alten heute handeln? Und es war auch eine wahrhaft historischschwerwiegende<br />
Entschließung, die Grundsteuer des Orts dem Landeshebesatz anzupassen,<br />
welcher in den Genuss staatlicher Beihilfen bringt. Aber gerade zu dieser Zeit kam jetzt<br />
durch einen Abgeordneten des Landtags, Erhard Schrempp, Gengenbach, die Anfrage, ob<br />
diese Regelung im Interesse der Stabilität und der Wirtschaftsentwicklung liege. Man darf<br />
gespannt sein, wie sich die Regierung dazu stellt. Für unser Dorf bedeutet dies auf alle Fälle<br />
den endgültigen Abschied der alten Epoche bäuerlichen Lebens und Wandels.<br />
Da ist es dann ein freundlicher Zufall, daß gerade in dieser Sitzung ein Antrag einiger<br />
Bergwaldbürger zur Sprache kam, man möge am Eingang zu ihrer Siedlung dem ehemaligen<br />
Gechinger Festplatz unter ihrer Assistenz etwas Pflege angedeihen lassen. Hier wurde,<br />
vielleicht unbewusst, an den unsterblichen Genius der Heimat appelliert, der dieses schöne<br />
Fleckchen Erde mit der Ewigkeit verbindet. Nun fiel auch zum ersten Mal seit Jahrzehnten<br />
wieder das Wort "Sedan", der Ort, wo am 2. Sept. 1870 Kaiser Napoleon III. mit seiner<br />
Armee vernichtet wurde, ohne allerdings den Krieg selbst zu beenden. Doch wurde nach<br />
dessen Ende 1871 und nach der Errichtung des Deutschen Kaiserreiches dieser Tag ein<br />
nationaler Feiertag, allerdings ohne Triumph, ganz aus dem Gefühl eines sicheren<br />
Vereintseins.<br />
Da wollten dann auch Gechingen seine Sedansfeier und seinen Festplatz. Und sicher war es<br />
der Initiative des damals schon amtierenden Schultheißen Otto Friedrich Ziegler zu<br />
verdanken, daß man den Platz auf steiler Bergeshöhe dazu wählte, <strong>von</strong> wo aus sich ein<br />
prächtiger Ausblick auf eine gleichsam verströmende Landschaft bot, welche im Unterschied<br />
zu der südlichen mit ihrem kulissenförmigen Halbrund Felder und Wälder der<br />
Nachbargemeinden einbezog und im Hintergrund die ersten Tannenwälder des<br />
Schwarzwaldes zeigte. Im Kreis wurden 12 Linden, gepflanzt, die sich im Laufe der Zeit zu<br />
prächtigen Bäumen entwickelten.<br />
Die Bedingung des Festplatzes war erfüllt und dann wurde ein Fest gehalten, das noch bis<br />
zur Jahrhundertwende immer Gesprächstoff bot. Nicht nur Ansprachen sollten gehalten<br />
werden und Lieder gesungen, nein man wollte ein echtes Volksfest feiern mit Trank und<br />
Schmaus. Tische und Bänke wurden aufgeschlagen, Bierfässer und Esswaren<br />
69
hinauftransportiert. Der nagelneue Waschkessel meiner Großeltern musste als<br />
Gulaschkanone funktionieren. Es wurde Nudelsuppe darin gekocht. Es gab natürlich auch<br />
Brezeln, Wurst und Wecken und für die Kinder Süßigkeiten. Aber ehe diese Lustbarkeit<br />
begann, wurden die 12 Bäume (Lindenbäume waren schon den Germanen heilig) zu<br />
"Friedenslinden" geweiht.<br />
Pfarrer Storz war sicher damals am 2. Sept. 1872, noch bewegt <strong>von</strong> dem Dienst, den er<br />
während des Krieges in seiner Gemeinde und für die Ausmarschierten zu tun hatte. Denn<br />
wenn uns heute der 70er Krieg so klein vorkommt im Unterschied zu der Hölle zweier<br />
Weltkriege, leicht war diese Zeit auch nicht gewesen. Ich bin im Besitz eines Briefes aus<br />
dem Januar 1871, wo der damalige Schorndorfer Dekan und nochmalige Prälat<br />
Brackenhammer schreibt: "Ich habe heute in den Verlustlisten auch Namen Gechinger<br />
Verwundeter gelesen". (Es war da auch der einzige Bruder meines Großvaters Heinrich<br />
Böttinger dabei, dem die blutige Schlacht bei Champigny den Verlust eines Fußes brachte,<br />
der aber bis in die hohen Achtzig sich seine Vaterlandsliebe, erhalten hatte), Pfarrer Storz<br />
aber sagte, vielleicht schon <strong>von</strong> einem dunklen Ahnen erfasst, die Worte: "Wenn diese<br />
Linden sterben, wird das Reich vergehen!" Es gab Festteilnehmer, welche diese Worte durch<br />
die Zeit begleiteten. Einmal war dann auch die Stunde des Schicksals gekommen,<br />
Vorderhand aber war noch eine reiche gesegnete Zeit vor den Menschen, die <strong>von</strong> ihrem<br />
Sedansfest wieder ins Tal hinunter gingen. Die Friedenslinden waren uns in meiner<br />
Kinderferienzeit ein beliebtes Wanderziel, sie waren sozusagen der Eingang in die prächtige<br />
Heide, die sich im Hochsommer, wenn das Gras zu gilben begann, in einen Silberteppich<br />
verwandelte, reichlich bestickt mit den schönen Silberdisteln, die damals noch nicht unter<br />
Naturschutz gestellt werden mussten und in vielen Bauernstuben einen prächtigen Schmuck<br />
abgaben. Dann gab es in dem weiteren Gelände kleinere und größere Kieferngruppen, die<br />
der Heide ihren Duft gaben. Es gab auch kleinere Steinbrüche und einen Fußpfad der dann<br />
hinter dem Schlossberg nach Deufringen führte. Er wurde in jener Zeit wieder benutzt, als es<br />
zwei Württemberg gab und an der Grenze zwischen Neckar- und Schwarzwaldkreis<br />
amerikanische Soldaten Wache hielten. Das lag aber noch weit im Feld, wenn wir am Ende<br />
der Heide in den heiligen Hain eintraten, in die keltische Kulturstätte, die heute noch unter<br />
Denkmalschutz steht. Die zweite Kulturstätte an der jenseitigen Kirchhalde, die ebenfalls<br />
unter Denkmalschutz steht, hat auch durch ihren Wasserturm eine unmittelbare Beziehung<br />
zu der Bergwaldsiedlung, birgt sie doch die Wasservorräte für die Wohnstätten, die vom<br />
Zähler auf dem Rathaus genau registriert werden.<br />
Die Friedenslinden aber, die nun bald hundert Jahre alt sind, hatten ihre Bewährungsprobe<br />
erst noch vor sich. Wieviel außer dem großen Sedansfest noch ähnliche Feste da oben<br />
gehalten wurden, ist nirgends verzeichnet. Aber einmal hatten sie noch ihren großen Tag.<br />
Das war im Herbst 1913, als ganz Deutschland, <strong>von</strong> Russland und Österreich assistiert, die<br />
100 jährige Wiederkehr der Völkerschlacht bei Leipzig feierte. Diese zog sich vom 17. - 20<br />
Oktober hin und entfachte in ganz Deutschland einen Sturm <strong>von</strong> Jubel und Dankbarkeit.<br />
Auch Gechingen wollte seinen kleinen, bescheidenen Teil dazu geben. Man wollte bei den<br />
Friedenslinden ein Höhenfeuer entfachen wie im ganzen Land. Durch die Ortsschelle wurde<br />
bekanntgegeben, die Einwohner möchten Holz und Reisig bereitstellen für den nächtlichen<br />
Holzstoß. Es war dann kein Haus, das nicht das Seine gab. Am beliebtesten waren aber die<br />
Holzkörbe mit Scheitle. Diese würden langer halten. So war es denn ein mächtiger Holzstoß,<br />
zu dem man hinaufwanderte. Bald schlugen die Flammen zum Himmel. Aber dann kam die<br />
Überraschung, nicht nur vom Althengstetter <strong>Jäger</strong>berg kam ein Flammengruß, nein, im<br />
weiten Umkreis am Schwarzwaldrand und im Widerschein flammten die Feuer, weit bis zu<br />
den Steilabhängen der Alb. Über 30 Feuer wurden gezählt. Ein überwältigendes Bild! Und<br />
ein Schwabendichter sang dazu: "Sieh auf mein Volk, wo deine Berge ragen, dort winkt der<br />
70
goldnen Freiheit Lichter Schein, der Höhenfeuer wilde Funken tragen in das Land hinein.<br />
Kein Berg, aus dem nicht hell die Lohe schlüge, kein Tal, das nicht ein Flammengruß erhellt,<br />
kein Hügel, der nicht stolz sein Feuer trüge, so grüßt ein freies Volk die weite Welt."<br />
Und dann als feierlicher Schluss: "Kein Herz, aus dem nicht heut Begeisterung schlüge, kein<br />
Herz, das nicht der Freude Licht erhellt, kein Herz, das nicht der Liebe Krone trüge, so grüßt<br />
ein freies Volk die weite Welt. Den Treueschwur, wie ihn nur Helden schwören, o hör den<br />
Fahneneid, mein Heimatland. Dir soll Mut, Gut und Blut gehören, du schönes, großes,<br />
deutsches Vaterland."<br />
So war es am 17. Oktober 1913, dem Vorabend des 100. Jahrestages der Völkerschlacht bei<br />
Leipzig. Wir besitzen noch die Zeitungen jener Tage. Da gäbe es zu berichten <strong>von</strong> der<br />
Einweihung des heute noch erhaltenen Völkerschlachtdenkmals, <strong>von</strong> dem Festzug der<br />
24 000 Stuttgarter Schüler zum Hof des neuen Schlosses, ein Musterbeispiel <strong>von</strong> Disziplin.<br />
Von der Festvorstellung des Eberhard-Ludwig Gymnasiums im kleinen Haus des neuen<br />
Hoftheaters, wo die Schüler das vaterländische Schauspiel "Kolberg" <strong>von</strong> Paul Heyse<br />
aufführten. Die Gesamtleitung hatte der Oberprimaner Arnold Bergsträßer, der nachmalige<br />
berühmte Rechtslehrer. Nach seiner Heimkehr aus der Emigration schrieb er mir einmal <strong>von</strong><br />
Freiburg im Breisgau, diese Erinnerung gehörte zu dem Schönsten, was er in seinem Leben<br />
besessen habe. Er starb kurze Zeit darnach, nicht viel über 60 Jahre alt. Der Treuschwur war<br />
auch für ihn schwer gewesen.<br />
Der Festredner jedes Oktoberabends bei der Feier im Lammsaal gehörte auch zu den vielen,<br />
die ihre Treue mit dem Tode bezahlten. Denn ein Jahr später, als die Welt in Flammen stand,<br />
kämpfte er auf französischem Boden und fand auch dort sein frühes Grab. Er war der<br />
Buchhändler Friedrich Essig, dessen einziger Sohn der Gechinger Heimatforscher Karl<br />
Friedrich Essig war. Auch sein Lebenswerk wurde ihm zu früh aus den Händen genommen.<br />
Hier hilft nur, wie einmal in einer Todesanzeige stand, der Glaube an die Ewigkeit.<br />
Dann kamen die Jahre der Demütigung nach fünfjährigem Heldenkampf, bei dem die<br />
Ruhmestaten <strong>von</strong> Leipzig und Champigny und Sedan verblassten. Noch einmal, in<br />
bitterkalter Winternacht, 20 Jahre nach jenen leuchtenden Oktobertagen, flammte ein<br />
Höhenfeuer auf, aber es war ein Phantom. Und wieder sechs Jahre später stand die Welt in<br />
Flammen, bis zum allerbittersten Ende. Dann kamen auch 6 Friedenslinden zu Sterben.<br />
Denn im April 1945 als die Franzosen schon im Nagoldtal standen, hatte droben auf dem<br />
Festplatz ein Geschütz Aufstellung genommen und ballerte in den Abendstunden völlig<br />
sinnlos in die Welt. Unten im Tal konnte man den verzweifelten Ausruf hören: "Die machet<br />
osere seltene Lenna he!" So war es auch. Aber als dann am 20. April auch über Gechingen<br />
Bomben fielen, als der Feind ins Dorf einzog, da dachte man lange nicht an die Linden.<br />
Dann kam lange danach die Zeit, da die stille Heide zur großen Baustelle wurde. Wenn man<br />
einmal auf die Höhe stieg, da wußte man nimmer recht, wo die Linden zu suchen waren.<br />
Und wenn man mich fragen wurde, wie viele heute noch stehen, ich wüsste es nicht. Daß<br />
nun aber die Neubürger zusammen mit der Gemeindeverwaltung etwas unternehmen, ist<br />
lobenswert. Vielleicht ist dann das Bannwort gelöst und ein Stück Heimatgeschichte uns<br />
wieder geschenkt.<br />
71
ALT-WÜRTTEMBERG 1967<br />
Es muß ein bitterkalter Winter gewesen sein, derjenige vom Jahr 1847/48. So schilderte ihn<br />
wenigstens mein Großvater, der ihn als 5 jähriges Büblein, und was vielleicht die Sache<br />
verständlich macht, als Sohn des Kommandanten der Gechinger Bürgerwehr, erlebte. Diese<br />
Wehren hatten in ganz Alt-Württemberg höchste Alarmbereitschaft und schon seit dem<br />
Spätherbst eifrig exerziert. Buben sind zu allen Zeiten die gleichen. So hatten die kleinen<br />
Kerle, es war auch noch der hoch betagt verstorbene Ferdinand Breitling, genannt der<br />
Maurer -Ferdinand, und der gleichaltrige Simon Rüffle, genannt der Stelzensemme, mit <strong>von</strong><br />
der Partie. Wenn sie oben auf dein Buckel am hohen Angel die übenden "Mannen"<br />
beobachteten, dachte wohl keiner <strong>von</strong> ihnen, daß sie einmal fast 20 Jahre später selbst unter<br />
den Waffen stunden, in dem Bruderkrieg <strong>von</strong> 1866, wo in der Schlacht bei<br />
Tauberbischofsheim dem Simon Rüffle eine preußische Kugel das Bein zerschmetterte. Sein<br />
Kamerad, mein Großvater, der spätere Feuerwehrkommandant Jakob Friedrich Böttinger,<br />
konnte ihm nur noch zurufen: "Semme, paß uff, se kommet". Da war das Unglück schon<br />
geschehen. Also, da<strong>von</strong> hatten die Drei noch keine Ahnung, als sie mit kleinen Steinchen<br />
nach den steifen Bauernhüten zielten und bei der Heimkunft ordentlich Schelte deshalb<br />
bekamen.<br />
Aber was war die Ursache <strong>von</strong> all der Unruhe und Aufregung in der Beschaulichkeit des<br />
Winterdorfes? Drüben über dem Rhein, in Frankreich, war seit der Revolution <strong>von</strong> 1787<br />
keine Ruhe mehr eingekehrt. Der Stern Napoleons war längst erloschen und er, der soviel<br />
Opfer und Blut gefordert hatte, war auf der Ozeaninsel Sankt Helena eines einsamen Todes<br />
gestorben. Die Bourbonenkönige hatten die Zügel ergriffen und auch wieder verloren. Aber<br />
die Losung: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" spuckte auch in den deutschen Köpfen.<br />
Unser Schwabenland hatte sein Blutopfer auch gebracht. König Friedrich hatte die<br />
Kurfürsten- und hernach Königswürde der Gnade Napoleons zu verdanken. Seine einzige<br />
Tochter Katharina hatte er dem König <strong>von</strong> Westfalen, Jerome Bonaparte zur Frau gegeben.<br />
Obwohl dieser König "Morgen wieder lustig" die feine und gütige Fürstin nicht besonders<br />
hoch schätzte. Die beiden Söhne hatten weder für Westfalen noch für Württemberg eine<br />
Bedeutung. Der eine, Prinz Plon-Plon genannt, verschwand in Frankreich. Der andere stand<br />
als Major in österreichischen Diensten, starb aber wenige Jahre, nach dem <strong>von</strong> uns<br />
geschilderten Zeitpunkt.<br />
Die ganze Lage war 1848 ziemlich unklar. König Wilhelm der Erste gab in Stuttgart seinen<br />
Ministerien allerlei Zugeständnisse, doch hielt er sein Militär in steter Alarmbereitschaft.<br />
Gegen wen, das wußte kein Mensch so richtig, denn der Nachrichtendienst lief nicht auf so<br />
hohen Touren. So standen also auch die Bürgerwehren "Gewehr bei Fuß", wobei allerdings<br />
die Ausrüstung nicht gerade glänzend war.<br />
So kam dann der März 1848 heran. Ein erstes Frühlingsahnen zog durch Feld und Flur. Da<br />
läuteten an einem Samstag die Glocken <strong>von</strong> Turm zu Turm. Der sogenannte<br />
"Franzosenfeiertich" war angebrochen und die Bürgerwehren setzten sich in Bewegung. Was<br />
war geschehen? Die Kunde: "Die Franzosen kommen mit 40 000 Mann über die<br />
Alexanderschanze"(bei Freudenstadt) und die "Freischärler", d. h. die meist aus Studenten<br />
bestehenden Freikorpskämpfer sammelten sich um Hecker und Herwegh, Da kam dann auch<br />
das bäuerliche Schwabenblut in Wallung. Mein Urgroßvater sammelte seine "Mannen" und<br />
zog mit ihnen den Calwer Weg hinaus gegen den Schwarzwald. Da die Gewehre nicht<br />
ausreichten, bewaffneten sie sich - nicht nur in Gechingen - mit Dreschflegeln und<br />
Heugabeln. Es war dies durchaus kein Scherz, sondern eine bitterernste Sache. Zum Glück<br />
erwies sich dann der Alarm als falsch und die Gruppen konnten nach einigen Tagen wieder<br />
heimwärts ziehen.<br />
Ich habe diese Ereignisse in meinem dritten Gechinger Heimatspiel "Heiliges Feuer"<br />
72
festgehalten. Denn mein Großvater und die anderen "Vetraner" die auch noch 1870/71 dabei<br />
waren, sahen in den 48er Jahren immer das Präludium zur Einigung Deutschlands unter<br />
einer demokratischen Regierung. Es war auch an eine Einigung mit Österreich gedacht, das<br />
die Führung des "Heiligen römischen Reiches Deutscher Nation" bis zum Jahre 1806 gehabt<br />
hatte. Die heutige Geschichtsforschung gibt vielen Ereignissen <strong>von</strong> damals eine andere<br />
Deutung, nach dem das <strong>von</strong> dem mächtig aufstrebenden Brandenburg-Preußen geführte<br />
Kaiserreich endgültig zerbrach. Jedenfalls aber durfte sich die heutige Jugend kaum mehr<br />
vorstellen können, mit welcher vaterländischen Begeisterung vergangene Geschlechter ihrer<br />
Vaterlandsliebe Ausdruck gaben, auch später noch.<br />
Es war auch so, daß viel wertvolles Menschentum nicht nur in den folgenden Kämpfen im<br />
Badner Land und bis hinauf nach Norddeutschland, bis nach Berlin geflossen ist. Nein, auch<br />
nach den Niederlagen der "Freischärler" und Miliz, als die Regierungen fest im Sattel saßen,<br />
schüttelte mancher "Achtundvierziger" den Staub der Heimat <strong>von</strong> den Füßen und zog in eine<br />
oft ungewisse Zukunft. Die Schweiz bot ihnen Asyl. Dorthin flüchtete auch Georg Herwegh,<br />
der aber später <strong>von</strong> Heimweh getrieben wieder zurückkehrte und unangefochten leben<br />
konnte. Auch der "Vetter <strong>von</strong> Schwaben", Joh. Nefflen, der die Fahrt über den großen Teich<br />
angetreten hatte, kam noch einmal in seine Unterländer Heimat, wo er einst Schultheiß war.<br />
Mit brennendem Herzen schrieb er seine "Geschichten aus Schwaben", die eine prächtige,<br />
meist schwäbisch-dialektische Schilderung der vormärzlicher Zeit sind. Er kehrte dann<br />
allerdings wieder nach Amerika zurück und ist auch dort gestorben. In Zürich als<br />
Hochschullehrer hat ein anderer Schwabe, Johannes Scherr, gewirkt. Er, der ein<br />
phänomenales Wissen der europäischen Geschichte besaß, ging in seinen, mehreren Bänden<br />
umfassenden "Tragikkomödien der Weltgeschichte" mit der Oberschicht der europäischen<br />
Völker nicht gerade schonlich um. Bei ihm ließen sich bestimmt neue, interessante<br />
Kolumnen finden, wenn allmählich den Journalisten die Themen ausgehen sollten.<br />
Wieder gehen wir durch Wintergrau und Nebel einem neuen Lenz entgegen. Aber er wird<br />
uns nicht nur sonnige Tage bringen und sorglose Zeiten. für viele Menschen unserer<br />
Bundesrepublik. Vieles, was unsere Alten kaum zu ahnen wagten, ist in Erfüllung gegangen,<br />
aber die Bewährungsprobe, die kommt auf uns alle zu. Es werden keine Sturmglocken läuten<br />
und die Franzosen beginnen unsere Freunde zu werden, aber einen inneren Ruck müssen<br />
sich viele moderne Menschen doch geben und darin werden sie sicher auch das neue<br />
Schicksal meistern. Denn das wird in den künftigen Monaten und Jahren dringend nötig<br />
sein!<br />
73
Strukturwandel auf dem Dorf 1967<br />
So nennt sich das Motto eines im SiIberburgverlag Stuttgart erschienenen Werkes, <strong>von</strong><br />
welchem der Schreiber mit Stichworten in prägnanter Form alle die Umwandlungen bringt,<br />
die auch der Bürgermeister unserer Gemeinde in seinem Rechenschaftsbericht in seinem<br />
" Blättle" vor seiner Wiederwahl gab. Man höre:- Innere und äußere Struktur (dieses<br />
lateinische Wort bedeutet Bauart oder Gefüge) unserer Dörfer hat sich in den letzten Jahren<br />
wesentlich geändert. Eine Anzahl der Landgemeinden ist zu Arbeiterwohngemeinden<br />
geworden. Rein landwirtschaftliche Siedlungen haben sich zu "gemischtwirtschaftlichen<br />
Orten" entwickelt.<br />
Die Motorisierung hat um sich gegriffen, die landwirtschaftlichen Methoden sind technisiert,<br />
marktwirtschaftliche Grundsätze spielen eine neue Rolle. Kommunikationsmittel wie Radio<br />
und Fernsehen, erobern sich auch im entferntesten Dorf Haus um Haus.<br />
Hier muss zu den Kommunikationsmitteln auch noch da Pressewesen kommen, das<br />
ebenfalls eine Erweiterung des dörflichen Gesichtskreises bedeutet. Gerade das "Gechinger<br />
Blättle" die ureigenste und dringendnötige Schöpfung <strong>von</strong> Bürgermeister Weiß lässt bei den<br />
alten Leuten die Erinnerung an das ehemalige "Gemeindeblatt" aufkommen, das vom<br />
Pfarramt herausgegeben wurde und im ersten Dezennium unseres Jahrhunderts in die damals<br />
so schlichten Bauernhäuser kam. Mit dem Wegzug des späteren Kirchemanns Andler war<br />
sein Erscheinen eingestellt. Pfarrer Reusch wollte es noch einmal herausgeben, aber, schon<br />
griff die neue Zeit danach und er resignierte mit dem Seufzer des kleinen ABC- Schützen:<br />
"Hätt i no des Deng net a'gfanga!" Es war schade um die kleine Kopfleiste.<br />
Das jetzige Amtsblatt scheint sozusagen ein stolzer Nachkomme zu sein. Dank der Initiative<br />
eines hiesigen Künstlers, Herrn Staege, freut man sich jedes mal, wenn man ein Exemplar in<br />
die Hände bekommt. Die Kopfleiste ist eine minutiöse Zeichnung des Ortskerns mit Kirche<br />
und Pfarrhaus und weiter das Straßenwinkel bis hinauf zur Angeläckersiedlung. Diese<br />
Zeichnung fiel so gut aus, daß sie die Einladung zum vorjährigen Heimatfest schmückte und<br />
im kleinen Format die Briefumschläge der Gemeindeverwaltung ziert, mit dem Vermerk:<br />
"Herrliche Lage im Bäderkreis Calw. Solcher Gestalt hätte man den Kopf des früheren<br />
Gemeindeblattes nicht verwenden können. Es fragt sich auch, ob überhaupt in einem Haus<br />
noch ein Exemplar vorhanden ist. Diese weitschweifige Erklärung zum ureigenen<br />
Presseerzeugnis des mit kleinstädtischen Ambitionen ausgestatteten Dorfes zeigt, wieviel<br />
Neuerungen zu finden sind.<br />
Fand sich früher in den Häusern außer dem Wochenblatt, dem Sonntich- und dem<br />
Pfennigblättle kaum viel Lesestoff, so machen heute die großen Sendungen der<br />
Tageszeitungen, Wochenzeitschriften und Illustrierten einen imposanten Eindruck, nicht zu<br />
vergessen die Fachzeitschriften. Man wird nicht mehr sagen können, daß sie in den Dörfern<br />
auch in dieser Beziehung nicht mehr über Kirchturmspitze hinaussehen.<br />
Besondere Bedeutung hatte die Zuwanderung <strong>von</strong> Vertriebenen und Flüchtlingen gebracht.<br />
Hier muss bemerkt werden, daß es sich bei der Reszens um die Hohenloher Gegend handelt,<br />
wiewohl die ganze Aufzählung als Musterbeispiel gelten soll. Bei unserem Dorf kommen<br />
auch noch die neuen Siedlungen mit meist städtisch orientierten Bewohnern hinzu. Die<br />
ersten Neubürger, die Heimatvertriebenen, die längst akklimatisiert sind, kamen vielfach aus<br />
bäuerlichen Verhältnissen und bebauten gern das Land. Sie haben aber auch mit ihren<br />
Familien die schmerzlichen Lücken ausgefüllt, die der Krieg in die Reihen der jungen<br />
Gechinger Bürger gerissen hat. Wenn diese auch <strong>von</strong> der Gemeinde und ihren Familien<br />
unvergessen sind.<br />
Dann fährt der Bericht fort. Mechanisierung, Technisierung und Rationalisierung drang<br />
sogar in das häusliche Leben ein. Schließlich brachten Flurbereinigung, Aussiedlung,<br />
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung neue, strukturverändernde Lebensgrundlagen in<br />
74
die Dorfgemeinschaft. Dies alles zu untersuchen - auch die architektonischen Neuheiten und<br />
Veränderungen - dazu ist zweifellos jetzt die rechte Zeit. Dann heißt es weiter; denn nur die<br />
Kenntnis des vorher Gewesenen läßt die Wirkungen und Wandlungen offenbar werden.<br />
Diese sind auch in Mundart, Wortschatz, Volkskunst, Volksdichtung, Volksmusik,<br />
Überlieferung, Gemeinschafts- und Vereinsleben zu untersuchen. Wie wirken die neuen<br />
musikalischen Schlager und modernen Lieder und was bleibt vom schönen alten Volkslied<br />
erhalten?<br />
Man sieht, wie sich aus vielen Mosaikstücken die Strukturwandlung zusammen-<br />
setzt, denn nur kurz gestreift wird das heute so heiß umkämpfte Schulwesen, Problem über<br />
Problem häuft sich vor dem Leser auf und zwingt zum Nachdenken.<br />
Gerade weil auch die Dörfer in den Wirbel der Zeit hineingezogen sind, werden sie auch bei<br />
einer Umwandlung der heutigen Verhältnisse, die sich abzeichnet, nicht mehr in der<br />
patriarchalischen Ruhe vergangener Epoche verharren können, wo man mit Bescheidenheit<br />
und Genügsamkeit sein Tagwerk tat und einen geruhsamen Feierabend und Sonntag hatte.<br />
Das Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Und schon der gute alte Busch, der Vater<br />
des unsterblichen Brüderpaares "Max und Moritz" schrieb zu einer seinen witzigen<br />
Zeichnungen vor 70 Jahren: "Ein, zwei, drei, im Sauseschritt geht die Zeit. Wir sausen mit!".<br />
Was würde er heute erst sagen?<br />
Seernanns letzte Fahrt 1967<br />
Immer um Weihnachten herum fand im Dorfe die Altenfeier statt. Das hat der junge Pfarrer<br />
so eingeführt und da freuten sich die Alten <strong>von</strong> einem Jahr zum andern darauf. Und immer -<br />
wenn dieser wichtige Tag nahe war, kam vorher der gute, alte Vater Zech: "Ach würden sie<br />
mir nicht wieder schreiben eine Dankrede für den Altentag?" Er sprach immer etwas<br />
mühsam seine Muttersprache, denn mehr als 40 Jahre hat er nur noch in ihr gedacht,<br />
gesprochen hat er sie nicht mehr.<br />
Es heißt gewiss nicht aus der Schule schwätzen, wenn ich verrate, daß er jedes Jahr seine<br />
Rede bekam, denn der Greis ruht nun schon Jahre auf dem stillen Gottesacker. seines<br />
Heimatdorfes. Ein reichbewegtes Leben ist im Heimathafen vor Anker gegangen.<br />
Der junge Verwaltungspraktikant, der in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts die<br />
sichere Existenz aufgab, um die weite Welt kennen zu lernen, hat dies, trotz schwerer<br />
Schicksalsschläge, auch am Abend seines Lebens nicht bereut.<br />
Als Schiffskoch fuhr er auf allen Meeren und lernte die Länder und Völker der Erde kennen.<br />
In Sydney, der australischen Hafenstadt, gründete sich der junge Schwabe ein eigenes Heim<br />
und wurde der Besitzer eines gut gehenden Feinkostgeschäftes, dem ein Erfrischungsraum<br />
für die Gäste eines nahegelegenen Theaters angegliedert war.<br />
Drei Kinder entsprossen seiner Ehe mit einer Engländerin. Aber das einzige Töchterlein<br />
ertrank an einem Weihnachtstag, als es am Strand weilte, ein Schmerz, den der Greis nie<br />
verwand. Die Söhne mit den deutschen Namen wurden <strong>von</strong> der Mutter erzogen. da der Vater<br />
immer wieder auf See ging. So kam der Weltkrieg, er traf den Seemann in St. Louis, und<br />
dort war er bis zum Kriegsende interniert. Seine Angehörigen hat er nie mehr gesehen, seine<br />
Frau hatte sich <strong>von</strong> ihm losgesagt.<br />
Der alte Seemann hatte nur noch ein Ziel: wieder heim in das Land seiner Kindheit, in das<br />
Dorf. wo seine Wiege gestanden. Er hatte schon während der Gefangenschaft als Lagerkoch<br />
eine gutbezahlte Stellung gehabt und fand später wieder ähnliches. Er gedachte in<br />
75
Deutschland eine Hühnerfarm aufzumachen und die ersten Vorbereitungen waren schon<br />
getroffen. Die Inflation machte alle Pläne zunichte.<br />
Als der Greis wenige Wochen nach seinem 70. Geburtstag in Deutschland eintraf, war zum<br />
zweiten Mal sein Lebenswerk zerschlagen. Bei guten Bekannten fand er ein sonniges<br />
Stüblein. Statt der Hühnerzucht trieb er Kanarienzucht und diese war der Grund unserer<br />
Bekanntschaft. Wir kauften ihm zwei fleißige Sänger ab, die ihrem Pflegepapa alle Ehre<br />
machten.<br />
Da leuchtete nun das Abendrot des Christabends über dem Dorfe, als ich dem Greis wieder<br />
eine Rede und einen kleinen Weihnachtsgruß brachte. Ein schmuckes Tannenbäumchen<br />
stand auf dem Tisch, an den Fenstern blühten späte Blumen. Die kleinen Sänger in den<br />
zahlreichen Käfigen zwitscherten noch leise ihr Abendlied. Ganz unwillkürlich kam mir<br />
mein Vers in den Kopf:<br />
Wir Alten - wir haben schon viel erlebt,<br />
Nun hat sich die Lebensflut verebbt,<br />
Nun sehen wir ferne - im Abendrot<br />
Ein seliges Land - ohne Kummer und Not!"<br />
Während sonst der gute Vater Zech immer so kindlich fröhlich war, schien ihm heute<br />
wehmütig zu Mute zu sein. Er erzählte,- was er noch nie getan - <strong>von</strong> seiner schönen, aber<br />
kaltherzigen Frau, die er vor gerade 50 Jahren geheiratet hatte. Er erzählte <strong>von</strong> seinen beiden<br />
Söhnen, die den Vater auch ablehnten, weil er deutsch sein und bleiben wollte.<br />
Aber: "Es ist ja mein letztes Weihnachten, Ich sehe den Heimathafen." Da<strong>von</strong> ließ er sich<br />
nicht abbringen. Auch nicht vier Wochen später, als er trotz Schnee und Kälte nach "Hans"<br />
und "Fips', seinen einstigen Schützlingen sehen wollte.<br />
Es war sein letzter Besuch bei uns, es war überhaupt sein letzter Gang gewesen. Am andern<br />
Morgen traf ihn der Schlag und tags darauf ist er sanft hinübergeschlummert.<br />
Warum er gerade mich noch so in sein Leben hineinschauen ließ? Vielleicht weil ich ihn<br />
immer so treu mit Gedichten versorgte. Wer kann's sagen. Aber ich gehe kaum an dem alten<br />
Haus vorbei, ohne an den zwei verwaisten Fenstern hinaufzusehen, wo in vergangenen<br />
Jahren ein gutes, altes Gesicht zwischen Blumen und Vöglein herausgrüßte.<br />
Warum Calw am 4. Dezember 1767 so festlich beleuchtet wurde 1967<br />
Auf der Suche nach geschichtlichen Ereignissen in und um unser Dorf Gechingen stießen<br />
wir schon vor 35 Jahren in dem 1911 erschienenen Tagebuch des Herzoglich<br />
Württembergischen Generaladjutanten Alexander Freiherrn <strong>von</strong> Buwingausen-Wallmerode<br />
über die "Landreisen" des Herzog Karl Eugen <strong>von</strong> Württemberg in der Zeit <strong>von</strong> 1767 - 1773.<br />
Der Herausgeber war ein Urenkel des Schreibers aus der weiblichen Linie, Freiherr Ernst<br />
<strong>von</strong> Ziegeser, der es im Auftrag des Geschichts- und Altertumsvereins etwas mühsam aus<br />
schon vergilbten Blättern zusammengestellt hatte. Es machte ihn aber Freude, wie heute<br />
noch den Lesern, die hier einen antiquierten Serienbericht <strong>von</strong> großer Akribie und<br />
Unbekümmertheit vorfinden.<br />
Das Geschlecht der Buwinghausen, der ehemaligen Burgherren <strong>von</strong> Zavelstein, wurde ja<br />
auch heuer bei der Festlichkeit zur Erinnerung an die Flucht Graf Eberhards, des<br />
Rauschebarts, erwähnt. Dies war ja ein Geschehnis, das 600 Jahre zurückliegt und <strong>von</strong><br />
Ludwig Uhland in einer Ballade festgehalten wurde, welche die schwäbische Schuljugend,<br />
76
<strong>von</strong> den Gymnasien an bis zu den einklassigen Volksschulen, auswendig zu lernen hatte und<br />
<strong>von</strong> welchen die Anfangsreime meist fest im Gedächtnis blieben: "In schönen Sommertagen,<br />
wenn lau die Lüfte wehn, die Wälder lustig grünen, die Gärten blühend stehn, da ritt aus<br />
Stuttgarts Toren ein Held <strong>von</strong> stolzer Art, Graf Eberhard der Greiner, der alte Rauschebart."<br />
Und in echter Begeisterung <strong>von</strong> künftigem Ferienglück, ging es weiter: "Zu Hirsau bei dem<br />
Abte, da kehrt der Ritter ein und trinkt beim Orgelschalle den kühlen Klosterwein. Dann<br />
gehts durch Tannenwälder ins grüne Tal gesprengt, wo durch ihr Felsenbette die Enz sich<br />
rauschend drängt."<br />
Calw wird hier ja nicht erwähnt, doch wissen wir längst, daß der Dichter und Jurist, der<br />
Landtagsabgeordnete und alte 48er Ludwig Uhland das Glück seines Lebens, seine Gattin<br />
Emilie geb. Fischer in Calw fand. Ist also da unserer Kreisstadt nicht erwähnt worden, so hat<br />
sie zu den Herren <strong>von</strong> Buwinghausen Beziehung gehabt. Diese hatten zwar ihr Burg-Gut<br />
schon über Herzog Eberhard Ludwig dem Lande Württemberg verkauft, doch war der Vater<br />
des Schreibers Johann Friedrich <strong>von</strong> Buwinghausen Obervogt <strong>von</strong> Calw, Neuenbürg und<br />
Wildbad. Zuvor war er Hauptmann im Kaiserlichen Infanterie-Regiment Prinz Alexander<br />
<strong>von</strong> Württemberg in Belgrad gestanden, dort war auch Alexander Maximilian im Februar<br />
1728 geboren worden.<br />
Als Herzog Karl Eugen, 1744 <strong>von</strong> Berlin kommend, die Regierung über das Land<br />
Württemberg antreten konnte, für seinen Vater Karl Alexander, der nur <strong>von</strong> 1733 - 1737,<br />
nicht gerade glänzend regiert, war er eigentlich nur militärisch geschult, am Hofe Friedrichs<br />
des Großen. Sein jüngster Bruder Friedrich Eugen blieb in Preußen und heiratete eine<br />
Prinzessin <strong>von</strong> Brandenburg-Schwedt, deren Nachkommen bis zum ersten Weltkrieg das<br />
festgefügte königliche Haus ausmachte, heute aber im Mannesstamm erloschen ist, bis auf<br />
den jüngsten Sohn Alexander, dessen Nachkomme Herzog Philipp <strong>von</strong> Württemberg ein<br />
Ehrengast in Zavelstein war. Und da der vitale alte Herr, er wurde mit seinen 5<br />
Geschwistern, noch zwei Brüdern und drei Schwestern, (<strong>von</strong> uns Stuttgartern nach dem<br />
Vater Herzog Albrecht nur die "Albrechle" genannt) eine vielköpfige Enkelschar besitzt,<br />
unter denen sogar ein kleiner Herzog Friedrich und Herzog Eberhard zu finden sind, so wird<br />
auch Herzog Karl Eugens Gedächtnis noch nicht erlöschen, wenn er auch mit seiner Gattin,<br />
einer Prinzessin Ansbach-Bayreuth keine Kinder hatte. Buwinghausen erzählt dafür <strong>von</strong><br />
einigen Söhnen, welche ihm seine Freundinnen schenkten und welchen er väterliche Hilfe<br />
angedeihen ließ.<br />
So sind wir also im Dezember 1767 und Buwinghausen, der langjährige Begleiter des<br />
Herzogs schreibt: "Tübingen-Calw am 3. Dezember. In dieser Nacht legte es einen Schnee<br />
und gefrohre stark. Nach 9 Uhr fuhren er in der Reise-Chaise Mdm. Bonfina (einer Sängerin<br />
und seine ständige Begleiterin) auf die Solitude, woselbst sie über Nacht blieben. Die<br />
Damen und das ganze Theatre gingen wieder zurück nach Ludwigsburg. Die chaisierten<br />
Cavaliers aber nach Calw."<br />
Es folgen eine ungeheure Menge adeliger Namen, deren Repräsentanten noch am<br />
Königlichen Hof existierten. Mein Großvater <strong>Jäger</strong>, der nach seiner Pensionierung als<br />
Regimentsmusiker des 3. Königl. Infanterie-Regmients "Alt-Württemberg" Ludwigsburg,<br />
noch viele Jahre im Königlichen Schlossgardekorps seine Dienste tat, nannte manchen dieser<br />
Adelsnamen, was <strong>von</strong> seiner Enkelin mit Wohlgefallen registriert wurde. Doch im<br />
Dezember 1767 ging die Stadt Calw einem lebhaften Abend entgegen. Am Abend um 1/2<br />
Uhr kam der Herzog mit dem Major <strong>von</strong> Schwartzenfels hier an. An der Hengstetter Steig<br />
hatte die Stadt eine schöne Ehrenpforte aufgerichtet, an derselben bis zum "Waldhorn" war<br />
der Magistrat und die ganzen Bürger in Mänteln "en haye"aufgestellt.<br />
77
2. Februar, Lichtmeß - Kunkel vergeß! 1968<br />
"Wenn der Tag beginnt zu langen, kommt der Winter erst gegangen."<br />
Dieser Spruch aus Urväter Tagen hat heut noch seine Gültigkeit. Und damals wie heute lebt<br />
die Menschheit in der Hoffnung des steigenden Lichtes. So liegt in dem Wort "Lichtmeß"<br />
mehr als der alte, kirchliche Brauch der "Lichtermesse" oder "Lichterweihe", der diesem Tag<br />
seinen Namen gab.<br />
Er entspringt dem Feiertag der Begegnung der Gottesmutter Maria mit dem alten Simeon im<br />
Tempel zu Jerusalem. Es ist hier wie meist bei kirchlichen Feiern, daß sie sich wie<br />
selbstverständlich dem Rhythmus der Natur verbinden und an einem Platz stehen, den man<br />
sich geeigneter gar nicht denken könnte.<br />
Lichtmeß! Darin liegt Befreiung, darin liegt die Freude des Sieges über das Dunkel der<br />
Winterzeit. Wir modernen Menschen müssen uns, um dies ganz zu verstehen, einmal<br />
zurückversetzen in die Winter unserer Vorfahren.<br />
Eine kleine Ahnung ist uns alle überkommen, als in der zweiten Januarwoche eine<br />
Winterkatastrophe <strong>von</strong> gigantischen Ausmaßen unsrem ganzen zeitgemäßen Leben drohte.<br />
Wenn es plötzlich keinen elektrischen Strom mehr gäbe, wenn all die Annehmlichkeiten, die<br />
sein Vorhandensein birgt, unter Sturm und Schneelast versiegen würden? Wie gnädig ging<br />
dies für unser Dorf ab. Aber wieviel Not und Zerstörung hat es anderen Gegenden und<br />
Menschen gebracht.<br />
Und damals in der alten Zeit, wie karg waren namentlich auf den Dörfern die Lichtquellen.<br />
Beim flackernden Schein der Laternen mußte man in Stall und Scheuer hantieren, und zwar<br />
mit größter Vorsicht und viel Umständlichkeit, weil die Feuersgefahr immer drohend über<br />
Haus und Hof lag. Bei der Öllampe wurde die Abendandacht gehalten und gesponnen. je<br />
geringer der Lichtverbrauch war, umso mehr rühmte man die Hausfrauentugend der Bäuerin.<br />
Kein Wunder, daß alles den langen und oft so bitterkalten Januar beinahe nicht zu Ende<br />
erwarten konnte, daß der Lichtmeßtag einen hellen Freudenschein ins Haus trug.<br />
"Lichtmeß, bei Tag z' Nacht eß" schmunzelte der Bauer und klopfte sein Pfeifle aus.<br />
"Lichtmeß, Kunkel vergeß" sagte die Bäuerin und stellte das Spinnrad beiseite. jawohl, jetzt<br />
wird es Schluß mit der Ofenhockerei. Bald hängen die weißen Wolkenfahnen am blauen<br />
Himmel und die Erde dampft aus brauner Scholle.<br />
Auch jetzt noch dringt das Helle und Frohe, das Hoffnungsvolle, das am Lichtmeßtag hängt,<br />
in das dörfliche Leben ein und läßt die Herzen der Menschen höher schlagen:<br />
Bald ist der Winter vorbei, das Dunkel verschwindet,<br />
s´ist Lichtmeß! Das Lenzhoffnung kündet!<br />
Aus vormärzlicher Zeit 1968<br />
Man mag den Frühling noch so oft erleben, sein Zauber wird mit jedem Jahre neu, wenn mit<br />
geheimnisvollem Weben die Erde wird <strong>von</strong> ihren Winterfesseln frei. Blau spannt der<br />
Himmel seinen Bogen, weit liegt die Welt im Sonnenglanz. Vom Süden kommen<br />
Wandervögel hergezogen ein erster Schmetterling lebt sich im Tanz. Die Kinder spielen auf<br />
den Gassen, die Alten sonnen sich auf warmer Bank, weil sie die Winterstuben nun<br />
verlassen, so sagen sie dem Frühling innig Dank. Und hastet um sie all' das laute Leben, so<br />
stört das ihre Seelen nicht, sie haben ihren Teil bereits gegeben und freuen wunschlos sich<br />
am goldnen Licht.<br />
Diese Verse, schon vor geraumer Zeit in die Öffentlichkeit gedrungen, gelten fast wie ein<br />
78
Gruß an Alt-Gechingen, ja noch mehr an die alten, betagten Einwohner. So ist es auch ein<br />
Gruß an die jenigen die so fest im Dorfbild verankert waren und deren Gruß und<br />
freundlichen Worte in unserer hektischen Zeit fast eine Rarität waren. Aber auch als Zeugen<br />
einer besonnten Jugendzeit waren sie mit unter uns. Sie konnten berichten <strong>von</strong> einem<br />
geruhsamen, bescheidenen Leben, welches heute fast wie ein Märchen anmutet, und <strong>von</strong><br />
dem sie so bereitwillig erzählten, wenn man sich die Mühe gib, ihnen zuzuhören.<br />
Heute, wo die technischen Fortschritte, Funk und Fernsehen weitgehend die menschliche<br />
Unterhaltung bestimmen, kommt Überlieferung und Tradition unwillkürlich zu kurz. Und<br />
doch, erst kürzlich konnte man den Ausspruch eines mitten im Leben stehenden Beamten<br />
lesen: "Was vom Alten neben dem Modernen geblieben ist, ist für uns Lebende, soweit wir<br />
noch geschichtlich denken können, soweit für uns Geschichte lebendiger Beziehung vorn<br />
Gewordenen zum Werdenden ist, eine stetige Gründung auf den fundamentalen Kräften<br />
unserer Existenz." Gewiss ein Satz, der hohe Anforderungen in die Konzentration des Lesers<br />
stellt. Er läßt sich aber auf die einfache Norm bringen; wir haben kein tragendes Fundament,<br />
wenn wir die Vergangenheit ablehnen. Dabei gilt es natürlich in erster Linie die<br />
Vergangenheit hervorzuholen, die nicht ein ganzes Volk in Zweifel und Verwirrung stürzte.<br />
Dann wird es auch nicht mehr so sein, wie man heute oft hört, ja <strong>von</strong> "dem" wollen die<br />
jungen Leute nichts mehr wissen. Dann werden sie plötzlich entdecken, daß noch eine<br />
Substanz da ist, die keiner konjunkturellen Schwankung unterworfen ist, sondern die <strong>von</strong><br />
Menschen kündet, die wohl einer anderen Epoche angehörten, die andere<br />
Lebensbedingungen kannten, die aber auch Glieder in einer Kette des völkischen Lebens<br />
waren, dem auch wir angehören. Und <strong>von</strong> solchem Zeitlauf soll hier die Rede sein, im<br />
Großen wie im Kleinen. Mancher der alten Leser wird sich an den glanzvollen Film der Ufa<br />
aus den dreißiger Jahren erinnern: "Der Kongress tanzt", der an eine der glanzvollsten<br />
Episoden der europäischen Diplomatie erinnert, die allerdings auch keine grundlegende<br />
Besserung der Verhältnisse schaffen konnte. Man schrieb das Jahr 1815, als im glanzvollen<br />
Wien eine illustre Gesellschaft an Diplomaten und schönen Frauen - man würde heute sagen<br />
des Hochadels - versammelt war, um in langen Beratungen zu retten, was der auf die Insel<br />
Elba verbannte große Korse an Scherben in seinen großen Feldzügen zurückgelassen hatte.<br />
Man sieht, der weise Ben Akibal, den mein Vater so oft zitierte, hatte schon recht: Alles<br />
schon dagewesen!<br />
Die lieben Alten und wir, die wir nun nachrücken, haben in unseren Schuljahren noch <strong>von</strong><br />
dem Befreiungskrieg gehört, der nach der schmerzlichen Niederlage <strong>von</strong> Jena und Auerstädt<br />
(1806) mit vielen glanzvollen Namen erzählt wurde. Da war aber nichts <strong>von</strong> Chauvinismus<br />
zu lesen und zu hören, sondern nur <strong>von</strong> der Freiheit. Aber in Wien war das so, daß die vielen<br />
verwickelten Verhandlungen (der Kaiser <strong>von</strong> Österreich hatte ja auch seine Verbündeten<br />
eingeladen, den Kaiser <strong>von</strong> Russland, König Friedrich <strong>von</strong> Preußen ebenso wie die<br />
regierenden Herren der deutschen Lande) eine klare Konzeption unmöglich machten. Da<br />
sagte der belgische Fürst Lingne das bittere Wort: "Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht<br />
<strong>von</strong> der Stelle." Wobei er auf die vielen prächtigen Feste anspielte, die in endloser Reihe<br />
gefeiert wurden, vergleichbar den heutigen Pressebällen der einzelnen Bundesländer. Auch<br />
die vornehmen Salons fürstlicher Damen, in denen die politischen Gespräche oft unter ihrer<br />
Assistenz geführt wurden, waren ein wichtiger und ungeheure Summen verschlingender<br />
Faktor. Und hier setzt denn eine Geschichte ein, die für unser schwäbisches Volk nicht ohne<br />
Bedeutung wurde. Unter den Damen, die den Wiener Kongress schmückten, waren zwei, die<br />
durch ihre Schönheit und Bildung die allergrößte Hochachtung genossen. Es waren dies die<br />
Schwestern des Zaren Alexander I. <strong>von</strong> Rußland, Maria Pawlowna, Erbgroßherzogin <strong>von</strong><br />
Sachsen-Weimar und Katharina Pawlowna, verwitwete Herzogin <strong>von</strong> Oldenburg. Beides<br />
waren Töchter der Zarin Witwe Marie, Herzogin <strong>von</strong> Württemberg. Diese Witwe des<br />
79
unglücklichen Zaren Paul war mitten in dem sittenlosen Treiben am russischen Fürstenhof<br />
eine unantastbare Erscheinung. Sie ließ ihren neun Kindern - es waren fünf Söhne und vier<br />
Töchter - die denkbar beste Erziehung angedeihen. Und das zeigte sich auch beim Wiener<br />
Kongress. Nur setzte dann eine Herzensgeschichte ein, die wohl dem Schwabenlande eine<br />
seiner edelsten Fürstinnen schenkte, aber wie es heute oft geht, einem anderen Frauenherzen<br />
bitterstes Herzeleid zufügte. Das wurde im Schwabenland erst heute richtig bekannt, wo<br />
seriöse Wochenschriften aus alten Chroniken Fürstenschicksale hervorholen.<br />
So schrieb -mir eine Verwandte: "'Weißt Du übrigens, daß, unser Stuttgarter Charlottenplatz<br />
nicht nach der Gattin unseres letzten Königs Wilhelm des Zweiten benannt ist, sondern nach<br />
der ersten, unglücklichen Gattin, einer Herzogin Charlotte <strong>von</strong> Bayern seines Großvaters<br />
Wilhelm Ersten?" Das war auch mir, zeitlebens begeisterter Stuttgarterin, nicht bekannt.<br />
Und diese Romanze fand ihren Anfang beim Wiener Kongress, wo der junge Kronprinz<br />
Wilhelm <strong>von</strong> Württemberg sich unsterblich in seine leibliche Base Katharina verliebte, und<br />
da seine Ehe mit Charlotte kinderlos war, sich kurzerhand <strong>von</strong> ihr trennte. Tief verletzt<br />
verließ die junge Fürstin das Schwabenland, und sicher hat sie diese Demütigung nie<br />
verschmerzt, auch wenn sie später die vierte Gemahlin des Kaisers <strong>von</strong> Österreich wurde.<br />
Katharina aber, die 1816, kurze Zeit nach ihrer Verheiratung mit ihrem Gatten den<br />
Königsthron Württembergs bestieg, musste bald ihrer Pflicht als Landesmutter in der<br />
schrecklichen Notzeit 1816/17 nachkommen. Und sie tat das in vollendeter Weise. Neben<br />
der Speisung der Hungernden gründete sie den sogenannten Wohltätigkeitsverein, der<br />
vorletztes Jahr, wenn auch unter anderem Namen, sein 150-jähriges Bestehen feierte. Auch<br />
die Sparkasse fand in ihr die Gründerin, ebenso die Katharinenschule und das<br />
Katharinenstift. Leider war dem königlichen Paar nur ein kurzes Glück beschieden. Schon<br />
1819 schloss Katharina die Augen zum letzten Schlummer, einen verzweifelten Gatten mit<br />
seinen Kindern Sophie und Marie zurücklassend. Wie sie sich so oft gewünscht, fand sie auf<br />
dem Rotenberg, wo das Stammschloss der Württemberger stand, die letzte Ruhestätte.<br />
König Wilhelm ließ die Burg abbrechen und den tempelartigen Bau errichten, der in seiner<br />
Gruft mehr als fünfzig Jahre später den Sarkophag Wilhelms des Ersten aufnahm und dann<br />
noch denjenigen seiner jüngsten Tochter, der Prinzeß Marie, Gräfin <strong>von</strong> Neipperg, der ja<br />
unsere Marienlinde gehört. Hier taucht noch einmal ein Name auf, der, eh wir die Zeit des<br />
Wiener Kongresses verlassen, dort eine Rolle spielte. Es war der Schwiegervater der Prinzeß<br />
Marie, Adam <strong>von</strong> Neipperg ein tapferer Krieger und damals kaiserlicher Stallmeister zum<br />
Dienst der Kaiserin Marie-Luise <strong>von</strong> Frankreich bestellt. Diese kümmerte sich wenig um die<br />
Verhandlungen der Hinterlassenschaften ihres kaiserlichen Gemahls, ebenso wenig wie um<br />
den unglücklichen Kaisersohn, Herzog <strong>von</strong> Reichstadt, der einem frühen Tod<br />
entgegenvegetierte. Sie durfte, als Napoleon auf St. Helena gestorben war, im Unterschied<br />
zu Prinzeß Margret <strong>von</strong> England, ihren Stallmeister heiraten. Als dem Paar ein Sohn geboren<br />
wurde, ernannte ihn sein kaiserlicher Großvater zum Fürsten Montenuovo, wodurch der<br />
uralte Name des Reichsgrafen mit der schwäbischen Standesherrschaft Schwaigern<br />
romanisiert wurde. Sein Sohn Fürst Alfred Montenuovo war der letzte Oberhofmeister<br />
Kaiser Franz Josephs <strong>von</strong> Österreich. Sic transit gloria mundi!<br />
Damit kommt man so langsam an die vormärzlicher Zeit der 30er Jahre, die vom<br />
Bürgerlichen her auch die Biedermeier-Zeit genannt wurde. Unser Schwabenland gedieh<br />
unter der segensreichen Regierung Wilhelms des Ersten in allen Sparten. Seine Einsamkeit<br />
hatte er längst aufgegeben. Wieder eine Kusine, Prinzeß Pauline <strong>von</strong> Württemberg, war<br />
seine Lebensgefährtin geworden, und zu den beiden Stiefgeschwistern hatten sich noch drei<br />
eigene Kinder gesellt, darunter der Kronprinz Karl. Wir haben vorletztes Jahr gehört, wie der<br />
holländische Kronprinz sich <strong>von</strong> dem so fröhlichen Württembergischen Königshof die<br />
Patentochter seiner Mutter, Prinzeß Sophie, zur Frau erkor.<br />
80
Das Schicksal hatte es aber mit den beiden Fürstinnen nicht gut gemeint. Die Söhne<br />
Wilhelm und Alexander starben schon vor ihrem Vater, unversöhnt, das mag auch der Grund<br />
sein. warum Königin Juliane niemals Kontakt mit Württemberg nimmt, obwohl ihre<br />
Urgroßmutter Henriette <strong>von</strong> Waldeck ebenfalls eine württembergische Fürstin war, sich also<br />
das Fürstenhaus weder seiner Abstammung noch das Schwabenvolk seiner Könige zu<br />
schämen brauchte. Wie draußen im Land, so hatte auch unser Dorf, damals ziemlich allen<br />
Verkehrs fern, die günstige Entwicklung Württembergs empfunden.<br />
Wenn man in seiner Chronik blättert oder den <strong>Erzählungen</strong> nachsinnt, die einem aus jener<br />
Periode geworden sind, so haben wohl Schlichtheit und Einfachheit das Leben bestimmt,<br />
aber profilierte Persönlichkeiten sind an seiner Spitze gestanden.<br />
Da waren es im geistlichen Amte die beiden Pfarrer Klinger, <strong>von</strong> denen der Vater mit dem<br />
akademischen Titel Magister, Christoph Heinrich (1772 - 1828), nach einer älteren<br />
Aufzeichnung auch der Schwiegersohn des Pfarrers Pommer Sohn (1723 - 1749) gewesen<br />
ist. Dessen Vater Johann Konrad, beides Magister (1690 1723) greift sogar ins 17.<br />
Jahrhundert zurück (1690 1723). Auch da ist die Kette nicht gerissen. Unter dem Sohn<br />
Klinger wurde dann die nette und jetzt bald ausgediente Schule erbaut. Da dieser <strong>von</strong> 1828 -<br />
1862 amtierte, also weit in das 19. Jahrhundert hinein, muß der Jahrestag der<br />
Grundsteinlegung der 17. Juli 1834, nicht der Tag des 50-jährigen Amtsjubiläums <strong>von</strong> Vater<br />
Klinger gewesen sein, sondern sein Todesjahr. Es ist schon eine schwierige Sache, mit den<br />
Daten vergangener Zeiten zu rechnen. Auch in der Presse kommt es oft zu Anachronismen.<br />
Jedenfalls kam es mit dieser "Vater-Klinger-Schule" zu einer Hochblüte. Gechingen hatte<br />
nicht nur vorzügliche Lehrer, sondern es stellte auch ein bedeutendes Kontingent an<br />
Lehrkräften. Für kluge Bauernsöhne war es, im Unterschied zu heute, fast der einzige Weg<br />
zum sozialen Aufstieg. Es führt schon über die vormärzliche Zeit hinaus, aber auch da lag<br />
viel lenzliches Erwarten. An Lehrern amtierte <strong>von</strong> 1789 - 1831., also noch im ganz alten<br />
Schulgebäude, Georg Andreas Hartmann, dessen Grabtafel mit der lapidaren Inschrift: "15<br />
Jahre Schullehrer dahier" am Friedhofbrunnen zu finden ist. Später kommt dann nach einem<br />
Georg Ludwig Schneider ein Karl Gotthilf Hartmann, vielleicht ein Sohn des erstgenannten?<br />
Hier ist aber in der Liste unserer Heimatchronik eine ziemliche Lücke, die <strong>von</strong> der<br />
vormärzlichen Zeit bis in die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts hereinreicht. Da stehen <strong>von</strong><br />
1789 - 1896 nicht weniger als, acht Lehrernamen, <strong>von</strong> denen mir einige aus der Erzählung<br />
meiner Angehörigen rühmlich bekannt sind, ja <strong>von</strong> denen einer, der nachmalige Studienrat<br />
am Lehrerinnenseminar Markgröningen, manchen <strong>von</strong> uns persönlich bekannt ist. Einer<br />
derselben, Gottlieb Christoph Kopp, ist um 1870 Lehrer hier gewesen. Meinen Urgroßonkel<br />
Prälat Brackenhammer hat er, laut dessen Brief <strong>von</strong> 1870, in Schorndorf besucht und ihm die<br />
Gechinger Ereignisse der Kriegszeit berichtete. Ob nicht aber der Lehrer Jässle schon vor<br />
ihm amtierte, ist anzunehmen. Er war hier sehr beliebt und starb ja auch an den Folgen einer<br />
Erkrankung, die er sich bei der Rettung einer Frau aus dem Hochwasser zuzog. Von den<br />
Schultheißen, die während der vormärzlichen Zeit amtierten, wäre zu nennen Christoph<br />
Friedrich Ziegler (1831 - 32), Hirschwirt und Schultheiß zu Gechingen. Er starb mit erst 30<br />
Jahren. Sein Sohn war der noch oft zu nennende Otto Friedrich Ziegler, der beim Tode<br />
seines Vaters nur wenige Jahre zählte und dann später seinem Stief- und Schwiegervater<br />
Georg Ludwig Schumacher folgend (1841 - 1868) <strong>von</strong> 1868 - 1895 sein heute noch<br />
unvergessenes Amt führte. Ein weiterer Schultheiß dieser für unser Württemberg so<br />
idyllischen Zeit war ein Georg Quinzler (1832-1841).<br />
Während der Amtszeit Schumachers scheint eine Unterbrechung <strong>von</strong> vier Jahren eingetreten<br />
zu sein, denn <strong>von</strong> 1844 - 48 wird ein Friedrich-Wilhelm Pregizer genannt, den ich seinem<br />
Namen nach, wenn ihn mein Großvater nannte, für einen sehr vornehmen Mann hielt. So<br />
muß es auch gewesen sein. Denn im "Schwarzwälder Boten" kam sein Bild <strong>von</strong> einem Maler<br />
81
Robert Hub, der, 1831 in Stuttgart geboren, viele "Porträter", wie unsere Alten sagten, malte.<br />
Dazu gehörte auch der Gechinger königliche Notar (und zeitweilige Schultheiß) Pregizer.<br />
Die Familie war früher weit verzweigt und ihr entstammen manche Theologen, Juristen und<br />
Verwaltungsbeamte. Die Skizze Pregizers stammt ans der Sammlung Doktor Keims,<br />
Reutlingen. Mit Wehmut gedachte ich da unseres Heimatforschers, meines Vetters Karl<br />
Essig. Wäre ihm nicht zu früh die Feder ans der Hand genommen worden, hätte er vielleicht<br />
noch allerhand aus dein Leben dieses Mannes und seines Wirkens im Dorf erfahren können.<br />
Warum aber gerade in dem so stürmischen Jahr 1848 Georg Ludwig Schumacher sein Amt<br />
wieder antrat, wäre wohl kaum mehr in Erfahrung zu bringen. Jedenfalls hat Gechingen<br />
damals eine kulturell nicht unbedeutende Zeit erlebt, die sich auch über die 48er Jahre<br />
erstreckte. Doch da<strong>von</strong> ein andermal.<br />
Ein Schicksalslied (1934) 1969<br />
Nun will ich meine letzten Blumen auf deinen schmalen Hügel legen, du kleine Rosemarie.<br />
Und wie ein Gruß aus weiter Ferne wird mir die Weise durch den Sinn gehen, die der<br />
kriegsgefallene Dichter Hermann Löns einst sang: Rosemarie, Rosemarie, sieben Jahre mein<br />
Herz nach dir schrie, Rosemarie, aber du hörtest es nie, Rosemarie! Vor acht Jahren ist es<br />
gewesen, zur Maienzeit, als du zum ersten Mal die klaren Augen öffnetest. Da klang und<br />
sang das Heimatdörflein wider <strong>von</strong> dieser schlichtinnigen Weise. Sängerfest sollte sein und<br />
ein gülden Kränzlein lockte, das wollten die Sänger erringen, unter denen auch dein Vater<br />
war, du kleine stille Schläferin. Sie haben ihn auch errungen, und dein Vater freute sich noch<br />
mehr über dich, auch wenn du kein Bube warst, wie er heimlich gehofft hatte nach dem<br />
ersten Mädel. Auch dieser Wunsch sollte ihm noch erfüllt werden; eben als du anfingst,<br />
nicht mehr in der dritten Person <strong>von</strong> dir zu sprechen und die "große" Schwester zur Schule<br />
kam, kam das Brüderlein. Wieder ging die Zeit, und wir haben noch viele Lieder gehört,<br />
aber du und das Löns-Lied, ihr gehörtet einfach zusammen, kleine Rosemarie.... Und dann<br />
kam ein Sommersonntag kurz vor der Erntezeit, da stand ein Sarg in eurem Hause -<br />
Rosemarie - und da lag dein Vater drin, dein fröhlicher, kluger Vater. Seine<br />
Kriegsverwundung hatte ihm den Tod gebracht und mit dem Siegesruf: Erlöser komm! war<br />
er hinüber gegangen in die Ewigkeit, und hatte euch allein gelassen. Rosemarie. Ich habe<br />
noch nie so viele Menschen so bitter weinen sehen wie an jenem Sonntag, als man ihn aus<br />
dem alten Nachbarhause zum Gottesacker trug. Du hattest große, erschrockene Augen,<br />
Rosemarie, aber weinen tatest du nicht. Du hattest ja noch die Mutter, die Geschwister und<br />
das ganze sonnige Kinderglück. Du lachtest bald wieder, fröhlich und unbeschwert, wie nur<br />
Kinder lachen. Einmal an einem stillen Nachmittag habe ich dich unbemerkt beobachtet, du<br />
tanztest in den Strümpfen vor unsrem Hause auf dem weichen Rasen. In den guten<br />
Sonntagsstrümpfen! Wart nur, du Unband, was wird die Mutter sagen. Ich wollte schon<br />
schelten. Aber da sah ich, mit welcher Verzückung du das kleine Gestältlein recktest und<br />
wie deine Kamerädlein mit offenem Mund dich anstaunten. Sie wären längst über ihre<br />
eigenen Füße gepurzelt, aber du strebtest wie ein erdgebundenes Seelchen zum Licht. Ach,<br />
aber dann, als schon die ersten Veilchen blühten, ein und ein halbes Jahr später, da trat der<br />
Würgeengel der Kinder, die Diphtherie, an dein Lager. Drei lange, bange Wochen,<br />
Rosemarie, und an einem Sonntagmorgen, als die Glocken zur Kirche läuteten, schliefst du<br />
hinüber, Rosemarie, mit sieben Jahren...<br />
Am ersten Maien, als das Dorf im Schmuck des Festtages der Arbeit prangte, trug man auch<br />
82
dich hinaus, du kleine Nachbarin. Als ich dich zum letzten Male sah, da lagst du über und<br />
über mit Blumen bedeckt im Sarge. Ein Zug <strong>von</strong> unendlicher Hoheit lag auf deinem<br />
schmalen Gesicht, Rosemarie. Du gingst wissend hinüber.<br />
Aber diesen Sommer ist nun kein Kind vor mein Gartentor gekommen und wollte Blumen<br />
haben, wie du einst. Und wenn das Abendrot hinter fernen Hügeln verglomm, hat mich auch<br />
keines gefragt, ob hinter der goldenen Mauer das Paradies und der liebe Gott seien? Aber du<br />
bist bei deinem Vater - und wirst es wissen.<br />
Nun lege ich die letzten Blumen auf deinen Hügel. Und wie aus weiter Ferne klingt das<br />
Lönslied mir durch den Sinn: Rosemarie, sieben Jahre mein Herz nach dir schrie, aber dir<br />
hörtest es nie, Rosemarie.<br />
Der Grabstein im Walde <strong>von</strong> Johannes Böttinger<br />
Gedanken dazu 1970<br />
Die junge Traudel Roller-Weiß sammelt mit einer, für die heutige Jungmädchenwelt seltener<br />
Intensität Zeugen <strong>von</strong> Gechingens Vergangenheit, stellte mir dieses Gedicht zur Verfügung,<br />
das zweifach interessant ist, einmal ist es ein Produkt des Jüngsten aus dem Triumvirat<br />
unserer Dorfpoeten, zum anderen enthält es einen Beweis des weiteren Schicksals der jungen<br />
Witwe Graskunz. Sie wurde die Frau <strong>von</strong> Hansjörg Böttinger, meinem Urgroßonkel, ihre<br />
einzige Tochter Katharina heiratete einen Weiß. Sie wurde die Mutter des "Vaters der<br />
Gemeinde" Ludwig Weiß, des Urgroßvaters der jungen Heimatfreundin.<br />
Auch ein Stück Kulturgut, ein letzter Gruß ausgestorbener Gechinger Familien.<br />
Heimatliches 1972<br />
Du Märchenland aus Kinderferientagen, leb wohl, du Zauberparadies.<br />
Ich muß dich tief im Herzen tragen, weil mich dein holdes Bild verließ.<br />
Du standest freundlich vor den Fenstern, mit deinen baumbestandnen Höhn.<br />
Man wußte nichts on Nachtgespenstern, selbst unterm Sternenhimmel warst du schön.<br />
Und dann, die reichen Sonnenweiten, bis zu dem Dorf der Erntefelder Glanz,<br />
die Buchenhalden, blaue Weiten mit ihrer Tannenwälder Kranz.<br />
dies alles war - der Silberwelle, des Ahnenquells im Wiesentale gleich,<br />
in seiner sommerlichen Helle ein schönes, blankes Ferienreich.<br />
Und gab es einmal ein Gewitter so ging es ohne Schaden aus.<br />
Am nächsten Tage zogen Schnitter zur Erntearbeit frisch hinaus.<br />
Ja, so war es einmal! Vor mehr als 60 Jahren, wenn man, mit den lieben Eltern, wie weiland<br />
"Graf Eberhard, der Greiner, der alte Rauschebart" (Ludwig Uhland) zu "Stuttgarts Toren"<br />
hinauszog, aber nicht um in Hirsau, bei dem Abte "einzukehren", oder gar gleich "ins<br />
Wildbad" zu reiten. O nein, so eine brave Dampflok, wie sie vor einigen Tagen mir auf dem<br />
Bahnhof <strong>von</strong> Calw auftauchte und einen ihrer Fan den Ausruf entlockte: "Da ist doch<br />
wenigstens noch Leben drin" trug einem zu der würzig blauen Station, die heute nicht mehr<br />
benutzt wird und dort nahm man den Weg unter die Füße und wanderte über die steile<br />
Steige, durch den hohen Tannenwald und das Wiesental dem Heimatdorfe der Mutter zu.<br />
83
Mit leichtem Gepäck, denn die großen Reisekörbe brachten dann einer der "Milchmänner",<br />
der immer freundliche und pünktliche Herr Dürr und der meist etwas säumige Herr Heim<br />
glücklich an Ort und Stelle. Und damit tauchen auch gleich die Gestalten auf, die damals<br />
zum Dorfleben gehörten. Denn wie ganz anders war der Rhythmus und vor allem die<br />
Lebenshaltung auf dem Dorfe als heute, wo auch in unserem, längst über den alten "Flecken"<br />
hinausgewachsenen Dorf, ein fast städtisches Leben und Treiben herrscht. Und wo selbst<br />
<strong>von</strong> bäuerlichen Betrieben aus, der alte Zauber der Leiterwagen, mit ihren vielfach gemütlich<br />
ziehenden Kühen längst verschwunden sind, und mit ihren Traktoren und hochbeladenen<br />
"Ladewagen" für alte Herzen einen ungewohnt schmerzlichen Anblick bieten. Damals sang<br />
man in der "Ärnbetstund" mit gutem Recht: "Die Ernt` ist da, es winkt der Halm dem<br />
Schnitter in das Feld."<br />
Damals - vor mehr als 60 Jahren. Und doch hat ein jäher Blitzstrahl mit verheerender<br />
Wirkung die Erkenntnis aufflammen lassen, auch unsere technisierte und hochqualifizierte<br />
Zeit untersteht noch dem urewigen Geschehnissen des Äthers.<br />
Wieviel Jammer hat der Blitzstrahl vom Freitag, den 21. Juli den Familien Bantel-Kielwein<br />
gebracht und wie hat er das ganze Dorf - auch die Neusiedlungen aufgeschreckt! Wie hat<br />
man plötzlich verstanden, wenn bei den frommen Alten das Wetterschutzgebet üblich war:<br />
"Vor Feuer- und vor Wassersnot behüt uns lieber Herregott!" Gewiss, es ist für die<br />
Geschädigten ein Trost, daß es dem Einsatz der tapfren Feuerwehren <strong>von</strong> hier und Calw<br />
gelang, das Feuer auf seinen Herd zu beschränken, daß es nicht in unseren guten, alten<br />
Mühlweg noch eine größere Lücke reißen konnte und auch die Heimstätten der<br />
Geschädigten und ihrer nahen Nachbarn vernichten konnte.<br />
Gerade um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert hat mein wackerer Ururahne, der<br />
Zimmermann Johann Jakob Schwarzmeier den Familien Wagner Schwarz dieses bäuerliche<br />
Anwesen erbaut, das behäbige Doppelwohnhaus und die bescheiden im Hintergrund<br />
stehende, nun so grausam vernichtete Scheuer, deren Balkenanordnung <strong>von</strong> mittelalterlicher<br />
Bauweise stammend, stets meine Bewunderung erweckte, auf die ich manchen<br />
Heimatfreund und auch die heutigen Besitzer aufmerksam machte!<br />
In wenigen Tagen, am 12. auf 13. August jährt sich zum 91. Mal, daß der "grause Brand" mit<br />
seiner gewaltigen Feuerwalze über das Dorf herbrauste und über 50 Gebäude vernichtete.<br />
Dieses Geschehen war in den Gesprächen der Verwandten und Bekannten oft zu hören. Und<br />
auch der Großvater, zu dessen Lebenswerk die bald 100 jährige Gechinger Feuerwehr<br />
gehörte, trug mit seinen Schilderungen eine ernste Note in das glückliche Ferienleben!<br />
Wusste doch die kleine Städterin <strong>von</strong> keinem Großbrand als demjenigen des königlichen<br />
Hoftheaters anno 1902, den sie aber nicht bewusst erlebte, sondern nur daran gemahnt<br />
wurde, wenn sie in der Weihnachtszeit mit der Mutter eine Aufführung im königlichen<br />
Interimstheater besuchen durfte und man da<strong>von</strong> sprach, daß mit königlicher Unterstützung<br />
am Anlagensee zwei neue, prächtige Theaterbauten erstehen würden, was auch der Fall war,<br />
wobei doch bei den zahlreichen Fliegerangriffen auf Stuttgart das "Kleine Haus" der<br />
Staatstheater vernichtet wurde, ebenso wie das stolze Königschloss und viele andere kaum<br />
ersetzliche Gebäude, die noch strahlend und schön das Leben der Stadt zwischen "Wald und<br />
Reben" umgeben, wenn man nach vier Ferienwochen wieder in die liebe Heimat<br />
zurückgekehrt war!<br />
Dies nebenbei, ehe wir in der Chronik des Dorfes weiter blättern, die auch in dem Buch<br />
"Heimat Gechingen" zum Teil aufgezeichnet ist. Hier befindet sich auch eine Aufnahme <strong>von</strong><br />
dem Ruinenfeld <strong>von</strong> 1881, die man bei Besuchen der Verwandten in der Hohen Gasse, der<br />
Familie Ludwig Weiß oft <strong>von</strong> der Wand nahm und studierte, welches Haus es wohl war, das<br />
noch stehen geblieben war? Und das ist, seltsamerweise, am Bildrand, der damals<br />
verschonte rechte Teil des Mühlwegs festgehalten, während im Gegenüber die letzten<br />
84
Brandstätten sichtbar sind, das Wohnhaus <strong>von</strong> Metzger Gehring dessen Wiederaufbau heute<br />
<strong>von</strong> der Familie des Kirchengemeinderates Richard Vetter bewohnt wird. Während die<br />
wiederaufgebaute sehr schöne Scheuer der Familie Riehm sich in Besitz <strong>von</strong> Frau Marie<br />
Breitling befindet. Sie erzählte mir, daß sich im Fundament ihrer Scheune, im Keller, noch<br />
Spuren des verheerenden Brandes befinden. Und nun hat das Gegenüber auch nach langer<br />
Zeit ein Ende in den Flammen gefunden!<br />
Die heutigen Besitzer Frau Witwe Kielwein und Geschwister Bantel haben ihren Besitz kurz<br />
vor dem ersten Weltkrieg erworben. Unten wohnte vorher der Bauer und Stundenhalter<br />
Daniel Wagner, und in der traulichen, niedrigen Stube haben viele ernsthafte Gespräche der<br />
Hahnischen Brüder stattgefunden, die ihren Ursprung in dem seltsamen Theosophen<br />
Michael Hahn hatten. Nach seinem Tode verkaufte der Sohn Karl dieses Anwesen an den<br />
Gärtnereibesitzer August Bantel, der dort mit seiner jungen Frau Berte geb. Maier seinen<br />
Hausstand gründete und wo eine fröhliche Kinderschar heranwuchs. Leider mußte die<br />
Familie zwei ihrer Söhne, Karl und Walter, im zweiten Weltkrieg opfern, auch Karl Wagner<br />
mußte seinen Sohn zum Opfer bringen. Wenn man die Stiege hinaufgeht kommt man in die<br />
Wohnräume der Familie Kielwein. Der Totengräber Kielwein erwarb das Anwesen <strong>von</strong> Karl<br />
Ginader, den man liebevoll "Markenkarle" nannte, weil er, einer der reichsten Bauern des<br />
Dorfes, sich nicht an die straff preußische Mark gewöhnen konnte, wo man vorher mit<br />
Gulden, Kreuzer und "Karlee" (Karolinen) rechnete. Ich selbst habe diese Bezeichnungen<br />
noch oft vom Großvater gehört. Karl Ginader war eine sehr profilierte Erscheinung, die mich<br />
oft an den Helden eines Bauerntheaters erinnerte. Und ein ländliches, heute kaum ver-<br />
ständliches Geschehen ließ den Besitzer, dessen beide Söhne Lehrer geworden waren, sein<br />
Anwesen verkaufen und an einem fremden Ort seinen, durch die damalige Inflation, das<br />
heißt Geldentwertung, einen trüben Lebensabend beschließen, wobei auch er im Krieg einen<br />
seiner Söhne opfern mußte. Es ist der 50.te der Gechinger Gefallenen <strong>von</strong> 1914-18, der aber<br />
nicht erwähnt wird.<br />
Der neue Besitzer hatte ebenfalls den Verlust seines jüngsten Sohnes Otto zu beklagen. Und<br />
im zweiten Weltkrieg fielen seinem Sohne Gottlob die beiden einzigen Söhne Hermann und<br />
Otto. Was würden auch diese, in der Blüte ihrer Jahre heimgeholten Männer sagen, wenn sie<br />
wüssten wieviel Leid und Verlust ein einziger Blitzschlag für ihre Lieben brachte...<br />
Aber auch schon in die heiteren Tage der Ferien fiel immer wieder eine Erzählung <strong>von</strong><br />
einem zündenden Blitzstrahl. Am 2. Juni 1903 brannte durch einen Blitzschlag die Scheuer<br />
der Familie Stiegelmaier im Gailer (heute Uhlandstraße) ab. Am 24. August 1904 brach über<br />
die Familie Gehring auf der Mauer (Stammhaus der Familie Wagner) dasselbe Unglück<br />
herein. Und in dem so musikfreudigem Haus, dem ich vor Jahren einen Zeitungsbericht<br />
"Von denen die waren und denen die sind" widmete, war immer wieder die Rede <strong>von</strong> dem<br />
Wiederaufbau der Scheuer, die bedeutend teurer wurde, als die Versicherung ausbezahlte.<br />
Aber auch für dieses stattliche Anwesen brachte der erste Weltkrieg zwei große Opfer. der<br />
Sohn Karl wurde schon im Herbst 1914 bei Lodz, bei einem nächtlichen Überfall durch<br />
Russen getötet. Sein Schwager, Oberlehrer Gottfried Quinzler fiel kurze Zeit danach in den<br />
Vogesen. Sein noch erhaltenes Grab wurde schon <strong>von</strong> den Kindern besucht. Seine Witwe,<br />
Frau Marie Quinzler geb. Gehring ist nach 56 jähriger Witwenschaft, und schweren Leiden,<br />
heimgegangen.<br />
Von diesem Stammhaus der Familie Wagner heiratete der einzige Sohn Michael das<br />
Nachbarkind Annemarie Kappis und wurde damit zum Besitzer des, ebenfalls <strong>von</strong> dem<br />
Zimmermann Schwarzmaier erbauten, malerischen "Samels Haus", heute im Besitz <strong>von</strong><br />
Kirchenpfleger Ludwig Wagner. Aber auch dieses vor der Jahrhundertwende erbaute Haus<br />
hatte ein Kriegsopfer zu bringen. Denn die Brüder der Annemarie Kappis mussten <strong>von</strong> ihr<br />
und den Eltern Abschied nehmen um 1813 gegen Russland zu ziehen, <strong>von</strong> dem sie nicht<br />
85
wieder heimkehrten. Über dem schönen alten Haus, das für viele Gechinger Ansichtskarten<br />
ein gutes Objekt ist, schwebte mitunter das Damoklesschwert der Zerstörung. Auf besorgte<br />
Fragen, ob es dem immer stärker werdenden Durchgangsverkehr weichen müsse, bekommt<br />
man immer die tröstliche Antwort, wenn ja, dann würde das bestimmt noch lange Zeit<br />
anstehen.<br />
"Aus Dörfleins Freud und Leid". Selige Ferienerinnerungen aus einer Kindheit in unser noch<br />
heilen Welt und doch auch Erinnerung an harte Schicksalsschläge und Verluste durch<br />
Feuersnot. Wer kann sagen, was die Zukunft bringt? In der hektischen Betriebsamkeit<br />
unserer Tage sind die Stunden der Besinnlichkeit selten. Und nach dem letzten Schicksal<br />
wird doch mancher überdenken, daß dem Walten des Himmels die moderne Welt genau so<br />
ausgeliefert ist, wie in alter Zeit. Da ist dann auch der Ausruf verständlich, den die Frauen<br />
vergangener Zeit bei einem besonders grellen Blitz mit frommen Händefalten sagten: "Helf<br />
uns Gott!"<br />
86
PS Liebe Fräulein (auf dem Rathaus)<br />
Hier habt Ihr einen Fortsetzungsbericht, den Euer derzeitiger Chef vieleicht in die nächsten<br />
Nummern aufnehmen lässt! Zum Beispiel "Das Waldelflein", "Das gibt es noch?", oder "Es<br />
ist schon so, die Menschen haben keine Zeit". Das wäre doch zeitgemäß und wurde bereits<br />
in meiner SH Zeitschrift für Volkswirtschaft und Kultur veröffentlicht. Auch Weil der Stadt<br />
nahm einiges da<strong>von</strong>. Und wenn mein Herr Recht, der aber schon vor 16 Jahren starb, noch<br />
an der Setzmaschine stände, würde er den Blödsinn, der <strong>von</strong> anderer Seite eingesandt wird,<br />
bestimmt nicht aufnehmen.<br />
Ich schreibe ja diese Sache noch aus dem Krankenzimmer, denn meine Verletzung ist so<br />
schlecht behandelt worden, daß die Schmerzen eher schlimmer als besser werden. Deshalb<br />
habe ich auch meine, nun 50 Jahre umfassende Arbeit zusammen genommen und bitte Euch<br />
nochmals, wenn Ihr sie noch habt und wollt sie beim Umzug verbrennen, dann schickt sie<br />
mir lieber, auch die Zeitungsberichte! Ich bin Euch dankbar!<br />
Freundliche Grüße!<br />
87