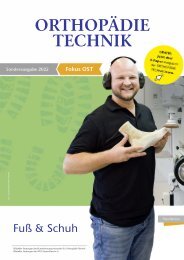05 / 2024
Die Fachzeitschrift ORTHOPÄDIE TECHNIK ist die maßgebliche Publikation für das OT-Handwerk und ein wichtiger Kompass für die gesamte Hilfsmittelbranche.
Die Fachzeitschrift ORTHOPÄDIE TECHNIK ist die maßgebliche Publikation für das OT-Handwerk und ein wichtiger Kompass für die gesamte Hilfsmittelbranche.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prothetik<br />
a. b.<br />
Abb. 1a u. b Beispiel für eine Myotestung für eine 2-EMG-Elektrodensteuerung (a) und<br />
eine Steuerung von komplexeren Steuerungssystemen mittels Elektrodenmanschette (b).<br />
– Behandlung von Phantomschmerzen<br />
– Behandlung des Stumpfes<br />
– Einhändertraining<br />
– Training der Aktivitäten des täglichen<br />
Lebens (AdLs) – ohne Prothese<br />
– Myotestung/Myotraining<br />
Um festzustellen, welche Prothesenart<br />
individuell anwendbar ist und<br />
welches Steuerungssystem eine betroffene<br />
Person umsetzen kann, wird<br />
bereits sehr früh eine Myotestung<br />
durchgeführt (Abb. 1). Unter Myotestung<br />
versteht man die graphische<br />
Abbildung der vorhandenen Muskelpotenziale,<br />
die zur Steuerung einer<br />
Prothese verwendet werden könnten.<br />
Mit dieser softwareunterstützten<br />
Darstellung kann den Patienten<br />
die Muskelkontraktion visualisiert<br />
werden. Mit der visuellen Rückmeldung<br />
ist es den Klienten möglich,<br />
Muskeln selektiv anzusteuern und<br />
so zu trainieren, dass diese dauerhaft<br />
reproduziert werden können. Dies<br />
kann zum einen mit 2 EMG-Elektroden<br />
zur Muskelsignalsuche durchgeführt<br />
werden. Sind die Muskelsignale<br />
so schwach, dass eine 2-Elektrodensteuerung<br />
nicht möglich ist, kann<br />
zum anderen mithilfe von „Elektrodenmanschetten“<br />
eine Evaluation<br />
für komplexere Steuerungssysteme<br />
durchgeführt werden.<br />
Die Myotestung wird in enger Zusammenarbeit<br />
von Ergotherapie und<br />
Orthopädietechnik durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse aus Myotestung, den<br />
Fähigkeiten des Patienten und dem<br />
Anforderungsprofil (ICF-basiert: Körperfunktion,<br />
Teilhabe, Umweltfaktoren<br />
sowie personenbezogene Faktoren)<br />
(siehe Kasten und Abb. 2) zur gewünschten<br />
Prothesennutzung, stellen<br />
die Grundlage (Weichenstellung)<br />
für eine prothetische Versorgung dar.<br />
Sobald feststeht, welche Prothesenausführung<br />
mit welchem Steuerungssystem<br />
ausgeführt werden kann, wird<br />
mit dem Myotraining begonnen. Dabei<br />
sollen die in der Testung gefundenen<br />
Signale verinnerlicht und weiter<br />
verbessert werden. Bei manchen<br />
Systemen ist es notwendig, zwischen<br />
mehreren Komponenten (Hand öffnen/schließen,<br />
Hand drehen, Ellenbogen)<br />
umzuschalten. Hierzu müssen<br />
verschiedene Varianten einstudiert<br />
werden. Möglichkeiten hierbei sind<br />
z. B. 2 oder 3 schnelle Muskelkontraktionen,<br />
ein langer Muskelimpuls oder<br />
eine Kokontraktion (die möglichst<br />
gleichzeitige Anspannung eines Muskels<br />
[Agonist] mit seinem Gegenspieler<br />
[Antagonist], z. B. M. biceps- und<br />
M. triceps brachii).<br />
Die Elektroden können in ihrer<br />
Empfindlichkeit, bzw. Sensitivität<br />
verändert werden. Je besser und zuverlässiger<br />
das Muskelsignal reproduzierbar<br />
ist, umso geringer kann später<br />
die Sensitivität der Elektroden eingestellt<br />
werden. Wenn die Elektrode<br />
sehr empfindlich eingestellt ist, reicht<br />
bereits ein sehr geringer Muskelimpuls<br />
zur Ansteuerung der Prothese.<br />
Dies kann jedoch auch zu ungewollten<br />
Bewegungen führen. Dadurch<br />
sollen ungewollte Bewegungen der<br />
Prothese minimiert werden.<br />
Prothesengebrauchsschulung<br />
Hier wird zuerst mit dem Erlernen der<br />
Grundfunktionen begonnen. Die Betroffenen<br />
sollen den Umgang mit der<br />
Prothese erlernen. Zu Beginn werden<br />
sämtliche Bedienfunktionen erklärt.<br />
Dazu zählen neben allen technischen<br />
Gegebenheiten, wie z. B. das<br />
Ein- und Ausschalten der Prothese,<br />
das Akku-Management oder die Maximallasten<br />
der Komponenten, auch<br />
hygienische Vorgaben bzw. Reinigungshinweise.<br />
Anschließend wird<br />
das selbstständige An- und Ausziehen<br />
der Prothese erlernt. Vor allem<br />
ICF: Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit<br />
Die ICF (International Classification of Functioning,<br />
Disability and Health der WHO) klassifiziert im Unterschied<br />
zur ICD (International Statistical Classification<br />
of Diseases and Related Health Problems) die Auswirkungen<br />
einer Verletzung oder Erkrankung in Bezug auf<br />
die Körperfunktionen, die Aktivitäten und die Teilhabe<br />
einer Person.<br />
Sowohl der Begriff der Funktionsfähigkeit als auch der<br />
der Behinderung beschreiben die Folgen, die sich für einen<br />
Menschen mit einem Gesundheitsproblem in Bezug<br />
zu seinen Umwelt- und seinen personenbezogenen Faktoren<br />
(Kontextfaktoren) ergeben. Die Grundlage für diese<br />
Sichtweise stellt das biopsychosoziale Modell dar [10].<br />
In Anlehnung an diese Systematik gehen wir davon<br />
aus, dass Klienten mit einer Armprothese in ihrer Teilhabefähigkeit<br />
profitieren, je besser sie die Funktionen<br />
einer Prothese in einzelnen Aktivitäten einsetzen können.<br />
Aus diesem Gedanken heraus ergibt sich für uns die<br />
Aufteilung der Prothesengebrauchsschulung in Funktions-,<br />
Aktivitäts- und Teilhabetraining.<br />
76<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24