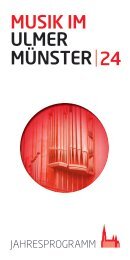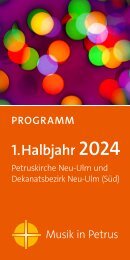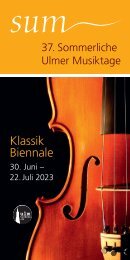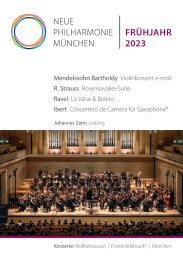Sinfonietta Isartal März 2024
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MUSIKWERKSTATT<br />
JUGEND<br />
Dienstag<br />
26. <strong>März</strong> <strong>2024</strong><br />
19:30 Uhr<br />
Wolfratshausen<br />
Loisachhalle<br />
künstlerische Leitung<br />
Sophia Herbig<br />
BELICZAY<br />
Serenade für Streicher op. 36<br />
MENDELSSOHN<br />
BARTHOLDY<br />
Streichersymphonie Nr. 10<br />
NIELSEN<br />
Kleine Suite für Streicher op. 1<br />
GRIEG<br />
Nordische Weisen<br />
in Zusammenarbeit<br />
mit Video- und Lichtkünstler<br />
Stefan Bitterhoff<br />
© Stefan Bitterhoff © Andrej Grilc
GRUSSWORT<br />
Susanne Lange - In memoriam<br />
Susanne Lange, die 1963 in der Lüneburger Heide zur Welt kam, war ihr Leben lang eine große<br />
Liebhaberin der Musik. Als Geisteswissenschaftlerin ausgebildet arbeitete sie für einige Jahre in<br />
Buchverlagen, bevor sie sich beruflich umorientierte und als Heilpraktikerin und Homöopathin tätig<br />
war. Vor allem die klassische Musik, der ihre Leidenschaft galt, war für sie eine Quelle der Freude und<br />
auch der Freundschaft. In dieser Kunstform, die Emotionen, aber keine Bedeutungen außerhalb<br />
ihrer selbst transportiert, fand sie eine intensiv erlebte Gegenwelt zu unserem Alltag – und immer<br />
wieder erfüllte Gegenwart. Auch nachdem sie schwer erkrankte, war es Susanne wichtig, so lange<br />
es nur irgend ging, Konzerte und Opernaufführungen zu besuchen. Die musikalische Entwicklung<br />
unserer Kinder hat sie intensiv begleitet. Und die musikalische Förderung junger Menschen lag ihr sehr<br />
am Herzen. Die Konzerte der <strong>Sinfonietta</strong> machte sie immer wieder zu Ereignissen, bei denen sich die<br />
ganze Familie, Verwandte und Freunde trafen.<br />
Susanne ist am 10. November 2023 gestorben. Zu ihren letzten Wünschen zählte, dass anlässlich ihrer<br />
Beerdigung Spenden zugunsten der Musikwerkstatt Jugend und der <strong>Sinfonietta</strong> <strong>Isartal</strong> gesammelt<br />
werden. Dass ihr das heutige Konzert zum Dank gewidmet ist, hätte sie als Ehre empfunden und es<br />
hätte sie aufrichtig gefreut.<br />
Thomas Rathnow<br />
2
PROGRAMM<br />
Dientag, 26. <strong>März</strong> <strong>2024</strong>, 19:30 Uhr<br />
Wolfratshausen | Loisachhalle<br />
Gyula Beliczay (1835-1893)<br />
Serenade für Streicher op. 36<br />
I. Moderato ma non troppo<br />
II. Allegretto vivace<br />
III. Adagio cantabile<br />
VI. Allegro con fuoco - Allegretto vivace<br />
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)<br />
Streichersymphonie Nr. 10<br />
I. Adagio - Allegro - Più Presto<br />
Carl Nielsen (1865-1931)<br />
Kleine Suite für Streicher op. 1<br />
I. Prelude - Andante con moto<br />
II. Intermezzo - Allegro moderato<br />
III. Finale - Andante con moto - Allegro con brio<br />
Edvard Grieg (1843-1907)<br />
Nordische Weisen<br />
I. Im Volkston<br />
II. Kuhreigen und Bauerntanz<br />
3
ICKINGER FRÜHLING <strong>2024</strong><br />
9. Internationales Kammermusik-Festival<br />
© Astrid di Crollalanza<br />
© Vojtěch Havlík<br />
© Maximilian Mann<br />
© Gregor Hohenberg<br />
Sa. 20. April | 16.00 Uhr<br />
Klaviertrio Incendio<br />
A. Panufnik, Klaviertrio op. 1 (1934,<br />
revidiert 1945 und 1985)<br />
B. Martinů, Klaviertrio Nr. 3 C-Dur H. 332<br />
A. Dvořák, Klaviertrio Nr. 2 g-Moll op. 26<br />
Sa. 20. April | 19.30 Uhr<br />
Aris Quartett<br />
F. Mendelssohn, Streichquartett Nr.1 Es-Dur op. 12<br />
G. Ligeti, „Metamorphoses Nocturnes“<br />
L. v. Beethoven, Streichquartett a-Moll op. 132<br />
So. 21. April | 11.00 Uhr<br />
Klaviertrio Sōra<br />
J. Haydn, Klaviertrio Nr. 39 G-Dur „Zigeunertrio“<br />
M. Kagel, Klaviertrio Nr. 2 in einem Satz (2001)<br />
J. Brahms, Trio Es-Dur op. 40 für Klavier, Violine und<br />
Waldhorn in Besetzung eines Klaviertrios<br />
So. 21. April | 16.00 Uhr<br />
Goldmund Quartett<br />
J. Haydn, Streichquartett Nr. 61 d-Moll op.76/2<br />
D. Schostakowitsch, Streichqu. Nr. 7 fis-Moll op. 108<br />
A. Webern, Langsamer Satz Es-Dur (1905)<br />
A. Borodin, Streichquartett Nr. 2 D-Dur (1881)<br />
Rainer-Maria-Rilke-Konzertsaal,<br />
Gymnasium Ulrichstr. 1-7, 82057 Icking<br />
Online-Shop | ticket@klangwelt-klassik.de | Tel. 08178-7171<br />
www.klangwelt-klassik.de<br />
4
DER VEREIN MUSIKWERKSTATT JUGEND STELLT SICH VOR<br />
MUSIKWERKSTAT T<br />
JUGEND<br />
Der Verein und seine Ziele<br />
Die Musikwerkstatt Jugend e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der nicht auf die Erzielung von Gewinn<br />
ausgerichtet ist, sondern sich zum Ziel gesetzt hat, junge musikalische Talente umfassend zu fördern,<br />
im Wissen, dass Musik die ganzheitliche Entwicklung des Menschen besonders unterstützt. Die Musikwerkstatt<br />
Jugend bietet ein breit angelegtes Förderkonzept für alle jungen Musizierenden, d.h. eine<br />
differenzierte Orchesterarbeit im Kinderorchester <strong>Isartal</strong>, im Jugendorchester <strong>Sinfonietta</strong> <strong>Isartal</strong> und in<br />
der Neuen Philharmonie München.<br />
Grundgedanke ist die breit angelegte Begleitung vom Kindesalter an, die sich mit den entwickelnden<br />
Fähigkeiten der jungen Musizierenden ausweitet bis zur Förderung spezieller Begabungen. Neben der<br />
professionell betreuten Orchesterarbeit werden auch individuelle Maßnahmen bis hin zu Meisterkursen<br />
angeboten. Renommierte Musizierenden und Ensembles ermöglichen gezielt die Hinführung<br />
zur Kammermusik.<br />
In der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen wird Musik in ihrer intellektuellen, emotionalen und<br />
spirituellen Dimension erschlossen und durch eine sensibel geführte Gratwanderung zwischen<br />
hohem Anspruch an Qualität und Spaß am Musizieren zum spannenden Erlebnis.<br />
Der Förderverein der Musikwerkstatt Jugend e.V.<br />
Kontakt:<br />
Spatzenloh 10<br />
82057 Icking<br />
Tel.: 08178 – 90 018<br />
Fax: 08178 – 90 89 188<br />
E-Mail:<br />
barbarahubbert@t-online.de<br />
deutsch@musikwerkstattjugend.de<br />
Register:<br />
Amtsgericht München-Registergericht<br />
Registernummer: VR 100864<br />
Geschäftsführender Vorstand:<br />
Franz Deutsch, 1. Vorsitzender<br />
Angela Zahn, Organisation/Sponsoren<br />
Sabine Weinert-Spieß, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Daniel Nodel, BR, Dozent<br />
Simon Edelmann, Orchestervertretung<br />
Steffen Kühnel<br />
Beirat:<br />
Prof. Alfredo Perl, Musikhochschule Detmold<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Sadlo (†), HS für Musik<br />
München & Uni Mozarteum Salzburg<br />
Johannes Zahn, Dirigent<br />
Prof. Albrecht Holder, Musikhochschule Würzburg<br />
5
DAS ORCHESTER<br />
Sophia Herbig<br />
Violine I (KM)<br />
Ema Almeida<br />
Violine I<br />
Amelie Altena<br />
Violine I<br />
Jakob Fuksik<br />
Violine I<br />
Franziska Gutdeutsch<br />
Violine I<br />
Sophia Gutdeutsch<br />
Violine I<br />
Amrei von Kracht<br />
Violine I<br />
Andrea Santiago<br />
Carrillo<br />
Violine II (SF)<br />
Liora Dinkelbach<br />
Violine II<br />
Lena Maria Farkas<br />
Violine II<br />
Isabella Jellema<br />
Violine II<br />
Valeriia Kustitska<br />
Violine II<br />
Theresa Müller<br />
Violine II<br />
Gina Principi<br />
Violine II<br />
Antonia Rudnik<br />
Violine II<br />
6
DAS ORCHESTER<br />
Patrizia Messana<br />
Viola (SF)<br />
Moritz Defregger<br />
Viola<br />
Pauline<br />
Schulte-Beckhausen<br />
Viola<br />
Xinyuan Wang<br />
Viola<br />
Katja Deutsch<br />
Violoncello (SF)<br />
Samuel Dinkelbach<br />
Violoncello<br />
Julia Häring<br />
Violoncello<br />
Alina Holender<br />
Violoncello<br />
Linda Promintzer<br />
Violoncello<br />
Klara Streck<br />
Kontrabass<br />
© Stefan Bitterhoff<br />
7
DIE DOZIERENDEN<br />
Sophia Herbig Künstlerische Leitung | Dozentin Violine 1<br />
© Andrej Grilc<br />
Die Geigerin Sophia Herbig widmet sich gleichermaßen der Kammer- sowie<br />
Orchestermusik. So führte sie ihre Orchestertätigkeit zu führenden europäischen<br />
Klangkörpern wie u.a. dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,<br />
dem Mahler Chamber Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra und<br />
Utopia.<br />
Seit der Saison 2019/20 ist Sophia als Stimmführerin der 2. Violinen im<br />
Mozarteum-orchester Salzburg engagiert und wurde als Gast in ebendieser<br />
Position zu Orchestern wie u.a. dem Symphoniorchester des Bayerischen Rundfunks,<br />
hr-Sinfonieorchester, dem Stuttgarter Kammerorchester, Münchener<br />
Kammerorchester eingeladen.<br />
Highlights der letzen Jahre waren mehrere solistische Auftritte mit dem<br />
Mozarteumorchester Salzburg, so Vivaldis Frühling unter der Leitung von<br />
Reinhard Goebel, als auch Mozarts Serenata notturna an der Seite von Lorenza<br />
Borrani, Roberto Gonzales-Monjas und unter der Leitung von Manfred Honeck.<br />
Zudem spielte sie Mozarts Violinkonzert KV 219 mit dem Kammerorchester der<br />
Akademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter der<br />
Leitung von Stefan Schili sowie Violinkonzerte von Brahms, Mendelssohn-<br />
Bartholdy und Kachaturian mit Dirigenten wie Yoel Gamzou, Ulrich Weder,<br />
Simon Edelmann und Johannes Zahn.<br />
Als vielseitige Kammermusikerin trat sie mit Musikern wie Lorenza Borrani, Alina<br />
Pogostkina, Patricia Kopatchinskaja, Dmitry Smirnov und Rainer Schmidt auf.<br />
Zudem verbindet sie eine regelmäßige Zusammenarbeit mit Patrick Leung und<br />
dem Ensemble Tamangur. Auftritte beim Beethovenfest Bonn, Casals Festival,<br />
den Ludwigsburger Schlossfestspielen und dem Trasimeno Music Festival und in<br />
Sälen wie dem Herkulessaal München, dem Kammermusiksaal der Philharmonie<br />
Berlin, Philharmonie München. Aussendung von Aufnahmen sowie Konzertmitschnitten<br />
durch den ORF, BR, WDR sowie Catalunya Musica.<br />
Prägende Lehrer waren Rainer Schmidt sowie Wonji Kim-Ozim und Igor Ozim.<br />
Die jährliche Zusammenarbeit mit der <strong>Sinfonietta</strong> <strong>Isartal</strong> bietet die wunderschöne<br />
Möglichkeit, eigene Erfahrungen weitergeben zu können, aber auch in<br />
Frage zu stellen, neue Konzertformate zu etablieren und die Jugendlichen in<br />
einen kreativen Gestaltungsprozess mit einzubeziehen.<br />
8
DIE DOZIERENDEN<br />
Andrea Santiago Carrillo Dozentin Violine 2<br />
Geboren im Jahr 1998, absolvierte Andrea ihre Bachelor bei Professorin Vera<br />
Martínez Mehner an der ESMUC dank des Anna Riera Exzellenzstipendiums.<br />
Sie schließt ihren Master in Interpretation bei Professorin Meesun Hong Coleman<br />
an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz ab, wo sie auch den Wettbewerb<br />
gewinnt und eine Giovanni Battista Guadagnini von 1750 zur Verfügung gestellt<br />
bekommt. Sie erhielt Unterricht von Agustín Leonara, Sergey Teslya, Barnabás<br />
Kelemen, Natalia Prishepenko, Latica Honda Rosenberg und Lily Francis.<br />
Als Solistin erhielt sie eine lobende Erwähnung beim Peregrinos Musicales<br />
Wettbewerb 2021. Sie tritt bei Festivals wie Músics en Residència d'Alella,<br />
DeltaChamber Music Festival und Festival de Musique de Wissembourg auf. Seit<br />
2023 ist sie Künstlerische Leiterin des Festival de Cambra Pòdium Matadepera.<br />
Sie spielt regelmäßig in Kammerorchestern wie dem Orquestra de Cambra<br />
del Penedés, der Haydn Philharmonie, der Spira Mirabilis, Da Camera, beim<br />
Münchener Kammerorchester und sie hat gewonnen ein 6. monate Zeitvertrag<br />
mit dem Mozarteumorchester Salzburg. Sie wurde auch ausgewählt, um an<br />
einem Bildungsprojekt der Berliner Philharmoniker mit Mitgliedern des Orchesters<br />
und dem Dirigenten Sir Simon Rattle am 21. Mai 2018 teilzunehmen.<br />
Als Gründungsmitglied des Quartet Atenea erhielt sie Unterricht von Musikern<br />
wie Heime Müller, Donald Weilerstein, Cuarteto Casals, Heinz Holliger,<br />
William Coleman und dem Kronos Quartet. Außerdem hatte das Atenea Quartet<br />
verschiedene Auftritte in Europa, darunter Konzerte in der Konzertsaal<br />
des Radios von Genéve, l’Auditori in Barcelona, Auditorium Lo Squero in Venezia<br />
und beim Festival Internacional de Musique de Wissembourg.<br />
© Privat<br />
9
DIE DOZIERENDEN<br />
Patrizia Messana Dozentin Viola<br />
© Jan Walford<br />
Die deutsch-italienische Bratschistin Patrizia Messana begann im Alter von<br />
fünf Jahren zunächst mit dem Violinspiel. Schon früh gewann sie zahlreiche<br />
erste Preise beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“ und dem Carl-Schröder<br />
Wettbewerb in Erfurt. Nach Violinstudien bei Bartlomiej Niziol und Dora<br />
Bratchkova, absolvierte sie im Anschluss ihre Violastudien in der Klasse von<br />
Jone Kaliunaite an der Hochschule für Musik in Saarbrücken. Aktuell studiert<br />
sie im Master Konzertfach am Mozarteum in Salzburg in der Klasse von<br />
William Coleman.<br />
Angeregt durch Begegnungen mit international anerkannten Künstlern wie<br />
Nobuko Imai, Hariolf Schlichtig, Thomas Riebl, Tatjana Masurenko, Lars Anders<br />
Tomter, Jean Sulem, Ferenc Rados, Günter Pichler, Barbara Westphal, Tabea<br />
Zimmermann, Veit Hertenstein, Oliver Wille, Carol Rodland, Wolfgang Rihm,<br />
Roland Glassl, dem Tana Quartet, dem Jerusalem String Quartet u.a., konnte<br />
sie ihr künstlerisches Potenzial maßgeblich erweitern und vertiefen.<br />
Als Solistin verschiedener Orchester und als Kammermusikpartnerin<br />
konzertierte sie in zahlreichen Ländern Europas, in Südamerika, China und der<br />
Schweiz, und wurde entscheidend durch die Teilnahme an Kammermusikprojekten<br />
geprägt, bei denen sie mit Künstlern wie Patricia Kopatchinskaja,<br />
Joonas Ahonen, Nicolas Altstaedt, Reto Bieri, Andreas Ottensamer, William<br />
Coleman, Rainer Schmidt, Meesun Hong-Coleman, Erika Geldsetzer,<br />
Julia Gallégo, Hans-Peter Hofmann, Lena Neudauer u.a. zu hören war.<br />
Patrizia Messana war zu Gast auf zahlreichen Festivals wie den Salzburger<br />
Festspielen, dem Kammermusikfest Lockenhaus, dem Kissinger Sommer,<br />
dem Musikfestival Bern, dem Herbstgold Festival, der Mozartwoche Salzburg,<br />
dem George Enescu Festival und den Händelfestspielen. Als regelmäßige<br />
Aushilfe spielt sie im Mozarteumorchester Salzburg, der Geneva Camerata<br />
und dem Mahler Chamber Orchestra.<br />
Sie war Solobratschistin der Mannheimer Philharmoniker und ist seither<br />
regelmäßig als Stimmführerin bei der Haydn-Philharmonie, den Salzburg<br />
Chamber Soloists sowie der Camerata Bern zu Gast.<br />
Die Gesamteinspielung der Streichquartette des romantischen Komponisten<br />
Felix Draeseke entstand in Zusammenarbeit mit dem Constanze Quartet bei<br />
dem deutschen Plattenlabel CPO.<br />
10
DIE DOZIERENDEN | VIDEO- UND LICHTKUNST<br />
Katja Deutsch Dozentin Violoncello<br />
Die Cellistin Katja Deutsch, geb. 2001, studiert seit Oktober 2019 bei<br />
Prof. Sebastian Klinger und Alexey Stadler an der Hochschule für Musik und<br />
Theater Hamburg.<br />
Bereits im Alter von vier Jahren erhielt sie ihren ersten Cellounterricht,<br />
zunächst bei Michael Weiß, später wechselte Katja zu Hanno Simons,<br />
stellv. Solocellist des Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.<br />
Ab 2008 nahm sie regelmäßig am Wettbewerb „Jugend musiziert“<br />
teil und erhielt zahlreiche erste Preise auf allen Wettbewerbsstufen<br />
in den Kategorien Cello Solo, Kammermusik und Klavierduo. Im April<br />
2017 gewann sie zusätzlich den Sparkassensonderpreis. In frühen Jahren<br />
sammelte sie zudem Orchestererfahrungen. So musizierte sie bereits 2013 bei<br />
den Kinderkonzerten der Münchner Philharmoniker unter Heinrich Klug mit,<br />
war langjähriges Mitglied im bayerischen Landesjugendorchester und nimmt<br />
seit 2016 regelmäßig an Projekten der Neuen Philharmonie München teil.<br />
© Andrej Grilc<br />
Im Jahr 2017 spielte Katja Deutsch mit der Neuen Philharmonie in der<br />
Konzertreihe „Junge Stars in Fürstenfeldbruck“ und konzertierte in Baku<br />
an der Musikhochschule. Ebenfalls als Solistin konzertierte Katja Deutsch<br />
mit der <strong>Sinfonietta</strong> <strong>Isartal</strong>, dem Orchesterverein München, der Hamburger<br />
Orchestergemeinschaft, dem Wratislavia Chamber Orchestra und den Bad<br />
Reichenhaller Philharmonikern unter Dirigenten wie Fuad Ibrahimov und<br />
Christian Simonis. Zu einem ihrer jüngsten Erfolge zählt der 1. Preis des<br />
Elise-Meyer-Wettberwerbs in Hamburg im Mai 2022.<br />
Weitere Inspirationen gaben ihr Meisterkurse u.a. bei Prof. Peter Bruns, Prof.<br />
Troels Svane, Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt und Prof. Jens Peter Maintz.<br />
Stefan Bitterhoff Video- und Lichtkunst<br />
Stefan Bitterhoff beschäftigt sich seit Anfang der 90er Jahre mit Bewegtbildern<br />
und Licht. Neben der kulturtheoretischen Auseinandersetzung und diversen<br />
Kunstprojekten arbeitete er als Fernsehjournalist und Dokumentarfilmer, als<br />
Musikvideo- und Werbecutter und als Regisseur und Producer für Industriefilme.<br />
Das charakteristische seiner Kunst ist das Zusammenspiel von Bild und Raum,<br />
die Verbindung visueller Komplexität mit der Bedeutungsebene. Es geht Bitterhoff<br />
um die Übersetzung von Filmbildern in Farbe und Bewegung, verbunden<br />
mit Klängen und Musik.<br />
© Privat<br />
11
GEIGEN- UND BOGENBAU<br />
Hermann + Stefan Wörz<br />
Geigenbaumeister<br />
Kreittmayrstr. 11<br />
80335 München<br />
Tel. 525988<br />
Fax. 5236886<br />
Neubau und Reparaturen<br />
von Streichinstrumenten und Bogen<br />
Vermietung von Streichinstrumenten<br />
Markus Wörz<br />
Bogenbaumeister<br />
Kreittmayrstr. 17<br />
80335 München<br />
Tel. 5231240<br />
Fax. 5231179<br />
Geschäftszeiten:<br />
Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr<br />
Samstag von 9.30 bis 13.00 Uhr – Montag geschlossen<br />
Bahnhofstrasse 5, 82069 Hohenschäftlarn<br />
+49 (0) 81 78. 99 85 55<br />
Täglich geöffnet 11.30 - 23.00 Uhr<br />
www.il-brigante.de<br />
12
WERKEINFÜHRUNG<br />
Gyula Beliczay<br />
Serenade für Streicher d-moll, op. 36<br />
Gyula – auch Julius von Beliczay genannt – wurde am 10. August 1835 in<br />
Komárom an der Donau in Ungarn geboren als Sohn eines Holzhändlers geboren.<br />
Der deutsche Ortsname lautete in der Donaumonarchie Komorn. Die Stadt wurde<br />
1920 geteilt und das Stadtzentrum mit seinem größeren und bedeutenderen<br />
Teil gehört heute unter dem Namen Komárno zum Staatsgebiet der Slowakei.<br />
Während Gyulas Zeit auf dem evangelischen Lyzeum in Pressburg (heute<br />
Bratislava) erteilte der dortige Kapellmeister des Kirchenmusikvereins Joseph<br />
Kumlik (1801 – 1865) dem vielseitig begabten Schüler Klavier und Musiktheorie.<br />
Sechzehnjährig schrieb er sich 1851 an der Technischen Hochschule in Wien<br />
in Wien ein, wo er Mathematik und der Ingenieurswissenschaften studierte.<br />
Zeitgleich nahm zunächst Unterricht in Komposition bei Joachim Hoffmann<br />
(1784 – 1856) und später noch bei Franz Krenn (1816 – 1897) und dem<br />
Beethovenforscher Gustav Nottebohm (1817 – 1882). Der Klavierpädagoge<br />
Anton Halm (1789 – 1872) erteilte ihm Klavier-Unterricht. 1858 trat er als Ingenieur<br />
in den Dienst der Staatseisenbahn. Dieser Beruf ließ ihm offenbar genügend Zeit,<br />
sich seinen musikalischen Neigungen zu widmen. Am 21. Februar 1864 stellte er<br />
sich wagemutig in einem Konzert einer größeren Öffentlichkeit vor, wie wir einem<br />
Konzert-Bericht von dem berühmten und gefürchteten Musikkritiker Eduard<br />
Hanslick (1825 – 1904) in der Wiener Presse vom 24. Februar entnehmen können:<br />
Protrait von Beliczay, 1835<br />
„Die Erfolge der Pianisten T a u s i g und B e n d e l scheinen einem jungen Ungarn,<br />
Herrn J u l i u s v. B e l i c z a y , den Schlaf geraubt zu haben; derselbe gab<br />
Sonntag ein Concert im Musikvereins-Saale, offenbar ohne eine Ahnung, welche<br />
Ansprüche das Wiener Publicum an einen Clavier-Virtuosen stellen darf und muß.<br />
Herrn B.’s Spiel ist in technischer Hinsicht sehr verwahrlost (er spielte selbst die<br />
kleinsten Stücke aus Noten und dennoch falsch), in Bezug auf geistige Beseelung,<br />
ja gewöhnlichste musikalische Empfindung läßt es noch weit mehr zu wünschen<br />
übrig. Mit vieler Gelassenheit und einiger Bewunderung hörten wir, wie Herr v. B.<br />
das Kunststück fertig brachte, Tondichtungen wie B e e t h o v e n ’ s Es-dur-Phantasie,<br />
S c h u m a n n ’ s ‚Aufschwung’, C h o p i n ’ s Es-dur-Nocturne jede Spur von Geist<br />
auszublasen. Einige kleine Clavier-Compositionen des Concertgebers, und L i s z t ’ s<br />
zweite ‚Ungarische Rhapsodie’ haben wir nicht mehr gehört. Hatten wir doch in<br />
dem ganzen Unternehmen eine Art ‚Rhapsodie hongroise’.“<br />
Wenig später zeigte der Wiener Musikverlag C. A. Spina in der II. Beilage des<br />
Fremden-Blattes vom 16. April 1864 das Erscheinen von je zwei Klavierstücken<br />
Duetto und capriccio op. 1 und Novelette und Romanze op. 2 von Julius von<br />
Beliczay an. Selbstbewusst komponierte er als sein Opus 4 eine Solo-Kadenz<br />
als Einlage für das 3. Klavierkonzert in c-moll op. 37 von Ludwig van Beethoven<br />
(1770 – 1827), die 1867 bei Haslinger in Wien gedruckt wurde und Franz Liszt (1811<br />
– 1886) dediziert ist. Dieser bedankte sich brieflich mit den folgenden Worten:<br />
13
WERKEINFÜHRUNG<br />
„Geehrter Herr, Aufrichtigen Dank für Ihr sehr freundliches Schreiben und die<br />
Widmung der Beethoven-Cadenz. Dieselbe klingt gut und spielt sich angenehm.<br />
Allerdings könnte man dabei etwas mehr in’s Zeug gehen und gleich von vornherein<br />
andre Tonarten als C moll ergreifen. Doch geziemt es mir weit besser, Kritik<br />
zu erleiden als selbst auszuüben — und für heute will ich Ihnen blos danken<br />
und Sie meiner Theilnahme an Ihren Bestrebungen und Erfolgen versichern.<br />
Freundlichst ergeben 29. April 67. Rom. F. Liszt.“<br />
Beliczays Grabstein auf<br />
dem Kerepesi-Freiedhof<br />
Im Jahre 1871 wurde er in die Direktion der ungarischen Staatseisenbahn<br />
nach Pest in Ungarn versetzt. Auf seinen Dienstreisen bereiste er halb Europa<br />
und studierte neben dem Eisenbahnwesen das musikalische Geschehen in den<br />
Metropolen. Er knüpfte überall Kontakte und fortan erschienen seine Kompositionen<br />
nicht nur in Wien, sondern in Berlin, Budapest, Leipzig, Mainz und Paris,<br />
wo 1875 seine Sérénade im Verlag Durdilly neben weiteren Werken erschien.<br />
1886 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, konnte er sich fortan ausschließlich<br />
der Musik widmen. Sein Biograph, der Komponist August Naubert (1839 – 1897),<br />
schildert im Leipziger Musikalischen Wochenblatt vom 7. Mai 1891 den weiteren<br />
Werdegang seines Kollegen Beliczay:<br />
„Von da an war er nur Musiker, gelangte im Jahre 1888 zu einer Professur an<br />
der ungarischen Landesmusikakademie [in Budapest] und macht dort seine<br />
contrapunctischen Kenntnisse, die er im Unterrichte bei Nottebohm in Wien<br />
sich erworben hat, seinen jungen Landsleuten nutzbar.“<br />
Die viersätzige Serenade für Streichorchester op. 36 bringt laut Naubert aufgrund<br />
ihrer fließend und leicht[en] Erfindung einen höchst freundlichen Eindruck<br />
hervor. Der Musikkritiker Uwe Krusch rezensiert das Werk aufgrund einer CD-<br />
Einspielung eines Eisenbahner-Orchesters in Budapest und analysiert es wie folgt:<br />
„Die Serenade ist nicht nur wegen der reinen Streicherbesetzung leichter [als],<br />
sondern hat auch einen ihrem Werktypus entsprechend charmanteren Charakter.<br />
Das erste Thema schafft in allen Sätzen die zyklische Form. Das zweite Thema<br />
im ersten Satz sowie das im Trio des zweiten haben ungarischen Charakter und<br />
schaffen so ein volkstümliches Kolorit. Trotz der vielen kompositorischen Anhaltspunkte,<br />
die ihn begleiteten, hat Belisczay eine eigene Tonsprache gefunden, mit<br />
der er die Verbindung von Mossonyi und Volkmann zu Dohnanyi ist.“<br />
Gyula von Beliczay starb am 30. April 1893 in Budapest in seinem 58. Lebensjahr<br />
und wurde auf dem dortigen Kerepesi-Friedhof bestattet. Sein Grabmal hat sich<br />
erhalten und nennt auch seine Ehefrau Gyuláné Beliczay (1853 – 1933) geborene<br />
Anna Tarizalonitz, die ihn vierzig Jahre überlebte.<br />
Der ungarische Musikhistoriker Ferenc Bónis (1932 – 2019) charakterisiert seinen<br />
Landsmann in der Enzyklopädie Die Musik in Geschichte und Gegenwart wie<br />
folgt:<br />
14
WERKEINFÜHRUNG<br />
„Niemand war unter den ungarischen Kleinmeistern der 2. Hälfte des 19. Jh.<br />
berühmter und bekannter in den internationalen Musikzentren der Zeit als<br />
Beliczay. Dieser hochgebildete Komponist ohne besondere Originalität hatte<br />
seinen Ruhm der Vermittler-Funktion seiner Musik zu verdanken. Seine unter<br />
dem Einfluß Schuberts komponierten geistlichen Werke sowie die von Schumann<br />
beeinflußte Klavier- und Kammermusik verbreiteten den Geist der deutschen<br />
Romantik in Frankreich und Ungarn, während die im ungarischen Stil<br />
Fr[anz] Liszts und M[ihály] Mosonyis entstandenen Klavierwerke von Beliczay<br />
zur Popularität dieser osteuropäischen Kunst in Westeuropa wesentlich beitrug.“<br />
Felix Mendelssohn-Bartholdy<br />
Streichersymphonie Nr. 10<br />
Felix Mendelssohn Bartholdy, wurde am 3. Februar 1809 als Sohn des Bankiers<br />
Abraham Mendelssohn (1776 – 1835), Sohn des Philosophen Moses Mendelssohn,<br />
und Lea Mendelssohn (1777 – 1842), Tochter aus vermögender Berliner<br />
Kaufmannsfamilie, in Hamburg geboren. 1811 floh die Familie mit der vier Jahre<br />
älteren Schwester Fanny, Felix und Rebekka (1811 - 1858) vor der napoleonischen<br />
Besatzung nach Berlin. Mit fünf Jahren erhielt Felix den ersten Klavierunterricht<br />
durch seine Mutter. Von 1816 an übernahm der Pianist, Komponist und<br />
Clementi-Schüler Ludwig Berger (1777 – 1839) die pianistische Ausbildung der<br />
musikalisch hochbegabten Mendelssohn-Kinder Fanny und Felix, und drei Jahre<br />
später wurden sie Kompositionsschüler von Carl Friedrich Zelter (1758 – 1832),<br />
der beide Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) vorstellte. Felix erhielt<br />
Unterricht auf der Violine von Carl Wilhelm Henning (1784 – 1867) und auf der<br />
Viola von Eduard Rietz (1767 – 1828). Einem erhaltenen Übungsheft von Felix<br />
zufolge begann der Unterricht bei Zelter mit einfachen Generalbassübungen,<br />
die am 6. Oktober 1819 ihren erfolgreichen Abschluss fanden. Anschließend<br />
wurden Choräle harmonisiert und vom Frühjahr 1820 an Übungen im einfachen<br />
Kontrapunkt aufgegeben bis hin zur Erfindung zweistimmiger Kanons. Zweiund<br />
dreistimmige Fugen gefolgt von freien Kompositionsversuchen schlossen<br />
den Elementarunterricht bei Zelter ab. In einer Besprechung der Uraufführung<br />
der komischen Oper Die Hochzeit des Camacho am 29. April 1827 des gerade<br />
Achtzehnjährigen wird dessen Werdegang kurz gestreift:<br />
Portrait von Mendelssohn-<br />
Bartholdy, 1846<br />
"Obgleich sich Hr. F. Mendelssohn schon als elfjähriger Knabe durch höchst<br />
fertiges, besonders feuriges und energisches Klavierspiel und fertiges Partituren-<br />
Lesen ausgezeichnet, früher meistens mit Schularbeiten bey seinem würdigen<br />
Lehrer Hrn. Professor Zelter, im doppelten Contrapunkte geübt, und zu dem<br />
Ende Symphonien im Bach’schen Styl für blosse Saiten-Instrumente geschrieben<br />
hatte, welche früher im Hause seiner fein gebildeten Eltern aufgeführt wurden,<br />
so ging der Feuergeist des Knaben doch bald zu Compositionen für sein Instrument,<br />
Sonaten, Concerten, Trio’s und Quartetten über, und versuchte sich endlich<br />
15
WERKEINFÜHRUNG<br />
auch in Operetten, die viel Leichtigkeit der Erfindung und natürliche Melodie<br />
zeigten.“ (Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig, Volume 29 (1827), Sp. 411)<br />
Mendelssohn-Bartholdy<br />
mit 12 Jahren<br />
Die hier erwähnten außerordentlichen Begabungen sowohl von Felix als auch<br />
von Fanny (1805 – 1847) hatten sich früh gezeigt. 1823 spielten die Geschwister<br />
die Ouvertüre zur Oper Alimelek von Giacomo Meyerbeer (1791 – 1864) in<br />
einem öffentlichen Konzert vierhändig aus der Partitur. Eine Fähigkeit, welche<br />
die Mutter mit berechtigtem Stolz als besondere Gabe betonte „dergleichen<br />
vierhändig einzurichten ohne es erst aufzuschreiben.“<br />
Die häuslichen Sonntagsmusiken wurden laut den von Sebastian Hensel (1830 –<br />
1898) gesammelten Familiendokumenten im Jahre 1822 begonnen. Sebastian<br />
Hensel entstammt der 1829 geschlossenen Ehe von Fanny Mendelssohn Bartholdy<br />
und ihrem Ehemann Wilhelm Hensel (1794 – 1861). In diesen Sonntagsmusiken,<br />
zu denen der vermögende Familienvater ein kleines Orchester bestehend aus<br />
den Mitgliedern der Hofkapelle verpflichtete, wurden die Sinfonias genannten<br />
Sätze für Streicher aufgeführt. Auch auswärtige Musiker wurden zur Mitwirkung<br />
eingeladen, wie eine Einladung von Lea Mendelssohn Bartholdy vom<br />
14. November 1824 belegt:<br />
„Ich ersuche Sie freundlich, uns Sonntag zu einem ganz einfachen Mittagsmahl,<br />
dem auch Herr Moscheles beiwohnen wird, Ihre Gegenwart zu schenken,<br />
werter Herr Speyer. Bei diesem Anlaß erlaube ich mir einen kleinen Vorwurf<br />
über ihre neidische Bescheidenheit, die uns den Genuß, Sie zu hören, entziehen<br />
möchte. Herr Arnold sagt mir eben, daß Sie ein ganz vortrefflicher Geiger sind;<br />
wir besitzen ein schönes Instrument, das Rode zugehörte. Fühlen Sie sich<br />
dadurch und durch unsern lebhaften Wunsch nicht angelockt, meine Kinder zu<br />
begleiten? Bestimmen Sie gefälligst einen ihnen genehmen Abend hierzu und<br />
rechnen Sie auf die herzlichste Dankbarkeit Ihrer ergebenen Dienerin.“<br />
Der in Offenbach am Main ansässige Liederkomponist Wilhelm Speyer (1790<br />
– 1878) leistete der Einladung Folge und traf dort auch mit Karl Arnold (1791 –<br />
1875) zusammen, einem Pianisten und Kapellmeister. Über den Abend berichtet<br />
Speyer am 19. November 1824 in einem Brief an den befreundeten Louis Spohr<br />
(1784 – 1859) aus Berlin:<br />
„In diesem hörte ich eine Sinfonie von dem kleinen Felix Mendelssohn, die mich<br />
zur Bewunderung hinriß. Dieser Junge ist eine Erscheinung, wie sie die Natur<br />
nur selten hervorbringt. Diese seine dreizehnte Sinfonie ist so vortrefflich, daß<br />
sie den ersten Meistern zugeschrieben werden dürfte. Phantasie, Originalität,<br />
Symmetrie der Formen, ausgezeichnete Melodien, gepaart mit der strengsten<br />
Schreibart, dem reinsten Satz und kontrapunktischer Kunst. So hörte ich bei ihm<br />
zu Hause ein Doppelkonzert für zwei Klaviere, Quartette, Sonaten, usw. usw.,<br />
lauter Meisterstücke. Und wie herrlich, wie ausdrucksvoll spielt dieser Junge!“<br />
16
WERKEINFÜHRUNG<br />
Die von Speyer so begeistert beschriebene Sinfonia XIII in C wurde am 31. <strong>März</strong><br />
1824 beendet und erschien 1834 als Sinfonie Nr. 1 in c-moll op. 11 im Druck.<br />
Die Sinfonias I bis XII blieben zu Lebzeiten von Felix Mendelssohn Bartholdy<br />
Manuskripte und wurden nicht wieder aufgeführt. Er selbst hat sie in seinem<br />
eigenhändigen Verzeichnis als Knabenarbeiten erwähnt. Dem Titel Sinfonias<br />
nach als größer besetzte symphonische Orchesterwerke gedacht, ließen<br />
die häuslichen Verhältnisse nur eine Aufführung in kammermusikalischer<br />
Besetzung zu. Charakteristisch ist die Instrumentation mit zwei Violinen, zwei<br />
Bratschen und Violoncello und Kontrabass im Unisono. Die Aufführungspraxis<br />
ist überliefert. Übereinstimmend berichten die Komponisten und Musikkritiker<br />
Heinrich Dorn (1804 – 1892) und Adolf Bernhard Marx (1785 -1866)<br />
in ihren Lebenserinnerungen, dass die Sinfonias für Streichinstrumente mit<br />
Klavierbegleitung als Bläserersatz musiziert wurden. Auch die 1826 komponierte<br />
Sommernachtstraum-Ouvertüre wurde zunächst in einer vierhändigen Klavierfassung<br />
im häuslichen Bereich aufgeführt, wie der Pianist, Komponist und<br />
Dirigent Ignaz Moscheles (1794 – 1870) berichtete. Als Teil der Schauspielmusik<br />
zum Orchesterwerk instrumentiert, erfolgte die Uraufführung am 20. Februar<br />
1827 in Stettin. In der Aufführung wirkte der Komponist selbst an der Viola mit<br />
und trat mit diesem Werk als gestandener Komponist an die Öffentlichkeit.<br />
Der Vater Abraham Mendelssohn hatte seinen Kindern eine umfassende Bildung<br />
angedeihen lassen, die sich nicht nur auf den Musikunterricht beschränkte. Als<br />
Hauslehrer wurde der spätere Universitätsprofessor Carl Wilhelm Ludwig Heyse<br />
verpflichtet, Vater des Münchner Dichters und Nobelpreisträgers Paul Heyse<br />
( 1830 – 1914). Ein Jugendfreund, der spätere Pfarrer Julius Schubring (1806 –<br />
1889) schrieb 1866 in seinen Erinnerungen:<br />
Aquarell von James<br />
Warren Childe, 1830<br />
„Der Felix war doch ein wunderbar begabter Mensch. Abgesehen von der<br />
Musik, als dem Mittelpunkte seines Lebens, zeigte sich diese Begabung nach<br />
den verschiedensten Richtungen hin, ohne daß er damit eitlen Prunk getrieben<br />
hätte. Er turnte z.B. kräftig und geschickt. Reck und Barren standen unter den<br />
Bäumen des Gartens, und es verschlug ihm wenig, kurz vor den Concerteaufführungen,<br />
welche Sonntags in der Mittagszeit alle vierzehn Tage im Hause<br />
stattfanden, auch wenn er darin Clavier zu spielen hatte, erst eine halbe Stunde<br />
zu turnen.“<br />
Schubring berichtete weiter, dass Felix ausgezeichnet Schach spielte, ein<br />
guter Zeichner war, eine altrömische Komödie des Terenz druckreif aus dem<br />
Lateinischen übersetzte, ausgezeichnet Klavier und Bratsche spielte und die<br />
Partituren der Hauskonzert-Musiken auswendig dirigierte. Die Komposition der<br />
Sinfonia X wurde von Felix laut seinem Eintrag in der Handschrift am 13. <strong>März</strong><br />
1823 begonnen und am 18. Mai beendet.<br />
17
WERKEINFÜHRUNG<br />
Carl Nielsen<br />
Kleine Suite für Streicher op. 1<br />
Carl Nielsen im Jahr 1908<br />
Carl August Nielsen gilt heute als der bedeutendste Komponist Dänemarks.<br />
Er wurde am 8. Juni 1863 in Sortelung bei Nørre Lyndelse auf der Ostseeinsel Fyn<br />
(Fünen) als siebtes von zwölf Kindern in eher ärmlichen Verhältnissen geboren.<br />
Sein Vater Niels Jørgensen (1835 – 1916) war Anstreicher und Tagelöhner und<br />
verdiente als Geiger und Kornettist in einem Trio auf Bauernfesten ein Zubrot.<br />
Während seiner Schulzeit hatte er Geigenunterricht und trat mit seinem Vater<br />
als Tanzmusiker auf. In einem um 1874 gegründeten Musikverein Landbomusikforeningen<br />
Braga lernte er als Mitwirkender u.a. Werke von Joseph Haydn (1732<br />
– 1809) und Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) kennen. Sein Einstieg<br />
in den Musikerberuf begann 1879 mit dem Eintritt als Trompeter-Eleve in das<br />
Regimentsmusikkorps in Odense, in dem er bis 1883 diente. Nebenher setzte<br />
er seinen Violinunterricht bei dem dort tätigen Kantor Carl Larsen fort, der<br />
ihn mit der Musik von Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) vertraut machte.<br />
Als Mitglied eines Streichquartetts komponierte der gerade Zwanzigjährige sein<br />
1. Streichquartett in d-moll. Einflussreiche Wohltäter in Odense schickten ihn<br />
nach Kopenhagen auf das Konservatorium, wo er nach bestandener Aufnahmeprüfung<br />
1884 als Stipendiat mit dem Hauptfach Violine aufgenommen wurde.<br />
Während seines zweijährigen Studiums wurde er von Valdemar Tofte (1832 –<br />
1907), einem ehemaligen Schüler von Joseph Joachim (1831 – 1907), auf der Violine<br />
unterrichtet. Sein Klavierlehrer war Gottfred Matthison-Hansen (1832 – 1909),<br />
der neben seiner Lehrtätigkeit das Amt eines Organisten an der deutschen<br />
Kirche in Kopenhagen ausübte. Wichtige Impulse für sein kompositorisches<br />
Schaffen erhielt Carl Nielsen von Johann Peter Emilius Hartmann (1805 – 1900)<br />
und besonders von Orla Rosenhoff (1844 – 1905), dem er bis zu dessen Lebensende<br />
freundschaftlich verbunden blieb. Nach Abschluss seines Studiums war<br />
Nielsen vertretungsweise als Geiger u.a. im Konzertsaal-Orchester des Kopenhagener<br />
Vergnügungspark Tivoli aber auch freischaffend als Musiklehrer<br />
tätig. Als Komponist stellte er sich einer größeren Öffentlichkeit mit der Suite<br />
für Streichorchester op. 1 vor. Das 1843 gegründete Tivoli-Orchester führte<br />
unter der Leitung ihres Dirigenten Balduin Dahl (1834 – 1891) die Suite am<br />
8. September 1888 während der Großen Nordischen Industrieausstellung<br />
erstmals auf. Unter den Mitwirkenden befand sich auch der Komponist selbst.<br />
Die Uraufführung war ein großer Erfolg. Der mittlere Satz musste wiederholt<br />
werden und der Komponist mehreren Hervorrufungen Folge leisten.<br />
Auch die zweite Aufführung in Odense auf Fünen am 16. Oktober 1888 unter<br />
der Leitung des Komponisten selbst wurde enthusiastisch bejubelt, zumal sich<br />
der Komponist auch als Geiger mit Souvenir d’Haydn des belgischen Hubert<br />
Léonard (1819 – 1890) vorstellte. Das Stück ist besser bekannt unter dem Titel<br />
Fantasie sur l’air Gott erhalte Franz den Kaiser. Die 1797 von Joseph Haydn komponierte<br />
Melodie für die alte Kaiserhymne Österreichs hatte August Heinrich<br />
18
WERKEINFÜHRUNG<br />
Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874) im Sinn, als er 1841 Das Lied der<br />
Deutschen dichtete. In einer zeitgenössischen Kritik lesen wir:<br />
„[Carl Nielsens] Suite für Streichorchester, von ihm selbst dirigiert, ist ein sehr<br />
attraktives musikalisches Werk und fand die bestmögliche Aufnahme bei den<br />
Zuhörern. In seiner Wiedergabe von Leonards Souvenir d’Haydn lernten wir<br />
ihn als hochmögenden Violinisten kennen, der bereits über einen hohen Grat<br />
an technischer Fertigkeit verfügt. Nach der Aufführung dieses Musikstückes<br />
brach ein veritabler Beifallsturm von Seiten der Zuhörerschaft los.“ (Fyens<br />
Stiftstidende, 17.10.1888. Übersetzung Gunther Joppig)<br />
Nielsen mit 14 Jahren<br />
Carl Nielsen hatte die drei Sätze seiner Suite mit den fantasievollen Namen<br />
Die Danaiden, Tanz der Chariten und Die Bacchus Prozession überschrieben.<br />
In der Druckfassung wurden dann seitens des Verlages die Bezeichnungen<br />
zunächst die französischen Bezeichnungen Prélude, Intermède und Finale eingeführt,<br />
aber letztendlich in I. Präludium, II. Intermezzo und III. Finale abgeändert.<br />
Nielsen widmete sein Opus 1 dem verehrten Lehrer Orla Rosenhoff.<br />
Der amerikanische Bibliothekar der Western Washington University Libraris,<br />
selbst Geiger, Bratscher, Pianist und Arrangeur, charakterisiert 2011 die Suite in<br />
seinem Vorwort zum verdienstvollen Reprint in der Musikproduktion Höflich in<br />
München:<br />
„Als das Werk eines 23 Jahre alten Komponistenneulings zeigt die Komposition<br />
einen frühreifen Fluss aller Standardtechniken, die zur damaligen Zeiz beim<br />
Schreiben für streicher gebräuchlich waren, darunter Pizzicato, Tremolo, reichlichen,<br />
aber besonnenen gebrauch von divisi und klugen Kontrapunkt. (...)<br />
Das Juwel der Suite ist das Intermezzo, in allem ein Walzer ausser in seiner<br />
Bezeichnung. Man fragt sich, ob die Walzer aus den Streicherserenaden von<br />
Antonín Dvořák (1841 – 1904) und Peter Tschaikowsky (1840 – 1893), komponiert<br />
1875 und1880, Inspirationsquellen für den beeindruckbaren Nielsen waren. Lässt<br />
man diese Mutmassungen beiseite, beschwört die Tonsprache dieses Satzes<br />
ohne Zweifel das Wiener Genre. Einen besonders koketten Geschmack liefert<br />
der Einsatz der Dämpfer während des gesamten Satzes und verleiht ihm einen<br />
Hauch transparenten Charmes. Es verwundert nicht, dass dieses Intermezzo<br />
als Zugabe bei den ersten zwei Aufführungen wiederholt wurde.<br />
Als einen Teil seiner Revision fügte Nielsen dem Finale die langsame Einleitung<br />
hinzu. Indem er das Thema aus dem ersten Satz zitiert, schafft er eine zyklische<br />
Rückbesinnung, die dem Werk eine noch grössere Stringenz verleiht. Später<br />
im allegro con brio dient die Aufnahme des Themas als Wegweiser in diesem<br />
grundlegenden Durchführungsabschnitt, der sich ansonsten durch eine weitschweifige,<br />
mäandernde harmonische Sprache auszeichnet. Insgesamt erinnert<br />
die Ausgelassenheit dieses Finale, und auch in mancher Hinsicht die des ganzen<br />
Stückes, an die heiteren Symphonien des jungen Felix Mendelssohn (1809<br />
– 1847).“<br />
19
WERKEINFÜHRUNG<br />
Im Spätsommer 1889 bestand Carl Nielsen das Probespiel für die zweite Geige in<br />
der Kopenhagener Hofkapelle und empfing im Jahr darauf das Stipendium Det<br />
Anckerske Legat, welches ihm vom September 1890 bis Juni 1891 eine Reise durch<br />
Deutschland, Frankreich und Italien ermöglichte. In Paris lernte er am 2. <strong>März</strong><br />
1891 die dänische Bildhauerin Anne Marie Brodersen (1863 – 1945) kennen, die<br />
er auf dieser Reise am 18. April heiratete. Fortan setzte sie ihre Künstlerkarriere<br />
unter dem Namen Anne Marie Carl Nielsen fort. Als Tochter eines Landwirtes<br />
zunächst auf Tierplastiken spezialisiert schuf sie auch Portraitbüsten, darunter<br />
1928 eine solche ihres Mannes, für die ihr nach dem Tod von Carl Nielsen am 3.<br />
Oktober 1831 die Thorvaldsen-Medaille im Jahre 1932 verliehen wurde.<br />
Edvard Grieg<br />
Nordische Weisen<br />
Fotografie von Grieg<br />
um 1900<br />
Edvard Grieg wurde am 15. Juni 1843 in Bergen an der norwegischen Westküste<br />
als Sohn von Alexander Grieg (1806 – 1875) und Gesine Judithe Grieg (1814 –<br />
1875) geb. Hagerup geboren. Der Urgroßvater Alexander Greig (1739 – 1803) war<br />
um 1770 aus Schottland nach Norwegen ausgewandert, hatte hier geheiratet<br />
und wurde 1797 zum britischen Vizekonsul in Bergen ernannt. Dessen Sohn<br />
John Grieg (1772 – 1844), der Großvater von Edvard, war mit Maren Regine Grieg<br />
(1776 – 1835), geb. Haslund verheiratet, der Tochter eines aus Dänemark zugewanderten<br />
Geigers, die das musikalische Element in die Familie einbrachte,<br />
verstärkt durch Edvard Griegs Mutter, die aus einer vermögenden Familie<br />
stammend eine erstklassige Ausbildung erhielt. Die Eltern förderten die<br />
musikalischen Anlagen: Sie erhielt als junges Mädchen Unterricht in Gesang,<br />
Klavier und Musiktheorie bei Albert Gottlieb Methfessel (1785 – 1869) in Hamburg<br />
und war später die angesehenste Klavierlehrerin in Bergen. Mit sechs Jahren<br />
erhielt Edvard von der Mutter den ersten Klavierunterricht und später auf<br />
der Tanks scole – einer Art Realschule – Musikunterricht von dem aus Prag<br />
stammenden Ferdinand Giovanni Schediwy (1804 – 1877) mit dem Grieg bis zu<br />
dessen Lebensende freundschaftlich verbunden blieb. Mit 15 Jahren spielte<br />
Edvard dem berühmten norwegischen Violinvirtuosen Ole Bull (1810 – 1880)<br />
auf dem Klavier eigene Kompositionen vor. In seinen Lebenserinnerungen<br />
beschrieb Grieg das Ergebnis dieses Zusammentreffens mit den folgenden<br />
Worten Ole Bulls: „Du must nach Leipzig gehen und ein Musiker werden.“<br />
Edvard Grieg nahm am 6. Oktober 1858 sein Musikstudium am Leipziger Konservatorium<br />
auf. Nur schwer konnte sich der Jüngling an die dort herrschende<br />
strenge Disziplin gewöhnen. Bei dem von ihm geschätzten ersten Klavierlehrer<br />
Ernst Ferdinand Wenzel (1806 – 1880) erhielt er einen systematischen Unterricht<br />
in Klaviertechnik und war dann Schüler von Ignaz Moscheles (1794 – 1870). Seine<br />
Lehrer in Harmonielehre und Komposition waren zunächst der Thomaskantor<br />
Moritz Hauptmann (1792 – 1868), dessen späterer Nachfolger als Thomaskantor<br />
Friedrich Richter (1808 – 1879) und Robert Papperitz (1826 – 1903). Carl Reinecke<br />
(1824 – 1910) war der Kompositionslehrer in seinem letzten Studienjahr 1861/62.<br />
20
WERKEINFÜHRUNG<br />
Im Abschlusszeugnis vom 23. April 1862 des gerade 18-jährigen ist der folgende<br />
Eintrag von Reinecke zu lesen:<br />
„Daß Herr Edvard Grieg ein höchst bedeutendes musikalisches Talent, namentlich<br />
für die Composition besitzt, und daß es sehr wünschenswert wäre, wenn<br />
demselben Gelegenheit geboten würde, dasselbe nach allen Seiten hin auf’s<br />
vollständigste auszubilden, bezeuge ich demselben mit Freuden.“<br />
Im Mai 1863 ging Edvard nach Kopenhagen, da er im Elternhaus in Bergen keine<br />
Entwicklungsmöglichkeit sah und der Vater ihm ein weiteres Auslandsstudium<br />
nicht finanzieren konnte. Hier machte er die Bekanntschaft des dänischen Komponisten<br />
Nils Gade (1817 – 1890), der ihn anregte eine Symphonie zu komponieren,<br />
und hier lernte er im Haushalt seines Onkels Herman Hagerup (1816 – 1900)<br />
seine damals 18jährige Cousine Nina kennen mit der er sich Weihnachten 1864<br />
heimlich verlobte. Im Sommer dieses Jahres war er wieder Ole Bull begegnet.<br />
In seinem Todesjahr 1907 hat Grieg bekannt, wie ihn dieses Zusammentreffen<br />
bezüglich seiner zukünftigen Kompositionen beeinflusst hat:<br />
Der junge Grieg<br />
im Jahre 1958<br />
„Ole Bull war mein guter Engel. Er öffnete mir die Augen für die Schönheit und<br />
Ursprünglichkeit der norwegischen Musik. Durch ihn lernte ich viele vergessene<br />
Volksweisen und vor allen Dingen meine eigene Natur kennen.“<br />
Gegen den Widerstand beider Elternhäuser heirateten Edvard und Nina am<br />
11. Juni 1867 in Kopenhagen. Das junge Paar zog nach Oslo, wo er seinen<br />
Lebensunterhalt mit Konzertauftritten und Unterrichten bestritt. In dieser Zeit<br />
erschienen seine Lyrischen Stücke opus 12 im Druck, die seine internationale<br />
Popularität begründeten. Am 10. April 1868 wurde die Tochter Alexandra geboren<br />
und während seines Sommeraufenthaltes in dem Dorf Søllerød nördlich von<br />
Kopenhagen entwarf er sein Klavierkonzert in a-moll, opus 16 in enger Zusammenarbeit<br />
mit dem Pianisten Edmund Neupert (1842 – 1888), dem Grieg das Werk<br />
widmete und der auch die Uraufführung am 3. April 1869 unter der Leitung des<br />
Chefdirigenten des Königlichen Theaters in Kopenhagen Holger Simon Paulli<br />
(1810 – 1891) mit überwältigtem Erfolg spielte. Durch die Geburt einer Enkeltochter<br />
hatte sich das Verhältnis zu den jeweiligen Großeltern verbessert. Mitte<br />
Mai 1869 reiste die kleine Griegfamilie nach Bergen, wo die kleine Tochter am 21.<br />
Mai plötzlich verstarb. Nach dem Tod der Tochter suchte und fand Grieg Trost im<br />
Komponieren und wandte sich der Bearbeitung von Volksmusik zu. Als Opus 17<br />
bearbeitete er noch im selben Jahr 25 norwegische Volksweisen und Tänze für<br />
Klavier aus der Sammlung Ældre og nyere norske Fjeldmelodier des Organisten<br />
und Komponisten Ludwig Mathias Lindeman (1812 – 1887).<br />
21
WERKEINFÜHRUNG<br />
1885 bezog das Ehepaar Grieg sein Haus Troldhaugen bei Bergen, von wo aus<br />
Edvard fortan seine Unternehmungen startete:<br />
Portrait gemalt von<br />
Eilif Peterssen, 1891<br />
„Im Oktober 1894 gab Grieg vier gut besuchte Konzerte in seiner Heimatstadt.<br />
Gegen Ende des Monats verließ er Troldhaugen und begab sich über Kristiana<br />
nach Kopenhagen, wo er sich ein halbes Jahr aufhielt. (...) Bevor Grieg Anfang Mai<br />
nach Troldhaugen zurückkehrte, vollendete er ein neues Orchesterwerk, Zwei<br />
nordische Weisen, op.63 für Streichorchester. Wie seine anderen Kompositionen<br />
dieses Genres sind auch diese beiden Stücke sehr wohlklingend. Das erste, »Im<br />
Volkston«, ist eine Bearbeitung einer kleinen Melodie, die ihm vom norwegischschwedischen<br />
Gesandten in Paris, Frederik Due, zugesandt worden war, nachdem<br />
die beiden ein Jahr zuvor in der französischen Hauptstadt zusammengekommen<br />
waren. Das andere Stück enthält zwei Bearbeitungen von Volksliedmelodien<br />
aus op. 17, »Lockruf« (Nr. 22) und »Humoristischer Tanz« (Nr. 18).“<br />
(Fin Benestad und Dag Schjelderup-Ebbe, Edvard Grieg, Mensch und Musiker,<br />
Leipzig 1993, S. 253f.)<br />
Aus Opus 17 begegnet uns also Nr. 18 Humoristischer Tanz und Nr. 22 Lockruf 16<br />
Jahre später in Opus 63 als Nr. 2 wieder. Der Lockruf mutiert 1895 zum Kuhreigen<br />
und der Humoristische Tanz zum Bauerntanz.<br />
Die Komposition mit dem Titel Zwei nordische Weisen ist Seiner Excellenz Herrn<br />
Fr. Due königlich norwegisch-schwedischer Botschafter in Paris gewidmet.<br />
Opus 63, Nr. 1 Im Volkston verarbeitet eine Melodie von Frederik Georg Knut<br />
Due (1833 – 1906), Sohn des norwegischen Premierminister Frederik Gottschalck<br />
Haxthausen Due (1796 – 1873) in Stockholm. Erst 1905 erkämpften sich die<br />
Norweger die Unabhängigkeit von Schweden und entschieden sich mit großer<br />
Mehrheit für eine Monarchie. Grieg äußerte sich dazu am 26. Oktober 1905<br />
gegenüber seinem Biographen Gerhard Schjelderup (1859 – 1933) mit<br />
folgenden Worten:<br />
„Und, so sehr ich auch für die Idee einer Republik bin, zweifle ich nicht einen<br />
Augenblick daran, daß jetzt die Monarchie nötig ist. Nur sie kann uns vor einer<br />
unvermeidbaren ökonomischen und politischen Misere retten (...) Hoffentlich<br />
haben wir Ende november einen König und eine königin und damit die<br />
dringende Ruhe im Lande.“<br />
In den folgenden drei Jahrzehnten bis zum Tod von Edvard Grieg am 4. September<br />
1907 bearbeitete er immer wieder skandinavische Volkslieder. Eines der letzten<br />
diesbezüglichen Werke sind die 1906 komponierten Vier Psalmen op.74 für<br />
gemischten Chor und Baritonsolo. Es handelt sich um eine Bearbeitung von vier<br />
alten norwegischen Kirchenliedern aus der bereits genannten Sammlung Ældre<br />
og nyere norske Fjeldmelodier von Ludwig Mathias Lindeman.<br />
Text: Dr. phil. Gunther Joppig<br />
22<br />
Bilder: Wikipedia
SPONSOREN UND FÖRDERER<br />
Gemeinde Icking<br />
Raiffeisenbank <strong>Isartal</strong><br />
Sparkasse Bad Tölz Wolfratshausen<br />
Anja Fichte Stiftung<br />
Freifrau von Schrenck<br />
SPIESZDESIGN, Neu-Ulm<br />
Dr. Gunther Joppig<br />
Der Förderverein der SINFONIETTA ISARTAL /<br />
Musikwerkstatt Jugend e. V.<br />
Marina Holtkamp<br />
Hilfswerk Lions Club München <strong>Isartal</strong> e. V.<br />
Tonkünstlerverband Bayern e. V.<br />
Nina Gühring<br />
Susanne Lange<br />
Thomas Rathnow<br />
Landkreis Bad Tölz<br />
Wolfratshausen<br />
MUSIKWERKSTATT<br />
MUSIKWERKSTATT<br />
JUGEND<br />
JUGEND<br />
23
VORSCHAU <strong>2024</strong><br />
NEUE<br />
PHILHARMONIE<br />
MÜNCHEN<br />
NPHM Konzertprojekt<br />
Herbst <strong>2024</strong><br />
ROBERT SCHUMANN Manfred Ouvertüre<br />
CLARA SCHUMANN Klavierkonzert<br />
JOHANNES BRAHMS 1. Symphonie<br />
© Andrej Grilc<br />
Simon Edelmann, Dirigent<br />
Freddy Kempf, Klavier<br />
© Sara Porter<br />
25. September <strong>2024</strong> | 20 Uhr,<br />
Silian (A), Kultursaal<br />
27. September <strong>2024</strong> | 20 Uhr,<br />
Wolfratshausen, Loisachhalle<br />
28. September <strong>2024</strong> | 20 Uhr,<br />
München, Herkulessaal<br />
Benefizkonzert in Zusammenarbeit mit Kolibri<br />
24
VORSCHAU <strong>2024</strong><br />
MUSIKWERKSTAT T<br />
JUGEND<br />
Musikwerkstatt Jugend e.V.<br />
Kammermusik<br />
Winter <strong>2024</strong><br />
SCHUBERT Winterreise<br />
Tareq Nazmi, Bariton<br />
Henriette Zahn, Klavier<br />
© Privat<br />
04. Dezember <strong>2024</strong> | 19:30 Uhr,<br />
Wolfratshausen, Loisachhalle<br />
Karten für alle Konzerte<br />
erhältlich bei München Ticket<br />
unter www.muenchenticket.de<br />
© Marco Borggreve<br />
25
Musik tut gut! Werden Sie Freund, Förderer, Stifter, Sponsor<br />
Das Orchester braucht Ihre Unterstützung<br />
Das Orchester wurde von einem privaten Verein gegründet. Alle Organisations- und Verwaltungsarbeiten<br />
werden ehrenamtlich erbracht, d.h. alle Spenden kommen den Musikern<br />
direkt zugute. Diese erhalten keine Gagen (nur in Ausnahmefällen eine geringe Aufwandsentschädigung);<br />
allerdings werden die Fahrtkosten erstattet und die Musiker aus ganz<br />
Europa erhalten während des Projekts Kost und Logis. Allein durch EIntrittsgelder und<br />
öffentliche Förderungen ist das nicht zu finanzieren, wir sind daher dringend auf private<br />
finanzielle Unterstützung angewiesen.<br />
Unsere Mitglieder - unsere Freunde des Fördervereins<br />
Ihre Mitgliedschaft ist Grundlage dafür, dass die Arbeit des Orchester überhaupt erst<br />
möglich wird. Die Mitgliedschaft im Förderverein bietet Ihnen auch Vorteile. Sie erhalten<br />
Vorab-Informationen zu den kommenden Konzerten und Sie können vergünstigte Konzertkarten<br />
erhalten.<br />
Jahresbeitrag: 30 Euro<br />
Mit Spenden helfen<br />
Sie können Ihre Spenden von der Steuer absetzen. Als gemeinnütziger Verein stellen wir<br />
Ihnen Spendenbescheinigungen gerne aus. Außerdem wird Ihr Name (sofern gewünscht)<br />
in unserem Programmheft abgedruckt.<br />
Unsere Fördere - unsere Stifter - unsere Sponsoren<br />
Werden Sie Förderer, Stifter oder sogar Sponsor! Ihr Nahme/Firmenlogo wird (sofern<br />
gewünscht) in unserem Programmheft auf einer extra Seite abgedruckt. Möchten Sie eine<br />
Werbung im Programmheft schalten, sprechen Sie uns an. Maße/Ort richtet sich nach der<br />
Höhe Ihrer Zuwendungen. Firmenlogos der Stifter und Sponsoren erscheinen auf Plakat<br />
und Flyer, die Rückseite des Programmhefts ist für Sponsoren reserviert. Wir informieren Sie,<br />
wenn Sie es möchten, zweimal jährlich über unsere Newsletter frühzeitig zu allen aktuellen<br />
Aktivitäten, Projekten und Konzerten. Sie erhalten außerdem für alle Konzerte eine persönliche<br />
Einladung und können sich Eintrittskarten reservieren lassen. Gerne laden wir Sie zu<br />
unseren Generalproben, Nachfeiern und besonderen Veranstaltungen ein. So haben Sie<br />
die Möglichkeit, die Dirigenten, Solisten und Orchstermusiker aus ganz Europa persönlich<br />
kennenzulernen.<br />
Förderer: Jahresbeitrag* ab 500 Euro<br />
Stifter: Jahresbeitrag* ab 3.000 Euro<br />
Sponsoren: Jahresbeitrag* ab 7.000 Euro<br />
*auch einmalig möglich<br />
Bankverbindung: Musikwerkstatt Jugend e.V.<br />
Raffeisenbank <strong>Isartal</strong><br />
IBAN: DE95 7016 9543 0100 2015 70<br />
BIC: GENODEF1HHS<br />
26
www.quartettissimo.de · www.bad-toelz.de/quartettissimo<br />
SPITZENENQUARTETTE<br />
TRIFFT MAN IM KURHAUS<br />
IN BAD TÖLZ<br />
7. quartettissimo!-Saison<br />
<strong>2024</strong>/25<br />
Einladung zu Top-Erlebnissen auf Weltniveau in einem<br />
Konzertsaal mit bester Akustik, stilvollem Ambiente<br />
und Restauration, keine Parkplatzprobleme!<br />
© Maya Matsuura<br />
© Escher String Quartet<br />
© Petra Hajska<br />
© Amaryllis Quartett<br />
Sonntag 27. Oktober <strong>2024</strong>, 19:30<br />
NOVO Quartet<br />
(Kopenhagen)<br />
Haydn · Nielsen · Vestergaard ·<br />
Schumann<br />
Sonntag 24. November <strong>2024</strong>, 19:30<br />
Escher String Quartet<br />
(New York City)<br />
Mendelssohn Bartholdy · Barber ·<br />
Dvořák<br />
Sonntag 23. Februar 2025, 19:30<br />
Pawel Haas Quartet<br />
(Prag)<br />
Dvořák · Martinů · Tschaikowski<br />
Sonntag 16. <strong>März</strong> 2025, 19:30<br />
Amaryllis Quartet<br />
(Köln)<br />
Lise de la Salle<br />
Klavier<br />
(Paris)<br />
Beethoven · Mahler/Schnittke<br />
(Klavierquartett) ·<br />
Dvořák (Klavierquintett)<br />
© Philippe Porter<br />
Kurhaus Bad Tölz Ludwigstr. 25, 83646 Bad Tölz (www.kurhaus-badtoelz.de) · Einführungen 18:30<br />
Einzelkarten (incl. VVG) Konzerte 1-3: 44 und 49 €, erm. 50 % (Schwerb. >50%, Jugendl. bis 18)<br />
Einzelkarten (incl. VVG) Konzert 4: 54 und 59 €, erm. 50 % (Schwerb. >50%, Jugendl. bis 18 Abo<br />
<strong>2024</strong>/25 mit allen 4 Konzerten quartettissimo! 124 und 144 €, erm. 50 % (30 % Rabatt)<br />
Vorverkauf Tourist-Info Bad Tölz (08041-7867-0)<br />
MünchenTicket (089-54 81 81 81), Online-Verkauf www.muenchenticket.de<br />
Gedenkkonzert zum<br />
50. Todesjahr Schostakowitschs<br />
Sonntag 19. Januar 2025<br />
27quartettissimo!<br />
KCG design ICKING<br />
Jerusalem Quartet Tel Aviv<br />
Schostakowitsch Nr. 3, 9, 12<br />
<strong>2024</strong>0209-abo <strong>2024</strong>-25-plus jerusalem-v-1-140x205-SICH.indd 1 09.02.<strong>2024</strong> 23:42:57
SPIESZDESIGN<br />
MUSIK FÜR DIE AUGEN<br />
Plakate, Flyer, Programme // Bücher und Zeitschriften<br />
Signets, Logos und Visitenkarten<br />
CD – und DVD-Gestaltung // Websites<br />
Illustrationen // Fotografie und Video<br />
Kalligrafie // 3D-Architektur-Visualisierung<br />
SPIESZDESIGN Büro für Gestaltung<br />
Wallstraße 28, 89231 Neu-Ulm // Tel 0731 725 44 81<br />
design@spiesz.de // www.spiesz.de<br />
Förderer der Neuen Philharmonie München