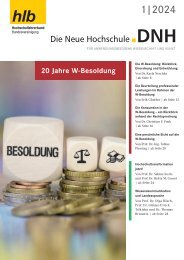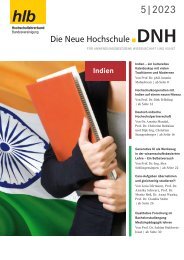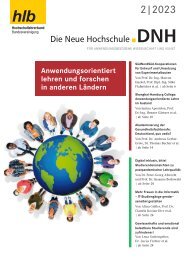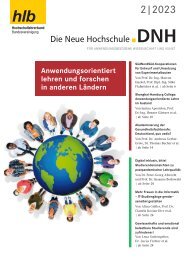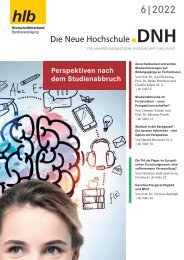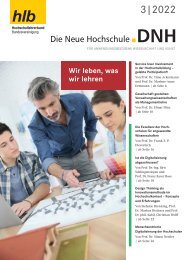Die Neue Hochschule Heft 2/2024
Zeitschrift des hlb Hochschullehrerbund e.V. - Themenschwerpunkt: Lernziel Demokratie
Zeitschrift des hlb Hochschullehrerbund e.V. - Themenschwerpunkt: Lernziel Demokratie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2|<strong>2024</strong><br />
FÜR ANWENDUNGSBEZOGENE WISSENSCHAFT UND KUNST<br />
Lernziel: Demokratie<br />
Lehrziel Demokratie: Werden<br />
wir unserer Verantwortung<br />
gerecht?<br />
Von Prof. Dr. Jochen Struwe<br />
| ab Seite 8<br />
Wirtschaftsdemokratie –<br />
(k)ein Thema für die<br />
Hochschullehre<br />
Von Prof. Dr. André Bleicher<br />
| ab Seite 12<br />
Demokratische Werte in der<br />
Hochschullehre erlebbar<br />
machen<br />
Lilija Willer-Wiebe, M. A.<br />
| ab Seite 16<br />
Demokratieerziehung muss<br />
bei den Grundlagen ansetzen<br />
Von Prof. Dr. rer. pol. Markus<br />
Karp | ab Seite 18<br />
Gut eingepreist? Zum Stand<br />
und zur Perspektive der<br />
Lehrpreisvergabe an HAW<br />
Von Dr. Peter-Georg Albrecht,<br />
Prof. Dr. Susanne Borkowski und<br />
Lisa König | ab Seite 22<br />
<strong>Die</strong> Magie des gemeinsamen<br />
Erlebens – Lessons Learned<br />
eines Entrepreneurship-Kurses<br />
Von Prof. Dr. Verena Kaiser<br />
und Prof. Dr. Bettina Maisch<br />
| ab Seite 26
2 INHALT<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
CAMPUS UND FORSCHUNG<br />
FACHBEITRÄGE<br />
Ostbayrische Technische <strong>Hochschule</strong><br />
Amberg-Weiden: Erste Winterschool in<br />
Bangladesch<br />
Frankfurt University of Applied Sciences:<br />
Kinderschutz-Fachtag Schule<br />
Künstliche Intelligenz, Mobilität, Klima:<br />
Drei Millionen Euro für Fortführung von<br />
Reallaboren<br />
4<br />
5<br />
Gut eingepreist? Zum Stand und zur<br />
Perspektive der Lehrpreisvergabe an<br />
HAW | Von Dr. Peter-Georg Albrecht, Prof.<br />
Dr. Susanne Borkowski und Lisa König<br />
<strong>Die</strong> Magie des gemeinsamen<br />
Erlebens – Lessons Learned eines<br />
Entrepreneurship-Kurses | Von Prof. Dr.<br />
Verena Kaiser und Prof. Dr. Bettina Maisch<br />
22<br />
26<br />
Künstliche Intelligenz in der Lehre: Neun<br />
Mythen über generative KI in der<br />
Hochschulbildung<br />
TH Bingen: Nachhaltigkeit nicht als<br />
„Trend“ verstehen<br />
6<br />
7<br />
HOCHSCHULPOLITIK<br />
Sinkende Studierendenzahlen durch<br />
demografischen Wandel: Anteil<br />
erfolgreicher Abschlüsse steigern<br />
29<br />
Titelthema:<br />
LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
Lehrziel Demokratie: Werden wir<br />
unserer Verantwortung gerecht?<br />
| Von Prof. Dr. Jochen Struwe<br />
8<br />
Studieren in Kanada: Kanada will weniger<br />
internationale Studierende<br />
Bremen: Promotion jetzt auch an HAW<br />
möglich<br />
Curriculumentwicklung: Whitepaper<br />
„Studiengänge für eine digitale Welt“<br />
30<br />
Wirtschaftsdemokratie – (k)ein Thema<br />
für die Hochschullehre<br />
| Von Prof. Dr. André Bleicher<br />
Demokratische Werte in der<br />
Hochschullehre erlebbar machen<br />
| Von Lilija Willer-Wiebe, M. A.<br />
Demokratieerziehung muss bei den<br />
Grundlagen ansetzen<br />
| Von Prof. Dr. rer. pol. Markus Karp<br />
12<br />
16<br />
18<br />
Erstsemesterzahlen: Stabilisierung auf<br />
niedrigerem Niveau<br />
Private <strong>Hochschule</strong>n: Große Vielfalt:<br />
Typologie nicht staatlicher <strong>Hochschule</strong>n<br />
Hochschulforum Digitalisierung: Visionen<br />
einer neuen Prüfungskultur<br />
Psychische Belastungen bei Studierenden:<br />
Nach der Pandemie noch kein normaler<br />
Studienalltag<br />
31<br />
32<br />
33<br />
BERICHTE AUS DEM hlb<br />
Landessprache in der Lehre<br />
Das Thema Sprache der Lehre regt lebhafte<br />
Debatte an | Von Prof. Dr. Olga Rösch<br />
Eigenständiges Promotionsrecht für HAW<br />
Hälfte der Bundesländer bereits aktiv<br />
20<br />
21<br />
AKTUELL<br />
Editorial<br />
<strong>Neue</strong>s aus der Rechtsprechung<br />
Veröffentlichungen<br />
3<br />
35<br />
36<br />
hlb-Kolumne: Englischsprachige<br />
Studiengänge zur Rettung bedrohter<br />
Studienstandorte?<br />
| Von Prof. Dr. Olga Rösch<br />
Europäische Hochschulpolitik<br />
hlb wird Mitglied der EURASHE<br />
36<br />
Neuberufene<br />
Impressum | Autorinnen<br />
und Autoren gesucht<br />
Seminarprogramm<br />
37<br />
39<br />
40
DNH 2 | <strong>2024</strong> EDITORIAL 3<br />
Mehr als nur Fachkraft sein<br />
Ein Studium legt nicht nur den Grundstein für die spätere fachliche Leistung am<br />
Arbeitsplatz. Es bietet auch Raum für die Beschäftigung mit der eigenen Rolle und<br />
Verantwortung im Zusammenleben in unserer Gesellschaft.<br />
Foto: Fotoladen Wedel<br />
Prof. Dr. Christoph Maas<br />
Chefredakteur<br />
„Erfinderische Zwerge,<br />
die für jeden Zweck<br />
gemietet werden<br />
können“ – so sah<br />
für Bertolt Brecht in<br />
seinem Theaterstück<br />
„Leben des Galilei“ das<br />
Zerrbild einer Wissenschaft<br />
aus, die jede<br />
Verantwortung für die<br />
Gesellschaft, innerhalb<br />
derer sie praktiziert<br />
wird, ablehnt. Unsere<br />
Lebensumstände sind<br />
jedoch in so vielfältiger<br />
Weise durch Errungenschaften geprägt, die es ohne<br />
Wissenschaft nicht geben würde, und für die Bewältigung<br />
aktueller Probleme fragen wir so selbstverständlich<br />
nach Hilfestellungen aus den Wissenschaften, dass<br />
die Verflechtung und damit auch die Verantwortung<br />
offensichtlich ist.<br />
<strong>Die</strong> Titelbeiträge in diesem <strong>Heft</strong> fragen danach,<br />
was es bedeutet, in unserer Gesellschaft, die sich auf<br />
ein gemeinsames demokratisches Selbstverständnis<br />
festgelegt hat, ein wissenschaftliches Studium anzubieten.<br />
Sie widmen sich dabei sowohl grundsätzlichen<br />
Aspekten als auch disziplinären Sichtweisen.<br />
Unsere Hochschulgesetze verpflichten uns dazu,<br />
unsere Studierenden zu wissenschaftlichem Arbeiten<br />
und zu verantwortlichem Handeln in einem demokratischen<br />
Staat zu befähigen. Jochen Struwe führt<br />
aus, welche Aufgaben jenseits der fachlichen Qualifizierung<br />
daraus für uns als Lehrende erwachsen<br />
(Seite 8).<br />
Wir sehen es heute als mehr oder weniger selbstverständlich<br />
an, dass ein Mensch am Arbeitsplatz<br />
weniger Rechte hat als im politischen Raum. André<br />
Bleicher diskutiert die Idee einer demokratisch<br />
verfassten Wirtschaft sowohl anhand von Prinzipien<br />
als auch mittels konkreter Beispiele. Für uns<br />
alle geht es dabei um einen erheblichen Anteil unseres<br />
Lebens, für wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge<br />
darüber hinaus um ein relevantes und oft<br />
unterschätztes Fachthema (Seite 12).<br />
Auch Studierende der Sozialen Arbeit sind nicht<br />
gegen politische Tendenzen immun, die die Gleichwertigkeit<br />
aller Menschen infrage stellen. Lilija<br />
Willer-Wiebe stellt ein didaktisches Konzept vor,<br />
bei dem die Studierenden die Konsequenzen von<br />
Ausgrenzungsmechanismen erleben können (Seite<br />
16).<br />
Demokratie ist kein Naturzustand, sondern findet<br />
stets im Rahmen eines konkreten Regelwerks statt.<br />
Markus Karp erinnert uns daran, dass die Erhaltung<br />
unserer Demokratie eine ausreichende Verbreitung<br />
des Wissens über dieses Regelwerk voraussetzt<br />
(Seite 18).<br />
<strong>Die</strong> Themenwahl für dieses <strong>Heft</strong> dient der Einstimmung<br />
auf das diesjährige Kolloquium des hlb. Dessen<br />
Überschrift unterscheidet sich nur in einem Buchstaben<br />
von unserem Titel. Mir ist aber wichtig, durch<br />
die Wortwahl zu betonen, dass für die Qualität unserer<br />
Arbeit nicht die gute Absicht entscheidend ist,<br />
mit der wir vor unsere Studierenden treten, sondern<br />
das, was dadurch bei ihnen ausgelöst wird. Schließlich<br />
wissen wir schon lange: „Erwachsene sind unbelehrbar,<br />
aber lernfähig“ (Horst Siebert, 1996).<br />
Ihr Christoph Maas
4 CAMPUS UND FORSCHUNG<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Ostbayrische Technische <strong>Hochschule</strong> Amberg-Weiden<br />
Erste Winterschool in Bangladesch<br />
Premiere in der internationalen<br />
Bildungszusammenarbeit: Als erste<br />
akademische Institution Europas<br />
besucht die OTH Amberg-Weiden die<br />
University of Asia Pacific (UAP) in<br />
Bangladesch im Rahmen einer gemeinsamen<br />
Winterschool. Fünf Tage setzten<br />
sich Studierende beider <strong>Hochschule</strong>n<br />
intensiv mit Themen zu Personalmanagement,<br />
Leadership und Kommunikation<br />
auseinander und förderten zugleich<br />
den interkulturellen Austausch. Zur<br />
Eröffnung der Winterschool konnte<br />
Prof. Dr. Qumrul Ahsan, Vizekanzler<br />
der UAP, zahlreiche hochrangige Gäste<br />
begrüßen. Allen voran den deutschen<br />
Botschafter in Bangladesch, Achim Tröster<br />
, sowie Dr. Musharrof Hossain, Präsident<br />
der Human Ressources Gesellschaft<br />
von Bangladesch, und Mahbubur<br />
Rahman, Präsident der Internationalen<br />
Handelskammer (ICC) von Bangladesch.<br />
Von der OTH Amberg-Weiden waren<br />
Prof. Dr. Gabriele Murry und Prof. Dr.<br />
Bernt Mayer angereist.<br />
Bei der Auftaktveranstaltung wurde<br />
betont, dass Bangladesch und Deutschland<br />
eine entscheidende Phase ihrer<br />
bilateralen Beziehungen erleben, denn<br />
diese Winterschool sei nicht nur eine<br />
akademische Initiative, sondern vielmehr<br />
ein Symbol dafür, dass Studierende<br />
voneinander lernen und gemeinsam<br />
Entwicklung und Wachstum fördern<br />
und Freundschaften fürs Leben schließen<br />
könnten. Auch Prof. Dr. Gabriele<br />
Murry, Internationalisierungsbeauftragte<br />
der Weiden Business School, die<br />
die Winterschool mit initiierte, betonte<br />
die Wichtigkeit des Austauschs und<br />
der Erfahrungen zwischen verschiedenen<br />
Kulturen.<br />
Über fünf Tage hinweg standen<br />
für die 15 Studierenden aus Weiden<br />
sowie Studierende der UAP Vorlesungen<br />
und interaktive Seminare in den<br />
Bereichen Internationale Kommunikation,<br />
Leadership und Personalmanagement<br />
auf dem Programm – gehalten<br />
von Dozierenden aus Deutschland und<br />
Bangladesch. Abgerundet wurde die<br />
Woche noch durch abwechslungsreiche<br />
Aktivitäten in Dhaka, der pulsierenden<br />
Hauptstadt Bangladeschs. „<strong>Die</strong> Lernziele<br />
und Strukturen der Vorlesungen<br />
<strong>Die</strong> Teilnehmenden der ersten Winterschool an der University of Asia Pacific<br />
hatten das Ziel, eine andere Perspektive<br />
kennenzulernen. Es war nicht<br />
einfach, aber mithilfe von UAP-Studierenden<br />
konnten wir die Herausforderung<br />
bewältigen“, so Julian Widmaier,<br />
Student der OTH Amberg-Weiden. Daniela<br />
Schubert, Masterstudentin an der<br />
OTH Amberg-Weiden, sagt: „<strong>Die</strong> Vorlesungen<br />
waren herausfordernd, da sie<br />
uns dazu brachten, uns intensiv miteinander<br />
auseinanderzusetzen. Es war<br />
eine Ehre, wie uns die UAP empfangen<br />
hat und uns über die Zeit betreut hat.“<br />
Prof. Dr. Gabriele Murry und Prof.<br />
Dr. Bernt Mayer betonen, dass es in<br />
einer sich ständig wandelnden Welt<br />
entscheidend sei, dass Bildungseinrichtungen<br />
wie die OTH Amberg-Weiden<br />
und die Asia University Pacific den<br />
Weg für internationale Kooperationen<br />
ebnen: „Durch Projekte wie die Winterschool<br />
in Bangladesch werden nicht nur<br />
akademische, sondern auch kulturelle<br />
Brücken gebaut, die die Studierenden<br />
auf eine globalisierte Welt vorbereiten.<br />
Es ist ein Schritt hin zu einer integrativen<br />
Zukunft, in der Wissen und Erfahrungen<br />
über Kontinente hinweg geteilt<br />
werden.“<br />
<strong>Die</strong> OTH Amberg-Weiden und die<br />
UAP planen, ihre Beziehung in Zukunft<br />
auszubauen und den kontinuierlichen<br />
Austausch fortzusetzen. Studierende<br />
aus Bangladesch sollen die Möglichkeit<br />
erhalten, die OTH Amberg-Weiden<br />
zu besuchen und dort zu studieren<br />
und umgekehrt. Darüber hinaus<br />
sind gemeinsame Forschungsprojekte<br />
in International Human Ressource<br />
Management und Leadership & Sustainability<br />
Management geplant. Um diese<br />
Ergebnisse zu präsentieren, ist bereits<br />
eine erste Konferenz in Dhaka im<br />
Herbst <strong>2024</strong> geplant.<br />
OTH Amberg-Weiden<br />
Foto: MD Sadique Hasan Polash, UAP
DNH 2 | <strong>2024</strong> CAMPUS UND FORSCHUNG 5<br />
Frankfurt University of Applied Sciences<br />
Kinderschutz-Fachtag Schule<br />
Foto: Frankfurt UAS<br />
Hessens Lehrkräfte werden seit diesem<br />
Schuljahr in einem interdisziplinär<br />
gestalteten Onlinekurs zum Thema<br />
Kinderschutz weitergebildet. Lehrende<br />
bekommen entsprechende Fachkenntnisse<br />
und Handlungswissen vermittelt,<br />
um das Verständnis im Umgang<br />
mit Vernachlässigung und Formen der<br />
Gewalt an Kindern zu erweitern. Der<br />
Stifterverband vergibt für diesen interdisziplinären<br />
Ansatz die Hochschulperle<br />
des Monats Januar <strong>2024</strong>.<br />
<strong>Die</strong> Frankfurt University of Applied<br />
Sciences (Frankfurt UAS) stellt für<br />
alle Lehrkräfte in Hessen einen Moodlekurs<br />
zum Thema Kinderschutz und<br />
Kindeswohlgefährdung bereit. Lehrkräfte<br />
können sich auf der Lernplattform<br />
der Hessischen Lehrkräfteakademie<br />
<strong>Die</strong> Hochschulperle des Monats Januar zum Thema „Lehrkräftebildung<br />
neu gestalten“ geht an das Projekt Kinderschutz-Fachtag Schule.<br />
anmelden und das Kursangebot nutzen.<br />
Der Kurs wurde durch Frankfurt UAS<br />
interdisziplinär (Soziale Arbeit, Rechtswissenschaften,<br />
Medizin) in Kooperation<br />
mit dem Hessischen Kultusministerium<br />
konzipiert. Ursprünglich wurde er für<br />
die Lehre der Sozialen Arbeit initiiert, wo<br />
er bereits an über 20 Hochschulstandorten<br />
bundesweit zum Einsatz kommt.<br />
Aufgrund der großen Bedeutung des<br />
Themas wurde das Konzept, angelehnt an<br />
das „Frankfurter Modell: Kinderschutz<br />
in der Lehre“, weiterentwickelt und als<br />
Weiterbildungskurs auch auf Lehrkräfte<br />
in Schulen zugeschnitten.<br />
Oft sind Lehrkräfte die ersten und<br />
manchmal auch die einzigen Ansprechpartner<br />
für Schulkinder, die in der Familie<br />
misshandelt werden. Den Lehrerinnen<br />
und Lehrern<br />
sollen durch den<br />
Weiterbildungskurs<br />
die Angst vor dem<br />
Thema genommen und<br />
Handlungskompetenzen<br />
vermittelt werden.<br />
Dabei sind Netzwerkarbeit<br />
und Interdisziplinarität<br />
unverzichtbar.<br />
Lehrkräfte lernen<br />
hier, wie die am Kinderschutz beteiligte<br />
Professionen und Institutionen wirksam<br />
zusammenarbeiten und welche Rolle sie<br />
selbst dabei haben. Für den Kurs wird<br />
ein konkreter Fall aus der Schule pseudonymisiert<br />
und über verschiedene Lernstationen<br />
begleitet. Auch Schulleitung,<br />
Kinderschutzfachkräfte, Lehrkräfte und<br />
das Kultusministerium kommen zu den<br />
Schutzkonzepten gegen Gewalt und sexuellen<br />
Missbrauch zu Wort. Der Kurs ist<br />
für acht Zeitstunden konzipiert. Darüber<br />
hinaus gibt es ergänzend weiterführende<br />
Informationen für das Selbststudium,<br />
um Kindeswohlgefährdungen schneller<br />
zu entdecken und betroffene Kinder und<br />
ihre Familien professionell zu begleiten.<br />
„Der Kinderschutz-Fachtag Schule<br />
ist praxisnah konzipiert und fördert<br />
die Professionalisierung der Lehrkräfte“,<br />
so die Jury des Stifterverbandes zu<br />
ihrer Entscheidung, die Hochschulperle<br />
des Monats Januar nach Frankfurt<br />
zu vergeben. „Das Projekt zeigt, dass<br />
nicht nur Universitäten an der Lehrkräftebildung<br />
teilhaben. Hier wird deutlich,<br />
welch wichtigen Beitrag auch engagierte<br />
Menschen in Institutionen leisten<br />
können, die bisher nicht in der Lehrkräftebildung<br />
involviert waren.“<br />
Stifterverband<br />
Künstliche Intelligenz, Mobilität, Klima<br />
Drei Millionen Euro für Fortführung von Reallaboren<br />
Baden-Württembergs erfolgreichste<br />
Reallabore zu den Themen Künstliche<br />
Intelligenz, Mobilität und Klima erhalten<br />
eine Anschlussförderung bis 2026<br />
von insgesamt rund drei Millionen Euro.<br />
Mit ihren Ideen, Themen und Konzepten<br />
durchgesetzt haben sich Reallabore<br />
an der <strong>Hochschule</strong> Reutlingen, an der<br />
<strong>Hochschule</strong> für Wirtschaft und Umwelt<br />
Nürtingen-Geislingen, am Karlsruher<br />
Institut für Technologie KIT sowie an der<br />
Universität Stuttgart. Wissenschaftsministerin<br />
Petra Olschowski sagt dazu: „Ich<br />
freue mich, dass es uns gelungen ist, die<br />
vier Reallabore weiter zu finanzieren.<br />
<strong>Die</strong> Gutachterinnen und Gutachter sind<br />
überzeugt, dass von ihnen weitere wichtige<br />
Erkenntnisse und Lösungen für<br />
Klimaschutz und KI-Nutzung zu erwarten<br />
sind. Nachhaltige Lösungen für die<br />
Zukunftsthemen Klima, Mobilität und<br />
Künstliche Intelligenz können oft nur im<br />
Zusammenspiel von Gesellschaft, Politik,<br />
Wirtschaft und Wissenschaft erarbeitet<br />
und erfolgreich umgesetzt werden.“<br />
Weiter gefördert werden die vier<br />
Reallabore, deren bisherige Arbeit und<br />
deren Projektskizzen für Anschlussvorhaben<br />
von einem unabhängigen<br />
Gutachtergremium am besten bewertet<br />
wurden. Folgende Reallabore werden<br />
für zwei weitere Jahre gefördert:<br />
Reallabor „EKUS hoch i“ (Fortführung<br />
von „CampUS hoch i“) an der<br />
Universität Stuttgart:<br />
Als Anschluss an das erfolgreiche Reallabor<br />
„CampUS hoch i“ zur Umsetzung<br />
von Klimaneutralität in Landesgebäuden<br />
des Campus Stuttgart-Vaihingen<br />
soll nun untersucht werden, wie<br />
Nutzende von Gebäuden effektiver motiviert<br />
werden können, sich energiesparend<br />
zu verhalten und die Umsetzung
6 CAMPUS UND FORSCHUNG<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
der Klimaziele aktiv zu unterstützen.<br />
Das Anschlussprojekt knüpft dabei an<br />
Forschungen zu Einzelraumregelungen<br />
(technisch) und Bestimmungsfaktoren<br />
individueller Motivation (sozialwissenschaftlich)<br />
an.<br />
Reallabor „Klima-RT-LAB“ an der<br />
<strong>Hochschule</strong> Reutlingen:<br />
Mit dem Reallabor Klimaneutrales Reutlingen<br />
soll der Weg der Stadt Reutlingen<br />
hin zu Klimaneutralität vertiefend<br />
erforscht, unterstützt und erweitert<br />
werden. Zu den Zielen gehören die<br />
Erforschung und Gestaltung des Institutionalisierungsprozesses<br />
von Klimaneutralität,<br />
die Förderung einer Kultur der<br />
Nachhaltigkeit und die Verstetigung der<br />
Nachhaltigkeitstransformation. Reutlingen<br />
strebt bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität<br />
an.<br />
Reallabor „MobiQ“ (Nachhaltige<br />
Mobilität durch Sharing im Quartier)<br />
der HfWU Nürtingen-Geislingen:<br />
Das Reallaborprojekt „MobiQ“ setzt sich<br />
für nachhaltige Mobilität in Quartieren<br />
ein. Auch in der zweiten Förderphase<br />
wird an den drei Reallabor-Standorten<br />
Stuttgart-Rot, Geislingen und Waldburg<br />
gearbeitet. Ziel ist es, Wissen für eine<br />
generationengerechte, geschlechterfaire<br />
und diskriminierungsfreie Mobilitätsgestaltung<br />
zu erzeugen und dies in ein<br />
Konzept zu fassen, das eine klimafreundliche<br />
und lebenswerte Mobilitätszukunft<br />
für Stadt und Land ermöglicht.<br />
Reallabor „Robotische Künstliche<br />
Intelligenz“ am Karlsruher Institut<br />
für Technologie (KIT):<br />
Das Reallabor hat das Ziel, Künstliche<br />
Intelligenz durch humanoide Roboter<br />
für Menschen erfahrbar zu machen. <strong>Die</strong><br />
Forschungsgebiete umfassen hierbei<br />
Nutzergruppen in unterschiedlichen<br />
Umgebungen – von Kita über Schule<br />
bis zu Museum, Bibliothek und Krankenhaus.<br />
<strong>Die</strong> Erkenntnisse aus dem<br />
gemeinsamen Forschen von Gesellschaft<br />
und Wissenschaft sollen dann<br />
Grundlage für die Entwicklung zukünftiger<br />
humanoider Roboter sein.<br />
Das Treffen mit der Leitung des Partnerschaftsvereins<br />
diente dem gegenseitigen<br />
Austausch über das Projekt BioMex.<br />
Der Verein mit zahlreichen Netzwerken<br />
in Ruanda ist ein wichtiger Multiplikator<br />
zur Bekanntmachung des Projekts<br />
in den verschiedenen „Communities“.<br />
MWK-BW<br />
www.reallabore-bw.de<br />
Künstliche Intelligenz in der Lehre<br />
Neun Mythen über generative KI in der Hochschulbildung<br />
Der jüngste Hype um Künstliche Intelligenz<br />
hat neben Euphorie auch viele<br />
Unsicherheiten hervorgerufen. Aber ist<br />
KI gegenwärtig wirklich so mächtig und<br />
„intelligent“, wie ihr nachgesagt wird?<br />
Julius-David Friedrich, Jens Tobor und<br />
Martin Wan widmen sich im neuen<br />
Diskussionspapier des Hochschulforum<br />
Digitalisierung (HFD) diesem Thema und<br />
klären dabei Irrtümer über generative KI<br />
in der Hochschulbildung auf. Ein besonderer<br />
Schwerpunkt dieser Publikation<br />
sind die Auswirkungen generativer KI<br />
auf die Hochschulbildung. Aber auch für<br />
Interessierte außerhalb der <strong>Hochschule</strong><br />
bietet das Diskussionspapier wertvolle<br />
Erklärungen und Hintergründe, um die<br />
Funktionsweise von KI – und damit ihre<br />
Grenzen und Möglichkeiten – besser zu<br />
verstehen. Denn: Was (generative) KI<br />
eigentlich ist und kann, ist keineswegs<br />
immer eindeutig. Das Ziel des Diskussionspapieres<br />
ist es, zu einem besseren<br />
Verständnis von generativer KI beizutragen<br />
und auf diese Weise den derzeitigen<br />
KI-Diskurs zu entmystifizieren. Auf<br />
diese Weise soll neuer Raum für einen<br />
produktiven Austausch entstehen, der<br />
die dringlichen Themen rund um KI in<br />
der Hochschulbildung adressiert.<br />
„Wir wollen mit diesem Diskussionspapier<br />
entmystifizieren, um Platz<br />
zu schaffen für einen produktiven<br />
Austausch zu Chancen und Risiken von<br />
generativen KI-Tools in Studium und<br />
Lehre“, stellen die Autoren Julius-David<br />
Friedrich, Jens Tobor und Martin Wan<br />
heraus. Folgende KI-Mythen werden im<br />
Diskussionspapier thematisiert:<br />
1. Generative KI-Sprachmodelle sind<br />
fehlerfrei<br />
2. KI versteht Bedeutungen<br />
3. KI wird immer klüger<br />
4. KI ist eine Blackbox<br />
5. KI ist kreativ<br />
6. KI hat ein Bewusstsein<br />
7. Wissenschaftliches Arbeiten wird<br />
obsolet<br />
8. KI führt zu mehr Arbeitslosigkeit<br />
9. KI kann in die Zukunft blicken<br />
Im Anschluss zeigen die Autoren,<br />
worauf es aktuell ankommt, damit generative<br />
KI einen positiven Einfluss auf<br />
Studium und Lehre nehmen kann.<br />
Foto: HFD<br />
Screenshot<br />
CHE<br />
https://www.che.de/download/<br />
neun-mythen-ueber-generative-ki-in-der-hochschulbildung/
DNH 2 | <strong>2024</strong> CAMPUS UND FORSCHUNG 7<br />
TH Bingen<br />
Nachhaltigkeit nicht als „Trend“ verstehen<br />
Wasserstoff, Larven und Stadtökologie<br />
– diese Themen haben auf den<br />
ersten Blick auch an der Technischen<br />
<strong>Hochschule</strong> Bingen nicht viel gemeinsam.<br />
„Jedes dieser drei Forschungsfelder<br />
kann einen wichtigen Beitrag für<br />
eine nachhaltigere Zukunft liefern“, so<br />
Prof. Dr. Katharina Lenhart, die zusammen<br />
mit Prof. Dr. Bruno Grimm die<br />
Projektleitung an der TH Bingen innehat.<br />
„Nachhaltigkeit ist kein Trend,<br />
sondern eine dringende Notwendigkeit,<br />
um künftigen Generationen ein<br />
lebenswertes und sicheres Leben auf<br />
unserem Planeten zu garantieren“,<br />
so Grimm. Vor diesem Hintergrund<br />
hat sich die Technische <strong>Hochschule</strong><br />
Bingen im Rahmen des Verbundprojekts<br />
„EMPOWER”, gemeinsam mit vier<br />
weiteren <strong>Hochschule</strong>n aus dem Raum<br />
Rheinhessen/Vorderpfalz, auf den<br />
Schwerpunkt „Sustainability“ fokussiert.<br />
EMPOWER wird über fünf Jahre<br />
über das Förderprogramm Innovative<br />
<strong>Hochschule</strong>, initiiert vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung und<br />
der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz,<br />
gefördert. Ziel dieses Förderprogramms<br />
ist es, den Wissens- und<br />
Technologietransfer von den <strong>Hochschule</strong>n<br />
hin zu Unternehmen, Behörden, in<br />
die Politik und Gesellschaft zu unterstützen.<br />
In dem Teilprojekt Wasserstoff<br />
werden unter der Leitung von Prof.<br />
Dr. Michael Mangold Lösungen für<br />
die Speicherung elektrischer Energie<br />
aus erneuerbaren Quellen in Form<br />
von Wasserstoff erarbeitet, um wetterund<br />
tageszeitabhängige Schwankungen<br />
bei der Stromerzeugung besser<br />
ausgleichen zu können. Da elektrische<br />
Batteriespeicher bislang eine<br />
sehr teure Lösung darstellen, soll in<br />
diesem Projekt die alternative Energiespeicherung<br />
in Form von Wasserstoff<br />
erforscht und optimiert werden. Hierzu<br />
wird eine Demonstrationsanlage aufgebaut,<br />
anhand derer der bisher noch<br />
wenig erprobte instationäre Betrieb<br />
von kombinierten Elektrolyse-/Brennstoffzelleneinheiten<br />
erforscht und<br />
dynamische Prozessführungskonzepte<br />
zusammen mit Industriepartnern<br />
entwickelt werden.<br />
Der Fokus des Teilprojektes Erzeugung<br />
nachhaltiger Futtermittel, Wertund<br />
Werkstoffe unter der Leitung von<br />
Prof. Dr. Bernhard Seyfang liegt auf der<br />
effizienten Nutzung von Rohstoffen in<br />
biogenen Kreisläufen. Ziel des Projekts<br />
ist es, biogene Reststoffe als Futter für<br />
Larven zu verwenden, die dann wiederum<br />
zur Erzeugung von Futtermitteln,<br />
Wert- und Werkstoffen genutzt werden.<br />
Larven der schwarzen Soldatenfliege<br />
(Hermetia illucens) werden mit Reststoffen<br />
aus der Lebensmittelindustrie<br />
ernährt. Anschließend werden die<br />
Larven weiterverarbeitet und nach<br />
ihren Bestandteilen aufgetrennt. Das<br />
Protein dient als Futtermittel, während<br />
die für die Tierernährung nicht geeigneten<br />
Bestandteile weiterverarbeitet<br />
und in vorhandene Wertschöpfungsketten<br />
integriert werden sollen, z. B.<br />
in Form von biogenen Tensiden oder<br />
Kunststoffen.<br />
Unter der Leitung von Prof. Dr. Oleg<br />
Panferov werden im Teilprojekt Stadtnahe<br />
Experimentierflächen die Projekte<br />
„Dachbegrünung“, „Phänologische<br />
Gärten“ sowie „Mobile Gärten“ weiterentwickelt<br />
und die Ergebnisse allgemeinverständlich<br />
für einen Transfer<br />
in verschiedene Gesellschaftsgruppen<br />
aufbereitet. Ein Modell-Gründach „zum<br />
Anfassen“, an dem umfassende Klimaund<br />
Vegetationsdaten erfasst werden,<br />
befindet sich auf Augenhöhe des Besuchers<br />
auf dem Campus der TH Bingen.<br />
Außerdem lassen sich mit phänologischen<br />
Gärten die Auswirkungen der<br />
Klimaerwärmung auf Ökosysteme vor<br />
Ort beobachten und erforschen: Da<br />
die Pflanzenentwicklung in unseren<br />
Breiten maßgeblich von der Temperatur<br />
bestimmt wird, lassen sich durch<br />
die langjährige Erfassung verschiedener<br />
phänologischer Phasen im Leben<br />
der Pflanzen die Veränderungen in der<br />
Temperatur vor Ort an den Pflanzen<br />
selbst ablesen. Durch Mobile Gärten<br />
Doktorandin Laura Schneider bei der Arbeit<br />
an den Larven der Schwarzen Soldatenfliege<br />
(Hermetia illucens)<br />
soll Stadtbegrünung an Orten ermöglicht<br />
werden, an denen eine dauerhafte<br />
Begrünung (aktuell) nicht möglich<br />
ist. Mobile Gärten können zur Erhöhung<br />
der Biodiversität in städtischen<br />
Räumen beitragen und positive Effekte<br />
auf das Mikroklima bewirken.<br />
Prof. Dr. rer. nat. Katharina Lenhart<br />
(Projektleitung),<br />
Prof. Dr. rer. nat. Bruno Grimm<br />
(Projektleitung),<br />
Andrea Lösch (Transfermanagerin)<br />
Technische <strong>Hochschule</strong> Bingen<br />
<strong>Die</strong> Meldungen in dieser Rubrik, soweit<br />
sie nicht namentlich gekennzeichnet<br />
sind, basieren auf Pressemitteilungen<br />
der jeweils genannten Institutionen.<br />
Foto: TH Bingen
8 LERNZIEL: DEMOKRATIE DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Lehrziel Demokratie: Werden wir unserer<br />
Verantwortung gerecht?<br />
In bewusster Abänderung des <strong>Heft</strong>themas „Lernziel Demokratie“ soll hier die<br />
professorale Herangehensweise an den gesetzlichen Auftrag hinterfragt werden. Es<br />
wird sich zeigen, dass die Antwort auf die aufgeworfene Frage eher zwiespältig ausfällt.<br />
Prof. Dr. Jochen Struwe<br />
Foto: privat<br />
PROF. DR. JOCHEN STRUWE<br />
Vizepräsident der hlb-<br />
Bundesvereinigung<br />
Stellvertretender hlb-<br />
Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz<br />
jochen.struwe@hlb.de<br />
<strong>Die</strong> zentralen Ziele des Studiums<br />
werden in den einschlägigen Hochschulgesetzen<br />
des Bundes und der<br />
Länder im Wesentlichen übereinstimmend<br />
beschrieben. 1 Beispielhaft sei § 7<br />
Hochschulrahmengesetz (HRG) zitiert:<br />
„Lehre und Studium sollen den<br />
Studenten auf ein berufliches<br />
Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihm<br />
die dafür erforderlichen fachlichen<br />
Kenntnisse, Fähigkeiten und<br />
Methoden dem jeweiligen Studiengang<br />
entsprechend so vermitteln,<br />
daß [sic] er zu wissenschaftlicher<br />
oder künstlerischer Arbeit und zu<br />
verantwortlichem Handeln in einem<br />
freiheitlichen, demokratischen und<br />
sozialen Rechtsstaat befähigt wird.“<br />
In der täglichen Arbeit steht außer<br />
Frage, dass die <strong>Hochschule</strong>n für angewandte<br />
Wissenschaften (HAW) die erstgenannten<br />
Ziele bei ihren Absolventinnen<br />
und Absolventen erreichen:<br />
Lehre und Studium sollen den<br />
Studenten auf ein berufliches Tätigkeitsfeld<br />
vorbereiten und ihm die<br />
dafür erforderlichen fachlichen<br />
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden<br />
dem jeweiligen Studiengang<br />
entsprechend … vermitteln …<br />
Inwieweit jedoch die beiden<br />
vermeintlichen Randbedingungen<br />
– Befähigung zu verantwortlichem<br />
Handeln in einem freiheitlichen,<br />
demokratischen und sozialen<br />
Rechtsstaat und<br />
– Befähigung zu wissenschaftlicher<br />
oder künstlerischer Arbeit<br />
im Tagesgeschäft verfolgt werden, unterscheidet<br />
sich von <strong>Hochschule</strong> zu <strong>Hochschule</strong>,<br />
von Fachbereich zu Fachbereich,<br />
von Studiengang zu Studiengang, von<br />
Professor zu Professorin. Dabei wäre<br />
schon die Lesart als Rand- oder Nebenbedingung<br />
verfehlt. Denn bei genauem<br />
Lesen des Satzes wird deutlich, dass<br />
beide Befähigungen sowohl als Grundlage,<br />
als Voraussetzung für eine spätere<br />
berufliche Tätigkeit, gleichzeitig aber<br />
auch als übergeordnete, primäre Ziele<br />
eines Studiums zu verstehen sind.<br />
Wenn die deutschen <strong>Hochschule</strong>n<br />
(Universitäten wie HAW) den Anspruch<br />
und die Verpflichtung haben, den akademischen<br />
Führungskräftenachwuchs<br />
unserer Gesellschaft emporzubringen,<br />
dann müssen diese beiden Primärziele<br />
weit mehr in den Fokus eines<br />
jeden/einer jeden einzelnen Lehrenden<br />
rücken, als es angesichts der Fülle<br />
weiterer Tagesaufgaben wie Forschung,<br />
(Hochschulselbst-)Verwaltung, Transfer,<br />
Weiterbildung zurzeit und zumeist der<br />
Fall ist (im Übrigen ein weiteres Argument<br />
für die Erfüllung der hlb-Forderung<br />
12plusEins).<br />
Angesichts der epochalen Gemengelage<br />
aufgrund wachsender Bedrohungen<br />
bspw. durch<br />
– bisher unzureichend gebremste<br />
Klimatrends,<br />
– ungeregelte KI-Anwendungen, die<br />
u. a. Trollfabriken mit „alternativen<br />
Permalink:<br />
https://doi.org/10.5281/zenodo.10838032<br />
1 Ziel(e) des Studiums in DE: § 7 HRG, DE-BB: § 17 BbgHG, DE-BE: § 21 BerlHG, DE-BW: § 29 LHG, DE-BY: Art 76<br />
BayHlG, DE-HB § 52 HG, DE-HE: § 15 HessHG, DE-HH: § 49 HmbHG, DE-MV: § 3 LHG M-V, DE-NI: § 3NHG, DE-NW: §<br />
58 LHG, DE-RP: § 16 HochSchG, DE-SH: § 3 i. V. m. § 46 HSG, DE-SL: § 56 SHSG, DE-SN: § 15 HSFG, DE-ST: § 6 HSG<br />
LSA, DE-TH: § 46 ThürHG.
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
9<br />
Fakten“ und KI-generierten Fake-Audios/-Fotos/<br />
-Videos, am Ende vielleicht sogar einer Maschinenherrschaft<br />
die Tore weit öffnen,<br />
– verschärften Wettbewerb zwischen den großen<br />
politisch-ökonomischen Blöcken mit der Folge<br />
internationaler Polarisierung,<br />
– die Bereitschaft Russlands, den eigenen<br />
Machtanspruch in einem imperialistischen<br />
Angriffskrieg durchzusetzen,<br />
– einen heißen Krieg in Israel und Gaza, zahlreiche<br />
weitere Brandstellen im Nahen Osten<br />
und zumindest „lauwarme“ Auseinandersetzungen<br />
im Maghreb oder auf dem Balkan,<br />
– die latenten Bestrebungen Chinas, sich zum<br />
Hegemonen zumindest im asiatisch-pazifischen<br />
Raum aufzuschwingen,<br />
– die Unsicherheiten und Verwerfungen, die mit<br />
einem erneuten Wahlsieg Donald Trumps im<br />
Herbst verbunden wären,<br />
– einen in Wahlergebnissen manifestierten<br />
Trend zu rechtsnationalistisch-populistischen,<br />
den Rechtsstaat instrumentalisierenden (um<br />
nicht „unterminieren“ zu schreiben) Regierungen<br />
selbst in der EU,<br />
– auch in unserem geografischen Raum zunehmende,<br />
zersetzende kriminelle Aktionen mit<br />
staatlichen Hintermännern (wie Pipelinesprengungen,<br />
Zerstörung zentraler Datenleitungen,<br />
Hacken von staatlichen und kommunalen Institutionen<br />
und kritischer Infrastruktur),<br />
– gesellschaftliche Spaltungstendenzen und<br />
Dysfunktionalitäten in Parlamenten und Regierungen,<br />
– die wahrgenommene Unfähigkeit demokratisch<br />
legitimierter Institutionen zu rascher, zielgerichteter,<br />
„unbürokratischer“ Problemlösung,<br />
– Medien, die ihrer Auflagensteigerung und Followerzahl<br />
eine größere Bedeutung zumessen<br />
als einer ethisch verantwortbaren, wahrheitsgetreuen<br />
Berichterstattung und einer sachlichseriösen<br />
Kommentierung des Geschehens,<br />
ist die Befähigung unserer Studierenden zu verantwortlichem<br />
Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen<br />
und sozialen Rechtsstaat als Aufgabe<br />
allerersten Ranges zu sehen; dem Heranführen der<br />
Studierenden an eine frühzeitige und nachhaltige<br />
Verantwortungsübernahme in unserer Gesellschaft<br />
kommt eine nicht überschätzbare Bedeutung zu.<br />
Der erste Schritt des eigenen gesellschaftlichen<br />
Engagements ist bei jungen Menschen heute meist<br />
anlass- und projektbezogen, kurzfristig, vorübergehend,<br />
überschaubar (Beispiele: Flüchtlingshilfen 2015,<br />
diverse Klimabewegungen). Damit ist jedoch auf Dauer<br />
kein Staat zu machen, dazu bedarf es eben auch der<br />
Inkaufnahme der Mühen der Ebene, also langfristige,<br />
anhaltende Verantwortungsübernahme in Parteien 2<br />
und den vielen anderen gesellschaftlichen Institutionen.<br />
Dabei ist eher unerheblich, ob es sich um politische,<br />
soziale, kirchliche, sportliche oder andere Aktivitäten<br />
handelt, solange sich diese im demokratischen<br />
Spektrum bewegen. Dass es an nachhaltigem Einsatz<br />
vielfach mangelt, zeigt das lange Sterben von Vereinen,<br />
weil kein Nachwuchs mehr vorhanden ist, der sich als<br />
Vorstand bewähren will – gerade in Deutschland mit<br />
seiner starken Tradition ehrenamtlicher Vereinsarbeit<br />
eine große Herausforderung. Unsere Studierenden<br />
müssen wieder stärker lernen, ihre eigenen Angelegenheiten<br />
selbst in die Hand zu nehmen.<br />
Hier scheinen wir an den <strong>Hochschule</strong>n zu versagen.<br />
Allein die Beteiligung an studentischen Wahlen 3<br />
drängt die Frage auf, ob dem Gros der Studierenden<br />
der 500 Jahre alte, urdemokratische Anspruch „Nihil<br />
de nobis, sine nobis“ 4 nichts bedeutet:<br />
Fachbereich der<br />
<strong>Hochschule</strong> Trier<br />
Wahlberechtigte<br />
Profs.<br />
Aktive Wähler<br />
Profs.<br />
Wahlbeteiligung<br />
Profs.<br />
Wahlberechtigte<br />
Stud.<br />
Aktive<br />
Wähler Stud.<br />
Wahlbeteiligung<br />
Stud.<br />
Bauen & Leben 22 13 59,1 % 609 14 2,3 %<br />
Informatik 17 16 94,1 % 1.105 66 6,0 %<br />
Technik 25 16 64,0 % 768 8 1,0 %<br />
Wirtschaft 15 12 80,0 % 843 67 7,9 %<br />
Gestaltung 37 29 78,4 % 1.149 99 8,6 %<br />
Umweltplanung<br />
& -technik<br />
Umweltwirtschaft<br />
& -recht<br />
33 30 90,9 % 909 177 19,5 %<br />
22 12 54,5 % 808 111 13,7 %<br />
∑ HS Trier 171 128 74,9 % 6.191 542 8,8 %<br />
2 Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG: „<strong>Die</strong> Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“<br />
3 In der Tabelle (rechte Spalte) durchaus repräsentativ gezeigt am Beispiel der <strong>Hochschule</strong> Trier, Wahlen 2020 (Professoren)<br />
und 2023 (Studenten) zum Senat und den Fachbereichsräten (unterschiedliche Jahre aufgrund abweichender<br />
Wahlperioden).<br />
4 <strong>Die</strong> Verfassung des polnischen Reichstags zu Radom 1505 prägte den Grundsatz „Nihil de nobis, sine nobis (Nichts<br />
über uns ohne uns)“.
10 LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
„Dem Heranführen der Studierenden an eine<br />
frühzeitige und nachhaltige Verantwortungsübernahme<br />
in unserer Gesellschaft kommt<br />
eine nicht überschätzbare Bedeutung zu.“<br />
Wenn einstellige Wahlbeteiligungen (die studentische<br />
Bereitschaft, sich wählen zu lassen, ist ein<br />
noch größeres Trauerspiel) eher die Regel denn die<br />
Ausnahme sind, stimmt etwas nicht beim demokratischen<br />
Selbstverständnis und Engagement unserer<br />
Studierenden.<br />
An dieser Stelle seien die ersten Sätze aus Immanuel<br />
Kants „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“<br />
in Erinnerung gerufen:<br />
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen<br />
aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.<br />
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines<br />
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.<br />
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit,<br />
wenn die Ursache derselben nicht am Mangel<br />
des Verstandes, sondern der Entschließung und<br />
des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines<br />
andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth<br />
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist<br />
also der Wahlspruch der Aufklärung.<br />
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum<br />
ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die<br />
Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen<br />
(naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens<br />
unmündig bleiben; und warum es Anderen<br />
so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen.<br />
Es ist so bequem, unmündig zu sein.“<br />
Unmündigkeit und folgend Untätigkeit mögen<br />
bequem sein, zu rechtfertigen sind sie angesichts der<br />
momentanen Weltlage nicht. <strong>Die</strong> vielfach kolportierte<br />
Erkenntnis Friedrich Eberts „Demokratie braucht<br />
Demokraten“ ist ein Weckruf, und diesen Appell an<br />
das persönliche Einstehen für unsere freiheitlich<br />
demokratische Grundordnung müssen wir Lehrenden<br />
unseren Lernenden immer wieder vorhalten.<br />
Nicht „die Politik“, auf die gern und oft zu Unrecht<br />
Verantwortung abgeladen wird, ist der Staat: Der<br />
Staat sind wir alle, und jeder, jede Einzelne ist für<br />
die individuelle und gesellschaftliche Daseinsvorsorge<br />
(mit) zuständig.<br />
Uns Professorinnen und Professoren kommt im<br />
Hinblick auf diese für den Fortbestand einer grundgesetzkonformen<br />
Gesellschaftsordnunng die elementare<br />
Aufgabe zu, zunächst durch unser eigenes Vorbild<br />
zu wirken. Wir würden unsere Bedeutung als „Role<br />
Model“ unterschätzen, würden wir dieser Anforderung<br />
nicht gerecht werden. Wir müssen die Auseinandersetzung,<br />
die offene Diskussion über gesellschaftlich<br />
relevante Themen mit unseren Studierenden<br />
suchen und immer wieder einfordern. Wir dürfen<br />
unsere Studierenden „nicht vom Haken lassen“, was<br />
selbstverständlich nicht bedeutet, dass wir sie indoktrinieren,<br />
unseren etwaigen Wissens- und Erfahrungsvorsprung<br />
unfair überwältigend ausspielen, nur die<br />
eigene Meinung gelten lassen. 90 Minuten, die mit<br />
solchen Diskussionen verbracht werden, sind letztlich<br />
prägender und zukunftsweisender als jede 90<br />
Minuten Thermodynamik, Betriebswirtschaft oder<br />
Praxis der Pflegearbeit.<br />
Das zweite Ziel, nämlich die „Befähigung zu<br />
wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit“, mag<br />
im Hinblick auf das zuvor Festgestellte und Geforderte<br />
banal erscheinen. Aber auch hier sind im Hinblick<br />
auf das „Lehrziel Demokratie“ Defizite festzustellen,<br />
die es zu beseitigen gilt.<br />
Fördern ohne Fordern funktioniert in einem<br />
Hochschulstudium nicht. Beobachtet man die Langzeitentwicklung<br />
im deutschen Bildungssystem, ist<br />
zu konstatieren, dass das Abitur allein nicht mehr<br />
für die Hochschulreife bürgt. Hinzu kommt die<br />
gesellschaftlich gewünschte und politisch geforderte<br />
Öffnung der <strong>Hochschule</strong>n für andere Zugänge,<br />
Stichwort „Meisterabitur“. Sosehr gerade die HAW<br />
für die Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems<br />
stehen: <strong>Die</strong> Augen dürfen nicht vor den resultierenden<br />
Problemen verschlossen werden.<br />
Dass Erstsemester keinen Dreisatz, die Prozentrechnung,<br />
geschweige denn Infinitesimalrechnung<br />
oder elementare Statistik beherrschen, mag noch<br />
durch Brückenkurse, Propädeutika o. Ä. teilweise<br />
reparierbar sein (im Übrigen sind das keine originären<br />
hochschulischen Aufgaben). Wenn es aber<br />
auch daran gebricht, einen „geraden Satz“ auszusprechen<br />
oder niederzuschreiben, wird es schwierig.<br />
Es dürfte in Deutschland keinen Hochschullehrer,<br />
keine Hochschullehrerin geben, der/die nicht ob<br />
fehlender Fähigkeiten und Fertigkeiten hinsichtlich<br />
Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, Satzbau,<br />
Textlogik verzweifeln könnte. Wenn dann selbst<br />
Masterstudierende, die ihren ersten akademischen<br />
Abschluss bereits attestiert bekamen, noch Arbeiten<br />
abliefern, die wissenschaftlichen Anforderungen
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
11<br />
allenfalls eingeschränkt standhalten 5 , dann liegt das<br />
auch an fehlender Verantwortungsbereitschaft von<br />
Lehrenden.<br />
Es darf uns eben nicht nur darauf ankommen,<br />
unsere jeweiligen Fachthemen irgendwie an den<br />
Mann, an die Frau zu bringen. In jedem Gespräch<br />
mit Arbeitgebern und deren Verbänden, in jeder Rückmeldung<br />
von HAW-Absolventinnen und -Absolventen,<br />
egal welcher Provenienz, wird deutlich, dass von<br />
dem an der <strong>Hochschule</strong> erlernten Fachwissen allenfalls<br />
10, 15 Prozent unmittelbar beim Berufseinstieg<br />
verwertbar sind – das berufsnotwendige Know-how<br />
wird wesentlich erst vom späteren Arbeitgeber vermittelt.<br />
<strong>Die</strong>s ist kein Vorwurf an die HAW, sondern liegt<br />
in der Natur der Dinge: Solange die HAW hinsichtlich<br />
Sachmitteln und (wissenschaftlichen) Mitarbeitenden<br />
schlechter ausgestattet sind als im Wettbewerb stehende<br />
Unternehmen, kann sich daran wenig ändern. Als<br />
Defizite von Hochschulabsolventinnen und -absolventen<br />
werden von den Arbeitgebern bzw. ihren Vertretern<br />
im Übrigen nicht fehlende Fach-, IT- oder Fremdsprachenkenntnisse<br />
oder auch Auslandserfahrungen<br />
adressiert, sondern zum einen fehlende Soft Skills wie<br />
Teamfähigkeit, Führungsvermögen, soziale und interkulturelle<br />
Kompetenzen, zum anderen die mangelnde<br />
Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit in interdisziplinären<br />
Projekten mit u. U. wechselnden Mitarbeitenden<br />
und flexiblen Hierarchien (letztlich wohl auch<br />
demokratische „Basics“).<br />
Für uns Professorinnen und Professoren bedeutet<br />
dies, dass eine zweistündige Einführungsveranstaltung<br />
„Wissenschaftliches Arbeiten“ im ersten<br />
Semester keineswegs die Anwendung der grundlegenden<br />
Methodik garantiert. So ist eher kontraproduktiv,<br />
Studierende dadurch unterstützen zu wollen<br />
(um das Wort „pampern“ zu vermeiden), dass bald<br />
jeder Fachbereich eigene Gestaltungsvorschriften für<br />
Abschlussarbeiten, Zitationsregeln etc. veröffentlicht:<br />
Das verführt nur zur Denkfaulheit und verhindert die<br />
Suche nach eigenen, vielleicht besseren Lösungen.<br />
Ähnliches gilt für zahlreiche weitere Maßnahmen, die<br />
sich <strong>Hochschule</strong>n in ihrer Not einfallen lassen, um<br />
Studierende vermeintlich zu fördern: <strong>Die</strong>se entmündigen<br />
Studierende vielfach, lassen sie die Verantwortung<br />
für eine nicht bestandene Prüfung überall, nur<br />
nicht bei sich selbst suchen, führen jedenfalls kaum<br />
dazu, dass das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten<br />
eingeübt wird. Und nur der Erinnerung halber:<br />
„Studium“ ist lateinischen Ursprungs und bedeutet<br />
übersetzt Eifer, Anstrengung, Bemühen, Begierde …<br />
Lehrende müssen vielmehr in jeder (!) Veranstaltung,<br />
egal ob Vorlesung, Seminar, Übung, Laborpraktikum<br />
o. Ä., in jeder (!) Prüfung (schriftlich, mündlich,<br />
praktisch, in niederrangigen Hausarbeiten genauso<br />
wie in hochdotierten Abschlussarbeiten) Verstöße<br />
gegen gute wissenschaftliche Praxis korrigieren und<br />
ggf. sanktionieren. Und das nicht einmal, sondern<br />
immer und immer wieder. „Wiederholung festigt“ –<br />
das gilt auch für formale Aspekte des wissenschaftlichen<br />
Arbeitens. So traurig es ist: Selbst „einwandfreies<br />
Deutsch“ (schon eine der Minimalforderungen im<br />
Tutzinger Maturitätskatalog der Westdeutschen Rektorenkonferenz<br />
und der Kultusministerkonferenz von<br />
1958) muss so lange eingefordert werden, bis Rechtschreibung,<br />
Grammatik, Satzbau, logische Konsistenz<br />
wissenschaftlichen Anforderungen genügen. 6<br />
Und spätestens damit ist der Anschluss an das<br />
Lehrziel Demokratie wiederhergestellt: Sind Studierende,<br />
die zur sprachlichen Differenzierung nurmehr<br />
eingeschränkt fähig sind, die sich nur noch in ihren<br />
Filterblasen „informieren“, in der Lage, jetzt und<br />
später Verantwortung zu übernehmen? Wer liest<br />
noch Tageszeitung, schaut die Tagesschau, und das<br />
täglich? Wer hält sich vorurteilsfrei über das lokale,<br />
regionale, nationale und internationale Tagesgeschehen<br />
auf dem Laufenden, und das bewusst aus<br />
vielleicht weltanschaulich unterschiedlich ausgerichteten<br />
Medien und nicht allein aus X, Instagram,<br />
TikTok oder irgendwelchen per Algorithmus empfohlenen,<br />
abseitigen Blogs? Wir müssen Studierende<br />
wie Absolventen in die Lage versetzen, in Zeiten<br />
von durch KI beliebig Konstruierbarem zwischen<br />
Wahn und Wirklichkeit zu unterscheiden. Wie sollen<br />
sie zwischen richtig und falsch trennen, wenn sie<br />
nicht die wissenschaftlich einwandfreie Methodik<br />
internalisiert haben? Erst damit wird die Grundlage<br />
gelegt für die eigene, faktengestützte Meinungsbildung<br />
und anschließende Aktion. Allein auf „gesunden<br />
Menschenverstand“ zu setzen, heißt heute, das<br />
Prinzip Hoffnung doch etwas überzustrapazieren …<br />
Wollen wir also allen eingangs wiedergegebenen<br />
Zielen des Studiums gerecht werden, sind auch wir<br />
Professorinnen und Professoren an den HAW gefordert.<br />
Dass die Voraussetzungen, insbesondere die<br />
beiden höchstrangigen Ziele<br />
– Befähigung zu verantwortlichem Handeln in<br />
einem freiheitlichen, demokratischen und<br />
sozialen Rechtsstaat und<br />
– Befähigung zu wissenschaftlicher oder künstlerischer<br />
Arbeit<br />
auch in der täglichen Praxis zu erreichen, angesichts<br />
der Lehrbelastung und der vielfach fehlenden<br />
wissenschaftlichen Unterstützung nicht optimal sind,<br />
entbindet uns nicht von der dringend notwendigen<br />
Annäherung an diese Ziele – im eigenen wie im gesellschaftlichen<br />
Interesse. <strong>Die</strong>se Prioritäten bei unserer<br />
Zielerreichung richtig zu setzen, ist eines der wenigen<br />
verbliebenen Privilegien der Freiheit von Forschung<br />
und Lehre. Gehen wir es also an, es ist höchste Zeit!<br />
5 Zur grundsätzlichen Problematik, ergänzt durch Beispiele, vgl. Jochen Struwe: Ideologische Überzeugungstäter mit akademischem Titel vs. Wissenschaftler<br />
mit gefestigtem Wertekostüm. In: <strong>Die</strong> <strong>Neue</strong> <strong>Hochschule</strong> 4/2018, S. 12 ff.<br />
6 <strong>Die</strong>ser Absatz entnommen aus Jochen Struwe: a. a. O., S. 14 f.
12 LERNZIEL: DEMOKRATIE DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Wirtschaftsdemokratie – (k)ein Thema<br />
für die Hochschullehre<br />
Als Arbeitskraft in einem Unternehmen oder einer <strong>Hochschule</strong> befinde ich mich nicht<br />
im Vollbesitz meiner bürgerlichen Rechte – wir leben in einer „halbierten“ Demokratie.<br />
Ansätze, diese Diskrepanz zu überwinden, werden im Folgenden dargestellt.<br />
Von Prof. Dr. André Bleicher<br />
Foto: André Bleicher<br />
PROF. DR. ANDRÉ BLEICHER<br />
<strong>Hochschule</strong> Biberach<br />
Professur Allgemeine<br />
Betriebswirtschaftslehre,<br />
Strategisches Management und<br />
Organisation<br />
Karlsstraße 11<br />
88400 Biberach<br />
bleicher@hochschule-bc.de<br />
https://www.hochschule-biberach.de/<br />
kontakt/andre-bleicher<br />
https://orcid.org/0009-0009-<br />
4818-7541<br />
Wirtschaftsdemokratie gilt gemeinhin<br />
als ein verstaubtes Element des Traditionssozialismus,<br />
das in den 1920er-<br />
Jahren zwar eine Rolle spielte, etwa<br />
in der Vorstellung einer funktionalen<br />
Demokratie, welche die parlamentarische<br />
Demokratie ergänzen sollte. 1 In<br />
der Verfassung der Weimarer Republik<br />
findet in Artikel 165 die gleichberechtigte<br />
Mitbestimmung als wirtschaftsdemokratische<br />
Forderung ihren<br />
Niederschlag, diese sollte in einem<br />
dreistufigen Rätesystem auf Betriebs-,<br />
Bezirks- und Reichsebene umgesetzt<br />
werden. Der inhaltlich nur wenig präzisierte<br />
Verfassungsauftrag zur Demokratisierung<br />
von Unternehmen und<br />
Wirtschaft wurde jedoch während der<br />
1920er-Jahre nur in sehr begrenztem<br />
Umfang umgesetzt. Wesentlich geprägt<br />
wurde die Debatte durch Fritz Naphtalis<br />
(1929) Schrift „Wirtschaftsdemokratie.<br />
Ihr Wesen, Weg und Ziel“. Neben<br />
Arbeitsrecht und Kollektivverträgen<br />
sollte Mitbestimmung auf allen Ebenen<br />
wirtschaftlicher Entscheidungen, vom<br />
Arbeitsplatz über die Fabrik (Betrieb),<br />
das Unternehmen bis zu Branchen und<br />
Gesamtwirtschaft, als Prinzip wirksam<br />
werden, und es sollten geeignete Institutionen<br />
geschaffen werden, welche die<br />
Arbeitnehmerbeteiligung sichern.<br />
Realisiert wurde davon wenig.<br />
<strong>Die</strong> Gewerkschaften versuchten nach<br />
dem zweiten Weltkrieg zwar, an diese<br />
Diskussion anzuknüpfen, allerdings sah<br />
das Grundgesetz der Bundesrepublik<br />
Deutschland eine wirtschaftsdemokratische<br />
Verfasstheit der Ökonomie nicht<br />
vor. In der Auseinandersetzung um die<br />
paritätische Mitbestimmung versuchte<br />
Viktor Agartz, damals Leiter des wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Instituts<br />
des DGB, die Konzepte der Weimarer<br />
Republik neu zu beleben, und favorisierte<br />
eine wirtschaftsdemokratische<br />
Ausgestaltung in Kammern, Räte und<br />
Ausschüsse. <strong>Die</strong> Gegenposition vertrat<br />
der Betriebswirt Erich Potthoff, der vor<br />
allem das erreichbare Ziel, die Mitbestimmung<br />
in den Aufsichtsräten, favorisierte<br />
und eine makroökonomische<br />
Koordinierung in Räte als nicht sinnvoll<br />
ansah und deshalb die Traditionslinie<br />
zur Debatte der 1920er-Jahre durchtrennen<br />
wollte. Schließlich setzte sich<br />
Potthoff durch und die Gewerkschaften<br />
konzentrierten sich in den 1950er-Jahren<br />
auf die Durchsetzung der paritätischen<br />
Mitbestimmung in den Sektoren<br />
Kohle und Stahl (ausführlich hierzu<br />
Molitor 2011).<br />
So wird verständlich, warum einzelne<br />
Studien über wirtschaftsdemokratische<br />
Erfolgsmodelle, wie sie beispielsweise<br />
Hartmut Wächter (2012) mit der<br />
Fallstudie „Opel Hoppmann“ vorgelegt<br />
hat, keinen großen Nachhall gefunden<br />
haben. Walther Müller-Jentschs Replik<br />
auf Wächter favorisiert statt eines wirtschaftsdemokratischen<br />
Ansatzes den<br />
rheinischen Kapitalismus und die in<br />
ihm verankerten Formen der Mitbestimmung<br />
und Müller-Jentsch mahnt<br />
eine pragmatische Ausrichtung der<br />
Gewerkschaften an, indem er die Maximen<br />
Gottfried Benns zitiert und dafür<br />
plädiert, man möge doch von seinen<br />
Permalink:<br />
https://doi.org/10.5281/zenodo.10838037<br />
1 Vertreten wurde diese Idee von den Austromarxisten Otto Bauer, Max Adler und Karl Renner, die sich dabei an die<br />
von G.D.H. Cole (1920) entwickelte Idee des englischen Gildensozialismus anlehnten, in welchem Produktions- und<br />
Konsumsphäre demokratisiert werden sollten.
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
13<br />
„Demokratie bleibt ‚halbiert‘, solange sie am Arbeitsplatz,<br />
im Betrieb, in der Ökonomie ausgeschlossen ist und die<br />
Gestaltung der eigenen Arbeitstätigkeit lediglich im Rahmen<br />
einer vom Management gewährten Partizipation möglich ist.“<br />
Beständen (also dem Erreichten) ausgehen und nicht<br />
von seinen Parolen (dem Utopischen).<br />
So nimmt es kaum wunder, dass wirtschaftsdemokratische<br />
Inhalte keinen Eingang in den Curricula<br />
ökonomischer Studiengänge gefunden haben;<br />
dort finden sich allenfalls ein paar Hinweise auf<br />
Mitbestimmungsgesetze und das Betriebsverfassungsgesetz.<br />
Der Verzicht auf wirtschaftsdemokratische<br />
Inhalte spart jedoch Entwicklungen aus, die<br />
im Folgenden skizziert werden sollen, nämlich die<br />
Debatte um demokratische Unternehmen und die<br />
vergessene Geschichte demokratischer Unternehmen,<br />
also Genossenschaften.<br />
Das demokratische Unternehmen wird zu<br />
einem Management-Thema<br />
Nicht erst seit Sattelberger et al. (2015) das Thema<br />
des demokratischen Unternehmens auf die Tagesordnung<br />
setzten, belebt sich die Debatte um Chancen<br />
und Risiken demokratischer Unternehmen. <strong>Die</strong>se<br />
Demokratisierung erscheint plausibel, trifft sie doch<br />
auf ein oft beschriebenes Defizit: Demokratie bleibt<br />
„halbiert“ – nämlich auf das politische Subsystem<br />
begrenzt –, so formulieren Raymond Aron (1981) und<br />
Ulrich Beck (1997), solange sie am Arbeitsplatz, im<br />
Betrieb, in der Ökonomie ausgeschlossen ist und die<br />
Gestaltung der eigenen Arbeitstätigkeit lediglich im<br />
Rahmen einer vom Management gewährten Partizipation<br />
möglich ist. Es sei, so führt Ulrich Beck aus,<br />
erklärungsbedürftig, dass die Bürger eines Staates<br />
zwar ihre Regierung wählen dürfen, die Beschäftigten<br />
eines Unternehmens aber mit den von der Unternehmensführung<br />
bestimmten Vorgesetzten vorliebnehmen<br />
müssen. In der Regel wird diese halbierte<br />
Demokratie damit gerechtfertigt, dass es demokratischen<br />
Organisationen erstens an systemischer Effizienz<br />
gebräche. Demokratische Entscheidungsprozesse<br />
dauerten – zumindest im Durchschnitt – länger als<br />
autokratische, sie binden Kapazitäten und verhindern<br />
aufgrund des Konsenszwangs tendenziell<br />
„harte“ Entscheidungen. <strong>Die</strong> zweite Argumentationsfigur<br />
zielt auf die Belohnung individueller Leistung:<br />
Wer besondere Leistungen erbringt und bereit<br />
ist, besondere Risiken auf sich zu nehmen, soll dafür<br />
belohnt werden. Er soll in seiner Freiheit, andere für<br />
sich arbeiten zu lassen und Eigentum anzuhäufen,<br />
über freilich bestehende Schutzrechte hinaus, nicht<br />
behindert werden, weil daraus für die Allgemeinheit<br />
der größte Nutzen erwächst.<br />
Kieser und Kubicek (1992, S. 99 f.) unterstützen<br />
in dem Klassiker „Organisation“ das Argument,<br />
dass demokratische Verfahren zeitaufwendig seien,<br />
und konstatieren, dass das Unternehmen sich in<br />
einem Abwägungsprozess befände, ob es eher wirtschaftliche<br />
Ziele erreichen wolle oder ob es vielmehr<br />
demokratischen Zielen verpflichtet sei. Dem<br />
steht jedoch entgegen, dass demokratisches Management<br />
(Jarley et al. 1997) mit höherer organisationaler<br />
Effizienz sowie mit erhöhter Innovationsbereitschaft<br />
und besserer Performance (Manville und Ober<br />
2003) in Bezug gesetzt wird. Auch führe es dazu,<br />
die ökonomischen, sozialen und aus der Unternehmensumwelt<br />
resultierenden Zielstellungen mit den<br />
je individuellen Zielen der Organisationsmitglieder<br />
in einen besseren Zusammenklang zu bringen (Cloke<br />
und Goldsmith 2002). Beispiele für Unternehmen,<br />
die sich verschiedenster demokratischer Verfahren<br />
bedienen sind W. L Gore, welches Entscheidungen<br />
partizipativ-demokratisch trifft, oder das radikal-demokratische<br />
Vorgehen bei Semco in Brasilien<br />
(Semler 1995). Ricardo Semler (1995, S. 233) thematisiert<br />
die halbierte Demokratie, indem er ausführt:<br />
„Im Zeitalter des Schlagworts von der neuen Weltordnung<br />
glaubt fast jeder, dass alle Menschen ein<br />
Recht darauf haben, die zu wählen, welche sie führen<br />
sollen, zumindest im öffentlichen Bereich. Aber noch<br />
hat die Demokratie nicht Einzug in die Arbeitswelt<br />
gehalten. Noch immer können in den Büros und
14 LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Fabriken auf der ganzen Welt Diktatoren und Despoten<br />
schalten und walten.“<br />
<strong>Die</strong> Diskrepanz zwischen den Befunden ist möglicherweise<br />
darauf zurückzuführen, dass Partizipationsbereitschaft<br />
und -kompetenz der Beschäftigten,<br />
verglichen mit der Situation in den 1950er- oder<br />
1960er-Jahren, im Durchschnitt zugenommen hat.<br />
Dass die Partizipationsbereitschaft im Bereich<br />
Arbeit (Klages 2000) steigt – während sie in anderen<br />
gesellschaftlichen Feldern eher abzunehmen<br />
scheint (Putnam 2000) –, stellt ein bedeutsames<br />
kulturelles und soziales Kapital dar, welches eine<br />
ökonomische Produktivitätsentwicklung ermöglicht,<br />
die über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut<br />
und gefestigt werden musste. Sie wuchs gleichsam<br />
mit dem kulturellen Kapital der Bevölkerung. In<br />
diesem Sinne verstehen Welpe et al. (2015, S. 79 f.)<br />
unter organisationaler Demokratie Unternehmensstrukturen,<br />
welche allen Mitgliedern der Organisation<br />
Einfluss auf Entscheidungen, auf die Gestaltung<br />
der Arbeit und auf die Formen der Zusammenarbeit<br />
ermöglicht. <strong>Die</strong>s führe zu besseren Entscheidungen,<br />
höherer Identifikation und einer Stärkung der Innovations-<br />
und Kooperationsfähigkeit.<br />
Auf einen bedeutsamen Unterschied ist allerdings<br />
hinzuweisen: Demokratische Verfahren in Unternehmen<br />
sind gegenwärtig nur partiell durch gesetzlich<br />
oder vertraglich abgesicherte Mitbestimmungsformen<br />
begründet, sondern scheinen eher einem freiwilligen<br />
Zugeständnis der Eigner oder ihrer Vertreter<br />
zu entspringen oder aber auf deren ideelle Überzeugung<br />
zurückzuführen sein. Klaus Dörre (2015) weist<br />
darum auch zu Recht auf die schwache institutionelle<br />
Absicherung des demokratischen Unternehmens<br />
hin, erkennt in diesem gleichwohl eine Chance, weil<br />
im Zuge der Demokratisierung auch geklärt werden<br />
müsse, wer denn letztlich der Souverän im Unternehmen<br />
sei und weil ein Fortschreiten auf dem Weg<br />
der Demokratisierung notwendigerweise auch eine<br />
Institutionalisierung der Partizipationsformen über<br />
die geltenden Mitbestimmungsformen hinaus herbeiführen<br />
müsse. In diesem Sinne ruft die Debatte um<br />
das demokratische Unternehmen zur Beantwortung<br />
der Frage auf, ob man sich mit dem Begriff der Partizipation<br />
zufrieden geben will, wie er im hegemonialen<br />
Managementdiskurs etabliert wurde, und ob<br />
man damit die „halbierte Demokratie“ grundsätzlich<br />
akzeptiert. Oder ob Partizipationspraxen im<br />
Lichte demokratischer Prinzipien beurteilt werden<br />
und untersucht wird, wie nahe diese Praxen an echte<br />
Demokratie heranreichen. Ein solcher Blickwinkel<br />
könnte eine in Vergessenheit geratene Form des<br />
wirtschaftsdemokratischen Unternehmens wieder<br />
ins Licht rücken: die Genossenschaft.<br />
Renaissance der Produktiv-Genossenschaften?<br />
– Der Fall Mondragón<br />
Das Verhältnis von Beteiligungsrechten und -ansprüchen<br />
in Wirtschaft und Gesellschaft darf nicht<br />
statisch gesehen werden. Kapitalismus und Demokratie<br />
bilden ebenso wenig eine natürliche Einheit,<br />
wie der freie Markt die genuine Existenzform der<br />
freien Gesellschaft darstellt. Vielmehr befinden sich<br />
Demokratie und Markt in einem Spannungsverhältnis<br />
(Polanyi 1978). Zunächst stellt die Verselbstständigung<br />
der ökonomischen Sphäre selbst als ein<br />
Produkt der Moderne dar und ist somit als Modernisierungsprojekt<br />
zu begreifen. Ein wesentlicher Teil<br />
dieses Modernisierungsprozesses ist die Verselbstständigung<br />
der Arbeit und die Entstehung des sozialen<br />
Typus Arbeitskraft, wie Max Weber (1971, S.<br />
321 f.) ausführt: „<strong>Die</strong>se entscheidende ökonomische<br />
Grundlage: die Trennung des Arbeiters von den<br />
sachlichen Betriebsmitteln; den Produktionsmitteln<br />
in der Wirtschaft, den Kriegsmitteln im Heer, den<br />
sachlichen Verwaltungsmitteln in der öffentlichen<br />
Verwaltung, den Forschungsmitteln im Universitätsinstitut<br />
und Laboratorium, den Geldmitteln bei<br />
ihnen allen, ist dem modernen … Staatsbetrieb und<br />
der kapitalistischen Privatwirtschaft als entscheidende<br />
Grundlage gemeinsam.“ Dabei übersieht Weber,<br />
dass eine Form moderner Unternehmen – die Genossenschaft<br />
– genau diese Trennung nicht vollzieht;<br />
Eric Olin Wright (2020, S. 336 ff.) portraitiert mit<br />
dem Fallbeispiel Mondragón eine Genossenschaft<br />
als reale Utopie.<br />
Etwa 70 km von Bilbao entfernt liegt die Kleinstadt<br />
Mondragón. Dort begann in den 1950er-Jahren<br />
die Erfolgsgeschichte einer Kooperative. 1956<br />
begann Ulgor, ein genossenschaftliches Unternehmen<br />
mit 24 Beteiligten, damit, Petroleumöfen und<br />
Gasherde herzustellen. In den Folgejahren wurden<br />
auf Anregung und unter der Leitung des links-katholischen<br />
Priesters José María Arizmendiarrieta weitere<br />
Kooperativen gegründet. <strong>Die</strong>s wurde vor allem<br />
dadurch ermöglicht, dass es gelang, eine Bank-Kooperative,<br />
die Caja Laboral Popular, zu etablieren,<br />
welche den Mitgliedern der Kooperativen einerseits<br />
als Sparkasse, andererseits aber auch als Kreditgenossenschaft<br />
diente und das Finanzierungsproblem<br />
der Genossenschaften löste. <strong>Die</strong> Caja Laboral<br />
Popular war mit allen Genossenschaften verbunden<br />
und unterstützte diese als Kreditgeberin und<br />
durch Bereitstellung von <strong>Die</strong>nstleistungen. Heute<br />
weist Mondrágon eine Belegschaftsgröße von über<br />
70.000 Arbeiterinnen und Arbeitern in 150 Betrieben<br />
auf und ist in 65 Ländern tätig. Mondragón gliedert<br />
sich in die Bereiche Industrie, Vertrieb und<br />
Finanzen – allerdings nicht in Form einer hierarchischen<br />
Organisation, vielmehr bildet sich die Struktur
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
15<br />
gewissermaßen Bottom-up. <strong>Die</strong> einzelnen Kooperativen<br />
besitzen die Hoheitsgewalt und entsenden in die<br />
übergreifenden Organisationsebenen ihre Vertreter.<br />
Bedeutsam erscheint, dass die Kooperativen eine<br />
duale Verwaltungsstruktur entwickelt haben. Es<br />
werden – durch demokratische Wahlen – verschiedene<br />
Räte und Vorstände bestimmt, das Unternehmen<br />
verzichtet also auf die Entscheidungsfindung<br />
mittels direkter Demokratie. <strong>Die</strong> funktionale Differenzierung<br />
der Verwaltungsstrukturen erfolgt nach<br />
den Gesichtspunkten der Soziopolitik und der Technostruktur<br />
– wobei die Vertreter der technostrukturellen<br />
Gremien den soziopolitischen formal zwar<br />
untergeordnet sind, de facto jedoch eine weitgehende<br />
Autonomie besitzen. Überbetrieblich wird diese<br />
Verwaltungsstruktur ergänzt um Repräsentativräte,<br />
welche die einzelnen Kooperativen auf der überbetrieblichen<br />
Ebene vertreten. <strong>Die</strong>se Organe koordinieren<br />
die Aktivitäten der verschiedenen Kooperativen<br />
und versuchen für das gesamte Gebilde Synergien zu<br />
erzeugen. Daher stellt die Mondragón Corporatión<br />
Cooperativa nicht einfach eine Genossenschaft dar,<br />
sondern vielmehr eine Kooperativ-Marktwirtschaft<br />
– sie bildet die Infrastruktur für die Reproduktion<br />
und Erweiterung der Kooperativen. Mondragón-Kooperativen<br />
haben in der Vergangenheit in krisenhafte<br />
Prozesse geratene kapitalistische Unternehmen<br />
übernommen und den dort tätigen Belegschaftsmitgliedern<br />
geholfen, die Krise zu überstehen und<br />
die Betriebe in Genossenschaften zu verwandeln. 2<br />
Wenn in der Hochschullehre das Scheitern des<br />
illyrischen Experiments (jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung)<br />
transaktionskostentheoretisch<br />
erklärt wird und das genossenschaftliche Modell<br />
vorschnell als untauglich für die Koordination auf<br />
Meso- oder Makroebene angesehen wird, so ist dieses<br />
Urteil dahingehend zu relativieren, als im Baskenland<br />
eine große kooperative Wirtschaftsdemokratie<br />
seit nunmehr beinahe 70 Jahren erfolgreich praktiziert<br />
– der Fall könnte immerhin Anlass bieten, das<br />
Modell Wirtschaftsdemokratie erneut auf den Prüfstand<br />
zu stellen.<br />
2 So etwa dem Bushersteller Irizar, welcher allerdings, nach Überwindung der Krise, aus der Mondragón Corporatión austrat, um den nun erzielten Erfolg nicht<br />
mit den anderen Kooperativen teilen zu müssen.<br />
Aron, Raymond (1981): Über die Freiheiten. Stuttgart: DVA.<br />
Beck, Ulrich (1997): Kinder der Freiheit. Wider das Lamento über den Werteverfall. In: Beck, U. (Hrsg.): Kinder der Freiheit. 3. Aufl. Frankfurt<br />
a. M.: Suhrkamp, S. 9–33.<br />
Cloke, Kenneth; Goldsmith, Joan (2002): The End of Management and the Rise of Organizational Democracy. New York: Wiley.<br />
Cole, George Douglas Howard (1920): Guild-Socialism Re-Stated. London: Leonard Parsons.<br />
Dörre, Klaus (2015): Das demokratische Unternehmen – ein zukunftsträchtiges Leitbild? In: Sattelberger, Thomas; Welpe, Isabell; Boes, Andreas<br />
(Hrsg.) (2015): Das demokratische Unternehmen. Freiburg und München: Haufe, S. 77–94.<br />
Jarley, Paul; Fiorito, Jack; Delany, John T. (1997): A Structural Contingency Approach to Bureaucracy and Democracy in U.S. National Unions.<br />
In: Academy of Management Journal, 40 (August ), S. 831–61.<br />
Kieser, Alfred; Kubicek, Herbert (1992): Organisation, 3. Auflage, Berlin und New York: Walter de Gruyter.<br />
Klages, Helmut (2000): Engagement und Engagementpotential in Deutschland. Erkenntnisse der empirischen Forschung. In: Beck, Ulrich (Hg.):<br />
<strong>Die</strong> Zukunft von Arbeit und Demokratie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 151–170.<br />
Manville, Book; Ober, Josiah (2003): A company of Citizens. What the World‘s First Democracy Teaches Leaders About Creating Great Organizations.<br />
Boston, MA: Harvard Business School Press.<br />
Molitor, Andreas (2011): Griff in den Himmel. Der Kampf um die Mitbestimmung. In: Mittbestimmung, <strong>Heft</strong> 5/2011, S. 5–15.<br />
Müller-Jentsch, Walther (2010): Wirtschaftsdemokratie oder Soziale Marktwirtschaft mit erweitertem Zielsystem? In: Zeitschrift für Personalforschung.<br />
24/3, S. 307–311.<br />
Naphtali, Fritz (1929): Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, Weg und Ziel. Berlin: Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes<br />
GmbH.<br />
Polanyi, Karl (1978): The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Frankfurt<br />
a. M.: Suhrkamp.<br />
Putnam, R. D. (2000): Bowling Alone: Civic Disengagement in America. New York et al.: Simon & Schuster Paperback.<br />
Semler, Ricardo (1995): Das Semco-System. München: Heyne.<br />
Sattelberger, Thomas; Welpe, Isabell; Boes, Andreas (Hrsg.) (2015): Das demokratische Unternehmen. Freiburg und München: Haufe, S. 95–114.<br />
Wächter, Hartmut (2012): Möglichkeiten und Grenzen der Wirtschaftsdemokratie – der Fall Hoppmann. In: Zeitschrift für Personalforschung.<br />
24/1, S. 7–28. https://doi.org/10.1177/239700221002400102<br />
Weber, Max (1971): Gesammelte Politische Schriften. 3. Aufl. Tübingen: Mohr.<br />
Welpe, Isabell; Tumasjan, Andranik; Theurer, Christian (23015): Der Blick der Managementforschung. In: Sattelberger, Thomas; Welpe, Isabell;<br />
Boes, Andreas (Hrsg.) (2015): Das demokratische Unternehmen. Freiburg und München: Haufe.<br />
Wright, Eric Olin (2020): Reale Utopien. Wege aus dem Kapitalismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
16 LERNZIEL: DEMOKRATIE DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Demokratische Werte in der<br />
Hochschullehre erlebbar machen<br />
Das Lernziel Demokratie muss auch in der Hochschullehre der Sozialen Arbeit<br />
gesetzt werden. Forschungsergebnisse zeigen auf, wie weit neurechte Denk- und<br />
Handlungsweisen in der Sozialen Arbeit und unter Studierenden verbreitet sind.<br />
Von Lilija Willer-Wiebe, M. A.<br />
Foto: privat<br />
LILIJA WILLER-WIEBE, M. A.<br />
Development Studies<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin für<br />
Interkulturelle Öffnung<br />
willer-wiebe@cvjm-hochschule.de<br />
CVJM-<strong>Hochschule</strong> –<br />
University of Applied Sciences<br />
Im Druseltal 8<br />
34131 Kassel<br />
www.cvjm-hochschule.de<br />
„<strong>Die</strong> reflektierte<br />
Lernerfahrung des<br />
Selbsterlebens birgt<br />
die Chance, Empathie<br />
zu fördern und<br />
Ausgrenzungsmechanismen<br />
aufzudecken.“<br />
Das Klischee des Birkenstock tragenden<br />
Sozialarbeiters ist lange vorbei,<br />
aber auch die Annahme, alle Sozialarbeitenden<br />
seien weltoffen und demokratiefreundlich<br />
orientiert, ist dem Berufsbild<br />
nicht (mehr) inhärent. Längst ist<br />
bekannt, dass rechtes 1 Gedankengut<br />
auch unter Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen<br />
vertreten ist.<br />
Rechtes Gedankengut auch in<br />
der Sozialen Arbeit<br />
In einer 2019 erschienenen Studie,<br />
herausgegeben vom Forschungsinstitut<br />
für gesellschaftliche Weiterentwicklung,<br />
werden Versuche der Einflussnahme<br />
auf die Soziale Arbeit durch die <strong>Neue</strong>n<br />
Rechten in Nordrhein-Westfalen aufgezeigt<br />
(Gille, Jagusch 2019). <strong>Die</strong> Ergebnisse<br />
weisen drei unterschiedliche Varianten<br />
der Einflussnahme auf. Zum einen<br />
bieten <strong>Neue</strong> Rechte und extrem rechte<br />
Akteure und Akteurinnen eigene Angebote<br />
der Sozialen Arbeit an, zum anderen<br />
nehmen sie von extern Einfluss und zum<br />
Dritten, und für die hier gestellte Fragestellung<br />
am relevantesten, nehmen <strong>Neue</strong><br />
Rechte von intern Einfluss auf sozialarbeiterische<br />
Angebote (Gille, Jagusch 2019,<br />
S. 44). <strong>Die</strong>s zeigt sich in der Präsenz<br />
extrem rechter Akteure und Akteurinnen,<br />
in der Diskriminierung in der praktischen<br />
Arbeit und in einer veränderten<br />
Artikulation, die durch eine sprachliche<br />
Verschiebung nach rechts sichtbar<br />
wird. Darüber hinaus enthalten Diskussionen<br />
unter Sozialarbeitenden diskursive<br />
Orientierungen, die anschlussfähig<br />
an neurechte und rechtsextreme Diskurse<br />
sind, wie beispielsweise neosoziale<br />
Äußerungen und hegemoniale Normalitätsvorstellungen.<br />
Auch in der Alltagspraxis<br />
wird eine interne Einflussnahme<br />
der <strong>Neue</strong>n Rechten sichtbar (Gille, Jagusch<br />
2019, S. 79 ff.). Eine aufbauende Studie,<br />
durchgeführt in Mecklenburg-Vorpommern,<br />
schließt sich den oben genannten<br />
Erkenntnissen an (Gille et al. 2022).<br />
Seit 2007 (Bitzan, Scherr 2007) wird<br />
die Fragestellung nach dem Umgang mit<br />
(neu-)rechtem Gedankengut an <strong>Hochschule</strong>n<br />
in unterschiedlichen Aufsätzen<br />
diskutiert (Thiessen et al. 2020; Leidinger,<br />
Radvan 2019; Radvan, Schäuble<br />
2019) und erforscht (Besche 2022). Dass<br />
(neu-)rechtes Gedankengut auch unter<br />
den Studierenden der Sozialen Arbeit<br />
vertreten ist, verdeutlicht Besche (2022).<br />
Wenn auch keine neurechte Hegemonie<br />
ersichtlich ist, kann trotzdem die<br />
Präsenz neurechter und rechtsaffiner<br />
Studierender an <strong>Hochschule</strong>n festgehalten<br />
werden (Besche 2022, S. 262).<br />
Grundlagen des neurechten<br />
Gedankenguts – ein Erklärungsversuch<br />
Man sollte annehmen, neurechtes<br />
Gedankengut und das Studium einer<br />
Menschenrechtsprofession seien diametral.<br />
An dieser Stelle wird ein Blick auf<br />
das Menschenbild, welches dem rechten<br />
Gedankengut zugrunde liegt, geworfen,<br />
da das Verständnis über das Menschenbild<br />
meines Erachtens handlungsleitend<br />
für die Hochschullehre sein kann. <strong>Die</strong><br />
Grundlage eines rechten und demokratiefeindlichen<br />
Menschenbildes ist die<br />
Ungleichheit von Menschen, welche als<br />
Permalink:<br />
https://doi.org/10.5281/zenodo.10838041<br />
1 Unter den Oberbegriff „rechts“ fallen unterschiedliche Einstellungen, Denk- und Handlungsweisen und politische<br />
Ausrichtungen, für die Ungleichheit natürlich und normativ erstrebenswert ist und die an der Erhaltung oder Herstellung<br />
von Ungleichheitsverhältnissen interessiert sind (Biskamp 2021, S. 26).
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
17<br />
natürlich oder erstrebenswert gedeutet wird. Auf dieser<br />
Grundannahme fallen Othering-Prozesse leicht bzw.<br />
sind die logische Konsequenz. Mit Othering-Prozessen<br />
(deutsch „verandernde“ Ausgrenzungsmechanismen)<br />
ist die Legitimation gemeint, anhand derer „das Gegenüber<br />
zu dem Anderen“ gemacht wird, indem homogenisiert,<br />
dichotomisiert und essentialisiert wird (Attia<br />
2014, S. 9). Der oder die Andere ist nur noch der oder<br />
die Andere und nicht mehr der Mensch hinter dem<br />
Differenzierungsmerkmal. Es fehlt der emphatische<br />
Zugang zu dem oder der Anderen.<br />
Handlungsansätze innerhalb der Lehre<br />
der Sozialen Arbeit<br />
<strong>Die</strong> Enthüllungen der Correctiv-Recherche am 10. Januar<br />
<strong>2024</strong> über eine Gruppe Neurechter, die die Vertreibung<br />
vieler Deutscher planten (Bensmann et al. <strong>2024</strong>),<br />
hat zu deutschlandweiten Demonstrationen geführt.<br />
Was hat die Enthüllung bei den Menschen ausgelöst,<br />
dass diese jetzt motiviert sind, für die Demokratie auf<br />
die Straße zu gehen? Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit<br />
gab es bereits vor der Enthüllung.<br />
Der Unterschied liegt darin, dass die enthüllten Pläne<br />
greifbarer und „näher“ für die Menschen geworden<br />
sind. Es hat einen Lebensbezug bekommen und sie<br />
„erleben“ die Bedrohung durch Demokratiefeindlichkeit<br />
konkreter. Der Bezug und die Nähe zum eigenen Leben<br />
machen mögliche Konsequenzen erfahrbar. Genau hier<br />
sollten didaktische Strategien im Umgang mit rechten<br />
Denkweisen unter Studierenden ansetzen.<br />
Auch wenn der Umgang mit rechten Äußerungen im<br />
Lehrsaal unterschiedlich bewertet wird (Besche 2022,<br />
S. 260 f.) und die Wirkung der Lehre auf eine nachhaltige<br />
Einstellungsveränderung der Studierenden hinterfragt<br />
wird (Radvan, Schäuble 2019, S. 217; Besche<br />
2022, S. 262), ist man sich doch einig, dass Äußerungen<br />
von (neu-)rechtem Gedankengut im Lehrsaal<br />
thematisiert werden sollten (Radvan, Schäuble 2019,<br />
S. 221). Aus der Vielzahl möglicher Handlungsansätze<br />
soll hier einer von Schäuble und Radvan (2019) aufgegriffen<br />
werden. <strong>Die</strong> Autorinnen werfen die Frage nach<br />
didaktischen Strategien auf, die die Habitusformation<br />
beeinflussen können, und plädieren dazu, <strong>Hochschule</strong>n<br />
als „Orte der beruflichen Sozialisation“ zu konzipieren<br />
(Radvan, Schäuble 2019, S. 224).<br />
<strong>Die</strong>sem Ansatz möchte ich einen methodischen<br />
Vorschlag hinzufügen, der aus dem Verständnis für<br />
die Othering-Prozesse entsteht. Geothert zu werden<br />
ist eine Erfahrung, die nachempfunden werden kann<br />
und somit den Studierenden „nahbar“ wird. Im Rahmen<br />
von Serious Games als methodischen Lehreinheiten,<br />
wie beispielsweise das Planspiel oder Rollenspiel,<br />
kann das grundlegende Gefühl, welches durch Dichotomisierung,<br />
Essentialisierung und Homogenisierung<br />
entsteht, erzeugt werden. Didaktisch gut im Seminar/<br />
Modul eingebunden, werden Planspiele als erfolgreiche<br />
Methode der Hochschullehre angesehen (Eberle,<br />
Kriz 2017; Strohschneider 2010; Willer-Wiebe,<br />
Zimmermann 2023). <strong>Die</strong> Gefühle der Reduzierung<br />
auf ein Unterscheidungsmerkmal, die Zuschreibung,<br />
Aus- und Abgrenzung aufgrund eines Diversitätsmerkmals<br />
lassen sich erfahrungsgemäß eindrücklich erzeugen<br />
(Wiebe, Zimmermann 2020).<br />
Schluss<br />
Ein Nachweis über eine nachhaltige Habitusformation<br />
durch Methoden, die das Lernen anhand von Erleben<br />
fördern, kann an dieser Stelle nicht gegeben werden.<br />
<strong>Die</strong> reflektierte Lernerfahrung des Selbsterlebens birgt<br />
die Chance, Empathie zu fördern und Ausgrenzungsmechanismen<br />
aufzudecken. <strong>Die</strong> Integration und Aufarbeitung<br />
der Erfahrung im Rahmen der Lehre haben das<br />
Potenzial, Transformationsprozesse in rechtsaffinen<br />
Sozialarbeitsstudierenden anzustoßen.<br />
Attia, Iman: Rassismus (nicht) beim Namen nennen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) Nr. 13–14, Jg. 64, 2014, S. 8–14.<br />
Bensmann, Marcus; Daniels, Justus von; Dowideit, Anette; Peters, Jean; Keller, Gabriela: Geheimplan gegen Deutschland. Online verfügbar unter https:/<br />
correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/<strong>2024</strong>/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-afd-rechtsextreme-november-treffen/ – Abruf am 10.01.<strong>2024</strong>.<br />
Besche, Julia: Vielfältige Herausforderungen. Zu den Schwierigkeiten der Wahrnehmung rechtsaffiner und autoritärer Äußerungen bei Studierenden der<br />
Sozialen Arbeit. In: Sozial Extra Nr. 4, Jg. 46, 2022, S. 259–267.<br />
Biskamp, Floris: Extrem populistisch? Über die Kategorisierung von Rechtsaußenparteien und die Einordnung der AfD. In: Sehmer, Julian; Simon, Stephanie;<br />
ten Elsen, Jennifer; Thiele, Felix (Hrsg.): Recht Extrem? Dynamiken in Zivilgesellschaftlichen Räumen. Wiesbaden: Springer Fachmedien 2021, S. 21–37.<br />
Bitzan, Renate; Scherr, Albert: Rechtsextreme Studierende und JugendarbeiterInnen. Phantom oder Tabu? In: Sozial Extra Nr. 1/2, Jg. 31, 2007, S. 8–10.<br />
Eberle, Thomas; Kriz, Willy: Planspiele in der Hochschullehre und Hochschuldidaktik. In: Petrik, Andreas; Rappenglück, Stefan (Hrsg.): Handbuch Planspiele<br />
in der politischen Bildung. Schwalbach/Ts., Wochenschau Verlag, 2017, S. 155–168.<br />
Gille, Christoph; Jagusch, Birgit: <strong>Die</strong> <strong>Neue</strong> Rechte in der Sozialen Arbeit in NRW. Exemplarische Analysen. Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung<br />
e. V., 2019.<br />
Gille, Christoph; Krüger, Christine; Wéber, Júlia: Einflussnahmen der extremen Rechten. Herausforderung für die soziale Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Weinheim, Beltz Juventa, 2022.<br />
Leidinger, Christiane; Radvan, Heike: Rechtsextremismus und völkischer Autoritarismus an <strong>Hochschule</strong>n. In: Femina Politica - Zeitschrift für feministische<br />
Politikwissenschaft Nr. 1, Jg. 28, 2019, S. 142–147.<br />
Radvan, Heike; Schäuble, Barbara: Rechtsextrem orientierte und organisierte Studierende - Umgangsweisen in <strong>Hochschule</strong>n Sozialer Arbeit. In: Köttig, Michaela;<br />
Röh, <strong>Die</strong>ter (Hrsg.): Soziale Arbeit in der Demokratie – Demokratieförderung in der Sozialen Arbeit. Theoretische Analysen, gesellschaftliche Herausforderungen<br />
und Reflexionen zur Demokratieförderung und Partizipation. Opladen, Verlag Barbara Budrich, 2019, S. 216–236.<br />
Strohschneider, Stefan: Planspiele und Computersimulationen. In: Straub, Jürgen; Weidemann, Arne Nothnagel, Steffi (Hrsg.): Wie lehrt man interkulturelle<br />
Kompetenz? Theorien, Methoden und Praxis in der Hochschulausbildung. Ein Handbuch. Bielefeld, transcript Verlag, 2010, S. 241–255.<br />
Thiessen, Barbara; Schäuble, Barbara; Radvan, Heike; Ehlert, Gudrun: Verunsicherungen und Herausforderungen. Strategien im Umgang mit Rechtsextremismus<br />
und Antifeminismus in <strong>Hochschule</strong> und Profession. In: Sozial Extra Nr. 2, Jg. 44, 2020, S. 102–106.<br />
Wiebe, Lilija; Zimmermann, Germo: ANKOMMEN in einer Flüchtlingsunterkunft. Ein handlungsorientiertes Planspiel zur Entwicklung interkultureller<br />
Kompetenzen. In: e&l (erleben und lernen) – Internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen Nr. 6, Jg. 28, 2020, S. 24–27.<br />
Willer-Wiebe, Lilija; Zimmermann, Germo: Serious Games in der Hochschullehre: Das interkulturelle Planspiel „ANKOMMEN“. In: <strong>Die</strong> <strong>Neue</strong> <strong>Hochschule</strong><br />
6/2023, S. 20–21.
18 LERNZIEL: DEMOKRATIE DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Demokratieerziehung muss<br />
bei den Grundlagen ansetzen<br />
Demokratieerziehung ist nicht nur Wertevermittlung, sondern die bildungsstufengerechte<br />
Erschließung von Faktenwissen. Denn das Verständnis der<br />
Demokratie ist die Voraussetzung dafür, sich ihr zuwenden zu können.<br />
von Prof. Dr. rer. pol. Markus Karp<br />
Foto: Uwe Voelkner FOX<br />
PROF. DR. RER. POL. MARKUS KARP<br />
Staatssekretär a. D.<br />
Professor im Fachbereich Wirtschaft,<br />
Informatik und Recht an der Technischen<br />
<strong>Hochschule</strong> Wildau<br />
markus.karp@t-online.de<br />
Permalink:<br />
https://doi.org/10.5281/zenodo.10848079<br />
Wohin man auch blickt: Lokal wie global<br />
ist die Demokratie unter Druck. Autoritäre<br />
Regime strotzen vor Kraft und sind<br />
teils schon von der bloßen Drohung zum<br />
tatsächlichen militärischen Angriff übergegangen.<br />
Liberale Verfassungsordnungen<br />
werden von Populisten herausgefordert,<br />
gewachsene Institutionen und<br />
Bündnissysteme lahmgelegt oder infrage<br />
gestellt. <strong>Die</strong> Fortschreibung der demokratischen<br />
Gegenwart in eine unbestimmte<br />
Zukunft, eben noch ein geradezu natürliches<br />
Axiom im Denken der meisten,<br />
ist nicht sicher, denn der Flirt mit dem<br />
Autoritären verlockt viele, die des ewigen<br />
Aushandelns und Schließens vermeintlich<br />
kompromittierter Kompromisse überdrüssig<br />
sind. Dialog, Diskurs, Debatte, diese<br />
klassischen Instrumente gesellschaftlichen,<br />
politischen und wissenschaftlichen<br />
Fortschritts, werden oft eingefordert, aber<br />
noch öfter nicht gelebt. Stattdessen gibt es<br />
einen Drang zum manichäischen Denken<br />
und zur öffentlichen Provokation, die das<br />
eigene Profil schärft, aber keinen Raum<br />
mehr lässt für das Zulassen und Aushalten<br />
anderer Sichtweisen. Der Wunsch<br />
nach dem Bekennen und Zurschaustellen<br />
der eigenen Überzeugung übertönt alle<br />
Diskursethik, die doch dringend notwendig<br />
wäre, um die Erosion der demokratischen<br />
Gesellschaft aufzuhalten.<br />
<strong>Die</strong>se Megatrends westlicher Demokratie<br />
betreffen naturgemäß auch die <strong>Hochschule</strong>n<br />
als Knotenpunkte aller Bereiche<br />
moderner Gesellschaften. Ideenwettstreit<br />
und Erkenntnisehrgeiz werden überschattet<br />
vom Ringen darum, wer was sagen<br />
darf. Damit einher geht eine ritualisierte<br />
Auseinandersetzung um die Verteidigung<br />
oder bewusste Störung des Tabus, ohne<br />
dass es eine Rolle spielen würde, welcher<br />
diskursive Mehrwert aus der einen wie<br />
der anderen Handlung erwächst. Es steht<br />
die Selbstvergewisserung und Imprägnierung<br />
der eigenen Position gegen die Zumutung<br />
des abweichenden Arguments im<br />
Vordergrund. <strong>Die</strong>se Tendenzen einseitig<br />
einer Strömung und einem Lager zuzuweisen,<br />
führt in die Irre. <strong>Die</strong> Befähigung zum<br />
zumindest halbwegs höflichen Streit ist<br />
verkümmert, abgelöst vom digital befeuerten<br />
Aufbrausen mit Signalwirkung vor<br />
allem für die eigene Zelle der fragmentierten<br />
Öffentlichkeit.<br />
Angesichts dieses desolaten Bildes<br />
stellt sich die Frage, wie ein „Lernziel:<br />
Demokratie“ mit der Absicht, für Abhilfe<br />
zu sorgen, denn aussehen könnte.<br />
Dabei wäre es falsch, in die Nostalgiefalle<br />
zu tappen: Auch die vordigitale Demokratie<br />
war kein Oberseminar in Sachen<br />
Rhetorik und argumentativer Vernunft.<br />
Verkürzung, Zuspitzung, Unterstellung,<br />
Ausgrenzung, das Gefühl rasenden Stillstands<br />
– es wäre ein Ding der Unmöglichkeit,<br />
ein demokratisches System zu<br />
irgendeinem Zeitpunkt zu finden, dem<br />
diese Phänomene fremd wären. Damit<br />
alle Probleme zu relativieren, wäre indes<br />
ähnlich abwegig. In der Gesamtschau der<br />
vielen Untersuchungen zur Demokratiezufriedenheit<br />
zeigt sich unzweifelhaft<br />
mehrheitlich der Schluss, dass Vertrauen<br />
und Zustimmung zu dieser Staatsform<br />
abnehmen. Demokratie als Lernziel<br />
kann sich angesichts dessen aber<br />
nicht als Werbeveranstaltung verstehen,<br />
welches von der Vorschule bis zum<br />
Hörsaal die Vorzüge der Volkssouveränität<br />
preist. Das ist auch nicht nötig. Denn<br />
Unzufriedenheit und Fremdeln mit der<br />
Demokratie fußen auch darauf, dass der<br />
ubiquitär verwendete und oft genug zum<br />
inhaltsleeren Kampfbegriff geronnene<br />
Term oftmals unverstanden ist. So wird<br />
Demokratie zu einer abstrakten Chiffre<br />
des Positiven, alles negativ Aufgefasste<br />
hingegen als undemokratisch angesehen.<br />
Demokratisch ist in diesem Sinne<br />
kongruent mit dem eigenen Werturteil<br />
und Normempfinden. Das muss natürlich<br />
oft genug in Enttäuschung münden,<br />
zumal zu Prozessen und Institutionen
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
LERNZIEL: DEMOKRATIE<br />
19<br />
„Deshalb ist es bestürzend, dass ausgerechnet in einer Ära, in<br />
welcher Wissen zugänglich ist wie nie und die Hürden für den<br />
Zugang zu Bildungsinstitutionen niedriger sind als je zuvor,<br />
ausgerechnet das Allgemeinwissen und die Grundkenntnisse<br />
zur Demokratie, der real existierenden und nicht nur dem<br />
allgegenwärtigen Schlagwort, immer dünner werden.“<br />
häufig banalste Grundkenntnisse fehlen. Das führt<br />
dazu, dass das Warum einer demokratischen Entscheidung<br />
nicht verstanden wird. Den Institutionen wiederum,<br />
deren Bestehen die Voraussetzung des demokratischen<br />
Systems sind, wird mit weniger Respekt begegnet.<br />
<strong>Die</strong>s liegt darin begründet, dass ihre Legitimität durch<br />
das Verständnis ihrer Fundamente, also die Legitimationskette<br />
von der Wahlurne an, entsteht. Fehlt dieses<br />
Verständnis, werden die Institutionen der Demokratie zu<br />
bloßen Avataren politischer Stimmungen, anstatt deren<br />
regulierender Überbau zu sein. Politische Idolisierung<br />
und Zorn, die beiden Pole politischer Passion, übertragen<br />
sich dann auf Institutionen, die auf keine der politischen<br />
Konjunktur enthobene Ehrerbietung mehr zählen<br />
können und dementsprechend nur noch in dem Maß<br />
Popularität genießen wie die politische Kraft, welche<br />
gerade ihre Leitung innehat oder sie dominiert. <strong>Die</strong>se<br />
Differenzierung ist aber notwendige Bedingung für die<br />
Existenz der liberalen Demokratie, welche durch starke<br />
überparteiliche Institutionen die Leidenschaft volatiler<br />
Mehrheiten einhegt und auch für statische oder zeitweilige<br />
Minderheiten erträglich macht.<br />
Deshalb ist es bestürzend, dass ausgerechnet in einer<br />
Ära, in welcher Wissen zugänglich ist wie nie und die<br />
Hürden für den Zugang zu Bildungsinstitutionen niedriger<br />
sind als je zuvor, ausgerechnet das Allgemeinwissen<br />
und die Grundkenntnisse zur Demokratie, der<br />
real existierenden und nicht nur dem allgegenwärtigen<br />
Schlagwort, immer dünner werden. Dabei geht es<br />
nicht um elaborierte Demokratietheorien, fortgeschrittene<br />
Kenntnisse politikwissenschaftlicher Komparatistik<br />
oder eine vertiefte Beschäftigung mit Ideengeschichte.<br />
Zum Verständnis von Demokratie und der daraus<br />
resultierenden Fähigkeit zum konstruktiven Mitwirken<br />
am demokratischen Aushandlungsprozess würde<br />
wesentlich grundlegenderes Wissen genügen. Den<br />
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte EGMR<br />
von EuGH unterscheiden zu können, wäre da schon<br />
die Kür, könnte aber beispielsweise dazu führen, dass<br />
nicht jeder Unmut über ein Urteil beim Feindbild EU<br />
verortet werden würde. Aber bereits einfachere Kenntnisse,<br />
so zum Beispiel, welche bundesrepublikanische<br />
Institution welcher Gewalt zuzuordnen ist, können nicht<br />
immer als selbstverständlich vorausgesetzt werden.<br />
Damit einhergehend verfällt jedoch die Möglichkeit,<br />
Entscheidungen zuzurechnen, was wiederum Demokratieverdrossenheit<br />
begünstigt.<br />
Im Idealfall muss ein „Lernziel Demokratie“ dazu<br />
auch noch eine Debattenkultur im besten Habermasschen<br />
Sinne vermitteln. Sinnvolle Ziele sind aber nach<br />
Drucker immer SMARTe, 1 mithin auch realistische Ziele.<br />
<strong>Die</strong> Bildungseinrichtungen vermögen es nicht, sich im<br />
Alleingang gegen die Kalamitäten unserer Epoche zu<br />
stemmen. <strong>Die</strong> Folgen der Social-Mediatisierung unserer<br />
Debattenkultur, der Vielzersplitterung und Tribalisierung<br />
als Kehrseite von mehr Individualisierung und<br />
der Auflösung traditioneller Großmilieus aufzuhalten,<br />
werden Schulen und <strong>Hochschule</strong>n nicht leisten können,<br />
da sie letztlich auch immer Spiegel ihrer Umwelt sind.<br />
Was sie aber für das „Lernziel: Demokratie“ leisten<br />
können, ist klar: Es geht um basales Faktenwissen.<br />
Verhältniswahlrecht, Föderalismus, Bündnissysteme,<br />
später die wichtigsten Artikel des Grundgesetzes, der<br />
Europäischen Verträge – so etwas. Ein Überblick über<br />
die US-Verfassung könnte grassierenden Antiamerikanismus<br />
und wuchernde Klischees eindämmen helfen.<br />
Vieles davon ließe sich zwar ohne Weiteres autodidaktisch<br />
erschließen. Offenkundig aber konkurriert Faktenwissen<br />
online oftmals erfolglos mit Vereinfachung und<br />
Verschwörungstheorien. Simples, aber grundsolides<br />
Wissen über die Funktionsweisen, Prinzipien und Institutionen<br />
der Demokratie ist gewiss keine Gewähr für<br />
eine demokratische Gesinnung. Aber so, wie die Alphabetisierung<br />
Voraussetzung, wenn auch nicht Garantie<br />
für das Verstehen eines Buches ist, braucht es das<br />
Verständnis der Demokratie, um an ihr überhaupt teilhaben<br />
zu können und bestenfalls auch noch zu wollen.<br />
Demokratieerziehung ist essenziell für die Persönlichkeitsentwicklung.<br />
Wenn dieses „Lernziel: Demokratie“ über die gesamte<br />
Bildungslaufbahn hinweg angemessene und gebührende<br />
Berücksichtigung erfährt, können die <strong>Hochschule</strong>n<br />
ihrer Rolle als Foren und Taktgeber unserer<br />
Demokratie, insbesondere über den sehr beschränkten<br />
Horizont der Tagespolitik hinaus, umso besser gerecht<br />
werden.<br />
1 People and Performance : The Best of Peter Drucker on Management. 1977. New York NY: Harper’s College Press.
20 BERICHTE AUS DEM hlb DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Landessprache in der Lehre<br />
Das Thema Sprache der Lehre regt lebhafte Debatte an<br />
<strong>Die</strong> Positionierung des hlb zu Sprachenpolitik<br />
an <strong>Hochschule</strong>n ist ein Ergebnis<br />
einer fünfjährigen Arbeit der Arbeitsgruppe<br />
„Sprache der Lehre“ im ständigen<br />
Austausch mit dem Bundespräsidium.<br />
Der Entstehung des Dokuments sind<br />
mehrere einschlägige Veröffentlichungen<br />
in dieser Zeitschrift zur Sprachenpolitik<br />
1 vorausgegangen. <strong>Die</strong> Rückmeldungen<br />
darauf machten den Bedarf an<br />
Analyse und Austausch darüber deutlich.<br />
Nach wiederholter Thematisierung<br />
wurden auf Beschluss des Bundespräsidiums<br />
die Mitglieder in der DNH 3/2018<br />
zur Beteiligung an einer neuen Arbeitsgruppe<br />
„Sprache der Lehre“ aufgerufen.<br />
Der Zuspruch und die Beteiligung waren<br />
sehr gut. Bereits im Mai 2019 kam die<br />
Arbeitsgruppe überein, die verschiedenen<br />
Aspekte des Themas in einem Entwurf für<br />
ein Positionspapier zusammenzufassen.<br />
<strong>Die</strong>ses Papier wurde nach eingehenden<br />
Beratungen und Überarbeitungen am 13.<br />
Dezember 2019 zunächst als Diskussionspapier<br />
mit dem Titel „<strong>Die</strong> Bedeutung<br />
der Landessprache in der Lehre“ als<br />
Gesprächsangebot veröffentlicht, um zu<br />
einer noch breiteren Diskussion im hlb<br />
anzuregen. Das aktuelle Positionspapier<br />
ist vom hlb-Bundespräsidium in seiner<br />
Sitzung am 15. Dezember 2023 schließlich<br />
einstimmig verabschiedet worden.<br />
Da das Thema sehr vielschichtig ist<br />
und „uns alle angeht“, wurde seitens<br />
mehrerer hlb-Mitglieder vorgeschlagen,<br />
in den Landesverbänden Gesprächsrunden<br />
zum Diskussionspapier im Format<br />
von Workshops durchzuführen. <strong>Die</strong>se<br />
Anregung hat die Arbeitsgruppe gern<br />
aufgenommen. Den Auftakt hat der<br />
Landesverband Nordrhein-Westfalen<br />
gemacht; mehrere weitere Landesverbände<br />
haben das Format anschließend<br />
aufgegriffen. In diesem Prozess erreichten<br />
uns gleichermaßen Anfragen nach<br />
Diskussionsrunden zur Sprachenpolitik<br />
von Universitäten, Bildungsinstitutionen<br />
und Bildungspolitikern. In der<br />
Presse wurde das Thema ebenso aufgenommen,<br />
z. B. von der Deutschen Universitätszeitung<br />
DUZ, die das <strong>Heft</strong> 10/2020<br />
dem Thema „Wert der Sprache“ gewidmet<br />
hat, und von der Zeitschrift Begegnungen<br />
3/2020.<br />
<strong>Die</strong> Diskussionen waren für uns in<br />
jeder Hinsicht bereichernd und anregend.<br />
In den Erfahrungsberichten von Kolleginnen<br />
und Kollegen kamen wiederholt Problematik<br />
und Konsequenzen der Lehre auf<br />
Englisch zur Sprache, z. B.<br />
– unfreiwillige Einschnitte in der Qualität<br />
der Lehre (langsamer, weniger,<br />
vereinfachend), Absenkung der Prüfungsanforderungen<br />
und Rückgang<br />
des diskursiven Lernens zugunsten<br />
des Frontalunterrichts;<br />
– Erfolglosigkeit bei der Suche nach<br />
Praktikumsplätzen für ausländische<br />
Studierende englischsprachiger<br />
Studiengänge wegen Sprachdefiziten<br />
im Deutschen;<br />
– das Sinken von Schreibkompetenz<br />
und mündlichem Ausdrucksvermögen<br />
im Deutschen bei den deutschsprachigen<br />
Studierenden und Verstärkung<br />
dieser Entwicklung durch<br />
Austausch der Lehrsprache,<br />
– unkritische Gleichsetzung von<br />
Internationalisierung mit Anglophonisierung.<br />
Mehrere positive Beispiele im Umgang<br />
mit Mehrsprachigkeit in der Lehre deuten<br />
darauf hin, dass das Thema längst in der<br />
Praxis angekommen ist. Einige <strong>Hochschule</strong>n<br />
berichteten über Erfahrung z.<br />
B. mit parallel laufenden, identischen<br />
Studiengängen in Deutsch und Englisch,<br />
englischsprachigen Modulen in einem<br />
deutschsprachigen Studiengang, Sprachbegleitung<br />
seitens Sprachenzentren für<br />
ein fremdsprachiges Lehrangebot. <strong>Die</strong>se<br />
Best-Practice-Beispiele wurden im Positionspapier<br />
unter Einbeziehung von Fachliteratur<br />
entsprechend abgebildet und als<br />
Empfehlungen formuliert.<br />
Ein wiederkehrendes Thema waren<br />
die komplett englischsprachigen Studiengänge,<br />
die als „praktische Notwendigkeit“<br />
gesehen werden, um die Gefahr der<br />
Schließung von schrumpfenden Hochschulstandorten<br />
in peripheren Regionen<br />
abzuwenden. In den Diskussionen wurde<br />
aber auch angeregt, an anderen, nachhaltigeren<br />
Lösungen der strukturpolitischen<br />
Probleme zu arbeiten, als die Landessprache<br />
zu ersetzen, um vor allem die Chancen<br />
auf Integration von bleibewilligen<br />
Studierenden in den deutschen Arbeitsmarkt<br />
zu erhöhen. Als Professorinnen<br />
und Professoren an den <strong>Hochschule</strong>n für<br />
angewandte Wissenschaften tragen wir<br />
nicht zuletzt auch eine Mitverantwortung<br />
für die arbeitsmarktliche und gesellschaftliche<br />
Integrationsfähigkeit unserer<br />
Absolventinnen und Absolventen.<br />
<strong>Die</strong>se erfolgt auch über die Landessprache.<br />
Gerade die internationalen Studierenden,<br />
die zu uns kommen, um später<br />
als dringend benötigte Fachkräfte langfristig<br />
zu bleiben, benötigen dafür auch<br />
gute Sprachkenntnisse im Deutschen. Für<br />
zukunftsweisende Internationalisierung<br />
ist deshalb die Anzahl englischsprachiger<br />
Studiengänge, ausländischer Studierender<br />
und Mitarbeitenden kein geeigneter<br />
Parameter, wird aber stets als budgetrelevanter<br />
Indikator für die Hochschulfinanzierung<br />
herangezogen.<br />
Das geschilderte breite Echo auf die<br />
hlb-Initiative, die Tendenzen in der Sprachenpolitik<br />
im Hochschulbereich kritisch<br />
zu reflektieren, bestätigt die Aktualität<br />
des Themenkomplexes. Das vorgelegte<br />
Positionspapier soll dabei unterstützen,<br />
die wichtigen Diskussionen über Internationalisierung<br />
und EMI in den <strong>Hochschule</strong>n<br />
zu bereichern, das Thema zu<br />
entideologisieren und zu versachlichen,<br />
positive Erfahrungen zu beleuchten und<br />
Argumente bei den Entscheidungen über<br />
die Sprache der Lehre abzuwägen. Wir<br />
stellen erfreut fest, dass es bereits sehr<br />
viele Kolleginnen und Kollegen in dieser<br />
Weise nutzen.<br />
Zum Positionspapier:<br />
https://www.hlb.de/fileadmin/<br />
hlb-global/downloads/Positionen/<strong>2024</strong>-01-26_Positionspapier_hlb_Bund_-_Landessprache_<br />
in_der_Lehre.pdf<br />
Olga Rösch<br />
1 Internationalisierung der <strong>Hochschule</strong> – was sind unsere Ziele? (2015) https://www.hlb.de/fileadmin/hlb-global/downloads/dnh/full/DNH_2015-1.pdf; Studiengänge nur auf<br />
Englisch – Zeichen der Internationalität oder ideologische Nebelkerze? (2017) https://www.hlb.de/fileadmin/hlb-global/downloads/dnh/full/2017/DNH_2017-6.pdf; Zum<br />
Diskurs über die Sprache in der Wissenschaftskommunikation (2018) https://www.yumpu.com/de/document/read/61749220/die-neue-hochschule-heft-4-2018; <strong>Die</strong> Landessprache<br />
in der Lehre – welche Bedeutung kommt ihr bei der Internationalisierung zu? (2019), https://www.hlb.de/fileadmin/hlb-global/downloads/dnh/full/2019/DNH_2019-6.pdf;<br />
Warum gute Lehre Landessprache braucht (2021) https://www.hlb-nrw.de/fileadmin/hlb-nrw/downloads/hlbNRW-Newsletter/211129_hlb-NRW_Infobrief_2021-12_screen.pdf
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
BERICHTE AUS DEM hlb<br />
21<br />
Eigenständiges Promotionsrecht für HAW<br />
Hälfte der Bundesländer bereits aktiv<br />
Das Promotionsrecht an <strong>Hochschule</strong>n<br />
für angewandte Wissenschaften stärkt<br />
die anwendungsorientierte Forschung<br />
und erhöht die Chancengleichheit ihrer<br />
Absolventinnen und Absolventen.<br />
Nachdem sich kooperative Promotionsverfahren<br />
an HAW in einer langjährigen<br />
Versuchsphase als wenig erfolgreich herausgestellt<br />
hatten, ermöglichen inzwischen acht<br />
Bundesländer das eigenständige Promotionsrecht<br />
für HAW durch entsprechende Regelungen<br />
im jeweiligen Hochschulgesetz. Vor<br />
dem Hintergrund der mittlerweile erreichten<br />
Forschungsstärke der <strong>Hochschule</strong>n für angewandte<br />
Wissenschaften ist eine Ausdehnung<br />
des Promotionsrechts auf diese vergleichsweise<br />
junge Hochschulform eine folgerichtige,<br />
schlüssige und zugleich notwendige<br />
Entwicklung. Der hlb gab 2010 den ersten<br />
Anstoß für die Einführung des eigenständigen<br />
Promotionsrechts für HAW, nachdem<br />
der Wissenschaftsrat ein Jahr zuvor Kriterien<br />
für die Vergabe des Promotionsrechts an<br />
nicht staatliche <strong>Hochschule</strong>n vorgelegt hatte.<br />
Darin wurde deutlich, dass auch HAW, die<br />
diese Kriterien erfüllen, nicht länger vom<br />
Promotionsrecht ausgeschlossen werden<br />
dürfen. Bereits 2013 kündigte die Wissenschaftsministerin<br />
in Schleswig-Holstein<br />
öffentlich die Vergabe des Promotionsrechts<br />
für HAW in ihrem Bundesland an.<br />
2014 fand das eigenständige Promotionsrecht<br />
im Zuge eines Novellierungsverfahrens<br />
dann in Baden-Württemberg erstmals<br />
Eingang in ein Landeshochschulgesetz. Der<br />
hlb hatte 2010 eine Entwicklung angestoßen,<br />
der sich – verstärkt von weiteren Akteuren<br />
aus dem HAW-Bereich – weitere Bundesländer<br />
anschlossen. Mittlerweile haben<br />
mit Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,<br />
Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen,<br />
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein<br />
acht Bundesländer Regelungen für die Verleihung<br />
des Promotionsrechts an HAW oder an<br />
Hochschulverbünde in die jeweiligen Landeshochschulgesetze<br />
aufgenommen.<br />
Im letzten Jahr ist der Prozess der Umsetzung<br />
des eigenständigen Promotionsrechts<br />
für HAW erneut vorangekommen. So trat<br />
zu Jahresbeginn das neue Hochschulgesetz<br />
in Bayern in Kraft mit einer Regelung,<br />
forschungsstarken Einrichtungen das eigenständige<br />
Promotionsrecht befristet zu verleihen.<br />
Elf Promotionszentren an 13 <strong>Hochschule</strong>n<br />
erfüllen die hohen Anforderungen<br />
an die Forschungsstärke von mindestens<br />
zwölf Professorinnen und Professoren pro<br />
Zentrum. Sie erhielten im letzten Jahr das<br />
Promotionsrecht. In Bremen wurde die<br />
noch ausstehende Rechtsverordnung für<br />
das Promotionsrecht erarbeitet und trat am<br />
1. Februar <strong>2024</strong> in Kraft. An diesem Prozess<br />
war der hlb Bremen aktiv beteiligt. In Berlin<br />
steht eine solche Rechtsverordnung hingegen<br />
seit dem 2021 erfolgten Beschluss zur<br />
Einführung des Promotionsrechts für HAW<br />
aus. Es bleibt zu hoffen, dass die zuständige<br />
Behörde nach dem Beispiel etlicher<br />
vorliegender Rechtsverordnungen in anderen<br />
Bundesländern bald zu einem Ergebnis<br />
kommt. In Schleswig-Holstein konnte<br />
– nach ersten positiven Zeichen aus der Politik<br />
vor mittlerweile elf Jahren – bis Anfang<br />
<strong>2024</strong> noch kein Promotionsverfahren an den<br />
HAW begonnen werden. Zunächst unterlag<br />
der Aufbau, später der Arbeitsbeginn<br />
des gemeinsamen Promotionskollegs von<br />
Universitäten und HAW immer neuen Verzögerungen.<br />
Das Modell eines gemeinsamen<br />
Promotionskollegs von Universitäten und<br />
HAW legt damit deutliche Nachteile gegenüber<br />
dem Modell aus Hessen und Sachsen-Anhalt<br />
offen.<br />
Ernst zu nehmende Absichtserklärungen<br />
zum Promotionsrecht für die HAW<br />
liegen uns aus Rheinland-Pfalz und<br />
Hamburg vor. Dort haben die zuständigen<br />
Behörden via Pressemeldungen die<br />
Einführung des Promotionsrechts für HAW<br />
angekündigt. In Rheinland-Pfalz plant die<br />
Wissenschaftsministerin erfreulicherweise<br />
die Umsetzung des Best-Practice-Modells<br />
nach dem Vorbild von Hessen und Sachsen-Anhalt.<br />
In Hamburg gibt es aufgrund<br />
der Situation nur einer staatlichen HAW<br />
im Stadtstaat die Besonderheit, dass die<br />
Promotionsverfahren in einer hochschulzentralen<br />
Organisationseinheit gebündelt<br />
werden. Der Wissenschaftsrat bestätigte im<br />
Oktober 2023 die hohe Qualität des Promotionsgeschehens<br />
an der HAW Hamburg<br />
und empfahl ein fachrichtungsgebundenes<br />
Promotionsrecht. <strong>Die</strong> Wissenschaftssenatorin<br />
kündigte daraufhin auch hier an, das<br />
Promotionsrecht für die Research School<br />
der HAW Hamburg einführen zu wollen.<br />
In Sachsen kam diese ansonsten positive<br />
Entwicklung ins Stocken. Obwohl die<br />
Planungen im Koalitionsvertrag berechtigte<br />
Hoffnung geweckt hatten, verfehlte<br />
das am 31. Mai beschlossene Hochschulgesetz<br />
das eigenständige Promotionsrecht<br />
für HAW. Karla Neschke<br />
Foto: hlb_Barbara Frommann<br />
hlb-Kolumne<br />
Englischsprachige<br />
Studiengänge zur<br />
Rettung bedrohter<br />
Studienstandorte?<br />
Olga Rösch<br />
Im Rahmen der Vorbereitung unseres<br />
Positionspapiers „<strong>Die</strong> Bedeutung der<br />
Landessprache in der Lehre“ gab es<br />
wiederholt Hinweise, dass an manchen<br />
Studienstandorten rückläufige Einschreibezahlen<br />
zu existenzbedrohenden Budgetproblemen<br />
führen. <strong>Die</strong>s zwinge praktisch<br />
zur Umstellung auf English-Medium Instruction<br />
(EMI), die das globale Potenzial<br />
an nicht deutschsprachigen Studienbewerbern<br />
und ihr Interesse an gebührenfreien,<br />
international anerkannten Studiengängen<br />
anzapft.<br />
<strong>Die</strong>ser Aspekt des Themas ist für den<br />
hlb durchaus diskussionswürdig. <strong>Die</strong> kurzfristige<br />
Lösung des Budgetproblems liegt<br />
zwar auf der Hand. Längerfristig ergeben<br />
sich jedoch schwierige Fragen: Wie können<br />
Quantität und Qualität der Wissensvermittlung<br />
und eine noch akzeptable Abbrecherquote<br />
sichergestellt werden? Können<br />
und wollen die Absolventinnen und Absolventen<br />
ohne deutsche Sprachkenntnisse in<br />
Arbeitsmarkt und Gesellschaft integriert<br />
werden und erfolgreich sein? Davon hängt<br />
letztlich die volkswirtschaftliche Rendite<br />
der EMI-Studienangebote ab.<br />
Nachhaltigere Möglichkeiten, mit<br />
Rückgängen der Bewerberzahlen umzugehen,<br />
um strukturpolitische Ziele in<br />
Verbindung mit dem Wunsch betroffener<br />
<strong>Hochschule</strong>n nach Selbsterhalt zu<br />
realisieren, könnten sein: Frei werdende<br />
Lehrkapazitäten für den Einstig in die<br />
Reduktion des Lehrdeputats auf 12 SWS<br />
verwenden, die der hlb seit Jahren fordert.<br />
So könnten wir Sprachbildung viel stärker<br />
als bisher berücksichtigen sowie mehr<br />
Zeit und Raum für Forschung bekommen,<br />
was die Attraktivität eines Hochschulstandortes<br />
sowohl für die Studierenden,<br />
Promovierenden und für die regionale<br />
Wirtschaft steigern kann.<br />
Ihre Olga Rösch<br />
hlb-Vizepräsidentin
22 FACHBEITRÄGE DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Gut eingepreist? Zum Stand und zur Perspektive<br />
der Lehrpreisvergabe an HAW<br />
Lehrpreise gibt es mittlerweile an fast allen <strong>Hochschule</strong>n für angewandte<br />
Wissenschaften in Deutschland. <strong>Die</strong> Anerkennungskultur ist hoch; allerdings<br />
fehlen Überblicke und Studien zur Wirkung.<br />
Von Dr. Peter-Georg Albrecht, Prof. Dr. Susanne Borkowski und Lisa König<br />
In Deutschland gibt es rund 211 <strong>Hochschule</strong>n der<br />
angewandten Wissenschaften (HAW) und 108 Universitäten.<br />
1 An über 30 HAW und über 65 Universitäten<br />
sowie elf Fakultäten von Universitäten werden Lehrpreise<br />
verliehen, auch wenn darüber nur ältere Zahlen<br />
vorliegen (Stifterverband 2015). <strong>Die</strong> Zahl der Lehrpreise<br />
hat zugenommen: 2010 wurden sieben HAW-Preise<br />
gezählt. Daneben gab es 25 Lehrpreise an Universitäten<br />
und vier an Fakultäten von Universitäten: für<br />
Rechtswissenschaft an der FU Berlin, Maschinenbau<br />
an der Universität Paderborn, Medizin an der Universität<br />
Würzburg und an der Medizinischen <strong>Hochschule</strong><br />
Hannover (Jorzik 2010, S. 127–140). 2015 waren<br />
es dann schon deutlich mehr (Stifterverband 2015).<br />
Heute dürfte die Zahl noch deutlich höher sein. Zu den<br />
Lehrpreisen der <strong>Hochschule</strong>n traten Landes- sowie<br />
Bundespreise hinzu: 2010 waren sieben Landes- und<br />
ein Bundespreis bekannt (Jorzik 2010). Derzeit gibt<br />
es zehn Landes- und zehn Bundespreise (Stifterverband<br />
2015) – oder auch mehr.<br />
Lehrpreise sollen die vielfach vorhandenen<br />
Forschungspreise ergänzen – bis hin zum berühmten<br />
Nobelpreis (Tremp 2010, S. 21–23). Ihr Anliegen<br />
ist es, die Lehre als hochschulischen Leistungsbereich<br />
von HAW und Universitäten aufzuwerten<br />
(Wissenschaftsrat 2017). Deshalb engagieren sich<br />
mittlerweile auch einige Stiftungen in der Lehrpreisvergabe<br />
(z. B. der Stifterverband 2 ). <strong>Die</strong> Preisvergabe<br />
erfolgt in der Regel jährlich. <strong>Die</strong> Preishöhe von HAWbzw.<br />
Universitätspreisen variiert zwischen 1.000<br />
und 5.000 Euro (Stifterverband 2015). <strong>Die</strong> <strong>Hochschule</strong><br />
Magdeburg-Stendal vergibt seit zwölf Jahren<br />
Lehrpreise und arbeitet an der Weiterentwicklung<br />
ihrer Lehrpreisvergabe. Sie ist auf der Suche nach<br />
Verankerung ihres Verfahrens in die hochschuleigene<br />
Qualitätsentwicklung von Studium und Lehre<br />
und in die Personalentwicklung. <strong>Die</strong> Autorinnen<br />
und der Autor haben sich deshalb mit der Thematik<br />
befasst und ausgewählte Lehrpreisordnungen<br />
und -richtlinien, Qualitätsmanagementverfahren<br />
mit Prozessmodellen, Akkreditierungssatzungen<br />
und Personalentwicklungskonzepte an verschiedenen<br />
HAW und Universitäten untersucht.<br />
Verständnis und Anliegen von Lehrpreisvergaben<br />
Lehrpreise dienen vor allem der Anerkennung hervorragender<br />
Lehre. Erwartet wird allerdings auch eine<br />
Anreizsetzung für die stetige Verbesserung der Lehre<br />
(BMBF 2010a und 2010b). Lehrpreise sollen die bis<br />
2010 wenig in den Blick genommene akademische<br />
Lehre aufwerten und hochschuldidaktisch sowie studiengangsentwickelnd<br />
verbessern helfen. Lehrpreise<br />
sind stärker Prämien für vergangene Lehrveranstaltungen<br />
als investive Aufschläge für kommende<br />
Lehr- bzw. Lehrorganisationstätigkeiten bis hin zur<br />
Studiengangsleitung (oder für die – akkreditierungsrelevante<br />
– Lehrqualitätsentwicklung). Im Mittelpunkt<br />
steht die Lehrqualität in all ihren Facetten (Wissenschaftsrat<br />
2008). Zielgruppe sind alle Lehrenden;<br />
prämiert werden aber zumeist Professorinnen und<br />
Professoren. Lehrkräfte für besondere Aufgaben (an<br />
den HAW) und Dozentinnen und Dozenten (an den<br />
Universitäten) sowie externe Lehrbeauftragte oder<br />
mitlehrende Studierende (Tutorinnen und Tutoren)<br />
werden deutlich seltener ausgezeichnet (wie es z. B.<br />
an der <strong>Hochschule</strong> Merseburg geschieht).<br />
Ähnlichkeiten und Unterschiede<br />
Es gibt deutliche Unterschiede zwischen Hochschultypen<br />
und Hochschul- bzw. Fakultätspreisen: Universitäre<br />
Lehrpreise gab es zuerst an Fakultäten, von<br />
denen die Universitäten (und ihre jeweiligen Bundesländer)<br />
einen besonderen Output erwarten: im Lehramt,<br />
in der Medizin, in den MINT-Fächern. An den<br />
Universitäten markiert die Installation von Lehrpreisen<br />
(ob an einzelnen Fakultäten oder der gesamten<br />
1 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/<strong>Hochschule</strong>n/Tabellen/hochschulen-hochschularten.html?nn=209416<br />
– Abruf am 21.02.<strong>2024</strong>.<br />
2 https://www.stifterverband.org/ars-legendi-preis – Abruf am 21.02.<strong>2024</strong>.
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
FACHBEITRÄGE<br />
23<br />
„Lehrpreise sind stärker Prämien für<br />
vergangene Lehrveranstaltungen als<br />
investive Aufschläge für kommende Lehrbzw.<br />
Lehrorganisationstätigkeiten.“<br />
Foto: <strong>Hochschule</strong> Madgeburg-<br />
Stendal<br />
DR. PETER-GEORG ALBRECHT<br />
Referent im Prorektorat<br />
peter-georg.albrecht@h2.de<br />
Universität) eine deutlich wahrnehmbare<br />
Aufwertung der Lehre.<br />
HAW haben Lehrpreise etwas später<br />
und gleich als „Gesamtpreise“ eingeführt.<br />
Sie dienen – aus Sicht der <strong>Hochschule</strong>n<br />
– der Anerkennung der Lehrtätigkeit<br />
und des damit verbundenen<br />
hohen Lehrdeputats (bei fehlendem<br />
Mittelbau). Spezifische staatliche HAW<br />
(so Verwaltungshochschulen wie die<br />
<strong>Hochschule</strong> für Polizei und öffentliche<br />
Verwaltung Nordrhein-Westfalen<br />
(HSPV NRW)) wollen mit der Vergabe<br />
von Lehrpreisen ihre Lehre verbessern,<br />
Studienabbrüche verringern, vor<br />
allem aber im Wettbewerb um Studierende<br />
attraktiver für Studienbewerber<br />
werden. Gleiches gilt für gemeinnützige<br />
(z. B. kirchliche) und private<br />
(gewerbliche) <strong>Hochschule</strong>n, bei denen<br />
aber das Interesse mitschwingt, ihre<br />
Lehrenden stärker in ihr Profil bzw. ihre<br />
Organisationsstruktur einzubinden (bis<br />
hin zum Bekenntnis zum Leitbild der<br />
entsprechenden <strong>Hochschule</strong> oder einer<br />
Einbindung ins Total Quality Management).<br />
Bei den öffentlichen HAW gibt<br />
es ähnliche Intentionen, hier wird sich<br />
aber vorrangig an der grundsätzlichen<br />
Freiheit von Forschung und Lehre<br />
orientiert. Organisatorisch muss also<br />
zwischen HAW- bzw. Universitätslehrpreisen<br />
und Fachbereichs- bzw. Fakultätslehrpreisen<br />
unterschieden werden.<br />
Während Erstere von den Hochschulleitungen<br />
bzw. der Präsidentin/dem Präsidenten<br />
oder der Rektorin/dem Rektor<br />
vergeben werden, erhalten die Lehrenden<br />
bei Letzteren den Preis von ihren<br />
Dekanaten. Daneben gibt es – insbesondere<br />
an Universitäten – Lehrpreise der<br />
studentischen Fachschaften.<br />
Rechtlicher und organisatorischer<br />
Rahmen<br />
Lehrpreisverfahren werden – im<br />
Rahmen der Hochschulautonomie und<br />
ihrer Satzungsbefähigung als Körperschaften<br />
des öffentlichen Rechts –<br />
zunehmend reguliert. Lehrpreise gelten<br />
hochschulrechtlich – wenn sie in den<br />
zumeist älteren „Prämienordnungen“<br />
schon erwähnt sind – als zusätzliche<br />
einmalige Leistungsbezüge. Es gibt Lehrpreisordnungen,<br />
aber auch Prozessmodelle,<br />
implizite und explizite Erwähnung<br />
und Einbeziehung von Lehrpreisen in<br />
Qualitätssatzungen der Programm- und<br />
Systemakkreditierung der Studiengänge<br />
bzw. in den Personalentwicklungsund/oder<br />
Professorengewinnungskonzepten<br />
der HAW. Lehrpreise stehen als<br />
Anerkennungs- und Reputationssteigerungsinstrument<br />
für sich selbst (Pasternack<br />
2010). Sie könnten aber auch Teil<br />
der leistungsorientierten Mittelvergabe<br />
bzw. der Zielvereinbarungen mit Fachbereichen<br />
(Organisationsentwicklung)<br />
sein – oder gar in Zielvereinbarungen<br />
der Rektorinnen, Rektoren, Präsidentinnen<br />
oder Präsidenten mit einzelnen<br />
Professorinnen und Professoren Erwähnung<br />
finden. Immer häufiger finden sich<br />
an HAW Lehrpreisordnungen; einige<br />
sind mit Prozessmodellen zum Verfahren<br />
hinterlegt. Eine Integration in Studiengangsentwicklungsprozesse<br />
(im<br />
Rahmen der Programm- bzw. Systemakkreditierung)<br />
gibt es, so wie auch einen<br />
Einbezug in Personalentwicklung oder<br />
ein hochschulweites Qualitätsmanagement<br />
(wie bspw. an der HSZG Zittau/<br />
Görlitz), erst in Ansätzen.<br />
Foto: <strong>Hochschule</strong> Madgeburg-<br />
Stendal<br />
Foto: <strong>Hochschule</strong> Magdeburg-<br />
Stendal<br />
PROF. DR. SUSANNE BORKOWSKI<br />
Prorektorin für Studium, Lehre und<br />
Internationales<br />
susanne.borkowski@h2.de<br />
LISA KÖNIG<br />
Projektkoordinatorin im Projekt h2d2 –<br />
didaktisch und digital kompetent<br />
Lehren und Lernen<br />
lisa.koenig@h2.de<br />
alle:<br />
<strong>Hochschule</strong> Magdeburg-Stendal<br />
Breitscheidstr. 2<br />
39114 Magdeburg<br />
www.h2.de<br />
Permalink:<br />
https://doi.org/10.5281/zenodo.10838049
24 FACHBEITRÄGE DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Kriterien und Maßstäbe der Vergabe<br />
Über Maßstäbe und Kriterien guter Lehre, für die<br />
Lehrpreise verliehen werden, gibt es in Deutschland<br />
– seit jeher – breite Diskurse (Stichworte: Entschulung<br />
der akademischen Lehre; partizipatives, interdisziplinäres,<br />
problemorientiertes, forschendes Lehren;<br />
aber auch Freiheit von Lehre und Forschung auch an<br />
HAW). <strong>Die</strong>se Debatten werden sich durch Nachfrageveränderung<br />
(Stichwortbeispiel: Generation Z) bzw.<br />
hinzutretende Lehrherausforderungen (Stichwortbeispiele:<br />
Diversität, Digitalisierung, Internationalisierung,<br />
Klimawandel, Energiewende) weiterhin fortsetzen.<br />
HAW machen diese Entwicklungspfade häufig<br />
auch zum Thema – Top down – ihrer Lehrpreisvergabe,<br />
setzen darüber hinaus aber auch ganz eigene,<br />
hochschulprofilbezogene Schwerpunkte (Scheidig,<br />
Tremp 2020; Tremp et al. 2010). <strong>Die</strong>se wechseln zum<br />
Teil jährlich (wie an der <strong>Hochschule</strong> Magdeburg-Stendal).<br />
Partizipativ werden bei der Lehrpreisvergabe –<br />
Bottom-up – immer auch die Bewertungen durch die<br />
Studierenden einbezogen, die an den Lehrveranstaltungen<br />
teilnehmen bzw. die Lehrenden „erleben“.<br />
Unter Berücksichtigung des „shifts from teaching to<br />
learning“ wird das Feedback der Studierenden bei der<br />
Auswahl der Lehrpreisträgerinnen und -träger explizit<br />
berücksichtigt. Ausnahmen sind die wenigen Lehrpreise,<br />
die ausschließlich auf Vorschlag von Kolleginnen<br />
und Kollegen oder der Fachbereiche (wie an der<br />
<strong>Hochschule</strong> Zittau/Görlitz) vergeben werden, und<br />
natürlich die Landes-, Bundes- und Stiftungspreise.<br />
<strong>Die</strong> Studierenden haben – das zeigen die diesbezüglichen<br />
umfangreichen Untersuchungen – unterschiedliche<br />
Anliegen an sehr gute bzw. herausragende Lehre.<br />
Während Kolleginnen-/Kollegen- sowie Selbst-,<br />
aber auch die Jury- und Gutachterbewertungen<br />
bisher kaum beforscht wurden, gibt es mittlerweile<br />
viel qualitative und quantitative Forschung zu den<br />
Bewertungen durch die Studierenden (Webler 2010,<br />
Woll et al. 2020, Borkowski, Albrecht 2021, Hawlitschek<br />
et al. 2022). Dabei konnten die Kriterien und<br />
Maßstäbe, die Studierenden wichtig sind, herausgearbeitet<br />
werden, allerdings nicht ihr Einbezug in die<br />
Entscheidungen der Jurys: Unterscheiden lassen sich<br />
Aussagen, mittels derer 1. die Lehrveranstaltung, die<br />
Lehrinhalte und ihre Vermittlung beurteilt werden;<br />
Aussagen, die sich 2. mit dem Lehrverhalten der<br />
lehrenden Personen auseinandersetzen; 3. Aussagen<br />
über die persönliche Erreichbarkeit und Kommunikation<br />
dieser Lehrenden außerhalb der Lehrveranstaltung<br />
(Beratung); sowie 4. Aussagen über so<br />
etwas wie ein Engagementniveau (Hawlitschek et<br />
al. 2022, Borkowski, Albrecht 2021). Lehre ist dann<br />
hervorragend, wenn sie nicht nur in der Lehrveranstaltung<br />
selbst stattfindet, sondern ihr Lehrmaterial<br />
auch über die Veranstaltung hinaus bereitsteht und<br />
so digital inkludiert. Eine Lehrperson wird dann als<br />
sehr gute Didaktikerin bzw. guter Didaktiker angesehen,<br />
wenn sie die Kooperation der Studierenden anregt,<br />
Studierende auch unaufgefordert zu Bedarfen der<br />
Lehre befragt und proaktiv lehrt. Dazu gehört, den<br />
einzelnen Studierenden auch außerhalb der Lehrveranstaltung<br />
– diskret – ehrliches individuelles<br />
Feedback zu geben. Hervorragende Lehrende (die<br />
Lehrpreise verdienen) verfügen über so etwas wie<br />
ein erhöhtes Engagementniveau für ihre Studierenden,<br />
ihre Lehre, ihr Fach (ebenda).<br />
Auswahlverfahren und Auswahlbeteiligte<br />
An der Auswahl sind neben den Benannten (Studierende,<br />
Jury, Kolleginnen, Kollegen, die Kandidierenden<br />
selbst sowie interne oder externe Gutachtende)<br />
zumeist die Hochschulleitungen als Verantwortungsträger<br />
und die Servicebereiche für Hochschuldidaktik<br />
und/oder Qualitätsmanagement in Studium und<br />
Lehre als Durchführungsverantwortliche beteiligt.<br />
<strong>Die</strong>se Servicebereiche schreiben im Auftrag oder<br />
gemeinsam mit der Hochschulleitung die zu vergebenden<br />
Preise aus und fordern zur Einreichung von<br />
Vorschlägen auf. <strong>Die</strong>se Votings gehen dann – primär<br />
von den Studierenden, manchmal auch von den Kolleginnen<br />
und Kollegen (und, wenn es wie an der TH<br />
Wildau nicht explizit ausgeschlossen ist, auch von<br />
guten Lehrenden selbst) bei den Durchführungsverantwortlichen<br />
ein. <strong>Die</strong>se strukturieren die Votings<br />
für eine Jury, die eine Rankingliste erstellt und der<br />
Hochschulleitung zur Letztentscheidung bzw. zum<br />
Beschluss vorlegt. Eine öffentliche Preisvergabeveranstaltung<br />
der die Gesamtverantwortung wahrnehmenden<br />
Hochschulleitung schließt sich an. Danach<br />
erfolgt das verwaltungsinterne Verfahren der Preisgeldauszahlung:<br />
als einmalige Leistungszulage zum<br />
Sold oder Gehalt („Prämie“) oder als Aufstockung des<br />
Hochschulbudgets des prämierten Lehrenden.<br />
Forschungsbedarfe<br />
Bisher werden Lehrpreisverfahren nur selten und<br />
nur als Einzelfälle und nicht komparativ – prozessual<br />
– evaluiert. Noch weniger ist über die Wirkung<br />
von Lehrpreisvergaben bekannt, wenngleich immer<br />
wieder darüber nachgedacht wird, wie bei Scheidig,<br />
Tremp 2020; Krempkow 2014; Futter, Tremp 2008.<br />
<strong>Die</strong> aktuelle Studie von Scheidig, Tremp (2020),<br />
die sich nur auf die Schweiz und auch dort nur auf<br />
einen einzigen, noch dazu einen stiftungsfinanzierter<br />
Bundespreis bezieht, ist eine Ausnahme, an der<br />
sich zukünftige Forschungen über HAW und Universitäten<br />
in Deutschland orientieren sollten. Forschungen<br />
zu Prozessen empfehlen sich ebenso dringlich<br />
wie auch weitere dezidierte Forschungen zu Fragen<br />
der Anerkennung und zu Fragen der Wirkungen von<br />
Lehrpreisvergaben. Besonders in den Blick genommen<br />
werden sollte bei Ersterem die Verknüpfung<br />
der Lehrpreisvergabe mit der Lehrveranstaltungsevaluation,<br />
der Studiengangs-, der Personal- und der
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
FACHBEITRÄGE<br />
25<br />
Hochschulorganisationsentwicklung. Im Sinne eines<br />
„shifts from evaluation to development“ sind neben<br />
der Passung und der Legitimität (die die Prozesse mittlerweile<br />
gut „im Griff“ haben) aber darüber hinaus<br />
auch die Wirkungen in den Blick zu nehmen: auf<br />
die ausgezeichnete Lehrperson selbst, auf die Kolleginnen<br />
und Kollegen, auf die Lehrenden an anderen<br />
Fachbereichen, auf die Wahrnehmung, Würdigung<br />
und Aufwertung der Leistungsdimension Lehre<br />
insgesamt. Dabei sollte offengehalten werden, ob es<br />
eine Integration in die genannten Evaluations- bzw.<br />
Entwicklungsprozesse und -strukturen geben muss,<br />
weil sie immer auch eine Ein- und Unterordnung ist<br />
(Nassehi 2019), oder ob eine „lose Kopplung“ (Weick<br />
2009) zur Förderung der Freiheit der Lehre nicht doch<br />
auch ausreicht.<br />
<strong>Hochschule</strong> Zittau/Görlitz (Hrsg.): Ordnung für die Vergabe des Lehrpreises der <strong>Hochschule</strong> Zittau/Görlitz (Lehrpreisvergabeordnung). Beschlussfassung<br />
durch das Rektorat der <strong>Hochschule</strong> Zittau/Görlitz. 2017.<br />
Technische <strong>Hochschule</strong> Wildau (Hrsg.): Satzung zur Vergabe des Lehrpreises der Technischen <strong>Hochschule</strong> Wildau. 2017. In: Amtliche Mitteilungen<br />
Nr. 27/2022 vom 22.07.2022.<br />
<strong>Hochschule</strong> Darmstadt (Hrsg.): Richtlinie der <strong>Hochschule</strong> Darmstadt vom 15.05.2018 zur Vergabe eines Lehrpreises. 2018. Zuletzt geändert<br />
durch den Präsidiumsbeschluss vom 23.06.2020. Der Präsident der <strong>Hochschule</strong> Darmstadt.<br />
<strong>Hochschule</strong> Merseburg (Hrsg.): Ordnung zur Vergabe der Lehrpreise der <strong>Hochschule</strong> Merseburg (Lehrpreisvergabeordnung LpVO), hier: 5.<br />
Ordnung zur Änderung der Ordnung zur Vergabe der Lehrpreise der <strong>Hochschule</strong> Merseburg (Lehrpreisvergabeordnung LpVO). 2023. In:<br />
Amtliche Bekanntmachungen Nr. 27/2023 des Rektorats/Dezernat Akademische Angelegenheiten vom 11.10.2023.<br />
<strong>Hochschule</strong> für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Organisationsverfügung – Vergabe eines Lehrpreises<br />
an der <strong>Hochschule</strong> für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW); sowie: Geschäftsordnung für den Lehrpreis an<br />
der <strong>Hochschule</strong> für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW) (GO Lehrpreis-Jury HSPV NRW). 2017. In: Amtliche<br />
Mitteilungen der <strong>Hochschule</strong> für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen Nr. 23 vom 22.11.2021.<br />
EHS Freiburg: Evangelische <strong>Hochschule</strong> Freiburg i. Br. (Hrsg.): Satzung über die Vergabe von Lehrpreisen. 2022. In ergänzter Fassung vom<br />
19.04.2023. Rektorat der <strong>Hochschule</strong>.<br />
BMBF (Hrsg.): Bekanntmachung der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes<br />
über ein gemeinsames Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre („Qualitätspakt Lehre“). 2010a.<br />
Bundesanzeiger vom 18. Oktober 2010.<br />
BMBF (Hrsg.): Richtlinien zur Umsetzung des gemeinsamen Programms des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und<br />
mehr Qualität in der Lehre. 2010b. Bundesanzeiger vom 10. November 2010.<br />
Borkowski, S; Albrecht P.-G.: Digital inklusiv, bitte! Studierendenansichten zu postpandemischer Lehrqualität: In: <strong>Die</strong> <strong>Neue</strong> <strong>Hochschule</strong> DNH<br />
2/2023. S. 20–23.<br />
Futter, K., Tremp, P.: Wie wird gute Lehre „angereizt”? Über die Vergabe von Lehrpreisen an Universitäten. Das Hochschulwesen, Nr. 2/2008,<br />
S. 40–46.<br />
Hawlitschek, A., May Briese, S.; Albrecht, P.-G.: „Man fühlt sich nicht alleine gelassen.“ Merkmale guter Online-Lehre aus studentischer Perspektive.<br />
In: die hochschullehre. Interdisziplinäre Zeitschrift für Studium und Lehre. Nr. 3/2022. S. 1–15. DOI: https://doi.org/10.3278/HSL2203W<br />
Jorzik, B.: Viel Preis, wenig Ehr. Lehrpreise in Deutschland. In: Tremp, P. (Hrsg.): Ausgezeichnete Lehre! Lehrpreise an Universitäten. Erörterungen<br />
– Konzepte – Vergabepraxis. Münster: Waxann 2010, S. 117–140.<br />
Krempkow, R.: <strong>Die</strong> Rolle von Wissenschaftspreisen als nichtmaterielle Anreize im Wettbewerb um Reputation. In: Forschung Nr. 4/2014. S. 116–122.<br />
Nassehi, A.: Karriere an der Uni – Zwischen Schattendasein und Achtungsappell. In: FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung am 24.10.2019.<br />
Pasternack, P.: Hochschulqualität und Lehrpreise. In: Tremp, P. (Hrsg.): Ausgezeichnete Lehre! Lehrpreise an Universitäten. Erörterungen –<br />
Konzepte – Vergabepraxis. Münster 2010, S. 27–38.<br />
Scheidig, F.; Tremp, P.: <strong>Die</strong> Bedeutung von Lehrpreisen für Preisträger:innen und ihr Beitrag zur Lehrentwicklung. Befunde der Schweizer Lehrpreisstudie.<br />
In: ZfHE Zeitschrift für <strong>Hochschule</strong>ntwicklung Nr. 4/2020 S. 59-81. https://doi.org/10.3217/ZFHE-15-04/04 – Abruf am 25.11.2023.<br />
Stifterverband (Hrsg.): Lehrpreise in Deutschland 2015. Eine Übersicht über alle in Deutschland vergebenen akademischen Lehrpreise und<br />
Auszeichnungen für Innovationen und Verbesserung der Hochschullehre. Siehe: www.stifterverband.de/lehrpreise – Abruf am 10.01.<strong>2024</strong>.<br />
Tremp, P.: Lehrpreise an Universitäten. In: Tremp, P. (Hrsg.): Ausgezeichnete Lehre! Lehrpreise an Universitäten Erörterungen – Konzepte –<br />
Vergabepraxis. Münster 2010, S. 13–26.<br />
Webler, W.-D.: <strong>Die</strong> studentische Sicht auf Lehre, Lehrende und Lehrveranstaltungen – und ihre angemessene Berücksichtigung (auch im Rahmen<br />
von Lehrpreisen). In: HSW Das Hochschulwesen Nr. 4/2012 S. 108–109.<br />
Weick, K. E.: Bildungsorganisationen als lose gekoppelte Systeme. In: Koch, S.; Schemmann, M. (Hrsg.): Neo-Institutionalismus in der Erziehungswissenschaft.<br />
Wiesbaden 2009, S. 85–109.<br />
Wissenschaftsrat (Hrsg.): Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium. Positionspapier Nr. 8639–08. Berlin 2008.<br />
Wissenschaftsrat (Hrsg.): Strategien für die Hochschullehre. Positionspapier Nr. 6190/17. Berlin 2017.<br />
Woll, J.; Hettrich, H.; Hanna; K.: Studierenden eine Stimme geben. Der Lehrpreis als Auszeichnung guter Lehre. In: ZfHE Zeitschrift für <strong>Hochschule</strong>ntwicklung<br />
Nr. 4/2020 S. 59–81. https://doi.org/10.3217/ZFHE-15-04/05. S. 83-102 – Abruf am 15.01.<strong>2024</strong>.
26 FACHBEITRÄGE DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
<strong>Die</strong> Magie des gemeinsamen Erlebens – Lessons<br />
Learned eines Entrepreneurship-Kurses<br />
Bessere Ergebnisse bei der Entwicklung eines Geschäftsmodells<br />
in kürzerer Zeit – wie funktioniert das?<br />
Von Prof. Dr. Verena Kaiser und Prof. Dr. Bettina Maisch<br />
Foto: privat<br />
Foto: Andreas Hoernisch<br />
PROF. DR. VERENA KAISER<br />
<strong>Hochschule</strong> München<br />
Professur für Enterprise and<br />
Innovation<br />
Am Stadtpark 20<br />
81243 München<br />
verena.kaiser@hm.edu<br />
www.hm.edu<br />
ORCID 0000-0002-8683-8319<br />
PROF. DR. BETTINA MAISCH<br />
<strong>Hochschule</strong> München & Strascheg<br />
Center for Entrepreneurship<br />
Professur für Entrepreneurship<br />
Heßstraße 89<br />
80797 München<br />
bettina.maisch@sce.<br />
www.sce.de<br />
ORCID 0000-0001-9474-0226<br />
In der Ausgabe der Zeitschrift <strong>Die</strong> <strong>Neue</strong><br />
<strong>Hochschule</strong> 5/2022 1 präsentierten wir<br />
die iterative Entwicklung unseres Entrepreneurship-Kurses<br />
im COIL-Format<br />
(Collaborative Online International<br />
Learning), an dem Studierende und<br />
Lehrende aus Südafrika, Nepal, Polen<br />
und Deutschland teilnahmen. Das<br />
vorgestellte Kursdesign wurde über<br />
sechs Semester auf Basis von Studierendenfeedback<br />
und Dozentenreflektionen<br />
kontinuierlich weiterentwickelt. In den<br />
letzten Semestern wurde eine zunehmende<br />
„Zoom Fatigue“ deutlich, die mit<br />
einer reduzierten Interaktion zwischen<br />
Gastrednern und Studierenden sowie<br />
dem Rückgang von Engagement einzelner<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
einherging. Aus diesen Faktoren ergaben<br />
sich immer häufiger auftretende<br />
Teamkonflikte und daraus resultierend<br />
Arbeitsergebnisse in reduzierter Qualität.<br />
Wir Lehrende fühlten auch mehr<br />
und mehr, dass das Online-Format uns<br />
zunehmend auslaugte, und wollten<br />
deshalb unbedingt wieder zurück in<br />
einen Hörsaal. Auf Basis dieser Veränderungen<br />
und Kenntnisse sind wir zu<br />
dem Schluss gelangt, dass eine Kombination<br />
von On- und Offline-Elementen<br />
besser für diesen Kurs geeignet sein<br />
dürfte, kurz: ein COOIL-Format (Collaborative<br />
Online and Offline International<br />
Learning). Im Sommersemester<br />
2023 testeten wir das neue Konzept<br />
und möchten unsere Erfahrungen nun<br />
gerne teilen.<br />
Was war und was blieb?<br />
Der ursprüngliche Rahmen war<br />
ein interdisziplinärer, projektbasierter<br />
Entrepreneurship-Kurs auf<br />
Bachelorniveau mit internationalen<br />
Hochschulpartnern. Über den Seminarzeitraum<br />
entwickelten die Studierenden<br />
eine innovative Produktlösung<br />
sowie ein nachhaltiges Geschäftsmodell<br />
im Bereich Green Tech, Landwirtschaft<br />
und Ernährung. Das 4 SWS/5 ECTS-Modul<br />
fand wöchentlich via Zoom statt.<br />
Wir verwendeten einen „Flipped classroom“-Ansatz,<br />
bei dem die Studierenden<br />
sich das theoretische Hintergrundwissen<br />
anhand von aufgezeichneten Lehrvideos<br />
vor den einzelnen Veranstaltungen<br />
aneigneten, in ihrem eigenen Tempo<br />
und zeitlich flexibel. <strong>Die</strong> Vorlesungszeit<br />
nutzten wir regelmäßig für inspirierende<br />
Gastvorträge von Gründern, das<br />
Adressieren von allgemeinen Fragen,<br />
die Förderung der Projektumsetzung<br />
durch ein Coaching der Teams sowie<br />
für Arbeitszeit an den Projekten selbst<br />
und zum Ende des Semesters auch für<br />
Peer-Feedback sowie Präsentationen.<br />
All diese Elemente haben sich kontinuierlich<br />
bewährt und wurden von uns<br />
beibehalten.<br />
Was haben wir verändert?<br />
Zwei grundlegende Parameter wurden<br />
angepasst: Zum einen wurde, um der<br />
„Zoom-Fatigue“ entgegenzuwirken und<br />
das Energielevel sowie das Engagement<br />
in den Teams zu erhöhen, von einem<br />
synchronen Onlineunterricht auf ein<br />
Präsenzformat umgestellt. Zweitens<br />
wurde das Projekt statt im wöchentlichen<br />
Unterricht nun in einer kompakten,<br />
sechstägigen Blockwoche am Entrepreneurship<br />
Center der <strong>Hochschule</strong><br />
München (HM), dem Strascheg Center<br />
for Entrepreneurship (SCE), durchgeführt.<br />
Lehrende und Studierende aus<br />
Permalink:<br />
https://doi.org/10.5281/zenodo.10838057<br />
1 https://doi.org/10.5281/zenodo.7050619
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
FACHBEITRÄGE<br />
27<br />
„In den letzten Semestern wurde eine zunehmende<br />
‚Zoom Fatigue‘ deutlich, die mit einer reduzierten<br />
Interaktion zwischen Gastrednern und Studierenden<br />
sowie dem Rückgang von Engagement einzelner<br />
Teilnehmender einherging.“<br />
Polen, Nepal und Südafrika wurden eingeladen.<br />
Letzten Endes konnten wir nur eine Delegation aus<br />
Polen willkommen heißen, da die Teams aus Südafrika<br />
und Nepal nicht rechtzeitig die Finanzierung<br />
für die Reise und Unterkunft der Teilnehmenden<br />
sicherstellen konnten. Auch eine lokale Durchführung<br />
in Kathmandu oder Durban mit Interaktionselementen<br />
nach München war aus Kapazitätsgründen<br />
seitens der Partneruniversitäten nicht möglich.<br />
Da der Kurs jedoch auf Englisch angeboten wurde<br />
und dadurch allen Incoming Exchange Students<br />
sowie auch Studierenden aller Fakultäten der HM<br />
offenstand, verfügten wir trotzdem über eine sehr<br />
heterogene Teilnehmergruppe. In Summe nahmen 20<br />
Studierende aus vier unterschiedlichen Fakultäten<br />
der HM (Betriebswirtschaft, Angewandte Naturwissenschaften<br />
und Mechatronik, Technische Systeme,<br />
Prozesse und Kommunikation, Design) und sieben<br />
Nationalitäten teil.<br />
Um die sechs Tage in Präsenz effektiv zu nutzen,<br />
wurden vorab zwei virtuelle Unterrichtseinheiten<br />
je 60 Minuten über Zoom abgehalten. Das erste<br />
Arbeitstreffen hatte zum Ziel, über die Rahmenbedingungen<br />
des Seminars zu informieren, relevante<br />
Herausforderungen im Food-Kontext vorzustellen<br />
sowie die Studierendenteams zu bilden. Im zweiten<br />
Termin stellten sich Teams mit ihrer selbst gewählten<br />
konkreten Herausforderung, die sie adressieren<br />
wollten, vor und die Vorbereitungsaufgaben für<br />
die Blockwoche wurden verteilt. Somit konnten die<br />
Studierenden an Tag eins des Präsenzunterrichts<br />
gezielt in die Projektarbeit einsteigen und bereits<br />
vorab terminierte Gespräche mit relevanten Stakeholdern<br />
zur Bedürfnisanalyse führen. Vier interaktive<br />
Elemente führten zu einer spürbaren positiven<br />
Veränderung der Seminaratmosphäre, der Interaktionsqualität<br />
zwischen den Studierenden und der<br />
Effektivität in der Projektarbeit.<br />
1. Essen als Nervennahrung und Glücklichmacher<br />
<strong>Die</strong> Studierenden wurden informiert, dass jeder<br />
Tag der Blockwoche mit einem Frühstücksbuffet<br />
eine Stunde vor dem offiziellen Seminar beginnt.<br />
Foto: privat<br />
Foto: privat<br />
Abbildung 1: Abschlussfoto mit allen Studierenden und Coaches<br />
Dabei brachten die Coaches Brot mit und die<br />
Studierenden wurden gebeten, ihren liebsten<br />
Frühstückssnack mitzubringen und mit allen zu<br />
teilen (schließlich war es ja auch ein Kurs, in dem<br />
es ums Essen ging). So begannen die Arbeitstage<br />
in einer sehr entspannten, positiven Atmosphäre,<br />
was sich den gesamten Tag über bemerkbar<br />
machte.<br />
Abbildung 2: Frühstück ist fertig!
28 FACHBEITRÄGE DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Foto: privat<br />
2. Energizer als Katalysator für eine positive<br />
Projektdynamik<br />
Um die Atmosphäre in der Gruppe aufzulockern,<br />
ein Gemeinschaftsgefühl zu erzielen und den<br />
Kreislauf der Studierenden anzukurbeln, musste<br />
jedes Team einen fünfminütigen Eisbrecher vorbereiten.<br />
Zum offiziellen Beginn eines jeden Tages<br />
sowie gleich nach der Mittagspause durften die<br />
Teams selbst gewählte Übungen mit den Mitstudierenden<br />
durchführen. Es zeigte sich, dass dies<br />
als eine perfekte Bekämpfung gegen das „Suppenkoma“<br />
nach dem Frühstück oder der Mittagspause<br />
wirkte und zudem einige Lacher bescherte.<br />
3. Gründer und unternehmerisches Handeln live<br />
erleben<br />
Ein weiterer fester Bestandteil des Blockseminars<br />
waren die täglichen kurzen Impulsvorträge vor<br />
Ort von charismatischen Food-Start-up-Gründerinnen<br />
und -Gründern. In nur 15 Minuten wurde<br />
über das Unternehmen bzw. das Projekt, die Motivation<br />
sowie die Höhen und Tiefen des Gründens<br />
gesprochen und im Anschluss 15 Minuten auf die<br />
Fragen der Studierende eingegangen. Manchmal<br />
hatten die Studierenden Glück und es gab auch<br />
Produktproben wie Pralinen oder Bio-Limonade.<br />
Abbildung 3: Köstliche Naschprobe - Pralinen des Start-ups Djoon<br />
4. Rahmen und Disziplin<br />
Um sicherzustellen, dass die Studierendenteams<br />
effektiv die kurze Arbeitszeit während der Blockwoche<br />
nutzten, war es notwendig, dass alle pünktlich<br />
zum Unterricht erschienen. <strong>Die</strong>s haben wir<br />
mit einer unkonventionellen Methode gefördert,<br />
die anfangs die Studierenden etwas irritierte, doch<br />
sofort akzeptiert wurde und zu dem gewünschten<br />
Effekt führte: Wer zu spät kam (morgens oder nach<br />
der Mittagspause), wurde „bestraft“. Der Zuspätkommende<br />
konnte sich dabei die Form der „Buße“<br />
selbst wählen: zehn Push- oder Situps, singen<br />
oder einen Witz erzählen. Von dieser Maßnahme<br />
waren auch die Dozierenden nicht ausgeschlossen,<br />
die aufgrund eines Verkehrsstaus nicht pünktlich<br />
waren. <strong>Die</strong>se Maßnahme sorgte nicht nur für ein<br />
diszipliniertes Arbeitsverhalten, sondern auch für<br />
ein verbessertes Verantwortungsgefühl gegenüber<br />
der Gesamtgruppe sowie in einigen Fällen auch<br />
zu großer Erheiterung.<br />
Fazit<br />
Insgesamt war die Blockwoche gekennzeichnet durch<br />
eine sehr offene, positive und fokussierte Atmosphäre.<br />
<strong>Die</strong> Energie und das Engagement der Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer war spürbar hoch, was wir<br />
in einem Online-Setting so nie erlebt hatten. Wir<br />
hatten den Eindruck, dass besonders der Faktor des<br />
gemeinsamen Essens nicht nur für einen ausgeglichenen<br />
Energiehaushalt für Geist und Körper sorgte,<br />
sondern auch für ein familiäres und vertrauensvolles<br />
Arbeiten in den Gruppen, zwischen den Studierenden<br />
und gegenüber uns Dozierenden. Wir haben<br />
immer wieder beobachtet, wie sich Kursteilnehmende<br />
aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen am Essensbuffet<br />
ausgetauscht, gelächelt oder gar gelacht haben.<br />
Der Hauptaspekt war jedoch schlicht und ergreifend<br />
die Tatsache, dass alle gemeinsam in einem<br />
Raum waren. <strong>Die</strong> Coachings fanden Face-to-Face<br />
statt, niemand konnte sich davonschleichen, wie das<br />
häufig bei Online-Veranstaltungen der Fall ist, und<br />
die Lehrenden waren jederzeit greifbar für eine kurze<br />
Zwischenfrage oder Meinung. <strong>Die</strong> Kursevaluation<br />
sowie die Selbstreflexionen, die die Studierenden als<br />
Teil ihrer Prüfungsleistung abgeben mussten, zeigten,<br />
dass alle den Kurs sehr schätzten und unbedingt<br />
weiterempfehlen würden. Obwohl es ein sehr intensiver<br />
Kurs war, der aufgrund des Zeitdrucks kaum andere<br />
Aktivitäten an den Abenden zuließ (da die Teams<br />
häufig noch abends an ihren Meilensteinen oder Prototypen<br />
tüftelten), war das Feedback überaus positiv.<br />
Mit all dem hatten wir mehr oder weniger gerechnet.<br />
Womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass die<br />
Ergebnisse der Studierenden trotz der im Vergleich<br />
zu einer semesterbegleitenden Lehrveranstaltung<br />
sehr kurzen Bearbeitungszeit überdurchschnittlich<br />
gut waren. <strong>Die</strong> Geschäftsideen waren sehr innovativ<br />
und die Ausarbeitungen sehr sorgfältig und qualitativ<br />
hochwertig. Das hätten wir aufgrund der kurzen<br />
Zeitspanne von sechs Tagen so nicht erwartet. Vermutlich<br />
lag es an der Tatsache, dass alle sehr fokussiert<br />
auf die Aufgabe waren und motiviert waren, das Beste<br />
aus sich und dem Team herauszuholen. Damit sahen<br />
wir in dieser Blockwoche die besten Studierendenergebnisse<br />
der letzten sechs Semester! Selbstverständlich<br />
ist dieses Ergebnis nicht generalisierbar<br />
und wir werden sehen, wie gut sich künftige Studierendengruppen<br />
schlagen werden. Dennoch hat sich<br />
das Lehrteam dazu entschieden, darauf aufzubauen<br />
und künftig nur noch COOIL-Formate durchzuführen.<br />
Hoffentlich wird es für unsere Partner aus Nepal und<br />
Südafrika bald möglich sein, mit ihren Studierenden<br />
dabei zu sein.
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
HOCHSCHULPOLITIK<br />
29<br />
Sinkende Studierendenzahlen durch demografischen Wandel<br />
Anteil erfolgreicher Abschlüsse steigern<br />
<strong>Die</strong> Zeit stetig wachsender Studierendenzahlen<br />
geht zu Ende. Prognosen<br />
gehen davon aus, dass die Zahl der<br />
Studienanfänger ab 2027 stagnieren<br />
wird. Doch die Entwicklung ist uneinheitlich.<br />
Während in ganzen Regionen<br />
und manchen Fächern ein Rückgang<br />
stattfindet, stehen die Zeichen in anderen<br />
Disziplinen und an anderen Orten<br />
sogar auf Wachstum. Der Vorsitzende<br />
des Wissenschaftsrats (WR), Wolfgang<br />
Wick, hat in seinem jährlichen Bericht<br />
zu aktuellen Tendenzen im Wissenschaftssystem<br />
für maßgeschneiderte<br />
Strategien im Umgang mit dem demografischen<br />
Wandel geworben und für<br />
eine veränderte Perspektive vom Studienbeginn<br />
auf den Studienerfolg. „<strong>Die</strong><br />
<strong>Hochschule</strong>n bekommen die Chance,<br />
Fehlentwicklungen der Wachstumsperiode<br />
zu korrigieren, die Qualität der<br />
Lehre zu verbessern, den Anteil erfolgreicher<br />
Abschlüsse zu steigern und die<br />
Digitalisierung voranzutreiben“, betont<br />
Wick. Hierfür bräuchten sie die Unterstützung<br />
der Politik, die der Versuchung<br />
kurzsichtiger Einsparungen widerstehen<br />
müsse. „Eine <strong>Hochschule</strong>, die weniger<br />
Studierende aufnimmt und diese<br />
dafür besser betreut, muss belohnt<br />
und nicht durch Stellenabbau bestraft<br />
werden. Denn am Ende kann sie mehr<br />
und besser qualifizierte Absolventinnen<br />
und Absolventen für den vom Fachkräftemangel<br />
geplagten Arbeitsmarkt<br />
ausbilden. Hierauf und nicht auf hohe<br />
Einschreibungszahlen kommt es am<br />
Ende an“, unterstreicht Wick.<br />
Der WR-Vorsitzende ruft die <strong>Hochschule</strong>n<br />
dazu auf, individuelle Strategien<br />
zu entwickeln. So könnten sie<br />
nicht ausgelastete Studienangebote in<br />
Abstimmung mit <strong>Hochschule</strong>n in ihrer<br />
Region abbauen, zusammenlegen oder<br />
durch attraktivere Angebote ersetzen.<br />
Außerdem könnten sie neue Zielgruppen<br />
erschließen durch Studienformate,<br />
die Berufstätigen, Eltern und beruflich<br />
Ausgebildeten ein Studium ermöglichen.<br />
<strong>Die</strong>s, so Wick, sei ein Wachstumsrezept<br />
der privaten <strong>Hochschule</strong>n, von dem<br />
staatliche <strong>Hochschule</strong>n lernen könnten.<br />
Sehr beliebt sind deutsche <strong>Hochschule</strong>n<br />
bei Studierenden aus dem<br />
Ausland. Doch um diese dauerhaft als<br />
Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt<br />
gewinnen zu können, ist noch<br />
einiges zu tun. Hierbei könnten sich<br />
die <strong>Hochschule</strong>n auf Länder konzentrieren,<br />
die nach bisherigen Erfahrungen<br />
besonders große Chancen bieten, dass<br />
Absolventinnen und Absolventen nach<br />
ihrem Studium in Deutschland bleiben<br />
oder die sich für Fächer interessieren,<br />
in denen der Bedarf in Deutschland<br />
besonders hoch ist, etwa im MINT-Bereich.<br />
Zugleich warnt Wick davor, dass die<br />
<strong>Hochschule</strong>n sich allein am Arbeitsmarkt<br />
orientieren. Internationale Studierende,<br />
die ins Ausland zurückkehren,<br />
seien wichtig für die Entwicklung ihrer<br />
Heimatländer und für die internationale<br />
Vernetzung Deutschlands. Auch<br />
müsse das Hochschulsystem weiterhin<br />
ein breites fachliches Spektrum bieten,<br />
um mit disziplinärer Vielfalt für Aufgaben<br />
der Zukunft gerüstet zu sein. „Wir<br />
dürfen nicht aufgrund von Nachfrageschwankungen<br />
Fächer und Institute<br />
kaputtsparen, die wir später nur langwierig<br />
und mit hohen Kosten wiederaufbauen<br />
müssen“, sagt Wick.<br />
Bericht zu aktuellen Tendenzen im<br />
Wissenschaftssystem:<br />
https://www.wissenschaftsrat.de/download/<strong>2024</strong>/VS_<br />
Bericht_<strong>2024</strong>_Jan.html<br />
Wissenschaftsrat<br />
Studieren in Kanada<br />
Kanada will weniger internationale Studierende<br />
In den vergangenen Jahren hat die Zahl<br />
internationaler Studierender an <strong>Hochschule</strong>n<br />
in Kanada stark zugenommen.<br />
<strong>Die</strong>s stellt das Land vor wachsende<br />
Herausforderungen, etwa bei der<br />
Betreuung der Studierenden vor Ort,<br />
ihrer Unterbringung und gesundheitlichen<br />
Versorgung. Um diesen Engpässen<br />
zu begegnen, wird die Regierung<br />
für die kommenden zwei Jahre Obergrenzen<br />
für die Zahl neu zugelassener<br />
Studierender aus dem Ausland einführen.<br />
Das zuständige Bundesministerium<br />
Immigration, Refugees and Citizenship<br />
Canada (IRCC) legt für die einzelnen<br />
Provinzen und Territorien des Landes<br />
Obergrenzen fest, die an die jeweilige<br />
Bevölkerungsstruktur angepasst sind.<br />
<strong>Die</strong>se wiederum weisen den <strong>Hochschule</strong>n<br />
in ihrem Zuständigkeitsbereich<br />
Kontingente zu.<br />
Im Jahr <strong>2024</strong> sollen maximal<br />
360.000 neue internationale Studierende<br />
nach Kanada kommen dürfen.<br />
Das entspricht einem Rückgang von 35<br />
Prozent gegenüber dem Vorjahr. <strong>Die</strong><br />
Zahlen für 2025 werden Ende dieses<br />
Jahres bekannt gegeben. Internationale<br />
Studierende, die sich bereits in<br />
Kanada befinden, sind von den neuen<br />
Regelungen nicht betroffen. Ebenso sind<br />
Masterstudierende, Doktorandinnen<br />
und Doktoranden sowie Schülerinnen<br />
und Schüler der Primar- und Sekundarstufe<br />
von der Deckelung ausgenommen.<br />
In Ergänzung zu den Maßnahmen<br />
werden auch die Regelungen für<br />
Arbeitserlaubnisse angepasst. Ab dem<br />
1. September <strong>2024</strong> haben internationale<br />
Studierende, die ein grundstämmiges<br />
Studienprogramm beginnen,<br />
keinen Anspruch mehr auf eine Arbeitserlaubnis<br />
nach Abschluss des Studiums.<br />
Absolvierende von Masterstudiengängen<br />
sollen hingegen bald eine<br />
Arbeitserlaubnis für drei Jahre beantragen<br />
können.<br />
Kooperation-International
30 HOCHSCHULPOLITIK<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Bremen<br />
Promotion jetzt auch an HAW möglich<br />
Künftig können neben der Universität<br />
auch die <strong>Hochschule</strong>n für angewandte<br />
Wissenschaften (HAW) im<br />
Land Bremen in forschungsstarken<br />
Bereichen eigenständig den Weg zur<br />
Promotion anbieten. Eine entsprechende<br />
Rechtsverordnung hat die Senatorin<br />
für Umwelt, Klima und Wissenschaft<br />
nun unterzeichnet und erklärt: „Mit<br />
diesem Schritt tragen wir in Bremen der<br />
erfreulichen Entwicklung Rechnung,<br />
dass Forschung und Transfer ein selbstverständlicher<br />
Teil des Aufgabenspektrums<br />
auch der Fachhochschulen sind.<br />
Der Fokus liegt dort bei den angewandten<br />
Wissenschaften. <strong>Die</strong>ser Praxisbezug<br />
ist sehr wertvoll, weil wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse so ganz gezielt in praktische<br />
Lösungen fließen und unser tägliches<br />
Leben verbessern können.“<br />
Darüber hinaus stärke Bremen<br />
mit der Erteilung des Promotionsrechts<br />
die HAW im Wettbewerb um die<br />
besten Köpfe. Es sei ein entscheidender<br />
Standortvorteil, dass die <strong>Hochschule</strong>n<br />
in Bremen nun auch den Weg zur<br />
Promotion anbieten können, so Kathrin<br />
Moosdorf weiter: „Wir modernisieren<br />
unsere Wissenschaftsorganisation<br />
und stärken die angewandten Wissenschaften<br />
damit erheblich. Das ist auch<br />
ein Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit,<br />
weil häufig Menschen aus eher<br />
bildungsfernen Familien eine Fachhochschule<br />
anwählen. Nun können die Absolventinnen<br />
und Absolventen auch direkt<br />
dort promovieren, wo sie zuvor studiert<br />
haben. Mit der Erteilung des Promotionsrechts<br />
erkennen wir zudem die Leistungen<br />
und Kompetenzen forschungsstarker<br />
Professorinnen und Professoren an den<br />
Bremer <strong>Hochschule</strong>n ausdrücklich an.“<br />
<strong>Die</strong> <strong>Hochschule</strong> Bremen und die<br />
<strong>Hochschule</strong> Bremerhaven können nun<br />
Anträge stellen, um ein eigenständiges<br />
Promotionsrecht für forschungsstarke<br />
Wissenschaftssenatorin Kathrin Moosdorf ermöglicht<br />
jetzt auch an <strong>Hochschule</strong>n den Weg zur<br />
Promotion.<br />
Bereiche zu erlangen. Dafür muss die<br />
jeweilige <strong>Hochschule</strong> ein Konzept vorlegen,<br />
das die Qualität der Promotionen<br />
sichert. <strong>Die</strong> <strong>Hochschule</strong> für Künste erhält<br />
wie vom Wissenschaftsrat empfohlen ein<br />
eigenständiges Promotionsrecht.<br />
Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft<br />
Bremen<br />
Foto: Wissenschaftsressort<br />
Curriculumentwicklung<br />
Whitepaper „Studiengänge für eine digitale Welt“<br />
Der technologische Wandel stellt<br />
fortlaufend neue Anforderungen an<br />
die Hochschulbildung. Mehr denn je<br />
müssen neue Kompetenzbereiche und<br />
gesellschaftsrelevante Themen nicht<br />
nur in Spezialstudiengängen, sondern<br />
auch in der Breite verankert werden.<br />
Doch wie lassen sich Studiengänge<br />
für eine digitale Welt gestalten und<br />
beispielsweise Digital- und KI-Kompetenzen<br />
nachhaltig und entwicklungsoffen<br />
in die Curricula integrieren?<br />
Welcher hochschulweiten Rahmenbedingungen<br />
bedarf es dafür? Vor rund<br />
einem Jahr brachten das Hochschulforum<br />
Digitalisierung (HFD) und der<br />
KI-Campus zu dieser Frage knapp 300<br />
Akteure aus allen <strong>Hochschule</strong>benen bei<br />
der Curriculumentwicklung zusammen,<br />
um sich über Good Practices der Curriculumentwicklung<br />
auszutauschen und<br />
Herausforderungen und Lösungsansätze<br />
bei der Curriculumstransformation<br />
zu diskutieren.<br />
Das vorliegende Whitepaper greift<br />
nun Erkenntnisse und Beispiele aus<br />
dem Barcamp auf, geht aber über eine<br />
reine Dokumentation hinaus, indem<br />
es Grundlagen der Curriculumentwicklung<br />
und den zugrunde liegenden<br />
strategischen Veränderungsprozess<br />
beleuchtet. Hierbei gehen die Autorinnen<br />
und Autoren insbesondere auf<br />
die Rolle und Handlungsmöglichkeiten<br />
der Unterstützungsstrukturen ein.<br />
„Curriculumentwicklung, insbesondere<br />
die Integration von Zukunftskompetenzen,<br />
bedeutet auch einen Kulturwandel,<br />
der alle Beteiligten betrifft und sich<br />
in einer veränderten Lehr-, Lern- und<br />
Prüfungskultur niederschlagen muss“,<br />
so Lavinia Ionica, die das Barcamp 2022<br />
initiierte.<br />
CHE<br />
https://www.che.de/<br />
download/studiengaenge-fuer-eine-digitale-welt-whitepaper-zur-curriculumentwicklung-als-hochschulweiter-veraenderungsprozess/
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
HOCHSCHULPOLITIK<br />
31<br />
Erstsemesterzahlen<br />
Stabilisierung auf niedrigerem Niveau<br />
Nach Jahren auf Rekordniveau schreiben<br />
sich mittlerweile deutlich weniger Studienanfängerinnen<br />
und -anfänger an deutschen<br />
<strong>Hochschule</strong>n ein. Nach rückläufigen<br />
Erstsemesterzahlen zwischen 2018<br />
und 2021 hat sich die Zahl der <strong>Neue</strong>inschreibungen<br />
seit 2022 wieder auf niedrigerem<br />
Niveau stabilisiert. Der leichte<br />
Anstieg ist allerdings auf einen Rekordwert<br />
bei ausländischen Studienanfängerinnen<br />
und -anfängern zurückzuführen,<br />
die überwiegend aus Asien stammen.<br />
<strong>Die</strong>s zeigt eine Auswertung des CHE<br />
Centrum für <strong>Hochschule</strong>ntwicklung.<br />
Jahrzehntelang stiegen die Studienanfängerzahlen<br />
in Deutschland bis<br />
zu ihrem Höchststand von 445.000 im<br />
Wintersemester 2011/12. Nach einer<br />
Stagnation auf hohem Niveau gingen<br />
die Werte seit dem Wintersemester<br />
2019/20 nun wieder deutlich zurück<br />
und lagen 2021/22 erstmals wieder bei<br />
unter 400.000 Personen. Ein Grund<br />
dafür ist der Rückgang der Geburtenzahlen<br />
in Deutschland zwischen 1990<br />
und 2011. Seitdem haben sich die Zahlen<br />
wieder auf niedrigerem Niveau stabilisiert.<br />
Laut vorläufigen Zahlen des Statistischen<br />
Bundesamtes schrieben sich<br />
zum Wintersemester 2023/24 402.617<br />
Personen erstmals an einer deutschen<br />
<strong>Hochschule</strong> ein. <strong>Die</strong>s entspricht einem<br />
Zuwachs von 1,1 Prozent gegenüber dem<br />
Vorjahr.<br />
Ein aktueller DatenCHECK des CHE<br />
zeigt allerdings, dass der Stabilisierungseffekt<br />
der Zahlen für das Wintersemester<br />
2022/23 hauptsächlich auf ein<br />
starkes Wachstum bei den ausländischen<br />
Studienanfängerinnen und -anfängern<br />
zurückzuführen ist. „Der leichte Anstieg<br />
der Erstsemester ist vor allem durch eine<br />
Rekordzahl an ausländischen Studienanfängerinnen<br />
und Studienanfängern<br />
zu erklären“, erläutert Marc Hüsch. „Zu<br />
Beginn der Corona-Pandemie war die<br />
Zahl ausländischer Erstsemester deutlich<br />
eingebrochen, nun schreiben sie<br />
sich wieder in hoher Zahl an deutschen<br />
<strong>Hochschule</strong>n ein“, so der Projektleiter<br />
des Portals hochschuldaten.de beim<br />
CHE. <strong>Die</strong> Zahl der deutschen Studienanfängerinnen<br />
und -anfänger ist dagegen<br />
weiter rückläufig und lag im Wintersemester<br />
2022/23 bei knapp 305.000<br />
Personen.<br />
Einen Rekordwert gab es mit rund<br />
93.000 Personen bei den Erstsemestern<br />
ohne deutsche Staatsangehörigkeit an<br />
deutschen <strong>Hochschule</strong>n. Gezählt wurden<br />
dabei sowohl sogenannte Bildungsinländer,<br />
die ihre Hochschulzugangsberechtigung<br />
(HZB) in Deutschland erworben<br />
haben, als auch Bildungsausländer, die<br />
die HZB im Ausland erworben haben.<br />
Mehr als 40 Prozent der internationalen<br />
Studienanfängerinnen und -anfänger<br />
in Deutschland stammen aus Asien. Mit<br />
rund 38.000 Erstsemestern liegt die Zahl<br />
sogar noch höher als vor dem Beginn der<br />
Corona-Pandemie. <strong>Die</strong> meisten ausländischen<br />
Studienanfängerinnen und -anfänger<br />
kamen 2022/23 mit 11.733 Personen<br />
aus Indien, gefolgt von China (5.661).<br />
Dabei ist auffällig, dass die Anzahl der<br />
Studienanfängerinnen und -anfänger aus<br />
Indien in den vergangenen Jahren stark<br />
gestiegen ist, die Zahl der Erstimmatrikulierten<br />
aus China hingegen rückläufig<br />
ist.<br />
Wie das CHE in einer Analyse aus<br />
dem vergangenen Jahr zeigen konnte,<br />
betrifft der Rückgang der Erstsemesterzahlen<br />
die Studienfächer unterschiedlich<br />
stark. <strong>Die</strong>ser Trend scheint sich weiter<br />
fortzusetzen, wie Marc Hüsch erläutert:<br />
„Während sich im Fach Maschinenbau/Verfahrenstechnik<br />
die Zahlen<br />
der Studienanfängerinnen und -anfänger<br />
seit 2011/12 halbiert haben, erlebt<br />
ein Trendfach wie Informatik ein nahezu<br />
konstantes Wachstum bei den Erstsemesterzahlen.“<br />
Insgesamt zeige die Analyse, so<br />
Hüsch, dass die Zahl der <strong>Neue</strong>inschreibungen<br />
von sehr vielen unterschiedlichen<br />
Faktoren abhänge. Insbesondere<br />
die Zahl der ausländischen Studienanfängerinnen<br />
und -anfänger werde vom<br />
Weltgeschehen beeinflusst und lässt<br />
sich daher für die Zukunft auch nur<br />
schwer vorhersagen. „Sollte die Zahl<br />
der ausländischen Studienanfängerinnen<br />
und -anfänger jedoch insgesamt<br />
weiter ansteigen, könnte eine sinkende<br />
Zahl an deutschen Studienanfängerinnen<br />
und -anfängern – die aufgrund<br />
der demografischen Entwicklung wahrscheinlich<br />
ist – möglicherweise auch<br />
künftig ausgeglichen werden“, so der<br />
Senior Expert Statistik und Datenvisualisierung<br />
beim CHE.<br />
CHE
32 HOCHSCHULPOLITIK<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Private <strong>Hochschule</strong>n<br />
Große Vielfalt: Typologie nicht staatlicher <strong>Hochschule</strong>n<br />
<strong>Die</strong> Bedeutung nicht staatlicher <strong>Hochschule</strong>n<br />
in Deutschland nimmt seit<br />
Jahren zu. Ein Hinweis darauf ist die<br />
gestiegene Anzahl privater <strong>Hochschule</strong>n<br />
und ihrer Studierenden. Aber auch<br />
kirchliche <strong>Hochschule</strong>n sind seit Jahrzehnten<br />
ein nicht wegzudenkender<br />
wichtiger Bestandteil der deutschen<br />
Hochschullandschaft. Allerdings unterscheiden<br />
sich die nicht staatlichen<br />
<strong>Hochschule</strong>n zum Teil recht deutlich<br />
voneinander. <strong>Die</strong>s zeigt eine Analyse<br />
des CHE Centrum für <strong>Hochschule</strong>ntwicklung.<br />
Von den aktuell 426 <strong>Hochschule</strong>n<br />
in Deutschland ist mehr als ein<br />
Drittel nicht in staatlicher Trägerschaft.<br />
Hierbei handelt es sich um sehr heterogene<br />
Hochschulinstitutionen, was ein<br />
Blick auf wenige Charakteristika bereits<br />
illustriert: Zu den Trägern dieser rund<br />
150 <strong>Hochschule</strong>n zählen in Deutschland<br />
unter anderem Kirchen, Unternehmen,<br />
Stiftungen oder Vereine. Von den kirchlichen<br />
Einrichtungen bestehen einige<br />
schon seit dem 19. Jahrhundert. <strong>Die</strong><br />
Mehrzahl der privaten Einrichtungen<br />
ist hingegen erst in den vergangenen<br />
30 Jahren gegründet worden.<br />
„In der öffentlichen Wahrnehmung<br />
werden die privaten und auch die kirchlichen<br />
<strong>Hochschule</strong>n immer als eine sehr<br />
homogene Gruppe wahrgenommen.<br />
Doch das entspricht nicht der Realität“,<br />
so Cort-Denis Hachmeister. „<strong>Die</strong><br />
nicht staatliche Hochschullandschaft<br />
in Deutschland ist sehr vielschichtig.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Hochschule</strong>n unterscheiden sich<br />
auch stark hinsichtlich ihrer Größe und<br />
Ausrichtung“, so der <strong>Hochschule</strong>xperte<br />
und CHE-Mitarbeiter.<br />
Das Verbundprojekt nsh-inno des<br />
Fraunhofer-Instituts für System- und<br />
Innovationsforschung ISI und des CHE,<br />
das im Rahmen einer aktuellen Förderlinie<br />
des Bundesministeriums für Bildung<br />
und Forschung (BMBF) im Juni 2023<br />
gestartet ist, beschäftigt sich speziell<br />
mit der Rolle von kirchlichen und privaten<br />
<strong>Hochschule</strong>n im Bereich Wissensund<br />
Technologietransfer. Das regionale<br />
Umfeld, in das die <strong>Hochschule</strong>n<br />
eingebettet sind, wird dabei als wichtige<br />
Bestimmungsgröße der produktiven<br />
Interaktionen zwischen nicht<br />
staatlichen <strong>Hochschule</strong>n und externen<br />
Akteuren besonders berücksichtigt.<br />
In einer ersten umfassenden Strukturanalyse<br />
wurden Basisangaben zu<br />
Hochschultyp und Trägerschaft, Gründungsjahr,<br />
geografischer Verortung,<br />
Studierendenzahl und Fächerprofil<br />
ausgewertet. Zusätzliche Charakteristika,<br />
die in die Betrachtung mit eingingen,<br />
waren u. a. der Grad der internationalen<br />
Ausrichtung der betrachteten<br />
<strong>Hochschule</strong>n, ihr Drittmittelaufkommen<br />
sowie die Zahl der dort abgelegten<br />
Promotionsprüfungen.<br />
<strong>Die</strong> untersuchten nicht staatlichen<br />
<strong>Hochschule</strong>n gruppierte das Projektteam<br />
von nsh-inno schließlich in insgesamt<br />
sieben unterschiedliche Cluster<br />
von <strong>Hochschule</strong>n.<br />
– Überregionale <strong>Hochschule</strong>n (28<br />
<strong>Hochschule</strong>n) sind hauptsächlich<br />
private <strong>Hochschule</strong>n mit einer<br />
hohen Anzahl an überregional<br />
verteilten Standorten oder Fernhochschulen<br />
mit einer überregional<br />
verteilten Studierendenschaft.<br />
– Theologisch/weltanschauliche<br />
<strong>Hochschule</strong>n (26 <strong>Hochschule</strong>n), bei<br />
denen Theologie oft das zentrale<br />
oder einzige Fach ist, bilden meist<br />
für eine berufliche Tätigkeit beim<br />
jeweiligen Träger aus. <strong>Hochschule</strong>n<br />
dieses Clusters sind mit im Schnitt<br />
161 Studierenden eher sehr kleine<br />
Einrichtungen.<br />
– Künstlerische <strong>Hochschule</strong>n (zehn<br />
<strong>Hochschule</strong>n) sind mit durchschnittlich<br />
71 Studierenden die kleinsten<br />
Einrichtungen. In das Cluster fallen<br />
zwei private und acht kirchliche<br />
Einrichtungen, u. a. <strong>Hochschule</strong>n<br />
für Kirchenmusik.<br />
– Breit aufgestellte Universitäten<br />
(zwölf <strong>Hochschule</strong>n) verfügen über<br />
mindestens zwei verschiedene Studienbereiche.<br />
<strong>Hochschule</strong>n dieses<br />
Clusters bieten im Durchschnitt 27<br />
Studienangebote für 2.900 Studierende<br />
pro Einrichtung an.<br />
– Spezialisierte Universitäten (zehn<br />
<strong>Hochschule</strong>n) sind ausschließlich<br />
private Universitäten, die im Wesentlichen<br />
ein Studienfach anbieten.<br />
Im Bereich Internationalisierung ist<br />
die Gruppe dieser <strong>Hochschule</strong>n im<br />
Vergleich zu den anderen führend.<br />
– Breit aufgestellte <strong>Hochschule</strong>n für<br />
angewandte Wissenschaft, kurz<br />
HAW, (46 <strong>Hochschule</strong>n) bilden<br />
die größte Gruppe unter den nicht<br />
staatlichen <strong>Hochschule</strong>n in Deutschland.<br />
Solche <strong>Hochschule</strong>n bieten in<br />
mindestens zwei Studienbereichen<br />
im Schnitt 14 Studiengänge an.<br />
– Spezialisierte HAW (20 <strong>Hochschule</strong>n),<br />
wie etwa Business Schools,<br />
verfügen über ein sehr schmales<br />
Fächerspektrum. <strong>Hochschule</strong>n<br />
dieses Clusters bieten deutlich weniger<br />
Studiengänge im Durchschnitt<br />
(sechs) an als breit aufgestellte<br />
HAW; auch die durchschnittliche<br />
Studierendenzahl ist niedriger.<br />
Bezugnehmend auf diese verschiedenen<br />
Cluster bzw. Typen nicht staatlicher<br />
<strong>Hochschule</strong>n werden im weiteren<br />
Projektverlauf von nsh-inno Muster<br />
des Wissens- und Technologietransfers<br />
vergleichend untersucht. Dazu werden<br />
die Potenziale der entsprechenden<br />
Hochschulcluster hinsichtlich ihres<br />
Beitrags zu regionalen Innovationssystemen<br />
und den branchenspezifischen<br />
Innovationsnetzwerken ihrer Träger<br />
ausgewertet.<br />
„Der Wissenstransfer nicht staatlicher<br />
<strong>Hochschule</strong>n und ihre spezifischen<br />
Beiträge für die Regionalentwicklung<br />
bzw. ihre Rolle in regionalen Innovationssystemen<br />
werden durch dieses<br />
Projekt erstmals genauer erforscht“,<br />
erläutert Dr. Hendrik Berghäuser vom<br />
Fraunhofer-Institut für System- und<br />
Innovationsforschung ISI den Hintergrund<br />
des Forschungsprojektes.<br />
CHE<br />
<strong>Die</strong> Meldungen in dieser Rubrik, soweit<br />
sie nicht namentlich gekennzeichnet<br />
sind, basieren auf Pressemitteilungen<br />
der jeweils genannten Institutionen.
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
HOCHSCHULPOLITIK<br />
33<br />
Hochschulforum Digitalisierung<br />
Visionen einer neuen Prüfungskultur<br />
Seit der Corona-Pandemie und nicht<br />
zuletzt durch die Breitenwirkung generativer<br />
KI-Tools wird an den <strong>Hochschule</strong>n<br />
so intensiv wie lange nicht mehr über<br />
das Prüfen gesprochen. Doch nicht nur<br />
die Prüfungsformate an sich, sondern<br />
auch die Rahmenbedingungen und der<br />
Umgang mit Prüfungen müssen sich<br />
ändern, um angemessen auf den technologischen<br />
Wandel zu reagieren. Das Diskussionspapier<br />
nimmt dabei eine Perspektive<br />
jenseits konkreter Prüfungsszenarien<br />
ein und beschreibt in zehn Visionsaspekten<br />
Vorbedingungen, ermöglichende<br />
Rahmenbedingungen sowie grundlegende<br />
Werte zeitgemäßen Prüfens.<br />
Das Diskussionspapier identifiziert<br />
auch grundlegende Störfelder für<br />
den Wandel der Prüfungskultur: Didaktisch<br />
Wünschenswertes stößt häufig an<br />
Grenzen des Machbaren im Sinne der<br />
Arbeitsbelastung von Prüferinnen und<br />
Prüfern sowie (vermeintlicher) rechtlicher<br />
Einschränkungen. Um diese Grenzen<br />
neu auszuloten, braucht es einen umfassenden<br />
und kontinuierlichen Austausch<br />
zu Erwartungen und Bedarfen hinsichtlich<br />
des Prüfens, der alle Statusgruppen<br />
umfasst – innerhalb der einzelnen <strong>Hochschule</strong>n<br />
wie im Gesamtsystem.<br />
Das HFD-Diskussionspapier und die<br />
darin enthaltene Vision basieren auf<br />
einer Workshopreihe im Sommer 2023,<br />
in der Studierende, Lehrende, Unterstützungsstrukturen<br />
sowie Hochschulleitungen<br />
und strategische Akteure statusgruppenintern<br />
über ihre Vorstellungen und<br />
Bedarfe diskutierten.<br />
CHE<br />
https://hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/<br />
uploads/<strong>2024</strong>/01/HFD_Diskussionspapier_28_Vision-einer_<br />
neuen_Pruefungskultur_final.pdf<br />
Psychische Belastungen bei Studierenden<br />
Nach der Pandemie noch kein normaler Studienalltag<br />
Prof. Dr. Beate Schücking, die Präsidentin<br />
des Deutschen Studierendenwerks<br />
(DSW), macht bei der DSW-Fachtagung<br />
Beratung in Berlin vor 130 Mitarbeitenden<br />
der psychologischen und sozialen Beratungsstellen<br />
der Studierendenwerke auf<br />
die anhaltenden Folgen aufmerksam, von<br />
denen die Beratungsarbeit seit der Coronapandemie<br />
betroffen ist.<br />
So stieg laut Schücking das Stressempfinden<br />
bei Studierenden während der<br />
Pandemie stark an, was unter anderem<br />
in den Ergebnissen der 22. Sozialerhebung<br />
zur wirtschaftlichen und sozialen<br />
Lage der Studierenden aufgezeigt wird.<br />
Stressauslösende Faktoren waren erhöhter<br />
Arbeitsaufwand durch die Online-Lehre,<br />
Wissens- und Kompetenzrückstände<br />
durch ausgefallene Veranstaltungen,<br />
Unzufriedenheit mit dem Online-Studium<br />
– insbesondere der Mangel an Austausch<br />
mit Kommilitoninnen, Kommilitonen und<br />
Lehrenden –, gesteigerte Eigenverantwortung<br />
und Selbstorganisation sowie der<br />
Verlust oder die Stundenreduzierung von<br />
Nebenjobs.<br />
Neben dem Anstieg des Stressempfindens<br />
verstärkte die Corona-Pandemie die<br />
Symptome von Depressionen und Ängsten.<br />
16 Prozent aller Studierenden gaben<br />
an, von mindestens einer gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigung betroffen zu sein,<br />
wovon 65 Prozent psychische Erkrankungen<br />
sind. Der Anteil der Studierenden, die<br />
Antidepressiva verordnet bekamen, ist laut<br />
Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse<br />
2023 von 2019 bis 2022 um 30<br />
Prozent gestiegen.<br />
<strong>Die</strong> psychischen Belastungen, die<br />
während der Pandemiezeit entstanden<br />
sind, hinterlassen aber auch nach deren<br />
Ende weiterhin Spuren, wie Schücking<br />
erläutert: „Verhaltensweisen, die unter<br />
den Bedingungen des Online-Studiums<br />
entstanden sind, enden nicht automatisch<br />
mit dem offiziell verkündeten Ende<br />
der Pandemie. Einige Studierende haben<br />
die Rückkehr in den normalen Studienalltag<br />
nicht geschafft. Oft ist die Leistungsfähigkeit<br />
beeinträchtigt, sowohl im Studium<br />
als auch bei der Erwerbsfähigkeit.<br />
<strong>Die</strong>se Entwicklungen führen dazu, dass<br />
die Nachfrage nach psychologischer Beratung<br />
bei den Studierendenwerken bundesweit<br />
enorm gestiegen ist, was sich auch in<br />
drastisch längeren Wartezeiten für beratungsbedürftige<br />
Studierende äußert. Mussten<br />
etwa Betroffene beim Studentenwerk<br />
Schleswig-Holstein im Jahr 2019 zu Spitzenzeiten<br />
sechs Wochen auf eine Beratung<br />
warten, waren es 2020 zehn und 2021<br />
mehr als 14 Wochen.<br />
Allerdings konnten seitdem die Wartezeiten<br />
wieder deutlich reduziert werden,<br />
beim Studentenwerk Schleswig-Holstein<br />
warteten Studierende im Jahr 2022 erfreulicherweise<br />
nur ein bis drei Wochen auf<br />
ein Erstgespräch.“<br />
<strong>Die</strong>se positive Entwicklung nach dem<br />
Ende der Pandemie ist Sonderprogrammen<br />
zum Ausbau des coronabedingten personellen<br />
Mehrbedarfs der psychologischen<br />
Beratungsstellen in einigen Bundesländern<br />
zu verdanken, wie Baden-Württemberg,<br />
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,<br />
Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen<br />
und Schleswig-Holstein. Dazu Schücking:<br />
„Angesichts der aktuellen weltpolitischen<br />
Lage, welche die Studierenden zunehmend<br />
belastet und zu wachsender Verunsicherung<br />
führt, appellieren wir an Bund und<br />
Länder, langfristige finanzielle Ressourcen<br />
für die Psychologischen und Sozialen<br />
Beratungsstellen bereitzustellen. Konkret<br />
fordern wir zehn Millionen Euro Bund-Länder-Mittel<br />
über die kommenden vier Jahre.<br />
<strong>Die</strong>s ist entscheidend, um die personellen<br />
Kapazitäten der Beratungsstellen der<br />
Studierendenwerke dauerhaft zu erweitern<br />
oder zumindest auf dem Niveau zu<br />
halten, das durch die vorübergehenden<br />
Sonderförderungen einiger Bundesländer<br />
ermöglicht wurde.“<br />
DSW
Lehrziel Demokratie – werden wir dieser<br />
Verantwortung gerecht?<br />
Kolloquium <strong>2024</strong><br />
Freitag, 3. Mai <strong>2024</strong>, 11:00–18:30 Uhr, Courtyard Marriott Schwerin<br />
PROGRAMM<br />
11:00 Uhr Begrüßung<br />
Prof. Dr.-Ing. Tobias Plessing, Präsident des hlb<br />
11:05 Uhr Keynote Lehrziel Demokratie –<br />
Was heißt das für uns?<br />
Prof. Dr. Jochen Struwe, Vizepräsident des hlb<br />
11:20 Uhr Impulsvorträge<br />
Lebenslanges Lernen trifft gläserne Decke<br />
Ye-One Rhie, MdB, Mitglied im<br />
Wissenschaftsausschuss des Deutschen Bundestags<br />
<strong>Hochschule</strong>n als demokratische Orte und<br />
Impulsgeberinnen unserer Gesellschaft<br />
Christian Schaft, MdL, Mitglied im Ausschuss für<br />
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft des<br />
Landtags Thüringen<br />
Prof. Dr. Mario Voigt, MdL, Landtag Thüringen<br />
(angefragt)<br />
Starke Hochschulgemeinschaft – starke Demokratie<br />
Didem Azgin, <strong>Hochschule</strong> München,<br />
Vorstandsvorsitzende der Studierendenvertretung,<br />
Senatsmitglied und Anastasiia Orlova, <strong>Hochschule</strong><br />
München, Stv. Vorsitzende der Studierendenvertretung,<br />
Fachschaftssprecherin der Fakultät<br />
Mathematik und Informatik<br />
12:00 Uhr Diskussion<br />
13:00 Uhr Pause<br />
Courtyard Marriott Schwerin,<br />
Zum Schulacker 1<br />
19061 Schwerin<br />
Google Maps: t.ly/qnWar<br />
14:30 Uhr Workshops<br />
Service Learning und (spielerische) Demokratiebildung<br />
Prof. Dr. Susanne Koch, Frankfurt University of Applied Sciences,<br />
Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung<br />
Wie können Lehrende die Befähigung zu wissenschaftlicher oder<br />
künstlerischer Arbeit und zu verantwortlichem Handeln in einem<br />
freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat vermitteln?<br />
Prof. Dr. Jochen Struwe<br />
Wie können wir als Hochschulgemeinschaft zu<br />
Demokratiemultiplikatorinnen und -multiplikatoren werden?<br />
Didem Azgin und Anastasiia Orlova<br />
16:30 Uhr Ergebnispräsentation<br />
17:00 Uhr Kommunikationspause<br />
17:30 Uhr Abschlussdiskussion<br />
18:30 Uhr Ende der Veranstaltung<br />
Moderation: Prof. Dr. Christoph Maas, Chefredakteur der<br />
Zeitschrift „<strong>Die</strong> <strong>Neue</strong> <strong>Hochschule</strong>“<br />
Anmeldung bis zum<br />
29. April <strong>2024</strong><br />
Online https://hlb.de/anmeldung-kolloquium<br />
Telefon 0228 555256-0<br />
E-Mail hlb@hlb.de
DNH 2 | <strong>2024</strong> AKTUELL 35<br />
<strong>Neue</strong>s aus der Rechtsprechung<br />
De-Mail-Konto auch für Hochschullehrende,<br />
die als Verteidiger<br />
auftreten<br />
Nach mehreren Entscheidungen des<br />
Kammergerichts Berlin gilt die besondere<br />
Formvorschrift des § 32d Strafprozessordnung<br />
(StPO) für Verteidiger und<br />
Rechtsanwälte auch für Hochschullehrerinnen<br />
und -lehrer, die Verteidiger sind.<br />
In § 32 StPO heißt es u. a.: „Verteidiger<br />
und Rechtsanwälte sollen den Strafverfolgungsbehörden<br />
und Gerichten<br />
Schriftsätze und deren Anlagen sowie<br />
schriftlich einzureichende Anträge und<br />
Erklärungen als elektronisches Dokument<br />
übermitteln. <strong>Die</strong> Berufung und ihre<br />
Begründung, die Revision, ihre Begründung<br />
und die Gegenerklärung sowie die<br />
Privatklage und die Anschlusserklärung<br />
bei der Nebenklage müssen sie als elektronisches<br />
Dokument übermitteln.“<br />
Der eindeutige Wortlaut von § 32d<br />
StPO sehe die entsprechende Verpflichtung<br />
gerade nicht nur für Rechtsanwältinnen<br />
und Rechtsanwälte, sondern für<br />
„Verteidiger und Rechtsanwälte“ vor. Zu<br />
Verteidigerinnen und Verteidigern könnten<br />
nach § 138 Absatz 1 StPO Rechtsanwältinnen<br />
und Rechtsanwälte sowie die<br />
Rechtslehrerinnen und -lehrer an deutschen<br />
<strong>Hochschule</strong>n im Sinne des Hochschulrahmengesetztes<br />
mit Befähigung<br />
zum Richteramt gewählt werden. Rechtslehrende<br />
an <strong>Hochschule</strong>n seien wiederum<br />
als ordentliche und außerordentliche<br />
– auch emeritierte – Professorinnen,<br />
Professoren, Privatdozentinnen und<br />
-dozenten und Lehrbeauftragte, welche<br />
die Befähigung haben, ein Rechtsgebiet<br />
an einer deutschen Universität oder<br />
gleichrangigen <strong>Hochschule</strong> selbstständig<br />
zu lehren, zu charakterisieren.<br />
Raum für eine teleologische Reduktion<br />
von § 32d Satz 1 StPO, durch die<br />
Verteidiger, die nicht Rechtsanwälte<br />
sind, vom Anwendungsbereich der Norm<br />
ausgenommen werden, bestehe nicht. Es<br />
sei nicht ersichtlich, dass dieser Personenkreis<br />
von der Norm nicht erfasst<br />
werden sollte. In der Gesetzesbegründung<br />
werde zudem deutlich gemacht,<br />
dass dieses besondere Formerfordernis<br />
nicht für Beschuldigte, nicht vertretene<br />
Nebenkläger und sonstige Verfahrensbeteiligte<br />
gelten soll. Ausgenommen<br />
werden sollte also, so das Gericht, vor<br />
allem der „einfache“ Bürger in seinem<br />
Kontakt mit der Strafjustiz, dessen<br />
Zugang nicht erschwert werden sollte.<br />
Daraus könne im Umkehrschluss gefolgert<br />
werden, dass die am Verfahren<br />
beteiligten Beistände von Beschuldigten<br />
und Nebenklägerinnen und -klägern<br />
vollständig erfasst werden sollten.<br />
Dafür spreche schließlich auch der<br />
Sinn und Zweck der Norm, denn eine<br />
elektronische Aktenführung könne nur<br />
dann die damit verbundenen Vorteile voll<br />
umfänglich entfalten, wenn möglichst<br />
alle Prozessbeteiligten ihre Beiträge<br />
systemgerecht einreichen. Folglich sollte<br />
der davon ausgenommene Personenkreis<br />
möglichst klein bleiben. Soweit der<br />
konkret betroffene Verteidiger meine, für<br />
ihn könne die Vorschrift nicht gelten, da<br />
er als Hochschullehrer kein besonderes<br />
elektronisches Anwaltspostfach erhalten<br />
könne, führe dies zu keiner anderen<br />
Bewertung. Denn nach § 32a Absatz<br />
4 Satz 1 Nr. 1 StPO stehe als möglicher<br />
sicherer Übermittlungsweg im Sinne von<br />
§ 32a StPO der Versand mittels eines<br />
De-Mail-Kontos jedem offen.<br />
Praxistipp<br />
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,<br />
die als Verteidiger auftreten,<br />
sollten sich daher um die Anschaffung<br />
eines entsprechenden De-Mail-Kontos<br />
kümmern. Wie das Kammergericht zu<br />
Recht ausgeführt hat: Jedem steht die<br />
Eröffnung eines solchen Kontos offen.<br />
Kammergericht Berlin, Beschlüsse<br />
vom 11. Mai 2022, Az. 3 Ws (B) 88/22,<br />
162 Ss 47/22 und vom 25. März 2022,<br />
Az. 3 Ws (B) 71/22, 162 Ss 38/22.<br />
Ersatztermin für Bewerbungsgespräch<br />
bei Schwerbehinderung<br />
Ein öffentlicher Arbeitgeber ist grundsätzlich<br />
verpflichtet, einem schwerbehinderten<br />
Menschen einen Ersatztermin<br />
anzubieten, wenn dieser nicht zum<br />
Vorstellungsgespräch kommen kann.<br />
Voraussetzung dafür ist, dass ein<br />
gewichtiger Grund für das Nicht-Erscheinen<br />
besteht und die Durchführung<br />
des Ersatztermins dem Arbeitgeber<br />
zumutbar ist.<br />
In vorliegenden Fall suchte eine<br />
Kommune für ihre Ausländerbehörde<br />
„Fallmanager*innen im Aufenthaltsrecht“<br />
und beabsichtigte, „schwerbehinderte<br />
Bewerberinnen und Bewerber“<br />
gleicher Eignung und Qualifikation<br />
bevorzugt einzustellen. Ein Schwerbehinderter<br />
sagte das Vorstellungsgespräch<br />
wegen Terminkollision ab. Dabei<br />
wurde ihm allerdings kein Ersatztermin<br />
angeboten, mit der Begründung, dass<br />
das Stellenbesetzungsverfahren nicht<br />
weiter verzögert werden solle. Weil<br />
die Behörde nach § 165 S. 3 Sozialgesetzbuch<br />
(SGB) IX verpflichtet gewesen<br />
wäre, ihm einen Alternativtermin anzubieten,<br />
verlangte er eine Entschädigung<br />
nach dem Antidiskriminierungsgesetz<br />
(AGG). Während das Bundesarbeitsgericht<br />
den Entschädigungsanspruch<br />
aus dem AGG verneinte – es liege<br />
insoweit kein Verstoß vor –, stellte es<br />
aber fest, dass der Schwerbehinderte<br />
gegenüber der öffentlichen Arbeitgeberin<br />
grundsätzlich einen Anspruch auf<br />
das Angebot eines Ersatztermins habe.<br />
Denn ansonsten sei das Ziel, im Bewerbungsverfahren<br />
die Chancen behinderter<br />
Menschen zu verbessern, nicht zu<br />
erreichen.<br />
<strong>Die</strong>ser Anspruch scheiterte konkret<br />
allerdings an der Zumutbarkeit. Das<br />
Gericht argumentierte, dass die Behörde<br />
eine Vielzahl von Bewerbungsverfahren<br />
durchzuführen hatte und ein<br />
anderes Vorgehen organisatorisch mit<br />
Blick auf die langen internen Bearbeitungszeiten<br />
auch nicht möglich gewesen<br />
wäre.<br />
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom<br />
23. November 2023, Az. 8 AZR 164/22.<br />
Dr. Christian Fonk
36 AKTUELL<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Veröffentlichungen von Kolleginnen & Kollegen<br />
TECHNIK/INFORMATIK/<br />
NATURWISSENSCHAFTEN<br />
Grundkurs Informatik<br />
Grundlagen und Konzepte für die erfolgreiche<br />
IT-Praxis<br />
Eine umfassende, praxisorientierte<br />
Einführung<br />
H. Ernst, J. Schmidt, G. Beneken (alle TH<br />
Rosenheim)<br />
8. Auflage<br />
Springer Vieweg 2023<br />
Grundkurs Informatik<br />
Das Übungsbuch: 163 Aufgaben mit<br />
Lösungen<br />
J. Schmidt (TH Rosenheim)<br />
3. Auflage<br />
Springer Vieweg 2023<br />
BERICHTE AUS DEM hlb<br />
Gewissensbisse<br />
Fallbeispiele zu ethischen Problemen der<br />
Informatik<br />
Hrsg. von D. Weber-Wulff (HTW Berlin),<br />
Ch. B. Class (EAH Jena), W. Coy, C. Kurz,<br />
O. Obert, R. Rehak, C. Trinitis, St. Ullrich<br />
Transcript <strong>2024</strong><br />
BETRIEBSWIRTSCHAFT/<br />
WIRTSCHAFT/RECHT<br />
Mapping Sustainability Measurement<br />
A Review of the Approaches, Methods,<br />
and Literature<br />
Sustainable Development Goals Series<br />
English Edition<br />
A. Gehringer, S. Kowalski (beide TH Köln)<br />
Springer <strong>2024</strong><br />
<strong>Die</strong> Renaissance des Marxismus<br />
D. Jdanoff (DHBW Heilbronn)<br />
Kohlhammer Verlag 2023<br />
Vertrauen in Künstliche Intelligenz.<br />
Eine multiperspektivische Betrachtung<br />
S. Schork (TH Aschaffenburg)<br />
Springer Nature <strong>2024</strong><br />
SOZIALE ARBEIT/GESUNDHEIT/<br />
BILDUNG<br />
Zwischen Restauration und<br />
Inneren Reformen<br />
Cora Baltussens transnational kontextualisiertes<br />
Leben und Wirken als Beitrag<br />
zur Entwicklung der Supervision in der<br />
Bundesrepublik Deutschland in den<br />
1960er Jahren<br />
V. J. Walpuski<br />
Beltz Juventa 2023<br />
Für die Physiotherapie<br />
Checklisten Krankheitslehre<br />
mit Red Flags<br />
C. Zalpour (HS Osnabrück)<br />
Elsevier <strong>2024</strong><br />
Europäische Hochschulpolitik<br />
hlb wird Mitglied der EURASHE<br />
Am 11. März hat das Board der European<br />
Association of Institutions in Higher<br />
Education (EURASHE) die hlb-Bundesvereinigung<br />
als assoziiertes Mitglied<br />
aufgenommen. <strong>Die</strong> EURASHE ist der<br />
europäische Dachverband der HAW/<br />
FH sowie <strong>Hochschule</strong>inrichtungen mit<br />
berufsorientierter Ausrichtung. Als beratendes<br />
Mitglied gehört sie der Bologna-Follow-up-Group<br />
an und vertritt die<br />
Interessen von Bildungseinrichtungen<br />
mit starker Anwendungs- und Berufsorientierung.<br />
<strong>Die</strong> EURASHE setzt sich für die<br />
Weiterentwicklung von Richtlinien<br />
und Empfehlungen für den Europäischen<br />
Hochschul-, Forschungs- und<br />
Innovationsraum ein und steht im<br />
engen Austausch mit den zuständigen<br />
Abteilungen der Europäischen Kommission.<br />
Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf<br />
der Qualitätssicherung im berufspraktischen<br />
akademischen Ausbildungsbereich<br />
und der anwendungsbezogenen<br />
Forschung. Nicht zuletzt unterstützt die<br />
EURASHE beim Aufbau von europäischen<br />
Hochschulallianzen.<br />
Mit der Mitgliedschaft in der EURAS-<br />
HE vertieft der hlb den Austausch<br />
mit gleichgesinnten Organisationen,<br />
um gemeinsam Verbesserungen der<br />
Rahmenbedingungen für die angewandte<br />
Forschung und die <strong>Hochschule</strong>n<br />
für angewandte Wissenschaften<br />
zu erwirken. Beispiele dafür sind die<br />
Zusammenarbeit von EURASHE und<br />
hlb innerhalb der Coalition for Advancing<br />
Research Assessment (CoARA), die<br />
sich für eine Reform der Leistungsbewertung<br />
von Forschung einsetzt, oder<br />
der Konsultationsprozess zu „Attractive<br />
and Sustainable Careers in Higher<br />
Education“, in den der hlb beratend<br />
einbezogen war. <strong>Die</strong> <strong>Hochschule</strong>n für<br />
angewandte Wissenschaften haben<br />
von der Entwicklung des europäischen<br />
Hochschulraums, der Anerkennung<br />
der Gleichwertigkeit ihrer Abschlüsse<br />
sowie von den Impulsen für angewandte<br />
Forschung in der EU-Kohäsionsförderung<br />
profitiert. Angewandte<br />
Wissenschaften stehen auch im neuen<br />
Forschungsrahmenprogramm der EU im<br />
Fokus. Dafür wird sich der Hochschullehrerbund<br />
hlb gemeinsam mit EURAS-<br />
HE starkmachen.<br />
PM hlb<br />
Vom 22. bis 23. Mai <strong>2024</strong> findet die 33. Jahreskonferenz der EURASHE<br />
in St. Pölten, Österreich, unter dem Titel „Stronger Together“ statt:<br />
https://www.eurashe.eu/events/annual-conference-<strong>2024</strong>/
DNH 2 | <strong>2024</strong> AKTUELL 37<br />
Neuberufene Professorinnen & Professoren<br />
BADEN-WÜRTTEMBERG<br />
Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Alshut, Mechatronische<br />
Systeme in Gesundheit und Pflege, HS<br />
Esslingen<br />
Prof. Dr. Till Ansgar Baumhauer, Praxis<br />
und Theorie der bildenden Künste, HfWU<br />
Nürtingen-Geislingen<br />
Prof. Dr. med. Tanja Beament, Allgemeinmedizin<br />
und Grundlagen ärztlicher Behandlung,<br />
HS Aalen<br />
Prof. Dr. rer. nat. Alexander Brandt, Data<br />
Science und digitale Technologien, DHBW<br />
Stuttgart<br />
Prof. Dr.-Ing. Philipp Bulling, Elektrotechnik,<br />
Elektronik und Digitalisierung, HS<br />
Esslingen<br />
Prof. Dr. Alexander Grüning, Informatik,<br />
DHBW Ravensburg<br />
Prof. Dr. Thomas Hanstein, Berufspädagogik,<br />
DIPLOMA HS<br />
Prof. Dr. Eva Kircher, Medizinpädagogik,<br />
SRH HS für Gesundheit<br />
Prof. Dr. phil. Michel Mann, Betriebswirtschaftslehre,<br />
insbes. Handel, DHBW Heilbronn<br />
Prof. Maria Mohr, Film und Video, Merz<br />
Akademie Stuttgart – HS für Gestaltung,<br />
Kunst und Medien<br />
Prof. Dipl.-Des. Henrik Mucha, Interaction<br />
Design, HdM Stuttgart<br />
Prof. Dr. Jasmine Naun, Pharmamanagement,<br />
DIPLOMA HS<br />
Prof. Dr. Ricarda Schlimbach, Wirtschaftsinformatik,<br />
insbes. Digitales Management,<br />
HS Heilbronn<br />
Prof. Dr. phil. Volker Jörn Walpuski, Supervision<br />
und Coaching, Ev. HS Freiburg<br />
BAYERN<br />
Prof. Dr. Katharina Angermeier, Theorien<br />
und Methoden der Sozialen Arbeit, Kath.<br />
Stiftungshochschule München<br />
Prof. Dr. rer. nat. Martina Artmann, Grüne<br />
Infrastruktur, HS Weihenstephan-Triesdorf<br />
Prof. Dr. Klaus Brunner, Angewandte<br />
Informatik und Softwareengineering, HS<br />
München<br />
Prof. Dr.-Ing. Matthias Ehrenwirth, Anlagen<br />
für dezentrale Energiewandlung, TH<br />
Nürnberg GSO<br />
Prof. Dr. Susanna Endres, Pädagogik mit<br />
Schwerpunkt Medienpädagogik und Digitale<br />
Bildung, Kath. Stiftungshochschule<br />
München<br />
Prof. Dr. rer. nat. Andrea Früh-Müller,<br />
Applied Remote Sensing and Landscape<br />
Analysis, HS Weihenstephan-Triesdorf<br />
Prof. Dr. rer. pol. Michaela Gebele-Ruhland,<br />
Personalmanagement, HS Hof<br />
Prof. Dr. Daniel Gerhard, Strategisches<br />
Management und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,<br />
TH Nürnberg GSO<br />
Prof. Dr.-Ing. Daniel Hofer, Apparate-<br />
und Anlagenkonstruktion, TH Würzburg-Schweinfurt<br />
Prof. Dr.-Ing. Markus Müller, Räumliche<br />
Analytische Künstliche Intelligenz, TH<br />
Würzburg-Schweinfurt<br />
Prof. Dr. Roman Rusch, Moderation, Interviewtechnik<br />
und Präsentation, HS Ansbach<br />
Prof. Dr. Philipp Unberath, Artificial Intelligence,<br />
SRH – Wilhelm-Löhe HS<br />
Prof. Dr.-Ing. Laura Weitze, Technikkommunikation,<br />
TH Nürnberg GSO<br />
BERLIN<br />
Prof. Dr. Mischa Hansel, Sozialwissenschaften<br />
mit dem Schwerpunkt Cyber- und<br />
Informationssicherheit, HWR Berlin<br />
Prof. Dr. Janpeter Schilling, Risiko-, Krisenund<br />
Konfliktmanagement, HWR Berlin<br />
Prof. Dr. Jana Werg, Angewandte Psychologie<br />
mit Schwerpunkt Umweltpsychologie,<br />
Deutsche HS für Gesundheit & Sport<br />
BRANDENBURG<br />
Prof. Dr. rer. pol. Susanne Marx, Allgemeine<br />
Betriebswirtschaftslehre, insbes. Projektmanagement,<br />
TH Wildau<br />
BREMEN<br />
Prof. Dr. Kay Suwelack, Digitale Prozesse in<br />
der Umwelttechnik, HS Bremen<br />
HAMBURG<br />
Prof. Dr. Katja Starken, International<br />
Management, HSBA Hamburg School of<br />
Business Administration<br />
Prof. Dr. rer. nat. Andy Witt, Business<br />
Informatics mit Schwerpunkt Digitalisierung,<br />
HSBA Hamburg School of Business<br />
Administration<br />
HESSEN<br />
Prof. Dr. Lars Dittrich, Staat und Verfassung,<br />
Hessische HS für öffentliches Management<br />
und Sicherheit<br />
Prof. Dr. Stephanie Ernst, Recht der Sozialen<br />
Arbeit, HS Fulda<br />
Prof. Dr. Kristina Lemmer, Verwaltungsinformatik,<br />
Hessische HS für öffentliches<br />
Management und Sicherheit<br />
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schrems, Life<br />
Cycle Management, TH Mittelhessen<br />
Prof. Dr. Jan Steffens, Inclusive Education<br />
mit dem Schwerpunkt Entwicklung und<br />
Teilhabe, Ev. HS Darmstadt<br />
NIEDERSACHSEN<br />
Prof. Dr. phil. Ilka Benner, Berufspädagogik<br />
mit Schwerpunkt Lernortgestaltung und<br />
Lernortkooperation in den Gesundheitsberufen,<br />
Ostfalia HS<br />
Prof. Dr.-Ing. Achim Breckweg, Fertigungstechnik,<br />
HS Osnabrück<br />
Prof. Dr. Karin Cudak, Inklusion, Teilhabe<br />
und Soziale Arbeit, HAWK Hildesheim-Holzminden-Göttingen
38 AKTUELL<br />
DNH 2 | <strong>2024</strong><br />
Neuberufene Professorinnen & Professoren<br />
Prof. Dr. Ingo de Vries, Bioprozess- und<br />
Fermentationstechnik in der Wirkstoffproduktion,<br />
HS Emden/Leer<br />
Prof. Dr. rer. medic. Shiney Franz, Pflege,<br />
HAWK Hildesheim-Holzminden-Göttingen<br />
Prof. Dr. phil. Björn Hermstein, Bildungssoziologie<br />
in der Sozialen Arbeit, Ostfalia<br />
HS<br />
Prof. Dr. phil. Michael Lichtblau, Kindheitspädagogik<br />
mit Schwerpunkt frühkindliche<br />
Entwicklungs- und Bildungsprozesse,<br />
Ostfalia HS<br />
Prof. Dr.-Ing. Javad Mola, Werkstofftechnik<br />
und -mechanik metallischer Werkstoffe, HS<br />
Osnabrück<br />
Prof. Karsten Moldenhauer, Werkstoffe der<br />
Elektrotechnik, Energiespeichertechnologien<br />
sowie Physik, HS Hannover<br />
Prof. Dr. Philip Niemeyer, Mechatronik, HS<br />
Osnabrück<br />
Prof. Dr. Sven Stadtmüller, Gesundheitsbezogene<br />
empirische Sozialforschung in der<br />
Sozialen Arbeit, HAWK Hildesheim-Holzminden-Göttingen<br />
Prof. Dr.-Ing. Monika Strickstrock, Dentale<br />
Werkstofftechnologie und -analytik der<br />
Keramiken, HS Osnabrück<br />
NORDRHEIN-WESTFALEN<br />
Prof. Dr. Frederik Simon Bäumer, Wirtschaftsinformatik,<br />
insbes. Data Science, HS<br />
Bielefeld<br />
Prof. Dr. rer. nat. Anna Lea Dyckhoff,<br />
Customer Experience, FH Aachen<br />
Prof. Dr. Rainer Edelbrock, Kulturelle<br />
Bildung im Kontext Sozialer Arbeit, Kath.<br />
HS NRW<br />
Prof. Dipl.-Ing. Tobias Götz, Holzbau und<br />
Baumechanik, TH Köln<br />
Prof. Dr. phil. Kolja Tobias Heckes, Fachwissenschaft<br />
Soziale Arbeit, Kath. HS NRW<br />
Prof. Frank Höhne, Illustration, HS Düsseldorf<br />
Prof. Sabine Krieg, Retail Design, HS<br />
Düsseldorf<br />
Prof. Dr. phil. Carolin Küppers, Gender in<br />
der Sozialen Arbeit, TH Köln<br />
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock, Fabrikbetrieb/Produktionsorganisation,<br />
HS Ruhr<br />
West<br />
Prof. Dr. rer. pol. Nils Ommen, Betriebswirtschaft,<br />
insbes. Digitales Marketing, FH<br />
Münster<br />
Prof. Dr.-Ing. Stephan Poßberg, KI im<br />
Engineering, HS Ruhr West<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Rademacher, Embedded<br />
Systems und Netze, TH Köln<br />
Prof. Felictitas Rohden, Gestaltungslehre<br />
Form und Farbe, HS Düsseldorf<br />
Prof. Dr. rer. nat. Robert Scheidweiler,<br />
Mathematik für das Ingenieurwesen, HS<br />
Düsseldorf<br />
Prof. Dr. Benny Schneider, Wirtschaftswissenschaften,<br />
HS Bund<br />
Prof. Dr. phil. Christin Schörmann, Soziale<br />
Arbeit, IU Internationale HS<br />
RHEINLAND-PFALZ<br />
Prof. Dr. Manoj Gupte, Betriebswirtschaftslehre<br />
mit dem Schwerpunkt internationales<br />
Management, HWG Ludwigshafen<br />
Prof. Dr. jur. Alfred Stapelfeldt, Umweltrecht<br />
und Klimaschutz, TH Bingen<br />
Prof. Dr. Stéphane Timmer, Allgemeine<br />
Betriebswirtschaftslehre, insbes. Strategisches<br />
und Internationales Management, HS<br />
Mainz<br />
Prof. Dr. Andrea Walkenhorst, Process<br />
Mining, HS Trier<br />
SACHSEN<br />
Prof. Dr. habil. Christina Beckord, Soziologie<br />
und empirische Sozialforschung, Ev. HS<br />
Dresden<br />
Prof. Dr. jur. Sören Hohner, Recht in der<br />
Sozialen Arbeit, HS Mittweida<br />
Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Rinke, Informatik<br />
mit dem Schwerpunkt Rechnerarchitektur,<br />
HTWK Leipzig<br />
SACHSEN-ANHALT<br />
Prof. Dr. Henning Bostelmann, Angewandte<br />
Ingenieurmathematik, HS Merseburg<br />
Prof. Dr. Frank Heckel, Web Engineering,<br />
HS Anhalt<br />
Prof. Dr. phil. Richard Lemke, Methoden<br />
der empirischen Sozialforschung, HS Merseburg<br />
Prof. Dr. Robert Nadler, Sozialwissenschaften,<br />
HS Harz<br />
SCHLESWIG-HOLSTEIN<br />
Prof. Dr. Kim Bräuer, Theorien und Methoden<br />
der Sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkt<br />
sozialer Ungleichheit, DH Schleswig-Holstein<br />
Prof. Dr. Cona Ehresmann, Gesundheitswissenschaften,<br />
FH Kiel<br />
Prof. Dr. rer. medic. Michaela Heinrich-Rohr,<br />
Sozialepidemiologie und empirische<br />
Sozialforschung, DH Schleswig-Holstein<br />
Prof. Dr.-Ing. Edgar Nehlsen, Naturnaher<br />
Wasserbau, TH Lübeck<br />
Prof. Dr. Serhat Yalçın, Soziale Arbeit in<br />
der Migrationsgesellschaft, FH Kiel<br />
THÜRINGEN<br />
Prof. Dr. Kerstin Mayhack, Soziale Arbeit<br />
mit dem Schwerpunkt Systemische Beratung,<br />
SRH HS für Gesundheit
DNH 2 | <strong>2024</strong> AKTUELL 39<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Hochschullehrerbund –<br />
Bundesvereinigung e. V. hlb<br />
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn<br />
Telefon: 0228 555 256-0<br />
Fax: 0228 555 256-99<br />
Chefredakteur:<br />
Prof. Dr. Christoph Maas<br />
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel<br />
Telefon: 04103 141 14<br />
christoph.maas@haw-hamburg.de<br />
(verantwortlich im Sinne des Presserechts<br />
für den redaktionellen Inhalt)<br />
Redaktion:<br />
Dr. Karla Neschke<br />
Telefon: 0228 555 256-0<br />
karla.neschke@hlb.de<br />
Schlusskorrektorat:<br />
Manuela Tiller<br />
www.textwerk-koeln.de<br />
Gestaltung und Satz:<br />
Nina Reeber-Laqua<br />
www.reeber-design.de<br />
Herstellung:<br />
Wienands Print + Medien GmbH<br />
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef<br />
Bezugsbedingungen:<br />
Jahresabonnements für Nichtmitglieder<br />
45,50 Euro (Inland) inkl. Versand<br />
60,84 Euro (Ausland) inkl. Versand<br />
Probeabonnement auf Anfrage<br />
Erfüllungs-, Zahlungsort<br />
und Gerichtsstand ist Bonn<br />
Anzeigen:<br />
Dr. Karla Neschke<br />
karla.neschke@hlb.de<br />
Erscheinung:<br />
zweimonatlich<br />
Fotonachweise:<br />
Titelbild: rudiernst © 123RF.com<br />
U4: magele-picture – stock.adobe.com<br />
S. 35, 36: vegefox.com – stock.adobe.com<br />
S. 37, 38: Murrstock – stock.adobe.com<br />
S. 39: Gstudio – stock.adobe.com<br />
Verbandsoffiziell ist die Rubrik „hlb aktuell“.<br />
Alle mit Namen der Autorin/des Autors<br />
versehenen Beiträge entsprechen nicht<br />
unbedingt der Auffassung des hlb sowie<br />
der Mitgliedsverbände.<br />
Redaktionsschluss dieser Ausgabe:<br />
23. Februar <strong>2024</strong><br />
ISSN 0340-448 x<br />
Persistent Identifier bei der<br />
Deutschen Nationalbibliothek:<br />
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:<br />
101:1-20220916111<br />
FÜR ANWENDUNGSBEZOGENE WISSENSCHAFT UND KUNST<br />
Autorinnen und Autoren gesucht<br />
3/<strong>2024</strong>: „KI-Sprachmodelle in der Lehre“,<br />
Redaktionsschluss: 26. April <strong>2024</strong><br />
4/<strong>2024</strong>: „Forschungsbewertung“,<br />
Redaktionsschluss: 14. Juni <strong>2024</strong><br />
5/<strong>2024</strong>: „Hidden Champions – kleine Fächer an HAW“,<br />
Redaktionsschluss: 25. August <strong>2024</strong><br />
Schicken Sie uns Ihre Beiträge, Informationen und Meinungen!<br />
Es erleichtert Ihnen und uns die Arbeit, wenn Sie<br />
Aufsatzmanuskripte frühzeitig ankündigen.<br />
Kontakt: Dr. Karla Neschke, karla.neschke@hlb.de
Seminarprogramm <strong>2024</strong><br />
FREITAG, 26. APRIL <strong>2024</strong><br />
Bewerbung, Berufung und Professur an einer <strong>Hochschule</strong> für angewandte Wissenschaften<br />
Online-Seminar | 9:30 bis 16:00 Uhr<br />
FREITAG, 14. JUNI <strong>2024</strong><br />
Professionelles und erfolgreiches Schreiben von Forschungsanträgen<br />
Online-Seminar | 10:00 bis 16:30 Uhr<br />
FREITAG, 6. SEPTEMBER <strong>2024</strong><br />
Professionelles und erfolgreiches Schreiben von Forschungsanträgen<br />
Online-Seminar | 10:00 bis 16:30 Uhr<br />
FREITAG, 27. SEPTEMBER <strong>2024</strong><br />
Vom Umgang mit Hierarchien in der HS – Tipps (nicht nur) für Frischberufene<br />
Siegburg, Kranz Parkhotel | 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr<br />
FREITAG, 7. NOVEMBER <strong>2024</strong><br />
Professionelles und erfolgreiches Schreiben von Forschungsanträgen<br />
Online-Seminar | 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr<br />
Anmeldung unter:<br />
https://hlb.de/seminare/