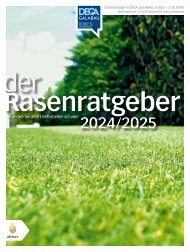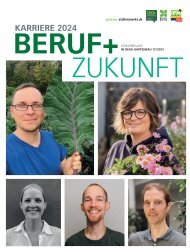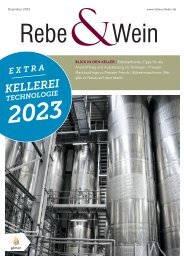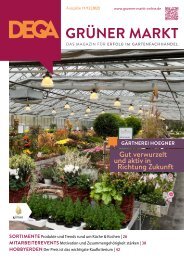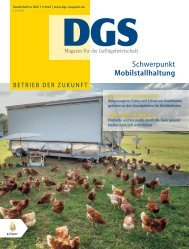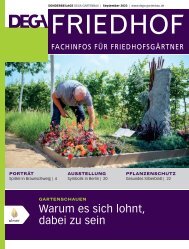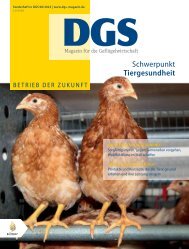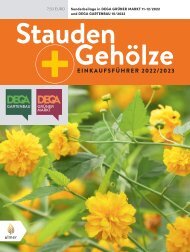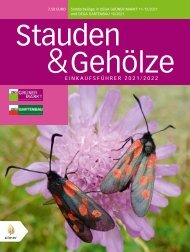Rebe und Wein Extra Rebschutz 2024
In Bezug auf den Pflanzenschutz waren die letzten Monate recht turbulent. Zuerst war die Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, auch bekannt unter dem Kürzel SUR, vom Tisch, die besonders den Weinbau getroffen hätte. Kurz darauf wurde auch das geplante Aus für glyphosathaltige Herbizide kassiert. Deutschland hat nun bis Mitte des Jahres Zeit, die hiesige Gesetzeslage anzupassen und darüber zu entscheiden, ob und welche Einschränkungen es beim Einsatz von Glyphosat künftig in Deutschland geben wird. Ein Komplettverbot ist ausgeschlossen. Damit Sie sich in den Irrungen und Wirrungen der Pflanzenschutzmittelzulassungen nicht verheddern, haben die Kollegen des WBI und der LVWO wieder alles Wichtige für die kommende Saison kompakt zusammengetragen.
In Bezug auf den Pflanzenschutz waren die letzten Monate recht turbulent. Zuerst war die Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, auch bekannt unter dem Kürzel SUR, vom Tisch, die besonders den Weinbau getroffen hätte. Kurz darauf wurde auch das geplante Aus für glyphosathaltige Herbizide kassiert. Deutschland hat nun bis Mitte des Jahres Zeit, die hiesige Gesetzeslage anzupassen und darüber zu entscheiden, ob und welche Einschränkungen es beim Einsatz von Glyphosat künftig in Deutschland geben wird. Ein Komplettverbot ist ausgeschlossen. Damit Sie sich in den Irrungen und Wirrungen der Pflanzenschutzmittelzulassungen nicht verheddern, haben die Kollegen des WBI und der LVWO wieder alles Wichtige für die kommende Saison kompakt zusammengetragen.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
März <strong>2024</strong><br />
www.rebe<strong>und</strong>wein.de<br />
E X T R A<br />
REB<br />
SCHUTZ<br />
<strong>2024</strong><br />
Zusammengestellt vom Staatlichen <strong>Wein</strong>bauinstitut<br />
Freiburg unter Mitwirkung der Staatlichen Lehr- <strong>und</strong><br />
Versuchsanstalt für <strong>Wein</strong>- <strong>und</strong> Obstbau <strong>Wein</strong>sberg, des<br />
Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg<br />
<strong>und</strong> der Staatlichen <strong>Wein</strong>bauberatung
E X T R A<br />
INHALT<br />
Regina Klein<br />
rklein@ulmer.de<br />
Turbulente<br />
Zeiten<br />
Auch in Bezug auf den<br />
Pflanzenschutz waren<br />
die letzten Monate<br />
recht turbulent.<br />
Zuerst war die Verordnung zur<br />
nachhaltigen Verwendung von<br />
Pflanzenschutzmitteln, auch<br />
bekannt unter dem Kürzel SUR,<br />
vom Tisch, die besonders den<br />
<strong>Wein</strong>bau getroffen hätte. Kurz<br />
darauf wurde auch das geplante<br />
Aus für glyphosathaltige<br />
Herbizide kassiert. Deutschland<br />
hat nun bis Mitte des Jahres<br />
Zeit, die hiesige Gesetzeslage<br />
anzupassen <strong>und</strong> darüber zu<br />
entscheiden, ob <strong>und</strong> welche<br />
Einschränkungen es beim Einsatz<br />
von Glyphosat künftig in<br />
Deutschland geben wird. Ein<br />
Komplettverbot ist ausgeschlossen.<br />
Damit Sie sich in den<br />
Irrungen <strong>und</strong> Wirrungen der<br />
Pflanzenschutzmittelzulassungen<br />
nicht verheddern, haben<br />
die Kollegen des WBI <strong>und</strong> der<br />
LVWO wieder alles Wichte für<br />
die kommende Saison kompakt<br />
zusammengetragen.<br />
TITELBILD | Ges<strong>und</strong>e, reife Trauben sind das Ziel.<br />
Bild: Krampfl<br />
Schaderreger<br />
3 Vorbeugen <strong>und</strong> bekämpfen<br />
Tipps zum Umgang mit<br />
Krankheiten <strong>und</strong> Schädlingen<br />
Zugelassene Mittel<br />
12 Tabellen <strong>und</strong> Hinweise<br />
Fungizide, Insektizide,<br />
Akarizide <strong>und</strong> Herbizide<br />
Mitteldosierung<br />
18 Neues Dosiermodell<br />
Praktische Tipps zur Laubwandflächenberechnung<br />
Anwenderschutz<br />
Die Inhalte dieses <strong>Extra</strong>s <strong>Rebschutz</strong> <strong>2024</strong> stammen von Fach instituten<br />
in Baden-Württemberg. Die Bayerische Landesanstalt für <strong>Wein</strong>- <strong>und</strong><br />
Gartenbau (LWG) Veitshöchheim weist darauf hin, dass die getroffenen<br />
Aussagen für das fränkische <strong>Wein</strong>bau gebiet gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
ebenso gelten. Für spezielle Gegeben heiten in Franken (zum Beispiel<br />
Peronospora, Oidium ) verweist die LWG auf den „<strong>Rebschutz</strong>leitfaden<br />
<strong>2024</strong>“ (LWG, Amtlicher <strong>Rebschutz</strong>dienst, Telefon 0931 / 9801501<br />
oder im Internet unter www.lwg.bayern.de) <strong>und</strong> die jeweils aktuellen<br />
Beratungs aussagen im <strong>Wein</strong>baufax Franken.<br />
<strong>Rebschutz</strong> <strong>2024</strong><br />
IMPRESSUM<br />
Ergänzend zu diesem Heft<br />
empfehlen wir den Beitrag<br />
„Alles eine Frage der Einstellung“<br />
sowie unsere Tutorial-<br />
Videos auf youtube.com/@<br />
rebe<strong>und</strong>wein<br />
21 Persönliche Schutzausrüstung<br />
Für einen sicheren Umgang<br />
mit Pflanzenschutzmitteln<br />
I N F O<br />
GILT AUCH FÜR<br />
FRANKEN<br />
Zudem können Sie sich bei uns<br />
einen Vordruck zur Dokumentation<br />
Ihrer Pflanzen schutzan<br />
wendungen herunterladen<br />
(www.rebe<strong>und</strong>wein.de, Webcode<br />
6108).<br />
HERAUSGEBER | Staatliches <strong>Wein</strong>bauinstitut Freiburg i. B. in Zusammenarbeit mit der Staatlichen<br />
Lehr- <strong>und</strong> Versuchsanstalt für <strong>Wein</strong>- <strong>und</strong> Obstbau <strong>Wein</strong>sberg.<br />
REDAKTION | Regina Klein (verantwortliche Redakteurin), Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart,<br />
Tel. 0178/1989724, E-Mail: rklein@ulmer.de.<br />
VERLAG | Eugen Ulmer KG, Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart, www.ulmer.de. UST-ID: DE147639185.<br />
VERLAGSRECHTE | Die in der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.<br />
Fotokopien für den persönlichen Gebrauch dürfen nur von den einzelnen Beiträgen oder Teilen daraus<br />
als einzelne Kopien erstellt werden.<br />
2 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
VORSCHAU AUF DIE REBSCHUTZSAISON <strong>2024</strong><br />
Tipps für den Pflanzenschutz<br />
Die <strong>Rebschutz</strong>saison <strong>2024</strong> steht aufgr<strong>und</strong> des „Gesetzes zur Änderung des Natur schutzgesetzes <strong>und</strong> des<br />
Landwirtschafts- <strong>und</strong> Landeskulturgesetzes“ in Baden-Württemberg vom Juli 2020 unter besonderen<br />
Vorzeichen. Das <strong>Extra</strong> „<strong>Rebschutz</strong> <strong>2024</strong>“ bietet wertvolle Hilfestellungen, um die Ziele der oben genannten<br />
Gesetzes novelle in der Praxis längerfristig umzusetzen.<br />
Zum Schutz des Anwenders<br />
<strong>und</strong> der Umwelt<br />
wird der Pflanzenschutz<br />
nach der guten fachlichen Praxis<br />
durchgeführt <strong>und</strong> berücksichtigt<br />
alle Maßnahmen des integrierten<br />
Pflanzenschutzes. Er beinhaltet<br />
biologische, biotechnische, pflanzenzüchterische<br />
sowie anbau<strong>und</strong><br />
kulturtechnische Maßnahmen,<br />
um die Anwendung chemischer<br />
Pflanzenschutzmittel auf<br />
ein notwendiges Maß zu reduzieren.<br />
Die Applikation der Pflanzenschutzmittel<br />
sollte dabei stets<br />
nach entsprechenden Schadensschwellen<br />
<strong>und</strong> mit der Anwendung<br />
von Prognoseverfahren<br />
durchgeführt werden.<br />
Krankheiten<br />
Falscher Mehltau – <strong>Rebe</strong>nperonospora<br />
(Plasmopara viticola):<br />
Für die Bekämpfung der <strong>Rebe</strong>nperonospora<br />
steht das Prognosemodell<br />
„VitiMeteoPeronospora“<br />
(www.vitimeteo.de) als Hilfsmittel<br />
zur Verfügung. Das Modell<br />
berechnet Infektions- <strong>und</strong> Ausbruchsbedingungen<br />
sowie Inkubationszeiten<br />
<strong>und</strong> ermittelt somit<br />
das mögliche Auftreten der<br />
Krankheit. Dadurch ist ein gezielter<br />
Einsatz von Fungiziden<br />
unmittelbar vor Ausbruch <strong>und</strong><br />
Neuinfektion der <strong>Rebe</strong>nperonospora<br />
möglich.<br />
Die Empfehlungen der regionalen<br />
<strong>Wein</strong>bauberatung <strong>und</strong> die<br />
aktuellen Wettervorhersagen<br />
sollten beim Festlegen der ersten<br />
Behandlung auf jeden Fall beachtet<br />
werden, da sich die Witterung<br />
in den verschiedenen <strong>Wein</strong>baubereichen<br />
Baden-Württembergs<br />
erheblich unterscheidet. Nachfolgend<br />
sind zwei Strategien für die<br />
Terminierung der ersten Behandlung<br />
beschrieben.<br />
→ Die erste Behandlung erfolgt<br />
STRATEGIEN ZUR BEKÄMPFUNG DER REBENPERONOSPORA <strong>2024</strong><br />
Wirkung 6 - 8 Tage<br />
400 cm 2 - 600 cm 2<br />
Blattfläche<br />
2 bis 4 Blätter<br />
Infektion<br />
Behandlung<br />
Inkubationszeit<br />
Wirkung<br />
keine Infektion<br />
schwache<br />
Infektion<br />
starke Infektion<br />
Zuwachs beachten!<br />
Zeit<br />
Fungizidwahl abhängig<br />
– Infektionsdruck<br />
– Phänologie<br />
– Prognose<br />
Termin bei 80 % Inkubation<br />
möglichst kurz vor Regen<br />
Fungizidwahl abhängig<br />
– Infektionsdruck<br />
– Phänologie<br />
– Prognose<br />
Zeit<br />
nächstmöglicher Termin<br />
kurativ/protektives Fungizid<br />
Zeit<br />
nach einer Primärinfektion (Bodeninfektion)<br />
zwischen dem 1-<br />
bis 3-Blattstadium, in der Regel<br />
kurz vor Ende der Inkubationszeit,<br />
also unmittelbar vor möglichen<br />
Sporulationen (Ausbrüchen)<br />
<strong>und</strong> Infektionen.<br />
→ Befinden sich die <strong>Rebe</strong>n jedoch<br />
schon zwischen dem 3- bis<br />
6-Blattstadium ist es sinnvoll, die<br />
erste Behandlung vor einer<br />
Primär infektion durchzuführen,<br />
da die erste Bodeninfektion in<br />
diesem Entwicklungsstadium bereits<br />
zu einem nennenswerten<br />
Befall an den Gescheinen führen<br />
kann.<br />
Nachfolgend wird die nebenstehende<br />
Abbildung näher erläutert.<br />
Nach der ersten Behandlung<br />
sind die Reborgane relativ lang<br />
vor Infektionen geschützt, wobei<br />
die Wirkungsdauer in erster Linie<br />
vom Zuwachs begrenzt wird.<br />
Selbst bei starkem Infektionsdruck<br />
ist ein Zuwachs von zwei<br />
bis vier Blättern bzw. 400 bis<br />
600 cm 2 Blattfläche je Haupttrieb<br />
zwischen zwei Behandlungen akzeptabel.<br />
Die Behandlungsintervalle<br />
können vom bisherigen 400 cm 2 -<br />
Standardabstand auf 600 cm 2<br />
Blattflächenzuwachs verlängert<br />
werden, wenn vorbeugende Fungizide<br />
zusammen mit Kaliumphosphonat-Präparaten,<br />
wie beispielsweise<br />
Veriphos, Frutogard<br />
oder das Kombipräparat Delan<br />
Pro ausgebracht werden. Dies gilt<br />
ausschließlich für die Hauptwachstumsphase<br />
zwischen dem<br />
3- bis 6-Blattstadium bis zur<br />
Schrotkorngröße der Beeren.<br />
Wenn jedoch darüber hinaus un-<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
3
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
OIDIUM-BEKÄMPFUNGSSTRATEGIE <strong>2024</strong><br />
13<br />
3 Blätter<br />
16<br />
6 Blätter<br />
NORMALLAGEN<br />
Schwefelpräparate<br />
BEFALLSLLAGEN<br />
SANIERUNGSFLÄCHEN<br />
Schwefel präparate<br />
19/57<br />
9 Blätter<br />
Gescheine<br />
Belanty<br />
Dynali<br />
Talendo (<strong>Extra</strong>)<br />
Prosper TEC<br />
Spirox<br />
Belanty<br />
Dynali<br />
Talendo (<strong>Extra</strong>)<br />
Prosper TEC<br />
Spirox<br />
60-69<br />
Blüte<br />
Mehltaufenster<br />
Strategie 1 (Normallagen): Bei diesen Lagen <strong>und</strong> Rebsorten<br />
stellt die Kontrolle von Oidium kein Problem dar. Die Lagen <strong>und</strong><br />
Rebsorten zeichnen sich durch ein geringes Befallsrisiko aus.<br />
Es wird nur ein geringer Spätbefall an einzelnen Blättern,<br />
Trieben oder Geiztrauben gef<strong>und</strong>en.<br />
1. Behandlung mit Netzschwefel ab 6-Blattstadium bzw. mit<br />
erster Peronosporabehandlung. 2. Behandlung ebenfalls mit<br />
Netzschwefel möglich. Spätestens ab 3. Behandlung bzw. ab<br />
letzter Vorblütebehandlung bis einschließlich BBCH 75<br />
(Mehltaufenster) mit Produkten aus orange-rotem Kasten.<br />
Behandlung mit Prosper TEC oder Spirox vor BBCH 61. Antiresistenzstrategie<br />
beachten! Behandlung mit Kusabi oder<br />
Vivando ab BBCH 75 . Danach Behandlung mit Topas,<br />
Sarumo /Galileo oder Kaliumhydrogencarbonaten (VitiSan,<br />
Kumar) bis BBCH 79 / 81. Abschlussbehandlung eventuell<br />
mit Netzschwefel Stulln oder mit biologischen Produkten<br />
(Taegro, FytoSave oder Romeo).<br />
Strategie 2 (Befallslagen): Bei diesen Lagen <strong>und</strong> Rebsorten ist<br />
mit einem starken Befall in Form von frühem Blattbefall, von<br />
Zeigertrieben <strong>und</strong> von Schäden an Trauben (> 5 % der Anlage)<br />
zu rechnen. Die Lagen <strong>und</strong> Rebsorten zeichnen sich durch ein<br />
hohes Befallsrisiko aus. Zu den Lagen gehören Rebflächen mit<br />
Taubildung, die morgens längere Zeit nicht abtrocknen, z. B.<br />
Waldrandlagen. Zu den besonders anfälligen Sorten gehören<br />
Trollinger <strong>und</strong> Cabernet Dorsa. Auch Dornfelder, Chardonnay<br />
<strong>und</strong> Müller-Thurgau sind stark anfällig.<br />
1. Behandlung mit Netzschwefel ab 3-Blattstadium (ca. 10<br />
bis 15 cm Trieblänge). 2. Behandlung bis einschließlich BBCH<br />
75 mit Produkten aus orange-rotem Kasten behandeln. Behandlung<br />
mit Prosper TEC oder Spirox vor BBCH 61. Antiresistenzstrategie<br />
beachten! Bei sehr schnellem Blatt- <strong>und</strong><br />
Traubenzuwachs im Mehltaufenster kann sich die Wirkungsdauer<br />
der Pflanzenschutzmittel verkürzen! Behandlung mit<br />
Kusabi oder Vivando nur außerhalb des Mehltaufensters.<br />
Danach Behandlung mit Topas, Sarumo/Galileo, Kaliumhydrogencarbonaten<br />
(VitiSan, Kumar) oder Netzschwefel Stulln<br />
bis BBCH 79 / 81. Biologische Produkte (Taegro, FytoSave<br />
oder Romeo) werden in diesen Flächen nicht empfohlen. In<br />
der kritischen Phase des Mehltaufensters jede Gasse fahren!<br />
71-73 75-77<br />
Schrotkorngröße bis Erbsengröße<br />
Luna Experience<br />
Luna Max<br />
Sercadis<br />
Collis<br />
Luna Experience<br />
Luna Max<br />
Sercadis<br />
Collis<br />
Belanty,<br />
Dynali,<br />
Talendo (<strong>Extra</strong>)<br />
Belanty,<br />
Dynali,<br />
Talendo (<strong>Extra</strong>)<br />
Bitte die Antiresistenzstrategie berücksichtigen!<br />
* Die Wirkstoffgruppe wird aufgr<strong>und</strong> von Resistenzen nicht im Mehltaufenster empfohlen.<br />
Kusabi*<br />
Vivando<br />
Kusabi*<br />
Vivando<br />
77-79<br />
Traubenschluss<br />
Galileo<br />
Sarumo<br />
Topas<br />
Galileo<br />
Sarumo<br />
Topas<br />
81<br />
Reifebeginn<br />
Netzschwefel<br />
Stulln<br />
Kumar<br />
Vitisan<br />
Taegro<br />
FytoSave<br />
Romeo<br />
Netzschwefel<br />
Stulln<br />
Kumar<br />
Vitisan<br />
Taegro<br />
FytoSave<br />
Romeo<br />
Befallslagen, in denen mehrere Jahre hintereinander<br />
verstärkt Traubenbefall auftritt, sind Sanierungsflächen:<br />
→ Oidium ist in diesen Flächen die Leitkrankheit, an der sich<br />
die Behandlungsintervalle orientieren sollten, ohne dabei die<br />
Behandlung der Peronospora zu vernachlässigen.<br />
→ In diesen Flächen ist es ratsam, die Strategie für Befallslagen<br />
zwei bis drei Jahre nacheinander, konsequent anzuwenden.<br />
Erst mit dieser Sanierungsstrategie ist es möglich<br />
Oidium längerfristig wieder zu kontrollieren<br />
Vorbeugende Maßnahmen<br />
→ Frühzeitige Kontrolle der Anlagen <strong>und</strong> Beseitigung von<br />
Zeigertrieben.<br />
→ Termingerechte Laubarbeit <strong>und</strong> Entblätterung durch führen.<br />
Chemische Maßnahmen<br />
→ Pflanzenschutzmittel aus der Wirkstoffkategorie „ L“<br />
(Collis, Luna Experience, Luna Max <strong>und</strong> Sercadis) sollten im<br />
Rahmen der Antiresistenzstrategie nur einmal pro Saison<br />
(BBCH 68-73) eingesetzt werden. Bei Befallslagen <strong>und</strong> anfälligen<br />
Sorten, wie z. B. Trollinger, Dornfelder, Cabernet<br />
Dorsa, Chardonnay <strong>und</strong> Müller-Thurgau können auch zwei<br />
Anwendungen durchgeführt werden. Diese sollten dann im<br />
Stadium BBCH 61-65 <strong>und</strong> BBCH 73-77 erfolgen.<br />
→ Keine Anwendung von Flint, da Resistenzen gegen Strobilurine<br />
bei Oidium weit verbreitet sind!<br />
→ Anwendung von Custodia nur bei Schwarzfäuleproblematik<br />
<strong>und</strong> nicht im Mehltaufenster (BBCH 57-77).<br />
→ Auch Kleinbetriebe sollten, neben Netzschwefel, Oidiumpräparate<br />
aus 5 Wirkstoffgruppen für einen idealen Wirkstoff<br />
kategorienwechsel bevorraten.<br />
→ Jede Wirkstoffgruppe möglichst nur einmal anwenden!<br />
→ Ein Schwefelzusatz zu organischen Fungiziden wird nicht<br />
empfohlen!<br />
Applikationsqualität <strong>und</strong> Dosierung<br />
→ Druck <strong>und</strong> Düsen regelmäßig kontrollieren.<br />
→ Angepasste Fahrgeschwindigkeit bis maximal ca. 6 km/h.<br />
→ In der kritischen Phase des Mehltaufensters in Befallslagen<br />
jede Gasse befahren.<br />
→ Wassermenge von mind. 350 - 500 l/ha verwenden <strong>und</strong><br />
exakte Dosierung beachten.<br />
geschützte Blätter bzw. Blattfläche<br />
zugewachsen sind, wird anhand<br />
des Prognosemodells der<br />
Termin für die nächste Behandlung<br />
gegen die <strong>Rebe</strong>nperonospora<br />
ermittelt. Falls in absehbarer<br />
Zeit keine Infektionen zu erwarten<br />
sind, richtet sich die nächste<br />
Behandlung entweder nach dem<br />
Infektionsrisiko des Echten<br />
Mehltaus (Oidium) oder den<br />
nächsten stärkeren Niederschlägen<br />
aus.<br />
Bei schwachem Infektionsdruck<br />
erfolgt die nächste Behandlung<br />
kurz vor Ende der Inkubationszeit,<br />
bzw. möglichst kurz vor<br />
Regen <strong>und</strong> in der Regel mit einem<br />
vorbeugenden Kontaktfungizid.<br />
Bei starkem Infektionsdruck sollte<br />
zum nächstmöglichen Termin,<br />
sobald die Rebanlagen ein sicheres<br />
Befahren erlauben, unbedingt<br />
ein kurativ wirkendes Fungizid<br />
eingesetzt werden. Bei hohem Infektionsdruck<br />
<strong>und</strong> um die Blütezeit<br />
herum bietet generell die Anwendung<br />
eines Präparates, das in<br />
die Reborgane eindringt, einen<br />
besseren Schutz vor Infektionen.<br />
Falls keine Prognosedaten zur<br />
Verfügung stehen, ist es ratsam,<br />
sechs bis acht Tage nach der letzten<br />
Behandlung die Witterung zu<br />
beobachten <strong>und</strong> die Stärke der<br />
Infektion einzuschätzen:<br />
→ Bei schwachen Infektionsbedingungen,<br />
beispielsweise bei<br />
Tau oder nur geringen Niederschlägen,<br />
kann bei kühlen<br />
durchschnittlichen Tagestemperaturen<br />
unter 14 °C am 14. Tag,<br />
bzw. bei warmen Temperaturen<br />
über 17 °C am zwölften Tag mit<br />
einem Kontaktfungizid behandelt<br />
werden. Ist anhaltend trockene<br />
Witterung vorhergesagt,<br />
kann die nächste Behandlung<br />
weiter hinausgezögert werden.<br />
Sie sollte aber vor einer angesagten<br />
Regenperiode durchgeführt<br />
werden <strong>und</strong> Behandlungen gegen<br />
Oidium berücksichtigen.<br />
→ Bei starken Infektionsbedingungen,<br />
beispielsweise bei lang<br />
andauernden Niederschlägen<br />
oder heftigen Gewittern mit<br />
warmen Temperaturen, ist der<br />
Einsatz eines kurativ wirkenden<br />
4 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
MAXIMAL MÖGLICHE WIRKUNGSDAUER<br />
NACH OIDIAG <strong>2024</strong><br />
Aktueller Indexwert<br />
Podukte<br />
Netzschwefel<br />
Kumar<br />
Vitisan<br />
Sarumo, Galileo<br />
Topas<br />
Belanty<br />
Collis<br />
Dynali<br />
Kusabi a)<br />
Prosper TEC, Spirox<br />
Talendo (<strong>Extra</strong>)<br />
Vivando a)<br />
Luna experience<br />
Luna Max<br />
Sercadis<br />
Wirkung<br />
(Einstufung)<br />
gering<br />
(1)<br />
mittel<br />
(2)<br />
hoch<br />
(3)<br />
sehr hoch<br />
(4)<br />
0-33 34-66 > 66<br />
Maximale mögliche<br />
Wirkungsdauer in Tagen<br />
10-12 7-9 6-7*<br />
11-13 8-10 **<br />
12-14 11-13 9-10<br />
*** 13-14 10-12<br />
Bitte das Rebwachstum <strong>und</strong> die Prognose nach VitiMeteo Oidium berücksichtigen!<br />
* Anwendung in kritischer Phase nur im ökologischen Pflanzenschutz<br />
** Keine Anwendung dieser Produkte bei hohem Risiko<br />
*** Anwendung in der kritischen Phase nur bei hohem Risiko<br />
a)<br />
Die Wirkstoffgruppe wird aufgr<strong>und</strong> von Resistenzen nicht im Mehltaufenster<br />
empfohlen.<br />
Wichtige Anmerkung: Die Angaben zur Wirkungsdauer in Tagen basieren auf<br />
Versuchs ergebnissen <strong>und</strong> Erfahrungswerten. Sie sollen eine Hilfestellung geben,<br />
um Spritzabstände besser abschätzen zu können. Bei einem besonders schnellen<br />
Blatt- <strong>und</strong> Traubenzuwachs im Mehltaufenster kann sich die Wirkungsdauer verkürzen!<br />
Dies gilt besonders für die stark anfälligen Sorten Trollinger, Cabernet<br />
Dorsa, Dornfelder, Chardonnay <strong>und</strong> Müller-Thurgau. Der Gebrauch dieser Tabelle<br />
liegt ausschließlich in der Verantwortung des Nutzers.<br />
Sonstige Anmerkung: Die biologischen Präparate Taegro, FytoSave <strong>und</strong> Romeo<br />
wurden bezüglich ihrer Wirkungsdauer nicht ausreichend geprüft <strong>und</strong> können<br />
daher nicht in die Tabelle integriert werden.<br />
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BOTRYTIS-<br />
BEKÄMPFUNG <strong>2024</strong><br />
<strong>Wein</strong>bauliche <strong>und</strong> indirekte<br />
Maßnahmen<br />
Alle Maßnahmen, die ein schnelles<br />
Abtrocknen der Trauben <strong>und</strong> eine<br />
lockere Traubenstruktur fördern:<br />
→ Sorten- <strong>und</strong> Klonenwahl z. B.<br />
locker beerige, mischbeerige Klone bei<br />
Spätburg<strong>und</strong>er oder Grauburg<strong>und</strong>er,<br />
botrytisun anfällige Piwis.<br />
→ Pflanzsystem (Luftige Erziehungssysteme,<br />
Reihenabstand über 1,80 m).<br />
→ Steuerung des Stickstoff- <strong>und</strong> Wasserhaushalts,<br />
Dämpfung des Wuchses besonders<br />
in Jahren mit hohem Wasserangebot.<br />
Zum Beispiel keine Bodenbearbeitung<br />
während der Reife.<br />
→ Ertragsmanagement:<br />
Ertragsregulierung; Trauben dürfen<br />
nicht übereinander hängen.<br />
→ Kulturmaßnahmen:<br />
- Doppeltriebe entfernen,<br />
- maschinelle oder manuelle<br />
Entblätterung der Traubenzone ab<br />
Schrotkorngröße der Beeren,<br />
- Trauben teilen (Produktionsziel<br />
Premium qualität),<br />
- Steuerung des Wachstums, mit dem<br />
Ziel, die Beerengröße nicht zu stark zu<br />
fördern, zum Beispiel nicht zu frühes<br />
Einkürzen.<br />
→ Pflanzenschutz:<br />
- Traubenwicklerbekämpfung,<br />
- Oidiumbekämpfung,<br />
- Einsatz von Bioregulatoren, Witterung<br />
beachten!<br />
Chemische Bekämpfung<br />
Anzahl der Anwendung pro<br />
Jahr:<br />
→ Eine Anwendung bei empfindlichen<br />
Sorten <strong>und</strong> Klonen.<br />
→ Maximal zwei Anwendungen bei<br />
Sorten <strong>und</strong> Klonen mit kompakten<br />
Trauben. Wegen der Resistenzgefahr<br />
ist dabei ein Wirkstoffwechsel vorzunehmen.<br />
Mögliche Einsatztermine*:<br />
→ (Abgehende Blüte (BBCH 68))<br />
→ Vor Traubenschluss (BBCH 77)<br />
→ Abschluss (BBCH 81)<br />
→ Optimaler Anwendungstermin<br />
für Fungizide gegen Botrytis ist vor<br />
dem Beginn des Traubenschlusses<br />
(BBCH 77).<br />
* Bei Verwendung der Präparate<br />
Kumar , Serenade ASO, Botector,<br />
Romeo <strong>und</strong> Taegro können Behandlungen<br />
auch nach BBCH 81 noch<br />
sinnvoll sein. Bitte beachten Sie die<br />
Empfehlungen des Herstellers.<br />
Fungizides zum nächstmöglichen<br />
Termin erforderlich.<br />
→ Bei hohem Infektionsdruck<br />
oder um die Blüte bietet im Allgemeinen<br />
die Anwendung eines<br />
Fungizides, das in die Reborgane<br />
eindringt, einen besseren Schutz.<br />
In der Saison <strong>2024</strong> steht bei<br />
„VitiMeteoPeronospora“ wieder<br />
das „Wirkungsdauertool“ für die<br />
Anzeige der Wirkungsdauer von<br />
Fungiziden zur Verfügung. Die<br />
Nutzer können damit ihre letzte<br />
Behandlung eingeben. Der Behandlungstermin<br />
wird auf der<br />
interaktiven Grafik eingeblendet.<br />
Zusätzlich erscheint ein Verlaufsbalken,<br />
der anzeigt bis wann die<br />
Rebfläche durch diese Behandlung<br />
voraussichtlich geschützt ist.<br />
Echter Mehltau – Oidium (Erysiphe<br />
necator): Für eine sichere<br />
Bekämpfung des Echten Mehltaus<br />
ist es notwendig, eine frühe<br />
Ausbreitung des Pilzes im <strong>Wein</strong>berg<br />
zu unterbinden. Die erste<br />
Behandlung sollte erfolgen, bevor<br />
die ersten Symptome sichtbar<br />
werden.<br />
Alle zugelassenen Fungizide<br />
müssen gr<strong>und</strong>sätzlich vorbeugend<br />
eingesetzt werden. Sichtbarer<br />
Befall kann nicht oder nur mit<br />
sehr hohem Aufwand geheilt werden.<br />
Die erste Behandlung muss<br />
in der Regel im 6- bis 9-Blattstadium<br />
zusammen mit einer Behandlung<br />
gegen die <strong>Rebe</strong>nperonospora<br />
durchgeführt werden.<br />
Falls jedoch im Vorjahr in der<br />
betreffenden Rebanlage bzw. auf<br />
benachbarten Flächen verstärkter,<br />
früher Befall festgestellt wurde<br />
<strong>und</strong> für den Pilz günstige Witterungsbedingungen<br />
herrschen,<br />
ist es empfehlenswert, die erste<br />
Behandlung vorher, nämlich ab<br />
dem 3- bis 6-Blattstadium,<br />
durchzuführen. Allzu frühe Behandlungen<br />
(Austriebsbehandlungen)<br />
vor dem 3-Blattstadium<br />
sind gegen diesen Erreger allerdings<br />
wirkungslos.<br />
Von der ersten Spritzung bis<br />
kurz vor der Blüte können Netzschwefel<br />
oder alle anderen zugelassenen<br />
Mittel verwendet werden.<br />
Die kürzere Wirkung von<br />
Netzschwefel muss jedoch berücksichtigt<br />
werden, wenn bei<br />
feuchtwarmer Witterung die<br />
kritische Phase früher als gedacht<br />
eintritt. Bereits nach fünf bis sieben<br />
Tagen kann Netzschwefel<br />
ohne nennenswerte Wirkung<br />
sein, wenn sehr heiße Witterungsbedingungen<br />
herrschen.<br />
Wie bei allen Pflanzenschutzmitteln<br />
muss auch bei Netzschwefel<br />
sorgfältig auf die Dosierungsmenge<br />
je Hektar geachtet<br />
werden. Die besonders anfällige<br />
Periode für den Befall der Gescheine<br />
<strong>und</strong> der Beeren beginnt<br />
ungefähr eine Woche vor der<br />
Blüte ab dem Rebstadium BBCH<br />
57, wenn sich die Gescheine strecken.<br />
Dieser Zeitraum („Mehltaufenster“)<br />
endet etwa mit der<br />
Schrotkorn- bzw. Erbsengröße<br />
der Beeren (BBCH 75). In diesem<br />
Zeitraum müssen insbesondere<br />
bei feuchtwarmer Witterung engere<br />
Behandlungsintervalle eingehalten<br />
werden <strong>und</strong>/oder besonders<br />
wirksame Mittel verwendet<br />
werden (Belanty, Collis, Dynali,<br />
Luna Experience, Luna Max,<br />
Talendo (extra), Sercadis oder<br />
Prosper Tec; siehe Oidium-Bekämpfungsstrategie<br />
<strong>2024</strong>).<br />
Bei anhaltend feuchtwarmer,<br />
niederschlagsarmer Witterung<br />
(optimal für den Erreger sind<br />
Tagesdurchschnittstemperaturen<br />
zwischen 17 <strong>und</strong> 24 °C) sollten<br />
auch bei diesen Präparaten<br />
Spritzabstände von zehn bis<br />
zwölf Tagen in der besonders kritischen<br />
Zeitspanne nicht überschritten<br />
werden. Bei einem besonders<br />
schnellen Blatt- <strong>und</strong><br />
Traubenzuwachs im Mehltaufenster<br />
kann sich die Wirkungsdauer<br />
verkürzen! Dies gilt besonders<br />
für die stark anfälligen Sorten<br />
Trollinger, Cabernet Dorsa,<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
5
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
Dornfelder, Chardonnay <strong>und</strong><br />
Müller-Thurgau.<br />
Nach dem Ende der anfälligen<br />
Phase können alle anderen organischen<br />
Fungizide, vorzugsweise<br />
Präparate auf der Basis der Wirkstoffgruppe<br />
der älteren Azole, wie<br />
Topas <strong>und</strong> Sarumo eingesetzt<br />
werden. Die letzte Behandlung<br />
kann auch mit den Kaliumhydrogencarbonat-Präparaten<br />
Vitisan<br />
oder Kumar sowie Netzschwefel<br />
Stulln durchgeführt werden. Diese<br />
Behandlungen sollen möglichst<br />
die Bildung der Überwinterungsformen<br />
(Chasmothecien) des<br />
Mehltaupilzes verhindern.<br />
Präparate aus der Wirkstoffgruppe<br />
der Strobilurine, gegen die<br />
bereits vielerorts Resistenzen<br />
nachgewiesen wurden, sollten nur<br />
noch in nicht gefährdeten Gemarkungen<br />
<strong>und</strong> bei weniger anfälligen<br />
Sorten zum Einsatz kommen.<br />
Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln<br />
mit einem Strobilurin<br />
als alleinigem Wirkstoff, z. B.<br />
Flint, wird nicht mehr empfohlen.<br />
Zum Zusatz von Schwefelpräparaten<br />
zu anderen Fungiziden zur<br />
Verhinderung der Resistenzentwicklung<br />
bei Oidium wird ebenfalls<br />
nicht geraten, da keine gesicherten<br />
Ergebnisse für eine Zusatzwirkung<br />
vorliegen. Generell<br />
darf auf keinen Fall zweimal hintereinander<br />
ein Mittel derselben<br />
Wirkstoffgruppe verwendet werden,<br />
da ansonsten Minderwirkungen<br />
durch Resistenzentwicklung<br />
Gegen Pilzkrankheiten<br />
Antiresistenzstrategien bei<br />
Fungiziden<br />
Gegen Fungizide mit spezifischer Wirkung können die<br />
Erreger Resistenzen entwickeln, sodass die Wirksamkeit<br />
nachlässt oder die Mittel nach gewisser Zeit völlig unwirksam<br />
werden. Für alle Fungizide mit Resis tenzrisiko, dazu<br />
zählen vor allem kurativ wirkende Präparate, gilt:<br />
→ Niemals darf mit den Behandlungen gewartet werden,<br />
bis die Krankheitssymptome deutlich zutage treten.<br />
→ Kurative Fungizide zeigen ihre beste Wirkung, wenn sie<br />
gezielt vor oder unmittelbar nach für das Pathogen<br />
günstigen Infektionsbedingungen angewandt werden.<br />
→ Prognoseverfahren, zum Beispiel VitiMeteoPeronospora<br />
oder VitiMeteoOidium, erleichtern die gezielte <strong>und</strong><br />
wirkungsvolle Anwendung der Fungizide.<br />
→ Präparate in der vorgeschriebenen Aufandmenge anwenden<br />
<strong>und</strong> auf gute Applikation achten (ausreichende<br />
Benetzung, jede Gasse fahren).<br />
→ Kombinationspräparate, die neben dem spezifischen<br />
auch noch einen breitwirksamen Wirkstoff enthalten,<br />
vermindern das Resistenzrisiko.<br />
→ Um Kreuzresistenz zu vermeiden, sollten Pflanzen schutzmittel,<br />
die derselben Wirkstoffgruppe angehören <strong>und</strong><br />
damit in der Regel einen sehr ähnlichen Wirkungsmechanismus<br />
haben, nicht hinterei nander eingesetzt werden.<br />
Bei Resistenzbildung gegen einen Wirkstoff ist auch die<br />
Wirkung der anderen Mittel dieser Gruppe deutlich geringer.<br />
In der Tabelle auf Seite 7 sind die Wirkstoffe <strong>und</strong> Präparate<br />
aufgeführt, bei denen die Antiresistenzstrategie beachtet<br />
werden sollte. Die Buchstaben der Wirkstoffkategorie<br />
kennzeichnen die Wirkstoffgruppen, die denselben Wirkmechanismus<br />
besitzen. Präparate mit demselben Buchstaben<br />
dürfen nicht mehr als ein-, zwei- oder dreimal, je<br />
nach Präparat, in der Saison angewandt werden.<br />
möglich sind (siehe Antiresistenzstrategie<br />
<strong>2024</strong>).<br />
Die Nutzung des Prognosemodells<br />
„VitiMeteoOidium“ erleichtert<br />
die gezielte Ausbringung von<br />
zugelassenen Präparaten in sinnvollen<br />
Intervallen. Zu Saisonbeginn<br />
<strong>2024</strong> steht bei „VitiMeteo-<br />
Oidium“ wieder das „Wirkungsdauertool“<br />
für die Anzeige der<br />
Wirkungsdauer von Fungiziden<br />
zur Verfügung. Die Angabe der<br />
Wirkungsdauer in Tagen wird ab<br />
<strong>2024</strong> ergänzt mit der Angabe des<br />
Zuwachses an Blattfläche <strong>und</strong><br />
Blättern. Die Hinweise zum Zuwachs<br />
sollen helfen kritische Situatio-nen<br />
besser einzuschätzen.<br />
Die Oidium-Bekämpfungsstrategien<br />
für Normallagen sowie<br />
Befallslagen bzw. Sanierungsflächen<br />
sind in der Grafik <strong>und</strong> im<br />
Kastentext auf Seit 4 ausführlich<br />
<strong>und</strong> detailliert dargestellt!<br />
→ Tipp zur Reduktion von<br />
Pflanzenschutzmitteln: Um<br />
Pflanzenschutzmittel einzusparen<br />
<strong>und</strong> Rückstände zu verringern,<br />
kann gegebenenfalls eine<br />
Behandlung der Traubenzone<br />
gegen <strong>Rebe</strong>nperonospora <strong>und</strong><br />
auch gegen Oidium bei der Abschlussbehandlung<br />
entfallen.<br />
Voraussetzung dafür ist ein vorausgegangener<br />
fachgerechter<br />
Pflanzenschutz. Dies bedeutet,<br />
dass die Rebanlage überwiegend<br />
befallsfrei sein sollte.<br />
Graufäule – Botrytis (Botrytis<br />
cinerea) <strong>und</strong> Essigfäule: Die Basis<br />
für eine Bekämpfung der Botrytis,<br />
Essigfäule <strong>und</strong> anderer<br />
Fäulniserreger sind in erster Linie<br />
pflanzenzüchterische sowie anbau-<br />
<strong>und</strong> kulturtechnische Maßnahmen,<br />
die eine gute Durchlüftung<br />
<strong>und</strong> das schnelle Abtrocknen<br />
der Trauben fördern. Hierzu gehören<br />
beispielsweise der Anbau<br />
lockerbeeriger Klone, das Entblättern<br />
der Traubenzone mit der<br />
Maschine bzw. von Hand <strong>und</strong> die<br />
Ausdünnung der Trauben (Traubenteilung,<br />
Anwendung von Bioregulatoren,<br />
wie Gibberellinsäure-<br />
Präparate oder Regalis Plus).<br />
Eine optimale Bekämpfungsstrategie<br />
der Graufäule <strong>und</strong> anderer<br />
Fäulniserreger ist nur<br />
durch die Kombination von indirekten<br />
weinbaulichen <strong>und</strong> direkten<br />
chemischen Maßnahmen<br />
möglich. Hierbei sollte die Applikation<br />
von Pflanzenschutzmitteln<br />
auf maximal zwei Anwendungen<br />
bei Sorten <strong>und</strong> Klonen<br />
mit kompakten Trauben beschränkt<br />
werden.<br />
Welche dieser Maßnahmen<br />
gegen Botrytis durchgeführt werden,<br />
ist in erster Linie vom Produktionsziel<br />
des Winzers abhängig.<br />
Im Kasten auf Seite 5 sind die<br />
wichtigsten Maßnahmen gegen<br />
die Erreger aufgelistet.<br />
Schwarzfleckenkrankheit<br />
(Phomopsis viticola): Zu massiven<br />
Infektionen durch den Erreger<br />
der Schwarzfleckenkrankheit<br />
kommt es überwiegend in Regenperioden<br />
in der Austriebsphase<br />
der <strong>Rebe</strong>n (Knospenaufbruch<br />
bis 3-Blattstadium) bei<br />
anfälligen Rebsorten <strong>und</strong> entsprechenden<br />
Lagen. Der Einsatz<br />
von Fungiziden gegen die<br />
Schwarzfleckenkrankheit ist nur<br />
dann sinnvoll, wenn an den<br />
Fruchtruten die typischen Symptome<br />
der Krankheit (weißgefärbte<br />
Borke mit schiffchenförmigen,<br />
dunklen Nekrosen) vorhanden<br />
sind.<br />
Vor gezielten Bekämpfungsmaßnahmen<br />
sollte allerdings<br />
geprüft werden, ob diese überhaupt<br />
wirtschaftlich lohnend<br />
oder für die Formerhaltung der<br />
Stöcke notwendig sind. Spätestens<br />
bei der Bekämpfung von<br />
Peronospora oder Oidium wird<br />
Phomopsis mitbehandelt, da viele<br />
der eingesetzten Produkte auch<br />
eine gute Wirkung auf den Erreger<br />
der Schwarzfleckenkrankheit<br />
besitzen.<br />
Schwarzfäule (Guignardia bidwellii):<br />
Alle Strobilurine <strong>und</strong> Triazole<br />
haben eine ausreichende<br />
Wirkung auf diesen Pilz. Die<br />
zugelassenen Präparate sind auf<br />
Seite 15 aufgelistet. Daher sollte<br />
in Problemgebieten bei der Bekämpfung<br />
von <strong>Rebe</strong>nperonospora<br />
<strong>und</strong> Echtem Mehltau darauf<br />
6 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
ANTIRESISTENZSTRATEGIE <strong>2024</strong><br />
Aufgr<strong>und</strong> von Resistenzgefährdung dürfen Präparate einer Wirkstoffkategorie nicht zweimal nacheinander verwendet werden<br />
Wirkstoffkategorie Handelspräparat Wirkstoff Wirkstoffgruppe Anzahl max. empfohlener Anwendungen<br />
Peronospora-Fungizide<br />
B Afrasa Triple WG Cymoxanil + Folpet + AL-Fosethyl Azetamide<br />
C<br />
Mandipropamid + Carboxylsäureamide (CAA) +<br />
Ampexio<br />
E Zoxamide Benazamide<br />
C Forum Gold, Akutan Gold Dimetomorph + Dithianon<br />
C Vino Star Dimetomorph + Folpet<br />
Carboxylsäureamide (CAA)<br />
C Melody Combi Iprovalicarb + Folpet<br />
C<br />
Dimetomorph + Carboxylsäureamide (CAA) +<br />
Orvego<br />
S Initium (Ametoctradin) Triazol-Pyrimidylamine<br />
F Mildicut Cyazofamid<br />
F Videryo F Cyazofamid + Folpet<br />
Sulfonamide<br />
F Sanvino Amisulbrom + Folpet<br />
D Fantic F Benalaxyl-M + Folpet<br />
D Folpan Methalaxyl-M + Folpet<br />
Phenylamide<br />
P Profiler Fluopicolide + Al-Fosethyl Acylpicolide<br />
Q<br />
Oxathiapiprolin +<br />
Peridinyl-thiazol-isoxazolin<br />
Zorvec Vinabel<br />
E Zoxamide Benazamide<br />
Q Zorvec Zelavin Bria Oxathiapiprolin + Folpet Peridinyl-thiazol-isoxazolin<br />
S Enervin SC Initium (Ametoctradin) Triazol-Pyrimidylamine<br />
Oidium-Fungizide<br />
A Flint Trifloxystrobin Strobilurine<br />
A<br />
Azoxystrobin Strobilurine +<br />
Custodia<br />
G Tebuconazol Azole<br />
L<br />
Fluopyram + Carboxyanilide +<br />
Luna Experience<br />
G Tebuconazol Azole<br />
L<br />
Fluopyram + Carboxyanilide +<br />
Luna Max<br />
H Spiroxamine Spiroketalamine<br />
A<br />
Kresoxim-methyl + Strobilurine +<br />
Collis<br />
L Boscalid Carboxyanilide<br />
L Sercadis Fluxapyroxad Carboxyanilide<br />
G Belanty Mefentrifluconazol<br />
G Sarumo, Galileo Tetraconazole<br />
Azole<br />
G Topas Penconazol<br />
H Prosper TEC, Spirox Spiroxamine Spiroketalamin<br />
J Talendo Proquinazid Quinazolinone<br />
J<br />
Proquinazid + Quinazolinone +<br />
Talendo extra<br />
G Tetraconazole Azole<br />
K Vivando Metrafenone Benzophenone<br />
K Kusabi Pyriofenone Benzolpyridine<br />
R<br />
Cyflufenamid + Phenyl-Acetamide +<br />
Dynali<br />
G Difenoconazol Azole<br />
Botrytis-Fungizide<br />
L* Cantus Boscalid<br />
L* Kenja Isofetamid<br />
Carboxyanilide<br />
M Scala, Pyrus Pyrimethanil Anilinopyrimidine<br />
O Prolectus, Kamuy Fenpyrazamine Aminopyrazolinone<br />
M<br />
Cyprodinil + Anilinopyrimidine +<br />
Switch<br />
N Fludioxinil Phenylpyrrole<br />
3 Anwendungen<br />
pro Saison für alle Präparate<br />
mit demselben Buchstaben<br />
(mit derselben Farbe)<br />
1 Anwendung/Saison für alle Präparate mit<br />
demselben Buchstaben (mit derselben Farbe)<br />
2 Anwendungen/Saison für alle Präparate<br />
mit demselben Buchstaben (mit derselben<br />
Farbe)<br />
max. 1 mal Wirkstoffgruppe „Strobilurine“<br />
(A)<br />
1 Anwendung<br />
pro Saison für alle Präparate<br />
mit demselben Buchstaben<br />
(mit derselben Farbe)<br />
2 Anwendungen<br />
pro Saison für alle Präparate mit<br />
demselben Buchstaben<br />
(mit derselben Farbe)<br />
max. 4 mal verschiedene Produkte<br />
der Wirkstoffgruppe „Azole“ (G)<br />
1 Anwendung<br />
pro Saison für alle Präparate<br />
mit demselben Buchstaben<br />
(mit derselben Farbe)<br />
1. L*: Keine Anwendung dieser Produkte gegen Botrytis, wenn Gruppe L gegen Oidium eingesetzt wurde.<br />
2. Die „Gruppe L“ der SDHI‘s (Luna experience, Luna Max, Sercadis, Collis) wird nur einmal von abgehender Blüte bis Schrotkorngröße der Beeren empfohlen. Bei besonders gefährdeten Sorten, wie<br />
Trollinger, Dornfelder, Cabernet Dorsa, etc. kann auch eine zweite Anwendung durchgeführt werden.<br />
Nicht aufgeführt sind alle Produkte, deren Zulassung ausgelaufen ist <strong>und</strong> noch Aufbrauchfrist besteht, sowie Produkte mit Zulassung, die jedoch nicht vertrieben werden: Forum Star - Aufbrauchfrist<br />
30.06.<strong>2024</strong><br />
Fungizide mit geringer Resistenzgefahr <strong>2024</strong> (Bei diesen Mitteln ist die Gefahr auch bei mehrfacher Anwendung gering)<br />
Handelspräparat Wirkstoff Wirkstoffgruppe Indikation<br />
Polyram WG<br />
Metiram<br />
Delan WG Dithianon Chinone<br />
Delan Pro Dithianon + Kaliumphosphonat Chinone + Phosphonate<br />
Folpan 80 WDG; Folpan 500 SC Folpet Phtalimide<br />
Frutogard, Veriphos, Foshield, Vinteger, Rombiphos extra Kaliumphosphonat Kaliumphosphonat<br />
Peronospora<br />
Cuproxat<br />
Kupfersulfat<br />
Cuprozin progress, Funguran progress<br />
Kupferhydroxid<br />
Kupfer-Mittel<br />
Airone SC, Coprantol Duo, u. a.<br />
Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid<br />
FytoSave<br />
COS - OGA<br />
Romeo<br />
Cerevisane<br />
*** Peronospora <strong>und</strong> Oidium<br />
Thiovit Jet, Kumulus, NS-Stulln, etc. Netzschwefel Schwefel<br />
Kumar, Vitisan Kaliumhydrogencarbonat Hydrogencarbonate<br />
Oidium<br />
Taegro Bacillus amyloliquefaciens ***<br />
Kumar Kaliumhydrogencarbonat Hydrogencarbonate<br />
Oidium <strong>und</strong> Botrytis<br />
Botector<br />
Aureobasidium pullulans<br />
Romeo<br />
Cerevisane<br />
*** Botrytis<br />
Serenade, Texio<br />
Bacillus amyloliquefaciens<br />
*** Biologische Präparate<br />
Die Buchstaben A-S kennzeichnen verschiedene Wirkstoffgruppen, Wirkstoffe oder Wirkungsmechanismen. Präparate mit demselben Buchstaben enthalten Wirkstoffe mit gleichem Wirkmechanismus.<br />
Dies muss bei der Planung der Behandlungen <strong>und</strong> der Anzahl der Behandlungen je Fungizid beachtet werden. In der Tabelle „Fungizide mit geringer Resistenzgefahr“ sind die breiter<br />
wirksamen Fungizide, sogenannte „Multisite“ Fungizide aufgeführt.<br />
Beispiel 1: Nach zwei Behandlungen mit „Forum Gold“ (Wirkstoffkategorie C) gegen Peronospora, ist nur noch eine Behandlung mit „Orvego“ (Wirkstoffkategorie C/S) möglich.<br />
Beispiel 2: Nach zwei Behandlungen mit „Dynali“ (Wirkstoffkategorie R/G) gegen Oidium, sind nur noch zwei Behandlungen mit „Topas“ (Wirkstoffkategorie G) möglich.<br />
Beispiel 3: Nach einer Behandlung mit „Switch“ (Wirkstoffkategorie M/N) gegen Botrytis ist nur noch eine Behandlung mit „Prolectus“ (Wirkstoffkategorie O) oder „Cantus“ bzw. „Kenja“<br />
(Wirkstoffk ategorie L) möglich. Es ist aber zu beachten, dass die Wirkstoffkategorie L auch bei den Oidiumpräparaten eingesetzt wird. Präparate der Wirkstoffkategorie L (z. B. „Sercadis“) sollten<br />
möglichst nur einmal pro Saison angewendet werden.<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
7
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
geachtet werden, dass Präparate<br />
mit einer Zusatzwirkung gegen<br />
Schwarzfäule bevorzugt eingesetzt<br />
werden. Problemgebiete<br />
können Gemarkungen sein, in<br />
denen sich Drieschen, also nicht<br />
ordnungsgemäß bewirtschaftete<br />
Rebflächen, befinden. Für die<br />
Bekämpfung der Schwarzfäule ist<br />
das Prognosemodell „VitiMeteo-<br />
Schwarzfäule“ als Entscheidungshilfe<br />
für den richtigen Zeitpunkt<br />
der Bekämpfungsmaßnahme<br />
verfügbar.<br />
Prognosemodelle <strong>und</strong> mehr<br />
Die Vitimeteo-Bausteine<br />
Zu einzelnen Rebkrankheiten, -schädlingen <strong>und</strong> Nützlingen<br />
werden jährlich Befallsdaten erfasst <strong>und</strong> online unter<br />
www.vitimeteo.de veröffentlicht. Die Daten zum Auftreten<br />
der Krankheiten werden von den <strong>Rebschutz</strong>warten sowie<br />
den Forschungseinrichtungen des Landes erhoben <strong>und</strong><br />
bieten einen Überblick über die tatsächliche Befallssituation<br />
in Baden-Württemberg. Die Informationen können wertvolle<br />
Hilfen bieten, um unnötige Pflanzenschutzmaßnahmen<br />
zu vermeiden. Die Bausteine im Überblick:<br />
VM <strong>Rebe</strong>nperonospora: Prognosemodell für die <strong>Rebe</strong>nperonospora<br />
(Falscher Mehltau) inkl. Wirkungsdauertool<br />
für ökologischen <strong>und</strong> integrierten Pflanzenschutz<br />
VM Oidium: Risikomodell für Oidium (Echter Mehltau) inkl.<br />
Wirkungsdauertool für ökologischen <strong>und</strong> integrierten<br />
Pflanzenschutz<br />
VM Schwarzfäule: Prognosemodell für Schwarzfäule<br />
VM Wachstum: Wachstumsmodelle für die Rebsorten<br />
Riesling, Blauer Spätburg<strong>und</strong>er <strong>und</strong> Müller-Thurgau<br />
VM Traubenwickler: Temperatursummenmodell für die<br />
Ermittlung des Flugbeginns der Traubenwickler<br />
VM Schwarzholz: Temperatursummenmodell für die<br />
Ermittlung des Flugbeginns der Glasflügelzikade<br />
VM Kräusel- <strong>und</strong> Pocken milbe: Temperatursummenmodell<br />
für die Ermittlung des Wanderungsbeginns der Kräusel<strong>und</strong><br />
Pockenmilbe<br />
VM Phänologie: Simulation der phänologischen Stadien der<br />
<strong>Rebe</strong>ntwicklung (BBCH-Stadien)<br />
VM VineCam: Bilder direkt aus dem <strong>Wein</strong>berg<br />
VM Wetter: Grafische Darstellung von gemessenen <strong>und</strong><br />
vorhergesagten Wetterdaten in ganz Baden-Württemberg<br />
VM Wetterdaten: Interaktives Werkzeug zur Erstellung von<br />
Wettergrafiken<br />
VM Meteogramme: Detaillierte Wettervorhersage für<br />
sieben Tage<br />
Regenradar: Niederschlagsradar<br />
VM Stationsübersicht: Grafik mit den Standorten der<br />
Wetter stationen <strong>und</strong> deren Daten<br />
VitiMonitoring: Online-Meldungen der <strong>Rebschutz</strong>warte<br />
<strong>und</strong> Forschungseinrichtungen; Darstellung der tatsächlichen<br />
Befallssituation<br />
VitiMeteo Mobil: Für Smartphone oder Tablet optimiert.<br />
Esca (Phaeomoniella chlamydospora,<br />
Phaeoacremonium minimum<br />
<strong>und</strong> Fomitiporia mediterranea):<br />
Esca wird durch holzzerstörende<br />
Pilze verursacht. Diese<br />
dringen vorrangig über Schnittw<strong>und</strong>en<br />
am Kopf der <strong>Rebe</strong>, jedoch<br />
auch über Verletzungen am<br />
Stamm ins Holz ein. Dort breiten<br />
sich die Erreger über Jahre hinweg<br />
unentdeckt aus <strong>und</strong> verursachen<br />
Braunfärbungen sowie<br />
Weißfäule. Äußerlich sichtbare<br />
Symptome treten erst nach mehreren<br />
Jahren an Blättern in Form<br />
der auffälligen Tigerstreifenmuster<br />
auf.<br />
Zum Schutz der <strong>Rebe</strong>n vor<br />
Esca sollten viele <strong>und</strong> vor allem<br />
größere Verletzungen beim Rebschnitt<br />
vermieden werden. Zugefügte<br />
W<strong>und</strong>en sollten möglichst<br />
unmittelbar nach dem Rebschnitt<br />
mit einem Pflanzenschutzmittel,<br />
zum Beispiel Tessior oder<br />
Vintec, behandelt werden. Diese<br />
Maßnahme ist ausschließlich bei<br />
frischen W<strong>und</strong>en <strong>und</strong> jüngeren<br />
Anlagen sinnvoll, da ältere <strong>Rebe</strong>n<br />
sehr wahrscheinlich bereits von<br />
Esca befallen sind.<br />
Zusätzlich sollte beim Rebschnitt<br />
darauf geachtet werden<br />
die bestehenden Leitbahnen aufrecht<br />
zu erhalten (Stichwort<br />
„sanfter Rebschnitt“). Um eine<br />
Verbreitung der Krankheit durch<br />
Sporenlager an befallenen <strong>und</strong><br />
bereits abgestorbenen Stöcken zu<br />
minimieren, sollten diese aus den<br />
Anlagen entfernt werden. Da<br />
Pilzsporen über die Luft verbreitet<br />
auch größere Distanzen zurücklegen<br />
können, ist es ebenfalls<br />
ratsam kein Totholz neben den<br />
Rebanlagen zu lagern.<br />
Zur Verhinderung von Ertragsausfällen<br />
<strong>und</strong> zur Erhöhung<br />
der Lebenserwartung sollte der<br />
Stamm älterer <strong>Rebe</strong>n beim Auftreten<br />
von Esca saniert werden.<br />
Hierzu bieten sich die Methoden<br />
Stammrücknahme <strong>und</strong> Rebchirurgie<br />
an. Bei der Methode der<br />
Stammrücknahme wird der befallene<br />
Teil des Stamms entfernt<br />
<strong>und</strong> durch einen nachgezogenen<br />
Trieb ersetzt. Das Verfahren setzt<br />
entsprechende Stockaustriebe<br />
voraus <strong>und</strong> ist daher für Hochstammreben<br />
ungeeignet.<br />
Bei der Rebchirurgie wird mit<br />
einer Kettensäge der Rebstamm<br />
geöffnet <strong>und</strong> das befallene Holz<br />
vollständig von Weißfäule befreit.<br />
Reicht die Weißfäule bis zur<br />
Veredlungsstelle hinunter, ist<br />
kein langfristiger Erfolg der Behandlung<br />
zu erwarten. Bei<br />
schlagartig eingetrockneten <strong>Rebe</strong>n<br />
oder <strong>Rebe</strong>n mit vielen abgestorbenen<br />
Trieben sind die Erfolgsaussichten<br />
ebenfalls gering.<br />
Die Rebchirurgie setzt eine<br />
gewisse Dicke sowie Stabilität des<br />
Stamms voraus. Sie sollte vor<br />
dem Rebschnitt erfolgen, da der<br />
Rebstock durch die Triebe im<br />
Drahtrahmen stabilisiert wird.<br />
Die Methode erfordert einen erhöhten<br />
Arbeitsschutz <strong>und</strong> Kenntnisse<br />
im Umgang mit der Kettensäge<br />
sowie ein gewisses Maß an<br />
Übung. Eine Behandlung der<br />
W<strong>und</strong>e wird nicht empfohlen,<br />
weil die Erreger durch die Rebchirurgie<br />
niemals restlos entfernt<br />
werden können.<br />
Schwarzholzkrankheit (Candidatus<br />
Phytoplasma solani): Die<br />
Schwarzholzkrankheit zeichnet<br />
sich durch verfärbte <strong>und</strong> nach<br />
innen eingerollte Blätter an einzelnen<br />
Trieben oder der gesamten<br />
Pflanze aus. Die ersten Symptome<br />
treten im Sommer auf <strong>und</strong><br />
nehmen bis zum Herbst zu. So<br />
können beispielsweise noch im<br />
August ges<strong>und</strong> aussehende <strong>Rebe</strong>n<br />
im September oder Oktober<br />
deutliche Symptome der Krankheit<br />
zeigen.<br />
Eine direkte Bekämpfung der<br />
Schwarzholzkrankheit ist bislang<br />
nicht möglich. Befallene Teile des<br />
Rebstocks sollten daher so rasch<br />
wie möglich abgeschnitten werden,<br />
um eine weitere Ausbreitung<br />
des Erregers, den Phytoplasmen,<br />
innerhalb der Leitbahnen der <strong>Rebe</strong><br />
zu vermeiden. Von infizierten<br />
Rebstöcken sowie deren Schnittholz<br />
geht kein Infektionsrisiko für<br />
benachbarte <strong>Rebe</strong>n aus. Außerdem<br />
werden Phytoplasmen nicht<br />
durch den Rebschnitt übertragen.<br />
Eine Übertragung der Krankheit<br />
bei der Pfropfung infizierter<br />
Veredlungspartner ist jedoch<br />
möglich, weshalb in Vermehrungsanlagen<br />
auf ein Befall geachtet<br />
werden sollte. Die<br />
Schwarzholzkrankheit wird in<br />
erster Linie durch die wärmeliebende<br />
Winden-Glasflügelzikade<br />
übertragen, die überwiegend an<br />
Wirtspflanzen, wie Brennnessel,<br />
Acker- <strong>und</strong> Zaunwinde, lebt.<br />
Brennnessel-Horste, insbesondere<br />
an warmen Stellen (Mauern,<br />
Wasserstaffeln, Wegränder) <strong>und</strong><br />
8 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
in Lagen, in denen Schwarzholz<br />
auftritt, sollten im Oktober/November<br />
beziehungsweise im<br />
Frühjahr mit einem zugelassenen<br />
Herbizid beseitigt werden. Dadurch<br />
werden auch die unterirdisch<br />
lebenden Larven der Zikade<br />
vernichtet. An Wegrändern,<br />
Wasserstaffeln <strong>und</strong> Böschungen<br />
dürfen Herbizide nur nach einer<br />
Genehmigung durch die Landratsämter<br />
ausgebracht werden.<br />
Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen<br />
an die <strong>Wein</strong>bauberatung.<br />
Von Anfang bis zum Ende der<br />
Flugphase der Zikade bis etwa<br />
Mitte August sollten Brennnesseln<br />
nicht gemäht werden. Dadurch<br />
wird verhindert, dass die<br />
in diesem Zeitraum auf den<br />
Brennnesseln vorhandenen erwachsenen<br />
Zikaden auf der Suche<br />
nach neuen Wirtspflanzen in<br />
die <strong>Rebe</strong>n fliegen <strong>und</strong> die Krankheit<br />
auf die <strong>Rebe</strong>n übertragen.<br />
Flächendeckende Hinweise zum<br />
Flugbeginn der Winden-Glasflügelzikade<br />
liefert das Prognosemodell<br />
„VitiMeteoSchwarzholz“.<br />
Rebvirosen (Reisig-Virus, Arabismosaik-Virus,<br />
Blattroll-Virus,<br />
Grauburg<strong>und</strong>er-Virus):<br />
Rebvirosen werden durch verschiedene<br />
Pflanzenviren verursacht<br />
<strong>und</strong> äußern sich in Entwicklungsstörungen,<br />
die je nach<br />
Sorte, Standort <strong>und</strong> Witterungsverhältnissen<br />
unterschiedlich<br />
stark ausfallen können. Zu den<br />
typischen Symptomen gehören<br />
beispielsweise Wuchsdepressionen<br />
der Triebe, Farb- <strong>und</strong> Formveränderung<br />
der Blätter, Verrieselung<br />
der Trauben sowie vorzeitige<br />
Absterbeerscheinungen der<br />
gesamten <strong>Rebe</strong>.<br />
Übertragen werden Viren<br />
durch Vektoren, bei denen es sich<br />
in Abhängigkeit vom Virustyp<br />
entweder um Nematoden, Insekten<br />
oder Milben handelt. Bei der<br />
vegetativen Vermehrung infizierter<br />
Pflanzen sowie bei der Pfropfung<br />
infizierter Veredlungspartner<br />
findet ebenfalls eine Übertragung<br />
der Krankheit statt. Beim<br />
Rebschnitt werden keine Viruskrankheiten<br />
übertragen.<br />
Eine direkte Bekämpfung der<br />
Viren ist bislang nicht möglich.<br />
Nur über indirekte Maßnahmen,<br />
wie beispielsweise Ges<strong>und</strong>heitsselektion,<br />
lässt sich eine Ausbreitung<br />
verhindern. Daher empfiehlt<br />
es sich, nur zertifiziertes, virusgetestetes<br />
Pflanzgut bei Neupflanzungen<br />
zu verwenden. Bereits<br />
betroffene Rebstöcke sollten markiert<br />
<strong>und</strong> die Entwicklung beobachten<br />
werden. Treten die Symptome<br />
über mehrere Jahre hinweg<br />
auf, können die entsprechenden<br />
Rebstöcke gerodet <strong>und</strong> durch<br />
neue <strong>Rebe</strong>n ersetzt werden.<br />
Tierische Schädlinge<br />
Einbindiger Traubenwickler<br />
(Eupoecilia ambiguella) <strong>und</strong> Bekreuzter<br />
Traubenwickler (Lobesia<br />
botrana): Für eine gezielte<br />
Bekämpfung beider Traubenwicklerarten<br />
ist die Kontrolle des<br />
Mottenfluges mit geeigneten<br />
Pheromonfallen unumgänglich.<br />
Aus der Flugaktivität kann eine<br />
Prognose für das Auftreten der<br />
kleinen Räupchen (Heuwurm,<br />
Sauerwurm) aufgestellt <strong>und</strong> entsprechende<br />
Termine für die Behandlung<br />
festgelegt werden. Der<br />
Großteil der Räupchen schlüpft<br />
im Frühjahr ungefähr zehn bis 14<br />
Tage, im Sommer etwa sieben bis<br />
zehn Tage nach dem Mottenflug-<br />
Höhepunkt.<br />
Ein genaueres Bild des Befalls<br />
erhält man durch die Kontrolle<br />
im Bestand. Begrenzter Heuwurmbefall<br />
ist nicht problematisch.<br />
Im Sommer sollte man auf<br />
die Einbohrstellen der Sauerwürmer<br />
an den Beeren achten, da sie<br />
Eintrittspforten für Botrytis <strong>und</strong><br />
andere sek<strong>und</strong>äre Erreger sind<br />
<strong>und</strong> somit die Sauerfäule fördern.<br />
Die Schadschwellenwerte liegen<br />
je nach Rebsorte <strong>und</strong> der Jahreswitterung<br />
bei der Heuwurm-<br />
Generation bei 30 % (Würmer<br />
pro 100 Gescheine), bei der<br />
Sauerwurm-Generation bei fünf<br />
bis 10 % (Würmer pro 100 Trauben).<br />
In Baden-Württemberg wird<br />
seit Jahren großflächig das biotechnische<br />
Verwirrverfahren mit<br />
Pheromon-Verdampfern durchgeführt,<br />
die vor Beginn des Mottenfluges<br />
möglichst großflächig<br />
ausgebracht werden <strong>und</strong> eine direkte<br />
chemische Bekämpfung des<br />
Traubenwicklers überflüssig machen.<br />
Einen Hinweis zum Flugbeginn<br />
der Traubenwickler liefert<br />
das Prognosemodell „VitiMeteo-<br />
Traubenwickler“. Bei der Anwendung<br />
ist die angegebene Aufwandmenge<br />
(zurzeit 500 Ampullen/ha)<br />
unbedingt einzuhalten. Befallsbonituren<br />
<strong>und</strong> der Einsatz von Pheromonfallen<br />
sind auch hier zur<br />
Erfolgskontrolle erforderlich.<br />
Kirschessigfliege (Drosophila<br />
suzukii): Die Kirschessigfliege<br />
wurde erstmals 2011 in Baden<br />
nachgewiesen <strong>und</strong> hat sich in den<br />
Folgejahren etablieren können.<br />
Dies zeigt das umfangreiche Fallenmonitoring<br />
des Staatlichen<br />
<strong>Wein</strong>bauinstituts Freiburg (WBI)<br />
<strong>und</strong> der Staatlichen Lehr- <strong>und</strong><br />
Versuchsanstalt für <strong>Wein</strong>- <strong>und</strong><br />
Obstbau <strong>Wein</strong>sberg (LVWO).<br />
Die Daten können über http://<br />
monitoring.vitimeteo.de abgerufen<br />
werden.<br />
Das Auftreten der Kirschessigfliege<br />
im Obst- <strong>und</strong> <strong>Wein</strong>bau ist<br />
maßgeblich von den über das<br />
Jahr herrschenden Entwicklungsbedingungen<br />
<strong>und</strong> dem daraus<br />
folgenden Populationsaufbau<br />
abhängig. Wichtige Faktoren<br />
sind die Witterungsbedingungen<br />
während des Winters sowie im<br />
Sommer <strong>und</strong> das Fruchtangebot<br />
über den Verlauf des Jahres.<br />
In den vergangenen Jahren hat<br />
sich herausgestellt, dass nicht alle<br />
Rebsorten gleichermaßen mit<br />
Eiern belegt werden. Eine Übersicht<br />
über die aktuelle Eiablagesituation<br />
findet sich ab Reifebeginn<br />
ebenfalls auf www.vitime<br />
teo.de bei den Monitoringdaten.<br />
Weitere Informationen zur Befallsvermeidung<br />
<strong>und</strong> direkten<br />
Bekämpfung stellen das WBI <strong>und</strong><br />
die LVWO in einer gesonderten<br />
Empfehlung <strong>und</strong> über die Webseiten<br />
zur Verfügung.<br />
Kräuselmilbe (Calepitrimerus<br />
vitis): Bevor eine Schädigung des<br />
Austriebs durch Kräuselmilben<br />
eintritt, ist bei zwei- bis fünfjährigen<br />
Anlagen frühzeitig im Jahr<br />
zwischen Knospenschwellen <strong>und</strong><br />
Wollestadium eine Behandlung<br />
empfehlenswert. Bei deutlichen<br />
Schadsymptomen ist der entstandene<br />
Schaden nicht mehr rückgängig<br />
zu machen. Mit einer<br />
Behandlung kann lediglich das<br />
Schadensmaß begrenzt werden.<br />
Bei starkem Sommerbefall<br />
sollten betroffene Stöcke <strong>und</strong><br />
Anlagen unbedingt für eine konsequente<br />
Austriebsbehandlung<br />
mit Ölen bzw. Schwefelpräparaten<br />
im folgenden Frühjahr vorgemerkt<br />
werden. Das Modell<br />
„VitiMeteoKräuselmilbe“ berechnet<br />
den Wanderungsbeginn der<br />
beiden Schadmilben Kräusel<strong>und</strong><br />
Pockenmilbe <strong>und</strong> gibt somit<br />
wichtige Hinweise für den gezielten<br />
Bekämpfungszeitpunkt.<br />
Allerdings stellt die effektivste<br />
Behandlung des Schädlings immer<br />
noch die Ansiedlung von<br />
Raubmilben dar, die als natürliche<br />
Gegenspieler eine Vermehrung<br />
der Milbe verhindern. In<br />
dem Zusammenhang soll auf den<br />
Einsatz von raubmilbenschonenden<br />
Pflanzenschutzmitteln bei<br />
der Bekämpfung von Rebkrankheiten<br />
hingewiesen werden.<br />
Reblaus (Daktulosphaira vitifoliae):<br />
In den vergangenen Jahren<br />
wird vermehrt von stärkerem<br />
Reblausbefall in Ertragsanlagen<br />
berichtet. Verwilderte <strong>Rebe</strong>n an<br />
Böschungen oder in Drieschen<br />
spielen eine entscheidende Rolle.<br />
Die Reblauspopulationen können<br />
an solchen Standorten immense<br />
Ausmaße annehmen. Die oberirdisch<br />
lebenden Blattrebläuse werden<br />
zum Beispiel durch den Wind<br />
auf die benachbarten Ertragsanlagen<br />
verdriftet, sodass sich dort<br />
ein deutlicher Befallsgradient,<br />
ausgehend von der reblausbefallenen<br />
Verwilderung, ausbildet.<br />
In solchen Fällen besteht<br />
Handlungsbedarf zur nachhaltigen<br />
Eindämmung der verwilderten<br />
<strong>Rebe</strong>n. In einigen Landkreisen<br />
sind für diesen Zweck Allgemeinverfügungen<br />
erarbeitet<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
9
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
worden. Nähere Informationen<br />
gibt die <strong>Wein</strong>bauberatung.<br />
Obstbaumspinnmilbe (Panonychus<br />
ulmi): Bevor eine Maßnahme<br />
gegen Spinnmilben<br />
durchgeführt wird, muss festgestellt<br />
werden, ob eine kritische<br />
Befallssituation eingetreten oder<br />
zu erwarten ist. Bei ausreichendem<br />
Besatz mit Raubmilben <strong>und</strong><br />
einer raubmilbenschonenden<br />
Spritzfolge sind keine Schäden zu<br />
erwarten. Die Bekämpfung erfolgt<br />
beim Austrieb gegen das<br />
Ei-Stadium mit entsprechenden<br />
Ölen beziehungsweise nach dem<br />
Austrieb mit einem Akarizid.<br />
Thripse (Drepanothrips reuteri):<br />
Verschiedene Thripsarten können<br />
vor allem während des Austriebs<br />
an den jungen Blättern Schäden<br />
verursachen (gleichmäßig über<br />
die Triebe verteilte Blattdeformationen).<br />
Thripse wandern in erster<br />
Linie dann auf die <strong>Rebe</strong>n,<br />
wenn ihre natürlichen Wirtspflanzen<br />
in der Begrünung durch<br />
Bodenpflegearbeiten entfernt<br />
werden. Raubmilben sind wichtige<br />
Gegenspieler der Thripse <strong>und</strong><br />
sollten daher gefördert werden.<br />
Grüne <strong>Rebe</strong>nzikade (Empoasca<br />
vitis): Zur Kontrolle können<br />
Blattunterseiten auf die Jugendstadien<br />
<strong>und</strong> Häutungsreste abgesucht<br />
werden. Die erwachsenen<br />
Tiere fliegen beim Berühren oder<br />
Abklopfen der Laubwand auf,<br />
verschwinden dann aber wieder<br />
auf die Blattunterseiten. Eine gezielte<br />
Bekämpfung der <strong>Rebe</strong>nzikade<br />
ist in der Regel nur bei sehr<br />
starkem Befall in der Sommergeneration<br />
nötig (Termin: 1. Nachblütespritzung).<br />
Amerikanische Rebzikade (Scaphoideus<br />
titanus): Die Amerikanische<br />
Rebzikade ist der Überträger<br />
der Flavescence dorée (FD).<br />
Diese Krankheit lässt sich optisch<br />
nur schwer von der Schwarzholzkrankheit<br />
unterscheiden. Im<br />
Sommer 2016 wurde die Amerikanische<br />
Rebzikade erstmals im<br />
Elsass an <strong>Rebe</strong>n nachgewiesen,<br />
allerdings ohne selbst Träger der<br />
Krankheit zu sein.<br />
Im Gegensatz zur Winden-<br />
Glasflügelzikade verbringt die<br />
Amerikanische Rebzikade ihren<br />
gesamten Lebenszyklus auf der<br />
<strong>Wein</strong>rebe <strong>und</strong> kann so leicht von<br />
einer <strong>Rebe</strong> auf die nächste fliegen.<br />
Ein Infoblatt zum Erkennen dieses<br />
Insektes ist unter www.wbibw.de<br />
abrufbar. Sollte Scaphoideus<br />
titanus in Rebanlagen gef<strong>und</strong>en<br />
werden, ist die Staatliche<br />
<strong>Wein</strong>bauberatung zu informieren.<br />
EINSATZ UNTERSCHIEDLICHER ABDRIFTMINDERUNGSKLASSEN<br />
90%<br />
75%<br />
Standardtechnik<br />
B: Restfläche: Spritzung beidseitig,<br />
Spritzdruck betriebsüblich<br />
B: Restfläche: Spritzung beidseitig, Luftleistung<br />
betriebsüblich, Spritzdruck betriebsüblich<br />
A: Randfahrt: Spritzung einseitig,<br />
B: Restfläche: Spritzung beidseitig,<br />
Druck betriebsüblich<br />
Behandlung mit<br />
Luftunterstützung<br />
A: Reihe 1-3:<br />
Spritzung einseitig,<br />
Spritzdruck 3-20 bar<br />
A: Reihe 1-3:<br />
Spritzung einseitig,<br />
max. 20.000 m³,<br />
Spritzdruck 3-20 bar<br />
20 m Abstand zum Gewässer<br />
(gemessen ab Böschungsoberkante)<br />
Teilbreite zum Gewässer<br />
geschlossen<br />
10 m Abstandsauflage<br />
gemäß §29 WG<br />
5 m Abstand<br />
zum Gewässer<br />
10 m Abstand zum Gewässer<br />
Das Staatliche <strong>Wein</strong>bauinstitut<br />
Freiburg (WBI) <strong>und</strong> die Staatliche<br />
Lehr- <strong>und</strong> Versuchsanstalt für<br />
<strong>Wein</strong>- <strong>und</strong> Obstbau <strong>Wein</strong>sberg<br />
(LVWO) führen seit Jahren ein<br />
Monitoring durch. Bisher wurde<br />
diese Zikade in Baden-Württemberg<br />
nicht nachgewiesen.<br />
Knospenschädlinge: Als Knospenschädlinge<br />
treten lokal, vor<br />
allem Larven verschiedener<br />
Schmetterlingsarten wie Rhombenspanner<br />
<strong>und</strong> Eulenfalter<br />
(„Erdraupen“, Noctua-Arten),<br />
auf. Die Raupen fressen an den<br />
Rebknospen. Dadurch kommt es<br />
zu einem, je nach Befall, mehr<br />
oder weniger großen Ausfall an<br />
Knospenaustrieb. Die Bekämpfung<br />
mit Insektiziden ist bei<br />
Knospenschädlingen nur schwer<br />
durchzuführen. Bei Befall ist das<br />
Absammeln der Raupen (bei<br />
Erdraupen nachts mit der Taschenlampe)<br />
sinnvoll.<br />
Bewuchsregulierung<br />
Herbizide werden, wenn notwendig,<br />
nur punkt- oder streifenförmig<br />
unter den Stöcken eingesetzt.<br />
Empfehlenswerte Einsatztermine:<br />
→ Im Frühjahr, sobald der Unterwuchs<br />
über 20 cm hoch ist<br />
<strong>und</strong> sich aus Arten zusammensetzt,<br />
die eine Konkurrenz für<br />
die <strong>Rebe</strong>n darstellen.<br />
→ Im Sommer ab Mitte Juni,<br />
um den Wiederaufwuchs zu regulieren,<br />
vor allem wenn hochwachsende<br />
Unkräuter, wie zum<br />
Beispiel Amarant, Winden oder<br />
Quecken auftreten.<br />
Hinweise, ab welchem Standjahr<br />
Herbizide eingesetzt werden<br />
können, sind der „Herbizid-Tabelle“<br />
auf Seite 15 zu entnehmen.<br />
Generell ist beim Einsatz von<br />
Herbiziden besondere Vorsicht<br />
geboten. Abdrift an die <strong>Rebe</strong>n<br />
kann zu großen Schäden, insbesondere<br />
während der Blüte führen.<br />
An Rändern, Wegen <strong>und</strong> in<br />
den Vorgewenden muss das<br />
Spritzgerät abgeschaltet werden.<br />
Flächen, die der Abführung<br />
von Oberflächenwasser dienen,<br />
wie Wegränder mit Abflussrin-<br />
10 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
nen <strong>und</strong> Wasserstaffeln, dürfen<br />
auf keinen Fall mit Herbiziden<br />
behandelt werden. Weiterhin ist<br />
es außerordentlich wichtig, die<br />
vielfältigen Auflagen bei den verschiedenen<br />
Herbiziden, wie beispielsweise<br />
die Nutzung von<br />
Spritzschirmen in den Gebrauchshinweisen<br />
genau zu beachten!<br />
Besondere Auflagen<br />
Pflanzenschutzmittel dürfen nur<br />
dann angewandt werden, wenn<br />
es aufgr<strong>und</strong> eines möglichen Befallsrisikos<br />
oder wegen Überschreitung<br />
einer Schadschwelle<br />
notwendig ist <strong>und</strong> wenn sie für<br />
das jeweilige Anwendungsgebiet<br />
eine Zulassung besitzen.<br />
Die in der Zulassung festgelegte<br />
Aufwandmenge, Zahl der maximalen<br />
Anwendungen <strong>und</strong> die<br />
Wartezeit bis zur Ernte dürfen<br />
nicht überschritten werden. Außerdem<br />
sind die Auflagen zum<br />
Schutz des Anwenders sowie der<br />
Gewässer <strong>und</strong> benachbarten Flächen<br />
(terrestrische Saumstrukturen)<br />
zu beachten.<br />
Abstände zu Oberflächengewässern:<br />
Zum Schutz von Gewässerorganismen<br />
sind Anwendungsbestimmungen<br />
(„NW-Auflagen“)<br />
einzuhalten. Diese fordern<br />
entweder die Einhaltung<br />
von festen Standardabständen für<br />
die angegebenen Anwendungsgebiete<br />
(zum Beispiel <strong>Wein</strong>bau)<br />
zwischen Gewässer <strong>und</strong> Behandlungsfläche<br />
oder varia ble, reduzierte<br />
Abstände durch Verwendung<br />
von verlustmindernden<br />
Pflanzenschutzgeräten.<br />
Als verlustmindernd gelten<br />
ausschließlich die im Verzeichnis<br />
„Verlustmindernde Geräte“ des<br />
Julius Kühn-Instituts aufgeführten<br />
Pflanzenschutzgeräte. Unter<br />
www.ltz-augustenberg.de ist eine<br />
Liste, der als verlustmindernd<br />
eingestuften Applikationstechnik<br />
(Düse/Gerät), sowie die Zuordnung<br />
zu den Abdriftminderungsklassen<br />
(50 %, 75 %, 90 % <strong>und</strong><br />
95 %) eingestellt. Die Abstände<br />
zu den Oberflächengewässern<br />
betragen maximal 20 m. Die jeweils<br />
einzuhaltenden Gewässerabstände<br />
sind aus den Pflanzenschutzmittel-Tabellen<br />
zu entnehmen.<br />
Bei Tankmischungen ist die<br />
weitestgehende Abstandauflage<br />
der einzelnen Mischungspartner<br />
einzuhalten.<br />
Beim Einsatz abdriftmindernder<br />
Technik (Düsen/Geräte) sind<br />
zur Reduzierung der vorgeschriebenen<br />
Gewässerabstände auch<br />
die mit der Anerkennung verb<strong>und</strong>enen<br />
Verwendungsbestimmungen<br />
zu beachten. Dazu gehört<br />
neben der sachgerechten Anpassung<br />
der Geräteeinstellung auf<br />
die zu behandelnde Laubwand<br />
häufig auch eine Reduzierung der<br />
Gebläseleistung im Randbereich<br />
zur Gewässerseite hin.<br />
Zusätzlich kann eine Abschaltung<br />
der zum Gewässer hin ausgerichteten<br />
Düsen in den äußeren<br />
drei Reihen erforderlich sein. Im<br />
Verzeichnis „Verlustmindernde<br />
Geräte“ sind die Verwendungsbestimmungen<br />
für jedes eingetragene<br />
Gerät beschrieben.<br />
→ Anwendungsbeispiel: Folgende<br />
Abstände sind gemäß den<br />
erteilten Anwendungsbestimmungen<br />
bei der Applikation von<br />
Folpan 80 WDG gegen Falscher<br />
Mehltau einzuhalten (siehe<br />
Tabelle S. 13): NW606: Standard<br />
= 20 m; NW605-1: 50 % Abdriftminderung<br />
= 15 m; 75 % Abdriftminderung<br />
= 10 m; 90 %<br />
Abdriftminderung = 5 m.<br />
Die Abbildung auf Seite 10<br />
zeigt die Anwendungsszenarien<br />
beim Einsatz von Geräten unterschiedlicher<br />
Abdriftminderungsklassen<br />
(Reihenabstand 2 m):<br />
→ Szenario I: Verwendung eines<br />
Geräts der Abdriftminderungsklasse<br />
90 % (zum Beispiel<br />
Wanner ZA 28 mit Düse aus<br />
„WA“, zum Beispiel Albuz AVI<br />
80-015).<br />
→ Szenario II: Verwendung eines<br />
Geräts der Abdriftminderungsklasse<br />
75 % (zum Beispiel<br />
Axialsprühgerät mit maximal<br />
20.000 m 3 /h in einer Getriebestufe<br />
mit Düse Lechler IDK 90-<br />
0067C).<br />
→ Szenario III: Verwendung<br />
von Standardtechnik (zum Beispiel<br />
Sprühgerät mit feintropfigen<br />
Hohlkegeldüsen in allen<br />
Düsenpositionen).<br />
Neben der NW605 <strong>und</strong><br />
NW606, die immer gemeinsam<br />
erteilt werden, kann auch die<br />
NW607 zur Auflage gemacht<br />
werden. Bei dieser strengeren<br />
Auflage ist eine Anwendung nur<br />
mit eingetragener verlustmindernder<br />
Technik möglich (zum<br />
Beipiel Piretro Verde: 90 % <strong>und</strong><br />
15 m Abstand).<br />
Angesichts der Tatsache, dass<br />
die Zulassungsbehörden hinsichtlich<br />
der Auflagen immer strenger<br />
werden <strong>und</strong> für einzelne Mittel<br />
auch Anwendungsbestimmungen<br />
erteilt werden können, die den<br />
Einsatz von 90 %-Technik auf der<br />
Gesamtfläche fordern, sind Winzer<br />
gut beraten, wenn sie in ein<br />
Gerät investieren, welches mindestens<br />
in der 90 %-Abdriftminderungsklasse<br />
eingetragen ist.<br />
Im Rahmen des Integrierten<br />
Pflanzenschutzes wurden für<br />
Baden-Württemberg zusätzliche<br />
landesspezifische Vorgaben formuliert<br />
(IPSplus), die mit dem<br />
neuen Naturschutzgesetz <strong>und</strong><br />
Landwirtschafts- <strong>und</strong> Landeskulturgesetz<br />
am 31. Juli 2020 in Kraft<br />
getreten sind. Danach soll in<br />
Rebanlagen in Landschaftsschutzgebieten<br />
<strong>und</strong> Natura<br />
2000-Gebieten sowie in Kern<strong>und</strong><br />
Pflegezonen von Biosphärengebieten,<br />
gesetzlich geschützten<br />
Biotopen <strong>und</strong> bei Naturdenkmalen<br />
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln<br />
auf das absolut<br />
notwendige Maß beschränkt<br />
werden. Zudem ist in diesen Gebieten<br />
der Einsatz abdriftmindernder<br />
Technik der 75 %-Klasse<br />
zwingend vorgeschrieben.<br />
Seit dem 1. Januar 2014 sind in<br />
Baden-Württemberg der Einsatz<br />
<strong>und</strong> die Lagerung von Dünge<strong>und</strong><br />
Pflanzenschutzmitteln in einem<br />
Bereich von 5 m zu Gewässern<br />
von wasserwirtschaftlicher<br />
Bedeutung verboten. Bereits seit<br />
dem 1. Januar 2010 ist die Kultivierung<br />
von <strong>Rebe</strong>n in einer Breite<br />
von 10 m entlang des Gewässers<br />
verboten. Pflanzungen vor diesem<br />
Stichtag genießen Bestandsschutz.<br />
Zusätzlich ist seit dem 1. Januar<br />
1996 die Errichtung baulicher<br />
<strong>und</strong> sonstiger Anlagen in diesem<br />
Bereich verboten. Hierzu gehören<br />
unter anderem Drahtanlagen<br />
bzw. Abspannvorrichtungen. Die<br />
hierfür relevanten Gewässer sind<br />
im Amtlichen Digitalen Wasserwirtschaftlichen<br />
Gewässernetz<br />
(AWGN) verzeichnet. Auskünfte<br />
erteilen die Unteren Wasserbehörden<br />
an den Landratsämtern.<br />
Abstände zu Saumstrukturen:<br />
Zum Schutz von Nichtzielorganismen<br />
der an Kulturflächen angrenzenden<br />
Saumbiotope (Hecken,<br />
Feldraine, Waldränder<br />
u. a.) sind beim Ausbringen von<br />
bestimmten Pflanzenschutzmitteln<br />
Mindestabstände von 20 m<br />
bzw. 25 m vorgeschrieben<br />
(NT101-NT103 <strong>und</strong> NT107-<br />
NT109). Diese Abstände können<br />
durch den Einsatz abdriftmindernder<br />
Technik reduziert werden.<br />
Für diese Behandlungseinschränkungen<br />
gelten folgende<br />
Ausnahmen:<br />
→ Die Fläche grenzt an eine<br />
Hecke mit weniger als 3 m Breite,<br />
→ die Saumstruktur ist nachweislich<br />
auf einer landwirtschaftlich<br />
oder gärtnerisch genutzten<br />
Fläche angepflanzt,<br />
→ Verwendung eines tragbaren<br />
Pflanzenschutzgerätes.<br />
Bei den Anwendungsbestimmungen<br />
NT107-109 kann zudem<br />
auf einen Mindestabstand (nicht<br />
jedoch auf den Einsatz verlustmindernder<br />
Technik) verzichtet<br />
werden, wenn die jeweilige Gemeinde<br />
einen ausreichenden Anteil<br />
an Kleinstrukturen besitzt.<br />
Im sogenannten Verzeichnis der<br />
regionalisierten Kleinstrukturen<br />
des JKI sind derzeit 89 Gemeinden<br />
in Baden-Württemberg verzeichnet<br />
(Stand: Januar <strong>2024</strong>),<br />
deren Kleinstrukturanteil aktuell<br />
nicht ausreichend ist. Dieses Verzeichnis<br />
wird laufend aktualisiert<br />
<strong>und</strong> ist auf der Homepage des JKI<br />
veröffentlicht.<br />
Text: WBI <strong>und</strong> LVWO<br />
Bild: Karl Bleyer<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
11
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
ERTRAGSANLAGEN, KELTERTRAUBEN, TAFELTRAUBEN, ÖKO-WEINBAU<br />
Diese Mittel stehen <strong>2024</strong><br />
zur Verfügung<br />
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie den aktuellen Stand der zugelassenen Pflanzenschutzmittel für<br />
den <strong>Wein</strong>bau (Stand: 3. Januar <strong>2024</strong>). Aktuelle Zulassungen gibts auch online unter www.bvl.b<strong>und</strong>.de.<br />
In den nachfolgenden Tabellen<br />
ist der Stand der Zulassung<br />
der Pflanzenschutzmittel<br />
im <strong>Wein</strong>bau mit den dazugehörigen<br />
Indikationen (Schaderregern)<br />
zusammengestellt. Die<br />
Daten basieren auf Angaben des<br />
B<strong>und</strong>esamtes für Verbraucherschutz<br />
<strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit<br />
(BVL) vom 3. Januar 2023.<br />
Für alle Pflanzenschutzmitteltabellen<br />
gilt: Keine Gewähr für die<br />
Richtigkeit <strong>und</strong> Vollständigkeit<br />
der Angaben. Für die Anwendung<br />
der genannten Pflanzenschutzmittel<br />
sind die Anwendungsbedingungen<br />
<strong>und</strong> Auflagen zu beachten<br />
<strong>und</strong> einzuhalten. Sie sind in den<br />
jeweiligen Gebrauchsanleitungen<br />
aufgeführt. WBI, LVWO<br />
Sonderfall Tafeltrauben<br />
EINSATZ VON PFLANZEN-<br />
SCHUTZMITTELN IM<br />
TAFEL TRAUBENANBAU<br />
Tafeltrauben mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln,<br />
für die im Tafeltraubenanbau keine Zulassung<br />
vorhanden ist, sind nicht verkehrsfähig. Wenn<br />
Keltertrauben als Tafeltrauben vermarktet werden,<br />
sind diese Vorgaben zu beachten. In den Tabellen<br />
Fungizide, Insektizide <strong>und</strong> Herbizide finden Sie die<br />
informative Spalte, welche Präparate für Tafeltrauben<br />
genehmigt bzw. nicht genehmigt sind.<br />
Bei Tafeltrauben sind nicht alle in den Tabellen aufgeführten<br />
Herbizide zugelassen. Bitte beachten sie<br />
die Anwendungshinweise auf der Packung.<br />
KONTAKT<br />
<strong>Wein</strong>bauberatung<br />
HN: Tel. 07131 / 994-7111, M:<br />
0175 / 2622383; Tel. 07131 /<br />
994-7353, M: 0175 / 2619011<br />
Main-Tauber: Tel. 07931 / 4827-<br />
6332, M: 0171 / 7623278<br />
LB: Tel. 07141 / 144-44917<br />
KA: Tel. 0721 / 936-88400, M:<br />
0175 / 7232543<br />
RA: Tel. 07222 / 381-4522<br />
Ortenau: Tel. 0781 / 8057-206<br />
EM: Tel. 07641 / 451-9132, M:<br />
0175 / 2623256<br />
Breisgau-Hochschwarzwald:<br />
Tel. 0761 / 2187-5828, M: 0162 /<br />
2550675; Tel. 0761 / 21875858,<br />
M: 0162 / 2550680; Tel. 0761 /<br />
2187-5827, M: 0162 / 255 0679<br />
HINWEISE UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ZU DEN PFLANZENSCHUTZTABELLEN<br />
Formulierung<br />
Wirkstoffkategorie<br />
Aufwandmenge<br />
Raubmilben<br />
Bienenschutz<br />
Wartezeit<br />
NT-Auflagen<br />
Abstandsauflagen<br />
Sonstige Angaben<br />
AE: Aerosoldose, -flasche, EW: Emulsion, Öl in Wasser (ME=Mikroemulsion), EC: Emulsionskonzentrat, WG: Wasserdispergierbares Granulat, SC: Suspensionskonzentrat,<br />
VP: Verdampfender Wirkstoff, SE: Suspoemulsion, SL: Wasserlösliches Konzentrat, WP: Wasserdispergierendes Pulver, OD: Dispersion in Öl (ölhaltiges Suspensionskonzentrat),<br />
DC: Dispersionskonzentrat, CS: Kapselsuspension, SG: Wasserlösliches Granulat<br />
Die Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen (z. B. L oder L/G) geben unterschiedliche Wirkstoffkategorien an <strong>und</strong> dienen der Antiresistenzstrategie bei Fungiziden.<br />
Der Basisaufwand (Basis) ist die Mittelaufwandmenge zum Zeitpunkt des Austriebes pro Hektar (ha). Die Aufwandmenge ist im Verlauf der Vegetationsperiode kontinuierlich an das<br />
Entwicklungsstadium (BBCH) der <strong>Rebe</strong> anzupassen. Das Dosiermodell nach Laubwandfläche (LWF) richtet sich primär an der zu behandelnden Laubwandfläche aus.<br />
BBCH 00-BBCH 61; Austrieb bis Beginn Blüte: Basisaufwand x 1 bis 2; BBCH 61-BBCH 71; Beginn der Blüte bis Fruchtansatz: Basisaufwand x 2 bis 3; BBCH 71-BBCH 75;<br />
Frucht ansatz bis Beeren erbsengroß: Basisaufwand x 3 bis 4; BBCH 75-BBCH 81; Beeren erbsengroß bis Beginn Reife: Basisaufwand x 4<br />
LWF Das Dosiermodell nach Laubwandfläche (LWF) richtet sich primär nach der zu behandelnden Fläche der Laubwand aus <strong>und</strong> nicht nach den BBCH-Stadien.<br />
II Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilben) bzw. relevanter Raubmilben <strong>und</strong> Spinnen eingestuft.<br />
III Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilben) bzw. relevanter Raubmilben <strong>und</strong> Spinnen eingestuft.<br />
B1 Das Mittel ist als bienengefährlich eingestuft. Es darf nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter.<br />
B2 Das Mittel wird als bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23 Uhr, eingestuft. Es darf außerhalb<br />
dieses Zeitraums nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht.<br />
B3 Aufgr<strong>und</strong> der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen nicht gefährdet.<br />
B4 Das Mittel wird bis zur höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge bzw. Anwendungskonzentration als nicht bienengefährlich eingestuft.<br />
NN410 Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum<br />
Schutz von Wildbienen in den Abendst<strong>und</strong>en erfolgen.<br />
Die Wartezeit ist die Zeit zwischen der letzten Anwendung eines Pflanzenschutzmittels <strong>und</strong> der Ernte bzw. der frühestmöglichen Nutzung des behandelten Erntegutes.<br />
F Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen <strong>und</strong>/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung <strong>und</strong> Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. dass die<br />
Festsetzung einer Wartezeit in Tagen nicht erforderlich ist.<br />
NT101 bis NT103 Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte<br />
Flächen, Straßen, Wege <strong>und</strong> Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50 % (NT101), 75 % (NT102) bzw. 90 % (NT103)<br />
eingetragen ist.<br />
NT108 <strong>und</strong> NT109 Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte<br />
Flächen, Straßen, Wege <strong>und</strong> Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät<br />
erfolgen, das mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % (NT108) bzw. 90 % (NT109) eingetragen ist.<br />
5/10 Gemäß PflSchAnwV § 4a (1) gilt ein Mindestabstand von 10 m zu angrenzenden Gewässern einzuhalten. Abweichend beträgt der einzuhaltende Mindestabstand 5 m, wenn<br />
eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke vorhanden ist. Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des Pflanzenbewuchses darf einmal innerhalb von Fünfjahreszeiträumen<br />
durchgeführt werden. Der erste Fünfjahreszeitraum beginnt mit dem 08.09.2021.<br />
1) Die Aufbrauchfrist endet 18 Monate nach Zulassungsende (6 Monate für den Verkauf <strong>und</strong> Vertrieb sowie 12 zusätzliche Monate für den Verbrauch der Restbestände).<br />
2) Diese Pflanzenschutzmittel sind im ökologischen <strong>Wein</strong>bau nach der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1165 zugelassen (Stand November 2023).<br />
3) Die Anwendung ist nur nach Beantragung <strong>und</strong> Genehmigung einer Ausnahme zulässig.<br />
4) Die Anwendung ist nur nach Beantragung <strong>und</strong> Genehmigung einer Ausnahme sowie nach gesonderter behördlicher Freigabe in schwerwiegenden Ausnahmefällen zulässig.<br />
5) Laut Hersteller soll die Zulassung des Wirkstoffs Metiram am 28.02.<strong>2024</strong> beim BVL widerrufen werden. Somit endet die Aufbrauchfrist von Polyram bereits am 28.11.<strong>2024</strong>.<br />
(A.51) Die Pflanzenschutzmittel sind nach Artikel 51 (VO (EG) Nr. 1107/2009) zugelassen. In Abhängigkeit von Kultur, Sorte <strong>und</strong> dem Anbauverfahren können Schäden an der Kultur<br />
nicht ausgeschlossen werden. Vor einem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.<br />
n. a. Mittel nicht anwendbar, mit Ausnahme der Abstand zum angrenzenden Gewässer beträgt mehr als 100 m.<br />
- Anwendung nicht zulässig bzw. nicht vorgesehen.<br />
* Für Tafeltrauben gelten teilweise andere Anwendungsbestimmungen bzw. Wartezeiten.<br />
# Anwendung nur in Junganalgen zulässig..<br />
12 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
FUNGIZIDE<br />
Handelsname<br />
Wirkstoff(e)<br />
Wirkstoffkategorie<br />
Wirkstoffgehalt<br />
[g/kg bzw. g/l]<br />
Formulierung<br />
BBCH 00-16<br />
Aufwandmenge in<br />
Abhängigkeit vom BBCH-<br />
Stadium [kg bzw. l/ha]<br />
BBCH 61<br />
BBCH 71<br />
BBCH 75<br />
Max. Anzahl Anwendungen<br />
Raubmilben<br />
Bienenschutz<br />
Wartezeit Keltertraube<br />
[Tage]<br />
NT-Auflage<br />
Standard<br />
Abstandsauflagen<br />
Gewässer [m]<br />
Abdriftminderung<br />
[%]<br />
Basis x 2 x 3 x 4 50 75 90<br />
<strong>Rebe</strong>nperonospora<br />
Wirkstoffe mit protektiver Wirkung<br />
Diverse Wirkstoffgruppen<br />
Delan WG Dithianon 700 WG 0,2 0,4 0,6 0,8 8 B4 49 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.01.<strong>2024</strong><br />
Delan Pro<br />
Dithianon<br />
125 SC 1,2 2,4 3,6 4 4 B4 42 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.08.2025<br />
Kaliumphosphonat<br />
561<br />
Enervin SC Ametoctradin (Initium®) S 200 SC 0,6 1,2 1,8 2,4 2 II B4 21 20 15 10 5 - - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Folpan 80 WDG Folpet 800 WG 0,4 0,8 1,2 1,6 8 B4 35 20 15 10 5/10 ja* - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Folpan 500 SC Folpet 500 SC 0,6 1,2 1,8 2,4 8 B4 35 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Videryo F<br />
Folpet<br />
F 400 SC 0,625 1,25 1,875 2,5 6 B4 28 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Cyazofamid<br />
40<br />
Mildicut<br />
Cyazofamid<br />
F 25 SC 1,0 2,0 3,0 4,0 6 B4 21 10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 30.06.<strong>2024</strong><br />
Dinatriumphosphonat<br />
250<br />
Polyram WG Metiram 700 WG 0,8 1,6 2,4 3,2 3 II B4 56 101 n.a. n.a. n.a. 15 ja - ja3) 5)<br />
Profiler<br />
Fluopicolide<br />
P 44,4 WG 0,75 1,5 2,25 3,0 2 B4 28 101 10 10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Fosetyl-Al<br />
667<br />
Wirkstoffgruppe: Phosphonate<br />
Foshield,<br />
Kaliumphosphonat 726 SL 1,0 2,0 3,0 4,0 6 B4 14 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 30.09.<strong>2024</strong><br />
Elixir, Phosfik, Rombiphos <strong>Extra</strong><br />
Frutogard, Alginure Bio Schutz Kaliumphosphonat 342 SL 1,5 3,0 4,5 - 6 B4 14 10 10 5/10 5/10 ja - ja 3) 30.09.<strong>2024</strong><br />
Veriphos Kaliumphosphonat 755 SL 1,0 3,0 4,0 - 5 B4 28 5/10 5/10 5/10 5/10 - - ja 3) 30.09.<strong>2024</strong><br />
Wirkstoffgruppe: Kupfer<br />
Cuprozin progress Kupferhydroxid 383 SC 0,4 0,8 1,2 1,6 7 B4 21 15 10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 30.09.<strong>2024</strong><br />
Funguran progress Kupferhydroxid 537 WP 0,5 1 1,5 2 4 B4 21 15 10 10 5/10 ja ja ja 3) 30.09.<strong>2024</strong><br />
Airone SC,<br />
Kupferoxychlorid<br />
229 SC 0,65 1,3 1,95 2,6 5 II B4 21 20 10 10 5/10 - ja ja 3) 31.03.<strong>2024</strong><br />
Grifon SC<br />
Kupferhydroxid<br />
208<br />
Coprantol Duo<br />
Kupferoxychlorid<br />
235 SC 0,625 1,25 1,875 2,5 5 II B4 21 15 10 10 5/10 - ja ja 3) 31.03.<strong>2024</strong><br />
Kupferhydroxid<br />
215<br />
Cuproxat Kupfersulfat, basisch 345 SC 2,0 4,0 6,0 8,0 2 II B4 21 n.a. 15 10 5/10 ja ja ja 3) 31.10.<strong>2024</strong><br />
Biologische Präparate<br />
FytoSave COS-OGA 13 SL 0,5 1 1,5 2 8 II B4 3 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 22.04.2031<br />
Romeo Cerevisane 941 WP 0,25 0,25 0,25 0,25 10 B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 23.04.2031<br />
Upside ABE IT-56 (S. cerevisiae) 326 SC 2,5 l/10.000 m² LWF; max. 4 l/ha 8 B4 3 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 20.05.2035<br />
Wirkstoffe mit protektiver <strong>und</strong> kurativer Wirkung<br />
Wirkstoffgruppen: Cyanoacetamide-Oxime & andere Wirkstoffe<br />
Afrasa Triple WG<br />
Cymoxanil<br />
Folpet<br />
Fosethyl-Al<br />
Wirkstoffgruppen: CAA-Fungizide & andere Wirkstoffe<br />
Ampexio<br />
Mandipropamid<br />
Zoxamide<br />
Forum Gold,<br />
Dimethomorph<br />
Aktuan Gold<br />
Dithianon<br />
VinoStar<br />
Dimethomorph<br />
Folpet<br />
Melody Combi<br />
Iprovalicarb<br />
Folpet<br />
Orvego<br />
Dimethomorph<br />
Ametoctradin<br />
Wirkstoffgruppen: Acylalanine & Phthalimide<br />
Fantic F<br />
Benalaxyl-M<br />
Folpet<br />
Folpan Gold<br />
Metalaxyl-M<br />
Folpet<br />
Wirkstoffgruppe: Sulfamoyl-Triazole & Phthalimide<br />
Sanvino<br />
Amisulbrom<br />
Folpet<br />
B 40<br />
250<br />
466<br />
C/E 250<br />
240<br />
C 150<br />
350<br />
C 113<br />
600<br />
C 90<br />
563<br />
C/S 225<br />
300<br />
F 50<br />
500<br />
Wirkstoffgruppen: Piperidinyl-Thiazole-Isoxazoline & Phthalimide<br />
Zorvec Vinabel<br />
Oxathiapiprolin<br />
Q/E 40<br />
Zoxamide<br />
300<br />
Zorvec Zelavin Bria<br />
Oxathiapiprolin<br />
Q 100<br />
Folpet<br />
800<br />
WG - 1,5 2,25 3 3 III B4 28 15 10 10 5/10 - - ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
WG 0,16 0,32 0,48 0,48 3 B4 21 15 10 10 5/10 ja - ja 3) 30.09.<strong>2024</strong><br />
WG 0,48 0,96 1,44 1,56 3 B4 35 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.08.2025<br />
WG 0,48 0,96 1,44 1,92 3 B4 35 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
0,5 1,0 1,5 2,0<br />
WG 0,55 1,1 1,65 2,2 4 III B4 28 103 n.a. n.a. n.a. 20 - - ja 3) 15.02.2026<br />
SC 0,4 0,8 1,2 1,6 2 II B4 35 10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
D 38<br />
480<br />
WG 0,6 1,2 1,8 2,4 3 B4 42 n.a. n.a. n.a. 20 - - ja 3) 31.12.2029<br />
D 49 WG 1 2 2 2 2 B4 28 n.a. n.a. 20 10 - - ja 3) 15.02.2026<br />
400<br />
WG 0,375 0,75 1,125 1,5 4 II B4 28 15 10 10 5/10 - - ja 3) 30.09.2025<br />
SE<br />
OD 0,08<br />
WG 0,4<br />
0,38l/10.000m² LWF;<br />
max.0,6l/ha<br />
0,16 0,24 0,32<br />
0,8 1,2 1,6<br />
Tafeltrauben Zulassung<br />
Zulassung ökologischer<br />
<strong>Wein</strong>bau 2)<br />
Anwendung Naturschutzgebiete<br />
2 B4 28 20 15 10 5 ja - ja 3) 30.03.2028<br />
2 B4 35 20 15 10 5/10 ja - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Oidium<br />
Wirkstoffgruppe: Azole (DMI-Fungizide)<br />
Belanty Mefentrifluconazol G 75 SC 1 l/10.000 m² LWF; max. 2 l/ha 2 B4 21 10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 20.03.2030<br />
Sarumo, Galileo Tetraconazol G 40 EW 0,3 0,6 0,75 0,75 3 II B4 28 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Topas Penconazol G 100 EC 0,08 0,16 0,24 0,32 4 B4 35 5/10 5/10 5/10 5/10 ja* - ja 3) 31.12.2026<br />
Wirkstoffgruppe: Strobilurine (QoI-Fungizide)<br />
Flint Trifloxystrobin A 500 WG 0,06 0,12 0,18 0,24 3 B4 35 10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 30.06.<strong>2024</strong><br />
Wirkstoffgruppen: Strobilurine & Azole & SDHI-Fungizide<br />
Custodia<br />
Azoxystrobin<br />
A/G 120 SC 0,175 0,35 0,525 0,7 2 II B4 35 101 15 10 10 5/10 - - ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Tebuconazol<br />
200<br />
Collis<br />
Kresoxim-methyl A/L 100 SC 0,16 0,32 0,48 0,64 3 B4 28 10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.12.2026<br />
Boscalid<br />
200<br />
Wirkstoffgruppen: SDHI-Fungizide & Azole & Spiroketalamine<br />
Luna Experience<br />
Fluopyram<br />
L/G 200 SC 0,125 0,25 0,375 0,5 3 II B4 14 15 10 10 5/10 - - ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Tebacunazol<br />
200<br />
Luna Max<br />
Fluopyram<br />
L/H 75 SC 0,33 0,66 1 - 2 B4 35 n.a. 20 15 10 - - ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Spiroxamine<br />
200<br />
Sercadis Fluxapyroxad L 300 SC 0,06 0,12 0,18 0,24 3 II B4 35 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.05.2026<br />
Wirkstoffgruppe: Spiroketalamine<br />
Prosper TEC Spiroxamine H 300 CS 0,33 0,66 0,99 - 2 B4 35 5/10 5/10 5/10 5/10 - - ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Spirox Spiroxamine H 500 EC 0,20 0,40 0,60 - 2 II B4 14 n.a. n.a. 20 15 ja - ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Zugelassen bis 1)<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
13
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
FUNGIZIDE<br />
Handelsname<br />
Wirkstoff(e)<br />
Wirkstoffkategorie<br />
Wirkstoffgehalt<br />
[g/kg bzw. g/l]<br />
Formulierung<br />
BBCH 00-16<br />
Aufwandmenge in<br />
Abhängigkeit vom BBCH-<br />
Stadium [kg bzw. l/ha]<br />
BBCH 61<br />
BBCH 71<br />
BBCH 75<br />
Max. Anzahl Anwendungen<br />
Raubmilben<br />
Bienenschutz<br />
Wartezeit Keltertraube<br />
[Tage]<br />
NT-Auflage<br />
Standard<br />
Abstandsauflagen<br />
Gewässer [m]<br />
Abdriftminderung<br />
[%]<br />
Basis x 2 x 3 x 4 50 75 90<br />
Oidium (Fortsetzung)<br />
Wirkstoffgruppe: Quinazolinone<br />
Talendo, Talius Proquinazid J 200 EC 0,1 0,2 0,3 0,375 4 B4 28 101 15 10 10 5/10 ja - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Wirkstoffgruppen: Quinazolinone & Azole<br />
Talendo <strong>Extra</strong><br />
Proquinazid<br />
J/G 160 EC 0,1 0,2 0,3 0,4 3 II B4 28 15 10 10 5/10 ja - ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Tetraconazole<br />
80<br />
Wirkstoffgruppe: Benzophenone<br />
Kusabi Pyriofenone K 300 SC 0,075 0,15 0,225 0,3 3 B4 28 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.12.2027<br />
Vivando Metrafenone K 500 SC 0,08 0,16 0,24 0,32 3 B4 28 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 15.12.2025<br />
Wirkstoffgruppen: Phenyl-Acetamide & Azole<br />
Dynali<br />
Cyflufenamid<br />
Difenoconazol<br />
R/G 30<br />
60<br />
DC 0,2 0,4 0,6 0,8 2 B4 21 10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.03.2025<br />
Wirkstoffgruppe: Schwefel<br />
Kumulus WG,<br />
Schwefel 800 WG 3,6 4,8 2,4 3,2 8 II B4 56 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja* ja ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Thiovit Jet, Microthiol S<br />
Microthiol WG Schwefel 800 WG 6 8 4 5,3 10 II B4 56 102 5/10 5/10 5/10 5/10 ja* ja ja 3) 15.04.2026<br />
Netzschwefel Stulln Schwefel 799 WG 5 5 5 5 8 II B4 28 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja* ja ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
SulfoLiq 800 SC Schwefel 800 SC 4 4 4 4 8 II B4 56 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja* ja ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Wirkstoffgruppe: Hydrogencarbonate<br />
Kumar Kaliumhydrogencarbonat 850 WP 1,25 2,5 3,75 5 6 III B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
VitiSan Kaliumhydrogencarbonat 990 WP 3 6 9 12 6 B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.10.2037<br />
Biologische Präparate<br />
FytoSave COS-OGA 13 SL 0,50 1,00 1,50 2,00 8 II B4 3 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 22.04.2031<br />
Romeo Cerevisane 941 WP 0,25 0,25 0,25 0,25 10 B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 23.04.2031<br />
Taegro<br />
B. amyloliquefaciens<br />
130 WP 0,37 0,37 0,37 0,37 10 B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 01.06.2033<br />
Stamm FZB24<br />
Botrytis<br />
Wirkstoffgruppen: Anilino-Pyrimidine & Phenylpyrrole<br />
Pyrus Pyrimethanil M 400 SC 0,625 1,25 1,875 2,5 2 B4 21 10 10 5/10 5/10 - - ja 3) 30.04.<strong>2024</strong><br />
Scala Pyrimethanil M 400 SC 0,5 1,0 1,5 2,0 1 B4 28 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 15.03.2026<br />
Switch<br />
Cyprodinil<br />
M/N 375 WG - - - 0,96 2 B4 21 102 20 15 10 10 ja - ja 3) 31.12.2026<br />
Fludioxonil<br />
250<br />
Wirkstoffgruppe: SDHI-Fungizide<br />
Cantus Boscalid L 500 WG 0,3 0,6 0,9 1,2 1 B4 28 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 15.04.2027<br />
Kenja Isofetamid L 400 SC 0,375 0,75 1,125 1,5 2 B4 21 5/10 5/10 5/10 5/10 - - ja 3) 15.09.2027<br />
Wirkstoffgruppe: Aminopyrazolinone<br />
Prolectus, Kamuy Fenpyrazamine O 500 WG 0,3 0,6 0,9 1,2 1 II B4 21 15 10 10 5/10 ja* - ja 3) 31.12.2026<br />
Wirkstoffgruppe: Hydrogencarbonate<br />
Kumar Kaliumhydrogencarbonat 850 WP - - 5 5 4 III B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Biologische Präparate<br />
Botector<br />
Aureobasidium pullulans<br />
DSM14940<br />
DSM14941<br />
500<br />
500<br />
WG - - 0,75 1 3 B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.12.2025<br />
Romeo Cerevisane 941 WP 0,25 0,25 0,25 0,25 5 B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 23.04.2031<br />
Serenade ASO<br />
B. amyloliquefaciens<br />
14 SC - - 4 4 4 III B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 15.08.2025<br />
Stamm QST 713<br />
Taegro<br />
B. amyloliquefaciens<br />
130 WP 0,37 0,37 0,37 0,37 10 B4 1 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 01.06.2033<br />
Stamm FZB24<br />
Essigfäule <strong>und</strong> Botrytis; Bioregulatoren zur Lockerung des Traubengerüstes (Rebsortenempfehlung <strong>und</strong> Mengenangaben des Herstellers beachten!)<br />
Wirkstoffgruppe: Pflanzenhormone<br />
Berelex 40 SG Gibberellinsäure 400 WG BBCH 62-68: 50 g/ha 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 - - ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Gibb 3 Gibberellinsäure 100 Tab BBCH 62-68: 16 Tabletten/ha 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 - - ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Wirkstoffgruppe: Carbonsäuren<br />
Regalis Plus Prohexadion 85 WG BBCH 61-65: 1,8 kg/ha 1 II B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 - - ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Esca<br />
Tessior<br />
Pyraclostrobin<br />
A/L 5 SC ab Vegetationsruhe: 20 l/ha 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Boscalid<br />
10<br />
Biologische Präparate<br />
Vintec<br />
Eutypiose<br />
Tessior<br />
Phomopsis<br />
Aktuan<br />
Trichoderma atroviride<br />
Stamm SC1<br />
Pyraclostrobin<br />
Boscalid<br />
Cymoxanil<br />
Dithianon<br />
A/L 5<br />
10<br />
B 100<br />
250<br />
150 WG ab Vegetationsruhe: 0,2 kg/<br />
ha<br />
Tafeltrauben Zulassung<br />
Zulassung ökologischer<br />
<strong>Wein</strong>bau 2)<br />
Anwendung Naturschutzgebiete<br />
2 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 - ja ja 3) 06.07.2032<br />
SC ab Vegetationsruhe: 20 l/ha 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
WP 0,5 1,0 - - 3 B4 35 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Delan WG Dithianon 700 WG 0,3 0,6 - - 3 B4 49 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.01.<strong>2024</strong><br />
Flint Trifloxystrobin A 500 WG 0,06 0,12 - - 3 B4 35 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 30.06.<strong>2024</strong><br />
Folpan 80 WDG Folpet 800 WG 0,6 1,2 - - 4 B4 35 20 15 10 5/10 ja* - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Folpan 500 SC Folpet 500 SC 1,0 2,0 - - 4 B4 35 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Zugelassen bis 1)<br />
14 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
FUNGIZIDE<br />
Handelsname<br />
Phomopsis (Fortsetzung)<br />
Melody Combi<br />
Wirkstoff(e)<br />
Iprovalicarb<br />
Folpet<br />
Wirkstoffkategorie<br />
Wirkstoffgehalt<br />
[g/kg bzw. g/l]<br />
C 90<br />
563<br />
Formulierung<br />
BBCH 00-16<br />
Aufwandmenge in<br />
Abhängigkeit vom BBCH-<br />
Stadium [kg bzw. l/ha]<br />
BBCH 61<br />
BBCH 71<br />
BBCH 75<br />
Max. Anzahl Anwendungen<br />
Raubmilben<br />
Bienenschutz<br />
Wartezeit Keltertraube<br />
[Tage]<br />
NT-Auflage<br />
Standard<br />
Abstandsauflagen<br />
Gewässer [m]<br />
Abdriftminderung<br />
[%]<br />
Basis x 2 x 3 x 4 50 75 90<br />
WG 0,55 1,1 - - 2 III B4 28 103 n.a. n.a. n.a. 20 - - ja 3) 15.02.2026<br />
Microthiol WG Schwefel 800 WG 6,25 - - - 3 II B4 56 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja* ja ja 3) 15.04.2026<br />
Polyram WG Metiram 700 WG 0,8 1,6 - - 2 II B4 56 101 n.a. n.a. 20 10 ja - ja3) 5)<br />
Roter Brenner<br />
Aktuan<br />
Cymoxanil<br />
Dithianon<br />
B 100<br />
250<br />
WP 0,5 1,0 - - 3 B4 35 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Cuprozin progress (A.51) Kupferhydroxid 383 SC 2,5 5,0 - - 3 B4 F 101 20 15 10 5/10 ja ja ja 3) 30.09.<strong>2024</strong><br />
Delan WG Dithianon 700 WG 0,3 0,6 - - 3 B4 49 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.01.<strong>2024</strong><br />
Dynali<br />
Cyflufenamid<br />
Difenoconazol<br />
R/G 30<br />
60<br />
DC 0,2 0,4 - - 2 B4 21 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.03.2025<br />
Flint Trifloxystrobin A 500 WG 0,06 0,12 - - 3 B4 35 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 30.06.<strong>2024</strong><br />
Folpan 80 WDG Folpet 800 WG 0,6 1,2 - - 3 B4 35 20 15 10 5/10 ja* - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Folpan 500 SC Folpet 500 SC 1,0 2,0 - - 3 B4 35 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.07.<strong>2024</strong><br />
Melody Combi<br />
Iprovalicarb<br />
Folpet<br />
C 90<br />
563<br />
WG 0,55 1,1 - - 2 III B4 28 103 n.a. n.a. n.a. 20 - - ja 3) 15.02.2026<br />
Polyram WG Metiram 700 WG 0,8 1,6 - - 2 II B4 56 101 n.a. n.a. 20 10 ja - ja3) 5)<br />
Schwarzfäule<br />
Belanty Mefentrifluconazol G 75 SC 1 l/10.000 m² LWF; max. 2 l/ha 2 B4 21 10 5/10 5/10 5/10 ja ja 3) 20.03.2030<br />
Cuprozin progress (A.51) Kupferhydroxid 383 SC 0,4 0,8 1,2 1,6 10 B4 21 15 10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 30.09.<strong>2024</strong><br />
Delan Pro<br />
Dynali<br />
Dithianon<br />
Kaliumphosphonat<br />
Cyflufenamid<br />
Difenoconazol<br />
125<br />
561<br />
R/G 30<br />
60<br />
SC 1,2 2,4 3,6 4 4 B4 42 20 15 10 5/10 - - ja 3) 31.08.2025<br />
DC 0,2 0,4 0,6 0,8 2 B4 21 10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.03.2025<br />
Flint (A.51) Trifloxystrobin A 500 WG 0,06 0,12 0,18 0,24 3 B4 35 10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 30.06.<strong>2024</strong><br />
Luna Experience<br />
Fluopyram<br />
L/G 200 SC 0,125 0,25 0,375 0,5 3 II B4 14 15 10 10 5/10 - - ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Tebacunazol<br />
200<br />
Polyram WG (A. 51) Metiram 700 WG 0,8 1,6 2,4 3,2 6 II B4 56 101 n.a. n.a. n.a. 15 ja - ja3) 5)<br />
Sercadis Fluxapyroxad L 300 SC 0,06 0,12 0,18 0,24 3 II B4 35 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 3) 31.05.2026<br />
Topas Penconazol G 100 EC 0,08 0,16 0,24 0,32 4 B4 35 5/10 5/10 5/10 5/10 ja* - ja 3) 31.12.2026<br />
Für folgende Mittel gilt noch eine Aufbrauchfrist<br />
Aufbrauchfrist bis:<br />
Forum Star<br />
Dimethomorph<br />
Folpet<br />
C 113<br />
600<br />
WG 0,48<br />
0,5<br />
0,96<br />
1,0<br />
1,44<br />
1,5<br />
1,92<br />
2,0<br />
Tafeltrauben Zulassung<br />
Zulassung ökologischer<br />
<strong>Wein</strong>bau 2)<br />
3 B4 35 20 15 10 5/10 - - ja 3) 30.06.<strong>2024</strong><br />
Polyram WG Metiram 700 WG 0,8 1,6 2,4 3,2 3 II B4 56 101 n.a. n.a. n.a. 15 ja - ja 3) 28.11.<strong>2024</strong><br />
Zugelassen bis 1)<br />
HERBIZIDE<br />
Wirkstoffgehalt<br />
[g/kg bzw.gl/l]<br />
Formulierung<br />
Aufwandmenge<br />
[g bzw. ml /m² ]<br />
Anwendung ab Standjahr<br />
Tafeltrauben Zulassung<br />
Anzahl Anwend. max.<br />
Raubmilben<br />
Bienenschutz<br />
Wartezeit [Tage]<br />
NT-Auflage<br />
Anwendung Naturschutzgebiete<br />
Abstandsauflagen<br />
Gewässer [m]<br />
Abdriftminderung<br />
[%]<br />
50 75 90<br />
Handelsname<br />
Wirkstoff(e)<br />
Blattherbizide<br />
Amega 360 Glyphosat 360 SL 0,5 4 ja 2 III B4 30 103 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - - 15.12.<strong>2024</strong><br />
Ro<strong>und</strong>up Rekord Glyphosat 720 WG 0,25 4 ja 2 III B4 30 103 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - - 31.12.<strong>2024</strong><br />
Ro<strong>und</strong>up PowerFlex Glyphosat 480 SL 0,375 4 ja 2 II B4 30 103 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - - 15.12.<strong>2024</strong><br />
Taifun forte Glyphosat 360 WG 0,5 4 ja 2 II B4 30 103 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - - 15.12.<strong>2024</strong><br />
Bodenherbizide<br />
Kerb FLO, Groove Propyzamid 400 SC 0,625 2 ja 1 B4 F 103 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.01.2025<br />
<strong>Wein</strong>rebe <strong>und</strong> Wurzelschosse<br />
Garlon (A.51),<br />
Triclopyr 150<br />
Rodung - 1 III B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 15.12.2025<br />
Ranger (A.51) (bei Stockinjektion)<br />
Fluroxypyr 150<br />
EC 0,4 ml /<br />
Stock<br />
max.<br />
2,0 l/ha<br />
Blatt- <strong>und</strong> Bodenherbizide<br />
Beloukha Pelargonsäure 680 EC 0,16 4 ja 2 III B4 F 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 15.12.2025<br />
Chikara, Katana Flazasulfuron 250 WG 0,02 4 ja 1 B4 90 102 n.a. 15 10 5/10 ja ja ja 3) 31.07.2033<br />
Focus Aktiv-Pack Cycloxydim 100 EC 0,2 1 - 1 B4 42 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.12.2025<br />
0,5<br />
102<br />
Vorox F (A.51), Hyganex-Perfekt Flumioxazin 500 WG 0,06 # ja 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 30.06.<strong>2024</strong><br />
Stockaustriebe<br />
Beloukha Pelargonsäure 680 EC 0,16 4 ja 2 III B4 F 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 15.12.2025<br />
Quickdown (A.51)<br />
(Rebsorten begrenzt)<br />
Pyraflufen 24 EC 0,04 3 ja 2 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.01.2025<br />
Shark (A.51)<br />
(Rebsorten begrenzt)<br />
Carfentrazone 56 ME 0,05<br />
0,1<br />
3 ja 2<br />
1<br />
Standard<br />
Anwendung außerhalb von<br />
Natur-, Wasser- <strong>und</strong><br />
Quellschutzgebieten<br />
Anwendung in Wasser<strong>und</strong><br />
Quellschutzgebieten<br />
Anwendung in<br />
Naturschutzgebieten<br />
B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.03.2025<br />
Zugelassen bis 1)<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
15
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
INSEKTIZIDE UND AKARIZIDE<br />
Handelsname<br />
Wirkstoff(e)<br />
Traubenwickler, Heu- <strong>und</strong> Sauerwurm<br />
Biologische Präparate<br />
DiPel DF<br />
Bacillus thuringiensis<br />
subspecies kurstaki<br />
Stamm ABTS-351<br />
Dipel ES,<br />
Universal-Raupenfrei<br />
Lizetan, Bactospeine ES<br />
Xen Tari,<br />
Florbac<br />
Verwirrungsverfahren<br />
CheckMate Puffer LB/EA<br />
RAK 1+2 M<br />
Bacillus thuringiensis<br />
subspecies kurstaki<br />
Stamm ABTS-351<br />
Bacillus thuringiensis<br />
subspecies aizawai<br />
Stamm ABTS-1857<br />
(Z)-9-Dodecen-1-ylacetat<br />
(E, Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat<br />
(Z)-9-Dodecen-1-ylacetat<br />
(E, Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat<br />
Wirkstoffgehalt<br />
[g/kg bzw. ml/l]<br />
Formulierung<br />
BBCH 00-16<br />
Aufwandmenge in<br />
Abhängigkeit vom BBCH-<br />
Stadium [kg bzw. l/ha]<br />
BBCH 61<br />
BBCH 71<br />
BBCH 75<br />
Max. Anzahl Anwendungen<br />
Raubmilben<br />
Bienenschutz<br />
Wartezeit [Tage]<br />
NT-Auflage<br />
Standard<br />
Abstandsauflagen<br />
Gewässer [m]<br />
Abdriftminderung<br />
[%]<br />
Basis x 2 x 3 x 4 50 75 90<br />
540 WG 1,00 1,00 1,00 1,00 3 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 4) 15.08.2025<br />
33 SC 0,5 1 1,5 2 2 B4 2 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 4) 15.08.2025<br />
540 WG 0,4 0,8 1,2 1,6 3 B4 6 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 4) 30.04.<strong>2024</strong><br />
104<br />
91,1<br />
205<br />
178<br />
AE<br />
VP<br />
vor Beginn des Fluges:<br />
2,5 Stück / ha<br />
vor Beginn des Fluges:<br />
500 Ampullen / ha<br />
Tafeltrauben Zulassung<br />
Zulassung ökologischer<br />
<strong>Wein</strong>bau 2)<br />
Anwendung Naturschutzgebiete<br />
1 B3 F 5 5 5 5 ja ja ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
1 B4 F 5 5 5 5 ja ja ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
RAK 1 Neu (Z)-9-Dodecen-1-ylacetat 205 VP 500 Ampullen / ha 1 B4 F 5 5 5 5 ja ja ja 3) 31.08.<strong>2024</strong><br />
Isonet LE<br />
(E/Z)-9-Dodecen-1-ylacetat 195 VP vor Beginn des Fluges: 1 B3 F 5 5 5 5 ja ja ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
(E,E/Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat 183 500 Ampullen / ha<br />
Diverse Wirkstoffgruppen<br />
Coragen,<br />
Chlorantraniliprole 200 SC 0,07 0,14 0,21 0,28 1 B4 42 10 5/10 5/10 5/10 - - ja 4) 31.12.2025<br />
Suvisio 200SC, Voliam<br />
410<br />
Exirel Cyantraniliprole 100 SC BBCH 55-83: 0,75 l/ha 1 B1 10 109 15 10 10 5/10 - - ja 4) 14.09.2027<br />
Mimic Tebufenozid 240 SC 0,2 0,4 0,6 0,8 2 B4 21 15 10 10 5/10 ja - ja 4) 31.05.2025<br />
Piretro Verde Pyrethrine 19 EC 0,64 1,28 1,92 2,4 3 B1 1 102 n.a. n.a. n.a. 15 - ja ja 4) 31.08.<strong>2024</strong><br />
SpinTor Spinosad 480 SC 0,04 0,08 0,12 0,16 4 B1 14 109 n.a. n.a. 15 10 ja ja ja 4) 15.03.2026<br />
Drosophila-Arten (Kirschessigfliege)<br />
Exirel Cyantraniliprole 100 SC BBCH 71-85: 0,5 l/ha 1 B1 10 103 15 10 5/10 5/10 - - ja 4) 14.09.2027<br />
Minecto One (A.51) Cyantraniliprole 400 WG ab BBCH 81: 0,125 kg/ha 1 III B1 10 103 n.a. n.a 20 10 ja - ja 4) 14.09.2027<br />
Mospilan SG (A.51),<br />
Danjiri (A.51)<br />
Acetamiprid 200 SG ab BBCH 81: 0,375 kg/ha 1 II B4<br />
410<br />
14 109 15 10 10 5/10 ja - ja 4) 28.02.<strong>2024</strong><br />
SpinTor (A.51) Spinosad 480 SC 0,04 0,08 - - 2 B1 14 108 20 15 10 5/10 ja ja ja 4) 15.03.2023<br />
Springwurm<br />
Mimic (A.51) Tebufenozid 240 SC 0,2 0,4 - - 2 B4 F 15 10 5/10 5/10 ja - ja 4) 31.05.2025<br />
SpinTor Spinosad 480 SC 0,04 0,08 - - 2 B1 14 108 20 15 10 5/10 ja ja ja 4) 15.03.2026<br />
Rhombenspanner<br />
DiPel DF<br />
Bacillus thuringiensis<br />
540 WG 1,00 - - - 3 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 4) 15.08.2025<br />
subspecies kurstaki<br />
Stamm ABTS-351<br />
Mimic (A.51) Tebufenozid 240 SC 0,2 - - - 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja - ja 4) 31.05.2025<br />
SpinTor Spinosad 480 SC 0,04 - - - 1 B1 14 108 20 15 10 5/10 ja ja ja 4) 15.03.2026<br />
Grüne Rebzikade<br />
Exirel Cyantraniliprole 100 SC BBCH 71-85: 0,5 l/ha 1 B1 10 103 15 10 5/10 5/10 - - ja 4) 14.09.2027<br />
Kiron Fenpyroximat 51 SC 0,6 1,2 1,8 2,4 1 B4 35 20 15 10 5/10 ja - ja 4) 30.04.<strong>2024</strong><br />
Spinnmilben<br />
Wirkstoffgruppe: Öle<br />
Micula Rapsöl 785 EC 12 - - - 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.12.2027<br />
Para Sommer Paraffinöl 654 EW 4 - - - 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 15.08.2026<br />
Promanal HP Paraffinöl 830 EC 8 - - - 1 III B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 15.08.2026<br />
410<br />
Promanal Neu Paraffinöl 546 EW 8 - - - 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Wirkstoffgruppe: Glukose<br />
Kantaro Maltodextrin 574 SL 37,5 37,5 37,5 37,5 20 III B2 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 4) 30.09.<strong>2024</strong><br />
Wirkstoffgruppe: METI’s<br />
Kiron Fenpyroximat 51 SC 0,6 1,2 1,8 2,4 1 B4 35 20 15 10 5/10 ja - ja 4) 30.04.<strong>2024</strong><br />
Kräuselmilben <strong>und</strong> Pockenmilben<br />
Wirkstoffgruppe: Schwefel<br />
Thiovit Jet (A.51)<br />
Schwefel 800 WG 3,6 4,8 - - 5 II B4 F 101 5/10 5/10 5/10 5/10 ja* ja ja 3) 31.12.<strong>2024</strong><br />
Microthiol S (A.51)<br />
Wirkstoffgruppe: Öle<br />
Micula (A.51) Rapsöl 785 EC 8 - - - 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.12.2027<br />
Para Sommer (A. 51) Paraffinöl 654 EW 4 - - - 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 15.08.2026<br />
Schildläuse<br />
Wirkstoffgruppe: Öle<br />
Micula (A.51) Rapsöl 785 EC 8 - - - 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 31.12.2027<br />
Para Sommer (A.51) Paraffinöl 654 EW 4 - - - 1 B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 ja ja ja 3) 15.08.2026<br />
Wirkstoffgruppe: Tetronsäure<br />
Movento SC 100 Spirotetramat 100 SC BBCH 69-81: 0,7 l/ha 2 III B1 14 109 5/10 5/10 5/10 5/10 - - ja 4) 30.04.2025<br />
Maikäfer<br />
NeemAzal-T/S Azadirachtin 11 EC 3 3 - - 2 II B4 F 5/10 5/10 5/10 5/10 - ja ja 4) 31.08.2025<br />
Zugelassen bis 1)<br />
16 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
INTEGRIERTER PFLANZENSCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG<br />
Biologische Vielfalt stärken<br />
Neben dem Ziel der Reduktion des Einsatzes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel <strong>und</strong> dem Ausbau<br />
des ökologischen Landbaus bis zum Jahr 2030 soll der integrierte Pflanzenschutz in Baden-Württemberg<br />
kontinuierlich weiterentwickelt <strong>und</strong> insbesondere in den Schutzgebieten verpflichtend umgesetzt werden.<br />
Mehr Biodiversität im <strong>Wein</strong>berg ist nicht nur hübsch fürs Auge sondern<br />
hilft auch, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren.<br />
Arbeitsgruppen sind gebildet<br />
worden, um die<br />
oben genannten Vorgaben<br />
unter Einbezug von Wissenschaft,<br />
Praxis <strong>und</strong> Verwaltung<br />
weiter zu entwickeln <strong>und</strong> die<br />
Reduktion des Einsatzes von<br />
Pflanzenschutzmitteln mittel- bis<br />
langfristig auf der gesamten landwirtschaftlichen<br />
Fläche in Baden-<br />
Württemberg voranzubringen.<br />
Landesspezifische<br />
Vorgaben<br />
In Landschaftsschutzgebieten,<br />
Natura 2000-Gebieten sowie auf<br />
intensiv genutzten land- <strong>und</strong> fischereiwirtschaftlichen<br />
Flächen<br />
in Kern- <strong>und</strong> Pflegezonen von<br />
Biosphärengebieten, in gesetzlich<br />
geschützten Biotopen <strong>und</strong> bei<br />
Naturdenkmalen erfolgt die Anwendung<br />
von Pflanzenschutzmitteln<br />
gem. § 34 Abs. 1 Satz 2<br />
NatSchG nach den Gr<strong>und</strong>sätzen<br />
des Landes zum Integrierten<br />
Pflanzenschutz. Dabei sind zusätzlich<br />
landesspezifische Vorgaben<br />
einzuhalten <strong>und</strong> zu dokumentieren.<br />
Sie ermöglichen einen<br />
zielgerichteten <strong>und</strong> reduzierten<br />
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Die Kontrolle erfolgt im<br />
Rahmen des landwirtschaftlichen<br />
Fachrechts.<br />
Der integrierte Pflanzenschutz<br />
in Baden-Württemberg umfasst<br />
zum Beispiel:<br />
→ Das Informationsangebot<br />
des Landes ist regelmäßig zu nutzen<br />
(unter anderem Warndienst,<br />
Gruppenberatung, Broschüren<br />
des WBI bzw. der LVWO, Demonstrationsbetriebe),<br />
um den<br />
aktuellen Sachstand der landesspezifischen<br />
Vorgaben betriebsindividuell<br />
anpassen zu können.<br />
→ Zur Förderung der Biodiversität<br />
<strong>und</strong> Schonung sowie Förderung<br />
von Nützlingen in ihrer<br />
Funktion als natürliche Gegenspieler<br />
sollten zum Beispiel Heckenpflanzungen,<br />
die Ansiedelung<br />
von Nützlingen <strong>und</strong> Anbringung<br />
von Nisthilfen für Vögel<br />
<strong>und</strong> Wildbienen erfolgen.<br />
Geänderte Mulchregime in <strong>und</strong><br />
vor allem am Außenrand der<br />
Anbauflächen, die Aussaat ein<strong>und</strong><br />
mehrjähriger Blühmischungen,<br />
die Duldung von Ruderalflächen,<br />
„Unkrautbestände“ an<br />
Böschungen, Gräben <strong>und</strong> Wegen<br />
sowie ein alternierender Heckenrückschnitt<br />
tragen ebenso<br />
dazu bei. Einzelne durchgeführte<br />
Maßnahmen sind zu dokumentieren.<br />
→ Die Bestände sind konsequent<br />
auf Befall mit Schädlingen<br />
<strong>und</strong> Krankheiten zu überwachen,<br />
um frühzeitig eine Strategie<br />
zur Regulierung der Schadorganismen<br />
unter größtmöglicher<br />
Umweltschonung zu erarbeiten.<br />
Beispielsweise können<br />
Saftfallen mit Dokumentation<br />
der Fänge mit der Kirschessigfliege<br />
genutzt werden. Weitere<br />
kulturspezifische Möglichkeiten<br />
sind ab Seite 3 in diesem <strong>Extra</strong><br />
<strong>Rebschutz</strong> aufgeführt.<br />
→ Die Behandlung hat nach<br />
vorhandenen Prognosemodellen<br />
zu erfolgen. Für den <strong>Wein</strong>bau<br />
stehen Prognosemodelle unter<br />
www.vitimeteo.de zur Verfügung,<br />
die Entscheidungshilfen<br />
zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln<br />
geben. Weitere für<br />
die Behandlung nutzbare Informationen<br />
werden durch den<br />
amtlichen Warndienst verbreitet,<br />
der regelmäßig zu nutzen ist.<br />
→ Vorgegebene Schadschwellen<br />
bzw. Bekämpfungsrichtwerte<br />
sind zu beachten, um angepasst<br />
an einen möglichen wirtschaftlichen<br />
Schaden keine unnötigen<br />
Pflanzenschutzmittel einzusetzen.<br />
Die Schadschwellen sind<br />
ebenfalls ab Seite 3 aufgeführt.<br />
Beispielsweise ist für den Heuwurm<br />
bei 30 % (Würmer pro 100<br />
Gescheine) je nach Rebsorte <strong>und</strong><br />
der Jahreswitterung die Schadschwelle<br />
erreicht.<br />
→ Nützlingsschonende Pflanzenschutzmittel<br />
sind, soweit eine<br />
Auswahl möglich ist, anzuwenden,<br />
um die Auswirkungen auf<br />
die Nutzinsekten bzw. die Umwelt<br />
zu minimieren. Im vorliegenden<br />
<strong>Extra</strong> <strong>Rebschutz</strong> sind die<br />
Pflanzenschutzmittel hinsichtlich<br />
ihrer Wirkung auf Nutzinsekten<br />
klassifiziert.<br />
→ Zur Beurteilung der Behandlungsnotwendigkeit<br />
sind<br />
Spritzfenster anzulegen, die keinen<br />
negativen Einfluss auf die<br />
Epidemiologie des Schaderregers<br />
haben sollten. Beispielsweise<br />
kann die Notwendigkeit herbizider<br />
Maßnahmen beurteilt<br />
<strong>und</strong> für Folgemaßnahmen bewertet<br />
werden.<br />
→ Geeignete Gerätetechnik<br />
(zum Beispiel Düsen) <strong>und</strong> die<br />
entsprechenden Verwendungsbestimmungen<br />
sollen so gewählt<br />
werden, dass kurzfristig hohe<br />
Abdriftminderungswerte erzielt<br />
werden. Innerhalb einer Übergangszeit<br />
von fünf Jahren soll<br />
auf eine Applikationstechnik mit<br />
hoher Abdriftminderung umgestellt<br />
sein, soweit dies technisch<br />
<strong>und</strong> wirtschaftlich zumutbar ist.<br />
Text: WBI <strong>und</strong> LVWO<br />
Bild: Dr. Hermann Kolesch<br />
INTERNET<br />
Den gesamten Beitrag zur Stärkung<br />
der Biologischen Vielfalt<br />
in Baden-Württemberg lesen<br />
Sie online unter www.rebe<strong>und</strong><br />
wein.de, Webcode 8461.<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
17
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
NEUES DOSIERMODELL IM PFLANZENSCHUTZ<br />
Laubwandflächenmodell<br />
Das neue Dosiermodell nach Laubwandfläche (LWF) berücksichtigt im Vergleich zum bisherigen in<br />
Deutschland umgesetzten Modell (Faktorberechnung nach Entwicklungsstadium), dass der einzusetzende<br />
Mittelaufwand sich primär auf die zu behandelnde Laubwandfläche bezieht.<br />
Die Laubwandfläche<br />
wird durch die Laubwandlänge<br />
in Bezug<br />
auf einen Hektar Gr<strong>und</strong>fläche<br />
sowie der Laubwandhöhe errechnet.<br />
Allerdings definiert sich die<br />
Laubwandhöhe nicht als die tatsächliche<br />
Höhe der zu behandelnden<br />
Blätter <strong>und</strong> Trauben im<br />
engeren Sinne, sondern als die<br />
von den Düsen vertikal behandelte<br />
Höhe.<br />
Die durchschnittliche Behandlungshöhe<br />
pro Düse beträgt in<br />
der Regel 0,3 m. Diese kann jedoch<br />
in Abhängigkeit von den<br />
verwendeten Düsen <strong>und</strong> dem<br />
Abstand zur Behandlungsfläche<br />
variieren. Die zu behandelnde<br />
Laubwandhöhe ist demnach aus<br />
der Behandlungshöhe, welche<br />
sich aus der Anzahl der jeweils<br />
geöffneten Düsen zusammensetzt,<br />
abzuleiten. Mithilfe der<br />
Parameter Reihenabstand <strong>und</strong><br />
Laubwandhöhe kann die Laubwandfläche<br />
pro Hektar berechnet<br />
werden.<br />
Neuzulassungen enthalten zur<br />
Berechnung des Mittelaufwandes<br />
die Dosierangabe des Laubwandflächenmodells<br />
in l oder kg pro<br />
10.000 m 2 Laubwandfläche. Die<br />
maximale Aufwandmenge pro<br />
Behandlung sowie die maximale<br />
Menge, die in der Vegetationsperiode<br />
ausgebracht werden darf,<br />
werden pro Hektar Gr<strong>und</strong>fläche<br />
angegeben.<br />
DLR Rheinpfalz, WBI<br />
FORMEL ZUR BERECHNUNG DER LAUB-<br />
WANDFLÄCHE<br />
10.000 m 2 x Laubwandhöhe [m] x 2 = Laubwandfläche [m 2 ]<br />
Reihenabstand [m]<br />
Laubwandlänge<br />
in Bezug auf<br />
1 ha Gr<strong>und</strong>fläche<br />
10.000 m 2 x 1,5 m x 2 = 15.000 m 2 Laubwandfläche<br />
2 m<br />
Laubwandlänge<br />
in Bezug auf<br />
1 ha Gr<strong>und</strong>fläche<br />
Behandlungshöhe<br />
je nach Anzahl der<br />
geöffneten Düsen<br />
Praxisbeispiel zur Berechnung der Laubwandfläche<br />
Der Reihenabstand in der Fläche beträgt 2 m. Bei einer Behandlung der<br />
ausge wachsenen Laubwand werden beispielsweise 5 Düsen mit je 0,3 m<br />
Behand lungshöhe beidseitig geöffnet. Hieraus ergibt sich eine errechnete<br />
Laubwandhöhe von 1,5 m. Der Faktor 2, der sich durch die beidseitige Behandlung<br />
ergibt, ist nicht veränderbar.<br />
Behandlungshöhe bei<br />
5 geöffneten Düsen<br />
Beidseitige<br />
Behandlung<br />
Behandelte Laubwandfläche<br />
nach dem<br />
neuen Dosiermodell<br />
Behandelte Laubwandfläche<br />
nach dem neuen Dosiermodell<br />
ERMITTLUNG DER PRODUKTAUFWAND MENGE (L ODER KG/HA GRUNDFLÄCHE)*<br />
Anwendungszeitpunkt<br />
[BBCH]<br />
Anzahl<br />
geöffneter<br />
Düsen paare 1<br />
Laub wandhöhe<br />
2<br />
[m]<br />
Laubwandfläche<br />
[m 2 /ha]<br />
Reihenabstand [m]<br />
1,8 2,0 2,5<br />
Aufwand 3<br />
[l oder kg/ha]<br />
Laubwandfläche<br />
[m 2 /ha]<br />
Aufwand 3<br />
[l oder kg/ha]<br />
Laubwandfläche<br />
[m 2 /ha]<br />
00 - 17 1 0,3 3333 0,33 3000 0,30 2400 0,20<br />
2 0,6 6667 0,67 6000 0,60 4800 0,40<br />
53 - 57 3 0,9 10.000 1,00 9000 0,90 7200 0,60<br />
57 - 68 4 1,2 13.333 1,33 12.000 1,20 9600 0,80<br />
Ab 71 5 1,5 16.667 1,67 15.000 1,50 12.000 1,20<br />
Aufwand 3<br />
[l oder kg/ha]<br />
* anhand der je nach Entwicklungsstadium (BBCH) vorliegenden Laubwandfläche. Die Produkt aufwandmenge beträgt in diesem Beispiel: 1,0 l/kg pro 10.000 m 2 LWF<br />
1<br />
Die durchschnittliche Behandlungshöhe beträgt i. d. R. 0,3 m pro Düse. Je nach verwendeter Düsen <strong>und</strong> Abstand zur Behandlungsfläche kann diese jedoch variieren.<br />
2<br />
Die Laubwandhöhe resultierend aus der Anzahl der geöffneten Düsen multipliziert mit 0,3 m.<br />
3<br />
Aufwandmenge bei entsprechender Laubwandfläche pro Hektar Gr<strong>und</strong>fläche (im Beispiel: 1 l pro 10.000 m 2 ).<br />
Praxisbeispiel zur Berechnung der Aufwandmengen<br />
von zwei Pflanzenschutzmitteln in einer<br />
Tankmischung mit unterschiedl. Dosierangaben:<br />
Eine Behandlung zur abgehenden Blüte (BBCH 68) soll<br />
gegen die Schad erreger Echter <strong>und</strong> Falscher Mehltau<br />
stattfinden. Dabei werden 4 Düsenpaare am Gerät geöffnet,<br />
um eine ausreichende Abdeckung der Behandlungshöhe<br />
zu erzielen. Hieraus ergibt sich eine berechnete<br />
Laubwandhöhe von 1,2 m. Der Reihenabstand beträgt<br />
wie im voran genannten Beispiel zur Berechnung der<br />
Laubwandfläche 2 m. Eingesetzt werden folgende Mittel<br />
mit entsprechenden Zulassungs angaben zur Aufwandmenge:<br />
Folplan 80 WDG<br />
Basisaufwand: 0,4 kg/ha<br />
Ab BBCH 61: 0,8 kg/ha<br />
Ab BBCH 71: 1,2 kg/ha<br />
Ab BBCH 75: 1,6 kg/ha<br />
Belanty<br />
Laubwandflächenbezogene Aufwandmenge:<br />
1 l/10.000 m 2<br />
Max. Aufwandmenge pro Behandlung: 2 l/ha<br />
Max. Aufwandmenge für die Kultur bzw. das<br />
Kalenderjahr: 4 l/ha<br />
Aufwandmenge<br />
angepasst an das<br />
Entwicklungs stadium<br />
Aufwandmenge angepasst<br />
an die zu behandelnde<br />
Laubwandfläche<br />
(4 geöffnete Düsen paare bei<br />
einer jeweiligen Behand lungshöhe<br />
von 0,3 m <strong>und</strong> einem<br />
Reihenabstand von 2 m)<br />
Folplan 80 WDG<br />
2,5-facher<br />
Basisaufwand<br />
1,0 kg/ha Gr<strong>und</strong>fläche<br />
Belanty<br />
12.000 m 2 LWF<br />
1,2 l/ha Gr<strong>und</strong>fläche<br />
18 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
WASSER- UND MITTELAUFWAND<br />
Mittel richtig ansetzen<br />
Bilder: SaGa Studio/shutterstock.com (Blätter), Forgem/shutterstock.com (Notizblatt)<br />
BEHANDLUNGSTERMINE UND MITTELAUFWAND<br />
Rebstadium<br />
nach der<br />
BBCH-Skala<br />
00–09 11–16 19–55 57–65 68 71 73–75 77–81<br />
00: Vegetationsruhe<br />
09: Knospenaufbruch<br />
11: 1. Blatt<br />
entfaltet<br />
16: 6 Blätter<br />
entfaltet<br />
19: 9 Blätter<br />
entfaltet<br />
55: Gescheine<br />
vergrößern<br />
sich<br />
57: Gescheine<br />
voll entwickelt<br />
65: Vollblüte:<br />
50 % der Blütenkäppchen<br />
abgeworfen<br />
68: 80 % der<br />
Blütenkäppchen<br />
abgeworfen<br />
Behandlungstermin Austrieb 1. Vorblüte 2. Vorblüte 3. Vorblüte abgehende<br />
Blüte<br />
71: Fruchtansatz:<br />
Fruchtknoten<br />
vergrößern<br />
sich<br />
73: Beeren sind schrotkorngroß<br />
75: Beeren sind erbsengroß<br />
77: Beginn Traubenschluss<br />
81: Beginn der Reife: Beeren<br />
werden hell<br />
2. Nachblüte ab 3. Nachblüte, je nach<br />
Laubwanddichte<br />
Basisaufwand [kg bzw. l] x 1 x 1 x 1,5 x 2 x 2,5 x 3 x 3,5 - 4 x 4<br />
Empfohlene Wassermenge 100 - 400 100 - 400 200 - 800 200 - 800 250 - 800 300 - 800 400 - 800 400 - 800<br />
[l/ha]*<br />
Beispiel:<br />
Folpan 80 WDG<br />
0,1 % = kg/ha<br />
0,4 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 - 1,6 1,6<br />
* Der empfohlene Wasseraufwand in l/ha ist fett gedruckt. Bei niedrigen Wassermengen <strong>und</strong> kleineren Tropfen wird die Anlagerung schwieriger (eventuell schlechtere<br />
Wirkungsgrade) <strong>und</strong> die Gefahr von Abdriftverlusten steigt (höhere Windanfälligkeit der kleinen Tropfen).<br />
REIHENFOLGE BEI MISCHUNGEN VON<br />
PFLANZENSCHUTZMITTELN<br />
1. Wasserlösliche Folienbeutel<br />
Als Gr<strong>und</strong>lage der Berechnungen<br />
von Wasser-<br />
<strong>und</strong> Mittelaufwand<br />
in Direktzuglagen dient der<br />
Basisaufwand (kg oder l/ha), der<br />
in der Regel auf die 1. Vorblütebehandlung<br />
bezogen wird (früher<br />
Mittelaufwand bei 400 l/ha<br />
als Berechnungsgr<strong>und</strong>lage). Der<br />
Mittelaufwand ist im Verlauf der<br />
Vegetationsperiode an das Entwicklungsstadium<br />
der <strong>Rebe</strong> <strong>und</strong><br />
der damit verb<strong>und</strong>enen Vergrößerung<br />
der Zielfläche anzupassen.<br />
Dazu wird der Basisaufwand<br />
je nach Entwicklungszustand mit<br />
dem Faktor 1,5 bis 4 multipliziert<br />
(siehe Tabelle oben). Die erforderliche<br />
Mittelmenge wird in die<br />
pro Hektar auszubringende Wassermenge<br />
eingerührt <strong>und</strong> ausgebracht.<br />
In der Tabelle sind auch<br />
die empfohlenen Wassermengen<br />
je Hektar zu den jeweiligen Entwicklungsstadien<br />
der <strong>Rebe</strong> angegeben.<br />
Beispielrechnung für die Mittelmenge:<br />
→ Fläche: 50 Ar<br />
→ Entwicklungs stadium: „Abgehende<br />
Blüte“ (BBCH 68)<br />
→ Basisaufwandmenge: 0,8 kg/ha<br />
0,8 kg/ha (Basisaufwand)<br />
× 2,5 (Faktor)<br />
× 0,5 ha (Fläche)<br />
= 1 kg Mittelmenge<br />
2. Wasserdispergierbare Granulate (WG-) <strong>und</strong> Spritzpulver<br />
(WP-Formulierungen)<br />
3. Suspensionskonzentrate (SC-Formulierungen)<br />
4. Emulsion Öl in Wasser (EW-) <strong>und</strong> emulgierbare Konzentrate<br />
(EC-Formulierungen), Öle<br />
5. Netzmittel (Tenside)<br />
6. Wasserlösliche Konzentrate (SL-Formulierungen)<br />
Bemerkung: Bei einzelnen Produkten kann dies abweichend sein; zum Beispiel bei<br />
„Profiler“. Beachten Sie deshalb dringend die Gebrauchsanweisung!<br />
CheckMate ® Puffer ® LB/EA<br />
Die vollautomatisierte Pheromonverwirrung<br />
gegen den Einbindigen <strong>und</strong> den Bekreuzten<br />
Traubenwickler<br />
Jetzt NEU:<br />
Förderfähig auch in<br />
Rheinland-Pfalz!<br />
Biofa GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 2 | 72525 Münsingen<br />
Tel. 07381 9354-0 | contact@biofa-profi.de | www.biofa-profi.de<br />
Ausgezeichnet mit dem<br />
Nachhaltigkeitspreis<br />
Nur 2,5 Puffer / ha<br />
<strong>und</strong> Saison reichen!<br />
Schnell auf- <strong>und</strong><br />
abgehängt<br />
Keine Kunststoffreste<br />
Auch für den ökologischen Landbau zugelassen.<br />
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwen dung stets Etikett <strong>und</strong> Produkt informationen lesen.<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
19
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
HERBIZIDEINSATZ<br />
Berechnungen bei der<br />
Unkrautbekämpfung<br />
Bei allen Herbiziden ist<br />
der Mittelaufwand in g/<br />
m 2 oder ml/m 2 aufgeführt.<br />
Soweit nicht anders vorgegeben,<br />
erfolgt die Ausbringung<br />
im Spritzverfahren mit einem<br />
Wasseraufwand von 200 bis 600 l/<br />
ha (0,02 bis 0,06 l/m 2 ) – je nach<br />
Anwendungsempfehlung des<br />
Herstellers.<br />
In direktzugfähigem Gelände<br />
werden Herbizide in der Regel als<br />
Unterzeilenspritzung mit Schlepperanbaugeräten<br />
(Bandspritzung)<br />
ausgebracht. Da sich diese<br />
Werte auf eine Ganzflächenbehandlung<br />
beziehen, muss die<br />
Wasser- <strong>und</strong> Mittelmenge auf<br />
den zu behandelnden Spritzstreifen<br />
berechnet werden.<br />
BERECHNUNGSMETHODE<br />
1. Ermittlung der effektiv zu behandelnden Fläche<br />
Spritzbandbreite (m) × Parzellengröße (ar) = effektiv zu behandelnde Fläche (ar)<br />
Gassenbreite (m)<br />
2. Ermittlung der notwendigen Brühemenge<br />
gewünschter Brüheaufwand je ha (l) × zu behandelnde Fläche (ar) = Brühebedarf (l)<br />
100 ar<br />
3. Ermittlung der notwendigen Mittelmenge<br />
empf. Präparataufwand je ha (l od. kg) × zu behand. Fläche (ar)<br />
100 ar<br />
4. Ermittlung des notwendigen Brüheausstoßes<br />
bei einseitigem Spritzen: Arbeitsbreite = Gassenbreite<br />
bei zweiseitigem Spritzen: Arbeitsbreite = doppelte Gassenbreite<br />
= Präparatbedarf (l oder kg)<br />
Brühebedarf (l) × Fahrgeschw. (km/h) × Arbeitsbr. (m) = Brüheausstoß je Düse (l/min)<br />
Flächengröße (ar) × 6 × Anzahl offener Düsen<br />
Vorsicht Abdrift<br />
Um Abdriftschäden zu vermeiden,<br />
sollten abdriftarme Injektordüsen<br />
verwendet werden. Druck<br />
über 3 bar (bei Injektordüsen<br />
auch höher) ist zu vermeiden, da<br />
es zu einer feinen Zerstäubung<br />
der Spritzbrühe kommt <strong>und</strong> die<br />
Gefahr von Abdriftschäden größer<br />
ist.<br />
Liegt der errechnete erforderliche<br />
Druck über 3 bar, müssen<br />
Fahrgeschwindigkeit oder Brüheaufwand<br />
pro ha so weit verringert<br />
werden, dass der geringere<br />
erforderliche Brüheausstoß (l/<br />
min) mit einem Druck von weniger<br />
als 3 bar erreicht werden<br />
kann, oder es muss eine größere<br />
Düse verwendet werden.<br />
Bild: Forgem/shutterstock.com<br />
5. Erforderlicher Druck aus Düsen-Einstelltabelle<br />
6. Kontrolle der ausgebrachten Brühemenge<br />
Nach Einbau der Düse <strong>und</strong> Einstellung des Drucks ist die Ausstoßmenge mit einem geeigneten Messgefäß zu<br />
überprüfen. Abweichungen können über den Spritzdruck geregelt werden.<br />
Beispielrechnung für die Unkrautbekämpfung<br />
Fläche: 60 ar<br />
Gassenbreite: 2,0 m<br />
Bandbreite: 0,4 m<br />
Fahrgeschwindigkeit: 4 km/h<br />
Wasseraufwand: 600 l/ha<br />
Mittelaufwand: 4 l/ha<br />
Düsenzahl: 2<br />
1. 0,4 m × 60 ar = 12 ar zu behandelnde effektive Fläche<br />
2,0 m<br />
2. 600 l × 12 ar = 72 l Wasser(Brühe)menge<br />
100 ar<br />
3. 4 l × 12 ar<br />
= 0,48 l Mittelmenge<br />
100 ar<br />
4. 72 l × 4 km/h × 4,0 m = 1,6 l/min Brüheausstoß/Düse<br />
60 ar x 6 x 2<br />
5. Düsentabelle<br />
bar 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0<br />
l/min 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,5 3,9<br />
UMRECHNUNGS-<br />
HINWEISE<br />
Gassenbreite (m)<br />
Streifenbreite (m)<br />
Behandlungsfläche<br />
in Prozent (%)<br />
1,6 0,3 19<br />
1,6 0,4 25<br />
0,3 17<br />
0,4 22<br />
2,0 0,3 15<br />
2,0 0,4 20<br />
2,2 0,3 14<br />
2,2<br />
0,4 18<br />
20 3 | <strong>2024</strong><br />
Der erforderliche Druck liegt bei 2 bar.<br />
Quelle:<br />
Sachk<strong>und</strong>e im Pflanzenschutz,<br />
DLR Rheinpfalz
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
ANWENDERSCHUTZ<br />
An die eigene<br />
Ges<strong>und</strong>heit denken<br />
Im Zulassungsverfahren werden Pflanzenschutzmittel umfassend geprüft. Neben der biologischen Wirksamkeit<br />
<strong>und</strong> den Auswirkungen auf die Umwelt spielt auch der Anwenderschutz eine wesentliche Rolle.<br />
Die Zulassungsbehörde prüft ges<strong>und</strong>heitliche Risiken <strong>und</strong> ob Maßnahmen zur Risikominderung erforderlich<br />
sind. In der Zulassung wird dann die individuell für jedes Mittel notwendige persönliche Schutzausrüstung<br />
(PSA) verbindlich vorgeschrieben. Die Vorschriften gelten für möglichen Kontakt zu unverdünnten<br />
<strong>und</strong> verdünnten Pflanzenschutzmitteln sowie für Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen.<br />
KOMPAKT<br />
Mit T-Shirt oder gar freiem<br />
Oberkörper Pflanzenschutz<br />
zu betrieben ist keine gute<br />
fachliche Praxis. Allerdings<br />
ist es in vielen Fällen auch<br />
nicht notwendig, eingepackt<br />
wie ein Raumfahrer im <strong>Wein</strong>berg<br />
zu hantieren. Mittlerweile<br />
gibt es auf dem Markt<br />
komfortable <strong>und</strong> funktionelle<br />
Schutzkleidung. Die jeweils<br />
erforderlichen Risikominderungsmaßnahmen<br />
werden<br />
seitens der Zulassungsbehörde<br />
in den Gebrauchsanleitungen<br />
als Anwendungsbestimmungen<br />
vorgegeben.<br />
Die Missachtung stellt eine<br />
Ordnungswidrigkeit dar, vergleichbar<br />
mit der Gurtpflicht<br />
beim Autofahren. Betriebe<br />
mit Fremdarbeitskräften <strong>und</strong><br />
Auszubildenden haben eine<br />
besondere Verantwortung,<br />
geeignete Schutzausrüstung<br />
vorzuhalten. Bei Betriebskontrollen<br />
durch die Ämter<br />
sollte die erforderliche<br />
Schutzkleidung vorhanden<br />
sein. Es wird empfohlen, insbesondere<br />
auch für Mitarbeiter<br />
im Betrieb, die erforderliche<br />
Schutzkleidung zu<br />
beschaffen <strong>und</strong> die Mitarbeiter<br />
einmal im Jahr zu unterweisen<br />
– möglichst mit Unterschrift.<br />
Für das Tragen<br />
sind sie dann selbst verantwortlich.<br />
Bei der Auswahl von<br />
Schutzkleidung wird<br />
unterschieden, ob mit<br />
konzentrierten, verdünnten oder<br />
angetrockneten Pflanzenschutzmitteln<br />
umgegangen wird. Während<br />
Schutzmaßnahmen beim<br />
Anfertigen <strong>und</strong> beim Ausbringen<br />
von Spritzbrühe schon lange bekannt<br />
sind, wurden sie für Nachfolgetätigkeiten<br />
im Jahr 2018 neu<br />
geregelt.<br />
Hierbei hat sich die Zulassungsbehörde<br />
(BVL) dazu entschieden,<br />
diese Vorschriften auch<br />
für den Bereich des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes<br />
als Anwendungsbestimmung<br />
zu definieren. Daraus resultiert,<br />
dass ein Verstoß dagegen<br />
als Ordnungswidrigkeit gilt <strong>und</strong><br />
mit einem Bußgeld geahndet werden<br />
kann. Verantwortlich für die<br />
Einhaltung der Vorschriften sind<br />
Anwender <strong>und</strong> Betriebsleiter.<br />
Um Personen bei Nachfolgearbeiten<br />
zu schützen, darf gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
erst nach Antrocknen des<br />
Spritzbelages weitergearbeitet<br />
werden. Überschreitet dann die<br />
theoretisch mögliche Aufnahme<br />
immer noch den toxikologischen<br />
Grenzwert, werden Maßnahmen<br />
zur Risikominderung festgelegt,<br />
um die Aufnahmedosis zu verringern.<br />
Dazu zählen das Tragen<br />
von Schutzhandschuhen, langer<br />
Arbeitskleidung <strong>und</strong> festem<br />
Schuhwerk. Ergibt die Risikobewertung,<br />
dass auch diese Maßnahmen<br />
noch nicht ausreichend<br />
sind, wird die Tätigkeit in der<br />
behandelten Kultur zeitlich begrenzt.<br />
Beispiele finden sich in<br />
der Tabelle auf Seite 24.<br />
Persönliche<br />
Schutzausrüstung<br />
Das BVL hat gemeinsam mit<br />
Herstellern, Verbänden <strong>und</strong> Institutionen<br />
abgestimmt, welche<br />
Anzüge, Handschuhe, Schürzen<br />
<strong>und</strong> Co. sich als Schutzkleidung<br />
eignen. In einer speziellen Datensammlung<br />
des BVL sind zertifizierte<br />
<strong>und</strong> auf dem Markt befindliche<br />
Produkte aufgeführt (www.<br />
bvl.b<strong>und</strong>.de/PSA). Neben der<br />
Schutzfunktion ist auch der Tragekomfort<br />
wichtig. Es empfiehlt<br />
sich daher, den Landhändler<br />
nach entsprechender Ware zu<br />
fragen <strong>und</strong> die Praxistauglichkeit<br />
der Produkte für den geplanten<br />
Einsatzzweck zu bewerten.<br />
→ Handschutz: Der mit Abstand<br />
häufigste Hautkontakt erfolgt<br />
über die Hände. Deshalb<br />
sind geeignete Schutzhandschuhe<br />
besonders wichtig. Sie werden<br />
nach bestimmten Schutzstufen<br />
gekennzeichnet. Man unterscheidet<br />
drei Typen: G2 für Schutz vor<br />
Konzentraten, G1 für Schutz vor<br />
anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln<br />
<strong>und</strong> GR für Schutz<br />
vor getrocknetem Spritzbelag bei<br />
Nachfolgearbeiten.<br />
Die Buchstaben entstammen<br />
dabei dem Englischen. G für<br />
Glove (Handschuh) <strong>und</strong> R für<br />
Re-entry (Wiederbetreten).<br />
Handschuhe für Nachfolgearbeiten<br />
sind leichte Schutzhandschuhe<br />
des Typs GR, die hauptsächlich<br />
die Griffflächen der Hand<br />
schützen. Die Rückseite ist mit<br />
atmungsaktiven Materialen versehen.<br />
Dadurch kann die Hitzebelastung<br />
verringert werden.<br />
→ Körperschutz: Entsprechend<br />
der zu erwartenden Exposition<br />
ist der Körperschutz in<br />
drei Typen eingeteilt <strong>und</strong> wird<br />
mit dem Buchstaben C für<br />
Clothing (Kleidung) gekennzeichnet.<br />
C1 steht für „Schwacher<br />
Schutz“ vor anwendungsfertigen<br />
Pflanzenschutzmitteln.<br />
C2 für „Mittlerer Schutz“ <strong>und</strong><br />
C3 für „Starker Schutz“.<br />
Arbeitskleidung (C1 <strong>und</strong> C2)<br />
<strong>und</strong> spezielle Schutzanzüge (C3)<br />
sind zwei verschiedene Dinge<br />
<strong>und</strong> unterscheiden sich insbesondere<br />
durch den Tragekomfort<br />
<strong>und</strong> die Rückhaltefähigkeit von<br />
kritischen Stoffen. Schutzanzüge<br />
der Schutzstufe C 3 sind wasserdicht<br />
<strong>und</strong> für den eigentlichen<br />
Einsatz zum Pflanzenschutz vorgeschrieben.<br />
Bei Nachfolgearbeiten<br />
wird es dagegen notwendig<br />
sein, vernünftige, den Witterungsbedingungen<br />
angepasste<br />
Arbeitskleidung, zu wählen.<br />
Weiter gehts auf Seite 22<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
21
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
Piktogramme: Lothar Neumann<br />
Bei der Entwicklung zertifizierter<br />
Kleidung wurde daher<br />
versucht, den notwendigen<br />
Schutz mit der Praxistauglichkeit<br />
zu verknüpfen. Zertifizierte<br />
Schutzkleidung ist mit dem Piktogramm<br />
„Erlenmeyerkolben<br />
mit Blatt“ gekennzeichnet. Die<br />
Schutzstufe C2 liefert ein höheres<br />
<strong>und</strong> die Schutzstufe C1 ein vergleichbares<br />
Schutzniveau wie die<br />
nachfolgend genannte nicht zertifizierte<br />
Arbeitskleidung.<br />
Nicht zertifizierte Arbeitskleidung<br />
wird toleriert, wenn sie aus<br />
einer langärmeligen Jacke <strong>und</strong><br />
einer langen Hose oder einem<br />
Overal besteht. Das Material<br />
muss aus einem Mischgewebe<br />
aus Baumwolle <strong>und</strong> einem Mindestanteil<br />
von 65 % Polyester bestehen.<br />
Die Materialstärke beträgt<br />
mindestens 245 g/m 2 .<br />
→ Ärmelschürze im Pflanzenschutz:<br />
Bei bestimmten Tätigkeiten<br />
mit Pflanzenschutzmitteln<br />
kann der vorgeschriebene Schutzanzug<br />
(C3) durch eine Kombination<br />
aus Ärmelschürze <strong>und</strong> Arbeitskleidung<br />
ersetzt werden. Zu<br />
diesen Tätigkeiten gehören beispielsweise<br />
das Ansetzen der<br />
Spritzflüssigkeit, Befüllen des<br />
Pflanzenschutzgerätes <strong>und</strong> Reinigen<br />
von Maschinen <strong>und</strong> Geräten.<br />
Geeignet ist eine Ärmelschürze<br />
(auch Rückenschlusskittel genannt),<br />
die den Körper von den<br />
Schuhen über den Brustbereich<br />
bis zum Halsansatz bedeckt. Sie<br />
kann in Kombination mit Arbeitskleidung<br />
als Alternative zum<br />
Schutzanzug eingesetzt werden.<br />
Seit dem Jahr 2019 ist die Ärmelschürze<br />
ein Element der persönlichen<br />
Schutzausrüstung für Anwender.<br />
Eine Ärmelschürze<br />
schützt die darunter getragene<br />
Kleidung. Vor <strong>und</strong> nach dem jeweiligen<br />
Arbeitsschritt kann die<br />
Ärmelschürze wieder leicht an<strong>und</strong><br />
abgelegt werden.<br />
NEUERE GEFAHRENPIKTOGRAMME ZUM<br />
GLOBAL HARMONISIERTEN SYSTEM ZUR<br />
EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG VON<br />
CHEMIKALIEN (GHS)<br />
Instabile explosive Stoffe<br />
<strong>und</strong> Gemische, GHS01<br />
Komprimierte Gase,<br />
GHS04<br />
Akute Toxizität,<br />
Ätz- oder Reizwirkung,<br />
GHS07<br />
Entzündlich,<br />
GHS02<br />
Ätzwirkung; auf Metall<br />
korrosiv wirkend<br />
GHS05<br />
Systemische Ges<strong>und</strong>heitsgefährdung,<br />
GHS08<br />
Brandfördernd,<br />
GHS03<br />
Akute Toxizität<br />
GHS06<br />
Umwelt- <strong>und</strong><br />
Gewässergefährdend,<br />
GHS09<br />
Seit dem 20. Januar 2009 ist das Global Harmonisierte System (GHS) zur<br />
weltweiten Einstufung, Kennzeichnung <strong>und</strong> Verpackung von Stoffen <strong>und</strong><br />
Gemischen in Kraft (EG-Verordnung Nr. 1272/2008). Die Gebrauchsanweisung<br />
eines jeden Pflanzenschutzmittels gibt Hinweise auf die sachgerechte<br />
Anwendung <strong>und</strong> macht auf bestehende Gefahren aufmerksam.<br />
Bitte beachten Sie vor der Anwendung eines jeden Pflanzenschutzmittels<br />
die Gebrauchsanweisung.<br />
CAT 4 Kabine mit Überdrucksystem:<br />
Hier kann bei der Pflanzenschutzausbringung<br />
auf weitere Schutzausrüstung<br />
verzichtet werden.<br />
→ Schlepperkabinen: Dicht<br />
schließende Fahrerkabinen können<br />
Anwender während der Ausbringung<br />
von Pflanzenschutzmitteln<br />
wirksam vor Spritznebel<br />
schützen. Die Schutzwirkung ist<br />
abhängig von der technischen<br />
Ausgestaltung der verschiedenen<br />
Kabinentypen <strong>und</strong> lässt sich in<br />
vier Kategorien mit unterschiedlichem<br />
Schutzniveau einteilen.<br />
Für den Kabinentyp der Kategorie<br />
1 – das sind offene Kabinen<br />
oder Halbkabinen – ist kein<br />
Schutzniveau definiert. Daher<br />
sind dort entsprechende Schutzausrüstungen<br />
wie bei handgeführten<br />
Geräten zu tragen. Dicht<br />
schließende Schlepperkabinen<br />
der Kategorie 2 mit Zuluftfilter<br />
<strong>und</strong> Klimaanlage können den Anwender<br />
ausreichend vor Spritznebel<br />
schützen. In solchen Kabinen<br />
können Anwender auf das Tragen<br />
spezieller Schutzkleidung verzichten,<br />
wenn Fenster, Türen <strong>und</strong> weitere<br />
Lüftungsöffnungen während<br />
der Anwendung geschlossen sind.<br />
Diese Regelung ist solange<br />
noch gültig, bis entsprechende<br />
Versuche abgeschlossen sind. Da<br />
die Ergebnisse nicht abschätzbar<br />
sind wird empfohlen, bei Neuanschaffungen<br />
von Traktoren möglichst<br />
einen Kabinentyp mit höherem<br />
Schutzniveau zu wählen.<br />
Alternativ ist für Bestandstraktoren<br />
mittlerweile auch die Nachrüstung<br />
von Schutzbelüftungssystemen<br />
vom BVL anerkannt.<br />
Offen ist auch, ob dies bei gängigen<br />
Schmalspurtraktoren praxisgerecht<br />
umgesetzt werden<br />
kann. Müssen beim Spritzen Reparaturarbeiten<br />
an Spritze oder<br />
am Traktor durchgeführt werden,<br />
sind mitgeführte Handschuhe zu<br />
verwenden. Nach Beendigung der<br />
Reparaturarbeiten sollten Handschuhe<br />
<strong>und</strong> Hände mit sauberem<br />
Wasser über bewachsenem Boden<br />
abgewaschen werden. Verfügen<br />
die Spritzgeräte über keinen<br />
Frischwassertank, sollte sauberes<br />
Wasser in einem Kanister mitgeführt<br />
oder auf Einweghandschuhe<br />
zurückgegriffen werden. Für Außenreparaturen<br />
ist das Fahrzeug<br />
möglichst in einen noch nicht<br />
behandelten Bereich zu fahren.<br />
→ Atem- <strong>und</strong> Augenschutz:<br />
Nur bei wenigen Pflanzenschutzmitteln<br />
ist spezieller Atemschutz<br />
vorgeschrieben. Sofern es der<br />
Tragekomfort erlaubt, ist Atemschutz<br />
am ehesten noch bei<br />
handgeführten Sprühvorgängen<br />
sinnvoll. Mittlerweile gibt es auch<br />
speziell belüftete Helm- <strong>und</strong> Anzugvarianten<br />
auf dem Markt.<br />
Wird Atemschutz verlangt, so ist<br />
je nach Erfordernis eine partikelfiltrierende<br />
Halbmaske (FFP2),<br />
eine Halbmaske mit Partikelfilter<br />
(P2), eine kombiniert filtrierende<br />
Halbmaske mit Ausatemventilen<br />
zum Schutz gegen Partikel <strong>und</strong><br />
Gase (FFA1P2) oder eine Halbmaske<br />
mit kombiniertem Partikel-<br />
<strong>und</strong> Gasfilter zu verwenden.<br />
Beim Umgang mit konzentrierten<br />
Präparaten wird gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
Augenschutz empfohlen.<br />
Schutzbrillen sollten Belüftungslöcher<br />
haben, gut passen <strong>und</strong> die<br />
Augen ausreichend schützen. Die<br />
22 3 | <strong>2024</strong>
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
Schutzbrille sollte das Tragen von<br />
Sehhilfen ermöglichen. Es bietet<br />
sich an, saubere Schutzbrillen<br />
immer im Spritzmittelraum oder<br />
Schrank vorrätig zu haben.<br />
Anwohner <strong>und</strong><br />
Spaziergänger<br />
Während sachk<strong>und</strong>ige Anwender<br />
Kenntnis von erforderlichen<br />
Schutzmaßnahmen haben, ist davon<br />
auszugehen, dass unbeteiligte<br />
Dritte, wie Anwohner <strong>und</strong> Spaziergänger,<br />
nicht informiert sind.<br />
Daher müssen zu Flächen, die von<br />
unbeteiligten Personen genutzt<br />
werden, Mindestabstände eingehalten<br />
werden. Zu diesen Flächen<br />
gehören Gr<strong>und</strong>stücke mit Wohnbebauung,<br />
privat genutzte Gärten<br />
sowie Flächen, die für die Allgemeinheit<br />
bestimmt sind.<br />
Die Mindestabstände gelten,<br />
unabhängig davon, ob sich dort<br />
tatsächlich Personen aufhalten.<br />
Bei seitwärts gerichteten Anwendungen<br />
in Raumkulturen sind<br />
5 m Mindestabstand einzuhalten.<br />
Bei nach unten gerichteten Anwendungen<br />
2 m. Zum Schutz für<br />
Radfahrer <strong>und</strong> Spaziergänger ist<br />
sicherzustellen, dass diese bei Anwendungen<br />
nicht mit dem Sprühnebel<br />
in Berührung kommen.<br />
Verhalten bei Unfällen<br />
Pflanzenschutzmittel sind immer<br />
mit besonderer Vorsicht zu handhaben.<br />
Kommt es trotz aller Vorsicht<br />
zu einem Unfall, sollte die<br />
Kleidung zügig ausgezogen <strong>und</strong><br />
die betroffenen Körperstellen mit<br />
viel Wasser gereinigt werden. Bei<br />
der Spritzarbeit im <strong>Wein</strong>berg ist es<br />
ratsam, immer einen Frischwasserbehälter<br />
mitzuführen. Wenn<br />
sich bei der Arbeit Kopfschmerzen,<br />
Schweißausbruch, Übelkeit<br />
oder andere auffällige Ges<strong>und</strong>heitsstörungen<br />
bemerkbar machen,<br />
muss die Arbeit umgehend<br />
unterbrochen oder beendet <strong>und</strong><br />
ein Arzt aufgesucht werden.<br />
Bei schweren Vergiftungen, wie<br />
sie auch im Haushalt vorkommen<br />
können, ist ein Rettungswagen zu<br />
rufen, um den Vergifteten so<br />
schnell wie möglich in ein Krankenhaus<br />
zu bringen. Bis zum Eintreffen<br />
des Arztes ist es wichtig,<br />
den Vergifteten im Freien oder in<br />
einem gut belüfteten Raum in stabile<br />
Seitenlage zu bringen. Der<br />
Arzt benötigt die Pflanzenschutzmittelpackung<br />
<strong>und</strong> die Gebrauchsanweisung<br />
der verwendeten Mittel.<br />
Bewegung oder Anstrengung<br />
des Geschädigten ist zu vermeiden.<br />
Gesicht <strong>und</strong> Haut sollten mit<br />
Wasser gereinigt werden. Bei Augenkontakt<br />
ist längere Zeit mit<br />
fließendem Wasser auszuspülen.<br />
Text: Roland Zipf<br />
Bilder: Roland Zipf<br />
Geeignete <strong>und</strong> zertifizierte<br />
Schutzausrüstzung ist im Landhandel<br />
erhältlich.<br />
Roland<br />
Zipf<br />
ist <strong>Wein</strong>bauberater am<br />
Landrats amt Main-Tauber-Kreis.<br />
Innovativer<br />
Schutz für Ihre<br />
Trauben vor<br />
Peronospora.<br />
KEIN<br />
DOWNSIDE ZU<br />
KUPFERFREI • BIOLOGISCH • WIRKSAM<br />
Zul.Nr. 00A891-00. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.<br />
Vor Verwedung stets Etikett <strong>und</strong> Produktinformationen lesen.<br />
3 | <strong>2024</strong><br />
23
...EXTRA REBSCHUTZ...<br />
ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZ FÜR FOLGEARBEITEN (SF-AUFLAGEN)<br />
Auflage Auflagetext Pflanzenschutzmittel<br />
SF179<br />
SF189<br />
SF1891<br />
SF245<br />
SF245-01<br />
SF245-02<br />
Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Kulturen dürfen gr<strong>und</strong>sätzlich erst<br />
24 St<strong>und</strong>en nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb<br />
von 48 St<strong>und</strong>en sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel<br />
<strong>und</strong> Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.<br />
Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tag der<br />
Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für<br />
das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten<br />
Flächen/Kulturen dürfen gr<strong>und</strong>sätzlich erst 24 St<strong>und</strong>en nach<br />
der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 St<strong>und</strong>en<br />
sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel <strong>und</strong> Universal-<br />
Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.<br />
Behandelte Flächen/Kulturen dürfen gr<strong>und</strong>sätzlich erst nach dem Abtrocknen<br />
des Spritzbelags wieder betreten werden.<br />
Veriphos u. a.<br />
Aktuan, Collis, Custodia, Delan WG, Flovine, Folpan 80<br />
WDG, Folpan 500 SC, Forum Gold, Forum Star, Karate<br />
Zeon, Kiron, Polyram WG, Pyrus, Sanvino, Scala, Switch,<br />
Talendo, Talendo <strong>Extra</strong>, Videryo F, Vinifol SC, VinoStar<br />
u. a.<br />
Betrifft nahezu alle relevanten Mittel<br />
SF266<br />
SF266-01<br />
Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelags<br />
wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk <strong>und</strong><br />
Schutzhandschuhe zu tragen.<br />
Delan Pro, Fantic F, Luna Experience, Sercadis<br />
SF274-2<br />
SF275-EEWE<br />
SF276-EEWE<br />
SF276-3WE<br />
SF276-4WE<br />
SF276-14WE<br />
SF276-28WE<br />
SF278-VEWE<br />
SF278-2WE<br />
SF278-14WE<br />
SF278-21WE<br />
SF1811<br />
SF1961<br />
Quelle: DLR Rheinpfalz<br />
Nachfolgearbeiten/Inspektionen auf/in behandelten Flächen/Kulturen<br />
dürfen gr<strong>und</strong>sätzlich erst 2 Tage nach der Ausbringung des Mittels<br />
durchgeführt werden.<br />
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem<br />
Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung<br />
im <strong>Wein</strong>bau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung <strong>und</strong> festes<br />
Schuhwerk getragen werden.<br />
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem<br />
Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung<br />
im <strong>Wein</strong>bau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung <strong>und</strong> festes<br />
Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.<br />
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem<br />
Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 3/4 Tagen<br />
nach der Anwendung im <strong>Wein</strong>bau lange Arbeitskleidung <strong>und</strong> festes<br />
Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.<br />
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem<br />
Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14<br />
Tagen nach der Anwendung im <strong>Wein</strong>bau lange Arbeitskleidung <strong>und</strong> festes<br />
Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.<br />
Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem<br />
Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen<br />
nach der Anwendung im <strong>Wein</strong>bau lange Arbeitskleidung <strong>und</strong> festes<br />
Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.<br />
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen<br />
nach der Anwendung im <strong>Wein</strong>bau bis unmittelbar vor der Ernte auf maximal<br />
2 St<strong>und</strong>en täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung <strong>und</strong><br />
festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.<br />
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb<br />
von 2 Tagen nach der Anwendung im <strong>Wein</strong>bau auf maximal<br />
2 St<strong>und</strong>en täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung <strong>und</strong> festes<br />
Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.<br />
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb<br />
von 14/21 Tagen nach der Anwendung im <strong>Wein</strong>bau auf maximal<br />
2 St<strong>und</strong>en täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung <strong>und</strong> festes<br />
Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.<br />
Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mittels Luftfahrzeugen<br />
<strong>und</strong> bis zum Abtrocknen des Spritzbelags die behandelte Fläche von<br />
unbeteiligten Dritten nicht betreten wird.<br />
Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mittels Luftfahrzeugen<br />
<strong>und</strong> bis zum Abtrocknen des Spritzbelags die behandelte Fläche <strong>und</strong><br />
ein zusätzlicher 20 Meter breiter, nicht behandelter Streifen ringsherum<br />
von unbeteiligten Dritten nicht betreten wird.<br />
Melody Combi<br />
Alginure BioSchutz, Durano (TF), Glyphogan, Minecto<br />
One, Frutogard, Ro<strong>und</strong>up PowerFlex, Zorvec Vinabel u. a.<br />
Afrasa Triple WG, Cuproxat, Kenja, Luna Max, Mildicut,<br />
Melody Combi, Polyram WG, Solofol, Zorvec Zelavin u. a<br />
Belanty<br />
Prosper TEC<br />
Spirox<br />
Airone SC, Coprantol Duo, Cuprozin Progress, Funguran<br />
Progress u. a.<br />
Polyram WG u. a.<br />
Luna Max, Prosper TEC, Spirox u. a.<br />
Cuproxat<br />
Pergado<br />
Orvego<br />
Custodia<br />
24 3 | <strong>2024</strong>