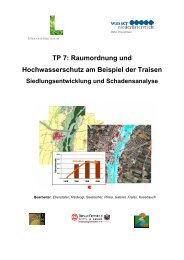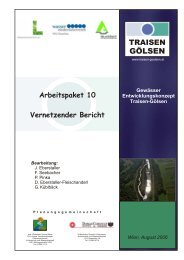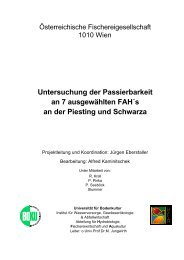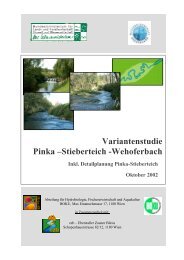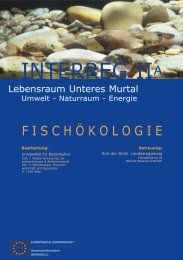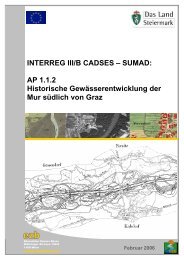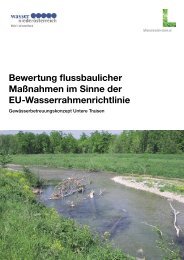Toplitzbach - Hochwasserschutz mit fischökologischer Fachplanung
Toplitzbach - Hochwasserschutz mit fischökologischer Fachplanung
Toplitzbach - Hochwasserschutz mit fischökologischer Fachplanung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Toplitzbach</strong> – <strong>Hochwasserschutz</strong><br />
<strong>mit</strong> <strong>fischökologischer</strong> <strong>Fachplanung</strong><br />
Photodokumentation & Baubericht<br />
Verfasser:<br />
Zauner Gerald<br />
Ratschan Clemens<br />
ezb – TB Zauner<br />
TB für Angewandte Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft<br />
Siedlungstraße 140<br />
4090 Engelhartszell a.d. Donau<br />
zauner@ezb-fluss.at Tel.Nr. 07717 / 717611 FAX:07717 / 717644<br />
Engelhartszell, im Juni 2004
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
1 Einleitung und Kurzcharakterisierung des Gebietes<br />
Natürliche Seeausrinne sind grundsätzlich durch ungewöhnlich hohe Fischbestände<br />
gekennzeichnet, welche vor allem durch Faktoren wie das ausgeglichene Abflussregime, die<br />
kontinuierliche Nährstoffzufuhr und in weiterer Folge gute Entwicklung von benthischen<br />
Invertebraten zurückzuführen sind („lake effect“). Weiters trägt aber auch eine freie<br />
Durchwanderbarkeit von Fluss – Seen – Systemen zu einer hohen Produktivität bei, weil<br />
dadurch unterschiedliche Altersstadien von Fischen die optimalen Lebensräume hinsichtlich<br />
Laichsubstrat, Temperatur, Nahrungsverfügbarkeit, Prädationsrisiko etc. aufsuchen können.<br />
Der <strong>Toplitzbach</strong> ist insofern eine Besonderheit, als er auf kurzer Strecke zwei Seen verbindet:<br />
Er fließt auf einer Strecke von 1,5 km vom Toplitzsee (718 m.ü.A.) in den Grundlsee (708<br />
m.ü.A.) und überwindet dabei eine Höhendifferenz von etwa 10 m, was einem Gefälle von<br />
etwa 7%0 entspricht.<br />
Schon seit langer Zeit wurden hier durch den Menschen wasserbauliche Eingriffe getätigt,<br />
welche aufgrund dieses langen Bestehens oft nicht mehr wahrgenommen bzw. als natürlich<br />
akzeptiert werden. Allerdings werden bei detaillierter, unvoreingenommener Betrachtung<br />
deutliche Defizite in der Gewässerstruktur deutlich. Besonders aber weist der verhältnismäßig<br />
geringe Fischbestand, welcher im Zuge der Ist – Bestandserhebung des fischökologischen<br />
Monitorings erhoben wurde, deutlich auf strukturelle Defizite im System hin, die die oben<br />
genannten positiven Faktoren in diesem Seeausrinn überlagern.<br />
Abbildung 1: Lage des Projektgebietes. Quelle: Alpenvereinskarte Nr. 15/1 Totes Gebirge West, Stand<br />
1996.<br />
Seite 1
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Die wesentlichsten und gravierendsten anthropogenen Maßnahmen wurden gesetzt, um den<br />
<strong>Toplitzbach</strong> für die Holzdrift zu adaptieren. Beim Ausrinn wurde eine Klause errichtet,<br />
welche nicht fischpassierbar ist und alljährlich dutzenden bis hunderten Fischen, die zum<br />
Laichen aus dem Toplitzsee in den Bach absteigen, am Wiederaufstieg in den See hindert.<br />
Auf der gesamten Strecke wurden im Gewässer liegende Steine ausgeräumt und teils am Ufer<br />
liegen gelassen, teils zur Errichtung von Steinschlichtungen zur Ufersicherung verwendet.<br />
Weiters wurden einige Mäanderbögen des Baches <strong>mit</strong> Durchstichen begradigt, welche die<br />
Länge des Bachlaufes deutlich verkürzten und so<strong>mit</strong> das Gefälle erhöhten. Als Ausgleich<br />
dazu wurden einige Schwellen in Form von Querhölzern eingebaut, die zusätzliches zur<br />
Klause Kontinuumsprobleme <strong>mit</strong> sich bringen.<br />
Später wurden weitere Ufersicherungen, oft in Form von Längswerken aus Rundhölzern,<br />
errichtet. Auch die harte Regulierung der Bachmündung in den Grundlsee hat eine<br />
Verschlechterung der Lebensraumqualität für aquatische Organismen zur Folge.<br />
Die beiden Seen beherbergen eine hoch spezialisierte Fischfauna, deren Bestände durch<br />
verschiedene Faktoren, Gewässerstruktur, Seeneutrophierung, falsche Bewirtschaftung, aber<br />
auch die Einschleppung der gebietsfremden Fischarten Hecht und Flussbarsch, stark<br />
zurückgegangen sind. Beinahe die gesamte Fischfauna nutzt obligatorisch oder zusätzlich die<br />
Zubringer, vor allem den abflussstärksten <strong>Toplitzbach</strong>, als Laich- und Jungfischhabitat. Die<br />
Arten Seeforelle (Salmo trutta forma lacustris), Seesaibling (Salvelinus alpinus) und Elritze<br />
(Phoxinus phoxinus) stehen heute auf der Roten Liste, die im Bach vorkommenden bzw.<br />
laichenden Arten Koppe (Cottus gobio) und Seelaube (Chalcalburnus alburnoides) werden in<br />
der Fauna – Flora – Habitat – Richtlinie der Europäischen Union geführt. Bei einer<br />
strukturellen Aufwertung des <strong>Toplitzbach</strong>es und Herstellung einer freien Durchwanderbarkeit<br />
des Systems für Fische ist von einer deutlichen Verbesserung der Bestände bzw. des<br />
Erhaltungszustandes dieser gefährdeten Arten auszugehen.<br />
Deshalb wurde in den Jahren 2003 und 2004 das gegenständliche Projekt in Angriff<br />
genommen, welches zum Ziel hat, alle wesentlichen strukturellen Defizite im <strong>Toplitzbach</strong> von<br />
der Klause bis zur Mündung zu entschärfen. So wurde das Gewässer <strong>mit</strong> Ausnahme einer<br />
morphologisch hochwertigen, etwa 150 m langen „Referenzstecke“ im Herbst 2003 auf<br />
beinahe der gesamten Bachlänge rückgebaut.<br />
Um die Seeklause fischpassierbar zu machen, wurde entschieden, nicht die Klause selbst zu<br />
adaptieren, sondern den Unterwasserspiegel durch Errichtung einer naturnahen,<br />
fischpassierbaren Rampe aufzuhöhen und dadurch das Gefälle nicht in der Klause selbst,<br />
sondern auf einer längeren Strecke abzubauen. Weiters wurde die Mündungsstrecke einseitig<br />
großzügig aufgeweitet, so dass hier entsprechend dem natürlichen Leitbild ein Mündungsdelta<br />
rekonstruiert werden konnte. Diese Arbeiten wurden im Frühjahr 2004 fertig gestellt und<br />
werden in der folgenden Photodokumentation vorgestellt.<br />
Bei diesem Projekt wurde bewusst auf eine ins Detail gehenden Planung im Voraus<br />
verzichtet, weil erfahrungsgemäß im Zuge der Bauarbeiten ständig auf die angetroffenen<br />
Bedingungen (Untergrund, Materialverfügbarkeit etc.) reagiert werden muß. Stattdessen war<br />
während der Bauarbeiten ständig ein Mitarbeiter der Firma ezb, TB Zauner zur ökologischen<br />
Bauaufsicht vor Ort anwesend.<br />
Seite 2
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Vor Baubeginn wurde ein Restrukturierungskonzept erstellt, welches neben den<br />
grundsätzlichen Rahmenbedingungen wie strukturelle Hauptdefizite, Laufform, Gefälle,<br />
<strong>Hochwasserschutz</strong>erfordernisse und Grundbesitzverhältnissen auch auf die ökologischen<br />
Ansprüche der standortgemäßen Fischfauna eingeht und darauf eine grobe Verortung von<br />
Maßnahmen vorsieht. Im Zuge der Bauarbeiten bestätigte sich die Sinnhaftigkeit und<br />
Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen, sodass eine detailoptimierte, im Sinne der angetroffenen<br />
Rahmenbedingungen angepasste Umsetzung einer leitbildorientierten Restrukturierung<br />
gewährleistet werden konnte.<br />
Um den Erfolg der Baumaßnahmen bzw. die zeitliche Entwicklung des Fischbestandes in<br />
Reaktion auf die verbesserte gewässermorphologische Situation zu dokumentieren, ist ein<br />
mehrjähriges fischökologisches Monitoring vorgesehen.<br />
Seite 3
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
2 Dokumentation des Zustandes vor Umbau -<br />
Defizitanalyse<br />
Charakterisierung der Hauptdefizite im System:<br />
• Lineare Laufform (Abbildung 2)<br />
• Geringe Tiefenvarianz (Abbildung 3)<br />
• Geringe Breitenvarianz (Abbildung 4<br />
• Steine ausgeräumt (Abbildung 5)<br />
• Glatte Ufersicherungen (Abbildung 7)<br />
• Fehlende Geschiebedynamik, homogene Substratverteilung (Abbildung 6)<br />
• Geringer Totholzanteil (Abbildung 2 bis Abbildung 5)<br />
• Kontinuumsprobleme: 5 Schwellen <strong>mit</strong> Höhenunterschied bis 30 cm (Abbildung 8)<br />
• Klause: Fisch – unpassierbar durch Schusstafeln, abgelösten Strahl (Abbildung 9)<br />
• Unbefriedigende Mündungssituation (Abbildung 10)<br />
Abbildung 2: Die lineare Laufform hat eine geringe Breiten – und Tiefenvarianz zur Folge. Aufgrund der<br />
fehlenden Lebensraumvielfalt stehen hier für viele Arten und Altersstadien nur minimale Flächen<br />
optimaler Mikrohabitate zur Verfügung!<br />
Seite 4
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 3: Stromauf der Fußgängerbrücke war die monoton seichte Gewässermorphologie besonders<br />
auffällig. Derartige Bereiche können bei extremer Niedrigwasserführung sogar ein Migrationshindernis<br />
für große Seeforellen darstellen.<br />
Abbildung 4: Blick stromauf zum Bereich der großen Laufverschwenkung. Auch hier war vor Umbau –<br />
neben dem künstlich begradigten Lauf - eine sehr geringe Tiefen- und Breitenvarianz zu konstatieren.<br />
Seite 5
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 5: Im Abschnitt unterhalb der Klause war die Monotonisierung der Gewässermorphologie<br />
durch das im Zuge der Regulierung erfolgte Ausräume n von Steinen besonders markant. Diese Steine<br />
sind links als Uferwall zu erkennen.<br />
Abbildung 6: Über die gesamte Gewässerbreite einheitlichen Strömungs- und Tiefenverhältnisse führen<br />
zu einer einheitlichen Substratverteilung. Ein Aufsortieren des Substrates kann nicht stattfinden, welches<br />
kieslaichenden Fischarten wie Bachforelle, Seeforelle, Elritze oder Seelaube das Anlegen von Laichplätzen<br />
auf Stellen <strong>mit</strong> optimalen Korngrößen ermöglichen würde.<br />
Seite 6
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 7: Vielerorts bestanden glatte Ufersicherungen in Form von eingewachsenen<br />
Steinschlichtungen und <strong>mit</strong>tels Piloten eingebauten Längswerken aus Holz.<br />
Abbildung 8: An 5 Stellen bestanden Querbauwerke in Form von Holzschwellen <strong>mit</strong> einer Fallhöhe von<br />
bis zu 30 cm. Derartige Schwellen können, vor allem bei niedrigem Wasserstand, für schwimmschwache<br />
Altersstadien und Arten (z.B. Koppe) ein unüberwindbares Migrationshindernis darstellen.<br />
Seite 7
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 9: Die Klause stellte vor Umbau ein Migrationshindernis zum Toplitzsee dar. Aufgrund der<br />
hohen Strömungsgeschwindigkeit des dünnen Wasserfilms auf den Schusstafeln (kleines Bild links), des<br />
abgelösten Strahles beim Ausstieg und der fehlenden Möglichkeit, davor Anlauf zu nehmen (kleines Bild<br />
rechts), ist das Bauwerk für alle Arten und Stadien als unpassierbar einzuschätzen.<br />
Abbildung 10: Die <strong>Toplitzbach</strong> – Mündung war vor dem Umbau beidseitig von <strong>mit</strong> Blockstein<br />
gesicherten, steilen Uferböschungen begrenzt. Dadurch wurde eine Nutzung des Mündungsbereiches<br />
durch Badegäste erschwert. Aufgrund der Überbreite und der symmetrischen Profilform traten bei<br />
herbstlichem Niedrigwasser sehr geringe maximale Wassertiefen auf, was in manchen Jahren die<br />
Einwanderbarkeit für laichwillige Seeforellen erschwerte.<br />
Seite 8
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
3 Dokumentation der Bauphase<br />
Abbildung 11: Einbau mehrerer Tonnen schwerer Blocksteine für die Rampe unterhalb der Klause.<br />
Abbildung 12: Das Bild zeigt das Graben der ersten Laufverschwenkung etwa 300 m stromab der Klause.<br />
Der lineare Altlauf ist im Hintergrund noch zu erkennen. Die Prallhangbereiche wurden aufgrund der<br />
hohen hydraulischen Belastung dieser ersten Verschwenkung nach einer langen, nur leicht pendelnen<br />
Strecke massiv gesichert, linksufrig durch eine raue Blocksteinschlichtung (siehe Abbildung 34) und<br />
rechtsufrig durch Piloten und Wurzelstöcke (siehe Abbildung 13), die zusätzlich durch Blocksteine<br />
strukturiert werden.<br />
Seite 9
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 13: Einbau von Wurzelstöcken und Piloten zur Prallhangstabilisierung im Bereich der ersten<br />
Laufverschwenkung.<br />
Abbildung 14: Einbau von Wurzelstöcken zur Bildung einer buhnenartigen Verschwenkung des<br />
Gewässers. Der Stock wird durchbohrt und <strong>mit</strong> einem Stahlseil am Piloten fixiert.<br />
Seite 10
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 15: Einbau von Wurzelstöcken zur Bildung einer weniger massiven buhnenartigen<br />
Verschwenkung des Gewässers. Hier genügte ein Hinterfüllen der durch die Wurzelstöcke gesicherten<br />
Böschungsfront <strong>mit</strong> Grobschotter, um dauerhaft eine pendelnde Linienführung zu etablieren.<br />
Abbildung 16: Die im Bach liegenden Holzschwellen wurden ausnahmslos entfernt.<br />
Seite 11
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 17: Graben eines neuen Laufes bei der zweiten Laufverschwenkung. Der Bagger verfüllt den<br />
Altlauf im Hintergrund <strong>mit</strong> dem ausgehobenen Material. Durch diese Maßnahme wird der <strong>Toplitzbach</strong> in<br />
einer Durchstichstrecke, entsprechend de m natürlichen Vorbild, in einen geschwungenen Lauf verlegt.<br />
Abbildung 18: Der Bereich nach Fertigstellung. Man beachte die flachen Ufer, welche bei allen<br />
Wasserständen einen flachen Gradienten von Wassertiefe und Strömungsgeschwindigkeit gewährleisten,<br />
sowie den im unteren Teil als Bucht erhaltenen Altlauf (links im Bildhintergrund)!<br />
Seite 12
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 19: Zur Sohlstabilisierung beim Dotationsbauwerk für den Mühlbach wurde eine Pilotenreihe<br />
gschlagen. Um ein seichtes Überströmen bei Niedrigwasser zu verhindern, welches die Fischpassierbarkeit<br />
beeinträchtigen könnte, wurde auf ein asymmetrisches Profil geachtet, wobei der tiefste Punkt in diesem<br />
Fall nahe dem Außenufer rechts liegt (siehe auch Abbildung 35).<br />
Abbildung 20: Der Fußgängersteg zwischen Strand und GH Rostiger Anker wurde ca. 30 m in Richtung<br />
stromauf versetzt. Dadurch konnte un<strong>mit</strong>telbar nach der Brücke entsprechend dem natürlichen Vorbild<br />
ein aufgeweitetes Mündungsdelta <strong>mit</strong> mehreren Armen und versetzten Inseln rekonstruiert werden.<br />
Seite 13
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 21: Mit dem beim Aushub des Nebenarmes und Tieferlegen des Geländes im<br />
Mündungsbereich anfallenden Material wurden entsprechend dem Leitbild eines Mündungsdeltas<br />
versetzte, flache Inseln in den See vorgeschüttet.<br />
Seite 14
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
4 Dokumentation von umgesetzten Bauelementen und<br />
Gewässerstrukturen<br />
Grundsätzlich wurden die Maßnahmen nach Möglichkeit wenig massiv ausgeführt, um den<br />
Bach nicht in einem aufgezwungenen Lauf zu konservieren, sondern ihm nach der<br />
Bauausführung eine gewisse Dynamik zu ermöglichen bzw. zurückzugeben. Aufgrund des<br />
aufkommenden Bewuchses und dessen Verwurzelung ist von einer natürlichen Stabilisierung<br />
dieser Bauelemente auszugehen, die verhindern soll, dass der Bach bei Hochwässern wieder<br />
in den regulierten, gestreckten Lauf durchbricht. Lokal wurden aufgrund äußerer<br />
Erfordernisse (Einstau der Klause, Nachhaltigkeit von Laufverschwenkungen,<br />
Dotierungsbauwerk für den Mühlbach, Sockel der Fußgängerbrücke) verhältnismäßig massive<br />
Bauwerke errichtet, jedoch wurde auch hier auf eine im Detail ökologisch optimierte<br />
Ausführung geachtet.<br />
Folgende naturnahe Bauelemente und Gewässerstrukturen wurden umgesetzt bzw.<br />
rekonstruiert:<br />
• Laufverschwenkungen <strong>mit</strong>tels Wurzelstöcken und Steinen (Abbildung 18)<br />
• Flache Schotterbänke und Buchten (Abbildung 18)<br />
• Rauhbäume (Abbildung 22:)<br />
• Wurzelstöcke (Abbildung 23, Abbildung 24)<br />
• Störsteine (Abbildung 25)<br />
• Uferanbrüche (Abbildung 26)<br />
• Angeströmter Fels (Abbildung 27)<br />
• Nebengerinne (Abbildung 28)<br />
• Schaffung bzw. Aufwertung von Feuchtflächen und stagnierenden Kleingewässern,<br />
Initiierung eines Bruchwaldes (Abbildung 29, Abbildung 30)<br />
• Aufweitung <strong>mit</strong> Nebenarmen und Inseln (Abbildung 31)<br />
• Mündungsdelta <strong>mit</strong> Furkation zwischen versetzten Inseln (Abbildung 32)<br />
Technische, massiv ausgeführte Bauwerke:<br />
• Aufgelöste Rampe zum Einstau der Klause (Abbildung 33)<br />
• Raue Steinschlichtungen (Abbildung 34)<br />
• Dotierungsbauwerk und Sohlgurt (Abbildung 35)<br />
• Brückensicherung und Sohlgurt zur Abflusskonzentration im Hauptarm des<br />
Mündungsdeltas (Abbildung 36)<br />
Seite 15
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 22: Rauhbäume können sowohl als<br />
lokale Ufersicherung als auch zur Strömungslenkung<br />
eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch<br />
eine große Oberfläche und eine vielfältige, von<br />
gering durchströmten Mikrohabitaten durchsetze<br />
Struktur aus, was eine hohe Eignung als<br />
Fischeinstand und Lebensraum für eine hohe Dichte<br />
und Vielfalt an wirbellosen Tieren zur Folge hat.<br />
Sämtliche Rauhbäume wurden durch Stahlseile<br />
gesichert, welche durch angebohrte Piloten bzw.<br />
Bäume am Ufer gezogen und <strong>mit</strong> Klemmen<br />
zusammengehalten werden.<br />
Seite 16
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 23: Im Herbst eingebaute Wurzelstöcke von Laubgehölzen trieben großteils im Frühjahr<br />
wieder aus, wodurch nach vollendeter Verrottung des eigentlichen Stockes von einer ausreichenden<br />
Stabilität der <strong>mit</strong>tels Wurzelstöcken konstruierten Strukturen ausgegangen werden kann.<br />
Abbildung 24: Dieser Wurzelstock wurde weniger zur Ufersicherung eingebaut, sondern soll durch seine<br />
strukturreiche Form attraktive Fischeinstände bilden.<br />
Seite 17
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 25: Hinter Störsteinen bilden sich strömungsberuhigte Zonen und so<strong>mit</strong> attraktive<br />
Fischeinstände. Durch lokale Totholzanlandungen und Ansammlung von Laubpaketen wird eine<br />
zusätzliche Oberflächenvergrößerung und erhöhte Substratvielfalt erreicht, sodass es hier zur<br />
Entwicklung von besonders hohen Dichten von be nthischen Invertebraten komme n kann<br />
(Fischnährtiere!). Im abgebildeten Bereich wurde eine Blockrutschung von der steilen Böschung<br />
rekonstruiert.<br />
Abbildung 26: Im Bereich von Prallhängen wurden in Abschnitten, wo aufgrund der Umlandnutzung<br />
keine Sicherung erforderlich ist, Uferanbrüche initiiert. Hier kann der Bach Geschiebe erodieren und<br />
dynamisch umlagern. Weiters bieten derartige Steilufer dem Eisvogel die Möglichkeit zur Anlage von<br />
Bruthöhlen.<br />
Seite 18
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 27: Angeströmter Fels weist zwar eine glatte Oberfläche auf, aufgrund der hohen Energieumwandlung<br />
wird hier langfristig eine sehr hohe Wassertiefe erhalten bleiben, die eine hervorragende<br />
Eignung als Adultfischhabitat und Einstand für migrierende Großfische (Seeforelle!) zur Folge hat.<br />
Abbildung 28: Zwischen dem Mühlbach und de m Hauptgerinne liegen etliche Nebengerinne, welche hoch<br />
attraktive Jungfischhabitate darstellen.<br />
Seite 19
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 29: Durch verstärkte Anbindung bestehender Nebengerinne und Graben neuer Nebenarme<br />
wurden im Wald im Bereich zwischen dem Mühlbach und dem Hauptarm attraktive Kleingewässer und<br />
bei hohem Wasserstand überstaute Feuchtflächen geschaffen.<br />
Abbildung 30: Durch die Vernässung der Waldfläche in Folge der vermehrten Anbindung bzw.<br />
Neuschaffung von Nebengewässern wurde die Qualität und Ausdehnung von Feuchtbiotopen verbessert.<br />
Hier liegen stagnierende Kleingewässer, die wertvolle Amphibiengewässer und Reproduktionsareale für<br />
Fische bilden.<br />
Seite 20
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 31: Stromab des Fußgängerstegs im Wald wurde – entsprechend dem geringen Gefälle in<br />
diesem Abschnitt – durch Graben von versetzten Nebenarmen bzw. Schütten von Inseln – eine<br />
furkierende Aufweitungsstrecke rekonstruiert. Die Inselköpfe wurden entsprechend dem natürlichen<br />
Vorbild durch Wurzelstöcke (und verdeckte Piloten) gesichert.<br />
Abbildung 32: Blick vom Sichtstein vor der versetzten Fußgängerbrücke Richtung Mündungsdelta bzw.<br />
Grundlsee. Im Vordergrund liegt der große Nebenarm, welcher sich im Bildhintergrund weiter verzweigt,<br />
sodass insgesamt 4 versetzte Inseln entstehen. Die Uferlinie lag vor Umbau im Bereich der Weiden in der<br />
Bild<strong>mit</strong>te, durch Vorschütten des beim Absenken des Deltas gewonnenen Schottermaterials wurde das<br />
Delta etwa 25 m seewärts erweitert. Der Hauptarm des Baches ist rechts im Bildhintergrund zu erkennen.<br />
Seite 21
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 33: Blick stromauf auf die naturnahe Rampe und die dadurch eingestaute Klause. Die Rampe<br />
wurde eine m natürlichen Felsriegel nachempfunde n, der den Bach quert. Anstehender Fels bildet den<br />
Ausrinn vieler alpiner Seen. Bei der Bauausführung wurde auf eine raue Sohle und das Vorliegen von<br />
strömungsberuhigten Zonen innerhalb der Rampe geachtet, um eine optimale Fischpassierbarkeit zu<br />
gewährleisten.<br />
Abbildung 34: Dieses Bauwerk zur Sicherung der ersten Laufverschwenkung wurde als rauhe<br />
Steinschlichtung ausgeführt und ist aufgrund der exponierten Situierung massiv gefertigt. Es wurde<br />
besonders auf eine raue Oberfläche geachtet; zusätzlich wurde durch den Einbau von kleineren<br />
Wurzelstöcken die Sicherung verdeckt, sodass auch das Bewachsen des Bauwerkes möglich ist und<br />
strömungsberuhigte Fischeinstände entstehen.<br />
Seite 22
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Abbildung 35: Das alte, morsche Dotierungsbauwerk für den Mühlbach wurde durch diese Konstruktion<br />
ersetzt. Es wurde ähnlich einer Krainerwand durch längs liegenden Stämme und herausragende<br />
Wurzelstöcken ein hydraulisch raues Bauwerk konstruiert, das einerseits das Ufer sichert und für eine<br />
passende Dotierung des Mühlbaches sorgt, andererseits aber auch attraktive Fischeinstände bietet. Links<br />
im Bild ist der Sohlgurt zu erkennen, welcher als Pilotreihe ausgeführt wurde (siehe auch Abbildung 19).<br />
Abbildung 36: Blick vom Hauptarm in de n Nebenarm des Mündungsdeltas. Links ist die neue<br />
Brückensicherung zu erkennen, von der sich ein Sohlgurt aus eingegrabenen Steinen bis zur ersten Insel<br />
zieht. Dieser Gurt soll den Abfluss bei Niedrigwasser im Hauptarm konzentrieren, um eine verbesserte<br />
Einwanderbarkeit für große Seeforellen zu gewährleisten.<br />
Seite 23
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
5 Gegenüberstellung von repräsentativen Stellen: Vorher -<br />
Nachher<br />
Seite 24
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 25
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 26
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 27
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 28
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 29
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 30
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 31
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 32
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 33
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 34
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 35
ezb, TB ZAUNER PHOTODOKUMENTATION TOPLITZBACH<br />
Seite 36