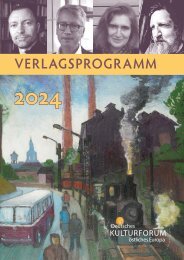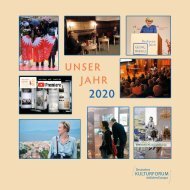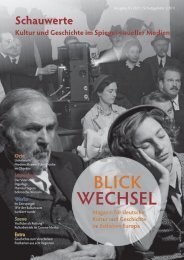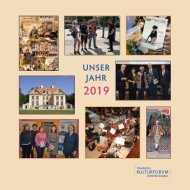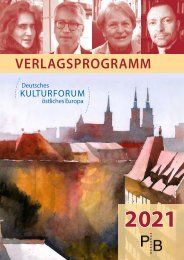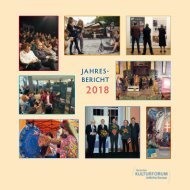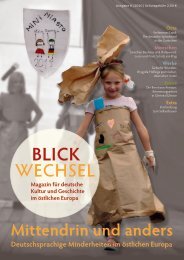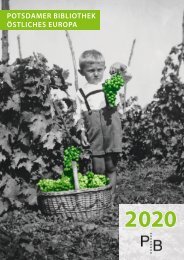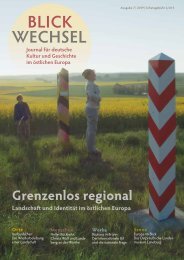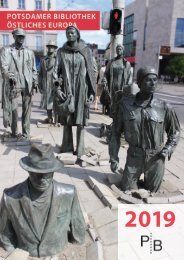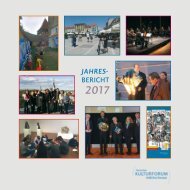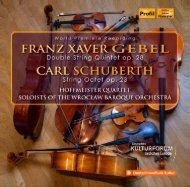Jahresbericht 2012
Überblick über die Aktivitäten des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam, im Kalenderjahr 2012
Überblick über die Aktivitäten des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam, im Kalenderjahr 2012
- TAGS
- fußball
- sport
- oestliches europa
- deutsches kulturforum
- ostmitteleuropa
- slubice
- usedom
- literatur
- neumark
- backsteinarchitektur
- hinrich brunsberg
- marburg an der drau maribor
- minderheiten
- deutsche minderheit
- radka denemarková
- eva profousová
- peter demetz
- georg dehio buchpreis
- friedrich ii von preußen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Jahres<br />
bericht<br />
<strong>2012</strong>
Grenzüberschreiter...................................................................................................................................................6<br />
Friedrich ii. von Preußen und das östliche Europa<br />
Georg Dehio-Buchpreis <strong>2012</strong>.................................................................................................................................8<br />
Maribor/Marburg an der Drau...........................................................................................................................10<br />
Europas Kulturhauptstadt <strong>2012</strong><br />
Deutsche Minderheiten und regionale<br />
Identitäten im östlichen Europa........................................................................................................................12<br />
Kooperationspartnertagung in Groß Stein/Kamień Śląski bei Oppeln/Opole<br />
Ausstellung/Wystawa................................................................................................................................................14<br />
Innovation und Tradition. Hinrich Brunsberg und die spätgotische<br />
Backsteinarchitektur in Pommern und der Mark Brandenburg<br />
Innowacja i tradycja – Henryk Brunsberg i późnogotycka<br />
architektura ceglana na Pomorzu i w Marchii Brandenburskiej<br />
Neuerscheinung im Verlag des<br />
Deutschen Kulturforums östliches Europa..................................................................................................16<br />
Präsentation des Kulturreiseführers Streifzüge zwischen Oder und Drage.<br />
Begegnungen mit der Neumark im Juli <strong>2012</strong><br />
Usedomer Literaturtage <strong>2012</strong>..............................................................................................................................18<br />
Wortreiche Landschaften zwischen der Ostsee und den Karpaten<br />
Das Stadion in Słubice.............................................................................................................................................20<br />
Lokale Sportgeschichte und Erstellung von Audio-Podcasts
Vorbemerkung<br />
Das Deutsche Kulturforum östliches Europa will mit diesem<br />
Jahresheft einen Überblick über einige Arbeitsschwerpunkte<br />
des Jahres <strong>2012</strong> geben. Seit seiner Gründung erstellt<br />
das Kulturforum interne <strong>Jahresbericht</strong>e, und für die Jahre 2001<br />
bis 2005 liegt ein umfangreicher Bericht auf der Internetpräsenz<br />
zum Abruf bereit. In gedruckter Form wenden wir uns<br />
aber nun erstmals mit einer knappen Bilanz an unser Publikum,<br />
an unsere Partner und Förderer.<br />
Das Jahr <strong>2012</strong> bot manche inhaltliche Höhepunkte. Neben<br />
einem Programmschwerpunkt aus Anlass des Jubiläumsjahres<br />
zu Friedrich II. von Preußen und dem östlichen Europa waren<br />
das etwa die Neuerscheinungen Jeder zweite Berliner über<br />
schlesische Spuren an der Spree sowie der Kulturreiseführer<br />
Streifzüge zwischen Oder und Drage über die Neumark,<br />
die beide – aus Potsdamer und Berliner Perspektive – unsere<br />
nähere Nachbarschaft bekannter machen und besser erschließen<br />
helfen. Als besonders erfreulich sind auch jene Programmangebote<br />
anzusehen, an denen Studierende und Schüler<br />
beteiligt waren, etwa im Rahmen eines in Odessa und Stuttgart<br />
durchgeführten Workshops, bei Projekten im Zusammenhang<br />
mit der Fußball-EM oder bei Schülerrallyes durch Berlin.<br />
Mit 111 Veranstaltungen in elf Bundesländern und zehn Staaten<br />
sowie sechs Neuerscheinungen legte das Kulturforum trotz<br />
Personaleinschnitten ein stattliches Ergebnis vor.<br />
So war das Jahr <strong>2012</strong> für das Team des Kulturforums, für<br />
dessen Vorstand und dessen Gremien angesichts personeller<br />
Veränderungen und Engpässe oft eine Herausforderung.<br />
Als der Georg Dehio-Buchpreis – diesmal recht spät im Jahr<br />
– im Rahmen einer schönen Feier in Berlin verliehen wurde,<br />
war allgemein zu erkennen, dass die gemeinsamen Anstrengungen<br />
erfolgreich waren und dass das Kulturforum festgefügt<br />
dasteht, es nimmt seine Aufgaben ohne Einschränkung<br />
und mit Elan wahr. Intensiven Einsatz erforderte <strong>2012</strong><br />
auch die vollständige Umarbeitung der Internetpräsenz. Die<br />
Inhalte sollten nicht nur übersichtlicher aufbereitet werden,<br />
sondern auch die öffentlichkeitswirksame Forumsfunktion<br />
des Kulturforums für den gesamten Förderbereich des Bundes<br />
zur deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa<br />
berücksichtigen. Die fruchtbare Kooperation sowohl mit unserem<br />
Fachreferat beim Beauftragten der Bundesregierung für<br />
Kultur und Medien wie auch mit unseren Partnereinrichtungen<br />
bundesweit waren dafür eine gute Grundlage. Das Ergebnis<br />
ist seit 2013 unter www.kulturforum.info online und wird<br />
weiter ausgebaut.<br />
Das Deutsche Kulturforum östliches Europa freut sich auf<br />
eine weiterhin breitgefächerte Mitwirkung und auf gute<br />
Zusammenarbeit mit seinen zahlreichen Kooperationspartnern<br />
im In- und Ausland.
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im Breslauer Rathaus.<br />
(Stich von Friedrich Bernhard Werner )<br />
Banner des Deutschen Kulturforums<br />
östliches Europa<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im<br />
Breslauer Rathaus.<br />
(Stich von Friedrich Bernhard Werner )
Grenzüberschreiter<br />
Friedrich ii. von Preußen und das östliche Europa<br />
Das kulturelle Angebot zum Friedrich-<br />
Jahr <strong>2012</strong> war überwältigend, zumal<br />
im Großraum Berlin-Potsdam. Der 300.<br />
Geburtstag des Preußenkönigs war<br />
Anlass für Ausstellungen jeder Größenordnung,<br />
für Tagungen, Vorträge, Publikationen,<br />
Konzerte. Für das Deutsche<br />
Kulturforum östliches Europa stand<br />
somit fest, dass es sich diesem Thema<br />
als Jahresschwerpunkt nur zuwenden<br />
könne, wenn es sich auf Aspekte konzentriert,<br />
die in der allgemeinen Friedrichbegeisterung<br />
übersehen zu werden<br />
drohten. Gefragt war also der Blick<br />
aus dem Osten. Eine Annäherung an<br />
den Begründer Prußens als europäische<br />
Großmacht wird jedoch schwierig,<br />
sobald man die Perspektive des östlichen<br />
Europa einnimmt. So sehr dem<br />
Attribut »der Große« angesichts seiner<br />
herausragenden Aufbauleistungen<br />
etwa aus märkischer oder ostpreußischer<br />
Sicht zugestimmt werden konnte,<br />
so ganz anders mochte die Einschätzung<br />
in den habsburgischen Ländern<br />
oder unter Polen, aber selbst in Sachsen<br />
sein.<br />
Diese Ambivalenz wurde in mehreren<br />
Potsdamer Vorträgen deutlich.<br />
Hans-Jürgen Bömelburg setzte sich mit<br />
Friedrich II. als Erinnerungsort im deutschen<br />
und polnischen Bewusstsein auseinander,<br />
und Claudia Sinnig erklärte,<br />
weshalb sich Königsberg während der<br />
Siebenjährigen Krieges russischer Herrschaft<br />
unterstellte und seinem König<br />
nicht treu blieb. Die tschechische Perspektive<br />
konnte Miloš Řezník mit seinem<br />
Beitrag über böhmische Emigranten in<br />
Brandenburg und Schlesien in friderizianischer<br />
Zeit aufzeigen. Der erfolgreichen<br />
Peuplierungspolitik widmete sich<br />
auch der Vortrag von Reinhard Schmook<br />
über »Friedrichs neue Untertanen in der<br />
Neumark«.<br />
Dieser Beitrag leitete thematisch zu<br />
einer Neuerscheinung des Kulturforums<br />
über, die im Rahmen des Jahresschwerpunkt<br />
in Schloss Caputh vorgestellt<br />
wurde: »Streifzüge zwischen Oder<br />
und Drage. Begegnungen mit der Neumark«<br />
(herausgegeben von Paweł Rutkowski)<br />
ist ein Kulturreiseführer durch<br />
das ehemalige östliche Brandenburg,<br />
das seine neuzeitliche Blüte wesentlich<br />
Friedrichs Förderung zu verdanken<br />
hat. Schwerpunktmäßig in die Zeit<br />
Friedrichs II. weist auch das Buch von<br />
Hildegard Schieb »Jeder zweite Berliner.<br />
Schlesische Spuren an der Spree«; es<br />
wurde im Frühjahr im Roten Rathaus in<br />
Berlin vorgestellt, und im Laufe des Jahres<br />
konnte die Autorin wiederholt Stadtrallyes<br />
für Schüler durch Berlin anbieten,<br />
so dass sich dem Kulturforum ein neues<br />
Programmformat erschloss.<br />
6
Für eine zentrale Fragestellung konnte einer der besten Kenner<br />
schlesischer Geschichte gewonnen werden: Norbert Conrads<br />
widmete sich dem Verhältnis des schlesischen Adels zu<br />
Friedrich II., dessen Loyalitätsdilemma und der sich allmählich<br />
vollziehenden Orientierung auf den preußischen König. Einige<br />
der geplanten Angebote zum Jahresschwerpunkt konnten<br />
aus Kosten- und Kapazitätsgründen nicht realisiert werden.<br />
Dennoch war es möglich, die oft etwas idealisierende, teils<br />
gar heroisierende Sicht auf Friedrich II. durch differenzierte,<br />
manchmal auch kritische Blicke aus der östlichen Perspektive<br />
zu ergänzen und dadurch abzurunden.<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im Breslauer Rathaus.<br />
(Stich von Friedrich Bernhard Werner )<br />
xxxxxxxxxxxxxx<br />
7
Georg Dehio-Buchpreis <strong>2012</strong><br />
Das Kulturforum vergibt seit 2003 jeden Herbst in jährlichem<br />
Wechsel den vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur<br />
und Medien ausgelobten Georg Dehio-Kulturpreis sowie<br />
den Georg Dehio-Buchpreis. Der Georg Dehio-Buchpreis wird<br />
Autoren verliehen, die Themen der gemeinsamen Kultur und<br />
Geschichte der Deutschen und ihrer östlichen Nachbarn in<br />
ihrem literarischen, wissenschaftlichen oder publizistischen<br />
Werk aufgreifen, auf hohem Niveau reflektieren und breiten<br />
Kreisen anschaulich vermitteln. Der Georg Dehio-Buchpreis<br />
ist aufgeteilt in einen Hauptpreis und einen Ehrenpreis.<br />
Der Hauptpreis würdigt ein publizistisches bzw. literarisches<br />
Gesamt- und Lebenswerk. Mit dem Ehrenpreis werden Verfasser<br />
einer herausragenden Publikation sowie Übersetzer<br />
ausgezeichnet.<br />
Die siebenköpfige Jury tagte am 18. April <strong>2012</strong> unter dem Vorsitz<br />
von Manfred Sapper (Chefredakteur der Zeitschrift osteuropa)<br />
und sprach den Hauptpreis dem in den USA lebenden<br />
Autor und Germanisten Peter Demetz zu.<br />
Peter Demetz wurde 1922 in Prag geboren und wuchs in<br />
einer katholisch-jüdischen Familie auf. Während der deutschen<br />
Besatzung wurde er von der Gestapo verhaftet und musste<br />
Zwangsarbeit leisten. 1949 ging er in den Westen, zunächst<br />
nach München, 1953 wanderte er in die USA aus, wo er bis zu<br />
seiner Emeritierung an der Yale-Universität in New Haven als<br />
Professor für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft<br />
wirkte. Seine Dissertation zu Franz Kafka und sein Buch<br />
René Rilkes Prager Jahre (1953) waren nur der Auftakt zu einer<br />
ganzen Reihe von vielbeachteten Arbeiten zur Germanistik.<br />
Neben seiner akademischen Tätigkeit war Peter Demetz auch<br />
immer als kritischer Beobachter der zeitgenössischen deutschsprachigen<br />
Literatur präsent, u. a. lange Jahre als Mitglied<br />
der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises. Vor allem in den<br />
vergangenen zwei Jahrzehnten setzte er sich in zahlreichen<br />
Publikationen und Essays mit der gemeinsamen deutschtschechisch-jüdischen<br />
Kultur und Geschichte seiner Heimat<br />
Böhmen auseinander. Die Bücher Böhmische Sonne, mährischer<br />
Mond. Essays und Erinnerungen (1996), Prag in Schwarz<br />
und Gold (1998) und Mein Prag. Erinnerungen (2007) wurden<br />
in englischer, deutscher und tschechischer Sprache veröffentlicht<br />
und fanden große Beachtung.<br />
Mit dem Ehrenpreis wurde die tschechische Autorin Radka<br />
Denemarková und die Übersetzerin Eva Profousová für das<br />
Buch Ein herrlicher Flecken Erde ausgezeichnet. Radka Demenarková,<br />
1968 in Kutná Hora (dt. Kuttenberg) geboren, studierte<br />
Germanistik und Bohemistik an der Karls-Universität in<br />
Prag, wo sie 1997 promovierte. Sie arbeitet als freie Schriftstellerin<br />
und Journalistin sowie als Übersetzerin aus dem Deutschen.<br />
Ein herrlicher Flecken Erde, ihr dritter Roman, wurde<br />
2007 mit dem renommierten tschechischen Buchpreis »Magnesia<br />
Litera« in der Kategorie »Prosa« ausgezeichnet. In der<br />
Kategorie »Publizistik« erhielt sie den »Magnesia Litera« im<br />
Jahr 2009 für ihr Buch Smrt, nebudeš se báti aneb příběh petra<br />
lébla (»Tod, Du wirst Dich nicht fürchten, oder Die Geschichte<br />
des Petr Lébl«) sowie im Jahr 2011 in der Kategorie »Übersetzung«<br />
für ihre tschechische Übertragung des Buches Atemschaukel<br />
der Nobelpreisträgerin Herta Müller.<br />
8
Die gebürtige Pragerin und überzeugte<br />
Hamburgerin Eva Profousová<br />
ist seit 2002 als freie Literaturübersetzerin<br />
und Publizistin tätig. Sie hat sich<br />
vor allem mit Übertragungen aktueller<br />
tschechischer Autoren einen Namen<br />
gemacht. 2010 erhielt Sie für ihre Übersetzung<br />
von Jáchym Topols Roman Die<br />
Teufelswerkstatt den Förderpreis der<br />
Hansestadt Hamburg für Literarische<br />
Übersetzung.<br />
Die Preisverleihung geschah in festlichem<br />
Rahmen am 29. November <strong>2012</strong><br />
im gut besuchten Atrium der Deutschen<br />
Bank in Berlin. Die Laudatio auf den<br />
Hauptpreisträger Peter Demetz hielt<br />
der Berliner Germanist und Mitherausheber<br />
der »Tschechischen Bibliothek«<br />
Hans Dieter Zimmermann, der Historiker<br />
und Buchautor Andreas Kossert<br />
hielt die Preisrede auf Radka Denemarková<br />
und Eva Profousová. Die Urkunden<br />
überreichte die Stellvertreterin des<br />
Kulturstaatsministers, Frau Dr. Ingeborg<br />
Berggreen-Merkel.<br />
Zusätzlich zur festlichen Preisverleihung<br />
hatte das interessierte Publikum<br />
Gelegenheit, die Georg-Dehio-Preisträger<br />
und ihre Werke in zwei besonderen<br />
literarischen Abendveranstaltungen<br />
zu erleben. Im Veranstaltungssaal der<br />
Tschechischen Botschaft befragte am<br />
30. November Peter Becher, Geschäftsführer<br />
des Adalbert-Stifter-Vereins, Peter<br />
Demetz über sein bewegtes Leben zwischen<br />
Prag und New Jersey. Anschließend<br />
las Demetz aus seinem Prag-Buch<br />
sowie aus seinen Übertragungen von<br />
Gedichten des tschechischen Dichters<br />
Jiří Orten.<br />
Das Literaturhaus Berlin war schließlich<br />
der passende Ort für eine Lesung,<br />
in der Radka Denemarková gemeinsam<br />
mit der Übersetzerin Eva Profousová<br />
am 4. Dezember den preisgekrönten<br />
Roman Ein herrlicher Flecken Erde vorstellten.<br />
Im Gespräch mit Ernest Wichner,<br />
dem Leiter des Literaturhauses, der<br />
auch Mitglied der Jury des Georg Dehio-<br />
Buchpreises ist, erfuhren die aufmerksamen<br />
Zuhörer viel Interessantes über<br />
die Arbeitsweise der Autorin und der<br />
Übersetzerin.<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände<br />
1741 im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich<br />
Bernhard Werner )<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände<br />
1741 im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich<br />
Bernhard Werner )<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände<br />
1741 im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich<br />
Bernhard Werner )<br />
9
Maribor/Marburg an der Drau<br />
Europas Kulturhauptstadt <strong>2012</strong><br />
Zahlreiche derjenigen Städte, die sich jeweils ein Jahr lang mit<br />
dem Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt schmücken<br />
dürfen, sind einer breiten Öffentlichkeit nur wenig bekannt.<br />
Von diesen Städten liegen wiederum viele nicht nur im Arbeitsgebiet<br />
des Kulturforums, sondern waren in der Vergangenheit<br />
auch häufig Zentren deutschsprachigen Lebens. So auch<br />
Maribor/Marburg an der Drau in Slowenien, wo bis 1918 aufgrund<br />
der Zugehörigkeit zum Habsburgerreich mehrheitlich<br />
deutsch gesprochen wurde. Die Slowenisierung des Stadtnamens<br />
fällt in Zeit des Völkerfrühlings in der Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
und orientierte sich spiegelbildlich an der Eindeutschung<br />
der slawischen Bezeichnung Brandenburgs, Branibor<br />
– so wurde aus Marburg Maribor.<br />
Andere historische und vor allem kunsthistorische Besonderheiten<br />
lassen sich entdecken mit dem Reiseführer Maribor/<br />
Marburg an der Drau. Ein kunstgeschichtlicher Rundgang von<br />
Marjeta Ciglenečki, den das Kulturforum gemeinsam mit dem<br />
Verlag Schnell und Steiner anlässlich des Kulturhauptstadtjahres<br />
<strong>2012</strong> herausgegeben hat. Die Publikation ist Teil eines<br />
Programms, das das Kulturforum seit 2007 für die in seinem<br />
Interessenbereich liegenden Kulturhauptstädte organisiert,<br />
um ein größeres Publikum darauf aufmerksam zu machen:<br />
Im Vorfeld des jeweiligen Kulturhauptstadtjahrs gibt es eine<br />
mehrtägige Exkursion für Journalisten, die sich jedes Mal in<br />
ausführlichen Pressebeiträgen niederschlägt. Auf der Frankfurter<br />
Buchmesse wird die jeweilige Kulturhauptstadt im Weltempfang<br />
in Halle 5 im Jahr zuvor präsentiert und ein vom<br />
Kulturforum gestalteter Kalender begleitet durch das Kulturhauptstadtjahr.<br />
Und schließlich sorgt ein Stadtschreiber, der<br />
Stadtschloss von Marburg/Maribor mit Loretto-Kapelle und Floriani-Statue<br />
(© H. Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa)<br />
für ein paar Monate in das Treiben der jeweiligen Kulturhauptstadt<br />
eintaucht und seine Eindrücke in einem Blog dokumentiert,<br />
für eine ganz persönliche Information des Publikums. Im<br />
Fall von Maribor wurde für dieses Stipendium der Journalist<br />
und Publizist Fredy Gareis ausgewählt, der fünf Monate lang<br />
10
aus Maribor berichtete – unter anderem<br />
über die landschaftliche Schönheit,<br />
verschiedene Gaumenfreuden,<br />
die Bewohner und nachwirkende vergangene<br />
sowie aktuelle Begebenheiten.<br />
Ein vielfältiges, reichhaltiges Bild<br />
der Kulturhauptstädte kann zudem<br />
über die Thementage des Kulturforums<br />
vermittelt werden. So gab es zu<br />
Maribor eine mehrteilige Veranstaltung<br />
mit Musik, Kurzvorträgen, Bildern und<br />
einer Gesprächsrunde. Hier erfuhr das<br />
in großer Zahl erschienene Publikum<br />
staunend, dass in Maribor die älteste<br />
Weinrebe der Welt rankt – sie wurde<br />
gegen Ende des 16. Jahrhunderts an<br />
der Vorderfront des Hauses Nr. 8 auf<br />
dem Vojašniški trg gepflanzt; die jährliche<br />
Weinlese, die bis zu dreißig Liter<br />
Wein bringt, ist ein großes Fest. Außerdem<br />
wurde es mit dem Konzept des Kulturhauptstadtbüros<br />
bekannt gemacht,<br />
das als Motto den Titel »Wendepunkt/<br />
Zravrtimo skupaj« trägt. Der Stadtschreiber<br />
Fredy Gareis konnte sich während<br />
seines Aufenthalts in Maribor diesem<br />
Motto kaum entziehen: »Nach und<br />
nach merkte ich, dieser Wendepunkt,<br />
der die Stadt von einem ehemaligen<br />
Industriezentrum in etwas anderes verwandeln<br />
soll, er ist nicht der einzige in<br />
der Geschichte. Ganz im Gegenteil:<br />
alleine im 20. Jahrhundert hat sie dreimal<br />
ihre Identität gewechselt. Dazu<br />
muss man ja nur mal auf die Straßennamen<br />
schauen, wie Drago Jančar in seinem<br />
Buch ‚Nordlicht‘ schreibt: Aus der<br />
Goethestraße wird die Prešerenstraßen,<br />
dann löste ihn Goethe wieder ab, am<br />
Ende siegte aber doch der slowenische<br />
Dichter. So erging es den meisten<br />
Straßen und Plätzen in dieser Stadt, die<br />
immer wieder aus ihrer Identität gerissen<br />
wurde, durch das Zusammenbrechen<br />
von Reichen, durch Besatzungen,<br />
durch Befreiungen, durch das Platzen<br />
von großen Ideen und das kindstotplötzliche<br />
Sterben der Industrie. Ein<br />
Übermaß an Geschichte sozusagen.«<br />
In der mit dem Verlag Schnell und<br />
Steiner gemeinsam ins Leben gerufenen<br />
Reihe »Große Kunstführer in der<br />
Potsdamer Bibliothek östliches Europa«<br />
sind bisher kunsthistorische Stadtspaziergänge<br />
durch die Europäischen<br />
Kulturhauptstädte Sibiu/Hermannstadt<br />
(2007, Rumänien), Pécs/Fünfkirchen<br />
(2010, Ungarn), Tallinn/Reval (2011,<br />
Stadtschloss von Marburg/Maribor mit Loretto-<br />
Kapelle und Floriani-Statue (© H. Roth, Deutsches<br />
Kulturforum östliches Europa)<br />
Estland) und Maribor/Marburg (<strong>2012</strong>,<br />
Slowenien) erschienen. Zur Leipziger<br />
Buchmesse 2013 wird die Reihe um<br />
die ostslowakische Metropole Košice/<br />
Kaschau ergänzt.<br />
11
Deutsche Minderheiten und regionale Identitäten<br />
im östlichen Europa<br />
Kooperationspartnertagung in Groß Stein/Kamień Śląski bei Oppeln/Opole<br />
Mit der Kooperationspartnertagung wollte das Kulturforum<br />
Vertreter deutschsprachiger Minderheitenorganisationen aus<br />
möglichst vielen Ländern des östlichen Europa versammeln,<br />
um sich über die Arbeit auszutauschen, gemeinsame Anliegen<br />
zu eruieren und über Perspektiven für künftige Vorhaben<br />
zu sprechen.<br />
Tagungsort war mit Groß Stein in der Nähe des berühmten<br />
Annaberges ein Ort, der in Oberschlesien liegt und somit<br />
in einer für die nationale Zugehörigkeit besonderen Region.<br />
Viele Schlesier fühlen sich weder eindeutig polnisch noch<br />
deutsch, die Anerkennung einer schlesischen Nationalität<br />
scheiterte aber bisher. Seit der Wende dürfen sich nationale<br />
Minderheiten in Polen wieder organisieren, so auch die Deutschen.<br />
Sie haben bereits in zahlreichen Gemeinden Oberschlesiens<br />
Deutsch als Hilfssprache bei den Behörden sowie zweisprachige<br />
Ortsschilder durchgesetzt. Schwerpunkt der Arbeit<br />
der deutschen Minderheit ist die Einführung eines bilingualen<br />
Erziehungssystems, Zweisprachigkeit, so Rafał Bartek,<br />
Leiter des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit<br />
in Gliwice/Gleiwitz, soll zur Normalität werden. In dieser Hinsicht<br />
ist bei der deutschen Minderheit in Ungarn schon Vieles<br />
selbstverständlicher, wie Dr. Gábor Frank aus Fünfkirchen<br />
(Pécs) erläuterte – so werden beispielsweise Geografie- und<br />
Geschichtsunterricht für die deutsche Minderheit in deutscher<br />
Sprache abgehalten.<br />
Diese beiden Kurzvorträge zur Situation der deutschen<br />
Minderheit in Polen bzw. Ungarn fanden innerhalb der vier<br />
Sektionen statt, innerhalb derer sich die Vertreter der Minderheiten<br />
unter verschiedenen thematischen Gesichtspunkten<br />
austauschten – in der ersten Sektion ging es um Bildung, Sprache,<br />
Jugend; in der zweiten um Politik, Verbände, Minderheiten;<br />
in der dritten um Medien und in der vierten um Kultur,<br />
Kunst, Wissenschaften, Literatur.<br />
In der Medien-Sektion präsentierten sich vor allem die<br />
Rumäniendeutschen mit einem vielfältigen Programm an<br />
deutschen Zeitungen und Verlagen, die in deutscher Sprache<br />
veröffentlichen. Nicht zuletzt dem engagierten Eintreten<br />
der Chefredakteurin Beatrice Ungar ist es zu verdanken, dass<br />
die Hermannstädter Zeitung auch heute noch in deutscher<br />
Sprache berichtet, und der Verlag Hora präsentiert sich mit<br />
einer deutschsprachigen Homepage und Büchern zu siebenbürgisch-sächsischen<br />
Persönlichkeiten, zu Kunstdenkmälern<br />
und zu anderen touristischen Attraktionen. Auch die Banater<br />
Berglanddeutschen im Südwesten Rumäniens, so ihr Vorsitzender<br />
Ernst Josef Ţigla, können mit der Deutschen Vortragsreihe<br />
Reschitza, die <strong>2012</strong> ihr 25-jähriges Jubliäum feiert, eine<br />
Erfolgsgeschichte vorweisen, die sich vornehmlich aus der<br />
Bewahrung der Sprache und des Brauchtums speist.<br />
Zur Situation der deutschen Minderheit in Odessa sprach<br />
die Leiterin des Kultur- und Begegnungszentrums des Bayerischen<br />
Hauses, Professor Natalja Köhn. Einerseits kümmert sich<br />
das Bayerische Haus um die Pflege deutscher Kultur und Sprache<br />
im Schwarzmeergebiet, andererseits spielt für die aktive<br />
Pflege deutschsprachiger Traditionen die gerade fertig renovierte,<br />
riesige lutherische Kirche, Sitz der deutschen Minderheit,<br />
eine wichtige Rolle. An beiden Institutionen bestehen<br />
Chöre, von denen auch Frau Köhn einige leitet.<br />
12
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im Breslauer Rathaus.(Stich<br />
von Friedrich Bernhard Werner )<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im Breslauer Rathaus.(Stich<br />
von Friedrich Bernhard Werner )<br />
In der letzten Sektion präsentierte Sirje Kivimäe aus Tallinn<br />
das deutsche Erbe in Estland anhand der Geschichte ihrer<br />
Gutshäuser und stellte ihre ehemaligen Besitzer vor. Die meisten<br />
dieser Gutshäuser stammen aus der zweiten Hälfte des<br />
18. Jahrhunderts und aus dem 19. Jahrhundert, als Estland zum<br />
Russischen Reich gehörte. Die heutige Nutzung der Gutshäuser<br />
fällt sehr unterschiedlich aus, manche werden als Hotels<br />
oder Kulturzentren genutzt, einige sind zur Besichtigung freigegeben<br />
wie das Herrenhaus in Palmse. Dieses bekannteste<br />
Landgut Estlands wurde schon Ende des 13. Jahrhunderts<br />
erwähnt, doch erst die Adelsfamilie von der Pahlen besaß es<br />
über einen längeren Zeitraum.<br />
Ganz deutlich fasste am Abend Dr. Koloman Brenner, Vorsitzender<br />
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten<br />
in der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen, die<br />
Bedürfnisse der deutschsprachigen Minderheiten zusammen:<br />
Es gehe nicht darum, mit finanziellen Zuwendungen bedacht<br />
zu werden – die könnten zwar auch helfen, seien aber zweitrangig.<br />
Viel wichtiger für die erfolgreiche Arbeit sei vielmehr<br />
politisch hochrangige Unterstützung aus Deutschland, vor<br />
allem in Form von überall gehörten Worten; sie könnten echte<br />
Türöffner sein.<br />
Winfried Smaczny, Vorstandsvorsitzender des Kulturforums,<br />
betonte zum Abschluss der regen zwei Tage, dass die Minderheiten<br />
überall auf der Welt wahre Schutzengel seien, die sich<br />
für Vielfalt, Toleranz und politische Partizipation engagierten.<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im Breslauer<br />
Rathaus.(Stich von Friedrich Bernhard Werner )<br />
13
Ausstellung/Wystawa<br />
Innovation und Tradition. Hinrich Brunsberg und die spätgotische<br />
Backsteinarchitektur in Pommern und der Mark Brandenburg<br />
Innowacja i tradycja – Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura<br />
ceglana na Pomorzu i w Marchii Brandenburskiej<br />
Hinrich Brunsberg (um 1350 bis nach<br />
1428) ist einer der bedeutendsten spätgotischen<br />
Baumeister und als solcher<br />
einer der wenigen namentlich bekannten<br />
im Bereich der Backsteingotik im<br />
südlichen Ostseeraum. Der Ausgangspunkt,<br />
eine bestimmte Architekturgestaltung<br />
mit seinem Namen zu verbinden,<br />
ist die Bauinschrift an der<br />
Katharinenkirche in Brandenburg an der<br />
Havel. An prominenter Stelle, dem Portal<br />
der Nordkapelle, dem ehemaligen<br />
Haupteingang der Kirche, angebracht,<br />
weist sie darauf hin, dass der Meister<br />
Hinrich Brunsberg aus Stettin die Kirche<br />
im Jahr 1401 errichtet habe. Gebäude<br />
mit gleich hoher bautechnischer Qualität,<br />
innovativem Aufbau sowie mit ähnlichem<br />
reichem Bauschmuck entstanden<br />
Ende des 14. und Anfang des 15.<br />
Jahrhundert in Pommern und der Mark<br />
Brandenburg. Es liegt nahe, sie mit der<br />
Katharinenkirche in Brandenburg und<br />
ihrem Baumeister in Zusammenhang<br />
zu bringen.<br />
Das älteste dieser Bauwerke, die<br />
den für Brunsberg so typischen Dekor,<br />
bestehend aus aufwendigen Formsteinprofilen,<br />
feingliedrigen Maßwerkfüllungen<br />
und Ziergiebeln aus gebranntem<br />
Ton, aufweist, ist der um 1398 fertig<br />
gestellte Chor der Marienkirche im Stargard/Stargard<br />
Szczeciņski. Etwa zur gleichen<br />
Zeit wie die Marienkirche wurde<br />
mit dem Bau der Jakobikirche im – mit<br />
Stargard nicht nur auf wirtschaftlicher<br />
Ebene rivalisierenden – Stettin/Szczecin<br />
begonnen. Der Grundriss mit nach<br />
innen gezogenen Strebepfeilern, zwischen<br />
denen sich Kapellen unter einem<br />
emporenartigen Umgang befinden, ist<br />
ähnlich wie der der Stargarder Marienkirche,<br />
ebenso die Schmuckformen der<br />
Wandvorlagen an der Außenseite der<br />
Strebepfeiler im Untergeschoss des südlichen<br />
Seitenschiffes. Auch die Fassaden<br />
der Kirche St. Peter und Paul in Stettin<br />
sowie des Rathauses der Stadt weisen<br />
diese aufwendige Zierarchitektur auf.<br />
Bauwerke mit vergleichbarer Gestaltung<br />
wie die Marienkirche in Stargard<br />
finden sich außerdem in Königsberg in<br />
der Neumark/Chojna, in Prenzlau, Gartz<br />
und Tangermünde. Neben Kirchen sind<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741<br />
im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich Bernhard<br />
Werner )<br />
es Rathäuser und Toranlagen der Stadtbefestigung,<br />
die in diesem repräsentativen<br />
und reichen Stil errichtet wurden.<br />
Die Bauwerke orientieren sich an<br />
der höfisch-französischen Architektur<br />
und der Gestaltung in Haustein. Sie<br />
gehören zur Blütephase der Spätgotik<br />
in der Region. Mit ihrem aufwendigen<br />
Schmuck unterscheiden sie sich von<br />
den gleichzeitig errichteten schlichten<br />
14
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im Breslauer Rathaus.(Stich<br />
von Friedrich Bernhard Werner )<br />
Bauwerken in den Hansestädten im südlichen Ostseeraum,<br />
die einem anderen Gestaltungsprinzip folgen.<br />
Die genannten Bauwerke entstanden zum Teil parallel. So<br />
wurde in Königsberg mit dem Bau der Marienkirche begonnen<br />
noch bevor die Arbeiten an der Stargarder Marienkirche<br />
abgeschlossen waren. Aber nicht nur Hinrich Brunsberg war<br />
in leitender Position an der Errichtung dieser verschiedenen<br />
Bauwerke beteiligt. Die Bauinschrift an dem 1411 fertig gestellten<br />
Mühlentorturm in Brandenburg nennt den ebenfalls aus<br />
Stettin stammenden Nikolaus Craft als Baumeister. Der mit<br />
der Nordkapelle an der Marienkirche in Prenzlau im Zusammenhang<br />
stehende Claus Brunsberg war sicherlich mit Hinrich<br />
Brunsberg verwandt. Über Hinrich Brunsberg selbst ist<br />
wenig bekannt. Aufgrund seines Namens wird vermutet, dass<br />
er oder zumindest seine Familie aus Braunsberg/Braniewo<br />
in Ostpreußen stammte. Über seine Tätigkeit als Baumeister<br />
weiß man nur aufgrund der Inschrift an der Brandenburger<br />
Katharinenkirche. Nur die beiden in Brandenburg an der<br />
Havel entstandenen Gebäude tragen Inschriften, die auf den<br />
jeweiligen Erbauer verweisen. Vermutlich waren die aus Stettin<br />
stammenden Baumeister in Pommern und in den näher<br />
daran angrenzenden Gebieten bekannt.<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im Breslauer Rathaus.(Stich<br />
von Friedrich Bernhard Werner )<br />
Mit der Foto-Ausstellung Innovation und Tradition – Hinrich<br />
Brunsberg und die spätgotische Backsteinarchitektur<br />
in Pommern und der Mark Brandenburg / Innowacja i tradycja<br />
– Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana<br />
na Pomorzu i w Marchii Brandenburskiej will das Deutsche<br />
Kulturforum östliches Europa an Hand der Gebäude, die mit<br />
dem Namen Hinrich Brunsberg verbundene Architektur mit<br />
ihren charakteristischen Schmuckelementen vorstellen. Außerdem<br />
will sie demonstrieren, dass die Mark Brandenburg und<br />
Pommern um 1400 einem einheitlichen Kulturraum angehörten.<br />
Für die Realisierung konnten der Bauhistoriker Dirk Schumann<br />
und der Berliner Fotograf Thomas Voßbeck gewonnen<br />
werden. Die zweisprachige Ausstellung entstand in Kooperation<br />
mit dem Nationalmuseum Stettin / Muzeum Narodowe w<br />
Szczecinie und der Erzdiözese Stettin-Cammin / Archidiecezją<br />
Szczecińsko-Kamieńską und wird in Zusammenarbeit mit dem<br />
Pommerschen Landesmuseum in Greifswald in verschiedenen<br />
Orten in Deutschland und Polen gezeigt.<br />
Bisher war die Ausstellung in Brandenburg an der Havel und<br />
Tangermünde zu sehen. Zurzeit befindet sie sich im Stadtgeschichtlichen<br />
Museum in Stettin. In diesem Jahr wird sie u.a.<br />
15
Neuerscheinung im Verlag des<br />
Deutschen Kulturforums östliches Europa<br />
Präsentation des Kulturreiseführers Streifzüge zwischen Oder und Drage.<br />
Begegnungen mit der Neumark im Juli <strong>2012</strong><br />
Der Verlag des Kulturforums veröffentlicht in seiner Potsdamer<br />
Bibliothek östliches Europa Kulturreiseführer, Monografien,<br />
Text- und Bildbände, Ausstellungskataloge, literarische<br />
Reiseführer sowie Lesebücher und Musik vergessener Schriftsteller<br />
und Komponisten aus dem östlichen Europa bzw. wenig<br />
beachteter Schaffensperioden dieser Künstler. In diesem Jahr<br />
konnte der Reihe Kulturreisen ein bedeutender Band hinzugefügt<br />
werden – neben den Burgen, Schlössern, Herrenhäusern<br />
und Parks im Hirschberger Tal sowie den Kirchenburgen und<br />
Städten im südlichen Siebenbürgen kann man jetzt die Neumark<br />
mit ihren idyllischen Bruchlandschaften der Warthe und<br />
Netze erkunden. Streifzüge zwischen Oder und Drage. Begegnungen<br />
mit der Neumark – dieses Buch ist »nicht weniger als<br />
eine kulturhistorische Bestandsaufnahme der gesamten Neumark,<br />
dieser Region, die sowohl in Deutschland als auch in<br />
Polen fast in Vergessenheit geriet« (Das Polen Magazin).<br />
Die historische Landschaft der Neumark, im Mittelalter als<br />
Terra Transoderana bezeichnet, ist im 21. Jahrhundert weitgehend<br />
eine Terra Incognita. Die Kulturgeschichte dieser Region<br />
zwischen Brandenburg, Pommern, Großpolen und Schlesien,<br />
die bis 1945 zu Deutschland gehörte, ist dort großenteils in<br />
Vergessenheit geraten, während sie in Polen oft unbekannt<br />
blieb. Das vielgestaltige Gebiet birgt reiche Spuren der älteren<br />
und der jüngsten Vergangenheit Deutschlands und Polens:<br />
Städte, Marktflecken und Dörfer, Paläste und Parks, Kirchen<br />
und Klöster. Einige Objekte sind in ihrem ursprünglichen, häufig<br />
mittelalterlichen Erscheinungsbild erhalten, andere stehen<br />
nur noch als Ruine. Neben Einzelbeschreibungen gehen vier<br />
Themenkapitel auf für die gesamte Region bedeutsame Entwicklungen<br />
ein: die Bautätigkeit und Alltagskultur verschiedener<br />
Orden, die Sakralarchitektur des Mittelalters, die Entstehung<br />
der Städte sowie der Schlösser und Herrenhäuser.<br />
Eine historische Einführung gibt einen Einblick in das Werden<br />
dieser Landschaft.<br />
Kurzbiografien werfen ein Licht auf Persönlichkeiten, die<br />
ihre Geburts- oder Wirkungsstätte in der Neumark hatten: Victor<br />
Klemperer und Christa Wolf stammten aus Landsberg an<br />
der Warthe, an das sich die berühmte Schriftstellerin in ihrem<br />
Roman Kindheitsmuster erinnerte, Friedrich II. trug dazu bei,<br />
Warthe- und Netzebruch trockenzulegen, um besiedelbares<br />
Land zu schaffen, Karl Friedrich Schinkel schuf Kirchenbauten<br />
16
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741 im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich Bernhard<br />
Werner )<br />
– und, nicht zuletzt, Lars von Trier drehte<br />
hier Szenen für seinen Film Europa.<br />
Herausgeber und Autor Paweł Rutkowski<br />
ist Historiker und studierte in<br />
Thorn/Toruń und Potsdam. Er kuratierte<br />
mehrere Ausstellungen, u. a. »Die Neumark.<br />
Begegnung mit einer historischen<br />
Landschaft« 2005–07. Ein Jahr später war<br />
er als Koordinator der archäologischen<br />
Grabungen im neumärkischen Quartschen/Chwarszczany<br />
tätig. Er leitet die<br />
deutsch-polnische Agentur, die zahlreiche<br />
deutsch-polnische Kulturprojekte<br />
organisiert. Mitautor Zbigniew Czarnuch<br />
ist Regionalhistoriker in Witnica/<br />
Vietz in der Neumark, wo er mit den Hinterlassenschaften<br />
vor allem auch der<br />
deutschsprachigen Kultur einen »Park<br />
der Wegweiser« geschaffen hat.<br />
»Den hohen Gebrauchswert des Buches<br />
macht auch der reichhaltig bestückte<br />
Anhang aus, zu dem ein umfangreiches<br />
Glossar genauso gehört, wie Kurzbiografien,<br />
ein Personenverzeichnis, ein<br />
Ortsverzeichnis mit Konkordanz und<br />
ein Literaturverzeichnis. Für viele Polenreisende<br />
ist die Neumark eine Landschaft,<br />
die man einfach nur so schnell<br />
wie möglich durchquert auf der Fahrt<br />
zum Urlaubsziel an der Ostsee, in Masuren,<br />
Warschau oder Schlesien. Das Blättern<br />
in Rutkowskis Kulturführer aber<br />
macht Lust mal einen Stop einzulegen.<br />
Ob es eines der Schlösser ist oder eine<br />
der typisch pommerschen Kleinstädte,<br />
die Neumark ist eine Entdeckung wert.<br />
Wie wäre es beispielsweise, das Landsberg<br />
an der Warthe (Gorzow Wielkopolski)<br />
einmal auf den Spuren von Christa<br />
Wolf zu erkunden? Auch dabei hilft<br />
dieser empfehlenswerte, keine Fragen<br />
offen lassende Kulturreiseführer, der<br />
eine kleine, aber feine Perle auf dem<br />
Büchermarkt ist.«<br />
Das Polen Magazin<br />
17
Usedomer Literaturtage <strong>2012</strong><br />
Wortreiche Landschaften zwischen der Ostsee und den Karpaten<br />
Die Usedomer Literaturtage <strong>2012</strong> widmeten sich vom 28. März<br />
bis zum 1. April den wortreichen Landschaften zwischen<br />
der Ostsee und den Karpaten. In Lesungen und Gesprächen<br />
blätterten namhafte Schriftsteller, Publizisten und Filmemacher<br />
die multikulturelle und multinationale Geschichte Rumäniens<br />
auf und begaben sich auf deutsche Spurensuche in den<br />
Regionen Siebenbürgen, Banat und der Bukowina sowie nach<br />
Niederschlesien, Kasachstan, in den Nordkaukasus und in die<br />
ehemalige DDR. Mit der thematischen Dichte und der inhaltlichen<br />
Qualität haben sich die Literaturtage auf der deutschpolnischen<br />
Insel zu einem wichtigen Podium für den europäischen<br />
Austausch entwickelt. Jedes Jahr versammeln sich<br />
die prägendsten Literaten und Kenner mit diesem Schwerpunkt<br />
auf Usedom.<br />
Wie in den vergangenen Jahren stieß das Programm der<br />
Literaturtage auch <strong>2012</strong> auf reges Interesse und versammelte<br />
zahlreiche Literaturbegeisterte in sehr gut besuchten Sälen.<br />
Eröffnet wurden die Usedomer Literaturtage am 28. März<br />
mit dem Dokumentarfilm »Die Wahrheit über Dracula« von<br />
Stanisław Mucha, der mit eindringlichen Bildern und einer<br />
großen Portion Ironie und Humor ein Portrait des heutigen<br />
Rumänien zeichnete. Skurriles traf hierbei auf Nachdenkliches,<br />
was in den Köpfen der Zuschauer für langen Nachhall sorgte.<br />
Im Anschluss an den Film diskutierten Tanja Dückers, Ilma<br />
Rakusa, Ernest Wichner und Stanisław Mucha über den<br />
Landstrich, der einst von Deutschen geprägt wurde, die dort<br />
heute jedoch kaum noch anzutreffen sind.<br />
Die Polin Joanna Bator und die rußlanddeutsche Autorin<br />
Eleonora Hummel berichteten am nächsten Tag im polnischen<br />
Swinemünde/Świnoujście über die komplizierte<br />
Geschichte ihrer Heimatregionen und über die von ihnen<br />
erlebte Zeit des Sozialismus. In der deutsch-polnischen Veranstaltung<br />
standen zwei Familienromane im Mittelpunkt, die<br />
aus der Perspektive der Frau von Ängsten, Problemen und<br />
Träumen in einem repressiven System erzählen.<br />
Mit dem Buch »Rote Handschuhe« von Eginald Schlattner<br />
und der dazugehörigen bildgewaltigen Verfilmung von Radu<br />
Gabrea bewegte die Veranstaltung im restlos ausverkauften<br />
Saal des Hotel Palace in Zinnowitz. Thematisiert wurden die<br />
unmenschlichen Verhältnisse im stalinistischen Rumänien<br />
anhand der autobiografischen Geschichte des Siebenbürger<br />
Pfarrers Eginald Schlattner. Das anschließende Gespräch<br />
beleuchtete die Situation in den 50er Jahren, als die rumänische<br />
Staatsmacht mit diktatorischen Werkzeugen Menschen,<br />
darunter viele Rumäniendeutsche, unterdrückte und zerstörte.<br />
Einer der geistreichsten Köpfe des Klaviers und der Poesie,<br />
der 1931 bei Olmütz geborene Alfred Brendel, war am 31. März<br />
zu erleben. Er sprach über sein Leben sowie über das Komische<br />
in den Werken von Haydn, Mozart und Beethoven. Dabei<br />
spürte er pianistisch und wortgewandt mit seinen spitzfindigen<br />
Gedichten das Komische in der klassischen Musik auf.<br />
Unter dem Titel »Mit deutschem Migrationshintergrund auf<br />
dem Balkan« widmeten sich die Schriftsteller Jan Koneffke<br />
(Deutschland) und Filip Florian (Rumänien) den deutschen<br />
Auswanderern in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zu verschiedenen<br />
Zeiten der Geschichte. Besucht wurde die Lesung<br />
18
von der Gesandten der Rumänischen<br />
Botschaft in Berlin Adriana Stanescu.<br />
In einer weiteren Veranstaltung<br />
stellte Arne Franke sein Buch »Das<br />
wehrhafte Sachsenland« über die Kirchenburgen<br />
in Siebenbürgen vor. Während<br />
einer szenischen Lesung konnte<br />
man Oskar Ansull auf seiner literarischen<br />
Reise nach Czernowitz folgen.<br />
Ergänzt wurde das Programm durch<br />
die Literarische Inselrundfahrt und eine<br />
Schülerlesung mit Sarah Jana Portner<br />
und Paulina Schulz. Großes Interesse<br />
fand die Ausstellung »In Tallinn leben –<br />
Geschichten von Menschen und Häusern«<br />
von Sarah Jana Portner. Zu entdecken<br />
waren Fotos und Geschichten<br />
aus der estnischen Hauptstadt, die die<br />
junge Schriftstellerin und Journalistin<br />
als Stadtschreiberin Reval/Tallinn 2011<br />
aufgenommen hat.<br />
Die Usedomer Literaturtage sind<br />
mit der Verleihung des Usedomer Literaturpreises<br />
am 1. April <strong>2012</strong> zu Ende<br />
gegangen. In einer feierlichen Veranstaltung<br />
überreichte die Preisträgerin<br />
2011, Radka Denemarková, die Auszeichnung<br />
an die polnische Autorin<br />
Olga Tokarczuk. Die 1962 geborene<br />
Autorin gilt als eine der bekanntesten<br />
und bedeutendsten polnischen Schriftstellerinnen.<br />
Die Laudatio hat Marta<br />
Kijowska gehalten, die als Übersetzerin<br />
und Journalistin mit besonderem<br />
Schwerpunkt auf polnischer Literatur<br />
und Geschichte in München arbeitet.<br />
Die Jury schrieb in der Begründung:<br />
»Olga Tokarczuk erhält den Usedomer<br />
Literaturpreis für ihr bisheriges literarisches<br />
Schaffen sowie für die literarische<br />
und intellektuelle Manifestierung der<br />
Region Niederschlesien in der europäischen<br />
Geschichtserfahrung und in der<br />
polnischen Sprache. Ihre mutigen, bisweilen<br />
radikalen Inhalte kleidet sie in<br />
klare, ruhige Worte und erschafft eine<br />
geheimnisvolle Poesie.« Ihre Werke sind<br />
mehrfach ausgezeichnet und wurden in<br />
23 Sprachen übersetzt.<br />
Die Usedomer Literaturtage sind<br />
eine gemeinsame Veranstaltungsreihe<br />
des Usedomer Musikfestivals in<br />
Zusammenarbeit mit dem Deutschen<br />
Kulturforum östliches Europa sowie der<br />
Gemeinde Ostseebad Heringsdorf. Wie<br />
in den letzten drei Jahren übernahm<br />
der Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Erwin Sellering,<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741<br />
im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich Bernhard<br />
Werner )<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741<br />
im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich Bernhard<br />
Werner )<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741<br />
im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich Bernhard<br />
Werner )<br />
19
Das Stadion in Słubice<br />
Lokale Sportgeschichte und Erstellung von Audio-Podcasts<br />
Anlässlich der Fußball-EM in Polen und der Ukraine im Juni<br />
<strong>2012</strong> fand an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)<br />
auf Initiative des Deutschen Kulturforums östliches Europa<br />
Potsdam ein Seminar statt, das sich der lokalen, deutsch-polnischen<br />
Geschichte aus einer sporthistorischen Perspektive<br />
widmete und dabei das Stadion in Słubice – das frühere Ostmarkstadion<br />
von Frankfurt (Oder) – in den Fokus nahm. Als<br />
Dozenten wurden die beiden Studierenden Dorothee Ahlers<br />
und Jakob Venuß gewonnen, die bereits bei einem früheren<br />
Projekt des Kulturforums mitgewirkt hatten.<br />
Die beiden Dozenten hatten sich für die Aufbereitung des<br />
Stoffes eine einleuchtende und abwechslungsreiche Struktur<br />
überlegt: Am ersten Wochenende des Blockseminars präsentierten<br />
Dorothee Ahlers und Jakob Venuß den geschichtlichen<br />
Kontext des Stadionbaus chronologisch in mehreren<br />
bebilderten Kurzvorträgen – Beginn der Turnbewegung, Stadionbau,<br />
Sport in der Nazizeit. Nach jeder Informationseinheit<br />
zur jeweiligen Periode wurde Quellenmaterial ausgeteilt, das<br />
sich auf Frankfurt und seine Dammvorstadt (heute Slubice)<br />
bezog, die Teilnehmer erhielten Fragen zu den Quellen und<br />
erarbeiteten sich so das zuvor Gehörte für den konkreten Ort.<br />
Während des zweiten Wochenendes des Blockseminars<br />
erfolgte der praktische Teil: Zunächst erkundete die Gruppe<br />
unter der Leitung eines deutschen und eines polnischen Regionalhistorikers<br />
– Eckhard Reiß und Roland Semik – das Stadion<br />
selbst, das heute am Rande des großen Basars auf der polnischen<br />
Seite, in Slubice, liegt. Oberhalb des Stadions befindet<br />
sich noch immer die Wiese, die Turnvater Jahn hier ursprünglich<br />
für die Übungen benutzt hatte. Im Wald liegen außerdem<br />
die Reste eines Türmchens, die zum Kleistturm gehörten, der<br />
auf einem Bergrücken hinter dem Stadion zu Ehren des Dichters<br />
und Schlachtteilnehmers im Siebenjährigen Krieg (1756–<br />
1763), Ewald Christian von Kleist, errichtet wurde. Deutsche Soldaten<br />
sprengten ihn 1945 bei ihrer Flucht vor der Roten Armee,<br />
um den Russen einen geeigneten Peilungspunkt zu nehmen.<br />
Ziel des Seminars war neben der theoretischen Beschäftigung<br />
und der Besichtigung des Ortes auch eine praktische<br />
Verarbeitung der gelernten Inhalte in Form von Audiobeiträgen.<br />
Unter der Anleitung der DozentInnen Dorothee Ahlers<br />
und Jacob Venuß sind fünf Beiträge von Max Hege, Jan Körting,<br />
Fabian Sader, Paula Voigt sowie Ariane Afsari entstanden,<br />
die sich unterschiedlichen Themen der Stadiongeschichte<br />
widmen.<br />
Paula Voigt versuchte durch Interviews in Słubice herauszufinden,<br />
was heutige Bewohner und Besucher vom Stadion wissen,<br />
und forschte darüber hinaus in der Rezeptionsgeschichte<br />
zum Stadion. Ariane Afsari begann noch vor den Anfängen des<br />
Stadions, nämlich bei dem kleinen Turnplatz oberhalb des Stadions,<br />
der bis heute nicht überwuchert ist und den Friedrich-<br />
Ludwig-Jahn im Jahr 1813 einrichtete. Nach ihm war auch die<br />
Straße benannt, an der das Stadion liegt. Fabian Sader beschäftigt<br />
sich in seinem Beitrag mit den Anfängen des Stadions im<br />
Ersten Weltkrieg, als russische Kriegsgefangene aus dem nahe<br />
gelegenen Kriegsgefangenenlager Gronenfelde die mühevollen<br />
Erdarbeiten für das zukünftige Stadion verrichteten – was<br />
ist von ihnen geblieben? Jan Körting zeigt aus der Perspektive<br />
eines zufälligen Entdeckers des Słubicer Stadions, wie viele<br />
Geschichten sich auftun, wenn man sich mit der Historie des<br />
20
Ortes beschäftigt, das im deutschen Ostbrandenburg , in der<br />
Frankfurter Dammvorstadt, eröffnet wurde und das seit dem<br />
Zweiten Weltkrieg jenseits der Oder im polnischen Słubice<br />
liegt. Max Hege wollte wissen, was es mit der irreführenden<br />
und falschen Bezeichnung »Olympiastadion« auf sich hat(te),<br />
unter dem das Stadion lange Zeit firmierte und unter dem es<br />
auch heute noch in großen Teilen der Bevölkerung bekannt<br />
ist. Die Beiträge können auf der Homepage des Kulturforums<br />
heruntergeladen werden.<br />
Fotos: Stadion vs-Kopie, BU: Max Hege, Jakob Venuß und Jan<br />
Körting im Stadion von Slubice, im Hintergrund die Tribüne.<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände 1741<br />
im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich Bernhard<br />
Werner )<br />
Huldigung der niederschlesischen<br />
Stände 1741 im Breslauer Rathaus.(Stich<br />
von Friedrich Bernhard Werner )<br />
Huldigung der niederschlesischen Stände<br />
1741 im Breslauer Rathaus.(Stich von Friedrich<br />
Bernhard Werner )<br />
21
Kalender <strong>2012</strong><br />
Thementage<br />
Maribor/Marburg an der Drau. Europas Kulturhauptstadt <strong>2012</strong>: Berlin<br />
(Februar)<br />
Halbzeitkonferenz. Fußball als Spiegel ethnischer und regionaler Identitätssuche<br />
in MittelOsteuropa: Berlin (Juni)<br />
Der Himmel über Danzig. Johannes Hevelius - Nachtleben und Nachleben<br />
eines Astronomen: Berlin (August)<br />
Donaudelta und Dobrudscha. Heimat vieler Völker: Berlin (Oktober)<br />
München (November)<br />
Deutsche Minderheiten und regionale Identitäten im östlichen<br />
Europa: Kooperationspartnertagung, Groß Stein/Kamien Śląski<br />
(November)<br />
Buchvorstellungen, Buchmessen<br />
HinterNational – Johannes Urzidil: Wien, Linz, Salzburg (Januar), Heppenheim<br />
(April), Berlin (Juni)<br />
Maribor/Marburg an der Drau: München (März), Bad Kissingen (Mai),<br />
Ulm (Mai)<br />
Buchmesse Leipzig: Deutschsprachige Siedler in Slowenien, Danziger<br />
Identitäten, Eginald Schlattner: Mein Nachbar, der König (März)<br />
Jeder zweite Berliner. Schlesische Spuren an der Spree: Berlin (April),<br />
Görlitz (November), Königswinter-Heisterbacherott (November), Berlin<br />
(November, Dezember)<br />
Spurensuche in der Gottschee. Deutschsprachige Siedler in Slowenien:<br />
Regensburg (April)<br />
Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer: Belgorod<br />
Dnjestrowski (Mai), München (Juni), Minneapolis/North Dakota (Juli),<br />
Stuttgart (September), Czernowitz (September)<br />
Wędrówki między Odrą a Dragą. Spotkanie z Nową Marchią: Landsberg<br />
a.d.Warthe/Gorzów Wlkp. (Mai), Grünberg/Zielona Góra (Oktober)<br />
Streifzüge zwischen Oder und Drage. Begegnungen mit der Neumark:<br />
Caputh (Juli), Fürstenwalde (September), Słubice (Oktober),<br />
Potsdam (November)<br />
Buchmesse Frankfurt: mit Podiumsgespräch Košice/Kaschau Interface<br />
2013 (Oktober)<br />
Theodor Lepner: Der Preusche Littau (1690): Vorstellung der zweisprachen<br />
Edition, Berlin (November)<br />
Lesungen, Filmreihen<br />
Fanny Lewald. Eine emanzipierte Schriftstellerin aus Königsberg:<br />
Lesungen mit Einführung und Kommentar, Weimar, Stuttgart,<br />
Düsseldorf (Januar)<br />
Wortreiche Landschaften. Zwischen Ostsee und Karpaten. Vierte Usedomer<br />
Literaturtage: Podiumsdiskussionen, (Schul-)Lesungen, Buchpräsentation,<br />
Gespräch, Musik, Film, Ausstellung (März)<br />
Anziehung und Distanz. Deutsche im tschechischen Film: Filmreihe,<br />
Freiburg (Mai)<br />
Stadtschreiber Maribor <strong>2012</strong>: Einführung des Stadtschreibers, Marburg<br />
a.d. Drau/Maribor (Juni)<br />
Wer kennt noch Gerhart Hauptmann? Ein west-östlicher Klassiker wird<br />
150: Podiumsdiskussion und Film in der Reihe »Forum Neuer Markt,<br />
Potsdam: Feste feiern und Geschichte vergessen« (September)<br />
Vorträge<br />
Wieder entdeckt: Martin Opitz: Vorträge und Konzert, Görlitz (Februar)<br />
Friedrich II. von Preußen als Erinnerungsort im deutschen und polnischen<br />
Bewusstsein: Potsdam (März)<br />
Friedrichs neue Untertanen in der Neumark. Die Kolonisierung des<br />
Oder- und Warthebruchs: Potsdam (Mai)<br />
Die Wiederentdeckung des Kulturerbes der Neumark nach 1945: Potsdam<br />
(Mai)<br />
Die mittelalterlichen Orden und ihr Beitrag zur Entwicklung der Neumark:<br />
Potsdam (Juni)<br />
Warum blieb Königsberg seinem König nicht treu?: Potsdam (September)<br />
Zwischen Österreich und Preußen. Friedrich II. und der schlesische<br />
Adel: Potsdam (Oktober)<br />
Zum Gedenken an Hugo Rokyta (1912–1999): München (Oktober)<br />
Böhmische Dörfer an Havel, Spree und Oder: Potsdam (Oktober)<br />
Struktur und Architektur. Das postindustrielle Kulturerbe Oberschlesiens:<br />
Multimediapräsentation, Potsdam (November)<br />
Ostpreußische Städte im Ersten Weltkrieg. Wiederaufbau und Neuerfindung:<br />
Berlin (Dezember)<br />
Workshops<br />
Spurensuche. Multinationale Heimatkunde in Odessa: Workshop für<br />
Studierende, Odessa (März), Stuttgart (August)<br />
Zeichen der Teilung. Das Erbe der Architekturmoderne in Oberschlesien<br />
heute: Exkursion für Studierende, Kattowitz/Katowice, Hindenburg/Zabrze<br />
(Mai)<br />
Das Stadion in Słubice. Lokale Sportgeschichte und Erstellung von<br />
Audiopodcasts: Workshops für Studierende, Frankfurt/O., Słubice (Juni)<br />
Suche schlesische Spuren in Deiner Stadt: Schülerstadtrallyes, Berlin<br />
(Juni), (August)<br />
Kulturhauptstadt Europas 2013 Kaschau/Košice: Informationsfahrt für<br />
Medienvertreter, Kaschau/Košice (September)<br />
22
Henry van de Velde in Polen: Studienfahrt mit der Bauhaus-Universität<br />
Weimar, Trebschen/Trzebiechów (Oktober)<br />
Konzerte<br />
Von Wien nach St. Petersburg. Violinsonaten von Haydn, Mozart und<br />
Titz: Hannover (Mai)<br />
»Die Nacht, die will verbergen sich« - geistliche und weltliche Lieder<br />
aus der Glogauer Handschrift: Konzerte, Berlin-Kreuzberg, Brandenburg<br />
(September)<br />
Wie das Quartett nach Russland kam. Hoffmeister-Quartett: Usedomer<br />
Musikfestival (Oktober)<br />
Georg Dehio-Buchpreis <strong>2012</strong><br />
Preisverleihung und Begleitveranstaltung mit Peter Demetz, Berlin<br />
(November)<br />
Begleitveranstaltung mit Radka Denemarková und Eva Profousová,<br />
Berlin (Dezember)<br />
Wanderausstellungen<br />
Schloss Friedrichstein in Ostpreußen und die Grafen von Dönhoff: Düsseldorf<br />
(Januar-März)<br />
Struktur und Architektur. Das postindustrielle Kulturerbe Oberschlesiens:<br />
Stettin (Januar-März), Waldenburg/Walbrzych (April-Juni), Oppeln/<br />
Opole (Juni-August), Buchwald/Bukowiec (September-Dezember),<br />
Potsdam (November-Januar 2013)<br />
Zeit-Reisen. Historische Ansichten aus der Graphiksammlung Haselbach:<br />
Hirschberg/Jelenia Góra (Januar-Juni), Reutlingen (September-Oktober)<br />
Brückenschläge – Daniel Jablonski im Europa der Frühaufklärung:<br />
horn/Toruń (poln., Februar), Oldenburg (dt., April-Mai), Breslau/Wrocław<br />
(poln., Mai-Juli), Emden (dt., Juni-Juli), Memel/Klaipeda<br />
(dt., August-September), Vilnius (dt., Oktober), Halle/S. (dt., November-Februar<br />
2013)<br />
In Tallinn leben – Geschichten von Menschen und Häusern: Heringsdorf<br />
(März-Mai), Passau (November)<br />
Die Neumark. Begegnungen mit einer historischen Landschaft: Potsdam,<br />
Caputh (Mai-Juli), Frankfurt/Oder (September-Oktober), Berlin<br />
(November-Februar 2013)<br />
Siebenbürgen - eine Wissenschaftslandschaft: Dinkelsbühl, Gundelsheim<br />
(Mai-Juni), Heidelberg, Gundelsheim (September), Bad<br />
Kissingen (September-November), Schäßburg/Sighişoara (November),<br />
Kronstadt/Braşov (November-Dezember), Hermannstadt/Sibiu<br />
(Dezember-Januar 2013)<br />
Zoppot, Cranz, Rigaer Strand. Ostseebäder im 19. und 20. Jahrhundert:<br />
Kiel (Juni), Ellingen (Juli-Dezember)<br />
Adel in Schlesien: Potsdam (August-Oktober)<br />
Hinrich Brunsberg und die Backsteingotik in Pommern und Brandenburg:<br />
Brandenburg (September-Oktober), Tangermünde (November-<br />
Januar 2013)<br />
Neuerscheinungen<br />
Arne Franke, Hermannstadt/Sibiu. Ein kunstgeschichtlicher Rundgang<br />
durch die Stadt am Zibin. Illustrierter Stadtführer, in Kooperation mit<br />
Schnell und Steiner in der Reihe Große Kunstführer in der Potsdamer<br />
Bibliothek östliches Europa, 2., korr. Aufl., 48 S., geb., € 9,95 (Januar)<br />
Marjeta Ciglenečki, Maribor/Marburg an der Drau. Ein kunstgeschichtlicher<br />
Rundgang. Illustrierter Stadtführer, in Kooperation mit Schnell<br />
und Steiner in der Reihe Große Kunstführer in der Potsdamer Bibliothek<br />
östliches Europa, 48 S., geb., € 9,95 (Januar)<br />
Paweł Rutkowski (red.), Wędrówki między Odrą a Drawą. Spotkanie z<br />
Nową Marchią. Die polnischsprachige Publikation informiert über die<br />
Geschichte der Neumark, einer historischen Landschaft, die in Polen<br />
und in Deutschland in Vergessenheit geraten ist. Schlösser, Herrenhäuser,<br />
Kirchen, Klosteranlagen – die architektonischen Zeugnisse<br />
der Vergangenheit – werden in diesem Kulturreiseführer beschrieben<br />
und auf historischen Abbildungen und zeitgenössischen Fotografien<br />
gezeigt. Mit hist. Einf. u. vier Themenkapiteln dt. u. pl. Fachleute, zahlr.<br />
farb. u. S.-W.-Abb., Kurzbiografien, Glossar, Karten u. umfangr. Registern,<br />
219 S., geb., € 19,80 (Januar)<br />
Roswitha Schieb, Jeder zweite Berliner. Schlesische Spuren an der<br />
Spree. Auf drei großen Spaziergängen durch die architektonische,<br />
künstlerische und literarische Stadtlandschaft zeigt das reich bebilderte<br />
und mit Karten versehene Buch typisch schlesische Phänomene<br />
der Industrie-, Theater-, Kunst- und Gesellschafts-geschichte Berlins.<br />
Die Thematik dieser Einzelpublikation ist bisher in dieser Form noch nie<br />
auf dem deutschen Buchmarkt präsentiert worden. Mit zahlr. farb. u. S.-<br />
W.-Abb., Kurzbiografien, Verzeichnis Berliner Straßen mit schlesischem<br />
Bezug und Registern, 388 S., geb. m. Lesebändchen, € 19,80 (April)<br />
Paweł Rutkowski (Hg.), Streifzüge zwischen Oder und Drage. Begegnungen<br />
mit der Neumark. Die Übersetzung der polnischsprachigen<br />
Publikation (s. o.) ins Deutsche enthält neben allen Inhalten der Urfassung<br />
elf weitere Objekttexte und wurde an ein deutsches Lesepublikum<br />
angepasst. Mit hist. Einf. u. vier Themenkapiteln dt. u. pl. Fachleute,<br />
zahlr. farb. u. S.-W.-Abb., Kurzbiografien, Glossar, Karten und umfangr.<br />
Registern, 256 S., geb. m. Lesebändchen, € 19,80 (Juli)<br />
Ute Schmidt, Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen<br />
Meer Buch über die gut 125-jährige Vergangenheit (1814–1940) der<br />
deutschen Kolonien an der nordwestlichen Schwarzmeerküste, 2.,<br />
aktual., erw. u. korr. Aufl., mit zahlr. farb. u. S.-W.-Abb., Zeittafel, Ortsnamenkonkordanz<br />
u. Einsteckkarte, 420 S., geb., € 19,80 (September)<br />
23
Team des Kulturforums:<br />
(Stand: 1. Januar 2013)<br />
Saskia Aberle, Assistenz Direktion, Veranstaltungsorganisation<br />
Ariane Afsari, Verlag, Fachreferat Kulturelle Bildung<br />
Susanna Becker, Assistenz Verlag, Elektronische Medien<br />
Dr. Klaus Harer, Fachreferat Musik, Länderreferat Osteuropa<br />
Frauke Kraft, Verwaltungsleiterin<br />
Tanja Krombach, Leitung Verlag, Länderreferat Tschechien und Slowakei<br />
Dr. Harald Roth, Fachreferat Geschichte, Länderreferat Südosteuropa, ab April <strong>2012</strong> kommissarischer Direktor<br />
Thomas Schulz, Fachreferat Literatur, Länderreferat Polen<br />
Hana Kathrin Stockhausen, Grafik, Design<br />
Dr. Claudia Tutsch, Fachreferat Kunstgeschichte, Länderreferat Baltikum<br />
Ilona Wäsch, Sachbearbeiterin Verwaltung, Buchhaltung<br />
André Werner, Redaktionsleitung Website<br />
Vorstand (Stand: 1. Januar 2013)<br />
MinDgt. i.R. Winfried Smaczny, Berlin, Vorstandsvorsitzender<br />
Dr. Elisabeth Fendl, München<br />
MinDir. Hans-Heinrich von Knobloch, Berlin<br />
Kuratorium:<br />
Sabine Deres, Ministerialrätin beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (Vorsitz)<br />
Dr. Markus Bauer, Vertreter der Mitgliederversammlung im Kuratorium<br />
Magdalena Erdman, Vertreterin der Botschaft der Republik Polen<br />
Prof. Oliver Günther, Ph.D., Präsident der Universität Potsdam<br />
Dr. Uwe Koch, Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg<br />
Martin Sarvaš, Direktor des Slowakischen Instituts Berlin<br />
Prof. Dr. Matthias Weber, Direktor des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa<br />
24
Impressum<br />
Herausgeber: Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V.<br />
Berliner Straße 135, Haus K1<br />
D–14467 Potsdam<br />
www.kulturforum.info<br />
deutsches@kulturforum.info<br />
© 2013. Alle Rechte vorbehalten.<br />
Diese Publikation wurde gefördert vom Beauft ragten der Bundesregierung für Kultur<br />
und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.<br />
Redaktion: xxxxxxe<br />
V. i. S. d. P.: Dr. Harald Roth<br />
Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die Meinung der Autorin/des Autors<br />
wieder, nicht die Meinung der Redaktion oder des Herausgebers.<br />
Abbildungen und Bildrechte: xxxxxx<br />
Gestaltung und Satz: Hana Kathrin Stockhausen<br />
Druck und Bindung: Flyeralarm Würzburg<br />
25
Deutsches Kulturforum östliches Europa<br />
Berliner Straße 135 · 14467 Potsdam<br />
Tel. +49(0)331/20098-0<br />
Fax +49(0)331/20098-50<br />
deutsches@kulturforum.info<br />
www.kulturforum.info<br />
26<br />
Das Kulturforum wird gefördert vom Beauftragten<br />
der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund<br />
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.