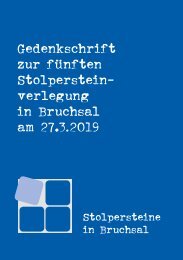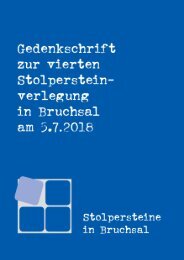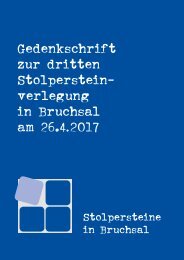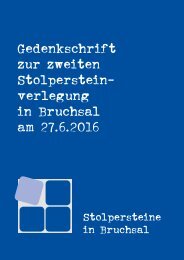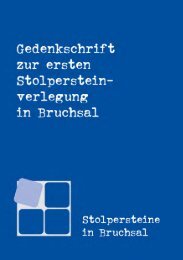Gedenkschrift zur siebenten Stolpersteinverlegung in Bruchsal am 8. Juni 2021
In dieser Gedenkschrift sind Opferbiographien der folgenden Bruchsaler Familien enthalten: Schloßberger, Katz, Straus, Baer, Hahn, Tuteur und Kann.
In dieser Gedenkschrift sind Opferbiographien der folgenden Bruchsaler Familien enthalten: Schloßberger, Katz, Straus, Baer, Hahn, Tuteur und Kann.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ausbrach.“ Am folgenden Tag erhielt Elisabeth Kann daraufhin durch den Metzgermeister
im Keller Schläge ins Gesicht, „bis ich zusammenbrach. Währenddessen stand seine Frau
mit gespreizten Füßen am Kellerausgang und wollte mich nicht herauslassen.“ Für mehrere
Tage war Elisabeth Kann bettlägerig und in der Folge gallenkrank, was eine Operation
und einen vierwöchigen Aufenthalt im Bruchsaler Krankenhaus nach sich zog. Zeitlebens
hatte Elisabeth Kann von diesem Überfall enorme Einschränkungen der Sehfähigkeit des
linken Auges. Siegbert Kann hatte am Tag nach seiner Rückkehr Anzeige gegen den Metzgermeister
erstattet. Beim Gerichtsverfahren sagte der junge Gerichtsassessor, sie müsse
die Klage zurückziehen, „andernfalls bestellten sie 100 SS- und SA-Männer.“
Auf Anraten ihres Arztes Dr. Mai
zog die Familie im folgenden Jahr,
1937, in die Bismarckstraße 3, in
das Haus des Fabrikanten Julius
Weil. Da Siegbert Kann inzwischen
arbeitslos geworden war, wurden
zwei der fünf Zimmer an jüdische
Mitbürger vermietet, zum Beispiel
die Lehrerin der Judenklasse. Durch
Flick- und Näharbeiten und andere
Hausarbeiten konnte Elisabeth
Elisabeth Kann (re.) mit Tochter Gisela. Foto: M. Carrancejie.
Kann viel zur Ernährung ihrer Familie
beitragen. Da eine Auswanderung
nicht so schnell möglich war, flüchtete ihr Mann im Juli 1939 nach Brüssel, und sie
folgte mit den Kindern nach. In Brüssel fanden sie eine möblierte, aber feuchte Wohnung.
Da Siegbert und Elisabeth Kann als illegale Einwanderer keine Arbeitserlaubnis erhielten,
schlugen sie sich mit Gelegenheitsarbeiten durch und überlebten mit Unterstützung
des jüdischen Hilfskomitees und Päckchen von Elisabeths Verwandten aus Deutschland.
Nach der plötzlichen Verhaftung ihres Mannes und einer eintägigen Internierung von
sich und den Kindern flüchtete Elisabeth mit den drei Kleinen für sechs Wochen quer
durch Nordfrankreich. Schließlich mussten sie nach Brüssel zurückkehren. Als Putz- und
Waschfrau verdiente sie den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder. Auf dem deutschen
Konsulat fand sie schließlich unerwartet Hilfe vor drohenden Deportationen in den Osten:
Man stellte ihr illegal einen Pass ohne „J“ aus und organisierte ihre Rückkehr nach
Deutschland. Am 30. November 1941 konnte sie daher mit dem Zug in ihren Heimatort
Diedesheim zurückkehren und wurde von ihrem Vater und ihren Geschwistern aufgenommen.
„Abgemagert und krank wie ich war, schlugen Bekannte vor Schreck die Hände
zusammen, als sie mich wieder sahen.“ Im August 1942 wurde ihr ein kleines Häuschen
in Diedesheim vermietet, in das sie zusammen mit ihren Kindern und ihrem Vater gegen
den Widerstand der politischen Leiter einzog. Da sie keine Lebensmittelmarken bekamen,
musste Elisabeth bis Kriegsende hart auf Bauernhöfen und in einer Konservenfabrik
arbeiten. Am Kriegsende, aber auch immer wieder im Laufe der Jahre seit 1936, war
49