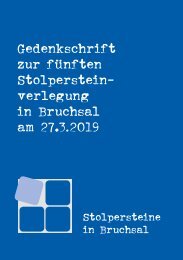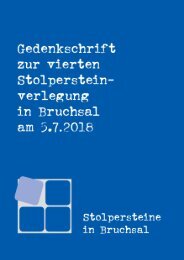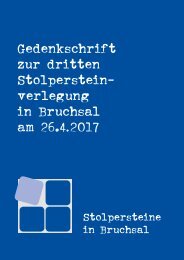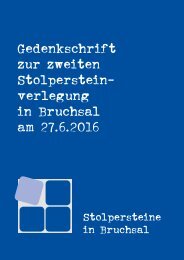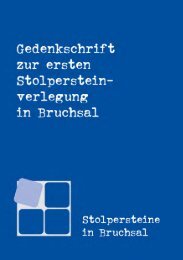Gedenkschrift zur siebenten Stolpersteinverlegung in Bruchsal am 8. Juni 2021
In dieser Gedenkschrift sind Opferbiographien der folgenden Bruchsaler Familien enthalten: Schloßberger, Katz, Straus, Baer, Hahn, Tuteur und Kann.
In dieser Gedenkschrift sind Opferbiographien der folgenden Bruchsaler Familien enthalten: Schloßberger, Katz, Straus, Baer, Hahn, Tuteur und Kann.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gedenkschrift
zur siebenten
Stolpersteinverlegung
in Bruchsal
am 8.6.2021
Stolpersteine
in Bruchsal
Inhaltsverzeichnis
1 Grußwort der Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick
2 Einführung in das Schülerprojekt Florian Jung
Die Opferbiographien
3 Mathilde Schloßberger geb. Neter (1868-1943) Florian Jung
5 Max Schloßberger (1890-1940) Collin Anielack, 9s
8 Hilde Schloßberger (1894-1976) Sophie Dannenmaier, 9v
10 Übersicht Familie Schloßberger Florian Jung
12 Hugo Katz (1872-1940) Florian Jung
14 Friedolina Katz geb. Reiß (1860-1943) Annika Wormer, Alicia Degen, 9t
16 Ernst Katz (1884-1943) Annika Wormer, Chanuvi Chandrapalan, 9t
18 Übersicht Familie Katz Florian Jung
21 Johanna Straus geb. Weil (1874-1948) Tafreed Ahmad, Luca Hauth, 9s
25 Kakteen namens Straus Florian Jung
27 Übersicht Familie Straus Florian Jung
32 Alfred Baer (1864-1940) und Malte Willmann, 9v, Jonas de Bortoli, 9s
Rosa Baer geb. Schönmann (1869-1941)
36 Leo Hahn (1896-1971) und Florian Jung
Anny Hahn geb. Baer (1904-1987)
39 Eric Hahn (* 1933) Florian Jung
41 Ida Tuteur geb. Bär (1874-1967) Sean Urban, Josip Kujundzic, 9v
44 Übersicht Familie Bär/Baer Florian Jung
47 Siegbert Kann (1903-1942) Aaron Kammerer, 10u
48 Elisabeth Kann geb. Rau (1903-1985) Florian Jung
50 Werner Kann (1929-2017) Theo Fraißl, Noah Wagner, 10v
51 Gisela Kann (1932-2009) Theo Fraißl, Noah Wagner, 10v
53 Eleonore Kann (1934-2010) Theo Fraißl, Noah Wagner, 10v
54 Übersicht Familie Kann Florian Jung
Anhang
55 Rückblick auf die fünfte Bruchsaler Florian Jung
Stolpersteinverlegung am 27.3.2019
56 Rückblick auf die sechste Bruchsaler Florian Jung
Stolpersteinverlegung am 11.2.2020
Die Druckkosten dieser Broschüre wurden dankenswerterweise von der BürgerStiftung Bruchsal übernommen.
Grußwort
der Oberbürgermeisterin
Als am 8. Juni 2021 zum mittlerweile siebten
Mal in Bruchsal Stolpersteine verlegt wurden,
war vieles anders als in den vorigen Jahren.
Nach Monaten des Lockdowns war diese Veranstaltung
eine der ersten, die dank gewisser
Lockerungen in den vorangegangenen Wochen
mit einem größeren Publikum hat durchgeführt
werden können. Dennoch musste der Kreis
der Eingeladenen auf einen engeren Rahmen
begrenzt bleiben, und erstmals erschien die begleitende
Gedenkschrift nicht zum Verlegungstermin
selbst. Denn Archive waren nicht zugänglich,
was die entsprechenden Forschungen
erschwert hat. Und da die Schrift ausgearbeitet
wurde von einer Projektgruppe aus Schülern
der 8. Klasse unter Leitung von Florian Jung,
Lehrer am Justus-Knecht-Gymnasium, verzögerten
auch Schulschließungen und Homeschooling
die Fertigstellung.
Diese Veränderung gegenüber früheren Stolperstein-Verlegungen bietet aber nun zugleich
Gelegenheit, die Veranstaltung dieses Jahres rückblickend zu betrachten und
einmal mehr zu erkennen, welche große Bedeutung diese Aktion und der Tag der
Verlegung vor allem für die Familien der Betroffenen besitzt – als ein Beitrag zur Aussöhnung
mit der Geburtsstadt ihrer Vorfahren. In den Grußworten, die am 8. Juni von
anwesenden Nachfahren und Verwandten der NS-Opfer gesprochen wurden, kam
dies in sehr deutlicher Weise zum Ausdruck. Gleichzeitig fällt die Verlegung 2021 in
eine Zeit, in der jüdisches Leben und jüdische Kultur in Deutschland gegenwärtig
wieder stark gefährdet sind. So durfte die Aktion zugleich auch als ein Zeichen der
Solidarität, als ein Signal gegen Antisemitismus und Rassismus verstanden werden.
Ich danke allen, die durch ihre Anwesenheit bei der Stolperstein-Verlegung am
8. Juni 2021 in diesem Sinne ein solches Zeichen gesetzt haben.
Cornelia Petzold-Schick
1
Einführung in das Schülerprojekt
von Florian Jung, OStR am Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal
Eigentlich waren die Schüler der 8. Klassen gerade dabei, in Kleingruppen ins Karlsruher
Generallandesarchiv zu fahren, um in den Wiedergutmachungsakten über die
Biografien der ehemaligen jüdischen Mitbürger zu recherchieren. Eigentlich war die
Kontaktaufnahme zu Nachkommen, immer wieder vorbereitet durch Rolf Schmitt, in
vollem Gange. Man hoffte, ähnlich der Stolpersteinverlegung 2019, wieder viele Angehörige
nach Bruchsal einladen zu können: Im März 2019 war es gelungen, insgesamt
35 Angehörige der Familien Lindauer, Westheimer, Majerowitz und Bravmann
in Bruchsal zu begrüßen. Sie waren angereist aus Israel, Kanada, den USA, den Niederlanden,
Ungarn, aus der Schweiz und aus verschiedenen Regionen Deutschlands.
Doch aufgrund der Corona-Pandemie schlossen die Archive. Gunter Demnig konnte
seine Reisen zu den Verlegungsorten nicht durchführen. Ein Treffen mit der Schülergruppe
war bis zum Schuljahresende aufgrund der Kontaktbeschränkungen verboten.
Eine Veranstaltung mit hundert oder mehr Besuchern war undenkbar. Die für den
7. Juli 2020 geplante Stolpersteinverlegung in Bruchsal musste verschoben werden.
Für die Schülergruppe war es daher umso wichtiger, dass sie die Verlegung von Stolpersteinen
in Heidelsheim und Helmsheim am 11. Februar 2020, wenige Wochen vor
Beginn des Lockdowns, miterleben konnten.
Ebenfalls herausfordernd war es für alle Beteiligten, ein Jahr später den Faden wieder
aufzunehmen und die Verlegung für den 8. Juni 2021 vorzubereiten, sodass sich die
Herausgabe der Gedenkschrift leider verzögerte. Umso mehr gilt mein großer Dank
daher Rolf Schmitt und Marlene Schlitz, die die langwierige Forschungsarbeit oft entscheidend
voranbringen. Dankbar bin ich auch Dr. Elisabeth Krimmel, Darmstadt,
und Heidemarie Leins, Bretten, für die Überlassung zahlreicher Informationen zu den
Familien Katz bzw. Lämle – und natürlich einer großen Zahl von Angehörigen der
Familien Schloßberger, Straus, Baer und Kann. Sie alle haben uns Einblick gewährt
in ihre Fotoalben und Familienunterlagen. Nur so kann diese Gedenkschrift einen
lebendigen Eindruck von unseren ehemaligen jüdischen Mitbürgern geben. Wie bedauerlich,
dass es Angehörigen, die in den USA, Israel, Australien und Südamerika
leben, auch im Juni 2021 nicht erlaubt war, nach Bruchsal zu reisen.
Angehörige und Mitglieder der Schülergruppe bei der Stolpersteinverlegung am 27. März 2019. F.: Jung.
2
Biografie von Mathilde Schloßberger geb. Neter
(1868-1943)
von Florian Jung
Mathilde Schloßberger (rechts) mit Tochter Anna und
Schwester Amalie Behr geb. Neter, 1895. Foto: Fred Strauss.
3
Mathilde Neter wurde am 23. Februar
1868 in Gernsbach geboren. Von
ihrem Vater Eli Neter (1837-1908)
wird um 1930 im Gernsbacher Tageblatt
berichtet, dass er eines der
schönsten Häuser am Gernsbacher
Marktplatz besaß: „Als Eigentum
des Eisenwarenhändlers Nether
war es lange Zeit nur das ‚Netherhaus‘.
Jener Nether zählte zu den
bekanntesten Gestalten der Stadt!
Wer denkt nicht daran, wie er an
allen katholischen Feiertagen mit
besonderer Aufmerksamkeit sein
Haus zierte und wie er einmal anlässlich
des Bischofsbesuchs folgenden
Spruch an eine Girlande heftete:
,Bin ich auch ein Israelit, so ehr‘ ich doch den Bischof mit!‘“ Mit seiner Frau Auguste
Sinauer (1843-1896) hatte er zwölf Kinder, wobei Mathilde das älteste war.
Am 19. August 1889 heiratete Mathilde Neter den am 4. April 1860 in Hollenbach bei
Bad Mergentheim geborenen Rudolf Schloßberger. Sie ließen sich in der Mitte ihrer beiden
Geburtsorte, in Bruchsal, nieder, wo Rudolf Schloßberger im Jahr 1888 die Eisenhandlung
Berg am Holzmarkt 30 gekauft hatte. Rudolf hatte eine gediegene Ausbildung
hinter sich, wie Mathilde später in seinem Lebenslauf schrieb: „Er kam mit 12 Jahren in
die Realschule nach Heilbronn, mit 15 Jahren in das Manufakturgeschäft von A. Sussmann
nach Tauberbischofsheim. Nach dreijähriger Lehrzeit und weiterer Tätigkeit in
Wertheim nahm er mit 21 Jahren eine Stellung als Reisender bei der Damenkonfektionsfirma
M. J. Meyer in Berlin an. Von 1882 bis 1888 war er im Eisengeschäfte seines
ältesten Bruders Max Schloßberger in Mergentheim tätig.“
In Bruchsal wurden dem Ehepaar drei Kinder geboren: Max im Jahr 1890, Anna 1894
und Otto 1902. Rudolf und Mathilde Schloßberger führten ihr Geschäft erfolgreich,
mehrere Angestellte wurden beschäftigt. Ein weiteres Gebäude am Holzmarkt 6, eine
Lagerhalle in der Seilersbahn 2, ein Acker und ein Weinberg konnten im Laufe der Jahre
hinzuerworben werden. Das Dienstmädchen Rosa Müller (später Veith, geb. 1897) arbeitete
bei Schlossbergers von 1922 bis 1939 und hatte ihre Kammer im Dachgeschoss.
Tochter Anna konnte bereits um 1910 eine Schule in England besuchen. Sohn Otto
machte sein Abitur 1920 am Humanistischen Gymnasium Bruchsal und studierte danach
an der Technischen Hochschule Stuttgart Elektrotechnik. Sicher traf er dort häu-
fig seine Schwester Anna, die seit 1920 in Bad Cannstatt mit dem Zigarrenfabrikanten
Ludwig Strauß verheiratet war und zwei Söhne hatte. In Bruchsal waren Rudolf und
Mathilde Schloßberger auch gesellschaftlich anerkannt: 1915 wurde Rudolf Schloßberger
zum Vorsitzenden der Israelitischen Gemeinde Bruchsals gewählt, außerdem war er
Mitglied der Israelitischen Landessynode Badens und 16 Jahre Vorstandsmitglied des
Israelitischen Waisenvereins Badens.
Nachdem Rudolf Schloßberger am 28. März 1925 nach nur fünftägigem Kranksein an
einem Hirnschlag verstarb, zeigte sich auch der Oberbürgermeister bestürzt: „Viele Jahre
hat der Heimgegangene in verschiedenen öffentlichen Ämtern, zu denen ihn das Vertrauen
seiner Mitbürger berief, und namentlich in seiner Eigenschaft als Vorsteher der
hiesigen israelitischen Gemeinde, durch unermüdliche Schaffenskraft und treue Hingabe
an die übernommenen Pflichten Ersprießliches zum Wohle der Allgemeinheit geleistet.“
Und die Bruchsaler Zeitung schrieb: „Er wird im goldenen Buch des Gedächtnisses
als Edelmensch fortdauern.“ Seine Frau Mathilde überlebte ihn 18 Jahre – und es hätten
mehr werden können, hätte man sie nicht in Theresienstadt ermordet.
Zunächst jedoch ging das Leben in geordneten Bahnen weiter. Sohn Otto spürte die
Auswirkungen vom Tod des Vaters wohl am meisten: Er musste sein Studium abbrechen,
zur Mutter zurückkehren und als Angestellter in dem nun zu 70% dem Bruder
Max gehörenden Familienbetrieb eintreten. Bis Ende 1934 liefen die Geschäfte wohl gut,
dann aber machte sich ein Umsatzeinbruch bemerkbar. Die jungen Schloßbergers sahen
keine Zukunft mehr in Bruchsal und wanderten aus: 1936 flüchtete die Tochter Anna mit
ihrer Familie in die USA, 1936 Sohn Otto und Frau Elisabeth geb. Martin über Southampton
nach Johannesburg in Südafrika. Sohn Max flüchtete 1937 mit seiner Frau Hilde
nach Luxemburg. Zu Mathilde
zog ihre jüngste Schwester,
die unverheiratete Else Neter
(1883-1941). Im März 1939
verkaufte sie alles in Bruchsal
und zog mit ihrer Schwester
nach Stuttgart in die Nähe von
Schwägerin Henriette Schloßberger
(1869-1942) – einer
wohl sehr interessanten Frau,
die ihre weiten Reisen bis in
den Orient in Reiseerinnerungen
festhielt. Es sind auch
zahlreiche Briefe Mathildes
an ihre Kinder erhalten, und
sie zeigen, dass Mathilde stark
blieb und in sich ruhte, auch
Mathilde Schloßberger (Mitte) mit Schwester Else Neter und Bruder
Dr. Eugen Neter (1876-1966), um 1935. Nach dem Kinderarzt
ist in Mannheim eine Schule benannt.Foto: Fred Strauss.
4
nach dem Tod ihres Sohnes
Max 1940. Aus dieser Zeit ist
von Otto Oppenheimer, dem
wohl bekanntesten jüdischen Mitbürger Bruchsals, ein Gedicht erhalten. Es ist, wie es
heißt, „in treuer Liebe und Verehrung“ geschrieben:
Früher war es eine Zierde, wenn an Rosch Ha-schana brav
Man zum Kübelmarkt spazierte und dort den Herrn Bravmann traf.
Immer wusste Frau Mathilde, zu erfreun das Menschenherz.
Wenn sie sprach, so klug und milde, ging die Seele himmelwärts.
Ach, die Zeiten sind vorüber, und der Kübelmarkt ist leer!
Grübeln wir nicht mehr darüber; was vorbei ist, kommt nicht mehr.
Eines aber ist geblieben. Und kann nimmermehr vergehn:
Die Verehrung unsrer lieben Frau Mathilde bleibt bestehn.
Und des guten Toten können wir gedenken auch von fern
wenn wir ihm die Ruhe gönnen, loben wir zugleich den Herrn.
Mathilde Schloßberger musste Stuttgart im September 1941 verlassen und zog zusammen
mit ihrer Schwester Else Neter nach Bad Mergentheim, der Heimat ihres Mannes Rudolf
Schloßberger. Am 22. August 1942 wurde sie nach Theresienstadt deportiert. Marie, das
ehemalige Dienstmädchen von Mathildes Schwester Frieda Strauss, schrieb dieser 1946
in die USA: „[…] aber die Frau Schloßberger war eine Frau, die es nur einmal gibt, so
etwas von Gottvertrauen ist mir nur einmal begegnet. Sie sagte damals beim Abschied
(Theresienstadt): ,Marie, das Gottvertrauen nimmt mir niemand und deshalb trage ich
es auch nicht so schwer. Was mir auferlegt wird, kann ich tragen.‘“ Sie traf bei der Verladestelle
in Stuttgart mit vier weiteren älteren Verwandten zusammen: Ihren Schwägerinnen
Henriette Schloßberger und Pauline Geschmay geb. Schloßberger sowie deren Ehemann
David Geschmay. Die vierte war Mina Lämle, die Mutter ihrer Schwiegertochter
Hilde. Diese vier starben innerhalb der ersten vier Wochen. Mathilde Schloßberger lebte
noch drei Monate länger alleine dort und starb am 1. Januar 1943 im Alter von 75 Jahren.
Biografie von Max Schloßberger (1890-1940)
von Collin Anielack, Klasse 9s
Max Schlossberger wurde am 20.06.1890 in Bruchsal geboren. Als ältestes Kind des reichen
Eisenhändlers Rudolf Schloßberger und seiner Frau Mathilde mit eigener Eisenhandlung
am Holzmarkt in Bruchsal war für ihn eigentlich ein gutes Leben zu erwarten.
Er besuchte zunächst eine höhere Schule in Bruchsal und machte dann eine Ausbildung
zum Eisenhändler bei den größten deutschen Eisenfirmen, u. a. der Firma Wolff, Netter
& Jacobi, Berlin sowie I. Netter, Mannheim (Metallwarenfabrik und Verzinkerei). 1909
bis 1910 leistete er bei der berittenen Waffe seine Militärzeit ab. Ein Freund hob später
hervor, dass der „Einjährige“ damals sein Pferd selbst kaufen und unterhalten musste
und ebenso die eigene Unterbringung samt Bekleidung selbst zahlte. Im Ersten Weltkrieg
war er von Anfang an dabei und war bis April 1917 in den Stellungen der Westfront.
Nach einer leichten und einer schweren Verwundung war er im 2. Bayerischen
Trainbataillon eingesetzt und dort 1918 als Leutnant der Reserve aktiv.
Am 5. September 1922 heiratete er die aus Bretten stammende Hilde Lämle, mit der er
5
eine geräumige und elegant eingerichtete Wohnung mit der Adresse Bahnhofsplatz 1
bezog, heute Bahnhofstraße 7. Kinder hatte das Ehepaar keine. Max Schloßberger wird
aber von Otto Oppenheimers Frau Emma 1940 in einem Brief an Max‘ Schwester Anna
als äußerst kinderlieb beschrieben: „Dass [Max‘ Tod] Euren Buben sehr nahe ging, haben
wir uns gedacht, denn keiner wie Maxel hatte es doch so verstanden mit Kindern
zu spielen und auf ihre Ideen einzugehen.“ Nach mehreren Aussagen im Rahmen des
Wiedergutmachungsverfahrens war Max Schloßberger „ein sehr wohlsituierter Mann“
und „verkehrte in den besten Kreisen“, war in Bruchsal Mitglied im Offiziersverein, im
Museumsverein, im Turnverein 1846 und im Tennisclub. Auch in der Sportabteilung des
Reichsbunds jüdischer Frontsoldaten war er aktiv. Seine Frau beschrieb ihn später als
begeisterten Sportler und guten Skiläufer.
Beruflich war Max Schloßberger der Weg vorgezeichnet: Er arbeitete sich erfolgreich
an der Seite seines Vaters Rudolf in die familieneigene Eisenhandlung ein. Nach dessen
überraschenden Tod im März 1925 übernahm er sofort die volle Verantwortung:
Es ist ein Schreiben an das Finanzamt vom September 1925 überliefert, in dem er um
Aufschub zur Abgabe diverser Unterlagen bittet, da er nach einer doppelseitigen Lungenentzündung
sofort zu einer längeren Nachkur nach Italien zu reisen gedenke. Das
Geschäft entwickelte sich in den Jahren bis 1930 augenscheinlich sehr gut, er hatte vier
bis fünf Angestellte, fünf Arbeiter, einen Kraftfahrer und zwei Reisende beschäftigt, darunter
seinen um 12 Jahre jüngeren Bruder Otto. Friedrich Firnkes, der von 1916 bis 1931
als Buchhalter bei Schloßberger mit teilweiser Handlungsvollmacht ausgestattet war und
vom Chef als „rechte Hand“ bezeichnet wurde, erinnerte sich später: „Die Fa. Schloßberger
führte Eisenwaren und Haushaltsartikel und zwar im Groß- und Einzelhandel.
Es waren ein Hauptgeschäft mit Laden und noch zwei Lagergebäude vorhanden, für die
damaligen Verhältnisse modern eingerichtet. Außerdem hatten wir einen gepachteten
Lagerplatz am Güterbahnhof. […] Ich kann mich noch erinnern, dass insbesondere in
den Jahren 1927/29 Umsätze
von jährlich ca. 1 Million
Reichsmark erzielt wurden.
In den folgenden Jahren bis
1931 waren die Umsätze etwas
rückläufig, wie damals
überall. […] Es wurde gut gerechnet
und die Preise waren
nicht gerade niedrig, dafür
waren wir aber gut sortiert.
Die durchschnittliche Reingewinnquote
lag bei etwa
5 – 6%. Das Ladengeschäft
war nicht so groß, es war sozusagen
unser Sorgenkind.
Wir hatten Aufträge angefangen
von der Industrie über
Militärentlassungsschein 1918. Foto: Heidemarie Leins.
6
öffentliche Verwaltungen, z. B. Zuchthaus Bruchsal,
Landesgefängnis Bruchsal mit eigenen Werkstätten
bis zu den Handwerksmeistern. Die Vertreter reisten
bis in die Pfalz, ihr Gebiet umfasste aber im Wesentlichen
den Kraichgau.“ Nach übereinstimmender
Aussage mehrerer Fachleute gehörte die Firma
Schloßberger zu den größten und angesehensten in
Baden. Max Schloßberger selbst galt als besonders
tüchtiger Kaufmann und Fachmann und begleitete
auch eine leitende Stellung im Süddeutschen Eisenhandelsverband
mit Sitz in Mannheim.
„Nach der Machtergreifung Hitlers ging unser
Geschäft sofort zurück, es wurde boykottiert. Das
Zuchthaus und die Behörden durften nicht mehr
geschäftlich mit uns arbeiten. Ich möchte annehmen,
dass bereits in den ersten Jahren das Geschäft
50% zurückging. Ab 1935 sah mein Mann ein, dass
Max Schloßberger. Foto: Carl Ohler.
er das Geschäft nicht mehr halten konnte; im Jahr
1936 wurde das Geschäft liqiudiert“, so Hilde Schloßberger später. Noch im Juni 1936
hatte Max Schloßberger die Hoffnung gehabt, das Geschäft zu einem annehmbaren
Preis zu veräußern, die Kaufinteressenten hatten aber durchweg zu wenig geboten. Max
Schloßberger selbst litt sicher auch unter dem Verlust seines gesellschaftlichen Ansehens,
und so wanderte er im März 1937 zusammen mit seiner Frau Hilde nach Luxemburg
aus. Der Mutter Mathilde überschrieben er und seine bereits 1936 ausgewanderten
Geschwister alle Immobilien, um den Lebensunterhalt zu sichern. In Luxemburg
versuchten Max und Hilde mühsam, sich ein neues Leben aufzubauen, was nicht recht
gelingen wollte.
Luxemburg wurde am ersten Tag des Westfeldzugs der Deutschen Wehrmacht, am
10. Mai 1940, besetzt. Max und Hilde flohen überhastet ins noch unbesetzte Frankreich.
Hilde Schloßberger schilderte ihren Verwandten am 18. Juli 1940: „Neben mir liegend
traf ihn die Kugel, nachdem wir bereits einen furchtbaren Tag hinter uns hatten. Wir
waren 40 km zu Fuß gelaufen, mit wunden Füßen, oft durch Stacheldraht; kriechend
wegen der Gefahr, und waren dann nachts ½ 3 mit Güterzug nach dem kleinen, hellen
Bahnhof verladen worden. Morgens, in der Frühe, als wir uns schon etwas in Sicherheit
wähnten, wurden wir ausgeladen. Max war am Tag der Flucht schon sehr deprimiert, die
geschäftlichen Aufregungen hatten ihn doch schon sehr mitgenommen, auch körperlich
litt er und sicher machte er sich große Sorgen, weil […] wir so wenig Existenzmittel mit
uns führten. Er ahnte es nicht, wie rasch sein Ende sein sollte.“ Max Schloßberger verstarb
am 12. Mai 1940, eineinhalb Tage nach dem Angriff der deutschen Jabos auf den
Bahnhof von Ancemont bei Verdun, an „der schauerlichen [Kopf-]Verletzung“, ohne
das Bewusstsein wiederzuerlangen. Hilde wich ihm in dieser Zeit nicht von der Seite
und es war tröstlich, dass ihr Mann würdig in einem kleinen Dorf bei Verdun nach
jüdischem Ritus beigesetzt werden konnte – „zwei Soldaten sagten Kaddisch. Wenige
7
Minuten nach dem Begräbnis wurde ich nach Verdun gebracht.“ Die Tatsache, dass der
Luftangriff der Gesamtgruppe der Flüchtenden gegolten hatte und keine individuell
„gegen den Juden“ Max Schloßberger gerichtete Tötungsmaßnahme war, diente dem
Landesamt für Wiedergutmachung in Karlsruhe 1954 beschämenderweise als Ablehnungsgrund
für jegliche Zahlung an die Witwe Hilde.
Biografie von Hilde Schloßberger geb. Lämle
(1894-1976)
von Sophie Dannenmaier, Klasse 9v
Hilda Lämle wurde als zweite von drei Töchtern des Fabrikanten Arnold Lämle (1864-
1927) und seiner Frau Mina geb. Maier (1870-1942) am 6. August 1894 in Bretten geboren
und „Hilde“ gerufen. Arnold Lämle gehörte als Mitinhaber der MALAG-Werke
(Machul Aron Lämle AG) und Sohn des Firmengründers zu den größten Arbeitgebern
der Stadt Bretten, die gusseisernen Öfen und Kachelofenarmaturen wurden lokal und
international gut verkauft. Schwester Klara (1892-1944) heiratete 1919 den Weinbrennereibesitzer
Wilhelm Brettheimer und wohnte in Stuttgart. Sie und ihre Tochter wurden
später in Riga ermordet. Die jüngere Schwester Elisabeth (1897-1976) studierte Chemie
und promovierte sogar, bevor sie den nichtjüdischen Chemiker Dr. Walter Herrmann
heiratete und in Höchst bei Frankfurt wohnte. Aufgrund dieser sogenannten „Mischehe“
wurden Elisabeth und die beiden Söhne vor einer Deportation bewahrt.
Hilde selbst hat sicher eine gute Ausbildung genossen. Warum sie von November 1915 bis
April 1916 in Karlsruhe wohnte, dann in Weinsberg und schließlich von April 1917 bis
Januar 1920 in München, wissen wir nicht. Endgültig von Bretten weg zog sie dann nach
ihrer Verheiratung mit Max Schloßberger am 5. September 1922. In Bruchsal bewohnte
das kinderlose Ehepaar eine großzügige und modern eingerichtete Wohnung in Bahnhofsnähe.
Das Einkommen
ihres Mannes
aus dessen
Eisenwarenhandlung
überstieg das eines
höheren Beamten um
mindestens das Doppelte,
sodass sich die
Schloßbergers auch
Arnold und Mina Lämle mit den Töchtern (v. l.) Klara, Elisabeth und Hilde. Foto:
Carl-Ulrich Herrmann.
8
ein Dienstmädchen
und einen PKW leisten
konnten. Von
März 1932 bis etwa
1935 wohnte Hildes
verwitwete Mutter
Hilde Schloßberger, um 1925 und um 1970. Fotos: Uta Herrmann, Fred Strauss.
9
Mina Lämle bei ihnen.
Die Flucht nach
Luxemburg im März
1937 brachte bedeutende
Einschränkungen
für Max und Hilde mit
sich, aber Hilde schrieb
1940 an ihre Schwägerin
Anna: „Die Zeit
hat uns in den letzten
Jahren des Neuaufbaus
auch immer enger zusammengeführt.
Wie
oft hat der Gute zu mir
gesagt: ‚Kindl, wenn ich
Dich nicht hätte‘, wenn ich ihn aufmunterte, vielleicht weißt Du es Anna, welcher gütiger,
rücksichtsvoller und lieber Ehekamerad Dein Bruder war.“ Nach dem Tod ihres
Mannes im Mai 1940 hatte Hilde das wohl schwerste Jahr ihres Lebens zu bewältigen.
Durch die dramatische Flucht aus Luxemburg blieben ihr nichts als die Kleider, die sie
auf dem Leib trug, und sie war dringend auf die Hilfe ihrer Verwandten angewiesen. Sie
war im Sommer 1940 in verschiedenen Lagern interniert, kurzzeitig auch in Gurs, bevor
sie zusammen mit anderen Flüchtlingen in St. Christan (Basses Pyrenees) eine Wohngemeinschaft
gründete und ein ärmliches Leben fristete. Zahlreiche erhaltene Briefe zeugen
von ihrer Verzweiflung, und trotzdem fuhr sie im Winter 1940/41 mehrmals zum
Lager Gurs, um die inzwischen dort internierten Verwandten mit Lebensmitteln usw. zu
unterstützen. Schließlich konnte Hilde mit Unterstützung durch die inzwischen in New
York lebende Schwägerin Anna Strauß ein Visum für die USA erhalten. Im Juli 1941 fuhr
sie dann über Madrid nach Lissabon und bestieg dort einen Dampfer nach New York.
Die Schwiegermutter Mathilde Schloßberger kommentierte im fernen Stuttgart: „Ich bin
in Gedanken viel bei Euch und so dankbar, dass Du liebe Hilde nun bei den Lieben bist.
Deiner Mutter und den Geschwistern geht’s ebenso.“
Nur mühsam konnte sich Hilde eine neue Existenz in New York aufbauen. Sie schaffte
sich in den Jahren 1949 und 1952 je eine Nähmaschine an und nähte in Heimarbeit
Schonbezüge für Sommermöbel, und ihr Jahreseinkommen lag bis 1958 durchschnittlich
bei 1500 $. Nach einer chronischen Gallenblaseninfektion musste sich Hilde im
Jahr 1954 schließlich die Gallenblase entfernen lassen. Die in der Folge auftretende
chronische Cholangitis machte sie zu 60% erwerbsunfähig. Trotzdem erinnert sich der
Großneffe Fred Strauß noch heute gerne an die Baseballspiele, zu denen er von Großtante
Hilde mitgenommen wurde. Im Dezember 1969 siedelte Hilde in ein Altersheim
in Frankfurt-Seckbach über. Im Lauf der Jahre wurde sie, wie sich ihr Großneffe Carl-
Ulrich Herrmann erinnert, etwas „tüddelich“. 82-jährig verstarb sie am 29. September
1976 In Frankfurt. In Leonberg, dem Wohnort ihres Neffen Dr. Arnold Herrmann, wurde
sie begraben.
Familie Rudolf und Mathilde Schloßberger
Rudolf Schloßberger
* 04.04.1860 Hollenbach † 28.03.1925 Bruchsal
(Sohn von Moses Baruch Moritz Schlossberger (1818-1889), und Helene Strauß (1831-1909))
Kaufmann (Eisenhandlung); seit 1888 Holzmarkt 30, Bruchsal; Vorsitzender Isr. Gemeinde Bruchsal
verh. 19.08.1889 Gernsbach
Mathilde Neter
* 23.02.1868 Gernsbach † 01.01.1943 Theresienstadt
(Tochter v. Eli Neter (1837-1908), Eisenwarenhändler in Gernsbach, und Auguste Sinauer (1843-1896))
Bruchsal, Holzmarkt 30; 03.1939 Stuttgart; 09.1941 Bad Mergentheim; 23.08.1942 Deportation
3 Kinder:
1. Max Schloßberger * 20.06.1890 Bruchsal † 12.05.1940 Ancemont bei Verdun
Leutnant im 1. Weltkrieg; Kaufmann in Bruchsal (Eisenhandlung); 05.1937 Flucht nach Luxemburg
verh. 05.09.1922 Bretten
Hilda „Hilde“ Lämle * 06.08.1894 Bretten † 29.09.1976 Frankfurt/M.
(Tochter von Arnold Lämle (1864-1927), Kaufmann in Bretten, und Mina Maier (1870-1942))
Bruchsal; 05.1937 Flucht nach Luxemburg; 1940 Gurs; 07.1941 New York; 1969 Frankfurt/M.
kinderlos
2. Anna Luisa Schloßberger * 13.06.1894 Bruchsal † 08.03.1985 Hartford/CT/USA
Schulbesuch u. a. in England; 1921-1936 in Stuttgart-Bad Cannstatt; 1936 in USA; in Hartford
verh. 06.05.1920 Bruchsal
Ludwig Strauß
* 18.11.1892 Stuttgart-Bad Cannstatt † 01.08.1967 Hartford
(Sohn von Leopold Strauß (1856-1936), Kaufmann in Stuttgart, und Bertha Grünwald (1865-1933))
Kaufmann in Stuttgart-Bad Cannstatt; Zigarrenfabrikant; 1936 in USA; Buchhalter
2 Kinder:
a) Kurt H. Strauss * 18.01.1923 Stuttgart † 30.09.2010 The Cedars/ME/USA
1936 in USA; 1949-1981 Senior Technologist bei Texaco Inc., NY; seit 1991 wohnhaft in Portland/ME
vh. 01.02.1948 New York
Florence Piperno
* 09.09.1924 New York City † 01.10.2016 Portland/ME/USA
2 Kinder: Frederick Strauss, vh. Batia, in Jerusalem; Rebecca Strauss, South Portland, USA
b) Ralph Strauss * 26.04.1926 Stuttgart † 09.04.2020 Mamaroneck/NY/USA
Kaufmann; wohnhaft in Bedford, NY
vh. Joan Petereit * 24.03.1931 † 07.10.2017 Bedford/NY/USA
1 Kind: Lisa Elizabeth Strauss (1960-2018) vh. Minishi, Stamford, Connecticut, USA; 1 Kind
3. Otto Schloßberger * 21.09.1902 Bruchsal † 28.08.1971 Johannesburg/Südafrika
Kaufmann in Bruchsal; Juni 1936 Auswanderung nach Südafrika; wohnhaft in Johannesburg
verh. 19.10.1933 Karlsruhe
Elisabeth Magdalena Sofie Martin * 26.11.1905 Bruchsal † 30.06.1995 Sydney/Australien
(Tochter von Gustav Martin (1871-1930), Hotelier in Karlsruhe, und Emilie Lister)
1933 Kontoristin; Juni 1936 Auswanderung nach Südafrika; wohnhaft in Johannesburg
1 Kind:
10
a) Percy Schloßberger * 13.11.1938 Johannesburg † 23.01.2021 Melbourne/Austr.
Südafrika; frühe 1960er für 8 Jahre in Canada, dann ~ 1970 Sydney/Australien
vh. Olive
2 Kinder: Elizabeth Schlossberger vh. Paddy; Moira Schlossberger
Rudolf Schloßberger, 1911. Foto: Boppel. Grabstein auf dem Jüdischen Friedhof in Bruchsal. Foto: F. Jung.
Anna Strauß geb. Schloßberger; Ludwig Strauß; Kurt H. Strauß; Ralph Strauß. Fotos: Fred Strauss.
11
Otto Schloßberger;
Elisabeth Schloßberger
geb. Martin;
Percy Schloßberger.
Fotos: Elizabeth
Schlossberger.
Biografie von Hugo Katz (1872-1940)
von Florian Jung
Leider wurde für Hugo Katz von seinen weitläufigen Verwandten keine Wiedergutmachung
für „Schaden im beruflichen Fortkommen“ beantragt, sodass nirgends ein Lebenslauf
des am 1. Juni 1872 in Bruchsal geborenen jüdischen Kaufmanns dokumentiert ist.
Man kann sich aber durch die Betrachtung seiner Familie ein Bild seiner persönlichen Vita
machen. Die Judenemanzipation 1862 brachte für Juden die Erlaubnis, ihren Wohnort
innerhalb Badens frei zu wählen. Der Großvater von Hugo Katz, Wolf Katz (1815-1886),
nutzte diese Gelegenheit und zog mit seiner 7-köpfigen Familie von Untergrombach nach
Bruchsal. 1859 wurde das letzte Kind in Untergrombach geboren, und 1871 ist Wolf Katz
bereits in Bruchsal wohnhaft. Der von ihm gegründete Rohtabakhandel florierte, und er
selbst scheint schnell Anerkennung unter seinen Mitbürgern gefunden zu haben, da er
1880 als einer der ersten Juden Bruchsals Mitglied im Bürgerausschuss der Stadt war. Sein
Geschäft ernährte nicht nur ihn, sondern auch die Familien seiner drei Söhne Bernhard
(1843-1898), Nathan (1853-1918) und Ferdinand (1857-1926), und spätestens um die
Jahrhundertwende, der Blütezeit des Tabakanbaus in unserer Gegend, ist davon auszugehen,
dass die Familie Katz zu den wohlhabendsten Bruchsals gehörte. Bürgerschaftliches
Engagement haben auch alle drei Söhne gezeigt: Bernhard wird 1894 und 1897 in den
Bruchsaler Adressbüchern als Stadtverordneter genannt. Ferdinand war durchgehend von
1900 bis 1914 Stadtverordneter. Nathan war 1900, 1904 und 1907 sogar Stadtrat.
Ob Hugo Katz als ältester Enkel des Wolf Katz allerdings schon in den ersten Jahren seines
Lebens den beschriebenen Wohlstand erleben durfte, darf eher bezweifelt werden. Der
Vater Bernhard Katz heiratete kurz nach seiner Teilnahme am Krieg von 1870/71, am 19.
Juni 1871, die aus Grötzingen stammende, 22-jährige Fanny Berg. Als Hugo im Juni 1872
geboren wurde, hatte Vater Bernhard bereits
das Bürgerrecht in Bruchsal erworben. Die
jüngeren Brüder kamen bald danach zur
Welt: 1873 wurde Sally geboren, Julius 1876.
Die junge Familie scheint in den ersten Jahren
häufig umgezogen zu sein. 1880 wohnte
die Familie unter der heutigen Adresse
Huttenstraße 26 (damals Kapuzinerstr. 321),
1884 und 1888 im Eckhaus zur Seilersbahn,
heute Huttenstraße 22. Für die Jahre 1894
und 1897 ist die Adresse Kaiserstraße 22
nachgewiesen. 1897/1898 kaufte die Familie
die Villa Schillerstraße 14 (heute Franz-
Bläsi-Straße 14), die der frühere Bruchsaler
Oberbürgermeister Dr. Albert Gautier erbauen
ließ. Doch Vater Bernhard konnte Quelle: Bruchsaler Zeitung vom 28.11.1933.
das
12
Leben im großzügigen Eigenheim kaum genießen, da er wenig später, am 19. Oktober
1898, starb und somit seinem bereits 1894 verstorbenen Sohn Sally nachfolgte. Für Hugo
und seinen jüngsten Bruder Julius bedeutete dies, dass sie, nun 27-jährig und 22-jährig,
an der Seite ihrer Onkel und Mitinhaber des Rohtabakgroßhandels „Wolf Katz und Co.“
Verantwortung übernehmen mussten. Im 1. Weltkrieg wurden beide einberufen. Julius
Katz war seit August 1914 Infanterist, erreichte den Grad eines Leutnants und wurde leicht
verwundet. Hugo Katz kam im November 1915 als Landsturmmann nach Karlsruhe und
wurde im Juli 1917 zur Verleihung des Badischen Kriegsverdienstkreuzes vorgeschlagen,
weil er „mittels Kartei ein- und ausgehende Briefe mit großem Fleiß und anerkennenswertem
Eifer bearbeitet.“ Beide Brüder blieben unverheiratet und bewohnten gemeinsam
mit ihrer Mutter Fanny weiterhin die Villa in der Schillerstraße 14. Es kann davon ausgegangen
werden, dass sie von einer oder zwei Hausangestellten unterstützt wurden. In den
Adressbüchern 1930/31 und 1933/36 wird Rosa Nohlen als Haushälterin genannt.
Die Machtübernahme Hitlers fiel für Hugo Katz zusammen mit persönlichen Schicksalsschlägen:
Am 26. November 1933 verstarb Mutter Fanny fast 85-jährig, am 24. Januar
1934 Bruder Julius im Alter von 57 Jahren. Hugo Katz, nun 62-jährig und letztes Mitglied
seines Familienzweigs, musste sich Gedanken machen, was aus seinen Firmenanteilen
nach seinem Tod werden sollte. Offenbar entschied er sich dafür, dass sein Vermögen denjenigen
Verwandten zu Gute kommen sollte, die ebenfalls Anteile am Familienunternehmen
„Tabakgroßhandel Wolf Katz und Co.“ besaßen, nämlich den Nachkommen seiner
Onkel Nathan Katz und Ferdinand Katz. Hugo Katz war gemeinsam mit seinem Cousin
Ernst Katz, dem Sohn des Nathan, Geschäftsführer der Firma, und jeder besaß 40%. Die
in Darmstadt wohnende Tante Emma Katz, die Witwe Ferdinands, war mit 20% stille Teilhaberin.
Deren Enkel, Johann Friedrich Strauß, bis zu seiner Entlassung 1933 Landgerichtsrat
in Darmstadt, trat in die Firma in Bruchsal 1934 bis 1935 ein, wanderte 1936 aber
nach Palästina aus. Hugo Katz‘ Testament war 1934 demnach so verfasst, dass es nicht
diese genannten Familienzweige explizit begünstigte, sondern alle anderen ausschloss: Die
Nachkommen der beiden Tanten väterlicherseits (Karoline Altschul geb. Katz und Fanny
Simon geb. Katz) sowie die einzige Schwester der Mutter, Sofie Metzger geb. Berg, wurden
enterbt. Ob vielleicht ein schlechtes Verhältnis zu diesen Verwandten dazu den Ausschlag
gab? Zumindest für die Tante Sofie Metzger kann dies mit Bestimmtheit verneint werden:
Sie starb am 22. Juli 1937 in Bruchsal in der Villa des Hugo Katz, und er war es auch, der
ihren Tod beim Standesamt anzeigte. Wohnte die verwitwete, 85-jährige Sofie Metzger bei
ihm oder war sie nur zu Besuch? Und warum kümmerten sich nicht ihre beiden Kinder
Leo und Flora, die in Karlsruhe wohnten, um sie? Wir wissen es nicht.
Wann Hugo Katz Bruchsal und Deutschland verließ, ist ebenfalls unklar. In einer Klageschrift
von 1941 wird der Dezember 1937 genannt. Im Bruchsaler Adressbuch von 1938
ist er hingegen noch als Bewohner seiner Villa in der Schillerstraße 14 verzeichnet. Am
24. Juni 1938 verfügte das Finanzamt Bruchsal, dass etwaige Erlöse aus der „Firma Wolf
Katz und Co. Rohtabake“ oder aus dem Verkauf des Privateigentums der Beteiligten bis
zu einer Höhe von 2,6 Millionen Reichsmark zur Begleichung angeblicher Steuerschulden
gepfändet seien. Hugo Katz und sein Cousin Ernst Katz befanden sich zu diesem
13
Zeitpunkt bereits in Amsterdam. Das Firmenvermögen, das aus mehreren Immobilien,
Bauplätzen und Grundstücken, Bankkonten, sämtlichem beweglichen Besitz und einem
beachtlichen Tabaklager bestand, wurde am 2. Oktober 1938 an die Firma Kaussel und
Beckroege in Bremen für einen Preis von 1,365 Millionen Reichsmark verkauft. Die Firma
hieß in Bruchsal „Beckroege und Renner OHG“. Im Wiedergutmachungsverfahren wurde
festgestellt, dass dieser Kaufpreis weit unter dem eigentlichen Wert lag: Die Familie Katz
war offensichtlich unermesslich reich. Hugo und Ernst Katz wollten auch in diesem letzten
Moment noch für ihre langjährigen, treuen Hausangestellten sorgen und ließen Rosa
Nohlen eine Rente von 2000 RM und Maria Gsell 500 RM zufließen. Da der Fiskus sofort
die Hand auf den Verkaufserlös legte, erhielten Hugo und Ernst Katz keinen Pfennig. Als
Hugo Katz sein Haus in der Schillerstraße 14 im Juli 1939 an die Landkreisverwaltung
für 28.000 Reichsmark verkaufte und sein gesamtes zurückgelassenes Inventar versteigert
wurde, wohnte er im Carlton-Hotel in Amsterdam. Als Hugos Tanten Emma und Frieda
Katz und die beiden Cousinen Mina und Johanna am 11. August 1939 aus Darmstadt
nach Amsterdam flüchteten, hatten Hugo und Ernst Katz eine Wohnung im ersten Stock
der Corellistraat 23 gemietet. Vom 21. Oktober 1939 an sind die Verwandten dann im
zweiten Stockwerk der Zuider Amstellaan 32 gemeldet, Hugo Katz blieb in der Wohnung
wohl alleine zurück. Nachdem die deutschen Truppen im Mai 1940 in Amsterdam eingerückt
waren, wurden Hugo und Ernst Katz von deutschen Steuerbehörden beschuldigt,
160.000 Reichsmark illegal nach Amsterdam transferiert zu haben. Dieser Vorwurf scheint
nicht haltbar, da die 1925 von Hugo, Julius und Ernst Katz gegründete Firma „N. V. Tabak
Maatschapp Ambruka“ (Ambruka = Amsterdam Bruchsal Katz) den Tabakhandel rheinabwärts
unterstützen sollte und damit weit vor den durch die Nationalsozialisten 1935
erlassenen, restriktiven Devisengesetzen existierte. „Hugo Katz ist in Amsterdam während
der Ermittlungen des Devisenschutzkommandos Holland vor seiner geplanten Festnahme
verstorben,“ so heißt es in der Klageschrift der Zollfahndungszweigstelle Karlsruhe von
1941. Der Polizeibericht aus Amsterdam führt allerdings zum Tod von Hugo Katz an, dass
er durch übermäßige Einnahme von Schlafmitteln in seiner Wohnung in der Corellistraat
23 in Amsterdam am 23. November 1940 verstorben ist.
Biografie von Friedolina Katz geb. Reiß (1860-1943)
von Annika Wormer, Alicia Degen, Klasse 9t
Friedolina Reiß, die wohl auf den Namen Frieda hörte, wurde am 12. März 1860 in Mußbach
an der Weinstraße geboren. Sie hatte eine ältere Schwester, Lina Reiß (1853-1934),
die sich 1874 in Mußbach mit Siegmund Weiß (1845-1916) verheiratete und in Landau
wohnte, wo sie vier Söhne großzog. Um 1882 heiratete Frieda ihren Mann Nathan Katz,
der am 3. Februar 1853 in Untergrombach geboren wurde. Bereits in den 1880ern konnte
die junge Familie in ihr neugebautes Haus Schloßstraße 5 in Bruchsal ziehen, das Frieda
bis zu ihrer Flucht über 50 Jahre bewohnte.
Das Ehepaar Nathan und Frieda Katz hatte drei Kinder. Ihr erstes Kind hieß Johanna Katz.
14
Sie wurde am 1. Dezember 1883 in Bruchsal geboren. 1905 heiratete sie den Rechtsanwalt
Dr. Karl Simon in Bruchsal und zog mit ihm in seine Heimatstadt Darmstadt; man mietete
sich in die Heidelberger Straße 9 ein. Bis zum Tod von Dr. Simon im Jahr 1909 war die Ehe
kinderlos geblieben.
Das zweite ihrer Kinder ist Ernst Katz.
Geboren wurde er 1884, ebenfalls in
Bruchsal. Er wohnte zeitlebens bei
seiner Mutter. Über ihn wird später
noch ausführlicher berichtet werden.
Dann gab es noch das jüngste der
Kinder, Paul Katz, geboren 1892 in
Bruchsal. Paul war Rechtspraktikant,
als er im September 1914 ins Artillerieregiment
Nr. 66 eintrat. Jedoch
starb er als Unteroffizier am 2. Mai
1916 durch eine Verletzung am Kopf
durch Granatensplitter bei Larhere bei
Paul Katz. Q.: J. Münch. Bruchsal im Weltkrieg, 1920.
Dr. Karl Simon (rechts). Quelle: Hess. Staatsarchiv
Darmstadt, Bildersammlung R 4, n–11#29-1.
Verdun (Frankreich). Nathan Katz, der Ehemann von Frieda, wird in den Jahren 1900,
1904 und 1907 als Stadtrat in Bruchsal genannt und man kann annehmen, dass die Familie
ein gutes Ansehen genoss. Der Tabakgroßhändler starb allerdings am 15. August 1918 in
Bruchsal. Bereits 1920 hatte Frieda Katz einen Telefonanschluss (Nr. 277). Es ist gemäß
der Adressbucheinträge davon auszugehen, dass es im Haushalt Katz ein Dienstmädchen
gab. Die zweite Wohnung des Hauses Katz wurde an andere angesehene Mitglieder der
jüdischen Gemeinde vermietet, namentlich an Jakob Oppenheimer, Samuel Katzauer und
an Albert Reiß, von etwa 1905 bis zu seinem Tod 1928. Ob dieser allerdings verwandt war,
konnte nicht ermittelt werden. Seit 1936 wohnte die Familie von Alfred Baer (siehe S. 32)
im Hause Katz.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde es für Friedas Sohn Ernst
Katz immer schwieriger, die Geschäfte im Rohtabakhandel aufrecht zu erhalten. Im März
1938 folgte Ernst Katz seinem Cousin Hugo nach Amsterdam. In etwa dieser Zeit zog
Frieda Katz zu ihrer Tochter Johanna Simon nach Darmstadt, die dort noch immer in
der Heidelberger Straße 9 wohnte. Bezeugt ist ihre Anwesenheit unter dieser Adresse im
März 1939. Mutter Frieda und Tochter Johanna kamen der behördlichen Aufforderung
nach, Silber, Gold und Edelsteine abzuliefern. Die Aufstellung umfasst mehrere Seiten und
zeugt von einem bis dahin sehr gut und edel gefüllten Besteckschrank und Schmuckkästchen.
Auch einen Großteil ihrer Aktien musste Frieda Katz als „Judenvermögensabgabe“
abgeben. Am 11. August 1939 reisten die 79-jährige Frieda Katz, ihre 56-jährige Tochter
Johanna Simon zusammen mit Emma und Minna Katz in die Niederlande zu Ernst und
Hugo Katz. Emma Katz war die seit 1919 in Darmstadt wohnende, 77-jährige Schwägerin
von Frieda Katz, Minna deren 54-jährige Tochter. Die vier Damen wurden von ihrem
Steuerberater Dr. Warthorst bis an die Grenze begleitet und konnten nur leichtes Hand-
15
gepäck mitnehmen. Eine Bleibe fanden sie in Amsterdam in der Zuider Amstellan 32 im
2. Stock. In diesem Wohngebiet lebten viele deutsche Emigranten, unter anderem in
nächster Nachbarschaft Anne Frank.
Frieda Katz musste miterleben, dass ihr Sohn Ernst Katz 1940 verhaftet wurde und mehrere
Selbstmordversuche unternahm. Einer davon, den er am 17. Januar 1943 zusammen
mit seiner Schwester Johanna nach dem Verrat des Verstecks mit der Einnahme des
Schlafmittels Veronal durchführte, endete für Johanna Simon tödlich. Frieda Katz musste
auch von ihrem dritten Kind, dem Sohn Ernst Katz, Abschied nehmen: Er wurde im März
1943 verhaftet und nach Sobibor verschleppt. Die erhaltene Postkarte des Norbert Jeidels
an Friedas Nichte Minna Katz belegt, dass Frieda das Schicksal ihres Sohnes kannte oder
zumindest ahnte, als sie selbst, zusammen mit Schwägerin Emma und Nichte Minna, vom
Lager Westerbork aus in den Osten deportiert wurden. Der Zug verließ Westerbork am
13. Juli 1943 und erreichte Sobibor am 16. Juli. Frieda, Emma und Minna Katz wurden
noch an demselben Tag ermordet.
Biografie von Ernst Katz (1884-1943)
von Annika Wormer, Chanuvi Chandrapalan, Klasse 9t
Ernst Katz wurde am 3. November 1884 als zweites Kind der Eheleute Nathan und Frieda
Katz in Bruchsal geboren. Über seine Ausbildung zum Kaufmann wissen wir nichts,
allerdings hat er später zu Protokoll gegeben, dass er 1912 in die Firma seiner Familie,
die „Wolf Katz und Co. Rohtabakgroßhandlung“ eintrat. Nach dem Tod seines Vaters im
Jahr 1918 führte er die Firma zusammen mit seinen Cousins Julius und Hugo Katz sowie
seinem Onkel Ferdinand Katz. Nach dem Tod von Ferdinand Katz 1926 und von Julius
Katz 1934 war er gemeinsam mit seinem Cousin Hugo Geschäftsführer des großen und
florierenden Unternehmens. Ernst Katz blieb unverheiratet und lebte bis März 1938 bei
seiner Mutter Frieda im Elternhaus in der Schlossstraße 5 in Bruchsal. Dann folgte er
seinem Cousin Hugo Katz nach Amsterdam, wo die beiden seit 1925 eine Niederlassung
zur Stärkung des Überseehandels führten. Der Besitz der Firma in Bruchsal wurde im
Oktober 1938 für 1,3 Millionen Reichsmark verkauft. Dazu gehörten die Geschäfts- und
Lagerräume im Haus Durlacher Straße 136 genauso wie das Wohn- und Geschäftshaus
Durlacher Straße 139a, das Magazingebäude und Gartenland in der Büchenauer Straße
9, ein Bauplatz in der Prinz-Wilhelm-Straße, Bauland im Hagelkreuz und mehrere
Äcker in Grötzingen. Unvorstellbare Mengen an Rohtabak gehörten auch zum Firmenvermögen:
93.000 kg Inlandstabake „alte Ernten“ und über 302 Tonnen 1937er Ernte.
Dazu eine Vielzahl an Waagen und Gerätschaften - und: zwei Personenkraftwagen, ein
Opel und ein Wanderer. Der leitende Angestellte Ludwig Schroth führte den Verkauf
durch, da Hugo und Ernst Katz bereits nach Amsterdam geflüchtet waren. Eine Flucht,
die sich der deutsche Fiskus teuer bezahlen ließ: Jeder der beiden musste fast 500.000
Reichsmark an Reichsfluchtsteuer entrichten. Übrigens sahen Hugo und Ernst Katz vom
16
Verkaufserlös keinen Pfennig, da dieser vom Finanzamt wegen angeblicher Steuerschulden
gepfändet wurde. In Amsterdam drohte beiden im November 1940 die Verhaftung
wegen angeblicher Devisenschieberei. Hugo Katz nahm sich kurz vor der Verhaftung
das Leben, und zu Ernst Katz steht in den auf Dezember 1941 datierten Ermittlungsakten:
„Ernst Katz wurde im November 1940 in Amsterdam festgenommen und in Devisensicherungshaft
überführt. Das Amtsgericht Bruchsal erließ am 6.1.1941 Haftbefehl
gegen Ernst Katz, den ich dem Devisenschutzkommando Holland übersandte. Dieses
teilte daraufhin mit, Ernst Katz habe im Polizeigefängnis einen Selbstmordversuch unternommen
und sich hierbei schwer verletzt, sodass eine Überführung des Katz nach
Deutschland noch nicht in Frage komme. Katz unternahm später noch einen zweiten
Selbstmordversuch und verletzte sich wiederum schwer. Er hat außerdem ein starkes
Vorsteherdrüsenleiden. Der deutsche Polizeiarzt und der holländische Arzt haben Katz
für nicht haftfähig erklärt. Der holländische Arzt hält Katz außerdem für geisteskrank
(manisch-depressives Irresein mit Betonung der depressiven Phase bis hin zu Selbstmordversuchen).
Die Vernehmungen gestalteten sich daher auch äußerst schwierig.
Ernst Katz gab den geschilderten Ermittlungstatbestand im Wesentlichen zu. […] Nachdem
Katz nicht haftfähig ist, bitte ich, wenigstens die Einziehung bzw. die Ersatzeinziehung
der verschobenen, noch sichergestellten […] Werte […] zu beantragen.“
Ernst Katz wohnte im Januar 1943 zusammen mit seiner Mutter Frieda, seiner Schwester
Johanna, seiner Tante Emma und seiner Cousine Minna in Amsterdam in der Zuider
Amstellan 32 II, als ihr Aufenthalt verraten wurde und eine Inhaftierung in der Tulpenkaserne
drohte. Er unternahm zusammen mit seiner Schwester Johanna einen weiteren
Selbstmordversuch, den sie nicht überlebte. Sie starb an diesem Sonntag, den 17. Januar
1943 um 17.20 Uhr im Westergasthuis-Krankenhaus in Amsterdam an einer Veronalvergiftung.
Nach seiner körperlichen Wiederherstellung wurde Ernst Katz im Durchgangslager
Vught-Hertogenbosch inhaftiert. Am 11. März kam er ins Lager Westerbork.
Ernst Katz wurde dann am 17. März 1943 in das Konzentrationslager Sobibor deportiert
und dort drei Tage später, am 20. März 1943, ermordet.
Die den Devisenschmuggel betreffenden Akten scheinen 1942, im weiteren Verlauf des
Verfahrens, beim Oberfinanzpräsidenten in Berlin verloren gegangen zu sein. Im August
1943, als alle Mitglieder
der Familie Katz
nach Selbstmord oder
Mord nicht mehr belangt
werden konnten,
suchte der Karlsruher
Oberstaatsanwalt noch
immer nach diesen
Ermittlungsakten, um
den Fall ordnungsgemäß
abzuschließen.
Postkarte von Norbert Jeidels an Mina Katz. Q.: Irene Linssen-Jeidels, Delft.
17
Familie Wolf Katz
Wolf Katz
* 01.12.1815 Untergrombach † 31.10.1886 Bruchsal
(Sohn v. Seligmann Bär Katz (1772-1820), Handelsmann in Ugb., u. Mina Bär/Mindel Nathan (1773-1820))
1871 in Bruchsal wohnh.; 1876 Kaufmann, Durlacher Straße 198, Br.; 1880 Mitgl. im Bürgerausschuss
verh. 05.02.1840 Untergrombach
Regina „Rechele“ Kahn * 12.07.1819 Jöhlingen † 08.01.1893 Bruchsal
(Tochter v. Moses Kahn (~1784-1864), Handelsmann in Jöhlingen, und Minkele Schrak (~1784-1846))
9 Kinder:
1. Mina Katz * 18.11.1841 Untergrombach † 28.12.1850 Untergrombach
2. Bernhard Katz * 21.05.1843 Untergrombach † 19.10.1898 Bruchsal
Kriegsteilnehmer; 1872 Bürger in Br.; Tabakhändler; 1876 Kübelmarkt 199; 1898 Schillerstr. 14
verh. 19.06.1871 Bruchsal
Fanny Berg * 03.03.1849 Grötzingen † 26.11.1933 Bruchsal
(Tochter von Hayum Berg (1797-1890), Handelsmann in Grötzingen, und Therese Veit (1818-1885))
3 Kinder:
a) Hugo Katz * 01.06.1872 Bruchsal † 23.11.1940 Amsterdam
1894 Kaufmann; 1933 Großkaufmann für Rohtabake; 1937/1938 Flucht nach Amsterdam, unverh.
b) Sally Katz * 01.12.1873 Bruchsal † 24.08.1894 Bruchsal
1894 Kaufmann, unverheiratet
c) Julius Katz * 10.04.1876 Bruchsal † 24.01.1934 Bruchsal
1934 Kaufmann, unverheiratet
3. Leopold Katz * 22.07.1846 Untergrombach † 13.12.1847 Untergrombach
4. Jonas Katz * 16.08.1848 Untergrombach † 21.06.1852 Untergrombach
5. Karoline Katz * 25.11.1850 Untergrombach † 09.09.1908 Karlsruhe
verh. 13.01.1873 Rastatt
Simon Altschul * 26.07.1847 Rastatt † 23.05.1916 Neckargemünd
(Sohn von Josef Altschul (1812-1892), Gastwirt in Rastatt, und Mina Külsheimer (~1815-1887))
Kaufmann, lebte in Weinheim und bis 1911 in Karlsruhe; 1911-1916 in Weinheim
5 Kinder:
a) Melanie Altschul * 14.01.1874 Rastatt † nach 1939
vh. Siegmund Schnurmann, Straßburg? Kinder?
Sohn evtl. Friedrich Schnurmann (1902 Str. – 1947 NY), Kaufm. in Offenbach; Auswand. 1940, led.
b) Flora Altschul * 09.02.1875 Rastatt † .01.1952 Milwaukee/USA
1938 wohnhaft in Rastatt; 01.01.1939 nach Lissabon/Portugal
18
vh.12.07.1897 Rastatt Max Hirsch * 23.02.1871 Weinheim † 01.11.1950 Milwaukee/USA
Leder-Fabrikant in Weinheim; Gemeinderatsmitglied 1912-1919; 01.01.1939 nach Lissabon
4 Ki.: Arthur (1898-1980), Elisabeth May (1900-?), Erna Hertz (1902-?), Marianne Fuchs (1905-1980)
c) Oskar Ludwig Altschul * 22.06.1876 Rastatt † .05.1942 Chelmno
wohnhaft in Köln; 22.10.1941 ins Ghetto Lodz, 12.05.1942 nach Chelmno
vh. evtl. Karoline Nelly Heymann * 08.01.1886 Köln + .05.1942 Chelmno; 22.10.1941 Lodz
Kind evtl. Marianne Altschul * 22.09.1924 Köln † .05.1942 Chelmno; 22.10.1941 Lodz
d) Emil Altschul * 26.09.1877 Rastatt †
verheiratet, 2 Kinder. E. A. wurde 1918 mit Ehefrau und 2 Kindern in Offenbach aufgenommen
e) Frieda Altschul * 08.12.1883 Rastatt † 1946 Basel
vh. 03.09.1906 Rastatt Ludwig „Louis“ Epstein * 20.05.1875 Kreuzlingen † 1940 Basel
Kaufmann in Basel
1 Kind: Walter Epstein (1912-?), wohnhaft in Basel – weitere Kinder?
6. Nathan Katz * 03.02.1853 Untergrombach † 15.08.1918 Bruchsal
1883 Kaufmann in Bruchsal; um 1900/1907 Stadtrat in Bruchsal; ~1885-1918 Schloßstr. 5, Bruchsal
verh. ca. 1882
Friedolina „Frieda“ Reiß * 12.03.1860 Mußbach/Pfalz † 16.07.1943 Sobibor/Polen
Schloßstr. 5, Bruchsal; Darmstadt; 11.08.1939 Emigration nach Amsterdam; Lager Westerbork
3 Kinder:
a) Johanna Katz * 01.12.1883 Bruchsal † 17.01.1943 Amsterdam
seit 1905 Darmstadt; 1939 Emigration nach Amsterdam; Selbstmord nach Verrat des Verstecks
verh. 14.09.1905 Bruchsal
Dr. iur. Karl Simon * 08.06.1872 Darmstadt † 22.06.1909 Heidelberg
(Sohn von Hermann Simon, Privatier, und Emma Langenbach)
Dr. iur.; Studium in Heidelberg; 1905 Rechtsanwalt in Darmstadt; kinderlos
b) Ernst Nathan Katz * 03.11.1884 Bruchsal † 20.03.1943 Sobibor/Polen
Großkaufmann; 03.1938 Emigration in die Niederlanden; Westerbork, unverheiratet
c) Paul Katz * 24.07.1892 Bruchsal † 02.05.1916 Verdun/Frankr.
1916 Rechtspraktikant; Unteroffizier 4. Bad. Feld Art. Reg. 66; Granatsplitterverletzung am Kopf
7. Fanny Katz * 20.11.1854 Untergrombach † 22.11.1886 Mainz
verh. 22.05.1876 Bruchsal
Daniel Simon * 30.05.1850 Bechtheim † 05.12.1921 Mannheim
(Sohn von Josef Simon, 1876 Privatmann in Worms, und Emanuele Wolf)
1876 Kaufmann; Weinhändler; 1877/1883 wohnhaft in Sterngasse 12, Worms; ~1885 nach Mainz
3 Kinder:
a) Emma Simon * 23.09.1877 Worms †
verheiratet? Kinder?
b) Marie Simon * 13.08.1879 Worms † 09.11.1939 Wiesloch
verheiratet? Kinder?
c) Josef Simon * 02.02.1883 Worms † 09.06.1960 Baden/Schweiz
verheiratet? Kinder?
19
8. Ferdinand Katz * 12.04.1857 Untergrombach † 08.03.1926 Darmstadt
Tabakgroßkaufmann; Stadtverordneter; Kaiserstr. 14, Bruchsal; seit 1919 in Darmstadt, Ohlystr. 30
verh. 22.10.1884 Bingen
Emma Marx
* 24.05.1862 Cörrenzig/Aachen † 16.07.1943 Sobibor/Polen
(Tochter von Sigmund Marx, Kaufmann, und Karoline Seligmann)
1 Kind:
a) Minna Katz * 08.08.1885 Bruchsal † 16.07.1943 Sobibor/Polen
in Bruchsal; seit 1907 in Darmstadt; 1939 Flucht nach Amsterdam; hieß seit 1929 wieder Katz
vh. 1. Ehe 31.01.1907 Bruchsal, getrennt 1917, geschieden 17.11.1920 Darmstadt
Dr. Joseph Strauß * 03.10.1875 Darmstadt † 09.02.1942 Lodz, Ghetto
seit 1901 Rechtsanwalt in Darmstadt; 11.1938 Buchenwald; von Köln nach Lodz am 30.10.1941
vh. 2. Ehe 06.08.1921 Darmstadt, geschieden 03.09.1928
Loni Bendheim * um 1883 Frankfurt/M. †
Rechtsanwalt, Syndikus, hatte seit 1901 ein Büro in Darmstadt; Wegzug 1928 nach Gießen
3 Ki.: Johann Friedrich Strauß (1907-?), Wilhelm Alfred Strauß (1910-56), Viktor Ferd. Strauß (1917-56)
9. Amalie Katz * 23.03.1859 Untergrombach † 07.05.1859 Untergrombach
Franz-Bläsi-
Straße 14,
früher Schillerstraße
14.
Foto: F. Jung.
Grabsteine von Julius Katz (links) sowie Bernhard und
Fanny Katz. Jüd. Friedhof in Bruchsal. Fotos: Rolf Schmitt.
20
Biografie von Johanna Straus geb. Weil (1874-1948)
von Tafreed Ahmad und Luca Hauth, Klasse 9s
Johanna Weil wurde am 26. Oktober 1874 in Speyer als älteste Tochter des Hopfenhändlers
Adalbert Weil (1842-1907) und dessen Ehefrau Karolina Scharff (~1852- vor 1893)
geboren. Sie entstammte einer alteingesessenen Speyerer jüdischen Familie, und ihr Großvater
Abraham Weil (1805-1887), ebenfalls Hopfenhändler in Speyer, wurde als Zeuge ihrer
Geburt eingetragen. Sie wuchs mit vier jüngeren Schwestern auf: Bertha (1876-~1916,
später Lewy), Frieda (1878-1943, später Wertheimer), Alice (1879-~1944, später Emsheimer)
und Hermine (1885-?). Im Jahr 1888 wurde den Eltern „endlich“ ein Sohn geschenkt,
Alfred Weil. Ob er eine Zeit lang in Bruchsal wohnte? Jedenfalls heiratete er am 14.05.1919
in Bruchsal die in Strasburg geborene Martha Rosa Haas.
Johanna Weil heiratete in Speyer bereits im Alter von 19 Jahren, am 6. Juli 1893, den
aus Bruchsal stammenden, damals 31-jährigen Kaufmann und Hopfenhändler Lazarus
Straus. Er war der älteste Sohn des Hopfenhändlers Gutmann Straus (1835-1916), und es
spricht einiges dafür, dass die Ehe, wie in damaliger Zeit üblich, von den Familien arrangiert
wurde. Ihre erste gemeinsame Wohnung ist im Bruchsaler Adressbuch von 1894 in
der Schillerstraße 4 (heute Franz-Bläsi-Straße 4) bezeugt, im selben Häuserblock gelegen
wie das Elternhaus des Lazarus Straus. Es ist davon auszugehen, dass sich Johanna Straus
von Anfang an stark in die familiären Strukturen der Großfamilie ihres Mannes einfügen
durfte – oder musste: Der Schwiegervater Gutmann Straus hatte aus seiner ersten Ehe mit
Sara geb. Stadecker (1842-1874) zehn Kinder, geboren zwischen 1862 und 1874, und aus
zweiter Ehe mit Hannchen geb. Münzesheimer (1854-1913) nochmals elf Kinder, geboren
zwischen 1876 und 1890.
Praktisch nahtlos fügten sich
die drei Töchter von Lazarus
und Johanna Straus an: Else
wurde am 22. April 1894
geboren, Grete am 25. April
1896 und Alice am 10. April
1899.
Zwischen 1897 und 1900
gaben Lazarus und Johanna
Straus ihre Wohnung in der
Schillerstraße 4 an seinen
jüngeren Bruder Max weiter.
Da dieser im Jahr 1900
heiratete, ist wahrscheinlich,
Neben dem eingeschossigen Gebäude einer Gartenwirtschaft folgen
in der Bildmitte die beiden zweigeschossigen weißen Gebäude
Schlossstraße 1 und 3, Postkarte 1913. Q.: Sammlung Rolf Schmitt.
21
dass der Umzug in die Mietwohnung
in der Schloßstraße
6 in diesem Jahr stattfand.
Gutmann Straus, 1860, und Hannchen Straus geb. Münzesheimer,
um 1880. Fotos: Susan Vidmar und Ulrike Schüler.
22
Johanna Straus wohnte jetzt direkt
gegenüber von den Schwiegereltern,
die seit 1880 das Haus
Schloßstraße 3 besaßen und bewohnten
– für Lazarus war das
sicher günstig, da sich in diesem
Haus auch die Geschäftsräume
der Hopfengroßhandlung befanden.
Ein Indiz für Größe und
Bedeutung des Geschäfts mag
sein, dass man bereits 1907 einen
Telefonanschluss hatte (mit der
Nummer 38!). In den Jahren 1913
und 1916 starben die Schwiegereltern,
und es muss wohl 1916
gewesen sein, als Lazarus und
Johanna Straus mit ihren drei Töchtern in das Haus der Schwiegereltern umzogen. Als
ältester Sohn übernahm Lazarus nicht nur das Elternhaus, sondern auch – zusammen mit
dem zweitältesten Sohn Max – die Hopfengroßhandlung, die den Namen „Staadecker &
Straus“ trug – ein Hinweis darauf, dass die Firma eine lange Tradition hatte: Sta(a)decker
war der Geburtsname der bereits 1874 verstorbenen leiblichen Mutter von Lazarus und
Max. Dieser Schwager von Johanna, Max Straus, spielte in Bruchsal eine bedeutende Rolle:
Von 1925 bis zu seinem Tod 1935 war er Vorsteher der Israelitischen Gemeinde Bruchsals,
außerdem Mitglied im Sommertags-Komitee und Unterstützer zahlreicher weiterer Vereine.
Dass Max sehr wohlhabend war, kann man bis heute sehen: Er ließ sich von seinem
Freund, dem Bruchsaler Ehrenbürger Prof. Dr. Fritz Hirsch, 1905 in der Schillerstraße 18
(heute Franz-Bläsi-Straße 18) ein Wohnhaus bauen, das durch seine Fassadenmalereien
ans Bruchsaler Schloss erinnert.
Wir wissen nicht, welchen Charakter Johanna Straus hatte, welche Rolle Johanna in ihrer
Familie spielte. Lazarus Straus widmete sich neben der Geschäftsführung der Hopfengroßhandlung
einem seltenen und teuren Hobby: Er züchtete Kakteen. Bereits 1892, noch
vor der Hochzeit, zählte er zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Kakteen-Gesellschaft,
und seine Sammlung soll die größte eines Privatsammlers in ganz Deutschland
gewesen sein. Ob Johanna sich freute, als 1901 und 1907 Kakteenarten nach ihrem Mann
benannt wurden? Oder war dieses Hobby für sie eher lästig?
Wir wissen auch nicht, wie Johanna Straus die unterschiedlichen Lebensläufe ihrer drei
Töchter bewertete: Jede für sich brach mit den damals üblichen Konventionen. Bekamen
sie Unterstützung von der Mutter – oder versuchte sie, es den Töchtern auszureden, es zu
verbieten oder schwer zu machen? Alle drei Töchter besuchten zunächst die „Höhere Mädchenschule
Bruchsal“ am Friedrichsplatz. Die Älteste, Else, heiratete 1919 den Münchner
Spediteur Heinrich Otto Frank. Dieser war katholisch – oft bei jüdischen Familien nicht
gern gesehen. Sicher war die Familie Straus religiös: 1925 wurde Onkel Max Straus, wie
bereits erwähnt, Vorsteher
der Israelitischen
Gemeinde. Die zweite
Tochter, Grete, wechselte
nach dem Besuch der
Else Frank geb. Straus und Heinrich Frank, 1951. Q.: www.family-search.com.
„Höheren Mädchenschule“
auf die Oberrealschule
und machte
dort 1915 ihr Abitur.
Sie war damit eine der
ersten Abiturientinnen
in Bruchsal. Danach
studierte sie in Freiburg
Medizin und promovierte
sogar – um dann
1923 Dr. Hans Prausnitz,
einen jüdischen Zahnarzt aus München, zu heiraten. In der damaligen Zeit kam eine
Verheiratung fast einem Berufsverbot gleich. Wir wissen aber nicht, wie diese kinderlose
Ehe geführt wurde: Waren vielleicht doch beide berufstätig? Jedenfalls wurde die Ehe 1933
geschieden – ein weiterer Tabubruch in jenen Jahren. Über die dritte Tochter, Alice, wird
in schulischen Unterlagen vermerkt, sie störe den Unterricht, und auch: „eigenmächtiges
Umstellen der Bänke.“ Mit 23 Jahren heiratete Alice den Diplom-Ingenieur Friedrich
Ehrmann aus Wien. Für die beiden und deren 1924 in Wien geborenen Sohn Hans bauten
Lazarus und Johanna Straus eine Villa in der Söternstraße 8 in Bruchsal, wo die junge
Familie 1926/27 wohnte. Die Ehe wurde 1928 in
Wien geschieden und Friedrich Ehrmann wanderte
1929 nach Chile aus. Hans, der einzige Enkel von Lazarus
und Johanna Straus, wurde von den Großeltern
väterlicherseits erzogen. 1930 wurde festgelegt, dass
Alice ihren Sohn nur montags für wenige Stunden
sehen durfte, in den Sommerferien konnte sie Hans
allerdings für sechs Wochen mit zu ihren Eltern nach
Bruchsal nehmen.
Am 20. Februar 1934 verstarb Lazarus Straus im Alter
von 72 Jahren. Johanna Straus musste in den Folgejahren
erleben, wie ihre Familie weiter auseinanderbrach:
Die Tochter Alice, die 1933/36 bei ihr in der
Schloßstraße 3 gewohnt hatte, verheiratete sich 1938
nach Wien mit einem Dr. Lederer, dann verliert sich
ihre Spur. Der einzige Enkel Hans Ehrmann übersiedelte
1939 zum Vater nach Chile. Die Tochter Dr. Grete
Prausnitz wanderte 1939 nach New York aus und
23
Alice Ehrmann geb. Straus und Hans Ehrmann,
um 1935. Foto: Karin Ehrmann.
arbeitete als Ärztin. Lediglich die in sogenannter „Mischehe“ lebende Tochter Else Frank
blieb in München wohnhaft. Alle anderen Mitglieder der umfangreichen Familie Straus
verließen Bruchsal und Deutschland nach und nach. Den in der Schweiz wohnhaften Verwandten
ist es gelungen, mehrere Dutzend Angehörige der großen Sippe Straus über die
Schweiz ins Ausland, meist nach Südamerika, zu schleusen. Unter ihnen ist auch Dr. Moritz
Straus (1882-1959), einer der jüngeren Brüder von Lazarus und Max. Er war Besitzer
der Argus Motorengesellschaft und Anteilseigner der Horch AG. Lediglich Johanna Straus
blieb. Warum verließ sie Deutschland nicht? Verkannte sie die Gefahr? Hatte sie Angst vor
einem Neuanfang? Im Alter von 65 Jahren sicher keine Kleinigkeit.
Am 22. Oktober 1940 wurde Johanna Straus zusammen mit nahezu allen Juden aus Baden
und der Pfalz ins südfranzösische Lager Gurs deportiert. Am 6. Januar 1941 war sie in
der Krankenstation („Infirmerie“) des Ilot K und beantragte aufgrund ihres Gesundheitszustands
ihre Entlassung, die ihr auch am Folgetag gewährt wurde. Dieser Vorgang ist
sehr ungewöhnlich, da in diesem ersten, harten Winter etwa 1000 der 6500 Deportierten
starben, und sicher hätten diese nahezu alle einen Grund gehabt, „aufgrund des Gesundheitszustands“
das Lager zu verlassen. Man kann daher vermuten, dass Einfluss und finanzielle
Mittel der Großfamilie Straus einen Beitrag dazu leisteten, dass Johanna Straus am
07.01.1941 nach Fontana bei Pau kam, dann nach Billère (bis April 1941). Von Dezember
1941 bis März 1942 war sie in Izeste (Bas-Pyrénées), vom 15.07.1942 bis 15.10.1942 in
Morláas, dann wieder in Gurs. Am 21.06.1943 wurde sie aus Gurs nach Saint-Sébastien
(Creuse) entlassen – davon zeugt ein an
diesem Tag vom Direktor des Lagers
Gurs mit offiziellem Siegel des französischen
Innenministers ausgefertigtes
„certificat de liberation“. Auch dies
äußerst ungewöhnlich: Eigentlich wurden
in den Jahren 1942/43 nahezu alle
in französischen Lagern befindlichen
Juden nach Auschwitz verbracht und
ermordet.
Johanna Straus konnte nach Kriegsende
zu ihrer Tochter Else Frank und ihrem
Schwiegersohn Heinrich Frank nach
München übersiedeln, wo sie am 1. Januar
1948 starb. Ungeklärt ist, warum
ihre Beisetzung in Bruchsal erst für den
25. April 1949 protokolliert wurde. Auf
jeden Fall trägt der gemeinsame, prachtvolle
Grabstein auf dem Jüdischen
Grabstein von Lazarus und Johanna Straus auf dem
Jüdischen Friedhof Bruchsal. Foto: Rolf Schmitt.
24
Friedhof Bruchsal bis heute die Namen
von Lazarus und Johanna Straus.
Kakteen namens Straus
von Florian Jung
Sicher – oder zumindest sehr wahrscheinlich
– ist Lazarus Straus der einzige
Bruchsaler, nach dem Pflanzen benannt
sind: Die Kakteen Cleistocactus strausii
und Eriosyce strausiana tragen heute den
Namen des Bruchsaler Kakteensammlers
und -züchters.
Schon in jungen Jahren hat sich Lazaraus
Straus (1862-1934) mit den damals in
Europa wohl sehr selten anzutreffenden
Pflanzen intensiv beschäftigt: 1892, im
Jahr vor seiner Eheschließung mit der zuvor
genannten Johanna Weil, gehörte er
zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen
Kakteen-Gesellschaft. Dort erwarb
er sich mit seiner Sammlung große Anerkennung,
es sei die „wohl artenreichste
im Besitze eines Zimmerkultivateurs“ gewesen.
Lazarus Straus selbst wird in einer
Veröffentlichung als „unser eifriges, liebenswürdiges
Mitglied und Freund“ bezeichnet, an anderer Stelle, 1921, als „alter, gediegener
Kenner.“ Scheinbar reiste Lazarus Straus auch regelmäßig zu den Treffen der Kakteengesellschaft
nach Berlin, da 1901 in der Monatsschrift für Kakteenkunde hervorgehoben
wurde: „Leider müssen wir in diesem Jahre auf seine Anwesenheit bei der Hauptversammlung
verzichten.“
Es muss in den Jahren
kurz vor 1900
gewesen sein, als ein
gewisser Leonardo
Hammerbacher auf
einer Reise durch
Argentinien eine
bisher unbekannte
Kakteenart sammelte,
die dann von
Friedrich Adolf Haage
jun. nach Europa
eingeführt und dem Beide Abb. aus: Monatsschrift für Kakteenkunde 1901, Seite 112 - 113.
25
Vermutlich Lazarus Straus mit seinem Enkel Hans Ehrmann, vor dessen
Wohnhaus Söternstraße 8, Bruchsal, um 1927. Q: Karin Ehrmann.
Sammler und Züchter Lazarus
Straus übergeben
wurde. Dieser wiederum
sandte sie mit anderen
Pflanzen an den Vorsitzenden
der Deutschen
Kakteengesellschaft, den
in Fachkreisen berühmten
Karl Moritz Schumann.
Schumann veröffentlichte
1901 in der Monatsschrift
für Kakteenkunde die
Erstbeschreibung dieser
neuentdeckten Kakteenart
und nannte sie nach Lazarus
Straus „Echinocactus
strausianus“. Schumann
befand, das sei „eine Ehrung,
welche ihm durchaus
gebührt.“ Der Veröffentlichung wurde auch eine von Lazarus Straus angefertigte Fotografie
beigefügt. 1994 wurde die Pflanze von Fred Kattermann in eine andere Gattung
gestellt und in Eriosyce strausiana umbenannt.
Wesentlich bekannter ist der 1907 durch Emil Heese erstbeschriebene
Pilocerus strausii. Der 1934 durch Curt Backeberg in
eine andere Gattung gestellte und somit in Cleistocactus strausii
umbenannte bolivianische Silberkerzenkaktus entwickelte sich
nach einem Zitat von Prof. Dr. Wilhelm Barthlott zum „weitverbreitetsten
Kaktus in deutschen Blumenfenstern“ und wurde im
Jahr 2013 von den Kakteengesellschaften aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz zum „Kaktus des Jahres“ gewählt.
Es ist ein Bericht eines Herrn Richter aus dem Jahr 1921 überliefert,
aus dem hervorgeht, dass Lazarus Straus einen Großteil
seiner sehr umfangreichen Sammlung in Gewächshäusern einer
Gärtnerei untergebracht hatte, „weil eine neue Wohnung keine
Möglichkeit zur sachgerechten Unterbringung mehr bot“, und
dass 1918 etwa 80% der Sammlung erfroren war. Lapidar heißt
es an anderer Stelle: „Danach beschäftigte er sich v. a. mit Rosen.“
Am Wohnhaus des Lazarus Straus, Schlossstraße 3, Bruchsal,
wurde am 8. Juni 2021 im Beisein von Familienmitgliedern eine
Gedenktafel für Lazarus Straus und „seine“ Kakteen enthüllt.
26
Cleistocactus strausii.
Q: www.exotenherz.de.
Familie Gutmann Straus
(Eltern von Lazarus Straus)
Gutmann Straus (bis ~1900 auch: Strauß) * 14.03.1835 Diedelsheim † 02.11.1916 Bruchsal
(Sohn v. Hirsch Straus (1793 Thairnbach-1873 Bruchsal) u. Helene (Hefele) Kaufmann († 1854 Diedelsh.)
1862 Bürger in Diedelsheim; 1872 Kaufmann, 1893 Hopfenhändler, 1916 Privatier; Schloßstr. 3, Br.
verh. 1. Ehe 21.11.1860 Diedelsheim (Kinder 1-10 aus dieser Ehe)
Sara Stadecker (auch Staadecker) * 30.01.1842 Walldorf † 18.04.1874 Bruchsal
(Tochter v. Lazarus Stadecker (~1807-1843), Lehrer u. Handelsmann in Walldorf, u. Blümchen Bär († nach 1850))
verh. 2. Ehe 08.04.1875 Bruchsal (Kinder 11-21 aus dieser Ehe)
Hannchen Münzesheimer * 25.02.1854 Stebbach † 22.07.1913 Bruchsal
(Tochter v. Lazarus Münzesheimer (~1813 Stebbach-1888 Bruchsal) u. Sophie Stein (~1819 Freudental-1897 Br.))
21 Kinder:
1. Lazarus Straus * 17.07.1862 Bruchsal † 20.02.1934 Bruchsal
Kaufmann/Hopfenhändler in Bruchsal, Schloßstr. 3; Kakteensammler, nach ihm 2 Kakteen benannt
verh. 06.07.1893 Speyer
Johanna Weil * 26.10.1874 Speyer † 01.01.1948 München
(Tochter v. Adalbert Weil (1842-1907), Hopfenhändler in Speyer, u. Karolina Scharff (*~1852 + vor 1893)
22.10.1940 deportiert nach Gurs; verschiedene Lager in Südfrankreich; 1945 befreit; Grab Bruchsal
3 Kinder:
a) Else Straus * 22.04.1894 Bruchsal † 11.03.1976 München
vh. 09.12.1919 Bruchsal Heinrich Otto Frank * 30.01.1894 München † 20.08.1958 München
Spediteur, Kaufmann in München-Solln, (röm.-kath.), kinderlos
b) Dr. med. Grete Straus * 25.04.1896 Bruchsal † 14.10.1961 Flushing/NY/USA
Ärztin, Promotion vor 1923; 1939 in USA; Ärztin in versch. Kliniken in NY; kinderlos
vh. 19.05.1923 Br. Hans Ferdinand Prausnitz * 06.06.1891 München † 31.12.1974 Wash. D.C.
Dr. med. dent., 1923 Zahnarzt in München; gesch. 01.06.1933 München; 1940 USA; 2. Ehe: Ilse Meyer
c) Alice Straus * 10.04.1899 Bruchsal † nach 1939
1933/36: Schloßstr. 3, Bruchsal
vh. 02.11.1922 Br. Friedrich Erhard Christoph Ehrmann * 22.07.1894 Wien † 1958 Chile
Dipl.-Ing., Chemiker, 1922 in Wien; 1926/27 Bruchsal; gesch. 03.12.1928 Wien; in Chile seit 1929
vh. 2. Ehe 1933/1938 Dr. Lederer, Rechtsanwalt in Wien
1 Ki.: Hans Ehrmann-Ewart * 16.08.1924 Wien † 30.08.1999 Chile, vh. Judith Blumberg (*1930), 1 To.
2. „Unbenannter Junge“ Straus * 04.01.1864 Bruchsal † 08.01.1864 Bruchsal
verstorben an „trismus neonatorum“, beerdigt auf jüd. Friedhof Obergrombach
3. Max Straus * 10.03.1865 Bruchsal † 26.11.1935 Karlsruhe
Großkaufmann in Bruchsal, 1901: Schillerstr. 4; 1922: Schillerstr. 18; Friedhof Bruchsal, Grab 207
verh. 29.03.1900 Karlsruhe
27
Regina Machol
* 09.11.1873 Edesheim/RP † 14.12.1958 New York/USA
(Tochter v. Jakob Machol (1840-1892), Kaufmann in München, u. Elka Schulhöfer (*1850 † vor 1879))
bis 1933/36 in Bruchsal, Schillerstr. 18; 08.1938 mit To. und Fam. über Rotterdam nach New York
2 Kinder:
a) Margaretha „Margaret“ Straus * 11.10.1901 Bruchsal † 01.07.2001 Jamaica, NY/USA
vh. 20.12.1922 Bruchsal Dr. jur. Bernhard Friedrich Kurt Ettinghausen
* 07.12.1892 Frankfurt/M.-Höchst † 28.04.1982 Jamaica, NY/USA
1922: Rechtsanwalt in Frankfurt/M.-Höchst, 08.1938 in USA
1 Tochter: Ruth Ettinghausen (1925-2020), 1938 in USA, vh. Prof. Paul Keller (1921-2012), 3 Ki.
b) Werner Straus * 14.11.1902 Bruchsal † 14.11.1902 Bruchsal
4. Leopold Straus * 02.09.1866 Bruchsal † 12.07.1867 Bruchsal
beerdigt auf jüd. Friedhof Oberöwisheim, Grab 34
5. Adolf (Abraham) Straus * 15.11.1867 Bruchsal † 10.12.1879 Bruchsal
beerdigt auf jüd. Friedhof Bruchsal, Grab 226
6. Hermine („Mina“) Straus * 19.11.1868 Bruchsal † 01.02.1953 Rio de Janeiro
Auswanderung 1941 von Zürich nach Brasilien
verh. 19.02.1891 Bruchsal
Bernhard (Baruch) Bodenheimer * 02.09.1854 Wiesloch † 06.06.1926 Wiesloch
(Sohn v. Lazarus B. Bodenheimer (~1817-1892), Kaufmann in Wiesloch, u. Auguste Hirsch (~1824-1880))
Kaufmann in Wiesloch
4 Kinder:
a) Siegfried Simon Bodenheimer * 05.01.1892 Wiesloch † 31.05.1915 Aachen (gefallen)
Kaufmann, unverheiratet
b) Sara Anna Bodenheimer * 30.10.1893 Wiesloch † 15.02.1974 Rio de Janeiro
vh. 15.06.1921 Wiesloch Josef Kahn * 28.11.1884 Freiburg † nach 1939 / vor 1974
Zigarrenfabrikant in Freiburg; Familie 1939 nach Buenos Aires
1 Tochter: Doris Stefanie Kahn (1922-?), 1939 Auswanderung nach Brasilien
c) Ludwig Lazarus Bodenheimer * 26.04.1895 Wiesloch † nach 1963 Zürich (?) Sevilla (?)
1930 Kaufmann in Berlin-Schöneberg, Auswanderung nach Brasilien; wohnhaft in Sevilla/Span.
vh. 19.03.1930 Kassel Lieselotte Berta Lieberg * 03.11.1906 Kassel † nach 1978 Sevilla (?)
2 Tö.: Leonore (1931-2014) vh. Horst Oppenheim, B. Aires; Erika (*1934) vh. Gerardo Sichel, B. Aires
d) Auguste Bodenheimer * 10.09.1899 Wiesloch † 17.05.1906 Wiesloch
7. Rosalie („Rosa“) Straus * 05.01.1870 Bruchsal † 02.05.1961 Sao Paulo, Brasilien
1938/39 von Karlsruhe in die Schweiz; 1941 Auswanderung nach Brasilien
verh. 12.05.1892 Bruchsal
Max Odenheimer
* 22.12.1859 Heidelsheim † 04.12.1922 Karlsruhe
(Sohn von David Odenheimer (1828-1908), Heidelsheim, und Bertha Ottenheimer (~1835-1887))
Kaufmann in Bruchsal
4 Kinder:
28
a) Ernst Josef Odenheimer * 10.03.1893 Bruchsal † 20.06.1966 Recife, Brasilien
Kaufmann; Auswanderung 1931 nach Brasilien
vh. Sybilla de Aquino * 1901/02 † 17.05.1987 Recife, Brasilien
3 Ki.: Beatriz (†) vh. Costa; Marion O. (1925-2012) vh. Bandeira de Melo; Max Walter O. (1932-2004)
b) Alfred „Fred“ Odenheimer „Oden“ * 05.10.1894 Br. † 18.05.1966 San Francisco/USA
Auswanderung in USA, kinderlos
vh. Nellie Marx
* 14.07.1900 Bettingen/RP † 18.03.2002 Miami/FL/USA
c) Anneliese Bertha Odenheimer * 10.09.1897 Bruchsal † 19.03.1983 Basel/Schweiz
vh. Dr. iur. Erich Altgenug * 24.04.1894 Essen † 01.05.1969 Basel/Schweiz
1 Tochter: Hanna Eva Altgenug (*1926), vh. Fritz Abrahamson (1919-2017), Australien, 2 Kinder
d) Fritz Odenheimer * 09.12.1898 Bruchsal † 08.07.1976 Basel/Schweiz
Kaufmann in Basel
vh. Erika Fuchs
* 21.07.1907 Karlsr. † 11.10.1987 Campos de Jordao/Bras.
4 Ki.: Jörg O. (1930-2015); Werner O. (*1935), Sao Paulo; Eva O. (1940-1960); Peter O. (*1945), Basel
8. Julius Straus * 13.01.1872 Bruchsal † 14.12.1872 Bruchsal
beerdigt auf jüd. Friedhof Oberöwisheim, Grab 68
9. Josef Straus * 24.02.1873 Bruchsal † 01.06.1874 Bruchsal
beerdigt auf jüd. Friedhof Oberöwisheim, Grab 74
10. Hugo Straus * 09.03.1874 Bruchsal † 28.10.1954 Rio de Janeiro, Bras.
Kaufmann; Inhaber v. Bijouteriefabrik Pforzheim zusammen mit (20); Auswanderung nach Bras.
verh. 12.04.1907 Worms
Rosa („Rosl“) Guggenheim * 25.05.1883 Worms † 03.04.1965 New York City, USA
(Tochter von Samuel Guggenheim (1840-1930), Worms, und Bertha Merzbach (1851-1907))
3 Kinder:
a) Franz Straus * 25.03.1908 Pforzheim † 1958 (?) Familie?
b) Fritz Straus * 12.07.1912 Pforzheim † Brasilien (?)
vh. Clara von Mentz * † Kinder?
c) Peter Straus * 10.07.1918 Pforzheim † 16.06.1979 Brasilien
vh. Ellen Frank
* 25.10.1921 Köln (?) † 25.11.2020 Rio de Janeiro, Bras.
3 Kinder: Ruth Straus (1944-2020), Eva vh. Gomez, Vera Straus
11. Ferdinand Straus * 21.01.1876 Bruchsal † 05.08.1885 Bruchsal
beerdigt auf jüd. Friedhof Bruchsal, Grab 268
12. Bertha Straus * 15.02.1877 Bruchsal † 20.02.1878 Bruchsal
beerdigt auf jüd. Friedhof Bruchsal (Ort unbekannt)
13. Emil Straus * 09.08.1878 Bruchsal † 16.12.1880 Bruchsal
beerdigt auf jüd. Friedhof Bruchsal, Grab 233a
14. Jakob Straus * 17.10.1879 Bruchsal † 25.09.1880 Bruchsal
beerdigt auf jüd. Friedhof Bruchsal, Grab 233b
29
15. Arthur Straus * 15.04.1881 Bruchsal †
weiterer Lebensweg unbekannt (auch im Straus-Stammbaum von 1938 keine weiteren Angaben)
16. Dr. phil. Dr. h. c. Moritz Straus * 18.03.1882 Bruchsal † 19.01.1959 Zürich
1912 Kaufmann; Inhaber Argus Motorengesellschaft; wohnh. in Berlin und Zürich; 1939 nach Bras.
vh. 20.01.1921 Karlsr. Leonore Beate Schnurmann * 15.07.1896 Karlsr. † 27.11.1978 Zürich
(Tochter v. Jakob Schnurmann (1861-1908), Fabrikant in Karlsruhe, u. Alice Auerbacher (1869-1915))
2 Kinder:
a) Dr. phil. Hannah-Alice Straus * 29.12.1922 Berlin
wohnhaft in Basel; gründete 1999 die Moritz-Straus-Stiftung
vh. Dr. phil. Alfred Katz (vgl. Nr. 19c) * 09.08.1916 Basel † 24.12.2004 Basel
Apotheker, Besitzer der Holbein-Apotheke Basel; Mitglied der New York Acad. of Sciences 1996
2 Kinder: Dr. med. Georg Katz, Basel; Dr. Katharina Katz, Basel
b) Dr. phil. Juliane Dorothea Straus * 09.12.1926 Berlin † 03.05.1984
vh. Müller
3 Töchter
17. Dr. iur. Heinrich Straus * 22.07.1883 Bruchsal † 31.07.1960 Sao Paulo/Bras.
Rechtsanwalt in Karlsruhe; 11.1938 Dachau; 03.1939 mit Ehefrau u. Söhnen nach Brasilien
außerehel. Beziehung
Luise Johanna Emilie Pissowotzki * 31.07.1898 Rastatt † 14.11.1978 Trittau
1 Kind:
a) Ruth Pissowotzki * 26.06.1925 Freiburg/Breisgau † 11.09.2018 Reinbek
vh. 03.04.1948 Wentorf Johannes Grüschow * 02.02.1926 Hamburg
3 Kinder: Ulrike Grüschow (*1953) vh. Schüler; Axel Grüschow (*1955); Felix Grüschow (*1963)
(Heinrich Straus) verh. 23.07.1925 Berlin-Friedenau
Wilhelmine Käte Stern * 27.01.1901 Peckelsheim † 18.09.1992 Sao Paulo/Bras.
(Tochter von Paul Stern und Bertha Stern)
2 Kinder:
b) Walter Heinrich Straus * 20.06.1926 Karlsruhe † 23.04.2014 Sao Paulo/Bras.
Unternehmer (Zement) in Brasilien
vh. Valdeci * 1 Kind: Alexandre do Carmo Straus (*1987)
vh. 08.11.2013 Leonis Ribeiro Cardoso * 06.08.1961
c) Hans Paul Straus * 27.05.1929 Karlsruhe † 08.09.2008 Cuiaba/Brasilien
Pilot, Unternehmer (Kühlanlagen, Möbel) in Brasilien
vh. Camila * 1 Kind: Henrique Straus
18. Dr. Wilhelm Straus * 11.07.1884 Bruchsal † 24.07.1955 Rio de Janeiro
Dr. iur. et rer. pol., vor 1938 nach Rio de Janeiro
verh. 15.06.1941 Rio de Janeiro
Gertrud Kahn * 04.08.1914 München † London (?)
(Tochter v. Julius Kahn (1878-1937), Oberingenieur in München u. Elsa Rosenfelder (1891-1925))
wohnhaft in München; ausgewandert Frühjahr 1938 nach Brasilien
Kinder? (eher wohl nicht)
30
19. Klara Straus * 20.02.1886 Bruchsal †
verh. 02.12.1910 Bruchsal
Dr. phil. Georg Ernst Katz * 05.04.1874 Basel/Schweiz † 1957
(Sohn von Paul Katz, Kaufmann (* 1835 † vor 1910) und Justine Haas (1847-?))
1910 Apotheker in Basel
3 Kinder:
a) Dr. Helene Katz * 06.10.1911 Basel †
vh. Dr. Alfred „Fred“ Singeisen * 1909 Kinder?
b) Paul Katz * 27.04.1913 Basel †
3 Kinder: Marianne Katz (*1962), vh. Werner Niederberger, Basel, Schweiz; 2 weitere Kinder
c) Dr. phil. Alfred Katz * 09.08.1916 Basel (vh. Hannah-Alice Straus, s. Nr. 16.a)
20. Otto Straus * 12.03.1887 Bruchsal † 03.08.1947 Rio de Janeiro
Inhaber v. Bijouteriefabrik Pforzheim zus. mit (10); 1936 Ausw. nach Rio de Janeiro; Juwelier
vh. 22.03.1929 Elisabeth „Liesel“ Kahn * 22.11.1909 Pforzheim †
1 Kind:
a) Brigitte (oder Anna?) Straus * 10.06.1930 Pforzheim Familie?
21. Suse (Liese?) Straus * 15.07.1890 Bruchsal †
verh. 04.03.1914 Bruchsal, geschieden 25.11.1925 Basel
Bruno Fabian * 11.02.1897 Basel † 31.05.1955 London/GB
(Sohn von Levin Fabian, Kaufmann (+ vor 1914) und Margula Olga Hurwitz)
1914 Kaufmann in Berlin, Familie lebte seit ca. 1919 in Basel; 1952 Rohwollhandel in Basel
1 Kind:
a) Hanna Fabian * 17.12.1914 Berlin Familie?
Violinistin (1948); wohnt bis 1948 in Basel; Auswanderung nach New York; 1948 unverheiratet
Gutmann und Sara Straus geb. Stadecker,
um 1860 (Eltern). Foto: Susan Vidmar.
Max Straus, Hermine Bodenheimer, Rosa Odenheimer,
Hugo Straus, Heinrich Straus, Moritz Straus (Geschwister).
31
Biografien von Alfred Baer (1864-1940) und
Rosa Baer geb. Schönmann (1869-1941)
von Malte Willmann, Klasse 9v, und Jonas de Bortoli, Klasse 9s
Rosa Baer geb. Schönmann und Alfred Baer, um 1930 in Bruchsal. Foto: Eric Hahn.
Alfred Baer wurde am 3. November 1864 in Bruchsal als Sohn von Jesaias Machol Bär
und Babette Bär geb. Weil geboren. Außer ihm hatten sie noch zehn weitere Kinder.
Alfred Baer besuchte das Gymnasium in Bruchsal vermutlich bis zur Mittleren Reife
und trat als Lehrling in ein Weißwarengeschäft in Mannheim ein. Nach Beendigung
seiner Lehrzeit arbeitete er in einem Geschäft der gleichen Branche in Neuwied als
Handlungsgehilfe. Der 2. Juli 1890 ist als Gründungsdatum seines Weißwarengeschäfts
im Handelsregister Bruchsal eingetragen. Zunächst befand sich das Geschäft
in der Kaiserstraße 45. 1896 kaufte Alfred Baer das Anwesen Friedrichstraße 29, ein
1789 erbautes Haus mit nur 71 qm Grundfläche für 13.000 Reichsmark. Es hatte einen
Keller, im Erdgeschoss einen kleinen Laden, von dem aus eine Treppe ins Obergeschoss
führte. Dort befanden sich Wohnräume und Küche – diese bewohnte Alfred
Baer zusammen mit seiner Familie 40 Jahre lang.
Alfred Baer heiratete am 17. November 1892 in Bruchsal Rosa Schönmann, die am
16. Dezember 1869 in Neu-Isenburg/Hessen geborene Tochter von Elias Schönmann
(1836-1896) und Mariam Fürth (1839-1908). Elias Schönmann stammte
aus Obertshausen/Kreis Offenbach und war Kaufmann in Neu-Isenburg, und das
32
Ehepaar hatte neben Rosa mindestens
sieben weitere Kinder: Pauline Fürth
geb. Schönmann (1864-1904), Ludwig
Schönmann (1865-1938), Julius Schönmann
(1871-1928), Berta Brumlik geb.
Schönmann (1873-1916), Jenny Cahn
geb. Schönmann (1874-1944), Helene
Oppenheimer geb. Schönmann (1876-
1937) und Kathinka Schönmann (1879-
?). Pauline und Ludwig lebten mit ihren
Familien in Wien, Berta in Mannheim,
Jenny und Helene in Frankfurt/M. Kathinka
(oder eine weitere, namentlich
nicht bekannte Schwester) lebte mit
zwei Töchtern in Brüssel – dort konnte
sie der Großneffe Eric Hahn in den
1950ern kennen lernen. Ludwig Schönmann
blieb als Kaufmann in Neu-
Isenburg und kam nach dem Tod seiner
Frau Flora nach Bruchsal. Er starb
im Haus seiner Schwester Rosa Baer,
Friedrichstr. 29, am 13. August 1928.
Anny u. Ernst Baer, 1906 in Bruchsal. F.: Jeanne Baer.
Blick vom Schönbornplatz durch die Friedrichstr.
zum Friedrichsplatz. Q.: Stadtarchiv Bruchsal.
Leider wissen wir aus dem persönlichen Leben
von Rosa und Alfred Baer wenig, und
so geben nur die Lebensdaten der Kinder
einen spärlichen Einblick: Am 22.8.1894
kam ihr erstes Kind zur Welt. Sie nannten
es nach seiner Mutter: Erna Babette. Am
3.12.1896 starb Erna, und ihr Kindergrab
ist bis heute auf dem Bruchsaler Jüdischen
Friedhof erhalten. Am 5.7.1899 wurde
Ernst Bär, das zweite Kind der Familie, geboren,
und fünf Jahre später, am 1.7.1904,
Anna, genannt Anny.
Zu etwa dieser Zeit begann Bruchsals wirtschaftlicher
Aufschwung, in dessen Zuge
Alfred Bär sein Geschäft stark ausbaute.
Sicher hatte dabei die zentrale Lage seines
Geschäfts in unmittelbarer Nähe der Kreuzung
der beiden Hauptgeschäftsstraßen
33
Werbeanzeige. Quelle: Adressbuch Bruchsal, 1925.
Bruchsals einen Anteil.
Allerdings war auch die
Konkurrenz nicht weit:
Genau gegenüber in der
Friedrichstraße hatten
zwei ebenfalls jüdische
Geschäfte des gleichen
Geschäftszweigs ihren
Sitz (Maier und Dreifuß),
und um die Ecke,
in der Kaiserstraße, war
das Weißwarengeschäft
Bärtig. In etwa die Hälfte
seines Umsatzes machte
Alfred Baer im Ladengeschäft.
Außerdem war
Alfred Baer viel unterwegs
und besuchte seine
Kundschaft während dieser Reisen. Dabei war Baer hauptsächlich auf Brautausstattungen
spezialisiert. „Man unterhielt Lager in Damenwäsche, Leinen, Tischwäsche,
Bettwäsche, Bettfedern, Barchent, Wolldecken, Kissenbezügen, Handtüchern, Vorhängen,
Kinderwäsche, Kinderkleidern, Herrenunterwäsche, Herrenstrümpfen,
Krawatten, Wollwesten, Arbeitshemden und -schürzen, Daunendecken u. ä.“ – so
schrieb Schwiegersohn Leo Hahn später. „Dann möchte ich noch aufführen, dass
wir Arbeitshemden angefertigt haben. Wir hatten einige Frauen, die für uns Heimarbeit
machten und wir waren weit und breit für diese Spezialarbeit bekannt. Wir
waren spezialisiert in der einfachsten wie zur feinsten Ausstattung, da unsere Kundschaft
aus gut bürgerlichen bis zu den feinsten Kreisen bestand.“
Der einzige Sohn, Ernst Baer, war im Ersten Weltkrieg bei der Fußartillerie-Brigade
in Straßburg und danach Kaufmann bzw. Bankbeamter in Essen. Somit blieb nur
die Tochter Anny bei den Eltern in Bruchsal. Als sie 1929 den aus dem hessischen
Auerbach stammenden Kaufmann Leo Hahn heiratete, wandelte Alfred Baer sein
Geschäft in eine OHG um und der Schwiegersohn konnte 50%-iger Teilhaber werden.
Alfred Baer zog sich danach aber, immerhin 66-jährig, nicht aus dem Geschäft
zurück, sondern soll bis zur Geschäftsaufgabe und dem Alter von 74 Jahren noch
täglich im Laden gestanden haben. Auch führte er bis zuletzt die Geschäftsbücher.
Immerhin stellte ein Buchrevisor die Bilanzen auf und fertigte die Steuererklärungen
an.
Kurze Jahre nach dem Geschäftseintritt des Schwiegersohns Leo Hahn verschlechterte
sich das Verhältnis zwischen den Juden und der restlichen Bevölkerung. Die
Einnahmen der Baers verringerten sich in den 1930ern stark, von etwa 15.000 RM
pro Jahr in der Zeit vor Hitlers Machtergreifung bis auf 0 im Jahre 1938, als das Ge-
34
schäft von offizieller Stelle geschlossen wurde. Man lebte von den Rücklagen früherer
Jahre. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde der
Laden verwüstet und geplündert und die Scheiben eingeschlagen. Das Warenlager
im Wert von ca. 45.000 RM zu normalen Zeiten wurde durch einen Treuhänder an
„Nichtjuden“ verkauft. Alfred Baer bekam dafür nur eine minimale Summe, auf
die er jedoch nicht zugreifen konnte: Das Geld wurde gesperrt. Im Dezember 1938
musste er schließlich sein Haus in der Friedrichstraße 29 verkaufen, die Käuferfamilie
Bohn führte ein Geschäft in derselben Branche. Das Haus wurde beim Angriff
auf Bruchsal vollständig zerstört, heute befindet sich dort ein Schmuckgeschäft.
Bereits 1936 waren Rosa und Alfred Baer aus ihrer Wohnung im eigenen Haus ausgezogen,
vermieteten ihre Wohnung und kamen in der Schlossstraße 5 bei der Familie
Katz, die ebenfalls jüdisch war, gemeinsam mit Anny und Leo Hahn und dem
3-jährigen Enkelsohn Erich unter. Im November 1938 kam Alfreds Schwester Ida
Tuteur nach ihrer Flucht aus Kaiserslautern dazu.
Im März 1939 flohen Anna und Leopold Hahn dann mit ihrem Sohn Erich nach
Amerika. Schon früh schlugen Anna und Leopold Hahn dem Ehepaar Baer eine
Flucht vor, seine Heimat wollte Alfred Baer jedoch nicht verlassen. Zwischen Mai
1939 und Oktober 1940 zogen sie noch einmal um, da die Familie Katz inzwischen
nach Holland geflüchtet war und das Haus verkauft hatte. Alfred und Rosa Baer und
Ida Tuteur mussten in die Bismarckstraße 3 ziehen, eines der „Judenghettohäuser“
Bruchsals. Alfred Baer wurde schließlich am 22. Oktober 1940 zusammen mit seiner
Frau Rosa, seiner Schwester Ida und den anderen badischen Juden nach Gurs
deportiert. Kurz darauf starb er dort am 15. Dezember 1940 im Alter von 76 Jahren.
Seine Ehefrau Rosa Baer starb wenig später, am 19. Januar 1941. Sie waren unter
den ersten Bruchsaler Todesopfern in Gurs. Die Kinder Ernst Baer und Anny Hahn
erhielten im Entschädigungsverfahren
1957 für den Tod
des Vaters DM 150 und für den
Tod der Mutter DM 300 ausbezahlt,
da nach bundesdeutschem
Recht nicht der Tod aus
Entkräftung, sondern nur die
Haftzeit entschädigungswürdig
war. Für jeden vollendeten
Monat Haftzeit bezahlte das
sogenannte „Amt für Wiedergutmachung“
DM 150: Alfred
Baer war einen Monat und 17
Tage interniert, Rosa Baer zwei
Monate und 28 Tage.
Lagerfriedhof in Gurs. Foto: Cornelia Petzold-Schick.
35
Biografien von Leo Hahn (1896-1970) und
Anny Hahn geb. Baer (1904-1987)
von Florian Jung
Leopold Hahn wurde am 16. Oktober 1896 in
Auerbach an der Bergstraße geboren. Seine Eltern,
der Kaufmann Zodick Hahn (1858-1937)
und seine Ehefrau Hanchen geb. Bentheim
(1854-1914), entstammten beide alteingesessenen
jüdischen Familien und betrieben in
Auerbach ein Geschäft; 1910 wird in der Bachgasse
11 (heute Bachgasse 13) in Auerbach
eine Immobilienagentur unter dem Namen
Zodick Hahn genannt. Zur Familie gehörten
zwei ältere Schwestern: Ida (1887-1942) war
die ältere, sie war seit 1909 mit Arthur Haas
(1880-1942) verheiratet. Beide blieben kinderlos
und lebten viele Jahre in Darmstadt,
bevor sie 1942 nach Piaski-Lublin deportiert
und ermordet wurden. Da sie von 1937 bis
1939 in Auerbach lebten, erinnern dort seit
2011 Stolpersteine an sie. Die zweite Schwester,
Bella (1890-1983), war seit 1913 mit Berthold
Anny und Leo Hahn, um 1930. F.: Jeanne Baer.
Frank (1884-1973), Kaufmann in Auerbach
und letzter Vorsteher der dortigen jüdischen Gemeinde, verheiratet und konnte 1939 in
die USA fliehen. Das ebenfalls kinderlose Ehepaar ist in Paramus (New Jersey) bestattet.
Leopold Hahn, der sich auch in offiziellen Dokumenten später durchgängig Leo nannte,
besuchte nach der Volksschule das Gymnasium in Bensheim und verließ es nach Abschluss
der Untersekunda (Mittlere Reife), um eine kaufmännische Lehre zu absolvieren.
In Darmstadt und Neubrandenburg war Leo Hahn dann in großen und angesehenen Firmen
tätig. Am 15. Oktober 1915, einen Tag vor seinem 19. Geburtstag, musste er ins Heer
eintreten und diente an der West- und Ostfront. Nach seiner Entlassung war er zunächst
wieder Angestellter bei größeren Firmen, übernahm dann aber das väterliche Geschäft in
Auerbach.
Am 12. September 1929 heirateten Leo Hahn und Anny Baer in Bruchsal. Anny Hahn war
am 1. Juli 1904 in Bruchsal als Tochter von Alfred Baer und Rosa Baer geb. Schönmann geboren
und wuchs im Haus Kaiserstraße 29 auf, wo der Vater Alfred Baer ein Ausstattungsgeschäft
betrieb. Leo Hahn trat im Januar 1930 mit einer Beteiligung von 50% in die Firma
ein und nahm die Reisetätigkeit wieder auf, die sein damals 66-jähriger Schwiegervater
nicht mehr so umfangreich wie früher auszuüben im Stande war. Leo Hahn beschrieb
36
seine Reisetätigkeit später so: „Wir hatten für Jahre und Jahre die gleiche Kundschaft, die
von Zeit zu Zeit mit Mustern besucht wurde, ihre Aufträge gaben, die dann per Post geliefert
wurden. Wie oft hatten wir Briefe von Kunden, wenn eine Tochter heiraten wollte,
mit unseren Mustern zu kommen und bekamen Aufträge für die ganze Ausstattung. Niemals
verkauften wir von Haus zu Haus, sondern wie ich Ihnen gerade erklärt habe, hatten
wir unsere Stammkundschaft, die durch Empfehlungen immer größer wurde.“ Etwa
60% des Umsatzes wurden in den Jahren 1930 bis 1933 durch das Ladengeschäft und 40%
durch die Reisetätigkeit erzielt. Leo Hahn konnte das Geschäft insgesamt somit wieder in
Schwung bringen. Es handelte sich dabei um ein typisches Familienunternehmen, in dem
neben Alfred Baer und Leo Hahn auch Anny Hahn geb. Baer mitarbeitete.
Anny und Leo Hahn bezogen nach ihrer Verheiratung eine Drei-Zimmer-Wohnung mit
Küche im damals sicher imposanten Neubau Amalienstraße 5, dem sogenannten Odenwaldbau
an der Ecke zum Bahnhofsplatz. Als das einzige Kind, Erich, am 27. Juni 1933 in
Karlsruhe geboren wurde, mag es bei den Eltern schon Sorgen um seine Zukunft gegeben
haben. Sehr bald nach der Machtübernahme spürte das Ladengeschäft den Boykott, und
zur Reisetätigkeit schrieb Leo Hahn später: „Der Umsatz, den ich durch meine Reisetätigkeit
erzielen konnte, wurde immer geringer. Es war mir besonders auf den kleinen Plätzen,
die ich aufsuchte, kaum mehr möglich, Zutritt zu den alten Kunden zu erhalten, da diese
sich fürchteten, einen Juden in die Wohnung hereinzulassen.“ – und an anderer Stelle:
„Der Rückgang des Geschäftes zwang mich, meine Wohnung in dem teuren Neubau
aufzugeben. Wir mieteten eine andere Wohnung, welche wir gemeinschaftlich mit den
Schwiegereltern bewohnten.“ Diese Wohnung lag im Haus der jüdischen Familie Katz,
Schlossstraße 5. „Die Schwiegereltern selbst, die bisher im eigenen Hause, Friedrichstraße
29, gewohnt hatten, vermieteten diese Wohnung“, so Hahn weiter. Andernorts ist überliefert,
dass Ludwig und Ida Geismar im April 1936 genau diese Vier-Zimmer-Wohnung in
Anny und Leo Hahn. um 1939. Fotos: Einbürgerungsanträge USA, www.family-search.com.
37
der Friedrichstraße 29 von Rosa und Alfred Baer bezogen. Im Bruchsaler Adressbuch des
Jahres 1933/36 wird noch die Amalienstraße 5 als Adresse der Familie Hahn angegeben,
im Adressbuch 1938 dann die Schlossstraße 5. Somit spricht einiges dafür, dass dieser Umzug
in die dann sicher sehr beengten Verhältnisse im Frühjahr 1936 stattfand.
Zur Katastrophe kam es für die Familien Baer und Hahn im November 1938. Am Tag
nach der Reichspogromnacht, am 10. November 1938, musste das Geschäft verfolgungsbedingt
schließen. Leo Hahn wurde verhaftet und zusammen mit 40 weiteren Bruchsaler
Männern nach Dachau verschleppt. Alfred Baers Schwester, Ida Tuteur geb. Baer, kam
völlig überraschend in Bruchsal an und suchte Asyl bei ihrem Bruder, weil ihre Wohnung
in Kaiserslautern im Zuge des Pogroms verwüstet worden war.
Wann sich Leo und Anny Hahn entschlossen, Deutschland zu verlassen, ist nicht bekannt.
Schon Monate oder Jahre vor November 1938? Oder erst, als Leo Hahn Ende 1938 aus der
Haft im Konzentrationslager Dachau zurückkehrte? Ende März 1939 reisten Leo, Anny
und der mittlerweile sechsjährige Erich Hahn mit dem Zug bis Cuxhafen und dann weiter
mit den Dampfer „SS Hamburg“ auf der Hamburg-Amerika-Linie nach New York, wo sie
am 31. März 1939 ankamen. Dort konnten sie bei Ernst Baer, Annys Bruder, unterkommen,
der 1937 nach New York ausgewandert war und mit seiner Frau Julia im Mai 1939
mit dem Sohn Leslie Familienzuwachs bekam. Noch im April 1940 lebte Familie Hahn
dort als Untermieter in sehr beengten Verhältnissen, da sich Leo Hahn in den ersten Jahren
in New York lediglich mit Gelegenheitsarbeiten notdürftig über Wasser halten konnte.
Erst 1942, nach dem Kriegseintritt der USA, konnte Leo Hahn eine reguläre Arbeitsstelle
finden, und in den 1950ern lebte Familie
Hahn in New York, 600, West 161 Street. Der
Bezirk Washington Heights war von vielen
deutschen Emigranten bewohnt. Bis zum
Renteneintritt 1959 arbeitete Leo Hahn dann
bei der Peter Pan MFG Corp.; 1955 gab er seinen
Beruf mit „Fabrikaufseher“ an.
Etwa im Jahr 1958 zogen Anny und Leo Hahn
nach Fairlawn in New Jersey (23-13 Ellington
Road), und Anny Hahn eröffnete in Paterson
NJ (95, Van Houten St.) ein Geschäft für Korsetts
und Büstenhalter, den „Hahn’s Corset
Shop“. Leo Hahn wurde Teilhaber, und bei
seinem Tod am 5. September 1970 wurde sein
Beruf mit „Store Manager“ angegeben. Leo
Hahn hatte bereits jahrelang eine Herz-Kreislauf-Erkrankung,
und ein Herzinfarkt ereilte
ihn in seiner Wohnung; er wurde 74 Jahre
alt. Sehr lange wird Anny Hahn ihr Geschäft
nicht weiter betrieben haben, da sie zwischen Anny Hahn geb. Baer, 1966. Foto: Jeanne Baer.
38
Juni 1973 und Juni 1974 nach Westwood NJ in das Valley Nursing Home (300, Old Hook
Road) umzog. Anny Hahn verstarb am 11. Dezember 1987 in Bergen NJ im Alter von 83
Jahren.
Leo und Anny Hahn blickten mit Verbitterung auf ihre Erfahrungen in Bruchsal während
des Nationalsozialismus zurück und sprachen auch mit ihrem Sohn Eric selten über diese
Zeit – ein Verhalten, das sich bei vielen überlebenden Opfern beobachten lässt. 1964
schrieben sie an das Landesamt für Wiedergutmachung in Karlsruhe, dass sie keinerlei
Kontakte nach Bruchsal unterhielten – und es ist überliefert, dass Anny Hahn eine Einladung
ehemaliger Bruchsaler Klassenkameradinnen ohne Zögern zerriss und im Papierkorb
entsorgte. Trotzdem blieben die deutsche Sprache, Kultur und Lebensweise von zentraler
Bedeutung im Hause Hahn, und deutsch blieb für Sohn Eric „Muttersprache“ im
wörtlichen Sinn.
Biografie von Eric Hahn (geb. 1933)
von Florian Jung
Als Eric Hahn unter dem Namen Erich Hahn am 27. Juni 1933 in Karlsruhe geboren wurde,
waren für seine Eltern Leo Hahn und Anny geb. Baer durch die Machtübernahme
Hitlers bereits dunkle Wolken am Horizont aufgezogen. Sehr bald bekamen die Eltern, die
zusammen mit den Großeltern Alfred und Rosa Baer in Bruchsals Zentrum ein Ausstattungsgeschäft
führten, einen rassistisch begründeten Umsatzrückgang zu spüren. Familie
Hahn musste die moderne Drei-Zimmer-Wohnung in der Amalienstraße 5 in Bruchsal im
Frühjahr 1936 verlassen und wohnte zusammen mit den Großeltern und einer Großtante
in einer beengten Wohnung
in der Schloßstraße
5. Im März 1939 konnte
Familie Hahn in die USA
auswandern und kam bei
Anny Hahns Bruder, Ernst
Baer, in New York unter.
Der Vater konnte in der
fremden Umgebung beruflich
nur schwer Fuß fassen.
„His early years were full of
struggle and uncertainty“,
schrieb Eric Hahns Frau
Hannie kürzlich in ihrer
Biografie – „Seine frühen
Jahre waren voller Kampf
Alfred und Rosa Baer mit ihrem Enkel Eric Hahn, 1939. F.: Jeanne Baer. und Unsicherheit.“
39
Erich, der von seinen Eltern seit der Einreise in die USA 1939 als „Eric“ geführt wurde,
besuchte nach seinem Schulabschluss die Universität von New York (NYU) und studierte
Mathematik und Physik. Dort lernte er Hannelore Strassner, genannt Hannie, kennen –
genauer beim Skifahren in Vermont. Sie war die Tochter des deutschen Widerstandskämpfers
Adolf Strassner, der nach einigen Jahren im Nürnberger Stadtgefängnis von Dezember
1935 bis April 1938 in Dachau inhaftiert war. Adolf Strassner machte nach fünfjährigem
Kriegsdienst dann die Erfahrung, dass sich im Nachkriegsdeutschland niemand für die
Schicksale der von Hitler Verfolgten interessierte, und spielte daher sogar mit dem Gedanken,
nach Argentinien auszuwandern. Tochter Hannie kam nach einem Jahr in London
1964 nach New York, um ihre Sprachstudien fortzusetzen.
Für Erics Eltern war von großer Bedeutung, dass die christliche deutsche Hannie nicht
aus einer Nazi-Familie stammte, was sich zufälligerweise verifizieren ließ: Erics Tante Bella
Frank hatte mit einer Dame in New York zusammengearbeitet, die früher mit Adolf
Strassner in Nürnberg befreundet war und die ganze Geschichte bestätigen konnte. 1966
wurden Hannelore und Eric Hahn im Haus von Erics Eltern in Fairlawn NJ vom Bürgermeister
der Stadt getraut.
Eric Hahn war zunächst bei Bendix (heute Honeywell) angestellt und kam in Verbindung
mit der NASA in Huntsville (Alabama), wo das junge Paar dann eine Weile lebte. Daran
schloss sich bei Lockheed in San Jose (Kalifornien) eine interessante Stellung in der
„Guidance and Control“-Abteilung an. Dort war Eric befasst mit wichtigen Weltraumprogrammen
(Skylab, Space Shuttle, Space Teleskop und der Space Station). Er arbeitete auch
mit ehemaligen Pennemünder Wissenschaftlern und der zweiten Generation junger deutscher
Ingenieure zur Unterstützung des amerikanischen Weltraumprogramms zusammen.
Nicht mit den ehemaligen Pennemünder Wissenschaftlern, wohl aber mit den jungen
Deutschen gleichen Alters
bauten Eric und Hannie
Hahn freundschaftliche
Beziehungen auf. Das Thema
NS-Zeit wurde jedoch
gemieden. In den späteren
Jahren kehrte das Ehepaar
Hahn nach New Jersey zurück
und lebte in Teaneck
und Woodcliff Lake.
Da die Ehe der Hahns
kinderlos blieb, konnte
sich Hannie Hahn eine eigene
Karriere aufbauen.
Zunächst arbeitete sie in
Huntsville und später in
Hannelore und Eric Hahn, 2020 in Lumberton/USA. F.: E. Hahn. San Jose als Lehrerin für
40
Spanisch und Musik. Nach der Rückkehr nach New Jersey unterrichtete sie Deutsch und
Spanisch nicht nur an der High School, sondern auch am College (William Patterson University).
Sie promovierte über lateinamerikanische Literatur an der Columbia University.
Die langen Jahre als Lehrstuhlinhaberin und Professorin für Deutsch und Spanisch am
College of Saint Elizabeth bezeichnet sie heute als Erfüllung eines Lebenstraums. Für Hannie
Hahn war es auch wichtig, am dortigen Zentrum für Holocaustforschung mehrmals
jährlich Vorträge zum Leben in Nazi-Deutschland zu halten.
Heute lebt das Ehepaar Hahn in einer ausgedehnten Seniorenwohnanlage in Lumberton
in New Jersey unweit von Philadelphia. Sie besuchten auch in den letzten Jahren immer
wieder Deutschland und die noch hier lebenden Verwandten von Hannie Hahn. Zur Stolpersteinverlegung
nach Bruchsal am 8. Juni 2021 konnten Eric und Hannie Hahn aufgrund
der Coronapandemie bedauerlicherweise nicht reisen, aber es ist zu hoffen, dass der
Besuch bald nachgeholt werden kann.
Biografie von Ida Tuteur geb. Bär (1874-1967)
Von Sean Urban und Josip Kujundzic, Klasse 9v
Ida Tuteur kam am 29. November 1874 als Ida Bär in Mannheim auf die Welt. Sie
war die jüngste Tochter von Babette Weil und Jessaias Machol Bär (ihr Vater starb
mit 66 Jahren an unbekannter Ursache, ihre Mutter mit 54 Jahren an Lungenentzündung)
und die Schwester von Auguste Bär, Max Moses Bär, Michael Myrtill Bär,
Hugo Bär, Henriette Bär, Alfred Baer und Jenny Bär.
Sie besuchte die Schule in Mannheim und in Bruchsal, wo sie nach der Schule im
Haushalt ihres Bruders tätig war. Ida Bär und Max Tuteur (1858-1931) heirateten
am 3. April 1906 in Heidelberg. 1906 zog sie daher nach Kaiserslautern, wo sie bis
1938 ihren eigenen Haushalt führte. Max Tuteur hatte die Volksschule in Winnweiler/Pfalz
besucht und dann die Realschule in Kaiserslautern bis zum Einjährigen.
Max Tuteur war erfolgreich als Pferdehändler und Kaufmann. Unter anderem war
Max Tuteur im ersten Weltkrieg Heereslieferant. In erster Ehe war Max Tuteur verheiratet
mit Amalie Wolf (1857-1905), mit der er zwischen 1886 und 1899 sieben
Kinder hatte. Zusammen waren Max und Ida Tuteur Vermieter eines Mehrfamilienhauses,
in dem Ida Tuteur Hausfrau war. Gleichzeitig wohnten sie auch in dem
Haus und ihr Einkommen betrug 4200 RM. Die Adresse war die Mainzer Straße 6
in Kaiserslautern. Am 1. Juni 1909 erblickte Helmut Julius als einziges Kind aus der
Ehe von Max und Ida Tuteur das Licht der Welt. Gerufen wurde er Herbert.
Frau Tuteur wohnte mit Familie Buhrke, Untermieter von ihr, auf derselben Etage
und im selben Flur. Die ganze Wohnung bestand aus zehn Zimmern, von denen
sie selbst die Hälfte bewohnte, die andere Hälfte stand Familie Buhrke zur Verfügung.
Zusätzlich nutzte Frau Tuteur noch eine Mansarde, die auch als Gastzimmer
diente. Familie Buhrke pflegte mit Frau Tuteur keinen gesellschaftlichen Umgang,
41
Sohn Helmut Tuteur, Einbürgerungsantrag, 1937.
Quelle: www.family-search.com.
42
Frau Buhrke: „Das brachten die damaligen
Zeitumstände mit sich“. Frau Tuteur
ließ sich allerdings von Herrn und Frau
Buhrke in manchen Dingen helfen, da
Herr Buhrke Gruppenleiter einer Organisation
für Inflationsgeschädigte war
und ihr in manchen Belangen Ratschläge
erteilen konnte. Frau Buhrke schrieb für
sie auf der Maschine Klagen für säumige
Mieter. Mit Frau Moser, einer Mieterin
aus dem Hintergebäude, hatte sie in den
letzten Jahren in der Mainzer Straße ein
fast freundschaftliches Verhältnis. Frau
Moser half ihr ab 1936 im Haushalt und
putzte ihre Wohnung. Ab diesem Zeitpunkt
durften Juden keine Dienstmädchen
mehr haben. Später übte sie diese
Tätigkeit heimlich aus, da sie deswegen bei der NSV-Dienststelle vorsprechen musste
und man ihr dort Vorhaltungen machte. Frau Tuteur wird als gebildete Frau beschrieben,
gut situiert, dennoch war sie äußerst sparsam - wobei sie auch am Essen
sparte -, da sie nicht immer die Miete bekam. In der Reichspogromnacht kam ein
uniformierter Mann zur Familie Buhrke und sagte: „sie würden jetzt diese Sachen
der Frau Tuteur zusammenschlagen.“ Frau Buhrke sagte, dass Frau Tuteur immer
eine vorbildliche Vermieterin gewesen sei und dass dazu kein Grund bestehe. Der
Mann ging weg und wollte davon Abstand nehmen, er teilte dies auch den Wartenden
unten an der Straße mit. Daraufhin sagte ein anderer Mann, dass Frau Tuteur
ihm gekündigt hatte. Daraufhin stürmten Leute in die Wohnung und zerstörten
oder beschädigten Möbelstücke und Inventar wie Teppiche und ähnliches, sogar Türen
und Fenster wurden zum Teil herausgerissen. Die Mansarde wurde verschont,
da niemand hinaufging – dort versteckte sich zum Zeitpunkt des Überfalls auch
Ida Tuteur. Ida Tuteur trug den Überfall mit Fassung und sagte zu Familie Buhrke:
„Das ist Judenschicksal“. Frau und Tochter Buhrke halfen Ida Tuteur in den herausgerissenen
Schubladen des Sekretärs dann die Brillantohrringe zu finden, worüber
Ida Tuteur sehr erleichtert war. Unmittelbar danach forderte man sie auf, Kaiserslautern
zu verlassen. Sie zog am nächsten Tag zu ihrem Bruder Alfred Baer nach
Bruchsal, in die Schlossstraße 5 und später in die Bismarckstraße. In die Mainzer
Straße in Kaiserslautern kehrte sie noch zwei oder drei Mal zurück und verschenkte
Teile der Wohnzimmer- und Küchenmöbel sowie Möbel aus der Mansarde an Frau
Moser, als Ausgleich für die Kaution. Möbel, die sonst noch einigermaßen erhalten
waren oder wieder repariert werden konnten, holte sie nach Bruchsal und auch
einzelne Wertgegenstände konnte sie noch mitnehmen. Sie wollte schon 1939 aus-
wandern und ließ sich beim amerikanischen Konsulat in Stuttgart unter Nummer
43700 registrieren. Ihr Sohn Herbert war schon 1937 in die USA ausgewandert. Die
Wartezeit war damals sehr lang und bevor das Visum erteilt werden konnte, fand
die Deportation statt. Ida Tuteur wurde am 22. Oktober 1940 verhaftet und nach
Frankreich abgeschoben.
Im Zeitraum vom 22. Oktober 1940 bis zum 16. März 1946 war sie in 5 Lagern:
22.10.1940-29.11.1941 Camp de Gurs, Frankreich
30.11.1941-14.11.1942 Camp de Levant, Marseille, Frankreich
(Hotel de Levant und Hotel Terminus des Portes)
15.11.1942-30.03.1943 Camp de Nexon, Frankreich
30.03.1943-15.05.1945 Camp de Masseube, Frankreich
15.05.1945-16.03.1946 Camp de Lacaune, Frankreich
Ida erkrankte im Lager Gurs an Ruhr und litt dort an allgemeiner Schwäche und
Nervenerregtheit, mit der Folge: Verschlechterung der Sehkraft. Bei einer Behandlung
in Toulouse sagte man ihr, sie solle mit der Behandlung bis zur Ankunft in den
USA warten. Auch bei zwei vorherigen Arztuntersuchungen teilte man ihr mit, man
könne nichts machen. Noch ein Versuch: es wurde alles Nötige getan, um ihr die
Auswanderung im August 1942 auf dem Schiff „Serpa Pinto“ zu ermöglichen, doch
war zu diesem Zeitpunkt die Ausreise aus Frankreich nicht mehr möglich. Ida reiste
erst am 22. April 1946 aus Frankreich aus, über Spanien nach Lissabon in Portugal,
von wo sie mit dem Flugzeug in die USA flog.
Sie wanderte in Chicago, Illinois ein. Dort lebte sie wohl erst in der Familie ihres
Sohnes, bis sie 1950 im jüdischen Altersheim aufgenommen wurde (Altersheim
Adresse: Drexel Home of Aged Jews, 6140 South Drexel Avenue, Chicago 37 Illinois).
Seit ihrer Befreiung sorgte ihr Sohn in Chicago für sie. In Chicago traf sie
auch eine alte Freundin wieder, Paula Metzger, die sie seit 1909 kannte und mit der
sie sich in Deutschland persönlich traf und schriftlich verkehrte. Auch Ella Schweitzer,
die sie seit 1928 kannte und mit der sie sich in Deutschland entweder in Kaiserslautern
oder in Essen (Frau Schweitzers Wohnort) sehr oft traf, traf sie in Chicago
wieder. Zu beiden Frauen
hatte sie schon 1946, nach
ihrer Ankunft in den USA,
wieder Kontakt. Ida war
US-Bürgerin seit dem
9. November 1951 (Citizenship
Nr. 338611) und starb
am 18. September 1967 in
Chicago im Alter von 93
Jahren.
43
Aus: Aufbau, Ausgabe vom 29.09.1967.
Familie von Jesaias Machol Bär
(Eltern von Alfred Baer und Ida Tuteur)
Jesaias Machol (Isaias Moses) Bär * 06.04.1827 Untergrombach † um 1893
(Sohn v. Machol Bär (1788-1852), Handelsmann in Untergrombach, u. Gella Dürnheimer (1794-1854))
1855 Handelsmann und Schutzbürger in Untergrombach, 1858 Weinhändler und Bürger in Bruchsal,
1875 in Mannheim (1875 Bankrott, 2 Jahre Haft), 1879 in Untergrombach wohnhaft
verh. 15.08.1855 Bruchsal
Babette Weil
* 01.08.1834 Emmendingen † 20.08.1888 Bruchsal
(Tochter v. Moses Weil, Bürger und Handelsmann in Emmendingen, u. Henriette Nelson († vor 1855))
11 Kinder:
1. „Auguste“ Karoline Bär * 07. oder 08.07.1856 Bruchsal † 24.11.1942 Theresienstadt
1899/1902 Spezereihändlerin in Mannh., 1926/42 in Offenbach a.M., Deportation 27.09.1942, unverh.
1 Kind:
a) Emma Bär * 28.05.1882 Untergrombach † 27.05.1940 Offenbach a. M.
1902 Dienstmädchen in Mannheim
vh. 21.06.1902 Höchst Theodor Abow * 15.08.1872 Schwerin † 25.07.1952 Offenbach a. M.
1902 Kellner in Höchst, 1940 in Belgien, 1940 und 1952 in Offenbach wohnhaft
mind. 1 Kind: Max Abow (1904 Ffm.-1966 Offenbach) vh. 1930 Hedwig Kraft (1910 Wiesbaden-?)
2. Max (Moses?) Bär * 01.12.1857 Bruchsal † 27.09.1911 Mannheim
1873 in Karlsruhe, später in Mannheim
verh. 31.01.1884 Karlsruhe
Henriette Straus * 05.02.1862 Diedelsheim † 22.07.1940 Mannheim
5 Kinder:
a) Jenny Bär * 04.11.1884 Mannheim † 1972 Tel Aviv/Israel
vh. 31.10.1907 Mannheim Albert Kissinger * 20.03.1881 Bad Kissingen † 1941 Israel
2 Kinder: Max Kissinger (1908-1976), Jerusalem; Ernst Kissinger (1910-1994), Tel Aviv
b) Hilda Bär * 30.10.1885 Mannheim † 05.09.1925 Mannheim (?)
beerdigt in Mannheim, unverheiratet
c) Moritz Richard Bär * 29.09.1886 Mannheim † 09.03.1943 Majdanek, KZ
Kaufmann in Mannheim u. Karlsruhe; 04.1937 in Niederlande emigriert; über Drancy nach Majdanek
vh. 24.11.1920 Berlin Gertrud Maria Rohde * 04.10.1890 Dortmund † 1977 USA
1 Kind: Margarete Ellen Bär * 30.09.1917 Mannheim † ?? (1938 Emigration 1938 in USA mit Mutter)
d) Bertha Bär * 29.03.1888 Mannheim † 16.10.1942 Camp de Noe/F
wohnhaft in Bad Kissingen und Mannheim; 22.10.1940 Deportation nach Gurs; unverheiratet
e) Hellmuth Bär * 18.06.1890 Mannheim † 19.05.1946 Shanghai/China
vh. Hedwig Wolf * 06.04.1902 Rastatt † 02.09.1942 Auschwitz; 2 Ki.
3. Michael Myrtill Bär * 22.02.1859 Bruchsal † 25.01.1941 Mainz
seit 1888 Fruchthändler in Worms; 1937-1941 im jüd. Krankenhaus Mainz, beerdigt in Worms
vh. 1. Ehe: Johanna Haas * 1870 Eich bei Worms † 02.06.1915 Worms
44
vh. 2. Ehe: 12.07.1922 Berta Rothschild * 05.08.1860 Neustadt/Odw. † 10.12.1926 Worms
vh. 3. Ehe: 19.05.1927 Lina Weil * 04.03.1868 Gailingen † 25.09.1935 Bad Homburg v.d.H.
1 Kind (aus 1. Ehe):
a) Albert Bär * 30.03.1896 Worms † 28.10.1915 (vermisst 1. WK)
Kaufmann in Worms
4. Hugo Bär * 04.04.1860 Bruchsal † 29.12.1922 Bruchsal
1893 Kaufmann; 1897: Württemberger Str. 9; 1922: Moltkestr. 15 (Grab in Bruchsal erhalten)
verh. 08.01.1893 DA-Arheilgen
Julie (Julchen) Kahn * 10.09.1865 in DA-Arheilgen † 20.10.1922 Bruchsal
2 Kinder:
a) Betty Bär * 14.12.1893 Bruchsal † 1941/1945
wohnhaft in Bruchsal und Frankfurt/Main; Deportation am 11./12.11.1941 ins Ghetto Minsk
b) Paula Bär * 19.07.1897 Bruchsal † 1941/1945
Kaufhausbesitzerin „Zum wahren Jakob“ Hufnagelstr. 22, Frankfurt; 11.11.1941 Deportation Minsk
vh. Sally Stern * Friedberg bei Ffm. † 15.03.1930 Frankfurt/M.
1 Kind: Hildegard Stern * 21.05.1928 Frankfurt/M., Deportation 11.11.1941 nach Minsk, † 1941/1945
5. Henriette „(Hedwig)“ Bär * 02.07.1861 Bruchsal † nach 1877
1877 Kleidermacherin in Mannheim {keine weiteren Angaben}
6. Oscar Bär * 18.11.1862 Bruchsal † 25.11.1862 Bruchsal
gestorben an „Kieferklemme“, begraben auf dem jüdischen Friedhof in Obergrombach
7. Alfred Baer * 03.11.1864 Bruchsal † 15.12.1940 Gurs/Frankreich
1892 Kaufmann, Weißwarengeschäft Friedrichstraße 29, Bruchsal, Deportation 22.10.1940 Gurs
verh. 17.11.1892 Bruchsal
Rosa Schönmann * 16.12.1869 Neu-Isenburg/Hessen † 19.01.1941 Gurs/Frankreich
(Tochter v. Elias Schönmann (1836-1896), Kaufmann in Neu-Isenburg, u. Mariam Fürth (1839-1908))
3 Kinder:
a) Erna Babette Baer * 22.08.1894 Bruchsal † 03.12.1896 Bruchsal
Grab in Bruchsal erhalten (Nr. 305)
b) Ernst Baer * 05.07.1899 Bruchsal † 23.04.1959 New York/USA
Kriegsteilnehmer 1914/18; vor 1937 Kaufmann in Essen; 03.09.1937 Emigration USA, wohnhaft NY
vh. 07.09.1937 Lawrence/NY Julia de Vries * 16.08.1914 Essen † 01.03.1981 Closter/NJ
13.01.1937 in USA eingewandert
1 Ki.: Dr. Leslie Baer * 09.05.1939 NY † 26.11.2002, vh. Dr. Jeanne Willner (3 Ki: Oliver, Nicholas, Naomi)
c) Anna „Anny“ Baer * 01.07.1904 Bruchsal † 11.12.1987 Bergen/NJ
vh. 12.09.1929 Bruchsal Leopold Hahn * 16.10.1896 Auerbach † 05.09.1970 Fairlawn/NJ
Kaufmann in Br.; 1939 in USA; 1940 zus. m. Fam. Ernst Bär in NY; ~ 1958 – 1973/74 in Fairlawn/NJ
1 Kind: Erich „Eric“ Hahn * 27.06.1933 Karlsruhe vh. 1966 Hannelore Strassner; in Lumberton/NJ
8. Jenny Bär * 21.03.1867 Bruchsal † 21.05.1940 Grafeneck, Tötungsanstalt
Putzmacherin, bis 1885 in USA; seit 1896 in versch. Anstalten: Heidelberg, Wiesloch, Pforzheim, Hub
1 Kind:
a) Berta Bär vh. Reis * 12.12.1895 Frankfurt (?) † nach 1938
seit 12.1938 in Anstalt Weilmünster bei Frankfurt {keine weiteren Angaben}
45
9. Bernhard Bär * 30.07.1868 Bruchsal † 15.08.1868 Bruchsal
beerdigt in Obergrombach
10. Frida Bär * errech. 1869 Bruchsal † 29.12.1871 Bruchsal
11. Ida Bär * 29.11.1874 Mannheim † 18.09.1967 Chicago/IL
1906-1938 Kaiserslautern; seit 11.1938 Bruchsal, Schloßstr. 5; Deportation 1940 Gurs; 1946 USA
verh. 03.04.1906 Heidelberg
Max Tuteur * 05.04.1858 Winnweiler † 15.10.1931 Kaiserslautern
Pferdehändler in Kaiserslautern (1. Ehe mit Amalie Wolf (1857-1905), 7 Kinder)
1 Kind:
a) Herbert (Helmut Julius) Tuteur * 01.06.1909 Kaisersl. † 13.01.1995 San Diego/CA
Emigration 04.1937 in USA; kinderlos
vh. 25.05.1948 Cook/IL
Gertrude Schweitzer * 25.01.1910 Gelsenkirchen † 19.06.1994 San Diego/CA
Ernst Baer mit Erich Hahn, um 1935
im Bruchsaler Schlossgarten. F.: J. Baer.
Grabsteine von Babette Bär (1834-1888), Erna Bär (1894-1896)
sowie Hugo und Julie Bär. Jüd. Friedhof Bruchsal. Fotos: F. Jung.
46
Leslie, Julia und Ernst Baer, um 1960
in den USA. Foto: Jeanne Baer.
Biografie von Siegbert Kann (1903-1942)
von Aaron Kammerer, Klasse 10u
Siegbert Kann kam am 15. Juli 1903 in Ehringhausen im Kreis Wetzlar zur Welt. Er hatte
noch einen jüngeren Bruder, Ludwig Kann (†1951). Dieser wohnte 1939 in Köln und half
Siegbert und seiner Familie bei der Flucht. Ob es noch weitere Geschwister gab, ist unbekannt.
Die Eltern waren Leopold und Julie geb. Cahn. Der Vater Leopold Kann war in
Ruttershausen geboren und lebte in Ehringhausen, Düren und Wetzlar. Am 11. Juni 1942
wurde er von Frankfurt aus nach Sobibor deportiert.
Bei der Firma Stern, May und Cie. in Frankfurt/Main vollendete Siegbert Kann im März
1922 seine Lehre, wobei ihm ein Jahr infolge guter Leistungen erlassen wurde. Danach
unterstand ihm zeitweise die Expedition der Firma, die er – laut Zeugnis von 1925 – mit
Geschick und Umsicht leitete. Später war er am Lager und im Verkauf beschäftigt und mit
dem Besuch der Stadtkundschaft betraut, und es wird ihm Fleiß, Tüchtigkeit und Arbeitswilligkeit
attestiert. 1925 schied er dort aus, um sich vermehrt der Reisetätigkeit widmen
zu können.
Nach der Hochzeit mit der evangelischen
Elisabeth Rau am 17. März 1929
in Frankfurt und der Geburt des Sohnes
Werner zog die Familie am 15. September
1929 nach Bruchsal, zunächst in
den Bannweideweg 2a. 1932 und 1934
kamen die Töchter Gisela und Eleonore
in Bruchsal zur Welt. Seit 1933 wohnte
Familie Kann in der Kaiserstraße 78 in
Bruchsal im 2. Obergeschoss. Ein Nachbar
erinnerte sich später: „Er war ein ruhiger,
feiner Mann.“
Für die „Erste Bruchsaler Herdfabrik“
Elise und Siegbert Kann mit Eleonore, Gisela und
Werner, 1935/36 in Mannheim. Foto: Heinrich Weller.
übte Siegbert Kann als Vertreter eine Reisetätigkeit in der gesamten Pfalz aus, in einem
Gebiet, das sich von Germersheim bis Saarbrücken und Alzey erstreckte. Das brachte es
mit sich, dass er unter der Woche häufig unterwegs übernachten musste. Vom Geschäftsführer
der ersten Bruchsaler Herdfabrik wurden die beruflichen Schwierigkeiten 1950 so
beschrieben: „Herr Kann war bei uns als Reisender beschäftigt und ab dem Jahr 1933 hatte
er auf Grund der damaligen politischen Verhältnisse bei der Kundschaft mit Schwierigkeiten
zu rechnen. Wir hatten aber mit Herrn Kann vereinbart, dass wir ihn solange beschäftigen
werden als er in der Lage ist, den Posten als Reisender auszufüllen. Im Jahr 1937 hat
sich Herr Kann von der Unmöglichkeit, weiterhin für uns tätig zu sein, selbst überzeugt
und sich entschlossen, nach Argentinien auszuwandern.“ Siegbert Kann gab seine Anstellung
bei der Ersten Bruchsaler Herdfabrik am 1. November 1937 auf und plante mit seiner
Familie dann, nach Bolivien auszuwandern um sich mit seiner Familie dort als Landwirt
47
eine neue Existenz aufzubauen. Dazu absolvierte er vom 1. Juni 1938 an eine dreimonatige
Eignungsprüfung als landwirtschaftlicher Arbeiter im Landwerk Neuendorf bei Berlin.
Die Auswanderung scheiterte zunächst an den fehlenden finanziellen Mitteln.
Am 11. November 1938 wurde Siegbert Kann das erste Mal verhaftet. Er verbrachte fünf
Wochen im Konzentrationslager Dachau. Nach seiner Entlassung aus Dachau wurde der
Alltag für Siegbert Kann und seine Familie immer unerträglicher. Siegbert emigrierte am
6. Juli 1939 illegal nach Belgien, um in Brüssel das Geld für die Auswanderung nach Südamerika
zu organisieren. Elisabeth und die drei Kinder folgten ihm auf einer Schmugglerroute
über die belgisch-deutsche Grenze Mitte August 1939.
Unerwartet wurde Siegbert Kann am 10. Mai 1940 auf dem Weg zum Zollamt in Brüssel
verhaftet. Siegbert kam in das Internierungslager St. Cyprienne in Südfrankreich und
am 10. September 1940 weiter in das Internierungslager Gurs. Am 6. August 1942 wurde
Siegbert Kann über Drancy in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Hier wurde
Siegbert Kann am 29. September 1942 umgebracht.
Biografie von Elisabeth Kann geb. Rau (1903-1985)
von Florian Jung
Elisabeth Babette Rau wurde am 6. Juli 1903 in Diedesheim bei Mosbach als Tochter des
evangelischen Bahnarbeiters Andreas Rau und seiner Frau Karoline geb. Wielandt geboren.
Elisabeth, genannt „Elies“, wuchs mit den Brüdern Ernst, Georg, Karl und Wilhelm
und den Schwestern Lina, Käthe, Hedwig und Paula auf. In Diedesheim besuchte sie die
Volksschule.
Nach der standesamtlichen Trauung mit Siegbert Kann am 17. März 1929 erfolgte am
24. November 1929 die Trauung nach jüdischem Ritus in der Hauptsynagoge Frankfurt,
wobei Rabbi Salzberger bescheinigte, dass „Frau Kann nach gehöriger Vorbereitung von
mir ins Judentum aufgenommen“ wurde. Zwischen beiden Trauungen lag die Geburt des
Sohnes Werner und der Umzug nach Bruchsal. Dort wurden 1932 bzw. 1934 die beiden
Töchter Gisela und Eleonore geboren. Der Umzug in die geräumige Wohnung im Hause
des jüdischen Metzgermeisters Hagenauer erfolgte 1933. Dort musste Elisabeth Kann
erleben, wie sie und ihre Kinder vermehrt antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt wurden.
Eine besondere Belastung ging von einem Metzger aus, der die Metzgerei seit 1935
gepachtet hatte, „alter Kämpfer“ der NSDAP war und gemeinsam mit seiner Familie auch
im Haus wohnte. Besonders die Frau des Metzgers war „eine aktive und aggressive und
gehässige Frauenschaftlerin und Judenhetzerin, und es ist nicht zu beschreiben, welchen
heimtückischen, boshaften und aggressiven Verleumdungen und Schikanen und Denunziationen
ich und Frau Hagenauer ausgesetzt waren.“ Einmal beobachtete Elisabeth Kann,
wie diese Frau ihrer Tochter Gisela im Hof auf den Finger trat. „Als ich dies sah und die
Kinder heulten, während ihre Töchter auf meine Kinder spuckten, konnte ich mich nicht
mehr beherrschen und verwehrte ihnen die Anpöbeleien, worauf sie in Hohngelächter
48
ausbrach.“ Am folgenden Tag erhielt Elisabeth Kann daraufhin durch den Metzgermeister
im Keller Schläge ins Gesicht, „bis ich zusammenbrach. Währenddessen stand seine Frau
mit gespreizten Füßen am Kellerausgang und wollte mich nicht herauslassen.“ Für mehrere
Tage war Elisabeth Kann bettlägerig und in der Folge gallenkrank, was eine Operation
und einen vierwöchigen Aufenthalt im Bruchsaler Krankenhaus nach sich zog. Zeitlebens
hatte Elisabeth Kann von diesem Überfall enorme Einschränkungen der Sehfähigkeit des
linken Auges. Siegbert Kann hatte am Tag nach seiner Rückkehr Anzeige gegen den Metzgermeister
erstattet. Beim Gerichtsverfahren sagte der junge Gerichtsassessor, sie müsse
die Klage zurückziehen, „andernfalls bestellten sie 100 SS- und SA-Männer.“
Auf Anraten ihres Arztes Dr. Mai
zog die Familie im folgenden Jahr,
1937, in die Bismarckstraße 3, in
das Haus des Fabrikanten Julius
Weil. Da Siegbert Kann inzwischen
arbeitslos geworden war, wurden
zwei der fünf Zimmer an jüdische
Mitbürger vermietet, zum Beispiel
die Lehrerin der Judenklasse. Durch
Flick- und Näharbeiten und andere
Hausarbeiten konnte Elisabeth
Elisabeth Kann (re.) mit Tochter Gisela. Foto: M. Carrancejie.
Kann viel zur Ernährung ihrer Familie
beitragen. Da eine Auswanderung
nicht so schnell möglich war, flüchtete ihr Mann im Juli 1939 nach Brüssel, und sie
folgte mit den Kindern nach. In Brüssel fanden sie eine möblierte, aber feuchte Wohnung.
Da Siegbert und Elisabeth Kann als illegale Einwanderer keine Arbeitserlaubnis erhielten,
schlugen sie sich mit Gelegenheitsarbeiten durch und überlebten mit Unterstützung
des jüdischen Hilfskomitees und Päckchen von Elisabeths Verwandten aus Deutschland.
Nach der plötzlichen Verhaftung ihres Mannes und einer eintägigen Internierung von
sich und den Kindern flüchtete Elisabeth mit den drei Kleinen für sechs Wochen quer
durch Nordfrankreich. Schließlich mussten sie nach Brüssel zurückkehren. Als Putz- und
Waschfrau verdiente sie den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder. Auf dem deutschen
Konsulat fand sie schließlich unerwartet Hilfe vor drohenden Deportationen in den Osten:
Man stellte ihr illegal einen Pass ohne „J“ aus und organisierte ihre Rückkehr nach
Deutschland. Am 30. November 1941 konnte sie daher mit dem Zug in ihren Heimatort
Diedesheim zurückkehren und wurde von ihrem Vater und ihren Geschwistern aufgenommen.
„Abgemagert und krank wie ich war, schlugen Bekannte vor Schreck die Hände
zusammen, als sie mich wieder sahen.“ Im August 1942 wurde ihr ein kleines Häuschen
in Diedesheim vermietet, in das sie zusammen mit ihren Kindern und ihrem Vater gegen
den Widerstand der politischen Leiter einzog. Da sie keine Lebensmittelmarken bekamen,
musste Elisabeth bis Kriegsende hart auf Bauernhöfen und in einer Konservenfabrik
arbeiten. Am Kriegsende, aber auch immer wieder im Laufe der Jahre seit 1936, war
49
Elisabeth physisch und psychisch derart ruiniert, dass sie kaum noch Kraft hatte, weiterzumachen.
Der elfseitige Bericht, den sie 1960 verfasste, gibt detailliert Auskunft über das
unvorstellbar harte Los dieser doch starken Frau, immer getrieben von der Sorge um ihre
drei Kinder. Im Juli 1946 zog sie mit ihren Kindern nach Bruchsal zurück. Ihnen wurde
eine Wohnung im Schubertweg 10 zugewiesen. Dort erholte sie sich nur langsam. 1949
wanderten ihre beiden ältesten Kinder aus, und im November 1951 emigrierte sie völlig
mittellos zusammen mit ihrer jüngsten Tochter nach New York. 1960 und dann nochmals
in den 70er Jahren kehrte sie nach Deutschland zurück, um ihre Geschwister und
Verwandten zu besuchen. 1967 zog sie nach Newburgh/NY zu ihrem Sohn Werner. Am
28. März 1985 starb Elisabeth Kann. Beerdigt wurde sie in Gardner Town/NY. Auf ihren
Grabstein ließ sie auch den Namen ihres Mannes Siegbert eingravieren.
Biografie von Werner Kann (1929-2017)
von Theo Fraißl und Noah Wagner, Klasse 10v
Werner Emil Kann wurde am 3. Juni 1929 in Frankfurt/M. geboren und zog als Säugling
mit seinen Eltern Siegbert und Elisabeth Kann nach Bruchsal, wo 1932 und 1934 die jüngeren
Schwestern Gisela und Eleonore geboren wurden. Als Werner Kann schulpflichtig
wurde, besuchte er die jüdische Schule in Bruchsal: Eine reguläre Schule war für jüdische
Kinder zu diesem Zeitpunkt bereits verboten. Die Schule wurde 1938 geschlossen und
Werner musste zusammen mit seiner kleinen Schwester Gisela täglich zur jüdischen Schule
nach Karlsruhe mit dem Zug fahren. Auf der Zugfahrt und auf den Bruchsaler Straßen
wurden Werner und seine Schwestern bespuckt, beschimpft und tyrannisiert. „Mein Sohn
Werner bekam durch alle diese Verfolgungen nachts Alpträume und Angstzustände“, berichtete
Mutter Elisabeth Kann später. Im August 1939 flüchtete die Familie nach Brüssel,
wo die Kinder die Prinz-Albert-Schule besuchten. Nach der Verhaftung des Vaters im
Mai 1940 und einer sechswöchigen Flucht durch Frankreich kam Elisabeth Kann mit den
drei Kindern wieder nach Brüssel zurück, wo Werner wieder dieselbe Schule besuchte. Da
den Kindern die Verhaftung in Belgien drohte, übersiedelten sie im November 1941 nach
Neckarelz zu Elisabeths Vater und Geschwistern. Werner kam zunächst bei seiner Tante
Hedwig Bock in Diedesheim unter.
Elisabeth Kann: „Hauptlehrer
Max Braun als rassisch-politischer
Leiter und seine Obernazis duldeten
auch keine Juden in der
Schule. So habe ich einen Kampf
geführt mit diesen politischen
Dummköpfen, welche mit mir
auf der Schulbank in Diedesheim
Werner und Joyce Kann, um 1965. Foto: Margo Carrancejie. saßen und von mir ihre Hausauf-
50
gaben abschrieben. […] Nach längerem Hin und Her
duldete [Lehrer Gefäller in Neckarelz] die Kinder in
der Schule.“ In den Schulferien arbeiteten die Kinder
in einer Konservenfabrik mit, um den Lebensunterhalt
zu verdienen. Nach den Herbstferien 1942 und
einem Lehrerwechsel konnten die Kinder die Volksschule
in Diedesheim besuchen, „doch schlimm waren
die Misshandlungen der Kinder in Diedesheim
auf dem Schulweg durch die anderen Kinder. […] Als
1945 alle Mischlinge und Juden nach Theresienstadt
kamen, versteckte ich meinen Sohn bei Freunden in
Neckarelz, da man mir erneut mit Exportation und
Werner Kann, um 2015. F.: Ellen Kann.
Gaskammer drohte.“
Bereits am 1. Juni 1945 begann Werner Kann eine Lehre zum Werkzeugmacher bei der
Siemens & Halske AG in Bruchsal. Nach deren Abschluss drei Jahre später arbeitete er
dort weiter bis zu seiner Auswanderung nach New York Ende Mai 1949. Dort arbeitete er
als Schlosser bis zu seiner Einberufung zum Militärdienst im Januar 1951. Nach zweijähriger
Dienstzeit arbeitete Werner Kann weiter als Schlosser, besuchte aber nebenher abends
die Universität von New York und belegte mathematische und technische Fächer, um seine
Ausbildung zu vervollständigen. 1958 heiratete er Joyce Laird, die Tochter Ellen wurde
geboren. 1983 kam Werner Kann als IBM-Mitarbeiter der Versuchs- und Einzelfertigung
zu Leitz und Leica in Wetzlar und besuchte auch seine Verwandten im Schwäbischen.
Ihren Lebensabend verbrachten Joyce und Werner Kann in Florida.
Biografie von Gisela Michtavy/Carrancejie
geb. Kann (1932-2009)
von Theo Fraißl und Noah Wagner, Klasse 10v
Gisela Kann. F.: M. Carrancejie.
Gisela Juliane Kann wurde am 31. März 1932 als zweites
Kind von Elisabeth und Siegbert Kann in Bruchsal geboren.
Sie erkrankte im Oktober 1934 schwer an Kinderlähmung,
musste im Kinderklinikum Karlsruhe behandelt werden und
schwebte vier Wochen in Lebensgefahr. Da Siegbert Kann
ständig auf Reisen war, kam Paula Rau, die 14-jährige jüngste
Schwester von Elisabeth Kann, nach Bruchsal, um die beiden
anderen Kinder zu versorgen. Der Aufenthalt Paulas „bei Juden“
wurde allerdings angezeigt, sodass sie bei der Gestapo
vorsprechen musste. Bei Gisela blieb infolge der Kinderlähmung
eine Behinderung zurück. Zu ihrem weiteren Lebens-
51
lauf schrieb Gisela Kann: „Bei Beginn meiner Schulpflicht
Ostern 1938 wurde ich als Jüdin von der Volksschule in
Bruchsal nicht mehr aufgenommen. Von Ostern 1939 an
fuhr ich mit meinem Bruder Werner Kann nach Karlsruhe
um die dortige jüdische Volksschule zu besuchen. Als wir
von anderen Kindern im Zug verhöhnt und misshandelt
wurden, nahmen mich meine Eltern von der Schule heraus,
weil ich die Strapazen und Misshandlungen im Zug nicht
mehr ertragen konnte. […] Im September 1939 wurde ich
in Brüssel in die erste Volksschulklasse der „Prinz Albert
School“, Chaussee de Anvers, aufgenommen. Mit Unterbrechungen
durch Kriegseinfluss besuchte ich diese Schule bis
Ende November 1941. […] Von Januar 1942 bis Juli 1946
besuchte ich die Volksschule in Neckarelz und Diedesheim.
Im August 1946 zogen wir […] in meine Geburtsstadt zurück.“ Im August 1947 erhielt sie
an der Freiherr-vom-Stein-Schule ihr Abschlusszeugnis der 8. Klasse. „Durch diese vielen
Unterbrechungen als rassisch Verfolgte hatte ich eine sehr mangelhafte Volksschulausbildung,
welche es mir unmöglich machte, einen Beruf zu erlernen.“ Schulleiter Palm aus
Diedesheim berichtete später, dass er Gisela und auch ihren Bruder Werner als fleißig und
begabt in Erinnerung hatte, „eine in jeder Hinsicht überdurchschnittliche Schülerin, die
gerne eine höhere Schule besucht hätte, wenn dieses damals möglich gewesen wäre. Beide
talentierten Kinder taten mir oft in der Seele leid, wenn sie von anderen Kindern infolge
ihrer Abstammung als minderwertig angesehen wurden, und ich musste sie öfters gegen
alle möglichen Arten von heimtückischen Übergriffen schützen.“
Wie aus den Wiedergutmachungsakten hervorgeht, war Gisela wegen Entwicklungsstörungen
im Jahr 1948 einige Monate im Hospital Bergen-Belsen, dann zum Jahreswechsel
1948/49 in Mergentheim, Diagnose: körperliche und nervliche Erschöpfung, Neurasthenie
(heute: Burn-out-Syndrom), Sprachfehler. Dort wurde sie für eine Ansiedlung in Israel
angeworben und bereitete sich im Anschluss im Warburg Kinderheim in Blankenese auf
ihre Auswanderung im Dezember 1949 vor (Operation Exodus). Am Tag nach ihrer Ankunft
trat sie in den Kibbuz Maos-Chajim bei Beth-Schean ein. Rasch trat eine körperliche
und seelische Erholung ein, und sie konnte dort als Krankenschwester arbeiten und später
Soldatin in der israelischen Armee werden. Nach ihrer Heirat im Januar 1954 wurden
die Söhne Zion Michtavy und Shlomo Michtavy in den Jahren 1954 und 1955 geboren.
1957 siedelte Gisela mit ihren Söhnen nach New York über und heiratete in zweiter Ehe
den Marinecorporal Frank Carrancejie. Die Tochter Margo wurde 1962 geboren, Sohn
Frank jr. schließlich 1968. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes 1994 siedelte sie für ihren
letzten Lebensabschnitt von New York nach Anderson in Indiana zu ihrer Tochter Margo
über, wo sie als mehrfache Großmutter und Urgroßmutter am 8. März 2009 starb. Beerdigt
wurde sie an der Seite ihres Mannes auf dem Calverton National Cemetery in New York,
einem Soldatenfriedhof.
52
Gisela Carrancejie geb. Kann.
Foto: Margo Carrancejie.
Biografie von Eleonore Kramer geb. Kann
(1934-2010)
von Theo Fraißl und Noah Wagner, Klasse 10v
Am 18. Mai 1934 wurde Eleonore Karola Kann als jüngstes Kind von Siegbert und Elisabeth
Kann in Bruchsal geboren. Über ihre Kindergartenzeit schrieb Mutter Elisabeth
später: „Ich schickte [die Kinder] in den katholischen Kindergarten, damit sie tagsüber
wenigstens etwas spielen konnten und vor den Verfolgungen der Nazis Ruhe hatten.“ Als
Eleonore Bruchsal im Juli 1939 verließ, war sie gerade fünf Jahre alt, und sicher war die
Flucht eine große Strapaze für sie. Nach dreitägigem Aufenthalt bei Onkel Ludwig Kann in
Köln wurde die Mutter Elisabeth mit den drei Kindern von Schleusern innerhalb von drei
Nächten über die belgische Grenze gebracht, wobei die Gruppe in einer der Nächte über
Wiesen und Felder marschieren musste und auch Bäche durchquerte. „In der 3. Nacht
kamen wir alle wohlbehalten, doch durchnässt, todmüde und zerrüttet in Brüssel auf dem
Jüdischen Hilfskomitee an, wo mein Mann auf uns wartete.“
Die zweite Flucht nach der Verhaftung des Vaters im Mai
1940 war noch wesentlich dramatischer: „Aus Angst gegen
erneute Verfolgungen durch die deutschen Dienststellen und
die Gestapo floh ich mit meinen Kindern und zwei anderen
deutschen verfolgten Frauen im großen Flüchtlingsstrom nach
Frankreich. Nach wochenlangem Fußmarsch kreuz und quer
durch Belgien und Frankreich zwischen den Fronten wurden
wir auf den Wegen nach Paris von der deutschen Wehrmacht
überholt. Wir kehrten nach drei Verhaftungen und großen
Strapazen mit blutunterlaufenen Fußsohlen, fußkrank, elend
und erschöpft nach Brüssel zurück.“
In Brüssel wurde Eleonore 1940 an der Prinz-Albert-Schule
eingeschult. Nach der Rückkehr nach Deutschland besuchte sie in Neckarelz und Diedesheim
die Volksschule und, ab 1946, in Bruchsal. „Nach meiner Volksschulentlassung in
Bruchsal Ostern 1948 war meine Schulbildung infolge Emigration und Flucht so mangelhaft,
dass ich nicht in eine Oberschule oder Berufsschule aufgenommen wurde“, schrieb
sie später. Von Juni 1950 bis Juli 1951 arbeitete Eleonore als Büroangestellte beim Wellpappenwerk
in Bruchsal. Mit ihrer Mutter reiste sie vom 24. November bis 2. Dezember
1951 mit dem Schiff von Bremerhaven nach New York. Dort arbeitete sie zunächst als
Fabrikarbeiterin, bildete sich seit Oktober 1952 an der George-Washington-Highschool
in Abendkursen in Englisch, Stenographie und Buchhaltung fort und konnte ab Oktober
1953 als Büroangestellte bei Franklin Stores Inc. arbeiten. Sie wohnte bei ihrer Mutter bis
zu ihrer Verheiratung mit Karl Kramer im November 1960 in 36 Sickles St., New York.
Die Kinder Audrey und Dean wurden 1962 und 1964 geboren. Später wohnte Eleonore
Kramer auch in Boynton Beach in Florida. In Hicksville/NY starb sie am 24. Mai 2010.
53
Eleonore Kramer geb. Kann.
Foto: Margo Carrancejie.
Familie Siegbert und Elisabeth Kann
Siegbert Kann
* 15.07.1903 Ehringhausen/Wetzlar † 29.09.1942 Auschwitz
(Sohn von Leopold Kann (1876-1942) und Julie Cahn)
Kaufmann, Reisender; wh. in Frankfurt; 1929-1939 Bruchsal; Belgien; 1940-1942 Gurs; 08.1942 Auschwitz
verh. 17.03.1929 Standesamt Frankfurt/M.; 24.11.1929 Hauptsynagoge Frankfurt/M.
Elisabeth Babette Rau * 06.07.1903 Diedesheim/Mosbach † 28.03.1985 Boca Raton, FL
(To. v. Andreas Rau (1874-1961), Bahnbeamter in Neckarelz, u. Karoline Wielandt (1876-1933), beide evgl.)
1929-1939 Bruchsal; Belgien; 11.1941 Neckarelz; 1946-1951 Schubertweg 10, Br.; 11.1950 nach NY
3 Kinder:
1. Werner Emil Kann * 03.06.1929 Frankfurt/Main † 22.11.2017 Boca Raton, FL
1945-1948 Werkzeugmacherlehre in Bruchsal, 1949 nach USA; wh. in New York und Florida
verh. 07.09.1958 Newburgh, NY
Joyce Marie Laird * 31.07.1937 † 03.04.2013 Pompano Beach, FL
1 Kind: Ellen Kann (*1965), New York
2. Gisela Juliane Kann * 31.03.1932 Bruchsal † 08.03.2009 Anderson, Indiana
1932-1939 sowie 1946-1949 Bruchsal; 12.1949 Auwanderung nach Israel; 1957 nach New York
verh. 1. Ehe 14.01.1954 Israel
Michtavy
verh. 2. Ehe
Frank A. Carrancejie * 04.02.1924 San Juan/ Puerto Rico † 29.01.1994 Jamaica, NY
Corporal im US Marine Corps während des 2. Weltkriegs; wh. in New York
4 Kinder: Zion Michtavy (*1954), Shlomo Michtavy (*1955), Margo Carrancejie (*1962),
Frank Carrancejie jr. (*1968)
3. Eleonore Karola Kann * 18.05.1934 Bruchsal † 24.05.2010 Hicksville, NY
Büroangestellte; 1934-1939 sowie 1946-1951 Bruchsal; 11.1951 Auswanderung in USA
verh. 20.11.1960 New York
Karl Charles Raymond Kramer * 22.07.1930
2 Kinder: Audrey L. Kramer (*1962); Dean C. Kramer (*1964)
54
Grabstein von
Elisabeth Kann
mit der Nennung
ihres in Auschwitz
ermordeten
Mannes.
Grabstein von
Gisela Carrancejie. F‘s.:
www.findagrave.com.
Rückblick auf die fünfte Bruchsaler
Stolpersteinverlegung am 27. März 2019
Die Schüler stellten in der gut besuchten Aula des Justus-Knecht-Gymnasiums Bruchsal
die Biografien einer Familie in Wort und Bild vor, gefolgt von der Ansprache eines Angehörigen.
Für die Familien sprachen Gerhard Lorch, Meike Westheimer und Nitza
Perlman. Von großer Symbolkraft war eine Bemerkung der Bravmann-Enkelin Mirjam
Chitman: Während der Gedenkveranstaltung erhielt sie eine SMS aus Israel. Sie war just
in diesem Moment erstmals Uroma geworden.
Bismarckstr. 12 (Lindauer): Großneffe Gerhard Lorch (Bildmitte), Familie
Robert Levinson sowie Angehörige von Hans Lindauers holländischen Pflegeeltern:
Die Familien van Meekren, van Dijk und Justitz. Fotos: Florian Jung.
Schwimmbadstr. 27 (Westheimer):
Kerstin, Sonja und
Meike Westheimer.
Orbinstr. 7 (Majerowitz): Die Enkelkinder Yael Oren (2.v.l.), Neora
Eden (3.v.l.), David Maor (7.v.l.), Nitza Perlman (8.v.l.), Nechama
Oron (9.v.l.) und Ruthi Almog (11.v.l.) mit Angehörigen.
55
Friedrichstr. 76 (Bravmann): Orly Bravmann,
Rolf Schmitt, Mirjam Chitman
mit Kindern Sharon, Orit und Gadi.
Rückblick auf die sechste Bruchsaler
Stolpersteinverlegung am 11. Februar 2020
Erstmals wurden in den
Ortsteilen Bruchsals Stolpersteine
verlegt: Auf Initiative
von Inge Schmidt,
Monika und Rüdiger Czolk
und Steffen Maisch in Heidelsheim
für Ida und Emanuel
Maier. Arye Nitzan,
der 83-jährige Großneffe,
war mit seiner Familie von
Israel nach Bruchsal gereist.
Auf dem Jüdischen Friedhof
in Waibstadt konnten
tags darauf Grabsteine der
Vorfahren gefunden werden,
der älteste aus dem
Jahr 1792.
Arye und Bilha Nitzan (Mitte) mit den Töchtern Chani Fisher (2.v.l.),
Noa Fisher (3.v.l.), Efrat Weizman (2.v.r.), Schwiegersohn Shimi
Weizman (r.) und Enkelin Nitzan Fisher Conforti (l.). Foto: F. Jung.
Irene Zeh u. Angehörige mit Günter Demnig. F.: Karl-Heinz Malzer.
In Helmsheim setzte sich Bernhard
Schührer für die Verlegung
von Stolpersteinen für den polnischen
Zwangsarbeiter Josef
Makuch und die Helmsheimerin
Hilda Eissler ein. Anlässlich der
Stolpersteinverlegung konnte
deren Tochter Irene in Kontakt
mit ihrem Halbbruder in Polen
kommen. Bei der würdig gestalteten
Gedenkfeier in der bis auf
den letzten Platz besetzten Alten
Kelter in Helmsheim beindruckten
Historiker und Angehörige
mit ihren Schilderungen der Lebensläufe.
56
Die am 8.6.2021 verlegten Stolpersteine wurden gespendet
von: für: Ort:
Brigitte Olsen, Bruchsal Mathilde Schloßberger Holzmarkt 30
Cornelia Wild, Jutta Aschendorf-Müller, Br., u. a. Max Schloßberger Bahnhofstr. 7
Elisabeth Rieger, Simone Staron, Bruchsal, u. a. Hilde Schloßberger Bahnhofstr. 7
Anke und Marco Hänßler, Bruchsal Hugo Katz Franz-Bläsi-Str. 14
Ulrike Schüler, Wohltorf Friedolina Katz Schlossstr. 5
Spenden f. Broschüren in Buchhandlungen Ernst Katz Schlossstr. 5
Ulrike Schüler, Wohltorf Johanna Straus Schlossstr. 3
Erika Dürr, Bruchsal Alfred Baer Friedrichstr. 29
Dr. Rolf Uebe, Helmut Merkle, Bruchsal, u. a. Rosa Baer Friedrichstr. 29
Dr. Franz u. Dr. Rosel Kaeppler, Bruchsal Leo Hahn Schlossstr. 5
Anja Nellinger, Ute Amend, Bruchsal Anny Hahn Schlossstr. 5
Hans Westheimer, Wiesbaden Eric Hahn Schlossstr. 5
Bürgerstiftung Bruchsal Ida Tuteur Schlossstr. 5
Kollekte Ökumenischer Gottesdienst Siegbert Kann Kaiserstr. 78
Kollekte Ökumenischer Gottesdienst Elisabeth Kann Kaiserstr. 78
Marieluise Gallinat-Schneider, Jutta Mader, u. a. Werner Kann Kaiserstr. 78
Ella u. Ludwig Müller, Marco Hänßler, Br., u. a. Gisela Kann Kaiserstr. 78
Frieda Amend, M. u. I. Kletzendorf, u. a. Eleonore Kann Kaiserstr. 78
Die BürgerStiftung Bruchsal hat die wichtige Aufgabe übernommen,
auch künftig Mittel für weitere Stolpersteine einzuwerben.
Jeder Stein kostet 120 Euro – dieser Betrag kann
jederzeit zweckgebunden an die BürgerStiftung Bruchsal gespendet
werden und wird in vollem Umfang für dieses Projekt
eingesetzt. Jeder Spender erhält eine Einladung zur nächsten
Stolpersteinverlegung, daher bitte auch die postalische Adresse
beim Verwendungszweck vermerken.
Sparkasse Kraichgau, IBAN DE 7566 3500 3600 0777 7777
Volksbank Bruchsal-Bretten, IBAN DE 5666 3912 0000 0080 0600
Impressum
Herausgeber: Stadtverwaltung Bruchsal
Auflage: 500 Stück, 1. Auflage August 2021
Redaktion: Florian Jung, Rolf Schmitt, Bruchsal
Layout & Druck: KAROLUS Media, Bruchsal
Die Rechte für die Beiträge liegen bei den jeweiligen Autoren.
David Maor (Majerowitz) aus Israel betete zusammen mit
Verwandten und Schülern des Justus-Knecht-Gymnasiums
für seine Großeltern Helena und David Majerowitz.
Für sie und deren vier Kinder wurden vor dem früheren
Wohnhaus Orbinstraße 7 am 27.3.2019 Stolpersteine
verlegt.