Aus dem Fachgebiet Allgemeine Radiologie und Medizinische ...
Aus dem Fachgebiet Allgemeine Radiologie und Medizinische ...
Aus dem Fachgebiet Allgemeine Radiologie und Medizinische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diskussion 84<br />
hinzukommende Reitergewicht erhöht. Das Reitergewicht könnte einen positiven Einfluss<br />
auf die Rückführung des Flüssigkeitspools gehabt haben. Höchstwahrscheinlich spielt die<br />
korrekte Einwirkung des Reiters auf das Pferd eine entscheidende Rolle für den<br />
Lymphabfluss (Schwerpunktverlagerung, Aktivierung der Hinterhand s. o.). Zur Klärung<br />
dieser These sollte in einer weiterführenden Studie ein Vergleich zwischen<br />
Volumenänderungen, bedingt durch das Reitergewicht <strong>und</strong> ein an den Sattel<br />
angebrachtes Gewicht, durchgeführt werden.<br />
In Gruppe 4 kam eine längere Bewegungszeit von insgesamt einer St<strong>und</strong>e hinzu. Dadurch<br />
verlängerte sich die Einwirkung der oben erwähnten Faktoren, was die größten<br />
Volumenänderungen in Gruppe 4 im Vergleich zu den anderen erklären könnte. Jede der<br />
in Gruppe 1 bis 4 vorgenommene Art der Bewegung führte zu signifikanten<br />
Volumenveränderungen im Bereich der distalen Gliedmaße.<br />
Bei den Pferden, die bei höheren (23-31°C) <strong>und</strong> bei niedrigeren (1-12°C) Temperaturen<br />
gemessen wurden, konnten signifikante Unterschiede der Volumenänderung zu den<br />
Messzeitpunkten I, II <strong>und</strong> III verzeichnet werden. Bei höheren Temperaturen fanden<br />
größere Volumenabnahmen (um 7,9 % bzw. 158,4 ml) von Messzeitpunkt I zu II statt, als<br />
bei niedrigeren Temperaturen (um 5,3 % bzw. 135,1 ml). Mittlere Temperaturen führten im<br />
Vergleich zu höheren oder niedrigeren Temperaturen zu keinen signifikanten<br />
Unterschieden. Laut AUER (1974) können Ö<strong>dem</strong>e bei hohen Temperaturen vorübergehend<br />
abtransportiert werden, was die größere Volumenabnahme an Messzeitpunkt<br />
I <strong>und</strong> II bei höheren Temperaturen erklären könnte. Dies stützt die Hypothese, dass sich<br />
unter den untersuchten Pferden solche befanden, bei denen ein nicht sichtbares bilateral<br />
symmetrisches Ö<strong>dem</strong> ausgeprägt war.<br />
In der Literatur wurden von STICK et al. (1989) ebenfalls größere Volumenzunahmen am<br />
Unterschenkel bei zunehmender Temperatur von 20 °C bis 36 °C gemessen. Diese<br />
Untersuchung deckt sich mit den Ergebnissen dieser Studie, wobei zu berücksichtigen ist,<br />
dass an den Pferdebeinen deutlich höhere Volumenänderungen stattfanden als beim<br />
Menschen. Hier wurde jedoch ein anderer anatomischer Bereich der Extremität<br />
gemessen.






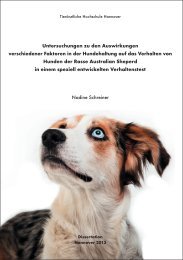



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






