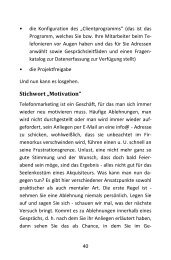Voin der RNA-Welt zur Welt der Proteine
Leseprobe "Astrobiologie"
Leseprobe "Astrobiologie"
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
316 3 Wie entsteht Leben? – das Rätsel der Abiogenese
der RNA-Welt ist dann die heutige Proteinwelt entstanden – LUCA war einer ihrer
ersten Vertreter (s. Abschn. 2.7.3).
Als Resümee muss man aber trotzdem leider feststellen, dass die Hypothese der
RNA-Welt immer noch auf ziemlich tönernen Füßen steht, aber ohne Frage das
Potenzial besitzt, sich in eine chemisch und biologisch plausible Theorie der Abiogenese
zu entwickeln. Sie ist das Beste, was wir gegenwärtig in dieser Beziehung
haben.
3.6.5 Von der RNA-Welt zur Welt der Proteine
Man kann davon ausgehen, dass LUCA bereits ein Organismus war, der vollständig
in der Proteinwelt angekommen ist und einen voll funktionsfähigen Biosyntheseapparat
für in DNA codierte Enzyme besessen hat. Nun ist der Biosyntheseapparat
selbst der primitivsten Mikroorganismen eine Kollektion höchst komplexer und
aufeinander abgestimmter Nanomaschinen mit einer bemerkenswerten Arbeitsteilung,
sodass man sich unweigerlich fragen muss, wie sie sich aus den vergleichsweise
einfachen Replikatoren der RNA-Welt entwickelt haben. Wesentliche grundlegende
Entwicklungen sind dabei
• die Entstehung des genetischen Codes,
• die Etablierung der stabileren DNA als Speicher der genetischen Information
und der molekularen Mechanismen, welche die Übertragung dieser Information
abschnittsweise (Gene) auf mRNA ermöglichen (Transkription),
• die Etablierung der Mechanismen, welche in der Lage sind, die auf mRNA-Moleküle
übertragene genetische Information (Spezifität) in die Primärstruktur der
Aminosäuresequenz eines Proteins umzusetzen (Translation),
• die Entstehung des grundlegenden Replikationsmechanismus der DNA, der eine
Weitergabe der (nahezu) vollständigen genetischen Information an Tochterzellen/Organismen
ermöglicht und damit einen Angriffspunkt für evolutionäre Veränderungen
bietet.
Das Problem ist auch hier, dass alle genannten Punkte voneinander abhängig sind
und der gesamte Biosyntheseapparat nur im Zusammenspiel mit allen seinen Teilen
und eingebaut in das metabolische Netzwerk einer Zelle funktioniert. Das macht es
schwierig, all die einzelnen kleinen Entwicklungsschritte hin zu dieser Komplexität
nachzuvollziehen, da man sie genau genommen an keiner Stelle isoliert für sich
betrachten kann. Im Folgenden sollen deshalb auch nur einige wenige der genannten
Entwicklungen andiskutiert werden, soweit sie grundlegend für die Entstehung
einer ersten, mit allen Lebensattributen ausgestatteten Zelle sind.
3.6.5.1 Die Entstehung des genetischen Codes
Unter dem genetischen Code versteht man die „Tabelle“, nach der in Dreiergruppen
(Tripletts, Codon) in einer DNA/RNA aufeinanderfolgende Nukleinbasen an
den Ribosomen in entsprechende Aminosäuren übersetzt werden. Er stellt damit
mathias.scholz@t-online.de
3.6 Abiogenese
317
die informelle Nahtstelle zwischen Nukleinsäuren und Proteinen dar. Dieser Code
ist bis auf ganz wenige, äußert spezifische Ausnahmen in allen Lebewesen der Erde
gleich, was auf sein hohes Alter hinweist. Und er ist auch nicht gänzlich zufällig
entstanden und dann für alle Zeiten konserviert worden, wie man zuerst annahm,
denn er zeigt deutliche Anzeichen einer Optimierung. Das Schicksal eines jeden
Lebewesens hängt auf Gedeih und Verderb von der fehlerfreien Übersetzung der in
den Genen enthaltenen Information gemäß diesem Code in Proteine ab, was seine
zentrale Rolle in der Biochemie der Zelle unterstreicht. Und er muss natürlich irgendwann
einmal entstanden sein. Die Frage ist nur: Wie?
Das Wesen der genetischen Information
Ein DNA- oder RNA-Molekül mit irgendeiner Nukleotidsequenz stellt für sich genommen
zunächst einmal nur ein Polymer aus einer Vielzahl entsprechender Nukleotiden
dar. Die Anordnung der Nukleotide im Molekül macht quasi ihre Spezifität
aus. Ihr Sinn in Form einer Information erschließt sich erst nachträglich im Vorgang
ihrer Umsetzung in eine Aminosäuresequenz eines Proteins, wofür der gesamte
Biosyntheseapparat der Zelle zur Verfügung stehen muss. Ohne die Möglichkeit der
Interpretation und Umsetzung in eine konkrete Proteinstruktur durch entsprechende
molekulare Mechanismen ist die Nukleotidsequenz für sich genommen selbst ohne
jede Bedeutung und stellt damit auch keine verwertbare Information dar. Es ist deshalb
besser, anstatt von „genetischer Information“ (wenn es sich auch eingebürgert
hat) von „genetischer Spezifität“ zu sprechen, wie es bereits 1953 Henry Quastler
vorgeschlagen hat (Quastler 1953). Oder, wie es Francis Crick einmal ausdrückte:
Die in einem Gen enthaltene Information ist lediglich die Spezifizierung der
Aminosäuresequenz eines Proteins. Sie bezieht sich weder auf den Vorgang einer
Nachrichtenübermittlung, sie stellt auch keine Kommunikation dar, noch hat sie
im semantischen Sinn eine tiefere Bedeutung. Ihr Bedeutungsgehalt erschließt sich
hier erst nach einer quasi Eins-zu-eins- Umsetzung der Codonfolgen des entsprechenden
Gens in über den genetischen Code spezifizierte Aminosäurepolymere –
und das noch in Form einer Einbahnstraße („zentrales Dogma der Molekularbiologie“:
DNA→RNA→Protein→everything else). Daher der Name „Translation“
für diese Umsetzung. Diese Art von Spezifität lässt sich deshalb auch nicht mit
dem Shannon’schen Informationsbegriff adäquat beschreiben, was schon zu einigen
Missverständnissen geführt hat.
Der genetische Code
Nachdem die Bedeutung der DNA als molekularer Speicher genetischer Spezifität
erkannt wurde, versuchte man ab Mitte der 1950er-Jahre mit viel Scharfsinn und
großem experimentellem Aufwand den genetischen Code, d. h. die konkrete Zuordnung
der 64 möglichen DNA-Codons zu den bekannten 23 proteinogenen bzw.
20 kanonischen Aminosäuren, zu entschlüsseln. Den endgültigen Durchbruch gab
es im Jahre 1961, als es Heinrich Matthei zusammen mit Marshall Nirenberg (Nobelpreis
1968) gelang, dem Nukleotidentriplett UUU die Aminosäure Phenylalanin
zuzuordnen. Die vollständige Entschlüsselung des genetischen Codes zog sich dann
noch weitere fünf Jahre hin und wurde 1966 abgeschlossen (s. Tab. 3.22).
mathias.scholz@t-online.de
318 3 Wie entsteht Leben? – das Rätsel der Abiogenese
Tab. 3.22 Genetischer Code (mRNA-Codons). Die Stoppcodons UAA, UAG und UGA terminieren
die Proteinsynthese am Ribosom. In Ausnahmefällen (z. B. bei gewissen Archaeen) werden
die Stoppcodons UGA und UAG auch zur Codierung der drei zwar proteinogenen, aber nicht
kanonischen Aminosäuren Selenocystein, Selenomethionin und Pyrrolysin verwendet. Kursiv dargestellt
sind die Aminosäuren, die sich abiotisch durch Bestrahlung einer Kohlenmonoxid-Stickstoff-Wasserdampf-Mischung
mit energiereichen Protonen herstellen lassen (und die man z. B.
auch an kohligen Chondriten oder bei diversen Ursuppenexperimenten gefunden hat)
1. Position (5‘) 2. Position U C A G 3. Position (3‘)
U Phenylalanin Serin Tyrosin Cystein U
Phenylalanin Serin Tyrosin Cystein
C
Leucin Serin STOP STOP
A
Leucin Serin STOP Tryptophan
G
C Leucin Prolin Histidin Arginin U
Leucin Prolin Histidin Arginin
C
Leucin Prolin Glutamin Arginin
A
Leucin Prolin Glutamin Arginin
G
A Isoleucin Threonin Asparagin Serin U
Isoleucin Threonin Asparagin Serin
C
Isoleucin Threonin Lysin Arginin
A
Methionin Threonin Lysin Arginin
G
G Valin Alanin Asparaginsäure Glycin U
Valin Alanin Asparaginsäure Glycin
C
Valin Alanin Glutaminsäure Glycin
A
Valin Alanin Glutaminsäure Glycin
G
Wenn man sich den genetischen Code anhand seiner Übersetzungstabelle etwas
genauer anschaut, kann man einige auf den ersten Blick nur schwer zu erklärende
Auffälligkeiten beobachten. So existieren für die meisten Aminosäuren mehrere
Codons: für Arginin, Leucin und Serin jeweils 6, für Prolin, Threonin, Alanin, Valin
und Glycin jeweils 4, für Isoleucin 3, für Lysin, Histidin, Glutamin, Glutaminsäure,
Asparagin, Asparaginsäure, Cystein, Phenylalanin und Tyrosin jeweils 2. Nur die
selten in Proteine eingebauten Aminosäuren Tryptophan und Methionin entsprechen
nur einem Codon. Drei weitere Sequenzen werden als Stoppcodons bzw. zur
Codierung der drei nichtkanonischen proteinogenen Aminosäuren verwendet. Da
offensichtlich keine bijektive Abbildung zwischen den Codons und den Aminosäuren
existiert, sagt man, dass der genetische Code entartet ist. Deshalb ist auch keine
eineindeutige Rückübersetzung der Aminosäurefolge eines Peptids oder Proteins
in eine Folge von Nukleotiden möglich. Und das hat wahrscheinlich einen guten,
entwicklungsgeschichtlich bedingten Grund. Dazu muss man wissen, dass die Fehlerfreiheit,
d. h. die Vermeidung von Mutationen (zumindest soweit das physikalisch
möglich ist), ein äußerst wichtiger Aspekt ist in Bezug auf die Stabilität der
Erbinformation über Generationen von Zellen hinweg. Insbesondere eine moderne
eukaryotische Zelle treibt einen riesigen Aufwand, um genau diese Fehlerfreiheit
mathias.scholz@t-online.de
3.6 Abiogenese
319
sicherzustellen. Es gilt z. B. Einzel- und Doppelstrangbrüche eines DNA-Moleküls
zu reparieren, Fehler in der Basenpaarung und Basenreihenfolge zu erkennen und
auszumerzen und auch Veränderungen im Ribose- (RNA) bzw. Desoxyribosegerüst
(DNA) rückgängig zu machen – um nur einige Arten von Nukleinsäureschäden zu
benennen.
Verändert sich an einer Genposition nur eine einzelne Base, dann spricht man
von einer Punktmutation. Sie hat genau in den Fällen keine Auswirkungen auf die
Aminosäuresequenz eines Proteins, wenn die Änderung zu einem Codon führt, welches
die gleiche Aminosäure codiert wie das Triplett ohne diese Basenmodifikation.
Der genetische Code ist nun genau so beschaffen, dass es gerade für die häufig
verwendeten Aminosäuren jeweils mehrere alternative Codons gibt. Wird z. B. in
einem Gen die Nukleotidfolge CUU durch eine Punktmutation in die Folge CUC
überführt, so hat das keinen Einfluss auf die Primärstruktur des exprimierten Proteins,
da beide Folgen jeweils die Aminosäure Leucin codieren. Solche Mutationen
nennt man deshalb auch „stille“ Mutationen. Selbst wenn eine einzelne Punktmutation
zu einer chemisch ähnlichen Aminosäure führt, muss das noch lange nicht
bedeuten, dass das entsprechende Protein in seiner Funktion ernsthaft eingeschränkt
wird. Schaut man sich die Übersetzungstabelle in dieser Beziehung einmal näher
an, dann erkennt man, dass alle Aminosäuren, deren zugehöriges Codon in der mittleren
Position ein U besitzt, mehr oder weniger hydrophob sind. Alle Aminosäuren,
deren mittlere Position im dazugehörenden Codon durch Adenin A besetzt ist, sind
dagegen mehr oder weniger hydrophil. Wird z. B. aufgrund einer Punktmutation
in einem Protein eine ursprünglich hydrophile Aminosäure durch eine hydrophobe
ersetzt, kann es bei der Faltung des Proteins zu Problemen kommen, die weniger
gravierend ausfallen, wenn beispielsweise eine hydrophobe Aminosäure durch eine
andere, ähnlich hydrophobe Aminosäure (z. B. Leucin UUG durch Valin GUG) ersetzt
wird. Schaut man sich unter diesen Gesichtspunkten den genetischen Code etwas
genauer an, dann wird offensichtlich, dass er in Bezug auf die Vermeidung von
Punktmutationen optimiert ist, also nicht völlig zufällig entstanden sein kann. Aber
es gibt noch weitere Auffälligkeiten. So besteht beispielsweise eine bemerkenswerte
Korrelation zwischen der Besetzung der zweiten Position eines Codons und der
Klasse der Aminoacyl-tRNA-Synthease, deren Funktion darin besteht, die tRNAs
entsprechend ihrer (Anti-) Codonsequenz mit der richtigen Aminosäure zu beladen.
Alle diese Umstände und Korrelationen beinhalten übrigens wichtige Fingerzeige
auf die Evolution dieses Codes. Trotzdem zeigen neuere Untersuchungen von
Biomathematikern, dass der genetische Code in Bezug auf die Minimierung von
Fehlern nicht ausoptimiert ist, denn es lässt sich zeigen, dass eine große Zahl alternativer,
in dieser Hinsicht durchaus robusterer Codierungen denkbar ist. Er muss
also wirklich (so wie es Francis Crick bereits 1968 vermutet hat) irgendwann – und
zwar noch in den Anfangszeiten des Lebens –„eingefroren“ worden sein (Crick
1968) und sich auf diese Weise weitgehend aus evolutionären Veränderungen ausgeklinkt
haben.
mathias.scholz@t-online.de
320 3 Wie entsteht Leben? – das Rätsel der Abiogenese
Hypothesen zur Evolution des genetischen Codes
Mit der Entschlüsselung des genetischen Codes und der detaillierten Aufklärung
der Proteinbiosynthese in den Zellen begann man sich auch zusehend Gedanken
über ihre Entstehung zu machen. Die dabei geäußerten Hypothesen und Ideen zeigen
dabei im Detail eine bemerkenswerte Diversität, was bei einem derart komplexen
Gegenstand auch gar nicht so verwunderlich ist. Es können deshalb in dieser
Hinsicht im Folgenden nur ein paar allgemeine Überlegungen und einige neuere
Entwicklungen kurz angeschnitten werden.
Die Hypothesen über den Ursprung des genetischen Codes lassen sich im Wesentlichen
in drei Gruppen einteilen:
Stereochemischer Ursprung
Dieses Modell für den Ursprung des genetischen Codes geht auf den bekannten
Physiker George Gamow (1904–1968) zurück, der strukturelle Gründe für die Zuordnung
von Aminosäuren zu den durch Nukleotide erzeugten Strukturen („rhombusförmige
Löcher“) in der DNA geltend machte. Moderner ausgedrückt, soll eine
von der Struktur der Moleküle herrührende chemische Affinität zwischen den Aminosäuren
und den sie codierenden Codons bestehen. Dies würde bedeuten, dass ihre
Codierung nicht zufällig so ist wie sie ist, sondern sich notwendigerweise aus genau
diesen strukturellen Gründen auf natürliche Weise ergeben hat. Diese Hypothese
wurde verschiedenen experimentellen und theoretischen Tests unterworfen (z. B.
für die sogenannte escaped triplet theory (Yarus et al. 2005)), ohne jedoch statistisch
signifikant die erwarteten Korrelationen bestätigen zu können.
Kontinuierliche Anpassung
Nach dieser Hypothese entwickelte sich der Code unter dem Einfluss selektiver
Kräfte durch positive Auslese hin zu einer weitgehend fehlertoleranten Form, bis
er dann bei einem bestimmten Punkt quasi eingefroren wurde. Das Selektionskriterium
lag dabei in einer Optimierung der Fehlertoleranz bezüglich von Translationsfehlern,
d. h. der Umsetzung des Codes in Aminosäuresequenzen. Zu nennen
sind hier insbesondere die Lethal mutation-Hypothese und die Translation-error
minimization-Hypothese (Alff-Steinberger 1969), die insbesondere auch von Carl
Richard Woese vertreten wurde. Im Detail ergeben sich aber auch hier schwer ausräumbare
konzeptionelle Probleme. Insbesondere wurde verschiedentlich darauf
hingewiesen, dass die scheinbare Robustheit des genetischen Codes eher ein Beiprodukt
der Evolution des Transkriptions-Translations-Apparats ist und ursächlich
wahrscheinlich nichts zu tun hat mit einer inhärenten Tendenz zur Fehlerminimierung
(Stoltzfus und Yampolsky 2007).
Koevolution mit dem chemischen Apparat der Proteinbiosynthese
Die insbesondere von Tze-Fei Wong seit den 1970er-Jahren entwickelte Theorie
einer Koevolution des genetischen Codes mit den Stoffwechselwegen der Aminosäurebiosynthese
(Tze-Fei Wong 1981) wird heute von vielen Wissenschaftlern als
in sich weitgehend schlüssig akzeptiert. Die Kernthese besteht darin, dass das Leben
zuerst mit weniger als den 20 kanonischen Aminosäuren begonnen hat. Das
mathias.scholz@t-online.de
3.6 Abiogenese
321
koinzidiert mit der Beobachtung, dass sowohl in Ursuppenexperimenten als auch
in kohligen Chondriten bisher nur eine Teilmenge aller proteinogenen Aminosäuren
nachgewiesen werden konnte. In einer frühen Form des genetischen Codes haben
diese Aminosäuren nach dieser Theorie alle möglichen Codons unter sich aufgeteilt.
Dabei war wahrscheinlich zunächst einmal nur die mittlere Base des Nukleotids
relevant. Es fällt nämlich auf, dass alle Codons der Form XUX (X = U, C, A, G)
Aminosäuren mit hydrophoben Seitenketten codieren (also konkret Phenylalanin,
Leucin, Isoleucin Methionin und Valin), Codons der Form XAX dagegen solche
mit hydrophilen Seitenketten (Tyrosin, Histidin, Glutamin, Asparagin, Lysin, Asparaginsäure
und Glutaminsäure). Möglich ist, dass es in einer primitiven Form
eines Urtranslationsmechanismus nur darauf ankam, entweder eine hydrophile oder
eine hydrophobe Aminosäure in ein Proteinpolymer einzubauen, und der Mechanismus
quasi blind für eine konkrete Aminosäure war. Als sich die Synthesewege
für neue Aminosäuren aufgetan hatten, mussten deshalb bereits belegte Codons auf
diese neuen Aminosäuren quasi umgewidmet werden, und damit wurden auch die
anderen Triplettpositionen signifikant. Dieser Umwidmungsvorgang ist chemisch
hochkomplex, denn er betrifft ja in erster Linie die Entstehung einer neuen tRNA
mit passendem Anticodon und einer passenden Aminoacyl-tRNA-Synthease, die
das Beladen der tRNA mit der entsprechenden Aminosäure bewerkstelligen muss.
Und dass solch ein Vorgang möglich ist und auch wirklich stattfindet, wenn z. B. ein
Bakterienstamm einem außergewöhnlichen Selektionsdruck ausgesetzt wird, zeigt
mittlerweile eine Vielzahl entsprechender Experimente. So konnte bereits Ende der
1950er-Jahre nachgewiesen werden, dass ein bestimmter Stamm des Darmbakteriums
Escherichia coli in der Lage war, statt der kanonischen Aminosäure Methionin
die strukturell ähnliche Aminosäure Selenomethionin in die eigenen Proteine
einzubauen – was einer Uminterpretation des Codons AUG bei der Translation
entspricht (Cohen und Cowie 1957). Die diesem speziellen Stamm angehörigen
Kolibakterien waren nämlich von sich aus nicht in der Lage, Methionin selbst zu
synthetisieren (Auxotrophie). Sie konnten sie aber aus ihrer Umgebung importieren.
Als man in Experimenten das Methionin aus der Nährflüssigkeit durch Selenomethionin
ersetzte, konnte es erfolgreich auf diese nichtkanonische Aminosäure
ausweichen. Mittlerweile wurden von Mikrobiologen sogar Wege gefunden, den
genetischen Code in Teilen umzuprogrammieren, d. h. durch Codes für „künstliche“
Aminosäuren zu erweitern. Damit konnte man Zellen zwingen, völlig neuartige
Proteine, wie sie nirgends sonst in der Natur vorkommen, herzustellen. So entstand
durch den gezielten Einbau einer als Elektronendonator dienenden Aminogruppe in
das bekannte Green Fluorescent Protein (GFP, ein „Gold-fluoreszierendes Protein“,
zuerst extrahiert aus der Qualle Aequorea victoria), ein lang erhofftes Hilfsmittel
für dynamische biophysikalische Untersuchungen von lebenden Zellen mit z. B.
4 Pi-Mikroskopen (Hyun Bae et al. 2003).
Ausgangspunkt einer Koevolution zwischen Translationsapparat und genetischem
Code dürften demnach primär Modifikationen an einem tRNA-Molekül gewesen
sein. Sie könnten dazu geführt haben, dass auf einmal auch die Beladung
einer anderen, aber ähnlichen Aminosäure ermöglicht wurde, als diejenige, für die
es eigentlich spezifiziert ist. Oder anders ausgedrückt: Die Codierung wurde zumathias.scholz@t-online.de
322 3 Wie entsteht Leben? – das Rätsel der Abiogenese
nächst einmal mehrdeutig, da die betreffende tRNA quasi eine fremde Triplettsequenz
dekodiert. Es gibt nun zwei Varianten der tRNA, die sich in einem gewissen
Konkurrenzverhältnis befinden. Entweder eine davon wird wieder wegselektiert,
oder beide können sich mit jeweils unterschiedlichen Anticodons etablieren. Zwar
führt eine derartige Mutation einer tRNA zunächst einmal zu einem fehlerhaft aufgebauten
Protein. Aber die Erfahrung zeigt, dass derartige Einbaufehler oft folgenlos
bleiben (d. h., sie sind funktionell neutral) und in einzelnen Fällen sogar zu einer
Verbesserung der enzymatischen Wirkung des entsprechenden Proteins beitragen.
In einem solchen Fall zeigt sich dann ein Nutzen für diese Modifikation, und die
Chancen stehen gut, dass sie in der Generationenfolge bewahrt wird.
Was Forscher im Labor fertigbrachten, dürfte auch der Natur gelungen sein.
Entsprechend der Koevolutionstheorie sollte sich, grob gesagt, die Entwicklung
zum modernen genetischen Code in drei unterscheidbaren Phasen in Bezug auf
die Aufnahme bestimmter Aminosäuren abgespielt haben. Zunächst standen nur
die wenigen Aminosäuren (5 bis 8) zur Verfügung, die entweder vor Ort abiotisch
synthetisiert oder von Kometen und Meteoriten stammten. Experimentell konnte
gezeigt werden, dass sich alle zur ersten Phase gehörenden proteinogenen Aminosäuren
zumindest durch Bestrahlung eines schwach reduzierenden CO–N 2
–H 2
O-
Gasgemischs mit hochenergetischen Protonen herstellen lassen (kursiv hervorgehoben
in Tab. 3.22). In einer zweiten Phase, die schon ein hochentwickeltes metabolisches
Netzwerk voraussetzte, erfolgte die Produktion weiterer Aminosäuren bereits
vermittels Biosynthese. Diese Phase-2-Aminosäuren lassen sich unter abiotischen
Bedingungen, wie man sie auf der frühen Erde vermutet, nicht synthetisieren. Zu
Beginn dieser Phase waren jedoch bereits alle 4 3 möglichen Nukleotid-Triplett-
Codes auf die abiotisch verfügbaren Aminosäuren aufgeteilt – und zwar im Zuge
der Entwicklung eines ersten einfachen Translationsmechanismus und unter der
Wirkung stereochemischer Wechselwirkungen zwischen den Aminosäuren und
ihren Codons/Anticodons. Als sich dann metabolische Wege zur Synthese neuer
Aminosäuren in einer Urzelle etablierten, mussten zu ihrer Codierung in der RNA/
DNA geeignete vorhandene Codons quasi uminterpretiert werden, d. h., am Ribosom
musste ihre Sequenz zum Einbau der neuen (Phase-2-) anstatt der alten (Phase-1-)
Aminosäure in das entsprechende Protein führen. Die Logik, nach der diese
Uminterpretation eine Erweiterung des ursprünglich vorhandenen Codes im Zuge
einer Verringerung seiner Entartung bedeutete, konnte von Tze Fei Wong und Mitarbeitern
recht schlüssig aufgeklärt werden. Als Phase-3-Aminosäuren bezeichnet
man schließlich Aminosäuren, die erst nach der Translation in Proteine gelangen
( pretranslational modifications) und für die es keine Entsprechungen im genetischen
Code gibt bzw. – in ferner Vergangenheit, als sie noch nicht codiert waren
– einmal gegeben hat.
Auf jeden Fall ist sicher, dass der genetische Code (nicht die Details des Translationsmechanismus)
irgendwann eingefroren wurde – und zwar, bevor sich LUCA
etablierte und noch um einiges entfernt von einem wirklich optimalen Code. Der
Grund dafür könnte eine einfache Nutzen/Kosten-Abwägung (natürlich in Bezug
auf evolutionäre Veränderungen) gewesen sein. Denn eines ist Fakt: Der genetische
Code ist für alle drei Domänen des Lebens auf der Erde im Wesentlichen gleich
mathias.scholz@t-online.de
3.6 Abiogenese
323
(Wenige diverse Ausnahmen, die oftmals nur Mitochondrien-DNA betreffen, spielen
in diesem Zusammenhang nur eine untergeordnete Rolle. Sie beweisen aber,
dass der Code eine Evolution durchgemacht hat.). Er muss also zur Zeit der Entstehung
von LUCA zusammen mit dem zugehörigen Satz von tRNAs und tRNA-
Syntheasen bereits vorhanden gewesen sein. 19
Die Entwicklung der informationsgesteuerten Proteinbiosynthese war ohne
Zweifel eine Schlüsselentwicklung im Rahmen der RNA-Welt, denn Proteine können
ihre enzymatischen Funktionen aufgrund ihrer viel größeren möglichen Formenvielfalt
in katalytischen Netzwerken viel besser wahrnehmen als Ribozyme.
Wenn man auch noch nicht genau sagen kann, wie diese Entwicklung im Detail
vonstattengegangen ist, so zeichnet sich doch ab, dass dabei durchaus alles mit natürlichen
Dingen zugegangen ist (Kreationisten behaupten bekanntlich das Gegenteil).
Notwendige Teilschritte, die sich experimentell überprüfen lassen, und die
entsprechende Interpretation der im modernen Proteinbiosyntheseapparat enthaltenen
urtümlichen Elemente erlauben zumindest ein grobes Bild der Entwicklungen
nachzuzeichnen, welches den Anspruch einer naturwissenschaftlichen Rekonstruktion
durchaus genügt. Und mehr kann man fast nicht von einer modernen Theorie
der Abiogenese verlangen.
3.6.5.2 Etablierung der DNA als universeller molekularer Speicher
genetischer Informationen
Mit RNA-Molekülen als Träger genetischer Information hätte das Leben mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf einem äußerst niedrigen Entwicklungsstand verharrt. Der
Grund liegt an der chemischen Struktur ihres Zuckergerüsts, genauer an der Präsenz
einer zusätzlichen Hydroxylgruppe an der 2‘-Position der Ribose. Im RNA-Polymer
ist sie die einzige funktionelle Gruppe der Pentose, die keine Bindungsfunktion
erfüllt. Aber sie erhöht entscheidend die Tendenz zur Hydrolyse der Bindung zwischen
dem Zucker und dem Phosphatrest und damit die Gefahr von Strangbrüchen
(neben weiteren Unannehmlichkeiten wie z. B. dem Hang zur Bildung von Wasserstoffbrücken).
Oder kurz gesagt: RNA ist als Polymer äußerst instabil und zum Aufbau
langer Ketten von z. B. mehr als einigen 10.000 Nukleotiden ungeeignet (die
Größe des RNA-Genoms von Retroviren liegt beispielsweise bei 8000 bis 12.000
Basenpaaren). Dafür kann sie im Gegensatz zur DNA eine gewisse Sekundärstruktur
ausbilden (Enzymfunktion) und auch als Einzelstrang existieren. Dadurch, dass
in der DNA das Zuckergerüst aus einer Desoxyribose besteht, die an der 2′-Position
der Pentose lediglich ein Wasserstoffatom gebunden hat (das ist auch schon der
einzige strukturelle Unterschied), entfallen alle Nachteile der RNA. Das DNA-Molekül
kann dafür nur in Form eines Doppelstrangs vorkommen, keine enzymatische
Wirkung entfalten und besitzt zudem eine Stabilität, die Michael Crichton (1942–
2008) letztendlich zu seinem vielbeachteten Roman Jurassic Park inspiriert hat.
Außerdem ist in ihr die Pyrimidinbase Uracil durch ihre methylierte Version, das
19
Eine Ausnahme stellen die tRNA-Syntheasen für die Aminosäuren Glutamin und Asparigin dar,
die, da sie heute bei den Archaeen fehlen, wahrscheinlich auch bei LUCA noch nicht vorhanden
waren.
mathias.scholz@t-online.de
324 3 Wie entsteht Leben? – das Rätsel der Abiogenese
Thymin (T), ersetzt. Dies ermöglicht eine bessere Fehlererkennung und effektivere
Reparaturmechanismen, als sie bei einem RNA-Strang möglich wären.
Wann genau und unter welchen Umständen die anfänglich in Form von RNA gespeicherte
genetische Information in DNA umgeschrieben wurde, ist nicht bekannt.
Aber als DNA zur Verfügung stand, entwickelte sich um dieses Riesenmolekül ein
umfangreicher „Fuhrpark“ an enzymatischen Nanomaschinen, die u. a. für Fehlerkorrekturen,
für das Aufdröseln von DNA-Abschnitten zwecks Transkription und
schließlich zu ihrer Replikation dienten. Das ontologische Problem, welches sich
hier auftut, besteht darin, dass man es offensichtlich mit einer äußerst komplexen
Art von zyklischer Kausalität zu tun hat, die man auf die einfach zu stellende Frage
„Was war zuerst da, das DNA-Molekül oder die Proteine, die für seine Funktionalität
notwendig sind?“ zurückführen kann. Da es biochemische Argumente für
beide Möglichkeiten gibt, ist diese Frage als noch nicht entschieden zu betrachten.
Auf jeden Fall muss es ab einem gewissen Punkt zu einer schnellen und hocheffizienten
Parallelentwicklung gekommen sein, die den gesamten Replikations-,
Transkriptions- und Translationsapparat umfasst hat und dazu diente, die metabolischen
Netzwerke der Zelle mit immer besser arbeitenden Enzymen auf Proteinbasis
auszustatten. LUCA jedenfalls war nach Meinung der meisten Biologen bereits ein
DNA-Wesen. Es war in der Lage, die für die Aufrechterhaltung der Homöostase
notwendigen Stoffwechselwege (Glykolyse, Substratkettenphosphorylierung) zu
realisieren, indem es die dafür notwendigen Enzyme codiert synthetisieren konnte.
Das setzt natürlich einen vollständigen und exakt funktionierenden Proteinbiosyntheseapparat
voraus. So gesehen war das erste greifbare Lebewesen auf der Erde
alles andere als primitiv (zumindest in Bezug auf die unbelebte Welt).
3.6.6 Astrobiologische Implikationen
Geht man von der Richtigkeit des Paradigmas aus, dass das Leben auf der frühen
Erde entstanden ist, dann lassen sich daraus – ebenso wie aus der Kürze der hierfür
benötigten Zeit (Größenordnung 10 8 Jahre) – einige Implikationen in Bezug auf die
Entstehung von „Leben, wie wir es kennen“ im Kosmos ableiten. Zu bedenken ist
dabei, dass sich die Erde vor ca. 4 Ga in Bezug auf ihre Oberfläche und Atmosphäre
völlig von ihrem heutigen Zustand (der außergewöhnlich stark durch die Wirkungen
der Biosphäre beeinflusst ist) unterschieden hat. Selbst eine Rekonstruktion
dieses frühen Zustands des Planeten ist nicht einfach, da viele Zeugnisse aus jener
Zeit verloren gegangen sind, was dem geologisch aktiven Charakter des Planeten
(Stichwort: Plattentektonik) geschuldet ist. So herrscht trotz enormer Forschungsanstrengungen
beispielsweise unter den Astrobiologen immer noch kein Konsens
darüber, wo und unter welchen konkreten Umweltbedingungen auf der frühen Erde
die Abiogenese stattgefunden hat. Gegenwärtig werden aus vielerlei Gründen hydrothermale
Quellen am Grund der Ozeane als wahrscheinlichste Orte für die Entstehung
des Lebens aus unbelebter Materie angesehen. Die Wahrscheinlichkeit ist
hoch, dass man dabei richtig liegt – aber ein Beweis ist das natürlich noch nicht.
Realistisch betrachtet besteht ohnehin nur wenig Hoffnung, dass es irgendwann
mathias.scholz@t-online.de
3.6 Abiogenese
325
einmal gelingt, eine physikalisch-chemisch schlüssige Theorie der Abiogenese auf
der Erde zu entwickeln. Sie würde wahrscheinlich in ihrer Gänze am Problem der
Nachprüfbarkeit scheitern. Was der experimentellen Forschung aber zugänglich ist,
sind wesentliche Teilprobleme einer solchen Theorie wie z. B. die Aufklärung von
Reaktionsfolgen, die zu den monomeren Grundbausteinen des Lebens führen. Das
sind in erster Linie Aminosäuren, bestimmte Saccharide, die für die RNA-Welt wesentlichen
Purine und Pyrimidine, Lipide für den Aufbau von Zellmembranen und
die Verknüpfung all der Reaktionswege dieser Stoffe zu komplexen chemischen
Netzwerken, die der Emergenz fähig sind. Diese Forschungen würden ein Gefühl
dafür vermitteln, ob „Leben, wie wir es kennen“ eher ein Ausnahmephänomen im
Kosmos ist oder quasi zwangsläufig entstehen muss, sobald die Rahmenbedingungen
dafür gegeben sind. Aber was sind nun genau diese Rahmenbedingungen? Man
kann sie in globale Rahmenbedingungen einteilen, die gewöhnlich mit dem Begriff
der „Habitabilität“ assoziiert werden (s. Abschn. 4.1). Die lokalen Rahmenbedingungen
sind dagegen schon weniger greifbar, da sie sich auf konkrete Umweltbedingungen
am Ort der Abiogenese auf einem Planeten beziehen – und diese sind
auch für den Fall der Erde nur ungenügend bekannt. Auf jeden Fall müssen sie im
Vergleich zu heute sehr extrem gewesen sein (man denke nur an das Zeitalter des
Großen Bombardements).
Wenn man bedenkt, dass zwischen der Ausbildung erster auf Autotrophie beruhender
autokatalytischer Netzwerke und LUCA nur wenige 100 Mio. Jahre liegen
– und das bei einem atemberaubenden Komplexitätsunterschied (!) 20 , dann gelangt
man schnell zu der Schlussfolgerung, dass die Entstehung des Lebens kein rein zufälliger,
sondern ein in irgendeiner Form determinierter Prozess gewesen sein muss,
der unter geeigneten Bedingungen quasi immer wieder stattfinden kann. Erkennt
man diese These an, dann bedeutet dies im Licht der modernen Exoplanetenforschung,
dass zumindest mikrobielles Leben weit im Kosmos verbreitet sein sollte.
Es macht also durchaus Sinn, in Zukunft (d. h., wenn dafür die instrumentellen
Voraussetzungen geschaffen sind) auf geeigneten Exoplaneten nach sogenannten
„Biomarkern“ zu suchen. Diese Aussage lässt sich aber nicht auf hochentwickeltes
Leben ausdehnen, welches man auf der Erde als „Metabionta“ bezeichnet und zu
denen bekanntlich auch der Mensch gehört. Es herrscht allgemein der Glaube vor,
dass die Entwicklung des Lebens zu immer komplexeren Formen ein unabwendbarer
Vorgang ist, wenn dafür nur genügend viel Zeit und ausreichend viele Ressourcen
unter geeigneten Umweltbedingungen zur Verfügung stehen. Aber hier kann
man durchaus skeptisch sein, wenn man sich die Entwicklung des Lebens auf der
Erde in den letzten 3,5 Ga vor Augen führt (Scholz 2014). Denn es ergeben sich in
dieser Beziehung einige unerfreuliche Wahrheiten:
Leben hat die Tendenz, klein und primitiv zu bleiben
Die wahren Beherrscher des Planeten Erde gehören den Domänen Archaea und
Bacteria an, und zwar sowohl was die Individuenzahl, die inkorporierte Biomasse
(ca. 10 3 Gt Kohlenstoff) und die Robustheit in Bezug auf die Umwelt (Stichwort
20
Es sei an das Eingangszitat zu Kap. 3 von Lynn Margulis erinnert!
mathias.scholz@t-online.de
326 3 Wie entsteht Leben? – das Rätsel der Abiogenese
Extremophile, s. Abschn. 2.9.1) betrifft. Das ist seit der Entstehung des Lebens so,
das ist heute so und wird auch die nächsten 1–2 Mrd. Jahre noch so bleiben, bis
die immer leuchtkräftiger werdende Sonne unabwendbar dem Leben auf diesem
Planeten ein schleichendes Ende bereiten wird (Li et al. 2009). Prokaryoten (Archaeen,
Bakterien) besitzen dabei auch heute noch einen Komplexitätsgrad, wie
er auch schon vor mehr als 3 Ga vorhanden war. Nur die bedeutend komplexeren
Eukaryonten (sie sind fossil seit ca. 2,1 Ga bekannt) besaßen das Potenzial, sich zu
arbeitsteilig differenzierten Metabiontazu entwickeln. So weiß man durch genetische
Untersuchungen, dass sich alle heute existierenden Tierstämme aus einer Urform
der Rippenquallen ( Ctenophora) entwickelt haben, die vielleicht am Ende des
Ediacariums bzw. (sicher) im frühen Kambrium lebten (Ryan et al. 2013).
In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch folgendes Faktum von Interesse:
Der „Superorganismus“ Mensch besteht größenordnungsmäßig aus ca. 10 Billionen
Körperzellen und ~ 100 Billionen Mikroorganismen in vielleicht 1000–1500 (oder
auch mehr) verschiedenen Arten, die immerhin zusammen ~ 10 % seiner Körpermasse
ausmachen. Sie sind zum allergrößten Teil lebensnotwendig (man denke nur
an die Darmbakterien), und ohne sie wäre der Mensch nicht lebensfähig. Und das
gilt nicht nur für ihn, sondern für alle höheren Lebewesen auf diesem Planeten. Es
ist durchaus richtig: Die erfolgreichsten Lebewesen auf der Erde sind ohne Zweifel
die Mikroben!
Der Entwicklungsweg von einer (primitiven) prokaryotischen Zelle zu einer
komplexen eukaryotischen Zelle eines ersten Metabionta hat sehr lange gedauert
Die eukaryotische Zelle, also eine Zelle, bei der die DNA im Zellkern verpackt ist
und die sich durch eine extrem komplexe innere Organisation mit einer Vielzahl
von hochspezifischen Zellorganellen auszeichnet, erschien vor ca. 2,4 Ga–2,2 Ga
auf der Bühne des Lebens. Erstaunlicherweise haben sich aus jener fernen Zeit des
Paläoproterozoikums Fossilien erhalten ( Gabonionta), bei denen es sich nach Meinung
ihrer Entdecker um die frühesten Formen mehrzelligen Lebens handelt (El
Albani et al. 2010). Da sich nach dem gültigen Paradigma bei Mehrzellern immer
um Komplexe (in diesem Fall zusammenhängende Kolonien?) aus voneinander abhängigen
eukaryotischen Zellen handelt, muss man ihre Entstehung aufgrund dieser
Funde um ca. 0,5 Ga zurückdatieren (Bis vor Kurzem war man noch der Meinung,
dass es Eukaryonten erst seit ca. 1,8 Ga auf der Erde gibt.). Zu diesem Zeitpunkt
hatte das Leben bereits fast die Hälfte seiner Geschichte hinter sich. Die ersten
großen und fossil überlieferten Mehrzeller mit einer gewissen nachweisbaren Diversität
gehören der Ediacarafauna an, die vor ca. 600 Ma den Grund der Weltmeere
besiedelte. Ihre Entwicklung (die noch weitgehend unerforscht ist) mündete in eine
knapp 100 Mio. Jahre andauernde Diversifikationsphase, bei der eine Vielzahl neuer
und z. T. grotesk aussehender Tierarten entstanden ist, von denen viele jedoch
schnell wieder ausstarben. Quintessenz dieser Entwicklungen ist jedoch, dass das
Leben einen großen zeitlichen Vorlauf benötigte, bis erste makroskopische und zellulär
ausdifferenzierte Lebewesen überhaupt möglich wurden. Ist ein solches Szenario
in zeitlicher Hinsicht repräsentativ, dann sollte man auf lebensfreundlichen
mathias.scholz@t-online.de
3.6 Abiogenese
327
Exoplaneten um relativ junge Sterne von der Art unserer Sonne (t < 3,5 Ga) nur mit
mikrobiellem Leben rechnen können.
Metabionta erreichen schnell eine hohe Diversität und Komplexität. Grundlegende
biologische Baupläne (z. B. Tiere mit Innenskelett, Schalentiere, Arthropoden
etc.) werden nach ihrer Entstehung nur noch modifiziert, aber nicht
neu erfunden
Zu erwähnen ist, dass zu Beginn des Kambriums innerhalb von einigen 10 Mio.
Jahren die Natur eine sehr große Zahl von verschiedenen Bauplänen erfunden hat,
die sich taxonomisch in Tierstämme ( Phylum) einteilen lassen. Aus nicht mehr
nachvollziehbaren Gründen waren am Ende dieser sogenannten „kambrischen Explosion“
(die genaugenommen eine adaptive Radiation war) vor ca. 540 Mio. Jahren
die meisten dieser biologischen Baupläne wieder verschwunden, und es sind
seitdem (bis auf wenige Ausnahmen) keine neuen hinzugekommen. Wären damals
zufällig die Chordata (z. B. die Pikaia aus dem Burgess-Schiefer) ausgestorben,
dann gäbe es heute weder Hering, Spatz noch Mensch… Oder anders ausgedrückt,
Mehrzelligkeit garantiert noch lange nicht die Entwicklung von mit Menschen (anatomisch
mehr oder weniger) vergleichbaren Lebewesen.
Die Geschichte des Lebens auf der Erde ist eine Geschichte von glücklich überstandenen
Katastrophen
Wenn man bedenkt, was in den rund 4 Mrd. Jahren von der Entstehung des Lebens
bis zum Erscheinen des Menschen hätte alles passieren können, was für das Leben
auf der Erde absolut tödlich gewesen wäre, dann kann man die Schlussfolgerung
wagen, dass höheres, d. h. mehrzelliges Leben im Kosmos eher selten bis sehr selten
anzutreffen ist. Und es hat in der Geschichte des Lebens auf der Erde eine ganze
Anzahl von einschneidenden Ereignissen (Katastrophen) gegeben (mindestens 10
große, wenn man die gegenwärtig stattfindende mitzählt), die zu einem sogenannten
„Faunen- oder auch Florenschnitt“, also einem Massenaussterben (Extinktion)
von Tier- und Pflanzenarten, geführt haben. Dieser paläontologisch gut gesicherte
Tatbestand hat Peter Ward veranlasst, seine Medea-Hypothese zu formulieren
(gewissermaßen als Gegenpart zur lebensfreundlichen Gaia-Hypothese von James
Lovelock), nach der das multizellulare Leben (verstanden in ihrer Gesamtheit als
Superorganismus) quasi zum Suizid neigt (Ward 2009).
Es ist aber nicht abzustreiten, dass derartige Katastrophen für die Entwicklung
des Lebens auch ungeahnte Chancen bieten, da auf diese Weise ehemals besetzte
ökologische Nischen wieder frei werden. Das fast vollständige Aussterben der großen
landlebenden Reptilien vor 65 Mio. Jahren war z. B. die Voraussetzung dafür,
dass die Säugetiere, die zur Zeit der Dinosaurier winzig klein waren und unter ihnen
nur ein Schattendasein fristeten, auf einmal erfolgreich die Erde erobern konnten.
Intelligenz im Sinne von Ich-Bewusstsein und zivilisationsstiftender Kraft ist
keine evolutionsbiologische Notwendigkeit
In den vielen Milliarden Jahren, seitdem es Leben auf der Erde gibt, steht das schwer
zu definierende Phänomen der Intelligenz als Ausdruck besonderer kognitiver Fämathias.scholz@t-online.de
328 3 Wie entsteht Leben? – das Rätsel der Abiogenese
higkeiten ganz am Ende der Entwicklung. Solche Fähigkeiten stellen zwar ohne
Zweifel immer einen Selektionsvorteil dar, aber sie sind erst bei höheren Primaten
zusammen mit dem Ich-Bewusstsein zu einer Synthese gelangt, die eine kulturelle,
zivilisatorische Entwicklung überhaupt erst ermöglichten. Die Einzigartigkeit des
Homo sapiens liegt in dieser Hinsicht in seiner Fähigkeit, kulturelle Informationen
weiterzugeben und zu einem zentralen Aspekt seines Lebens zu machen. Möglich
wurde dies durch die Entstehung zunächst sprachlicher, dann schriftlicher Kommunikation
(Mayr 2001). Ohne diese sehr speziellen Fähigkeiten sind kulturelle
(Kunst und Literatur) und technologische Entwicklungen (Mathematik und Naturwissenschaften)
nicht möglich.
Denken und Intelligenz sind übrigens kein alleiniges Privileg des Menschen.
Wenn man sich etwas umschaut, erkennt man schnell, dass sie unter warmblütigen
Tieren (Vögel und Säugetiere) durchaus verbreitet sind (Reichholf 2011).
Aber ohne sprachliche Komponente und spezielle motorische Fähigkeiten, die den
Menschen auszeichnen und mit deren Hilfe er seine Umwelt aktiv und bewusst
verändern kann, bleibt ihnen eine zivilisatorische Entwicklung versagt. Vorsichtig
ausgedrückt, lehrt allein schon das Beispiel Erde, dass außerirdische Zivilisationen
extrem selten sein dürften und ihre Zahl in unserer Milchstraße außer von Evolutionsbiologen
fast immer maßlos überschätzt wird.
mathias.scholz@t-online.de