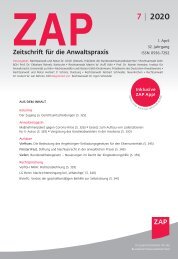ZAP-2019-24
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sozialrecht Fach 18, Seite 1703<br />
Sanktionen im SGB II<br />
Wird die Verletzung einer Mitwirkungspflicht durch eine Minderung existenzsichernder Leistungen<br />
sanktioniert, kann dies mit der verfassungsrechtlichen Gewährleistung einer menschenwürdigen<br />
Existenz vereinbar sein, wenn die Minderung nicht darauf ausgerichtet ist, repressiv Fehlverhalten<br />
zu ahnden, sondern darauf, dass Mitwirkungspflichten erfüllt werden, die gerade dazu dienen, die<br />
existenzielle Bedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Die Leistungsminderung wie auch die<br />
Pflicht, die mit ihr durchgesetzt werden soll, dienen dann dazu, so das BVerfG, den existenznotwendigen<br />
Bedarf auf längere Sicht nicht mehr durch staatliche Leistung, sondern durch Eigenleistung der<br />
Betroffenen zu decken.<br />
Allerdings hebt das Gericht hervor, dass strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit gelten<br />
müssen, da die Minderung existenzsichernder Leistungen in diesem Fall in einem unübersehbaren<br />
Spannungsverhältnis zur Existenzsicherungspflicht steht. Derartige Leistungsminderungen sind nur<br />
verhältnismäßig, wenn die Belastungen der Betroffenen auch im rechten Verhältnis zur tatsächlichen<br />
Erreichung des legitimen Ziels stehen, die Bedürftigkeit zu überwinden, also eine menschenwürdige<br />
Existenz insb. durch Erwerbsarbeit eigenständig zu sichern. Ihre Zumutbarkeit richtet sich vor allem<br />
danach, ob die Leistungsminderung unter Berücksichtigung ihrer Eignung zur Erreichung dieses Zwecks<br />
und als mildestes, gleich geeignetes Mittel in einem angemessenen Verhältnis zur Belastung der<br />
Betroffenen steht. Die Anforderungen aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG sind nur dann gewahrt,<br />
wenn die durch Deckung des gesamten existenznotwendigen Bedarfs erforderlichen Leistungen für<br />
Bedürftige jedenfalls bereitstehen und es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, in zumutbarer Weise die<br />
Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistungen auch nach einer Minderung wieder zu erhalten. Der<br />
sonst bestehende Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers ist hier beschränkt, er ist enger, wenn er<br />
auf existenzsichernde Leistungen zugreift. Soweit er sich auf Prognosen über tatsächliche Entwicklungen<br />
und insb. über die Wirkungen seiner Regelung stützt, müssen diese hinreichend verlässlich<br />
sein. Je länger eine Minderungsregel in Kraft ist und der Gesetzgeber damit in der Lage, fundierte<br />
Einschätzungen zu erlangen, umso weniger genügt es, sich nur auf plausible Annahmen zur Wirkung<br />
der Durchsetzungsmaßnahmen zu stützen.<br />
3. Umfang der Verfassungswidrigkeit<br />
a) Minderung i.H.v. 30 % des maßgebenden Regelbedarfs (§ 31a Abs. 1 S. 1 SGB II)<br />
Die in § 31a Abs. 1 S. 1 SGB II bei der ersten Pflichtverletzung normierte Höhe einer Leistungsminderung<br />
von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs ist, so das BVerfG, nach derzeitigen Erkenntnissen verfassungsrechtlich<br />
nicht zu beanstanden. Zwar ist schon die Belastungswirkung dieser Sanktion außerordentlich<br />
und die Anforderungen an ihre Verhältnismäßigkeit sind entsprechend hoch. Doch kann sich<br />
der Gesetzgeber auf plausible Annahmen stützen, wonach eine solche Minderung der Leistungen auch<br />
aufgrund einer abschreckenden Wirkung dazu beiträgt, die Mitwirkung zu erreichen, und er kann davon<br />
ausgehen, dass mildere Mittel nicht ebenso effektiv wären.<br />
Allerdings genügt die weitere Ausgestaltung dieser Sanktion nicht den verfassungsrechtlichen<br />
Anforderungen. Unzumutbar ist die Vorgabe in § 31a Abs. 1 S. 1 SGB II, den Regelbedarf bei einer<br />
Pflichtverletzung ohne weitere Prüfung immer zwingend zu mindern. Der Gesetzgeber muss nach<br />
Auffassung des Gerichts sicherstellen, dass Minderungen unterbleiben können, wenn sie außergewöhnliche<br />
Härten bewirken, insb. weil sie in der Gesamtbetrachtung untragbar erscheinen. Er muss Ausnahmesituationen<br />
Rechnung tragen, in denen es Menschen zwar an sich möglich ist, eine Mitwirkungspflicht<br />
zu erfüllen, die Sanktion aber dennoch im konkreten Einzelfall aufgrund besonderer Umstände<br />
unzumutbar erscheint.<br />
Für verfassungswidrig wird auch angesehen, dass die Sanktion der Minderung des Regelbedarfs nach<br />
§ 31a Abs. 1 S. 1 SGB II unabhängig von der Mitwirkung, auf die sie zielt, immer erst nach drei Monaten<br />
endet. Da der Gesetzgeber an die Eigenverantwortung der Betroffenen anknüpfen muss, wenn er<br />
existenzsichernde Leistungen suspendiert, weil zumutbare Mitwirkung verweigert wird, ist dies nur<br />
gerechtfertigt, wenn eine solche Situation grds. endet, sobald die Mitwirkung erfolgt. Sie darf ab<br />
<strong>ZAP</strong> Nr. <strong>24</strong> 18.12.<strong>2019</strong> 1297