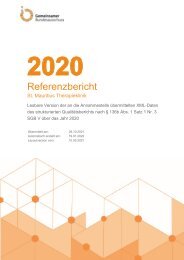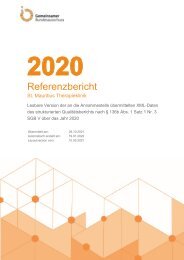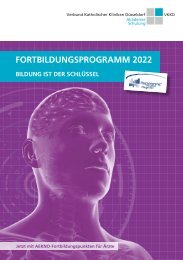150 Jahre MHD (Buch)
Geschichte des Marien Hospital
Geschichte des Marien Hospital
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ulrich Brzosa<br />
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital<br />
Düsseldorf
Herausgeber: Katholische Stiftung Marien Hospital zu Düsseldorf<br />
Rochusstraße 2, 40479 Düsseldorf<br />
Telefon (02 11) 44 00-0<br />
Telefax (02 11) 44 00-26 10<br />
info@marien-hospital.de<br />
www.marien-hospital.de<br />
Juni 2014<br />
Auflage: 1.000<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Druck und Bindung: Firmengruppe APPL<br />
aprinta druck GmbH, Senefelderstraße 3-11, 86650 Wemding<br />
Gestaltung: Leonard Sieg
Ulrich Brzosa<br />
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong> Marien Hospital Düsseldorf<br />
Herausgegeben von<br />
der Katholischen Stiftung Marien Hospital<br />
zu Düsseldorf<br />
Düsseldorf 2014
Das Marien Hospital Düsseldorf - <strong>150</strong> <strong>Jahre</strong> bürgerschaftliches Engagement<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
Schon im frühen Christentum war die Sorge um den kranken Menschen ein Wesens- und Unterscheidungsmerkmal<br />
zur ausgehenden Antike. Auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 erging ein Erlass, der die Bischöfe zur<br />
Einrichtung von Pflegehäusern für kranke und hilfsbedürftige Menschen verpflichtete. Die professionelle Sorge<br />
um pflegebedürftige Menschen in Europa ist aus dieser Tradition christlicher Ordensgemeinschaften entstanden<br />
und gilt als der Ursprung der heutigen Krankenhaus landschaft.<br />
Von Anfang an mussten sich die vielfachen Gründungen mit der Frage der Finanzierung ihrer Vorhaben beschäftigen.<br />
Das rief gerade im 19. Jahrhundert das konfessionelle Bürgertum auf den Plan, das fest im Stadtund<br />
Kirchenleben verwurzelt war. Mit viel Engagement trugen katholische Bürger der Stadt Düsseldorf einen<br />
Kapitalstock von 20.382 Talern zusammen und gründeten 1864 eine Stiftung mit dem Zweck der Errichtung<br />
eines Krankenhauses - das uns heute als Marien Hospital Düsseldorf bekannt ist.<br />
Das Marien Hospital Düsseldorf kann in diesem Jahr auf sein <strong>150</strong>-jähriges Stiftungs jubiläum zurückblicken. Es feiert dieses im Bewusstsein<br />
an einen Auftrag, der im christlichen Selbstverständnis verankert ist, aber auch in Verpflichtung gegenüber den Stifterinnen und Stiftern,<br />
deren Willen es war, ein Krankenhaus auf fundier ter wirtschaftlicher Grund lage zu erbauen und für zukünftige Generationen zu erhalten.<br />
Seit 2007 gehört das Marien Hospital Düsseldorf dem Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) an. Der Zusammenschluss mit anderen<br />
benachbarten Krankenhäusern sichert nicht nur das Bestehen in einem sich nachhaltig verändernden Umfeld, sondern bietet auch<br />
die Chance zu einer Profilierung des medizinischen Spektrums, wie dies an allen Standorten des VKKD realisiert wird.<br />
Heute ist die Vision der Stifter ein fester Bestandteil des Krankenhauswesens in der Stadt Düsseldorf und Anspruch wie Ansporn zugleich<br />
für alle hier beschäftigten Berufs gruppen. Das Marien Hospital Düsseldorf ist überregional bekannt und erfreut sich eines großen Renommees.<br />
Neben der hohen medizinischen Expertise in den medizinischen Fachbereichen ist es besonders die pflegerische Zuwendung<br />
und die ganzheitliche Betrachtung des Menschen sowie die Investition in Zukunftstherapien, die Patienten mit diesem Haus verbinden.<br />
Zuletzt durch den Neubau der Strahlentherapie und die Anschaffung der entsprechenden Hoch leistungstechnik im Jahr 2013 kann das<br />
Marien Hospital Düsseldorf auf dem Niveau führender Tumorzentren arbeiten.<br />
Was Düsseldorfer Bürger im Jahr 1864 mit ihrem Engagement angestoßen haben, hat sich heute zu einem anerkannten Zentrum, u. a. für<br />
die Tumormedizin, entwickelt, das in die universitäre und internationale Medizin eingebunden ist, aktuelle Entwicklungen auf dem neuesten<br />
wissenschaftlichen Stand in Therapiekonzepte umsetzt und den Patienten Behandlung aus „einer Hand“ anbieten kann. Bei allen<br />
diesen Entwicklungen steht heute noch immer der Anspruch, zugleich den seelischen Bedürfnissen im Umfeld von Hochleistungsmedizin<br />
gerecht zu werden und so das ursprüngliche Anliegen der christlichen Caritas im täglichen Medizinbetrieb zu bewahren.<br />
Das alles ist für die Stiftung, das Haus und alle darin Beschäftigten im Jahr 2014 ein Grund zu feiern. Als Begleiter für das Festjahr hat<br />
die Katholische Stiftung Marien Hospital zu Düsseldorf dieses Jubiläumsbuch herausgegeben. Es lässt in seinem ersten Teil die Geschichte<br />
des Hauses bis in die neueste Zeit Revue passieren. Im Anschluss befinden sich zahlreiche Abbildungen der Zeitgeschichte, die Entstehung<br />
und Wandel des Hauses dokumentieren.<br />
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und ein interessantes<br />
Jubiläumsjahr mit dem Marien Hospital Düsseldorf!<br />
Düsseldorf, im Juni 2014<br />
Bernd Eversmann, Vorsitzender des Kuratoriums der Katholischen Stiftung Marien Hospital zu Düsseldorf
Stationäre Krankenpflege in<br />
Düsseldorf vom Mittelalter<br />
bis zur Aufklärung<br />
Stationäre Krankenpflege in<br />
Düsseldorf vom Mittelalter<br />
bis zur Aufklärung<br />
Wie überall sind auch in Düsseldorf die<br />
meisten Krankenanstalten im Sinne von<br />
Heilanstalten erst in der zweiten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts entstanden. Bis zu dieser<br />
Zeit war Krankenpflege in der Regel Privatkrankenpflege<br />
in der eigenen Wohnung,<br />
in die sich auch der herbeigerufene Arzt<br />
begab. Zwar gab es auch in früheren Zeiten<br />
Häuser, in denen Kranke aufgenommen<br />
wurden; aber sie beschränkten sich nicht<br />
auf diese, sondern gewährten Bedürftigen<br />
verschiedener Art Einlass: Armen, Waisen,<br />
Pilgern und Siechen. Kranke fanden weniger<br />
zum Zweck der Heilung Aufnahme,<br />
sondern weil sie wegen unheilbarer oder<br />
ekelerregender Leiden und Gebrechen<br />
nirgendwo unterkommen konnten. Multifunktionale<br />
Häuser dieser Art wurden<br />
Xenodochium, Gasthaus oder Hospital<br />
genannt und waren seit dem Mittelalter in<br />
jeder größeren Stadt anzutreffen.<br />
Das Gasthaus in Düsseldorf war über<br />
mehrere Jahrhunderte die einzige nennenswerte<br />
Fürsorgeanstalt der Stadt. Die erste<br />
urkundliche Erwähnung eines Hospitals<br />
findet sich in einer Zoll‐ und Kellnereirechnung<br />
aus dem <strong>Jahre</strong> 1382, in der es<br />
heißt: „Omnium sanctorum gerechnet<br />
mit meister Luydken aas vam hospitail,<br />
asso dat hey darin vermurt hadde 132000<br />
steens“. Ob es sich dabei um einen von<br />
Gasthausmeister und Hausarme in Düsseldorf, 1629<br />
Kreuzherrenkirche, Ratinger Straße 2, um 1910<br />
Hôtel Dieu in Paris, um <strong>150</strong>0<br />
5
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Herzog Wilhelm I. veranlassten Neubau oder um die Erweiterung<br />
eines bereits seit dem 13. Jahrhundert bestehenden<br />
Hauses handelte, kann nicht entschieden werden.<br />
Als gesichert gilt, dass das Gasthaus neben der Liebfrauenkapelle<br />
vor den Toren der Stadt (heute Ratinger Str. 2) stand.<br />
Dies geht aus einer Urkunde von 1395 hervor, die zugleich<br />
den Zweck des Düsseldorfer Gasthauses umschrieb als eine<br />
Stiftung, um „de arme peilgrime, seeken ind lamen ind blynden<br />
to spysen ind to laven ... in dat Hospitael ind Gasthuys,<br />
dat gelegen is zo Dusseldorpe vur lieven Vrouwen porte“.<br />
Wie in vielen anderen Städten hatte auch in Düsseldorf das<br />
Gasthaus die Doppelfunktion, Kranke und Arme zu unterstützen<br />
und durchreisende Fremde und Pilger zu beherbergen.<br />
Als Düsseldorf im ausgehenden Mittelalter seine frühere<br />
Gedenkblatt zur Einweihung des Hubertushospitals<br />
an der Kasernenstraße, 1712<br />
Flingerstraße 21, um 1900<br />
Aufnahme neuer Ritter in den Hubertusorden, 1769<br />
Vorrangstellung unter den niederrheinischen<br />
Wallfahrtsorten verlor, transformierte<br />
das Gasthaus der Stadt immer mehr von<br />
einem Xenodochium zu einem Armenhaus.<br />
Spätestens seit dieser Zeit hatte im Gasthaus<br />
die Sorge für einheimische Arme,<br />
Alte und Waisen, Kranke und Invalide,<br />
überhaupt für alle der Hilfe Bedürftigen<br />
den Vorrang. Obwohl das Gasthaus eine<br />
profane Einrichtung war und keine Bindung<br />
an den Klerus oder eine kirchliche Institution<br />
besaß, hatte es unverkennbar „einen<br />
kirchlichen Anstrich“. Nach Ausweis der<br />
Akten mussten nicht selten diejenigen,<br />
„welche bleibend ... aufgenommen sein<br />
wollten, ihre weltliche Kleidung ablegen,<br />
allem Eigenthume entsagen, und häufigerem<br />
Gebet und gottesdienstlicher Übung<br />
obliegen, als sonst bei Laien gewöhnlich<br />
war“.<br />
Im Zuge der Planungen zum Bau<br />
eines Klosters für die Kreuzbrüder, die<br />
Herzog Gerhard nach Düsseldorf berufen<br />
und 1443 mit der Liebfrauenkapelle und<br />
dem angrenzenden Gasthaus ausgestattet<br />
hatte, wurde das Xenodochium vor dem<br />
Liebfrauentor aufgehoben und ein neues<br />
Hospital auf dem heutigen Grundstück<br />
Flinger Str. 21 eingerichtet, das spätestens<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1449/50 seine Pforten für<br />
Bedürftige öffnete.<br />
Trotz solider Finanzbasis geriet die<br />
Armenanstalt im Laufe der Zeit zunehmend<br />
in Verfall. Äußeres Indiz für den Niedergang<br />
ist der Befund, dass immer mehr vermögende<br />
Bürger in das Hospital aufgenommen<br />
und verpflegt wurden und die ursprünglich<br />
intendierte Armenfürsorge nur noch<br />
eine untergeordnete Rolle spielte. Erst zu<br />
Beginn des 18. Jahrhunderts wurde unter<br />
Kurfürst Johann Wilhelm eine grundlegende<br />
Reformierung der Anstalt in die Wege<br />
6
Stationäre Krankenpflege in<br />
Düsseldorf vom Mittelalter<br />
bis zur Aufklärung<br />
geleitet, die sowohl auf Erhöhung des<br />
Stiftungskapitals wie auch auf effizientere<br />
Koordination der verschiedenen Fürsorgeorgane<br />
ausgerichtet war. Zur Aufstockung<br />
des Gasthausfonds wurden die Einkünfte<br />
mehrerer milder Stiftungen gebündelt und<br />
dem Hospital zugeführt. Zusätzlich reaktivierte<br />
der Herzog 1708 den bereits 1444<br />
gestifteten, „aber durch die bey nach und<br />
nach zufälligen unglücklichen Zeitwechslungen<br />
erfolgte Empörungen in Untergang<br />
gerathenen Ritterlichen Orden des Heyligen<br />
Huberti“ und band die caritativ wirkende<br />
Adelsvereinigung an das Gasthaus.<br />
Die bedeutende Vermehrung des Stiftungskapitals<br />
erlaubte es, die Zahl der<br />
Hospitaliten von 22 auf 100 zu erhöhen. Da<br />
die vorhandenen Räumlichkeiten für eine<br />
derartige Erweiterung nicht ausreichten,<br />
ließ der Kurfürst das Gasthaus, mittlerweile<br />
„eine elende Hütte zur Unzierde der Stadt“,<br />
in ein neu zu errichtendes Hospital an der<br />
heutigen Kasernenstraße verlegen. Dieses<br />
neue, speziell für die Zwecke einer Fürsorgeanstalt<br />
konzipierte Gebäude wurde 1710<br />
von den ersten Gasthausinsassen bezogen,<br />
nachdem ein Jahr zuvor auf einem von Johann<br />
Wilhelm gestifteten Grundstück der<br />
Grundstein zu einem großzügig angelegten<br />
Gebäudekomplex gelegt worden war. Eine<br />
vom Kurfürsten erlassene Regula schrieb<br />
vor, nur „alte, arme, preßhafte, miserable<br />
Personen“ in das Hospital aufzunehmen.<br />
Als weiteres Auswahlkriterium trat die<br />
Zugehörigkeit zur katholischen Kirche hinzu.<br />
Man erwartete, „daß alle und Jede so<br />
schwärer unpäßlichkeit halber nicht gehindert,<br />
Täglich dem ordinairen Gottesdienst,<br />
und gebett mit innerlich und äußerlicher<br />
andacht beywohnen“.<br />
In den siebziger <strong>Jahre</strong>n des 18.<br />
Jahrhunderts musste das Gasthaus, das<br />
mittlerweile St. Hubertushospital<br />
genannt wurde, erneut<br />
verlegt werden, da die Räumlichkeiten<br />
zur Einrichtung eines<br />
Militärlazaretts benötigt wurden.<br />
Als Ersatz für die abgetretenen<br />
Liegenschaften erhielt<br />
das Hubertushospital im <strong>Jahre</strong><br />
1772 eine Immobilie in der<br />
Neustadt, die allgemein unter<br />
dem Namen „Judenhaus“<br />
(heute Neusser Str. 25) bekannt<br />
war. Das im <strong>Jahre</strong> 1712 erbaute<br />
Haus des kurpfälzischen Hoffaktors<br />
Joseph Jacob van Geldern<br />
hatte der jüdischen Gemeinde als<br />
Synagoge gedient, bis es von der Garnison<br />
als Kommissbäckerei übernommen wurde.<br />
Als sich die wirtschaftlichen Verhältnisse<br />
des wesentlich verkleinerten Hubertushospitals<br />
mehr und mehr konsolidierten,<br />
drohte dem Gasthaus mit dem Verlust<br />
des linken Rheinufers an die Franzosen<br />
im <strong>Jahre</strong> 1794 der völlige Untergang. Da<br />
die Einkünfte der Anstalt zu etwa zwei<br />
Dritteln aus linksrheinischen Besitzungen<br />
stammten, war an eine Fortführung der Tätigkeit<br />
im bisherigen Umfang nicht mehr zu<br />
denken. Aus eigener Kraft konnte die einst<br />
bedeutendste Institution des Düsseldorfer<br />
Fürsorgewesens, die um die Wende zum<br />
19. Jahrhundert zu einer reinen Wohnanstalt<br />
für mittellose Frauen herabgesunken<br />
war, die erlittenen Einkommensverluste<br />
nicht kompensieren<br />
Aus Sicht des Hubertushospitals war<br />
es ein Glücksfall, dass zur Zeit seines Niederganges<br />
eine andere Fürsorgeanstalt<br />
ins Leben trat, die wenig später mit dem<br />
Gasthaus fusionierte und das einstige Xenodochium<br />
vor der kaum noch abwendbaren<br />
Schließung bewahrte.<br />
Hubertushospital,<br />
Neusser Straße 25, 18. Jh.<br />
Hubertushospital, Annakapelle,<br />
Neusser Straße 25, um 1930<br />
7
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Das Max-Joseph-Krankenhaus<br />
Bei dieser Institution handelte<br />
es sich um das Max-Joseph-<br />
Krankenhaus, das seine Entstehung<br />
einer Initiative der<br />
Marianischen Bürger-Sodalität<br />
verdankte und in der Düsseldorfer<br />
Medizingeschichte<br />
als erstes Krankenhaus im<br />
eigentlichen Sinne gilt. Den<br />
entscheidenden Anstoß zur<br />
Einrichtung einer stationären<br />
Unterkunft für Kranke gab der<br />
Düsseldorfer Textil-Kaufmann<br />
Carl Eberhard Roosen im <strong>Jahre</strong><br />
1798, „wo die Stadt noch<br />
nicht ein einziges Bett besaß,<br />
auf dem sie arme Kranke hätte<br />
pflegen und heilen können“.<br />
Der rührige Geschäftsmann<br />
und engagierte Bürger-Sodale<br />
hatte auf seinen Reisen vielfach<br />
Gelegenheit gefunden,<br />
Einrichtungen zur Pflege und<br />
Versorgung erkrankter Personen<br />
kennen zu lernen. Nachdem<br />
Carl Eberhard Roosen<br />
zur Gründung einer Krankenanstalt<br />
in seiner Heimatstadt<br />
aufgerufen hatte, beschloss die<br />
Marianische Bürger-Sodalität<br />
am 11. September 1798, ein<br />
allgemeines Krankenhaus einzurichten,<br />
in dem mittellose<br />
Reuterkaserne, um 1900<br />
Andachtsbuch der Marianischen<br />
Bürgersodalität Düsseldorf, 1826<br />
Hubertushospital, Binnenhof,<br />
Neusser Straße 25, um 1910<br />
Patienten ohne Unterschied der Religion<br />
und des Standes aufgenommen und verpflegt<br />
werden sollten. Der Sodalitätsvorstand<br />
bat den Kurfürsten, „einige Stuben<br />
zu diesem Behuf miethen zu dürfen“, die<br />
ihm, wie es im ersten <strong>Jahre</strong>sbericht des<br />
Krankenhauses heißt, „den 17. Juli 1799<br />
und zwar mit Erlassung aller Miethzinsen<br />
gnädigst zugestanden“ wurden.<br />
Von der Marianischen Bürger-Sodalität<br />
wurden in der Reuterkaserne zwei Zimmer<br />
„geschwind und zweckmäßig“ hergerichtet.<br />
Im November 1799 konnten die<br />
ersten Patienten aufgenommen werden,<br />
von denen einer „aus den Bilker Gärten“<br />
stammte und mit einer Porto-Chaise überführt<br />
wurde. Bis Ende September 1800<br />
wurden 16 Kranke versorgt, „von welchen<br />
nur Drey starben; Sieben aber das Haus gesund<br />
verließen“. Während einige Mitglieder<br />
der Bürger-Sodalität, die um die Wende<br />
zum 19. Jahrhundert rund 600 Sodalen<br />
zählte, ehrenamtlich die Aufsicht über den<br />
Pflegebetrieb führten, wurde Carl Eberhard<br />
Roosen zum hauptamtlichen Direktor und<br />
Verwalter des Krankenhauses bestellt. Für<br />
die medizinische Betreuung konnten der<br />
Stadtphysicus und zwei Chirurgen, für<br />
die seelsorgliche Betreuung Jesuitenpater<br />
Heinrich Wüsten und die protestantischen<br />
Prediger Theodor Hartmann und Carl Ludwig<br />
Pithan gewonnen werden, von denen<br />
„jeder in seinem Fache, unentgeltlich mit<br />
zum Besten der Anstalt“ wirkte.<br />
Als die Räume in der Reuterkaserne<br />
den wachsenden Anforderungen und Ansprüchen<br />
nicht mehr genügten, wurde das<br />
Armen-Krankenhaus der Marianischen Bürger-Sodalität<br />
in die leer stehenden Zimmer<br />
8
Die Cellitinnen<br />
Die Cellitinnen<br />
des Hubertushospitals verlegt. Pfalzgraf<br />
Maximilian Joseph ordnete am 8. Juli 1802<br />
von München aus die Fusion beider Anstalten<br />
an, wobei er beabsichtigte, das<br />
Hubertushospital „nach und nach durch<br />
das Absterben der noch lebenden Hospitaliten,<br />
welche einstweilen im Spital noch<br />
beizubehalten“ waren, eingehen zu lassen.<br />
Bei der Aufnahme in das neue Krankenhaus<br />
sollte wie bisher die Zugehörigkeit zu einer<br />
bestimmten Konfession keine Rolle spielen,<br />
„sondern bloß auf das Bedürfnis und die<br />
übrigen aus der Natur eines solchen Instituts<br />
fließenden Erfordernisse zur Aufnahme<br />
Rücksicht genommen werden“. Obwohl<br />
sich beide Institute unter einem Dach befanden<br />
und der Oberaufsicht eines Direktors<br />
unterstellt waren, blieben sie rechtlich<br />
getrennt. Letzteres kam vor allem darin zum<br />
Ausdruck, dass das Krankenhaus, welches<br />
auf Anordnung des Kurfürsten vom 8. Juli<br />
1802 den Namen „Max-Joseph-Spital“<br />
trug, unter der Leitung von Kaufmann Carl<br />
Eberhard Roosen blieb und seine Betriebskosten<br />
allein aus Spendensammlungen der<br />
Bürger-Sodalität deckte.<br />
Die durch das Max-Joseph-Krankenhaus<br />
in Düsseldorf erstmals verwirklichte<br />
medizinische und organisatorische Struktur<br />
der stationären Krankenpflege setzte sich<br />
in der Stadt nur langsam durch. Erst nach<br />
Überlassung des alten Karmelitessenklosters<br />
in der Altestadt an den Cellitinnenorden<br />
im <strong>Jahre</strong> 1831 wurde in Düsseldorf eine<br />
weitere Krankenanstalt eröffnet.<br />
Unter den caritativen Ordensgenossenschaften<br />
Düsseldorfs war die nach der<br />
Augustinerregel lebende Kongregation der<br />
Cellitinnen der älteste Pflegekonvent. Ihre<br />
Niederlassung erfolgte während einer der<br />
zahlreichen Pestepidemien des 17. Jahrhunderts,<br />
mit der Absicht, Pestilenzopfer<br />
zu pflegen. Im Dezember 1650 kamen<br />
sechs Schwestern aus Köln in die bergische<br />
Kapitale, „um ihre Liebesdienste anzubieten<br />
und den Grund zu einem Kloster zu<br />
legen“. Von der ersten, heute nicht mehr zu<br />
lokalisierenden Unterkunft der Cellitinnen<br />
ist nur überliefert, dass sie baufällig war<br />
und den Anforderungen des klösterlichen<br />
Lebens nicht genügte. Daher baten 1681<br />
die Schwestern den Landesherrn Johann<br />
Wilhelm um Erlaubnis, ein nebenan liegendes<br />
Haus ankaufen zu dürfen. Im gleichen<br />
Jahr bewilligte der Stadtrat den Schwestern<br />
für ihre „so enge und baufällige“ Wohnung<br />
eine Kollekte, weil das Haus einzustürzen<br />
drohte und „die Bewohner sich nicht vor<br />
dem Regen schützen“ konnten. Ohne die<br />
Sammlung wäre der Orden kaum in der<br />
Lage gewesen, vor dem <strong>Jahre</strong> 1689 auf<br />
dem „Hundts-Ruggen“ (heute Hunsrückenstr.<br />
10) ein Klostergebäude und eine<br />
Kirche zu erbauen, die 1699 zu Ehren der<br />
Hl. Elisabeth geweiht wurden. Wie aus<br />
Notizen um die Wende zum 18. Jahrhundert<br />
hervorgeht, beschäftigten sich die<br />
Düsseldorfer Cellitinnen ausschließlich mit<br />
ambulanter Krankenpflege in der Stadt und<br />
im nahen Umland.<br />
Cellitinnenkloster, Hunsrückenstraße 10, 1837<br />
Unbekannte Düsseldorfer Cellitin, 18. Jh.<br />
9
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Die Heilanstalt für weibliche<br />
Kranke im Elisabethkloster<br />
Trotz gesicherter Einkünfte war die Funktionsfähigkeit des<br />
Elisabethklosters, dessen Schwestern aufgrund eines kurfürstlichen<br />
Erlasses als „Krankenwärterinnen“ von der allgemeinen<br />
Klosteraufhebung des <strong>Jahre</strong>s 1803 ausgenommen waren<br />
und weiterhin ambulante Krankenpflege in der Stadt leisten<br />
durften, nach der Säkularisation rückläufig. Mitte der 1820er<br />
<strong>Jahre</strong> waren von den zehn Schwestern drei altersschwach,<br />
vier alt und nur im Tagesdienst tätig. Hinzu kam, dass die<br />
alte Behausung der Cellitinnen gegenüber der Andreaskirche<br />
immer weniger den Arbeitserfordernissen der Schwestern<br />
entsprach und zusehends baufällig wurde. Zu Beginn des<br />
Karmelitessenkloster, Rheinflügel, Altestadt 2-4, vor 1909<br />
St. Elisabethkloster, Altestadt 2-4, 1836<br />
Karmelitinnenpriorin Anna de S. Teresa, nach 1667<br />
19. Jahrhunderts „bedauerten sie täglich,<br />
daß der beschränkte Raum ihres Klosters<br />
ihnen nicht gestattete, unbemittelte Kranke<br />
und Dienstboten zu sich zu nehmen, um<br />
ihnen bessere Pflege zu gewähren. Nur zu<br />
oft machten die Schwestern die Erfahrung,<br />
daß alle Sorge und Mühe vergeblich war,<br />
weil es dem Kranken an einem ordentlichen<br />
Lager, oder an der nöthigen Ruhe, Reinlichkeit,<br />
frischer Luft, und oft an allem dem<br />
fehlte, was die Genesung fördern kann“.<br />
In dieser Situation schlug der angesehene<br />
Schul- und Konsistorialrat Johann Vinzenz<br />
Josef Bracht im <strong>Jahre</strong> 1826 eine Einweisung<br />
der Cellitinnen in das aufgehobene<br />
und nur noch von drei Nonnen bewohnte<br />
Karmelitessenkloster in der Altestadt vor.<br />
Obwohl der Kölner Erzbischof Ferdinand<br />
August von Spiegel und der Düsseldorfer<br />
Landdechant Wilhelm Heinzen den Plänen<br />
der Regierung bald ihre Zustimmung gaben,<br />
ließ die Ausführung der Neuordnung<br />
noch fünf <strong>Jahre</strong> auf sich warten. In dieser<br />
Zeit, im Spätherbst 1828 kam auch der Plan<br />
auf, mit dem Kloster eine Krankenanstalt<br />
zu verbinden, zu deren Fundierung eine<br />
Stiftung von 4000 Talern bereitstand.<br />
Am 1. Januar 1831 übertrug König<br />
Friedrich Wilhelm III. durch Kabinettsorder<br />
unentgeltlich das Klostergebäude der Karmelitinnen,<br />
ihre Kirche und das vorhandene<br />
Kapitalvermögen mit den darauf ruhenden<br />
Lasten dem Cellitinnenorden. Nach dem<br />
Umbau des Karmelitessenklosters zu einem<br />
Spital eröffneten die Cellitinnen am 1. Januar<br />
1832 eine „Heilanstalt für weibliche<br />
Kranke im Elisabethen-Kloster“, in der am<br />
24. Januar die erste Patientin Aufnahme<br />
fand und stationär versorgt wurde. Bereits<br />
am 28. Mai 1831 hatte die Düsseldorfer<br />
Regierung verfügt, die Krankenaufnahme<br />
im Max-Joseph-Hospital auf Männer und<br />
10
Die Heilanstalt für weibliche<br />
Kranke im Elisabethkloster<br />
im Elisabethkloster auf Frauen zu beschränken.<br />
Um zu verhindern, dass die neue<br />
Einrichtung sich zu einem Siechenhaus<br />
entwickelt, wurden Greise abgewiesen und<br />
als längste Verweildauer ein Aufenthalt<br />
von drei Monaten festgelegt. Arme sollten<br />
kostenlos, Vermögende für einen Tagesatz<br />
von fünf Silbergroschen verpflegt werden.<br />
Auch wenn die Schwestern wenig<br />
geschult waren, bedeutete die Ausübung<br />
stationärer Krankenpflege durch die Cellitinnen<br />
ohne Zweifel einen bedeutsamen<br />
Fortschritt auf dem Gebiet der Düsseldorfer<br />
Krankenhausfürsorge. Mag das<br />
Max-Joseph-Hospital in der Neustadt medizingeschichtlich<br />
auch als erstes Krankenhaus<br />
in Düsseldorf gelten, so boten die<br />
„Barmherzigen Schwestern“, wie sich die<br />
Cellitinnen seit dem Umzug in den Karmel<br />
selbst bezeichneten, mit ihrer neuen Heilanstalt<br />
erstmals mehr als eine bloße Verwahranstalt<br />
für Kranke. In einer Beschreibung<br />
des <strong>Jahre</strong>s 1836 heißt es über die Vorzüge<br />
der Anstalt nahe des Rheinufers: „Das Gebäude<br />
vereiniget viele Eigenschaften, die<br />
seinen Werth für die jetzige Bestimmung<br />
erhöhen. Die ruhige Lage, die vortheilhafte<br />
Richtung der Krankensäle (nach Morgen),<br />
der abgeschlossene, jeder fremden Einsicht<br />
entzogene Garten, die frische Rheinluft, die<br />
freie Aussicht in eine anmuthige Landschaft<br />
und der Anblick des Rheinstroms und seiner<br />
belebten Ufer sind Vortheile, die kein anderes<br />
Gebäude unsrer Stadt darbietet, und<br />
die man auf solche Weise vereint, in vielen<br />
andern Städten vergebens suchen wird“.<br />
Da die Aufgabe, das von der Bevölkerung<br />
immer mehr in Anspruch genommene<br />
Krankenhaus zu leiten, bald die Kräfte<br />
der Cellitinnen überstieg, übernahmen<br />
1852 zunächst fünf Töchter vom Heiligen<br />
Kreuz den Dienst in der Anstalt, bis sie<br />
1859 formell den Barmherzigen<br />
Schwestern aus Aspel als<br />
Eigentum überwiesen wurde.<br />
Das Haus erfreute sich unter<br />
der Leitung der neuen Ordenskongregation<br />
großer Beliebtheit<br />
und behielt im Volksmund<br />
den Namen „Kloster der Barmherzigen<br />
Schwestern“ bei,<br />
auch als es nach dem großen<br />
Um- und Erweiterungsbau im<br />
<strong>Jahre</strong> 1912 den Namen Theresienhospital<br />
erhalten hatte.<br />
Rheinfront mit Karmelitessenkloster<br />
und Kohlentor, um 1900<br />
Theresienhospital, Töchter vom<br />
Hl. Kreuz, Altestadt 2-4, 1933<br />
11
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Städtische contra konfessionelle<br />
Krankenhäuser<br />
Katasterplan Pempelfort, 1866<br />
Düsseldorfer Röhren- und Eisenwalzwerke<br />
AG, Kölner Straße 172, um 1930<br />
Als die Töchter vom Heiligen<br />
Kreuz 1852 die Heilanstalt in<br />
der Altestadt übernahmen,<br />
hatten sich die Anforderungen<br />
an ein Krankenhaus bereits<br />
entscheidend geändert. Im Gegensatz<br />
zu dem als Armenversorgungshaus<br />
eingerichteten<br />
Gasthaus stand im „Kloster der<br />
Barmherzigen Schwestern“ die<br />
Heilung auf Grund ärztlicher<br />
Behandlung und sachgemäßer Pflege im Vordergrund. Nicht<br />
mehr der arme, unverschuldet in Not geratene oder alte,<br />
meist alleinstehende Mensch sollte hier Unterkunft finden,<br />
sondern das durch Krankheit kurzfristig ausgefallene Mitglied<br />
einer sich neu formierenden Gesellschaft. Nicht mehr der<br />
Anspruch auf Versorgung, sondern immer mehr der Wunsch<br />
nach Wiederherstellung und Heilung wurde an das sich neu<br />
orientierende Haus für Kranke gestellt.<br />
Als Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Düsseldorf die<br />
Industrialisierung durch den Ausbau der Eisenbahnstrecken,<br />
durch den Einsatz von Dampfmaschinen und durch<br />
die Telegraphie mit Macht einsetzte und das Anwachsen<br />
Maria-Hilf-Hospital in Aachen, vor 1914<br />
des städtischen Proletariats soziale Probleme<br />
wie nie zuvor aufwarf, stieß auch die<br />
medizinische Versorgung schnell an ihre<br />
Leistungsgrenzen. Den Bedürfnissen der<br />
prosperierenden Stadt Düsseldorf (1831:<br />
28710, 1858: 46849 Einwohner) genügten<br />
das Max-Joseph-Hospital in der Neustadt,<br />
die Krankenpflegeanstalt der Barmherzigen<br />
Schwestern in der Altestadt und das 1849<br />
eröffnete Krankenhaus der evangelischen<br />
Gemeinde in der Berger Straße nicht mehr.<br />
Als sich mehr und mehr die Erkenntnis<br />
durchsetzte, dass ein Neubau unumgänglich<br />
sei, beauftragte die Verwaltung im<br />
Frühjahr 1858 den Gemeinderat Christian<br />
Schlienkamp, in Begleitung des Chirurgen<br />
Dr. Franz Zens und Stadtbaumeisters<br />
Eberhard Westhofen, die Krankenhäuser<br />
in Köln, Bonn und Aachen zu visitieren.<br />
Obwohl die Delegation am 6. März 1858<br />
einen Bericht über ihre Erfahrungen vorlegte,<br />
wurde der Bau eines neuen allgemeinen<br />
städtischen Krankenhauses bald wieder<br />
verworfen, „weil die hiesigen Konfessionsgemeinden<br />
die Absicht kundgegeben haben,<br />
dem vorhandenen Bedürfnisse durch<br />
ihrerseits alsbald zu erbauende konfessionelle<br />
Krankenhäuser abzuhelfen“.<br />
Nachdem die Verwaltung für den<br />
Bau eines städtischen Krankenhauses das<br />
31 Morgen große Gut Stockkamp (Am<br />
graulichen Bongert) am 23. Juli 1859 für<br />
18000 Taler angekauft hatte, wandte sich<br />
das Kuratorium der evangelischen Gemeinde<br />
am 3. März 1860 an Oberbürgermeister<br />
Ludwig Hammers und fragte an, „ob das<br />
evangelische Krankenhaus nach wie vor<br />
12
Städtische contra konfessionelle<br />
Krankenhäuser<br />
neben dem städtischen bestehen solle, oder<br />
ob es nicht zweckmäßiger sein dürfte, daß<br />
die katholischen Gemeinden einerseits, und<br />
die evangelische Gemeinde andererseits<br />
durch ein von der Stadt aufzubringendes<br />
Baucapital in den Stand gesetzt würden,<br />
die für die Bedürfnisse, jeder Konfession<br />
ausreichenden Krankenhäuser jede für<br />
sich zu erbauen“. Der Magistrat sollte die<br />
Oberaufsicht behalten, doch hätte er nicht<br />
mehr die Last der Verwaltung und des<br />
Unterhalts zu tragen brauchen. Außerdem<br />
wäre den konfessionellen Gemeinden so<br />
„die längst gewünschte Möglichkeit geboten,<br />
die Pflege der Kranken den geeigneten<br />
Orden und Bruderschaften zu übergeben,<br />
und die geistliche Pflege der Kranken in der<br />
jeder Konfession entsprechenden Weise<br />
zu ordnen“.<br />
Als die katholischen Gemeinden Düsseldorfs<br />
am 31. März 1860 dem Auf- und<br />
Ausbau kircheneigener Krankenhäuser<br />
gleichfalls den Vorzug gaben, beschlossen<br />
die Stadtverordneten am 31. Oktober 1860<br />
die Einrichtung konfessioneller Heilanstalten.<br />
Die Förderung von Krankenhäusern<br />
in kirchlicher Trägerschaft ließen die Stadt<br />
erhebliche Einsparungen erwarten. Auf<br />
evangelischer Seite dachte man an einen<br />
Neubau, während die katholischen Pfarreien<br />
am 4. Januar 1861 eine Erweiterung<br />
der Heilanstalt der Töchter vom Hl. Kreuz<br />
von 40 auf 250 Betten in Betracht zogen.<br />
Da noch unklar war, wer für die Durchführung<br />
des Bauvorhabens verantwortlich sein<br />
sollte, schlug ein Leser des Düsseldorfer<br />
Anzeigers am 1. Dezember 1860 vor: „Wie<br />
wäre es, wenn der verehrliche Verein zur<br />
Errichtung einer Mariensäule den Gedanken<br />
der Erbauung eines ‚Marien-Hospitals‘<br />
zu dem seinigen machen würde?“. Zwar<br />
wurde die Anregung nicht weiter verfolgt,<br />
doch blieb zumindest der Name „Marienhospital“ weiter im<br />
Gespräch.<br />
Trotz mehrfacher Umarbeitungen wurde 1862 „die von<br />
den katholischen Pfarrgemeinden beabsichtigte Erweiterung<br />
des Klosters der barmherzigen Schwestern zu einem größeren<br />
katholischen Krankenhause ... Seitens der königlichen Regierung<br />
aus medizinal-polizeilichen Gründen für unstatthaft<br />
erklärt und ein anderer Plan zur Beschaffung eines katholischen<br />
Krankenhauses eingefordert“. Da ein Neubau nicht in<br />
Frage kam, verfolgten die Vertreter der katholischen Kirche<br />
nun den Plan, das Max-Joseph-Hospital in der Neustadt zu<br />
erwerben, mit dem Hubertushospital zu verbinden und beide<br />
Anstalten durch Um- oder Neubau zu einem Krankenhaus<br />
zu erweitern. Wegen der komplizierten und verwickelten<br />
Eigentumsverhältnisse des Hubertusstiftes wurden von der<br />
Stadtverwaltung verschiedene<br />
Gutachten über die Rechtslage<br />
in Auftrag gegeben. Obwohl<br />
der Besitzstand nicht eindeutig<br />
zu klären war, erkannte die<br />
Stadtverordnetenversammlung<br />
am 13. Oktober 1863 „das<br />
Hubertus-Hospital als rein katholische<br />
Anstalt und als Eigentümerin<br />
des sogenannten<br />
Max-Joseph-Kranken- und Verpflegungshaus<br />
... unter der<br />
Verpflichtung der Einrichtung<br />
dieser Immobilien zu einem katholischen<br />
Krankenhause und<br />
Aufnahme der von der Stadt<br />
zu verpflegenden Kranken“<br />
an. Am 30. Dezember 1863<br />
erklärte sich das Kuratorium<br />
des Hubertushospitals zur Einrichtung<br />
eines katholischen<br />
Krankenhauses bereit, wenn<br />
die katholischen Pfarreien das<br />
hierzu erforderliche Kapital bereitstellten. Optimistisch prognostizierte<br />
der städtische Verwaltungsbericht des <strong>Jahre</strong>s 1863:<br />
„Die in Folge dessen zwischen dem Hubertus-Hospital und<br />
den katholischen Pfarrern gepflogenen Unterhandlungen<br />
Hubertushospital,<br />
Neusser Straße 25, um 1910<br />
13
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
St. Andreas, Andreasstraße 10, um 1900<br />
Aufruf des Comités für die Errichtung<br />
eines katholischen Kranken- und<br />
Verpflegungshauses zu Düsseldorf,<br />
1. März 1864<br />
Oberbürgermeister Ludwig Hammers<br />
(1849-1876), um 1900<br />
sind ihrem Abschlusse nahe und hängt hiernach die endliche<br />
Herstellung geeigneter, geräumiger konfessioneller Krankenhäuser<br />
nur noch davon ab, ob die hiesige katholische<br />
Bevölkerung im Stande sein wird, in gleicher Weise, wie<br />
dies von den evangelischen Bewohnern der Stadt bereits<br />
geschehen ist, die Geldmittel für die Einrichtung jener, von<br />
ihnen gewünschten, konfessionellen Anstalt aufzubringen“.<br />
Dem Optimismus der Stadtverwaltung gegenüber stand<br />
der Pessimismus der Düsseldorfer Geistlichkeit, die nicht<br />
zu Unrecht fürchtete, viele Katholiken könnten sich einer<br />
freiwilligen Spende entziehen. Ein abschlägiger<br />
Bescheid des Kirchenvorstandes von<br />
St. Andreas führte am 6. Februar 1864 zur<br />
Begründung des Votums an: „Leitend für<br />
diesen Beschluß ist die Betrachtung, daß<br />
es gesetzlich Sache der Zivilgemeinde ist,<br />
für ihre erkrankten Gemeindemitglieder die<br />
Sorge in vollem Maße zu übernehmen, daß<br />
zu dieser Sorge wesentlich auch gehört,<br />
diese Kranken in einem zweckentsprechendem<br />
Raume unterzubringen, wozu<br />
sich am besten empfiehlt die Erbauung<br />
von einem oder mehreren Krankenhäusern,<br />
die den Anforderungen der Wissenschaft<br />
und der Erfahrung an solche entsprechen:<br />
daß es der Zivilgemeinde besonders bei<br />
so geordneten Finanzen, wie in unserer<br />
Gemeinde, ein Leichtes ist, die nötigen<br />
Gelder für die Errichtung oder Einrichtung<br />
von Krankenhäusern auf gesetzlichem<br />
Wege aufzubringen: daß es aber nicht im<br />
Entferntesten wahrscheinlich ist, daß in den<br />
betreffenden Pfarreien im Wege des freiwilligen<br />
Sammelns die enormen Summen<br />
aufgebracht werden, die nach dem Projekte<br />
in Aussicht gestellt sind, zumal sogar der<br />
Zivilgemeinde die Gebäulichkeiten für das<br />
katholische Krankenhaus noch besonders<br />
mit 13000 Talern aus den Liebesopfern<br />
der Pfarrkinder erstattet werden sollen“.<br />
Am 15. Februar 1864 beriet Oberbürgermeister<br />
Ludwig Hammers die Angelegenheit<br />
mit den Pfarrern von St. Lambertus,<br />
St. Maximilian und St. Andreas.<br />
Zwar gelang es ihm nicht, den Klerus für<br />
den Ausbau des Max-Joseph-Hospitals zu<br />
gewinnen, doch erhielt er von den Geistlichen<br />
die Zusage für die Veranstaltung einer<br />
Spendensammlung. Alle Pfarrgemeinden<br />
benannten Mitglieder zu einem „Comitè<br />
für die Errichtung eines katholischen Kranken‐<br />
und Verpflegungshauses“, das sich am<br />
14
Die Gründung des<br />
Marienhospitalvereins<br />
1. März 1864 erstmals mit einem Aufruf<br />
an die Katholiken der Stadt Düsseldorf<br />
wandte. Der Appell blieb jedoch ohne<br />
nennenswerte Resonanz und brachte kaum<br />
800 Taler ein.<br />
Die katholischen Kräfte waren erst<br />
durch eine Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung<br />
vom 7. Juni 1864<br />
zu mobilisieren. Hier hatte der Magistrat<br />
unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister<br />
Ludwig Hammers beschlossen, die für<br />
den Krankenhausneubau vorgesehenen<br />
Einzugsgelder in Höhe von 29406 Talern<br />
nach der Kopfzahl auf die drei Konfessionen<br />
zu verteilen. Die Auszahlung war<br />
an folgende Bedingungen geknüpft: „Es<br />
soll der auf die Evangelischen hiernach<br />
fallende Anteil dem hiesigen Presbyterium<br />
derselben als Vertreter der evangelischen<br />
Gemeinde, der auf die Katholiken fallende<br />
Anteil dem Vorstande des Vereins, welcher<br />
sich zu diesem Zwecke unter den Katholiken<br />
der Oberbürgermeisterei Düsseldorf<br />
bilden wird und Korporationsrechte erhalten<br />
haben muß, und der auf die Israeliten<br />
fallende Anteil dem Vorstande der hiesigen<br />
Synagogengemeinde übergeben werden,<br />
sobald der Erwerb des zur Erbauung des<br />
Krankenhauses erforderlichen Terrains und<br />
dessen Privilegien- und Hypothekenfreiheit<br />
oder doch die Beschaffung des zum<br />
Ankaufe des Terrains erforderlichen Fonds<br />
und mindestens ein Drittel der Bausumme,<br />
binnen zwei <strong>Jahre</strong>n von heute ab, nachgewiesen<br />
sein wird“.<br />
Die Gründung des<br />
Marienhospitalvereins<br />
Die Kirchenvorstände der sieben<br />
Düsseldorfer Pfarreien beschlossen<br />
am 10. Juni 1864 die<br />
Errichtung eines katholischen<br />
Krankenhauses und riefen am<br />
6. Juli ein Komitee zur Bildung<br />
eines „Marien-Hospital-Vereins“<br />
ins Leben, der Ende des<br />
<strong>Jahre</strong>s bereits 1401 Mitglieder<br />
zählte und über 20382 Taler<br />
gezeichnete Stiftungsmittel<br />
verfügte. Ziel des Zusammenschlusses<br />
war es, „ein ganz<br />
neues, allen Anforderungen<br />
entsprechendes Krankenhaus<br />
zu erbauen, in welchem es<br />
nicht nötig werden würde, auf<br />
den ursprünglichen beschränkteren<br />
Plan, die Gebäude des<br />
Max-Joseph-Krankenhauses<br />
zu einem katholischen Krankenhause<br />
einzurichten“. Das<br />
„Statut für die zu errichtende<br />
katholische Kranken- und<br />
Verpflegungs‐Anstalt in der<br />
Sammtgemeinde Düsseldorf“ vom 22. Juli 1864 formulierte<br />
den Zweck mit den Worten: „Es bildet sich ein Verein zum<br />
Zwecke der Gründung und Leitung einer Anstalt mit Corporationsrechten<br />
unter dem Namen ‚Marienhospital‘ zur<br />
Verpflegung heilbarer und unheilbarer Kranken und womöglich<br />
auch zur Verpflegung altersschwacher Personen, ohne<br />
Rücksicht auf religiöses Bekenntniß (§ 1)“. Nach Annahme<br />
der Statuten auf einer Mitgliederversammlung am 3. August<br />
1864 in der Tonhalle wurde der „Marien-Hospital-Verein“<br />
am 16. Dezember 1864 durch die Wahl von Hermann von<br />
Mallinckrodt zum Vorsitzenden und Emil Schauseil zum<br />
Stellvertreter endgültig konstituiert.<br />
Statut der katholischen<br />
Kranken- und Verpflegungsanstalt<br />
Düsseldorf, 22. Juli 1864<br />
15
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Evangelisches Krankenhaus,<br />
Fürstenwall 91, um 1900<br />
Fürstin Josephine von Hohenzollern<br />
(1813-1900), um 1880<br />
Die Finanzierung<br />
Angetrieben von den deutlichen Fortschritten beim Bau des<br />
evangelischen Krankenhauses am Fürstenwall, dessen Grundsteinlegung<br />
am 15. Juli 1864 erfolgt war, veranstaltete der<br />
Hospitalverein zur Vermehrung seiner Mittel eine Vielzahl von<br />
Kollekten und Bazaren. Zur Koordination der verschiedenen<br />
Benefizveranstaltungen wurde am 4. Juni 1867 ein „Hülfscomite<br />
des Marien-Hospitals“ ins Leben gerufen, das schon<br />
wenige Tage nach seiner Konstituierung mit folgendem Aufruf<br />
an die Öffentlichkeit trat: „Der Verein für das Marien-Hospital<br />
verdient gewiß die Unterstützung Aller, denen das Wohl der<br />
leidenden Menschheit am Herzen liegt; denn er strebt nach<br />
einem großen, wahrhaft würdigen Ziele, der Errichtung<br />
eines Krankenhauses, welches zur Aufnahme aller Kranken<br />
ohne Unterschied der Confession bestimmt ist. Mit Freude<br />
sehen wir daher der Stunde entgegen, wo der Grundstein<br />
zu dem schönen Werke gelegt werden soll; zur Vollendung<br />
aber reichen die Mittel noch lange nicht aus ... und es wird<br />
das Zusammenwirken aller Kräfte erfordern, bis das ganze<br />
Baukapital zusammengebracht ist. Von dieser Überzeugung<br />
durchdrungen, haben sich die Unterzeichneten zu einem<br />
Hülfscomite vereinigt und zunächst die Veranstaltung eines<br />
Bazars beschlossen, dessen Eröffnung gegen Ende Juli des<br />
<strong>Jahre</strong>s in Aussicht genommen ist“.<br />
Mit welchem Engagement der katholische Bevölkerungsteil<br />
den Bau eines eigenen Krankenhauses in Düsseldorf<br />
betrieb, erhellt der Befund, dass sich wenige Wochen nach<br />
Gründung des „Hülfscomite des Marien-Hospitals“ ein<br />
„Damen-Comite“ konstituierte, um die Bemühungen des<br />
ausschließlich aus Männern bestehenden Hilfskomitees auf<br />
Jahr Einwohner Katholiken Protestanten Juden Sonstige<br />
1831 29233 24612 (84,19 %) 4118 (14,09 %) 498 (1,70 %) 5 (0,02 %)<br />
1864 58015 45187 (77,89 %) 12017 (20,71 %) 773 (1,33 %) 38 (0,07 %)<br />
1867 63389 49540 (78,15 %) 12930 (20,39 %) 870 (1,38 %) 49 (0,08 %)<br />
1871 69365 53055 (76,49 %) 15298 (22,06 %) 919 (1,32 %) 93 (0,13 %)<br />
1875 80695 61089 (75,70 %) 18393 (22,79 %) 924 (1,14 %) 289 (0,37 %)<br />
Konfessionsstatistik Düsseldorf<br />
ihre Weise zu unterstützen. In einem<br />
Inserat, abgedruckt im Düsseldorfer<br />
Anzeiger vom 3. August 1867, rief die<br />
rührige Frauenvereinigung insbesondere<br />
zur Unterstützung des bereits geplanten<br />
Bazars zu Gunsten des Marienhospitals<br />
auf. „Angeregt durch den jüngst entstandenen<br />
Hülfsverein für das Marien-<br />
Hospital“, so die Sprecherinnen des<br />
Damenkreises, „haben sich die Unterzeichneten<br />
zu dem Zwecke vereinigt,<br />
den genannten Verein in seinen Bestrebungen<br />
thatkräftig zu unterstützen und<br />
besonders die Errichtung des zunächst in<br />
Aussicht genommenen Bazars verwirklichen<br />
zu helfen. Auf unser Ansuchen<br />
hat auch Ihre Königliche Hoheit die<br />
Frau Fürstin von Hohenzollern, welche<br />
stets, wo es gilt, das Gute zu fördern,<br />
mit ihrem Beispiele voranleuchtet, sich<br />
nicht nur bereit erklärt, unser Unternehmen<br />
nach Kräften zu unterstützen,<br />
sondern auch das Protektorat unseres<br />
Vereins huldvoll übernommen. Unsere<br />
Aufgabe ist nun zunächst, Geschenke<br />
für den Bazar zu sammeln“.<br />
Nur wenige Wochen nach den<br />
Appellen des „Hülfscomite des Marien-Hospitals“<br />
und des „ Damen-Comite“<br />
konnte der Bazar zu Gunsten<br />
des Marienhospitals am 25., 26. und<br />
27. November 1867 im Rittersaal der<br />
Tonhalle durchgeführt werden. „Eine<br />
überaus reiche Anzahl von Gegenständen“,<br />
so der Düsseldorfer Anzeiger vom<br />
16. November 1867 in einem Vorbericht,<br />
„werden an diesen Tagen zum<br />
Besten des neu zu erbauenden katholischen<br />
Krankenhauses zum Verkaufe<br />
kommen. Der Einsender hat sich durch<br />
eigene Anschauung überzeugt, wie viel<br />
Schönes und Zweckmäßiges durch den<br />
16
Die Finanzierung<br />
arbeitsvollen Eifer der Damen hier zusammen<br />
gekommen ist. Werthvolle Stickereien wechseln<br />
mit hunderterlei Gegenständen anderer<br />
Art, so daß Jeder für seinen Geschmack und<br />
seine besondere Liebhaberei etwas finden<br />
wird, wofür er gewiß gerne eine Ausgabe<br />
macht. Reiche Beiträge von Ölgemälden sind<br />
von unseren biedern Künstlern geschenkt<br />
worden, und es befinden sich darunter Piecen<br />
von den ersten Mustern, außerdem eine<br />
Menge von Kupferstichen“.<br />
Das Engagement der Initiatoren war<br />
nicht vergebens. Am 26. November 1867<br />
berichtete der Düsseldorfer Anzeiger über<br />
den Verlauf des ersten Verkaufstages: „Ihre<br />
Königliche Hoheit die Fürstin von Hohenzollern,<br />
die hohe Protectorin des Vereins, wurde<br />
am Eingange des Tonhallen-Lokals von dem<br />
Ausschusse ehrfurchtsvoll empfangen ... Den<br />
Herren des Hülfs-Comites wurde dieselbe<br />
Ehre zu Theil. ... Die hohen Herrschaften<br />
machten besonders reiche Einkäufe. ... Der<br />
Besuch war ein sehr starker, der nach den<br />
eingegangenen Entreegeldern auf <strong>150</strong>0-<br />
1800 Personen angeschlagen werden darf.<br />
Zusätzlich bemerken wir noch, daß folgende<br />
Bilder verkauft worden sind. Seine Königliche<br />
Hoheit der Fürst von Hohenzollern kaufte das<br />
große Gemälde von Professor Karl Wilhelm<br />
Hübner: ‚Trost im Gebete‘, und das von<br />
Christian Jakob Sell; weiter wurden verkauft<br />
Ölgemälde von Andreas Achenbach, Oswald<br />
Achenbach, Ernst Deger, ... Franz Ittenbach,<br />
Albert Arnz, Carl Jungheim“.<br />
Da die Düsseldorfer Künstler durch unentgeltliche<br />
Überlassung einer großen Anzahl<br />
von Bildern nicht unwesentlich am großen Erfolg<br />
des Bazars mit einem Reinerlös von 9478<br />
Talern beigetragen hatten, sah sich der Vorstand<br />
des Marienhospitalvereins veranlasst,<br />
„um die ausgezeichneten Verdienste der<br />
hiesigen Künstlerschaft um die Vollendung<br />
des Marien-Hospitals dauernd<br />
zu ehren und ihrer Dankbarkeit<br />
gegen dieselbe thatsächlichen<br />
Ausdruck zu geben ... , dem<br />
hiesigen Künstler-Unterstützungs-Verein<br />
für seine hülfsbedürftigen<br />
Mitglieder in dem<br />
zu erbauenden Krankenhause<br />
eine Anzahl von Betten zur<br />
Verfügung zu stellen“.<br />
Neben Bazaren und Kollekten,<br />
vor allem der jährlichen<br />
Sammlung zu Pfingsten<br />
in allen katholischen Kirchen<br />
der Oberbürgermeisterei Düsseldorf,<br />
gingen nicht unerhebliche<br />
Beiträge und Umlagen<br />
für den Krankenhausbau aus<br />
wissenschaftlichen Vorträgen<br />
ein, die Wissenschaftler aller<br />
Fakultäten und Persönlichkeiten<br />
des öffentlichen Lebens<br />
aus dem gesamten Rheinland<br />
„zum Besten des Marienhospital-Vereins“<br />
in Düsseldorf<br />
hielten. Den Auftakt machten<br />
Professoren der Universität<br />
Bonn, die zwischen dem 11.<br />
Januar und 15. Februar 1865<br />
zu sechs Vorlesungen verschiedener<br />
Wissensgebiete in die<br />
Aula des Gymnasiums (heute<br />
Heinrich-Heine-Allee 32) einluden.<br />
Im März 1865 berichtete<br />
der Düsseldorfer Regierungsrat<br />
Tonhalle, Schadowstraße 91,<br />
vor 1880<br />
Plakat des Hülfscomités des<br />
Marienhospitals, 31. Mai 1869<br />
Alte Kunstakademie,<br />
Burgplatz 2, um 1890<br />
17
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Der Ankauf eines<br />
Bauplatzes<br />
Gymnasium, Heinrich-Heine-Allee 32, um 1890<br />
Ferdinand Schlünkes, Der deutsche Pilgerzug nach dem<br />
heiligen Lande, 1865<br />
Einlasskarte, 10. Juli 1867<br />
Situationsplan Pempelfort, 1878<br />
Ferdinand Schlünkes an drei Abenden über<br />
eine Pilgerfahrt in das Heilige Land. Sein<br />
tagebuchartiger Reisebericht lockte nicht<br />
nur eine große Zahl von Interessierten<br />
in die Tonhalle, sondern erschien noch<br />
im gleichen Jahr unter dem Titel „Der<br />
deutsche Pilgerzug nach dem heiligen<br />
Lande im <strong>Jahre</strong> 1864“ im Düsseldorfer F.<br />
M. Kampmann Verlag. Während sich die<br />
Referenten der Vorlesungen des <strong>Jahre</strong>s<br />
1866 aus dem Kreis der Honoratioren<br />
des Düsseldorfer Katholizismus rekrutierten,<br />
waren zum Vortragszyklus 1867 in<br />
der Mehrzahl wieder auswärtige Wissenschaftler<br />
eingeladen.<br />
I m ersten Schritt für den Ankauf eines geeigneten<br />
Baugrundstückes veröffentlichte<br />
der Vorstand des Marienhospitalvereins am<br />
19. Dezember 1864 folgende Bekanntmachung:<br />
„Die Gründung des Marien-Hospitals<br />
erfordert den Erwerb eines sowohl nach<br />
Lage als Beschaffenheit für den Bau und die<br />
Zwecke eines Kranken‐ und Pflegehauses<br />
geeigneten Grundstückes zur Größe von<br />
etwa 6-10 Morgen. Wir ersuchen daher<br />
Diejenigen, welche sich im Besitze solcher<br />
Grundstücke befinden und zu deren Veräußerung<br />
geneigt sind, ihre desfalligen<br />
Anerbietungen unter genauer Bezeichnung<br />
der betreffenden Grundstücke, Beifügung<br />
einer Situationsskizze und Angabe der Verkaufsbedingungen<br />
bis spätestens 1. März<br />
1865 ... schriftlich einzusenden“. Schon<br />
Ende Februar 1865 wurden zwei zum Kauf<br />
offerierte Grundstücke in Bilk vom Vorstand<br />
besichtigt, doch gab der Verein dem von<br />
der Stadt für den Bau eines kommunalen<br />
Krankenhauses erworbenen Gut Stockkamp<br />
nach kurzen Verhandlungen den Vorzug.<br />
Am 23. Mai 1865 erklärte sich der Stadtrat<br />
bereit, „dem Marien-Hospitalverein den zur<br />
Erbauung eines katholischen Kranken- und<br />
Verpflegungshauses den nötigen Teil des<br />
Gutes Stockkamp, welchen näher zu bestimmen<br />
die Stadtverordnetenversammlung<br />
sich vorbehält, zum selbstkostenden Preise<br />
zu verkaufen“.<br />
In der Sitzung vom 15. August 1866<br />
fasste der Ausschuss des Marienhospitalvereins<br />
den Beschluss, „daß der 10,5 Morgen<br />
große, zwischen dem Düsselbache und der<br />
Winkelsfelderstraße gelegene Theil des<br />
18
Der Ankauf eines Bauplatzes<br />
Stockkampgutes von der Stadt Düsseldorf<br />
auf den Namen des Herrn Dechanten<br />
Philipp Joesten (St. Lambertus) für den Preis<br />
von 7700 Thalern und gegen Übernahme<br />
des 80 Thaler betragenden ratirlichen Antheils<br />
einer auf dem Grundstücke haftenden<br />
Rente von <strong>150</strong> Thalern zu Gunsten der Frau<br />
von Kyllmann angekauft ... werde“. Der<br />
Vertrag mit der Stadt Düsseldorf über den<br />
Ankauf des Anwesens wurde unter dem<br />
5. November 1866 abgeschlossen.<br />
Ausdrücklich war im Vereinsbericht<br />
1865 festgehalten worden, dass das Grundstück<br />
in Pempelfort (Sternstr. 91) „sich nach<br />
dem Gutachten von Sachverständigen,<br />
sowohl der Lage als der Beschaffenheit<br />
nach ganz besonders für das zu errichtende<br />
Hospital“ eignete. Dass das positive Urteil<br />
der Sachverständigen über die Beschaffenheit<br />
des Bauplatzes nicht von allen geteilt<br />
wurde, geht aus einer Zuschrift an den<br />
Düsseldorfer Anzeiger hervor, der am 11.<br />
April 1867 unter der Überschrift „Ernste,<br />
wohlgemeinte, laute Frage“ folgende Anfrage<br />
zum Abdruck brachte: „Ist es zweckmäßig,<br />
das neue katholische Krankenhaus<br />
in‘s Winkelsfeld zu bauen! Man gehe hinaus<br />
und sehe, wie fast das ganze, für das<br />
Krankenhaus bestimmte Grundstück hoch<br />
überschwemmt ist. Kann sich eine solche<br />
Überschwemmung nicht möglicher Weise<br />
von Jahr zu Jahr wiederholen? Und was<br />
sagen die Herren Baumeister, was sagen<br />
die Herren Ärzte dazu?“.<br />
Um eine lang andauernde Diskussion<br />
über den Bauplatz zu verhindern, trat der<br />
Vorstand des Marienhospitalvereins bereits<br />
fünf Tage später mit einer Gegendarstellung<br />
an die Öffentlichkeit: „Wir sehen uns<br />
... veranlaßt“, so die Rechtfertigung im<br />
Düsseldorfer Anzeiger vom 16. April 1867,<br />
„hierdurch zur öffentlichen Kenntniß zu<br />
bringen, daß sich die Bedenken<br />
gegen die Wahl des Bauplatzes<br />
im Stockkamp bei der von uns<br />
veranlaßten Untersuchung als<br />
gänzlich unbegründet herausgestellt<br />
haben“. Nach einem<br />
Gutachten, das der Vorstand<br />
beim Düsseldorfer Wasserbauinspektor<br />
Johannes Hild<br />
in Auftrag gegeben hatte, war<br />
das in Aussicht genommene<br />
Grundstück mit nur geringem<br />
Aufwand gegen Hochwasser<br />
„vollständig“ zu schützen.<br />
Zur Kostensenkung wurde<br />
im Mai 1866 mit Genehmigung<br />
der Stadtverordnetenversammlung<br />
auf dem westlich der Düssel<br />
(heute Prinz-Georg-Straße)<br />
gelegenen Teil des Stockkampgutes<br />
für den Bau des Marienhospitals<br />
eine Ziegelei angelegt.<br />
Unter der Aufsicht eines<br />
„Ziegelbaas“, der für je 1000<br />
gebrannte Steine einen Taler<br />
erhielt, wurden bereits im ersten<br />
Jahr für den projektierten<br />
Neubau mehr als 1265000 Ziegel hergestellt.<br />
„Diese Selbstfabrikation der Ziegelsteine bei<br />
dem schönen Material, was wir auf unserem<br />
Grundstück besitzen“, so der Rechenschaftsbericht<br />
zur <strong>Jahre</strong>swende 1866/67, „ist für den<br />
Verein von sehr wesentlichem Vortheil, und<br />
sind bereits für nächstes Jahr die Verträge mit<br />
den betreffenden Ziegelmeistern zur Fertigstellung<br />
von weiteren 1200000 Ziegelsteinen<br />
abgeschlossen“.<br />
Düsselgraben,<br />
Prinz-Georg-Straße, um 1900<br />
Alte Hofstelle am Stockkämpchen,<br />
Stockkampstraße, um 1930<br />
19
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Architekt August Rincklake (1843-<br />
1915), um 1910<br />
Die Baukonkurrenz<br />
Etwa zeitgleich mit dem Aufziegeln des Baugeländes erfolgte<br />
am 26. Februar 1866 die Ausschreibung einer Konkurrenz<br />
zur Einreichung von Bauplänen, in der für den besten Plan<br />
eine Prämie von 50 Friedrichsdor ausgesetzt war. Infolge der<br />
Konkurrenzausschreibung waren bis zum 1. August 1866 vier<br />
verschiedene Entwürfe für den Bau des Marienhospitals eingegangen.<br />
„Die Jurry“, so der Vereinsbericht 1866, „welche<br />
zur Beurtheilung dieser Pläne zusammengetreten ist, verlieh<br />
2 Plänen die in den Concurrenz-Ausschreiben zugesicherten<br />
Prämien, während die Pläne Eigenthum des Vereins bleiben.<br />
Bei Beurtheilung dieser Pläne erkannte die Jurry sowie später<br />
andere Sachverständige, daß wohl keiner dieser beiden<br />
prämiirten Pläne so ganz zur<br />
Ausführung sich eigne, theils<br />
weil die Anlage zu kostspielig,<br />
theils die Situation der einzelnen<br />
Gebäude, als: Krankenhaus,<br />
Capelle und Pflegehaus<br />
keine zweckmäßige sei, jedoch<br />
sonst zu einem neuen Projekt<br />
sehr schätzenwerthes Material<br />
böten. Später sind nun unter<br />
Zugrundelegung dieser beiden<br />
prämiirten Pläne sowie nach<br />
einer von einzelnen Mitgliedern<br />
des Vorstandes und Herrn<br />
Architekten August Rincklake<br />
unternommenen Reise zur<br />
Besichtigung der Krankenhäuser<br />
in Aachen, Cöln, Bonn<br />
etc. andere Situations-Pläne<br />
entstanden. Dieselben haben<br />
einer Commission, bestehend<br />
aus den Herren Regierungs-<br />
Architekt August Rincklake<br />
(1843-1915), um 1910<br />
Bauprogramm für das Marienhospital,<br />
26. Februar 1866<br />
und Baurath Krüger, Doctor Windscheid<br />
und Stadtbaumeister Westhoven, vorgelegen,<br />
und hatte jeder der Herren die<br />
Freundlichkeit, ein besonderes schriftliches<br />
Gutachten hierüber abzugeben. In diesen<br />
drei Gutachten sprachen die Herren sich<br />
einstimmig dahin aus, daß sie die Situation<br />
der verschiedenen Gebäude, wie sie in einem<br />
der vorgelegten Pläne aufgestellt, für<br />
zweckmäßig und praktisch hielten und in<br />
der Eintheilung der Grundrisse etc. einige<br />
sehr zweckentsprechende Verbesserungen<br />
fänden“. Nachdem Architekt August<br />
Rincklake im Winter 1866/67 unter Berücksichtigung<br />
der Gutachten einen neuen<br />
Plan entworfen und für das Krankenhaus<br />
ohne Kapelle und Pflegehaus einen mit<br />
90000 Talern abschließenden Kostenvoranschlag<br />
angefertigt hatte, gab dieser<br />
„bei seiner demnächstigen Prüfung durch<br />
die zuständige Behörde in baupolizeilicher<br />
und sanitätspolizeilicher Beziehung nicht<br />
allein zu Erinnerungen keinen Anlaß“, so<br />
der Düsseldorfer Anzeiger vom 11. Dezember<br />
1867, „sondern fand wegen seiner<br />
Zweckmäßigkeit und Schönheit allgemeine<br />
Anerkennung“.<br />
Baubeginn und<br />
Grundsteinlegung<br />
Nach Eingang der Bauerlaubnis durch die<br />
Königliche Regierung beschloss der Ausschuss<br />
des Marienhospitalvereins in der<br />
Sitzung vom 17. Mai 1867, den Bau des<br />
Krankenhauses in drei Schritten auszuführen.<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1867 sollte der Bau bis zum<br />
Erdgeschoss geführt, 1868 unter Dach<br />
gebracht und 1869 im Innern ausgebaut<br />
sein. Zugleich genehmigte der Ausschuss<br />
20
Baubeginn und Grundsteinlegung<br />
den Beginn des Baues. Noch im selben<br />
Monat wurden die Erdarbeiten und die<br />
Mauererarbeiten am Souterrain in Angriff<br />
genommen. Unterstützt wurden die Bauarbeiter<br />
in Pempelfort von Steinmetzen, die<br />
durch die Unterbrechung des Baues der<br />
Dominikanerkirche an der Herzogstraße<br />
frei geworden waren und in einer auf<br />
dem Bauplatz errichteten Steinmetzhütte<br />
unter der Leitung ihres Meisters beschäftigt<br />
werden konnten.<br />
Schon wenige Wochen nach Aufnahme<br />
der Bauarbeiten erfolgte am 17. September<br />
1867 in Gegenwart zahlreicher Ehrengäste<br />
die feierliche Grundsteinlegung für den<br />
Hospitalbau. Überschwänglich berichtete<br />
der Düsseldorfer Anzeiger noch am gleichen<br />
Tag: „Mit der heute Vormittag erfolgten<br />
feierlichen Grundsteinlegung zu dem St.<br />
Maria-Hospital und Verpflegungshause<br />
ist endlich das langersehnte Krankenhaus<br />
in Angriff genommen, dessen Vollendung<br />
von jedem Düsseldorfer, der es mit seiner<br />
Vaterstadt gut meint, ernstlich gewünscht<br />
wird, und das damit unseren armen kranken,<br />
alters- und körperschwachen Mitbürgern<br />
eine trostreiche Zufluchtsstätte zu bereiten<br />
und ihnen ein freundliches Unterkommen<br />
und liebreiche Pflege zu gewähren bestimmt<br />
ist. Die Feier begann heute Morgen um 9<br />
Uhr mit einem feierlichen Hochamte in<br />
der St. Lambertus-Pfarrkirche ... Nach dem<br />
Hochamte erfolgte der festliche Auszug<br />
sämmtlicher städtischen Pfarren, ... nach der<br />
Baustelle durch die festlich geschmückten<br />
Straßen unserer Stadt, in einer großartigen<br />
gemeinschaftlichen Prozession ... Die Baustelle<br />
war festlich geschmückt mit Fahnen<br />
und Flaggen aller Art und in Mitten derselben<br />
erhob sich die Statue der Patronin<br />
des Vereins unter zierlichen Topfpflanzen.<br />
Umringt von einer ungemein großen Anzahl<br />
Marienhospital, Entwurfszeichnung von August Rincklake, um 1868<br />
und Theilnehmenden eröffnete der Vicepräsident des St.<br />
Marien-Hospital-Vereins, Herr Advokat-Anwalt Emil Schauseil,<br />
die Festlichkeit mit einer Ansprache, in welcher die Entstehungsgeschichte<br />
des Vereins in kurzen Zügen skizzirt, der<br />
Bürgerschaft Düsseldorfs Dank ausgesprochen wird, für das<br />
einträchtige Zusammenwirken zur Beschaffung der zum Bau<br />
nöthigen Mittel, zu welcher Art beigetragen, der Reiche, wie<br />
der Arme, zu der Dienstboten ihre sauren Ersparnisse willig<br />
geopfert und die Kinder ihre Sparbüchsen umgestürzt hätten. ...<br />
Er verlas dann die in den Grundstein zu versenkende Stiftungsurkunde<br />
und ersuchte den erzbischöflichen Commissar, Herrn<br />
Domkapitular Philipp Joesten,<br />
dem Grundstein die kirchliche<br />
Weihe zu ertheilen. ... Mit<br />
dem Segensworte des Herrn<br />
Domkapitular schloß die Feier,<br />
und in der anständigsten<br />
Haltung kehrte die anwesende<br />
Volksmenge, welche die<br />
Festlichkeit zusammengezogen<br />
hatte, zur Stadt zurück“.<br />
Dominikanerkloster,<br />
Herzogstraße 17, um 1925<br />
Einladungskarte,<br />
17. September 1867<br />
21
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Fortschritt und Stillstand<br />
Das Jahr 1868, das später auch in eisernen<br />
Ziffern an der Front des Gebäudes angebracht<br />
wurde, war für das Marienhospital<br />
das wichtigste Baujahr. Über die Fortschritte<br />
des Bauvorhabens seit der Grundsteinlegung<br />
berichtete der Düsseldorfer Anzeiger am 29.<br />
Mai 1868 aus Anlass der jährlichen Pfingstkollekte:<br />
„Nachdem nämlich im vorigen <strong>Jahre</strong><br />
Fundamente und Souterrains im Rohbau in<br />
Angriff genommen und vollendet worden<br />
sind, hat der Weiterbau im März dieses <strong>Jahre</strong>s<br />
wieder begonnen und ist augenblicklich<br />
das Erdgeschoß vollendet und wird gleich<br />
nach Pfingsten auch der Aufbau der beiden<br />
Etagen in Angriff genommen werden. Diese<br />
Mauerarbeiten müssen vor Ende des Monats<br />
September beendet sein, um frühzeitig vor<br />
Eintritt des Winters das ganze Gebäude noch<br />
im Rohbau unter Dach bringen zu können“.<br />
Bereits im Herbst war der Neubau des<br />
Marienhospitals so weit fortgeschritten, dass<br />
am 2. Oktober 1868 die „Aufrichtung“ mit<br />
Vokal- und Instrumentalmusik wie auch Kanonendonner<br />
begangen werden<br />
konnte. Im folgenden Jahr<br />
kamen die Pliester- und ein<br />
großer Teil der Schreinerarbeiten<br />
zur Ausführung. Außerdem<br />
wurde an die Küche eine<br />
Waschküche und Trockenkammer<br />
angebaut.<br />
Die Belastungen der Vereinskasse<br />
durch das rasche<br />
Fortschreiten des Kranken-<br />
Marienhospital, Haupteingang mit<br />
Zieranker „1868“, um 1930<br />
Marienhospital, Gartenplan<br />
von Joseph Clemens Weyhe, 1870<br />
hausbaues in den <strong>Jahre</strong>n 1868 und 1869<br />
machte es notwendig, wiederholt an die<br />
Opferbereitschaft der katholischen Bevölkerung<br />
zu appellieren. Der Vorstand erließ<br />
bereits am 28. Mai 1868 einen Aufruf an<br />
die Bewohner der Stadt, sich mit großzügigen<br />
Spenden am Zustandekommen des<br />
Krankenhauses zu beteiligen. „Es waren<br />
wiederum das Hülfs- und das Damen-Comité“,<br />
so der Rückblick im Rechenschaftsbericht<br />
1868/69, „welche dem Vorstande<br />
in der aufopferndensten Weise ihre Unterstützung<br />
gewährten. Diese Comités trafen<br />
nämlich die Vorbereitungen, zum Besten<br />
des Marien-Hospitals eine Verloosung zu<br />
veranstalten. Die Sache fand auch diesmal,<br />
besonders unter den Künstler, die lebhafteste<br />
Theilnahme. ... Die Ausstellung der<br />
zur Verloosung bestimmten Sachen wurde<br />
am 13. Mai 1869 in der Aula der Realschule<br />
(Klosterstr. 7) in Gegenwart Ihrer Königlichen<br />
Hoheit der Fürstin von Hohenzollern<br />
eröffnet und ... zahlreich besucht. ... Das<br />
Ergebniß derselben übertraf selbst die<br />
kühnsten Erwartungen, indem ein Reinertrag<br />
von 21187 Thaler 15 Silbergroschen<br />
erzielt wurde“.<br />
Einnahmen mit Hilfe von Kollekten in<br />
den Pfarreien, Spenden von Wohltätern,<br />
Stiftungen und Legaten stellten auch in<br />
den folgenden <strong>Jahre</strong>n die wesentliche<br />
Einnahmequelle dar. Obwohl die Spendenbereitschaft<br />
der katholischen Bevölkerung<br />
ungebrochen anhielt, waren die Rücklagen<br />
des Marienhospitalvereins Ende der sechziger<br />
<strong>Jahre</strong> infolge der hohen Baukosten<br />
erheblich geschrumpft. Um einer Zahlungsunfähigkeit<br />
des Vereins zuvorzukommen,<br />
hatte der Vorstand den Beschluss gefasst,<br />
die Vergabe der noch notwendigen Arbeiten<br />
an der Innenausstattung des Krankenhausneubaues<br />
über einen längeren<br />
22
Eröffnung wider Willen<br />
Zeitraum zu strecken. Wörtlich heißt es<br />
im Rechenschaftsbericht: „Im <strong>Jahre</strong> 1870<br />
war noch die innere Fertigstellung des<br />
Marien-Hospitals, namentlich die Anfertigung<br />
der Thüren, der Treppen, der Bodenund<br />
Flurbelegungen, die Einrichtung der<br />
Gas- und Wasserleitung, der Bäder etc.<br />
zu bewirken und die Gartenanlage, wozu<br />
der Herr Garten-Inspektor Joseph Clemens<br />
Weyhe eine Plan angefertigt hatte, auszuführen.<br />
Mit Rücksicht darauf, daß zur<br />
Deckung der damals noch für erforderlich<br />
erachteten Baumittel von 40000 Thalern<br />
nur der Betrag von etwa 25000 Thalern<br />
vorhanden war, also noch <strong>150</strong>00 Thaler<br />
fehlte, sowie auf den Umfang der bis zur<br />
gänzlichen Vollendung des Krankenhauses<br />
noch zu fertigenden Arbeiten, lag es in<br />
der Absicht des Vorstandes, die Letzteren<br />
in der Weise ausführen zu lassen, daß das<br />
Marien-Hospital im Frühjahr 1871 seiner<br />
Bestimmung übergeben werden könne“.<br />
Eröffnung wider Willen<br />
Der besonnene Verfahrensplan zum Weiterbau<br />
des Marienhospitals wurde mit<br />
Ausbruch des deutsch-französischen Krieges<br />
1870/71 Makulatur, da der Vorstand<br />
am Tag der Kriegserklärung (18. Juli 1870)<br />
den Beschluss fasste, „das Unterhaus und<br />
den ersten Stock des Marien-Hospitals so<br />
rasch wie möglich provisorisch zu vollenden,<br />
und dasselbe für die Verwundeten<br />
einzurichten“.<br />
Unter der Überschrift „An unsere Mitbürger!“<br />
setzte der Vorstand am 18. Juli<br />
1870 folgenden Aufruf in Umlauf: „Der<br />
durch Frankreichs Übermuth in der unverantwortlichsten<br />
Weise heraufbeschworene<br />
Krieg macht es uns zur Pflicht, unser Ma-<br />
König Wilhelm I. auf dem Schlachtfeld von Sedan, 1870<br />
rien-Hospital in kürzester Frist zur Aufnahme der kranken<br />
und verwundeten Krieger fertig zu stellen. Mit Gottes Hülfe<br />
werden wir in der Lage sein, das Gebäude binnen 3 Wochen<br />
den wackern Kämpfern als eine Zufluchtstätte, wo sie die<br />
aufopferndste Pflege finden werden, anzubieten. Behufs<br />
Beschaffung der innern Einrichtung des Hauses und der zur<br />
Verpflegung der Militairkranken dienlichen Gegenstände wird<br />
das in seiner Fürsorge für unser Krankenhaus stets unermüdliche<br />
Damen-Comite von Neuem seine Thätigkeit eröffnen.<br />
Uns liegt es ob, die zur Vollendung des Baues noch erforderlichen<br />
Arbeiten so schleunig wie möglich ausführen zu lassen.<br />
Wir richten an unsere Mitbürger hiermit die dringende Bitte,<br />
uns durch Zuwendung reichlicher Geldbeiträge in der Ausführung<br />
unseres Vorhabens zu unterstützen“. Dem Appell<br />
zur Einrichtung des noch im Bau befindlichen Marienhospitals<br />
als Militärlazarett schloss sich am folgenden Tag das Damen-<br />
Comité mit einer eigenen Erklärung an. „Unter den Bewohnern<br />
unserer Stadt und Umgegend zeigte sich ein solcher<br />
Wetteifer in der Opferwilligkeit“, hebt der Vereinschronist<br />
später begeistert hervor, „daß in kurzer Zeit die für vorerwähnte<br />
Räume erforderlichen Einrichtungsgegenstände,<br />
sowie eine Menge von Naturalien, Verbandstücken und Labungsmitteln<br />
beschafft waren. Für die Anschaffung von<br />
Einrichtungsgegenständen allein verausgabte das Damen-<br />
Comité ... aus den von ihm gesammelten Geldern den Betrag<br />
23
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Pfarrer Philipp Joesten<br />
(St. Lambertus, 1841-1874), vor 1874<br />
Schlacht von Gravelotte,<br />
1870<br />
von 6382 Thalern 23 Silbergroschen 9 Pfennig. Gleichzeitig<br />
gelang es den unermüdlichen Anstrengungen des Vorstandsmitgliedes<br />
Herrn Carl Hilgers, die im Marien-Hospital noch<br />
nöthigen Arbeiten in der kurzen Frist von 4 Wochen ausführen<br />
zu lassen und die unteren Räume des Krankenhauses zur<br />
Aufnahme von Kranken herzurichten“. Was die Chronik<br />
verschweigt, ist der Umstand, dass zur Finanzierung der<br />
beschleunigten Bauarbeiten verschiedene Wertpapiere im<br />
Wert von 5800 Talern nur mit hohem Verlust veräußert<br />
werden konnten.<br />
Schon am 15. August 1870, am Fest Maria Himmelfahrt,<br />
erfolgte die Einweihung des Marienhospitals, die der Not<br />
der Zeit geschuldet, nur in einem bescheidenen Rahmen<br />
begangen wurde. Knapp meldete der Düsseldorfer Anzeiger<br />
am folgenden Tag über den Gottesdienst in der provisorisch<br />
eingerichteten Krankenhauskapelle und die Benediktion des<br />
Hauses: „Die Einweihung des Marienhospitals wurde gestern<br />
durch ein feierliches Hochamt, celebrirt durch den Herrn Dechant<br />
Philipp Joesten, eingeleitet ... . Dem Gottesdienste ...<br />
folgte die Einsegnung der einzelnen Räume des Hauses, worauf<br />
dem Publikum der Eingang in dasselbe gestattet wurde“.<br />
Noch am Abend des gleichen Tages wurden die ersten<br />
Verwundeten in das Marienhospital aufgenommen, denen<br />
nach der Schlacht von Gravelotte (18.<br />
August 1870) größere Transporte folgten.<br />
Nach einem Zwischenbericht des Damen-<br />
Comités vom 13. September 1870 waren<br />
infolge der Aufrufe zur Einrichtung des<br />
Marienhospitals als Militärlazarett so viele<br />
Spenden an Geld und Naturalien eingegangen,<br />
dass der Vorstand in der Lage war,<br />
„einstweilen zur Aufnahme von <strong>150</strong> unserer<br />
verwundeten, tapferen Krieger sowohl<br />
die vollständigen Betten, als auch das<br />
sämmtliche Leinen (Leintücher, Kissenzüge,<br />
Handtücher, Taschentücher, Hemden, Jacken<br />
usw.) und sonstige Gegenstände zu<br />
beschaffen“. Über 100 Betten waren mit<br />
Kranken belegt und täglich wurden Neuankommende<br />
versorgt. „Indem wir uns<br />
vorbehalten“, so das Damen-Comité, „später<br />
detaillirte Mittheilungen über unsere<br />
Wirksamkeit zu geben, danken wir einstweilen<br />
allen bekannten und unbekannten<br />
Gebern für die große patriotische Opferwilligkeit,<br />
mit der dieselben in dieser schweren<br />
Zeit zur Erleichterung der Lage unserer<br />
tapferen Verwundeten ein Scherflein beigetragen<br />
haben. ... Haben unsere Krieger<br />
für uns geblutet, so ist es unsere Pflicht,<br />
sie zu pflegen“.<br />
Bis zum Sommer des <strong>Jahre</strong>s 1871 wurden<br />
1043 Soldaten an 34005 Verpflegungstagen<br />
in der Pempelforter Anstalt versorgt.<br />
Die erzielten Heilresultate wurden vom<br />
Krankenhausvorstand in einem Rückblick<br />
als „sehr günstig“ bezeichnet, „da von<br />
sämmtlichen verpflegten Soldaten, ungeachtet<br />
sich unter denselben sehr viele<br />
schwer Verwundete und Kranke befanden<br />
und der weite, häufig mangelhafte Transport<br />
vom Gefechtsfelde bis hierher für den<br />
Zustand der Verwundeten meistens von<br />
den nachtheiligsten Folgen gewesen war,<br />
nur 19 oder 2,3 % gestorben sind. Unsere<br />
24
Die Franziskanerinnen<br />
Anstalt hat hiernach ihren Zweck, zur Linderung<br />
menschlichen Elends beizutragen,<br />
schon vor ihrer Vollendung in glänzender<br />
Weise erfüllt“.<br />
Die Behandlung der verwundeten<br />
Soldaten lag zunächst in den Händen des<br />
Medizinalrates Dr. Eduard Beyer, dann in<br />
der Verantwortung des Stabsarztes Dr.<br />
Gustav Windscheid. Die organisatorische<br />
Leitung des Lazarettes oblag der „Rheinisch-Westfälischen<br />
Johanniter-Malteser-<br />
Genossenschaft“, die vor allem den Kontakt<br />
zu den militärischen Dienststellen und<br />
der Berliner Zentralstelle für die freiwillige<br />
Krankenpflege hielt. Anerkennend ist im<br />
Generalbericht der Genossenschaft für die<br />
Kriegsjahre 1870/71 über das Düsseldorfer<br />
Marienhospital vermerkt: „Die vorzügliche<br />
Pflege der Schwestern, die kräftigende<br />
Kost und die ausgezeichnete ärztliche Behandlung<br />
hat von den ersten Sanitätsbehörden<br />
eine hervorragende Anerkennung<br />
gefunden“.<br />
Die Franziskanerinnen<br />
Ohne ausdrücklich beim Namen genannt<br />
zu werden, galt das Kompliment der<br />
„vorzüglichen Pflege der Schwestern“<br />
der Ordensgenossenschaft der Armen Franziskanerinnen,<br />
die zu Beginn des deutschfranzösischen<br />
Krieges zehn Schwestern für<br />
das Marienhospital abgestellt hatten. Unter<br />
den zahlreichen neugegründeten Orden<br />
und Genossenschaften in der ersten Hälfte<br />
des 19. Jahrhunderts kam den 1845 in<br />
Aachen von Franziska Schervier gestifteten<br />
„Armenschwestern vom Heiligen Franziskus“<br />
eine überragende Bedeutung zu. Ihre<br />
Zielsetzung und Formung waren das ganz<br />
persönliche Werk der Gründerin. Franziska<br />
Schervier (1819-1876) war die Tochter eines Aachener Nadelfabrikanten.<br />
Ihr Weg zum Dienst an den Armen war durchaus<br />
religiös motiviert, wurde aber auch durch das in der Heimatstadt<br />
sichtbare Elend der Frühindustrialisierung bestimmt.<br />
Franziska Scherviers Gemeinschaft lebte als Kongregation<br />
nach der dritten franziskanischen Ordensregel (Tertiarinnen).<br />
Die Nachfolge Christi gemäß den evangelischen Räten sah<br />
sie als ihre primäre Aufgabe an, außerdem verpflichtete sie<br />
sich zu allen Werken tätiger Nächstenliebe im Dienste der<br />
Armen, speziell in städtischem Milieu. Außer einem Mutterhaus<br />
und einem Noviziatshaus sollte die Gemeinschaft<br />
kein Eigentum besitzen. Die Schwestern verzichteten auf<br />
persönliches Eigentum und erklärten ihre Bereitschaft, für die<br />
Armen zu kollektieren. Am Anfang ihrer caritativen Tätigkeit<br />
stand die offene Armenpflege; mit der wachsenden Bedeutung<br />
der stationären Krankenpflege übernahmen sie aber<br />
auch Krankenanstalten und Waisenhäuser, allerdings nicht<br />
solche der öffentlichen Hand. Am 12. August 1851 wurde<br />
die Genossenschaft offiziell errichtet. Mutterhaus wurde das<br />
ehemalige Klarissenkloster in der Aachener Kleinmarschierstraße.<br />
Schon 1852 setzte eine rasche Filialbildung ein. Im<br />
Raum Düsseldorf eröffneten die Franziskanerinnen 1854 im<br />
Ratinger „Gasthaus zum hl. Geist“ (heute St. Marienkrankenhaus)<br />
ihre erste Niederlassung. Es folgte die Übernahme von<br />
Franziska Schervier (1819-1876),<br />
um 1870<br />
Düsseldorfer Anzeiger,<br />
7. August 1870<br />
25
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienkrankenhaus, Suitbertus-Stiftsplatz 11/15, um 1930 Annastift, Ritterstraße 20/22, um 1915<br />
Städtisches Pflegehaus, Himmelgeister Straße 152, 1930<br />
Herz-Jesu-Kloster, Mendelssohnstraße 13/15, vor 1939 Antoniushaus, Achenbachstraße 142/144, 1907<br />
Josephskloster, Hammer Dorfstraße 121, nach 1911<br />
Marienhospital, Aachen-Burtscheid, um 1930<br />
caritativen Einrichtungen in Kaiserswerth<br />
(Marienkrankenhaus 1855), in der Neustadt<br />
(Max-Joseph-Hospital und Städtisches<br />
Pflegehaus 1868), in Pempelfort (Marienhospital<br />
1870), in der Altstadt (Annastift<br />
1871), in Flingern (Herz-Jesu-Kloster 1888),<br />
in Düsseltal (St. Antoniushaus 1908), in<br />
Stoffeln (Städtisches Pflegehaus 1892) und<br />
in Hamm (Josephskloster 1911).<br />
Wie der Kontakt zwischen dem Vorstand<br />
des Düsseldorfer Marienhospitals und<br />
den Aachener Franziskanerinnen entstand,<br />
geht aus den überlieferten Unterlagen<br />
leider nicht hervor. Fest steht jedoch, dass<br />
der Marienhospitalverein sehr früh die<br />
Berufung der Aachener Schwestern erwog.<br />
Bereits im Protokoll der Vorstandssitzung<br />
vom 10. August 1866 findet sich<br />
der Vermerk, für die Krankenpflege in<br />
der Anstalt „die Franziskanerinnen, deren<br />
Mutterhaus sich in Aachen befindet,<br />
an erster Stelle in Aussicht zu nehmen“.<br />
Was in der genannten Vorstandssitzung<br />
noch nach Absicht klingt, scheint bis zur<br />
Generalversammlung am 10. Dezember<br />
1866 verbindliche Übereinkunft geworden<br />
zu sein, berichtete doch der Düsseldorfer<br />
Anzeiger über den Versammlungsverlauf:<br />
„Herr Landrath Graf Wilderich von Spee<br />
ergriff nun das Wort und theilte mit, daß<br />
der Ausschuß die Pflege in dem zu erbauenden<br />
Krankenhause den Franziskanerinnen<br />
aus dem Mutterhause in Aachen, das unter<br />
der Aufsicht der General‐Oberin Franziska<br />
Schervier stehe, übertragen habe. Er berichtete,<br />
daß er mit dem Herrn Hilgers, im<br />
Auftrage des Ausschusses, in Aachen, Cöln<br />
und Bonn von dem Wirken der Schwestern<br />
Einsicht genommen habe, und ertheilte<br />
denselben das höchste Lob. Er habe<br />
überall die sorgfältigste Pflege, Ordnung<br />
und Reinlichkeit, und die Hospitaliten bei<br />
26
Die Franziskanerinnen<br />
gesundem und fröhlichem Aussehen gefunden.<br />
... Er gedachte des Abkommens,<br />
welches die Commission mit der Oberin<br />
Franziska Schervier getroffen, wonach<br />
der Orden für das hiesige Krankenhaus<br />
18 Schwestern und mit dem Pflegehause<br />
25 Schwestern zu stellen habe, wofür der<br />
Verein nur die Beköstigung und Bekleidung<br />
der Schwestern zu liefern habe, während<br />
die Schwestern alle Arbeiten im Krankenhause<br />
am Krankenbette und in der Küche<br />
zu besorgen hätten“.<br />
Gemäß einer Absprache sollten bei der<br />
Aufnahme des Krankenhausbetriebes 25<br />
Schwestern die Pflege im Marienhospital<br />
übernehmen, was aber infolge des Einsatzes<br />
zahlreicher Schwestern auf den Kriegsschauplätzen<br />
und in den Lazaretten bei<br />
Ausbruch des deutsch-französischen Krieges<br />
nicht möglich war. Die Vorarbeiten zur<br />
Aufnahme des Pflegedienstes in Pempelfort<br />
mussten von den bereits seit zwei <strong>Jahre</strong>n im<br />
Max-Joseph-Hospital bzw. im Städtischen<br />
Pflegehaus in der Neustadt (Neusser Str.<br />
23/27) tätigen Schwestern übernommen<br />
werden. „Es war für diese“, so die Ordenschronik,<br />
„ein sehr mühsames Arbeiten, da<br />
alles Nothwendige aus der noch ziemlich<br />
weit entfernten Stadt beschafft werden<br />
mußte. Die Schwestern vom armen Kinde<br />
Jesus (Annakloster, Annastr. 62/64), welche<br />
abgesehen von den Bewohnern einiger<br />
zerstreut liegenden Hütten, die nächsten<br />
Nachbaren der Hospitalbewohner waren,<br />
suchten diese in opferwilligster Weise bei<br />
ihren Arbeiten zu unterstützen. Auch die<br />
armen Clarissen (Kaiserstr. 40) wollten bei<br />
diesem guten Werke nicht zurückstehen<br />
und baten daher die Franziskanerinnen,<br />
welche zu ihren Mahlzeiten noch den weiten<br />
Weg zur Neustadt machen mußten,<br />
das Mittagsmahl bei ihnen zu nehmen, bis<br />
die Küche des Hospitals eingerichtet<br />
sei, welches liebevolle<br />
Anerbieten mit Dank und Freude<br />
angenommen wurde. Bald<br />
konnten einige der bis dahin<br />
im Hospitale thätigen Schwestern<br />
darin Wohnung nehmen,<br />
deren sich bald mehrere aus<br />
dem Mutterhause zugesellten,<br />
bis ihre Zahl auf zehn gestiegen<br />
war. Schwester Cleopha, die<br />
Vorgesetzte des Armenhauses<br />
(Neustadt), stand anfangs auch<br />
den Schwestern des Hospitals<br />
Annakloster, Annastraße 62/64, um 1910<br />
vor und kam täglich mit mehreren Schwestern und arbeitsfähigen<br />
Pfleglingen, denen sich manche andere Frauen<br />
freiwillig anschlossen, dorthin, sich an mühevollen Arbeiten<br />
zu betheiligen. Es war weder Gas- noch Wasserleitung<br />
vorhanden und alles Wasser mußte aus den für die Ziegelei<br />
bestimmten Brunnen herausgeholt werden. Sobald der<br />
linke Flügel des Hauses eingerichtet war, beeilte man sich<br />
den ersten Saal desselben in eine Kapelle umzugestalten, in<br />
welcher die hohen Herrn Patres Franziskaner (Oststr. 62/64)<br />
den Gottesdienst übernahmen“.<br />
Für ihren aufopfernden Dienst im Lazarett hatten<br />
die Franziskanerinnen vom Marienhospitalverein keine<br />
Entschädigung beansprucht, doch übergab ihnen<br />
der Vorstand nach der Auflösung des Lazarettes am 15.<br />
März 1871 ein „einmaliges Almosen von 20 Thalern“.<br />
Klarissenkloster,<br />
Kaiserstraße 40, um 1925<br />
Franziskanerkloster,<br />
Oststraße 62/64, um 1925<br />
27
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Fotografie von<br />
Karl Ed. Becker, 1871<br />
Kaiser Wilhelm I. (1797-1888),<br />
um 1885<br />
Aus den Überschüssen der Verpflegungssätze erhielt jeder<br />
Verwundete bei seiner Entlassung aus dem Lazarett ein vom<br />
Düsseldorfer Photographen Karl Ed. Becker angefertigtes<br />
Lichtbild des Marienhospitals.<br />
Die Verleihung der<br />
Korporationsrechte<br />
Völlig unerwartet, „geruhte Seine Majestät der König“<br />
mitten in den Wirren des deutsch-französischen Krieges<br />
vom Hauptquartier Ferrières aus, dem Düsseldorfer Marienhospital<br />
am 2. Oktober 1870 „vorbehaltlich des Oberaufsichtsrechts<br />
des Staates und der Feststellung des Statuts<br />
durch den Oberpräsidenten der Rheinprovinz“ die Rechte<br />
einer juristischen Person zu verleihen. Mit dem Eingang<br />
des königlichen Schreibens endete ein mehr als fünf <strong>Jahre</strong><br />
dauerndes Antragsverfahren, das ohne die<br />
„patriotische Haltung“ des Marienhospitals<br />
bei Kriegsausbruch möglicherweise nie zu<br />
einem Abschluss gekommen wäre.<br />
Das langwierige Prozedere begann,<br />
als der Vorstand des Marienhospitalvereins<br />
die Königliche Regierung in Düsseldorf<br />
am 10. April 1865 und noch einmal am<br />
2. Oktober 1865 um die Verleihung der<br />
Korporationsrechte ersuchte. Obwohl der<br />
Vorstand von der preußischen Regierung<br />
auf beide Eingaben keine Antwort erhielt,<br />
gab der Vorsitzende Hermann von Mallinckrodt<br />
auf der Generalversammlung am 5.<br />
Dezember 1865 hoffnungsvoll zu Protokoll:<br />
„Ein Bescheid hierzu sei zur Zeit noch nicht<br />
ertheilt, indessen stehe derselbe in kurzer<br />
Zeit zu erwarten, da der Antrag, nachdem<br />
derselbe die vorgeschriebenen Instanzen<br />
passirt habe, gegenwärtig den königlichen<br />
Ministerien zu Berlin vorliege“. Offenbar<br />
traute der Vorsitzende seinen eigenen Worten<br />
nur wenig, denn nur so ist zu erklären,<br />
dass Hermann von Mallinckrodt zur Ausräumung<br />
verschiedener Missverständnisse<br />
noch im gleichen Monat eine Reise nach<br />
Berlin unternahm, „welche indeß nicht den<br />
erwünschten Erfolg hatte“. Im Gegenteil:<br />
Mit Ministerialreskript vom 29. Mai 1866<br />
machten die Berliner Stellen die Erwirkung<br />
der Korporationsrechte davon anhängig,<br />
dass alle im Raum stehenden Bedenken zunächst<br />
durch eine Abänderung der Statuten<br />
beseitigt werden mussten. Strittig waren<br />
nach einer Einschätzung des Vorstandes<br />
vor allem die Fragen, „ob dem Vereine oder<br />
der zu gründenden Anstalt diese Rechte<br />
verliehen werden könnten, ob nicht in<br />
der durch die Statuten vorgeschriebenen<br />
Leitung des Marienhospitals durch Mitglieder<br />
eines nicht näher bezeichneten Ordens<br />
eine indirekte Umgehung des § 13 der<br />
28
Die Verleihung der<br />
Korporationsrechte<br />
Verfassungsurkunde gefunden werden<br />
müsse und ob nicht durch die Statuten dem<br />
kirchlichen Element ein zu großer Einfluß<br />
auf die Anstalt eingeräumt sei“.<br />
Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom<br />
31. Januar 1850, Artikel 13:<br />
„Die Religionsgesellschaften, so wie die<br />
geistlichen Gesellschaften, welche keine<br />
Korporationsrechte haben, können diese<br />
Rechte nur durch besondere Gesetze<br />
erlangen“.<br />
Um Immobilien und Kapitalien auf den<br />
Namen des Marienhospitals zu erwerben,<br />
war der Besitz der Korporationsrechte<br />
eine unabdingbare Voraussetzung. Nachdem<br />
die betreffenden Ministerien in den<br />
weiteren Verhandlungen den Standpunkt<br />
einnahmen, „daß dem Verein diese Rechte<br />
nicht ertheilt werden könnten, daß aber<br />
nichts im Wege stehe, dieselben der Anstalt<br />
zu gewähren, sobald diese ins Leben gerufen<br />
sei“, schien der Marienhospitalverein<br />
vor einem unlösbaren Dilemma zu stehen.<br />
Wie sollte das Krankenhaus gebaut und<br />
eröffnet werden, wenn es vorab ein hierzu<br />
erforderliches Grundstück wegen fehlender<br />
Korporationsrechte nicht erwerben<br />
konnte? Es spricht für das Geschick des<br />
Vorstandes sowohl für dieses wie auch für<br />
andere Probleme, die sich aus dem Mangel<br />
an Korporationsrechten ergaben, Lösungen<br />
gefunden zu haben. Wie bereits berichtet,<br />
umging der Vorstand die Schwierigkeit des<br />
Grundstückankaufes dadurch, dass das<br />
Stockkamp Gut für den Verein auf den<br />
Namen der Privatperson Dechant Philipp<br />
Joesten erworben wurde.<br />
Die nach Eingang des königlichen Reskriptes<br />
vom 2. Oktober 1870 noch für<br />
nötig erachteten Änderungen des Statuts<br />
wurden in der Generalversammlung des Marienhospitalvereins<br />
am 11. Januar 1871 befürwortet und vom Koblenzer Oberpräsidenten<br />
am 11. Februar 1871 genehmigt. Von nun an gab<br />
es eine mit Korporationsrechten<br />
ausgestattete „katholische<br />
Kranken‐ und Verpflegungsanstalt<br />
Marien-Hospital zu Düsseldorf“<br />
und daneben einen<br />
neu konstituierten „Marien-<br />
Hospital-Verein“. Der Vorstand<br />
in beiden Vereinen bestand in<br />
allen Ämtern aus den gleichen<br />
Persönlichkeiten. Ein wesentlicher<br />
Unterschied war, dass die<br />
übrigen Mitglieder des Marienhospitalvereins<br />
der Anstalt<br />
Marienhospital nicht angehörten.<br />
Die einzige Aufgabe des<br />
„Marien-Hospital-Vereins“ war<br />
„die Fortexistenz der durch<br />
seine Bemühungen geschaffenen,<br />
unter dem Namen<br />
‚Marien-Hospital‘ zu Düsseldorf<br />
mit Corporationsrechten<br />
versehene Anstalt durch jährliche<br />
Beiträge sicher zu stellen<br />
(§ 1)“. Die Aufgabe der Anstalt<br />
Marienhospital war in ihren<br />
Statuten viel umfassender formuliert:<br />
„Die zu Düsseldorf<br />
unter dem Namen ‚Marien-<br />
Hospital‘ bestehende Anstalt<br />
hat zum Zwecke die Verpflegung<br />
heilbarer und unheilbarer<br />
Kranken und wo möglich auch<br />
die Verpflegung altersschwacher<br />
Personen, ohne Rücksicht<br />
auf religiöses Bekenntniß. Die Anstalt hat die Rechte einer<br />
juristischen Person und ihr Domizil zu Düsseldorf, ihr steht das<br />
Eigenthum an dem für die Ausführung des Krankenhausbaues<br />
erworbenen Grund und Boden nebst den darauf errichteten<br />
Gebäulichkeiten und der gesammten inneren Einrichtung<br />
Statut der katholischen<br />
Kranken- und Verpflegungsanstalt<br />
Marien-Hospital, 11. Januar 1871<br />
29
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Treppenaufgang,<br />
um 1930<br />
Marienhospital, Frauenabteilung,<br />
um 1930<br />
der letzteren zu (§ 1)“. Die Verwaltung der Anstalt sollte<br />
unter der gesetzlichen Oberaufsicht des Staates durch einen<br />
Vorstand erfolgen, „welcher aus dem von dem Erzbischof zu<br />
ernennenden Commissar und dem Oberbürgermeister, sofern<br />
dieser katholisch ist, sonst dessen Stellvertreter als geborenen<br />
Mitgliedern und aus sieben von dem ... Verwaltungsrathe<br />
zu wählenden Personen besteht (§ 4)“. Der Verwaltungsrat<br />
bestand aus den katholischen Pfarrern der Stadt Düsseldorf<br />
und dreißig weiteren Mitgliedern (§ 6).<br />
Pockenepidemie 1871 und<br />
verschleppte Fertigstellung<br />
Vom Juni 1871 ab, als das Marienhospital von verwundeten<br />
und erkrankten Soldaten allmählich geräumt war, überwies die<br />
städtische Verwaltung, um Raum für Pockenkranke im städtischen<br />
Pflegehaus in der Neustadt zu gewinnen, die „sonstigen<br />
männlichen Kranken aus dem letzteren dem Marienhospital“.<br />
Wegen Aufnahme dieser Patienten, die nach Ausweis der<br />
Ordenschronik „in Möbelwagen“ nach Pempelfort transportiert<br />
wurden, konnte die Absicht des Verwaltungsrates, „das<br />
Marien-Hospital zum Zwecke des beim Ausbruche<br />
des Krieges unterbrochenen inneren<br />
Ausbaues gänzlich zu räumen, nicht zur<br />
Ausführung gelangen; die Fertigstellung des<br />
Gebäudes mußte vielmehr trotz mancher,<br />
daraus entstehender Unzuträglichkeiten<br />
und Mehrkosten während der Benutzung<br />
desselben als Krankenhaus allmählich bewirkt<br />
werden“.<br />
Zu den gefährlichsten „Unzuträglichkeiten“<br />
im halbfertigen Krankenhaus<br />
gehörten ohne Zweifel die nur ungenügend<br />
hergerichteten Flure und Treppen. Im<br />
Sommer 1871, als die Zahl der Schwestern<br />
auf 25 gestiegen und Schwester Bernardin<br />
zur ersten Oberin ernannt worden war, berichtet<br />
die Ordenschronik von regelrechten<br />
„Stolperfallen“ in der Anstalt: „Die Gänge<br />
des Hauses waren sehr mangelhaft mit Ziegelsteinen<br />
belegt und hölzerne Hülfstreppen<br />
führten zu den oberen Räumen. Nicht<br />
selten ereignete es sich, daß die Schwestern<br />
in den unebenen Gängen stolperten<br />
und dabei, wenn auch nicht immer sich<br />
selbst, doch wenigstens das, was sie trugen,<br />
zum Falle kam. Einmal aber fand man eine<br />
Schwester, welcher der Arzt aufgetragen<br />
ihn eiligst etwas von unten zu holen, blutend<br />
am Fuße einer Treppe liegend; sie war<br />
hinuntergestürzt, hatte sich aber doch nur<br />
unerheblich verletzt“.<br />
Wann die beschriebenen „Unzuträglichkeiten“<br />
abgestellt und der Innenausbau<br />
des Marienhospitals endgültig abgeschlossen<br />
waren, ist den überlieferten Schriftstücken<br />
nicht genau zu entnehmen. Der<br />
Vorstand gab am 18. September 1871<br />
bekannt, „daß die innere Einrichtung des<br />
Krankenhauses zu zwei Dritteln zum Winter<br />
und der Rest im Frühjahre fertiggestellt<br />
sein werde“. Offenbar wurde der Zeitplan<br />
eingehalten, vermeldete Rudolph Ulrich in<br />
30
Pockenepidemie 1871 und<br />
verschleppte Fertigstellung<br />
der Vorstandssitzung vom 16. Dezember<br />
1872, „daß der Bau des Hospitals nunmehr<br />
als vollendet zu betrachten sei“. Ohne<br />
Zweifel waren im Frühjahr 1874 alle notwendigen<br />
Arbeiten am Krankenhaus zu<br />
Ende gebracht, da aus diesem Jahr eine<br />
Beschreibung der „in baulicher Vollendung<br />
uns entgegentretenden Anstalt“ erhalten<br />
ist. Besucher, die durch das Eingangstor am<br />
stumpfen Winkel von Stern-, Stockkampund<br />
Winkelsfelder Straße das Krankenhausgelände<br />
betraten, hatten zu jener Zeit<br />
folgendes Bild vor Augen: „Das Hauptgebäude<br />
des Marien-Hospitals, zu dessen<br />
Haupteingang man durch einen 47,08<br />
Meter tiefen, den Luftströmungen von<br />
allen Seiten zugänglichen Garten gelangt,<br />
ist im sogenannten gothischen Rohbaustyl<br />
aufgeführt und hat eine Gesammtlänge von<br />
75,32 Meter. Dieselbe wird unterbrochen<br />
durch einen 16,63 Meter breiten Mittelbau<br />
und zwei 11,93 Meter Flügelbauten, die in<br />
einer Tiefe von 37,03 Meter die Enden des<br />
Baues abschließen. Von dem hinter dem<br />
Haupteingange gelegenen Vestibül, welches<br />
mit einem von 8 freistehenden Granit-<br />
Säulen getragenen Kreuzgewölbenetze<br />
überdeckt und mit einer Statue der Patronin<br />
unseres Krankenhauses geschmückt<br />
ist, gelangt man rechts und links in die<br />
Corridore, geradeaus vermittelst zweier<br />
getrennter Treppen in den ersten Stock und<br />
indirekt in die Küche, welche in dem hinter<br />
das Gebäude verlängerten Mittelbau sich<br />
befindet. Über der Küche liegen die Zellen<br />
der Ordensschwestern vom heil. Franziskus,<br />
deren im Marien-Hospitale gegenwärtig<br />
24 ihrem schweren und opferreichen<br />
Berufe der Krankenpflege obliegen. ...<br />
Marienhospital, Sternstraße 91, um 1920<br />
Marienhospital, Vestibül, um 1930<br />
31
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Die Säle und Zimmer der Kranken<br />
liegen nach Süden, Osten<br />
und Westen, die Corridore, die<br />
Apotheke, der Operationsaal<br />
und die Closets nach Norden.<br />
Im Souterrain befinden<br />
sich 8 Räume für Krätzkranke<br />
und 7 Räume für Irre. Das<br />
Erdgeschoß (innere Station)<br />
enthält 7 große Säle und 12<br />
Zimmer für Kranke, sowie<br />
die provisorische Hauskapelle<br />
im rechten Seitenflügel. Die<br />
erste Etage (äußere Station)<br />
hat acht große Säle und 14<br />
Krankenzimmer nebst dem<br />
Operationsaal, und die zweite<br />
Etage (für unheilbare Kranke<br />
mit der abgeschlossenen<br />
Station für Syphiliten) 9 große<br />
Säle und 14 Zimmer. Jede<br />
Etage enthält vier Theeküchen<br />
Marienhospital, Hospitalküche,<br />
um 1930<br />
Marienhospital, Badeabteilung,<br />
um 1930<br />
Marienhospital, Fieberpavillion, 1871<br />
und zwei Wärterzimmer, welche zwischen<br />
den Sälen liegen. Die in den Seitenflügeln<br />
befindlichen, von den übrigen Räumen<br />
abgeschlossenen kleineren Krankenzimmer<br />
sind für Pensionäre I. und II. Klasse<br />
bestimmt. Die Räume werden durch gewöhnliche<br />
eiserne Öfen mittelst Kohlen<br />
geheizt. Diese Öfen stehen in den größeren<br />
Krankensälen in der Mitte; sie sind mit einem<br />
Blechmantel umgeben, welcher unten<br />
luftdicht verschlossen ist; in den dadurch<br />
gewonnenen Raum wird die äußere Luft<br />
durch abschließbare, unter dem Fußboden<br />
befindliche Röhren geleitet, daselbst<br />
erwärmt und durch die oben gelassene<br />
Öffnung dem Saale zugeführt, während<br />
die Zimmerluft unterhalb des Rostes in den<br />
Ofen gelangt und durch den Zug desselben<br />
entfernt wird. Außerdem sind in jedem<br />
größeren Krankensaale 2 Ventilationen,<br />
welche die Zimmerluft abführen und 2<br />
Ventilationen, welche frische Luft zuführen.<br />
Die Krankensäle und das Haus werden<br />
durch Gas erleuchtet. Das Wasser, welches<br />
durch die städtischen Wasserwerke aus<br />
dem Rheine zugeführt und mittelst Röhren<br />
durch die ganze Anstalt geleitet wird, ist<br />
frisch und gut trinkbar und zum Reinigen<br />
der Wäsche vorzüglich geeignet. In den<br />
Badezimmern, deren im Souterrain, im Erdgeschoß<br />
und auf jeder Etage im Mittelbau<br />
zwei und in den beiden Seitenflügeln je<br />
eines, im Ganzen also 14 (und außerdem<br />
im Pavillon zwei) vorhanden sind, werden<br />
warme und kalte Wasserbäder mit Douche<br />
und Brause gegeben. Der Fieber-Pavillon,<br />
welcher 62,77 Meter vom Hauptgebäude<br />
nach dem Barackensystem mit Fachwänden<br />
erbaut ist, hat nur ein Stockwerk, in<br />
welchem sich zwei große Krankenzimmer<br />
und 2 Glasterassen mit den erforderlichen<br />
Nebenräumen befinden“.<br />
32
Pockenepidemie 1871 und<br />
verschleppte Fertigstellung<br />
Der zuletzt genannte Fieberpavillon, die<br />
sogenannte „Villa“, verdient besondere<br />
Beachtung. Schon während des deutschfranzösischen<br />
Krieges hatten sich Versuche,<br />
im Hauptgebäude die Isolierung ansteckender<br />
Krankheiten zu erzielen, als erfolglos<br />
erwiesen. Daher war schon früh der Plan<br />
aufgekommen, auf dem Krankenhausgelände<br />
einen separaten Pavillon für Ruhr-,<br />
Pocken-, Typhus- und Cholerakranke zu<br />
errichten. Die Baracke wurde im <strong>Jahre</strong><br />
1871 östlich des Haupthauses, nahe der<br />
heutigen Prinz-Georg-Straße nach einem<br />
von Baumeister Julius Emmerich angefertigten,<br />
auf etwa 50 Kranke berechneten<br />
Plan begonnen und im folgenden Jahr<br />
fertig gestellt. Der ebenerdige Pavillon<br />
hatte zwei abgetrennte Krankensäle für<br />
je 14 weibliche und männliche Patienten.<br />
Neben den Baderäumen und Toiletten für<br />
Frauen und Männer gab es in der Baracke<br />
ein Leinenzimmer, eine Teeküche und ein<br />
Schwesternzimmer mit zwei Betten. An<br />
das Haupthaus schloss sich rechts und links<br />
eine geschlossene Terrasse für zusätzlich<br />
je sechs Betten an, von der eine Treppe in<br />
den Garten führte.<br />
Die Anlage des Gartens, die nach dem<br />
Tod des Garteninspektors Joseph Clemens<br />
Weyhe (†1871) sein Amtsnachfolger Oskar<br />
Hering übernommen hatte, war erst<br />
Mitte der siebziger <strong>Jahre</strong> des 19. Jahrhunderts<br />
abgeschlossen. Der größte Teil<br />
der auf dem Gelände des Marienhospitals<br />
angepflanzten Bäume und Ziersträucher<br />
ging auf eine Spende des Grafen August<br />
von Spee zurück. In einem abgesonderten<br />
Teil des Gartens war der Viehbestand der<br />
Krankenanstalt untergebracht, der im <strong>Jahre</strong><br />
1873 aus fünf Kühen, drei Schweinen<br />
und einer größeren Zahl von Enten und<br />
Hühnern bestand. „Je mehr aber“, so ein<br />
Rückblick aus späterer Zeit, „die umliegende<br />
Gegend bebaut wurde, desto schwieriger<br />
wurde die Futterbesorgung für Kühe, und<br />
man beschränkte sich deshalb auf das Halten<br />
von Schweinen und Federvieh, was sich bei<br />
der großen Menge von Abfall sehr rentierte“.<br />
Wenn der Vorstand im Frühjahr 1874<br />
der Öffentlichkeit das Marienhospital als ein<br />
„allen Anforderungen entsprechendes Krankenhaus“<br />
vorstellte, war dies nicht unbegründet.<br />
Das Hospital in Pempelfort brauchte den<br />
Vergleich mit anderen Krankenhäusern nicht<br />
zu scheuen, obwohl in Deutschland gerade<br />
nach Gründung des Kaiserreiches infolge des<br />
ökonomischen Aufstiegs eine sowohl zahlenmäßig<br />
als auch in Typenvielfalt beachtliche<br />
Bautätigkeit von Krankenanstalten einsetzte.<br />
Marienhospital, Haupteingang, um 1910<br />
Marienhospital, Gartenplan von<br />
Joseph Clemens Weyhe (Ausschnitt), 1870<br />
Marienhospital, Männergarten, um 1930<br />
33
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Sanierungsbedürftige Wohnhäuser,<br />
Grabbeplatz, um 1900<br />
Marktplatz, um 1890<br />
Dabei wurde insbesondere<br />
versucht, hygienische Vorstellungen,<br />
ärztliche Ansprüche<br />
und sozialpolitische Interessen<br />
miteinander zu verbinden. Das<br />
Krankenhaus wurde – mit den<br />
neuen Möglichkeiten der klinischen<br />
Medizin – zu einem unverzichtbaren<br />
Bestandteil der<br />
Gesellschaftspolitik. Mit dem<br />
durch die aufstrebende Arbeiterbewegung<br />
geforderten und<br />
seit 1883 geschaffenen sozialen<br />
Versicherungssystem auf<br />
der einen Seite und angesichts<br />
zunehmend schlechter Wohnverhältnisse der arbeitenden<br />
Bevölkerung auf der anderen Seite, kam als Möglichkeit<br />
und Notwendigkeit einer auch komplizierter werdenden<br />
Heilbehandlung letztlich nur das Krankenhaus in Frage.<br />
Dem sozialen Interesse der Krankenhausförderer entsprechend<br />
sollte dem Kranken während seines stationären Aufenthaltes<br />
sowohl eine qualitative ärztliche und pflegerische<br />
Versorgung gewährleistet als auch<br />
das entsprechende Milieu etwa hinsichtlich<br />
der Umgebung, der Einrichtung, der Hygiene<br />
und der Ernährung geschaffen werden.<br />
Viele der genannten Wünsche vermochte<br />
das für 144862 Taler errichtete<br />
Marienhospital zu erfüllen. Nach seiner<br />
endgültigen Fertigstellung konnte das von<br />
der Regierung am 3. Juli 1871 zum Betrieb<br />
einer Krankenanstalt konzessionierte Marienhospital<br />
etwa 200 Kranke aufnehmen,<br />
eine für die damalige Zeit beachtenswerte<br />
Zahl. Mit der Eröffnung der neuen Anstalt<br />
wurden alle „städtischen Kranken“ je nach<br />
Konfession in das evangelische Krankenhaus<br />
am Fürstenwall oder ins katholische<br />
Marienhospital an der Sternstraße überwiesen<br />
und die leer stehenden Räumlichkeiten<br />
des Max-Joseph-Hospitals zur Unterbringung<br />
von „altersschwachen und geistig<br />
oder körperlich gebrechlichen Personen“<br />
genutzt. Im Dezember 1871, als etwa 2/3<br />
der Räume des Marienhospitals benutzbar<br />
waren, befanden sich 180 Kranke im Haus.<br />
Wasserversorgung und<br />
Kanalisation<br />
Unter dem Eindruck von Cholera- und<br />
Pockenepidemien hatte sich in Düsseldorf<br />
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ein<br />
Umdenken in Fragen der Trinkwasserversorgung<br />
angebahnt, wenn auch langsam.<br />
Zwar wurden die Todesfälle noch nicht mit<br />
verschmutztem Trinkwasser in Verbindung<br />
gebracht, da man weiterhin vor allem an<br />
die infizierende Wirkung von Fäulnisgasen<br />
in der Luft glaubte. Ärzte, städtische Behörden<br />
und Öffentlichkeit richteten ihre<br />
34
Wasserversorgung<br />
und Kanalisation<br />
Aufmerksamkeit daher weiter auf die Beseitigung<br />
eventueller Verunreinigung der<br />
Luft durch Maßnahmen wie regelmäßige<br />
Desinfektion von Düngergruben, doch gab<br />
es auch erste Ansätze zur Schaffung einer<br />
Abwasser-Kanalisation des Stadtgebietes.<br />
Bei Inbetriebnahme des Militärlazarettes<br />
1870 bezog das Marienhospital den gesamten<br />
Wasserbedarf aus einem Brunnen<br />
auf seinem Gelände, der ursprünglich für<br />
die Ziegelei bestimmt war. Die Eröffnung<br />
des Fleher Wasserwerkes im gleichen Jahr<br />
Als jedoch im <strong>Jahre</strong> 1885 der Klärteich nahe<br />
der Düssel zur Offenlegung der Prinz‐Georg‐<br />
Straße von der Stadt eingezogen wurde,<br />
war die Verwaltung des Krankenhauses zum<br />
Handeln gezwungen. Das veraltete System<br />
aus Vorsenken, Abtritts- und Senkgruben, die<br />
den Klärteich mit Abwässern gespeist hatten,<br />
verschwanden vom Gelände des Hospitals und<br />
machten modernen Entwässerungsanlagen<br />
Platz, die mit dem neu angelegten Kanalnetz<br />
der Stadt an der Sternstraße in Verbindung<br />
standen.<br />
erlaubte es dem Krankenhaus, sich bereits<br />
Wasserwerk Flehe, um 1925<br />
1871 an die zentrale Wasserversorgung<br />
durch das städtische Wasserwerk anzuschließen,<br />
wofür der Vorstand des Marienhospitals<br />
5200 Taler bewilligte.<br />
Zu den von Hygienikern geforderten<br />
Maßnahmen der Stadthygiene gehörte<br />
auch die geregelte Beseitigung der Abwässer<br />
und Fäkalien aus dem Wohnumfeld. Bis<br />
weit in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein<br />
wurden in Düsseldorf Exkremente, auch<br />
von ansteckenden Kranken, noch meist im<br />
Erdreich nahe der Häuser vergraben. Soweit<br />
sich die Möglichkeit bot, wurden die Abwässer<br />
in der Altstadt durch kurze Kanäle<br />
dem Rhein, in anderen Stadtteilen den<br />
beiden Düsselarmen und den von diesen Müllentsorgung, Graf-Adolf-Straße, um 1905<br />
gebildeten Zierteichen zugeführt. Die Unzulänglichkeit<br />
der Entwässerungsverhältnisse<br />
führte schließlich zu dem Entschluss, für<br />
Düsseldorf eine systematische Kanalisation<br />
einzurichten, mit deren Realisierung 1884<br />
begonnen wurde.<br />
Einem Anschluss an die städtische<br />
Kanalisation stand der Verwaltungsrat des<br />
Marienhospitals wegen der hohen Kosten<br />
zunächst abwartend gegenüber, da die<br />
Entsorgung der Abwässer seit der Eröffnung<br />
des Krankenhauses kostengünstig<br />
über einen Klärteich in die Düssel erfolgte. Marienhospital, Klärteich, 1885 Düsselgraben, Prinz-Georg-Straße, um 1930<br />
35
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Betriebskosten<br />
Die jährlichen Betriebskosten deckte das Marienhospital<br />
vor allem aus den Pflegegeldern,<br />
deren Höhe sich im Laufe der Zeit nur wenig<br />
änderte. Die Pflegesätze für Patienten wurden<br />
bei der Eröffnung des allgemeinen Krankenhauses<br />
im <strong>Jahre</strong> 1871 für die I. Klasse auf<br />
2 Taler, für die II. Klasse auf 1,10 Taler und<br />
für die III. Klasse auf 20 Silbergroschen pro<br />
Tag festgesetzt. Die Pflegesätze blieben mit<br />
kleineren Schwankungen bis zum <strong>Jahre</strong> 1911<br />
gültig, als die Krankenkassen mit den anderen<br />
Düsseldorfer Krankenanstalten neue Tarife<br />
vereinbarten. Patienten der I. Klasse zahlten<br />
nun 7 Mark, Kranke der II. Klasse 5 Mark und<br />
Angehörige der III. Klasse 2,75 Mark, Kinder<br />
unter 12 <strong>Jahre</strong>n 2 Mark. Für die städtischen<br />
Armen kam die Stadtverwaltung auf, deren<br />
Verpflegungssatz mit dem Marienhospital<br />
jährlich neu ausgehandelt wurde, aber stets<br />
unter dem Betrag für die dritte Klasse lag.<br />
AOK Düsseldorf, Kasernenstraße 61, um 1910<br />
Donatus-Bruderschaft, Statuten, 25. Februar 1798<br />
Kranken- und Sterbekassen in Düsseldorf, 1889<br />
Marienhospital, Bilanzrechnung, 1886<br />
Die Einnahmen aus den Pflegegeldern<br />
waren viel geringer als die Auslagen an<br />
Pflegekosten, mit der Folge, dass in den<br />
Rechnungsbüchern des Marienhospitals<br />
schon in den ersten drei <strong>Jahre</strong>n ein Fehlbetrag<br />
von über 3100 Talern verzeichnet ist.<br />
Die Pflegegelder wurden teils von den<br />
Patienten selbst, teils von der Städtischen<br />
Armenverwaltung oder den Krankenkassen<br />
bezahlt. Letztere hatten sich schon lange<br />
vor der unter Reichskanzler Otto von Bismarck<br />
1883 eingeführten Krankenversicherung<br />
als freie Kranken-, Sterbe- und Unterstützungskassen<br />
etabliert. Die zur Vorsorge<br />
vor Verarmung gegründeten Kassen waren<br />
auf dem Prinzip der Selbsthilfe beruhende<br />
Vereinigungen von Handwerkern oder<br />
Arbeitern zur gegenseitigen Unterstützung<br />
in Fällen von Krankheit, Arbeitsunfähigkeit<br />
und Tod, teils konfessionell, teils örtlich,<br />
teils beruflich organisiert. Die ersten<br />
Düsseldorfer Kranken- und Sterbeladen<br />
gingen aus Unterstützungseinrichtungen<br />
hervor, die kirchliche Bruderschaften oder<br />
Sodalitäten bereits vor der Säkularisation<br />
entweder als Kranken-, Alten- oder Hinterbliebenenkasse<br />
ins Leben gerufen hatten.<br />
Dazu gehörte etwa der seit 1692 nachweisbare<br />
„Verein zur Unterstützung alter<br />
und kranker Sodalen“ der Marianischen<br />
Junggesellensodalität oder die 1798 als<br />
Sterbekasse gegründete „Bruderschaft unter<br />
dem Schutze und zu Ehren des heiligen<br />
Donati, Patronen des Hochgewitters in der<br />
Hauptstadt Düsseldorf“. Das zunehmende<br />
Bedürfnis nach nichtbruderschaftlicher<br />
Absicherung sozialer Risiken führte in der<br />
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur<br />
Gründung einer Vielzahl neuer Unterstützungskassen,<br />
die sich bewusst auch niedrigeren<br />
Ständen öffneten. Unter dem Diktat<br />
konkurrierender Mitarbeiterabwerbung,<br />
36
Betriebskosten<br />
besonders aber gesetzlicher Vorgaben<br />
richteten nach 1870 Düsseldorfer Industriebetriebe<br />
Kranken- und Sterbekassen<br />
für Arbeiter ein, auch um sie an sich zu<br />
binden. Hierzu gehörten etwa die Unterstützungskassen<br />
der Dampfkesselfabrik J.<br />
Piedboeuf, der Nagelfabrik Dawans, Orban<br />
& Cie, des Röhrenwerkes Lierenfeld oder<br />
der Firma Haniel & Lueg.<br />
In den achtziger <strong>Jahre</strong>n schufen das<br />
Reichsgesetz „betreffend die Krankenversicherung<br />
der Arbeiter“ vom 15. Juni<br />
1883 und das Unfallversicherungsgesetz<br />
vom 6. Juli 1884 umfassende und einheitlichere<br />
Regelungen zum Kranken- und<br />
Unfallschutz, auch der Angehörigen. Auf<br />
Grund von Ortsstatut und gerade erlassenem<br />
Gesetz wandelten sich 1885 die<br />
allgemeinen kommunalen Unterstützungskassen<br />
in Düsseldorf wie in vielen anderen<br />
Kommunen auch zur „Ortskrankenkasse zu<br />
Düsseldorf“. Dies war die Geburtsstunde<br />
der AOK Düsseldorf (Akademiestr. 5, später<br />
Kasernenstr. 61). Sie war von dieser Zeit<br />
an für alle diejenigen Pflicht‐Auffangkasse,<br />
die keiner anderen berufsständischen<br />
oder freiwilligen Kasse angehörten. Aus<br />
den ursprünglichen Zwangskassen wurde<br />
ein allgemeiner Kassenzwang. Dieser<br />
Versicherungszwang oder besser diese<br />
Versicherungspflicht, der Rechtsanspruch<br />
auf Versicherungsleistung, die Unabhängigkeit<br />
von staatlichen Fürsorgestellen<br />
sowie die Abkehr vom Armutsprinzip als<br />
Voraussetzung für Leistungen haben bis<br />
in die heutige Zeit ihre Gültigkeit behalten.<br />
Insbesondere wurde Krankenhausbehandlung<br />
in den Leistungskatalog der<br />
Krankenversicherung aufgenommen. Die<br />
Krankenversicherung von 1883 hatte daher<br />
allgemein großen Einfluss auf Ausstattung<br />
und Verbesserung der Krankenhäuser. Die<br />
ein Jahr später verabschiedete Unfallversicherung von 1884<br />
förderte die Etablierung und den Ausbau chirurgischer Stationen.<br />
Das Pempelforter Marienhospital erhielt 1894 zum<br />
ersten Mal eine chirurgische Abteilung mit dem Arzt Dr.<br />
Ludwig Sträter als verantwortlichem Chirurgen.<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1875 wurde am Marienhospital ein „Dienstbotenabonnement“<br />
eingeführt, das Dienstbotinnen gegen<br />
einen jährlichen Beitrag von 2 Talern im Falle einer Krankheit<br />
vier Wochen die unentgeltliche Behandlung und Pflege im<br />
Krankenhaus garantierte. Auch andere Standesvereinigungen<br />
sowie Unternehmen wollten ihren Mitgliedern bzw. Arbeitern<br />
die Vorteile einer Krankenhausversicherung bieten. Dem<br />
Katholischen Kaufmännischen Verein gegenüber erklärte<br />
sich der Vorstand des Marienhospitals im Januar 1871 bereit,<br />
dessen Mitglieder gegen einen <strong>Jahre</strong>sbeitrag von 2 Talern als<br />
Kranke in der zweiten Klasse ohne zeitliche Begrenzung zu<br />
verpflegen. Ende Dezember 1879 wollte die Bleiweißfabrik<br />
Deuss & Moll (Kölner Str. 44) ein <strong>Jahre</strong>sabonnement für ihre<br />
Arbeiter einrichten. Leider sind keine Unterlagen erhalten,<br />
aus denen hervorgeht, ob die Verhandlungen mit den beiden<br />
genannten Antragsstellern zu einem positiven Abschluss<br />
gelangten.<br />
Marienhospital, Operationsraum,<br />
um 1930<br />
Katholischer Kaufmännischer<br />
Verein Confidentia Düsseldorf,<br />
Festschrift, 1930<br />
37
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Haupteingang<br />
und Vestibül, um 1930<br />
Sodalitätsbuch der Marianischen<br />
Bürgersodalität Düsseldorf, 1796<br />
Jesuitenkolleg, Mühlenstraße 27/31,<br />
um 1910<br />
Spenden und milde Stiftungen<br />
Von Anbeginn an lässt sich ein ständiges Ringen um Einnahmen,<br />
Ausgaben, Kostendeckung, Modernisierungen,<br />
Erweiterungen beobachten. Defizite und „Finanznotstand“<br />
begleiten den Alltag des Hauses, wie die überlieferten<br />
Kassenunterlagen belegen. Der Unterhalt und der Ausbau<br />
der Gebäude des Marienhospitals waren teuer, zumal es zu<br />
Beginn der Tätigkeit noch keine staatlichen oder kommunalen<br />
Zuschüsse gab. So war die Anstalt neben den laufenden<br />
Einnahmen aus der Krankenpflege auf Finanzierungsmodelle<br />
anderer Art angewiesen: Spenden, Legate, milde Stiftungen,<br />
Vermächtnisse, Kollekten.<br />
Dass das Marienhospital Wirklichkeit wurde und die<br />
Aufbaujahre überstand, war zu nicht geringen Teilen dem<br />
finanziellen Engagement der Marianischen Kongregation<br />
in Düsseldorf zu verdanken. Als der Gottesmutter geweihte<br />
Vereinigung lag den Angehörigen der Kongregation die<br />
Gründung eines Krankenhauses unter dem Patronat Mariens<br />
besonders am Herzen.<br />
Kongregationen als Zusammenschluss gläubiger<br />
Christen hat es in Düsseldorf seit der<br />
Niederlassung von Jesuiten in der Hauptstadt<br />
des Herzogtums Berg im März 1616<br />
gegeben. Bald nach ihrer Ankunft hatten<br />
die Jesuiten in Düsseldorf am 26. Mai 1619<br />
eine „Kongregation von der Verkündigung<br />
der seligsten Jungfrau“ errichtet, die in<br />
späterer Zeit die „lateinische Sodalität“ oder<br />
das „Pactum Marianum“ genannt wurde.<br />
Ziel des Zusammenschlusses von „Herren<br />
und Gelehrten“ war es, „unter dem Schutze<br />
der großen Himmelskönigin Maria, mit<br />
gemeinschaftlichem Eifer die Tugend und<br />
wahre Religion zu handhaben“.<br />
Um möglichst allen Bewohnern der<br />
Stadt Düsseldorf den Beitritt zu einer Sodalität<br />
zu eröffnen, ließ Herzog Wolfgang<br />
im <strong>Jahre</strong> 1621 eine Vereinigung für den<br />
Bürgerstand errichten, „worinn alle Klassen<br />
und Zünfte desselben, Verheirathete und<br />
Unverheirathete, Kaufleute und Handwerker,<br />
unter der Leitung eines Priesters der<br />
Gesellschaft Jesu auf den Sonntagen und<br />
Festen der seligsten Jungfrau versammelt,<br />
und durch eifrige Ermahnung und einhellige<br />
Zusammenstimmung der Gemüther alle<br />
irrige Glaubensmeynungen ausgerottet, die<br />
christliche Liebe, die wahre Andacht und<br />
Gottseligkeit in alle Stände wieder eingeführet<br />
würde“. Im Mittelpunkt der Kongregationsregeln<br />
standen die Verehrung der<br />
Gottesmutter und die Aufforderung, ihrem<br />
tugendhaften Lebenswandel nachzueifern.<br />
Wie bereits berichtet, verdankte das 1798<br />
eröffnete Max-Joseph-Krankenhaus in der<br />
Neustadt seine Entstehung einer Initiative<br />
der Marianischen Bürgersodalität. Neben<br />
der Abstellung von ehrenamtlichen Pflegern<br />
hielt die Kongregation durch regelmäßige<br />
38
Spenden und milde Stiftungen<br />
Kollekten in der Stadt den Betrieb der<br />
Anstalt aufrecht. Es spricht für den solidarischen<br />
Geist der Kongregationisten, dass sie<br />
ungeachtet der Bedürftigkeit ihrer eigenen<br />
Einrichtung seit 1866 sich mit großem Eifer<br />
um die Einziehung kleinerer Beiträge für das<br />
Marienhospital kümmerten. In einem Aufruf<br />
des Vorstandes des Marienhospitalvereins<br />
vom 1. Januar 1867 heißt es dazu: „Seit<br />
Anfang des vorigen <strong>Jahre</strong>s hat die hiesige<br />
wohllöbliche Marianische Bürger-Sodalität<br />
das mühsame Geschäft des Einsammelns<br />
der kleineren Beiträge übernommen und<br />
mit unermüdlicher Thätigkeit ausgeführt.<br />
Ihrem regen und treuen Eifer verdankt<br />
der Verein eine Einnahme von über 1000<br />
Thalern, ein Ergebniß, welches für die<br />
Beitragenden wie für die Sammler gleich<br />
rühmlich ist“. Bis zum <strong>Jahre</strong> 1869 vermochte<br />
die Marianische Kongregation aus den<br />
von ihnen veranstalteten Sammlungen<br />
mehr als 2500 Taler zum Baufond für das<br />
Marienhospital beizusteuern.<br />
Als weitere Geldquelle standen dem<br />
Vorstand die Erträge des Marienhospitalvereins<br />
zur Verfügung, dessen Mitglieder<br />
sich auch nach Fertigstellung des Hospitals<br />
zu Beitragszahlungen verpflichtet hatten.<br />
Nach den Unterlagen brachte der Verein<br />
zwischen 1864 und 1873 folgende Beiträge<br />
in den Krankenhausetat ein:<br />
Jahr Taler<br />
1864 3074<br />
1865 6337<br />
1866 2478<br />
1867 3059<br />
1868 3690<br />
1869 626<br />
1870 1106<br />
1871 267<br />
1872 539<br />
1873 847<br />
Als die Beiträge immer spärlicher flossen,<br />
wurde der Verein schließlich im <strong>Jahre</strong> 1897<br />
aufgelöst.<br />
Einige im Hospital aufgestellte Opferstöcke<br />
brachten nur geringe Erträge. Bedeutendere<br />
Mittel flossen dem Hospital aus<br />
Vermächtnissen zu. Im Stiftungsbuch des<br />
Marienhospitals findet man als größere Spender<br />
die Namen der „ersten“ katholischen<br />
Familien Düsseldorfs wieder, die häufig genug<br />
untereinander enge Familienbindungen<br />
besaßen. „Ein hiesiger Herr“ stellte durch<br />
seine Gattin 1000 Taler zur Verfügung. Ein<br />
Geistlicher vermachte dem Verein über 2000<br />
Taler. Die großzügige Stiftung des Geheimen<br />
Kommerzienrates Gerhard Baum zum goldenen<br />
Firmenjubiläum seines Kommissions- und<br />
Spediteurgeschäftes wurde ebenso dankbar<br />
angenommen wie die anonyme Stiftung von zwei Aktien über<br />
100 Taler der Brohler Wasseranstalt. Die geläufigste Form<br />
der Stiftung bestand aus anlagefähigem Kapital, aus dessen<br />
Zinsen nicht selten ein oder mehrere Freibetten bereitgestellt<br />
wurden. Im <strong>Jahre</strong> 1875 hatte der Vorstand auf vier Stiftungen<br />
dieser Art mit einem Gesamtkapital von 21000 Talern<br />
Zugriff, darunter auf das Legat der Witwe Elisabeth Bremer<br />
in Höhe von 16000 Talern, deren jährlicher Zinsertrag von<br />
etwa 1000 Talern zur unentgeltlichen Verpflegung armer<br />
Kranker eingesetzt wurde.<br />
Stephan Hohenrath, Gönner des<br />
Marienhospitals, um 1875<br />
Marienhospital, Stiftungsverzeichnis<br />
(Auszug), um 1875<br />
Marienhospitalverein, Statuten,<br />
11. Januar 1871<br />
39
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Mit viel praktischem Engagement<br />
unterstützte das Damencomité<br />
des Marienhospitalvereins<br />
die Arbeit des Verwaltungsrates<br />
und der Ordensschwestern<br />
weit über die Eröffnung der Anstalt<br />
hinaus. Für das Jahr 1871 ist<br />
in der Hauschronik der Franziskanerinnen<br />
dazu vermerkt: „Mit<br />
Hülfe des Damenvereins konnte<br />
in der ersten Zeit, jedes Jahr<br />
eine Weihnachtsbescherung veranstaltet<br />
werden, deren erste<br />
für die verwundeten Soldaten<br />
besonders glänzend ausgefallen<br />
war. Der im Vestibül aufgestellte<br />
Weihnachtsbaum ragte in die<br />
erste Etage hinein, und die ihn<br />
umgebenden Tische waren mit<br />
praktischen Geschenken beladen,<br />
ein den Franzosen ganz<br />
neuer und sie freudig überraschender<br />
Anblick“.<br />
Marienhospital, Vestibül mit<br />
Weihnachtsschmuck, um 1950<br />
Theresienhospital, Altestadt 2/4, 1926<br />
Ursulinenkloster, Ritterstraße 12/14,<br />
um 1915<br />
Martinskloster, Martinstraße 7,<br />
um 1910<br />
Kulturkampf und<br />
kaiserlicher Besuch<br />
Der Aufstieg sozial-caritativer Einrichtungen,<br />
in denen Ordensgemeinschaften tätig<br />
waren, kam mit den klosterfeindlichen<br />
Maßnahmen des preußischen Kulturkampfes<br />
für nahezu ein Jahrzehnt empfindlich<br />
ins Stocken. Den Auftakt bildete die Entfernung<br />
der Ordensleute aus den Elementarschulen.<br />
Ein Erlass des Kultusministeriums<br />
vom 15. Juni 1872 bestimmte, „daß die<br />
Mitglieder einer geistlichen Congregation<br />
oder eines geistlichen Ordens in Zukunft<br />
als Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen<br />
Schulen nicht mehr zuzulassen und zu<br />
bestätigen sind“. Einschneidender war<br />
das „Gesetz, betreffend die geistlichen<br />
Orden und ordensähnlichen Kongregationen<br />
der katholischen Kirche“ vom 31.<br />
Mai 1875, auf Grund dessen alle religiösen<br />
Genossenschaften mit Ausnahme jener,<br />
die sich der Krankenpflege widmeten,<br />
aus Preußen ausgewiesen wurden (§ 2). In<br />
Düsseldorf mussten zunächst die Seelsorgeorden<br />
(Franziskaner, Dominikaner) und<br />
kontemplativen Gemeinschaften (Klarissen)<br />
ihre Niederlassungen aufgeben. Die<br />
Kranken pflegenden Orden blieben wie<br />
bei der Säkularisation auch im Kulturkampf<br />
von der Verbannung ausgenommen. Sie<br />
wurden jedoch der Staatsaufsicht unterstellt<br />
(§§ 2‐3) und die Aufnahme neuer<br />
Mitglieder bedurfte der Genehmigung des<br />
Oberpräsidenten, dem auch jede personelle<br />
Veränderung innerhalb der Niederlassungen<br />
anzuzeigen war. Unter die Ausnahmeregelung<br />
fielen im Kreis Düsseldorf<br />
die Armen Schwestern vom Hl. Franziskus<br />
(Hubertusstift Neustadt, Städtisches<br />
40
Kulturkampf und<br />
kaiserlicher Besuch<br />
Pflegehaus Neustadt, Marienhospital Pempelfort,<br />
Marienkrankenhaus Kaiserswerth),<br />
die Töchter vom Hl. Kreuz (Krankenhaus<br />
Altestadt) und die Armen Dienstmägde Jesu<br />
Christi (Krankenambulanzen Bilk, Karlstadt,<br />
Oberbilk, Benrath).<br />
Den Franziskanerinnen im Düsseldorfer<br />
Marienhospital gelang es, in zahlreichen<br />
Einzelfällen die restriktive Gesetzgebung<br />
des <strong>Jahre</strong>s 1875 zu umgehen oder von<br />
Amts wegen Milderungen zu erreichen.<br />
Da das Mutterhaus in Aachen jedoch auf<br />
die staatliche Genehmigung zur Aufnahme<br />
neuer Mitglieder verzichtet hatte, wirkte<br />
sich der ausbleibende Nachwuchs sehr bald<br />
hindernd auf die Arbeit aus. Beeinflusst<br />
von Kaiserin Augusta, die die Arbeiten<br />
caritativer Genossenschaften mehrfach<br />
durch eigene Anschauung kennengelernt<br />
und nachdrücklich gefördert hatte, äußerte<br />
Kaiser Wilhelm I. schon wenige Wochen<br />
nach Erlass des Gesetzes vom 31. Mai<br />
1875 schwere Bedenken gegen dessen<br />
Durchführung und Folgen. Auf den Einfluss<br />
der Kaiserin ging wohl auch ein kaiserlicher<br />
Erlass an die Minister des Inneren und der<br />
geistlichen Angelegenheiten vom 9. Juni<br />
1875 zurück, der größte Schonung bei<br />
der Durchführung des Gesetzes vorschrieb.<br />
Vor dem Hintergrund dieser Haltung<br />
verwundert es wenig, dass Kaiserin Augusta<br />
im <strong>Jahre</strong> 1877 bei einem Besuch der Bürgermeisterei<br />
Düsseldorf geradezu demonstrativ<br />
die beiden wichtigsten Krankenhäuser<br />
der Stadt visitierte. Nachdem sie zunächst<br />
das Evangelische Krankenhaus am Fürstenwall<br />
aufgesucht hatte, begab sie sich<br />
nach Pempelfort, wo sie vom Vorstand, den<br />
Ärzten und den Schwestern<br />
des Marienhospitals respektvoll<br />
in Empfang genommen<br />
wurde. Über den kaiserlichen<br />
Besuch der Anstalt am 7. September<br />
1877 ist in der Chronik<br />
der Armen Franziskanerinnen<br />
vermerkt: „Nachdem Ihre Majestät,<br />
die Kaiserin, von dem<br />
stellvertretenden Vorsitzenden,<br />
Herrn Lupp in den Empfangssaal<br />
geleitet und daselbst von<br />
dem Vorstandsmitgliede, Herrn<br />
Schauseil mit einer kurzen<br />
Ansprache begrüßt worden,<br />
ließen Ihre Majestät Sich die<br />
Vorstandsmitglieder und die<br />
Ärzte vorstellen. Sodann ließen<br />
Ihre Majestät Sich von dem<br />
Oberarzte des Marienhospitals,<br />
Dr. Windscheid Mittheilungen<br />
machen über die Einrichtungen<br />
des Krankenhauses und geruhten<br />
dann die einzelnen Räume<br />
Kaiserin Augusta (1811-1890), um 1870<br />
Marienhospital, Erinnerungsblatt an den Besuch<br />
von Kaiserin Augusta, 7. September 1877<br />
41
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Kardinal Paulus Melchers (1813-1895),<br />
um 1875<br />
Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler<br />
(1811-1877), um 1870<br />
W.E. von Ketteler, Die Arbeiterfrage und<br />
das Christenthum, 1864<br />
der Anstalt: die Kapelle, die Krankensäle, den Operationssaal<br />
und die Küche zu besuchen, wobei Ihre Majestät Sich huldvoll<br />
und theilnehmend nach einigen Kranken erkundigten.<br />
In den Empfangssaal zurückgekehrt geruhten Ihre Majestät<br />
eine über diesen allerhöchsten Besuch angefertigte Urkunde<br />
Höchsteigenständig zu unterzeichnen ... Dem im Protokoll<br />
Enthaltenen ist noch beizufügen, daß zu den Kranken, nach<br />
welchen Ihre Majestät Sich huldvoll und theilnehmend zu<br />
erkundigen geruhten, ein krankes dreijähriges Mädchen,<br />
Tochter eines Bahnwärters aus Immigrath gehörte, welchem<br />
von der Eisenbahn beide Beine abgefahren worden waren.<br />
Ihre Majestät stellten einige Fragen an das Kind und versprachen<br />
ihr eine Puppe, die auch nach 14 Tagen eintraf und<br />
selbstverständlich ein Prachtexemplar war. Das Kind lebte<br />
noch einige Monate“.<br />
Dass Kaiserin Augusta die Entwicklung des Marienhospitals<br />
auch später aufmerksam verfolgte, geht aus einer<br />
kurzen Notiz in den Katholischen Missionsblättern vom 4.<br />
Juli 1880 hervor, in denen ein Korrespondent von einem<br />
weiteren Besuch der Monarchin in Düsseldorf mitteilte: „Wie<br />
aus einem vom Herrn Oberbürgermeister an die Stände der<br />
hiesigen Wohlthätigkeitsanstalten gerichteten Schreiben<br />
hervorgeht, hat die Kaiserin Augusta bei ihrer jüngsten Anwesenheit<br />
in unserer Stadt sich nach den Verhältnissen der<br />
hiesigen Wohlthätigkeitsanstalten wiederholt und eingehend<br />
erkundigt. Ihre Majestät bedauerte den Verlust, den das<br />
Marienhospital durch den Tod seines Chefarztes, Herrn Dr.<br />
Windscheid erlitten, und beauftragte den Herrn Oberbürgermeister<br />
ausdrücklich, den Vorständen mitzutheilen, wie<br />
Allerhöchstdieselbe dem Gedeihen der wohlthätigen Anstalten<br />
nach wie vor das größte Interesse widme, und nur die<br />
Kürze des diesmaligen hiesigen Aufenthaltes sie darauf habe<br />
verzichten lassen müssen, sich von dem Zustande derselben<br />
persönlich Überzeugung zu verschaffen“.<br />
Besuche geistlicher Würdenträger<br />
Neben gekrönten Häuptern durfte das Marienhospital in<br />
den ersten <strong>Jahre</strong>n seines Bestehens auch mehrere Bischöfe<br />
in seinen Räumen begrüßen. Für das Jahr 1872 ist in der<br />
Ordenschronik neben einem Besuch des Kölner Erzbischofs<br />
Paulus Melchers auch der Aufenthalt eines<br />
Bischofs aus Japan im Marienhospital bezeugt.<br />
„Während die Schwestern mit den<br />
Kranken in der Kapelle den Rosenkranz<br />
beteten“, so der Eintrag der Chronistin,<br />
„wurde ein fremder Bischof gemeldet,<br />
ein französischer Missionär aus Japan,<br />
welcher die Stadt durchgereist sei und hier<br />
um Gastfreundschaft bäte. Noch an dem<br />
selben Morgen celebrirte der hohe Herr<br />
die hl. Messe und noch drei Wochen lang<br />
hatte das Hospital die Ehre, den hochwürdigsten<br />
Herrn zu logieren, währenddem er<br />
in der Stadt eine Collecte für seine Mission<br />
abhielt“.<br />
Wenige Monate nach dem Besuch<br />
des Kölner Erzbischofs folgte eine Visite<br />
des Mainzer Bischofs Wilhelm Emmanuel<br />
von Ketteler, der sich im September 1873<br />
für kurze Zeit in der Stadt Düsseldorf aufhielt.<br />
Wilhelm Emmanuel von Ketteler<br />
(1811-1877) gehörte zu den prägenden<br />
Figuren des sozialen Katholizismus im 19.<br />
Jahrhundert. Wie kaum ein anderer nahm<br />
er an den sozialen Debatten seiner Zeit teil<br />
und setzte sich für gerechte Löhne, verkürzte<br />
Arbeitszeiten wie auch ein Verbot der<br />
Kinderarbeit ein. Trotz dieser Forderungen<br />
wünschte der „Arbeiterbischof“ die liberalistisch<br />
geprägten Wirtschaftsstrukturen<br />
nicht im Sinne einer sozialen Revolution<br />
umzustürzen, sondern im Sinne einer auf<br />
konkrete Problemstellungen akzentuierten<br />
Sozialpolitik zu reformieren. Die Industriegesellschaft<br />
als unabdingbares Erfordernis<br />
der Zeit hatte Wilhelm Emmanuel von<br />
Ketteler anerkannt, es galt nur, das ihr<br />
entsprechende „soziale Netz“ zu schaffen.<br />
Um das soziale Netz stabil zu halten,<br />
hatte Wilhelm Emmanuel von Ketteler<br />
neben gesetzlichen Maßnahmen im Parlament<br />
vor allem die Einrichtung und den<br />
42
Besuche geistlicher Würdenträger<br />
Ausbau caritativer Anstalten durch die<br />
Kirche gefordert. Vor diesem Hintergrund<br />
verwundert es wenig, dass der Besuch des<br />
Mainzer Bischofs im Marienhospital nicht<br />
nur höfliche Geste, sondern politisches Programm<br />
war. Unter der Überschrift „Hoher<br />
Besuch im Marien-Hospital“ berichtete das<br />
Düsseldorfer Volksblatt am 23. September<br />
1873 aus Pempelfort: „Gestern Nachmittag<br />
beehrte der hochwürdigste Herr Bischof<br />
von Mainz, Freiherr von Ketteler, das hiesige<br />
St. Marienhospital durch seinen hohen<br />
Besuch. Hochderselbe sprach seine vollste<br />
Anerkennung über die schönsten und<br />
stattlichen Räumlichkeiten der Anstalt,<br />
besonders aber über das segensreiche<br />
Wirken, die musterhafte Ordnung und<br />
Reinlichkeit der armen Schwestern vom<br />
hl. Franziskus aus, unter deren Leitung das<br />
St. Marienhospital steht. Beim Abschied<br />
wünschte er der ehrwürdigen Oberin das<br />
beste Gedeihen der Anstalt und ertheilte<br />
schließlich allen Insassen des Hauses den<br />
bischöflichen Segen“.<br />
Pius XI. (1857-1939)<br />
war Papst von 1922 bis 1939.<br />
1879 zum Priester geweiht, wurde er<br />
1882 zum Professor in Mailand berufen<br />
und 1888 Bibliothekar an der dortigen<br />
Biblioteca Ambrosiana.<br />
Im Jahr 1907 wurde er deren Präfekt,<br />
bis ihn Papst Pius X. 1911 nach Rom<br />
holte.<br />
„Papst Pius XI.“ besucht das Marienhospital<br />
Ordenschronik der Franziskanerinnen 1925 (Auszug)<br />
25. Juni 1925: Folgende Mitteilung darf keinesfalls in der Chronik des Marienhospitals fehlen:<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1907 lag hier im Marienhospital ein Herr<br />
Alex Riccardi aus Mailand und zwar in der Privatabteilung<br />
für Herren I. Etage, Zimmer Nr. 12 unter der<br />
Pflege unserer Schw. Eulalia. Unser jetziger hl. Vater,<br />
Papst Pius XI., war zur Zeit Hausfreund bei den<br />
Eltern des Herrn Riccardi. Die Mutter dieses Herrn<br />
richtete mehrere Mal ein Schreiben an die pflegende<br />
Schwester, um Mitteilung über das Befinden, aber<br />
auch über das Betragen ihres Sohnes zu erhalten.<br />
Schw. Eulalia schrieb ab und zu nach Mailand<br />
an die Eltern des Herrn Riccardi. Unser jetziger<br />
hl. Vater übersetzte diese Briefe, und so erfuhr die<br />
Mutter stets das Genaueste über ihren Sohn, und<br />
antwortete der jetzige hl. Vater den Schwestern nun<br />
wieder auf Deutsch. Eines Tages nun besuchte unser<br />
jetziger hl. Vater im Auftrage der Eltern des Herrn<br />
Riccardi den Kranken und brachte der Schw. Eulalia<br />
ein schönes Bildchen mit, das Schmerzensantlitz des<br />
lieben Heilandes darstellend, worauf eine Widmung<br />
der Mutter des Patienten und das Datum: 22. März<br />
1907 stand. Also ist unser jetziger hl. Vater Pius XI.<br />
im <strong>Jahre</strong> 1907 im St. Marienhospital in Düsseldorf,<br />
Zimmer Nr. 12, Herren Abteilung I. Stock gewesen.<br />
43
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Die Kranken<br />
Marienhospital, Kinderabteilung,<br />
um 1930<br />
Marienhospital, Krankheitsfälle, 1910<br />
Marienhospital, Privatabteilung,<br />
um 1930<br />
Jahr 1871 1872 1873<br />
Patienten 692 909 1036<br />
Verpflegungstage 21593 38178 27163<br />
Geheilt entlassene Patienten 397 614 749<br />
Verstorbene Patienten 74 120 155<br />
Nicht geheilt entlassene Patienten 31 36 42<br />
Verbliebene Patienten 190 139 90<br />
Dauer der Aufnahme eines Patienten (Tage) 43 42 36<br />
Normalzahl der Betten 200 224 255<br />
Belegte Betten (Durchschnitt) 124 135 106<br />
Im „Statut der katholischen Kranken- und<br />
Verpflegungsanstalt Marien‐Hospital zu<br />
Düsseldorf“ vom 11. Januar 1871 war<br />
genau dargelegt, wer Aufnahme in das<br />
Krankenhaus fand. Wörtlich war im ersten<br />
Paragraphen der Statuten festgeschrieben:<br />
„Die zu Düsseldorf unter dem Namen<br />
‚Marien-Hospital‘ bestehende Anstalt hat<br />
zum Zwecke die Verpflegung heilbarer und<br />
unheilbarer Kranken und wo möglich auch<br />
die Verpflegung altersschwacher Personen,<br />
ohne Rücksicht auf religiöses Bekenntniß“.<br />
Prinzipiell war im Marienhospital kein Patient<br />
von einer Aufnahme, Behandlung<br />
und Pflege ausgeschlossen, so dass die<br />
Pempelforter Anstalt in Düsseldorf als allgemeines<br />
Krankenhaus in privater, näherhin<br />
katholischer Trägerschaft galt.<br />
Im ersten Jahr nach der Eröffnung<br />
des zivilen Krankenhauses wurden 692<br />
Patienten aufgenommen und verpflegt,<br />
von denen 397 geheilt und 31 ungeheilt<br />
entlassen werden konnten, 74 starben.<br />
1872 stieg die Zahl der im Laufe des <strong>Jahre</strong>s<br />
behandelten Patienten auf 909, im dritten<br />
Jahr stieg sie weiter auf 1036 Patienten.<br />
Die deutliche Abnahme der Verpflegungstage<br />
im <strong>Jahre</strong> 1873 im Vergleich zum<br />
Vorjahr resultierte daher, dass die städtische<br />
Armenverwaltung seit 1872 bedürftige<br />
Kranke katholischer Konfession nicht nur<br />
in das Marienhospital sondern auch in<br />
das Max-Joseph-Krankenhaus (Neustadt)<br />
und das Krankenhaus der Töchter vom<br />
Hl. Kreuz (Altestadt) einweisen ließ. „Die<br />
Zunahme der Sterblichkeit erklärt sich daraus“,<br />
so der dazugehörige <strong>Jahre</strong>sbericht<br />
des Marienhospitals, „daß im <strong>Jahre</strong> 1873<br />
dem Marien-Hospitale vorzugsweise die<br />
44
Die Kranken<br />
schweren, den beiden anderen vorerwähnten<br />
Krankenhäusern dagegen die leichteren<br />
Kranken überwiesen wurden und daß in<br />
sehr vielen Fällen die Aufnahme erst im<br />
letzten Stadium der Krankheit (allein in 13<br />
Fällen nur einen Tag vor dem Hinscheiden)<br />
erfolgte“.<br />
Den weit formulierten Aufnahmekriterien<br />
entsprechend, werden in den<br />
Nachweisungen über die in der Anstalt<br />
behandelten Patienten eine Vielzahl an<br />
Krankheiten genannt. Unter den aufgenommenen<br />
Personen befanden sich Infektionskranke,<br />
Kranke mit inneren Leiden,<br />
Schwerverletzte, aber auch Alte und Sieche<br />
mit nur geringen Heilungsaussichten. Das<br />
Krankenhaus erlebte wachsende Anerkennung<br />
in der Stadt, was sich an den stetig<br />
steigenden Patientenzahlen ablesen lässt.<br />
Die Patientenzahlen waren gleichzeitig der<br />
Beweis für die dringende Notwendigkeit<br />
eines weiteren Ausbaues der stationären<br />
Krankenpflege in Düsseldorf.<br />
Viele der auftretenden Krankheiten<br />
muten heute befremdlich an. Karbunkel,<br />
Skrofulose, Schlagfuss, Gliedschwamm,<br />
Wassersucht, Nervenfieber, gastrisches<br />
Fieber oder Wechselfieber, um nur einige zu<br />
nennen. Die Schwindsucht, d. h. Lungen-<br />
Tuberkulose, lässt sich wie die meisten<br />
dieser Krankheiten mit den schwierigen<br />
Lebensbedingungen in Armut korrelieren.<br />
Viele der in den ersten <strong>Jahre</strong>n Gestorbenen<br />
hatten jeweils nur wenige Tage im Krankenhaus<br />
zugebracht. Sie litten unter typischen<br />
hochinfektiösen „Arme-Leute-Gebrechen“:<br />
Nervenfieber und Schwindsucht als Mangelkrankheit.<br />
Als häufigste Ursachen für<br />
den Krankenhausaufenthalt lassen sich im<br />
Patientenbuch diffuse Fieberzustände und<br />
dermatologische Krankheiten ausmachen.<br />
Dazu gehörten Flechten und Geschwüre,<br />
auch Augenentzündungen und besonders Krätze. Berücksichtigt<br />
man die bescheidenen Lebenssituationen, dann lässt sich<br />
das Ausmaß möglicher Infektionsquellen ermessen. In vielen<br />
Düsseldorfer Wohnungen war nicht einmal das eigene Bett<br />
für jedes Familienmitglied selbstverständlich. Zudem waren<br />
in den meisten Häusern fließendes Wasser und Abwassersysteme<br />
noch nicht vorhanden und Kloaken dünsteten in<br />
offenen Hofstellen aus.<br />
Unhygienische, feuchte und enge Wohnungen begünstigten<br />
jede Art von Infektionskrankheiten. Geschlechtskrankheiten<br />
Arbeiterwohnhaus,<br />
Gumbertstraße 49/51, um 1900<br />
Müllentsorgung, Ritterstraße, 1885<br />
Düsselgraben, Mühlenstraße,<br />
um 1920<br />
45
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Fabrikarbeiterinnen in einer<br />
Weberei, um 1930<br />
Lederfabrik Franze de Hesselle,<br />
Siegburger Straße 139, 1895<br />
Cholerainfizierte in einem<br />
Behandlungssaal, 1892<br />
Marienhospital,<br />
Fieberpavillon, um 1930<br />
wie Syphilis waren ebenso häufig wie fiebrige Erkältungen.<br />
Den privaten Lebensumständen fügten sich externe Ursachen<br />
an. Je mehr sich die Industrie in Düsseldorf ausbreitete, desto<br />
stärker nahmen auch Beeinträchtigungen der Luft und der<br />
Gewässer zu. Die Belastungen durch Abwässer in die Düssel<br />
bzw. den Rhein und durch Emissionen in die Luft waren häufiger<br />
Anlass zu Beschwerden von Anwohnern. Die Arbeiter<br />
und Arbeiterinnen in Webereien waren vom feinen Staub des<br />
Garns oder Leinens am Arbeitsplatz eingehüllt, der für die<br />
Atemwege gefährlich werden konnte, die giftigen Farben des<br />
eingefärbten Garns verursachten Geschwüre an Fingern und<br />
Armen. Auch die Gerbereien entwickelten giftige Dämpfe,<br />
die Atemwege und Augen belasteten. Arbeitsschutzbestimmungen<br />
wurden erst im Laufe<br />
des späteren 19. Jahrhunderts<br />
entgegengesetzt.<br />
Auch die für die Bevölkerung<br />
besonders erschreckenden,<br />
periodisch auftretenden<br />
Epidemien: Cholera, Typhus,<br />
Pocken, Tuberkulose, Fleckfieber<br />
fehlen nicht in den<br />
Nachweisungen über die in<br />
der Anstalt behandelten Patienten.<br />
Da der zur Aufnahme<br />
von Infektionskranken vorgesehene<br />
Fieberpavillon nur über<br />
je 20 Betten für männliche bzw. weibliche<br />
Personen verfügte, waren die vorgehaltenen<br />
Kapazitäten im Epidemiefall schnell<br />
erschöpft. Die Folge war, dass es bis zum<br />
Ersten Weltkrieg zwischen dem Marienhospital<br />
und den Gesundheitsbehörden<br />
immer wieder zu Streitigkeiten kam, wenn<br />
das Krankenpflegepersonal die Aufnahme<br />
epidemisch Kranker außerhalb des Fieberpavillons<br />
verweigerte. Nicht zu Unrecht zog<br />
sich der Vorstand in den Korrespondenzen<br />
mit den städtischen Behörden auf die Position<br />
zurück, Patienten mit ansteckenden<br />
Krankheiten dürften in das Haupthaus nicht<br />
aufgenommen werden.<br />
Welche fatalen Folgen eine medizinisch<br />
unsachgemäße Versorgung epidemischer<br />
Patienten haben konnte, belegt<br />
eine Begebenheit aus der Frühzeit des<br />
Marienhospitals. Kurz vor der Fertigstellung<br />
und Inbetriebnahme des Fieberpavillons<br />
ist über den plötzlichen Tod einer Mitschwester<br />
in der Chronik der Franziskanerinnen<br />
vermerkt: „Am 16. August 1872<br />
berief der liebe Gott die erste Schwester<br />
aus dem Marienhospitale zu sich. Es war<br />
Schwester Medarda, die sich in der Pflege<br />
der Ruhrkranken, bevor dieselben in die<br />
Villa verlegt wurden, den Tod zuzog. Sie<br />
stand der Frauenstation in den unteren<br />
Räumen des Hauses vor und trug eines<br />
Morgens früh die Leiche eines eben an der<br />
Ruhr verstorbenen Kindes in das im Souterain<br />
gelegenen Leichenzimmer. Mittags<br />
in der Recreation erzählte sie einer anderen<br />
Schwester den Vorfall und äußerte dabei,<br />
die Leiche, welche sie habe vom Saale<br />
schaffen wollen, bevor sie den Kranken<br />
daselbst das Frühstück bringen musste,<br />
sei ihr, da sie selbst noch nüchtern gewesen,<br />
außergewöhnlich schwer geworden,<br />
und beim Niederlegen derselben habe<br />
46
Wunderheilungen<br />
und Bekehrungen<br />
sie gedacht, jetzt bekommst auch Du die<br />
Ruhr. Die Schwester suchte ihr alle Furcht<br />
auszureden, aber schon in der nächsten<br />
Nacht zeigten sich an Schwester Medarda<br />
alle Symptome der bösen Krankheit, der<br />
die gute Schwester schon am vierten Tage<br />
erlag, nachdem sie vorher ihr junges Leben<br />
von einigen zwanzig <strong>Jahre</strong>n dem lieben<br />
Gott bereitwilligst zum Opfer gebracht<br />
hatte“.<br />
Wunderheilungen und<br />
Bekehrungen<br />
Viele Patienten, die in den ersten <strong>Jahre</strong>n ins<br />
Marienhospital eingeliefert wurden, galten<br />
bei der Aufnahme als unheilbarer Fall, da<br />
nur wenige Erkrankungen medizinisch behandelt<br />
werden konnten. Kam es wider aller<br />
Erwartung bei einem todkranken Patienten<br />
zu einer Heilung, wurde dies in der Regel<br />
nicht dem medizinischen Können der Ärzte,<br />
sondern dem Beistand der himmlischen Patronin<br />
des Hauses zugeschrieben. „So wurde<br />
einmal ein junger Ziegelbäcker ins Spital<br />
gebracht“, berichtet die Hauschronik, „dessen<br />
Arm infolge einer Blutvergiftung ganz<br />
dunkel und entsetzlich angeschwollen war.<br />
Der Arzt erklärte, nur durch eine Amputation<br />
des Armes könne das Leben des Kranken<br />
erhalten werden. Hierzu aber konnte sich<br />
der arme Junge nicht entschließen und bat<br />
deshalb den Arzt, wenigstens noch einige<br />
Tage zusehen zu wollen, worauf dieser<br />
antwortete: ‚In einigen Tagen wird man Sie<br />
begraben können‘. Doch der Kranke ließ<br />
sich nicht irre machen; er habe eine Novene<br />
zur lieben Mutter Gottes angefangen, sagte<br />
er, und sei fest überzeugt, daß diese ihm<br />
helfen werde ... Die liebe Mutter Gottes<br />
ließ ihn in seinem Vertrauen nicht zu Schanden<br />
werden. Geschwulst und schwarze Farbe des<br />
Armes verloren sich und nach Beendigung<br />
der Novene verließ der junge Mann gänzlich<br />
hergestellt das Hospital, wobei der Arzt ehrlich<br />
gestand: ‚Den hab ich nicht geheilt‘“.<br />
Zahlreiche medizinisch nicht erklärbare<br />
Genesungen schrieben die Franziskanerinnen<br />
dem „Lourdeswasser“ zu, das im Haus offenbar<br />
immer in großer Menge vorgehalten wurde.<br />
„Das Dienstmädchen einer wohlhabenden<br />
Familie in Derendorf war von dem elfjährigen<br />
Sohn des Hauses“, so die Ordenschronik, „der<br />
mit dem geladenen Gewehr seines Vaters<br />
spielte, tödtlich in den Hals getroffen worden.<br />
Hier angekommen, wurde das arme Mädchen<br />
sofort mit den hl. Sterbesakramenten versehen,<br />
und jeden Augenblick konnte der Tod eintreten.<br />
Die Herrschaft war untröstlich und von ihrem<br />
Jammer gerührt, begannen die Schwestern<br />
sogleich mit ihr eine Novene zu Unserer lieben<br />
Frau von Lourdes, mit dem Versprechen, die<br />
Heilung im Sendboten veröffentlichen zu lassen.<br />
Gleichzeitig gab man dem Mädchen das<br />
Wasser von Lourdes zu trinken und schon nach<br />
14 Tagen war die vollständige Heilung erfolgt“.<br />
War der Körper eines Menschen trotz<br />
aller medizinischen Bemühungen der Ärzte<br />
und flehentlichen Bitten der Schwestern nicht<br />
mehr zu heilen, trat die Sorge für einen „guten<br />
Tod“ und das Seelenheil des Erkrankten in den<br />
Mittelpunkt der Hilfe. So berichtet die Chronistin<br />
der Franziskanerinnen: „Ein Mann, der<br />
dem Tode nahe war, war ... trotz alles Zuredens<br />
nicht zu bewegen, die hl. Sterbesakramente zu<br />
empfangen. Da bat man ihn, im Vertrauen auf<br />
Augustaklinik, Schwanenmarkt 4,<br />
Vierzellenbad, um 1915<br />
Marienhospital, Lourdesgrotte, um 1930<br />
Theresienhospital, Altestadt 2/4,<br />
Trauerkapelle, 1926<br />
47
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Frauenabteilung,<br />
um 1930<br />
die liebe Mutter Gottes etwas Wasser von Lourdes zu nehmen;<br />
diese würde ihm dann das Sterben erleichtern. Er that<br />
es, während die Schwestern für ihn beteten. Dann wurde er<br />
ruhig, begehrte bald die hl. Sakramente und nach andächtigem<br />
Empfang derselben verschied er sanft im Herrn“.<br />
Statut geregelt gewesen sein. Inhaltlich<br />
dürfte es den Hausordnungen der übrigen<br />
Krankenhäuser in Düsseldorf entsprochen<br />
haben, allem voran dem „Reglement für<br />
die Kranken“ im Krankenhaus der Töchter<br />
vom Hl. Kreuz in der Altestadt aus dem<br />
<strong>Jahre</strong> 1875.<br />
Marienhospital Düsseldorf<br />
Speiseordnung<br />
Sonntag, den 6. Oktober 1912<br />
I. Klasse<br />
Bouillonsuppe mit Markklöschen,<br />
Geflügelpastete,<br />
Blumenkohl mit Kalbskoteletts,<br />
Hasenbraten mit Apfelkompott,<br />
Weinpudding mit Vanillesauce,<br />
Trauben und Birnen.<br />
II. Klasse<br />
Bouillonsuppe mit Markklöschen,<br />
Blumenkohl mit Kalbskoteletts,<br />
Hähnchen mit Kompott,<br />
Weinpudding mit Vanillesauce.<br />
III. Klasse<br />
Bouillonsuppe mit Markklöschen,<br />
Kotelette mit gekochtem Obst<br />
und Kartoffeln.<br />
Reglement für die Kranken<br />
Patienten, die in das Marienhospital eingewiesen wurden,<br />
konnten sich darauf verlassen, dass sowohl Ärzte wie auch<br />
Pflegeschwestern sich in der gewissenhaftesten Weise um<br />
sie kümmerten. Dem Recht auf eine gute Behandlung durch<br />
das Personal stand die Pflicht der Erkrankten zur Einhaltung<br />
der Hausordnung gegenüber. Deren Regeln und die Kontrolle<br />
durch die Schwestern lassen die Vorstellung erkennen, „daß<br />
die Patienten möglicherweise, in jedem Fall jedoch in hygienischer<br />
Sicht zu erziehen seien“. Dazu gehörte in moralischer<br />
Hinsicht, dass die Franziskanerinnen darüber zu wachen hatten,<br />
dass „eine strenge Absonderung nach den Geschlechtern<br />
stattfindet“, im Haus wie auch in der Benutzung des Gartens.<br />
Auch wenn in schriftlicher Form kein Pflichtenkatalog des<br />
Marienhospitals überliefert ist, so wird der Aufenthalt von<br />
Patienten im Krankenhaus ohne Zweifel durch ein eigenes<br />
Verpflegung der<br />
Patienten<br />
Die Versorgung der Patienten mit Essen war<br />
im Marienhospital wiederholt Gegenstand<br />
heftiger Auseinandersetzungen zwischen<br />
Ärzten und Pflegeschwestern. Während<br />
die Franziskanerinnen den Kranken zu den<br />
Mahlzeiten oftmals mehr als die vorgesehenen<br />
Speisen verabreichten, forderten<br />
die Ärzte aus Kostengründen die genaue<br />
Einhaltung der vorgegebenen Essenspläne.<br />
Über den Vorgang, der die Einführung eines<br />
verbindlichen „Speiseregulativs“ im Marienhospital<br />
mit sich brachte, berichtet die<br />
Hauschronik: „Zu der am 8. Mai 1877 im<br />
Hospitale abgehaltenen Vorstandssitzung<br />
wurde die Schwester Raphaela und der<br />
Oberarzt Dr. Gustav Windscheid citiert, um<br />
Vorschläge zu Ersparnissen zu machen, da<br />
sich beim letzten <strong>Jahre</strong>sabschluß ein großes<br />
Deficit herausgestellt habe. Schwester<br />
Raphaela erklärte, sie wisse nicht, wie man<br />
hinsichtlich der Verpflegung der Kranken<br />
noch sparsamer sein könne und halte es<br />
für unzuträglich, daß zweite Frühstück ganz<br />
abzuschaffen. Auch könne sie nicht auf den<br />
Vorschlag eingehen, die Zahl der Schwestern<br />
zu vermindern, da bereits eine Verminderung<br />
des Dienstpersonals stattgefunden<br />
habe. Herr Dr. Windscheid brachte nun die<br />
Klage vor, daß einem Kranken längere Zeit<br />
48
Die Ärzte<br />
hindurch eine Zulage zum 2. Frühstück<br />
verabreicht worden sei, die er doch nur<br />
für ein einziges mal bewilligt habe, worauf<br />
Schwester Raphaela versichern konnte,<br />
daß die irrthümlich verabreichte unnötige<br />
Zulage bereits beseitigt sei. Um nun doch<br />
einige Ersparnisse zu erzielen, wurde auf<br />
Wunsch des Herrn Dr. Windscheid ein<br />
Speise-Regulativ eingeführt“.<br />
Dass die neu eingeführte Regelung<br />
im Marienhospital schon in kurzer Zeit<br />
die gewünschte Wirkung zeigte, geht aus<br />
dem Rückblick auf das Jahr 1877 hervor,<br />
wo es u.a. heißt: „Das im Mai eingeführte<br />
Speiseregulativ hatte sich hinsichtlich<br />
der Kostenersparung so bewährt, daß<br />
man noch vor Abschluß des <strong>Jahre</strong>s zu der<br />
Überzeugung gelangte, daß die Ausgaben<br />
bei weitem nicht so sehr die Einnahmen<br />
übersteigen würden, als man gefürchtet<br />
hatte. Diese Wahrnehmung veranlaßte nun<br />
aber auch die großmüthige Verordnung,<br />
daß die Verpflegung der Kranken dritter<br />
Klasse verbessert werde, indem zu Bouillon<br />
und Kaffee fortan anstatt eines trockenen,<br />
ein geschmiertes Brödchen und Abends ein<br />
Glas Bier verabreicht werden solle“.<br />
Die Ärzte<br />
Nachdem der Vorstand in der Sitzung vom<br />
28. Juni 1871 beschlossen hatte, „aus Mangel<br />
an Mitteln einstweilen von der Berufung<br />
eines weitberühmten Arztes abzusehen“,<br />
war die medizinische Verantwortung im<br />
Marienhospital am 9. Juli 1871 dem früheren<br />
Lazarettarzt Dr. Gustav Windscheid<br />
für ein jährliches Gehalt von 500 Talern<br />
übertragen worden. Den Düsseldorfer Adressbüchern<br />
ist zu entnehmen, dass Gustav<br />
Windscheid seit dem <strong>Jahre</strong> 1862 in Düs-<br />
seldorf als praktischer Arzt und<br />
Arzt der „Departemental-Irrenanstalt<br />
zu Düsseldorf“ (Fürstenwall)<br />
wirkte. Außerdem<br />
war er an der Düsseldorfer<br />
Kunstakademie beschäftigt,<br />
wo er einen Lehrauftrag für<br />
Anatomie hatte. Als Gustav<br />
Windscheid am 15. Juni 1880<br />
als Folge einer Blutvergiftung<br />
zum Opfer seines Berufes wurde,<br />
ließ der Vorstand des Marienhospitals<br />
im Düsseldorfer<br />
Volksblatt folgenden Nachruf<br />
zum Abdruck bringen: „Ausgezeichnet<br />
durch den reichen<br />
Schatz eines hervorragenden<br />
Wissens und grosser Erfahrung,<br />
war er für die Anstalt,<br />
der er seit der vor 10 <strong>Jahre</strong>n<br />
erfolgten Eröffnung ihrer Thätigkeit<br />
als Oberarzt angehörte,<br />
nicht bloss der rastlos thätige,<br />
umsichtige und in der Heilung<br />
und Linderung der Krankheiten<br />
seinen höchsten Lohn findende<br />
Arzt der Kranken, sondern<br />
auch der uneigennützige Förderer<br />
der Interessen der Anstalt, der ohne Rücksicht auf die<br />
Last der sonstigen Obliegenheiten seines Berufs kein Opfer<br />
scheute, um in freudigster Weise und mit voller Kraft bei Tage<br />
und bei Nacht für die Kranken der Anstalt einzutreten. Das<br />
Hospital verliert in dem Verstorbenen den liebevollen Freund<br />
und Wohlthäter der Anstalt wie der Kranken; es wird ihm ein<br />
dauerndes dankbares Andenken bewahren“.<br />
Am 8. Juli 1880 wählte der Vorstand des Marienhospitals<br />
Dr. Ludwig Sträter zum Oberarzt. 1848 in Rheine geboren,<br />
Theresienhospital, Altestadt 2/4,<br />
Krankenreglement, um 1875<br />
Marienhospital, Dr. Ludwig Sträter<br />
(1848-1925), um 1900<br />
49
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
studierte er nach dem Besuch<br />
des Gymnasiums in Würzburg<br />
und Bonn bis 1872 Medizin.<br />
Nach der Promotion war Ludwig<br />
Sträter von 1873 bis 1876<br />
Assistenzarzt im Maria-Hilf-<br />
Spital in Aachen, wo er von<br />
1877 bis zu seiner Berufung<br />
nach Düsseldorf auch als praktischer<br />
Arzt wirkte. Ludwig<br />
Sträter stand dem Düsseldorfer<br />
Marienhospital 30 <strong>Jahre</strong> lang<br />
als leitender Arzt vor und erwies<br />
während dieser Zeit „der<br />
leidenden Menschheit viel Gutes<br />
an Leib und Seele“.<br />
Schon am 1. August 1894<br />
hatte das Marienhospital einen<br />
zweiten Oberarzt in der<br />
Person von Dr. Eduard Wirsing<br />
erhalten. Im <strong>Jahre</strong> 1887<br />
approbiert, war er von 1888<br />
bis 1894 an der Medizinischen<br />
Klinik in Würzburg tätig. Im<br />
Marienhospital unterstand ihm<br />
die Behandlung der inneren<br />
Krankheiten, während Ludwig<br />
Sträter die chirurgische Abteilung<br />
leitete. Nach der Berufung<br />
von Eduard Wirsing an das<br />
Berliner Hedwigkrankenhaus<br />
übernahm Ludwig Sträter<br />
1898 wieder allein die ganze<br />
Leitung im Marienhospital,<br />
Augustaklinik, Schwanenmarkt 4,<br />
Röntgenzimmer, um 1915<br />
Allgemeine Städtische Krankenanstalten,<br />
Moorenstraße 5,<br />
Großer Operationssaal, 1926<br />
Marienhospital, Dienstanweisung<br />
für die Oberärzte, 15. Februar 1907<br />
worin er von einem Sekundärarzt und mehreren<br />
Assistenzärzten unterstützt wurde.<br />
Die Stelle des Sekundärarztes bekleideten<br />
von 1898 bis 1903 Dr. Hermann Peters,<br />
von 1903 bis 1907 Dr. Alex Max Florange.<br />
Die Aufgaben und Tätigkeiten der Ärzte<br />
am Marienhospital waren in hauseigenen<br />
Statuten festgehalten. Erhalten ist eine<br />
„Dienst‐Anweisung für die Oberärzte des<br />
Marienhospitals“, die am 15. Februar 1907<br />
vom Vorstand in Kraft gesetzt wurde. Als<br />
selbstverständlich galt, „dass die Oberärzte<br />
den ihnen zugewiesenen Kranken ihre<br />
Tätigkeit in der gewissenhaftesten Weise<br />
zu widmen haben. Es ist deshalb ein Morgenbesuch<br />
der ganzen Abteilung zu einer<br />
möglichst im voraus bestimmt festzusetzenden<br />
und immer zu haltenden Stunde<br />
(½ 10 Uhr) erforderlich, und haben die<br />
Oberärzte außerdem auch gegen Abend<br />
das Hospital zu besuchen, um bei besonders<br />
schwer Erkrankten, bei unmittelst<br />
neu Aufgenommenen, oder wo es sonst<br />
erforderlich ist, ihre ärztliche Hülfe eintreten<br />
zu lassen. Außerdem haben die Oberärzte,<br />
wenn sie in dringenden Fällen gerufen werden<br />
müßen, zu jeder Tages- und Nachtzeit<br />
einem solchen Rufe zu folgen und sich<br />
sogleich in das Hospital zu begeben“ (§ 5).<br />
In ihrer ärztlichen Wirksamkeit waren die<br />
Oberärzte selbständig. Es wurden ihnen<br />
alle zur Behandlung erforderlichen Mittel<br />
und Instrumente bereitgehalten, doch<br />
waren sie verpflichtet, „soweit es irgend<br />
möglich ist, die genaueste Sparsamkeit<br />
zu beobachten“ und „die im Etat derfalls<br />
vorgesehenen Credite“ einzuhalten. Die<br />
Behandlung von Kranken, die nicht in das<br />
Krankenhaus aufgenommen waren, war<br />
den Oberärzten verboten, wenn die medizinische<br />
Hilfeleistung im Marienhospital gegen<br />
Bezahlung erfolgte. Bei unentgeltlicher<br />
50
Die Krankenhausapotheke<br />
Behandlung ambulanter Patienten hatten<br />
die Ärzte dafür zu sorgen, „daß für die<br />
dabei verbrauchten Materialien des Hospitals,<br />
insbesondere für Verbandzeug und<br />
Medicamente, entsprechende Zahlung an<br />
das Hospital erfolgt“. Die Zuziehung von<br />
auswärtigen Ärzten und Studierenden<br />
sollte vermieden werden und war nur in<br />
Ausnahmefällen gestattet. Die Entlassung<br />
der Patienten, die erfolgen musste, „sobald<br />
sie in der Genesung weit genug vorgeschritten“<br />
waren, konnte ausschließlich<br />
vom zuständigen Oberarzt angeordnet<br />
werden (§ 9). Ermahnungen, zu denen<br />
etwa eine der Pflegeschwestern Anlass gab,<br />
waren niemals in Gegenwart der Kranken<br />
zu machen. Vielmehr hatten die Oberärzte<br />
diese zunächst bei der Oberin anzubringen,<br />
der ausschließlich die Disziplin über die<br />
Schwestern zustand (§ 11).<br />
Die<br />
Krankenhausapotheke<br />
Die Armenschwestern vom Heiligen Franziskus<br />
hatten von Anfang ihrer Gründung<br />
an die Herstellung von Heilkräutern, Salben<br />
und Verbandmaterial für die Behandlung<br />
der Kranken als Teil ihrer Berufstätigkeit<br />
geübt. In Preußen galt seit 1853 ein Ministerialerlass,<br />
der in konfessionellen Krankenhäusern<br />
die Zubereitung und Abgabe<br />
von Arzneimitteln durch ausgebildete Ordensangehörige<br />
gestattete, die in einer<br />
staatlichen Prüfung ihre Kenntnisse bewiesen<br />
hatten. Diese „Dispensierschwestern“<br />
(Apothekerinnen; nicht identisch mit heutigen<br />
approbierten Apothekern) wurden<br />
von Ärzten oder Apothekern ausgebildet<br />
und nach erfolgreich bestandenem Examen<br />
unter der Aufsicht eines Arztes in den Dispensieranstalten<br />
(Hausapotheken) eingesetzt.<br />
Nachdem der Vorstand am 28. Juni 1871<br />
die Königliche Regierung in Düsseldorf ersucht<br />
hatte, im Marienhospital eine Apotheke<br />
einrichten und betreiben zu dürfen, sprach<br />
diese vier Wochen später die hierzu erforderliche<br />
Genehmigung aus. Die Erlaubnis<br />
war an den Vorbehalt geknüpft, „daß der<br />
Arzney-Debit sich nur auf die Bedürfnisse des<br />
Marien-Hospitals erstreckt, und daß durchaus<br />
keine Arzney irgend welcher Person außer<br />
dem Marien-Hospital Wohnende verabfolgt<br />
werden“ durfte.<br />
In der Apotheke des Marienhospitals,<br />
die nach Erhalt der staatlichen Genehmigung<br />
„im ersten Zimmer linker Hand vom<br />
Haupteingang“ eingerichtet wurde, war seit<br />
Marienkrankenhaus, Suitbertus-<br />
Stiftsplatz 11/15, Visite, um 1920<br />
Marienhospital, Apotheke, um 1930<br />
51
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
von 5 Prozent an das Krankenhaus weiter.<br />
Bei der Anlieferung von Blutegeln gab<br />
es einen Rabatt von 10 Prozent auf den<br />
staatlich festgesetzten Normalpreis. Für<br />
das Zerkleinern resp. Zuschneiden von<br />
Vegetabilien wurden bei Rinden, Wurzeln<br />
und Samen zwei Silbergroschen pro Pfund,<br />
bei Kräutern ein Silbergroschen berechnet.<br />
Elephanten-Apotheke,<br />
Bolkerstraße 46, um 1910<br />
Marienhospital, Liefervertrag<br />
mit dem Apotheker Eduard Bausch,<br />
28. Mai 1872<br />
1871 Schwester Constantia tätig, die zusammen mit zwei<br />
anderen Schwestern über das erforderliche Examen verfügte.<br />
Arzneimittel, die im Krankenhaus nicht hergestellt werden<br />
durften, lieferte der Düsseldorfer Apotheker Eduard Bausch,<br />
mit dem der Vorstand des Marienhospitals am 28. Mai 1872<br />
einen exklusiven Abnahmevertrag geschlossen hatte. Der<br />
Arzneihändler von der Elephanten-Apotheke (Bolkerstr. 46)<br />
war verpflichtet, „den Bedarf an<br />
Arzneymitteln für das Marien-<br />
Hospital während der Zeit vom<br />
1. Juny 1872 bis Ende December<br />
1873 zu liefern“, wogegen der<br />
Vorstand des Marienhospitals die<br />
Verpflichtung übernahm, „diesen<br />
Bedarf während des genannten<br />
Zeitraums ausschließlich aus der<br />
Apotheke des Dr. Eduard Bausch<br />
zu beziehen“. Für den Ankauf von<br />
„undispensirten Arzneyen“ resp.<br />
„pharmacentischen Präparaten“<br />
in seiner Apotheke räumte Eduard<br />
Bausch dem Marienhospital<br />
einen Rabatt von 30 Prozent ein.<br />
Gefäße und sonstige Utensilien<br />
gab die Apotheke zum Selbstkostenpreis<br />
mit einem Aufschlag<br />
Die Seelsorge<br />
Die seelsorgliche Betreuung von Kranken<br />
war von Anfang an ein zentrales Anliegen<br />
der Kirche. Dahinter stand der Auftrag zur<br />
Krankenheilung, den Jesus seinen Jüngern<br />
gegeben hatte (Mt 10,8), und der<br />
evangelische Rat zum Krankenbesuch (Mt<br />
25,36). In dem Maße, wie eine Verlagerung<br />
der Verantwortung für Kranke von den<br />
Familien und Kirchengemeinden auf die<br />
Anstaltspflege geschah, erfolgte auch die<br />
Herausbildung einer speziellen Krankenhausseelsorge.<br />
Im Pempelforter Marienhospital war die<br />
Realisierung der christlichen Verantwortung,<br />
„trostbedürftige Kranke” durch „trostspendende<br />
Krankenpfleger” zu stärken,<br />
außer den Armenschwestern vom Heiligen<br />
Franziskus vor allem den Geistlichen an<br />
der Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit und den<br />
Hausgeistlichen der Anstalt in die Hände<br />
gelegt. Der Ort ihrer Wirksamkeit war neben<br />
dem Krankenzimmer die Kapelle, deren<br />
Altar im Marienhospital zunächst in einem<br />
profanen Raum, bald aber schon in einem<br />
eigenen Gotteshaus aufgestellt war. Schon<br />
wenige Tage nach der Eröffnung hatte das<br />
Kölner Generalvikariat am 19. August 1871<br />
genehmigt, in einem provisorisch als Kapelle<br />
benutzten Zimmer des Marienhospitals die<br />
heilige Messe lesen und das Allerheiligste<br />
52
Die Seelsorge<br />
Sakrament aufbewahren zu dürfen. Wie<br />
aus den überlieferten Aufzeichnungen<br />
hervorgeht, war die Hauskapelle zu Zeiten<br />
des Militärlazarettes im linken Seitentrakt,<br />
nach Fertigstellung des Allgemeinen Krankenhauses<br />
im Erdgeschoss des gegenüberliegenden<br />
Flügels untergebracht. Die<br />
Kapelle war der „Mutter vom guten Rat”<br />
geweiht, unter deren Schutz sich auch die<br />
Armenschwestern vom Heiligen Franziskus<br />
gestellt hatten. „Im Altar derselben”,<br />
so berichtet die Ordenschronik, „waren<br />
anfangs drei Gyps-Statuen angebracht<br />
gewesen, deren mittlere aber schon bald<br />
durch ein Ölgemälde, die Himmelskönigin<br />
darstellend, welches die hochwürdigen Herren<br />
Patres Franziskaner zu diesem Zwecke<br />
geliehen hatten, ersetzt worden war. Als<br />
Seitenbilder zu diesem wurden im <strong>Jahre</strong><br />
1872 von Herrn Professor Franz Ittenbach<br />
zwei sehr werthvolle Ölgemälde, der hl.<br />
Franziskus und die hl. Elisabeth, gemalt und<br />
dem Hospitale zum Geschenke gemacht”.<br />
Mit der provisorischen Kapelle im<br />
rechten Seitenflügel war den Bedürfnissen<br />
der Schwestern zunächst Rechnung<br />
getragen, doch zieht sich der Wunsch<br />
nach einer eigenen Sakralstätte für das<br />
Marienhospital wie ein roter Faden durch<br />
die Ordenschronik. Nicht zu Unrecht erinnerten<br />
die Franziskanerinnen daran, dass<br />
der Bau eines würdigen Gottesdienstraumes<br />
getrennt vom Hauptgebäude schon 1866<br />
im „Programm für den Entwurf eines Bau-<br />
Plans zum Marien-Hospital” vorgesehen<br />
war. Schon in den ersten Bauzeichnungen<br />
des Architekten August Rincklake war der<br />
Bau einer Kapelle auf dem Gelände des<br />
Marienhospitals westlich des Hauptgebäudes<br />
vorgesehen. Die Realisierung des<br />
Vorhabens wurde aber schon kurz nach<br />
der Grundsteinlegung für das Krankenhaus<br />
auf die Zeit nach der Fertigstellung<br />
des Hauptgebäudes verschoben,<br />
da die notwendigen<br />
Mittel für den Bau der Anstalt<br />
nur langsam flossen. Obwohl<br />
der Vorstand noch in seinem<br />
Rechenschaftsbericht für das<br />
Jahr 1874 notierte, mit dem<br />
Bau einer Kapelle könne „erst<br />
nach einigen <strong>Jahre</strong>n begonnen<br />
werden”, nutzten die Pflegeschwestern<br />
seit ihrer Ankunft<br />
in Düsseldorf jede Gelegenheit,<br />
die Gelder für die Errichtung<br />
eines eigenen Gotteshauses zu<br />
mehren. Hoffnungsfroh, aber<br />
ohne große Euphorie heißt es<br />
in der Chronik: „Herr Rendant<br />
Carl Hilgers hatte versprochen,<br />
den Vorstand zum Beginn des<br />
Baues zu bestimmen, sobald die<br />
Summe von 4 bis 5000 Thaler<br />
beschafft sei, ... – da brach der<br />
Kulturkampf aus und mit dem<br />
Kirchenbauen war es zu Ende.<br />
Der Vorstand legte das bereits<br />
gesammelte Geld, über 3000<br />
Thaler verzinslich an, bis auf<br />
bessere Zeiten”.<br />
Die besseren Zeiten<br />
schienen gegeben, nachdem<br />
Reichskanzler Otto von Bismarck<br />
zu Beginn der achtziger<br />
<strong>Jahre</strong> erkannt hatte, dass er<br />
mit den Kulturkampfgesetzen<br />
das von ihm erstrebte Ziel nicht<br />
Kapelle, Altarraum,<br />
um 1900<br />
Kapelle, Nichtausgeführte<br />
Entwurfszeichnung von<br />
August Rincklake, 1870<br />
53
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Kapelle, Entwurfszeichnungen<br />
von August Rincklake und<br />
Caspar Clemens Pickel, 1880<br />
Kapelle, Altarraum mit der<br />
Hl. Elisabeth (li.) und dem<br />
Hl. Franziskus (re.) von Franz<br />
Ittenbach, um 1930<br />
erreichen konnte. Um sich aus der politischen Bedrängnis<br />
zu befreien, erließ er „Milderungsgesetze”, die den Vollzug<br />
der antikirchlichen Verordnungen der <strong>Jahre</strong> 1872 bis 1875<br />
abschwächen sollten.<br />
Wie bereits berichtet, war das Marienhospital als stationäre<br />
Krankenpflegeeinrichtung von den Gesetzen der<br />
Kulturkampfzeit nur mittelbar betroffen, doch wurden mit<br />
Erlass der Milderungsgesetze und der Wiederherstellung der<br />
Rechtssicherheit für katholische Einrichtungen auch hier neue<br />
Kräfte für den weiteren Ausbau der Anstalt freigesetzt. Schon<br />
am 6. November 1879 meldete das Düsseldorfer Volksblatt<br />
aus Pempelfort: „Die Armenschwestern vom hl. Franziskus<br />
im hiesigen Marienhospital wurden zum<br />
vorgestrigen Feste ihres Stifters durch die<br />
Nachricht beglückt, daß eine hiesige, ungenannt<br />
sein wollende, edle Wohlthäterin<br />
dem Kapellenfond beim Marien-Hospital das<br />
reiche Geschenk von 3000 Mark mit dem<br />
Wunsche überwiesen habe, daß dasselbe<br />
zu neuen Beiträgen für den Kapellenbau<br />
anregen möge. Sicherem Vernehmen nach<br />
ist hierdurch der Kapellenfonds auf circa<br />
20000 Mark angewachsen, während noch<br />
eine weitere Summe von wenigstens 25000<br />
Mark erforderlich erachtet wird, ehe mit<br />
dem Bau eines für das wachsende Bedürfniß<br />
der Anstalt ausreichenden und würdigen<br />
Gotteshauses begonnen werden kann”.<br />
Die unverhoffte Schenkung einer unbekannten<br />
Wohltäterin beflügelte den<br />
Verwaltungsrat des Marienhospitals, am 2.<br />
Januar 1880 den Beschluss zu fassen, mit<br />
dem Bau der Kapelle zu beginnen, obwohl<br />
die notwendigen Mittel hierzu noch gar<br />
nicht ausreichend waren. Woher die notwendigen<br />
Geldmittel für den Bau und die<br />
Ausstattung der Kapelle kommen sollten,<br />
ließ der Vorstand offen, doch glaubte er,<br />
sich auf den gläubigen Enthusiasmus der<br />
Düsseldorfer Katholiken verlassen zu können.<br />
In einem Vorbericht zur Grundsteinlegung<br />
für den projektierten Kapellenbau<br />
spornte das Düsseldorfer Volksblatt am<br />
25. Mai 1880 seine Leser noch einmal an:<br />
„Den katholischen Bewohnern Düsseldorfs<br />
wird die Nachricht willkommen sein, daß<br />
am Freitag den 28. Mai, nachmittags um<br />
5 Uhr, die feierliche Grundsteinlegung für<br />
die Marienhospital‐Kapelle stattfindet.<br />
Manches Herz hat sich nach diesem Tage<br />
seit <strong>Jahre</strong>n gesehnt, denn der Bau einer<br />
Kapelle war eine unabweisbare Notwendigkeit<br />
geworden; ... aber es fehlt noch viel,<br />
bis wir den Schlüssel in die Thüre stecken<br />
54
Die Seelsorge<br />
können ... Die vorhandenen Mittel und die<br />
letzten frommen Gaben reichen kaum für<br />
den Rohbau. Das kleine Kirchlein aber soll<br />
eine würdige Stätte der Andacht werden<br />
und an Schönheit dem Hospitale nicht<br />
nachstehen. Mit dem Steigen der Mauern<br />
mögen denn auch die Gaben reichlicher<br />
fließen! Wer dem Herrn leiht, leiht auf<br />
hohe Zinsen, und wer den Armen dient,<br />
hat Gott zum Herrn!”<br />
Über den Ablauf der Feierlichkeiten<br />
zur Grundsteinlegung, die von Dechant<br />
Johannes Kribben vollzogen wurde, berichtete<br />
das Düsseldorfer Volksblatt am 1. Juni<br />
1880: „Nachdem die über den wichtigen<br />
Akt aufgenommene Urkunde, welche in den<br />
zu weihenden Grundstein eingeschlossen<br />
werden sollte, von den anwesenden Mitgliedern<br />
der Geistlichkeit der Stadt, des<br />
Vorstandes und des Verwaltungsrates des<br />
Marienhospitals-Vereins sowie anderen<br />
eingeladenen Herren unterzeichnet worden<br />
war, ... zog die Versammlung, unter<br />
Vortragung des Kreuzes an die im Westen<br />
des Hospitals gelegene Baustätte, wo die<br />
Fundamente bereits allerseits geöffnet und<br />
am Orte des zukünftigen Altars ein einfaches<br />
Kreuz vorschriftsmäßig aufgepflanzt war,<br />
und es erfolgte dann ... die Einschließung<br />
der Urkunde, die Segnung des Grundsteins<br />
und der Rundgang um die Grenzen der<br />
Kapelle”.<br />
Genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung<br />
erfolgte am 31. Mai 1881 die Einweihung<br />
der einschiffigen, vierjochigen<br />
neugotischen Kapelle, der als äußere Dominante<br />
„von den rühmlichst bekannten<br />
Architekten August Rincklake und Caspar<br />
Clemens Pickel“ ein kleiner Dachreiter<br />
aufgesetzt war.<br />
Von der im Zweiten Weltkrieg schwer<br />
beschädigten und 1965 niedergelegten<br />
Kapelle sind heute nur noch einige Photographien<br />
überliefert. Erhalten ist aber eine<br />
Beschreibung des kleinen Gotteshauses aus<br />
dem <strong>Jahre</strong> 1922, die nicht nur eine anschauliche<br />
Darstellung ihrer architektonischen<br />
Besonderheiten bietet, sondern auch ihre<br />
fortschreitende Ausstattung mit Mobiliar und<br />
Kunstwerken nachzeichnet. Wörtlich heißt<br />
es dort: „Die Kirche wurde vor dem westlichen<br />
Seitenflügel gebaut, so daß der rechte<br />
Hauptflur geradewegs in die Kirche führt.<br />
Die Räume im westlichen Flügel, denen durch den Anbau<br />
der Kirche das Licht entzogen wurde, und die bisher schon<br />
als Kapelle gedient hatten, wurden mit zur Kirche gezogen.<br />
Infolgedessen erhielt die Kirche drei größere Vorräume oder<br />
Chöre, die je wieder in zwei Teile geteilt sind. Ein solcher<br />
Vorraum befindet sich zu ebener Erde und je einer in den<br />
beiden Stockwerken, so daß von jedem Stockwerke aus<br />
Gelegenheit geboten ist, dem Gottesdienste beizuwohnen.<br />
Zur Kirche hin waren diese Chöre anfänglich durch Fenster<br />
abgeschlossen, die jedoch zu ebener Erde und im ersten<br />
Stockwerke später entfernt wurden. Der Chor im ersten<br />
Stockwerke wurde 1899 für die Schwestern eingerichtet und<br />
diesen damit ein Raum gewährt, wo sie abgesondert von<br />
den anderen Kirchenbesuchern ihren Gottesdienst halten<br />
können. In der Hospitalkirche selbst ist die ganze linke Seite<br />
für die Hausbewohner und Kranken reserviert, während die<br />
Kapelle, Innenansicht, um 1930<br />
Kapelle, Außenansicht, um 1965<br />
Einladungskarte, 28. Mai 1880<br />
Dechant Johannes Kribben<br />
(1833-1922), um 1875<br />
55
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Kapelle, Pietà, um 1930<br />
St. Lambertus, Kalvarienberg<br />
von Joseph Reiß, um 1900<br />
rechte Seite fast ganz den auswärtigen Besuchern<br />
freisteht, die durch einen besonderen<br />
Eingang von draußen in die Kirche gelangen.<br />
Die Kirche ist im gotischen Stile erbaut und<br />
besteht aus der Apsis und vier Jochen. Auch sie<br />
ist von außen mit hellen Oberkasseler Steinen<br />
verblendet. Die Baukosten betrugen 65000<br />
Mark. Auch die innere Ausstattung der Kirche<br />
wurde immer mehr vervollständigt und erlebte<br />
im Laufe der <strong>Jahre</strong> manche Veränderung.<br />
Außer dem Hochaltar hat die Kirche noch<br />
zwei Seitenaltäre, die alle in Holz geschnitzt<br />
sind. Der Hochaltar ist der Himmelskönigin,<br />
die beiden Seitenaltäre dem hl. Herzen Jesu<br />
und dem hl. Joseph geweiht, wie die Statuen<br />
anzeigen, die dieselben schmücken. Zu<br />
Weihnachten 1897 wurde im Hochaltar das<br />
kunstvolle und kostbare Tabernakel eingebaut.<br />
Bei der weiterten Ausstattung der Kirche ist<br />
vor allem der Ordensangehörigkeit der im<br />
Hospital pflegenden Schwestern Rechnung<br />
getragen. So schmücken die Kirche die Statuen<br />
der vorzüglichen Heiligen aus dem Franziskanerorden.<br />
Im Chorbogen stehen St. Franziskus<br />
von Assisi und St. Antonius von Padua. Auf<br />
dem Hochaltare zu Seiten der thronenden<br />
Himmelskönigin mit dem Jesuskind erblickt<br />
man St. Klara und St. Elisabeth in stehender<br />
Stellung. Zwei Beichtstühle und eine Kanzel,<br />
ebenfalls aus Holz, vervollständigen die Innenausstattung<br />
der Kirche. Anfang 1904 wurden<br />
... in der Kirche nochmals größere Veränderungen<br />
vorgenommen. Der gotische Bogen<br />
am Eingang des Chores wurde erweitert. Die<br />
Kommunionbank, zu der sonst einige Stufen<br />
hinaufführten, wurde zu ebener Erde und<br />
mehr in die Kirche hinein verlegt, wodurch<br />
das Chor größer wurde. Hinter den Figuren<br />
des Hochaltars wurden Scheiben angebracht,<br />
die die Statuen besser hervortreten lassen.<br />
Der Hochaltar und das ganze Chor wurde mit<br />
einem Kranze elektrischer Lichter umgeben.<br />
Der Schwesternchor wurde durch den Anbau<br />
einer Empore, die als Singchor dient,<br />
bedeutend vergrößert. Die Glaswände<br />
und Türen, welche den Chor zu ebener<br />
Erde von der Kirche schieden, wurden<br />
weggenommen und die beiden Räume<br />
so in engere Verbindung mit der Kirche<br />
gebracht. Die hohe Bretterwand, welche<br />
die beiden Räume trennte, wurde durch<br />
eine niedrige, reich gearbeitete Holzwand<br />
ersetzt. Infolge dieser Veränderungen war<br />
eine Neudekorierung der Kirche notwendig<br />
geworden. Die erste Dekoration war im<br />
<strong>Jahre</strong> 1888 von Maler Wilhelm Westermeyer<br />
ausgeführt worden; jetzt wurde sie dem<br />
Kunstmaler Odenthal aus Köln‐Ehrenfeld<br />
übertragen. Die Wandgemälde zu beiden<br />
Seiten des Chores und das Gemälde oberhalb<br />
des Chores wurden ausgeführt von<br />
Maler Rütters, einem Schüler von Professor<br />
Eduard von Gebhardt. Einen künstlerischen<br />
Schmuck erhielt das Hospital durch die<br />
Erwerbung der Kunstmodelle des Bildhauers<br />
Joseph Reiß. ... Als im <strong>Jahre</strong> 1898 der<br />
Bildhauer Joseph Reiß ganz ins Hospital<br />
übersiedelte, schenkte er demselben alle<br />
in seiner Werkstatt noch vorhandenen<br />
Modelle. Dieselben fanden Aufstellung<br />
in der Kirche, im Schwesternchor, in der<br />
Sakristei und draußen am Leichenhause.<br />
Eine Zierde der Kirche bildet vor allem die<br />
herrliche Pietà. Beim Bau der Kirche hatte<br />
man auf den Bau einer geräumigen Sakristei<br />
wenig Bedacht genommen. Der für<br />
diesen Zweck bestimmte Raum war ganz<br />
ungenügend; die kirchlichen Gewänder<br />
und Gerätschaften mußten in einem unter<br />
der Kirche liegenden Raum aufbewahrt<br />
werden, zu dem Wendeltreppen hinabführten.<br />
Diesem Übelstande suchte man<br />
abzuhelfen. Im <strong>Jahre</strong> 1900 machte man<br />
noch einen Anbau an die Kirche, wozu<br />
56
Die Seelsorge<br />
eine besondere Wohltäterin, Frau Dessire<br />
Bicheroux, das Kapital von 19000 Mark<br />
schenkte. Dieser Anbau zieht sich an der<br />
Südseite der Kirche unterhalb der Fenster<br />
an der ganzen Kirche entlang. Seitwärts<br />
vom Chore wurde dadurch eine helle und<br />
geräumige Sakristei gewonnen. Seitwärts<br />
der Kirche entstand ein großer Saal zum<br />
Aufbewahren und Ausbessern der Paramente.<br />
Unter diesen Räumen richtete man<br />
eine zweite Leichenhalle ein für verstorbene<br />
Hausbewohner, die mit entsprechenden<br />
Statuen ausgestattet ist. So ist der Plan der<br />
frommen Stifter doch in Erfüllung gegangen.<br />
Das Marienhospital besitzt eine Kirche,<br />
die allen Ansprüchen der Hausbewohner<br />
und Kranken genügt, und die auch von<br />
Auswärtigen gerne besucht wird”.<br />
Dem Bericht aus dem <strong>Jahre</strong> 1922 ist<br />
nachzutragen, dass die Kapelle am 30. Juni<br />
1927 eine Orgel erhielt und ein Jahr später<br />
vom Düsseldorfer Kunstmaler Bernhard<br />
Gauer neu ausgemalt wurde.<br />
Für den Dienst am Altar der Kapelle<br />
waren zunächst die Patres aus dem<br />
Franziskanerkloster an der Oststraße wie<br />
auch die Geistlichen an der Derendorfer<br />
Dreifaltigkeitskirche verantwortlich, doch<br />
konnte das Marienhospital schon im <strong>Jahre</strong><br />
1871 einen eigenen Hausgeistlichen verpflichten.<br />
Möglich wurde die Anstellung<br />
dank einer von den Gebrüdern Graf August<br />
und Kanonikus Leopold von Spee im<br />
September 1870 zugewendeten Stiftung<br />
in Höhe von 4000 Talern, deren Zinsen zur<br />
Besoldung eines Hausgeistlichen verwendet<br />
werden sollten. Da die Franziskaner keinen<br />
Pater für die Seelsorge abstellen konnten,<br />
wurde Kaplan Arnold Hubert Lofgnié aus<br />
Eschweiler am 9. Oktober 1871 durch den<br />
Kölner Erzbischof zum ersten Rektor an der<br />
Kapelle im Marienhospital ernannt.<br />
Kapelle, Innenraum nach der Neuausmalung von Bernhard Gauer, um 1930<br />
Hubert Ritzenhofen (1879-1961), Derendorfer Fronleichnamsprozession mit Statio am Marienhospital, um 1925<br />
Programmblatt, 30. Juni 1927<br />
57
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Prinz-Georg-Straße, Ballonaufnahme, um 1910<br />
Marienhospital, In den Ziertürmen zwischen<br />
Hauptgebäude und Seitenflügeln befanden<br />
sich die Toilettenanlagen, um 1920<br />
Personalhäuser Rochusstraße 2 & 4, 1929<br />
Telegrafen- und Fernmeldeamt,<br />
Karl-Theodor-Straße 1, um 1935<br />
Marienhospital, Aufzugsanlage, um 1930<br />
Ausbauten<br />
Im Laufe der <strong>Jahre</strong> mussten Teile des angekauften<br />
Stockkamp Gutes infolge Anlegung<br />
neuer Straßen (z. B. Prinz-Georg-Straße) abgetreten<br />
werden. Andere Grundstücke wurden<br />
getauscht, wieder andere als Bauplätze verkauft,<br />
besonders an der Ehrenstraße, was dem<br />
Marienhospital nicht unerhebliche Geldmittel<br />
einbrachte. Durch die verschiedenen Immobiliengeschäfte<br />
arrondierte sich im Laufe der<br />
Zeit das Gelände des Marienhospitals zu dem<br />
heutigen Karee zwischen Stern-, Stockkamp-,<br />
Prinz-Georg-, Ehren- und Rochusstraße. Schon<br />
1876 war damit begonnen worden, die Grundstücke<br />
des Marienhospitals durch eine Mauer<br />
mit eisernen Durchgangstoren einzufrieden.<br />
Im Frühjahr 1879 wurde das erste Gartenhaus<br />
gebaut, dem in den nächsten<br />
<strong>Jahre</strong>n noch mehrere Lauben folgen sollten.<br />
Zur Aufbahrung der im Krankenhaus<br />
verstorbenen Patienten wurde 1881 an<br />
der südwestlichen Ecke des Grundstückes<br />
(nördlich des Wohnhauses Rochusstr. 2) ein<br />
Leichenhaus errichtet, das den Unwillen<br />
verschiedener Anlieger an der Ehrenstraße<br />
und Hospitalstraße erregte, nach dem Gang<br />
durch alle gerichtlichen Instanzen aber<br />
weiter benutzt werden durfte. Im <strong>Jahre</strong><br />
1888 kaufte der Vorstand von der Witwe<br />
Caspar Schiffer die beiden an das Hospitalgrundstück<br />
grenzenden Häuser Rochusstr.<br />
2 und 4, die dem Krankenhausgeistlichen<br />
und Assistenzärzten bzw. dem Rendanten<br />
als Wohnung dienten.<br />
Drängende Enge und neue Vorschriften<br />
leiteten in den neunziger <strong>Jahre</strong>n neue<br />
Ausbaupläne des Krankenhauses in die<br />
Wege. Um allen eingewiesenen Patienten<br />
die Aufnahme zu ermöglichen, gab der<br />
Vorstand des Marienhospitals im <strong>Jahre</strong> 1893<br />
den Umbau des gesamten Dachgeschosses<br />
in Krankenzimmer in Auftrag. Nach Fertigstellung<br />
der umgebauten Räume konnten<br />
in der Pempelforter Anstalt 413 Patienten<br />
aufgenommen werden, von denen viele<br />
in der neu eingerichteten Kinder- und<br />
Frauenstation behandelt wurden.<br />
Mit der Erweiterung des Platzangebotes<br />
ging die Verbesserung der Infrastruktur<br />
durch den Einbau moderner technischer<br />
Einrichtungen einher. Im <strong>Jahre</strong> 1892 wurde<br />
das Marienhospital an das Düsseldorfer<br />
Fernsprech-Vermittlungsamt angeschlossen<br />
und war seitdem unter der Rufnummer 899<br />
telefonisch erreichbar. Zwei <strong>Jahre</strong> später<br />
wurde ein Wasseraufzug angelegt, der den<br />
Verkehr vom Erdgeschoß mit allen Etagen bis<br />
zum Dachgeschoß ermöglichte. Im Herbst<br />
58
Ausbauten<br />
1894 erhielt das ganze Haus Glühlicht, das<br />
acht <strong>Jahre</strong> später durch elektrisches Licht<br />
ersetzt wurde. Ein Gasmotor mit 6 PS wurde<br />
1897 angeschafft, zwei <strong>Jahre</strong> später für das<br />
ganze Hospital eine Dampfheizung angelegt,<br />
die von einem besonderen Kesselhaus<br />
aus betrieben wurde.<br />
Ein Bericht von Dr. Ludwig Sträter<br />
aus dem <strong>Jahre</strong> 1898 vermittelt in einer<br />
Momentaufnahme ein gutes Bild der Leistungsfähigkeit<br />
des Krankenhauses nach<br />
den bis zu diesem Jahr erfolgten Um- und<br />
Ausbauten. In einem Begleitbuch zur 70.<br />
<strong>Jahre</strong>stagung deutscher Naturforscher und<br />
Ärzte in Düsseldorf beschrieb der leitende<br />
Oberarzt des Marienhospitals seine Anstalt<br />
wie folgt: „Das Hospital hat 350 Betten,<br />
die auf 24 größeren Sälen und 40 kleineren<br />
Zimmern vertheilt sind. ... Sämmtliche Krankenräume<br />
schauen nach Osten, Süden und<br />
Westen, die Corridore, die Apotheke, die<br />
Operationszimmer, eins für frische Wunden,<br />
eins für inficirte, das Laboratorium der internen<br />
Abtheilung nach Norden. Die Closets,<br />
ebenfalls nach Norden gelegen, verdienen<br />
ein besonderes Wort der Erwähnung. Sie<br />
befinden sich in 2 vom Hauptgebäude<br />
getrennten Thürmen, die in der Front des<br />
Hauses, da wo der Langbau an die Seitenflügel<br />
anstößt, ingeniös angebracht sind, so<br />
daß sie sogar dem ganzen Bau zur Zierde<br />
gereichen. Die in der Front zugewandte<br />
Hälfe der Seitenflügel, welche besondere<br />
Eingänge und Treppen haben, dient den<br />
Patienten der I. und II. Klasse. Es sind dort<br />
30 kleinere Zimmer, 18 für Herren und 12<br />
für Damen. Oberhalb des Hauptportals in<br />
der ersten Etage ist das Operationszimmer<br />
unmittelbar gegenüber dem Elevator. Dasselbe<br />
ist nach den Vorschriften der Asepsis<br />
angelegt mit Terrazzo-Fußboden, abwaschbaren<br />
Wänden, Tischen und Schränken aus<br />
Schreiben von Bewohnern der Rochusstraße (früher Hospitalstraße) an Oberbürgermeister Wilhelm Marx (06.03.1904)<br />
Gesuch der Anwohner der Hospitalstraße – vulgo „Memento mori Straße“<br />
– um Beseitigung des Leichenhauses in der Nähe der Straße und der Häuser<br />
Die unterzeichneten Anwohner der Hospitalstraße<br />
beklagen mit Recht die Nähe des<br />
Todtenhauses des Marienhospitals. Die fast<br />
täglich sich wiederholenden Beerdigungen aus<br />
dem besagten Leichenhause, das vorherige<br />
Hereinschleppen der Särge, die Besuche der<br />
Angehörigen der Verstorbenen und das damit<br />
verbundene stetige Öffnen und Schließen der<br />
Halle, die Auffahrt der Leichenwagen und die<br />
Scenen beim Leichenabholen selbst, dann<br />
das Öffnen des Todtenhauses, das Lüften<br />
und das Reinigen desselben und die damit<br />
verbundenen Ausdünstungen, alles dieses<br />
sind für einiger Maaßen fühlende Menschen,<br />
namentlich für das weibliche Geschlecht so<br />
aufregende Scenen, daß die Beseitigung der<br />
Ursachen nicht nur wünschenswerth ist, sondern<br />
von den Unterzeichneten dringend beantragt<br />
wird. Die vorgenannten fast täglich<br />
sich wiederholende Scenen – unangenehm<br />
und aufregend zugleich – können allerdings<br />
nicht ganz beseitigt, aber doch gemildert werden,<br />
wenn das unstreitig zu nahe an unseren<br />
Wohnstätten gelegene Leichenhaus beseitigt<br />
und an eine mehr verborgene Stelle des sonst<br />
so großen Complexes des Marienhospitals<br />
verlegt wird. Die vorerwähnten Übelstände<br />
erklären die große Entwerthung der Häuser<br />
der Hospitalstraße! Der Ankäufer oder der<br />
Mieter ahnt die vorerwähnten Unannehmlichkeiten<br />
nicht und wird sich derselben<br />
nach einiger Zeit bewußt. Der Verkauf und<br />
die Vermietung der Häuser ist aus diesen<br />
Gründen recht schwierig. Verschiedene Häuser<br />
sind <strong>Jahre</strong> lang unbewohnt geblieben!<br />
Erst als vor einigen <strong>Jahre</strong>n sich Mangel an<br />
Wohnungen fühlbar machte, siedelte sich die<br />
Hospitalstraße erst an. Wenn die im Inneren<br />
des Hospitalshofes stehenden hohen Bäume<br />
im Sommer wenigsten die unangenehmen<br />
Scenerien etwas verstecken, etwas mildern, so<br />
steht uns die große Unannehmlichkeit bevor,<br />
daß die Verwaltung des Marienhospitals beabsichtigt,<br />
diese Bäume zu „kappen“, wie solches<br />
bereits in der Stockkampstraße geschehen ist.<br />
Das Unterlassen dieser Veränderung sowie eine<br />
entsprechende Erhöhung der Mauer nach der<br />
Straße zu könnte die Unannehmlichkeiten zwar<br />
mindern aber nicht beseitigen und bitten wir,<br />
diese unsere Petition auf irgend eine Weise zu<br />
berücksichtigen, am geeignetesten aber durch<br />
gänzliche Beseitigung der Leichenhalle.<br />
Marienhospital, Leichenhaus, 1881<br />
59
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Röntgenabteilung,<br />
um 1930<br />
Marienhospital, Waschküche,<br />
um 1930<br />
Statut der katholischen<br />
Kranken- und Verpflegungsanstalt<br />
Marien-Hospital, 4. März 1889<br />
Marienhospital, Kesselhaus, 1899<br />
Glas und Eisen construirt. Lautenschlägers Dampfsterilisator<br />
und Schimmelbuschs Apparat zur Sodasterilisation der Instrumente<br />
sind vorhanden, ebenso ein Röntgen-Apparat. Im<br />
dritten (wirtschaftlichen) Flügel befindet sich im Erdgeschoß<br />
die sehr geräumige, auf 2 gegenüberliegenden Seiten mit je 3<br />
Fenstern versehene Küche, hinter derselben die Spülküche, im<br />
Souterrain die Waschküche, welche von einem Gasmotor von<br />
6 Pferdestärken getrieben wird. Der Motor versorgt außerdem<br />
die Wasserpumpe für den Elevator, treibt im Souterrain 2<br />
Kartoffelschäl- und Gemüseschneidemaschinen, Schleifstein<br />
und Pferdehaarzupfmaschine zum Reinigen der Matratzen, in<br />
der Küche Brot- und Fleischschneidmaschinen, Kaffeemühle<br />
und Kartoffelquetsche. Östlich vom Hauptgebäude befindet<br />
sich im Garten ein Pavillon für Infectionskrankheiten. Derselbe<br />
hat 4 größere Räume mit je 12 Betten und 2 kleinere. Der<br />
Pavillon hat 3 separate Eingänge. Westlich vom Hospital ist<br />
das Leichenhaus. Das Hospital besitzt einen großen Desinfectionsapparat,<br />
in den ganze Bettstellen gebracht werden<br />
können, welche mit strömendem Wasserdampf sterilisiert<br />
werden. ... Der Etat des Hospitals balancirt in Einnahme und<br />
Ausgabe mit circa 180000 Mark. Die Verpflegungskosten<br />
für die Kranken betragen:<br />
für die I. Klasse mit 2 Zimmern 8 Mark, für<br />
die I. Klasse mit 1 Zimmer 6 Mark, für die<br />
II. Klasse mit 1 Zimmer 4 Mark, für die III.<br />
Klasse im allgemeinen Saal 2 Mark. Der<br />
Vorstand verfügt über eine Anzahl Freibetten<br />
infolge gemachter Stiftungen. Die<br />
ärztliche Behandlung leiten 2 Oberärzte,<br />
je einer die innere und die chirurgische<br />
Abtheilung; ersterem ist ein Assistenzarzt,<br />
letzterem ein Assistenzarzt und ein Volontärarzt<br />
zugewiesen. Die Pflege wird von 38<br />
Krankenschwestern aus der Genossenschaft<br />
der Armenschwestern vom hl. Franziskus ...<br />
versehen. Außerdem sind 6 Krankenwärter<br />
an der Anstalt thätig. ... Die Anzahl der Operationen<br />
wuchs entsprechend der Zunahme<br />
der Krankenzahl, so daß in den letzten 3<br />
<strong>Jahre</strong>n durchschnittlich 750 Operationen<br />
gemacht wurden”.<br />
Statutenänderung<br />
Ende der achtziger <strong>Jahre</strong> des 19. Jahrhunderts<br />
hatte das Marienhospital ein<br />
Geschäftsvolumen erreicht, das durchaus<br />
mit einem Mittelbetrieb der Industrie und<br />
Wirtschaft vergleichbar war. Der Haushalt<br />
des <strong>Jahre</strong>s 1885 wies Einnahmen in<br />
Höhe von 123944 Mark und Ausgaben<br />
in Höhe von 105707 Mark aus. Zu den<br />
Einnahmen und Ausgaben des Hospitals<br />
kam die Verwaltung der Legate und Stiftungen,<br />
die Betreuung des Grundbesitzes<br />
und die Sorge um Kranke, Schwestern<br />
und Mitarbeiter. Wer die Verantwortung<br />
für die einzelnen Aufgabenbereiche trug,<br />
war in den Statuten vom 11. Januar 1871<br />
festgeschrieben. Nach mehr als zehn <strong>Jahre</strong>n<br />
Krankenhausbetrieb zeigte sich indes, dass<br />
60
Mariensäule und Marienhospital<br />
das Marienhospital trotz fortschreitender<br />
Geschäftsentwicklung in seiner Organisationsform,<br />
seiner Arbeitsablaufgestaltung<br />
und seiner innerbetrieblichen Organisation<br />
auf dem Stand eines Kleinunternehmens<br />
geblieben war. Um die Anstalt im Alltagsgeschäft<br />
handlungsfähig zu halten, war<br />
eine Reform der Verwaltung unumgänglich<br />
geworden. Durch Beschluss des Vorstandes<br />
und Verwaltungsrates vom 23. November<br />
1888 wurden die Paragraphen 5, 8 und 11<br />
des Statuts abgeändert und in der neuen<br />
Fassung vom Erzbischöflichen Kommissar<br />
unter dem 16. Dezember 1888 und dem<br />
Oberpräsidenten unter dem 4. März 1889<br />
genehmigt.<br />
Mit der Revision der Satzung wurde<br />
dem Vorstand, der nach wie vor jedes Jahr<br />
aus seiner Mitte den Vorsitzenden, dessen<br />
Stellvertreter, den Rendanten und den<br />
Sekretär wählte, die gesamte Verwaltung<br />
der Anstalt übertragen. Die Kontrolle über<br />
die Geschäftsführung des Vorstandes führte<br />
der Verwaltungsrat.<br />
Mariensäule und<br />
Marienhospital<br />
Am 8. Dezember 1854 verkündete Papst<br />
Pius IX. in Rom in der Bulle „Ineffabilis<br />
Deus” das Dogma der „unbefleckten Empfängnis”<br />
der Gottesmutter Maria. Nach<br />
der Verkündigung des Dogmas setzte im<br />
Erzbistum Köln, das Kardinal Johannes von<br />
Geissel 1855 unter den besonderen Schutz<br />
der Gottesmutter Maria gestellt hatte, eine<br />
lebhafte Verehrung der Immaculata ein.<br />
Angeregt durch die „Entschließung wegen<br />
der unbefleckten Empfängniß“ wurden im<br />
Bistum vielerorts Kirchen, Kapellen und<br />
Hospitäler der Immaculata gewidmet wie auch Mariensäulen<br />
errichtet.<br />
In Düsseldorf konstituierte sich am 23. Januar 1859 ein<br />
Verein, dessen alleiniger Zweck es war, „zum Andenken an<br />
die Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängniß<br />
Mariä auf einem der öffentlichen Plätze der Stadt Düsseldorf<br />
eine Marien-Säule zu errichten”. Als der Verein zur Errichtung<br />
einer Mariensäule mit der Sammlung von Beiträgen begann,<br />
ahnte niemand, dass der noch zu bestimmende Ort zur Aufstellung<br />
des Denkmals in der Bürgerschaft eine jahrelange<br />
und hitzige Debatte auslöste. Der Antrag des Marienvereins,<br />
die Mariensäule auf einem repräsentativen Platz der Stadt<br />
wie zum Beispiel dem heutigen Grabbeplatz aufstellen zu<br />
dürfen, wurde von der liberalen Mehrheit der Düsseldorfer<br />
Stadtverordnetenversammlung mehrfach abgelehnt. Erst<br />
nach 14 <strong>Jahre</strong>n leidenschaftlicher Auseinandersetzungen<br />
beugte sich der Verein dem Votum des Stadtrates und stellte<br />
die Mariensäule 1873 auf dem damals wenig beachteten<br />
Maxplatz in der Karlstadt auf, wo sie noch heute katholisches<br />
Selbstverständnis demonstriert. Die bereits 1865 vollendete<br />
Hauptfigur der Madonna war aus den Händen des Düsseldorfer<br />
Bildhauers Joseph Reiß hervorgegangen.<br />
Bereits wenige Wochen nach Gründung des Marienhospitalvereins<br />
war der Vorschlag aufgekommen, das<br />
Mariendenkmal „auf dem Vorhofe” des zu errichtenden<br />
Krankenhauses aufzustellen. „Das Bild – die Helferin der<br />
Bedrängten, die Zuflucht der Notleidenden – dürfte wohl”,<br />
so eine Zuschrift im Düsseldorfer Anzeiger vom 23. März<br />
1865, „nirgendwo passender angebracht werden können<br />
In Düsseldorf wurde im <strong>Jahre</strong> 1891<br />
mit Errichtung der Pfarrgemeinde<br />
Maria Empfängnis im südlichen<br />
Pempelfort eine Kirche der<br />
unbefleckten Empfängnis geweiht.<br />
Papst Piux IX. (1792-1878), um 1860<br />
Kardinal Johannes von Geissel<br />
(1796-1864), um 1850<br />
Maria Empfängnis, Oststraße 40,<br />
um 1915<br />
Programmblatt, 22. September 1872<br />
61
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Mariensäule,<br />
Orangerie straße/<br />
Poststraße, um 1910<br />
Wilhelm Herchenbach<br />
(1818-1889), um 1885<br />
Marienhospital,<br />
Eingangsportal, 1900<br />
und kein Platz würde sich zur Verehrung der Gottesmutter<br />
mehr empfehlen, als der Eingang zu dem Krankenhause,<br />
das ihren Namen trägt”. Der Gedanke einer Aufstellung der<br />
Säule außerhalb des eigentlichen Stadtgebietes erregte unter<br />
der Bürgerschaft großes Aufsehen. „Die Bürger Düsseldorf’s<br />
nämlich”, so ein Leser im Düsseldorfer Anzeiger vom 30. März<br />
1865, „durch deren Scherflein hauptsächlich doch das großartige<br />
Kunstwerk nahezu vollendet wurde, haben nur in dem<br />
festen Glauben dazu beigesteuert, daß dasselbe auf einem<br />
öffentlichen Platze der Stadt errichtet werden sollte ... . Auch<br />
würde kein Fremder da hinausgehen, um<br />
das Werk zu betrachten, dessen Gleichen<br />
wohl schwerlich ringsum zu finden ist; selbst<br />
der hiesige Bürger würde nur auf einem<br />
gelegentlichen Spaziergange sich an der<br />
Schönheit desselben ergötzen; somit wäre<br />
diese erhabene Kunstzierde fast ganz für<br />
die Stadt verloren“. Trotz der vorgetragenen<br />
Bedenken der Düsseldorfer Katholiken hielt<br />
die Mehrheit des Stadtrates daran fest, „die<br />
Säule aus der Stadt, draußen in’s Feld vor<br />
das Marienhospital” zu verweisen. Gegen<br />
die unnachgiebige Haltung der liberalen<br />
Stadtverordneten erhob sich Ende der<br />
sechziger <strong>Jahre</strong> unter den Katholiken der<br />
Stadt ein Sturm der Entrüstung, der in eine<br />
Petition mit 11000 Unterschriften mündete.<br />
Zu den Wortführern der Petenten gehörte<br />
Wilhelm Herchenbach, der am 26. Januar<br />
1870 in der Stadtverordnetenversammlung<br />
erklärte: „Meine Herren, hören Sie auf die<br />
Stimmen der 11000, welche das Denkmal<br />
nicht im Winkelsfelde, sondern in der Stadt<br />
haben möchten”. Der rührige Katholik gab<br />
zu bedenken, dass die räumliche Verbindung<br />
von Marienhospital und Mariensäule<br />
schon aus künstlerischen Erwägungen<br />
heraus untunlich sei. Das Marienhospital<br />
werde im gotischen Stil errichtet, während<br />
die Mariensäule romanische Züge aufweise.<br />
Nach der Flammenrede von Wilhelm Herchenbach<br />
war von einer Aufstellung der<br />
Mariensäule vor dem Marienhospital keine<br />
Rede mehr. Dessen ungeachtet fand 1870<br />
gleichwohl das Modell, nach dem Joseph<br />
Reiß die Hauptfigur für die noch aufzustellende<br />
Mariensäule angefertigt hatte, wider<br />
aller „Sünden gegen den ästhetischen Geschmack”<br />
im Vestibül des neu eröffneten<br />
Marienhospitals einen dauerhaften Platz,<br />
„wo sie als Patronin des Hauses jeden<br />
Eintretenden begrüßte”.<br />
62
Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten<br />
in Düsseldorf<br />
Kranken-, Heil- und<br />
Pflegeanstalten in<br />
Düsseldorf<br />
Als das Marienhospital in Pempelfort im<br />
<strong>Jahre</strong> 1870 seine Arbeit aufnahm, glaubten<br />
die für die medizinische Versorgung der<br />
Bevölkerung zuständigen Stellen, mit dem<br />
neueröffneten Hospital und den bereits bestehenden<br />
Anstalten die Krankenhausfrage<br />
in Düsseldorf auf viele Jahrzehnte gelöst<br />
zu haben. Niemand vermochte damals<br />
zu ahnen, dass die Errichtung der beiden<br />
konfessionellen Krankenhäuser lediglich<br />
den Beginn einer Bauwelle an Kranken-,<br />
Heil- und Pflegeanstalten in Düsseldorf<br />
markierte. Gab es mit der Eröffnung des<br />
Marienhospitals in Düsseldorf bei 70000<br />
Einwohnern drei allgemeine Krankenhäuser,<br />
so vervierfachte sich die Zahl der Anstalten<br />
in der Stadt innerhalb eines halben<br />
Jahrhunderts. Als das Marienhospital im<br />
<strong>Jahre</strong> 1920 auf seine fünfzigjährige Wirksamkeit<br />
zurückblickte, konnten die 400000<br />
Bewohner der Stadt im Krankheitsfall unter<br />
14 größeren Heilanstalten wählen.<br />
Die mit Abstand größte medizinische<br />
Einrichtung in Düsseldorf waren die Allgemeinen<br />
städtischen Krankenanstalten.<br />
Bereits am 17. August 1897 hatte die Stadtverordnetenversammlung<br />
beschlossen, ein<br />
Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft<br />
mit zunächst 300 Betten einzurichten. Von<br />
der Herzoglich Arenbergschen Verwaltung<br />
wurde in Stoffeln ein Grundstück erworben<br />
und in den <strong>Jahre</strong>n 1904 bis 1907 mit einem<br />
Kostenaufwand von rund 7 Millionen Mark<br />
bebaut. Als die Anstalten am 27. Juli 1907<br />
ihrer Bestimmung übergeben wurden,<br />
umfasste die Anlage 25 Einzelbauten mit 745 Krankenbetten,<br />
verteilt auf einer Fläche von 9 Hektar. Die Gruppe der eigentlichen<br />
Krankenhausbauten bestand aus 15 festen Gebäuden<br />
und drei Baracken, die sieben verschiedenen ärztlichen Diensten<br />
zugeordnet waren: Medizinische Klinik, Klinik für Hals-,<br />
Nasen- und Ohren-Krankheiten, Klinik für Augenheilkunde,<br />
Klinik für Kinderheilkunde, Klinik für Frauenheilkunde und<br />
Geburtshilfe, Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten,<br />
Klinik für Infektionskranke. Nach einem Rundgang über das<br />
Anstaltsgelände schrieb der Redakteur vom Düsseldorfer<br />
Tageblatt am 7. Juli 1907 über die Vorzüge der einzelnen<br />
Klinikbereiche: „Ihr Gesamteindruck ist ein überaus wohltuender;<br />
überall drängt sich dem Besucher die Überzeugung auf,<br />
daß etwas möglichst Vollkommenes geschaffen ist, daß allen<br />
Anforderungen an die moderne medizinische Wissenschaft<br />
entspricht, daß das Beste von allen Erfahrungen verwirklicht<br />
worden, die durch die medizinischen Forschungen gesammelt<br />
worden sind. Und so dürften unsere neuen Krankenanstalten<br />
vorbildlich, ja in mancher Beziehung sogar bahnbrechend<br />
werden für ähnliche Anstalten”.<br />
Allgemeine Städtische<br />
Krankenanstalten,<br />
Moorenstraße 5, 1934<br />
63
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Der Plan der Stadtverwaltung, ein eigenes Krankenhaus<br />
zu errichten, stellte den Vorstand des Marienhospitals vor<br />
die schwierige Aufgabe, das eigene Haus auf einen wirtschaftlichen<br />
Konkurrenzkampf vorzubereiten, den es unter<br />
den Düsseldorfer Heilanstalten bisher nicht gegeben hatte.<br />
Schon im Bericht für das Jahr 1908 musste der Vorstand<br />
einräumen: „Die Belegung des Hospitals mit Kranken war im<br />
<strong>Jahre</strong> 1908 schwächer als im Vorjahr. Die Zahl der Kranken<br />
betrug 2909, 1907 3602, die Zahl der geleisteten Pflegetage<br />
106875, 1907 120079. Die Ursachen dieses ... Rückgangs<br />
ist ... in der Verminderung der städtischerseits überwiesenen<br />
Armenkranken zu erblicken; sie verminderten sich von 654<br />
Personen mit 21760 Pflegetagen auf 319 Personen mit<br />
12500 Pflegetagen”. Aus naheliegenden Gründen war die<br />
Armenverwaltung darauf bedacht, auf<br />
Kosten der Stadt zu behandelnde Patienten<br />
in das kommunale Krankenhaus in Stoffeln<br />
einzuweisen. Um gegen die Allgemeinen<br />
städtischen Krankenanstalten wie auch die<br />
übrigen konfessionellen und privaten Krankenhäuser<br />
bestehen zu können, musste das<br />
Marienhospital nicht nur stetig ausgebaut<br />
und modernisiert werden, sondern auch<br />
Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen.<br />
Krankenanstalten in Düsseldorf und Umgebung, 1920<br />
Allgemeine städtische<br />
Krankenanstalten<br />
Moorenstr. 5<br />
Gründung: 1907<br />
Träger: Stadt Düsseldorf<br />
Pflege: Weltliche Schwestern<br />
Augusta-Klinik<br />
Schwanenmarkt 4<br />
Gründung: 1912<br />
Träger: Dr. Karl Josef Wederhake<br />
Pflege: Weltliche Schwestern<br />
Augusta-Krankenhaus<br />
Amalienstr. 9<br />
Gründung: 1904<br />
Träger: Töchter vom Hl. Kreuz<br />
Pflege: Töchter vom Hl. Kreuz<br />
Diakonissen-Krankenhaus<br />
Alte Landstraße 179<br />
Gründung: 1836<br />
Träger: Kaiserswerther Diakonie<br />
Pflege: Diakonissen<br />
64
Kranken‐, Heil‐ und Pflegeanstalten<br />
in Düsseldorf<br />
Krankenhaus der<br />
Dominikanerinnen<br />
Rheinallee 26/27<br />
Gründung: 1902<br />
Träger: Dominikanerinnen<br />
Pflege: Dominikanerinnen<br />
Evangelisches Krankenhaus<br />
Fürstenwall 91<br />
Gründung: 1849<br />
Träger: Kuratorium<br />
Pflege: Diakonissen<br />
Freytag-Krankenhaus<br />
Gartenstr. 15<br />
Gründung: 1919<br />
Träger: Dr. Katharine Freytag<br />
Pflege: Schwestern vom<br />
Roten Kreuz<br />
Hellendall-Klinik<br />
Elisabethstraße 39<br />
Gründung: 1901<br />
Träger: Dr. Hugo Hellendall<br />
Pflege: Katholischer Krankenfürsorgeverein<br />
vom<br />
Roten Kreuz<br />
St. Josephs-Krankenhaus<br />
Hospitalstr. 1<br />
Gründung: 1892<br />
Träger: Bürgermeisterei Benrath<br />
Pflege: Arme Dienstmägde<br />
Jesu Christi<br />
St. Josephs-Krankenhaus<br />
Kruppstr. 23<br />
Gründung: 1898<br />
Träger: Vinzentinerinnen<br />
Pflege: Vinzentinerinnen<br />
Luisenkrankenhaus<br />
Degerstr. 8/10<br />
Gründung: 1901<br />
Träger: Dr. Paul Kuliga<br />
Pflege: Weltliche Schwestern<br />
Marienhospital<br />
Sternstr. 91<br />
Gründung: 1870<br />
Träger: Kuratorium<br />
Pflege: Arme Schwestern<br />
vom Hl. Franziskus<br />
65
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marien-Krankenhaus<br />
An St. Swidbert 17<br />
Gründung: 1855<br />
Träger: Kirchengemeinde<br />
St. Suitbertus<br />
Pflege: Arme Schwestern<br />
vom Hl. Franziskus<br />
Martinuskrankenhaus<br />
Martinstr. 7<br />
Gründung: 1914<br />
Träger: Pfarrgemeinde St. Martin<br />
Pflege: Arme Dienstmägde Christi<br />
Provinzial Heil- und Pflegeanstalt<br />
Grafenberg<br />
Bergische Landstr. 2<br />
Gründung: 1876<br />
Träger: Rheinprovinz<br />
Pflege: Weltliche Schwestern<br />
Theresienhospital<br />
Stiftsplatz 13<br />
Gründung: 1832<br />
Träger: Töchter vom Hl. Kreuz<br />
Pflege: Töchter vom Hl. Kreuz<br />
Tuberkulose-Kinderheilstätte<br />
Waldesheim<br />
Stadtwaldstraße 1<br />
Gründung: 1909<br />
Träger: Landesversicherungsanstalt<br />
Rheinprovinz<br />
Pflege: Weltliche Schwestern<br />
Vinzenzhaus<br />
Schloßstr. 81/85<br />
Gründung: 1894<br />
Träger: Vinzentinerinnen<br />
Pflege: Vinzentinerinnen<br />
Westdeutsche Kieferklinik<br />
Sternstr. 35/41<br />
Gründung: 1917<br />
Träger: Verein „Westdeutsche<br />
Kieferklinik“<br />
Pflege: Weltliche Schwestern<br />
Wöchnerinnenheim<br />
Flurstraße 14<br />
Gründung: 1882<br />
Träger: Frauenverein zur<br />
Unterhaltung eines<br />
Wöchnerinnen-Asyls<br />
Pflege: Weltliche Schwestern<br />
66
<strong>Jahre</strong>sberichte<br />
<strong>Jahre</strong>sberichte<br />
Um die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig<br />
über die wirtschaftliche, organisatorische<br />
und medizinische Fortentwicklung des<br />
Marienhospitals zu unterrichten, wurden<br />
seit der Eröffnung der Allgemeinen städtischen<br />
Krankenanstalten die jährlichen<br />
Rechenschaftsberichte des Vorstandes und<br />
der ärztlichen Stationsleiter in gedruckter<br />
Form veröffentlicht und auf diese Weise<br />
einem breiteren Publikum zugänglich<br />
gemacht. Unter dem Titel „Bericht des<br />
Marienhospitals zu Düsseldorf über das Jahr<br />
1907” erschien erstmals ein broschürtes<br />
Heftchen, in dem die Verantwortlichen des<br />
Marienhospitals auf 28 Seiten Rechenschaft<br />
über ihre geleistete Arbeit im genannten<br />
Zeitraum gaben.<br />
Wie der Patientenstatistik des Marienhospitals<br />
für das Jahr 1907 zu entnehmen<br />
ist, war die Abteilung für Innere Krankheiten<br />
bei der Behandlung von Magengeschwüren<br />
außerordentlich erfolgreich. Glaubt man den<br />
Aufzeichnungen von Dr. Paul Franz Leopold<br />
Engelen, war das gute Ergebnis dem Einsatz<br />
alternativer Therapien zu verdanken. „Bei<br />
der Behandlung des Ulcus ventriculi”, so der<br />
Leiter der Abteilung für Innere Krankheiten<br />
im Marienhospital, „wurde nach dem Vorgange<br />
von Lenhartz von der meistüblichen<br />
Ziemssen-Leubeschen Ruhe- und Schonungsdiät<br />
Abstand genommen und eine<br />
möglichst konzentrierte eiweissreiche Ernährung<br />
durchgeführt. In dieser Weise sind 27<br />
Magengeschwüre, von denen mehrere mit<br />
direkt bedrohlichen Blutungen eingeliefert<br />
wurden, behandelt und geheilt worden;<br />
Misserfolge, Todesfälle, Notwendigkeit<br />
chirurgischen Eingreifens hatten wir nicht zu<br />
verzeichnen. Bei Blutbrechen oder starkem<br />
Blutgehalt des Stuhles wurde<br />
zunächst nur Eis gegeben und<br />
bei Nachlass der bedrohlichen<br />
Erscheinungen zuerst Gelatine.<br />
Wenn dann Blut nicht mehr<br />
erbrochen wurde resp. wenn<br />
der Blutgehalt des Faces nicht<br />
mehr erheblich war, wurde die<br />
Bekömmlichkeit geschlagener<br />
Eier versucht, deren Zahl pro<br />
Tag bei Tolleranz des Magens<br />
gegen diese Nahrung in schneller<br />
Folge auf 8 Stück gesteigert<br />
wurde. Baldmöglichst wurde<br />
auch rohes gehacktes Fleisch<br />
in häufigen kleinen über den<br />
ganzen Tag verteilten Portionen gereicht. Sehr bewährt<br />
hat sich als Kräftigungsmittel Tropon, das bei hochgradiger<br />
Anaemie in Form von Eisentropon gereicht wurde. Fast immer<br />
Marienhospital, <strong>Jahre</strong>sbericht, 1907<br />
Dr. Paul Engelen (1876-1945), um 1940<br />
Das Marienhospital in den <strong>Jahre</strong>n 1904 bis 1913<br />
1904 1905 1906 1907 1908<br />
Patienten - 3070 3579 3602 2909<br />
Pflegetage - 109580 120560 120079 106875<br />
Höchster Krankenstand - 375 - 370 371<br />
Niedrigster Krankenstand - 240 - 279 245<br />
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Tage) - 30,25 - 33,33 36,66<br />
Freibetten (Patienten) - 127 - 113 121<br />
Freibetten (Pflegetage) - 16424 - 20599 19023<br />
Einnahme Pflegekosten (Mark) - - 250789,85 255995,67 242964,19<br />
Ausgaben Krankenpflege (Mark) - - 239366,67 259623,67 24757,43<br />
1909 1910 1911 1912 1913<br />
Patienten 3141 3257 3950 4348 -<br />
Pflegetage 111932 111911 114427 130398 140551<br />
Höchster Krankenstand 340 339 335 411 -<br />
Niedrigster Krankenstand 282 265 292 - -<br />
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Tage) 35,66 34,5 29 - -<br />
Freibetten (Patienten) 120 132 112 114 -<br />
Freibetten (Pflegetage) 17630 17394 15118 15742 -<br />
Einnahme Pflegekosten (Mark) 261734,33 271988,86 288887,38 358485,70 -<br />
Ausgaben Krankenpflege (Mark) 253304,23 251469,89 273715,22 321953,50 -<br />
67
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Unter der Rubrik „seltene und interessante Operationen” beschreibt der Leiter der chirurgischen<br />
Abteilung, Dr. Ludwig Sträter, im <strong>Jahre</strong>sbericht 1907 einige ungewöhnliche Krankenfälle und<br />
ihre medizinische Behandlung im Marienhospital.<br />
„Volvulus. Wilhelm U., 39 <strong>Jahre</strong> alt, wurde<br />
am 9. Oktober 1907 wegen Unwegsamkeit<br />
des Darmes aufgenommen. Der Leib war<br />
hochgradig aufgetrieben und mit Flüssigkeit<br />
angefüllt. Seit etwa 8 Tagen bestand Stuhlverhaltung<br />
und zeitweiliges Erbrechen. Da von<br />
einer innerlichen Medikation ein Erfolg nicht<br />
zu erwarten stand, so erfolgte nach 2 Tagen<br />
die Laparotomie. Bei derselben entleerte sich<br />
zunächst eine große Menge serös milchiger<br />
Flüssigkeit. Ferner fand sich eine kolossale<br />
Anfüllung der Mesenterialgefäße; alle Venen<br />
waren Gänsekieldick angeschwollen. Das<br />
Hinderniß konnte zunächst nicht gefunden<br />
werden. Zweimal mußte der ganze Dünndarm<br />
hervorgeholt werden, als man endlich<br />
fand, daß das Mesenterium um seine Achse<br />
gedreht war und damit gleichzeitig der an<br />
demselben befindliche Dünndarm. Nachdem<br />
die Masse Dünndarmschlingen an die richtige<br />
Stelle umgelegt war, erfolgte die Schließung<br />
der Wunde. Der gewünschte Erfolg trat sofort<br />
ein. Die Störung der Passage war behoben, indem<br />
Gase per vias naturales entleert wurden.<br />
Im weiteren Verlaufe wurde die Heilung durch<br />
ziemlich hartnäckigen Diarrhöen verzögert.<br />
Nachdem diese durch Opiate beseitigt waren,<br />
verließ U. am 7. November 1907 geheilt das<br />
Hospital”.<br />
„Talmasche Operation wegen Lebercirrhose.<br />
Michael B., 36 <strong>Jahre</strong> alt, kam am 26. März<br />
1907 wegen hochgradiger Bauchwassersucht<br />
ins Hospital. Aus der Anamnese ging<br />
hervor, daß Patient übermäßig stark dem<br />
Alkohol ergeben war, weshalb die Diagnose<br />
auf Leberschrumpfung gestellt wurde. Bei<br />
einer zunächst vorgenommenen Punktion<br />
des Leibes wurden 8 Liter Flüssigkeit entleert,<br />
jedoch stellte sich die Wassersucht nach 14<br />
Tagen in gleich hohem Grade wieder ein.<br />
Die vorgeschlagene Operation nach Talma<br />
wurde angenommen und am 16. April 1907<br />
ausgeführt. Der Leib wurde eröffnet und das<br />
parietale Bauchfell mit dem scharten Löffel<br />
wundgemacht, hierauf das Netz mit der<br />
Bauchwand durch Matratzennähte fixiert<br />
und ein Teil desselben in die Bauchwunde<br />
eingenäht, darüber die Hautwunde vereinigt.<br />
Der Erfolg der Operation bestand darin, daß<br />
eine Ansammlung von Flüssigkeit später nicht<br />
mehr konstatiert wurde. Es wurde so durch<br />
die Talmasche Operation ein Collateralkreislauf<br />
gebildet, welcher die vorher bestandene<br />
Stauung in der Leber ausglich. Da die Operation<br />
jedoch auf die Leberschrumpfung keinen<br />
Einfluß ausübt und der Patient zudem derart<br />
dem Alkoholgenusse fröhnte, daß er sogar in<br />
der Rekonvalescenz demselben nicht entsagte,<br />
sondern stets heimlich extravagierte, so ist<br />
nicht wahrscheinlich, daß die Operation einen<br />
dauernden Erfolg haben wird. Am Tage der<br />
Entlassung, dem 8. Juni 1907 bestand eine<br />
Bauchwassersucht nicht mehr”.<br />
konnte schon nach wenigen Tagen diese<br />
etwas einförmige Diät durch Zufügen von<br />
Schleimsuppen, Milch, Sahne, Butterkügelchen<br />
etwas reichhaltiger gestaltet werden.<br />
(Zeitweise wurde ausgesetzt, um den Stuhl<br />
chemisch auf das Vorhandensein von geringen<br />
Blutmengen prüfen zu können). Bei<br />
nicht mehr blutenden Geschwüren, (d.i.<br />
wenn der Stuhl chemisch blutfrei war) wurde<br />
dann breiige Kost: Kartoffelbrei, Zwieback<br />
in Milch geweicht, Puddings, Makkaroni,<br />
Kalbshirn, gekochte und zerkleinerte Eier,<br />
sehr lange gewässerter und ganz weich<br />
gekochter Reis etc. hinzugefügt. Dann<br />
erfolgte ganz allmählich und vorsichtig tastend<br />
der Übergang zur gewöhnlichen Kost,<br />
wobei nur für lange Zeit grobe und schwer<br />
verdauliche Speisen zu meiden sind. Medikamentös<br />
wurde Wismut (durchschnittlich<br />
3 mal täglich 2 gr.) gegeben, einmal war<br />
bei sehr starker Blutung eine Adrenalin-<br />
Injektion erforderlich. Solange Blut chemisch<br />
nachweisbar war, wurde eine Eisblase auf<br />
die Magengegend appliziert, bei nicht mehr<br />
blutendem aber noch schmerzhaftem und<br />
druckempfindlichen Ulcus feuchte Wärme.<br />
Die geschilderte diätetische Therapie hat<br />
große Vorteile gegen die schon seit etwa 70<br />
<strong>Jahre</strong>n (Cruveilhier) souveräne reichlichste<br />
Milchzufuhr. Bei forcierter Milchernährung<br />
stellt sich meist recht bald ein heftiger Widerwillen<br />
gegen dieses Nahrungsmittel ein,<br />
so daß die Durchführung dieses Regimes<br />
auf großen Widerstand stößt und nicht<br />
Konfessionsstatistik Marienhospital 1905<br />
Katholische Patienten 2500<br />
Evangelische Patienten 530<br />
Jüdische Patienten 28<br />
Dissidenten 2<br />
Griechisch-katholische Patienten 1<br />
Summa 3061<br />
68
Erweiterungsbauten 1910/1912<br />
selten wegen unüberwindlicher Abneigung<br />
unmöglich ist. Bei vorzugsweiser Milchdiät<br />
erfolgt häufig eine lästige und beschwerliche<br />
Auftreibung des Leibes, die bei oben<br />
geschilderter Ernährungsweise verhindert<br />
wird. Weiter hat sich diese Diät als vorzüglich<br />
geeignet erwiesen zur Bekämpfung der bei<br />
der Entstehung des Magengeschwüres sehr<br />
einflussreichen Blutarmut. Während bei<br />
Durchführung des Ruhe- und Schonungsprinzipes<br />
die Kranken stark abmagern und<br />
erheblich entkräftet werden, können sie<br />
bei obiger Diätform nach kurzer Zeit (4-5<br />
Wochen) in blühendem und vollkräftigem<br />
Gesundheitszustand entlassen werden.<br />
Die wesentliche Kürzung der Kurdauer ist<br />
schließlich ein weiterer beachtenswerter<br />
Vorzug der jetzt angewandten Diätvorschriften.<br />
Die erreichten Erfolge sprechen aber<br />
in jeder Beziehung zugunsten der neuen<br />
diätischen Therapie”.<br />
Erweiterungsbauten<br />
1910/1912<br />
Spätestens mit Eröffnung der Allgemeinen<br />
städtischen Krankenanstalten hatte der Vorstand<br />
erkannt, dass das über dreißig <strong>Jahre</strong><br />
alte Marienhospital „in etwa rückständig<br />
geblieben war“ und dringend erweitert und<br />
modernisiert werden musste. Schon im <strong>Jahre</strong>sbericht<br />
1908 beklagte der Vorstand: „Die<br />
notwendige Erweiterung der bestehenden<br />
Räume am Marienhospital, die eine Ausgabe<br />
von weit über 100000 Mark erfordern wird,<br />
konnte im Berichtsjahre wegen anderwertiger<br />
Anforderungen nicht im erwünschten<br />
Maße gefördert werden. Doch bleibt diese<br />
Aufgabe sehr dringlich und wird nunmehr<br />
ohne Verzug der Lösung entgegengeführt“.<br />
Bis mit der Ausführung der<br />
Baupläne begonnen werden<br />
konnte, vergingen jedoch noch<br />
zwei <strong>Jahre</strong>. Nachdem im März<br />
1910 die Pläne zum Erweiterungsbau<br />
fertiggestellt waren<br />
und „die Entscheidung über<br />
deren Genehmigung durch<br />
das Entgegenkommen aller<br />
Behörden so gefördert, dass am<br />
9. Juni 1910 die Bauerlaubnis“<br />
vorlag, wurden im September<br />
1910 die Arbeiten aufgenommen<br />
und die Fertigstellung aller<br />
Erweiterungsbauten im März<br />
1912 erreicht.<br />
Die feierliche Einweihung<br />
wurde am 16. April 1912 von Prälat Johannes Kribben vorgenommen,<br />
worüber das Düsseldorfer Tageblatt am folgenden<br />
Tag berichtete: „Für das Marienhospital war der gestrige Tag<br />
ein Ehrentag. Vertreter der kirchlichen, staatlichen und städtischen<br />
Behörden und der ärztlichen Wissenschaft gedachten<br />
Marienhospital,<br />
Erweiterungsbauten, 1911<br />
Marienhospital, Rückfront mit<br />
Erweiterungsbauten von 1912,<br />
um 1935<br />
69
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Hauptfront,<br />
um 1910<br />
Marienhospital, Liegehalle<br />
der Männer, um 1930<br />
dankbar der großen Verdienste, die sich das Marienhospital<br />
während mehr als vierzig <strong>Jahre</strong> auf dem Gebiete der christlichen<br />
Caritas erworben hat. In herzlichen Worten wurde der Anstalt<br />
der Dank für ihre segensreiche Tätigkeit ausgesprochen und<br />
alle Gratulanten vereinigten sich in dem Wunsche, daß das<br />
Marienhospital in demselben Geiste weiter wirken möge wie<br />
Marienhospital,<br />
Röntgenabteilung, 1912<br />
Marienhospital, Veranda, 1912<br />
Marienhospital,<br />
Badeabteilung, 1912<br />
bisher. ... Oberbürgermeister Dr. Adalbert<br />
Oehler dankte dafür, daß ihm Gelegenheit<br />
geboten worden sei, das Marienhospital<br />
kennen zu lernen. Unter den Krankenanstalten<br />
Düsseldorfs nehme das Marienhospital<br />
eine hervorragende Stellung ein. Ströme<br />
christlicher Nächstenliebe seien von hier<br />
aus in die Bürgerschaft Düsseldorfs geflossen.<br />
... Es folgte dann eine Besichtigung<br />
der neuen Räume, deren zweckdienlichen<br />
Einrichtungen allseitig Verwunderung und<br />
Anerkennung fanden“.<br />
Mit der Planung und Bauausführung<br />
bei laufendem Krankenhausbetrieb war<br />
wieder der Architekt Caspar Clemens Pickel<br />
beauftragt. Die Kosten beliefen sich auf etwa<br />
540000 Mark, wozu noch die Auslagen<br />
für die medizinische Ausstattung und das<br />
Mobiliar hinzukamen.<br />
Nach seiner Fertigstellung im Frühjahr<br />
1912 stellte sich das Krankenhaus mit den<br />
Erweiterungsbauten als imposante dreiflügelige<br />
Anlage mit drei neuen Anbauten<br />
zur Straßenseite (Sternstraße) bzw. zum<br />
Garten (Ehrenstraße) dar. Äußerlich bot es<br />
damit an der Sternstraße schon fast das für<br />
Jahrzehnte gültige Bild des Pempelforter<br />
Marienhospitals. In einer Beschreibung, die<br />
aus Anlass der Einweihung in einer größeren<br />
Stückzahl vertrieben wurde, heißt es über<br />
die Erweiterungsbauten: „Die neuen Bauten<br />
gliedern sich in drei verschiedene Anbauten,<br />
während außerdem das alte Haus mit einem<br />
Kostenaufwand von etwa 80000 Mark zeitgemäß<br />
erneuert wurde. Zwei der Anbauten,<br />
straßenwärts der Ost- und der Westflügel<br />
enthalten 34 Zimmer I. und II. Klasse, die<br />
nach Größe und Ausstattung nunmehr<br />
auch verwöhnteren Ansprüchen Genüge<br />
leisten dürften. Doppeldecken und andere<br />
Schalldämpfungseinrichtungen, eigene<br />
elegante Badezimmer, Toiletten, Teeküchen<br />
70
Erweiterungsbauten 1914/1915<br />
und Speiseaufzüge tragen ferner dazu bei,<br />
bei diesen Stationen alle Forderungen der<br />
Bequemlichkeit und Hygiene ausgiebig zu<br />
erfüllen. Indessen haben sich unsere Privatkranken-Zimmer<br />
nicht um diese volle Zahl<br />
vermehrt, vielmehr sind 17 kleinere Zimmer<br />
durch Umbau in solche Nebenräume und in<br />
Lichtflure weggefallen. Wir werden daher<br />
auch in Zukunft, getreu dem Gedanken der<br />
Gründer unseres Hauses in der Verpflegung<br />
der minderbemittelten Klassen, insbesondere<br />
auch des Mittelstandes den Schwerpunkt<br />
unseres Betriebes legen. Zu diesem Zweck<br />
sind in den Obergeschossen des dritten<br />
Anbaues, des Ostflügels gartenwärts drei<br />
helle geräumige Stationen dritter Klasse<br />
von je etwa 20 Betten mit prächtigen,<br />
im Winter heizbaren Liegehallen, großen<br />
Fluren und dergleichen eingerichtet. Auch<br />
hier ist alles erdenkliche für die Bequemlichkeit<br />
und Hygiene geschehen, wie es<br />
auch die Angabe dartut, das im Ganzen<br />
neu hergestellt wurden: 3 Aufzüge, 13<br />
Badezimmer, 17 Toiletten, 4 Teeküchen, 9<br />
Liegehallen, 3 Balkons, 9 Fernsprechapparate<br />
usw.. Der Hauptgesichtspunkt aber, der den<br />
Gedanken des Baues leitete, war nicht die<br />
Raumvermehrung, sondern die Erfüllung<br />
der durch die Fortschritte der Chirurgie,<br />
wie der inneren Medizin gestellten Forderungen<br />
nach vollendeten Operations- und<br />
therapeutischen Einrichtungen. Deshalb sind<br />
auch die Ausmessungen des vornehmlich<br />
für sie bestimmten Ostflügels mit über 40<br />
Meter Länge, denen der andern Bauten weit<br />
voranstehend. Hier dehnt sich im Untergeschoß<br />
zunächst die therapeutische Station<br />
für die innere Abteilung aus, dahinter der<br />
Röntgensaal und die medico-mechanische<br />
Einrichtung“.<br />
Erweiterungsbauten 1914/1915<br />
Eine weitere größere Erweiterung<br />
des Marienhospitals<br />
wurde 1914/15 mit dem Ausbau<br />
der Wirtschaftsräume, der<br />
Wohnungen für die Hausangestellten<br />
und der Klausur für die<br />
Pflegeschwestern vorgenommen.<br />
Schon 1884 war der dem<br />
Eingang gegenüberliegende<br />
Südflügel zur Einrichtung neuer<br />
Wohnräume für die Schwestern<br />
erhöht worden. Kurz vor<br />
Ausbruch des Ersten Weltkrieges<br />
erweiterte man diesen Flügel<br />
erneut, so dass er an Höhe<br />
und Tiefe dem östlichen Südflügel<br />
fast gleichkam. Wie der<br />
Hauschronik zu entnehmen<br />
ist, waren die vom Architekten<br />
Caspar Clemens Pickel betreuten<br />
Erweiterungsbauten, zu<br />
denen am 31. Mai 1914 der<br />
Grundstein gelegt wurde, Ende<br />
des <strong>Jahre</strong>s im Rohbau fertig gestellt<br />
und konnten im Sommer<br />
1915 in Benutzung genommen<br />
werden. Neben der Errichtung<br />
des neuen Schwesternhauses<br />
mit Spülküche, Bügel- und<br />
Mangelraum wurde im Zuge<br />
der Erweiterungsmaßnahmen<br />
auch das Maschinenhaus<br />
umgebaut, wo ein neuer<br />
Doppelkessel und eine Desinfektionsanlage<br />
ihren Platz<br />
fanden. Die Ordenschronik der<br />
Pflegeschwestern berichtete<br />
zur Fertigstellung der Erweiterungsbauten:<br />
„Am 6. April<br />
Marienhospital,<br />
Maschinenhaus, um 1930<br />
Marienhospital,<br />
Erweiterungsbauten, 1914<br />
Marienhospital,<br />
Mangelraum, um 1930<br />
71
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital,<br />
Bügelraum, um 1930<br />
Marienhospital,<br />
Erweiterungsbauten, 1914<br />
Paulushaus, Luisenstraße 33,<br />
um 1915<br />
konnten die ersten 4 Zellen der<br />
III. Etage, und am 13. Mai 1915<br />
dem Feste Christi Himmelfahrt<br />
das schöne neue Refectorium<br />
mit den anliegenden Räumen<br />
benutzt werden. ... Der Umbau<br />
des Klausurflügels erstreckt<br />
sich hauptsächlich auf die<br />
Schlafzellen der Schwestern<br />
und des Dienstpersonals. Nach<br />
baupolizeilicher Verordnung<br />
mußten die alten Gänge verbreitert und mit einem Lichtflur<br />
versehen werden, wodurch mehrere Räume in Wegfall kamen.<br />
Das Dachgeschoß durfte nur mehr Räume nach einer Seite<br />
hin haben. Ende Mai konnten sämtliche Zellen, Zimmer und<br />
Wirtschaftsräume fertig bezogen werden. Das Mangelzimmer<br />
wurde durch einen hydraulischen Wäscheaufzug mit dem<br />
Leinwandzimmer verbunden, und im Bügelzimmer ein elektrischer<br />
Bügelofen angelegt. Durch die in den letzten <strong>Jahre</strong>n<br />
vorgenommenen Umänderungen und Neueinrichtungen<br />
kamen auch eine Anzahl elektrischer Motoren in Aufstellung<br />
und setzten nunmehr 21 ... Maschinen und Apparate<br />
in Bewegung“.<br />
Kriegsbegeisterung<br />
Der Erste Weltkrieg brachte für den Düsseldorfer Katholizismus<br />
mannigfache Belastungsproben. An der Kriegsbegeisterung,<br />
die im August<br />
1914 die Massen im ganzen<br />
Land ergriff, hatte er vollen<br />
Anteil. Überzeugt von der Notwendigkeit,<br />
das Vaterland zu<br />
verteidigen, das ihnen zu Unrecht<br />
angegriffen schien, galt<br />
den Katholiken der Krieg als<br />
gerecht, und viele sahen auch<br />
kein Hindernis, nach einem<br />
deutschen Sieg weitgehende<br />
Gewinne an Land und Gut vom<br />
niedergeworfenen Gegner zu<br />
fordern. Zwei Tage vor der Kriegserklärung<br />
Österreich-Ungarns an Serbien am 28. Juli<br />
1914 fand im Paulushaus (Luisenstr. 33)<br />
eine Versammlung des „Vereins christlicher<br />
Arbeiter und Handwerker“ statt, die in charakteristischer<br />
Weise die Stimmung unter<br />
den Düsseldorfer Katholiken widerspiegelt.<br />
Ein Bericht des Düsseldorfer Tageblatts gibt<br />
die Ansprache des Gastredners Pfarrer Johann<br />
Adenauer (St. Joseph, Rath) mit den<br />
Worten wieder: „Tiefe Ruhe herrschte im<br />
Saale, als Herr Pfarrer Adenauer mit fester<br />
begeisterter Stimme fortfuhr: ‚Die Zeit ist<br />
ernst! Die Zeit ist schwer! Bange Sorgen<br />
birgt die nächste Zukunft. Die Gefahr des<br />
Krieges schwebt über uns, und es gilt harte<br />
Opfer zu bringen. Wir geben sie gern,<br />
und wenn auch bange Sorgen die Zurückbleibenden<br />
erfüllen, es gilt weit mehr: es<br />
gilt die Verteidigung des Vaterlandes. Da<br />
wollen wir beweisen, daß wir treue Söhne<br />
des Reiches sind, und beweisen, daß<br />
der Schimpf vaterlandsloser Gesinnung<br />
ein ruchloses Geschwätz unserer Gegner<br />
ist. ... Hierbei stärkt uns unser Glaube,<br />
und Gott in den Himmeln wird uns die<br />
Wege weisen. Ihm stets zugetan und seiner<br />
heiligen Kirche. So sei es!‘ Eine wahre<br />
Begeisterung toste durch den Saal, als der<br />
Redner geendet. Herr Meyer forderte alle<br />
auf zu dem patriotischen Lied: ‚Es braust<br />
ein Ruf wie Donnerhall‘, das stürmisch zu<br />
Ende gesungen wurde“.<br />
Als vier Tage später in Berlin die Nachricht<br />
von der russischen Mobilmachung<br />
eintraf, erklärte die deutsche Regierung<br />
gemäß Artikel 68 der Reichsverfassung den<br />
„Zustand drohender Kriegsgefahr“, von<br />
dem die Düsseldorfer Bevölkerung noch<br />
am gleichen Abend durch Anschlagzettel<br />
unterrichtet wurde.<br />
72
Kriegsbegeisterung<br />
Neben Oberbürgermeister Adalbert Oehler,<br />
der mit einem Aufruf „An meine Mitbürger“<br />
alle Zweifel an einer ausreichenden<br />
Lebensmittelversorgung zerstreuen wollte,<br />
gab am gleichen Tag auch das „Pfarrkapitel<br />
der Stadt Düsseldorf“ eine Erklärung „An<br />
die katholischen Krieger“ heraus: „Noch<br />
ist die Mobilmachung der gesamten Landund<br />
Seemacht nicht erfolgt: aber wenn sie<br />
erfolgt ist, dann wird die Eröffnung der<br />
Feindseligkeiten nicht mehr lange auf sich<br />
warten lassen. Was die Zukunft bringen<br />
wird, Gott mag es wissen. Hoffen wir zuversichtlich,<br />
daß er, der 1870/71 die Waffen<br />
der Väter gesegnet hat, auch 1914 uns als<br />
Alliierter zur Seite steht. Das eine ist aber<br />
sicher, der Erfolg hängt zum guten Teil ab<br />
von der moralischen Kriegsbereitschaft. Aus<br />
dieser Erwägung heraus richtet das Pfarrkapitel<br />
der Stadt Düsseldorf folgenden Aufruf<br />
an die katholischen Krieger: Katholische<br />
Krieger! Der Kaiser ruft Euch zur Fahne;<br />
vielleicht werdet Ihr bald für das Wohl des<br />
Vaterlandes kämpfen müssen. Deutsche<br />
Tapferkeit und deutschen Heldenmut könnt<br />
Ihr um so herrlicher erweisen, wenn Ihr<br />
Euch im Frieden mit Gott, dem Lenker der<br />
Schlachten, wißt. Schaut Ihr dann nicht<br />
um so kühner den Gefahren des Krieges,<br />
selbst dem Tode, ins Auge? Darum empfanget<br />
die hl. Sakramente, ehe Ihr einrückt.<br />
Gelegenheit zur Beichte ist an allen Tagen<br />
in allen Kirchen der Stadt, zu jeder Zeit!“.<br />
Was jedermann ahnte, trat am Nachmittag<br />
bzw. Abend des 1. August 1914<br />
ein: In Deutschland wurde die allgemeine<br />
Mobilmachung der gesamten Streitkräfte<br />
angeordnet und Russland der Krieg erklärt.<br />
Da sich Deutschland stark genug für<br />
einen Zweifrontenkrieg fühlte, scheute es<br />
nicht davor zurück, am 3. August 1914<br />
auch Frankreich den Krieg zu erklären.<br />
In der vaterländischen Begeisterung der ersten Augusttage<br />
schien es für einen Augenblick, als seien die inneren Parteiungen<br />
der deutschen Gesellschaft überwunden. Der weit<br />
verbreiteten Stimmung gab das Düsseldorfer Tageblatt vom<br />
gleichen Tag mit den Worten Ausdruck: „Deutschlands Heer<br />
ist ein Volksheer: zu den Waffen eilen die Männer aus den<br />
Fabriken und Kontoren, die wetterharten Bauernsöhne und<br />
die Akademiker, es gilt kein Ansehen von Person und Stand.<br />
Nebeneinander als Waffenbrüder stehen sie im Glied, bieten<br />
die Brust dem Feind, wissen, daß auch die feindliche Kugel<br />
nicht nach Stand und Rang fragt, ja den Offizier lieber sucht<br />
als den gemeinen Mann. Und der Krieg, den wir nicht zum<br />
Angriff, sondern zur Verteidigung führen, ist ein Volkskrieg.<br />
... Wer heute durch die Straßen unserer Stadt wanderte, dem<br />
mußten Freudentränen ins Auge treten. Welch wunderbare<br />
Ruhe und Entschlossenheit! Eine Kundgebung deutscher<br />
Tatkraft, die jedes Deutschen<br />
Herz mit Stolz erfüllt. ... Es gibt<br />
keinen politischen, keinen sozialen<br />
Kampf mehr; die sich<br />
vordem in bitterer Fehde entgegenstanden,<br />
kennen jetzt<br />
nur noch die freudige Pflicht,<br />
die die gemeinsame Not, die<br />
Sorge um die höchsten idealen<br />
Güter gebiert, kennen nur<br />
noch das stolze Bewußtsein,<br />
daß wir alle Deutsche sind. ...<br />
Und wir hoffen, daß der Sieg,<br />
den Gott unserer gerechten<br />
Sache schenken möge, nicht<br />
nur unserem Volke Freiheit und<br />
Macht sichern wird, sondern<br />
auch durch die Not des Krieges<br />
ihm eine Wiedergeburt und<br />
innerer Festigung bescheren<br />
wird. ... Und so vereinen wir<br />
unsern Rufe mit dem Rufe unserer<br />
Krieger: Gott mit uns! Es<br />
lebe der Kaiser!“.<br />
Düsseldorfer Generalanzeiger,<br />
1. August 1914<br />
Hauptbahnhof, Mobilmachung, 1914<br />
Ratinger Tor, Mobilmachung, 1914<br />
73
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marktstraße 7,<br />
Kartoffelgeschäft, um 1915<br />
Brotkarte, 1915<br />
Rathaus, Zentralstelle für freiwillige<br />
Liebestätigkeit, um 1915<br />
Ritterstraße, Liebesgaben-<br />
Sammelstelle, um 1915<br />
Kriegsfolgen für Düsseldorf<br />
Der „Hurra-Patriotismus“ der ersten Kriegstage war nicht von<br />
langer Dauer und wurde schon bald von drückenden Sorgen<br />
des Kriegsalltages verdrängt. Da Deutschland im <strong>Jahre</strong> 1914<br />
nur auf eine kurze Kriegsdauer eingestellt war, wurde für<br />
den Großteil der Bevölkerung die mangelnde wirtschaftliche<br />
Vorsorge besonders in der bald einsetzenden Lebensmittelverknappung<br />
spürbar. Verbitterung und Ressentiments<br />
lösten im Gefolge des Hungers die innere Geschlossenheit,<br />
die das deutsche Volk in den ersten Kriegsmonaten gezeigt<br />
hatte, allmählich auf. In Düsseldorf wurde schon am 2. August<br />
1914 beschlossen, „alle größeren Vorräte an Getreide,<br />
Mehl, Futter, die in den großen Mühlen des Bezirks oder<br />
auf Rheinschiffen unterwegs waren“, aufzukaufen. „Die<br />
Stadt Düsseldorf erwarb so 30000 Zentner<br />
Weizen, 20000 Zentner Roggenmehl, 305<br />
Eisenbahnwagen Roggenschrot, 4000 Sack<br />
Reis und Graupen, die mit Schiffen von<br />
Holland kamen, mehrere Eisenbahnwagen<br />
Nudeln und Schmalz. Die Stadt richtete<br />
auch sofort 7 Verkaufsstellen ein, in denen<br />
nur an die Verbraucher zu den von der Stadt<br />
vorgeschriebenen Preisen verkauft wurde“.<br />
Wie überall in Deutschland, so wurde auch<br />
in Düsseldorf im März 1915 die Brotkarte<br />
als erste Maßnahme zur Zwangsbewirtschaftung<br />
der Lebensmittel eingeführt.<br />
Später traten noch Butter-, Fett- Fleisch-,<br />
Kartoffel-, Zucker- und Eierkarten sowie<br />
eine Karte für sonstige Lebensmittel hinzu.<br />
Seit dem <strong>Jahre</strong> 1916 war das Anstehen<br />
vor Lebensmittelgeschäften in Düsseldorf<br />
ein gewohntes Bild. Im Steckrübenwinter<br />
1916/17 stand Milch nur noch Kindern<br />
und Kranken zur Verfügung. Als von der<br />
Stadt im Frühjahr 1917 nahezu keine Kartoffeln<br />
ausgegeben wurden, hatte dies<br />
zur Folge, dass Mangelerscheinungen und<br />
Unterernährung zunahmen. Verschlimmert<br />
wurde die Ernährungsmisere durch den<br />
Mangel an Heizmaterial. Viele Dinge des<br />
alltäglichen Lebens waren nur noch über<br />
den Schleichhandel zu erhalten.<br />
Zentralstelle<br />
für freiwillige<br />
Liebestätigkeit<br />
In den <strong>Jahre</strong>n 1914 bis 1918 war fast jede<br />
vierte Düsseldorfer Familie auf Kriegsunterstützung<br />
angewiesen. Glaubt man den<br />
Worten des Düsseldorfer Oberbürgermeisters<br />
Adalbert Oehler (1911‐1919), wollten<br />
74
Lazarette<br />
vom ersten Kriegstage an, „alle helfen<br />
und sich nützlich machen“. Zum Rathaus<br />
seien Tausende geströmt, „um ihre Hilfe<br />
oder die Hilfe ihrer Vereine anzubieten“.<br />
Um den Freiwilligen „den Weg zu zeigen,<br />
wie alle diese Kräfte in geregelter und<br />
geordneter Weise für die vielen Aufgaben<br />
... nutzbar zu machen“ waren, wurde am<br />
3. August 1914 in den Zeitungen unter<br />
der Überschrift „Düsseldorfs Frauen und<br />
Mädchen!“ folgender Aufruf veröffentlicht:<br />
„In dieser ernsten Stunde sind viele<br />
Hände bereit, zu helfen. Damit diese Hilfe<br />
nicht zersplittert, sondern wirksam an all<br />
die, denen sie gilt, herangebracht werden<br />
kann, ist ein Zusammenschluß unerläßlich.<br />
Heute früh hat sich zu diesem Zweck, zusammengefaßt<br />
unter dem Zweigverein vom<br />
Roten Kreuz für den Stadtkreis Düsseldorf<br />
und dem Vaterländischen Frauenverein für<br />
den Stadtkreis Düsseldorf und der Stadtverwaltung<br />
Düsseldorf, eine Zentrale für die<br />
gesamte freiwillige Liebestätigkeit am Orte<br />
gebildet. Wir bitten dringend alle, die helfen<br />
wollen, Vereine sowohl wie Private, sich<br />
dieser Zentrale anzuschließen und ihre Einrichtungen<br />
und Hilfskräfte zur Verfügung<br />
zu stellen“. Das Büro für die Zentralstelle<br />
für freiwillige Liebestätigkeit wurde im<br />
Düsseldorfer Rathaus eingerichtet.<br />
Der Aufruf genügte, so Oberbürgermeister<br />
Adalbert Oehler, „um eine kaum<br />
absehbare Schar von weiblichen Hilfskräften<br />
zum Rathause zu führen“. Der Andrang<br />
„von der greisen Witwe bis zum gerade<br />
der Schule entwachsenen Mädchen“ war<br />
so groß, dass die Zahl der Helferinnen<br />
zunächst auf 3000 beschränkt werden<br />
musste. Um zu erreichen, „daß jede Aufgabe,<br />
die irgendwie auftauchte, ihre Lösung<br />
fand, daß eine bestimmte Stelle oder<br />
eine Mehrheit von Kräften dafür bestimmt<br />
wurde, die Verantwortung hatte, aber auch<br />
die Mittel dafür erhielt, daß andererseits nicht<br />
auf demselben Gebiet, bei derselben Aufgabe<br />
gleichzeitig mehrere nebeneinander oder auch<br />
gegeneinander arbeiteten“, wurde für die<br />
„Zentralstelle für freiwillige Liebestätigkeit“<br />
sofort ein straffer Arbeits‐ und Organisationsplan<br />
entwickelt.<br />
Lazarette<br />
Neben staatlichen und kommunalen Stellen<br />
waren in Düsseldorf für die Errichtung und<br />
Versorgung der Reservelazarette das Rote<br />
Kreuz und der Vaterländische Frauenverein<br />
verantwortlich. Ursprünglich hatten diese den<br />
Aufbau eines zentralen Reservelazarettes in<br />
der städtischen Tonhalle (Schadowstr. 89/93)<br />
vorgesehen, doch wäre damit der Stadt die<br />
einzige größere Versammlungsstätte entzogen<br />
worden. „Die Zentralstelle für freiwillige Liebestätigkeit“,<br />
so berichtet Oberbürgermeister<br />
Gerresheim, Volksküche, um 1915<br />
Graf-Adolf-Straße, Verpflegungsstation, um 1915<br />
Hauptbahnhof, um 1915<br />
Tonhalle, Schadowstraße 89/93, um 1925<br />
Hauptbahnhof, um 1915<br />
75
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Bilker Allee, Floragarten, um 1910<br />
Katholisches Gesellenhaus,<br />
Bilker Straße 36/42, um 1910<br />
Katholisches Gesellenhaus,<br />
Birkenstraße 14, um 1920<br />
Katholisches Gesellenhaus,<br />
Blücherstraße 4/8, um 1920<br />
Bilker Bahnhof, Lazarettzug,<br />
um 1915<br />
Adalbert Oehler, „mit der die Vereine vom Roten Kreuz sich<br />
zusammengetan hatten, kam nicht in Verlegenheit. Es fanden<br />
sich sofort ausreichende Anstalten und Räume zur Errichtung<br />
von Reservelazaretten, vor allem die großen öffentlichen<br />
Krankenanstalten, die einen Teil ihrer Betten und ihre ganze<br />
Einrichtung nebst Personal hierfür zur Verfügung stellten;<br />
auch andere geeignete Räume konnten hierfür verwendet und<br />
eingerichtet werden“. Zur Disposition standen vor allem jene<br />
Gebäude, für die es in der Kriegszeit keine Verwendung gab<br />
wie dem Jägerhaus (Grafenberg), der Rheinlust (Oberkassel),<br />
dem Ausstellungspalast (Pempelfort), der Flora (Bilk) oder<br />
den Hospizen des Katholischen Gesellenvereins (Karlstadt,<br />
Flingern, Derendorf). Neben den unter militärischer Leitung<br />
stehenden Reservelazaretten konnte die Zentralstelle für<br />
freiwillige Liebestätigkeit eine Vielzahl von Vereinslazaretten<br />
einrichten, die gleichfalls unter ständiger militärischer und<br />
ärztlicher Aufsicht mit geschultem Pflegepersonal standen.<br />
Meist handelte es sich um kleinere Pflegestätten mit geringer<br />
Bettenzahl, die hauptsächlich der Versorgung von Leichtverwundeten<br />
und Genesenden dienten. Insgesamt war das<br />
Angebot an Pflegeplätzen in allen Kriegsjahren größer als der<br />
Bedarf. Die Folge war, dass viele zumeist aus patriotischem<br />
Überschwang eingerichtete Pflegestätten noch vor Kriegsende<br />
aufgelöst wurden. Soweit die Einrichtung der Lazarette nicht<br />
auf Kosten einzelner Spender erfolgte, übernahm es die Zentralstelle<br />
für freiwillige Liebestätigkeit, „die Lazarette entsprechend<br />
einzurichten, die Betten, Geräte, nötigenfalls, sonstige<br />
gesundheitliche Anlagen, auf ihre Kosten zu beschaffen, die<br />
nötigen Arzneien und Verbandsmittel zu<br />
liefern, die Pflegekräfte zu stellen, mit den<br />
Ärzten Verträge abzuschließen, auch mit<br />
den Inhabern des betreffenden Hauses oder<br />
sonstigen opferwilligen Persönlichkeiten,<br />
die die Verwaltung eines solchen Lazarettes<br />
zu übernehmen sich bereit fanden, welche<br />
Vergütung für die Beköstigung auf den<br />
Kopf und Tag zu zahlen sei“.<br />
Ende des ersten Kriegsmonats waren<br />
in den Düsseldorfer Lazaretten bereits mehr<br />
als 2500 Verwundete untergebracht. Am<br />
12. September 1914 standen 7100 Betten<br />
zur Verfügung; kurze Zeit später war<br />
mit 8000 Pflegeplätzen die höchste Zahl<br />
verfügbarer Betten erreicht. In den <strong>Jahre</strong>n<br />
1914 bis 1918 wurden in 53 Lazaretten und<br />
Privatpflegestätten der Stadt und in 16 Lazaretten<br />
in den Gemeinden des Landkreises<br />
Düsseldorf mehr als 113500 verwundete<br />
und kranke Soldaten versorgt. Nach einer<br />
Aufstellung von Oberbürgermeister Adalbert<br />
Oehler waren von den 53 Düsseldorfer<br />
Lazaretten 16 in katholischen Anstalten<br />
und Einrichtungen untergebracht.<br />
Zu Beginn des Krieges war die Verteilung<br />
der verwundeten Soldaten, die<br />
am Bahnhof Bilk eintrafen und von hier<br />
mit speziell zum Krankentransport umgerüsteten<br />
Straßenbahnen weitergeleitet<br />
wurden, ohne System. Erst im Laufe der<br />
Zeit spezialisierten sich die Lazarette auf<br />
die Behandlung bestimmter Schwerverwundeter.<br />
So war im Marienhospital ein<br />
psychologisches Laboratorium zur Erforschung<br />
traumatischer Neurosen und eine<br />
Spezialabteilung der peripheren Nervenverletzungen<br />
eingerichtet worden. Erblindete<br />
Soldaten wurden im Lazarett des katholischen<br />
Knabenwaisenhauses in Oberbilk<br />
behandelt.<br />
76
Kriegsfürsorge des<br />
Marienhospitals<br />
Kriegsfürsorge des<br />
Marienhospitals<br />
Zu den ersten Düsseldorfer Krankenhäusern,<br />
die der Militärverwaltung ihre Räumlichkeiten<br />
für Lazarettzwecke anboten,<br />
gehörte das Krankenhaus Marienhospital in<br />
Pempelfort. Patienten, deren Gesundheitszustand<br />
es erlaubte, wurden nach Hause<br />
entlassen und die Aufnahme neuer Kranker<br />
stark beschränkt. Der Militärbehörde<br />
wurden bei Ausbruch der Feindseligkeiten<br />
sofort 90 Betten überlassen, deren Zahl sich<br />
in wenigen Wochen auf 250 erhöhte. Nach<br />
einem Bericht des Düsseldorfer Tageblatts<br />
vom 29. Oktober 1914 konnten von den<br />
eingelieferten Verwundeten 15 Prozent<br />
dienstfähig entlassen und 55 Prozent in<br />
Reservelazarette überwiesen werden;<br />
2,3 Prozent starben. „Wie schon im Kriege<br />
1870 der Ruf des Hauses sich bewährte auf<br />
vielfache Art“, so der Berichterstatter des<br />
Tageblatts weiter, „so auch jetzt. Rührend<br />
ist oft die Dankbarkeit der Entlassenen und<br />
manchmal hörte Schreiber der Zeilen das<br />
deutsche Wort: Hier sieht man doch, wofür<br />
die Klöster gut sind. Über den Kranken<br />
schwebt einher der Geist echt christlicher<br />
Liebe. Von draußen wurden Liebesgaben<br />
aller Art von Freunden und Gönnern des<br />
Hospitals gebracht. Gesangschöre aus der<br />
Stadt wetteifern durch ernste und heitere<br />
Lieder die Tapferen zu erfreuen. ... Alles,<br />
was das Menschenherz in schwerer Zeit<br />
aufrichten kann“.<br />
Über die Vorgänge und Ereignisse im<br />
Marienhospital im Laufe des ersten Kriegsjahres<br />
berichtet die Chronik der Armenschwestern<br />
vom Heiligen Franziskus:<br />
„Die Parterre gelegene erste Frauen-Station<br />
und zwei Privatabteilungen mußten<br />
geräumt und für Belegung der<br />
Verwundeten benutzt werden,<br />
da alleine die Männer-Stationen<br />
nicht ausreichten; denn es<br />
mußte wegen der Krankenkassen<br />
auch eine Anzahl von Civilpersonen<br />
aufgenommen<br />
werden können. Eine große<br />
Wohlthäterin des Hauses<br />
schenkte sofort eine bedeutende<br />
Geldsumme zur Beschaffung<br />
von 18 eisernen Bettgestellen,<br />
wozu gleich die<br />
erforderlichen Einlagen angefertigt<br />
wurden; dieselben wurden für die Zimmer der Privatabtheilungen<br />
... benutzt. Herr Chefarzt Dr. Franz Kudlek<br />
wurde gleich mit 4 Assistenzärzten ins Feld berufen. Herr Dr.<br />
Alex Max Florange aus Crefeld, der früher lange <strong>Jahre</strong> (1901-<br />
1913) am Hospital tätig war, und trotz seiner mehrjährigen<br />
Abwesenheit dem Hause seine wohlwollende Gesinnung<br />
namentlich den Schwestern gegenüber stets bewiesen, bot<br />
sofort seine Hülfe als freiwilliger Arzt an, was vom Vorstande<br />
und den Vorgesetzten mit großem Dank und Freude<br />
Freistellungsbescheid<br />
für Dr. Franz Kudlek,<br />
14. Oktober 1915<br />
Marienhospital,<br />
Lazarettraum, um 1915<br />
77
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital,<br />
Verwundetenfürsorge,<br />
um 1915<br />
angenommen wurde. Ohne jede Vergütung hat Herr Dr.<br />
Florange seine Zeit und seine Kräfte dem Hospital gewidmet;<br />
täglich mußte er von Crefeld nach hier kommen, da dort<br />
seine Anwesenheit auch notwendig war. Ferner wurde<br />
Stabsarzt Herr Sanitätsrat Dr. Hermann Becker von hier zum<br />
Lazarettdienste von der Militärbehörde kommandiert. Auch<br />
eine unserer Schwestern, die Schwester Hieronyma, erhielt<br />
von der Würdigen Mutter aus Aachen die Aufforderung mit<br />
noch 14 anderen Schwestern der Genossenschaft, auf dem<br />
Schlachtfelde bzw. Kriegslazaretten zur Ehre Gottes und Wohl<br />
des Vaterlandes der armen Verwundeten zu pflegen. Bereitwillig<br />
und opferfreudig kam Schwester Hieronyma dem<br />
Wunsche der Würdigen Mutter nach. Zuerst übten die<br />
Schwestern ihre Tätigkeit in einem Lazarett in Luxemburg<br />
aus; nach einigen Monaten in einem Lazarett in Vouziers in<br />
Frankreich. Sofort bei Beginn der Feindseligkeiten wurden in<br />
vier getrennten Abteilungen 76 Damen und 28 Herren theoretisch<br />
und praktisch unter Leitung der Herren: Dr. Paul<br />
Franz Leopold Engelen, Dr. Klemens Zumbroich und Dr. Emil<br />
Hesse in der Krankenpflege ausgebildet. Der Eifer im Lernen<br />
wurde durch die patriotische Begeisterung noch gehoben,<br />
und in kurzer Zeit konnte die Prüfung mit<br />
gutem Erfolg in Gegenwart der Frau Regierungspräsident<br />
Francis Kruse, bzw. des<br />
Herrn Medizinalrates Dr. Franz Schrakamp<br />
abgelegt werden. Auch ein gutbesuchter<br />
Röntgenkursus wurde erteilt. Auf Veranlassung<br />
der Frau von Weise wurden am 5.<br />
September von der Stadt Düsseldorf fünf<br />
dieser ausgebildeten Helferinnen zur Gründung<br />
einer Sammelstelle für Verwundete<br />
nach Maubeuge gesandt; der ersten dieser<br />
Einrichtung auf französischem Boden. Nach<br />
Beendigung der Lehrkurse blieben 18 Damen<br />
und 5 Herren während des Krieges<br />
als freiwillige Helferinnen bzw. Helfer im<br />
Marien-Hospital tätig. Am 12. August erhielten<br />
wir die ersten Verwundeten. Nachdem<br />
anfangs meist Fußkranke zur Aufnahme<br />
geschickt wurden, hat sich dies auf<br />
ärztliche Vorstellung hin bald geändert, so<br />
daß nach einigen Wochen eine große Zahl<br />
Schwerstverwundeter, je nach Eintreffen<br />
der Transportzügen, Aufnahme fanden.<br />
Wie schon im Kriege 1870-71 der Ruf des<br />
Hauses sich bewährte auf vielfache Art, so<br />
nahm das Marien-Hospital als größtes<br />
katholisches Krankenhaus Düsseldorfs auch<br />
in dieser ernsten Zeit einen regen Anteil an<br />
der Linderung der Wunden, die der Krieg<br />
geschlagen. Rührend war oft die Geduld<br />
und Dankbarkeit der armen Helden; unter<br />
denselben herrschte durchweg eine heitere,<br />
zufriedene Stimmung. Liebesgaben<br />
aller Art und Menge wurden von Freunden<br />
und Gönnern des Hospitals gebracht; das<br />
in jederweise freundliche Entgegenkommen<br />
der Centralstelle der freiwilligen Liebestätigkeit<br />
muß gleichfalls dankend anerkannt<br />
werden. Gesangchöre aus der<br />
Stadt wetteiferten durch ernste und heitere<br />
Lieder die Tapferen zu erfreuen. Die<br />
Künstlervereine, sowie Herr Brockerhof<br />
78
Kriegsfürsorge des<br />
Marienhospitals<br />
veranstalteten manchen musikalischen<br />
Abend, und verstand letzterer es besonders<br />
den armen Verwundeten wiederholt recht<br />
unterhaltende und fröhliche Stunden zu<br />
bereiten. Liebesgabenlotterien, Lichtbildervorträge<br />
usw. wurden abwechselnd geboten.<br />
Auch wurde gestattet, daß an den<br />
Sonntagen evangelischer Gottesdienst, in<br />
einem der Tagesräume, gehalten wurde.<br />
Alles, was das arme Menschenherz in<br />
schwerer Zeit aufrichtet. St. Nikolaus kam<br />
und an zwei Abenden bedachte der hl.<br />
Mann seine tapferen Krieger. Am Nikolausabend<br />
war die übliche Feier wie in sonstigen<br />
<strong>Jahre</strong>n; doch für viele Kranke eine neue<br />
unbekannte Feier. St. Nikolaus von Knecht<br />
Ruprecht und einem ‚vierfüßigen‘ Feldgrauen<br />
begleitet, zog unter Gesang in feierlichem<br />
Zuge von Saal zu Saal durchs ganze<br />
Haus, jedem seine Gaben, ein Teller Süßigkeiten,<br />
spendend; gewürzt mit einigen<br />
Worten des Trostes und der Erheiterung.<br />
Nach einigen Abenden erschien St. Nikolaus<br />
wieder, begleitet von 20 kleinen Zwergen<br />
und Husaren, dazu noch eine große<br />
Schar, ca. 300 kleinere und größere Schülerinnen<br />
des Lyceums vom armen Kinde<br />
Jesus (Prinz-Georg-Str. 2), reich beladen<br />
mit großen Körben voller Gaben für die<br />
Krieger. Es war eine große Freude und<br />
Überraschung; St. Nikolaus ließ seine Gaben<br />
durch die Zwerge und kleinen Husaren<br />
verteilen. Jeder Kranke erhielt ein hübsch<br />
fein hergerichtetes Paketchen mit einliegendem<br />
Verschen oder Briefchen der Schülerinnen,<br />
die es sich zur größten Freude<br />
gemacht, für die Liebespaketchen zu sorgen.<br />
Die Waisenkinder dieser Anstalt, die<br />
auch teilweise an der Bescherung teilgenommen,<br />
sangen zur größten Freude der<br />
Soldaten mehrstimmige Lieder. So verlief<br />
dieser Abend in der schönsten Weise, und<br />
Geber und Empfänger waren hochbeglückt. Obgleich man<br />
in diesen traurigen Kriegszeiten lieber Abstand genommen<br />
von allen sonst so schönen Festangelegenheiten, so mußte<br />
doch wiederum gesorgt werden, den tapferen Vaterlandshelden<br />
die liebe, ferne Heimat in etwa zu ersetzen, und so<br />
wurde in der sonst üblichen schönen Weise, auch das Weihnachtsfest<br />
gefeiert. Jeder Kranke erhielt ein Paket mit nützlichem<br />
und drolligem Inhalt; weiß gekleidete Kinder trugen<br />
auf jeder Krankenstation am schön gezierten Weihnachtsbaum<br />
sinnreiche Gedichte und Lieder vor, wobei manches<br />
Auge sich mit Tränen füllte. Auch die Centralstelle der Liebestätigkeit<br />
setzte für jeden Verwundeten ein Geschenk von<br />
3 Mark aus, das mit der Weihnachtsgabe des Hauses verbunden<br />
wurde. Die Stadt Düsseldorf widmete jedem ein<br />
schönes Bild. So hat auch das Weihnachtsfest den armen<br />
Soldaten manche Freude bereitet und über Schmerz und<br />
Trennung hinweggeholfen. Die freiwilligen Pfleger und Pflegerinnen,<br />
die während des Krieges im Hospital tätig waren,<br />
schenkten zum Weihnachtsfeste, der vorgesetzten Schwester<br />
Veronika, ein großes Bild Seiner Majestät des Kaisers<br />
Wilhelm II. in prachtvollem Rahmen, das nun seinen Ehrenplatz<br />
im großen Sitzungssaale hat. Gleichzeitig wurden der<br />
Marienhospital,<br />
Verwundetenfürsorge,<br />
um 1915<br />
79
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Franziskanerkloster Oststraße 62/64,<br />
Lazarettraum, um 1915<br />
Vorgesetzten im Namen des Oberbürgermeisters drei große<br />
Kupferstiche in schönen Rahmen, mit einer unten angebrachten<br />
Widmung, als Anerkennung für geleistete Dienste und<br />
Pflege der Verwundeten, überreicht. Die Gesamtzahl der<br />
aufgenommenen Verwundeten betrug am 31. Dezember<br />
1914 sechshundertzweiundsiebzig. Die Pflegesätze für die<br />
Verwundeten waren durch Verhandlung der Stadt mit dem<br />
Generalkommando Münster am 14. September 1914 festgesetzt,<br />
und wurde für Mannschaften 3-5 Mark täglich je<br />
nach Art der Aufwendungen für Verbände, Medikamente<br />
etc. und für Offiziere 7 Mark gerechnet. Im Oktober 1914<br />
weilte der Hochwürdigste Herr Weihbischof Dr. Peter Lausberg<br />
mehrere Tage zur Spendung der hl. Firmung in der Stadt.<br />
Trotz der vielen Arbeiten besuchte der Hochwürdigste Herr<br />
auch unser Hospital, obgleich die Firmlinge des Hauses, wie<br />
in den letzten <strong>Jahre</strong>n üblich, zur Pfarrkirche St. Rochus geführt<br />
worden waren. Recht feierlich und herzlich wurde Herr<br />
Weihbischof von den Herren des Vorstandes und der Schwestern<br />
empfangen, begab sich dann zur Kapelle, wo die Kranken<br />
versammelt waren, hielt dort denselben eine kurze<br />
Ansprache; unterdessen hatten sich die Schwestern im Recreationszimmer<br />
versammelt und richtete der Hochwürdigste<br />
Herr dann auch an diese einige liebevolle, belehrenden<br />
Worte, namentlich in Bezug<br />
auf die schwere Kriegszeit.<br />
Alsdann verweilten die Herren<br />
noch eine kurze Zeit in gemütlicher<br />
Weise im großen Sitzungssaale“.<br />
Der Krieg lastete nicht nur<br />
wegen der Verwundetenpflege<br />
und des Ausfalls wichtiger Leistungsträger<br />
auf dem Alltag des<br />
Marienhospitals. Die Pflegekosten<br />
für die Verwundeten,<br />
überhaupt die ganze Umstellung<br />
auf Kriegswirtschaft mit den starken Verteuerungen<br />
von Grundnahrungsmitteln, ließen die Ausgaben in die Höhe<br />
schnellen. Angewiesen war man auf freiwillige Pflegekräfte.<br />
Wieder funktionierte freiwillige bürgerliche Wohltätigkeit.<br />
Töchter aus dem wohlbekannten Bürgertum der Stadt Düsseldorf<br />
lernten in Kursen Krankenpflege und wurden im<br />
Lazarettdienst eingesetzt. Die Gesamtzahl<br />
der im Krankenhaus verpflegten Kriegsverwundeten<br />
betrug 1915 etwa 1700.<br />
Die hohe Gesamtzahl an pflegebedürftigen<br />
Soldaten täuscht darüber hinweg,<br />
dass schon im Januar 1915 der Transport<br />
der Verwundeten in das Marienhospital<br />
nachgelassen hatte. Ursache waren die<br />
zahlreichen Feld- und Etappenlazarette,<br />
die man mittlerweile überall entlang<br />
des Frontverlaufs zur Vermeidung weiter<br />
Transporte eingerichtet hatte. Mitte April<br />
1915 war die Zahl der belegten Betten von<br />
Militärpersonen auf <strong>150</strong> bis 160 herabgesunken,<br />
wodurch die unteren Säle wieder<br />
der Frauenstation zugewiesen und ein<br />
Teil der Privatabteilung wieder hergestellt<br />
werden konnte.<br />
Die Entwicklung während des zweiten<br />
Kriegsjahres fand im <strong>Jahre</strong>sbericht des<br />
Marienhospitals für 1915 wie folgt seinen<br />
Ausdruck: „Der Krieg erschwerte und beeinflußte<br />
die Verwaltung der Anstalt auf<br />
die verschiedenste Weise. Die Schwierigkeiten<br />
in der ärztlichen Versorgung dauerten<br />
an, da der Chefarzt für Chirurgie<br />
und fünf Assistenzärzte zu den Fahnen<br />
berufen waren. Nur dank des aufopfernden<br />
Eintretens hiesiger und auswärtiger<br />
anderer Ärzte, insbesondere der Herren<br />
Klemens Zumbroich, Alex Max Florange,<br />
Hermann Becker, gelang es, die Versorgung<br />
der vielen Schwerverwundeten und<br />
Kranken genügend durchzuführen. Im<br />
Oktober 1915 wurde dann unser Chefarzt<br />
für Chirurgie, Stabsarzt Dr. Franz Kudlek,<br />
wieder an das Reservelazarett der Anstalt<br />
zurückbeordert. Eine fernere Schwierigkeit<br />
war die dauernde Überbelegung infolge<br />
der Einrichtung des Reservelazaretts. Je<br />
länger der Krieg andauerte, desto schwieriger<br />
gestaltete sich beim Marienhospital,<br />
80
Kriegsfürsorge des<br />
Marienhospitals<br />
wie bei allen anderen hiesigen größeren<br />
Krankenanstalten, die Unterbringung der<br />
Kranken aus der Düsseldorfer Bürgerschaft.<br />
Besonders fühlbar wurde dies auch für die<br />
hiesigen Krankenkassen, die in vielen Fällen<br />
die wünschenswerte Krankenhauspflege<br />
nicht gewähren konnten. Die Verwaltung<br />
hat deshalb die Militärbehörde ersucht die<br />
Belegungszahl im Reservelazarett erheblich<br />
zu mindern. Dieser Bitte ist teilweise entsprochen<br />
worden. Sehr fühlbar war für die<br />
Verwaltung auch die fortschreitende Teuerung<br />
und Knappheit mancher Lebensmittel<br />
und vieler Gegenstände der Krankenpflege.<br />
Da die allgemeine Verteuerung sich schon<br />
in den letzten <strong>Jahre</strong>n deutlich zeigte, schloß<br />
sich auch das Marienhospital der Kündigung<br />
des Verpflegungsvertrages mit den<br />
Krankenkassen an, welche Maßnahme<br />
zu einem Neuabschluß mit einem um 50<br />
Pfennig erhöhten Pflegesatz führte. Im<br />
übrigen hat auch die Anstalt das Ihrige zur<br />
wirtschaftlichen Ausnutzung der Nahrungsstoffe,<br />
zur Sammlung und Verwertung der<br />
Abfälle und Fettrückstände usw. getan. Drei<br />
Fettfänger wurden eingebaut. Ein schmerzliches<br />
Opfer war der Abbruch unserer fast<br />
neuen Nickel-Dampf-Kocheinrichtung<br />
im Werte von 12000 Mark, infolge der<br />
Metall-Beschlagnahme. Trotz aller dieser<br />
Schwierigkeiten blieb der Betrieb dank der<br />
Hingabe unserer Pflegeschwestern ganz<br />
auf seiner Höhe. ... Unser Reservelazarett<br />
war im <strong>Jahre</strong> 1915 durchschnittlich täglich<br />
mit 220 Militärpersonen belegt. ... Zwölf<br />
hiesige Damen leisteten ununterbrochen<br />
in deren Pflege wirksame Hilfe“.<br />
In besonderer Weise bedrückend<br />
waren die großen Versorgungsengpässe,<br />
die die Menschen allgemein und auch<br />
das Marienhospital schon recht bald<br />
nach Kriegsbeginn und, je länger der<br />
Krieg dauerte, trafen. Das traditionell auf Nahrungsmittelimporte<br />
angewiesene Kaiserreich, das mit Kriegsbeginn von<br />
Außenhandelsbeziehungen so gut wie abgeschnitten war,<br />
musste mit Zwangsbewirtschaftung im Inneren auf diese<br />
Situation reagieren. Die Vorstandsprotokolle und die Hauschronik<br />
der Franziskanerinnen spiegeln diese bedrückenden<br />
Umstände, die Nahrungsmittelknappheit, nur sehr sparsam<br />
wider. Sie geben überhaupt nur in geringem Maße Hinweise<br />
auf die Kriegssituation, sie vermitteln fast business as usual.<br />
Die Rationierung von Lebensmitteln, besonders Mehl und<br />
Brot, traf das Krankenhaus zum ersten Mal zu Beginn des<br />
<strong>Jahre</strong>s 1915. Der Oberbürgermeister hatte den Düsseldorfer<br />
Krankenhäusern den Beschluss der Reichsverteilungsstelle<br />
vom 25. Januar 1915 über eine Beschränkung des Brotverbrauchs<br />
mitzuteilen, wonach „jeder Kommunalverband<br />
Sorge tragen muß, daß ... nicht mehr Mehl verbraucht wird<br />
als durchschnittlich 225 Gramm pro Kopf der versorgungsberechtigten<br />
Bevölkerung“ pro Woche. Der Kommunalverband<br />
war dem Kriegsernährungsamt weisungsgebunden, das Mitte<br />
1916 als neue Verwaltungsbehörde zur Durchführung zentraler<br />
Bewirtschaftung geschaffen worden war. Nach einer<br />
Verordnung über die Regelung des Brotverkehrs in der Stadt<br />
Düsseldorf vom 11. März 1915 wurde immerhin festgelegt:<br />
„Für öffentliche Kranken‐ und Pflegeanstalten, Waisenhäuser<br />
Das Marienhospital in den <strong>Jahre</strong>n 1914 bis 1918<br />
1914 1915 1916 1917 1918<br />
Patienten 4345 - - - -<br />
Pflegetage 149797 168769 173809 173091 176622<br />
Höchster Krankenstand 455 510 511 511 534<br />
Niedrigster Krankenstand 243 411 445 - -<br />
Freibetten (Pflegekosten) - 35000 - - -<br />
Einnahme Pflegekosten (Mark) 429147 534872 582771 653324 739307<br />
Ausgaben Krankenpflege (Mark) 362075 386441 443736 555058 595423<br />
Das Reservelazarett im Marienhospital in den <strong>Jahre</strong>n 1914 bis 1918<br />
Verwundete 1914 1915 1916 1917 1918<br />
Mannschaften - 1580 883 - -<br />
Offiziere - 106 39 - -<br />
Feldgeistliche - 2 - - -<br />
Summa 672 1688 922 - -<br />
Durchschnitt - 220 170 175 110<br />
81
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Frauenabteilung,<br />
um 1930<br />
und dergleichen werden Berechtigungsausweise ohne Bezeichnung<br />
bestimmter Bezugsmengen von Brot und Mehl<br />
ausgestellt“. Es war aber Tagebuch über Bezug und Verbrauch<br />
zu führen. Auch Öle und Fette waren und wurden wertvoll.<br />
Doppelt wertvoll war das Milchprodukt Butter wegen der<br />
eingeschränkten Milchwirtschaft. Auch für Öle und Fette gab<br />
es eine Behörde, die Reichsstelle für Speisefette. Fette durften<br />
bei der Brotherstellung nicht mehr zum Bestreichen von<br />
Schwarzbrot und sogenanntem Kriegsbrot verwandt werden.<br />
Im Laufe des Krieges spitzte sich die Versorgungssituation<br />
ständig zu. Praktisch alle Nahrungsmittel, insbesondere auch<br />
Fleisch, Fisch, Zucker, Eier und Kartoffeln, waren rationiert. Im<br />
September 1915 wurden Milch und Milchprodukte auch beim<br />
Brotbacken verboten. Vollmilch sollte nur noch werdenden<br />
und stillenden Müttern, Kindern bis zu sechs <strong>Jahre</strong>n sowie<br />
Kranken zukommen. Mit Tränen in den Augen wussten die<br />
Küchenschwestern im Marienhospital manches Mal nicht, was<br />
sie zur Verpflegung der Patienten zubereiten sollten. Um in<br />
der Öffentlichkeit nicht in ein falsches Licht zu geraten, wählte<br />
der Vorstand im <strong>Jahre</strong>sbericht des Marienhospitals für 1916<br />
zur Versorgungslage der Patienten gleichwohl diplomatische<br />
Formulierungen: „Die Pfleglinge waren mit der vereinfachten<br />
Beköstigung durchweg zufrieden .... Wenngleich schwere<br />
Sorge um das ‚tägliche Brot‘ der 600 Insassen an manchen<br />
Tagen die Herzen der Schwestern bedrückte, so gelang doch<br />
die Belieferung durch die städtische Verwaltung immer noch<br />
so zeitig, daß ernste Verlegenheiten nicht eintraten. Ein großer<br />
Übelstand aber blieb es, daß auch für so große Verwaltungen<br />
die freihändige Beschaffung<br />
aus den früheren Quellen ganz<br />
lahmgelegt war. Einen großen<br />
Ersatz boten die Anschaffungen<br />
der Heeresverwaltung, die<br />
aber natürlich nicht für die Zivilinsassen<br />
bestimmt und ausreichend<br />
waren. Die Ausgaben<br />
für die Beköstigung zeigten ein<br />
weiteres Ansteigen. Sie betrugen<br />
1914: Mark 209646 -, für<br />
den Pflegetag und Kopf 1,40<br />
Mark; 1915: Mark 271126 -,<br />
für den Pflegetag und Kopf<br />
1,60 Mark; 1916: Mark 349680 -, für den<br />
Pflegetag und Kopf 2,01 Mark. Auf die<br />
gleiche Zahl der Pflegetage berechnet,<br />
ergibt dies ein Mehr von 66412 Mark“.<br />
Da sich nicht nur Lebensmittel mehr<br />
und mehr verteuerten, sondern auch fast<br />
alle übrigen Ausgaben (z. B. Handwerkerdienste,<br />
Gebrauchswaren, Arzneien,<br />
Löhne) stiegen, war das Marienhospital wie<br />
die übrigen Krankenhäuser der Stadt gezwungen,<br />
mit den zuständigen Verwaltungen<br />
eine Erhöhung der Pflegesätze auszuhandeln.<br />
Dieselben traten am 1. April 1916<br />
in Kraft: Patienten der I. Klasse zahlten nun<br />
je nach Zimmerkomfort zwischen 13 und<br />
20 Mark, Kranke der II. Klasse zwischen<br />
4,50 und 7,50 Mark und Angehörige der<br />
III. Klasse 3,50 Mark, Kinder unter 12 <strong>Jahre</strong>n<br />
2 Mark.<br />
Am Tag der Feststellung neuer Pflegesätze<br />
wurde zwischen dem Reichsmilitärfiskus<br />
und dem Marienhospital ein neuer<br />
Vertrag über die Aufnahme und Pflege<br />
verwundeter und erkrankter Heeresangehöriger<br />
in Pempelfort unterzeichnet. Die<br />
Pflege erstreckte sich auf die Gewährung<br />
ärztlicher Behandlung, soweit der Krankenanstalt<br />
dies bei dem noch verbliebenen<br />
Personal möglich war, auf die vollständige<br />
Beköstigung nach den von den Ärzten<br />
erteilten Verordnungen, auf die Verabreichung<br />
von Reinigungsbädern und auf die<br />
Behandlung mit medico-mechanischen<br />
Apparaten. Die Königliche Intendantur<br />
gewährte für den Tag und Kopf der Verpflegung<br />
folgende Pflegesätze: für Offiziere<br />
ohne Rangunterschied und Feldgeistliche<br />
7,50 Mark, für alle übrigen Heeresangehörigen<br />
4,25 Mark und für das militärische<br />
Aufsichtspersonal 2 Mark.<br />
Die große Zahl eingewiesener Kriegsverletzter,<br />
der Pflegeaufwand für diese<br />
82
Kriegsfürsorge des<br />
Marienhospitals<br />
Verwundeten und die Mehrarbeit der Ärzte<br />
schufen viele Engpässe, doch gab der Vorstand<br />
im <strong>Jahre</strong>sbericht des Marienhospitals<br />
für 1916 zu Protokoll, „auch die etwas<br />
enger gewordene Belegung wurde gern<br />
ertragen, wenn nur in schweren Krankheitsfällen<br />
überhaupt Aufnahme und Hülfe<br />
gewährt wurde. Dies war ja zu unserem<br />
Bedauern nicht in allen dringenden Fällen<br />
möglich. Wir haben unsere Bemühungen<br />
fortgesetzt, von der Militärverwaltung etwa<br />
40 weitere Betten für die Zivilbevölkerung<br />
freizubekommen. Das Entgegenkommen<br />
der Lazarettdirektion I ermöglichte, daß<br />
wir der chirurgischen Frauenstation ihre<br />
früheren luftigen Räume im Erdgeschoß<br />
zurückgeben konnten. Auch der ärztliche<br />
Dienst wurde, trotz des Fehlens mehrer<br />
Hilfskräfte, durch die vermehrten Anstrengungen<br />
der Chefärzte und die freiwillige<br />
Mitwirkung der Herren Klemens Zumbroich<br />
und Alex Max Florange in zufriedenstellender<br />
Weise weitergeführt“.<br />
Je länger die Kriegshandlungen andauerten,<br />
umso schwieriger wurde die<br />
Beschaffung von Lebensmitteln, obwohl<br />
Krankenhäuser und Lazarette bei der Lebensmittelzuteilung<br />
privilegiert waren.<br />
Gleichwohl waren die Pflegeschwestern<br />
ständig darum bemüht, den Rekonvaleszenten<br />
ihren Aufenthalt so erträglich<br />
wie möglich zu gestalten. Mit Sorge um<br />
die Sicherstellung einer ausreichenden Ernährung<br />
der Patienten notierte die Oberin<br />
der Franziskanerinnen 1917 in der Hauschronik:<br />
„Die Ausgaben für die Beköstigung<br />
zeigten ein weiteres Ansteigen. Sie<br />
betrugen 405807 Mark; es stellt sich ein<br />
Mehr heraus von 62207 Mark gegen das<br />
Vorjahr. ... Um in etwa einen Begriff der<br />
Teuerungslage zu erhalten, folgen einige<br />
Preisangaben. Für Fleisch wurde gezahlt<br />
7,80 Mark das Pfund; freies Fleisch 9 Mark; Milch 65 Pfennig<br />
der Liter und wo wir sonst für den täglichen Bedarf 400 Liter<br />
erhielten, gab‘s durchschnittlich 100 und lange Zeit nur 40-<br />
50 Liter täglich, sogar wochenlang keine Milch und mußte<br />
kondensierte Büchsenmilch oder Milchpulver zur Bereitung<br />
der Speisen verwandt werden. Der Preis der Gemüse betrug<br />
das 10fache, und der Kartoffeln das 8fache, Zucker, Cacao,<br />
Hülsenfrüchte das 4fache, Mehl das 10fache mehr als in<br />
Friedenszeiten. Die Lebensmittel als Brod, Mehl, Zucker,<br />
Hülsenfrüchte, Graupen, Gerste usw. waren rationiert; das<br />
pro Kopf bestimmte Quantum mußte ausreichen; so gab‘s<br />
an Fleisch pro Woche für jede Person 125 Gramm, Mehl<br />
3,5 Pfund incl. Brod, Butter 50 Gramm, Kartoffeln 7 Pfund,<br />
Zucker 175 Gramm usw.. Daß es für die Küchenschwestern<br />
oft sehr, sehr schwer war und große Sorgen mit sich brachte,<br />
ist längst begreiflich; doch der liebe Gott hat uns bis heute<br />
nie verlassen, ja er hat uns, gegenüber der großen Notlage<br />
der Weltläufe stets reichlich geholfen und gesegnet. Von<br />
wohltätiger Seite wurde dem Hause manches überlassen<br />
und zugewiesen; die Militärverwaltung wie auch die städtische<br />
Verwaltung sorgten, was in ihren Kräften stand, uns<br />
zu helfen. Eine Küchenschwester war aber fast beständig an<br />
den betreffenden Lebensmittelstellen, im Schlachthof, Hafen<br />
oder Garnisonsspeicher. Großen Nutzen brachte aber auch<br />
unsere Schweine- und Hühnerzucht. Von ersterer Sorte waren<br />
fast 25 Stück vorhanden, und war dies für die Küche, wenn<br />
Kasernengebäude, Kasernenstraße,<br />
um 1910<br />
Dominikanerkloster Herzogstraße 17,<br />
Verwundetenfürsorge, um 1915<br />
83
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Küche, um 1930<br />
auch mit vielen Mühen, doch mit großem Vorteil verknüpft.<br />
Der Hühnerhof, den Schwester Claver mit großem Fleiß und<br />
Mühe pflegte, versorgte die Küche stets mit frischen Eiern<br />
und konnte in der Hauptlegezeit monatlich mit 200 Eiern<br />
gerechnet werden; uns war das, bei dem hohen Preis 80-95<br />
Pfennig das Stück, und dem großen Mangel an Eiern, die<br />
oft wochenlang ausblieben, ein großer Vorteil und Segen,<br />
so daß wenigstens die ganz schwer Kranken ein Ei erhalten<br />
konnten. In den meistern Krankenanstalten mußte wegen<br />
Mangel an Lebensmitteln das 2. Frühstück den Kranken<br />
entzogen werden, und war die Zeit des Aufstehens deshalb<br />
eine Stunde später vorgeschrieben; doch Gott Dank wußte<br />
unsere vortreffliche Küchenschwester es stets so einzurichten,<br />
daß in unserem Hause die Mahlzeiten konnten bestehen<br />
bleiben, wenn auch in knapper oder vereinfachter Form.<br />
So bekamen die Frauen- und Kinderstation als 2. Frühstück<br />
eine gute Suppe, wie auch Abends eine sehr lange Zeit, da<br />
großer Kartoffelmangel war. Die Männerstationen erhielten<br />
zum 2. Frühstück eine Schnitte ungeschmiertes Brod, aber<br />
mit Zulage. ... Wöchentlich wurden fürs ganze Haus zwei<br />
auch schon drei fleischlose Tage festgelegt; die Privatkranken<br />
erhielten kleinere Portionen, wie auch einfachere Speisen, da<br />
ja manches wie Geflügel etc. mangelte.<br />
Im Allgemeinen waren die Kranken trotz<br />
alldem mit der Verpflegung recht zufrieden<br />
und hörte man selten eine Klage“.<br />
Nach den Berechnungen des Reichsgesundheitsamtes<br />
verlor jede erwachsene<br />
Person während des Krieges 10 bis 15<br />
Kilogramm, das heißt rund 20 % ihres Gewichtes.<br />
Die landwirtschaftliche Erzeugung<br />
lag 40 bis 60 % unter der Vorkriegszeit.<br />
Die Nahrungsmittelrationen sollen nur<br />
noch 20 % des Verbrauchs an Fleisch,<br />
11 % des Verbrauchs an Schmalz, 21 % an<br />
Butter, 41 % an Pflanzenfetten, 47 % an<br />
Mühlenprodukten gegenüber dem schon<br />
schlimmen Kriegsjahr 1917/18 betragen<br />
haben. Kein Wunder, dass in der allgemeinen<br />
Mangelsituation epidemischen<br />
Krankheiten, wie Grippewellen, geringer<br />
Widerstand entgegengesetzt werden konnte.<br />
Die Grippe grassierte im Herbst 1918.<br />
Die Anzahl der Opfer war erschreckend<br />
hoch, die Leichenhalle des Marienhospitals<br />
dauernd überfüllt, waren doch an<br />
manchen Tagen fünf Tote zu beklagen.<br />
Bis zum 5. November 1918 starben in<br />
Düsseldorf 757 Infizierte an Grippe und<br />
ihren Nachkrankheiten, Lungen- und Rippenfellentzündung.<br />
Das für 500 Kranke<br />
berechnete Marienhospital war im Herbst<br />
1918 mit mehr als 530 Patienten völlig<br />
überbelegt. „Trotzdem die Betten enger<br />
gestellt, teilweise die Gänge belegt waren“,<br />
vermeldet der Rechenschaftsbericht,<br />
„mußten zu unserem größten Leide in den<br />
Monaten Oktober und November öfter bis<br />
zu 25 Kranke am Tage abgewiesen werden.<br />
... Auch die Sterblichkeit war infolge der<br />
Grippe übermäßig hoch. 1918 = 391 (303<br />
im Vorjahre, 1916 = 254)“.<br />
Schuld an der hohen Zahl von Opfern<br />
bei epidemischen Krankheiten war neben<br />
84
Kriegsfürsorge des<br />
Marienhospitals<br />
der unzureichenden Nahrungsmittelversorgung<br />
auch der Mangel an Heizmaterialien.<br />
Wie die Bevölkerung hatte hierunter auch<br />
das Marienhospital zu leiden. Im <strong>Jahre</strong> 1917<br />
vermerkte der Rechenschaftsbericht hierzu:<br />
„Eine große Sorge war die Kohlenbeschaffung,<br />
bei der namentlich der Mangel an<br />
Gespannen sich höchst fühlbar machte.<br />
Die Heizung mußte infolgedessen häufig zu<br />
früher Nachmittagsstunde schon abgestellt<br />
werden, ein öfters in den Bade‐ und Operationsräumen<br />
als unleidlich empfundener<br />
Umstand“.<br />
Da das Marienhospital seine Räumlichkeiten<br />
sofort zu Lazarettzwecken zur<br />
Verfügung gestellt hatte, blieb es von Beschlagnahmungen<br />
weitgehend verschont.<br />
Gleichwohl musste es 1915 eine fast neue<br />
„Nickel-Dampf-Kocheinrichtung“ im Wert<br />
von 12000 Mark und 1918 die Blitzableiteranlage<br />
im Wert von 3700 Mark zur Waffenverarbeitung<br />
an den Reichsmilitärfiskus<br />
abführen. Zu den finanziellen Opfern, die<br />
das Marienhospital für den Weltkrieg leisten<br />
musste, gehörte die Zeichnung von Kriegsanleihen<br />
aus dem Reservefonds und aus<br />
zurückfließenden Hypotheken. Zwischen<br />
1914 und 1918 wurden neun Kriegsanleihen<br />
aufgelegt. Alle Anleihen waren zu 5<br />
Prozent verzinslich und wurden zunächst<br />
zum Zeichnungskurs von 98,5 Prozent,<br />
von der fünften Kriegsanleihe an zu 98<br />
Prozent aufgelegt. Die erste Kriegsanleihe<br />
im September 1914 brachte in Deutschland<br />
4,2 Milliarden Mark, davon in Düsseldorf<br />
80830000 Mark Zeichnungen.<br />
Infolge der hohen Zeichnungen für<br />
Kriegsanleihen hatte das Marienhospital<br />
während des Ersten Weltkrieges ständig<br />
mit Geldschwierigkeiten zu kämpfen. Die<br />
Bilanzen der <strong>Jahre</strong> 1916 und 1917 zeigen<br />
deutlich, dass das Marienhospital bereits<br />
von seiner Substanz lebte. Der Verlust aus beiden <strong>Jahre</strong>n belief<br />
sich auf 89047 Mark. Vor diesem Hintergrund verwundert<br />
es wenig, dass der Bericht über die letzte Versammlung des<br />
Vorstandes im Kriegsjahr 1918 mit einem düsteren Ausblick<br />
des Vorsitzenden über die Schwierigkeiten bei der Beköstigung,<br />
der Pflege der Kranken, Mangel an Lebensmitteln und<br />
Wäsche, der gewaltigen Steigerung der Preise für Verbandsmittel<br />
und Kohle, Erhöhung der Pflegesätze in allen Klassen<br />
schließt. Die Schwierigkeiten im Marienhospital konnten nur<br />
durch die übermenschliche Arbeit der Ärzte, Schwestern und<br />
freiwilligen Helfer gemildert werden, von denen viele für ihren<br />
Lazaretteinsatz mit dem Roten-Kreuz-Verdienstkreuz III. Klasse<br />
ausgezeichnet wurden. Ende 1918 hatte die Zahl der im Ganzen<br />
aufgenommenen Militärpersonen die Höhe von 4816 erreicht.<br />
Kriegsanleihen durch das Marienhospital 1914-1918<br />
Zeichnungswert in Mark<br />
1. Kriegsanleihe 1914 ?<br />
2. Kriegsanleihe 1915 25000<br />
3. Kriegsanleihe 1915 10000<br />
4. Kriegsanleihe 1916 60000<br />
5. Kriegsanleihe 1916 250000<br />
6. Kriegsanleihe 1917 105000<br />
7. Kriegsanleihe 1917 ?<br />
8. + 9. Kriegsanleihe 1918 130000<br />
Rath, Metallwerke, um 1920<br />
Werbeplakat, um 1915<br />
85
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Oberkasseler Brücke,<br />
Truppenrückzug, 1918<br />
Luegallee,<br />
Truppenrückzug, 1918<br />
Die Revolution 1918/1919<br />
Nach dem verlorenen Krieg<br />
und dem Zusammenbruch<br />
des Kaiserreiches waren die<br />
Startbedingungen der neuen<br />
Republik äußerst ungünstig.<br />
Die wirtschaftlichen und finanziellen<br />
Schwierigkeiten in<br />
der Anfangsphase der Weimarer<br />
Republik von 1919 bis<br />
1923, die durch die Demobilisierung,<br />
die Umstellung<br />
der Industrieproduktion von<br />
Kriegs- auf Friedenswirtschaft,<br />
Arbeitslosigkeit, Reparationsforderungen,<br />
Inflation und<br />
Ruhrbesetzung bedingt waren,<br />
brachten insbesondere<br />
das überkommene deutsche Sozial- und Fürsorgesystem in<br />
äußerste Bedrängnis. Sechs Millionen Soldaten und über drei<br />
Millionen Kriegshinterbliebene und Kriegsbeschädigte waren<br />
zu integrieren. Zu ihnen kamen verarmte Angehörige und<br />
weitere Arbeitslose der Umstellung von Kriegs- auf Friedensproduktion.<br />
Staat und Kommunen waren verschuldet und<br />
eine wachsende Inflation, die das Sparvermögen vernichten<br />
würde, schien nur eine Frage der Zeit. Auf diese Weise war<br />
aus der vor dem Krieg relativ<br />
begrenzten Schicht von „Armen“<br />
eine bedrohlich breite<br />
Schicht geworden, die nicht<br />
nur durch Kriegsopfer, sondern<br />
auch durch einen um seine<br />
Ersparnisse gebrachten Mittelstand<br />
aufgefüllt wurde.<br />
Wie so oft in wirtschaftlich<br />
schlechten Zeiten schnellte<br />
auch in Düsseldorf die Zahl<br />
der Diebstähle und Einbrüche<br />
nach Ende des Ersten Weltkrieges<br />
in die Höhe. „Täglich<br />
hörte man von unerhörten Schwindeleien<br />
und Räubereien“, so ein Eintrag in<br />
der Ordenschronik zu Beginn des <strong>Jahre</strong>s<br />
1919. „Durch Gottes Schutz blieb unser<br />
Haus aber immer verschont, bis wir in der<br />
Nacht vom 5. Januar 1919 auf einmal von<br />
einem so unliebsamen Ereignis betroffen<br />
wurden. Gegen 3 Uhr morgens bemerkte<br />
Herr Rendant Biesenbach, welcher mit<br />
seinem Vetter Leutnant Statz ein Zimmer<br />
im Herrenpensionatparterre innehatte, wie<br />
sich jemand leise und suchend seinem Bette<br />
näherte; auf seinen lauten Ruf nach seinem<br />
Zimmerkameraden ergriff der Dieb die<br />
Flucht, Herr Biesenbach war im Nu hinter<br />
ihm her und sah ihn noch gerade, wie er<br />
im Pförtnerzimmer durch das Fenster in den<br />
Garten sprang. Ehe die Nachtschwester auf<br />
das Läuten an der Hauspforte erschien,<br />
hatte der Dieb durch Überklettern des Gartentores<br />
das Freie erreicht und entkam. Nun<br />
untersuchte Herr Biesenbach mit seinem<br />
Vetter, welcher ihm auf dem Fuße gefolgt<br />
war, den Garten und fand die Schuhe,<br />
Überzieher und Brieftasche mit Personalien<br />
des Einbrechers vor; im Pförtnerzimmer sah<br />
es schrecklich aus, der Dieb hatte offenbar<br />
versucht den eisernen Wandschrank zu<br />
erbrechen, wahrscheinlich in der Meinung<br />
es sei ein Geldschrank; auch an Pult und<br />
Tischschublade versuchte er seine Künste,<br />
jedoch ohne Erfolg; wahrscheinlich hat er<br />
sich nach vergeblichen Bemühungen ins<br />
Herrenpensionat begeben. Nach späteren<br />
Feststellungen ist er durch das kleine<br />
Schalterfenster eingedrungen, deshalb<br />
wurde dieses sofort mit einem eisernen<br />
Gitter versehen. Von diesem Tage an wurde<br />
an der Pforte und im Leinwandzimmer<br />
eine männliche Person zum Schutze und<br />
eventueller Hülfe einquartiert“.<br />
86
Die Revolution 1918/1919<br />
Die deutsche Gesellschaft und ihre Politik<br />
waren durch Kriegsverlust und außenpolitische<br />
Demütigung verstört, die bislang<br />
herrschenden Klassen teils gestürzt, teils<br />
desorientiert. Die sich seit Anfang November<br />
1918 überstürzenden Ereignisse<br />
im Gefolge des militärischen Zusammenbruchs,<br />
die am 9. November 1918 zum<br />
Sturz der Monarchie führten, trafen auch<br />
die deutschen Katholiken ebenso unerwartet<br />
und unvorbereitet wie die Übernahme<br />
der Regierungsgewalt durch selbsternannte<br />
republikanische Volksbeauftragte der<br />
MSPD und USPD. Zwar hatte der deutsche<br />
Katholizismus bei der Neuordnung nach<br />
der Revolution, die er nicht gewollt und<br />
nicht bejaht hatte, politisch vieles von dem<br />
erreichen können, was lange Zeit unerfüllt<br />
geblieben war, doch wurde die neue<br />
staatliche Ordnung von den Katholiken<br />
keineswegs einhellig begrüßt.<br />
Auch in Düsseldorf waren die Monate<br />
nach der Abdankung Kaiser Wilhelm II. für<br />
die Katholiken eine Zeit des Hoffens und<br />
Bangens. Bereits am Nachmittag des 8.<br />
November 1918 hatte die revolutionäre Bewegung<br />
auf Düsseldorf übergegriffen und<br />
sich ein Arbeiterrat aus USPD, SPD und Soldaten<br />
konstituiert, der die öffentliche Ruhe,<br />
Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten<br />
wollte, um die Lebensmittelversorgung, die<br />
Kohlezufuhr sowie die Kriegsunterstützung<br />
und andere Wohlfahrtseinrichtungen zu<br />
sichern. Wie ein Großteil der Düsseldorfer<br />
Bevölkerung waren auch viele Katholiken<br />
der Stadt Monarchisten aus tiefster<br />
Überzeugung. Selbstverständlich kannten<br />
und respektierten sie die Lehre von Papst<br />
Leo XIII., dass die katholische Kirche nicht<br />
an eine bestimmte Staatsform gebunden<br />
sei. Schon am Tag nach der Abdankung<br />
stellte sich das Düsseldorfer Tageblatt als<br />
Sprachrohr der Katholiken auf den berühmten „Boden<br />
der Tatsachen“ und kommentierte den Vorgang mit den<br />
Worten: „Man darf die Ereignisse dieser Tage nicht mit<br />
dem Herzen, sondern nur mit dem kühlen Verstande beurteilen.<br />
Die geschehenen Dinge sind nicht ungeschehen<br />
zu machen; wir müssen sie als Tatsachen hinnehmen“.<br />
Der November 1918, der eigentliche Revolutionsmonat,<br />
verlief in Düsseldorf verhältnismäßig ruhig, ruhiger<br />
als in zahlreichen anderen deutschen Städten. Das Zurückfluten<br />
des Feldheeres und die im Waffenstillstand<br />
zugestandene Räumung des linken Rheinufers und damit<br />
auch der linksrheinischen Stadtteile Düsseldorfs nahmen<br />
die Öffentlichkeit vorerst noch in Anspruch. Glaubt man<br />
der Ordenschronik, verlief auch im Marienhospital der<br />
Übergang vom Kaiserreich zur Republik ohne besondere<br />
Zwischenfälle: „Infolge der Revolution und der Umwälzung<br />
am 9. November 1918 hob die Intendantur den<br />
Pflegesatz für Offiziere völlig auf, wünscht aber auch<br />
für sie die gleiche Behandlung wie für Mannschaften.<br />
Außer dieser angeordneten Gleichheit der Offiziere und<br />
Mannschaften in Kost und Pflegesatzes kam noch, daß<br />
von den Soldaten einige Obmänner gewählt wurden,<br />
die mit dem Chefarzt ins Benehmen traten, und daß<br />
einige Soldaten sich ohne Entlassungsbefehl entfernten.<br />
Wenn auch die Gemüter vielfach erregt waren, so war<br />
im Übrigen die Ordnung des Hauses in keiner Weise<br />
gestört und beeinflußt. Dazu half jedenfalls die Ankündigung,<br />
daß jede Unordnung zum sofortigen Aufhören<br />
der Pflege und zur Entlassung<br />
führen werde“.<br />
Kurz bevor am 4. Dezember<br />
1918 belgische Truppen<br />
das linke Rheinufer gegenüber<br />
der Stadt in Besitz nahmen,<br />
wurden dem Marienhospital<br />
am 28. November 1918 etwa<br />
15 Verwundete aus dem Reservelazarett<br />
der Dominikanerinnen<br />
in Heerdt überwiesen, da<br />
diese Anstalt wegen der Räumung<br />
als Lazarett geschlossen<br />
werden musste.<br />
Vorwärts, 9. November 1918<br />
Krankenhaus der Dominikanerinnen<br />
Rheinallee 26/27, Lazarettraum, um 1915<br />
87
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Ellerstraße/Kruppstraße,<br />
Spartakistenunruhen, 1919<br />
Ellerstraße 97,<br />
Spartakistenunruhen, 1919<br />
Als Spartakisten am 8. Januar 1919 in Düsseldorf die Herrschaft<br />
ergriffen und alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt<br />
unter ihre Kontrolle brachten, stand auch das Marienhospital<br />
in der Gefahr, in den Strudel der politischen Ereignisse hineingerissen<br />
zu werden. Ein Vollzugsrat übernahm die öffentliche<br />
Gewalt. Am 10. Januar 1919 erklärten die Spartakisten Oberbürgermeister<br />
Adalbert Oehler für abgesetzt und machten<br />
einen Mann aus ihrer Mitte zum Chef der Stadtverwaltung.<br />
Die Folge war, dass die städtischen Beamten die Arbeit niederlegten<br />
und die demokratische und die sozialdemokratische<br />
Partei, zusammen mit den christlichen Gewerkschaften,<br />
Gegendemonstrationen veranstalteten. In blutigen Zusammenstößen,<br />
bei denen es auf der Graf-Adolf-Straße 14 Tote<br />
und 28 Schwerverwundete gab, blieben die Spartakisten<br />
aber Herren der Stadt. Sie riefen den Generalstreik aus, verboten<br />
die bürgerlichen Zeitungen, sperrten den gesamten<br />
Telefonverkehr nach außerhalb. Der Vollzugsrat kontrollierte<br />
die öffentliche Sicherheit, es gab Ausgangsbeschränkungen.<br />
Auch das Personal und die Schwestern des Marienhospitals<br />
machten hier keine Ausnahme.<br />
Unter dem 11. Januar 1919 ist in der Hauschronik des<br />
Marienhospitals über die Unruhen in Düsseldorf zu lesen:<br />
„Einer der schlimmsten Tage und der traurigsten Ereignisse<br />
die Düsseldorf je gesehen, sollte der heutige Tag bieten.<br />
Die Empörung über das Treiben der Spartakusleute war bei<br />
der gutgesinnten Bevölkerung auf das<br />
höchste gestiegen; deshalb wurde eine<br />
große Demonstration gegen erstere beschlossen;<br />
Bürger und Arbeiter vereinigten<br />
sich zu einem großen Zuge und vaterländische<br />
Lieder singend, zogen sie durch<br />
die Hauptstraßen der Stadt; in die Nähe<br />
des Bahnhofes angekommen, wurden sie<br />
plötzlich von Schüssen, welche die Spartakisten<br />
aus Maschinengewehren abgaben,<br />
empfangen, wohin sich die Menge auch<br />
wendete, an fast allen Straßenecken wurde<br />
geschossen und bald gab es zahlreiche<br />
Verwundete und Tote unter den harmlosen<br />
Teilnehmern. Gleich bei den ersten<br />
Schüssen wurden wir auch schon mit den<br />
unglücklichen Opfern bedacht; um 5 ½<br />
Uhr kam der erste Verletzte und in Zeit von<br />
einer starken Stunde hatten wir schon sieben;<br />
die Feuerwehr fuhr dauernd die Leute<br />
aufzusuchen, das Licht brannte infolge der<br />
Spartakusregierung nur spärlich, jede Tragbahre<br />
mußte mit einer Kerze beleuchtet ins<br />
Operationszimmer gebracht werden, das<br />
alles erschwerte die erste Hülfeleistung. Der<br />
erste, welcher an den Folgen eines schweren<br />
Bauchschusses starb, war ein Bürger<br />
aus unserer nächsten Nachbarschaft, Herr<br />
Vogel, nach 2-3 Stunden hatte er schon<br />
ausgelitten. Der zweite, ein junger Mann,<br />
Prokurist der Mannesmannwerke starb<br />
infolge schwerer Unterleibsschüsse unter<br />
großen Schmerzen am zweiten Tage nach<br />
seiner Einlieferung; sein alter Vater und seine<br />
junge Frau, er war erst 4 Monate verheiratet,<br />
waren untröstlich. Ein anderer junger<br />
Mann, Herr Adler, hatte offenbar Gottes<br />
Schutz erfahren; mit einem Kopfschuß<br />
wurde er eingeliefert, immer rief er: ‚Nun<br />
verbindet mich schnell, damit ich wieder<br />
heraus kann, die Spartakusbande niederschießen!‘.<br />
Seine Geduld wurde aber auf<br />
88
Die Revolution 1918/1919<br />
eine harte Probe gestellt; erst drei Monate<br />
später konnte er als geheilt entlassen werden.<br />
Unter den Verletzten befanden sich<br />
auch Spartakusleute; zwei schwer durch<br />
Bauch- und Brustschuß verletzt; einer starb<br />
in derselben Nacht, seine Schußwunde<br />
kam allen unbedenklich vor, deshalb wurde<br />
er, da alles überfüllt war, ins Badezimmer<br />
untergebracht, dort fand man ihn morgens<br />
tot vor, in der Tasche seines Überziehers<br />
die schriftliche Austrittserklärung aus der<br />
katholischen Kirche – vielleicht, daß er doch<br />
im letzten Augenblick mit einem Act der<br />
Reue vor den Richterstuhl Gottes trat; der<br />
zweite lebte noch 3 Tage und starb dann<br />
nach andächtigem Empfang der Hl. Sakramente;<br />
Andere leichtverwundete kamen<br />
noch und wurden nach dem Notverband<br />
wieder entlassen; die Schießerei dauerte<br />
noch bis genau 9 Uhr, als die Nacht völlig<br />
hereinbrach, war alles ruhig und still, die<br />
wachehaltenden Schwestern, es waren<br />
jetzt deren immer 2, fanden Spartakus<br />
und deren Opfer friedlich nebeneinander<br />
liegen. Die folgenden Tage waren ruhiger,<br />
jedoch der 13. Januar verlangte wieder<br />
neue Opfer; einer der Verwundeten starb<br />
auch bald infolge seines schweren Halsschusses<br />
nach andächtigem Empfang der<br />
Hl. Sakramente“.<br />
Ein Generalstreik mit einem Ausfall<br />
an Strom und Gas, an Wasser und Kohle<br />
lähmte den Krankenhausbetrieb im Marienhospital<br />
in allen Bereichen. Ein Appell<br />
der Düsseldorfer Ärzte an die Bevölkerung<br />
und an die Militärverwaltung, zu deren<br />
Unterzeichnern auch Dr. Franz Kudlek<br />
vom Marienhospital gehörte, sollte Hilfe<br />
bringen. Unter dem 5. Februar 1919 berichtet<br />
die Ordenschronik: „Mittags 12 Uhr<br />
begann der große Generalstreik. Ausgehend<br />
von den vereinigten Beamten- und<br />
Berufsorganisationen legte alles die Arbeit nieder; die Eisenbahnen<br />
und Elektrische fuhren nicht mehr; Gas und Wasser<br />
wurde abgesperrt; die Bürgerschaft Düsseldorf‘s empfand<br />
wohl am meisten den Mangel an Beleuchtung, wohingegen<br />
sich bei uns im Hospital der Wassermangel empfindlicher bemerkbar<br />
machte; glücklicherweise entdeckten wir bald im<br />
Erdgeschoß ein Krähnchen, welches noch sparsam das jetzt<br />
so seltene Naß lieferte; mit Eimern und Kannen war es dann<br />
auch den ganzen Tag belagert, bis glücklich am Abend des<br />
6. Februar infolge Verhandlungen des Vollzugsrates mit den<br />
Verbänden der Streik als beendet erklärt wurde. Viel trug zu<br />
der baldigen Beendigung des Streikes auch die Festigkeit der<br />
Ärzte bei, welche erklärten, nicht mehr arbeiten zu wollen,<br />
wenn nicht bald geordnete Zustände in Düsseldorf zurückkehrten;<br />
die Spartakisten wollten allerdings die Ärzte zwingen<br />
die Patienten zu behandeln; mehrere derselben wurden<br />
infolge Weigerung verhaftet; auch vor unserer Hospitalpforte<br />
erschien ½ 3 Uhr das berüchtigte Auto der Spartakusleute<br />
und verlangte die Vorgesetzte oder den Chefarzt zu sprechen.<br />
Da erstere beim Gebet mit der Gemeinde war, sagte sie<br />
auf Bescheid der Pförtnerin, man solle die Leute zu Dr. Kudlek<br />
schicken. In rasendem Tempo sauste nun das Auto dorthin;<br />
aber schnell benachrichtigten wir denselben von dem<br />
bevorstehenden ... Besuch, so daß er noch gerade Zeit hatte,<br />
sich in seiner Kellertreppe in Sicherheit zu bringen. Frau<br />
Dr. Kudlek verhandelte mit den Roten und es gelang ihr die<br />
Leute bis auf 5 Uhr zu vertrösten; glücklicherweise wurde um<br />
½ 4 Uhr das Ende des Streiks bekannt gegeben“.<br />
Grabenstraße 19,<br />
Spartakistenunruhen, 1919<br />
Flingern, Stadtwerke, um 1925<br />
89
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Weimar, Nationalversammlung,<br />
6. Februar 1919<br />
Zum Hirschchen, Alt-Pempelfort 2,<br />
um 1915<br />
Ordenschronik der Franziskanerinnen 1920 (Auszug)<br />
Den Patienten I. und II. Klasse wurde<br />
mitgeteilt, die Bettwäsche selbst zu stellen,<br />
da die Wäsche des Hospitals fast ganz<br />
verbraucht und an eine Neuanschaffung in<br />
diesen schlimmen Zeiten nicht zu denken<br />
ist. Ebenso wurde den Privatpatienten,<br />
welche des nachts Licht verbrennen,<br />
dasselbe besonders berechnet und zwar<br />
gleich der Wäsche mit einer Mark pro Tag.<br />
Der Revolutionsspuk endete,<br />
als zum 28. Februar 1919<br />
das Freikorps Lichtschlag in<br />
Düsseldorf einrückte und die<br />
Kontrolle der Stadt wieder<br />
in die Hände der Regierung<br />
fiel. Großen Rückhalt bei der<br />
Gesamteinwohnerschaft der<br />
Stadt hatte der Vollzugsrat zu<br />
keiner Zeit gehabt. Besonders<br />
deutlich wurde dies am 19.<br />
Januar 1919 bei den Wahlen<br />
zur Nationalversammlung in<br />
Weimar, bei der in Düsseldorf von 245238 Wahlberechtigten<br />
187464 ihre Stimme gültig abgaben. An der Wahl zur Nationalversammlung<br />
durften die Frauen in Deutschland zum<br />
ersten Mal wählen. Mit der Änderung des Wahlrechts wurden<br />
auch die Franziskanerinnen aus dem Marienhospital am 19.<br />
Januar 1919 an die Urne gerufen. Über die<br />
erste Teilnahme der Schwestern an einer Volksabstimmung<br />
gab die Chronistin zu Protokoll:<br />
„Am 19. Januar war großer Wahltag; infolge<br />
des neuen Wahlrechtes auch für das weibliche<br />
Geschlecht gab es natürlich neue Aufgaben<br />
zu erledigen; alles war auf den Beinen und<br />
wem das nicht möglich, dem wurde Pferd<br />
und Wagen, Fahrstühle und sonstiges Fortbewegungsmaterial<br />
zur Verfügung gestellt. Von<br />
21 <strong>Jahre</strong>n angefangen bis hinauf zur ältesten<br />
Großmama bei Schwester Canisia lernte alles<br />
den Weg zum Hirschchen (Alt-Pempelfort 2),<br />
das war unser Wahllokal, kennen. Die Vorgesetzte<br />
mit den älteren Schwestern, dann<br />
wieder ein Trupp der jüngeren, die Postulanten,<br />
alles marschierte zum Hirschchen und gab<br />
seinen Zettel ab; knurrend ließen die Roten die<br />
Schwarzen durch und unter einiger Aufregung,<br />
denn man befürchtete immer unangenehme<br />
Zwischenfälle, kamen alle wieder glücklich,<br />
von den Beschützern begleitet, zum Hospital<br />
zurück. Einige Leutnants und Hausleute hatten<br />
sich nämlich mit festen Stöcken bewaffnet für<br />
eventuelle Vorfälle gerüstet und sorgten in<br />
bester Weise, daß das Marienhospital mit<br />
seinen Insassen im Wahllokal zu seinem<br />
Rechte kam“.<br />
Nach der deutschen Kapitulationserklärung<br />
im Herbst 1918 konnte das Marienhospital<br />
in kurzer Zeit seinen Betrieb<br />
wieder auf Zivilbelegung umstellen. Ein<br />
Problem blieben die aus dem Lazarett zur<br />
Weiterbehandlung verbliebenen Soldaten,<br />
die wie zivile Patienten behandelt wurden,<br />
sich aber ohne militärische Führung nur<br />
widerwillig den Anordnungen des Pflegepersonals<br />
unterwarfen. „Für Ärzte und<br />
Schwestern war der Umgang mit den Patienten<br />
besonders auf der Männerstation<br />
außerordentlich schwierig“, beginnt ein<br />
Eintrag in der Chronik der Franziskanerinnen<br />
im April 1919. „Die meisten waren<br />
verhetzt und aufrührerisch gesinnt; die<br />
größte Vorsicht mußte gebraucht werden,<br />
wollte man auch nur einigermaßen die<br />
Beobachtung der Hausordnung verlangen.<br />
‚Ich lasse mir von Niemand etwas sagen‘,<br />
das hörte man täglich; einer sagte sogar<br />
zum Chefarzt: ‚Sie haben mir überhaupt<br />
nichts zu sagen!‘ Ein anderer bemerkte der<br />
Stationsschwester: ‚Wartet, es soll schon<br />
bald anders mit Euch kommen‘. ... Die<br />
großen Unordnungen, welche durch Aufhebung<br />
der militärischen Disziplin in den<br />
Lazarettabteilungen der Krankenhäuser<br />
hervorgerufen wurde, hatte zur Folge, daß<br />
sich die Vertreter der betreffenden Lazarette<br />
veranlaßt sahen an das Generalkommando<br />
eine Klageschrift zu richten, welche diesen<br />
Zuständen ein Ende machten. Es wurden<br />
auch Maßregeln getroffen, welche wieder<br />
einigermaßen Ordnung brachten, jedoch<br />
war es der sehnlichste Wunsch aller, daß<br />
bald die Möglichkeit geschaffen wurde, die<br />
Lazarette vollständig aufheben zu können“.<br />
90
Die Französische Besatzung<br />
1921/1925<br />
Die Französische<br />
Besatzung 1921/1925<br />
Die Niederschlagung des Spartakistenaufstandes<br />
ließ der Düsseldorfer Bevölkerung<br />
nur kurze Zeit zum Durchatmen.<br />
Als Deutschland die durch den Versailler<br />
Vertrag auferlegten Reparationsansprüche<br />
nicht mehr erfüllen konnte, wurden Düsseldorf<br />
und einige Ruhrgebietsstädte von den<br />
Alliierten besetzt. Am 8. März 1921 rückten<br />
französische Truppen in die Stadt ein und<br />
übernahmen die Gewalt. Die Besatzungsmacht<br />
rief den Belagerungszustand aus,<br />
ließ Theater, Kinos und Lokale schließen,<br />
requirierte Wohnungen, kontrollierte den<br />
Straßen- und Personenverkehr. Außerdem<br />
gab es Post- und Pressebeschränkungen<br />
sowie Einschränkungen in der Versammlungsfreiheit.<br />
Zwar wurden viele Bestimmungen<br />
nach kurzer Zeit gelockert oder<br />
zurückgenommen, doch blieb das tägliche<br />
Leben beschwert. Drückend war vor allem<br />
die Wohnungsnot, da die französische Besatzungsmacht<br />
neben Kasernen, Schulen<br />
und Vereinsheimen auch unzählige Privathäuser<br />
zur Unterbringung ihrer Streitkräfte<br />
beschlagnahmte.<br />
Da die Franzosen auch kirchliche und<br />
medizinische Einrichtungen requirierten,<br />
befürchteten der Vorstand und die Franziskanerinnen<br />
für das Marienhospital das<br />
Schlimmste. In der Ordenschronik heißt es:<br />
„Die Franzosen beschlagnahmten zuerst 60<br />
Betten und am 10. April 1921 sogar <strong>150</strong>“.<br />
Am Ende begnügte sich die Besatzungsmacht<br />
mit der Inanspruchnahme eines<br />
Teils der Männerstationen nebst Büro und<br />
Operationssaal, „die sie dann einige Monate<br />
in entgeltliche Benutzung nahmen“.<br />
Nach dem von beiden Seiten<br />
im April 1921 unterzeichneten<br />
Vertrag musste das Marienhospital<br />
dem französischen Militär<br />
„eine Anzahl Betten zur<br />
Verfügung halten, den Kranken<br />
und dem dazu gehörigen<br />
militärischen Pflegepersonal<br />
Unterkunft und Verpflegung<br />
gewähren, die technischen<br />
Einrichtungen gegen Bezahlung<br />
zur Verfügung stellen,<br />
desgl. auch dem militärischen<br />
Chefarzt die benötigten Räume<br />
einrichten“. Bereits Ende Dezember 1921 wurden die<br />
unter Zwang abgetretenen Räume nicht mehr benötigt und<br />
von den Franzosen wieder freigegeben.<br />
Aller deutschen Propaganda gegen die französischen<br />
Besatzungstruppen zum Trotz, denen ständig Gräueltaten und<br />
Übergriffe gegen die deutsche Zivilbevölkerung zugeschrieben<br />
wurden, zeigten die in das Marienhospital eingewiesenen<br />
Soldaten gegenüber den Ärzten und Schwestern ein korrektes<br />
Verhalten. „An Geburtstagen und Namenstagen der Schwestern“,<br />
so die Ordenschronik, „trafen Gratulationsbriefe ein,<br />
welche davon Zeugnis geben, wie die Besatzungstruppen<br />
das Wohlwollen zum Ausdruck bringen, daß sie stets den<br />
Schwestern entgegenbrachten“. So erhielt beispielsweise<br />
Oberin Sw. Athanasia an ihrem Namenstag (2. Mai 1921)<br />
zahlreiche Zuschriften und Geschenke von französischen<br />
Soldaten. In einem Dankschreiben an den französischen<br />
Generaloberarzt in Mainz erwiderte sie: „Im Namen aller<br />
Kasernenstraße, Französische<br />
Besatzung, um 1923<br />
Tonhallenstraße, Französische<br />
Besatzung, um 1923<br />
Schloss Jägerhof, Französische<br />
Besatzung, um 1923<br />
91
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Propagandaflugblatt, um 1923<br />
Ordenschronik der Franziskanerinnen 1921 (Auszug)<br />
In unserem Hospital befanden sich unter<br />
den Franzosen auch Besatzungstruppen,<br />
Neger aus Madagaskar. Darunter war<br />
auch ein an schwerer Grippe erkrankter<br />
Mann mit Namen Esandraodha, der noch<br />
nicht getauft war. Als die ihn pflegende<br />
Schwester auf den lebensgefährlichen Zustand<br />
seiner Krankheit aufmerksam machte,<br />
verlangte er nach einem Priester. ...<br />
Schwestern des Marienhospitals, der ganzen<br />
Genossenschaft und im eigenen Namen dankt<br />
Unterzeichnete recht herzlich für das uns überreichte<br />
Geschenk (Ciborium) und die schönen<br />
nützlichen Bücher für die einzelnen Schwestern.<br />
Was die pflegenden Schwestern während der<br />
Grippe-Epidemie im Frühjahr 1921 den französischen<br />
Kranken getan, hätte auch jede andere<br />
Schwester bereitwilligst übernommen, wenn<br />
sie im Gehorsam damit beauftragt worden<br />
wäre; somit kommt das Verdienst der ganzen<br />
Genossenschaft zugute, die ihre Aufgabe und<br />
ihre Pflicht darin findet aus Liebe zu Gott allen<br />
Kranken ohne Unterschied nach Kräften die<br />
bestmögliche Pflege angedeihen zu lassen. ...<br />
Ich bitte der hohen Commission, der französischen<br />
Republik, dem Herrn General Jean-Marie<br />
Degoutte unseren besten Dank übermitteln zu<br />
wollen. gez. Schw. Athanasia, Oberin“.<br />
Schon während des Ersten Weltkrieges<br />
hatte sich die deutsche Propaganda lautstark<br />
über den Einsatz von Kolonialtruppen empört.<br />
Deutsche Zeitungen schrieben von „einem<br />
schmachvollen Schauspiel“; die Westmächte<br />
hetzten „Mongolen und Neger auf die weiße<br />
Rasse“. Nach der Niederlage empfanden viele<br />
Deutsche die Afrikaner am Rhein als besondere<br />
Demütigung. „Die Verwendung farbiger Truppen<br />
niederster Kultur als Aufseher über eine<br />
Er betete immer, und so ward ihm die große<br />
Gnade zuteil, die hl. Taufe zu empfangen.<br />
... Ein schon katholisch gewordener Corporal,<br />
auch Neger, besuchte ihn öfter und die<br />
Beiden beteten zusammen den Rosenkranz.<br />
Der arme Kranke litt viel, aber er hatte soviele<br />
Kraft und Trost in der katholischen Religion<br />
gefunden, daß er voll Vertrauen wartete, bis<br />
sein Schöpfer ihn am 5. April 1921 zu sich rief.<br />
Bevölkerung von der hohen geistigen und<br />
wirtschaftlichen Bedeutung der Rheinländer“,<br />
so Reichspräsident Friedrich Ebert, sei<br />
eine „Verletzung der Gesetze europäischer<br />
Zivilisation“. Die Schwestern im Marienhospital<br />
ließen sich von der Propaganda nicht<br />
beeinflussen und behandelten farbige Soldaten,<br />
wie die erhaltenen Dankschreiben<br />
von „schwarzen Truppen“ im Ordensarchiv<br />
zeigen, mit der gleichen Fürsorge, die auch<br />
alle anderen Patienten erfuhren.<br />
Nachdem sich das Verhältnis zwischen<br />
Besatzungsregime und Bevölkerung bis zu<br />
einem gewissen Grad eingependelt hatte,<br />
zerbrachen die friedlichen Beziehungen<br />
abrupt am 11. Januar 1923 mit dem Einmarsch<br />
französischer und belgischer Truppen<br />
ins Ruhrgebiet. Die deutsche Regierung<br />
ordnete Trauerbeflaggung an und rief die<br />
Bevölkerung im besetzten Gebiet zum<br />
Widerstand auf. Die Franzosen verstärkten<br />
demgegenüber den Druck in den alten<br />
Sanktionsgebieten, belasteten noch mehr<br />
den Wohnungsmarkt und versuchten vor<br />
allen Dingen, den passiven Widerstand<br />
der Beamten durch Geld- und Haftstrafen<br />
sowie Ausweisungen zu brechen.<br />
Das Marienhospital wurde vom 12.<br />
Januar bis 29. Dezember 1923 teilweise<br />
wieder von französischen Soldaten belegt.<br />
Hierzu war erneut ein Vertrag mit der<br />
Besatzungsmacht geschlossen worden,<br />
da sonst eine Beschlagnahme gedroht<br />
hätte. Ungeachtet des Vertrages stand im<br />
Herbst 1923 die gesamte Beschlagnahme<br />
des Marienhospitals bevor, doch kam es<br />
hierzu nicht, da sich die Franzosen für eine<br />
Requirierung des Evangelischen Krankenhauses<br />
am Fürstenwall entschieden hatten.<br />
92
Das 50jährige Bestehen<br />
des Marienhospitals<br />
Das 50jährige Bestehen<br />
des Marienhospitals<br />
Höhepunkt des <strong>Jahre</strong>s 1922 waren die Feierlichkeiten<br />
zum 50jährigen Bestehen des<br />
Marienhospitals. „Äußere Umstände“, wie<br />
es in der Chronik heißt, hatten verhindert,<br />
das Jubiläum im Sommer des Vorjahres zu<br />
begehen. Dass die Festlichkeiten zur Erinnerung<br />
an die Eröffnung des Marienhospitals<br />
im Juli 1871 erst ein Jahr später stattfinden<br />
konnten, stand ohne Zweifel im Zusammenhang<br />
mit dem unerwünschten Aufenthalt<br />
französischer Besatzungssoldaten in der<br />
Anstalt. „Auch heute ist zum Festefeiern<br />
gewiß nicht die Zeit“, erklärte der Vorstand<br />
in einer von Pater Bertold Bockolt OFM aus<br />
Anlass des Jubiläums verfassten Schrift über<br />
die bisherige Entwicklung des Marienhospitals.<br />
Nach der Freigabe des Hauses glaubten<br />
die Verantwortlichen jedoch, „jetzt, wo die<br />
äußeren Hindernisse des Vorjahres nicht<br />
mehr bestehen, geistliche und weltliche<br />
Behörden, Mitarbeiter und Freunde des<br />
Hauses zu einer schlichten Kundgebung<br />
einladen zu sollen, um zunächst Gott zu<br />
danken für seinen bisherigen Schutz, um<br />
dann auch dankbar zu gedenken aller Gönner<br />
und Freunde der Anstalt, um ferner die<br />
Öffentlichkeit auf die stille Arbeit katholischer<br />
Karitas hinzuweisen und um endlich<br />
alle zu bitten, die Arbeiten des Hauses auch<br />
in Zukunft mit Wohlwollen und tatkräftiger<br />
Unterstützung zu begleiten“.<br />
Nach einem feierlichen Hochamt, das<br />
vom Kölner Kardinal Karl Joseph Schulte<br />
zelebriert wurde, fand am 19. Oktober<br />
1922 im Festsaal des Krankenhauses<br />
der Empfang der zahlreich erschienenen<br />
Ehrengäste statt.<br />
Ordenschronik der Franziskanerinnen 1923 (Auszug)<br />
Am 9. Januar 1923 wurde unser Hospital<br />
wieder in große Aufregung versetzt, da sich<br />
wiederum die Franzosen hier angemeldet haben.<br />
Es wurde tapfer gebetet, damit der liebe<br />
Gott doch diese Gefahr von unserem Hause<br />
ablenken möge. Unter der französischen<br />
Besatzung war eine große Grippe-Epidemie<br />
ausgebrochen, und war die Zahl der Erkrankten<br />
nicht unterzubringen. Deshalb kamen die<br />
französischen Offiziere wiederum zu uns, um,<br />
wie es schien, hier wieder sich einzuquartieren.<br />
Die Arbeit nahm, weil das Haus außerdem<br />
sehr überbelegt war, überhand, zumal 10<br />
Schwestern schwer an der Grippe erkrankt<br />
waren. Die gute Schwester Blasia, welche alle<br />
mit großer Aufopferung pflegte, erkrankte<br />
ernstlich. Es schien, als wolle der liebe Gott sie<br />
zu sich nehmen, und stellten wir dem lieben<br />
Gott in flehentlichem Gebete alles anheim. ...<br />
Am 10. Januar 1923 schellte das Besatzungsamt<br />
hier an, daß also wieder 50 Betten für<br />
Marienhospital, Hauptfront, um 1920<br />
französische Truppen beschlagnahmt wären.<br />
Also forderte der liebe Gott wiederum dieses<br />
Opfer von uns. Es mußte so schnell ausgeräumt<br />
werden, da an uns die Mitteilung erging, daß<br />
sobald als möglich die Betten belegt würden.<br />
Da nun gerade Sonntag war, mußte trotzdem<br />
die Verlegung der Krankenkassen-Patienten zu<br />
der I. Männerstation vorgenommen werden,<br />
und schon am 12. Januar 1923 wurde die ganze<br />
II. Männerstation mit Franzosen belegt. ...<br />
Am 6. October 1923 wurden wir wiederum<br />
in große Aufregung versetzt wegen<br />
neuer wiederholter Beschlagnahme unseres<br />
Hospitals durch die Franzosen. Gott sei Dank<br />
lenkte der liebe Gott alle Gefahren von uns<br />
ab, und schon am 10. October 1923 verkündeten<br />
die Zeitungen die Beschlagnahme des<br />
Evangelischen Krankenhauses. Wir dankten<br />
dem lieben Gotte für seine Fürsorge und dem<br />
hl. Antonius für seine treue Hilfe.<br />
93
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Die Inflation<br />
Jubiläumsgedicht, 1895<br />
Einladungskarte, 19. Oktober 1922<br />
Marienhospital, Kinderabteilung<br />
Knaben, um 1930<br />
Die anlässlich des Jubiläums eingegangenen<br />
Spenden aus der Düsseldorfer Industrie erlaubten<br />
es dem Marienhospital, in der Folgezeit die<br />
Kinderstation der Anstalt auszubauen und einen<br />
Bestrahlungsapparat zur Behandlung krebskranker<br />
Patienten anzuschaffen, der in anderen<br />
Krankenhäusern der Stadt bereits seit längerer<br />
Zeit zur Standardeinrichtung gehörte.<br />
Der passive Widerstand gegen die Besatzungsmächte<br />
konnte nur aufrechterhalten<br />
werden, weil das Reich mit Lohnsicherungen<br />
und Krediten half. Es war abzusehen,<br />
dass die Finanzkraft des Reiches den Belastungen<br />
der Rheinlandbesatzung auf Dauer<br />
nicht gewachsen war. Die Quelle, die den<br />
passiven Widerstand speiste, musste in<br />
absehbarer Zeit versiegen. Die Lasten, die<br />
sich das Reich mit der Finanzierung des<br />
Ruhrkampfes auferlegt hatte, beschleunigten<br />
zudem den Verfall der ohnehin zerrütteten<br />
Geldwirtschaft immer schneller. Die<br />
deutschen Notenpressen liefen auf vollen<br />
Touren und bewirkten eine nie dagewesene<br />
Hochinflation.<br />
Die Geldentwertung führte dazu, dass<br />
der wirtschaftliche Betrieb des Marienhospitals<br />
1923 sich nur noch im Barzahlungsverkehr<br />
abspielte und mit schwindelerregenden<br />
Zahlen operierte. In der Tat hatte<br />
die Teuerungsrate astronomische Summen<br />
erreicht. Betrug der tägliche Pflegesatz<br />
für die dritte Klasse im Mai 1922 noch 80<br />
Mark, so war er im September 1923 bereits<br />
auf 7,1 Millionen Mark gestiegen.<br />
„Die Berechnung von Allem“, so die<br />
Schwesternchronik, „wurde mit jedem<br />
Tage schwieriger. Man geriet in eine geradezu<br />
kritische Lage, aus der man sich<br />
äußerst schwer herauszuwinden verstand.<br />
Sämtliche Stiftungsgelder wurden wertlos,<br />
alle Gehälter mußten aufgewertet<br />
werden, ebenso alle Vergütungen. Die<br />
Gehälter für die Chefärzte wurden wie<br />
folgt ausgerechnet: Das Friedensgehallt<br />
multipliziert mit dem vom Reichswohlfahrtsminister<br />
festgesetzten Teuerungs-<br />
Index, jedoch sollten die Gehälter für Beide<br />
94
Selbstversorgung<br />
3 % der Gesamteinnahme III. Klasse nicht<br />
übersteigen. Die Ausstellung der Rechnung<br />
war äußerst schwierig. Man mußte sich alle<br />
Tage nach dem Dollarkurs erkundigen und<br />
hiermit wurde der Preis ausgerechnet. Daher<br />
kamen ganz schrecklich große Zahlen<br />
zum Vorschein, welche am Anfang sehr<br />
schwer zu lesen waren“.<br />
Ordenschronik der Franziskanerinnen 1923 (Auszug)<br />
Die Teuerung nimmt täglich zu.<br />
Am 1. November 1923 kostete:<br />
1 Pfund Brot 3 Milliarden<br />
1 Pfund Fleisch 36 Milliarden<br />
1 Glas Bier 4 Milliarden<br />
Am 15. November 1923 kostete:<br />
1 Pfund Brot 80 Milliarden<br />
1 Pfund Fleisch 900 Milliarden<br />
1 Glas Bier 52 Milliarden<br />
Am 1. Dezember 1923 kostete:<br />
1 Pfund Brot 260 Milliarden<br />
1 Pfund Fleisch 3 Billionen,200 Milliarden<br />
Ende 1923 wurde der wertlosen Papiermark<br />
zunächst die Goldmark, dann die<br />
Rentenmark entgegengestellt. Letztere<br />
wurde am 30. August 1924 durch die<br />
Reichsmark abgelöst, die wieder durch<br />
Gold und wertbeständige Devisen gedeckt<br />
war. Durch das Vertrauen der Bevölkerung<br />
in die neue Währung blieben der Wert des<br />
Geldes und die Preise stabil. Im Februar<br />
1924 wurde der Pflegesatz der dritten Klasse<br />
auf 4,20 Mark festgelegt, wodurch fast<br />
wieder das Niveau des Friedenssatzes von<br />
3 Mark erreicht worden war. Nach mehreren<br />
<strong>Jahre</strong>n des wirtschaftlichen Verfalls<br />
konnte der Vorstand des Marienhospitals<br />
zum Ende des <strong>Jahre</strong>s 1924 wieder einen<br />
Finanzbericht mit günstigem Abschluss<br />
vorlegen.<br />
Selbstversorgung<br />
Im Juli 1924 wurde gegenüber dem Isolierhaus ein<br />
großes Treib- und Gewächshaus für Wintergemüse,<br />
Salat und Gurken errichtet. Das Marienhospital sollte<br />
so den ganzen Winter hindurch mit frischem Gemüse<br />
und Salat versorgt werden.<br />
Den Verfall des Wertes der deutschen Währung<br />
stellt die folgende Übersicht der Pflegesätze im<br />
Marienhospital dar:<br />
Preise pro Tag<br />
ab 1. Juli 1922<br />
III. Klasse 110,- Mark<br />
IIb. Klasse <strong>150</strong>,- Mark<br />
IIa. Klasse 200,- Mark<br />
I. Klasse 275-300,- Mark<br />
ab 16. November 1922<br />
III. Klasse 1340,- Mark<br />
IIb. Klasse 1000,- Mark<br />
IIa. Klasse 1600,- Mark<br />
I. Klasse 2000,- Mark<br />
ab 1. August 1923<br />
III. Klasse 97000,- Mark<br />
IIb. Klasse 159000,- Mark<br />
IIa. Klasse 212000,- Mark<br />
I. Klasse 424000,- Mark<br />
ab 1. September 1923<br />
III. Klasse 2467000,- Mark<br />
IIb. Klasse 4353000,- Mark<br />
IIa. Klasse 5804000,- Mark<br />
I. Klasse 11608000,- Mark<br />
ab 9. September 1923<br />
III. Klasse 7140000,- Mark<br />
IIb. Klasse 12600000,- Mark<br />
IIa. Klasse 16800000,- Mark<br />
I. Klasse 33600000,- Mark<br />
ab 16. September 1923<br />
(Einführung der Goldmark-Berechnung)<br />
III. Klasse 3,30 Goldmark<br />
IIb. Klasse 4,50 Goldmark<br />
IIa. Klasse 6,- Goldmark<br />
I. Klasse 9,- Goldmark<br />
1 Goldmark entspricht 1 Billionen Mark<br />
Notgeldschein der Stadt Düsseldorf, 1923<br />
Inflationsgeld, um 1923<br />
95
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Gewächshäuser, um 1930<br />
Ordenschronik der Franziskanerinnen 1925 (Auszug)<br />
12. April 1925: Bis zu dem hochheiligen<br />
Osterfeste bot das neu errichtete Treibhaus<br />
schon ca. 400 Köpfe Salat und etwa<br />
130 große Gurken. Neben den neuen<br />
Wirtschaftsgebäuden wurde ein großer<br />
Keller aufgebaut für Kartoffel und Gemüse<br />
unterzubringen. Über demselben wurde<br />
eine großartige Bleiche angelegt.<br />
Wirtschafts-Ertrag 1925:<br />
22 Schweine 6779,50 Mark<br />
72 Hühner 316,00 Mark<br />
14837 Eier 2256,83 Mark<br />
Erzeugnisse aus der Gemüsezucht im<br />
<strong>Jahre</strong> 1925 in der Treibhausanlage:<br />
1000 Pfund Spinat<br />
590 Pfund Feldsalat<br />
75 Pfund Kresse<br />
90 Bund Radieschen<br />
1300 Pfund Stielmus<br />
1550 Stück Kopfsalat<br />
250 Pfund Schnittgemüse<br />
111 Pfund Strauchbohnen<br />
140 Pfund Kurze Möhren<br />
835 Stück Blumekohl<br />
1540 Stück Schlangengurken<br />
745 Pfund Tomaten<br />
Das Marienhospital im<br />
Jahr der GESOLEI<br />
Aufsehen weit über die Grenzen der Stadt<br />
Düsseldorf und des Deutschen Reiches hinaus<br />
erregte im <strong>Jahre</strong> 1926 die Ausstellung<br />
„Gesundheitspflege, Soziale Fürsorge und<br />
Leibesübungen“ (Gesolei), die am 8. Mai<br />
auf dem Ausstellungsgelände in Golzheim<br />
eröffnet wurde. Ziel der Messe war es, „das<br />
gesundheitsgeschädigte deutsche Volk“ nach<br />
dem Ersten Weltkrieg und der Wirtschaftsrezession<br />
„für die Zukunft auszurüsten und<br />
für die Kraftanspannung des Neuaufbaus zu<br />
Gesolei, 1926<br />
ertüchtigen“. Auf einem Gelände von 400000<br />
qm waren 171 Ausstellungsbauten mit einer<br />
Fläche von 120000 qm errichtet, die für<br />
die Arbeitsfelder Gesundheitspflege, Soziale<br />
Fürsorge und Leibesübungen zeigen sollten,<br />
„was bereits geschieht und wo noch wichtige<br />
Aufgaben liegen, die in der Zukunft<br />
zu lösen sind“. Dem Ruf, die Ausstellung<br />
zu beschicken, waren das Reich, einzelne<br />
Länder, städtische Verwaltungen sowie<br />
zahlreiche private Organisationen gefolgt.<br />
Wie aus einem Bericht des Düsseldorfer<br />
Tageblatts vom 8. Mai 1926 hervorgeht,<br />
befand sich unter den zahlreichen<br />
Ausstellungsobjekten, die einen Einblick<br />
in die Einrichtungen und Betätigungen<br />
der Düsseldorfer Kranken‐, Heil‐ und Pflegeanstalten<br />
geben sollten, auch ein Modell<br />
des Pempelforter Marienhospitals.<br />
Bedauerlicherweise sind weder das Ausstellungsobjekt<br />
selbst noch photographische<br />
Dokumente, auf denen es abgelichtet war,<br />
erhalten geblieben.<br />
Das Modell des Marienhospitals in der<br />
Ausstellungshalle dürfte im wesentlichen<br />
den Entwicklungsstand der Anstalt widergespiegelt<br />
haben, den der Chefarzt Franz<br />
Kudlek 1926 in einem zur Gesolei veröffentlichen<br />
Begleitbuch über die Düsseldorfer<br />
Kranken‐, Heil‐ und Pflegeanstalten wie<br />
folgt beschrieb: „Das Hauptgebäude gliedert<br />
sich in einen Mittelbau, 2 Seitenflügel<br />
und einen Mittelflügel. An die Westseite<br />
des Hauptbaues schließt sich ... die Kapelle<br />
an. Ostwärts vom Hauptbau liegt das Isolierhaus,<br />
südwärts das Maschinen- und Kesselhaus,<br />
von dem aus das ganze Hospital<br />
beheizt und mit warmem Wasser versorgt<br />
wird, und eine Reihe Wirtschaftsgebäude.<br />
Zu beiden Seiten des Hauptgebäudes<br />
sind Grünanlagen vorhanden, die den<br />
Rekonvaleszenten Bewegung und Ruhe im<br />
Freien ermöglichen. In dem außerdem noch<br />
vorhandenen Gemüse‐ und Obstgarten ist<br />
die neue Gewächshaus-Anlage errichtet.<br />
Das Geschoß zur ebenen Erde im Hauptteil<br />
dient im wesentlichen Wirtschaftszwecken,<br />
96
Das Marienhospital<br />
im Jahr der GESOLEI<br />
wie Bäckerei, Koch-, Waschküche, Mangelraum,<br />
Bügelzimmer, Apparate- und Aufbewahrungsräume,<br />
Werkstätte für Schreiner<br />
und Anstreicher usw.. In dem nach Süden<br />
zu gelegenen Teil des Ostflügels liegt die<br />
physikalisch-therapeutische Abteilung; daran<br />
angegliedert ist das Röntgeninstitut<br />
und das Laboratorium für die chirurgische<br />
Abteilung. Das 1. Obergeschoß enthält<br />
im Mittelbau die Empfangs-, Warte-, Aufnahme-<br />
und Verwaltungsräume, sowie das<br />
Ärzte‐Casino. Nach Osten hin vom Eingang<br />
liegt die chirurgisch-gynäkologische Station.<br />
Davon durch einen etwa 30 qm großen<br />
Raum getrennt und vollkommen für sich<br />
abgeschlossen liegt die aus 7 Räumen bestehende<br />
Operationsabteilung. In den übrigen<br />
Geschossen befinden sich die Räume<br />
für die Unterbringung der Kranken. In dem<br />
straßenwärts gelegenen Teil des Ost‐ und<br />
Westflügels befinden sich die Krankenzimmer<br />
der Privatstation, die sich durch 3 Geschosse<br />
hindurchziehen und miteinander<br />
durch gesonderte Treppenverbindungen<br />
in Zusammenhang stehen. Die einzelnen<br />
Geschosse sind miteinander durch breite<br />
Steintreppen und 2 Personen-Aufzüge verbunden.<br />
Im ganzen Krankenhaus wurden,<br />
um den in den letzten <strong>Jahre</strong>n immer mehr<br />
zunehmenden Straßenlärm vollkommen<br />
auszuschalten und den Kranken, trotz der<br />
Zentrallage des Krankenhauses, den Aufenthalt<br />
möglichst angenehm zu gestalten,<br />
in sämtlichen Räumen Doppelfenster eingebaut.<br />
Der rückwärtige Mittelflügel stellt in<br />
seinen unteren 3 Geschossen das Schwesternhaus<br />
dar, während das obere Geschoß<br />
als Schlaf- und Aufenthaltsraum für das<br />
weibliche Dienstpersonal zur Verfügung<br />
steht. Bei allen baulichen Veränderungen<br />
war der leitende Gesichtspunkt nicht allein<br />
die Raumvermehrung für Krankenbetten,<br />
sondern die Erfüllung der durch die Fortschritte der Chirurgie<br />
sowie der inneren Medizin und Hygiene bedingten Forderung<br />
nach vollkommenen Operations‐, Laboratoriums‐ und therapeutischen<br />
Einrichtungen. Deshalb sind auch die Ausmessungen<br />
des vornehmlich für diese bestimmten Ostflügels mit über<br />
40 m Länge denen der anderen Bauten weit voranstehend.<br />
Hier dehnt sich ... im Untergeschoß zunächst die physikalischtherapeutische<br />
Abteilung aus, daran angrenzende das Röntgeninstitut.<br />
Die erstgenannte Abteilung setzt sich zusammen<br />
aus: a) Dem Institut für Bäder- und elektrische Behandlung.<br />
Dasselbe enthält die Badeeinrichtung für Voll- und Teilbäder<br />
(Sitz-, Fuß- Handbäder<br />
usw.), eine Einrichtung für allerlei<br />
Duschen, Dampfkasten<br />
und elektrisches Lichtbad, ein<br />
elektrisches Vierzellenbad, Diathermieapparate,<br />
elektrische<br />
Percussionsmassage usw., 12<br />
Stück medicomechanische<br />
Pendelapparate und eine Bogheansche<br />
Atmungsmaschine,<br />
vornehmlich verwendbar für<br />
Gesolei, Gesamtansicht, 1926<br />
Gesolei, Teilansicht mit<br />
Restaurant Rheinterasse, 1926<br />
97
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Gesolei, Liliputbahn mit Feuerwehrturm, 1926<br />
Die Düsseldorfer Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten 1926<br />
Anstalt Adresse Betten<br />
Allgemeine städtische Krankenanstalten Moorenstr. 5 1450<br />
Westdeutsche Kieferklinik Sternstr. 35/41 70<br />
Augusta-Krankenhaus Amalienstr. 9 200<br />
Auguste-Viktoria-Haus Blumenthalstr. 12 140<br />
Krankenhaus der Dominikanerinnen Rheinallee 26/27 180<br />
Dorotheenheim Dorotheenstr. 85 160<br />
Evangelisches Krankenhaus Fürstenwall 91 360<br />
Freytag-Krankenhaus Gartenstr. 15 25<br />
Gertrudisheim Ulmenstr. 83 180<br />
Privatklinik Golzheim Kaiserswerther Str. 329 80<br />
St. Josephs-Krankenhaus Kruppstr. 23 130<br />
St. Josephs‐Heil‐ und Pflegeanstalt Unterrather Str. 1 252<br />
Luisenkrankenhaus Degerstr. 8/10 60<br />
Marienhospital Sternstr. 91 450<br />
Martinuskrankenhaus Martinstr. 7 60<br />
Provinzial Heil‐ und Pflegeanstalt Grafenberg Bergische Landstr. 2 840<br />
Städtisches Pflegehaus Himmelgeister Str. 152 785<br />
Theresienhospital Stiftsplatz 13 200<br />
Tuberkulose-Kinderheilstätte Waldesheim Stadtwaldstr. 3 135<br />
Vinzenzhaus Schloßstr. 81/85 80<br />
Wöchnerinnenheim Flurstr. 14 50<br />
chronisch Lungen- und Herzkranke mit<br />
gestörter Atmungstätigkeit. Diesem Institut<br />
ist angegliedert auch die Licht-Therapie.<br />
In demselben sind untergebracht ein für<br />
therapeutische Bestrahlungen bestimmter<br />
Röntgenapparat, eine Krohmeyersche<br />
Quarzlampe, 2 Bachsche und 1 Jesionecksche<br />
Höhensonne und 2 Solluxlampen.<br />
Außerdem sind die letztgenannten Strahlenapparate<br />
in nochmaliger Ausführung<br />
auf der neu ausgebauten Kinderstation in<br />
einem eigens dazu hergestellten Raum aufgestellt,<br />
um möglichst ausgiebig bei der Behandlung<br />
spezifischer Kindererkrankungen<br />
Verwendung zu finden. b) Dem diagnostischen<br />
Röntgeninstitut. Dasselbe enthält<br />
einen allen Anforderungen genügenden<br />
Röntgenapparat mit sämtlichen in Betracht<br />
kommenden Hilfseinrichtungen. Demselben<br />
sind angegliedert ein phototechnisches<br />
Laboratorium zur Entwicklung und Weiterverarbeitung<br />
der Röntgenplatten und<br />
sonstiger, für wissenschaftliche Zwecke<br />
benötigter photographischer Aufnahmen.<br />
Über den eben genannten Räumen liegt die<br />
Operations‐Abteilung. Sie ist vom übrigen<br />
Krankenhaus völlig getrennt und besteht<br />
aus 7 Räumen: 2 großen Operationssälen<br />
mit Oberlicht, je einem Vorbereitungszimmer,<br />
einem weiteren Auskleidezimmer,<br />
einem Endoskopierraum und Sterilisationsraum.<br />
In dem einen Operationssaal<br />
werden alle Operationen ausgeführt, die<br />
teils als dringend bezeichnet werden und<br />
teils nicht als absolut steril anzusehen sind,<br />
während in dem zweiten Operationssaal<br />
nur Operationen ausgeführt werden, bei<br />
denen man absolut sicher weiß, daß man<br />
auf keinen Eiter stößt. Die spezifisch septischen<br />
Erkrankungen werden in einem<br />
besonders dafür bestimmten Raum auf<br />
der Station ausgeführt“.<br />
98
Das Marienhospital<br />
im Jahr der GESOLEI<br />
Dank der Stabilisierung der wirtschaftlichen<br />
Verhältnisse hatte das Marienhospital<br />
schon 1925 und 1926 ein umfangreiches<br />
Erneuerungs- und Erweiterungsprogramm<br />
aufstellen und verwirklichen können, das<br />
den Bau einer neuen Liegehalle und Terrasse,<br />
Ausbau und Neueinrichtung des<br />
dritten Stockwerkes im mittleren Flügel,<br />
Neubau eines Glockenturmes, Umbau<br />
des Pförtnerhauses, Einbau automatischer<br />
Fernsprechanlangen, Umgestaltung der<br />
Waschküche und Anlage neuer Gärten und<br />
Kühlanlagen umfasste. Gleichen Schritt mit<br />
den baulichen Erweiterungen hielt auch die<br />
ständige Modernisierung in hygienischer<br />
und technischer Beziehung, so dass das<br />
Marienhospital seine Vorrangstellung unter<br />
den konfessionellen Krankenanstalten<br />
behaupten konnte. Mit 450 Krankenbetten<br />
war es Mitte der zwanziger <strong>Jahre</strong> nach den<br />
Allgemeinen städtischen Krankenanstalten<br />
das zweitgrößte Krankenhaus in der Stadt<br />
Düsseldorf. 1925 wurden im Marienhospital<br />
4800 Kranke mit 136854 Verpflegungstagen<br />
von 11 Ärzten behandelt und 60<br />
Franziskanerinnen und 7 Krankenwärtern<br />
gepflegt.<br />
Das Marienhospital war als Institution<br />
aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. In<br />
der medizinischen Versorgung der Stadt<br />
nahm es eine herausragende Rolle ein, was<br />
durch seine offenbar hohen Belegungsziffern<br />
unterstrichen wurde. Als besonders<br />
fortschrittlich in der medizinischen Therapie<br />
und als Ergänzung für physikalische Therapien<br />
galt die bereits erwähnte Sonnenterrasse.<br />
Hier ließen sich Tuberkulose-Kranke<br />
und solche mit Gelenkerkrankungen therapieunterstützend<br />
Luft- und Sonnenbädern<br />
aussetzen.<br />
Dorotheenheim,<br />
Dorotheenstraße 85, um 1950<br />
Privatklinik Golzheim,<br />
Kaiserswerther Straße 329, um 1935<br />
Martinuskrankenhaus,<br />
Martinstraße 7, um 1950<br />
Gertrudisheim,<br />
Ulmenstraße 83, um 1930<br />
St. Josephs-Heil- und Pflegeanstalt,<br />
Unterrather Straße 1, um 1930<br />
Marienhospital,<br />
Treppenaufgang, um 1930<br />
99
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Die Privatabteilungen<br />
Mediziner, Psychiater, Theoretiker hatten<br />
sich schon lange mit Fragen der inneren<br />
Differenzierung der Patienten im<br />
Krankenhaus beschäftigt. Sanitätspolizeiliche<br />
Vorgaben schrieben die Trennung<br />
von Patientengruppen im Krankenhaus<br />
aus medizinischen Erwägungen, etwa<br />
der Absonderung ansteckender Kranker<br />
oder so genannter Irrer, schon immer vor.<br />
Isolierung der Kranken nach Krankheitsgruppen<br />
senkte das Sterblichkeitsrisiko<br />
spürbar. Die Differenzierung nach inneren<br />
und äußeren Krankheiten wurde ebenfalls<br />
gefordert und im Marienhospital von<br />
Beginn an durchgeführt. Praktische Erwägungen<br />
der Trennung von leichten und<br />
Marienhospital, Privatabteilung, um 1930<br />
Marienhospital, Privatzimmer, um 1930<br />
Marienhospital, Privatabteilung, um 1930<br />
schweren Erkrankungsfällen, alten und<br />
jungen Kranken ergaben sich im Alltag des<br />
Krankenhauses von selbst.<br />
Subjektivem Empfinden der Kranken,<br />
der Wahrung von Intimität durch die<br />
Möglichkeit der Abgrenzung gegen Mitpatienten<br />
maß 1892 der Privatdozent der<br />
Medizin in Berlin, Martin Mendelsohn, vor<br />
dem Hintergrund oft großer Krankensäle einen<br />
zusätzlichen „Heilfaktor“ bei: „Gewiss,<br />
man kann dort nicht jedem sein eigenes<br />
Zimmer geben – es wäre dies auch gar<br />
nicht vortheilhaft, denn der Kranke fühlt<br />
sich vereinsamt und vernachlässigt – aber<br />
es könnte doch wenigstens dafür gesorgt<br />
werden, dass der einzelne Kranke, zum<br />
mindestens zeitweise, vermag, sich dieser<br />
absoluten Gemeinschaft zu entziehen. Es ist<br />
zum wenigstens nicht Jedermanns Sache,<br />
vor neunzehn anderen Menschen Stuhlgang<br />
zu produziren, und man braucht nicht<br />
einmal ein junges Mädchen zu sein um in<br />
solchem Falle, wenn man sich schließlich<br />
dazu entschlossen hat, zu keinem Resultate<br />
zu kommen“.<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1904 gab es im Marienhospital<br />
30 Privatkrankenzimmer, 1912 erhöhte<br />
man sie auf 34. Was sprach dafür? Geschah<br />
dies vorwiegend aus ökonomischen Gründen?<br />
Soziale Abgrenzung? Die Schaffung<br />
von Privatzimmern erschien 1914 zum<br />
Beispiel dem Osnabrücker Vorsitzenden<br />
der kommunalen Krankenhauskommission<br />
wünschenswert, „weil diese besonders<br />
begehrt sind und ihre Belegung eine<br />
wesentliche nicht zu unterschätzende<br />
Einnahmequelle für das Krankenhaus bedeutet“.<br />
Wenn diese ökonomische Kalkulation<br />
zuträfe, müssten die Pflegesätze der<br />
Privatpatienten mehr kostendeckend die<br />
der anderen Klassen mitfinanzieren. Bei<br />
einer Gesamt-Bettenzahl im Pempelforter<br />
100
Die Wirtschaftskrise 1930/32<br />
Marienhospital von 450 Betten stellten<br />
1921 die rund 60 Privatbetten aber nur<br />
13 % des Gesamtangebotes dar.<br />
Bleibt der Aspekt, den der Berliner<br />
Arzt und Sozialhygieniker Alfred Grotjahn<br />
1908 vermutete: „An manchen Orten liegt<br />
in den Sonderklassen nach den hieraus erfließenden<br />
ärztlichen Honoraren leider ein<br />
Ausgleich für das kümmerliche oder ganz<br />
fehlende Gehalt des Chefarztes, wodurch<br />
das System selbst noch weniger verteidigenswert<br />
erscheint“. Die Differenzierung<br />
nach sozialen Gesichtspunkten war dann<br />
nicht mehr weit. Sie stellte aber eine vom<br />
Marienhospital von Beginn an und später<br />
immer wieder verurteilte interne Abgrenzung<br />
dar. Gleichwohl hatte die Anstalt<br />
seit ihrer Eröffnung in den Seitenflügeln<br />
einige von den übrigen Räumen abgeschlossene<br />
kleinere Krankenzimmer zur<br />
Aufnahme von „Pensionären“ der I. und<br />
II. Klasse bestimmt. Die Privatkranken mit<br />
besonderem Zimmer hatten etwa dreimal<br />
so viel zu zahlen wie der Armenpflegesatz<br />
ausmachte und nicht ganz doppelt so viel<br />
wie Privatkranke ansonsten.<br />
Mit der „Normalität“ der Institution<br />
Krankenhaus, mit seinem „Erfolg“ auch<br />
in bürgerlichen Kreisen als dem Ort der<br />
Heilung gegenüber häuslicher Krankenbehandlung<br />
war die „ganze Gesellschaft“<br />
ins Marienhospital eingezogen und mit<br />
ihr bisher in einem Krankenhaus nicht<br />
anzutreffende Schichten und Bedürfnisse.<br />
Also musste die „medizinische Attraktivität<br />
durch eine entsprechende standesgemäße<br />
Absonderung und Unterbringung in<br />
Einzel- bzw. Zweibettzimmern ergänzt<br />
werden“; auch ein Zugeständnis an das<br />
dem Krankenhaus stets wohlwollende Düsseldorfer<br />
Bürgertum, das dem „Geruch der<br />
Armut“ in den normalen Krankenzimmern<br />
ausweichen wollte. Die Privatabteilungen im Marienhospital<br />
stellten eine abgegrenzte, dem „Pöbel“ entzogene Welt dar.<br />
Die Wirtschaftskrise 1930/32<br />
Dem Ansehen des Marienhospitals in der Stadt entsprach die<br />
Finanzlage nur selten. Im Verlauf der Wirtschaftskrisenjahre<br />
Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger <strong>Jahre</strong> lag die Belegungsziffer<br />
des Marienhospitals<br />
bei durchschnittlich 190<br />
bis 200 Patienten und sank<br />
zeitweise auf eine Auslastung<br />
von nur <strong>150</strong> Betten. Die dramatische<br />
Minderbelegung<br />
hatte praktisch alle Krankenhäuser<br />
im Land erfasst und in<br />
den Verbänden allgemein die<br />
Diskussion um Herabsetzung<br />
von Krankenhausleistungen<br />
in Gang gesetzt. Im Hintergrund<br />
standen dabei auch die<br />
gesundheitspolitischen Vorstellungen<br />
des Wohlfahrtsstaates<br />
Weimarer Republik,<br />
Leistungen des Krankenhauses<br />
nach einheitlichen Prinzipien<br />
Marienhospital, Hauptfront,<br />
um 1930<br />
Ärztehaus, Ehrenstraße 14a,<br />
1928 fertig gestellt<br />
101
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Anleihe, 1930<br />
Düsseldorfer Nachrichten,<br />
2. Oktober 1932<br />
festlegen zu können. Die Arbeitsgemeinschaft der Versicherungsträger<br />
beantragte auch noch die Herabsetzung der<br />
Pflegesätze für die 95 % der bei ihnen versicherten Patienten,<br />
was die Finanzausfälle noch vergrößert hätte. Damit stieß sie<br />
auf einhellige Ablehnung der Krankenhäuser. Lediglich der<br />
Pauschalsatz für Entbindungen wurde nach Verhandlungen<br />
geringfügig herabgesetzt. Der Wohlfahrtsstaat stieß an<br />
seine Grenzen. Das Gesundheitswesen musste der allgemeinen<br />
Wirtschafts- und Finanzkrise, die mit dem „Schwarzen<br />
Freitag“ im Oktober 1929 ihren Höhepunkt gefunden<br />
hatte, Tribut zollen. Sparansätze durch Verminderung von<br />
Krankenhausleistungen, durch Vorenthaltung von Krankenhausbehandlung<br />
infolge Nichteinweisung ins Krankenhaus,<br />
drastische Pflegesatzsenkungen forderten unisono Staat und<br />
Arbeitsgemeinschaft der Versicherungsträger.<br />
Erweiterungsbauten<br />
1931/1932<br />
Bereits zwei <strong>Jahre</strong> nach Abschluss des Erneuerungs-<br />
und Erweiterungsprogramms<br />
hatte Chefarzt Dr. Franz Kudlek im Oktober<br />
1928 für das Marienhospital ein weiteres<br />
Bauvorhaben entwickelt. Vorgesehen war<br />
die Errichtung eines neuen Flügels mit<br />
100 Betten zur Aufnahme berufsgenossenschaftlicher<br />
Patienten. Der Neubau<br />
sollte mit einer therapeutischen Abteilung,<br />
einer Diathermieabteilung, Gemeinschaftsräumen<br />
für Frauen und drei getrennten<br />
Abteilungen mit zwei bis drei Betten für Infektionskranke<br />
im Erdgeschoss ausgestattet<br />
sein. Angesichts der Weltwirtschaftskrise<br />
war an die Ausführung des etwa 900000<br />
Mark teuren Bauprojektes jedoch vorerst<br />
nicht zu denken.<br />
Obwohl die Finanzlage noch mehr<br />
als dramatisch war, unterbreitete Regierungsbaumeister<br />
Karl Brocker dem Vorstand<br />
im Frühjahr 1931 ein vermindertes<br />
Umbau- und Erweiterungsprogramm, das<br />
für den Neubau der Röntgenabteilung, die<br />
Errichtung einer gynäkologisch-geburtshelferischen<br />
Abteilung, die Verbesserung<br />
der therapeutischen Einrichtung und die<br />
Änderung der alten Heizungsanlage einen<br />
Gesamtaufwand von 850000 Mark vorsah.<br />
Dank einer Anleihe über 1,2 Millionen<br />
Gulden bei einer Amsterdamer Inkassobank,<br />
für die der gesamte Grundbesitz des<br />
Marienhospitals verpfändet wurde, konnte<br />
noch im gleichen Jahr die Bauausführung<br />
in Angriff genommen werden. Kurz vor<br />
seiner Fertigstellung berichteten die Düsseldorfer<br />
Nachrichten am 2. Oktober 1932<br />
über den sechsgeschossigen Neubau an der<br />
102
Die Zeit des Nationalsozialismus<br />
Prinz-Georg-Straße: „Seit Monaten ist der<br />
Rohbau bereits fertig, und auch mit der<br />
Inneneinrichtung geht es gut voran, so daß<br />
im November, spätestens Anfang Dezember<br />
der Neubau in Benutzung genommen<br />
werden kann. ... Wenn in einigen Wochen<br />
die Arbeiten im Marienhospital beendet<br />
sein werden, wird das Krankenhaus an der<br />
Sternstraße zu den bedeutendsten Düsseldorfer<br />
Heilanstalten gerechnet werden<br />
müssen“.<br />
Wie aus der Chronik der Ordensschwestern<br />
hervorgeht, konnte ein Teil<br />
der Räume des Neubaues bereits am 23.<br />
Oktober 1932 in Gebrauch genommen<br />
werden. Nach einem Rundgang des Vorstandes<br />
und der Mitarbeiter durch den<br />
Neubau war die Zufriedenheit vor allem<br />
bei den Schwestern sehr groß.<br />
Die Zeit des<br />
Nationalsozialismus<br />
Die Nationalsozialisten hatten unter den<br />
deutschen Katholiken nur mäßige Wahlerfolge<br />
erzielen können. Um nach der<br />
Machtergreifung vom 30. Januar 1933<br />
den katholischen Bevölkerungsteil in das<br />
neue System einzugliedern, mussten die<br />
drei Stützen unterminiert werden, auf<br />
denen seit der Zeit des Kulturkampfes<br />
der deutsche Katholizismus ruhte: Klerus<br />
und Orden, Vereins‐ und Verbandswesen,<br />
Schul- und Bildungswesen. Das zunächst<br />
garantierte Vereins- und Schulwesen der<br />
Kirche wurde im Laufe der <strong>Jahre</strong> mehr und<br />
mehr ausgehöhlt und bis auf unbedeutende<br />
Reste zurückgedrängt. Schwieriger<br />
war es, den Einfluss von Priestern und<br />
Ordensleuten auf die Gesellschaft zu unterbinden, da ihr<br />
Handeln nicht einfach gleichgeschaltet werden konnte. Gegen<br />
Angehörige des geistlichen Standes setzte daher schon früh<br />
eine Diffamierung in Wort und Bild ein, die alle Grenzen des<br />
Geschmacks hinter sich ließ. Den Nationalsozialisten wäre die<br />
Diskreditierungskampagne weit schwerer geworden, wenn<br />
nicht Tatsachen bekannt geworden wären, die zu ernsten<br />
Zweifeln an der moralischen Integrität von Klerikern und<br />
Ordensleuten Anlass gaben. Seit März 1935 wurden unter<br />
dem Verdacht von Devisenvergehen zahlreiche männliche<br />
und weibliche Ordensangehörige, aber auch Weltpriester<br />
verhaftet. Die Tatbestände, die den Festnahmen und späteren<br />
Verurteilungen zugrunde lagen, waren unbestreitbar. Ordensgenossenschaften<br />
und andere kirchliche Gesellschaften, die<br />
durch ihre internationale Verflechtung Auslandsverbindlichkeiten<br />
besaßen, hatten die aus der Zeit der Weimarer Republik<br />
stammende Devisengesetzgebung umgangen oder verletzt,<br />
wobei nicht immer klar war, ob sie sich der strafrechtlichen<br />
oder moralischen Seite ihres Tuns bewusst waren. Von der<br />
Möglichkeit, solche Prozesse niederzuschlagen und gleichsam<br />
nachträglich Amnestie zu gewähren, die rechtlich gegeben<br />
war, machte das Regime keinen Gebrauch. Im Gegenteil – die<br />
nationalsozialistische Presse und die Sonntagsredner der Partei<br />
sparten nicht mit Kommentaren, die nur als antikirchliche<br />
Hetze zu bezeichnen sind.<br />
Marktplatz, um 1935<br />
103
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Das Schwarze Korps, 6. Mai 1937<br />
Oberbürgermeister Hans Wagenführ<br />
(1933-1937), um 1935<br />
Schreiben von Oberbürgermeister Hans Wagenführ an den Vorstand des<br />
Marienhospitals am 25. Oktober 1935, in dem er es ablehnte, einen Vertreter<br />
in die Vorstandssitzungen des Hospitals zu entsenden und seinen Vertreter,<br />
Stadtrat Wilhelm Füllenbach, gleichzeitig abberuft (Auszug):<br />
Nach den Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates ist es<br />
nicht mehr angängig, daß die Stadt Vertreter zu Organisationen<br />
stellt, die nach konfessionellen Gesichtspunkten ausgewählt<br />
werden. Ich habe daher Herrn Stadtrat Dr. Füllenbach von<br />
seinem Posten als Vertreter im Vorstand des Marienhospitals<br />
abberufen.<br />
Durch Denunziationen wie durch Ermittlungen in<br />
Devisenangelegenheiten waren Polizeiorgane zur<br />
gleichen Zeit auf Sittlichkeitsdelikte gestoßen, die<br />
verschiedenen Priestern und Ordensangehörigen zur<br />
Last gelegt wurden. Das Propagandaministerium trieb<br />
ihre publizistische Vermarktung voran und wies die<br />
Presse an, nicht von „Einzelfällen“ sondern von einer<br />
für die Kirche „symptomatischen Erscheinung“ zu<br />
sprechen. Ihren Höhepunkt erreichte die Kampagne<br />
mit der Rede des Reichspropagandaministers Joseph<br />
Goebbels vom 28. Mai 1937 in der Deutschlandhalle<br />
in Berlin. In Orden und Weltklerus habe sich „herdenmäßig<br />
Unzucht“ ausgebreitet, diese „Schweinereien“<br />
würden von der Gesamtheit des Standes gedeckt.<br />
„Tausende von Geistlichen und Ordensbrüdern“,<br />
Tausende von kirchlichen Sexualverbrechern seien<br />
auf „planmäßige sittliche Verwilderung Tausender<br />
von Kindern und Kranken aus“. Die Kirche habe das<br />
Recht verloren, den nationalsozialistischen Staat zu<br />
kritisieren und an der Erziehung der Jugend weiter<br />
mitzuwirken.<br />
Aus heutiger Sicht hat die publizistische Offensive<br />
gegen den Klerus und die Orden trotz des<br />
gewaltigen Aufgebots ihr Ziel nicht erreicht. Zweifellos<br />
hat sie antiklerikale Affekte, wo sie bereits<br />
vorhanden waren, weiter gesteigert, doch konnte<br />
sie kirchentreue Katholiken nicht in die Irre führen.<br />
Gleichwohl gingen die beiden großen Diffamierungskampagnen<br />
an Priestern und Ordensleuten nicht<br />
spurlos vorbei. Auch wenn die propagandistisch<br />
gesteuerte Diskreditierung seit dem <strong>Jahre</strong><br />
1937 verstummte, war ein Ende der gegen<br />
den geistlichen Stand gerichteten Maßnahmen<br />
nicht abzusehen. Als Repräsentanten<br />
einer Institution, die sich als normative Kraft<br />
des menschlichen Lebens mit universalem<br />
Gestaltungsanspruch versteht, blieben<br />
Priester und Ordensangehörige weiterhin<br />
unter scharfer Beobachtung der Machthaber.<br />
Ihre Tätigkeit wurde auf „staatsfeindliche<br />
Aktivitäten“ hin überwacht und<br />
schon kleinste „Vergehen“ konnten für<br />
die Betroffenen unabsehbare Folgen nach<br />
sich ziehen. Im Prinzip standen Klerus und<br />
Orden im nationalsozialistischen Deutschland<br />
unter Ausnahmerecht. Die Angst war<br />
in Pfarrhäusern und Klöstern ein ständiger<br />
Hausgenosse.<br />
In Furcht lebten auch die Franziskanerinnen<br />
des Düsseldorfer Marienhospitals.<br />
Zwar blieben ihnen Diffamierungen im<br />
Gefolge der Devisen- und Sittlichkeitsprozesse<br />
erspart, doch spricht aus vielen<br />
Dokumenten des Ordensarchivs die latente<br />
Sorge um die Zukunft der Anstalt.<br />
Sterilisation<br />
Das Ziel, die katholische Caritas in ihrer<br />
Wirksamkeit zu schwächen und aus der<br />
Öffentlichkeit zurückzudrängen, verfolgten<br />
die nationalsozialistischen Machthaber nicht<br />
nur in propagandawirksamen Bereichen,<br />
sondern auch auf dem Feld, das das Regime<br />
freien Wohlfahrtseinrichtungen zunächst<br />
explizit belassen hatte: die Behindertenfürsorge.<br />
Den Auftakt bildete das „Gesetz<br />
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“,<br />
das am 1. Januar 1934 in Kraft trat und<br />
bestimmte: „Wer erbkrank ist, kann durch<br />
chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht<br />
104
Sterilisation<br />
(sterilisiert) werden, wenn nach den Erfahrungen<br />
der ärztlichen Wissenschaft mit<br />
großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist,<br />
daß seine Nachkommen an schweren körperlichen<br />
oder geistigen Erbschäden leiden<br />
werden“ (§ 1.1). Als erbkrank im Sinne des<br />
Gesetzes galt, wer an folgenden Erkrankungen<br />
litt: „1. Angeborenem Schwachsinn,<br />
2. Schizophrenie, 3. zirkulärem (manischdepressivem)<br />
Irresein, 4. erblicher Fallsucht,<br />
5. erblichem Veitstanz, 6. erblicher Blindheit,<br />
7. erblicher Taubheit, 8. schwerer erblicher<br />
körperlicher Mißbildung“ (§ 2.1). Zuständig<br />
für die Entscheidung über eine Zwangssterilisation<br />
waren eigens eingerichtete<br />
„Erbgesundheitsgerichte“ (§ 5), die aus<br />
einem Amtsrichter, einem beamteten Arzt<br />
und einem mit der „Erbgesundheitslehre“<br />
besonders vertrauten Mediziner zusammengesetzt<br />
waren (§ 6.1).<br />
Die Meldepflicht an die Erbgesundheitsgerichte<br />
verlangte von katholischen Ärzten<br />
und Pflegern eine Form der Mitwirkung,<br />
die durch die Enzyklika „Casti connubii“<br />
untersagt war. „Zu verwerfen“, so die autoritative<br />
Stellungnahme von Papst Pius XI.<br />
im <strong>Jahre</strong> 1930 zur Sterilisationsfrage, „sind<br />
jene bedenklichen Bestrebungen, die zwar<br />
zunächst das natürliche Recht des Menschen<br />
auf die Ehe, tatsächlich aber unter gewisser<br />
Rücksicht auch das Gut der Nachkommenschaft<br />
angehen. Es finden sich nämlich<br />
solche, die in übertriebener Sorge um die<br />
‚eugenischen‘ Zwecke nicht nur heilsame<br />
Ratschläge zur Erzielung einer starken und<br />
gesunden Nachkommenschaft geben ... ,<br />
sondern dem ‚eugenischen‘ Zwecke den<br />
Vorzug vor allen andern, selbst denen einer<br />
höheren Ordnung geben. ... Ja sie gehen<br />
so weit, solches von Gesetzes wegen, auch<br />
gegen ihren Willen, durch ärztlichen Eingriff<br />
jener natürlichen Fähigkeit berauben zu<br />
lassen, und zwar nicht als Körperstrafe<br />
für vergangene Verbrechen, noch auch<br />
um künftigen Vergehen solcher Schuldigen<br />
vorzubeugen, sondern indem sie<br />
gegen alles Recht und alle Gerechtigkeit<br />
für die weltliche Obrigkeit eine Gewalt<br />
in Anspruch nehmen, die sie nie gehabt<br />
hat und rechtmäßigerweise nicht haben<br />
kann. Sie vergessen zu Unrecht, daß die<br />
Familie höher steht als der Staat, und daß<br />
die Menschen nicht an erster Stelle für die<br />
Zeit und Erde, sondern für den Himmel<br />
und die Ewigkeit geboren werden“.<br />
Zu Recht stellte der Deutsche Caritasverband<br />
nach der Veröffentlichung<br />
des Gesetzes im August 1933 fest: „Uns<br />
Katholiken bringt dieses Gesetz ... in<br />
eine besondere Lage, die der Schwierigkeiten<br />
nicht entbehrt“. Wohl mahnten<br />
die Bischöfe die Gläubigen wiederholt<br />
zur Einhaltung der lehramtlichen Normen,<br />
doch blieben sie eine Antwort auf<br />
die Frage schuldig, wie sich Ärzte und<br />
Pfleger einer Mitwirkung an dem Gesetz<br />
entziehen sollten. Bemerkenswert ist<br />
daher eine vertrauliche Aktennotiz von<br />
NS-Propagandaplakat, um 1935<br />
Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg,<br />
Bergische Landstraße 2, um 1930<br />
Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg,<br />
Patientenakte, 1934<br />
105
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Referendum vom<br />
19. August 1934<br />
August Gronarz, dem Vorstandsvorsitzenden<br />
des Marienhospitals, datiert mit dem 6. Februar<br />
1934: „In Ausführung des Beschlusses des Vorstandes<br />
vom 2. Februar begab ich mich gestern<br />
mit Herrn Dechant Max Döhmer nach Köln zum<br />
Herrn Generalvikar, um mit ihm die Frage der<br />
Zulässigkeit einer <strong>Buch</strong>führung von endgültigen<br />
Entscheidungen des Erbgesundheitsgerichtes zu<br />
besprechen. Das Ergebnis dieser Besprechung war,<br />
daß die Ausführung des im Gesetz zur Verhütung<br />
erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 vorgesehenen<br />
chirurgischen Eingriffs nach der kirchlichen<br />
Lehre nicht erlaubt ist, und daß sich daher<br />
das Marienhospital hier zu nicht bereit erklären<br />
darf“. Wieweit die Ärzte der Pempelforter Anstalt<br />
wie auch die übrigen katholischen Mediziner in<br />
der Stadt der Ansicht folgten, ist nicht bekannt.<br />
Desillusioniert musste die Konferenz der Bischöfe<br />
der Kölner Kirchenprovinz am 27./28. März 1935<br />
in Bensberg feststellen, dass an der Umsetzung<br />
und Ausführung des Sterilisierungsgesetzes viele<br />
Katholiken beteiligt waren. Dessen ungeachtet<br />
erinnerte das Kölner Generalvikariat die Krankenpflegeorden<br />
noch Ende Juli 1936 daran, dass jede<br />
Vorbereitung, Beteiligung und Durchführung von<br />
Sterilisationsoperationen verboten sei.<br />
Volksparole, 20. August 1934<br />
Wilhelm-Marx-Haus, Heinrich-Heine-Allee 53, um 1935<br />
Marienhospital, Stimmabgabe für die Reichstagswahl, 1938<br />
Als nach dem Tod Paul von Hindenburgs die<br />
Regierung am 19. August 1934 in einem<br />
Plebiszit vom deutschen Volk die Zustimmung<br />
zu einer Vereinigung der Ämter des<br />
Reichspräsidenten und des Reichskanzlers<br />
einforderte, bildeten die meisten Düsseldorfer<br />
Krankenhäuser (Patienten, Ärzte,<br />
Pflegepersonal etc.) eigene Wahlbezirke.<br />
Während die Wähler in den meisten Anstalten<br />
mit über 85 % für eine Annahme<br />
des geplanten Gesetzesvorhabens stimmten<br />
(z.B. Städtische Krankenanstalten Moorenstraße<br />
88 %, Evangelisches Krankenhaus<br />
Fürstenwall 90 %, Liebfrauenkrankenhaus<br />
Degerstraße 88 %, Martinuskrankenhaus<br />
Gladbacherstraße 92 %, Diakonissenkrankenhaus<br />
Alte Landstraße 100 %), votierten<br />
im Marienhospital an der Sternstraße von<br />
243 Wählern 124 (51 %) gegen die geplante<br />
Ämterneuordnung. Wie ein Schreiben von<br />
Caritasdirektor Johannes Becker an die Zentrale<br />
des Deutschen Caritasverbandes belegt,<br />
brach nach Bekanntgabe der Düsseldorfer<br />
Wahlergebnisse gegen das Marienhospital<br />
ein inszenierter Sturm der Empörung<br />
los. „Als am Sonntag abend von der nationalsozialistischen<br />
Zeitung ‚Volksparole‘<br />
das Resultat durch Lautsprecher bekannt<br />
gegeben wurde“, so der Bericht des Düsseldorfer<br />
Caritasdirektors vom 22. August<br />
1934, „setzte der Sprecher die evangelische<br />
Diakonissenanstalt und das katholische<br />
Marienhospital mit einer das letztere<br />
verunglimpfenden Bemerkung nebeneinander.<br />
Durch die öffentliche Diskreditierung<br />
veranlaßt, erhält das Marienhospital sehr<br />
viele anonyme Telefonanrufe und offene<br />
106
Referendum vom 19. August 1934<br />
Postkarten haßerfüllten, nicht wiederzugebenden<br />
Inhaltes. Daneben kommen gleich<br />
viele Sympathie-Kundgebungen an, die die<br />
Selbständigkeit und Charakterfestigkeit des<br />
Hauses lobend anerkennen. Wie die Oberin<br />
versichert, hat sie weder Anweisung erhalten<br />
noch gegeben, wie die (70) Schwestern<br />
des Hauses wählen sollten. Auch weiß sie<br />
nicht, wie die einzelne Schwester gewählt<br />
hat. Heute sind bereits Vertreter der Stadtverwaltung<br />
im Hause gewesen, um die<br />
Wohlfahrtspatienten zu verlegen. Es ist nach<br />
diesem Vorgehen zu befürchten, daß auch<br />
die Kassenpatienten heraus genommen werden.<br />
Damit würde die in dem beigefügten<br />
Schreiben angedrohte wirtschaftliche Vernichtung<br />
erreicht werden. Die entstehenden<br />
Folgen wären beklagenswert. Düsseldorf verlöre<br />
sein größtes katholisches Krankenhaus.<br />
Abgesehen von den 70 Ordensschwestern,<br />
die von der Genossenschaft anderweitig<br />
verwendet werden können, würden 104<br />
Angestellte (Ärzte, Pflegekräfte, Hausgehilfinnen<br />
etc.) stellenlos und fielen dem<br />
Arbeits- und Wohlfahrtsamt zur Last. Die<br />
holländischen Hypothekengläubiger – vor<br />
einigen <strong>Jahre</strong>n wurden an 2 Millionen für<br />
einen Erweiterungsbau aufgenommen –<br />
hätten, was Zins- und Tilgungszahlungen<br />
betrifft, das Nachsehen. Die ohnehin stark<br />
belasteten Beziehungen würden um ein<br />
Weiteres belastet. Ganz zu schweigen von<br />
der eintretenden Zerklüftung der doch regierungsseitig<br />
geförderten und geforderten<br />
Volksgemeinschaft! Ich bemerke noch, daß<br />
seitens des Kuratoriums des Marienhospitals<br />
entsprechende Schritte zur Rettung des<br />
Hauses unternommen sind“.<br />
Bei dem angefügten Schreiben, das<br />
mit der „wirtschaftlichen Vernichtung“ der<br />
Anstalt drohte, handelte es sich um einen<br />
Rundbrief, den der Vorsitzende des Vereins<br />
der Ärzte Düsseldorfs e.V. am 21. August 1934 an seine „Kollegen“<br />
gesandt hatte. Wörtlich hieß es darin: „Das Düsseldorfer<br />
Marienhospital hat am Sonntag den 19. August 1934, bei der<br />
Wahl mit mehr als 50 % den Führer und den Nationalsozialismus<br />
abgelehnt. Dieses Wahlergebnis bedeutet eine Herausforderung<br />
des Standes, der Stadt und darüber hinaus des Staates.<br />
Die Düsseldorfer Ärzteschaft wird diese landesfremde Gesinnung<br />
durch schärfste Aussperrung des Hospitals bis zu seiner<br />
wirtschaftlichen Vernichtung gutzumachen versuchen. Ich<br />
ordne deshalb an, daß Überweisungen an das Marienhospital<br />
strengstens untersagt sind. Die deutschen Ärzte, die trotz des<br />
Verbotes noch Einweisungen vornehmen, gebe ich durch ein<br />
Rundschreiben öffentlich bekannt“.<br />
Welches Aufsehen der Rundbrief des Vereinsvorsitzenden<br />
Dr. Heinrich Seiler über Düsseldorf hinaus erregte, belegt die<br />
Tatsache, dass das Schreiben am 13. September 1934 vom<br />
„L‘Osservatore Romano“ abgedruckt wurde. Unter dem Titel<br />
„Da Gerico a Düsseldorf“ (Von Jericho nach Düsseldorf) kommentierte<br />
das Organ des Vatikans den Vorgang mit den Worten:<br />
„Wir glauben nicht, dass die Ärzte Düsseldorfs sich allzu sehr<br />
geehrt gefühlt haben durch<br />
dieses Rundschreiben, das von<br />
jedem von ihnen unterstellt,<br />
dass er von der gleichen unqualifizierbaren<br />
menschlichen,<br />
bürgerlichen und beruflichen<br />
Gefühllosigkeit besessen sei,<br />
und von seiner eigenen sektiererischen<br />
Überempfindlichkeit.<br />
Während nämlich der Führer<br />
des Staates in Nürnberg proklamierte,<br />
dass keinerlei Verfolgung<br />
stattgefunden habe<br />
gegen solche, die ihre Neinstimme<br />
in die Wahlurnen gelegt<br />
haben, ging ein gewisser<br />
Seiler in Düsseldorf hin und<br />
dekretierte eine Ächtung, die<br />
dahin auslief, den Kranken Beistand,<br />
den Sterbenden letzte<br />
Hilfe zu versagen. Unglaublich!<br />
Unbeschreiblich!, aber wahr!“.<br />
L‘Osservatore Romano,<br />
13. September 1934<br />
107
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Stadtdechant Max Döhmer<br />
(1934-1946), um 1945<br />
Graf-Adolf-Platz, um 1935<br />
Der angedrohte Boykott gegen das Marienhospital blieb aus.<br />
Bereits am 25. August 1934 wandte sich Heinrich Seiler erneut<br />
an seine „Kollegen“ und teilte mit, „die von der Verwaltung<br />
des Marienhospitals getroffenen Maßnahmen rechtfertigen<br />
die hiermit ausgesprochene Aufhebung meiner Verfügung<br />
vom 22.8.1934“. Außerdem habe der Vorstand des Marienhospitals<br />
„mit größter Vorbehaltlosigkeit zum Ausdruck<br />
gebracht, daß er das Abstimmungsergebnis in seinem Hospital<br />
auf das tiefste bedauere und bereit ist, jeden vom Hospital<br />
fernzuhalten und von ihm auszuschließen, der die Einheit der<br />
Deutschen Volksgemeinschaft zu stören sucht“.<br />
Welche „Maßnahmen“ den Widerruf der angedrohten<br />
Sanktionen „rechtfertigten“, erschließt ein am 30. August<br />
1934 von Stadtdechant Max Döhmer an das Generalvikariat<br />
gerichtetes Protestschreiben, das folgende Mitteilung enthielt:<br />
„Der Vorsitzende des Kuratoriums des Marienhospitals hat<br />
nach Rücksprache mit einem der beiden Chefärzte des<br />
Hauses, angeblich weil größte Eile im Handeln geboten gewesen<br />
sei, die Drohungen des Vorsitzenden des Ärztevereins<br />
dadurch abwenden zu sollen geglaubt, daß er ohneweiters<br />
die in dessen Schreiben enthaltenen Vorwürfe als berechtigt<br />
anerkannte und als Sühne die Entfernung der Oberin sowie<br />
des Anstaltspfarrers anbot. Ich kann nicht anders als diese<br />
Aktion als eine himmelschreiende Ungerechtigkeit bezeichnen<br />
und zwar aus folgenden Gründen: 1. Nichts berechtigt<br />
den Vorsitzenden<br />
des Ärztevereins<br />
zu der Behauptung,<br />
daß die im Marienhospital<br />
abgegebenen<br />
124 ‚Nein‘-<br />
Stimmen von den<br />
Schwestern und<br />
dem Dienstpersonal<br />
des Hauses stammen.<br />
Selbst wenn<br />
es richtig wäre, was<br />
die Gegner behaupten,<br />
daß die Zahl<br />
der ‚Nein‘-Stimmen<br />
genau der Zahl der<br />
Schwestern und<br />
Hausangestellten entspräche, so könnte<br />
daraus doch nicht gefolgert werden, daß<br />
diese ‚Nein‘-Stimmen von den Schwestern<br />
und dem übrigen Hauspersonal herrührten.<br />
Aber tatsächlich haben, wie dies aus den<br />
Wahlscheinen nachgeprüft werden kann,<br />
nur 64 Schwestern bzw. ca. 15 Hausangestellte<br />
im Marienhospital gewählt. 2. Der<br />
Vorwurf, die Oberin habe die Schwestern<br />
und Hausangestellten zur Abgabe der<br />
‚Nein‘‐Stimmen beeinflußt, ist eine durch<br />
nichts begründete willkürliche Verdächtigung<br />
und kann durch die gegenteilige<br />
eidliche Erklärung sämmtlicher Schwestern<br />
widerlegt werden. Geradezu absurd muß<br />
demgegenüber der andere von denselben<br />
Leuten erhobene Vorwurf gegen die Oberin<br />
erscheinen, sie habe ihre Pflicht versäumt,<br />
wenn sie die ihr unterstellten Schwestern<br />
und Hausangestellten nicht im Sinne der<br />
Abgabe von ‚Ja‘‐Stimmen beeinflußt habe.<br />
3. Vor allem möchte ich darauf hinweisen,<br />
daß die Freiheit der Wahl garantiert war.<br />
Das besagt aber doch wohl, daß vor der<br />
Wahl niemand genötigt sein solle, seine<br />
Stimme in einer bestimmten Richtung<br />
abzugeben und daß nach der Wahl niemandem<br />
aus seiner Stimmabgabe irgend<br />
welcher Nachteil erwachsen solle. Gegen<br />
den Anstaltspfarrer sind meines Wissens<br />
von keiner Seite im Zusammenhang mit<br />
der Wahl Anklagen erhoben worden. Da<br />
fragt man sich doch, mit welchem Rechte<br />
der Vorsitzende des Kuratoriums zur Beschwichtigung<br />
kirchenfeindlicher Geister<br />
den Herrn als Sündenbock in die Wüste<br />
schicken will“.<br />
Da der Ärzteverein seine Boykottandrohung<br />
bereits zurückgezogen hatte,<br />
gab das Generalvikariat am 4. September<br />
1934 Max Döhmer beschwichtigend zur<br />
Antwort: „Der Vorsitzende des Kuratoriums<br />
108
Referendum vom 19. August 1934<br />
des Marienhospitals ist am 21. August<br />
1934 nachmittags bei uns in der Angelegenheit<br />
vorstellig geworden. Er glaubte,<br />
im damaligen Augenblick wohl nicht unbegründet,<br />
daß das Marienhospital durch<br />
die von ihm gefürchteten Maßnahmen von<br />
Stadt, Ärzteschaft und vielleicht auch Partei<br />
wohl vor der wirtschaftlichen Vernichtung<br />
stände. ... Die von dem Kuratoriumsvorsitzenden<br />
in Verbindung mit einzelnen<br />
Ärzten und Mitgliedern des Kuratoriums<br />
getroffenen Maßnahmen, die gewiß vom<br />
grundsätzlichen Standpunkte aus nicht in<br />
allem als glücklich anzusehen sind, sind<br />
aus einem starken Verantwortungsgefühl<br />
für das künftige Schicksal der Anstalt zu<br />
beurteilen. Wir glauben allerdings, daß<br />
die entschiedene Verwahrung gegen die<br />
Terrormaßnahmen, die sofort von uns aus<br />
vorgenommen wurde, sich als wirksamer<br />
herausgestellt hat. Bereits am 22. August<br />
1934 hat unser Sachbearbeiter, Herr Prälat<br />
Albert Lenné, fernmündlich gegen die Terrormaßnahmen<br />
gegen das Marienhospital<br />
bei der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk<br />
Düsseldorf protestiert. Wir<br />
haben ferner in einem Schreiben vom 24.<br />
August 1934 gegen die Ungeheuerlichkeit,<br />
die in dem Schreiben des Vorsitzenden des<br />
Düsseldorfer Ärztevereins gegenüber dem<br />
Charakter der Volksabstimmung als einer<br />
freien und geheimen Wahl zu sehen sei,<br />
bei der Staatspolizeistelle auch schriftlich<br />
Verwahrung eingelegt und ein möglichst<br />
umgehendes Einschreiten der Staatspolizei<br />
verlangt. ... Wir halten es aber für nicht<br />
förderlich, nachdem die Stellungnahme<br />
der kirchlichen Behörde bekanntgegeben<br />
ist und überdies die Terrormaßnahmen<br />
zurückgenommen worden sind, die Lage<br />
des schwerringenden Marienhospitals noch<br />
durch scharfe Auseinandersetzungen im<br />
Kuratorium zu erschweren. Es muß vielmehr versucht werden,<br />
ohne Preisgabe der grundsätzlichen Stellungnahme das<br />
Vertrauen zwischen Kuratorium, Ärzteschaft und Schwesternschaft<br />
wiederherzustellen, da sonst der Kampf um die<br />
Existenz des Hospitals nicht erfolgreich geführt werden<br />
kann. Der Vorsitzende des Kuratoriums hat es unter allen<br />
Umständen gut und selbstlos gemeint. Die Ärzte kämpfen<br />
um ihre Existenz. ... Wir würden es daher begrüßen, wenn<br />
Euer Hochwürden als Erzbischöflicher Kommissar des Marienhospitals<br />
nun erfolgreich bemüht wären, die bleibenden<br />
Schwierigkeiten zu überwinden“.<br />
Offenbar war es Max Döhmer schon bald gelungen, sein<br />
gespanntes Verhältnis mit dem Kuratorium des Marienhospitals<br />
zu entkrampfen. Auf der Kuratoriumssitzung vom 2.<br />
Oktober 1934 verlas er ein vorbereitetes Papier, in dem er u.a.<br />
das Schreiben des Düsseldorfer Ärztevereins „aufs tiefste“<br />
beklagte, „da es allem Recht und aller Gerechtigkeit Hohn<br />
spricht. ... Nachdrücklich muß ich sowohl die ehrwürdige<br />
Schwester Oberin und die ganze Schwesternschaft des<br />
Hauses, sowie auch den Herrn Pfarrer Heinrich Hamacher<br />
gegen die gegen sie erhobenen, völlig unbegründeten Angriffe<br />
in Schutz nehmen. ... Der ruhigen und abgeklärten<br />
Auffassung, der Demut und Friedensliebe der Generaloberin<br />
haben wir es zu verdanken, daß sie den ihr hingeworfenen<br />
Königsallee, 1937<br />
109
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Burgplatz, um 1935<br />
Graf-Adolf-Straße/Königsallee,<br />
um 1935<br />
Fehdehandschuh nicht aufgenommen<br />
und sofort die ganze<br />
Schwesternschaft zurückgezogen<br />
hat. ... Bezüglich des Herrn<br />
Pfarrers Hamacher hat die erzbischöfliche<br />
Behörde keinen<br />
Zweifel darüber gelassen, und<br />
auch der Staats-Regierung mitgeteilt,<br />
daß sie eine Versetzung<br />
des Herrn in Zusammenhang<br />
mit dem in Frage stehenden<br />
Wahlergebnis grundsätzlich<br />
ablehne. ... Ich bin persönlich<br />
der Überzeugung, daß das<br />
Kuratorium ruhig den Kampf<br />
mit dem Vorsitzenden des<br />
Ärzte-Vereins hätte aufnehmen<br />
und mit allen Mitteln und<br />
in allen Instanzen durchführen<br />
sollen. Der Endsieg wäre<br />
Unser gewesen. Auf unserer<br />
Seite hätte nicht bloß die weit<br />
überwiegende katholische<br />
Bürgerschaft, sondern auch<br />
eine große Zahl von Ärzten<br />
und auch Krankenkassen gestanden.<br />
... Ich möchte meine<br />
Ausführungen zu diesen beklagenswerten<br />
Ereignissen nicht<br />
schließen, ohne dem wegen seiner unermüdlich, selbstlosen<br />
Arbeit im Dienste des Marien-Hospitals von uns allen, und<br />
ich darf hinzufügen, auch von der erzbischöflichen Behörde<br />
hochgeschätzten Vorsitzenden, Herrn Landeskulturamts-<br />
Direktor August Gronarz, der selig unsagbar unter dem Druck<br />
der Ereignisse gelitten hat, zu danken für seine, von edelster<br />
Gesinnung getragenen Sorgen und Opfer. Lassen Sie uns<br />
alle, Kuratorium, Ärzte- und Schwesternschaft, einträchtig<br />
zusammen wirken, um die noch bestehenden Schwierigkeiten<br />
zu überwinden“.<br />
Spielte das Wahlergebnis vom 19. August 1934 für die<br />
Belegung und Auslastung des Hauses in der Folgezeit auch<br />
keine Rolle, so schwebte der Vorgang gleichwohl wie ein<br />
Damoklesschwert über dem Marienhospital<br />
und hatte die Anstalt für lange Zeit mit<br />
dem Kainsmal gezeichnet. Im Ganzen betrachtet,<br />
entpuppte sich die Hetzkampagne<br />
des Düsseldorfer Ärztevereins als Sturm<br />
im Wasserglas, doch lassen die übereilten<br />
Reaktionen des Kuratoriums erahnen, unter<br />
welchen Druck die Verantwortlichen des<br />
Marienhospitals geraten waren. Festzuhalten<br />
bleibt, dass weder der Anstaltsgeistliche<br />
noch eine Schwester gezwungen waren,<br />
die Anstalt in Pempelfort zu verlassen. Zwar<br />
wurden im Januar 1935 Oberin Hugolina<br />
Jansen und im Dezember 1935 Rektor<br />
Heinrich Hamacher vom Marienhospital<br />
abberufen, doch erfolgten ihre Versetzungen<br />
unabhängig von den geschilderten<br />
Ereignissen.<br />
Ausbauten 1935/1936<br />
Ungeachtet aller Repressionen wurde auch<br />
in der Zeit des Nationalsozialismus das medizinische<br />
Programm des Marienhospitals<br />
weiter spezialisiert. Ende des <strong>Jahre</strong>s 1934<br />
griff der Vorstand einen bereits vier <strong>Jahre</strong><br />
zuvor aufgekommenen, aber im Zeichen<br />
der Wirtschaftskrise zurückgestellten Plan<br />
wieder auf, in einem Teil des Neubaues an<br />
der Prinz-Georg-Straße neben der schon<br />
vorhandenen chirurgisch-gynäkologischen<br />
eine geburtshilflich‐gynäkologische Abteilung<br />
mit eigenem Chefarzt einzurichten.<br />
Nach Aufstockung des Vorbaues an der<br />
Nordfront und Einrichtung geeigneter Ordinationsräume<br />
konnte die Frauenklinik<br />
zusammen mit einer neuen Kinderabteilung<br />
am 1. Oktober 1935 ihren Betrieb<br />
aufnehmen. Die neue Klinik war sowohl<br />
für Entbindungen als auch für gynäkologisch-operative<br />
und strahlentherapeutische<br />
110
Ausbauten 1935/1936<br />
Frauenerkrankungen eingerichtet. Nach einem<br />
Rundgang durch die neu eröffnete Abteilung<br />
schrieb das Düsseldorfer Tageblatt<br />
am 14. Oktober 1935: „ Die Krankenzimmer,<br />
die im aufgestockten Stockwerk liegen,<br />
überraschen durch ihre Fülle von Licht<br />
und Luft. Die breiten Fenster sind rückwärts<br />
gelegen. Erstmalig in Deutschland wurde<br />
ein Bad- und Toilettenraum in unmittelbarer<br />
Verbindung mit dem Krankenzimmer angeordnet.<br />
Eine Frischluftzuführung temperiert<br />
und entlüftet die hygienisch vollkommenen<br />
und außerordentlich freundlichen Räume.<br />
Dasselbe Prinzip finden wir in den neuen<br />
Räumen der Gemeinschaftsklasse, der früheren<br />
dritten, durchgeführt“.<br />
Mit Eröffnung der Klinik verfügte das<br />
Marienhospital zum ersten Mal über drei<br />
vollwertige bettenführende Abteilungen<br />
mit Chefarzt. Die chirurgische Abteilung<br />
unterstand Dr. Franz Kudlek, die innere Abteilung<br />
leitete Dr. Gustav Pfeffer. Zur Eröffnung<br />
der gynäkologisch‐geburtshilflichen<br />
Abteilung war Dr. Georg Josef Pfalz als<br />
neuer leitender gynäkologischer Facharzt<br />
eingestellt worden. Ihm zugeordnet wurde<br />
der Assistenzarzt Dr. Jakob Müller, in dessen<br />
Verantwortungsbereich die Aufsicht über<br />
die Kinderabteilung lag.<br />
Zeitgleich mit der Frauenklinik wurde<br />
im Marienhospital eine Anlage zur eigenen<br />
Wasserversorgung installiert, um das<br />
Krankenhaus vom Netz der städtischen<br />
Wasserwerke unabhängig zu machen.<br />
Ferner ließ der Vorstand ein neues Isolierhaus<br />
mit Luftschutzkeller errichten, das<br />
am 7. Dezember 1936 eingeweiht und<br />
dem Hl. Joseph zum Schutz übergeben<br />
wurde. Eine Woche später konnte ein neu<br />
aufgestocktes Säuglingszimmer unter dem<br />
Patronat „Maria Erwartung“ von „kleinen<br />
Engelchen“ bezogen werden.<br />
Marienhospital, Geburtsstation, 1946<br />
Gertudisheim Ulmenstraße 83,<br />
Geburtsstation, um 1935<br />
Marienhospital, Isolierabteilung, 1936<br />
Marienhospital, Isolierabteilung,<br />
um 1945<br />
111
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Synagoge, Kasernenstraße 67b,<br />
um 1910<br />
Blick auf die brennende Synagoge,<br />
10. November 1938<br />
Mobiliar einer jüdischen Familie vor<br />
dem Haus Hüttenstraße 81,<br />
10. November 1938<br />
Das Pogrom vom<br />
9./10. November 1938<br />
Als Ernst vom Rath, Sekretär<br />
der deutschen Botschaft<br />
in Paris, von einem über die<br />
Zwangsdeportation seiner Eltern<br />
erbitterten Juden erschossen<br />
wurde, wurde dieser Mord<br />
zum Anlass für befohlene und<br />
planmäßige Gewalttaten an jüdischen<br />
Mitbürgern und ihrem<br />
Eigentum in der Nacht vom 9.<br />
zum 10. November 1938. Wie<br />
in anderen Städten des Reiches,<br />
ging auch in Düsseldorf<br />
die große Synagoge an der<br />
Kasernenstraße in Flammen<br />
auf. An zahlreichen Stellen in<br />
der Stadt wurden in den frühen Morgenstunden noch Wohnungseinrichtungen<br />
und Kunstgegenstände von höchstem<br />
Wert zerschlagen. Aus Augenzeugenberichten ist bekannt,<br />
dass bei der befohlenen Aktion in Düsseldorf nicht nur zahlreiche<br />
Menschen misshandelt und schwer verletzt, sondern<br />
auch mindestens acht ermordet wurden.<br />
Auch wenn nur wenige Nachrichten erhalten sind, so<br />
steht fest, dass in der Pogromnacht zahlreiche verletzte<br />
Düsseldorfer Juden im Marienhospital notärztlich versorgt<br />
wurden. So berichtet etwa der jüdische<br />
Maler Albert Herzfeld in seinem Tagebuch<br />
von folgender Begebenheit, die sich während<br />
der Reichskristallnacht in unmittelbarer<br />
Nähe des Marienhospitals ereignete:<br />
„Ich lag nach meinem Herzkollaps schwer<br />
leidend im Parterre straßenwärts im Bett<br />
und wurde in der Nacht von Mittwoch auf<br />
Donnerstag gegen 12 Uhr durch ein starkes<br />
Stoßen und Poltern gegen die Haustüre des<br />
uns genau gegenüberliegenden Hauses in<br />
der Feldstraße 34 und ein nachfolgendes<br />
Weh- und Schmerzensgeschrei geweckt.<br />
Ich war viel zu schwach, um aufzustehen,<br />
aber ich weckte die im nebenan liegenden<br />
Eßzimmer zu meiner eventuellen Hilfeleistung<br />
während der Nacht schlafende<br />
Hausangestellte Frau Auguste Stiltz. Ich<br />
war mir sofort klar, daß ein antisemitischer<br />
Exzeß gegen den hochanständigen<br />
Hausinhaber Salomon Loeb, einem Kombattanten<br />
aus dem Weltkrieg, statt fand.<br />
Frau Stiltz öffnete etwas die Jalousie und<br />
sah dann daß wilde Horden unter Führung<br />
von SA-Männern in das Haus eingedrungen<br />
waren, nachdem sie die Haustüre demoliert<br />
hatten. Wir hörten, wie alle Scheiben<br />
zerschlagen und die Hausbewohner, nach<br />
ihrem Schreien zu urteilen, in der gröbsten<br />
Weise mißhandelt wurden. Nach einer<br />
halben Stunde zogen die Horden ab, und<br />
es fuhr ein städtisches Krankenauto vor, in<br />
dem ein in Tücher eingewickelter Mann,<br />
wie sich später ergab, Herr Loeb selbst,<br />
ins Krankenhaus abtransportiert wurde. Er<br />
hatte, wie Frau Stiltz einige Tage später von<br />
seinem Angestellten hörte, 9 Dolchstiche<br />
erhalten und befindet sich heute noch als<br />
Patient im Marienhospital“.<br />
112
Die Stadt Düsseldorf während<br />
des Zweiten Weltkrieges<br />
Krankenhelferkurse<br />
statt<br />
Krankenpflegeschule<br />
Von verschiedenen Seiten war mehrfach<br />
angeregt worden, am Marienhospital eine<br />
Krankenpflegeschule zu eröffnen, doch<br />
mangelte es der Anstalt lange Zeit an den<br />
hierzu notwendigen Einrichtungen. Als<br />
der Gedanke im Sommer 1939 erneut<br />
aufgegriffen wurde, unterstützte der Düsseldorfer<br />
Regierungspräsident einen entsprechenden<br />
Antrag, doch versagte die<br />
Gauleitung der NSDAP in Düsseldorf ihre<br />
Zustimmung. Wie der Chronik der Franziskanerinnen<br />
zu entnehmen ist, war trotz der<br />
fehlenden Konzession im Herbst 1939 eine<br />
Krankenpflegeschule am Marienhospital<br />
unter Leitung der Chefärzte Franz Kudlek<br />
und Gustav Pfeffer und der Pflegeschwester<br />
Elfreda eingerichtet worden. Mit den<br />
Behörden sollten die Verhandlungen zur<br />
Erteilung der staatlichen Anerkennung<br />
weitergeführt werden, doch bereitete der<br />
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges allen<br />
Bemühungen ein abruptes Ende. „Da die<br />
Errichtung der Krankenpflegeschule uns<br />
bis heute noch nicht gelungen ist“, so der<br />
<strong>Jahre</strong>srückblick 1939, „sei ... erwähnt,<br />
daß nach einem neueren Ministerialerlass<br />
zur Errichtung einer solchen Schule die<br />
Zustimmung der Gauleitung erfordert. Da<br />
diese nicht herbeigeführt werden konnte,<br />
gab die Regierung unseren Antrag an das<br />
Innenministerium weiter, letzteres an das<br />
Büro des Stellvertreters des Führers nach<br />
München. Am 11. November 1939 erhielten<br />
wir die Mitteilung, daß der Antrag<br />
abgelehnt sei. Nun sind in Zusammenarbeit<br />
mit dem ‚Roten Kreuz‘ und der NSV Kurse für<br />
Helferinnen in der Krankenpflege eingerichtet<br />
worden, die je 20 Stunden umfaßten und von<br />
je 65 Helferinnen besucht wurden. Außerdem<br />
wurden auf Anordnung der Heeresverwaltung<br />
Sanitätsschüler und Sanitätssoldaten<br />
ausgebildet, sodaß also von unserer Seite<br />
alles geschieht, um den Erfordernissen der<br />
Kriegszeit gerecht zu werden“.<br />
Die Stadt Düsseldorf<br />
während des Zweiten Weltkrieges<br />
Die Düsseldorfer Bevölkerung nahm die Auswirkungen des<br />
Krieges anfänglich nur in ihren Einzelerscheinungen und am<br />
Rande wahr. Die Blitzkriege verliefen zunächst erfolgreich<br />
und unterbanden möglicherweise aufkommende Ängste<br />
und Unmut. Die Versorgung mit Gütern des alltäglichen<br />
Lebens verknappte sich zwar, aber sie verschlechterte sich<br />
Theresienhospital, Schwesternschülerinnen,<br />
um 1955<br />
Marienhospital, Rotkreuzschwestern,<br />
um 1943<br />
113
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Klosterstraße, um 1945<br />
Luftschutzkeller, Gumbertstraße 169,<br />
um 1943<br />
Heizkraftwerk, Höherweg 100,<br />
um 1930<br />
insgesamt nicht entscheidend. Die Katastrophe versteckte<br />
sich hinter vermeintlichen Anfangserfolgen und bahnte sich<br />
nur langsam an. Der Frontverlauf lag weit im Westen bzw.<br />
Osten und nur gelegentlich, wie am 14. Mai 1940, fielen<br />
Bomben auf die Stadt.<br />
Im Jahr 1942 brach allerdings ein Feuersturm los, der bis<br />
zum Ende des Krieges nicht mehr aufhören sollte. Ein erster<br />
Großangriff am 1. August 1942 zielte auf die Friedrichstadt,<br />
Oberbilk, Oberkassel und die Königsallee. In der Folgezeit<br />
überflogen britische und amerikanische Kampfflugzeuge fast<br />
täglich die Stadt und ließen in unregelmäßigen<br />
Zeitabständen Bombenteppiche auf<br />
Düsseldorf und die nähere Umgebung niederregnen.<br />
Besonders verheerend war der<br />
Angriff in der Nacht des Pfingstsamstags,<br />
12. Juni 1943. Die Maschinen kamen aus<br />
allen Himmelsrichtungen und hinterließen<br />
vor allem in der Altstadt, Derendorf, im<br />
Gebiet um den Hauptbahnhof und in den<br />
südlichen Stadtteilen eine Spur der Verwüstung.<br />
Etwa 1200 Menschen kamen ums<br />
Leben, über 2000 wurden verwundet und<br />
140000 obdachlos. In dieser Zeit begann<br />
die Stadtverwaltung sowie zahlreiche Betriebe,<br />
ihre Büros an den Rand der Stadt<br />
zu verlegen. Die Grundversorgung der<br />
Bevölkerung drohte zusammenzubrechen:<br />
Das Wasserwerk in Flehe, das Kraftwerk<br />
in Flingern und die Kokerei in Grafenberg<br />
erlitten beträchtliche Schäden. Zwar gelang<br />
es verhältnismäßig rasch, die Grundversorgung<br />
der Düsseldorfer Bevölkerung wieder<br />
herzustellen. Aber das Leben änderte sich<br />
in der seit 1942 zerfallenden Stadt dramatisch.<br />
Der hastige Wechsel von Alarm und<br />
Entwarnung rief eine überreizte Stimmung<br />
unter den Menschen hervor.<br />
Das Marienhospital als<br />
Reservelazarett<br />
Wie schon in den Kriegen 1870/71 und<br />
1914/18 wurde auch während des Zweiten<br />
Weltkrieges im Marienhospital ein<br />
Reservelazarett für verwundete Soldaten<br />
eingerichtet. Zu Beginn des Krieges berichtet<br />
die Ordenschronik: „Mit Ausbruch<br />
des Krieges wurden Verhandlungen mit der<br />
Wehrmacht geführt wegen der Benutzung<br />
des Marienhospitals zu Lazarettzwecken.<br />
114
Das Marienhospital<br />
als Reservelazarett<br />
Herr Oberstabsarzt Dr. Westphal forderte im<br />
Auftrag der Wehrmacht, daß das Marienhospital<br />
300 Betten zur Verfügung stellen<br />
müsse, die Kieferklinik (Sternstr. 35/41) würde<br />
200 stellen. Sollte dieser Bestand nicht<br />
ausreichen, müßte als Notreserve das in der<br />
Nähe liegende Kolpinghaus (Blücherstr. 4/8)<br />
mit 100 Betten eingerichtet werden. Der<br />
Tag der Räumung steht noch nicht fest. Es<br />
muß allerdings damit gerechnet werden,<br />
daß die Räumung Anfang der kommenden<br />
Woche, also ab 13. September 1939 eintreten<br />
kann. Nach diesen Richtlinien wird<br />
unser Hospital mit über 50 % der Betten<br />
der Wehrmacht zugeführt, die ärztliche<br />
Oberleitung wird Herr Chefarzt Dr. Franz<br />
Kudlek übernehmen, für die militärischen<br />
Belange wird militärisches Verwaltungs- und<br />
Sanitätspersonal überwiesen werden, im<br />
übrigen bleibt Verwaltung und Betrieb des<br />
Hauses bestehen“.<br />
Mit dem 15. November 1939 nahm<br />
das Reservelazarett im Marienhospital seinen<br />
Betrieb auf. Wie vorgesehen, blieb<br />
die Verwaltung des Hauses, Verpflegung,<br />
Gestellung des Inventars, der Wäsche, der<br />
Schwestern und des Pflegepersonals, Arzneimittel<br />
etc. in den Händen des Marienhospitals.<br />
Die Heeresverwaltung stellte<br />
gemäß einer Übereinkunft zwischen Hospital<br />
und militärischem Oberkommando<br />
das ärztliche Personal und das erforderliche<br />
Sanitätspersonal. Schon zu Beginn<br />
der Kampfhandlungen war das Lazarett<br />
stark belegt. „Leider ist die Belegung eine<br />
dauernd wechselnde“, klagte am Ende<br />
des ersten Kriegsjahres die Chronistin der<br />
Pflegeschwestern. „Die Kranken sind keine<br />
Gefechtsverwundeten, sondern Unfallverletzte<br />
und sonstige Kranke für die innere<br />
Abteilung, Augen- und Ohrenabteilung<br />
usw.. Außerordentlich stark ist der Verkehr<br />
Marienhospital, Reservelazarett, 1940<br />
Marienhospital, Verwundetenbetreuung, 1940<br />
Scheibenstraße, Hinweisschild, 1940<br />
115
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital,<br />
Reservelazarett, 1940<br />
Marienhospital,<br />
Feldpostbrief, 1940<br />
Oberbürgermeister Carl Haidn<br />
besucht verletzte Zivilisten im<br />
Marienhospital, 1942<br />
ambulant behandelter Militärpersonen. Unsere mit neuen<br />
Apparaten ausgerüstete Röntgenabteilung, sowie der im Juli<br />
des <strong>Jahre</strong>s eingestellte Röntgenarzt Dr. Hans Jepkens sind<br />
in der militärischen und zivilen Abteilung voll in Anspruch<br />
genommen“.<br />
Von den 83 Schwestern aus der Kongregation des Hl.<br />
Franziskus, die zu Beginn des Krieges im Marienhospital tätig<br />
waren, wurden 19 in das Reservelazarett einberufen und von<br />
der Militärverwaltung übernommen. Militärisch<br />
eingezogen war auch der Chefarzt Dr.<br />
Franz Kudlek, der zum Chefarzt und Leiter<br />
des Reservelazarettes II am Marienhospital<br />
Düsseldorf kommandiert wurde. Nicht<br />
ohne Wehmut bemerkt die Hauschronik,<br />
dass „das Hospital ... die meisten Ärzte von<br />
allen Düsseldorfer Krankenhäusern dem<br />
Vaterland zur Verfügung gestellt“ hatte.<br />
Neben den beiden Chefärzten Gustav Pfeffer<br />
und Georg Josef Pfalz waren 1939 auch<br />
die Fachärzte Theodor Hünermann, Josef<br />
Etten, Jakob Müller, der Oberarzt Walter<br />
Wynen und die Assistenzärzte Broich und<br />
Ziebarth zum Heeresdienst eingezogen.<br />
Ab Juni 1940 musste das Marienhospital<br />
der Heeresverwaltung weitere<br />
100 Betten für das Lazarett überlassen,<br />
wodurch sich die Zahl der abgetretenen<br />
Pflegeplätze auf insgesamt 400 erhöhte.<br />
Die Gesamtzahl entsprach in etwa dem<br />
letzten Friedensstand mit 415 Betten, der<br />
nur in Ausnahmefällen überschritten wurde.<br />
Der Bericht der Pflegeschwestern für<br />
das Jahr 1940 bemerkt zu der bedrängten<br />
Lage: „Um den Kontakt mit der Düsseldorfer<br />
Bevölkerung nicht zu verlieren, um<br />
vielfachen Wünschen unseres Patientenkreises<br />
und auch der im Norden der Stadt<br />
gelegenen Rüstungs-Industrie, sowie der<br />
Unfallberufs-Genossenschaft Rechnung zu<br />
tragen, haben wir durch Einschiebung neuer<br />
Betten und sonstiger organisatorischer<br />
Maßnahmen nunmehr einschließlich der<br />
Privatabteilungen noch <strong>150</strong> Betten nebst<br />
30 Kinderbetten für Civilpatienten zur<br />
Verfügung. Wir glaubten auch deshalb die<br />
Civilabteilung noch in kleinerem Rahmen<br />
aufrecht erhalten zu sollen, weil wir damit<br />
selbst noch einen gewissen Einfluß auf das,<br />
was im Hause vorgeht, ausüben können. Im<br />
Reserve-Lazarett sind seit seiner Eröffnung<br />
116
Das Marienhospital<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1939/1942<br />
bis heute 4261 Soldaten, Offiziere und<br />
Unteroffiziere in stationärer, und 13713<br />
in ambulanter Behandlung gewesen. ...<br />
Von den Schwestern sind 19 für das Reservelazarett<br />
einberufen, weitere 6 werden<br />
demnächst folgen. Außerdem arbeitet<br />
natürlich unsere gesamte sonstige Gefolgschaft<br />
für das Reservelazarett, da das Haus<br />
ja vertragsgemäß die Pflege, Verpflegung<br />
und die sonstige Versorgung des Lazaretts<br />
zu tragen hat. Außerdem sind 3 Rote Kreuz<br />
Schwestern als freiwillige Helferinnen in<br />
unserem Lazarett tätig“.<br />
Das mit der Wehrmacht ausgehandelte<br />
Übereinkommen fand 1942 eine<br />
Änderung, als auf allgemeine Anordnung<br />
der Sanitätsbehörden innerstädtische Reservelazarette<br />
wegen der zunehmenden<br />
Luftangriffe in weniger gefährdete Gebiete<br />
verlegt werden sollten. Anstelle des Reservelazarettes<br />
wurde im Marienhospital<br />
ein Standortlazarett für die in Düsseldorf<br />
und Umgebung liegenden militärischen<br />
Abteilungen eingerichtet und ab dem 4.<br />
Juli 1942 die Bettenzahl von 400 auf 120<br />
herabgesetzt. Hierdurch war es möglich,<br />
die bisher überaus dichte Belegung zu<br />
vermindern. Betrug die Zahl der zu versorgenden<br />
Betten vor der Umstellung 605,<br />
so waren am <strong>Jahre</strong>sende 1942 noch 540<br />
aufgestellt, von denen 120 dem Standortlazarett<br />
und 420 der Zivilbevölkerung zur<br />
Verfügung standen. Trotz der Verkleinerung<br />
des Militärlazaretts blieb die Versorgung<br />
der eingelieferten Patienten schwierig.<br />
Im Rechenschaftsbericht 1942 gibt der<br />
Vorstand zu Protokoll: „Die kriegsbedingte<br />
Verknappung der Lebensmittel, Medikamente<br />
und aller Gegenstände des großen<br />
und vielseitigen Bedarfes eines modernen<br />
Krankenhauses, verbunden mit der ständig<br />
sich steigernden Schwierigkeit in der<br />
Beschaffung von Bezugsscheinen und Kontingenten wirkten<br />
sich auf die Betriebsführung des Hauses erschwerend aus<br />
und stellten erhöhte Anforderungen an die Verwaltung, die<br />
Krankenpflege, die Versorgung des Hauses mit den notwendigen<br />
Betriebsmitteln sowie an die laufende Instandhaltung<br />
der Gebäude, Krankenräume, sanitären und technischen<br />
Einrichtungen. Dank der einsatzfreudigen und vorbildlichen<br />
Haltung der Ärzte, Schwestern und der ganzen Gefolgschaft<br />
ist es jedoch allen Schwierigkeiten zum Trotz gelungen, im<br />
vergangenen <strong>Jahre</strong> das Niveau des Hauses auf einer fast<br />
gleichwertigen Höhe zu erhalten und sowohl den erkrankten<br />
und verwundeten Soldaten als auch der Zivilbevölkerung, wie<br />
in den bisherigen Kriegsjahren, Pflege und Hilfe angedeihen<br />
zu lassen. ... Das Verhältnis zwischen dem militärischen<br />
und zivilen Sektor des Hauses war, wie in den vergangenen<br />
Kriegsjahren, bei dem beiderseitigen guten Willen, einander<br />
zu helfen und Schwierigkeiten auszuräumen, einwandfrei“.<br />
Das Marienhospital<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1939/1942<br />
Als am 1. September 1939 deutsche Truppen in das weit<br />
entfernte Polen einmarschierten, glaubte das Marienhospital<br />
in Pempelfort nach damaligen Vorstellungen, alle erforderlichen<br />
Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben. So ist im<br />
<strong>Jahre</strong>srückblick 1939 ausdrücklich vermerkt:<br />
„Unter dem Isolierhaus wurde im<br />
Laufe des <strong>Jahre</strong>s ein neuer Luftschutzraum<br />
erbaut, der den gestellten Anforderungen<br />
entspricht. Die Verdunkelung ist, wenn<br />
sie richtig gehandhabt wird, im ganzen<br />
Hause, besonders auch in den Operationsräumen,<br />
durchgeführt. Das notwendige<br />
Luftschutzgerät, soweit es zu kaufen ist,<br />
wurde beschafft. Auch der Luftschutzbetriebsplan<br />
wurde aufgestellt. Die aktive<br />
Luftschutzgefolgschaft ist in einem, hier<br />
im Hause abgehaltenen Luftschutzkursus,<br />
an dem sich auch viele Schwestern beteiligten,<br />
ausgebildet“.<br />
Dr. Gustav Pfeffer, Chefarzt der Inneren<br />
Abteilung (1934-1964), um 1960<br />
Marienhospital,<br />
Luftschutzkeller, 1936<br />
117
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital,<br />
vor 1939<br />
Die ersten Luftangriffe auf die Stadt<br />
1940/41 überstand das Marienhospital<br />
unbeschadet, doch löste der Einfall feindlicher<br />
Flieger „furchtbaren Schrecken aus“.<br />
Die Chronik berichtet zu diesen Angriffen:<br />
„Der Luftkrieg mit seinen vielen Terrorangriffen<br />
stellte immer neue und größere<br />
Anforderungen; vor allem mußten auch<br />
weitgehendste Maßnahmen zur sicheren<br />
Unterkunft und Unterbringung in Luftschutzräumen<br />
geschaffen werden. Die<br />
Kellerräume wurden mit großem Kostenaufwand<br />
dazu umgebaut, von außen<br />
Schutzvorrichtungen geschaffen und auch<br />
mit Sitz- und Liegeeinrichtungen versehen.<br />
... Ein <strong>Buch</strong> könnte gedruckt werden von all<br />
den Opfern, welche diese Luftschutzmaßregeln<br />
von den Schwestern und von den<br />
Hausangestellten erforderten; wie sie oft<br />
2‐3 mal des nachts ihre Pflegebefohlenen<br />
herauf und herunter befördern mußten.<br />
... Doch alles ließ sich ertragen, wenn<br />
man beim Verlassen der Luftschutzräume<br />
nach oben kam und das Haus unbeschädigt<br />
blieb; dann stieg jedesmal ein heißes<br />
Dankgebet zum Himmel auf. Da die Lage<br />
immer schwerer wurde und die Angriffe<br />
häufiger und ernster, wurde im Souterrain<br />
eine Krankenstation eingerichtet, welche<br />
die Schwerkranken und Operierten gleich<br />
aufnahm, was sich in der Folge, als äußerst<br />
vorteilhaft erwies“.<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1942 waren fast alle Teile der<br />
Düsseldorfer Innenstadt zur Zielscheibe der<br />
Fliegerangriffe geworden. Wie durch ein<br />
Wunder hatte das Marienhospital bei den<br />
Angriffswellen auf Derendorf und Pempelfort<br />
nur kleinere Schäden zu verzeichnen<br />
und keine Toten oder Verletzten zu beklagen.<br />
Beim Angriff am 1. August 1942 fielen<br />
30 Stabbomben auf das Gebäude und auf<br />
das Gelände des Hospitals, die allerdings<br />
118
Das Marienhospital<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1943/44<br />
nur ein Doppelbettzimmer im dritten Stockwerk<br />
in Brand setzten und fünf Betten in<br />
der zweiten Etage unbrauchbar machten.<br />
Auch das Treibhaus im Garten wurde getroffen<br />
und brannte vollständig aus. Als im<br />
September 1942 ein Bombenregen auf die<br />
Brauerei Dieterich an der Duisburger Straße<br />
niederprasselte, gingen im Marienhospital<br />
infolge des Luftdrucks fast alle Fensterscheiben<br />
zu Bruch. „Doch auch hier konnte man<br />
beim Verlassen des Luftschutzkellers“, so<br />
die Schwesternchronik, „wiederum Gott<br />
danken, daß er uns so gnädig beschützt<br />
und unser Haus verschont hatte“. Weiter<br />
heißt es zu den Bombardements des <strong>Jahre</strong>s<br />
1942: „Noch mehrere Male kamen kleinere<br />
und größeren Angriffe, und Düsseldorf<br />
wurde leider schwer mitgenommen so<br />
am 2. November 1942 beim Angriff auf<br />
Düsseldorf-Derendorf, wo viele Tote zu<br />
beklagen waren ... , während das Hospital<br />
Gott Dank nur mit Fensterschäden davonkam.<br />
So ... blieb das Haus im <strong>Jahre</strong> 1942<br />
Dank des besonderen Schutzes Gottes und<br />
der Patronin und Beschützerin des Hauses,<br />
der lieben Gottesmutter verschont“.<br />
Niederschrift der Vorstandssitzung 18. Juni 1942<br />
(Auszug)<br />
Abschließend bemerkte der Vorsitzende<br />
noch, daß im Zuge der sogenannten Glocken-Aktion<br />
auch die 3 Bronce-Glocken<br />
des Marienhospitals, die Kapellenglocke<br />
von 75 kg Gewicht und 2 Uhrenglocken<br />
von 25 und 15 kg Gewicht beschlagnahmt<br />
und ausgebaut worden seien. Da<br />
die Entfernung der Uhrenglocken sich<br />
im Betriebe sehr störend auswirkt, sind<br />
Verhandlungen eingeleitet, die Bronce-<br />
Glocken durch Stahlguss-Glocken zu<br />
ersetzen.<br />
Das Marienhospital<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1943/44<br />
Mit Beginn des <strong>Jahre</strong>s 1943 trafen<br />
die Fliegerangriffe das Marienhospital<br />
mit der gleichen Härte, die auch die<br />
Stadt traf. Über den verhängnisvollen<br />
Beschuss der Anstalt in der Nacht<br />
vom 27. zum 28. Januar 1943 hat<br />
die Chronistin des Hauses folgenden<br />
Ablauf der Geschehnisse festgehalten:<br />
„Am zweiten Josefs-Mittwoch abends<br />
7 Uhr wurde an der Flakdienststelle<br />
angefragt, ob Luftgefahr festzustellen<br />
sei, worauf es hieß: Alarmbereitschaft.<br />
So wurde es den Stationen gemeldet<br />
und sofort erfolgte vom 3. und<br />
2. Stock der Transport der Kranken<br />
in die Luftschutzräume; nach weiteren<br />
5 Minuten wurde Luftgefahr<br />
gemeldet, und nun flüchtete alles<br />
Brauerei Dieterich,<br />
Duisburger Straße 20/36, um 1930<br />
Flinger Straße, 1942<br />
Burgplatz, um 1945<br />
119
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
nach unten. Ein größerer friedlicher Verband an der Scheldemündung<br />
eingeflogen mit der Richtung auf Düsseldorf lautete<br />
die Meldung nach 5 Minuten. Noch weitere 5 Minuten und<br />
starke Flakgeschosse und Leuchtschirmchen über das Hospital<br />
künden uns nichts Gutes. Alle Insassen des Hauses, sind<br />
unten; wir sind schon in Erwartung und eifrig am beten, da,<br />
der erste schwere Einschlag, ein Knall, der das ganze Haus<br />
erschüttert, ein Klirren von Scheiben, die aus ihren Rahmen<br />
flogen, Türen und Fenster flogen hinaus. Im Augenblick steht<br />
das ganze Hospital in hellen Flammen, das ganze Gebäude,<br />
sämtliche Dächer waren von ungezählten Brandbomben<br />
getroffen und in ein Flammenmeer getaucht. Ein Beobachter<br />
meldete, daß aus einem Flugzeug Phosphormengen in loser<br />
Form abgeworfen wurde und sich aus der Ferne angesehen<br />
hätte, als ob Feuer in Eimern ausgeschüttet würde. An 300<br />
Bomben hatten das Haus getroffen und so entstand ein Feuermeer.<br />
Das Kesselhaus, Nähzimmer, Clausur, Doktorenhaus,<br />
Nachbarhaus, Sparkasse (Sternstr. 71/73) brennen lichterloh,<br />
der ganze Gartenweg ist wie mit leuchtenden Funken besät;<br />
zugleich geht eine Luftmine in die Brauerei Dieterich nieder,<br />
an deren Wirkungen die ganze Nachbarschaft zu leiden hatte.<br />
Die Kapelle dröhnte wieder von dem Bersten der Scheiben,<br />
das Singchor klingt wieder vom Krachen brennender Bänke<br />
und herabfallender Mauerstücke, alles nur ein Trümmerhaufen,<br />
und das Bombardement hält an; das Hospital steht<br />
im Mittelpunkt der Leuchtkugeln. Kranke und Angestellte<br />
bleiben auffallend und musterhaft ruhig. Schwestern und<br />
Hausangestellte leisten Übermenschliches im Löschen und<br />
Wassertragen. Die Feuerwehr wird alarmiert, kurze Zeit,<br />
und der erste Löschzug, dem bald sieben weitere folgen,<br />
fährt vor; beim Anblick des in Flammen stehenden Hospitals<br />
bekommt der Leiter des ersten Zuges einen Weinkrampf;<br />
unsere drei Hydranten, ganz neu, versagen ihr Wasser, weil<br />
von der Stadt abgestellt. Das Wasser wird aus der Düssel<br />
geholt; 14 lange Schläuche sind angelegt und mit Gefäßen<br />
jeglicher Art wird nachgeholfen. Außer dem Sicherheits- und<br />
Hilfsdienst nahmen etwa 200 Personen an den Löscharbeiten<br />
teil; selbst während des Löschens gingen noch Bomben auf<br />
das Haus nieder; der hintere Mittelflügel war am meisten<br />
getroffen. Nun fing ein furchtbares Wasserspiel an: Wasser,<br />
Geröll alles Mögliche kam die Treppe herunter, zum Überfluß<br />
platzte auch noch ein Schlauch und so sauste das Wasser<br />
wie ein reißender Strom allseitig die Treppe<br />
herunter; Matratzen und Betteile wurden<br />
hinausgeworfen, um zu retten, was eben<br />
möglich war. Schwestern, Pfleger und<br />
Pflegerinnen, Hausangestellte, alles half<br />
mit Besen aller Art und allen nur möglichen<br />
Geräten, das Wasser zu schöpfen und zu<br />
kehren und zu schleppen und so einen<br />
Weg zum Garten zu bahnen und einen<br />
Abfluß zu verschaffen; der Wasserzustrom<br />
war so stark, daß diese Arbeit bis 11 Uhr<br />
morgens anhielt, trotz aller Gegenarbeit<br />
und Abwehr. Nach 1,5-2 Stunden kam Entwarnung,<br />
die Rheinische Bahngesellschaft<br />
sandte gleich mehrere Autobusse zum<br />
Abtransport der Wehrmachtsangehörigen<br />
und Civilpersonen, es ging alles in bester<br />
Ordnung; viele hatten sich eingefunden für<br />
Hilfe zu leisten und die Leute weinten beim<br />
Anblick dieser Verheerung. Da, eine neue<br />
Welle feindlicher Flieger, neuer Alarm; es<br />
entsteht eine wahre Panik unter den Leuten;<br />
in diesem Riesenfeuer war es ja dem<br />
Feind ein Leichtes, die armen Menschen zu<br />
treffen; doch Gott Dank ging es bald vorüber,<br />
ohne weiteren Schaden anzurichten.<br />
Nach der Entwarnung ging es nun an die<br />
Aufräumungsarbeiten; im Hofe bot sich<br />
ein trostloser Anblick, brennende Balken,<br />
herabfallende Brocken hatten sich dort<br />
gelagert; nach den ersten Löscharbeiten<br />
ging es wieder ans Wasserschöpfen. Bei<br />
herannahendem Tageslicht erschien ein<br />
Trupp Holländer etwa <strong>150</strong> Mann stark,<br />
schätzungsweise ebenso zahlreich ein<br />
Trupp Franzosen als Hülfe und gegen 11<br />
Uhr erschien eine Hülfskommission, um<br />
die Arbeiten zu überwachen. Alle möglichen<br />
Arbeiter und Handwerker waren<br />
bald zur Stelle, Glaser, Klempner, Schreiner,<br />
Schlosser, Installateure, fast alle Innungen<br />
waren vertreten; es gab ein Aufräumen und<br />
120
Das Marienhospital<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1943/44<br />
Arbeiten fast ohne Ende. Auf dem Hof, im<br />
Garten, rund um das Hospital lag alles hoch<br />
aufgeschichtet von Geröll, Eisen, Balken,<br />
verkohlten Betten, Türen und Fenstereinfassungen<br />
und dergleichen mehr ein Greuel<br />
der Verwüstung. Jetzt waren wir arm dran,<br />
keine Heizung, kein Licht, weder warmes<br />
noch kaltes Wasser war da. Eine Metzgerei<br />
Gliedt (Duisburger Str. 84a) kochte uns<br />
Kaffee, die gute Schwester Ignatiana aus<br />
Kaiserswerth eilte herbei und brachte uns<br />
gut belegte Butterbrote und versorgte uns<br />
an den folgenden Tagen auch mit Eintopf-<br />
Speisung, die sie täglich mit dem Auto<br />
schickte; auch die Ratinger Schwestern<br />
beteiligten sich daran. So hat der liebe<br />
Gott in seiner Vatergüte und Sorge trotz<br />
allem seine Kinder doch nicht verlassen.<br />
Es war gewiß eine große Verheerung, Leid<br />
und Sorge und große Verluste, besonders<br />
für unsere gute Schwester Annuntiata<br />
und die Verwaltung, doch ist dieses noch<br />
zu ertragen und zu überbrücken, ist ja,<br />
Dank dem besonderen Schutze Gottes kein<br />
Menschenleben zu Schaden gekommen.<br />
Auch daß das Licht im Keller noch brannte,<br />
haben wir als Gottes Schutz erkannt.<br />
So ging der erste Tag vorüber, beständig<br />
fielen noch brennende Balken herunter, der<br />
Brandgeruch stieg immer mehr und abends<br />
½ 9 Uhr glimmten noch 8 Brandherde;<br />
die Stadt stellte uns eine 6 Mann starke<br />
Brandwache, die auch ihre Arbeit gut besorgten,<br />
sodaß wir etwas Sicherheit hatten.<br />
Schon in der Nacht und am folgenden Tag<br />
kamen Schwestern aus den benachbarten<br />
Filialen uns zu helfen, Annastift, Ratingen,<br />
Kaiserswerth, die auch Mädchen schickten<br />
zu räumen und zu putzen. So halfen sie uns<br />
denn, alles was an Matratzen, Bettzeug<br />
usw. herausgeworfen worden war, wieder<br />
zu sortieren und nach oben zu bringen; es Marienhospital, um 1943<br />
121
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, um 1943<br />
war ein buntes Durcheinander<br />
und erforderte viel Arbeit und<br />
Geduld. Viele Auswärtige boten<br />
sich auch an, zu helfen;<br />
es war rührend zu sehen, wie<br />
die Düsseldorfer Bevölkerung<br />
an unserem Mißgeschick teilnahm,<br />
viele weinten, mehrere,<br />
gute Leute hatten schon in<br />
der Nacht Obdach und Betten<br />
angeboten für die Schwestern;<br />
man sah es ihnen an, daß es<br />
ehrlich gemeint war und von<br />
Herzen kam; auch ihnen ein<br />
herzliches Vergelt‘s Gott für<br />
ihr Wohlwollen und ihre Hilfe;<br />
möge der liebe Gott es ihnen<br />
reichlich lohnen. ... Die Schlafräume<br />
der Hausangestellten<br />
waren auch abgebrannt und<br />
hatten diese alles verloren; so<br />
wurden Schlafmöglichkeiten<br />
auf alle verfügbaren Plätze im<br />
Bügelzimmer, Waschküche, in<br />
den Fluren usw. geschaffen“.<br />
Dem Bericht der Ordenschronik über die<br />
Ereignisse in der Nacht vom 27. auf den<br />
28. Januar 1943 ist zu ergänzen, dass noch<br />
während des Abklingens der Brände erste<br />
Maßnahmen zur Wiederherstellung des<br />
Marienhospitals unter Leitung des Architekten<br />
Wilhelm Dicken ergriffen wurden.<br />
Die Beschädigungen waren beträchtlich.<br />
Wesentlich sachlicher und nüchterner als<br />
der Bericht der Pflegeschwestern liest sich<br />
ein zeitgleich erstelltes Protokoll des Vorstandes,<br />
das den Schadensumfang an den<br />
verschiedenen Gebäuden des Marienhospitals<br />
wie folgt aufnahm:<br />
„Krankenhaus mit Schwesternflügel<br />
und Kapellenbau. Das Dach und das<br />
darunter liegende Dachgeschoß des Krankenhauses<br />
brannten ab. ...<br />
Kesselhaus mit Nebengebäuden. Das<br />
Dach über der Hochdruckkesselanlage<br />
brannte zum Teil und das über der Näherei<br />
vollständig ab. ... Die Kesselanlage<br />
mit den zugehörigen Apparaten wurde<br />
nur ganz gering beschädigt und blieb voll<br />
betriebsfähig.<br />
Isolierhaus mit anschließendem Anbau.<br />
Einige Stabbrandbomben durchschlugen<br />
das Dach und beschädigten die Decke.<br />
Die Krankenzimmereinrichtungen verbrannten.<br />
...<br />
Gefolgschaftshäuser Rochusstr. 2 und<br />
4. Stabbrandbomben durchschlugen das<br />
Dach. Im ersten Obergeschoß brannten<br />
die Balkendecke und fünf Räume aus. ...<br />
Ärztewohnungen Ehrenstr. 14a. Es traten<br />
im wesentlichen nur Glasschäden auf.<br />
Gärtnerei. Durch eine Stabbrandbombe<br />
entstanden geringe Beschädigungen“.<br />
122
Das Marienhospital<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1943/44<br />
Mit dem Luftangriff auf das Marienhospital<br />
waren der Stadt Düsseldorf in einer Nacht<br />
650 Krankenbetten verlorengegangen. Um<br />
Engpässe in der medizinischen Versorgung<br />
zu vermeiden, wurde von den Behörden<br />
noch in der Brandnacht beschlossen, die<br />
Wiederinbetriebnahme des Marienhospitals<br />
mit Nachdruck zu fördern, zumal<br />
sämtliche Operationssäle, Sterilisation,<br />
Röntgeninstitut, Badestation und technische<br />
Anlagen wie Heizung, Wasser- und<br />
Elektrizitätsversorgung, Küche, Bäckerei,<br />
Waschbetrieb, Fernsprechanlage noch<br />
einsatzbereit waren. Zum Fortgang der<br />
Reparaturarbeiten heißt es in einem Zwischenbericht<br />
des Vorstandes im Frühjahr<br />
1943: „Der Leiter der Sofortmaßnahmen<br />
der Stadt Düsseldorf hat ... als erste Anordnung<br />
die Aufräumungs- und Abbrucharbeiten<br />
sowie die notwendigen Reparaturen<br />
und die Verglasung usw. angeordnet. Das<br />
Haus wurde mit einem Not-Aschbetondach<br />
versehen und im übrigen die Instandsetzung<br />
nach der 18. Anordnung des Generalbevollmächtigten<br />
für die Regelung der<br />
Bauwirtschaft durchgeführt. Die Arbeiten<br />
wurden mit 50 deutschen Handwerkern<br />
aller Berufsgruppen und einer Kompanie<br />
vom Arbeits-Bataillon 7 (Holländer und<br />
Franzosen) begonnen. Als Ersatz für die<br />
durch die Zerstörung des Dachgeschosses<br />
ausgefallenen Räume wurde die Aufstellung<br />
zweier großer Wohnbaracken aus Holz<br />
auf dem Gartengelände zur Unterbringung<br />
des Pflege‐ und Hauspersonals sowie von<br />
Geschäftsräumen der Lazarettverwaltung<br />
und dergleichen genehmigt“.<br />
Auf behördliche Anordnung wurde<br />
Mitte Februar 1943 als Folge des Bettenverlustes<br />
im Marienhospital und in den<br />
übrigen Düsseldorfer Krankenhäusern in<br />
der Heil‐ und Pflegeanstalt Grafenberg<br />
eine behelfsmäßige „Innere<br />
Abteilung“ von etwa 100<br />
Betten eingerichtet, deren<br />
ärztlicher Dienst und stationäre<br />
Krankenpflege in den<br />
Händen der Pempelforter<br />
Anstalt lag.<br />
Am 20. März 1943<br />
konnte in der Kapelle des<br />
Marienhospitals „zur größten<br />
Freude aller“ wieder<br />
Gottesdienst gehalten werden;<br />
zwei Wochen später<br />
war auch die beschädigte<br />
Orgel spielbereit. Zur gleichen<br />
Zeit war die zivile Männerstation, ein<br />
Teil des Lazarettes und das Isolierhaus zur<br />
Aufnahme neuer Patienten fertig gestellt<br />
worden. Anfang April 1943 betrug die Zahl<br />
der stationär behandelten Kranken im Lazarett<br />
86, in den Zivilabteilungen 50 und im<br />
Ausweichkrankenhaus Grafenberg 86. Auch<br />
die Klausur der Franziskanerinnen konnte<br />
schnell wieder repariert und in Gebrauch<br />
genommen werden, so dass die Schwestern<br />
nicht mehr auf den Stationen zu schlafen<br />
brauchten. Als die Belegungsmöglichkeit im<br />
Marienhospital wieder auf über 400 Betten<br />
angestiegen war, wurden am 31. April 1943<br />
die ausgelagerten Versorgungskapazitäten von<br />
Grafenberg nach Pempelfort zurückgeführt.<br />
Durch die Zerstörung des Dachgeschosses<br />
fehlten dem Marienhospital in Ermangelung<br />
von Baustoffen und Arbeitskräften noch für<br />
längere Zeit 180 Betten; doch „sonst war das<br />
Haus wieder schön in Betrieb“.<br />
Obwohl die Schwestern seit Ende März<br />
1943 jeden Abend gemeinsam den Rosenkranz<br />
mit der besonderen Bitte um Schutz<br />
bei Fliegergefahr beteten, geriet das Marienhospital<br />
nur wenige Wochen nach der provisorischen<br />
Wiederherstellung wieder direkt<br />
Marienhospital, um 1943<br />
Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg,<br />
Bergische Landstraße 2, um 1935<br />
123
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
St. Rochus, Prinz-Georg-Straße 110,<br />
um 1945<br />
in das Schussfeld der Angreifer. Am 12. Juni 1943, dem<br />
Samstag vor Pfingsten, ertönten um 0.50 Uhr die Sirenen<br />
und signalisierten Großalarm für Düsseldorf. Was sich nach<br />
der Warnung in jener Nacht und am folgenden Tag im und<br />
vor dem Marienhospital ereignete, hat die Chronistin der<br />
Franziskanerinnen in bewegenden Worten festgehalten:<br />
„Das Allerheiligste ist bereits durch den hochwürdigen Herrn<br />
Pastor Karl Tholen unten untergebracht, auch die Schwestern<br />
und die Angestellten sind, schon den Rosenkranz betend<br />
versammelt, als Schlag auf Schlag das Haus erzittern macht,<br />
die Erde bebt, es folgt ein furchtbares Krachen und Poltern,<br />
man befürchtet das Schlimmste, man fragt sich: wo mag es<br />
sein, wer ist getroffen, jeder denkt: Gott ruft mich, das letzte<br />
Stündlein ist gekommen; Herr Pastor erteilt uns allen, auch<br />
den Kranken in den anderen Räumen inbegriffen die General-<br />
Absolution. Es sind qual- und angstvolle Stunden; nach ungefähr<br />
2 Stunden 20 Minuten, vor 3 Uhr wird entwarnt; diese<br />
Zeit war allen wie eine Ewigkeit vorgekommen, und bangen<br />
Herzens begaben sich alle wieder nach oben; es hatte besser<br />
gegangen, als wir erwartet hatten. ... Die Betten der Kranken<br />
waren mit Glassplitter besät; doch hat wiederum niemand<br />
Schaden gelitten; wir können der göttlichen Vorsehung nicht<br />
genug danken für den Schutz, die sie uns in dieser großen<br />
Gefahr gewährte. Auf dem Dach lagen 7 Canister und 31<br />
Brandbomben, im Garten brannten 3 Baracken bis auf Grund<br />
und Boden ab, und konnte nichts gerettet werden, während<br />
auf dem Dach gelöscht<br />
werden konnte. Eine Baracke<br />
war gerade vor 14 Tagen als<br />
Marienheim – als Schlafstätte<br />
für die Mädchen eingerichtet<br />
worden, die zweite war im<br />
Anstrich und die dritte diente<br />
als Lagerraum der beim ersten<br />
Angriff im Januar geretteten<br />
Türen und Fenster. Auch die<br />
Kapelle erhielt einige Brandbomben,<br />
das Feuer konnte<br />
aber vom Dach aus gelöscht<br />
werden. Alles in der Umgebung<br />
brennt, Ehren-, Blücher-,<br />
Stern- und Stockkampstraße,<br />
es ist ein wahrer Brandherd; raucherfüllte<br />
Luft, ganz geschwärzt, erfüllt von Brandteilchen,<br />
die den flüchtenden Menschen<br />
draußen in die Augen fliegen und ihnen<br />
große Schmerzen und Beschwerden verursacht,<br />
sodaß jetzt ein großer Anlauf zum<br />
Hospital beginnt von Augenkranken, Verbrennungen,<br />
Verletzte aller Art. Ärzte und<br />
Schwester hatten voll auf zu tun und haben<br />
Unmenschliches geleistet. Das Rauchen<br />
der brennenden Häuser dauerte den ganzen<br />
Tag, an der Pforte wurden unzählige<br />
Menschen gespeist, es war förmlich eine<br />
Völkerwanderung von armen, kranken,<br />
verletzten, hungrigen, flüchtenden und<br />
hilfesuchenden Menschen, ein Betrieb<br />
wie es noch nie erlebt worden ist. Gott<br />
Dank wurde allen bestmöglich geholfen.<br />
Alle waren bestrebt den armen gequälten<br />
Menschen in tätiger Liebe zu begegnen<br />
und ihnen zu helfen. Selbst vom lieben<br />
Mutterhause trafen hier 24 Schwestern<br />
als Obdachlose ein und fanden auch hier<br />
ein neues Heim, war ja in Aachen dem Angriff<br />
alles zum Opfer gefallen. Im Hospital<br />
waren ungezählte Scheiben zertrümmert,<br />
besonders im Neubau, Operationszimmer,<br />
die großen schönen Scheiben, Löcher in<br />
den Decken und Wänden. Dachstuhl und<br />
Sakristei brennen, doch es konnte gelöscht<br />
werden, ehe es um sich griff; in der Kapelle,<br />
erst vor kurzem schön erneuert, sind alle<br />
Fenster herausgeworfen. Die Rochuskirche,<br />
Heilig Geist, Dreifaltigkeit, St. Paulus,<br />
Marienkirche, Franziskanerkloster, alles<br />
brennt. Herr Dechant Max Döhmer mit seinem<br />
Kaplan und Haushälterin haben alles<br />
verloren und kommen zu uns und finden<br />
Obdach. Der Gottesdienst von Rochus und<br />
Heilig Geist wurde nach hier verlegt. Die<br />
hl. Messen waren 6, ½ 8, ½ 9, 9, 10, 11,<br />
12 und abends 8 Uhr. Das Annakloster<br />
124
Das Marienhospital<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1943/44<br />
der Schwestern vom armen Kinde Jesu,<br />
Dienstmägde Christi, Clarissen, Ursulinen,<br />
Theresienhospital, Martinus-Krankenhaus,<br />
alles brennt und haben alles verloren, und<br />
kommen hierhin Obdach zu suchen. Die<br />
Schwestern schlafen teilweise hier im<br />
Hospital und auswärts; die Schwestern<br />
von Rochus, Dienstmägde Christi wohnen<br />
in unserer Clausur, im Kapitelzimmer zu<br />
sieben Schwestern; 4 Clarissen wurden<br />
am folgenden Tag nach Heerdt ins Krankenhaus<br />
geholt. ... Am Sonntag den 13.<br />
Juni 1943 schickte uns die Stadt einen<br />
Wasserwagen mit Trinkwasser, was uns<br />
alle sehr erfrischte und erquickte, war es<br />
uns jetzt ermöglicht, einen Trunk reinen<br />
Wassers zu trinken; die Menschen waren<br />
ja wie innerlich verbrannt und ausgedörrt<br />
von der Feuersbrunst und Rauch; so sorgt<br />
der liebe Gott doch immer wieder für die<br />
Seinen. ... Warmes Wasser, Suppe und<br />
Gemüse holten wir in der Duisburgerstraße<br />
in der Metzgerei Gliedt, der das Hospital<br />
großen Dank schuldet, da die Familie in<br />
rührender Weise für uns sorgte“. Nach<br />
dem schweren Pfingstangriff wurden im<br />
Marienhospital über zwei Wochen lang<br />
an ausgebombte Menschen täglich 200<br />
bis 300 Essen in einer improvisierten Suppenküche<br />
ausgegeben.<br />
Im weiteren Verlauf des <strong>Jahre</strong>s 1943<br />
wurden die Intervalle zwischen den einzelnen<br />
Fliegerangriffen auf Düsseldorf und<br />
damit auch auf das Marienhospital immer<br />
kürzer. Jedes Bombardement hinterließ<br />
am Pempelforter Krankenhaus sichtbare<br />
Schäden und ließ den Zustrom von Verletzten<br />
anschwellen. So berichtet die Chronik<br />
beispielsweise: „Am 5. Oktober 1943 um<br />
7 Uhr abends ist Großalarm, 16 Volltreffer<br />
trafen die Rhein-Metallfabrik und kamen<br />
dann auch die Verletzten; Tag und Nacht<br />
Theresienhospital, Josephskapelle, um 1945<br />
Alt-Pempelfort/Prinz-Georg-Straße, 1943<br />
Kaufhof, Königsallee 1, um 1945<br />
Schreiben der Oberin Sw. Annuntiata an die Generaloberin Sw. Rufina in<br />
Aachen (Auszug)<br />
Düsseldorf, den 14. Juni 1943<br />
Liebe, teure Mutter.<br />
Herzliche Grüsse, liebe Würdige Mutter. ... Wir haben<br />
einen Bombenangriff hinter uns, wie wir bisher noch<br />
keinen erlebten. Eine Unmenge Spreng- und Brandbomben<br />
und sehr viele Luftminen kamen über uns.<br />
Durch unser neues, schweres Betondach konnten die<br />
Brandbomben nicht durchschlagen. Sie blieben im<br />
Beton stecken. ...<br />
Dem Herrn sei Dank für seinen gnädigen Schutz.<br />
Es ist niemandem, weder Schwestern noch Patienten<br />
etwas passiert. Alle waren im Keller. Im ganzen Haus<br />
sind Tür- und Fensterrahmen stark beschädigt und<br />
zertrümmert, die Decken und Wände sehr gerissen.<br />
Unsere beiden neuen Baracken sind abgebrannt, die<br />
waren so schön – und nun stehen wieder 60 Mädchen<br />
obdachlos da. Aber alles wie Gott will.<br />
Düsseldorf allerdings ist ein großer Brand. Die<br />
ganze Stadt ist zertrümmert. Die armen Menschen<br />
sitzen auf der Strasse und behüten die paar geretteten<br />
Sachen. Wir haben die Obdachlosen abwechselnd zu<br />
Hunderten im Flur sitzen. Alle bekommen zu essen und<br />
zu trinken. Zur Augenabteilung strömen die Menschen<br />
zur Behandlung der entzündeten Augen. Der Andrang<br />
ist so stark, daß wir in drei verschiedenen Abteilungen<br />
die Augen versorgen bis in die Nacht hinein. Im Operationszimmer<br />
ist beständig an den Verletzten zu arbeiten.<br />
Viele sterben. Es ist kein elektrischer Strom da, kein Gas,<br />
kein Wasser. So fahren also auch keine Aufzüge, was<br />
die Arbeit ungeheuer erschwert. Alle Schwerkranken<br />
bleiben Tag und Nacht im Luftschutzkeller – wir können<br />
sie ja nicht alle hin- und hertragen. ...<br />
Mehrere Krankenhäuser mussten räumen – es ist<br />
kaum ein einziges Krankenhaus der Stadt in Ordnung. ...<br />
Kein Geschäft besteht mehr. Die großen Geschäftsstrassen<br />
bilden ein wahres Trümmerfeld.<br />
125
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
haben Ärzte und Schwestern gearbeitet, den Verletzten,<br />
Verwundeten und Verbrannten Hilfe zu leisten; 70-80 mußten<br />
notgedrungen aufgenommen werden und wurden darum im<br />
Flur der Röntgen-Abteilung, Betten übereinander gestellt, diese<br />
Armen aufzunehmen. Was es heißt, die Kranken jedesmal<br />
herunter zu tragen, weiß nur der, der es mitmachen mußte“.<br />
Obwohl sich die Lebensbedingungen für die Einwohner<br />
der Stadt Düsseldorf von Tag zu Tag verschlechterten, gab<br />
es immer noch Menschen, die dem Marienhospital uneigennützig<br />
ihre Hilfe und Unterstützung anboten. So überließ<br />
etwa Direktor Emil Fenger der Anstalt für die Zeit des Krieges<br />
gegen einen geringen Mietzins sein Wohnhaus Ehrenstr. 16<br />
zur Aufnahme erkrankter Kinder.<br />
Liest man heute die Aufzeichnungen der Franziskanerinnen,<br />
berührt das Gottvertrauen und die Gelassenheit, mit<br />
der Ärzte, Schwestern und Hausangestellte aller Gefahren<br />
zum Trotz ihre Arbeit im Marienhospital fortsetzten. An einen<br />
Schutz für Leib und Leben durch diejenigen, die den Zweiten<br />
Weltkrieg angezettelt hatten, glaubte im Krankenhaus schon<br />
lange niemand mehr. Vor dieser Folie wenig verwunderlich, in<br />
einer Zeit ständiger Überwachung und Bespitzelung jedoch<br />
mehr als bemerkenswert, rückte das obligatorische Hitlerbild<br />
im Eingangsbereich des Marienhospitals demonstrativ in die<br />
zweite Reihe: „Am 25. September 1943 ist unser Portal wieder<br />
frei von allem Gerümpel“, bekennt die Hauschronik freimütig,<br />
„die Mutter Gottes steht Gott Dank wieder im Mittelpunkt<br />
des Hospitals. Das Bild des Führers, das zwangsweise dieser<br />
vorgestellt war, wurde vom Baukomite rechts an der Wand<br />
aufgehangen; und wenn auch im Hintergrund gestellt, war<br />
und blieb sie die Herrin, Herrscherin und Schützerin des<br />
Hauses“.<br />
Trotz aller Anrufe der Muttergottes geriet das Marienhospital<br />
am 23. April 1944 wieder unter schweren Beschuss.<br />
„Gegen 12 Uhr nachts gab es Vollalarm, der aber bald vorüberging“,<br />
beginnt die Chronistin ihre Zusammenfassung über<br />
den bislang folgenschwersten Angriff auf das Krankenhaus.<br />
„Nach der Entwarnung ½ 1 Uhr neuer Alarm, der uns nicht<br />
sonderlich beunruhigt; in dem Gedanken es sind Rückflüge,<br />
waren wir nicht alle im Luftschutzkeller, als bereits die ersten<br />
Bomben fielen. Die neue Meldung hieß: Die Spitze der<br />
Kampfverbände auf Düsseldorf, und schon dröhnte Bombe<br />
auf Bombe, das Haus erhielt 4 schwere Sprengbomben,<br />
7 Phosphorkanister und 30 Brandbomben,<br />
zu beiden Seiten der Kapelle, wo die<br />
Josefs-Statute stand und an der anderen<br />
Seite in der Nähe des Schweinestalles fielen<br />
2 Minen; außerdem brannten aus das<br />
Doktorenhaus Rochusstr. 2-4 sowie das<br />
gemietete Fengerhaus, wo die Mädchen<br />
untergebracht waren, und so waren diese<br />
schon dreimal ausgebombt und abgebrannt<br />
mitsamt ihren Sachen, Kleider und<br />
Wäsche. Die Minen richteten unsäglichen<br />
Schaden an; im ganzen Haus war eine<br />
furchtbare Verheerung, die Operations-,<br />
Entbindungsräume in der Frauen-Abteilung,<br />
Augenabteilung, Clausur, Nähzimmer,<br />
Kohlenlager und Leichenhaus mit<br />
anschließendem Schuppen, Schweinestall<br />
und was das traurigste war, unsere schöne,<br />
im streng gotischem Stile erbaute Kapelle<br />
wurde ein Opfer dieses Angriffes. Der<br />
40 Meter hohe gemauerte Schornstein<br />
des Kesselhauses wurde schwer geschädigt;<br />
später wurde er vom Militär aus,<br />
da er einen gewaltigen Riß hatte, daher<br />
ganz schief stand und so lebensgefährlich<br />
war, gesprengt. Im zweiten Obergeschoß<br />
brannte es an 3 Stellen, auch das Notdach<br />
über dem Treppenhaus brannte aus. An<br />
fast allen Stellen des Hauses entstanden<br />
Luftdruckschäden; der Operationstisch der<br />
Augenabteilung wurde durch drei Wände<br />
hindurch und durch die eiserne Aufzugstür<br />
in den Aufzug geschleudert. Der Luftdruck<br />
war so stark, daß die Schwester, die unten<br />
im Röntgenflur die Kranken betreuten<br />
über die Betten der Kranken geschleudert<br />
wurden, die Schleier wurden ihnen vom<br />
Kopf, Rosenkranz und Kordeln von der<br />
Seite gerissen; im Hof lagen die Schweine<br />
herum, zwei Tage rührten sie sich nicht,<br />
bewußt- und bewegungslos lagen sie da,<br />
sodaß man nicht feststellen konnte, ob<br />
126
Das Marienhospital<br />
in den <strong>Jahre</strong>n 1943/44<br />
sie noch lebten, zwei waren so schwer<br />
verletzt, daß sie notgeschlachtet werden<br />
mußten. Eine Sprengbombe und eine Mine<br />
gingen in den Gebäudeteil zwischen Altund<br />
Neubau und hat alles vom Dach bis<br />
Erdgeschoß auseinandergerissen. Drei<br />
kleine Zimmer parterre waren total mit<br />
Betten, Schränken und jeglichem Inhalt<br />
verschwunden und war keine Spur mehr<br />
davon zu sehen. So war der Verkehr zwischen<br />
beiden Bauten unterbrochen und die<br />
Verpflegung der im Neubau befindlichen<br />
Kranken, besonders die Unterbringung bei<br />
Alarm sehr erschwert. Auch der Mangel<br />
an Heizung, deren Rohre durchgeschlagen<br />
und am Boden lagen, machte sich<br />
besonders empfindlich bemerkbar, sowie<br />
auch das Fehlen der Wärmeanlagen bei der<br />
Verteilung von Essen. Die Kranken wurden<br />
wieder notdürftig untergebracht, viele<br />
abtransportiert, es verblieben etwa noch<br />
134 Patienten hier; doch war auch diesmal<br />
kein Menschenleben zu beklagen. Für uns<br />
Schwestern bot die Kapelle wohl den traurigsten<br />
und schmerzlichsten Anblick, der<br />
Dachstuhl brannte lichterloh, Beicht- und<br />
Predigtstuhl, die schönen Kreuzwegbilder<br />
brannten in hellen Flammen, die Statuen<br />
der Heiligen stürzten auf den Boden, die<br />
herrliche Pietà, ein Geschenk des seligen<br />
Künstlers Herrn Joseph Reiß fiel auch zum<br />
Opfer. Und mitten in diesem Qualm und<br />
Knistern erschallen die sterbenden Töne<br />
unserer wunderbaren, fast noch neuen Orgel<br />
wie ein schauriges ‚De profundis‘ über<br />
dieses große Sterben. Erhalten blieb im<br />
Schwesternchörchen das ergreifende Bild<br />
am Beichtstuhle: ‚Der verlorene Sohn‘, und<br />
unverletzt sind die Worte, die der Künstler<br />
darunter geschrieben hat: ‚Vater, ich habe<br />
gesündigt‘. Sind es Worte der gezeichneten<br />
Welt, als Mahnzeichen unseres Volkes,<br />
oder der gezeichneten Stadt,<br />
oder des gezeichneten Hauses?<br />
Dem lieben Gott allein<br />
ist bekannt, er fordert Sühne<br />
und Buße, und nur in diesem<br />
Geiste lassen sich diese Strafgerichte<br />
Gottes tragen. Der<br />
Schrecken, die Angst und die<br />
Not, die wir während dieses<br />
Angriffes aushielten, waren<br />
sehr groß; mehrere der Kranken<br />
waren knapp an der Verschüttung<br />
vorbeigekommen,<br />
eine Ukrainerin kam unter die<br />
Trümmer, konnte aber noch<br />
lebend ausgegraben werden ohne wesentlichen Schaden<br />
erlitten zu haben. Dieser Angriff war in seinen Wirkungen<br />
der schwerste, der uns getroffen hat, die Bogen der Kapelle<br />
waren in Stücke gebröckelt, Schutt lag nicht nur innerhalb<br />
des Gartens, sondern auch meterhoch auf der Straße; im<br />
Garten war ebenfalls eine große Verwüstung, die Mutter-<br />
Gottes Statue und die Grotte war vollständig zerstört, die<br />
Franziskusgrotte teilweise. Besonders erschütternd wirkte<br />
die umgestürzte Statue des hl. Joseph, welcher im Garten<br />
Marienhospital, Kesselhaus<br />
und Schornstein, um 1945<br />
Marienhospital, Franziskus-Grotte,<br />
um 1930<br />
127
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Zwangsarbeiterlager,<br />
Ellerkirchstraße 65, 1940<br />
vor der Kapelle seinen Platz gefunden hatte ... . Gott Dank<br />
blieben sämtliche technischen Betriebe und die technischen<br />
Anlagen erhalten, wie Waschküche, Röntgen-Apparate,<br />
Fernsprechanlage und dergleichen mehr erhalten, sodaß die<br />
Arbeiten weitergeführt werden konnten“.<br />
Wie schon in den Monaten zuvor ließen sich die Mitarbeiter<br />
des Marienhospitals auch durch den erneuten Angriff<br />
nicht entmutigen und gingen „mit neuem Mut an die Aufräumungsarbeiten,<br />
speisten die Armen und Obdachlosen<br />
und leisteten Hilfe wo und wie es nur eben möglich war“. Im<br />
Sprechzimmer „Hermann-Josef“, das u.a. der Vorstand für<br />
seine Zusammenkünfte genutzt hatte, und dem anstoßenden<br />
Ärztekasino wurde aus den Resten des Kapellenmobiliars ein<br />
provisorisches Oratorium eingerichtet. Das ein Jahr zuvor aufgelöste<br />
Ausweichkrankenhaus in der Heil‐ und Pflegeanstalt<br />
Grafenberg wurde am 6. Mai 1944 mit 70 Betten wieder<br />
eröffnet und mit Personal und Gerät aus dem Marienhospital<br />
ausgestattet. Im gleichen Monat wurden drei „große, lange<br />
Rohre“ ins Marienhospital geliefert und „von fachkundiger<br />
Hand“ zu einem neuen Schornstein zusammenmontiert.<br />
Der Umfang und die Schwere der Zerstörungen einerseits,<br />
die weitere Verknappung an Baustoffen und Arbeitskräften<br />
andererseits, verbunden mit einer immer straffer<br />
einsetzenden behördlichen Lenkung der Bauwirtschaft<br />
hatten zur Folge, dass die Beseitigung der Schäden trotz aller<br />
Bemühungen nur langsam fortschritt. Dessen ungeachtet<br />
wurden die Schutzmaßnahmen wie Umwallung<br />
des Erdgeschosses, Ausbau der<br />
Luftschutzräume etc. weiter fortgesetzt,<br />
um gegen weitere Angriffe gerüstet zu<br />
sein. Diese traten jedoch in besonders<br />
schwerer Form nicht mehr in Erscheinung,<br />
sondern beschränkten sich auf Glas und<br />
mittlere Luftdruckschäden.<br />
Zwangsarbeiter im<br />
Marienhospital<br />
War es schon mühsam, nach einem Fliegerangriff<br />
geeignetes Baumaterial für<br />
wichtigste Instandsetzungsmaßnahmen<br />
zu beschaffen, so war es noch schwieriger,<br />
fachkundige Handwerker für Reparaturarbeiten<br />
zu finden. In Ermangelung deutscher<br />
Arbeitskräfte kamen mit zunehmender<br />
Dauer des Krieges im Marienhospital immer<br />
öfter Zwangsarbeiter zum Einsatz. Von<br />
<strong>150</strong> Niederländern und <strong>150</strong> Franzosen,<br />
die im Januar 1943 zu Aufräumarbeiten<br />
im Marienhospital abkommandiert waren,<br />
ist bereits an anderer Stelle berichtet worden.<br />
Ausführlich ist in der Hauschronik der<br />
Hilfseinsatz eines Ostarbeitskommandos<br />
festgehalten, das aus 40 sowjetischen<br />
Facharbeitern bestand und am 30. August<br />
1944 im Hospital eintraf. „Sie waren von<br />
einem Dolmetscher, einem Feldwebel und<br />
vier Wachmannschaften begleitet“, weiß<br />
die Chronistin zu berichten. „Fast jede<br />
Innung war vertreten; sie bewohnten das<br />
Isolierhaus, es waren ja auch viele Lungenkranke<br />
dabei. In der Küche wurde Essen<br />
geholt, im übrigen, putzen, spülen und<br />
dergleichen, versorgten sie sich selbst.<br />
Das Isolierhaus durfte weder von Schwestern,<br />
Mädchen noch von sonst jemand<br />
128
Das Marienhospital<br />
im Frühjahr 1945<br />
betreten werden; an den Fenstern wurden<br />
Stanketten angebracht, die im Kesselhaus<br />
gemacht und nach Besichtigung und auf<br />
Befehl des Hauptmannes noch verbessert<br />
werden mußten. Als die armen Menschen<br />
ankamen, waren sie sehr müde, ungepflegt<br />
und hungrig, waren sie ja viele Kilometer<br />
zu Fuß gegangen; sie setzten sich auf den<br />
Hof auf ihre Rucksäcke nieder, mußten<br />
aber wieder aufbrechen und den Weg<br />
zur Entlausung antreten; sie schleppten<br />
sich förmlich fort. Ob es unseren Brüdern<br />
und Männern nicht auch so ergangen ist?<br />
Zurückgekehrt wurde ihnen auf dem Hof<br />
das Haar geschoren, das Haus stellte ihnen<br />
reine Wäsche, sie badeten dazu und keiner<br />
durfte die Zelle betreten, ehe er vollständig<br />
gereinigt war; das geschah nun jeden<br />
Samstag. Nach der allgemeinen Reinigung<br />
standen sie nun in Reih und Glied, alles<br />
anständige, gute Menschen, das war jetzt<br />
ein anderes Bild wie vor 1 bis 2 Stunden. Da<br />
fanden sich zusammen: Elektrotechniker,<br />
Glaser, Schuster, Schreiner, Stuckateur, Maler,<br />
Anstreicher, Metzger, Bauarbeiter usw..<br />
So konnten sie überall helfen und haben<br />
es auch ehrlich getan. Als das Kesselhaus<br />
durch Bomben in Brand geriet, löschten die<br />
Russen und verließen das Dach nicht, bis<br />
alles außer Gefahr war ... ; alle waren nett<br />
ordentlich und fleißig. Auch waren sie alle<br />
gern hier, zumal sie ab und zu eine kleine<br />
Belohnung so ganz verstohlen erhielten,<br />
denn die Wachmannschaft durfte es nicht<br />
sehen; das geschah, wenn sie mal den Hof<br />
gekehrt hatten, und das taten sie sehr<br />
sorgfältig; jedes Eckchen wurde ordentlich<br />
gesäubert, dann legte die Schwester Anicia<br />
vom Brodzimmer ihnen Plätzchen, Teilchen<br />
oder ein Butterbrot auf die Fensterbank,<br />
und nachdem sie alsmal herübergeäugelt<br />
hatten, verschwand es“.<br />
Außer den in der Chronik erwähnten Zwangsarbeitern lassen<br />
sich aus anderen Quellen noch etwa 40 weitere Ausländer<br />
(u.a. aus Belgien, Frankreich, Kroatien, den Niederlanden,<br />
Polen, Slowakei, Sowjetunion, Ukraine) nachweisen, die<br />
zwischen 1941 und 1945 im Marienhospital<br />
pflegerisch oder hauswirtschaftlich<br />
tätig waren. Ohne Zweifel<br />
trafen sie vergleichsweise humane<br />
Arbeitsbedingungen in einer caritativen<br />
Anstalt vor, auch wenn sie für<br />
niedrige Arbeiten eingesetzt wurden.<br />
Das Marienhospital<br />
im Frühjahr 1945<br />
Als amerikanische Verbände von Westen her immer näher<br />
zum Rhein rückten und Düsseldorf im Frühjahr 1945 zum<br />
Frontgebiet wurde, setzte eine gewaltige Fluchtbewegung ein.<br />
Jeder freie Winkel im Marienhospital diente der Aufnahme<br />
verletzter oder erkrankter Soldaten bzw. Zivilisten sowie der<br />
Unterbringung ausgebombter bzw. auf der Flucht befindlicher<br />
Ordensleute. Obwohl die Stadt Düsseldorf im März und April<br />
1945 einem pausenlosen Beschuss ausgesetzt war, berichtet<br />
die Chronistin der Franziskanerinnen nicht ohne sentimentale<br />
Rührung, was sich in den letzten Kriegstagen im völlig überbevölkerten<br />
Marienhospital abspielte. „Bei Alarm wanderte alles<br />
Marienhospital,<br />
Lebenszeichenbrief, 1945<br />
129
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital,<br />
Verwundetenbetreuung, 1941<br />
Luftschutzkeller,<br />
Alt-Eller 27, um 1943<br />
in den Luftschutzkeller, wo auch ein Altar aufgeschlagen<br />
war und celebriert wurde. ... Auch<br />
schliefen mehrere Schwestern hier in Liegestühlen,<br />
die nachts zum Schlafen und tagsüber<br />
als Sitzgelegenheit beim Gottesdienst dienten<br />
... . Bei Alarm waren die Stationsschwestern<br />
bei ihren Kranken im Untergeschoß, wo auch<br />
jedes Eckchen mit Betten besetzt war. ... Im<br />
Flur lagen schwer verwundete Soldaten und<br />
nur durch einen Schirm von diesem Schwesternraum<br />
getrennt. Hier unten lagen Männer,<br />
Frauen, Soldaten, selbst Priester, alles durcheinander,<br />
es standen Bett an Bett und doch<br />
ging es; eine polnische Wirtschaft, aber schön<br />
war es doch; jeder war zufrieden, denn jeder<br />
fühlte sich in Liebe geborgen; es war eine<br />
große Familie, eine Gottesfamilie. ... In der<br />
sogenannten Entgiftungszelle wohnten 2<br />
Clarissen aus der Kaiserstraße, die erst auf die<br />
Straße gesetzt wurden und dann auch alles<br />
verloren ... . Das Hospital war wirklich eine<br />
Herberge für alle und unsere gute Schwester Annuntiata nahm<br />
auch ‚Alle‘ in Großmut und großer Uneigennützigkeit auf. ...<br />
Schwestern verschiedener Genossenschaften fanden hier ein<br />
Heim, unsere Schwestern von Kaiserswerth, Hamm, Ratingen,<br />
Herz-Jesu-Kloster, Mutterhaus,<br />
Provinzialat;<br />
Kind-Jesu Schwestern,<br />
Clarissen, Dienstmägde<br />
Christi, Ursulinen, Brüder,<br />
Ordens‐ und Weltpriester,<br />
mehrere Familien,<br />
denen hier eine<br />
Wohnungsmöglichkeit<br />
verschafft wurde. .. Das<br />
Haus war vollgepfropft<br />
und doch fand man<br />
immer wieder Rat den<br />
Armen und Heimatlosen<br />
zu helfen“.<br />
Anerkennend schrieb Karl Fritzen, Vorstandsvorsitzender<br />
für das Marienhospital,<br />
im Rechenschaftsbericht für das Jahr 1945:<br />
„Mit welchem Aufwand von Pflichterfüllung,<br />
Verantwortungsbewußtsein, Mut und<br />
Entbehrung die gesamte Gefolgschaft sich<br />
einsetzte, um das Haus und seine Insassen<br />
gegen alle Terrorangriffe zu verteidigen<br />
und zu schützen, können nur diejenigen<br />
ermessen, welche diese Zeiten, in denen<br />
fast der gesamte Krankenhausbetrieb sich<br />
Tag und Nacht größtenteils in den Kellern<br />
abwickeln musste und die Sirenen fast<br />
pausenlos ‚Fliegeralarm‘ heulten, selbst<br />
miterlebt haben“.<br />
Wie durch ein Wunder hatte das Marienhospital<br />
trotz ständiger Überbelegung<br />
und dauerndem Beschuss nur einmal ein<br />
Todesopfer während eines auf die Anstalt<br />
gerichteten Angriffes zu beklagen.<br />
Im März 1945 wurde Martha Hoppe, eine<br />
seit über 50 <strong>Jahre</strong>n im Marienhospital<br />
tätige Dienstmagd, tödlich verletzt, als sie<br />
einen Eimer Wasser aus dem Garten holen<br />
wollte. „Männer, die auf dem Turm die Rot-<br />
Kreuzfahne anbringen wollten“, so berichtete<br />
später eine Ordensschwester, „hatten<br />
dadurch die Aufmerksamkeit des Feindes<br />
auf das Hospital gelenkt, und so war der<br />
Beschuß ganz auf das Haus gerichtet. ...<br />
Martha bereitete schon für Ostern vor und<br />
frischte die Fahne vom guten Hirten auf,<br />
die ab Weißen Sonntag als Hintergrund am<br />
Altar diente ... . Es war ruhiger geworden<br />
und wir wollten wieder an unsere Arbeit<br />
gehen; wir gehen nun und sind eben im<br />
Durchgang als ein Knall und wieder einer<br />
ertönt und Martha geht in dem Augenblick<br />
heraus und wird tödlich getroffen; sie tat<br />
einen Schrei und fiel tot zu Boden“.<br />
130
Der Wiederaufbau<br />
Schreiben der Schwestern Laurentiana, Cotidia und<br />
Hildegarda an die Mutter Assistentin in Aachen<br />
(Auszug)<br />
Düsseldorf-Grafenberg, den 28. März 1945<br />
Bergische Landstraße 2, Haus 3<br />
Liebe, ehrwürdige Mutter Assistentin!<br />
Während ich diesen Brief schreibe, pfeifen<br />
die Granaten um das Haus herum. So geht<br />
es nun schon fast 3 Wochen. Wegen der<br />
täglichen sich steigernden Gefahr haben<br />
wir alle Patienten, die nicht gehen können,<br />
ganz im Keller liegen. Auch das Personal<br />
und wir Schwestern schlafen unten. Für uns<br />
3 haben wir einen abgeschlossenen Raum,<br />
in dem sogar der Heiland seine mehr als<br />
bescheidene Wohnung aufgeschlagen hat.<br />
Tag und Nacht ist Er dort – und wir schlafen<br />
dabei! Wir haben Liegestühle in dem Raum;<br />
Betten gehen nicht hinein. Aus Ehrfurcht<br />
vor dem Allerheiligsten ziehen wir uns nicht<br />
ganz aus. Wenn wir große Wäsche etc.<br />
halten wollen, dann bringen wir zuerst den<br />
Heiland vorübergehend in die Kapelle. ...<br />
Morgens sind wir immer noch trotz der<br />
Schießerei zur Pfarrkirche gegangen, gut 20<br />
Minuten hin und auch wieder zurück. Uns<br />
bangt schon vor dem Augenblick, wo das<br />
nicht mehr möglich ist. ...<br />
Die Verbindung mit dem Marienhospital<br />
wird durch die Verhältnisse immer<br />
schwieriger. Manchmal denke ich, wenn<br />
wir doch gut hier weg wären. Es ist nicht<br />
so leicht. Jetzt haben wir schon einen Teil<br />
Lungenkranke. Die inneren Kranken werden<br />
vor und nach entlassen. Es sind meist<br />
schwere Fälle, die man uns schickt. Wenn<br />
nur die Verpflegung entsprechend wäre.<br />
Man hat kaum etwas für die armen Leute.<br />
Es ist einfach nichts da! Und ob es nicht<br />
noch schlimmer wird?<br />
Der Wiederaufbau<br />
Das historische wie das moderne Düsseldorf, die Industrie-,<br />
Geschäfts- und Büroviertel der Stadt wie auch zahlreiche<br />
Wohngebiete waren in Bombentrichtern und unter Trümmerhügeln<br />
verschwunden. Als am 3. März 1945 amerikanische<br />
Truppen den Rhein erreichten, war Düsseldorf eine zerstörte<br />
und entvölkerte Stadt. Von Heerdt und Oberkassel aus beschoss<br />
die 83. US‐Division mit Artillerie und Tieffliegern das<br />
rechtsrheinische Düsseldorf, wo Gauleiter Karl Friedrich Florian<br />
und Polizeipräsident August Korreng am 29. März 1945 die<br />
noch verbliebene Bevölkerung (1939: 555000; 1945: 185000<br />
Einwohner) zu sinnlosem Widerstand angetrieben und die<br />
Räumung der Stadt angeordnet hatten. Um den Alliierten das<br />
Nachrücken zu erschweren, sollten alle Verkehrs-, Produktions-<br />
und Versorgungsanlagen vernichtet werden. Das ganze<br />
Ausmaß der Politik der „Verbrannten Erde“ überblickte kaum<br />
jemand, aber viele Menschen verweigerten die Unterstützung<br />
St. Margareta, Gerricusplatz 1,<br />
um 1938<br />
131
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Oberkasseler Brücke, um 1945<br />
Turmspitzen der Marienkirche, um 1945<br />
Hauptbahnhof, um 1945<br />
Düsseldorfer Trümmerhäuser, um 1945<br />
der Maßnahmen. In dieser Situation des<br />
apokalyptischen Widersinns und der kollektiven<br />
Verweigerung bewahrten einige<br />
Düsseldorfer ihre Vernunft und bereiteten<br />
Übergabeverhandlungen vor, um der Stadt<br />
weitere Kämpfe und Bombardements zu<br />
ersparen. Dank ihres Einsatzes zog am 17.<br />
April 1945 ein Bataillon der 97. amerikanischen<br />
Infanteriedivision kampflos und ohne<br />
Blutvergießen in die nahezu menschenleere<br />
Stadt ein und nahm hier Quartier.<br />
Die Hinterlassenschaft der menschenverachtenden<br />
Diktatur war Chaos, waren<br />
Trümmer in vielfacher Bedeutung des Wortes.<br />
Der Neuanfang war alles andere als<br />
leicht. Der erste städtische Verwaltungsbericht<br />
beschreibt die Situation in Düsseldorf<br />
nach Kriegsende mit den Worten: „Eine<br />
Trümmerstadt, durch einen brückenlosen<br />
und durch zahlreiche Schiffswracks<br />
gesperrten Strom in zwei Teile getrennt,<br />
eine Stadt, in der Tausende Menschen<br />
in Bunkern und Kellern wohnten, eine<br />
Großstadt, in der keine Straßenbahn fahren<br />
konnte, eine Stadt deren Bewohner durch<br />
die Schrecken des Krieges erschüttert und<br />
nach der politischen Verirrung mutlos geworden<br />
waren, eine Stadt, in der Hunger<br />
und Not herrschten und Verwahrlosung<br />
und Demoralisierung zu einer immer größeren<br />
Unsicherheit führten, eine Stadt, in<br />
der primitivste Regeln der Hygiene vielfach<br />
nicht mehr beachtet werden konnten, in der<br />
die notwendigsten Gebrauchsgegenstände<br />
fehlten und selbst keine Särge mehr für<br />
die Toten vorhanden waren, das war das<br />
traurige Erbe, das diejenigen vorfanden,<br />
die sich für die Wiederingangsetzung und<br />
den Wiederaufbau ... einsetzten“.<br />
Für das Marienhospital bedeutete das<br />
Kriegsende keine „Stunde Null“. Zu einer<br />
Zeit, als noch niemand wusste, ob die<br />
132
Der Wiederaufbau<br />
Stadt jemals wieder aufgebaut werden<br />
würde, wurden im Marienhospital erste<br />
Maßnahmen zur Reorganisation eines geregelten<br />
Krankenhausbetriebes in Gang<br />
gebracht. Patienten, Ärzte, Schwestern und<br />
Angestellte verließen die Schutzkeller der<br />
Anstalt und bezogen wieder die oberirdischen<br />
Krankenzimmer, Operationsräume,<br />
Behandlungsräume und die Klausur. „Ostern<br />
(1. April 1945) war noch Beschuß“, so die<br />
Hauschronik der Franziskanerinnen, „kurz<br />
darauf drang der Feind durch und die Stadt<br />
Düsseldorf ergab sich (17. April 1945).<br />
Auf Mariä Verkündigung und Ostern war<br />
die Gemeinde noch im Untergeschoß, der<br />
Namenstag unserer ehrwürdigen Schwester<br />
Annuntiata wurde still, ohne Festlichkeit<br />
gehalten und später, nachdem wir am<br />
Schutzfest des hl. Josef (18. April 1945)<br />
heraufgezogen waren, still und einfach<br />
nachgeholt. ... Die ganzen Clausurzellen,<br />
Refectorium und Recreationszimmer wurden<br />
wieder bezogen, nachdem die Hauptsache<br />
an Schutt usw. fortgeschafft, die Löcher notdürftig<br />
zugemacht und die zertrümmerten<br />
Scheiben vielfach mit Pappendeckel ersetzt<br />
waren. ... Vor und nach wurden auch die<br />
Stationen gesäubert und eingerichtet und<br />
die Kranken wieder herauftransportiert;<br />
mehrere Kranke waren so geschwächt und<br />
die Kellerluft hatte ihnen so zugesetzt, daß<br />
sie hintereinander starben, weil sie diese<br />
reine Luft nicht mehr vertragen konnten“.<br />
Der allgemeine Gesundheitszustand<br />
der Bevölkerung war den Lebensumständen<br />
entsprechend schlecht. Tuberkulose<br />
nahm gegenüber 1939 um 50 % zu. Die<br />
Säuglingssterblichkeit betrug 1945 mehr<br />
als 10 % (1939: 5 %). Hungerödeme und<br />
Eiweißmangelerkrankungen führten nicht<br />
selten zum Tod. Rachitische Symptome bei<br />
Säuglingen und Kleinkindern hatten extrem<br />
Schreiben der Oberin Sw. Annuntiata an die<br />
Generaloberin in Aachen (Auszug)<br />
Düsseldorf, den 20. April 1945<br />
Liebe, teure Mutter!<br />
... Gestern waren die Amerikaner hier<br />
und machten bezüglich des Krankenhauses<br />
statistische Aufnahmen. Heute<br />
baten sie, ihnen 10 Betten für ihre<br />
Verbandsstation zu überlassen, ein<br />
Offizier wurde hier verbunden. Ob<br />
sie noch kommen und einen Teil des<br />
Hauses vielleicht in Anspruch nehmen,<br />
weiß man noch nicht. Wir haben ihnen<br />
10 Betten gegeben, liebe Mutter. Seit<br />
vorgestern sind wir nun aus dem Keller.<br />
Im Augenblick haben wir 229 Kranke<br />
und außerdem viele Bombenbeschädigte<br />
im Hause wohnen.<br />
Erkrankungen und Sterbefälle an anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten<br />
im Stadtkreis Düsseldorf in den <strong>Jahre</strong>n 1945 bis 1948<br />
Jahr Scharlach Diphtherie Typhus Ruhr Tbc<br />
Geschlechtskrankheiten<br />
1945 Erkrankungen 416 1070 225 124 627 -<br />
1945 Sterbefälle 11 88 23 5 292 20<br />
1946 Erkrankungen 211 1225 159 29 662 2119<br />
1946 Sterbefälle - 76 8 5 336 23<br />
1947 Erkrankungen 274 750 190 42 726 3696<br />
1947 Sterbefälle 1 30 14 1 317 34<br />
1948 Erkrankungen 405 423 114 5 66 5718<br />
1948 Sterbefälle 3 19 6 - 8 24<br />
Verwaltungsbericht der Landeshauptstadt Düsseldorf 1945 bis 1949 (Auszug)<br />
Gesundheitsamt (Amt 40)<br />
Außer den Städtischen Krankenanstalten<br />
(einschließlich Krankenhaus Benrath und<br />
Westdeutsche Kieferklinik) mit zusammen<br />
2145 Betten und der Heil‐ und Pflegeanstalt<br />
mit rund 1000 Betten, befanden sich<br />
US-Panzer rücken über die Flurstraße ein, 1945<br />
in Düsseldorf am Ende der Berichtszeit 19<br />
Krankenhäuser mit zusammen 2280 Betten,<br />
insgesamt also 5425 Krankenhausbetten<br />
gegenüber 4617 zu Beginn der Berichtszeit.<br />
133
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Gesundheitsamt Düsseldorf, um 1945<br />
Behelfsunterkunft am Stoffeler Kapellenweg, um 1947<br />
Martin-Luther-Platz/Bismarckstraße, um 1945<br />
Oststraße/Graf-Adolf-Straße, 1948<br />
zugenommen. Der Gesundheitszustand der<br />
Schulkinder wurde im Verwaltungsbericht der<br />
Stadt Düsseldorf als ausgesprochen schlecht<br />
bezeichnet. Gewichtsstürze von 20 bis 30<br />
% bis zu extremer Magerkeit erhöhten die<br />
Infektanfälligkeit der Bevölkerung.<br />
Die Probleme des Gesundheitswesens<br />
ergaben sich aus dem Widerspruch der vernichteten<br />
materiellen und personellen Voraussetzungen<br />
und den erhöhten Anforderungen an<br />
die medizinische Betreuung. Krankenhäuser<br />
und Praxen waren zerstört, Medikamente<br />
wurden kaum neu produziert. Sulfonamide,<br />
Salvarsan und Insulin gab es nur<br />
in kleinsten Mengen. Der Schwarzmarkt<br />
mit Arzneimitteln wucherte. Ärzte und<br />
Pflegepersonal fehlten. Fast alle Organisationsformen<br />
des Gesundheitswesens<br />
waren zusammengebrochen. Die Zerstörung<br />
sanitärer Anlagen, wie Trinkwasseraufbereitung<br />
und Kanalisation, fehlende Hygiene,<br />
Mangelernährung und Wohnungsnot,<br />
begünstigten die Entstehung von Seuchen.<br />
Ungeregelte Bevölkerungsfluktuation und<br />
Promiskuität führten zum Ansteigen der<br />
Geschlechtskrankheiten.<br />
Die Anstrengungen des Vorstandes des<br />
Marienhospitals galten zunächst vorrangig<br />
den notwendigen Wiederaufbauplanungen<br />
der partiell zerstörten Gebäudeteile. Die<br />
Bombenangriffe auf Düsseldorf hatten<br />
das Marienhospital zu etwa 70 Prozent<br />
zerstört. Die Schäden reichten von zersplitterten<br />
Fenstern über ausgebrannte Räume<br />
bis zu total zerbombten Gebäudetrakten.<br />
Das ausgebaute Dachgeschoss und das<br />
dritte Stockwerk waren schwer beschädigt<br />
und nahezu unbrauchbar. Andere, lebenswichtige<br />
Einrichtungen waren unversehrt<br />
geblieben, wie Kesselanlage und Küche. Die<br />
Röntgenanlagen und Operationseinrichtungen<br />
waren zum Einsatz bereit. So konnte der<br />
Betrieb, wenn auch notdürftig, auch nach<br />
der Kapitulation aufrecht erhalten werden.<br />
Nachdem zunächst Chefarzt Gustav Pfalz<br />
seine Frauenstation im Neubau III wieder<br />
in Betrieb genommen hatte, eröffneten<br />
wenig später auch der Ohrenarzt Theodor<br />
Hünermann und der Augenarzt Josef Etten<br />
ihre früheren Stationen. „Selbstverständlich<br />
nicht wie früher“, wirft die Chronistin ein,<br />
„es hieß, sich einschränken, da ja durch den<br />
134
Der Wiederaufbau<br />
Ausfall des dritten Stockwerkes viel weniger<br />
Räume zur Verfügung standen“. Um die<br />
frühere Raumkapazität wieder erreichen<br />
zu können, waren umfangreiche Arbeiten<br />
erforderlich. Angesichts des Material- und<br />
Handwerkermangels war an eine schnelle<br />
Ausführung jedoch vorerst nicht zu denken;<br />
nur kleinere Instandsetzungsarbeiten waren<br />
möglich. Im Sommer 1945 berichtet die<br />
Chronik: „Die Arbeiten im Hause wurden<br />
nun fleißig begonnen. Maurer und Pliesterer<br />
fingen an, ein Zimmer nach dem anderen<br />
zu renovieren, ... die Fenster wurden mit<br />
Glas besetzt, während sie bis jetzt meistens<br />
mit Pappe bekleidet waren, die Schreiner<br />
machten neue Einfassungen für Türen und<br />
Fenster, aber es ging manchmal sehr langsam<br />
wegen Mangel an Material, Arbeitskräften<br />
und Beschaffungsschwierigkeit“.<br />
Marienhospital,<br />
Trümmerbeseitigung,<br />
um 1945<br />
Schreiben des Architekten Wilhelm Dicken an die Stadt Düsseldorf – Anlage zum Bauantrag 16. April 1946<br />
Vor Beginn des Krieges standen dem Hospital<br />
450 Krankenbetten und 200 Personalbetten<br />
sowie alle modernen medizinischen und<br />
technischen Einrichtungen zur Verfügung.<br />
Außer den Städtischen Krankenanstalten ist<br />
es das größte Krankenhaus in Düsseldorf. ...<br />
Beim ersten Kriegsschaden im Januar<br />
1943 brannten über dem gesamten Krankenhaus<br />
das Dach und das darunter liegende<br />
ausgebaute Dachgeschoss mit rund 3200<br />
qm Nutzfläche ab. ... Beim zweiten großen<br />
Schaden im April 1944 wurde ein fünfgeschossiger<br />
Baukörper zerstört, in dem die<br />
Operations‐ und Entbindungsräume der<br />
Frauenstation, der Säuglingssaal, die Augenklinik,<br />
der Verbindungsgang vom Alt- zum<br />
Neubau mit dem angrenzenden Vortragssaal<br />
(Pflegerinnenschule) und den Nebenräumen<br />
untergebracht waren. Ferner wurden das<br />
Treppenhaus, die Kranken-, Neben- und<br />
Toilettenräume des viergeschossigen Baues<br />
zwischen dem Hauptbau und dem Nordflügel<br />
zerstört. Der so vom Hauptbau getrennte<br />
und mittelschwer beschädigte Nordflügel<br />
kann seit dem Schadenstag nicht mehr bewohnt<br />
werden. ... Weiter wurden zerstört:<br />
die Personalhäuser Rochusstr. 2 und 4 und<br />
ein Teil des Arzthauses Ehrenstr. 14a, das<br />
Kohlenlager mit den darüber liegenden<br />
Räumen zur Unterbringung der Näherei,<br />
der 30 m hohe Massivschornstein des Kesselhauses,<br />
der Schweinestall, die Garage<br />
und 4 Schuppenbauten. Zwei während des<br />
Krieges erbaute Holzbaracken von je 500<br />
qm bebauter Fläche zur Unterbringung der<br />
Ärzte und des Personals brannten mit allem<br />
Inventar ab.<br />
Infolge der behördlich gelenkten Maßnahmen<br />
durfte mit dem Wiederaufbau der<br />
vorgenannten Schäden noch nicht begonnen<br />
werden. ... Es sind zurzeit wieder 350 Kranke,<br />
wenn auch teils in überbelegten Räumen<br />
untergebracht. ... Durchschnittlich werden<br />
heute monatlich 6000 Personen ambulant<br />
behandelt. Zurzeit müssen täglich 30-40<br />
Kranke abgewiesen werden, die um Aufnahme<br />
und Behandlung im Krankenhaus bitten.<br />
135
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Bericht des Vorstands 1945 (Auszug)<br />
Am 15. März 1945 schloss das Reserve-<br />
Lazarett Marienhospital seine Pforten und<br />
wickelte unter englischer Aufsicht die im Hause<br />
befindlichen schweren Fälle ab, während<br />
die leichteren Fälle verlegt wurden.<br />
Mit der Auflösung des Reserve-Lazaretts<br />
stellte auch das Deutsche Rote Kreuz seine<br />
Tätigkeit im Marienhospital ein. Allen Angehörigen<br />
des DRK, die im Marienhospital<br />
tätig waren, sei an dieser Stelle der Dank<br />
des Hauses für ihre Hilfe und Unterstützung<br />
ausgesprochen.<br />
Die Ausweichstelle unserer Inneren Abteilung,<br />
die am 23. April 1944 zum zweiten<br />
Male während der Kriegszeit in der Provinzial<br />
Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg eröffnet<br />
worden war, wurde am 18. November 1945<br />
geschlossen.<br />
Inzwischen sind nach Entlassung unserer<br />
Chef- und Abteilungsärzte aus dem Wehrdienst<br />
die Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung<br />
am 15. August 1945, die geburtshilfliche und<br />
gynäkologische Abteilung sowie die Augenabteilung<br />
am 1. Dezember 1945 wieder eröffnet<br />
worden, wenn auch mit Rücksicht auf<br />
Britisches Hauptquartier im<br />
Stahlhof, Bastionstraße 39,<br />
um 1945<br />
die Zerstörungen im Hause vorläufig nur im<br />
beschränkten Rahmen. Die Röntgenabteilung,<br />
deren wertvolles Inventar durch die Bombenangriffe<br />
wenig gelitten hatte, wurde durch<br />
die Angehörigen der Wehrmacht und die<br />
Zivilbevölkerung überaus stark in Anspruch<br />
genommen, da die Röntgenabteilungen in<br />
den anderen Krankenhäusern der Stadt und<br />
in der Umgegend infolge der Kriegshandlungen<br />
vielfach zerstört wurden und den<br />
an sie gestellten Anforderungen nicht mehr<br />
entsprechen konnten. ...<br />
Die Besetzung der Stadt Düsseldorf<br />
durch die amerikanische und anschließend<br />
durch die englische Wehrmacht hatte für das<br />
Haus keine nachteiligen Folgen. Das Zeichen<br />
des Roten Kreuzes wurde geachtet, und das<br />
Marienhospital blieb von Einquartierung und<br />
Plünderung verschont. Die Militärregierung<br />
bemühte sich, soweit die Verhältnisse auf<br />
dem Baustoff- und Arbeitsmarkt es zuließen,<br />
den Wiederaufbau zu fördern. Dieser ist<br />
jedoch außerordentlich umfangreich und<br />
schwierig.<br />
Herbergsgäste<br />
Die Ausbesserungs- und Erneuerungsarbeiten<br />
hatten gerade begonnen, da bezog<br />
der Kölner Erzbischof Joseph Frings Anfang<br />
Juli 1945 für einen mehrtägigen Aufenthalt<br />
in der Stadt Düsseldorf im Marienhospital<br />
Quartier. „Herr Dechant Max Döhmer holte<br />
in seinem violetten Ornat als Prälat den<br />
Hochwürdigsten Herrn Erzbischof von der<br />
Bahn ab“, weiß die Chronik zu berichten,<br />
„Herr Pastor Karl Tholen empfing<br />
den hohen Herrn beim Aussteigen aus<br />
dem Wagen, während unsere ehrwürdige<br />
Vorgesetzte und die übrigen Schwestern<br />
und Hausangestellten vom Hauptportal<br />
an Spalier bildeten. Schwester Annuntiata,<br />
als Oberin des Hauses, begrüßte<br />
den Hochwürdigsten Herrn, oder besser<br />
gesagt, Seine Eminenz begrüßte sie, richtete<br />
ihr den Ring zum Küssen und gab<br />
ihr den Segen. So schritt Seine Eminenz<br />
zur Kapelle (im Sprechzimmer Hermann-<br />
Josef), gefolgt von seinem Kaplan, den<br />
Schwestern und Hausangestellten. Seine<br />
Hochwürden begrüßte kurz den Heiland,<br />
hielt eine kleine Ansprache und, nachdem<br />
er alle Anwesenden gesegnet hatte, begab<br />
er sich ... in seine Wohnung. Am Dienstag<br />
... celebrierte der hohe Herr in unserer<br />
Kapelle ganz feierlich, wobei sein Kaplan<br />
assistierte ... . Gegen ½ 10 Uhr kam dann<br />
Seine Eminenz zu den Schwestern in der<br />
Clausur, wo sie im Kapitelzimmer versammelt<br />
waren. Seine Hochwürden war einfach<br />
und herzlich, ja väterlich. Er sprach uns<br />
einige ermunternde Worte zu, erkundigte<br />
sich noch nach der Zahl der Schwestern,<br />
sprach auch seine Freude darüber aus, daß<br />
er das Marienhospital und die Schwestern<br />
hätte kennen gelernt, dankte, wie er sich<br />
136
Herbergsgäste<br />
ausdrückte, zuerst der Schwester Oberin<br />
für die liebevolle Aufnahme und Aufmerksamkeit,<br />
die er hier gefunden habe, dankte<br />
zweitens der Köchin, die so gut gesorgt<br />
hätte trotz der schweren Zeit, er könne<br />
nicht begreifen, wie sie bei den schwierigen<br />
Verhältnissen, wo alles so knapp sei, noch<br />
alles so beschaffen und zubereiten könnte,<br />
besonders bei dieser großen Menge; drittens<br />
dankte er der Schwester Margarita<br />
vom Neubau III, sie habe ihn vollständig<br />
aufgebügelt, das Käppchen, Schärge, Talar<br />
oder Kleid; Mantel und alles in schönster<br />
Ordnung gebracht. ... Darauf gab er uns<br />
noch einmal Seinen Erzbischöflichen Segen<br />
und begab sich von der guten Schwester<br />
Annuntiata und den Schwestern begleitet<br />
zum Hauptportal, wo sein Kaplan und sein<br />
Diener ihn erwarteten“.<br />
Auch in den folgenden <strong>Jahre</strong>n war<br />
Kardinal Joseph Frings mehrfach im Marienhospital<br />
zu Gast. Bemerkenswert ist<br />
ein Treffen zwischen dem Kölner Metropoliten<br />
und dem nordrhein-westfälischen<br />
Ministerpräsidenten Rudolf Amelunxen,<br />
der seit September 1946 ein möbliertes<br />
Zimmer im Marienhospital bezogen hatte.<br />
Wie die Chronik berichtet, ging es bei der<br />
Besprechung in der Pempelforter Anstalt,<br />
an der auch „einige Herren der Regierung“<br />
teilnahmen, um Fragen der Versorgung mit<br />
Lebensmitteln.<br />
Vorübergehende Unterkunft fanden<br />
im Marienhospital nicht nur geistliche<br />
Würdenträger und hochrangige Politiker,<br />
sondern auch Vertriebene, die auf ihrer<br />
Flucht in der Stadt Düsseldorf strandeten.<br />
So berichtet die Chronik 1945 von einem<br />
„regen Verkehr an der Pforte mit Flüchtlingen“,<br />
die um Essen und Unterkunft für<br />
eine Nacht baten. „Am Bahnhof hieß es nur<br />
immer“, so der Rückblick weiter, „gehen<br />
Sie nur zum Marienhospital. Da bekommen Sie etwas,<br />
da können sie übernachten. Es war manchmal recht<br />
schwer, sie alle unterzubringen und noch schwerer<br />
sie fortzuschicken, weil kein Platz mehr da war; leider<br />
mußte auch das oft sein, weil es überhand nahm“.<br />
Niederschrift über die Vorstandssitzung<br />
vom 22. März 1948 (Auszug)<br />
Sodann brachte der Vorsitzende<br />
Karl Fritzen die Belegung von Krankenzimmern<br />
durch anstaltsfremde<br />
Personen zur Sprache, die 1945<br />
seitens der Landesregierung eingewiesen<br />
wurden. Zur Zeit wohnen<br />
noch hier im Haus Sozialminister<br />
Rudolf Amelunxen, Oberregierungsrat<br />
und Rechtsanwalt Dr. Schröder<br />
und Fräulein Pley, Sekretärin bei<br />
der Landesregierung. Im Vorstand<br />
bestand Einstimmigkeit darüber, daß<br />
mit allen Mitteln versucht werden<br />
müßte, die Zimmer bzw. die Betten<br />
wieder frei zu bekommen, da täglich<br />
immer noch 25 bis 30 Schwerkranke<br />
abgewiesen werden müssen.<br />
Kardinal Joseph Frings in Düsseldorf,<br />
Mariensäule, 1946<br />
Hauptbahnhof Düsseldorf,<br />
Flüchtlingskinder, um 1948<br />
Ministerpräsident Rudolf Amelunxen<br />
im Marienhospital, um 1946<br />
137
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Hungerdemonstration<br />
im Hofgarten, 1947<br />
Lebensmittelmarken, 1950<br />
Luisenheim, Schlossallee 2,<br />
Lebensmittelausgabe, um 1947<br />
Kinder beim Fringsen,<br />
Mühlenstraße, um 1947<br />
Lebensmittelversorgung<br />
Not hatte nach dem Einmarsch der Alliierten in Düsseldorf<br />
vielerlei Gesichter, doch galt es im Kampf ums nackte Überleben<br />
vor allem, Nahrungsmittel zu beschaffen. Durch die<br />
Abtrennung der agrarischen Überschussgebiete des Ostens,<br />
die Zusammenballung der Bevölkerung auf engem Raum,<br />
den Produktionsausfall infolge von Kriegseinwirkungen und<br />
Beeinträchtigung der Infrastruktur war die Versorgung der<br />
Bevölkerung in Düsseldorf wie in allen westdeutschen Städten<br />
ernstlich bedroht.<br />
Nicht ohne Sarkasmus berichtete die Rheinische Post von<br />
der Stadtverordnetensitzung am 13. Juni 1946, die u.a. die<br />
Ernährungslage und Hungerfolgen zum Gegenstand hatte,<br />
folgende Begebenheit: „Ein Wachtmeister trägt behutsam<br />
einen kleinen Glaskasten in den Stadtverordnetensaal und stellt<br />
ihn mit schlichter Sachlichkeit auf den Präsidententisch. Einige<br />
lächeln im Saal, aber es ist ein Lächeln mit fatalen Zügen. Da<br />
steht nun der kleine Kasten, schmucklos und sehr bestimmt.<br />
Corpora delicti unter Glas: nämlich ein armseliges Brot von<br />
1250 Gramm Gewicht, ein paar Stück Pergamentpapier mit<br />
175 Gramm Fleisch, 125 Gramm Marmelade und 100 Gramm<br />
Fett, daneben ein mikroskopisches Häufchen Käse von 15,6<br />
Gramm, eine Tüte mit 125 Gramm Zucker, eine mit 30 Gramm<br />
Ersatzkaffee und schließlich eine Tüte, von der nicht mit Sicherheit<br />
anzunehmen ist, daß sie mehr enthält als Luft. Dem Maß<br />
nach könnte sie 250 Gramm Nährmittel (die es seit längerem<br />
nicht mehr gibt) bequem fassen. Tröstlicherweise darf man sich<br />
zu diesem Konvolut noch etwas Magermilch und ein bißchen<br />
Hering hinzudenken. So also sieht, erbarmungslos<br />
demonstriert, die Wochenration<br />
eines Düsseldorfer Bürgers aus. ... Und so<br />
sieht, ins Statistische übersetzt, die sinnfällig<br />
servierte Addition von tausend und einigen<br />
Kalorien aus“.<br />
Zum Tagesordnungspunkt „Die Versorgungslage<br />
Düsseldorfs“ berichtete Walther<br />
Hensel in der Stadtverordnetensitzung:<br />
„Die nach dem Urteil aller internationalen<br />
Autoritäten ohnehin schon unzureichende<br />
Kalorienzahl von <strong>150</strong>0 täglich wurde mit<br />
Wirkung vom 4.3.1946 auf 1050 täglich<br />
herabgesetzt. Tatsächlich wurde selbst diese<br />
Zahl monatelang nicht erreicht, weil von<br />
Januar bis Mai die Magermilch mit 42 Kalorien<br />
je Tag für den Normalverbraucher<br />
völlig ausfiel. ... Unsere Ernährungslage ist<br />
im kritischsten Stadium, das wir überhaupt<br />
bisher erlebten. Der Hunger droht nicht nur,<br />
er ist bereits bei uns eingezogen“.<br />
Dass der Hunger in der Stadt vor dem<br />
Marienhospital nicht Halt machte, liegt<br />
auf der Hand. In erkennbarer Verbitterung<br />
über die Versorgung mit Lebensmitteln und<br />
sonstigen Dingen des täglichen Bedarfs<br />
schrieb die Chronistin des Marienhospitals<br />
ins Protokollbuch: „1946 setzte ... die Hungerblockade<br />
ein. ... Die Flüchtlinge kamen<br />
zu Tausenden in die Heimat zurück; es war<br />
eine große Not, nichts war zu haben, das<br />
Notwendigste fehlte. Garn, Wolle, Stoffe,<br />
Schuhe wie auch Lebensmittel waren nur<br />
ganz spärlich und mit großer Mühe und<br />
Schwierigkeit zu erlangen; es wanderte alles<br />
auf den Schwarzmarkt und nur wer ganz<br />
enorme, hohe Preise, mehr als Wucherpreise<br />
zahlen konnte, bekam etwas; da war alles<br />
vertreten, selbst ‚Schotts‘ Meßbücher. Die<br />
Masse aber, die arme Bevölkerung konnte<br />
nur zusehen. Schlimmer noch war es mit<br />
Kartoffeln, Gemüse, Brot und Nährmittel.<br />
138
Die Krankenpflegeschule<br />
Bald waren keine Kartoffeln da, kein Gemüse,<br />
keine Nährmittel, wenig oder oft<br />
genug mehrere Tage gar kein Brot oder nur<br />
in kleinen Mengen. Obst oder feines Gemüse<br />
wie Blumenkohl, Spargel, Tomaten, Erd- und<br />
Stachelbeeren galt dem Feind als Luxusartikel<br />
für den Deutschen; diese ließ man nach Holland<br />
zurückgehen oder segnete sich selbst<br />
damit. So entstand eine große Hungersnot,<br />
und mancher ist daran zu Grunde gegangen.<br />
Als im Winter auch noch kein Brand da war,<br />
... wurden Menschen auf Dachkammern und<br />
in Kellerwohnungen erfroren aufgefunden,<br />
nicht selten brachen die Leute auf der Straße<br />
vor Elend zusammen, bei eintretenden<br />
Krankheiten hatten sie keinen Widerstand<br />
und starben dahin wie die Fliegen“.<br />
Als die Versorgung mit Lebensmitteln<br />
sich im Laufe des <strong>Jahre</strong>s 1946 immer mehr<br />
verschlechterte, gingen auch die Schwestern<br />
des Marienhospitals auf Hamsterfahrt.<br />
Hierzu heißt es in der Hauschronik: „Da es<br />
diesen Sommer und im Herbst so wenig Gemüse<br />
... gab ... , sahen wir uns genötigt uns<br />
anderweitig zu bemühen. Mit den nötigen<br />
Erlaubnis- und Bezugsscheinen versehen,<br />
zogen nun mehrere Schwestern ... nach<br />
allen vier Windrichtungen aus, um etwas<br />
zu erbeuten ... . Oft gelang es etwas zu<br />
erwischen, es gab aber auch Mißerfolge und<br />
Enttäuschungen, besonders als Schwester<br />
Alana im Vorgebirge, wo ... sie etwas Gemüse<br />
und Obst erhalten hatte, sie von einem<br />
Schutzmann angehalten wurde, der ihr dann<br />
alles abnahm ... . Das zweite Mal hatte sie einen<br />
anderen Heimweg angetreten, trotzdem<br />
stand derselbe Schutzmann vor ihr, wie aus<br />
der Erde geschossen und nahm ihr trotz des<br />
Scheines ... 10 Zentner Stangenbohnen ab,<br />
die wir doch so sehr benötigten. ... Trotzdem<br />
konnten wir den armen Menschen, die hier<br />
um Brot oder Essen baten, noch helfen“.<br />
Die Krankenpflegeschule<br />
Das 1939 „aus politischen Gründen“ ausgesprochene<br />
Verbot, am Marienhospital eine Ausbildungsschule<br />
für Krankenpflege zu betreiben, wurde mit Erlass des<br />
Regierungspräsidenten vom 16. Juli 1945 rückgängig<br />
gemacht. Die Eröffnung der Krankenpflegeschule<br />
konnte jedoch erst erfolgen, nachdem der Vortragssaal,<br />
der als Luftschutzraum ausgebaut worden war,<br />
wieder für seinen früheren Zweck eingerichtet und die<br />
erforderlichen Räume zur Unterbringung der Schülerinnen<br />
geschaffen waren, die bestimmungsgemäß<br />
im Krankenhause wohnen sollten. Im Frühjahr 1946<br />
waren die Voraussetzungen hierzu geschaffen. Am<br />
1. April 1946 konnte die Krankenpflegeschule am<br />
Marienhospital unter der Leitung des Chefarztes Dr.<br />
Franz Kudlek den Unterrichtsbetrieb mit 25 Schülerinnen<br />
wieder aufnehmen.<br />
Schuhverkaufstelle im Tonhallengarten,<br />
Schadowstraße 89, um 1945<br />
Hamsterfahrt ins Düsseldorfer<br />
Umland, um 1949<br />
Marienhospital, Bestimmungen<br />
zur Aufnahme in die<br />
Krankenpflegeschule, 1946<br />
Theresienhospital,<br />
Schwesternschülerinnen, um 1955<br />
139
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Wiederaufbau, 1947<br />
Marienhospital, Hauptportal, um 1946<br />
Bautätigkeit 1946-1955<br />
Die zweite Hälfte der 1940er <strong>Jahre</strong> und die erste Hälfte der<br />
1950er <strong>Jahre</strong> standen ganz im Zeichen von Ausbesserungsund<br />
Erneuerungsarbeiten. Im <strong>Jahre</strong> 1946 waren die provisorischen<br />
Sicherungsarbeiten soweit<br />
fortgeschritten, dass dem Marienhospital<br />
wieder 400 Betten zur Verfügung<br />
standen, was in etwa der<br />
Kapazität der Vorkriegszeit entsprach.<br />
Außer der Kinderabteilung<br />
waren alle übrigen Abteilungen<br />
(Chirurgie, Innere Krankheiten,<br />
Geburtshilfe und Gynäkologie,<br />
Augen-Krankheiten, Hals-, Nasenund<br />
Ohren‐Krankheiten, Strahleninstitut)<br />
wieder eingerichtet. Das<br />
Haus war dauernd voll belegt; viele<br />
Kranke mussten täglich wegen<br />
fehlender Krankenbetten abgewiesen<br />
werden. Seit den großen<br />
Kriegsbeschädigungen wohnten<br />
und schliefen die Mitarbeiter zum<br />
Teil in überbelegten Keller- und<br />
Nebenräumen. Zur Bereitstellung<br />
von Unterkünften für Ärzte, Pflege-<br />
und Hauspersonal wurde 1946<br />
im Garten und an der Rochusstraße<br />
mit der Errichtung von zwei<br />
Bericht über den Stand der Bauarbeiten am<br />
Marienhospital 27. Mai 1947 (Auszug)<br />
Die Bauarbeiten in den mit 375 Patienten<br />
belegten Räumen, den Operations‐,<br />
Untersuchungs-, Behandlungs-Räumen,<br />
im Laboratorium, in der Hals-, Nasenund<br />
Ohren‐Station, im Isolierhaus, den<br />
Küchen- und Neben-Räumen, der Waschküche,<br />
im Leichen- und Kessel-Haus, im<br />
Stallgebäude, sowie in den Gewächshäusern<br />
sind nahezu zum Abschluss gebracht.<br />
Die während des Krieges errichtete<br />
Luftschutz-Ummauerung um und<br />
im Krankenhaus wurde im verflossenen<br />
Herbst und Winter bis auf kleine Reste<br />
entfernt. Hierbei wurden rund 40000<br />
Stück Ziegelsteine gewonnen. Insgesamt<br />
wurden 8000 Tonnen Schutt transportiert.<br />
…<br />
Der Fortgang der Bauarbeiten ist<br />
zur Zeit nicht befriedigend. Die Ursache<br />
ist in der allgemeinen Wirtschaftslage<br />
begründet. Im Dezember 1946 wurden<br />
die letzten Baustoffbezugsrechte dem<br />
Krankenhaus zur Verfügung gestellt. ...<br />
Trotz all der Widerwärtigkeiten hoffen<br />
wir, dass noch in diesem Jahr vor<br />
Einbruch der Kälte der Nordflügel in Benutzung<br />
genommen werden kann.<br />
Behelfsheimen begonnen. Während im<br />
Gartenbau das Personal untergebracht<br />
werden sollte, sollte der Bau an der Rochusstraße<br />
zunächst an die evakuierten<br />
und vorübergehend im Marienhospital<br />
wohnenden Jesuitenpatres aus der Marienstraße<br />
vermietet werden. Nach dem<br />
Auszug der Jesuiten war das Behelfsheim<br />
zur Unterbringung unverheirateter Assistenzärzte<br />
vorgesehen.<br />
140
Bautätigkeit 1946-1955<br />
Briten zu Besuch<br />
Niederschrift über die Vorstandssitzung<br />
vom 29. Mai 1947 (Auszug)<br />
Der Vorsitzende Karl Fritzen machte alsdann<br />
Mitteilung von dem Besuch des Britischen<br />
Ministers für das englisch besetzte<br />
Gebiet, Lord Frank Pakenham, im Marienhospital<br />
am Freitag, den 9. Mai 1947.<br />
... Zuerst besichtigte der Herr Minister die<br />
Bombenschäden am Hause und besuchte<br />
dann in Begleitung des Chefarztes Dr.<br />
Gustav Pfeffer die im Untergeschoss des<br />
Nordflügels untergebrachten, an Hungerödemen<br />
leidenden, Patienten. ... Herr<br />
Prof. Theodor Hünermann empfing am<br />
Sonntag, den 4. Mai 1947 zwei konservative<br />
britische Abgeordnete, Mr. Sperman<br />
und Mr. Pool, die sich in eingehender und<br />
aufgeschlossener Weise über deutsche Ernährungsfragen,<br />
insbesondere diejenigen<br />
der Krankenhäuser unterrichten wollten.<br />
Im Laufe des <strong>Jahre</strong>s 1948 konnten mehrere<br />
Baumaßnahmen für das Marienhospital<br />
abgeschlossen werden. Der Ostflügel mit<br />
einer Frauenabteilung sowie Hals-Nasen-<br />
Ohren‐ und Augenabteilung im ersten<br />
Stock und einer gynäkologischen- und<br />
Wochenabteilung im zweiten Stock war<br />
fertig gestellt. Die Durchgänge vom Altzum<br />
Neubau waren bis zum dritten Obergeschoss<br />
wieder hergestellt. Das neu zu<br />
errichtende Ärztehaus-Behelfsheim an der<br />
Rochusstraße konnte in Benutzung genommen<br />
werden. Für das Personalhaus im<br />
Garten waren die Ausschachtungsarbeiten<br />
erledigt und die Errichtung der Fundamente<br />
vorbereitet. Ferner waren verschiedene Arbeiten<br />
an der Kapelle ausgeführt worden.<br />
So wurde das Dach gedeckt, die Fenster<br />
eingesetzt und das Gewölbe bearbeitet. Die Veranda an der<br />
hinteren Nordflügelseite wurde hochgezogen.<br />
Am Vigiltag von Pfingsten 1949 (4. Juni) konnte die neu<br />
restaurierte Kapelle durch den Kölner Weihbischof Joseph<br />
Ferche feierlich eingeweiht und wieder dem regelmäßigen<br />
Gottesdienst übergeben werden. In diesem Jahr konnte<br />
auch das Personalhaus fertig gestellt und am 1. Oktober<br />
von den Hausgehilfinnen bezogen werden. Bereits einen<br />
Monat zuvor war das zerstörte Ökonomiegebäude wieder<br />
hergestellt und das Kesselhaus mit einem neuen Schornstein<br />
ausgestattet worden.<br />
Lord Frank Pakenham zu Besuch<br />
im Marienhospital, 9. Mai 1947<br />
Weihbischof Joseph Ferche<br />
(1888-1965), 1961<br />
Britische Militärpolizei,<br />
Königsallee, um 1946<br />
141
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
1950 konnte die gynäkologische Frauenstation<br />
mit Untersuchungs‐, Operations‐ und<br />
Entbindungsraum und einem Saal für Neugeborene<br />
nach vollständiger Renovierung<br />
wieder in Benutzung genommen werden.<br />
Im Kesselhaus wurden die Wasserrückführungsanlage<br />
und die „total verkalkten“<br />
Rohrleitungen unter der Operationsabteilung<br />
erneuert. Die Wiederherstellung der<br />
zerstörten Veranden gegenüber dem Kesselhaus<br />
wurde durch das Einziehen neuer<br />
Stahlbetondecken, Einbau von Türen und<br />
Fenstern sowie Roll-Läden realisiert. In der<br />
Röntgenabteilung wurde eine schadhafte<br />
Entwickleranlage für Röntgenfilme erneuert.<br />
Gegen Ende des <strong>Jahre</strong>s wurden dem<br />
Bauamt die Entwürfe für den Aufbau des<br />
dritten Obergeschosses und des Dachgeschosses<br />
über dem Kapellenflügel, die die<br />
lang vermisste Kinderstation aufnehmen<br />
sollten, zur Prüfung vorgelegt. Nach Eintritt<br />
einer frostfreien Wetterlage wurde<br />
Mitte Januar 1951 im Westflügel mit der<br />
Ausführung des ersten Bauabschnittes für<br />
die Kinderstation begonnen. Am 15. November<br />
1951 konnten die 70 Betten der<br />
Station, die „im neuzeitlichen Stil mit allen<br />
Einrichtungen ausgestattet war, die zur besseren<br />
Gesundung der Kinder führen“, ihrer<br />
Bestimmung übergeben werden. Weiter<br />
heißt es zum Stand des Wiederaufbaus im<br />
<strong>Jahre</strong>sbericht 1952: „Für die Chirurgische<br />
Abteilung wurde die frühere Kinder-Station<br />
im Erdgeschoß als sogenannte ‚Wachstation’<br />
für Schweroperierte, die dauernder<br />
Überwachung bedürfen, neu eingerichtet.<br />
Sie liegt in unmittelbarer Nähe der Operationssäle.<br />
Die Unfallstation, die bisher in dem<br />
2. Stockwerk untergebracht war, wurde<br />
in das Unterhaus des Ostflügels verlegt“.<br />
Marienhospital, Situationsplan, 1949<br />
142
Bautätigkeit 1946-1955<br />
Obwohl das Marienhospital alle finanziellen<br />
Mittel ausschöpfte, um den Fortgang des<br />
Wiederaufbaues zu beschleunigen, blieb<br />
der erreichte Baufortschritt weit hinter den<br />
Bedarfen zurück. Im <strong>Jahre</strong>sbericht 1951<br />
stellt der Vorstand resignierend fest: „Der<br />
Bettenmangel bei den einzelnen Stationen<br />
des Hauses ist nach wie vor groß. Noch<br />
immer müssen schwerverletzte oder schwer<br />
kranke Aufnahmesuchende abgewiesen<br />
werden“. Neben dem allgemeinen Mangel<br />
an Krankenhausbetten in Düsseldorf führte<br />
der Vorstand die unbefriedigende Situation<br />
auf spezifische Besonderheiten der Pempelforter<br />
Anstalt zurück: „Das Marienhospital<br />
liegt in dem bevölkertsten Stadtteil von<br />
Düsseldorf mit zahlreichen Industrien und<br />
gewerblichen Betrieben, vielen Baustellen,<br />
großen Eisenbahnanlagen usw.. Der Anfall<br />
von Kranken ist daher sehr groß, nicht zuletzt<br />
auch deshalb, weil sich unsere Schwestern<br />
einer besonderen Beliebtheit in diesem Stadtbezirk<br />
Düsseldorfs erfreuen“.<br />
Nach der Fertigstellung des Westflügels<br />
geriet die Wiederherstellung der noch zerstörten<br />
Teile des Marienhospitals ins Stocken,<br />
da der Vorstand in Bauangelegenheiten sich<br />
nicht mehr auf ein gemeinsames Vorgehen<br />
verständigen konnte. In der Vorstandssitzung<br />
vom 27. Dezember 1951 kam der Richtungsstreit<br />
erstmals offen zum Ausbruch. Während<br />
einige Vorstandsmitglieder die sofortige Instandsetzung<br />
des Ost‐ und Mittelflügels forderten,<br />
was „eine überaus wertvolle Vermehrung<br />
der Bettenzahl um 115 Kranken- und<br />
mindestens 111 Personalbetten und damit<br />
eine erhebliche Verbesserung der Einnahmemöglichkeiten<br />
mit sich bringen würde“,<br />
wollten andere Mitglieder lieber den „zahlreichen<br />
und berechtigten Wünschen der<br />
Ärzte und Schwestern zur Modernisierung<br />
und Verbesserung bestehender Stationen,<br />
Liquidität<br />
Die zahlreichen Baumaßnahmen blieben nicht<br />
ohne Auswirkung auf die Bilanzen des Marienhospitals.<br />
Im Rechnungsabschluss für das Jahr 1951<br />
wird dies ausdrücklich vermerkt, doch werden für<br />
das Defizit auch andere Kostentreiber benannt:<br />
„Die finanzielle Lage des Hauses hat sich ...<br />
verschlechtert, eine Tatsache, die zwar bedauerlich<br />
ist, mit der unser Haus aber nicht allein steht.<br />
Die finanzielle Anspannung, um nicht zu sagen<br />
Verschuldung, hat bei den freien und gemeinnützigen<br />
Krankenhäusern mehr und mehr zugenommen.<br />
Der Wiederaufbau der Kriegszerstörungen<br />
konnte zum großen Teil nur mit Krediten und<br />
den entsprechenden Zinslasten durchgeführt<br />
werden. ...<br />
Auch durch das Pflege‐ und sonstige Personal<br />
des Hauses geht der Drang nach Erhöhung der<br />
Löhne und Gehälter, der bei der starken dienstlichen<br />
Beanspruchung vielfach berechtigt ist. Durch<br />
die Überbeanspruchung werden insbesondere<br />
auch die Ordensschwestern betroffen, die immer<br />
noch unter einem Mangel an Nachwuchs leiden,<br />
dem vorerst nur durch einen vermehrten Einsatz<br />
von freien Schwestern abgeholfen werden kann.<br />
Die Lage der freien Krankenhäuser in dem<br />
Zwiespalt zwischen der freien Marktwirtschaft,<br />
den Lohn- und Gehaltssteigerungen einerseits<br />
und der staatlichen Lenkung der Pflegesätze andererseits<br />
ist im hohen Maße kritisch geworden.<br />
Die staatlichen und kommunalen Krankenanstalten<br />
können ihre Betriebe durch Zuschüsse der<br />
öffentlichen Hand aufrechterhalten. Diese sollten<br />
auch den freien und gemeinnützigen Krankenhäusern<br />
gegeben werden, um sie lebensfähig<br />
zu erhalten, um so mehr als sie, wie u.a. auch in<br />
Düsseldorf, stets voll- und überbelegt sind und<br />
dadurch die Gemeinden von der Verpflichtung<br />
entlasten, übergroße und oft unwirtschaftliche<br />
Krankenanstalten zu errichten“.<br />
Marienhospital, Situationsplan, 1952<br />
Berliner Allee/Graf-Adolf-Straße, 1955<br />
143
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Flughafen Düsseldorf, um 1950<br />
Messe Düsseldorf, um 1955<br />
Dreischeibenhochhaus, um 1958<br />
von Kranken-, Personal-, Wirtschafts- und Betriebsräumen“<br />
entsprechen, was allerdings die<br />
Finanzmisere nicht verbessert hätte, „so sehr<br />
erwünscht die Modernisierungsarbeiten auch<br />
sein mögen“. Nach „einer lebhaften Debatte“<br />
wurde eine Baukommission gebildet, bestehend<br />
aus dem leitenden Arzt Dr. Gustav Pfeffer,<br />
Baurat Peter Dierichsweiler, Architekt Wilhelm<br />
Dicken, dem Vorstandsvorsitzenden Karl Fritzen<br />
und der Oberin Sw. Walburga.<br />
In der Vorstandssitzung des <strong>Jahre</strong>s 1952<br />
stand die Frage im Mittelpunkt, ob die weitere<br />
bauliche Rekonstruktion des Marienhospitals<br />
durch eine Gesamtsanierung mit Neuverschuldung<br />
oder in mehreren Teilabschnitten ohne<br />
Geldanleihen erfolgen sollte. Im Vorstandsprotokoll<br />
vom 27. Juni 1952 heißt es über den<br />
Verlauf der Kontroverse: „Die Erörterungen<br />
über diesen Punkt begannen mit der Grundfrage<br />
‚Aufbau und Zinsenaufbringung oder<br />
Verbesserungen im Inneren des Hauses?’ Der<br />
Vorsitzende Karl Fritzen befürwortete die Schaffung<br />
neuer Krankenbetten auf dem Wege des<br />
Wiederaufbaues der noch zerstörten Teile des<br />
Hauses. Die Nachfrage nach Betten sei weiter<br />
groß und würde auch groß bleiben, sowohl<br />
durch den steigenden Anfall von Verletzten<br />
aus dem Verkehr und den Betrieben in der<br />
Einflußzone des Marienhospitals, wie Eisenbahn,<br />
Industrieanlagen und Neubauten, als<br />
auch durch den ständigen und großen Bevölkerungszuwachs<br />
in Düsseldorf. ... Es entspann<br />
sich eine lebhafte Debatte über den Fortgang<br />
des Wiederaufbaues der noch zerstörten Teile<br />
unseres Hauses und die Frage ob man zunächst<br />
nur den 4. und 5. Bauabschnitt, der 41 Betten<br />
bringen würde, oder auch die übrigen zerstörten<br />
Teile (die Bauabschnitte 3, 6, 7 und 8) in<br />
Angriff nehmen solle, eine große Aufgabe,<br />
deren Lösung vorläufig durch die Beschaffung<br />
des erforderlichen Kapitals erschwert wird“.<br />
Mitten in der Diskussion über die Leitlinien der<br />
Instandsetzung des zerstörten Marienhospitals<br />
überraschte Peter Dierichsweiler den<br />
Vorstand in der Sitzung vom 6. Juli 1953<br />
mit einer Feststellung, die das gesamte Wiederaufbauprogramm<br />
in Frage stellte. „Herr<br />
Baurat Dierichsweiler hält es für fehlerhaft“,<br />
so das Protokoll, „das Marienhospital in der<br />
alten Gestaltung wieder aufzubauen. Es<br />
müsse einmal klar herausgestellt werden,<br />
daß das Haus von Anbeginn an insofern<br />
unrichtig gebaut sei, als auf der Südseite<br />
des Hauses Wirtschafts- und Versorgungsräume,<br />
wie Kesselhaus, Schornstein, Küche,<br />
Wäscherei usw. untergebracht sind, während<br />
die Krankenräume auf der Nordseite<br />
liegen. Vom hygienischen Standpunkt aus<br />
gesehen, müsse es genau umgekehrt sein“.<br />
Peter Dierichsweiler legte den überraschten<br />
Vorstandsmitgliedern eine Entwurfsskizze<br />
vor, „aus der zu ersehen war, daß es sich<br />
um eine gänzliche Umschichtung großer<br />
Bauteile mit erheblichen Neubauten handelte“,<br />
deren Kosten er auf ein Investitionsvolumen<br />
von 10 Millionen DM schätzte. Zu<br />
den Ausführungen des Baurates bemerkte<br />
der Vorstandsvorsitzende Karl Fritzen,<br />
„daß diese Umgestaltung weniger eine<br />
Architekten-Angelegenheit sei, sondern eine<br />
hygienische Notwendigkeit bedeute, der in<br />
allen modernen Krankenhäusern Rechnung<br />
getragen würde. Die größte Schwierigkeit sei<br />
aber die Finanzierung eines solchen Projekts<br />
und es lasse sich heute noch in keiner Weise<br />
übersehen, ob es jemals möglich sein werde,<br />
derartige Summen für ein privates Krankenhaus<br />
aufzubringen und vor allem auch zu<br />
verzinsen und zu tilgen“.<br />
Im Vorstand herrschte Einigkeit darüber,<br />
„daß dieser große Umbau ein Problem<br />
der Zukunft sei“. An eine baldige Ausführung<br />
war damals nicht zu denken, doch<br />
wollte man Sorge dafür tragen, „daß alle<br />
144
Bautätigkeit 1946-1955<br />
Wiederaufbauplanungen den Generalplan<br />
nicht behindern dürfen, vielmehr sich ihm<br />
zweckmäßig einzufügen hätten“. Es wurde<br />
ein Bauausschuss zur Erstellung eines Generalaufbauplans<br />
gebildet, der die Gedankenanstöße<br />
von Peter Dierichsweiler aufgreifen<br />
und weiter konkretisieren sollte.<br />
Bereits einen Monat später trat der Bauausschuss<br />
am 13. August 1953 zusammen<br />
und stellte fest, „daß auf dem bisher eingeschlagenen<br />
Weg des Wiederaufbaus nach<br />
den von Herrn Architekt Wilhelm Dicken<br />
bearbeiteten Plänen, d.h. mehr oder weniger<br />
Restauration des früheren Zustandes, nicht<br />
fortgefahren werden kann. Die in den letzten<br />
Jahrzehnten ausgeführten An- und Umbauten<br />
sind wohl nach dem Billigkeitsprinzip<br />
entstanden, haben aber zu einer baulichen<br />
Verfilzung und Unklarheit des Grundrisses<br />
und der Organisation geführt. Daher sind<br />
die nach den heutigen Gesichtspunkten an<br />
ein Haus von der Wichtigkeit des Marienhospitals<br />
zu stellenden Forderungen in keiner<br />
Weise erfüllt“. Der Ausschuss appellierte,<br />
„die jetzt zur Verfügung stehenden Mittel so<br />
zu verwenden, daß einem späteren Ausbau<br />
nach heutigen Forderungen keine Fesseln<br />
angelegt werden“. Um in keine Sackgasse<br />
zu geraten, wurde auf eine Wiederherstellung<br />
der südlichen Anbauten mit Blick auf<br />
einen in der Planung vorgesehenen Abbruch<br />
dieser Bauteile verzichtet. Vielmehr wurde<br />
versucht, mit den zur Verfügung stehenden<br />
Mitteln den Mitteltrakt und nordöstlichen<br />
Seitenflügel im vollem Kubus auszubauen,<br />
die nach dem Generalaufbauplan erhalten<br />
bleiben sollten.<br />
Der Plan eines vollständigen Neubaus<br />
und Abbruch des alten Hauses hatte mit<br />
dem Einwurf von Peter Dierichsweiler 1953<br />
erstmals konkrete Formen angenommen,<br />
doch war klar, dass aus finanziellen Gründen<br />
Referat Baurat Peter Dierichsweiler vom 30. November 1955 (Auszug)<br />
Der hier vorliegende Plan stellt zunächst<br />
eine private Überlegung dar und bedarf<br />
noch größerer Mitarbeit von Verwaltung und<br />
Ärzteschaft, um die heutigen Forderungen an<br />
ein modernes Haus zu erfüllen.<br />
Der Plan geht davon aus, vorerst alle im<br />
Laufe der Jahrzehnte eingefilzten und unzweckmäßigen<br />
Bauteile zu entfernen und den<br />
Krankenzimmern Luft und Sonne zukommen<br />
zu lassen. Dieses führt zunächst zum Abbruch<br />
und zur Verlegung des Schwesterntraktes<br />
mit darunter liegender Hauptküche, sowie<br />
Entfernung der jetzigen Heizzentrale und<br />
Nebenbauten.<br />
Diese Bauteile müssen an anderer Stelle<br />
zweckmäßiger untergebracht werden. Im<br />
Endausbau bei der gewünschten Kapazität<br />
von ca. 600 Krankenbetten wäre ein neues<br />
Bettenhaus in acht bis zehn Geschossen zu<br />
die Umsetzung des Vorhabens<br />
zunächst ein Fernziel bleiben<br />
musste.<br />
Ungeachtet der Tatsache,<br />
dass der Vorstand und Verwaltungsrat<br />
sich zu den Plänen und<br />
Vorschlägen eines Neubaues<br />
bekannt hatten, wurden im<br />
Marienhospital in den folgenden<br />
<strong>Jahre</strong>n „so nebenher“<br />
zahlreiche „kleinere und mittlere<br />
bauliche Verbesserungen“<br />
vorgenommen, um die Nachfrage<br />
nach Krankenbetten zu<br />
befriedigen. Mitte der 1950er<br />
<strong>Jahre</strong> konnte der Wiederaufbau<br />
des dritten Stockwerkes<br />
und des Dachgeschosses am<br />
kriegszerstörten Ostflügel<br />
errichten, dazu ein dreigeschossiges Behandlungsgebäude<br />
für Bäder, Röntgen- und Operationsabteilung.<br />
Eine zentrale Verteilungshalle,<br />
von der alle Stationen übersichtlich zu<br />
erreichen sind, wäre im Verbindungstrakt<br />
an Stelle der jetzigen Operationsabteilung<br />
richtig gelegen.<br />
Der Haupteingang kann an der Sternstraße<br />
bleiben, muss aber eine übersichtliche<br />
Einfahrt erhalten. Der Hautpeingang ist völlig<br />
umzugestalten, da der heutige Zustand untragbar<br />
ist. Nichtgehfähige Kranke und Verletzte<br />
werden angesichts der Patienten und<br />
Besucher ausgeladen. Alle Besucher müssen<br />
eine in Wind und Regen liegende Treppe<br />
passieren. Dieses ist nur durch Errichtung<br />
einer Halle mit Treppe und Aufzugsanlage zu<br />
lösen, wobei die Krankenwagen ungesehen<br />
unterfahren können.<br />
Marienhospital, Gebäudealter, um 1965<br />
145
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Niederschrift der Vorstandssitzung 31. Oktober 1956 (Auszug)<br />
Das Marienhospital aus der Sicht des Arztes und die Problematik des gemeinnützigen Krankenhauses (Referat des Herrn leitenden Arztes,<br />
Chefarzt Dr. Heinrich Bross)<br />
Herr Chefarzt Dr. Heinrich Bross schildert die immer<br />
noch schwierige Lage des konfessionellen Krankenhauses.<br />
Während die städtischen Anstalten viele<br />
Millionen Zuschüsse alljährlich erhalten, müssen<br />
die caritativen Häuser mit den Erträgen aus den<br />
Pflegesätzen auskommen. Die Lage wird allmählich<br />
unerträglich. Der angestaute Nachholbedarf kann<br />
nicht befriedigt und mit dem technischen Fortschritt<br />
nicht Schritt gehalten werden. Es besteht damit die<br />
Gefahr, auf einer zurückgebliebenen Entwicklungsstufe<br />
stehenzubleiben. Auch in unserem Hause<br />
ergeben sich noch viele Überholungsarbeiten. ...<br />
Die Stadt plant an der Peripherie mehrere Krankenhäuser<br />
zu errichten, die in ihrer Ausstattung<br />
dem neuesten Stand angepasst sind. Wir werden<br />
alles tun müssen, um uns durchzusetzen und die<br />
Gefahr der Abwanderung zu bannen.<br />
Bettenaufteilung<br />
Stand 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Gesamt<br />
1939 24 23 366 413<br />
1953 13 60 424 497<br />
1955 12 64 472 548<br />
1956 12 77 472 561<br />
1959 12 80 527 619<br />
Dr. Heinrich Bross, Chefarzt<br />
der Chirurgischen Abteilung<br />
(1951-1979), um 1970<br />
Düsseldorfer Nachrichten,<br />
25. November 1955<br />
„nach Überwindung zahlloser Schwierigkeiten“<br />
abgeschlossen werden. In den<br />
wiederhergestellten Räumlichkeiten fand<br />
am 1. Dezember 1955 die Frauen- und geburtshilfliche<br />
Abteilung eine neue Bleibe.<br />
Zur gleichen Zeit stellte sich heraus, dass<br />
das erste und zweite Obergeschoss des<br />
Marienhospitals vom Hausschwamm befallen<br />
war. Es mussten umfangreiche und<br />
kostspielige Erneuerungsarbeiten durch<br />
den Einzug neuer Decken vorgenommen<br />
werden, um in diesen Etagen den Befall<br />
zu beseitigen. Die Röntgenapparaturen,<br />
die Fernsprechanlage und ein Teil der<br />
Aufzüge waren so veraltet und abgenutzt,<br />
dass keine Ersatzteile mehr zu beschaffen<br />
waren und Reparaturarbeiten sich nicht<br />
mehr lohnten. Sie mussten vollständig<br />
erneuert werden. Vergeblich versuchte<br />
man, auch die marode Heizung wieder<br />
in Gang zu bringen, was schließlich 1956<br />
die Installierung einer neuen Anlage erforderlich<br />
machte. Die neue Heizung wurde<br />
allerdings so erstellt, dass der neue Kessel<br />
wie auch der neue Tank für 50000 Liter<br />
Öl beim projektierten Neubau weiterverwendet<br />
werden konnten.<br />
146
Die Aufgabe des Hauses<br />
ist uns schmerzlich ...<br />
Schwesternwohnheim<br />
Bis Ende der 1950er <strong>Jahre</strong> waren die<br />
Hausangestellten, die im Marienhospital<br />
wohnten, im Dachgeschoss des Ostflügels<br />
untergebracht, wo 26 Zimmer mit 55 Personalbetten<br />
zur Verfügung standen. Da einerseits<br />
der Bedarf an Mitarbeiterunterkünften<br />
wesentlich höher war, andererseits die vorhandenen<br />
Plätze wertvollen Raum für neue<br />
Krankenzimmer blockierten, hatte sich<br />
der Vorstand des Marienhospitals schon<br />
1955 für den Neubau eines Schwesternwohnhauses<br />
ausgesprochen. Vorgesehen<br />
war ein siebenstöckiges Gebäude, das auf<br />
sechs Etagen verteilt 70 Einzelzimmer für<br />
freie Schwestern und 16 Dreibettzimmer<br />
für Schwesternschülerinnen erhalten sollte.<br />
Für das Untergeschoss war ein großer und<br />
kleiner Tagesraum mit Radio und Fernsehen,<br />
Gästezimmer sowie ein Näh- und<br />
Flickraum geplant. Der Entwurf, der auf<br />
dem Eckgrundstück Stockkampstraße/<br />
Prinz-Georg-Straße ausgeführt werden<br />
sollte, berücksichtigte „selbstverständlich<br />
alle heutigen Forderungen bezüglich Installation<br />
und Schallschutz“. Die Errichtung<br />
eines siebengeschossigen Gebäudes war<br />
dem Wunsch geschuldet, „die Grundfläche<br />
nur sparsam zu bebauen“.<br />
Nach der feierlichen Grundsteinlegung<br />
am 19. Juni 1957 konnte das neue Schwesternwohnheim<br />
an der Prinz-Georg-Straße<br />
57 knapp ein Jahr später seiner Bestimmung<br />
übergeben werden. Am 21. August<br />
1958 wurde der Neubau von Stadtdechant<br />
Ernst Kreuzberg feierlich gesegnet und von<br />
120 Schwestern bezogen.<br />
Die Aufgabe des Hauses ist uns<br />
schmerzlich ...<br />
Im Sommer 1960 gab der Vorstand des Marienhospitals bekannt,<br />
dass die Ordensgemeinschaft der Armen Schwestern<br />
vom Hl. Franziskus sich gezwungen sah, ihren Vertrag mit der<br />
Krankenpflegeeinrichtung zu kündigen. „Was seit längerer<br />
Zeit Gegenstand von Verhandlungen gewesen ist“, so die<br />
Pressemitteilung, „hat sich in diesen<br />
Tagen entschieden. Die ehrwürdigen<br />
Schwestern im Marienhospital<br />
Düsseldorf aus der Genossenschaft<br />
der Armen Schwestern vom heiligen<br />
Franziskus, Mutterhaus Aachen, verlassen<br />
im Laufe des nächsten <strong>Jahre</strong>s<br />
das Marienhospital, ... . Viele Kräfte<br />
sind am Werk, eine einigermaßen<br />
ansprechende Lösung zu finden, aber<br />
diese ist äußerst schwierig“.<br />
In der Tat waren alle Verantwortlichen<br />
gezwungen, sich seit längerer<br />
Zeit mit der Frage des Abzugs der<br />
Aachener Ordensschwestern und den<br />
Schwesternwohnheim,<br />
Prinz-Georg-Straße 57, um 1970<br />
Schwesternwohnheim, Grundsteinlegungsurkunde,<br />
19. Juni 1957<br />
Rochusstraße 4, Heim für ledige Ärzte,<br />
1958 errichtet, heute Verwaltungsgebäude<br />
147
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Franziskanerinnen in Düsseldorf,<br />
um 1955<br />
sich daraus ergebenden Konsequenzen auseinanderzusetzen.<br />
Die grundsätzliche Entscheidung, die Schervier-Schwestern<br />
aus Pempelfort abzuziehen, war bereits zwei <strong>Jahre</strong> zuvor<br />
gefallen. Auf der Tagung der Höheren Oberen, die im Februar<br />
1958 in Köln stattgefunden hatte, war die Führungsspitze der<br />
Genossenschaft zu der Einsicht gelangt, „daß wir nicht alle<br />
Niederlassungen halten können, wenn nicht die Schwestern<br />
Schaden leiden sollen“. In Düsseldorf waren die Franziskanerinnen<br />
Ende der 1950er <strong>Jahre</strong> außer im Marienhospital noch<br />
im Marienkrankenhaus (Kaiserswerth) und Annastift (Altstadt)<br />
in der Kranken‐ und Altenfürsorge tätig. Nach „reiflicher“<br />
Abwägung fällte der Konvent der Ordensoberen den Entschluss,<br />
in Düsseldorf das Marienhospital „aufzugeben“. Zur<br />
Begründung hieß es: „Das Haus wird laufend erweitert. Den<br />
fortgesetzt wachsenden Aufgaben und Belastungen entsprechend,<br />
können wir nicht nur den Schwesternbestand nicht<br />
vermehren, sondern die Einsatzfähigkeit der dort arbeitenden<br />
Schwestern nimmt stetig ab wegen Überbelastung“. Von den<br />
45 Schwestern, die 1958 im Marienhospital zusammen mit<br />
350 weltlichen Kräften rund 600 Krankenbetten zu versorgen<br />
hatten, waren eine Schwester 20 <strong>Jahre</strong>, 13 Schwestern über<br />
30 <strong>Jahre</strong>, 15 Schwestern über 50 <strong>Jahre</strong>, 7 Schwestern über<br />
60 <strong>Jahre</strong> und 9 Schwestern über 70 <strong>Jahre</strong> alt.<br />
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg war die Niederlassung<br />
der Franziskanerinnen im Marienhospital überaltert. Fast in<br />
jedem Jahr klagte der Vorstand, dass nicht alle in Pempelfort<br />
eingesetzten Ordensschwestern für die Krankenpflege ausreichend<br />
qualifiziert und den Belastungen der Alltagsarbeit<br />
gewachsen waren. Angesichts des seit Beginn der 1950er<br />
<strong>Jahre</strong> zu verzeichnenden Rückgangs an Frauen und Männern,<br />
die sich für ein Leben in einer klösterlichen Gemeinschaft<br />
entschieden, konnte die Absicht der Leitung<br />
der Franziskanerinnen keine große<br />
Überraschung sein. Gleichwohl wollte der<br />
Vorstand des Marienhospitals, nachdem er<br />
im Juni 1958 von der Aachener Provinzialoberin<br />
über die geplante Auflösung der<br />
Pempelforter Niederlassung unterrichtet<br />
worden war, die Entscheidung nicht akzeptieren.<br />
In mehreren schriftlichen Eingaben<br />
und persönlichen Gesprächen drängte der<br />
Vorstand die Ordensleitung, die Schwestern<br />
am Marienhospital zu belassen. Zwar<br />
mangelte es nicht an der Bereitschaft zu<br />
Kompromissen, doch wurde die Suche nach<br />
neuen Lösungen schnell von der Realität<br />
eingeholt. Am 7. März 1959 teilte Sw.<br />
Edigna, Provinzialoberin in Aachen, dem<br />
Kölner Generalvikariat mit, dass man eher<br />
als geplant die Schwestern aus dem Marienhospital<br />
zurückziehen müsse. „Die Lage<br />
des Hauses“, so die Provinzialoberin, „hat<br />
sich inzwischen weiterhin verschlechtert<br />
insofern, als wir ausgeschiedene Schwestern<br />
nicht ersetzen konnten und zum Teil<br />
wiederum einige aus gesundheitlichen<br />
Gründen dringend um Abberufung bitten.<br />
Wir dürfen der Kommunität Belastungen<br />
in dem bisherigen Maße nicht mehr auferlegen,<br />
und so sehen wir uns vor die<br />
unabwendbare Notwendigkeit gestellt, die<br />
Tätigkeit im Marienhospital aufzugeben. ...<br />
Wir bitten das Hochwürdigste Erzbischöfliche<br />
Generalvikariat, jetzt die Kündigung<br />
einreichen und die Schwestern ... zurückziehen<br />
zu dürfen“. Entsprechend dem<br />
Gestellungsvertrag mit dem Marienhospital<br />
sollte die Kündigung zum 1. Januar 1960<br />
erfolgen, „doch haben wir ... angeboten,<br />
unter Umständen dann doch noch ein halbes<br />
Jahr zu bleiben, um die Überbrückung<br />
zu erleichtern“.<br />
148
Die Aufgabe des Hauses<br />
ist uns schmerzlich ...<br />
Was der Abzug der Aachener Schwestern<br />
für die Stadt Düsseldorf und das Erzbistum<br />
Köln bedeutete, vermag man daran abzulesen,<br />
dass sich Kardinal Joseph Frings<br />
mehrfach persönlich in das Verfahren<br />
einschaltete. Am 7. Juni 1959 teilte er<br />
der Generaloberin in einem eigenhändig<br />
aufgesetzten Brief mit, dass es ihm<br />
„ungeheuer schwer fällt“, die Kündigung<br />
anzunehmen. „Gerade habe ich mich bei<br />
einer Visitation von neuem überzeugt“,<br />
so der Kölner Metropolit weiter, „wie sehr<br />
das Marienhospital mit seinen Schwestern<br />
in den Herzen der Düsseldorfer verankert<br />
ist und welchen ungeheuren Wert es für<br />
den katholischen Geist in der Stadt und für<br />
die Rettung unzähliger Seelen darstellt. ...<br />
Daher bitte ich Sie, noch einmal mit Ihrem<br />
Rat zu überlegen, ob es Ihnen nicht möglich<br />
ist, die Beibehaltung des Hauses von<br />
Herzen zu bejahen, das Haus auch weiter<br />
mit guten Schwestern zu versehen ... . Auf<br />
keinen Fall kann ich meine Zustimmung<br />
geben, daß Sie Ende Juni die Kündigung<br />
aussprechen“.<br />
Zwar versicherte die Ordensleitung<br />
wiederholt, dass die Weiterbesetzung des<br />
Marienhospitals wegen seiner Größe „eine<br />
Unmöglichkeit“ sei und es auch nicht damit<br />
getan sei, ein anderes Haus aufzugeben.<br />
„Denn in allen Niederlassungen sind so<br />
viele ältere und alte Schwestern, die für<br />
den Einsatz im Marienhospital garnicht<br />
in Frage kommen können“. Dass dem<br />
Entschluss, von Düsseldorf wegzugehen,<br />
„reifliche und wohlwollende Überlegungen<br />
vorausgegangen“ waren, bezweifelten<br />
sowohl der Düsseldorfer Vorstand wie<br />
auch das Kölner Generalvikariat. Am 30.<br />
April 1960 schrieb Kardinal Joseph Frings<br />
der Generaloberin zum bevorstehenden<br />
Rückzug der Schwestern: „Ich bin darüber<br />
bestürzt und kann mir für die Seelsorge der Stadt Düsseldorf<br />
schlecht einen schwereren Schlag vorstellen. Wieviel katholischer<br />
Geist ist von diesem Hause aus in die liberale Stadt<br />
Düsseldorf ausgestrahlt! Wieviele unsterbliche Seelen sind<br />
durch das stille Wirken der Schwestern für das ewige Heil<br />
gerettet worden! Wenn die Schwestern gehen, wird – so hat<br />
man berechnet – auf die Dauer ein jährliches Defizit von 2<br />
Millionen DM entstehen. Um das zu tragen, wird die Hilfe der<br />
Stadt angerufen werden müssen und auf lange Sicht gesehen,<br />
wird das Haus unter Mitbestimmung der Stadt kommen. Es<br />
wird dann wohl noch ein katholischer Seelsorger bleiben,<br />
aber die Atmosphäre des Hauses wird ‚weltlich’ sein! Ich<br />
bitte Sie daher flehentlich, noch einmal die Entschlüsse zu<br />
überprüfen. ... Ich weiß, daß ich mich durch diesen Kniefall<br />
verdemütige, aber ich tue es gern, wenn ich dadurch etwas<br />
retten kann. Ihre Gründe sind schwerwiegend, aber ist nicht<br />
durch Heranziehung von noch mehr weltlichen Kräften oder<br />
auf andere Weise doch noch ein Verbleiben der Schwestern<br />
im Hause möglich?“.<br />
Schreiben von Kardinal Joseph Frings<br />
an Generaloberin Alexiana, 7. Juni 1959<br />
Kardinal Joseph Frings, um 1955<br />
149
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Rheinische Post, 1. Juli 1960<br />
Marienhospital,<br />
Caritasschwestern, 1963<br />
Obwohl der Kölner Erzbischof die Franziskanerinnen massiv<br />
unter Druck setzte, war die Auflösung der Pempelforter<br />
Niederlassung nicht mehr abzuwenden. Am 5. Mai 1960<br />
drückte Generaloberin Sw. Alexiana dem Kardinal gegenüber<br />
ihre Betroffenheit aus, ließ aber keinen Zweifel, dass es keine<br />
anderen Optionen für den Orden gab: „Der Brief Euerer Eminenz<br />
hat mich bestürzt, ja er hat mich tief erschüttert, und<br />
nur mit Kummer gebe ich die Antwort zu Papier. ... Was mich<br />
schmerzt ist, daß gerade durch uns, Ihre Franziskanerinnen,<br />
Ihnen Leid bereitet wird. Was würde ich darum geben, wenn<br />
wir nicht so zu tun brauchten, Hochwürdigster Herr Kardinal.<br />
Aber es liegt ja schon nicht mehr in unserer Macht; die Verhältnisse<br />
des großen Düsseldorfer Hauses sind längst über<br />
unsere Kräfte hinausgewachsen. ... Nicht nur mir, nein ich darf<br />
sagen uns allen blutet das Herz ob dieser Tatsache“.<br />
Eine Woche später lenkte der Kölner Erzbischof<br />
in der Sache ein und entsprach dem Gesuch der<br />
Ordenskongregation. Am 14. Mai 1960 teilte er der<br />
Generaloberin mit: „Wenn mich auch Ihr<br />
Schreiben vom 5. Mai, wie Sie sich denken<br />
können, traurig stimmt, so kann ich doch<br />
nicht umhin, den Ernst Ihrer Situation und<br />
das Gewicht Ihrer Beweggründe anzuerkennen.<br />
Ich erteile Ihnen hiermit die Erlaubnis<br />
... den Vertrag mit dem Kuratorium des<br />
Marienhospitals in Düsseldorf zu kündigen,<br />
verbinde aber damit zwei herzliche Bitten,<br />
die ich zugleich zu Auflagen mache: 1.)<br />
In der Kündigung wollen Sie bitte dem<br />
Kuratorium mitteilen, dass Sie bereit seien,<br />
bis zum 30. Juni 1961 das Krankenhaus zu<br />
betreuen. Eine so lange Zeit ist erfahrungsgemäß<br />
notwendig, um die Umstellung zu<br />
vollziehen. 2.) Sie wollen bitte bis zum 30.<br />
Juni 1961 keine weiteren Schwestern aus<br />
dem Krankenhaus abziehen“.<br />
Genau ein Jahr vor dem Abzug wurde<br />
die Düsseldorfer Öffentlichkeit über die Absichten<br />
des Ordens unterrichtet. Das Bedauern<br />
über den Fortgang der Schwestern wie<br />
auch das Anerkennen ihrer aufopfernden<br />
Fürsorge in neun Jahrzehnten ging weit<br />
über den Kreis der Katholiken in der Stadt<br />
hinaus. Gleichzeitig richteten sich die Blicke<br />
auf die Zukunft des Krankenhauses. So<br />
schrieb die Rheinische Post am 1. Juli 1960:<br />
„Die Zeiten sind längst vorbei, in denen die<br />
konfessionellen Krankenhäuser nur von<br />
Angehörigen des gleichen Bekenntnisses<br />
belegt waren. Nicht nur die hervorragenden<br />
ärztlichen Kräfte, die von Anfang an den<br />
Ruf des Marienhospitals begründeten, auch<br />
die Fürsorge der opferwilligen Schwestern<br />
vom heiligen Franziskus hat das Haus berühmt<br />
gemacht. Ihr Scheiden, das wohl auf<br />
den Nachwuchsmangel zurückzuführen<br />
ist, der dem Orden die Betreuung eines so<br />
großen Hauses nicht mehr erlaubt, stellt<br />
für das mit städtischen Unterstützungen so<br />
kärglich bedachte Krankenhaus ein ernstes<br />
<strong>150</strong>
Endemie<br />
Problem dar. Doch besteht berechtigte<br />
Aussicht, einen Ausweg zu finden“.<br />
In der Tat fand sich schon bald eine Lösung.<br />
Als Ersatz für die Ordensschwestern<br />
konnten Caritasschwestern aus Köln für<br />
den Dienst am Marienhospital verpflichtet<br />
werden. Im Gegensatz zu Ordensschwestern<br />
gehörten Caritasschwestern dem<br />
weltlichen Stand an und waren keiner<br />
Kommunität angeschlossen.<br />
Die Ablösung der Franziskanerinnen<br />
durch weltliche Schwestern verlief geräuschlos<br />
und zügig. Dem ausdrücklichen<br />
Wunsch der Franziskanerinnen entsprechend<br />
wurde von einer offiziellen Abschiedsfeier<br />
Abstand genommen. In einem<br />
feierlichen Gottesdienst in der Kapelle<br />
des Marienhospitals, in dem noch einmal<br />
die Verdienste der Ordensgemeinschaft<br />
hervorgehoben wurden, nahmen am 30.<br />
Juni 1961 Vorstand, Verwaltungsrat und<br />
Mitarbeiter des Krankenhauses von den<br />
Schwestern Abschied. Am 1. Juli 1961<br />
traten 12 Kölner Caritasschwestern an die<br />
Stelle der Aachener Schervier-Schwestern<br />
und übernahmen zusammen mit 44 freien<br />
Schwestern den Pflege‐ und Wirtschaftsdienst<br />
wie auch die Krankenpflegeschule.<br />
Endemie<br />
Wegen einer Endemie, d.h. einer andauernd<br />
gehäuft auftretenden Krankheit,<br />
mussten die Kinder-, Isolier- und Teile der<br />
Inneren Abteilung im Marienhospital vom<br />
1. bis 28. Juli 1959 vollständig geschlossen<br />
werden. Der Einnahmeausfall für rund <strong>150</strong><br />
Betten und die Kosten für die Desinfektionsmaßnahmen<br />
wurden auf 400000 DM<br />
geschätzt. Eine zweite Infektion, die zu<br />
einer Aufnahmesperre vom 3. Oktober<br />
bis 31. Dezember 1960 führte, brachte erneut erhebliche<br />
Einnahmeausfälle. Das Krankenhaus geriet in eine finanzielle<br />
Schieflage, die so ernst war, dass das Marienhospital kurz<br />
vor der Insolvenz stand. Am 14. Januar 1961 konstatierte<br />
der Vorsitzende Matthias Junk in einer Vorstandssitzung:<br />
„Wir werden die Löhne und Gehälter zum Monatsende noch<br />
zahlen können, dann sind wir aber blank“. Eine Liquidation<br />
des Marienhospitals konnte nur durch Sonderzahlungen<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Düsseldorf<br />
abgewendet werden.<br />
Bei den Endemien handelte es sich um eine Salmonelleninfektion,<br />
eine Darmerkrankung, die seit Beginn der 1950er<br />
<strong>Jahre</strong> auch in anderen deutschen Städten auftrat. Der Erreger<br />
„Salmonella bareilly“, für Erwachsene meist harmlos, für<br />
Kleinkinder jedoch gefährlich, galt als „unangenehm zäh“.<br />
Er war erst in der Nachkriegszeit durch Lebensmittel nach<br />
Deutschland eingeschleppt worden und rief durchfallartige<br />
Erkrankungen hervor. Im Düsseldorfer Marienhospital war der<br />
Erreger bereits seit 1952 sporadisch aufgetreten, verursachte<br />
aber 1957 plötzlich eine schleppend verlaufende Endemie, die<br />
nach wenigen Wochen wieder erlosch. Vermutlich bewirkte<br />
ein „Zwischenglied“ im Krankenhausbereich, ein nicht entdeckter<br />
Keimträger, dass es im September 1958 von der Kinderabteilung<br />
ausgehend zu neuen Ansteckungen kam. Als im<br />
Juli 1959 mehrere Stationen des Marienhospitals vollständig<br />
geschlossen werden mussten, waren 157 Personen infiziert.<br />
Düsseldorfer Nachrichten,<br />
19. Dezember 1962<br />
Düsseldorfer Nachrichten,<br />
28. Juli 1959<br />
Matthias Junk,<br />
Vorstandsvorsitzender des<br />
Marienhospitals (1961-1970),<br />
um 1970<br />
151
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Mittag, 26. Oktober 1960<br />
Rheinische Post, 29. Oktober 1960<br />
Neue Rhein Zeitung,<br />
13. Dezember 1960<br />
Bei einer routinemäßigen Gesundheitskontrolle wurde 1960<br />
festgestellt, dass im Marienhospital erneut einige Krankenpfleger‐<br />
und Krankenpflegerinnen mit „Salmonella bareilly“<br />
infiziert waren, ohne erkrankt zu sein. Um einer Ausweitung<br />
der Neuinfektion rechtzeitig zu begegnen, wurde das<br />
infizierte Personal isoliert. Da der Mitarbeitermangel durch<br />
diese Vorsichtsmaßnahmen sich noch stärker bemerkbar<br />
machte, wurde die Aufnahmefähigkeit des Marienhospitals<br />
vorübergehend eingeschränkt. Im Verlauf der neuen Endemie<br />
gab es 121 Stuhlerkrankungen, von den 66 auf das Personal<br />
entfielen. Die eingeleiteten Hygienemaßnahmen griffen<br />
in kurzer Zeit; nach wenigen Wochen war die Infektion<br />
wieder vollständig abgeklungen. Das zählebige Bakterium<br />
war schnell verschwunden, der nicht zu unterschätzende<br />
Reputationsverlust für das Hospital indes blieb am Haus noch<br />
für längere Zeit haften.<br />
Befeuert wurde der Imageschaden von Berichten in der<br />
Düsseldorfer Tagespresse, in denen gravierende Bau- und<br />
Ausstattungsmängel des Marienhospitals offengelegt wurden.<br />
So war in der Rheinischen Post am 29. Oktober 1960 unter der<br />
Überschrift „Das Marienhospital wird geschlossen“ zu lesen:<br />
„Die seit 1956 wiederkehrende Salmonella-Infektion wurde<br />
wohl auch durch die Überalterung der baulichen Struktur im<br />
Marienhospital mit ineinandergeschachtelten<br />
Stationen begünstigt, die es schon<br />
1959 unmöglich machte, eine straffe Isolierung<br />
durchzuführen. ... 1959 sollen die<br />
Spülautomaten mit 80 Grad heißem Wasser<br />
gefehlt haben, die eine gute Desinfektion<br />
gesichert hätten. Es soll kein Geld für die<br />
Anschaffung dagewesen sein. Man half<br />
sich mit chemischer Desinfektion“.<br />
Der erneute Ausbruch einer Salmonella-Infektion<br />
hatte zur Folge, dass die Küchenverhältnisse<br />
im Marienhospital genau<br />
untersucht wurden und so katastrophale<br />
Missstände ans Licht traten. Auf der Vorstandssitzung<br />
vom 12. November 1960<br />
musste der stellvertretende Vorsitzende<br />
Matthias Junk mitteilen, dass der Küchenbetrieb<br />
„in keiner Weise den heutigen Anforderungen<br />
entspricht“ und „gegenüber<br />
der Steigerung der Bettenzahl zurückgeblieben<br />
ist“. Die Hauptküche hatte eine<br />
Kapazität von 400 bis 500 Essen, musste<br />
aber mehr als 1100 Personen versorgen.<br />
„Dadurch, daß verschiedene Speisen vorgekocht<br />
werden müssen, um überhaupt<br />
die Versorgung der Patienten und der<br />
Angestellten durchführen zu können“,<br />
so der Befund von Prof. Dr. Ludwig Grün<br />
vom Hygienischen Institut der Städtischen<br />
Krankenanstalten, „ist die Küche zum<br />
Verteiler der Infektion geworden“. Um<br />
die Essensausgabe für Patienten und Mitarbeiter<br />
sicherzustellen, wurde ein Zug der<br />
Bundeswehr angefordert und richtete für<br />
mehrere Wochen auf dem Gelände des<br />
Marienhospitals eine Notküche ein.<br />
Nachdem die Endemie im Dezember<br />
1960 vollständig abgeklungen war, wurde<br />
das Marienhospital am 1. Januar 1961 wieder<br />
mit neuen Patienten belegt. Allerdings<br />
war die Zahl der Betten in der Folgezeit<br />
drastisch reduziert. Standen 1959 noch<br />
152
Vom Generalbebauungsplan<br />
zum Neubauentwurf<br />
619 Betten zur Aufnahme von Patienten<br />
zur Verfügung, so war die Zahl seit der<br />
Wiederbelegung auf 116 Betten der dritten<br />
Klasse und 48 Betten der Privatstationen<br />
sowie 25 Betten der Kinderstation vermindert<br />
worden. Eine Belegung über diese Zahl<br />
hinaus war „wegen der Kapazität der Küche“<br />
nicht möglich. Der leitende Arzt war<br />
vom Vorstand ermächtigt worden, „das<br />
überflüssige Personal am 31. Dezember<br />
1960 zum nächst zulässigen Termin zu<br />
kündigen und jede Härte zu vermeiden“.<br />
Von den 462 Beschäftigten im Marienhospital<br />
verloren fast zwei Drittel ihren<br />
Arbeitsplatz, da die Zahl der Mitarbeiter<br />
auf 160 heruntergefahren werden musste.<br />
Vom<br />
Generalbebauungsplan<br />
zum Neubauentwurf<br />
Die Endemien gaben dem Neubaugedanken<br />
starken Auftrieb. Schon Ende der<br />
1950er <strong>Jahre</strong> war der Vorstand am 27.<br />
Oktober 1959 zu der Einsicht gelangt:<br />
„Vordringlich ist die Anfertigung eines<br />
Generalbebauungsplanes“. Den Kerngedanken<br />
aus dem „Generalaufbauplan“ von<br />
Baurat Peter Dierichsweiler aus dem <strong>Jahre</strong><br />
1953 aufgreifend, dem Marienhospital<br />
ein Bettenhochhaus anzugliedern, das an<br />
die Stelle veralteter und abzubrechender<br />
Gebäudeteile erbaut werden sollte, legte<br />
der Düsseldorfer Architekt Paul Steinebach<br />
im Januar 1960 einen neuen „Generalbebauungsplan“<br />
vor.<br />
Der Generalbebauungsplan sah vor,<br />
zuerst das Krankenhausgelände zu bereinigen.<br />
Die auf dem südlichen und westlichen<br />
Grundstück aufstehenden Nebengebäude und Anlagen<br />
sollten zusammen mit den südlichen Anbauten des Hauptgebäudes,<br />
in denen u.a. die Klausurräume der Ordensschwestern<br />
untergebracht waren, niedergelegt werden. Die gesamte<br />
Fläche, die durch den Abriss der An- und Nebenbauten<br />
entstand, sollte später als einheitliche Gartenfläche genutzt<br />
werden. Der Generalbebauungsplan war in folgende Bauabschnitte<br />
unterteilt:<br />
I. Bauabschnitt: Neubau der Kinderabteilung<br />
II. Bauabschnitt: Neubau des Küchenhauses<br />
III. Bauabschnitt: Neubau der Unfall- und Notfallabteilung<br />
und der Operationsräume<br />
IV. Bauabschnitt: Behelfsmäßige Umgestaltung durch<br />
Ausführung des I., II. und III. Bauabschnittes<br />
der freiwerdenden Räume<br />
zu Krankenzimmern<br />
V. Bauabschnitt: Niederlegung der zwei alten südlichen<br />
Gebäudeflügel<br />
VI. Bauabschnitt: Neubau des zehngeschossigen<br />
Bettenhauses<br />
Der von Paul Steinebach vorgelegte Generalbebauungsplan<br />
kam über das Stadium der Vorplanung nicht hinaus, da dem<br />
Entwurf sowohl vom Bauaufsichtsamt der Stadt wie auch vom<br />
Düsseldorfer Regierungspräsidenten wegen Nichteinhaltung<br />
der „Richtlinien über die bauaufsichtliche Behandlung von<br />
Hochhäusern“ die Genehmigung verweigert wurde. Die<br />
„Hochhaus-Richtlinien“ sahen vor, dass der Abstand eines<br />
Hochhauses von der Nachbarbebauung das Doppelte der<br />
Höhe des Hochhauses betragen muss, was bei dem über<br />
40 Meter hohen Bettenhochhaus vor allen Dingen zu den<br />
Häusern der Ehrenstraße nicht eingehalten werden konnte.<br />
Marienhospital,<br />
Neubauentwurf, 1960<br />
153
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Konstanty Gutschow (1902-1978)<br />
Konstanty Gutschow war als Architekt<br />
der „Führerstadtplanungen“ Hamburg<br />
bekannt. In den 1930er <strong>Jahre</strong>n hatte<br />
Konstanty Gutschow den Auftrag, an der<br />
Elbe ein „Gauforum“ mit Volkshalle und<br />
„Gauhaus“ als neues, die Macht der<br />
Nationalsozialisten repräsentierendes<br />
Zentrum zu errichten. 1945 erhielt<br />
Konstanty Gutschow für vier <strong>Jahre</strong> Bauverbot,<br />
konnte sich jedoch in den 1950er<br />
<strong>Jahre</strong>n vor allem als Krankenhausarchitekt<br />
wieder etablieren. Zusammen<br />
mit dem Hamburger Architekten Godber<br />
Nissen realisierte Konstanty Gutschow<br />
verschiedene Klinikbauten in Tübingen<br />
(Universitätsklinik), Hannover (Medizinische<br />
Hochschule), Helgoland (Klinik)<br />
und Düsseldorf (Chirurgische Klinik der<br />
Städtischen Krankenanstalten).<br />
Marienhospital,<br />
Neubauentwurf Lageplan, 1960<br />
Chirurgische Klinik der Städtischen<br />
Krankenanstalten, Moorenstraße 5,<br />
um 1960<br />
Da die Abstandsbestimmungen der Hochhaus-<br />
Richtlinien nicht dispensibel waren, mussten von<br />
Seiten des Marienhospitals neue Überlegungen<br />
angestellt werden. Im Sommer 1960 trat der Vorstandsvorsitzende<br />
Heinrich Dinkelbach mit dem<br />
Hamburger Architekten Konstanty Gutschow in<br />
Kontakt, der in den 1950er <strong>Jahre</strong>n als renommierter<br />
Krankenhausarchitekt galt.<br />
Noch im Herbst des gleichen <strong>Jahre</strong>s wurde<br />
Konstanty Gutschow beauftragt, Pläne zur „Errichtung<br />
eines katholischen Notfallkrankenhauses mit<br />
allerhöchstens 600 Betten“ zu entwerfen. In der<br />
Sitzung vom 17. Dezember 1960 stellte Konstanty<br />
Gutschow dem Vorstand sieben Varianten für<br />
einen vollständigen Neubau des Marienhospitals<br />
vor. Nachdem ein Fachgutachten des Deutschen<br />
Krankenhausinstituts auch zu dem Ergebnis gelangt<br />
war, dass ohne einen Neubau kein neuzeitlicher<br />
Krankenhausbetrieb am Marienhospital mehr möglich sei,<br />
führte der Vorstand am 29. April 1961 den hierzu erforderlichen<br />
Beschluss herbei. Auf einer Pressekonferenz gab<br />
der neu gewählte Vorstandsvorsitzende Matthias Junk am<br />
2. Juni 1961 seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Neubauplan<br />
„mit weitgehender Unterstützung des Landes und der Stadt<br />
in naher Zukunft“ verwirklicht werden kann, „damit das<br />
Marienhospital in einem neuen Gewand und nach den Erkenntnissen<br />
neuzeitlicher Medizin, die ihm von den Gründern<br />
der Stiftung vor nahezu 100 <strong>Jahre</strong>n auferlegten<br />
Aufgaben im Dienste der Kranken<br />
unserer Stadt durchführen kann“. Unter<br />
der Überschrift „Marienhospital völlig neu“<br />
berichtete die Rheinische Post am folgenden<br />
Tag, dass das Marienhospital in seiner<br />
fast 100jährigen Geschichte „an einem<br />
Wendepunkt“ angelangt sei. „Entscheidend<br />
für die Überlegungen der leitenden<br />
Kräfte des Marienhospitals sei gewesen“,<br />
so schrieb das Blatt weiter, „daß es an seinem<br />
alten angestammten Platz im Herzen<br />
des dichtbesiedelten Stadtteils Derendorf<br />
bestehenbleibe und entsprechend seiner<br />
Lage als ein Notfall- und Schwerpunktkrankenhaus<br />
ausgestattet werden soll. …<br />
Die Beschränkung auf ein Haus mit 450 bis<br />
500 Betten, lange Zeit waren 630 belegt,<br />
… stellt einen Fortschritt dar, der nach den<br />
allgemeinen Erfahrungen im Bau von Krankenhäusern<br />
angestrebt wird. In dieser Größenordnung<br />
ergeben sich die günstigsten<br />
medizinischen und betriebswirtschaftlichen<br />
Ergebnisse. Eine Aufteilung der Patienten in<br />
kleinere Pflegegruppen von etwa 12 bis 16<br />
Patienten, die medizinisch wünschenswert<br />
ist, erfordert auch eine neue Raumaufteilung,<br />
die in den Altbauten nicht möglich<br />
ist. Die Raumverschwendung der hohen<br />
Zimmer, der Flure, Treppenaufgänge usw.<br />
ist zudem wirtschaftlich nicht vertretbar.<br />
Übersichtliche gepflegte Unterbringung<br />
und Versorgung der Patienten, ferner modernste<br />
diagnostische und therapeutische<br />
Möglichkeiten – das gilt es zu beachten“.<br />
Optimistisch hatte Matthias Junk auf<br />
der Pressekonferenz verkündet, die gesamte<br />
Planungsarbeit solle in einem Jahr<br />
bewältigt und der Neubau in drei <strong>Jahre</strong>n<br />
fertig gestellt sein. Die Frage, ob der Neubau<br />
bei laufendem Betrieb oder nach einer<br />
vollständigen Schließung errichtet werden<br />
154
Vom Generalbebauungsplan<br />
zum Neubauentwurf<br />
soll, wurde vom Vorstand am 11. November<br />
1961 entschieden. Aufgrund der Empfehlung<br />
einer vom Vorstand eingesetzten<br />
„Sparkommission“, die „nach eingehender<br />
Überlegung und Besprechung … zu dem<br />
Ergebnis“ kam, dass ab dem 1. Januar 1962<br />
das Marienhospital „als Übergangs- und<br />
Notfallkrankenhaus weitergeführt werden<br />
soll“, schlug der Vorsitzende Matthias Junk<br />
„gegenüber Überlegungen seitens staatlicher<br />
Stellen, die alten Gebäude möglichst<br />
bald abzureißen und neu zu bauen, und<br />
das Marienhospital während der Bauzeit zu<br />
schließen“, dem Vorstand vor, „unter allen<br />
Umständen die Fortführung des Marienhospitals<br />
mit einer Höchstbettenkapazität<br />
von 200 Betten auch während der Bauzeit<br />
fortzuführen“. Als Gründe führte er an,<br />
„die Stadt Düsseldorf sei außerordentlich<br />
daran interessiert, dass auch während der<br />
Bauzeit 200 Betten im Zentrum der Stadt<br />
erhalten bleiben“ und „die Öffentlichkeit<br />
würde es nicht verstehen, wenn das Marienhospital<br />
für <strong>Jahre</strong> geschlossen würde“.<br />
Dem Votum des Vorsitzenden schlossen<br />
sich alle Mitglieder des Vorstandes an.<br />
Unmittelbar nach dem Vorstandsbeschluss<br />
legte Konstanty Gutschow den<br />
Umbauplan für ein „Notfall-Übergangskrankenhaus“<br />
für 180 bis 200 Betten vor,<br />
das im Mittel‐ und Nordteil des Ostflügels<br />
vom alten Haupthaus und im Bettenhaus<br />
Ost, das auch nach der vollständigen Neugestaltung<br />
erhalten blieb, untergebracht<br />
werden sollte. Am 1. Januar 1963 – ein Jahr<br />
später als geplant – nahm das „Notfall- und<br />
Übergangskrankenhaus“ am Marienhospital<br />
den Betrieb mit 236 Betten auf, die sich<br />
auf fünf Stationen verteilten: Chirurgische<br />
Abteilung, Innere Abteilung, Gynäkologische<br />
Abteilung, Augenabteilung, Hals-<br />
Nasen‐Ohren‐Abteilung.<br />
Das Übergangskrankenhaus<br />
war Teil der Um- und Neubaupläne<br />
des Marienhospitals, die<br />
Konstanty Gutschow im Februar<br />
1962 den staatlichen<br />
Aufsichtsbehörden zur Prüfung<br />
vorlegte. In einem angehängten<br />
„Erläuterungsbericht“<br />
erklärte der Hamburger<br />
Architekt: „Die vorhandenen<br />
Gebäude des Krankenhauses<br />
sollen wegen Überalterung<br />
zum größten Teil abgerissen<br />
und durch einen Neubau ersetzt<br />
werden. Lediglich die<br />
neueren Bauteile im Nordosten<br />
des Krankenhausgeländes –<br />
Bettenhaus Ost, Heizzentrale<br />
und Schwesternwohnheim<br />
– bleiben erhalten und werden<br />
dem künftigen Neubau<br />
angeschlossen. Während der<br />
Durchführung des Abrisses<br />
und der Neubauten muß ein<br />
Betrieb in beschränktem aber<br />
voll funktionsfähigem Umfang<br />
als Übergangs- und Notfall-<br />
Krankenhaus jeweils solange<br />
aufrecht erhalten werden, bis<br />
die entsprechenden Neubauteile in Benutzung genommen<br />
werden können. Aus diesem Grunde ist sowohl der Abriss<br />
wie der Neubau in zwei zeitlich getrennten Abschnitten vorgesehen.<br />
... Im 1. Abschnitt werden abgerissen: Vom alten<br />
Hauptbau: Mittel‐ und Westflügel vollständig, einschließlich<br />
Kapelle sowie Südteil des Ostflügels, altes Heizhaus einschließlich<br />
Schornstein, verschiedene kleine Schuppen und provisorische<br />
Behelfsbauten. Nach Fertigstellung und Bezug des 1.<br />
Neubauteiles werden im 2. Abschnitt abgerissen: Restlicher<br />
alter Hauptbau: Mittel‐ und Nordteil des Ostflügels, Verbindungsbau<br />
zwischen altem Hauptbau und Bettenhaus Ost. ...<br />
Nach Abbruch des 1. Altbauteiles sollen im 1. Bauabschnitt<br />
neu errichtet werden: das gesamte Bettenhaus, etwa ¾ des<br />
Marienhospital,<br />
Betriebsbeschreibung für das<br />
Übergangskrankenhaus, 1962<br />
155
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Übergangskrankenhaus Lageplan, 1964<br />
Marienhospital, Übergangskrankenhaus, 1963<br />
Behandlungsteiles, die gesamten<br />
Wirtschaftsteile. Mit Fertigstellung<br />
dieser Bauten wird der Neubau in<br />
sich voll funktionsfähig sein. Nach<br />
Abbruch des 2. Altbauteiles werden<br />
im 2. Bauabschnitt neu errichtet: die<br />
Krankenhauskapelle, der restliche<br />
Behandlungsteil, die Verbindung zwischen<br />
Neubau und Bettenhaus Ost.<br />
... Das alte Marienhospital umfasste<br />
als allgemeines Krankenhaus sieben<br />
Fachabteilungen mit zusammen 630<br />
Betten. Der Neubau soll auf Grund<br />
der Verhandlungen mit der Landesregierung,<br />
dem Regierungspräsidenten<br />
und der Stadtverwaltung als Schwerpunkt-<br />
und Notfallkrankenhaus mit<br />
zusammen etwa 470 Betten ausgebildet<br />
werden. ... Auf die ursprünglich<br />
geplante Kinderklinik sowie auf<br />
eine besondere Infektionsabteilung<br />
wird verzichtet“.<br />
Der Neubau<br />
Um die Finanzierung des projektierten<br />
Neubaues sicherzustellen, mussten die<br />
Mitglieder des Vorstands und des Kuratoriums<br />
ihr gesamtes politisches Netzwerk<br />
mobilisieren. Wegen der angespannten<br />
Finanzlage des Marienhospitals war zu Beginn<br />
der 1960er <strong>Jahre</strong> an die Ausführung<br />
des geplanten Neubauvorhabens zunächst<br />
gar nicht zu denken. Obwohl das „Notfallund<br />
Übergangskrankenhaus“ ständig bis<br />
zu 95 Prozent belegt war, benötigte das<br />
Marienhospital von der Stadt Düsseldorf<br />
weiterhin einen sechsstelligen Betriebskostenzuschuss.<br />
Auf einer Pressekonferenz erläuterte<br />
der Vorstandsvorsitzende Matthias<br />
Junk am 25. März 1963 die Ursachen der<br />
wirtschaftlichen Miesere so: „Das Hospital,<br />
das nach dem Kriege zu schnell auf<br />
die Kapazität von 630 Betten gebracht<br />
worden war, mußte, nachdem man sich<br />
zu Umbau und Neuordnung entschlossen<br />
hatte, auf 200 Betten reduziert werden.<br />
Also ein Einnahmeschwund. Gleichzeitig<br />
liefen die Personalkosten (Kündigungsfristen)<br />
weiter, mußte 1962 in acht Monaten<br />
das Übergangskrankenhaus aus den alten<br />
Bauteilen zusammengestellt werden (während<br />
gleichzeitig der Krankenhausbetrieb<br />
weiterging), wurden Neueinrichtungen geschaffen“.<br />
Der Vorsitzende musste zugeben,<br />
dass die Aufsichtsgremien nicht alle Kosten<br />
überblickten und der Krankenhausbetrieb<br />
mehr Geld als vermutet erforderte. Besonders<br />
gravierend war das Missverhältnis<br />
zwischen der Bettenzahl und den Krankenhauskräften.<br />
Für die rund 230 Betten<br />
des Übergangs- und Notfallkrankenhauses<br />
waren 187 festangestellte Kräfte eingesetzt.<br />
Trotz personeller Überbesetzung empfahl<br />
156
Der Neubau<br />
1963 der Finanzausschuss dem Rat der Stadt<br />
Düsseldorf, dem „finanzkranken Marienhospital“<br />
ein zinsloses Darlehen in Höhe von<br />
300000 Mark zur Deckung des vorjährigen<br />
Betriebsverlustes zu gewähren. Nicht zuletzt<br />
der Fürsprache von Oberbürgermeister Peter<br />
Müller, der wiederholt betont hatte, dass die<br />
Organe des Krankenhauses bemüht seien,<br />
„bald zu geordneten Verhältnissen in der<br />
Wirtschaftsführung zu kommen“, folgte der<br />
Rat den Empfehlungen des Finanzausschusses<br />
und bewilligte dem „Finanzsorgenkind<br />
der Stadt Düsseldorf“ – wie der Mittag das<br />
Marienhospital nannte – den beantragten<br />
Finanzzuschuss.<br />
Die „ständige Nachfüllung der Marienhospital-Kassen“<br />
war unter den Düsseldorfer<br />
Stadtverordneten nicht unumstritten.<br />
So sprach sich etwa Ratsherr Hans Bender<br />
(SPD) dafür aus, „das Marienhospital als<br />
städtisches Krankenhaus zu übernehmen“.<br />
Obwohl der Rückhalt für das „kranke Krankenhaus“<br />
in der Politik zu bröckeln drohte,<br />
gelang es dem Vorstand, das Marienhospital<br />
in das Krankenhausförderungsprogramm<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen einzubinden.<br />
Mitentscheidend für die Aufnahme<br />
in das Landesprogramm war die zentrale<br />
Lage des Marienhospitals. In Übereinstimmung<br />
mit der vom Land geforderten Generalplanung<br />
für das Krankenhauswesen<br />
war in Düsseldorf „zur Versorgung akuter<br />
Krankheitsprozesse“ die Einrichtung mehrerer<br />
„Schwerpunkt-Notfallkrankenhäuser“<br />
vorgesehen, die sich in der medizinischen<br />
Versorgung gegenseitig ergänzen sollten.<br />
„Das Marienhospital wird sich als besonders<br />
günstig liegendes Schwerpunkt-Notfallkrankenhaus“,<br />
so die Prognose der Rheinischen<br />
Post vom 30. März 1962, „künftig den akuten,<br />
bedrohlichen Erkrankungen widmen:<br />
dem Bürger, der einen Herzinfarkt erleidet,<br />
einer Frau mit Blutungen oder einem Schwerverletzten zum<br />
Beispiel, die rasch und nach den modernsten Erkenntnissen<br />
der Medizin versorgt werden müssen“.<br />
Als das Marienhospital im Herbst 1964 vom Land die<br />
grundsätzliche Zusage der Förderungswürdigkeit erhalten<br />
hatte, war eine entscheidende Hürde für den Bau eines neuen<br />
„Schwerpunkt-Notfall-Krankenhauses“ für den Düsseldorfer<br />
Norden genommen. Von<br />
den kalkulierten Baukosten<br />
wurden zunächst 34,7 Millionen<br />
DM als förderungsfähig<br />
anerkannt. An der Aufbringung<br />
der Finanzmittel<br />
beteiligte sich das Land mit<br />
24,3 Millionen DM, die Stadt<br />
Düsseldorf mit 6,9 Millionen<br />
DM und die Stiftung als<br />
Krankenhausträgerin durch<br />
Aufnahme einer Anleihe mit<br />
3,47 Millionen DM.<br />
Mit Sicherstellung der<br />
Finanzzuschüsse und nach<br />
Abstimmung der Planungs-<br />
2<br />
1<br />
1 Ärztehaus<br />
2 Zentralaufnahme<br />
3 Behandlungsbau<br />
3<br />
4<br />
4 Bettenbau West<br />
5 Bettenbau Ost<br />
6 Krankenpflegeschule<br />
Marienhospital,<br />
Neubau Raumverteilung, 1965<br />
Marienhospital,<br />
Modell für den Neubau, um 1965<br />
6<br />
5<br />
7<br />
8<br />
7 Schwesternbau<br />
8 Wohnheim für Schwestern<br />
und Bedienstete<br />
157
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
grundlagen mit dem kommunalen Krankenhausprogramm<br />
konnte Mitte der 1960er <strong>Jahre</strong><br />
der Bau eines neuen Krankenhauses in Pempelfort<br />
in Angriff genommen werden. Im Sommer<br />
1965 begann der Abriss der alten Krankenhausgebäude.<br />
Auf Wunsch der Bauherren wurde das<br />
alte Hospital nicht „Stein für Stein“ abgetragen,<br />
sondern gesprengt. „Das monatelange Höllenkonzert<br />
der Preßlufthämmer wäre den Patienten<br />
im Übergangskrankenhaus und der Umgebung<br />
nicht zuzumuten“, gab der Vorstand als Begründung<br />
für das nicht ungefährliche Vorgehen an.<br />
Während der dreimonatigen<br />
Abbruchphase blieb das Übergangskrankenhaus<br />
mit seinen rund<br />
230 Betten voll in Betrieb. Nachdem<br />
die Kapelle am Westflügel<br />
von einem Bagger niedergelegt<br />
worden war, folgte am 21. August<br />
1965 die erste Sprengung.<br />
An 850 Stellen wurden die Fundamente<br />
im Südwestflügel angebohrt<br />
und 80 Kilogramm Ammongelit-<br />
Sprengstoff angebracht. Unter der<br />
Überschrift „Als wäre eine Bombe<br />
eingeschlagen“ berichteten die<br />
„Düsseldorfer Nachrichten“ über das von<br />
zahreichen Schaulustigen beobachtete Ereignis:<br />
„Ein Teil des alten Marienhospitals<br />
an der Sternstraße hat sich ... in einen<br />
Trümmerhaufen verwandelt. Um 9.32 Uhr<br />
ließ eine Detonation, die einige Phon lauter<br />
war als der vom Vorstand vorausgesagte<br />
‚Dumpfe Knall’, die Umgebung erzittern.<br />
Sekundenlang hörte man das Gepolter<br />
berstender und einstürzender Mauern. Wer<br />
einen guten Platz gewählt hatte ..., erlebte<br />
den Bruchteil eines Augenblicks, da der<br />
rechte Flügel des Krankenhauses wankte<br />
und zusammenbrach. Dann verschluckte<br />
eine riesige beige-graue Staubwolke, gegen<br />
die der berüchtigte Londoner Smog ein<br />
erbärmliches Nebelchen ist, die Überreste<br />
des Gebäudes und die angrenzenden Straßen.<br />
... Als sich die Wolke auflöste, war ein<br />
gutes Drittel des altehrwürdigen Bauwerks<br />
verschwunden. Das Bild erinnerte an die<br />
schrecklichen Kriegsjahre. Es sah aus, als<br />
wäre eine Bombe eingeschlagen“. Nach<br />
dem gleichen Verfahren wurden am 4.<br />
September 1965 die übrigen Teile des Altbaues,<br />
darunter auch der 40 Meter hohe<br />
Schornstein des Kesselhauses, gesprengt.<br />
Vom ursprünglichen Marienhospital war<br />
nun nur noch der ältere Teil des Übergangskrankenhauses<br />
erhalten geblieben, der erst<br />
zu Beginn des zweiten Neubauabschnittes<br />
abgetragen wurde.<br />
Die Beseitigung des Trümmerschuttes<br />
und die Vorbereitung der Baustelle zur<br />
Marienhospital, Erste Sprengung, 1965<br />
Marienhospital, Zweite Sprengung, 1965<br />
Marienhospital, Zweite Sprengung, 1965<br />
Krankenhaus Gerresheim,<br />
Gräulinger Straße 120, 1971<br />
Das Jahr 1966 war in Düsseldorf das Jahr des Krankenhausneubaues.<br />
Neben dem Marienhospital wurden in<br />
diesem Jahr zeitgleich das Evangelische Krankenhaus<br />
am Fürstenwall, das Dominikuskrankenhaus in Heerdt,<br />
das Diakonissenkrankenhaus in Kaiserswerth, das<br />
Vinzenzkrankenhaus in Derendorf und das Städtische<br />
Krankenhaus in Gerresheim neu gebaut.<br />
158
Der Neubau<br />
Errichtung des ersten Bauabschnittes erstreckten<br />
sich über mehrere Monate. Erst<br />
im Herbst 1966 waren die Ausschachtungsarbeiten<br />
beendet und hatten die Rohbauarbeiten<br />
begonnen.<br />
Sieben <strong>Jahre</strong> nach den ersten Planungsüberlegungen<br />
konnte am 8. Dezember 1966<br />
im Winkel von Stern- und Rochusstraße der<br />
Grundstein für das neue Marienhospital<br />
gelegt werden. Prominente Vertreter von<br />
Kirche, Land, Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft<br />
hatten sich nach einem Gottesdienst<br />
in St. Rochus bei schneidender Kälte an der<br />
festlich geschmückten Baugrube versammelt,<br />
um gemeinsam den Beginn einer neuen<br />
Ära für das Marienhospital zu feiern. Nach<br />
der Segnung des Grundsteins durch den<br />
Kölner Generalvikar Hermann Jansen rief<br />
der Vorstandsvorsitzende Matthias Junk zu<br />
den obligatorischen Hammerschlägen mit<br />
erhobener Stimme: „Möge das neue Krankenhaus<br />
ein Hort der Freiheit, des Friedens<br />
und der christlichen Nächstenliebe sein“.<br />
Die Zeremonie beendete der Vorsitzende mit<br />
dem Ausruf: „Auf daß die Finanzierungsquellen<br />
nie versiegen!“ Das Echo auf den<br />
Herzenswunsch kam schneller als erwartet.<br />
Der Düsseldorfer Regierungspräsident Kurt<br />
Baurichter teilte, als er zum Hammer griff, mit,<br />
dass die Landesregierung genau an diesem<br />
Morgen dem Marienhospital 687000 DM zur<br />
Schuldentilgung bewilligt habe. Nach dem<br />
Choral „Großer Gott, wir loben dich“ zog<br />
die Festversammlung zum Empfang in die<br />
Kultur‐ und Jugendfilmbühne (Prinz‐Georg‐<br />
Straße 80) hinüber, wo Konstanty Gutschow<br />
„an Hand reizvoller Dias“ die Entwicklung<br />
des alten und des neuen Hospitals schilderte,<br />
das – so der planende Architekt – „kein<br />
sensationelles Novum auf dem Gebiet des<br />
Krankenhauswesens, aber ein gebrauchsfähiger<br />
und wirtschaftlicher Bau“ sei.<br />
Von Tag zu Tag war zu beobachten,<br />
wie der Neubau<br />
des Marienhospitals in die<br />
Höhe wuchs. Angetrieben<br />
von den Baufortschritten<br />
auf den anderen Krankenhausbaustellen<br />
in der<br />
Stadt, legten die Arbeiter<br />
in Pempelfort ein „tolles<br />
Tempo“ vor, mit dem Ergebnis,<br />
dass das Richtfest zwei<br />
Monate früher als geplant<br />
stattfand. Nur acht Monate<br />
nach der Grundsteinlegung<br />
wurde am 27. Juli 1967 im<br />
Beisein zahlreicher Ehrengäste<br />
das Richtfest für den<br />
ersten Bauabschnitt des<br />
neuen Marienhospitals gefeiert.<br />
Architekt Konstanty<br />
Gutschow sprach den<br />
Bauleuten ein großes Lob<br />
aus: „In meiner 40jährigen<br />
Praxis habe ich noch nicht<br />
erlebt, daß ein Bauwerk so<br />
rasch emporwächst!“ Nicht<br />
ohne Stolz erläuterte der<br />
Marienhospital,<br />
Grundsteinlegung Neubau, 1966<br />
Marienhospital, Richtfest Neubau, 1967<br />
Marienhospital, Richtfest Neubau, 1967<br />
Marienhospital, Neubau, um 1967<br />
159
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Hausgeistliche im Marienhospital<br />
1871-1970<br />
· Kaplan Arnold Hubert Lofgnié (1871-1900)<br />
· Kaplan Joseph Scholl (1900-1903)<br />
· Kaplan Georg Rody (1903-1905)<br />
· Kaplan Klemens Wirtz (1905-1909)<br />
· Pater Sixtus Meyer SSCC (1909-1918)<br />
· Pater Adalarius Thomas OFM (1918-1919)<br />
· Pater Bertold Bockholt OFM (1919-1922)<br />
· Pater Optatus Benteler OFM (1922-1922)<br />
· Pater Hyginus Frenz OFM (1922-1925)<br />
· Pfarrer Heinrich Hamacher (1925-1935)<br />
· Pfarrer Karl Tholen (1936-1958)<br />
· Pater Reinulf Hoersch OFM (1958-1961)<br />
· Pater Irenäus Kremser OFM (1961)<br />
· Rektor Franz Hampel (1961-1964)<br />
· Pater Kurt Leunissen OFM (1964-1966)<br />
· Pater Leo Jamar SCJ (1967-1970)<br />
· Pfarrer Helmut Münz (1970-1972)<br />
Marienhospital, Neubau, 1967<br />
Marienhospital, Kapelle, um 1970<br />
Vorstandsvorsitzende Matthias Junk, dass mit dem<br />
Bettenbau West und Ost wie dem Behandlungstrakt<br />
bereits 75 Prozent des gesamten Bauvorhabens im Rohbau<br />
vollendet waren. In 22000 Arbeitsstunden waren<br />
76300 Kubikmeter umbauter Raum geschaffen worden.<br />
Leise ließ Matthias Junk, der zu Recht als „Motor des<br />
Krankenhausneubaues“ bezeichnet wurde, in seiner<br />
Richtfestansprache die Frage anklingen,<br />
ob das Land seine Finanzierungszusagen<br />
für das Marienhospital auch einhalten<br />
könne. Seine Sorge verflog spätestens<br />
beim Richtschmaus im Dieterich-Bierkeller<br />
(Duisburger Straße 18), wo Staatssekretär<br />
Karl Hölscher als Vertreter des<br />
Arbeits- und Sozialministeriums erklärte:<br />
„Trotz der Mittelverknappung hat der<br />
Regierungspräsident eine weitere Rate<br />
von 5,5 Millionen Mark für den Bau des<br />
Marienhospitals für 1967 bewilligt“.<br />
Ein Jahr nach der Grundsteinlegung<br />
wurde im Sommer 1968 mit den Innenputz-<br />
und Fliesenarbeiten begonnen. Die<br />
Rohrpostanlage und die Heizung waren<br />
bereits verlegt, die sanitären, medizinischen<br />
und elektrischen Installationen<br />
waren im vollen Gang. Für die aus Mitteln<br />
des Erzbistums Köln finanzierte Kapelle<br />
wurde am 12. Juni 1968 der Grundstein<br />
gelegt. Das neue Gotteshaus war als<br />
Rundbau konzipiert und so angelegt,<br />
dass auch Patientenbetten in den Sakralraum<br />
gefahren werden konnten. Im<br />
Dachreiter der neuen Kapelle, die beiden<br />
Konfessionen als Gottesdienststätte dient,<br />
wurde die Glocke der alten Krankenhauskapelle<br />
aufgehängt. Wenige Tage vor der<br />
Einweihung des neuen Marienhospitals<br />
konsekrierte Kardinal Josef Höffner am<br />
24. Mai 1970 den Altar in der neuen<br />
Kapelle, feierte hier das erste Messopfer<br />
und segnete anschließend das neue<br />
Krankenhaus ein.<br />
Fast auf den Tag genau 100 <strong>Jahre</strong><br />
nach der Eröffnung des Marienhospitals<br />
wurde der Pempelforter Krankenhausneubau<br />
am 1. Juni 1970 feierlich eingeweiht.<br />
Unter der Überschrift „Im Mittelpunkt<br />
steht der Patient“ berichteten die<br />
Düsseldorfer Nachrichten am folgenden<br />
160
Der Neubau<br />
Tag: „Mehrere hundert Gäste aus Politik,<br />
Kirche, Diplomatie, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft<br />
und anderen Bereichen hatten<br />
sich vor der alten Mutter-Gottes-Statue in<br />
der langen Eingangshalle des modernen<br />
Hauses versammelt, unter ihnen Kardinal<br />
Frings, Ministerpräsident Kühn, Landtags-<br />
Vizepräsident Dr. Fehlinghaus, Bauminister<br />
Dr. Kohlhase, die Bürgermeister Kürten und<br />
Deimel, Medizin-Professoren aus Düsseldorf,<br />
Köln und München und die früheren<br />
Marien-Hospital-Chefärzte Prof. Hünermann,<br />
Dr. Etten und Dr. Pfeffer. Seinen<br />
Dank an Kirche, Land und Stadt für ihre<br />
kräftige finanzielle Hilfe verband Matthias<br />
Junk, der Vorsitzende des Vorstandes und<br />
des Verwaltungsrates, mit einem Hinweis<br />
auf die sparsame Wirtschaftsführung beim<br />
Bau seines Hospitals: Die 3,5 prozentige<br />
Kostensteigerung in dreieinhalb <strong>Jahre</strong>n<br />
steht in der Tat in wohltuendem Gegensatz<br />
zu den enormen Mehrkosten bei vielen öffentlichen<br />
Bauten. Daß von den 462 Betten<br />
vorerst nur 298 belegt werden können,<br />
liegt an der Personalfrage und wird sich<br />
ändern, wenn zum <strong>Jahre</strong>swechsel ein weiteres<br />
Schwesternwohnheim bezugsfertig<br />
ist. Pläne für ... die Einführung von Ein- und<br />
Zweit-Bett-Zimmern auch in der Gemeinschaftsklasse<br />
und die tägliche Besuchszeit<br />
zeigen, daß das Hospital, dessen Neubau<br />
einschließlich beweglicher Einrichtung und<br />
des bevorstehenden zweiten Abschnittes<br />
voraussichtlich 42,5 Millionen DM kosten<br />
wird, mit der Zeit zu gehen versucht. Josef<br />
Kardinal Frings war von Köln herübergekommen,<br />
um ... das Marien-Hospital ...<br />
‚in das zweite Jahrhundert zu führen’. ...<br />
Ministerpräsident Heinz Kühn ... umriß die<br />
Ziele der Krankenhauspolitik des Landes:<br />
Förderung des Zusammenschlusses kleinerer<br />
Häuser zu Krankenhausgemeinschaften,<br />
Realisierung der Pläne um<br />
das klassenlose Krankenhaus,<br />
in dem alle Patienten<br />
in jeder Beziehung<br />
gleichgestellt sind, die Intensivierung<br />
der Krankenhausforschung,<br />
Bau von<br />
Spezialkrankenhäusern,<br />
Hilfe für die Herzchirurgie<br />
und vermehrte Prophylaxe<br />
– der nächste Schritt<br />
sei hier die Krebs-Vorsorge-Untersuchung bei Männern. ...<br />
Chefchirurg Dr. Bross erläuterte die neuartige medizinische<br />
Struktur des Hauses, in dem der Funktionsbereich sehr viel<br />
Platz einnimmt. Erstmals sei es gelungen, ein Hospital zu<br />
schaffen, dessen Diagnose- und Behandlungsräume weit<br />
über die Hälfte des Baues umfaßten“.<br />
Nach der Einweihung konnte das neue Marienhospital<br />
im Rahmen einer „Woche der offenen Tür“ von den Bürgern<br />
besichtigt werden. Erst danach wurden die Patienten aus<br />
dem Übergangskrankenhaus in die neuen Bettenhäuser<br />
verlegt. Der Neubau, dessen Haupteingang nicht mehr an der<br />
Stern- sondern an der Rochusstraße lag und der „nur noch<br />
hauptamtliche Abteilungen und keine Belegbetten mehr“<br />
kannte, zählte 462 Betten:<br />
Chirurgie und Unfall 142;<br />
Innere Medizin 116; Geburtshilfe<br />
und Gynäkologie<br />
78; Augenabteilung 44;<br />
Neurologie 36; Röntgen,<br />
Anästhesie, Urologie 36;<br />
Aufnahmeabteilung 10.<br />
Die medizinischen Funktionsbereiche<br />
des neuen<br />
Hospitals waren in drei<br />
separate Versorgungsbereiche<br />
gegliedert, standen<br />
aber in enger Verbindung<br />
untereinander und ermöglichten<br />
so ein direktes Zusammenwirken<br />
aller Abteilungen.<br />
Marienhospital,<br />
Einweihung Neubau, 1970<br />
Erste Reihe von rechts:<br />
Bauminister Dr. Kohlhase,<br />
Ministerpräsident Kühn,<br />
Vorsitzender Junk, Kardinal Frings,<br />
Landtags-Vizepräsident Dr. Flehinghaus<br />
und Bürgermeister Kürten<br />
Marienhospital,<br />
Neubau Lageplan, 1970<br />
161
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Dr. Heinrich Bross, Die Aufgaben des Marien-Hospitals und seine neue Struktur nach 100 <strong>Jahre</strong>n, 1970 (Auszug):<br />
1. Notfallbereich: Zu ebener Erde ist für<br />
Notfälle aus dem chirurgischen, insbesondere<br />
auch unfallchirurgischen, dem internistischen<br />
(Infarktpatienten, Vergiftungen)<br />
und dem geburtshilflich‐gynäkologischen<br />
Bereich mit allen Einrichtungen eine allgemeine<br />
Notfallzone geschaffen worden. Über<br />
eine zentrale Krankenaufnahme, die einen<br />
sofortigen Kontakt des eingelieferten Patienten<br />
zum ärztlichen Aufnahmedienst des<br />
Hauses herstellt, werden die notwendigen<br />
Sofortversorgungen eingeleitet und die Weiterleitung<br />
der Patienten an die zuständigen<br />
Stationen zur Vermeidung von Fehlleitungen<br />
und Umlegungen veranlaßt.<br />
In der Notfallzone ist eine Operationsanlage<br />
für alle akuten Eingriffe eingerichtet<br />
worden. Schockbekämpfung, Wiederbelegung<br />
sowie die Überwachung frischoperierter<br />
Patienten sind sichergestellt. Für die<br />
Notfallaufnahmen steht für die Nacht eine<br />
Notfallaufnahmestation von 10 Betten zur<br />
Verfügung. Dadurch wird eine Beunruhigung<br />
der stationären Bereiche durch nächtliche<br />
Aufnahmen oder Verlegungen vermieden<br />
und eine ständige Aufnahmebereitschaft des<br />
Hause in der Nacht gewährleistet.<br />
Die Unfallchirurgie ist für die Anwendung<br />
aller neuen Operationsverfahren eingerichtet,<br />
insbesondere für die operative<br />
Knochenbruchbehandlung, die Handchirurgie<br />
und für die allgemeine Wundversorgung.<br />
Ihr steht eine eigene Röntgendiagnostik<br />
mit der neuesten Bildverstärkertechnik zur<br />
Überprüfung des gesamten Skelettsystems<br />
vor allem bei schweren Unfällen und Massenverletzungen<br />
zur Verfügung.<br />
2. Operationsbereich: Er faßt die chirurgische<br />
Behandlung aus der Bauch- und Thoraxchirurgie,<br />
die geburtshilflich‐gynäkologischen<br />
Operationen und die ophthalmolatogischen<br />
Operationen in einem zentralen aseptischen<br />
Operationsbereich zusammen. Damit ist<br />
nicht nur die Zentralisation der technischen<br />
Einrichtungen im vorwiegend aseptischen<br />
Operationsbereich erreicht, sondern auch<br />
der zentrale Einsatz der Operationsdienste,<br />
besonders der Schwestern und Ärzte, ermöglicht<br />
und die kostspielige Dezentralisation<br />
früherer Zeiten überwunden.<br />
Dem zentralen aseptischen Operationsbereich<br />
mit 4 Operationssälen und 5 auswechselbaren<br />
Tischen ist die Anästhesieabteilung<br />
zugeordnet. Ihr steht ein Aufwachraum<br />
zur Verfügung, der in direkter Verbindung<br />
mit der Operationsabteilung steht und eine<br />
fachärztliche Überwachung der Operierten<br />
ermöglicht, bis sie in die Obhut der Stationen<br />
übergeben werden können.<br />
Zur Sicherung der zentralen aseptischen<br />
Operationsabteilung, insbesondere zur Vermeidung<br />
der Keimverschleppung (Hospitalismus),<br />
wurden alle septischen Operationen<br />
aus den drei großen Arbeitsgebieten räumlich<br />
und personell völlig von der aseptischen Operationsabteilung<br />
getrennt in einem septischen<br />
Operationsbereich im Erdgeschoß auf der<br />
Ebene der Notfallzone untergebracht.<br />
3. Intern-konservativer Bereich: Er umfaßt<br />
die Arbeitsgebiete der inneren Medizin,<br />
der Neurologie, der Röntgenologie und<br />
nach Fertigstellung des II. Bauabschnittes<br />
der Nuklearmedizin mit Isotopendiagnostik<br />
und Hartstrahlbehandlungsanlage. Damit<br />
sind insbesondere für das große Gebiet der<br />
Tumordiagnostik und -therapie die notwendigen<br />
Voraussetzungen geschaffen.<br />
Eine mit allen neuzeitlichen Einrichtungen<br />
versehene zentrale Röntgendiagnostik<br />
und ein modernes Zentrallaboratorium für<br />
die Anforderungen des gesamten Hauses<br />
sowie ein Blutdepot, zugleich für alle Innenstadtkrankenhäuser,<br />
sind dem internkonservativen<br />
Bereich zugeordnet.<br />
Der inneren Abteilung stehen 4 künstliche<br />
Nieren zur Verfügung.<br />
Bettenbau und sonstige Einrichtungen:<br />
Der Bettenbau ist nach Stationen mit 34 und<br />
30 Betten gegliedert. Es sind 1-, 2-, 4- und<br />
6-Bettzimmer vorhanden. Die Belegung der<br />
Zimmer richtet sich im Regelfall nach dem<br />
Krankenzustand der Patienten.<br />
Die in Ein- und Zweibettzimmern liegenden<br />
Schwerkranken sind innerhalb der<br />
einzelnen Stationen zwecks laufender Überwachung<br />
in unmittelbarer Nähe des Schwesterndienstzimmers<br />
untergebracht.<br />
Die Anordnung der Naßzellen und Pflegearbeitsräume<br />
in unmittelbarem Anschluß<br />
an jedes Krankenzimmer entlastet das Personal.<br />
Entsprechend unserer besonderen Aufgabe<br />
als Schwerpunkt- und Notfall-Krankenhaus<br />
sind Wachstationen in der chirurgischen<br />
Abteilung, der inneren Abteilung und der<br />
gynäkologischen Abteilung eingerichtet<br />
worden, die mit allen Erfordernissen der<br />
Intensivpflege ausgerüstet sind.<br />
Der Augen-Abteilung ist eine Sehschule<br />
angeschlossen, die eine optimale Behandlung<br />
kindlicher Sehstörungen ermöglicht.<br />
Eine Zentralsterilisation, die nach dem<br />
Verpackungssystem das ganze Haus versorgt,<br />
162
Der Neubau<br />
und Substerilisationen in den Operationsbereichen<br />
für das Instrumentarium schaffen<br />
eine gesicherte Asepsis in allen Teilen<br />
des Hauses.<br />
Das Haus verfügt über neuzeitliche<br />
Obduktionsräume.<br />
Ein Konferenzraum mit wissenschaftlicher<br />
Zentralbibliothek sowie ein Vortragsraum<br />
dienen der ständigen medizinischwissenschaftlichen<br />
Weiterbildung der<br />
Ärzte. ...<br />
Die Zentralküche mit Diätabteilung<br />
versorgt die Kranken direkt nach Tablettsystem.<br />
Auf jeder Station ist eine Teeküche<br />
vorhanden.<br />
Das neue Schwerpunktkrankenhaus<br />
Marien-Hospital ist nach den letzten Erkenntnissen<br />
der medizinischen Technologie<br />
eingerichtet. Es erfüllt alle Voraussetzungen,<br />
um sich auch einer weiteren<br />
Entwicklung der Medizin anzupassen.<br />
Die harmonische Zusammenarbeit<br />
des pflegerischen und Verwaltungsbereiches<br />
mit dem ärztlichen Dienst bietet die<br />
Voraussetzung dafür, daß der Kranke im<br />
Hause seine Geborgenheit findet, wobei<br />
das Verhältnis des Kranken zu seinem Arzt<br />
im Zentrum aller unserer Überlegungen<br />
steht unter dem Leitmotiv: Hic gaudet<br />
homo succurere vitae.<br />
Marienhospital,<br />
Neubau Ebene 01, 1970<br />
163
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Bauphase I<br />
1. Umbau des 1934 erbauten Ostflügels<br />
und des Altbau-Ostteiles zu einem<br />
Übergangskrankenhaus mit rund<br />
230 Betten.<br />
2. Anschließend Abbruch des westlichen<br />
Altbaubestandes.<br />
Bauphase II<br />
1. Neubau des ersten Bauabschnittes:<br />
Bettenbau - Behandlungsbau - Flachbau<br />
West und Schwesternwohnheim.<br />
2. Anschließend Abbruch des östlichen<br />
Altbaubestandes.<br />
Bauphase III<br />
1. Neubau Flachbau Ost mit Strahlenabteilung<br />
- Physikalischer Therapie<br />
und Apotheke.<br />
2. Neubau eines Familienwohnhauses<br />
mit Kindertagesstätte.<br />
Marienhospital, Neubau, 1968<br />
Marienhospital, Neubau Bauphasen, 1970<br />
164
Blaue Damen<br />
Blaue Damen<br />
Der ehrenamtliche Krankenhausbesuchsdienst hat im Marienhospital eine lange Tradition. Im Gegensatz zur Krankenhausseelsorge sind die Mitarbeiter im Krankenhausbesuchsdienst<br />
alle ehrenamtlich tätig. Über die Gründung und die Anfänge des Krankenhausbesuchsdienstes im Marienhospital berichtet die Mitinitiatorin Ilga Keller 1980 in einem Rückblick:<br />
Als wir 1972 begannen, über die Gründung<br />
eines Hilfsdienstes im Marienhospital nachzudenken,<br />
gab es noch kaum Beispiele in<br />
der Bundesrepublik. Der Vorsitzende unseres<br />
Kuratoriums hatte solche Gruppen, die „pink<br />
ladies“, in amerikanischen Krankenhäusern<br />
gesehen und bat mich, etwas Ähnliches in<br />
unserem Haus aufzubauen.<br />
Ich hatte das Glück, eine aufgeschlossene,<br />
moderne Oberin an der Seite zu haben.<br />
Aufrufe zur ehrenamtlichen Arbeit im Marienhospital,<br />
in den Zeitungen und in den<br />
Kirchen fanden ein unerwartetes positives<br />
Echo. Eine Woge der Hilfsbereitschaft wurde<br />
ausgelöst. 70 Frauen zwischen 18 und 70<br />
<strong>Jahre</strong>n meldeten sich spontan!<br />
Frau Oberin Sobotta und ich luden zu<br />
einem ersten Kennenlernen und zur Besichtigung<br />
des Hauses ein. Zu diesem Informationsnachmittag<br />
erschien eine große<br />
Schar von jungen, „mittelalterlichen“ und<br />
älteren Damen, alle mit leuchtenden Augen<br />
und strahlenden Gesichtern, voller Freude,<br />
endlich eine Aufgabe im Dienst am Nächsten<br />
gefunden zu haben. Es waren Frauen aller<br />
Schichten, Hausfrauen mit erwachsenen Kindern,<br />
Lehrerinnen im Ruhestand, pensionierte<br />
Beamtinnen etc.. In der Cafeteria sprachen wir<br />
bei einer Tasse Kaffee über unsere geplante<br />
Arbeit und verteilten Anmeldeformulare, in<br />
die man eintrug, wie oft und an welchen<br />
Tagen man „eingesetzt“ werden wollte und<br />
was man am liebsten täte. Fußend auf diesen<br />
Anmeldungen, stellten wir sofort einen<br />
exakten Plan auf, verschickten ihn an die Interessentinnen<br />
und begannen 14 Tage später.<br />
Ein Blitzstart, ein Experiment,<br />
von vielen guten Wünschen,<br />
aber auch Unkenrufen begleitet.<br />
Inzwischen arbeitet unsere<br />
Gruppe schon fast 8 <strong>Jahre</strong><br />
lang mit unverminderter Einsatzfreude<br />
und Verlässlichkeit.<br />
50 % der Helferinnen sind<br />
noch „Damen der ersten Stunde“,<br />
der Nachwuchs kommt<br />
aus dem Bekanntenkreis, oder<br />
es sind ehemalige Patientinnen.<br />
Nach dem jetzt auf alle<br />
Stationen erweiterten Einsatzplan<br />
verteilen sich 60 Damen so über einen<br />
Monat, daß das Krankenhaus täglich mit 5 bis<br />
7 Helferinnen rechnen kann. Wir sind ein fester<br />
Bestandteil des Krankenhauses geworden<br />
und nicht mehr wegzudenken. Freiwilligkeit<br />
ist oberstes Prinzip! Jede tut das, was ihr am<br />
meisten liegt: die Kontaktfreudigen an der<br />
Pforte zum Lotsendienst, Empfangen und<br />
Verabschieden, die Kinderliebenden bei den<br />
augenoperierten Kindern, einige kümmern<br />
sich rührend um alte Patientinnen.<br />
Der telefonische Anruf an die Pforte<br />
„Bitte eine Blaue Dame auf Station X oder<br />
Y“ ist für Schwestern und Patienten eine<br />
Selbstverständlichkeit in dringenden Fällen.<br />
Oberin Sobotta ist uns freundschaftlich verbunden<br />
und glaubt, daß die Blauen Damen<br />
„Reife und Wärme ins Haus bringen“. Wichtig<br />
ist die richtige Einstellung der Helferinnen!<br />
Sie müssen das Krankenhaus so annehmen,<br />
wie es ist, mit all seinen Schwächen. Die<br />
unruhebringenden, ständigen<br />
Kritiker gehören nicht hier<br />
hin! Wir bieten kleine Dienste<br />
an, in aller Bescheidenheit:<br />
Einkaufen Spazierengehen,<br />
Begleiten zum Röntgen und<br />
anderen Untersuchungen,<br />
Vorlesen, Briefeschreiben,<br />
Dolmetschen etc. Auf dieser<br />
Basis entstehen dann oft Gespräche,<br />
denn der Patient hat<br />
das gute Gefühl, hier ist ein<br />
Schwesternoberin Christa Sobotta, Mensch, der Zeit für mich hat,<br />
um 1970<br />
der dir zuhört.<br />
Wichtig für den reibungslosen<br />
Ablauf ist die richtige Einstellung zu den<br />
Schwestern. Diese dürfen nicht das Gefühl<br />
haben: die fremden Damen stehlen uns die<br />
Herzen der Patienten. Takt und Menschenkenntnis<br />
sind nötig.<br />
Erstaunlich ist die unermüdliche, herzerfrischende<br />
Art der Damen, ihre Arbeit zu<br />
sehen und anzupacken. Sie lassen sich nicht<br />
entmutigen durch schwierige Patienten,<br />
nichtgrüßende Ärzte – das dankbare Lächeln<br />
der Kranken macht sie glücklich. „Ich<br />
freue mich richtig auf meinen Donnerstag,<br />
meinen Dienstag“. „Mir würde etwas fehlen,<br />
wenn es den Hilfsdienst nicht gäbe“. Solche<br />
und ähnliche Aussprüche höre ich immer<br />
wieder. Jedenfalls war unser Unternehmen<br />
kein Strohfeuer – unsere Gruppe hat gezeigt,<br />
daß auch ehrenamtliche Arbeit, diszipliniert,<br />
ausdauernd und planmäßig getan, erfolgreich<br />
und anerkannt sein kann.<br />
165
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Flachbau Ost<br />
Personalhäuser<br />
Nach Fertigstellung der beiden<br />
Bettenhäuser und des Behandlungstraktes<br />
wurde der<br />
westliche Teil des Übergangskrankenhauses<br />
niedergelegt,<br />
um Raum zur Realisierung<br />
des zweiten Bauabschnittes<br />
zu schaffen. Anstelle des alten<br />
Ostflügels wurde in den<br />
<strong>Jahre</strong>n 1972 und 1973 ein<br />
neuer Flachbau errichtet, der<br />
die Physikalische Therapie (Bäderabteilungen<br />
und Krankengymnastik),<br />
die Hartstrahltherapie<br />
(Kobalt-Bombe) und die<br />
Isotopendiagnostik wie auch<br />
die Apotheke aufnehmen sollte.<br />
Die Bauarbeiten für den<br />
Flachbau Ost begannen im<br />
September 1972. Am 31. Mai<br />
1973 feierte man das Richtfest,<br />
am 1. August 1975 konnten<br />
die neuen Behandlungsräume<br />
in Betrieb genommen werden.<br />
Im Frühjahr 1969, als rund <strong>150</strong> freie<br />
Krankenschwestern im Marienhospital<br />
beschäftigt waren, wurde an der Prinz-<br />
Georg-Straße mit dem Bau von zwei<br />
neuen Personalwohnheimen begonnen.<br />
Neben dem 1958 fertig gestellten Wohnheim<br />
I (Prinz-Georg-Straße 57) wurde das<br />
Wohnheim II (Prinz-Georg-Straße 59) für<br />
Schwestern und das Wohnheim III (Prinz-<br />
Georg‐Straße 61) für Pfleger und Ärzte<br />
errichtet. Das neue Schwesternhaus war als<br />
70 Meter langer, gestreckter Bau geplant<br />
und wurde in „einbündiger“ Bauweise<br />
ausgeführt. Einbündig bedeutete, dass zur<br />
Prinz-Georg-Straße hin, als Abschirmung<br />
gegen Lärm, nur Flure und Nebeneinrichtungen<br />
angelegt wurden, während die<br />
Wohnräume zum Krankenhausgarten hin<br />
lagen. Nach neun Monaten waren die<br />
Arbeiten für die neue Behausung, die auf<br />
dem Gelände der ehemaligen Hospital-<br />
Ziegelei errichtet wurde, so weit vorangeschritten,<br />
dass am 8. Dezember 1969 das<br />
Richtfest gefeiert werden konnte. Anfang<br />
Februar 1971 wurde das Wohnheim II von<br />
den ersten Schwestern bezogen. Die 99<br />
Heimplätze waren auf 16 Wohnungen für<br />
leitende Schwestern und 83 Einzelappartements<br />
mit Duschraum und Balkon verteilt.<br />
Unmittelbar nach der Fertigstellung des<br />
Schwesternwohnheims wurde im April<br />
1971 der Bau des Familienwohnhauses in<br />
Marienhospital, Flachbau Ost, 2014<br />
Marienhospital, Neubau Personalhäuser, 1970<br />
Marienhospital, Schwesternwohnheim Vorderansicht<br />
Prinz-Georg-Straße 61, 2014<br />
Marienhospital, Schwesternwohnheim Rückansicht<br />
Prinz-Georg-Straße 61-63, 2014<br />
166
Marienfigur<br />
Angriff genommen. Das 1973 in Nutzung<br />
genommene Personalhaus III war nicht nur<br />
Wohnheim für Pfleger und Ärzte sondern<br />
auch Heimstatt für einen Kindergarten. Die<br />
am 1. August 1973 eröffnete krankenhauseigene<br />
Kindertagesstätte wurde von zwei<br />
Kindergärtnerinnen geleitet und nahm<br />
ausschließlich Kinder von Mitarbeitern<br />
des Marienhospitals auf. Mit Beginn des<br />
<strong>Jahre</strong>s 1977 wurde die Trägerschaft und<br />
die Leitung der Kindertagesstätte auf die<br />
Kirchengemeinde St. Rochus übertragen.<br />
Marienfigur<br />
Zur Ausschmückung der Eingangshalle<br />
erwarb der Vorstand des Marienhospitals<br />
im <strong>Jahre</strong> 1969 für 5900<br />
DM über den Kunsthandel eine neue<br />
Marienfigur. Die aus Terracotta angefertigte<br />
Madonna<br />
soll aus dem 18. Jahrhundert<br />
stammen, doch<br />
ist ihre wirkliche Herkunft<br />
ungewiss. Ungewiss ist auch<br />
der Verbleib des Marienbildnisses<br />
von Joseph Reiß, das bis zur<br />
Niederlegung des alten Marienhospitals<br />
im Vestibül stand und hier<br />
die Besucher des Krankenhauses<br />
„begrüßte“. Es ist heute nicht mehr<br />
auffindbar und gilt als verloren.<br />
Marienbildnis aus Terracotta, um 1970<br />
Marienbildnis aus Terracotta,<br />
nach der Restaurierung, 2014<br />
Marienbildnis von Joseph Reiß<br />
167
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Marienhospital, Gesamtansicht, um 1973<br />
168
Entwicklung seit 1970<br />
Blitzlichter der Entwicklung seit 1970<br />
Und wo bleiben in der Darstellung die letzten vier Jahrzehnte?<br />
Für eine historische Aufarbeitung ist es vielleicht noch zu früh, doch<br />
sollen diese wichtigen <strong>Jahre</strong> nicht unerwähnt bleiben. Bei der Vorbereitung<br />
des Jubiläumsjahres stieß man auf Fotografien, die in den ersten<br />
Monaten nach Inbetriebnahme des Neubaus angefertigt wurden. Wie<br />
wäre es, diesen Aufnahmen Fotos aus jüngster Zeit gegenüberzustellen<br />
und den Wandel in kurzer Form zu kommentieren? – Diese Idee fand<br />
im Vorbereitungskreis allgemeine Zustimmung, zumal die Zeit drängte.<br />
Ich selbst kenne das neue Haus seit über 40 <strong>Jahre</strong>n und habe den allmählichen<br />
Wandel in guter Erinnerung. Daher habe ich die Aufgabe gerne übernommen,<br />
die Bildauswahl zu treffen und die Begleittexte zu schreiben. Die Aufnahmen aus<br />
den siebziger <strong>Jahre</strong>n des letzten Jahrhunderts zeigen überwiegend die allgemeinen<br />
Einrichtungen des Hauses in ihrer architektonischen Schönheit, weniger die<br />
medizintechnischen Errungenschaften dieser Zeit. Daher kann die Auswahl auch<br />
nicht die Entwicklung der medizinischen Fachabteilungen dokumentieren. Es fand<br />
sich z.B. kein Bild, das den bereits damals hohen Standard in der Inneren Medizin<br />
mit der Erkennung von Herz- und Lungenkrankheiten, den Beatmungsgeräten der<br />
Intensiveinheit oder den damaligen Stand der Dialyseeinrichtung dokumentiert<br />
hätte. Diese Entwicklungen aufzuzeigen, ist einer späteren Aufbereitung vorbehalten.<br />
So bleiben die gezeigten Fotografien Blitzlichter des sich ständig wandelnden<br />
Marien Hospitals, mitten im Leben, mitten in Düsseldorf.<br />
Dr. Richard Derichs<br />
169
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Die Kapelle<br />
Die Aufnahme der neu errichteten kreisförmigen Kapelle zeigt<br />
die bis heute unveränderten Elemente des Gotteshauses. Dort,<br />
wo auf dem breiten Sockel eine kleine Marienstatue steht, sollte<br />
wenig später die restaurierte spätgotische Pietà stehen, die<br />
bis heute dort ihren Platz hat und von vielen Menschen, die in<br />
Sorge um ihre Angehörigen sind, aufgesucht wird. In den mehr<br />
als zwei Jahrzehnten des Wirkens von Pfarrer Hubert Doods<br />
erfuhr die Kapelle dank großzügiger Spenden eine Reihe von<br />
Veränderungen. Der Kreuzweg wurde durch das zeitgenössische<br />
Werk des Prager Künstlers Luděk Tichý ersetzt. Zusätzlich schuf<br />
170
Entwicklung seit 1970<br />
Die Kapelle<br />
Tichý Holzreliefs der Seligpreisungen sowie ein großes Auferstehungsrelief<br />
für den Ambo. Im Vorraum der Kapelle hängt nun<br />
ein Relief der Bielefelder Künstlerin Nina Koch, das die Flucht<br />
aus Ägypten aufgreift. Nina Koch schuf für die Seitenkapelle<br />
auch ein Relief, dass sich mit dem Wirken von Mutter Teresa<br />
befasst. Vor wenigen <strong>Jahre</strong>n wurde die spätgotische Madonna,<br />
die bereits in der Kapelle des alten Marien Hospitals stand,<br />
von der Stifterfamilie zurückgegeben. Nach einer gründlichen<br />
Restaurierung steht die Madonna nun auf einer Stele zwischen<br />
Altar und Tabernakel-Säule.<br />
171
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Der Eingangsbereich<br />
Tiefgreifende Veränderungen hat in den zurückliegenden<br />
Jahrzehnten auch der Eingangsbereich erfahren. Die durch<br />
Glaswände abgeschirmte Pförtnerloge, an die sich die Telefonzentrale<br />
anschloss, in der täglich zahllose Gespräche von Hand<br />
vermittelt wurden, die Telefonzelle, der Briefkasten und auch<br />
die Garderobe sind längst verschwunden. Heute gibt es auf<br />
der gegenüberliegenden Seite einen modernen Empfang. Gespräche<br />
werden elektronisch vermittelt, der Briefkasten ist nach<br />
172
Entwicklung seit 1970<br />
Der Eingangsbereich<br />
draußen gewandert. Dabei verlässt man das Haus durch eine<br />
Drehtür, die als Windfang dient. Heute wirkt die Eingangshalle<br />
großzügig, bietet Platz für Gespräche und dient für Infotafeln<br />
und wechselnde Kunstausstellungen. Zu der Großzügigkeit<br />
hat die Verlagerung großer Teile der Administration in das alte<br />
Ärztehaus an der Rochusstraße beigetragen. Hierdurch konnte<br />
ein geräumiger Wartebereich für die administrative Patientenaufnahme<br />
entstehen, der mit der Eingangshalle verbunden ist.<br />
173
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Cafeteria<br />
Schon der Name verheißt ein wenig mehr als nur eine Kantine.<br />
In hellen Räumen können Patienten, Besucher und das Personal<br />
warme und kalte Mahlzeiten einnehmen. Während früher die<br />
warme Mahlzeit vom Küchenpersonal ausgegeben wurde, kann<br />
man sich heute, wie in einem Restaurant, die gewünschten<br />
Zubereitungen an einem warmen Buffet oder an der Salatbar<br />
selbst zusammenstellen. Desserts oder Kuchen, heiße und kalte<br />
Getränke, verschiedene Eissorten lassen sich genauso finden wie<br />
eine Warengondel mit Gebäck, Schokolade und anderen Süßigkeiten.<br />
Auch Zeitungen und Zeitschriften sowie Hygieneartikel<br />
gehören zum Sortiment.<br />
Im Sommer vergrößert sich heute die Cafeteria um eine große<br />
Terrasse, die mit Tischen, Stühlen und dazugehörigen<br />
174
Entwicklung seit 1970<br />
Cafeteria<br />
Sonnenschirmen vor allem für das Personal oft die einzige<br />
Gelegenheit des Tages bietet, ein wenig Sonne zu tanken.<br />
In der Cafeteria gab es früher einige runde Tische. Mittags<br />
saßen oft Ärzte oder Schwestern einer Abteilung an diesen<br />
Tafeln, die stets für alle reichten und damit der Kommunikation<br />
untereinander dienten. Ursprünglich konnte die Cafeteria durch<br />
verschiebbare Wandelemente vergrößert werden. Heute ist der<br />
hintere Teil der Cafeteria zu einem wichtigen Konferenzraum<br />
geworden, der mit einem großen ovalen Konferenztisch und moderner<br />
Präsentationstechnik ausgestattet ist. Auch die Cafeteria<br />
lässt sich leicht in einen Veranstaltungsraum verwandeln, sei es<br />
für Fortbildungen mit Projektionsmöglichkeiten, Podiumsdiskussionen<br />
oder auch festliche Anlässe.<br />
175
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Die Aufzüge<br />
Obwohl das Marien Hospital über ein deutlich größeres Areal<br />
verfügt als andere Düsseldorfer Kliniken der Innenstadt, bestand<br />
beim Neubau die Notwendigkeit, deutlich mehr Geschosse anzulegen,<br />
als dies im Altbau möglich gewesen wäre. Dank moderner<br />
Aufzugsanlagen gelang es nun, Patienten im Krankenhausbett<br />
zu entfernten Behandlungsräumen liegend zu transportieren. Im<br />
Altbau hätte es dazu tragbarer Bahren bedurft, die von „Wärtern“<br />
treppauf/treppab getragen werden mussten. Wer heute<br />
noch das Treppenhaus im Ostflügel benutzt, wird sich über die<br />
breiten Treppenstufen und den geringeren Neigungswinkel der<br />
Treppen wundern. Nur so konnten Patienten halbwegs horizontal<br />
getragen werden.<br />
176
Entwicklung seit 1970<br />
Die Aufzüge<br />
Der Aufzugflur im neuen Haus war großzügig konzipiert worden,<br />
um das Rangieren mit Betten vor den Fahrstühlen zu erleichtern.<br />
Im Laufe der immer größeren Verdichtung von Diagnostik und<br />
Therapie gelangten die Lifte an die Grenzen der Kapazität, zumal<br />
sie ja auch der Beförderung der Besucherströme und vieler anderer<br />
Transporte dienten. Daher entschloss man sich, zu Lasten<br />
der großzügigen Fensterfront gegenüber den Fahrstühlen von<br />
außen einen Aufzugsschacht für zwei Personenlifte zu errichten,<br />
was zu einer deutlichen Entlastung führte.<br />
Neben den zentralen Aufzugsanlagen musste bei der Wiederherstellung<br />
des Altbaus (Ostflügel) auch dort ein Schacht für<br />
Fahrstühle errichtet werden, weil der Ostflügel noch ohne Lifte<br />
gebaut worden war.<br />
177
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Stationsflur<br />
Die Stationsflure dienen mit ihren Nebenräumen der pflegerischen<br />
und ärztlichen Versorgung der Patienten. Holzpaneele,<br />
mit denen die Decken abgehängt wurden, hölzerne Handläufe,<br />
Türen und Fensterzargen sorgten für Schallschutz und eine<br />
wohnliche Atmosphäre. Bei den Nebenräumen wurde seinerzeit<br />
viel Wert auf Funktionalität gelegt. Aber was vor 40 <strong>Jahre</strong>n noch<br />
vorbildlich war, muss Schritt für Schritt an wesentlich höhere<br />
178
Entwicklung seit 1970<br />
Stationsflur<br />
Anforderungen angepasst werden. Einer davon ist der Brandschutz,<br />
der aus guten Gründen das Haus zwang, hohe Beträge<br />
zu investieren. Die umfangreichen Investitionen betrafen u. a.<br />
Brandschutztüren und den Ersatz von Holzdecken durch brandsichere<br />
Deckenkonstruktionen. Auch konnten beim Rückbau der<br />
großen Zimmer neue Toilettenanlagen gebaut und dadurch der<br />
sogenannte Hotelstandard nach und nach verbessert werden.<br />
179
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Die Aufenthaltsräume<br />
Auf jeder Station befinden sich etwa in der Mitte des Flures<br />
in Nähe des Stationsarbeitsplatzes Einbuchtungen mit Sitzmöglichkeiten<br />
für Patienten und ihre Besucher. Zwischen zwei<br />
gegenüberliegenden Stationen gab es großzügige, durch eine<br />
Glaswand abgetrennte Aufenthaltsräume, in denen in den<br />
70er <strong>Jahre</strong>n teilweise noch das Rauchen erlaubt war. Durch<br />
die Fortschritte in der Medizin wurden immer mehr Flächen für<br />
Funktionsräume benötigt. Diesem Bedarf stand aber nur ein begrenztes<br />
Raumangebot gegenüber. Auch gab es neue Konzepte<br />
180
Entwicklung seit 1970<br />
Die Aufenthaltsräume<br />
in der Pflege, bei der nicht die Station, sondern die Pflegeebene<br />
Priorität bekam. Dadurch wurden die Aufenthaltsräume mehr<br />
und mehr zu Arbeitsräumen der Bereichspflege umgewandelt.<br />
Ein Raum diente eine Reihe von <strong>Jahre</strong>n als Bücherei mit einem<br />
vielfältigen <strong>Buch</strong>angebot. In einer anderen Ebene waren ärztliche<br />
Behandlungsräume untergebracht. Heute finden viele Kontakte<br />
zwischen Patienten und Besuchern in der Cafeteria statt, die<br />
durch ein gelungenes Ambiente und durch ein vielfältiges Angebot<br />
die alten Aufenthaltsräume deutlich überbietet.<br />
181
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Stationsarbeitsplatz<br />
Auf dem Bild zu Anfang der 70er <strong>Jahre</strong> erkennt man, dass es im<br />
Hause eine Rohrpostanlage gab. Es war ein großer Fortschritt, da<br />
hierdurch Befunde z. B. aus dem Labor oder aus der Radiologie<br />
schnell zu den Empfängern im Haus versendet werden konnten.<br />
Aus Gründen des Brandschutzes wurde die Anlage, die sich als<br />
recht störungsempfänglich erwies, stillgelegt. Die Rohre mussten<br />
entfernt oder versiegelt werden, um im Brandfall keine Gefahr<br />
darzustellen. Heute wird im Marien Hospital ein modernes Computergesteuertes<br />
Informationssystem benutzt, das kaum noch<br />
182
Entwicklung seit 1970<br />
Stationsarbeitsplatz<br />
Wünsche übrig lässt. Auch die elektronische Patientenakte ist<br />
längst Realität, wenngleich noch in einem Übergangsstadium.<br />
Unverzichtbar bleibt das verantwortungsvolle Zusammenstellen<br />
der Medikamente für jeden einzelnen Patienten. Auch die<br />
Schwesterntracht erfuhr einen Wandel. Unterschiedliche Hauben<br />
für Schwesternschülerinnen und examinierte Schwestern sind<br />
längst verschwunden. Das einteilige Schwesternkleid wurde<br />
durch einen Zweiteiler mit Hose und Kasack abgelöst.<br />
183
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Das Bettenhaus<br />
In der Phase des Neubaus des Marien Hospitals musste der<br />
Krankenhausbetrieb weitergehen. Daher wurde das Bettenhaus<br />
hinter dem alten Hauptgebäude parallel zur Sternstraße errichtet.<br />
Erst nach Fertigstellung des neuen Bettentraktes und nach<br />
Abriss des alten Haupthauses wurde im Winkel von 90 Grad<br />
der Therapie‐ und Ambulanzflügel parallel zur Rochusstraße<br />
errichtet. Das Bettenhaus ist also der älteste Teil des Neubaus.<br />
In den 60er <strong>Jahre</strong>n wurde der Bereitstellung eines genügend<br />
großen Bettenkontingents eine große Bedeutung zugewiesen.<br />
So wurden die Kopfzimmer der einzelnen Stationen als Sechsbettzimmer<br />
eingerichtet. Dies entspricht nicht mehr den heutigen<br />
Ansprüchen an eine Versorgung im Krankenhaus.<br />
184
Entwicklung seit 1970<br />
Das Bettenhaus<br />
Die Sechsbettzimmer werden heute mit maximal vier Betten<br />
belegt; die meisten von ihnen wurden bereits in zwei Einzel- oder<br />
Doppelzimmer umgewandelt. Durch intensive bauliche Maßnahmen<br />
konnte eine Reihe von Stationen entweder komplett saniert<br />
oder unter Einbeziehung erheblicher Brandschutzmaßnahmen<br />
dem heutigen Standard angepasst werden. Wir dürfen hoffen,<br />
dass in den nächsten <strong>Jahre</strong>n die Sanierungsarbeiten zu einem<br />
Abschluss geführt werden können. Wenn man heute ein Zimmer<br />
betritt, so fallen die modernen Betten auf, die von den Patienten<br />
vielfach verstellbar sind. Auch Flachbild-Fernsehmonitore,<br />
Telefone und sogar Internetanschlüsse gehören heute dazu.<br />
185
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Säuglingszimmer<br />
Neugeborene wurden früher nach der Entbindung in ein Bettchen<br />
gelegt und im Säuglingszimmer von Kinderkrankenschwestern<br />
versorgt. Zu den Stillzeiten konnten die fahrbaren Bettchen mit<br />
den Neugeborenen über einen eigens dafür gebauten Gang<br />
unter Umgehung des Aufzugsbereiches zu den Müttern auf die<br />
geburtshilfliche Station gebracht werden. Später blieben die Bettchen<br />
immer häufiger bei den Müttern, als sich das „rooming in“<br />
immer mehr durchsetzte. Das hatte die Konsequenz, dass vor<br />
einer Reihe von <strong>Jahre</strong>n die geburtshilfliche Station komplett<br />
saniert wurde, um den geänderten Bedürfnissen der jungen<br />
186
Entwicklung seit 1970<br />
Säuglingszimmer<br />
Eltern gerecht zu werden. Schließlich wurde das Säuglingszimmer<br />
mit seinen Nebenräumen nicht mehr gebraucht. Es wurde<br />
zunächst in ein Fortbildungszentrum mit zwei großen und zwei<br />
kleinen Multifunktionsräumen umgebaut. Seit einigen <strong>Jahre</strong>n<br />
beherbergen die Räume die Klinik für Senologie unter der Leitung<br />
von Prof. Audretsch.<br />
Auf der geburtshilflichen Station entstand neben dem zentralen<br />
Stationsarbeitsplatz für die Pflege der Säuglinge ein neuer<br />
Raum, der auch eine Still-Ecke beherbergt für Mütter mit ihren<br />
Neugeborenen.<br />
187
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Zentralambulanz<br />
Das historische Foto zeigt einen unfallchirurgischen Behandlungsraum<br />
in der Zentralambulanz.<br />
Die maßgeblichen Ärzte Dr. Bross als Chirurg und Dr. Wirtz als Internist<br />
haben das Marien Hospital bereits zu Anfang der 70er <strong>Jahre</strong><br />
zu einem sich stetig weiterentwickelnden Notfallkrankenhaus<br />
gemacht. Hier stand immer ein für den sogenannten Herzalarm<br />
ausgerüstetes Ärzte‐ und Pflegeteam für den sofortigen Einsatz<br />
bereit. Ein rotes Telefon kündigte die Einlieferung lebensbedrohlich<br />
Erkrankter an. Auch der sogenannte Schockraum war bereits<br />
188
Entwicklung seit 1970<br />
Zentralambulanz<br />
nach dem Neubau fester Bestandteil dieser Versorgungsstruktur.<br />
Heute ist das Marien Hospital zertifiziertes Traumazentrum. In<br />
der Zentralambulanz werden zu jeder Tages- und Nachtzeit viele<br />
Tausend Notfallpatienten pro Jahr versorgt. Inzwischen wurde<br />
die Organisation der zentralen Notfallambulanz einem ärztlichen<br />
Leiter übertragen. In vielen Räumen können parallel Patienten<br />
mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern versorgt werden.<br />
189
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Radiologie<br />
In der Radiologie hat die konventionelle Röntgentechnik noch<br />
einen hohen Stellenwert, wenngleich die Belichtung eines<br />
Röntgenfilms und seine Entwicklung in der Dunkelkammer der<br />
Vergangenheit angehören. Auch das auf dem Foto zu erkennende<br />
Tomografiegerät ist längst veraltet und wurde entfernt.<br />
Hierbei mussten durch eine mechanische Apparatur Röntgenfilm<br />
und Röntgenkopf gegenläufig bewegt werden, wodurch<br />
190
Entwicklung seit 1970<br />
Radiologie<br />
nur Strukturen einer Schicht des menschlichen Körpers scharf<br />
abgebildet wurden. Diese Technik half seinerzeit bei der Erkennung<br />
etwa von Nierensteinen oder von Bronchialkarzinomen.<br />
In gewisser Weise sind die alten mechanischen Tomografen<br />
Vorläufer der modernen Computertomografie‐Geräte. Heute<br />
gehören Computertomografie und Kernspintomografie längst<br />
zu den unverzichtbaren diagnostischen Geräten der Radiologie.<br />
191
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Operationssaal<br />
Im 5. Stock des Behandlungstraktes teilten sich Bauch- und<br />
Unfallchirurgen, Gynäkologen, Urologen und Augenärzte die<br />
bestehenden Operationssäle. Eine Kapazitätsausweitung stieß<br />
bald an Grenzen. Auch konnten die alten Räume den gestiegenen<br />
technischen Anforderungen im Laufe der <strong>Jahre</strong> nicht mehr gerecht<br />
werden. Nach dem Vorbild des Baues der Intensivstationen<br />
192
Entwicklung seit 1970<br />
Operationssaal<br />
auf dem westlichen Flachbau wurde nun in den 90er <strong>Jahre</strong>n<br />
über dem Flachbau der Physiotherapie ein neuer Operationstrakt<br />
errichtet, der wesentlich größere Kapazitäten zuließ. Inzwischen<br />
wurden die alten Operationsräume im 5. Stock saniert und zu<br />
modernen Operationssälen umgestaltet.<br />
193
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Labor<br />
Die Automatisierung von Arbeitsschritten hat innerhalb eines<br />
Krankenhauses vor allem die Labors verändert. Der Ermittlung jedes<br />
einzelnen Laborwertes gingen früher aufwändige, von Hand<br />
durchzuführende Analyseschritte voraus. Durch immer schnellere<br />
Automaten und deren Anbindung an immer leistungsfähigere<br />
Computer wuchs der ökonomische Druck, Labore auszulagern.<br />
Diese Entwicklung machte auch vor dem Marien Hospital nicht<br />
194
Entwicklung seit 1970<br />
Labor<br />
halt. Aber: Seit Antritt des neuen Chefarztes der Klinik für Hämatologie<br />
und Onkologie Dr. Giagounidis wurde Schritt für Schritt<br />
ein hochspezialisiertes hämatologisches Labor installiert, das den<br />
hohen Anforderungen der Hämato‐Onkologie gerecht wird.<br />
Auch das Institut für Pathologie Dr. Klosterhalfen und Partner<br />
ist mit einem Präsenzlabor, z.B. für Schnellschnittdiagnostik, ins<br />
Marien Hospital eingezogen.<br />
195
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Prinz-Georg-Straße<br />
Das Areal des Marien Hospitals reicht bis an die Prinz-Georg-<br />
Straße. Dort wurden beim Neubau des Krankenhauses zwei<br />
Wohnhäuser errichtet, von denen das Schwesternheim auf dem<br />
Bild zu erkennen ist. An der Ecke zur Stockkampstraße stand<br />
bereits ein Wohnheim, das lange als Krankenpflegeschülerheim<br />
benutzt wurde, inzwischen aber abgerissen werden musste.<br />
196
Entwicklung seit 1970<br />
Prinz-Georg-Straße<br />
Hierdurch wurde Gelände gewonnen für die Errichtung einer<br />
hochmodernen Strahlentherapie, die im Herbst 2013 unter der<br />
ärztlichen Leitung von Prof. Dr. Karl-Axel Hartmann den Betrieb<br />
aufgenommen hat. Das Marien Hospital hat sich hierdurch auch<br />
zur Prinz-Georg-Straße hin geöffnet und bietet dort Parkplätze<br />
für die Besucher der Strahlentherapie.<br />
197
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Der Blick von der Rochusstraße<br />
Beim Neubau des Marien Hospitals wurde die Eingangsachse um<br />
90 Grad nach Westen gedreht, wodurch sich das Krankenhaus<br />
zur Rochusstraße hin öffnet. Vor dem in Nord-Süd-Ausrichtung<br />
liegenden Behandlungstrakt wurde seinerzeit ein Flachbau<br />
errichtet, der u. a. die Ambulanzräume und die Administration<br />
aufnahm. Als fortschrittlich galt die Möglichkeit für Krankentransporte,<br />
sich abgeschirmt von Wind und Wetter und abgetrennt<br />
vom übrigen Ambulanzbetrieb in eine Vorhalle einzuschleusen,<br />
die direkt mit der Ambulanz verbunden war. Da die Rettungswagen<br />
Ende der 70er <strong>Jahre</strong> größer und höher wurden, musste die<br />
Halle aufgestockt werden. Als in den 80er <strong>Jahre</strong>n der Neubau<br />
von zwei Intensivstationen unumgänglich wurde, schlug der<br />
Architekt die Aufstockung des Flachbaus nach entsprechender<br />
statischer Armierung vor. Ähnliches wurde später in dem Flachbau<br />
östlich des Behandlungstraktes durch denselben Architekten<br />
198
Entwicklung seit 1970<br />
Der Blick von der Rochusstraße<br />
wiederholt, als es darum ging, einen neuen Operationstrakt zu<br />
errichten. Zwischen dem Behandlungstrakt und dem in etwa<br />
rechtwinklig dazu liegenden Bettentrakt mit einem westlichen<br />
und einem östlichen Flügel befindet sich der Aufzugsbereich. Auf<br />
dem Bild erkennt man den Schacht für die beiden zusätzlichen<br />
Personenaufzüge, der geschickt von außen hochgezogen wurde.<br />
Dem chronischen Mangel an Parkplätzen begegnete man mit<br />
einer Umgestaltung des Vorplatzes, wodurch deutlich mehr<br />
Parkgelegenheiten geschaffen wurden. Bei der Umgestaltung<br />
musste der mit Waschbetonplatten umrandete rechteckige<br />
Springbrunnen weichen.<br />
Rechts der Eingangsdrehtür befindet sich eine bronzene Madonna<br />
von der Künstlerin Nina Koch. Die Statue zeigt einen<br />
intensiven Blickkontakt zwischen Maria und dem Jesuskind.<br />
199
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital Düsseldorf<br />
Bildnachweis<br />
Herausgeber und Autor haben sich bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen. In Fällen, wo dies nicht gelungen ist, bitten wir um Mitteilung.<br />
Abkürzungen: o = oben; u = unten; m = Mitte; l = links; r = rechts<br />
Adalbert Oehler, Düsseldorf im Weltkrieg. Schicksal und<br />
Arbeit einer deutschen Großstadt, Düsseldorf 1927: Seite<br />
73u, 74or, 74ur<br />
Adolf von Kamp, Beschribung der Begrebnüs weilandt des<br />
Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten - und - Herren,<br />
Herren Iohan - Wilhelm, Hertzogen zu Gulich, Cleve und<br />
Berg, Grave zu der Marck, Ravensberg und Moers, Herr zu<br />
Ravenstein, Cristseliger Gedechtnüs der letzte Aus diesem<br />
Fürstlichem stam, Welche gehalten worden zu Düsseldorf<br />
den 30 Octobris Anno 1628. Nach dem Ihre Fürst. Gnade<br />
Leichnam Bey de 20 Jahr Nach Dero seligen Absterben<br />
in der Hoff Capellen Alda Oben der Erden unbegraben<br />
gestanden, Düsseldorf 1629: Seite 5o<br />
Andreas Bretz, Rheinische Post: Seite 3<br />
Angelika Rattenhuber, Düsseldorf: Seite 111ol<br />
Archiv der Kölnischen Franziskanerprovinz, Mönchengladbach:<br />
Seite 80<br />
Arme Schwestern vom Heiligen Franziskus, Aachen: Seite<br />
22o, 25o, 26ol, 26or, 26m, 26ml, 33o, 40o, 47m, 51o, 51u,<br />
53o, 54or, 57o, 66ol, 70um, 70ur, 71o, 96o, 99ur, 100u,<br />
118o, 118m, 118ul, 118ur, 148r, 167r<br />
Bibliothèque de Bourgogne, Brüssel: Seite 5ur<br />
Calendarium inclyti ordinis equestris D. Huberto sacri,<br />
Mannheim 1769: Seite 6u<br />
Caritasverband für die Stadt Düsseldorf: Seite 27o, 96u,<br />
97o, 97u, 98, 99ol, 108o, 134ml, 137ul, 138m<br />
Claus-Torsten Schmidt, Düsseldorf: Seite 47o, 50o, 64or,<br />
65ml, 72u, 76m, 99or<br />
Dieter Reinold, Düsseldorf: Seite 45o<br />
Erwin Quedenfeldt, Einzelbilder vom Niederrhein. Zur<br />
Pflege der Heimatkunst, Düsseldorf 1911: Seite 8u, 38u<br />
Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Düsseldorf: Seite<br />
64ur<br />
Gerd Schlüter, Düsseldorf: Seite 17o, 17u, 21m, 31o, 34o,<br />
36o, 40ul, 52o, 58ol, 64ol, 64ul, 65ol, 65or, 65mr, 66mr,<br />
70o, 75ul, 76m, 76ul, 77u, 83or, 85o, 90u, 91ul, 93, 99mr,<br />
99ul, 119ol, 127u, 144m<br />
Heiko Schneitler, Solingen: Seite 16o, 55ol, 56o, 60ol, 62u,<br />
65ml, 65ur, 66ml, 79, 87u, 99ml, 158ur<br />
Hubert Adolphs, Düsseldorf: Seite114ul<br />
Karl Theodor Zingeler, Karl Anton von Hohenzollern und<br />
die Beziehungen des Fürstlichen Hauses Hohenzollern zu<br />
dem Hause Zähringen-Baden. Festschrift zur Goldenen<br />
Hochzeits-Feier Ihrer Königlichen Hoheiten des Fürsten<br />
Karl Anton von Hohenzollern und der Fürstin Josefine,<br />
geb. Prinzessin von Baden am 21. Oktober 1884, Sigmaringen<br />
1884: Seite 16u<br />
Kranken-, Heil- und Pflege-Anstalten im Rheinland, Düsseldorf<br />
1930: Seite 50u, 65ul, 66ul<br />
Landesarchiv NRW-Abteilung Rheinland, Düsseldorf: Seite<br />
12ul, 35ur, 110u, 123u, 132ml, 137ur, 140u, 141ol, 141or<br />
Leonard Sieg, Kaarst: Titelbild, Seite 166o, 166ul, 166ur,<br />
167m, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 197, 199<br />
Ludwig Humborg, 275 <strong>Jahre</strong> Rincklake van Endert. 1681-<br />
1956. Handwerker und Kaufleute in Münster, Münster<br />
1956: Seite 20o<br />
Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf: Seite 104u, 105ur,<br />
109, 112ur<br />
Marienhospital, Düsseldorf: Seite 21o, 28o, 30l, 30r, 31u,<br />
32o, 32m, 33u, 37o, 38o, 39o, 44o, 44u, 46u, 48, 57ul,<br />
58ul, 60or, 67, 70ul, 71u, 72o, 82, 84, 94u, 100o, 100m,<br />
111u, 117o, 122o, 122ml, 122mr, 122u, 123o, 123m, 127o,<br />
135ol, 135or, 135ul, 135ur, 140ol, 140or, 146o, 147ol,<br />
<strong>150</strong>ul, <strong>150</strong>ur, 151u, 156u, 157u, 158o, 158m, 158ul,<br />
159ol, 159or, 159m, 159u, 160o, 160u, 161o, 165, 167l,<br />
168, 169, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186,<br />
188, 190, 192, 194, 196, 198<br />
Martinuskrankenhaus Düsseldorf: Seite 40ur, 66or<br />
Medienzentrum Rheinland, Düsseldorf: Seite 138u<br />
Michael Sommer: Seite 191, 193<br />
Peter Schiffers, Düsseldorf: Seite 130u<br />
Pfarrarchiv Maria Empfängnis, Düsseldorf: Seite 61or<br />
Pfarrarchiv St. Lambertus, Düsseldorf: Seite 24o, 41o, 42o,<br />
42m, 56u, 61ol, 119u, 132o<br />
Pfarrarchiv St. Margareta, Düsseldorf: Seite 131<br />
Pfarrarchiv St. Maximilian, Düsseldorf: Seite 55u<br />
Pfarrarchiv St. Pius, Düsseldorf: Seite 141ul<br />
Pfarrarchiv St. Rochus, Düsseldorf: Seite 27ul, 124<br />
Pfarrarchiv St. Suitbertus, Düsseldorf: Seite 149<br />
Provinzialat der Töchter vom heiligen Kreuz, Aspel:<br />
Seite 9o, 9u, 10o, 10m, 10u, 11u, 47u, 113o, 125o, 139u<br />
Ruth Kurz-Trimborn, Zülpich: Seite 58ur<br />
Richard Derichs: Seite 181, 189, 195<br />
St. Annastift, Düsseldorf: Seite 26ul, 148l, 148m<br />
St. Hubertusstift, Düsseldorf: Seite 6ol, 7o, 7u, 13<br />
Sozialdienst katholischer Frauen und Männer, Düsseldorf:<br />
Seite 111or<br />
Stadtarchiv Aachen: Seite 12ur<br />
Stadtarchiv Düsseldorf: Seite 14o, 18ol, 19o, 19u, 22u,<br />
27ur, 33m, 45ur, 53u, 55or, 63, 69u, 73m, 74ol, 74ul, 75ol,<br />
75or, 75m, 75ur, 78, 101o, 106u, 113u, 114o, 115o, 115ul,<br />
115ur, 116o, 116u, 121o, 121m, 121ul, 121ur, 125m,<br />
125u, 128, 130o, 132mr, 133, 134o, 134u, 137o, 141ur,<br />
143u, 144u, 164<br />
Stadtmuseum Düsseldorf: Seite 5ul, 8o, 11o, 14u, 34u,<br />
35m, 40um, 45ul, 62o, 62m, 76o, 83ol, 86o, 86u, 103,<br />
105ul, 108u, 110o, 112o, 112ul, 139ol, 144o<br />
Stadtwerke Düsseldorf: Seite 35o, 89ol, 114ur<br />
Ulrich Brzosa, Düsseldorf: Seite 6or, 26ur, 66ml, 66ur, 95o,<br />
138or, 154u<br />
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf:<br />
Seite 23, 24u, 28u, 43, 46ol, 46or, 61om, 85u, 90o, 95u<br />
Verkehrs- und Verschönerungs-Verein für den<br />
linksrheinischen Teil der Stadt Düsseldorf: Seite 58or<br />
Westdeutsche Zeitung, Düsseldorf: Seite 88ol, 88or, 89ol,<br />
91o, 91ur, 106m, 119or, 132u, 134mr, 136, 138ol, 139or<br />
Wilhelm Haberling, Die Geschichte der Düsseldorfer Ärzte<br />
und Krankenhäuser bis zum <strong>Jahre</strong> 1907, in: Düsseldorfer<br />
Jahrbuch 38 (1936), 1 – 141: Seite 49u<br />
Wolfgang Adolphs, Hilden: Seite 76ur<br />
200
Zum <strong>150</strong>-jährigen Gründungsjubiläum der Katholischen Stiftung Marien Hospital<br />
zu Düsseldorf schildert Ulrich Brzosa das bürgerschaftliche Engagement für die<br />
Gründung eines katholischen Krankenhauses in Düsseldorf und seine Entwicklung<br />
durch die Zeitläufte vom Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
über das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Einschnitte der beiden Weltkriege<br />
bis in die Gegenwart. Brzosa schöpft aus einem reichen Quellenfundus, aus dem<br />
heraus er den Lesern Geschichte auch als Geschichten lebendig vor Augen führt.<br />
In einem zweiten Teil dokumentiert Richard Derichs als dienstältester Arzt am<br />
Marien Hospital und Zeitzeuge die jüngste Entwicklung seit der Einweihung des<br />
Neubaus im <strong>Jahre</strong> 1970 mit sorgfältig ausgesuchten und kenntnisreich kommentierten<br />
Fotos. Mit diesem <strong>Buch</strong> ist mehr als die Chronik nur eines Krankenhauses entstanden.<br />
Diese bildet den „roten Faden“ für eine Geschichte des Krankenhaus- und<br />
Gesundheitswesens in Düsseldorf.<br />
Ulrich Brzosa wurde 1962 in Düsseldorf geboren und studierte Katholische Theologie<br />
und Geschichte in Bonn und Wien. Er ist Mitarbeiter beim Caritasverband für die<br />
Stadt Düsseldorf und hat sich durch zahlreiche Veröffentlichungen zur Geschichte,<br />
insbesondere zur Kirchengeschichte der Stadt Düsseldorf, einen Namen gemacht.<br />
<strong>150</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Marien Hospital<br />
Mitten im Leben<br />
Mitten in Düsseldorf<br />
Herausgegeben von der<br />
Katholischen Stiftung<br />
Marien Hospital zu Düsseldorf