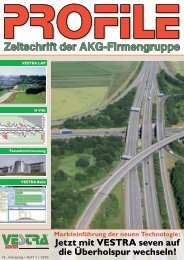Liebe Leserin, lieber Leser - AKG Civil Solutions
Liebe Leserin, lieber Leser - AKG Civil Solutions
Liebe Leserin, lieber Leser - AKG Civil Solutions
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
�
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>AKG</strong> Software<br />
Consulting GmbH<br />
Uhlandstraße 12<br />
79423 Heitersheim<br />
Tel. 0 76 34 / 56 12-0<br />
Fax 0 76 34 / 56 12-300<br />
Stralauer Platz 34<br />
10243 Berlin<br />
Tel. 0 30 / 28 52 91-0<br />
Fax 0 30 / 28 52 91-30<br />
Internet:<br />
www.akgsoftware.de<br />
E-Mail:<br />
info@akgsoftware.de<br />
Geschäftsführer<br />
Dipl.-Ing.<br />
Artur K. Günther<br />
Dipl.-Ing.<br />
Arno Brüggemann<br />
Dipl.-Ing. (FH)<br />
Bernhard Feser<br />
Redaktion<br />
Franz-Josef Knelangen<br />
Daniela Lentschewski<br />
Markus Körle<br />
profile@akgsoftware.de<br />
Anzeigen<br />
Peter Linder<br />
vertrieb@akgsoftware.de<br />
Herstellung<br />
Druckerei Winter<br />
Uhlandstraße 13<br />
79423 Heitersheim<br />
Auflage<br />
6.000 Exemplare<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
2<br />
Editorial<br />
Engagement im Hochschulbereich ................................ 3<br />
GAEB-VB 23.005 XML<br />
Bauabrechnung auf neuem Wege ................................... 4<br />
Modul VESTRA-RSA<br />
Baustellensicherung mit VESTRA (RSA-Pläne) ............. 7<br />
Geodäsie<br />
Netzausgleichung mit VESTRA leicht gemacht ............. 8<br />
Projektbeschreibung VESTRA CAD<br />
Ein neues Viertel am Ostbahnhof ................................ 10<br />
Baumaschinen-Ansteuerung<br />
Auf dem Weg zum internationalen Standard ................ 12<br />
Schulung<br />
VESTRA-Schulungen im Wandel der Zeit ................... 13<br />
GAEB-VB 23.005 XML<br />
Prototyping und Pilotprojekt ........................................ 14<br />
GAEB-VB 23.005 XML<br />
GAEB-VB 23.005 XML: Bauabrechnung heute ............ 16<br />
GAEB-VB 23.005 XML<br />
Werden die Erwartungen erfüllt? .................................. 20<br />
Neuerung in VESTRA<br />
VESTRA-Zwangspunktmanager .................................. 24<br />
Diplomarbeit über Maschinensteuerung<br />
VESTRA CAD auf dem Prüfstand .............................. 26<br />
VESTRA-Workshop<br />
Querschnitt: „Planen und Bauen im Bestand“ .............. 30<br />
Copyright © 2006 <strong>AKG</strong> Software Consulting GmbH<br />
Alle Informationen in dieser Zeitschrift werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Waren- und Markennamen werden ohne Gewährleistung der<br />
freien Verwendbarkeit benutzt. <strong>AKG</strong> Software Consulting GmbH kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung<br />
übernehmen. Alle Rechte inklusive fotomechanische Wiedergabe und Speicherung in elektronischen Medien vorbehalten. <strong>AKG</strong>®, <strong>AKG</strong> Software®, GE/Office®, KOSTRA®, OKview®,<br />
VESTRA®, VESTRA CAD®, VESTRA MAP®, VESTRA WEB® und WEGWEIS® sind eingetragene Marken der <strong>AKG</strong> Software Consulting GmbH. OKSTRA® ist eine einge-<br />
tragene Marke der BASt. Die in dieser Zeitschrift verwandten Marken und Bezeichnungen unterliegen dem Schutzrecht, auch wenn sie nicht gesondert ausgezeichnet sind.<br />
PROFILE 2/2006
PROFILE 2/2006<br />
<strong>Liebe</strong> <strong><strong>Leser</strong>in</strong>, <strong>lieber</strong> <strong>Leser</strong>,<br />
es gehört zu unserer Philosophie, offen für Innovationen<br />
zu sein. Das ist mit Forschung verbunden,<br />
im allgemeinen wie im institutionellen Sinne.<br />
Seit jeher pflegen wir daher einen engen und regen<br />
Kontakt zu den Hochschulen unseres Landes<br />
und unterstützen Forschungsprojekte sowohl<br />
finanziell als auch fachlich. Auch diese PROFILE-<br />
Ausgabe gibt Zeugnis davon (siehe Artikel S. 16<br />
und S. 26). Forschungsergebnisse der Hochschulen<br />
werden, soweit diese für unsere Software-Lösungen<br />
von innovativer Bedeutung sind, direkt in unsere<br />
Programmsysteme übernommen. Als Beispiel sei die Entwicklung des<br />
QuaSi-Bandes der Universität Karlsruhe aus dem Jahr 2001 erwähnt. Das<br />
QuaSi-Band ermöglicht eine qualitative Überprüfung der Sichtweite im<br />
Straßenverkehr und wurde in unser Programmsystem VESTRA integriert. Ein<br />
wesentlicher Bestandteil unseres Engagements im Hochschulbereich ist die<br />
direkte Unterstützung der Universitäten und Hochschulen bei Veranstaltungen<br />
und Vorlesungen. So bestehen seit mehreren Jahren Lehraufträge für die Universität<br />
Hannover und für die Technische Universität in Berlin. Es sind insgesamt<br />
72 Institute an Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen oder<br />
anderen Bildungseinrichtungen, die unsere Software-Produkte, vornehmlich<br />
der Produktlinie VESTRA, für Ausbildung, Lehre und Forschung nutzen. Der<br />
Schwerpunkt dieser Nutzung liegt in Deutschland, aber auch Universitäten in<br />
anderen europäischen Ländern und im Nahen Osten setzen unsere Software-<br />
Lösungen ein.<br />
Viele Studierende entschließen sich, eine Studien- oder Diplomarbeit mit einem<br />
System der VESTRA-Produktlinie durchzuführen. Sie bekommen hierbei vielfältige<br />
Unterstützung durch die <strong>AKG</strong>, etwa durch kostenlose Lizenzen für die<br />
Dauer der Diplomarbeit, durch kostenlose Schulungen und die Nutzung der<br />
<strong>AKG</strong>-Hotline. In den letzten Jahren konnte der Nachwuchs für unsere Abteilungen<br />
Support, Schulung und Vertrieb ausschließlich aus Absolventen von Universitäten<br />
und Hochschulen gewonnen werden, die bereits im Studium mit <strong>AKG</strong>-<br />
Produkten in Berührung gekommen waren. Für unsere Kundschaft bedeutet dies,<br />
dass sie bei Anfragen oder Problemstellungen immer einen fachkundigen und<br />
höchst kompetenten Gesprächspartner bei der <strong>AKG</strong> vorfinden wird. An dieser<br />
Stelle möchte ich den beteiligten Professoren und Assistenten für ihre gute Arbeit<br />
einmal ganz herzlich Danke sagen.<br />
Wir wollen unsere Hochschulkontakte mit neuen Ideen zusätzlich noch intensivieren.<br />
Beispielsweise werden wir zwecks Gedankenaustauschs einen Hochschultag<br />
organisieren und ein Forum für Studierende im Internet einrichten. Es ist<br />
für uns ein gewichtiges Anliegen sicherzustellen, dass sich die Studierenden der<br />
Sparte Verkehrswegebau bereits während ihrer Ausbildung mit modernster Bau-<br />
Software vertraut machen können, um dann gut vorbereitet ins Berufsleben einzutreten.<br />
Ihr A. K. Günther<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
3
Dipl.-Ing. Hermann<br />
Donat ist Mitglied im<br />
Arbeitskreises 14.11<br />
„Allgemeine Mengenberechnung“<br />
des<br />
Gemeinsamen Ausschusses<br />
Elektronik im<br />
Bauwesen (GAEB).<br />
XML: EXtensible<br />
Markup Language (erweiterbareAuszeichnungs-Sprache).Standard<br />
zur Erstellung<br />
maschinen- und menschenlesbarerDokumente<br />
in Form einer<br />
Baumstruktur. XML<br />
wird vom World Wide<br />
Web Consortium<br />
(W3C) definiert.<br />
AKS: Anweisung zur<br />
Kostenberechnung für<br />
Straßenbaumaßnahmen<br />
Die DIN 276 des<br />
Deutschen Instituts für<br />
Normung e. V. regelt<br />
die Kostenermittlung<br />
im Hochbau.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
4<br />
Bauabrechnung auf neuem Wege<br />
Von Dipl.-Ing. Hermann Donat<br />
Im Februar 2006 ist der Entwurf eines vom GAEB völlig neu konzipierten Verfahrens<br />
zur allgemeinen Mengenberechnung erschienen. Zwischen dem Bundesministerium<br />
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, der Bauwirtschaft, dem Bundesverband<br />
Bausoftware und einigen Software-Herstellern ist vereinbart worden,<br />
vor der offiziellen Einführung des Verfahrens seine grundsätzliche Eignung anhand<br />
eines Pilotprojektes zu erproben. Zum Leiter des Pilotprojektes wurde Prof. Dr.-<br />
Ing. Joachim Bahndorf berufen, der an der Fachhochschule Bielefeld lehrt. Frank<br />
Schaffner hat als Informatiker in seiner Diplomarbeit wesentliche Teile dieses Verfahrens<br />
bereits in ein Programm gegossen und damit die Realisierbarkeit bewiesen<br />
(siehe Artikel S. 22). Zwar ist von einer Studienarbeit noch kein professionelles<br />
Anwenderprogramm zu erwarten, aber der Weg dorthin ist geebnet.<br />
Ende und Neubeginn<br />
Wenn aus Aufmaßen und anderen Belegen Mengen<br />
berechnet werden sollen, verwendet man üblicherweise<br />
das REB-Verfahren 23.003 „Allgemeine Bauabrechnung“.<br />
An dieser Stelle werden die Mengen auch<br />
den Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses<br />
zugeordnet. Dieses REB-Verfahren gilt seit 1972<br />
unverändert, also seit weit über 30 Jahren. Es beruht<br />
auf der längst überwundenen Lochkartentechnik mit<br />
ihren 80-stelligen Datensätzen, mit ihrem Zwang<br />
zur Sortierbarkeit nach Adressen und den anderen<br />
bekannten Einschränkungen. Die Informationstechnik<br />
hat sich seitdem stürmisch entwickelt und<br />
ist in alle Bereiche vorgedrungen, so dass es an der<br />
Zeit ist, die neuen Technologien endlich auch für die<br />
Mengenberechnung zu nutzen. Außerdem sind die<br />
Anforderungen an ein solches Verfahren inzwischen<br />
erheblich gestiegen.<br />
Im Arbeitskreis 14.11 des Gemeinsamen Ausschusses<br />
Elektronik im Bauwesen (GAEB) wurde<br />
deshalb ein neues Verfahren entwickelt, das unter<br />
dem Titel „Allgemeine Mengenberechnung GAEB-<br />
VB 23.005 XML“ seit dem 06.02.2006 als Entwurf<br />
vorliegt. Zur Beschreibung der Daten hat man den<br />
internationalen Standard XML gewählt. Das heißt,<br />
die Daten befinden sich nicht mehr in einzelnen autonomen<br />
Datensätzen, sondern haben die Form eines<br />
Dokumentes, ähnlich dem eines strukturierten<br />
Schriftstückes, konsistent aufgebaut und in sich geschlossen.<br />
Bedingt durch das XML-Konzept konnten<br />
auch ganz neue Lösungen zur Berechnung von<br />
Mengen und deren Zuordnung gefunden werden, so<br />
dass dieses Verfahren mit seinem Vorgänger nicht<br />
mehr vergleichbar ist. Ergebnis des Verfahrens ist<br />
das XML-Dokument mit sämtlichen Eingabedaten<br />
und Ergebnissen. Es gestattet eine individuelle<br />
Auswertung, eignet sich zur digitalen Archivierung<br />
und kann mit einem entsprechenden Viewer betrachtet<br />
werden. Das Verfahren ermöglicht einen<br />
kontinuierlichen Datenaustausch zwischen den<br />
Vertragspartnern mit dem Ziel, bereits am Ende der<br />
Maßnahme über die geprüfte Mengenberechnung<br />
zu verfügen.<br />
Um einen raschen Einblick in das neue Verfahren<br />
zu erhalten, sollen im Folgenden die wichtigsten Be-<br />
griffe in der gebotenen Kürze angesprochen werden.<br />
Mengenelemente<br />
Aus den Angaben der Berechnungsunterlagen<br />
werden mit den Formeln des Formelkataloges<br />
Rechenansätze in Form von Mengenelementen gebildet.<br />
Innerhalb eines Rechenansatzes ist es möglich,<br />
die Werte selbst zu berechnen, so dass keine<br />
Hilfswertekonstruktionen erforderlich sind. Durch<br />
den besonderen Aufbau des Formelkataloges können<br />
umfangreiche Gebilde, wie die gesamte Fläche<br />
einer Straßeneinmündung, ganzheitlich in einem<br />
Rechengang bearbeitet werden, was die Übersicht<br />
und die Prüfung erleichtert. Überhaupt ist die<br />
Konzeption des Verfahrens immer auch darauf gerichtet,<br />
dem Benutzer am IT-System wieder eine natürliche<br />
Arbeitsweise zu gestatten, ohne verfahrensbedingte<br />
Tricks und mit grafischer Unterstützung,<br />
ein entsprechend intelligentes Programm vorausgesetzt.<br />
Struktur<br />
Jener Teil des XML-Dokuments, in dem die<br />
Mengen berechnet werden, kann in einer beliebigen<br />
Hierarchie strukturiert sein. Soweit die<br />
Mengenberechnung für die Ausschreibung oder<br />
die Vertragsabwicklung aufzustellen ist, dient<br />
als Struktur üblicherweise die Gliederung der<br />
Ordnungszahl des Leistungsverzeichnisses. Im<br />
Stadium der Kostenschätzung könnte aber auch<br />
die Gliederung der AKS oder diejenige nach DIN<br />
276 verwendet werden. Andere Betrachtungsweisen<br />
werden auch andere, zweckmäßigere Strukturen erfordern.<br />
Die Mengenelemente können jedoch durch<br />
die zusätzliche Angabe von hierarchisch aufgebauten<br />
Zuordnungsbegriffen von der einen in die andere<br />
Ordnung überführt werden.<br />
In der untersten Ebene der Struktur, angenommen<br />
eine LV-Position, befinden sich die<br />
Mengenelemente. Hier können sie vom Benutzer je<br />
nach den Erfordernissen beliebig angeordnet werden,<br />
so dass die Mengenberechnung nicht nur chronologisch,<br />
wie bisher, sondern auch topologisch aufgebaut<br />
sein kann. Damit steht zusammen, was zusammen<br />
gehört, und die Berechnung ist leichter auf<br />
Überlappungen und Lücken zu prüfen.<br />
PROFILE 2/2006
Neue Funktionen<br />
Häufig fallen Daten in Form von Tabellen an;<br />
man denke nur an den Bereich der Entwässerungsarbeiten.<br />
Deshalb erlaubt das Verfahren auch die<br />
Dateneingabe in frei zu gestaltende, mit umfangreichen<br />
Rechenfunktionen ausgestattete Berechnungstabellen<br />
ähnlich denen der bekannten<br />
Standardprogramme. Einzelne Werte und<br />
die Berechnungsergebnisse können dann aus den<br />
Tabellen in den Mengenelementen abgerufen werden.<br />
Das XML-Dokument kann auch Texte und Bilder<br />
enthalten. Aufmaßblätter, Skizzen, Beschreibungen,<br />
Fotos, Protokolle stehen dem Bearbeiter und dem<br />
Prüfer am IT-System direkt zur Verfügung und beschleunigen<br />
die Arbeit. Zahlreiche Möglichkeiten<br />
für Hinweise und Erläuterungen bieten Gelegenheit<br />
für eine bessere Transparenz als bisher.<br />
Manche Objekte, wie Schachtbaugruben, treten<br />
mit ähnlicher Form in großer Zahl auf und unterscheiden<br />
sich oft nur in wenigen Parametern, wie<br />
der Tiefe oder der Bodenklasse. In einem solchen<br />
Falle bietet sich die Bildung einer Vorlage an, bei<br />
deren Aufruf lediglich die wenigen veränderlichen<br />
Werte einzugeben sind. So lassen sich viele Aufgaben<br />
durch Vorlagen vereinfachen, besonders dann, wenn<br />
diese nicht jedesmal neu erfunden werden müssten,<br />
sondern auf einer Internet-Plattform öffentlich zugänglich<br />
wären.<br />
Wenn bestimmte Daten an mehreren Stellen<br />
benötigt werden, wie Punkte, Stockwerkshöhen,<br />
Aufmaßblätter, Skizzen oder ähnliches, werden sie<br />
als Variablen definiert und stehen zum Abruf zur<br />
Verfügung. Werte können auch berechnet werden.<br />
Es gibt global geltende Variablen, die im gesamten<br />
Dokument verfügbar sind, quellenbezogene<br />
Variablen, deren jeweiliger Wert von einer bestimmten<br />
Quelle abhängt, zum Beispiel einem Plan, und<br />
lokale Variablen, die nur in ihrem Mengenelement<br />
gültig sind. Texte und Bilder sind stets global verfügbar.<br />
Variablen werden unter ihrem Namen abgerufen.<br />
Da dieses Verfahren das Sammelbecken für alle<br />
Mengen bildet, die beispielsweise in die Rechnung<br />
eingehen sollen, auch für die, welche gar nicht<br />
mit diesem Verfahren errechnet worden sind, ist<br />
eine Schnittstelle zur Übernahme von externen<br />
Ergebnissen erforderlich. Über diese Schnittstelle<br />
werden auch andere externe Daten eingelesen, wie<br />
Werte, die für die weitere Berechnung benötigt werden<br />
sowie Texte, Bilder und andere. Durch einen<br />
Verweis auf die Herkunft des externen Objektes<br />
könnte bei der Prüfung sogar ein Rückgriff auf die<br />
Originalberechnung möglich sein. Die Schnittstelle<br />
ist so allgemein definiert, dass sie sowohl für<br />
OKSTRA- als auch für CAD-Objekte oder andere<br />
benutzt werden kann. Diese externen Daten werden<br />
wie globale Variablen behandelt.<br />
Aus Ergebnissen von Mengenelementen können<br />
beliebige Summen gebildet werden, auch über<br />
die Grenzen der Hierarchien hinweg, so dass man<br />
zum Beispiel Massenbilanzen aufstellen kann.<br />
Summen, Ergebnisse aus Mengenelementen und<br />
Zwischenergebnisse (das sind die im Rechenansatz<br />
selbst errechneten Werte) sind an allen relevanten<br />
Stellen abzurufen.<br />
Vorläufige oder überschlägig berechnete Mengen<br />
werden als solche gekennzeichnet und ihre Ergeb-<br />
PROFILE 2/2006<br />
nisse gesondert addiert. Vorausberechnungen, eigene<br />
Summen und eigene Zuordnungen, kurz alle Teile,<br />
die nicht am Datenaustausch teilnehmen sollen, erhalten<br />
ein besonderes Merkmal und werden nicht<br />
mit übergeben. Damit ist der Datenbestand sowohl<br />
beim Auftragnehmer als auch beim Auftraggeber<br />
für interne Zwecke nutzbar und eine redundante<br />
Datenhaltung wird überflüssig.<br />
Spezielle Berechnungen<br />
Neue Berechnungsmöglichkeiten vergrößern den<br />
Kreis der Anwendungen. In vielfältiger Weise können<br />
Monate, Wochen, Tage und Stunden berechnet<br />
werden. Der Berechnung von Fristen liegt das entsprechende<br />
Europäische Abkommen zugrunde. Der<br />
Arithmetische Ausdruck für Berechnungen in freier<br />
Schreibweise umfasst zahlreiche Funktionen, wie trigonometrische<br />
Funktionen, Bedingungsfunktionen,<br />
Tabellenfunktionen, und ist dadurch universell<br />
nutzbar. Bei profilweise zu berechnenden Mengen<br />
ist die Berücksichtigung des Schwerpunktes möglich.<br />
Schnittpunktberechnungen von Geraden sind<br />
zur Bildung von Querprofilen wichtig. Durch<br />
die Definition von Dreiecksmaschen kann der<br />
Aushub von vielen Baugruben errechnet werden.<br />
Gewichtsberechnungen für Stahl und andere<br />
Werkstoffe vervollständigen den Formelkatalog. Ist<br />
für eine spezielle Berechnung eine besondere, nicht<br />
im Formelkatalog enthaltene Formel erforderlich,<br />
kann man sie als Makro definieren.<br />
Zuordnungen<br />
Ein wichtiges Thema ist die Zuordnung von<br />
Mengen zu den verschiedensten Kriterien. Denn<br />
ein Bauprojekt wird häufig im Auftrag von vielen<br />
Beteiligten ausgeführt, die schließlich auch ihren<br />
Anteil an den Kosten zu tragen haben. Weiterhin<br />
werden Mengen nicht nur für die Abrechnung, sondern<br />
auch für das Controlling benötigt, welches<br />
aber anderen Ordnungskriterien gehorcht als denen<br />
des Bauvertrages. Immer wieder wird der Bezug<br />
zwischen Mengen und Abschlagsrechnungen gefordert.<br />
Oder es soll die Mengenberechnung, welche<br />
Grundlage der Kostenschätzung war, in die<br />
Struktur eines Leistungsverzeichnisses für die Ausschreibung<br />
überführt werden – und was für Anforderungen<br />
dieser Art sonst noch denkbar sind.<br />
Für solche Aufgaben können die Mengenelemente<br />
mit beliebig vielen Zuordnungen versehen werden,<br />
die es ermöglichen, das XML-Dokument mit entsprechenden<br />
Programmen auszuwerten oder die<br />
Mengenberechnung in einer anderen Struktur darzustellen.<br />
Datenaustausch<br />
Der Austausch der Daten zwischen den Vertragspartnern<br />
ist – erstmalig in einer solchen Verfahrensbeschreibung<br />
– eindeutig geregelt. Durch eine häufige<br />
wechselseitige Datenübergabe während der<br />
Bauzeit wird ein zunehmend identischer Datenbestand<br />
bei Auftragnehmer und Auftraggeber aufgebaut,<br />
so dass bereits am Ende der Maßnahme<br />
die geprüfte Mengenberechnung vorliegen kann.<br />
Es wird stets der gesamte Datenbestand als XML-<br />
Dokument übergeben. Die Prüfung erfolgt direkt<br />
am IT-System, wobei der Prüfer durch einen<br />
automatischen Abgleich zwischen dem empfangenen<br />
Datenbestand und seinem eigenen neue,<br />
geänderte, verschobene und gelöschte Daten erkennen<br />
kann. Die Prüfkennzeichen lauten „akzeptiert“<br />
oder „zurückgewiesen“. Außerdem hat<br />
OKSTRA: Objektkatalog<br />
für das<br />
Straßen- und<br />
Verkehrswesen<br />
www.okstra.de<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
5
Die Verfahrensbeschreibung<br />
kann bei<br />
dem Autor des Artikels<br />
bezogen werden.<br />
Kontakt:<br />
Hermann.Donat@F-KIRCHHOFF.de<br />
Oder per Download:<br />
www.gaeb23005.de<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
6<br />
er die Möglichkeit, Prüfbemerkungen anzubringen<br />
und den Auftragnehmer zu veranlassen,<br />
nach der Rückübertragung des Datenbestandes<br />
Beanstandungen auszuräumen oder<br />
abgewiesene Daten zu ändern. Mit diesem Datenaustausch<br />
steht ein Instrument zur Verfügung,<br />
das immer auch dann eingesetzt werden kann,<br />
wenn die Mengenberechnung von mehreren<br />
unabhängigen Stellen aufgestellt wird, wie bei<br />
Arbeitsgemeinschaften oder Nachunternehmern.<br />
Ausblick<br />
Hiermit liegt ein Verfahren vor, das den Software-<br />
Entwicklern die Voraussetzungen zum Einsatz mo-<br />
Abb. 1: Gegenüberstellung Ablauf Bauabrechnung nach 23.003 / 23.005 XML<br />
derner IT-Methoden bietet. Zusammen mit den<br />
Anwendern können sie neue Ideen verwirklichen<br />
und innovative, ergonomische Programme bereitstellen<br />
und vermarkten. Bedingt durch den XML-<br />
Standard ist das Verfahren zudem offen für weitere<br />
zukünftige Anforderungen.<br />
Das Verfahren wird einen notwendigen Generationswechsel<br />
einleiten. Die neuen Möglichkeiten,<br />
welche die interne Verwendung von XML eröffnet,<br />
der effektive Datenaustausch und die damit verbundene<br />
Prüfung am IT-System bilden das Zentrum des<br />
Wandels. Die Frage, ob denn eigentlich noch etwas<br />
gedruckt werden soll, ist schon fast entbehrlich.<br />
PROFILE 2/2006
Baustellensicherung mit VESTRA (RSA-Pläne)<br />
Von Dipl.-Ing. (FH) Joachim Hamann<br />
Es gibt praktisch keine Baustelle im öffentlichen Straßenraum, die nicht auf irgendeine<br />
Art und Weise wegen Unfallgefahr abgesichert werden muss. Bei kleineren<br />
Baumaßnahmen von kurzer Dauer genügt es oft, wenn das Bauunternehmen nach<br />
eigenem Ermessen eine Absperrung und Beschilderung vornimmt. Ansonsten, insbesondere<br />
bezüglich des Fahrzeugverkehrs, müssen die Richtlinien für die Sicherung<br />
von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) herangezogen werden.<br />
B<br />
ereits während vieler Jahre bietet <strong>AKG</strong><br />
für VESTRA-Anwender einen Beschilder-<br />
ungskatalog nach StVO an. In Verbindung<br />
mit den Punkt- und Liniensymbolen für Fahrbahnmarkierungen<br />
lassen sich damit seit langem<br />
Verkehrszeichen- und Markierungspläne erstellen.<br />
Solche Pläne dienen natürlich auch der Sicherung<br />
von Baustellen. Mit dem Programm WEGWEIS<br />
kombiniert konnte man auch Verkehrsschilder (z.B.<br />
Umleitungsbeschilderung) entwerfen, die für eine<br />
ganz bestimmte Baustelle benötigt wurden. In der<br />
Praxis gibt es unterschiedliche Anforderungen an<br />
Abb. 1: Regelplan B1/16<br />
Abb. 2: Plan-Auswahl<br />
PROFILE 2/2006<br />
die Planungsunterlagen<br />
zur Baustellensicherung.<br />
Häufig genügt ein Hinweis<br />
auf den betreffenden<br />
Regelplan aus<br />
den RSA oder das<br />
Beilegen einer Kopie<br />
des Regelplanes aus der<br />
Richtlinie. Zum Teil<br />
muss die Verwendung<br />
eines Regelplanes vom<br />
Projektierenden erläutert<br />
oder inhaltlich ergänzt<br />
bzw. verändert werden.<br />
Was bisher für VESTRA-Anwender fehlte, war eine<br />
einfache Möglichkeit, einen Regelplan schnell abzuändern,<br />
um ihn den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.<br />
Besonders aufwändig ist die Projektion<br />
eines Regelplanes auf eine maßstäbliche Lageplandarstellung.<br />
Viele Auftraggeber gehen dazu<br />
über, bei größeren Baumaßnahmen oder komplexen<br />
Baustellensicherungen (zusätzlich oder ohne<br />
Bezug zum entsprechenden Regelplan) einen maßstabsgetreuen<br />
Lageplan mit allen Schildern und sicherheitsrelevanten<br />
Angaben zu verlangen. Dies war<br />
bisher für einen VESTRA-Anwender mit sehr hohem<br />
Aufwand verbunden, weil es keine weitere softwareseitige<br />
Unterstützung gab.<br />
Neue Möglichkeiten mit VESTRA<br />
<strong>AKG</strong> hat nun einen Weg gefunden, wie Materialien<br />
zur Baustellensicherung sehr einfach mit Hilfe der<br />
Regelpläne erstellt werden können. Alle 73 Regel-<br />
pläne werden dem Anwender als AutoCAD-Vorlagen<br />
so genannten dynamischen Blöcken sehr rasch zu<br />
bewerkstelligen. Es geht dabei um Varianten der<br />
Beschilderung, Änderungen der Breiten- oder<br />
Verziehungslängen von Fahrspuren, unterschiedliche<br />
Arten von Absperrungen usw. Ein Mausklick<br />
wandelt z. B. die Absperrung mit Leitbaken in eine<br />
Absperrung mit Absperrschranke. Die Bemaßung,<br />
ebenfalls Teil des dynamischen Blockes, passt sich<br />
entsprechend an. Praxisgerechte Überlegungen<br />
lassen die Regelplanvorlagen so zu einer flexiblen<br />
Arbeitsgrundlage werden.<br />
Abb. 3 u. 4: Änderung eines Regelplanes mit dynamischem<br />
Block<br />
Weil es sich dabei um vordefinierte Zeichungselemente<br />
handelt, können die Regelpläne leicht<br />
in einen maßstäblichen Markierungs- und Beschilderungsplan<br />
für die Baustellensicherung umgesetzt<br />
werden. Die einzelnen Zeichnungsteile<br />
werden dann auf den Maßstab abgestimmt und in<br />
den Lageplan übernommen. Dies geschieht ganz<br />
einfach per „Drag & Drop“. Der Regelplan lässt<br />
sich neben den Lageplan in die Zeichnung einfügen.<br />
Anschließend werden die einzelnen Elemente<br />
mit der Maus auf den Baustellenbereich<br />
verschoben. Schließlich können Absperrungen<br />
oder Markierungen beliebig verkürzt werden,<br />
indem man lediglich am Bezugspunkt des<br />
dynamischen Blockes „zieht“. So entsteht auf<br />
Basis eines Regelplanes ein detaillierter maßstabsgetreuer<br />
Baustellensicherungsplan.<br />
zur Auswahl angeboten.<br />
Der für die Baustelle geeignete<br />
Regelplan wird<br />
ausgesucht und kann<br />
dann direkt bearbeitet<br />
werden. Die Anpassung<br />
ist auch bei einer Vielzahl<br />
von Möglichkeiten<br />
durch den Einsatz von Abb. 5: Maßstäblicher Baustellensicherungsplan<br />
Dipl.-Ing. (FH)<br />
Joachim Hamann<br />
ist Leiter der <strong>AKG</strong>-<br />
Niederlassung Berlin.<br />
Eine Demo des RSA-<br />
Moduls finden Sie auf<br />
unserer Homepage<br />
unter „Online-<br />
Kurzdemos“<br />
www.akgsoftware.de<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
7
Dipl.-Ing. (FH)<br />
Marco Schrempp ist<br />
bei der <strong>AKG</strong> Software<br />
Consulting GmbH in<br />
den Bereichen Schulung<br />
und Programm-<br />
Abnahme tätig. Allgemeines<br />
NETZ2D<br />
© Geodätisches Institut<br />
Universität Karlsruhe<br />
HEIDI<br />
© Prof. Dr. Reiner<br />
Jäger, FH Karlsruhe –<br />
Hochschule für Technik<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
8<br />
Netzausgleichung mit VESTRA leicht gemacht<br />
Von Dipl.-Ing. (FH) Marco Schrempp<br />
Im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft wurden viele infrastrukturelle Einrichtungen<br />
geschaffen, deren Realisierungen hohe Ansprüche an die Geodäten stellten.<br />
Genaue Bauabsteckungen und baubegleitende Überwachungsmessungen erfordern<br />
zu Beginn einer jeden größeren Baumaßnahme die Schaffung präziser und verzerrungsfreier<br />
Basissysteme. Diese Aufgabe übernehmen in der modernen Geodäsie<br />
leistungsfähige Ausgleichungsprogramme wie die VESTRA-Netzausgleichung, die im<br />
folgenden Beitrag vorgestellt wird.<br />
Die Berechnungsalgorithmen des VESTRA-<br />
Moduls Netzausgleichung, das für alle VESTRA-<br />
Plattformen erhältlich ist, basieren auf den<br />
Programmsystemen NETZ2D (Lageausgleichung)<br />
und HEIDI (Höhenausgleichung). Sie ermöglichen<br />
die Ausgleichung und Analyse ein- und zweidimensionaler<br />
redundanter geodätischer Netze nach der<br />
Methode der kleinsten Quadrate. Zur Beurteilung<br />
der Ergebnisse sind neben Genauigkeitsanalysen auch<br />
statistische Testverfahren (Global- und Einzeltests)<br />
integriert, die grobe Fehler im Beobachtungsmaterial<br />
aufdecken. Sämtliche Beurteilungsgrößen werden in<br />
der VESTRA-Netzausgleichung nicht nur in einer<br />
Liste dargestellt, sondern beim Mouseover „on the<br />
fly“ dargestellt. Damit erhält der<br />
Anwender im Handumdrehen<br />
eine visuelle Kontrolle.<br />
Abb. 1: Mouseover Fehlerbetrachtung<br />
Integrierte Ausgleichungsverfahren<br />
Alle Ausgleichungsverfahren können lage-, höhenmäßig<br />
oder kombiniert angewandt werden:<br />
• freie Ausgleichung: wahlweise als Gesamtspuroder<br />
Teilspurminimierung möglich, zur Aufdeckung<br />
grober Beobachtungsfehler und zur<br />
Beurteilung der inneren Netzgeometrie<br />
• stochastische Ausgleichung: zur Beurteilung der<br />
Güte der Anschlusspunkte<br />
• hierarchische Ausgleichung: zur Berechnung der<br />
endgültigen Neupunktkoordinaten<br />
Integrierte Testverfahren<br />
Statistische Testverfahren dienen hier zum Auffinden<br />
von groben Fehlern im Beobachtungsmaterial und<br />
sind daher aus der modernen Geodäsie kaum noch<br />
wegzudenken. Voraussetzung für solche Verfahren<br />
sind neben redundanten Messungen Schätzwerte<br />
für die zu erwartenden (a-priori) Genauigkeiten der<br />
einzelnen Beobachtungen (Richtungen, Strecken,<br />
Zenitdistanzen, Höhenunterschiede etc.), die<br />
den nach der Ausgleichung (a-posteriori) erzielten<br />
Genauigkeiten gegenübergestellt werden, sowie<br />
die Vorgaben der Irrtumswahrscheinlichkeit<br />
Alpha (5%) und der Testgüte Beta (80%). Im Modul<br />
Netzausgleichung wird zwischen dem Globaltest<br />
und den Einzeltests unterschieden. Der Globaltest<br />
ist den Einzeltests vorgeschaltet und beurteilt das<br />
gesamte Netz bzw. dessen mathematisches Modell.<br />
Eine mögliche Ablehnung kann beispielsweise in<br />
der falschen Annahme der a-priori Genauigkeiten,<br />
einer unzureichenden Modellbildung oder an der<br />
Verzerrung durch bestehende grobe Fehler im<br />
Beobachtungsmaterial liegen. Seine Ablehnung<br />
ist also nicht zwingend auf eine einzelne Fehlerart<br />
zurückzuführen! Diese Aufgabe übernehmen die<br />
Einzeltests in Form der a-priori bezogenen normierten<br />
Verbesserung des a-posteriori bezogenen<br />
Student-Test (t-Test).<br />
Vorgaben<br />
Folgende Beobachtungen und Vorgaben fließen in<br />
die VESTRA-Ausgleichung mit ein:<br />
• Horizontalrichtungen, Zenitdistanzen, Höhenunterschiede,<br />
Strecken<br />
• A-Priori-Standardabweichungen für Richtungen,<br />
Zenitdistanzen, Strecken, Höhenunterschiede,<br />
Instrumenten- und Zieltafelhöhen,<br />
für die Zentrierung und die<br />
Anschlusspunkte<br />
• Erdradius, Mittlerer Rechtswert, Mittlere Höhe,<br />
Refraktionskoeffizient für die Geodätischen<br />
Korrekturen (GK- und Höhenreduktion)<br />
• Koordinaten der Anschlusspunkte<br />
• Maßstab optional wählbar, entweder durch<br />
Definition der ersten Streckengruppe oder aus<br />
der Netzberechnung resultierend<br />
Jede Beobachtung oder jeder Anschlusspunkt kann<br />
wahlweise zur Berechnung aktiviert oder deaktiviert<br />
werden. Somit ist es möglich, gezielt fehlerbehaftete<br />
Messdaten aus der Ausgleichung herauszunehmen<br />
und ein optimales Ausgleichungsergebnis<br />
zu erzielen.<br />
PROFILE 2/2006
Abb. 2: Netzausgleichung mit Registerkarte<br />
„Statistische Parameter“<br />
Abb. 3: Netzausgleichung mit Registerkarte<br />
„Geodätische Korrekturen“<br />
Optimales Auswerteverfahren für die Praxis<br />
Für Ingenieurnetze unabdingbar ist zunächst die<br />
Durchführung der freien Netzausgleichung zur<br />
Aufdeckung grober Beobachtungsfehler und zur<br />
Beurteilung der inneren Netzgeometrie. Bei dieser<br />
Art Ausgleichung findet eine Lagerung auf<br />
Abb. 4: Datenliste mit Auflistung der Streckenfehler<br />
PROFILE 2/2006<br />
den Näherungskoordinaten aller (Gesamtspurminimierung)<br />
oder auf ausgewählten Punkten (Teilspurminimierung)<br />
im Messgebiet statt. Dadurch erhält<br />
man als Ergebnis ein Punktenetz, das allein ein<br />
Abbild der Beobachtungen ist.<br />
Grob fehlerhafte Beobachtungen werden zum<br />
einen durch die a-priori bezogene Normierte<br />
Verbesserung (NV) und zum andern durch den aposteriori<br />
bezogenen Student-Test (t-Test) aufgedeckt.<br />
Sind die a-priori Genauigkeiten sehr gut bestimmt,<br />
erweist sich die Normierte Verbesserung als das sensiblere<br />
Verfahren im Hinblick auf das Aufdecken<br />
der kleineren unter den groben Fehlern. Sind dagegen<br />
die a-priori Genauigkeiten schlecht bestimmbar<br />
oder gibt es eine hohe Redundanz (r > 20), so findet<br />
der a-posteriori bezogene Student-Test Anwendung.<br />
Zur Transformation der Neupunkte ins Landesnetz<br />
empfiehlt sich zunächst das Verfahren der<br />
stochastischen Ausgleichung. Dabei werden die<br />
Anschlusspunkte nicht als „fehlerfrei“ betrachtet,<br />
sondern gehen mit einer Standardabweichung,<br />
in der Regel 2 cm, in die Ausgleichung mit ein.<br />
Die Lagerung des Netzes findet somit in diesem<br />
Korrridor der Festpunkte statt. Fehlerbehaftete Anschlusspunkte<br />
werden auf diese Weise entdeckt, so<br />
dass sie vom Ausgleichungsverfahren ausgeschlossen<br />
werden können und das Beobachtungsmaterial nicht<br />
mehr verfälschen.<br />
Nachdem nun sowohl die Beobachtungen als<br />
auch die Anschlusspunkte kontrolliert sind, kann<br />
im letzten Schritt die Berechnung der endgültigen<br />
Neupunktkoordinaten über das Verfahren der hierarchischen<br />
Netzausgleichung erfolgen. Die Festpunkte<br />
gehen als „fehlerfreie“ Punkte in die Ausgleichung<br />
ein, weshalb im Vorfeld unbedingt die freie und die<br />
hierarchische Ausgleichung berechnet werden sollten.<br />
Qualitätssicherung und -nachweis sind heute<br />
unverzichtbare Kriterien, mit denen sich sowohl<br />
der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer absichert.<br />
Diese hohen Forderungen können letztlich<br />
nur durch redundante Netzmessungen mit<br />
anschließender Ausgleichung erfüllt und als erfüllt<br />
nachgewiesen werden. Mit herkömmlichen<br />
Verfahren, etwa mit Polygonzügen, wird<br />
man den heutigen Ansprüchen in der Kataster-<br />
und Ingenieurvermessung nicht mehr gerecht.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
9
Manuela Sewerin<br />
ist Projektleiterin im<br />
Fachbereich Verkehrsanlagen<br />
bei der Voigt<br />
Ingenieure GmbH.<br />
Das Anschutz-Areal<br />
liegt sehr verkehrsgünstig,<br />
unmittelbar<br />
am Ostbahnhof und<br />
am U-Bahnhof<br />
Warschauer Straße.<br />
Die Mühlenstraße<br />
führt direkt zum<br />
Alexanderplatz.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
10<br />
Eine neues Viertel am Ostbahnhof<br />
Von Manuela Sewerin<br />
Ein neues Stadtviertel entsteht: Im Zentrum Berlins, in unmittelbarer Nähe des<br />
Ostbahnhofs und der Spree, wird ein 21 ha großes Grundstück erschlossen. Herz<br />
dieses Areals wird die Multifunktions-Arena „O2 World“ sein. Diese Arena der<br />
Superlative soll im Jahr 2008 erstmals ihre Pforten öffnen. In den vergangenen zwei<br />
Jahren wurde das Areal erschlossen. Die Planung der Verkehrsanlagen und das<br />
Erdbaumanagement führte die Voigt Ingenieure GmbH aus – mit VESTRA CAD.<br />
Das Anschutz-Areal / O2 World<br />
Das Areal des ehemaligen Ostgüterbahnhofs<br />
in Berlin wurde im Jahr 2001 von der Anschutz<br />
Entertainment Group Development GmbH erworben.<br />
Besonders attraktiv ist das 21 Hektar<br />
große Grundstück durch seine Lage: die unmittelbare<br />
Nähe zum Ostbahnhof. Hier halten sowohl<br />
Fern- als auch Regionalzüge und natürlich<br />
die Berliner U- und S-Bahn. Außerdem haben sich<br />
in der Umgebung des Ostbahnhofs schon einige<br />
Unternehmen aus der boomenden Medien- und<br />
Musikbranche und andere Dienstleister niedergelassen.<br />
Rund um die Spree ist mit der Oberbaum-<br />
City und den Spreespeichern bereits eine attraktive<br />
Nachbarschaft entstanden, verkehrgünstig gelegen<br />
direkt im Herzen Berlins.<br />
Im Zentrum des Anschutz-Areals entsteht nun<br />
eine der modernsten Multifunktions-Arenen der<br />
Welt: die O2 World. Mit maximal 17.000 Sitz- und<br />
Stehplätzen, 59 Entertainment-Suiten, Konferenz-<br />
und Party-Suiten wird sie in zwei Jahren der<br />
neue Ort in Berlin für nationale und internationale<br />
Events der Spitzenklasse in Sport, Kultur<br />
und Entertainment sein. Geplant sind bis zu 150<br />
Veranstaltungen im Jahr.<br />
Abb. 1: So wird die O2 World am Ostbahnhof im<br />
Jahre 2008 aussehen (Modellbild)<br />
Auch optisch wird das Gebäude einiges zu bieten<br />
haben: Auf der rund 20.000 m² großen Fassade<br />
wird eine 1.800 m² umfassende LED-Lichtpunkt-<br />
Installation dafür sorgen, dass die Front-Fassade zum<br />
großen Bildschirm wird und Besucher wie Passanten<br />
auf einmalige Art anspricht. Der Name der Arena<br />
verweist auf den zweiten Beteiligten: Die Anschutz<br />
Entertainment Group Development GmbH realisiert<br />
das Projekt gemeinsam mit O2 Germany in<br />
einer langfristig angelegten Partnerschaft. Die O2<br />
World wird natürlich nicht alleine auf dem Anschutz-<br />
Areal stehen. Rund um die Arena soll ein lebendiges,<br />
durchmischtes Stadtgebiet als Treffpunkt für<br />
Freizeit, Sport, Wirtschaft, Kultur und Arbeit entstehen.<br />
Das Ergebnis wird ein neuer Stadtteil in zentraler<br />
Lage Berlins sein mit einer Mehrzweckhalle<br />
der Superlative. Der erste Schritt ist die Erschließung<br />
des gesamten Areals und der Bau der O2 World, die<br />
2008 eröffnet werden soll.<br />
Unser Auftrag<br />
Die Anschutz Entertainment Group Development<br />
GmbH beauftragte die Voigt Ingenieure GmbH<br />
mit der Verkehrsanlagenplanung, der Bauleitung<br />
und der Bauoberleitung für das gesamte Areal.<br />
Weiterhin wurden die Leitungskoordination und<br />
ein abgestimmtes Erdbaumanagement, die Planung<br />
und Bauleitung der Lichtsignalanlagen und die<br />
Maßnahmen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination<br />
von Voigt Ingenieure erbracht.<br />
Abb. 2: Blick von der Warschauer Brücke auf die<br />
Gr0ßbaustelle am Ostbahnhof<br />
Da die bei Beauftragung vorliegenden Planungsgrundlagen<br />
nicht mehr den tatsächlichen Anforderungen<br />
des Projektes entsprachen, modifizierten<br />
und aktualisierten Voigt Ingenieure außerdem,<br />
parallel zur Erarbeitung der Ausführungsplanung,<br />
die Planung für die Verkehrsanlagen.<br />
Voigt Ingenieure GmbH – Das Unternehmen<br />
Das Ingenieurbüro, aus dem sich unser Unternehmen<br />
entwickelte, wurde bereits 1929 in Karlsruhe gegründet.<br />
Heute besitzt die Voigt Ingenieure<br />
Unternehmensgruppe mit rund 150 Mitarbeitern an<br />
verschiedenen Standorten in Berlin, Brandenburg<br />
und Süddeutschland umfangreiche Erfahrungen in<br />
der Beratung, Planung und Bauüberwachung auf<br />
den Gebieten der Ver- und Entsorgung. Die Beller<br />
Consult GmbH ist diejenige Beteiligungsgesellschaft<br />
der Voigt Ingenieure, die sich auf das wachsende<br />
Auslandsgeschäft speziell in den Bereichen Wasser/<br />
Abwasser konzentriert. Durch unsere weitverzweigte<br />
Unternehmensstruktur können kompetente<br />
Planer aus allen Fachbereichen auch kurzfristig<br />
zur Problemlösung herangezogen oder zusätzlich<br />
PROFILE 2/2006
vor Ort eingesetzt werden. Auf Grund der hohen<br />
Mitarbeiteranzahl sind wir in der Lage, Projekte<br />
entsprechender Größenordnungen zu übernehmen<br />
und so den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht<br />
zu werden. Wir legen größten Wert darauf,<br />
ein unabhängig beratendes Ingenieurbüro zu sein.<br />
Unser Unternehmen arbeitet mit vielen öffentlichen<br />
und privaten Auftraggebern wie Kommunen, den<br />
Behörden der Länder, Abwasserzweckverbänden,<br />
Industrieunternehmen und Erschließungsträgern in<br />
ganz Deutschland zusammen. Für Menschen planen!<br />
ist unsere Maxime, nach der wir jeden Tag große wie<br />
kleine Aufgaben lösen. Unser Unternehmen steht<br />
für die Umsetzung des Dienstleistungsgedankens<br />
und für wirtschaftliche, wenn nötig auch unkonventionelle<br />
Wege. Jeder unserer Kunden hat ein<br />
einzigartiges Bauvorhaben, dabei einen andern<br />
Anspruch, und alle haben unterschiedliche Budgets.<br />
Unser Ehrgeiz ist es, Planungen zu entwickeln, die<br />
jeweils perfekt zu unseren Kunden passen – und<br />
nicht zuletzt zu den Menschen, die später mit unseren<br />
Leistungen leben und arbeiten werden.<br />
Abb. 3: Areal vor Abbruch und nach Erdarbeiten<br />
VESTRA CAD – einfacher Einstieg, stete<br />
Begleitung<br />
Bei der Suche nach einer leistungsfähigen Planungs-<br />
Software entschied sich die Voigt Ingenieure GmbH<br />
für VESTRA CAD von <strong>AKG</strong>. Maßgebliches Entscheidungskriterium<br />
beim Vergleich der Alternativen<br />
war – neben dem Programmumfang wie z. B. der<br />
hohen Kapazität von 999 Achsen – insbesondere die<br />
Möglichkeit, in gewohnter AutoCAD-Umgebung<br />
zu arbeiten.<br />
Nach einer dreitägigen Schulung wurden bereits<br />
erste Aufgaben in VESTRA CAD erledigt. Die<br />
Verfügbarkeit selbsterklärender Assistenten bzw.<br />
Manager, wie etwa dem Achsmanager, erwiesen sich<br />
dabei als nützliche Hilfestellung. Voigt Ingenieure<br />
hat seit 2003 umfangreiche Planungsaufgaben mit<br />
VESTRA CAD bearbeitet. Bei der Anwendung bot<br />
der Support von <strong>AKG</strong> stets technische und projektbezogene<br />
Unterstützung. Vielfach wurden Vorschläge<br />
zur Erweiterung des Leistungsumfanges umgesetzt.<br />
Entsprechende Updates und Programmversionen<br />
wurden im Kundenbereich zum Download zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Umsetzung des Auftrages mit VESTRA CAD<br />
Das Erdbaumanagement war insofern eine entscheidende<br />
Instanz des Projektes, als einerseits<br />
große Volumina verschoben wurden, andererseits<br />
aus gestalterischen Gründen auch Erhöhungen<br />
PROFILE 2/2006<br />
des Geländeniveaus um bis zu zwei Meter nötig<br />
waren. Mit Hilfe von VESTRA CAD wurden<br />
Querschnitte durch das vorhandene und das geplante<br />
Gelände gegenübergestellt. Mit den Modulen<br />
Horizontmanager, Horizontvergleich und der darauf<br />
aufbauenden Mengenberechnung nutzten Voigt<br />
Ingenieure verschiedene Werkzeuge von VESTRA<br />
CAD für die Erfassung der Objekte im Plan und<br />
die Bestimmung der Mengen. Das Ergebnis: Ein<br />
erfolgreiches Erdbaumanagement, dem erhebliche<br />
Einsparungen zu verdanken sind, z. B. bei den<br />
Kosten für die Herstellung der Rohrgräben.<br />
Weitere Vorteile bei der Bearbeitung mit VESTRA<br />
CAD entstanden durch die Erstellung eines Deckenhöhenmodells.<br />
Mit diesem Modell konnte zum einen<br />
der Regenwasserabfluss der Straßen auf dem<br />
gesamten Areal überprüft werden, zum anderen<br />
erleichterte das Modell anderen Beteiligten das<br />
weitere Vorgehen, etwa bei der Berechnung der<br />
Schachthöhen für die Medien.<br />
Auch die Umsetzung von Planungsänderungen<br />
ließ sich durch die hierarchischen Abhängigkeiten<br />
der verschiedenen Objekte untereinander relativ<br />
unkompliziert gestalten. So werden etwa bei<br />
der Änderung einer Achse durch die bestehenden<br />
Datenbezüge die zugehörigen Objekte automatisch<br />
nachgeführt.<br />
Wenn das Programm einmal an seine Grenzen<br />
stieß, konnten in Kooperation mit <strong>AKG</strong> Lösungen<br />
gefunden werden: Für eine der großen<br />
Erschließungsstraßen zum Beispiel erwies sich<br />
die bisher ausreichende Deckenbuchbegrenzung<br />
auf neun Spuren als zu gering. Mit Hilfe der<br />
Fachleute des Supports von <strong>AKG</strong> konnte zuerst<br />
eine Übergangslösung gefunden werden, auf die<br />
dann schließlich eine Erweiterung der Anzahl der<br />
Deckenbuchspuren folgte.<br />
Abb. 4: Ausschnitt aus einem Deckenhöhenplan mit<br />
Höhenlinien<br />
Erfolgreicher Projektabschluss<br />
Die Multifunktions-Arena soll im Jahr 2008 erstmals<br />
ihre Türen öffnen. Berlin wird dann endlich über<br />
die lang ersehnte Bühne für hochwertige Sport- und<br />
Entertainment-Events verfügen. Die Endabnahme<br />
der von Voigt Ingenieure erbrachten Leistungen erfolgte<br />
im Juli 2006. Ein erster Schritt ist damit getan,<br />
das gut erschlossene Anschutz-Areal steht nun<br />
bereit für die bewegte Zukunft als neues Stadtviertel<br />
rund um die O2 World am Ostbahnhof.<br />
VESTRA CAD hat sich hierbei bestens bewährt<br />
und wird von Voigt Ingenieure auch bei<br />
der Realisierung anderer Großprojekte eingesetzt,<br />
zum Beispiel bei der Planung der Zaun-<br />
und Betriebsstraßen auf dem entstehenden<br />
Großflughafen Berlin Brandenburg International.<br />
Bauherr:<br />
Anschutz Entertainment<br />
Group Development<br />
GmbH<br />
Planungszeit:<br />
Jan. 2004 – Feb. 2005<br />
Bauzeit:<br />
März 2005 – Juli 2006<br />
Die Voigt Ingenieure<br />
GmbH im Internet:<br />
www.voigt-ingenieure.de<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
11
Dipl.-Inform. Stefan Frei<br />
ist Entwicklungsleiter<br />
bei der <strong>AKG</strong> Software<br />
Consulting GmbH.<br />
LandXML im Internet:<br />
www.landXML.org<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
12<br />
Baumaschinen-Ansteuerung:<br />
Auf dem Weg zum internationalen Standard<br />
Von Dipl.-Inform. Stefan Frei<br />
Als wichtiges Qualitätsmerkmal zur Bewertung der professionellen Einsatzfähigkeit<br />
von Software dient gerade im CAD-Umfeld häufig die Vielfalt der vom System<br />
unterstützten Datenformate. Ermöglicht diese den Kunden doch, Daten unterschiedlichster<br />
Quellen zu nutzen und in diversen Formaten weitergeben zu können.<br />
Auch der Austausch von Daten zur Ansteuerung von Baumaschinen zählt zu dieser<br />
Kategorie, stellte bisher aber mangels einheitlichen Standards eine besondere<br />
Herausforderung dar.<br />
Als professionelle Bau-Software unterstützt<br />
VESTRA natürlich bereits seit geraumer<br />
Zeit die Ansteuerung von Baumaschinen über eine<br />
bidirektionale Schnittstelle zur Maschinensteuerung.<br />
Diese Schnittstelle wurde in enger Zusammenarbeit<br />
mit unseren Kunden auf Baumaschinen des deutschen<br />
Herstellers Wirth ausgerichtet. Da bis heute<br />
aber kein produktübergreifender, leistungsfähiger<br />
und einheitlicher Standard zum Austausch<br />
von Maschinensteuerungsdaten zur Verfügung<br />
steht, waren alle bisherigen Lösungen ausschließlich<br />
Insellösungen, die zwangsläufig eine enge und<br />
untrennbare Kopplung von Planungssystem und<br />
Baumaschinen voraussetzten. Ein Einsatz im internationalen<br />
Umfeld war somit praktisch nicht realisierbar.<br />
Genau an diesem Punkt setzen die Aktivitäten<br />
der <strong>AKG</strong> in enger Kooperation mit der Wirth Elektroniksystem,<br />
der Leonhard Weiss GmbH & Co. KG<br />
und der Trimble Navigation Limited an. Als ambitioniertes<br />
Ziel dieser Zusammenarbeit wurde<br />
die Schaffung eines einheitlichen Standards zum<br />
Austausch von Maschinensteuerungsdaten zwischen<br />
Planungssystemen und Baumaschinen formuliert,<br />
der gerade auch den Anforderungen im internationalen<br />
Umfeld gerecht wird.<br />
Die wichtigste Voraussetzung zum Erreichen dieses<br />
Ziels bestand nun zunächst darin, ein bereits<br />
etabliertes, weit verbreitetes und international standardisiertes<br />
Datenformat als Basis nutzen zu können,<br />
das sich mit geringem Aufwand in Planungssysteme<br />
und Baumaschinen-Software integrieren<br />
ließ. Dieses Format sollte bereits von sich aus möglichst<br />
viele Datenobjekte zur Verfügung stellen, die<br />
im Rahmen der Ansteuerung von Baumaschinen<br />
benötigt werden. Ein solches Standardformat sollte<br />
auch flexibel genug sein, um darin alle spezifischen<br />
Anforderungen der Maschinensteuerung modellieren<br />
zu können.<br />
Mit Etablierung des Datenformats LandXML<br />
wurden all diese Bedingungen auf einen Schlag erfüllt.<br />
Version 1.0 wurde bereits im Jahre 2002 als<br />
systemunabhängiges, nicht-proprietäres Format<br />
zum Austausch von Daten im Bereich Vermessung,<br />
Tiefbau und digitale Geländemodellierung auf<br />
Initiative eines Konsortiums führender Soft- und<br />
Hardware-Hersteller sowie staatlicher Behörden<br />
standardisiert. Die Liste der LandXML unterstützenden<br />
Software umfasst heute zahlreiche Firmen,<br />
darunter weltweit führende Anbieter wie Autodesk,<br />
Bentley und Trimble. Da auch <strong>AKG</strong> diesen Standard<br />
bereits seit geraumer Zeit in ihre Produkte integriert<br />
und als erstes deutsches Software-Unternehmen<br />
Aufnahme in die Liste der registrierten Anbieter<br />
fand, waren die Voraussetzungen für eine erfolgreiche<br />
Umsetzung von Anfang an gegeben.<br />
Der neu entwickelte Maschinensteuerungs-<br />
Export als weiterer Bestandteil der VESTRA-Fachschalen<br />
erlaubt es dem Benutzer, ein komplettes<br />
digitales Geländemodell samt Bruchkanten und<br />
Umringpolygon an Baumaschinen weiterzugeben.<br />
Trassenbezogene Daten des Querprofils können in<br />
einem extra für diesen Zweck modellierten Format<br />
übertragen werden. Auch diese Erweiterung basiert<br />
auf LandXML und bleibt somit vollständig kompatibel<br />
zum bereits bestehenden Standard. Beispieldaten<br />
wurden bereits an die LandXML.org, das für die<br />
Standardisierung zuständige Gremium, übergeben<br />
und können in Kürze auf deren Internetseite eingesehen<br />
werden.<br />
Als Zielsystem steht zunächst die von Wirth<br />
Elektoniksystem entwickelte Maschinensteuerung<br />
zur Verfügung. Dank des neuen Datenaustausch-<br />
Standards können die erzeugten Daten aber auch<br />
ohne weiteren Aufwand von Systemen gelesen werden,<br />
die bereits einen LandXML-Import implementieren.<br />
Der erste Schritt zu einer längst überfälligen<br />
Standardisierung ist gemacht. Alle Voraussetzungen<br />
zu einer schnellen Verbreitung sind dank Rückgriff<br />
auf den international etablierten Standard LandXML<br />
gegeben. Die Zeiten proprietärer Insellösungen bei<br />
der Ansteuerung von Baumaschinen gehören somit<br />
hoffentlich bald der Vergangenheit an.<br />
Abb. 1: Baumaschinen-Ansteuerung in der Praxis<br />
PROFILE 2/2006
VESTRA-Schulungen im Wandel der Zeit<br />
Von Dipl.-Ing. Arno Brüggemann<br />
Die wachsende Funktionalität der modernen Computer-Programme bietet<br />
dem Benutzer ein riesiges Spektrum von Möglichkeiten, auch anspruchsvollste<br />
Aufgabenstellungen zu bewältigen. Der Schlüssel liegt dann in der optimalen wirtschaftlichen<br />
Nutzung dieses Angebots – eine große Herausforderung in unserer<br />
modernen Wissensgesellschaft. Die <strong>AKG</strong>-Schulungsabteilung unterstützt die<br />
Anwender seit Jahren mit maßgeschneiderten Angeboten.<br />
Kapitalbildung Human Ressources<br />
Bei jeder Ingenieurleistung stellt das Wissen der<br />
Mitarbeiter des Unternehmens das Kapital dar, das<br />
darüber entscheidet, ob ein Unternehmen wirtschaftlich<br />
gut aufgestellt ist oder nicht. Dabei spielt<br />
es keine Rolle, ob es um Vermessung, Planung,<br />
Ausführung oder Abrechnung geht. Die Anforderungen<br />
steigen hier kontinuierlich, immer<br />
mehr Projekte oder Varianten müssen mit immer<br />
kleineren Teams in immer kürzerer Zeit gestemmt<br />
werden.<br />
Angesichts dieser Lage hilft kein Klagen, sondern<br />
nur der Blick in die Zukunft. Die Mitarbeiter<br />
müssen immer optimal auf ihre Aufgaben vorbereitet<br />
sein. Dies beinhaltet neben einer gründlichen<br />
Einarbeitung in die Software selbstverständlich<br />
auch die ständige Bereitschaft zur Weiterbildung.<br />
Wo schulen?<br />
Schulung kann in einem unserer Schulungszentren<br />
(Heitersheim oder Berlin) abgehalten werden,<br />
gerne schulen wir aber auch vor Ort. Die <strong>AKG</strong>-<br />
Schulungszentren in Berlin und Heitersheim haben<br />
sich ganz auf die Arbeit mit VESTRA im<br />
Windows-Umfeld eingestellt. Ausgestattet mit hochmodernen<br />
Arbeitsgeräten und allen erforderlichen<br />
Präsentationsmedien können VESTRA-Anwender<br />
hier ihr Wissen in angenehmer Atmosphäre bestmöglich<br />
aufbauen bzw. erweitern und vertiefen.<br />
Was schulen?<br />
Das Angebot gliedert sich dabei in vier Bereiche: Die<br />
Einsteiger- oder Umsteiger-Schulungen begleiten den<br />
Neustart mit VESTRA. Bei den Vertiefer-Schulungen<br />
wird das Know-how der Anwender auf konkrete<br />
Anwendungen hin gezielt vermehrt. Die Workshops<br />
dienen der Entwicklung neuer Ideen, indem sie helfen,<br />
neue Möglichkeiten in der Projektbearbeitung<br />
zu erkennen. Vervollständigt wird das <strong>AKG</strong>-<br />
Schulungsangebot durch internetgestützte Kurse.<br />
Das ortsunabhängige Online-Lernangebot E-<br />
Training eröffnet VESTRA-Anwendern die<br />
Möglichkeit, gemeinsam mit einem <strong>AKG</strong>-Trainer<br />
spezifische Projekt-Aufgabenenstellungen über das<br />
Internet zu bewältigen.<br />
Workshops<br />
Aufgrund der Initiative vieler Anwender entstand<br />
das Angebot der Workshops. Ziel dieser<br />
Gruppenveranstaltungen ist es, bestehende<br />
Kenntnisse der Anwender in Bezug auf besondere<br />
Themen zu vertiefen und neue Perspektiven aufzuzeigen.<br />
Schulungen und Workshops sind bei der<br />
<strong>AKG</strong> aber keine Massenveranstaltungen, sie lassen<br />
individuellen Spielraum und richten sich nach<br />
PROFILE 2/2006<br />
den Wünschen der Teilnehmer. Durch realistische<br />
Projekte und Fallbeispiele wird der Unterricht besonders<br />
anschaulich und leicht verständlich gestaltet.<br />
Im kleinen Kreise erhalten unsere Teilnehmer auf<br />
Fragen direkt Antwort und erarbeiten im gemeinsamen<br />
Dialog praxisorientierte Lösungen.<br />
Bei den Workshops werden die angebotenen<br />
Themenschwerpunkte an einem Workshop-Tag (auf<br />
Seite 15 finden Sie eine Workshop-Übersicht) umfassend<br />
behandelt. Die Teilnehmer lernen Neues und<br />
bekommen Anregungen und Tipps, um eingefahrene<br />
alte Pfade verlassen und neue Wege beschreiten<br />
zu können. Diskussion und Erfahrungsaustausch<br />
mit anderen Workshop-Teilnehmern erweitern dabei<br />
ebenso den Horizont.<br />
E-Training<br />
Der jüngste Spross im Angebot<br />
der <strong>AKG</strong>-Schulung ist das E-<br />
Training, hervorgegangen aus großer<br />
Nachfrage, denn das Lernen am<br />
Arbeitsplatz gewinnt immer mehr<br />
an Bedeutung. Dabei bietet sich E-<br />
Learning als das Lernkonzept an,<br />
welches das elektronische Medium<br />
Internet nutzt. Das E-Training<br />
der <strong>AKG</strong> verbindet computergestützte Schulung<br />
mit den Vorteilen des trainerbasierten Lernens. E-<br />
Training eröffnet einerseits die Möglichkeit, gemeinsam<br />
mit einem <strong>AKG</strong>-Trainer Schulungen durchzuführen,<br />
andererseits lassen sich auch spezifische<br />
Projekt-Aufgabenstellungen über das Internet bewältigen<br />
(Projekt-Beratung). Mit unseren individuellen<br />
Angeboten für E-Training gewinnen unsere<br />
Kunden die Flexibilität, mit der sie VESTRA in der<br />
Praxis noch effektiver nutzen können.<br />
Anerkannte Fachkompetenz<br />
VESTRA-Schulungen werden nicht – wie bei vielen<br />
anderen Anbietern – durch externe Referenten<br />
durchgeführt, sondern von kompetenten Dozenten,<br />
die fest im Team der <strong>AKG</strong> eingebunden sind und<br />
seit Jahren ihre didaktische Qualifizierung unter<br />
Beweis stellen müssen. Denn die gleichbleibend<br />
hohe Qualität der <strong>AKG</strong>-Schulungen sichern wir<br />
durch laufende Qualitätskontrollen sowie mittels<br />
ständiger Aus- und Weiterbildung.<br />
Wir helfen gerne bei der Frage, welches<br />
der Angebote auf Ihre Wünsche und speziellen<br />
Anforderungen zugeschnitten ist. Ob Sie<br />
nun VESTRA-Neueinsteiger oder bereits versierter<br />
Anwender sind, wenden Sie sich einfach<br />
mit Ihren Vorstellungen an uns – wir schnüren<br />
das für Sie optimale Schulungspaket.<br />
Dipl.-Ing. Arno<br />
Brüggemann ist<br />
Geschäftsführer<br />
der <strong>AKG</strong> Software<br />
Consulting GmbH für<br />
den Bereich Kunden.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
13
Dr.-Ing. Joachim<br />
Bahndorf ist Professor<br />
an der Fachhochschule<br />
Bielefeld im Fachbereich<br />
Architektur, Bauingenieurwesen<br />
und<br />
Verkehrsbau.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
14<br />
Prototyping und Pilotprojekt „Allgemeine Mengenberechnung“<br />
nach GAEB-VB 23.005 XML<br />
Von Prof. Dr.-Ing. Joachim Bahndorf<br />
Um die Möglichkeiten der modernen Informationstechnik auch für die Berechnung<br />
von Mengen im Bauwesen zu nutzen sowie den dort gestiegenen Anforderungen<br />
Rechnung zu tragen, ist ein effizienteres Aufstellen und Prüfen der Mengenberechnung<br />
notwendig, um das seit 1972 unverändert bestehende REB-Verfahren 23.003<br />
„Allgemeine Bauabrechnung“ durch ein neues Verfahren abzulösen. Was dieses<br />
Verfahren beinhaltet, soll im folgenden Artikel kurz umrissen werden.<br />
Vom Arbeitskreis 14.11 der Arbeitsgruppe 14 Bauabrechnung<br />
des GAEB (Gemeinsamer Ausschuss<br />
Elektronik im Bauwesen) wurde der Entwurf<br />
„Allgemeine Mengenberechnung“ GAEB-VB 23.005<br />
XML aufgestellt und am 30.11.2005 verabschiedet.<br />
Der Arbeitskreis wurde gegründet, um das seit<br />
über 30 Jahren bestehende REB-Verfahren 23.003<br />
„Allgemeine Bauabrechnung“ durch ein neues zu ersetzen.<br />
Das neue Verfahren beschreibt, wie aus allgemeinen<br />
Unterlagen Mengen<br />
• berechnet<br />
• dem Leistungsverzeichnis oder vorgegebenen<br />
Kriterien zugeordnet<br />
• an den Auftraggeber übermittelt<br />
• vom Auftraggeber unmittelbar geprüft<br />
werden können. Das Verfahren dient damit vornehmlich<br />
der Mengenerfassung für die Bauabrechnung,<br />
aber unter anderem auch zu Planungen und Ausschreibungen.<br />
Die Beschreibung der Daten und der Datenstrukturen<br />
beruht auf der Dokumentensprache XML<br />
(EXtended Markup Language). Sie ist eine international<br />
anerkannte Beschreibungssprache zur Übertragung<br />
komplexer Strukturen, wie sie bei diesem<br />
Verfahren auftreten. Neben den anderen vielfältigen<br />
Möglichkeiten, die XML bietet, können die Daten<br />
zur Übertragung elektronisch verschlüsselt und mit<br />
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen<br />
werden.<br />
Abb. 1: Ganzheitlicher Ansatz der Mengenermittlung im Überblick<br />
Ziel<br />
Auf der gemeinsamen Sitzung beim Bundesministerium<br />
für Verkehr, Bau und Städtebau (BMVBS,<br />
damals BMVBW) im Juni 2005, an der Vertreter<br />
des Ministeriums, der BAST (Bundesanstalt für<br />
Straßenwesen), der FGSV (Forschungsgesellschaft<br />
für das Straßen- und Verkehrswesen), des GAEB,<br />
des BVBS (Bundesverband der Bausoftwarehäuser)<br />
und der Bauindustrie teilnahmen, wurde über<br />
die neue Verfahrensbeschreibung „Allgemeine<br />
Mengenberechnung“ informiert und diskutiert.<br />
Die Diskussion ergab, dass es sinnvoll wäre, so wie<br />
bei der Software-Erstellung allgemein üblich im<br />
nächsten Schritt einen Prototyp zu erstellen und<br />
dazu ein Pilotprojekt zu initiieren. Der Autor dieses<br />
Artikels erklärte sich bereit, das Pilotprojekt zu<br />
organisieren. Dazu wurden im zweiten Halbjahr<br />
2005 diverse Präsentationen und Gespräche geführt,<br />
um möglichst viele Personen und Institutionen für<br />
die Durchführung des Prototyping und für das<br />
Pilotprojekt zu gewinnen.<br />
Ziel des Prototyping und des Pilotprojektes ist<br />
es, die Leistungsfähigkeit der neuen Verfahrensbeschreibung<br />
„Allgemeine Mengenermittlung“<br />
GAEB-VB 23.005 XML unter Beweis zu stellen.<br />
Hierbei sollen auch Erfahrungen darüber gesammelt<br />
werden, welchen Aufwand deren vollständige<br />
Implementierung erfordert und wie sich bei<br />
den Anwendern Akzeptanz erzielen lässt. Erarbeitet<br />
PROFILE 2/2006
wurde zunächst ein strategisches Konzept, das folgende<br />
fünf Punkte umfasst:<br />
1. Mengenberechung und Bauabrechnung trennen<br />
2. Verfahrensbeschreibung und zugehörige Informationstechnik<br />
trennen<br />
3. Mengenberechnung kundenorientiert gestalten<br />
4. moderne Methoden des Datenaustauschs nutzen<br />
5. zukunftsweisende Informationstechnologien<br />
nutzen<br />
Bei der Durchführung des Pilotprojekts ist dieses<br />
5-Punkte-Programm von zentraler Bedeutung.<br />
Dazu kommen noch Marketing-Maßnahmen, um<br />
Anwender über die neue Verfahrensbeschreibung<br />
zu informieren. Ziel ist letztlich, die anstehende<br />
Verfahrensbeschreibung in eine REB-VB zu überführen.<br />
Übrigens gibt es derzeit auch verstärkte<br />
Bestrebungen, alle in der täglichen Praxis verwendeten<br />
REB-Beschreibungen zu aktualisieren.<br />
PROFILE 2/2006<br />
Vorgehensweise<br />
Im März 2006 wurde in Stuttgart ein „Kickoffmeeting“<br />
durchgeführt, zu dem alle am Pilotprojekt<br />
Interessierten geladen waren und wo man es<br />
initiierte. Nach diesem Treffen wurde der Leistungsumfang<br />
für Phase 1 festgelegt. Es erging die Bitte,<br />
bis Anfang Mai eine Teilnahmeerklärung mit der<br />
Zusage von Projektressourcen zurückzusenden und<br />
zu besagtem Leistungsumfang Stellung zu nehmen.<br />
Dank der zur Verfügung gestellten Projektressourcen<br />
wurde dann zügig mit der Implementierung des<br />
Prototyps begonnen. Im September 2006 wird<br />
Phase 1 voraussichtlich abgeschlossen sein, wobei der<br />
Leistungsumfang deutlich größer ausfallen wird als<br />
ursprünglich geplant. Mitte September 2006 findet<br />
dann die nächste Sitzung zum Pilotprojekt statt.<br />
An diesem Projekt sind die oben genannte<br />
Arbeitsgruppe 14 des Ausschusses GAEB, der<br />
FGSV-Querausschuss 3 „Informationstechnologien“,<br />
der BVBS, verschiedene Landesstraßenbauverwaltungen<br />
bzw. Landesbetriebe<br />
und die Bauindustrie beteiligt.<br />
VESTRA-Workshops: Termine 4. Quartal 2006<br />
Spezialitäten in der Achskonstruktion<br />
• Einsatz spezieller Konstruktionselemente<br />
• Optimale und schnelle Lösungen<br />
• Prüfung mit der Dynamischen Schleppkurve<br />
Heitersheim: 16.11.2006, Berlin: 13.11.2006<br />
Digitales Geländemodell<br />
• Analyse, Prüfung und Korrektur der Datengrundlage<br />
• Optimale Nutzung des DGM in VESTRA<br />
• Spezielle Anwendungen: Vermessung, Baugruben<br />
und Deponien<br />
Heitersheim: 07.12.2006, Berlin: 30.10.2006<br />
Spezialitäten im Querschnitt<br />
• Anwendung selbst definierter Bausteine<br />
• Optimale wirtschaftliche Gestaltung<br />
• Nutzen der Ergebnisse im Plan und im DGM<br />
Heitersheim: 12.12.2006, Berlin: 27.11.2006<br />
Besonderheiten bei Gradiente und Deckenbuch<br />
• Planung im Bestand<br />
• Gradientenberechnung im Knotenpunkt<br />
• Deckenhöhenplan<br />
Heitersheim 12.10.2006, Berlin: 04.12.2006<br />
Projekt-, System- und Datenverwaltung<br />
• Projektverwaltung und Parameterdateien<br />
• System- und benutzerdefinierte Kataloge<br />
• Fachbedeutungen und Datenaustausch<br />
Heitersheim: 31.10.2006, Berlin: 18.12.2006<br />
Grunderwerb mit VESTRA<br />
• Übernahme der Katasterdaten (z. B. ALK, ALB)<br />
• Ermittlung von Bedarfsflächen einschließlich<br />
Grunderwerbsplan<br />
• Erstellung des Grunderwerbsverzeichnisses<br />
Heitersheim: 23.11.2006, Berlin: 11.12.2006<br />
Bahnplanung mit VESTRA<br />
• Achs- und Weichenberechnungen<br />
• Gradienten- und Querschnittsdefinition<br />
• Trassenplan (Gleisvermarkung)<br />
Heitersheim: 30.11.2006, Berlin: 23.10.2006<br />
Überblick zur Straßenplanung mit VESTRA<br />
• Achsen und Gradienten konstruieren<br />
• Querschnitte definieren<br />
• Zeichnungen ausgeben<br />
Heitersheim: 09.11.2006, Berlin: 06.11.2006<br />
Neuerungen in VESTRA 6H „Hamburg“<br />
• Achsmanager und Achsassistenten<br />
• Fachbedeutungen<br />
• Digitales Geländemodell<br />
Heitersheim: 19.10.2006, Berlin: 16.10.2006<br />
Weitere Workshop- und Schulungstermine finden<br />
Sie im Internet unter www.akgsoftware.de. Anmeldung<br />
einfach online oder formlos per E-Mail an<br />
schulung@akgsoftware.de.<br />
VESTRA-Workshop mit Dozent Dipl.-Ing. (FH)<br />
Marco Schrempp (2. v. li.) und Teilnehmern (Landratsämter<br />
Heidenheim und Bodenseekreis)<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
15
Frank Schaffner arbeitet<br />
derzeit bei der <strong>AKG</strong><br />
Software Consulting<br />
GmbH an seiner<br />
Diplomarbeit, die Ende<br />
August 2006 an der<br />
Hochschule Furtwangen<br />
University im Fachbereich<br />
Informatik eingereicht<br />
wird.<br />
In Office 12 will<br />
Microsoft die Oberfläche<br />
komplett verändern.<br />
Menüs gibt<br />
es nicht mehr. Das<br />
vorherrschende Bedienelement<br />
ist nun<br />
eine von Microsoft<br />
als „Ribbon“ (Band)<br />
bezeichnete und horizontal<br />
angeordnete<br />
Ansammlung von<br />
Begriffen und Befehlen,<br />
die verschiedene<br />
Tätigkeitsfelder<br />
repräsentieren.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
16<br />
GAEB-VB 23.005 XML: Bauabrechnung heute<br />
Von Frank Schaffner<br />
Im Rahmen einer Diplomarbeit wurde die Verfahrensbeschreibung GAEB-VB<br />
23.005 XML in eine Anwendung implementiert. GAEB-VB 23.005 XML ist ein<br />
Entwurf, die bestehende REB-VB 23.003 „Allgemeine Bauabrechnung“ in das<br />
21. Jahrhundert zu leiten. Hierfür ist in Zusammenarbeit mit der <strong>AKG</strong> Software<br />
Consulting GmbH ein Prototyp entwickelt worden. Der nachfolgende Beitrag stellt<br />
die Implementierung und deren Ergebnis vor.<br />
Die „Allgemeine Bauabrechnung“ REB-VB<br />
23.003 besteht seit mehr als drei Jahrzehnten<br />
unverändert, das Verfahren arbeitet noch heute im<br />
„Lochkartenformat“. Dies bedeutet Einschränkungen,<br />
die viele Benutzer der modernen Informationstechnik<br />
nicht mehr hinnehmen möchten.<br />
Abb. 1: Übersicht Workflow „Allgemeine<br />
Mengenberechnung“ GAEB-VB 23.005 XML<br />
Abbildung 1 skizziert den Ablauf der Mengenberechnung.<br />
Sie vereint das Leistungsverzeichnis<br />
und Daten, die beispielsweise aus CAD-Systemen<br />
stammen können. Mittels der erzeugten XML-Datei<br />
werden alle Angaben, die zur Abrechnung benötigt<br />
werden, an den Prüfer übermittelt. Dieser führt eine<br />
Prüfberechnung durch. Er erhält einen Prüfbericht<br />
und die Möglichkeit, sich die Daten direkt am IT-<br />
System grafisch darstellen zu lassen. Der Prüfer<br />
kann Prüfvermerke in die XML-Datei einfügen. Bei<br />
Rückübermittlung zum Auftragnehmer kann dieser<br />
die Prüfvermerke auswerten und entsprechend auf<br />
die Vermerke reagieren.<br />
Die Anwendung<br />
Ziel bei der Umsetzung der Applikation ist die<br />
Implementierung der Verfahrensbeschreibung<br />
GAEB-VB 23.005 XML unter Einsatz modernster<br />
Technologien. Auch die Benutzerführung sollte so<br />
komfortabel wie möglich integriert werden.<br />
Zu Beginn der Diplomarbeit stand bereits fest,<br />
dass nicht alle Aspekte der Verfahrensbeschreibung<br />
in die zu erstellende Anwendung integriert werden<br />
können. Daher wurde die Anwendung in Bezug auf<br />
ihre Funktionalität beschränkt. In erster Linie sollte<br />
sich die Diplomarbeit auf die Mengenberechnung<br />
konzentrieren, da dies der zentrale Bestandteil<br />
des Verfahrens ist. Ebenso wurde die Anzahl der<br />
zu verwendenden Formeln auf ein Minimum begrenzt.<br />
Konstruierte Beispielprojekte dienen als<br />
Validierungsbasis und zeigen die Fähigkeiten des entwickelten<br />
Software-Moduls. Wie Abbildung 2 zeigt,<br />
besitzt die Anwendung keine Menüführung im klassischen<br />
Sinne. Hier wurde das so genannte „Ribbon“<br />
von Microsoft implementiert. Diese Neuerung des<br />
Software-Herstellers aus Redmond wird im kommenden<br />
Office 2007 enthalten sein.<br />
Abb. 2: Anwendung GAEB-VB 23.005 XML<br />
Microsoft hat die klassischen Menüs entfernt und<br />
durch Reiter ersetzt. Das „Ribbon“ kann kontextabhängig<br />
gesteuert werden, was einen hohen Grad an<br />
Benutzerführung zulässt. Zugegeben, die Neuerung<br />
ist gewöhnungsbedürftig, bietet aber eine Vielzahl<br />
neuer Möglichkeiten.<br />
Die Reiter, die in der Abbildung 2 unten zu sehen<br />
sind, trennen die dynamischen Daten von den statischen<br />
Daten des Verfahrens. Erstere wurden unter<br />
dem Begriff Mengenberechnung zusammengefasst<br />
und bezeichnen alle Daten (Leistungsverzeichnis,<br />
Makros, Summen, Tabellen u. v. m), die ständig<br />
Änderungen ausgesetzt sind. Statische Daten werden<br />
einmalig zu Beginn des Projektes definiert<br />
und dann nicht mehr modifiziert. In der Mengenberechnung<br />
ist das Leistungsverzeichnis abgebildet.<br />
Es besteht aus Gruppenstufen, Positionen und<br />
Mengenelementen. Gruppenstufen und Positionen<br />
dienen der Gliederung und werden auch als<br />
Ordnungszahlen bezeichnet. Die Mengenelemente<br />
enthalten die Daten, die für die Mengenermittlung<br />
von Bedeutung sind. Ein Mengenelement ist einer<br />
Position zugeordnet, eine Position kann mehrere<br />
Mengenelemente beinhalten. Der Aufbau bzw. die<br />
Formel-Zusammensetzung des Mengenelements<br />
ist in der Verfahrensbeschreibung genau geregelt<br />
und kann komplexe Formen abbilden. So kann ein<br />
Mengenelement beispielsweise eine Kreuzung, wie<br />
sie in Abbildung 4 dargestellt ist, anzeigen. Die komplexe<br />
Form der Kreuzung wird, wie die Skizze zeigt,<br />
solange in Teilflächen unterteilt, bis die Formeln<br />
des Verfahrens GAEB-VB 23.005 XML angewendet<br />
werden können.<br />
PROFILE 2/2006
Abb. 3: Skizze Aufmaß<br />
In der Praxis könnte der Vermesser bei einer<br />
Kreuzung die Koordinaten der markanten Punkte<br />
aufnehmen, digitalisieren und in die Anwendung<br />
eingeben. Dieses Vorgehen erfordert genaue Kenntnisse<br />
über die Formel-Zusammensetzung, wie sie<br />
das Verfahren fordert. Nach Eingabe der Daten erhält<br />
der Benutzer das folgende Ergebnis:<br />
Abb. 4: Grafisches Ergebnis der Eingabe<br />
Die Eingabe der Daten in Abbildung 4 erfolgte<br />
manuell über den Formeleditor. Jedes Mengenelement<br />
besitzt einen solchen Formeleditor, der<br />
Daten modifiziert. Beim Formeleditor wurde die<br />
„Zahlenblockerfassung“ realisiert. Das Wort bedeutet,<br />
dass bei manueller Eingabe der Werte nur der<br />
Zehnerblock auf der Tastatur verwendet werden<br />
darf. Einzige Ausnahme ist die Kennzeichnung einer<br />
Formelnummer. Hier muss der Formelnummer<br />
ein „F“ vorangestellt werden, damit der Editor erkennt,<br />
dass es sich um eine Formel handelt und nicht<br />
um einen Wert.<br />
Wird eine Formel eingegeben, so erkennt der<br />
Formeleditor, um welche Formel es sich handelt.<br />
Er ergänzt die Formelnummer mit einem kurzen<br />
Beschreibungstext und erzeugt die benötigte Anzahl<br />
von Parametern, die für jede Formelnummer genau<br />
definiert ist. Da es auch Formeln mit beliebiger<br />
Anzahl von Parametern gibt, erzeugt der<br />
Formeleditor hier die Mindestanzahl der benötigten<br />
Parameter. Will der Benutzer die Formel mit zusätzlichen<br />
Parametern erweitern, so selektiert er die<br />
Formel und betätigt die „*“-Taste des Zehnerblocks.<br />
Daraufhin wird ein neuer Parameter eingefügt.<br />
Will der Benutzer Parameter entfernen, so selek-<br />
PROFILE 2/2006<br />
tiert er diese und entfernt sie mit der „/“-Taste des<br />
Zehnerblocks.<br />
Jeder Parameter einer Formel kann, allerdings mit<br />
Einschränkungen, wieder eine Formel sein. Gibt<br />
ein Benutzer beispielsweise eine Flächenformel für<br />
ein Rechteck ein, so werden zwei Parameter erzeugt.<br />
Der erste Parameter ist die Breite, der zweite die<br />
Höhe. Jedem dieser Parameter kann entweder ein fixer<br />
Wert oder die Berechnung einer Streckenformel<br />
zugeordnet werden. Diese Einschränkungen werden<br />
von der Anwendung berücksichtigt. Bei Eingabe einer<br />
nicht zulässigen Formelnummer wird der Anwender<br />
darauf aufmerksam gemacht, dass die eingegebene<br />
Formel nicht an diese Position platziert<br />
werden kann.<br />
Ein großer Fortschritt des Verfahrens ist die<br />
Zuordnung von Dokumenten und Bildern zu einem<br />
Mengenelement. So können z. B. digitalisierte<br />
Aufmaßblätter an ein Mengenelement gebunden werden.<br />
Die Bilddateien werden im XML-Dokument<br />
mit abgelegt, so dass der Prüfer die Bilder in seiner<br />
Prüfanwendung ebenfalls betrachten kann. Die<br />
Implementierung dieser Funktion wurde als dockbares<br />
Fenster verwirklicht. Dies ermöglicht verschiedene<br />
Formen der Darstellung. Die Grafik kann eingedockt<br />
sein, dann sieht der Anwender nur ein Label.<br />
Selektiert er dieses Label, so öffnet sich die Grafik.<br />
Per Doppelklick kann die Grafik ausgedockt und in<br />
einem frei beweglichen Fenster dargestellt werden.<br />
Abb. 5: Zuordnung der Skizze zum Mengenelement<br />
Die grafische Darstellung einer Formel ist bereits<br />
auf mehreren Abbildungen dargestellt. Sie<br />
zeigt immer die Formel an, die im Formeleditor<br />
selektiert wurde. Bestehen die Daten der Formel-<br />
Zusammensetzung aus Koordinaten, kann die Form<br />
eindeutig und in korrekter Lage dargestellt werden.<br />
Die Grafik wird immer zentriert und skaliert im<br />
Grafikfenster angezeigt. Zusätzlich werden noch<br />
der Maßstab und ein kleines Koordinatensystem<br />
gezeichnet. Der Maßstab dient dem Benutzer als<br />
Anhaltspunkt für die Größe. Die Koordinaten werden<br />
als rote Markierungspunkte in der Zeichnung<br />
sichtbar. Die Markierungspunkte sind mit Tooltipps<br />
versehen und zeigen bei Berührung mit der Maus die<br />
Koordinaten des Markierungspunktes an. Zusätzlich<br />
kann die Passivgrafik in einem extra Fenster dargestellt<br />
werden (siehe Abbildung 6).<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
17
Im OKSTRA wird die<br />
grafische Sprache<br />
NIAM verwendet, um<br />
Modellierungen anschaulich<br />
zu präsentieren.<br />
NIAM basiert auf<br />
dem binary relationship<br />
model und ist eine<br />
ausdrucksstarke grafische<br />
Notation.<br />
Eine Übersicht über<br />
die im OKSTRA derzeit<br />
verwendeten<br />
Sprachelemente findet<br />
sich unter:<br />
www.okstra.de<br />
„Einführung“ / „Einführung<br />
in NIAM“ (PDF)<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
18<br />
Abb. 6: Externes Zeichnungsfenster<br />
Da die Parameter jeder Formel unterschiedlich<br />
definiert sind, existiert für jede Formel eine eigene<br />
Darstellungsform, die die Parameter der Formel anzeigt<br />
und die Berechnung der Formel bei Änderung<br />
eines Wertes korrekt umsetzt.<br />
Weitere Funktionen<br />
Die Funktionalität der Anwendung umfasst neben<br />
den Standardoperationen, wie das Öffnen und<br />
Speichern von Dateien, einige Import- und Exportfunktionen.<br />
So können beispielsweise Leistungsverzeichnisse<br />
importiert werden, die den GAEB DA<br />
XML-Formaten *.X81 - *.X86 entsprechen. Mit diesen<br />
Leistungsverzeichnissen kann in der Anwendung<br />
weiter gearbeitet werden. Nach dem Abspeichern liegen<br />
die Daten dann im XML-Dokument gemäß<br />
GAEB-VB 23.005 XML vor.<br />
Ebenso wurde ein Export für die Angebotsaufforderung<br />
(*.X83-Datei) entwickelt.<br />
Abb. 7: Export Angebotsaufforderung<br />
In dieser Datei stehen die Gruppenstufen und<br />
Positionen sowie die ermittelten Mengen zu jeder<br />
Position. Bei der Angebotsaufforderung werden die<br />
ermittelten Mengen mit Einheitspreisen verknüpft<br />
und ein Angebotspreis für die Baumaßnahme errechnet.<br />
Erweiterungen des Verfahrens<br />
Da heutzutage die meisten Daten digital vorliegen,<br />
wurde in dem Verfahren die Möglichkeit integriert,<br />
Daten aus CAD-Systemen zu übernehmen. Die Anwendung<br />
wurde bis zu diesem Zeitpunkt als eigenständige<br />
Anwendung gestartet. Zur Übernahme von<br />
Daten aus VESTRA CAD musste die Oberfläche<br />
als untergeordnetes Fenster in VESTRA CAD<br />
eingebunden werden. Die Vorgehensweise, Daten<br />
aus dem CAD-System zu übernehmen, ist für den<br />
Anwender sehr einfach gestaltet. Der Benutzer navigiert<br />
dann einfach zu dem Mengenelement, dem<br />
er ein Grafikobjekt aus dem CAD-System zuordnen<br />
möchte. Über eine Schaltfläche im Menü hat der<br />
Anwender die Möglichkeit, Daten aus dem CAD-<br />
System abzugreifen.<br />
Nach Selektion des Objektes im CAD-System<br />
wird die geometrische Form in Teilflächen zerlegt,<br />
die dann gemäß GAEB-VB 23.005 XML als<br />
Formelbaum dargestellt werden. Die Zerlegung ist<br />
vorerst nur für Flächen realisiert worden, die aus<br />
Linien und Kreisbögen bestehen. Der Algorithmus,<br />
der die Zerlegung durchführt, untersucht zuerst,<br />
ob mehrere Flächen selektiert wurden. Den<br />
Einzelflächen werden dann die zugehörigen Linien<br />
und Kreisbögen zugeordnet. Der Algorithmus<br />
zerlegt jede Einzelfläche in ein unregelmäßiges<br />
Vieleck und Parabelsegmente. Hierbei kann es zu<br />
Abzugsflächen kommen, d. h. der Algorithmus<br />
prüft, ob ein Parabelsegment innerhalb oder außerhalb<br />
des Vielecks liegt, um dann zu entscheiden, ob<br />
es sich um eine Abzugsfläche handelt oder nicht.<br />
Nach erfolgreicher Zerlegung der Geometrie in<br />
den Formelbaum des Verfahrens wird das Mengenelement<br />
angezeigt. Im Formeleditor wird wie gewohnt<br />
die Formel-Zusammensetzung angezeigt. Bei<br />
Selektion des Wurzelelementes des Formelbaums<br />
wird die Formel-Zusammensetzung im Grafikfenster<br />
gezeichnet.<br />
Eine weitere Neuerung des Verfahrens ist die<br />
Übernahme von Geometrien. Die Idee entstand<br />
durch die Überlegung, dass eine Geometrie eine<br />
Form eindeutig beschreibt. Eine Zerlegung ist nicht<br />
notwendig. Da die Übernahme von Geometrien<br />
nicht in der Verfahrensbeschreibung enthalten war,<br />
musste eine Datenstruktur entwickelt werden, mit<br />
deren Hilfe die Geometrien im XML-Dokument<br />
ablegt werden können. Die Datenstruktur ist allgemein<br />
modelliert, so dass alle CAD-Systeme diese<br />
nutzen können. Der Aufbau der Datenstruktur wird<br />
in der Abbildung 8 verdeutlicht.<br />
Abb. 8: NIAM-Diagramm der Geometrie<br />
Das NIAM-Diagramm zeigt, dass eine Geometrie<br />
entweder ein Volumenobjekt, ein Flächenobjekt oder<br />
ein Linienobjekt sein kann. Ein Volumenobjekt besteht<br />
aus einer Dicke und besitzt mindestens eine<br />
Fläche. Die Fläche wiederum ist durch Linien<br />
eindeutig beschrieben. Eine Linie kann entweder<br />
eine einfache Linie mit zwei Punkten oder ein<br />
Kreisbogen mit drei Punkten sein. Ein Punkt ist die<br />
kleinste Einheit in der abgebildeten Modellierung.<br />
Punkte, Linien, Flächen und Volumen beinhalten<br />
PROFILE 2/2006
Parameter, die die Objekte näher beschreiben. Solche<br />
Parameter können beispielsweise Punktnamen oder<br />
Fachbedeutungen sein.<br />
Die Geometrie kennzeichnet eine Fläche eindeutig.<br />
Berechnungen des Volumens, der Fläche oder einer<br />
Linie können ohne weiteres auch an Geometrien<br />
durchgeführt werden. Um die Geometrie in das<br />
Verfahren vorläufig einzubinden, wurden neue<br />
Formelnummern an die Geometrien vergeben.<br />
Die Formel 199 kennzeichnet eine Geometrie aus<br />
Strecken, 299 definiert Geometrien aus Flächen und<br />
399 bezeichnet Geometrien aus Rauminhalten. Eine<br />
Geometrie kann, wie eine Formelzusammensetzung,<br />
grafisch im Darstellungsfenster gezeichnet werden.<br />
Abbildung 9 zeigt, wie eine Fläche in der zerlegten<br />
Darstellungsform (links) und als Geometrie (rechts)<br />
dargestellt wird.<br />
Abb. 9: Vergleich Zerlegung / Geometrie<br />
Die Geometrien werden im XML-Dokument abgelegt<br />
und beim Datenaustausch übertragen. Die<br />
abgelegten Geometrien können in jedem beliebigen<br />
CAD-System, das die Verfahrensbeschreibung<br />
GAEB-VB 23.005 XML und die oben dargestellte<br />
Modellierung interpretieren kann, geladen und dargestellt<br />
werden. Jeder Anwender hat die Möglichkeit,<br />
die Geometrien an ein Geoinformationssystem<br />
(GIS) zu leiten. In der Anwendung wurde hierfür<br />
VESTRA GIS GeoMedia verwendet.<br />
Im GIS werden die Geometrien ähnlich wie im<br />
CAD-System angezeigt. Bei der Übergabe der Daten<br />
an ein Geoinformationssystem werden noch zusätzliche<br />
Daten übergeben. Die Zusatzinformationen sind<br />
Ordnungszahl und Beschreibungstext der Position,<br />
der die Geometrie zugeordnet wurde. Die GIS-<br />
Anwendung prüft, ob z. B. Flächenüberschneidungen<br />
PROFILE 2/2006<br />
vorhanden sind oder gar Flächen doppelt abgerechnet<br />
wurden. Eine solche Form der Prüfung kann das<br />
bestehende Bauabrechnungsverfahren derzeit nicht<br />
leisten, da kein Koordinatenbezug im Verfahren<br />
REB-VB 23.003 enthalten ist.<br />
Fazit<br />
Die Diplomarbeit hat gezeigt, dass die „Allgemeine<br />
Bauabrechnung“ durch das Verfahren GAEB-VB<br />
23.005 XML modernisiert werden kann. Die<br />
Bauabrechnung würde mit der GAEB-VB 23.005<br />
XML einen großen Schritt in Richtung moderner<br />
Informationstechnologie vollziehen und den gestiegenen<br />
Anforderungen Rechnung tragen. Durch<br />
die Nutzung der modernen IT eröffnet sich für die<br />
Bauabrechnung eine Vielzahl neuer Möglichkeiten,<br />
die eine Bauabrechnung wesentlich effizienter<br />
und übersichtlicher gestalten. Der vorhandene<br />
Formelkatalog ist für manuelle Eingaben unabdingbar.<br />
Kommen allerdings Geometrien hinzu, hat sich<br />
gezeigt, dass auf den Formelkatalog weitestgehend<br />
verzichtet werden kann.<br />
Auch die Prüfung wird vereinfacht, da der Prüfer<br />
Daten direkt am IT-System auswertet. Sind die<br />
Daten in Form von Geometrien enthalten, kann<br />
eine Prüfung auch mittels Geoinformationssystemen<br />
vorgenommen werden. Mit einem solchen Prüfwerkzeug<br />
wird die Prüfung definitiv leichter nachvollziehbar.<br />
Am Beispiel der Geometrien hat sich gezeigt, dass<br />
eine Weiterentwicklung des Verfahrens unbedingt<br />
notwendig ist. Das Verfahren ist aufgrund der XML-<br />
Struktur sehr gut erweiterbar. Neuerungen können<br />
ohne Probleme nachträglich angebunden werden,<br />
was für die Verwendung dieses Verfahrens spricht.<br />
Das Ziel des Prototyps war es, einen Nachweis<br />
über die Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit<br />
der Verfahrensbeschreibung GAEB-VB 23.005<br />
XML zu erbringen. Mit der erstellten Anwendung<br />
wurde dieses Ziel erreicht. Erweiterungsmöglichkeiten,<br />
die noch nicht Bestandteil des Verfahrens<br />
sind, wurden ebenfalls aufgezeigt.<br />
Die GAEB-VB 23.005 XML hat auf jeden Fall<br />
das Potential, die schon in die Jahre gekommene<br />
„Allgemeine Bauabrechnung“ REB-VB 23.003 abzulösen,<br />
wenn ihr eine Chance gegeben wird.<br />
Abb. 10: Der Diplomand mit den Betreuern (von links): Frank Schaffner, Dipl.-<br />
Ing. Hermann Donat, Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Feser, Prof. Dr.-Ing. Joachim<br />
Bahndorf und Dipl.-Ing. (FH) Ralf Rosenthal<br />
Mehr Informationen<br />
zur Verfahrensbeschreibung<br />
GAEB 23.005<br />
XML und zu der<br />
Diplomarbeit unter:<br />
www.gaeb23005.de<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
19
Dipl.-Ing. (FH)<br />
Bernhard Feser ist<br />
Geschäftsführer bei<br />
der <strong>AKG</strong> Software<br />
Consulting GmbH für<br />
den Bereich Produkte.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
20<br />
Erfüllt die GAEB-VB 23.005 XML die Erwartungen<br />
der Anwender?<br />
Von Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Feser<br />
Am 06.02.2006 wurde der Entwurf der neuen Verfahrensbeschreibung „Allgemeine<br />
Mengenberchnung“ GAEB-VB 23.005 XML veröffentlicht. Die Umsetzung des<br />
neuen Verfahrens in eine Anwendung war Gegenstand der Diplomarbeit von Frank<br />
Schaffner (siehe S. 16). Was Anwender von der GAEB-VB 23.005 XML erwarten<br />
können, wird im folgenden Artikel dargestellt.<br />
Seit 1972 werden die Mengen für die Bauabrechnung<br />
im REB-Verfahren 23.003 „Allgemeine<br />
Bauabrechnung“ ermittelt. Über 30<br />
Jahren lang ist dieses Verfahren technisch unverändert.<br />
Im Jahre 1972 gab es noch keine Festplatten<br />
(1973 IBM), zu dieser Zeit wurde gerade die erste<br />
Floppy Disk 8“ (IBM) vorgestellt und ein Jahr später<br />
kamen Festplatten auf den Markt (IBM). Als<br />
Speichermedium stand der „Allgemeinen Bauabrechnung“<br />
aus 1972 nur die Lochkarte mit ihren 80<br />
Spalten zur Verfügung.<br />
Heute zeigt sich, dass die Anwendung des REB-<br />
Verfahrens 23.003 „Allgemeine Bauabrechnung“ einfach<br />
an ihre Grenzen stößt. So ist z. B. die Länge der<br />
Ordnungszahl im Lochkartenformat auf 8 Stellen begrenzt<br />
und entspricht nicht mehr den heute üblichen<br />
Längen. Auch die Verwendung der Adressen stößt<br />
bei viele Anwendern inzwischen auf Unverständnis,<br />
obwohl die Sortierbarkeit der Datenzeilen selbst<br />
dann besteht, wenn der Lochkartenstapel mal auf<br />
den Boden gefallen ist. In den letzten 30 Jahren<br />
gab es schon viele Initiativen für eine Weiter- oder<br />
Neuentwicklung der REB-VB 23.003. Hier seien<br />
nur GAEB 23.004 mit seinem Lochkartenformat<br />
DA 12 oder die GAEB 23.004 XML genannt. Bis<br />
zum letzten Jahr sind aber alle Bemühungen gescheitert,<br />
nicht zuletzt daran, weil die Interessen und<br />
Vorstellungen zu unterschiedlich waren.<br />
Aufgabenstellung<br />
Für eine prototypische Anwendung der GAEB-<br />
VB 23.005 XML hatte die <strong>AKG</strong> Software<br />
GmbH eine Diplomarbeit ausgeschrieben. Eine<br />
Herausforderung, der sich Frank Schaffner von der<br />
Hochschule Furtwangen – Fachbereich Informatik<br />
– stellte. Seitens der Hochschule Furtwangen wurde<br />
die Arbeit von Herrn Prof. Dr. Dieter Ongyert betreut,<br />
bei der <strong>AKG</strong> unterstützte Dipl.-Ing. (FH)<br />
Ralf Rosenthal die technische Umsetzung. Für<br />
Fragen hinsichtlich der praktischen Anwendung<br />
hielt sich Herr Prof. Dr.-Ing. Joachim Bahndorf<br />
von der Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich<br />
Architektur und Bauingenieurwesen, zur Verfügung<br />
(siehe Artikel S. 14). Die Erläuterung der neuen<br />
GAEB-VB 23.005 XML wurde vom Mitautor<br />
der GAEB-Verfahrensbeschreibung Dipl.-Ing.<br />
Hermann Donat übernommen (siehe Artikel S. 4).<br />
Damit stand dem Diplomanden ein überaus kompetentes<br />
Team zur Verfügung. An dieser Stelle sei<br />
nochmals allen Beteiligten für ihre unentgeltliche<br />
Mitarbeit gedankt.<br />
Im Rahmen einer solchen Arbeit kann man<br />
nicht die gesamte GAEB-VB 23.005 XML umsetzen.<br />
Daher wurde ein Mengenberechnungsbeispiel<br />
aus der Praxis gewählt. Als Schwerpunkt<br />
bestimmte man eine Anwendungsoberfläche für<br />
die Verfahrensbeschreibung und die Geodaten-<br />
Abb. 1: Mengenerfassung: Digitales Aufmaß mittels Zeiss Elta 4 Tachymeter mit elektronischem<br />
Feldbuch; grafische Kontrolle der Aufnahme und Selektion für die Positionszuordnung<br />
in VESTRA CAD; GAEB-Anwendung mit Import des Leistungsverzeichnisses;<br />
Zuordnung der grafischen Selektion zu einer Position und das Speichern in einer GAEB<br />
23.005 XML-Datei<br />
PROFILE 2/2006
Unterstützung des GAEB-Verfahrens. Für dieses<br />
Verfahren sollte eine moderne Oberfläche geschaffen<br />
werden. Die Aufmaße wurden vor Beginn der<br />
Diplomarbeit von einem Vermesser digital aufgenommen.<br />
Wegen der Umstellung von Lochkarten (spaltenorientierte<br />
Datenhaltung) auf XML (zeilenorientiertes<br />
Datenformat) ist der Anwendungsoberfläche<br />
besondere Beachtung zu schenken. Als Vorgabe für<br />
die Oberfläche diente das neue Microsoft Office<br />
2007 mit dem neuem „Ribbon“. Damit soll sich die<br />
Anwendung nahtlos in die zukünftige Office-Welt<br />
eingliedern. Bei der geografischen Betrachtung sollen<br />
moderne Aufnahmeverfahren entwickelt werden,<br />
um z. B. der von Prüfern gestellten Forderung nach<br />
Geobezug der Positionen nachzukommen. Die digitale<br />
Aufnahme über Messgeräte bot sich als ein<br />
schneller und präziser Weg mit dem Vorteil des sofortigen<br />
Geobezugs an. Die aufgenommenen digitalen<br />
Daten sollten zur grafischen Kontrolle in ein<br />
CAD-System importiert, das Leistungsverzeichnis<br />
als GAEB DA 81 XML eingelesen werden.<br />
Umsetzung der Aufgaben / Vorgaben<br />
Für den Prototyp wurde die Mengenberechnung auf<br />
Flächen beschränkt. Zu den Positionen wurden die<br />
selektierten Aufmaße in die Grafik eingefügt und die<br />
Geometrien dabei automatisch in GAEB-VB 23.005<br />
XML-Formeln umgesetzt. Die Mengenberechnung<br />
sollte dann im neuen Verfahren GAEB-VB 23.005<br />
XML gespeichert werden. Neben dem automatischen<br />
Datenfluss war auch die manuelle Eingabe des<br />
Aufmaßes gefragt. Die Mengenberechnung sollte zuerst<br />
in Formeln der GAEB-VB 23.005 XML-Datei<br />
in ein Prüfsystem übertragen und dort wieder eingelesen<br />
werden. Das Prüfsystem sollte neben der<br />
Inhaltsanzeige für Mengenberechnungen auch eine<br />
grafische Überprüfung ermöglichen. Als grafisches<br />
Prüfungswerkzeug wurde ein GIS ausgewählt. Mit<br />
dieser Vorgabe war der Diplomarbeit die Aufgabe<br />
gestellt, traditionelle und moderne Aufmaßverfahren<br />
in GAEB-VB 23.005 XML zu integrieren.<br />
Im ersten Teil der Dipomarbeit sollte eine Anwendung<br />
für das GAEB-VB 23.005 XML-Verfahren<br />
erstellt werden. Hierbei war der Umfang<br />
auf die Mengenberechnungsformeln der Fläche<br />
beschränkt. Neben der bereits erwähnten Office<br />
PROFILE 2/2006<br />
2007 Ribbon-Oberfläche bestand als weitere<br />
Vorgabe, dass die Aufmaße manuell über den<br />
Nummernblock der Tastatur eingegeben werden<br />
können. Leistungsverzeichnisse sollten über GAEB<br />
DA 81 XML eingelesen oder manuell erfasst werden<br />
können. Aufmaßblätter waren digital als Bilddatei<br />
zu hinterlegen.<br />
Digitales Aufmaß<br />
Für die Bauabrechnung war von einem Vermesser<br />
ein Parkplatz aufgenommen worden. Im Prototyp<br />
wurden die verschiedenen Flächen berechnet.<br />
Zunächst aber mussten die Daten vom Messgerät<br />
über ein Grafik-System zur Kontrolle und Selektion<br />
in den GAEB-Prototyp gelangen. Mittels grafischer<br />
Selektion konnten die einzelnen Flächen den<br />
Positionen zugeordnet werden. Bei der Zuordnung<br />
mussten die Flächen in Formeln aus der GAEB-VB<br />
zerlegt werden, da Letztere keine Geometrien zulässt.<br />
Unter der Formel 020 („Zusammengesetzte<br />
Flächen“) wurden dann die Flächen nach<br />
Formel 203 („Unregelmäßiges Vieleck“) und<br />
Formel 235 („Parabelsegment“) zerlegt. In der<br />
Verfahrensbeschreibung gibt es keine Bogenfläche<br />
und so musste diese als Parabelsegment angenähert<br />
werden. Beim Parabelsegment können allerdings<br />
nur die Aufmaßwerte Sehnenlänge und Stich angegeben<br />
werden, damit ließ sich die geografische<br />
Lage des Parabelsegments nicht fixieren. Die neue<br />
Verfahrensbeschreibung bietet jedoch Möglichkeiten,<br />
die Sehnenlänge aus einer anderen Formel zuzuweisen.<br />
Sehnenlänge und Stich lassen sich aus der<br />
Formel 102 („Strecke zwischen Punkten“) ableiten.<br />
Mit dieser nicht ganz übersichtlichen Methode können<br />
Flächengeometrien in das Verfahren übertragen<br />
und auch wieder in ihrer korrekten geographische<br />
Lage ausgegeben werden.<br />
Am Beispiel des Parkplatzes zeigten sich die<br />
Grenzen dieser Methode. Eine einfache Parkplatzfläche<br />
wird durch mehrere Formeln zerlegt und<br />
ist daher schwer prüfbar. So stellte man sich die<br />
Frage, warum denn nicht Geometrien unter einer<br />
Formel direkt gespeichert werden können. In<br />
vielen Systemen, wie z. B. im OKSTRA, können<br />
Geometrien einfach, nachvollziehbar, übersichtlich<br />
und von einem CAD-System in ein anderes übertra-<br />
Abb. 2: Datenübergabe der Mengenberechnung in GAEB 23.005 XML-Datei; einlesen<br />
der GAEB 23.005 XML-Datei und Prüfberechnung der Flächen mit grafischer<br />
Anzeige; grafische Prüfung der in der GAEB 23.005 XML-Datei enthalten Flächen<br />
mit VESTRA GIS GeoMedia durch Überlagerung und geografische Analysen<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
21
ALK: Automatisierte<br />
Liegenschafts-Karte<br />
Enthält grundsätzlich<br />
alle Informationen<br />
der analogen<br />
Liegenschafts-<br />
(Kataster-)Karte mit<br />
mehr Komfort und<br />
höherer Genauigkeit.<br />
Die Informationen<br />
sind in Objekte strukturiert<br />
und in verschiedenen<br />
Ebenen<br />
abgelegt, so kann z.B.<br />
auf Flurstücke, Gebäude<br />
und Nutzungsarten<br />
gezielt zugegriffen<br />
werden.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
22<br />
gen werden. Ein Problem, das schon in OKSTRA<br />
REB-VB 23.003 gelöst wurde. So enthält denn<br />
auch die Diplomarbeit einen Vorschlag, wie die<br />
Geometrie-Integration umzusetzen wäre.<br />
Prüfmethoden<br />
Wichtiger Aspekt in der Diplomarbeit war der<br />
Bereich Prüfung. In der REB-VB 23.003 ist es<br />
derzeit nicht möglich, eine Prüfung anhand der<br />
Geografie durchzuführen. Eine zentrale Forderung<br />
der Prüfer betrifft die Lage der Örtlichkeit einer<br />
Mengenberechnung, d. h. die Frage, wo sich die<br />
berechnete Fläche innerhalb des Komplexes befindet.<br />
Zur Prüfung gehört auch die Suche nach<br />
Flächen, die doppelt abgerechnet worden sind.<br />
Bei dem neuen Verfahren werden die Mengen-<br />
Positionen über eine GAEB 23.005 XML-Datei an<br />
den Prüfer übergeben und in die Prüfanwendung<br />
eingelesen. Der Prototyp ist in der Lage, zu einer<br />
Position die Teilflächen anzuzeigen. Des Weiteren<br />
kann die Geometrie jeder Fläche angezeigt werden.<br />
Dies ist aber nur ein kleiner Anwendungsbereich<br />
der heute möglichen Prüftechniken. Eine weiterer<br />
Schritt bestand in der Realisierung von geografischen<br />
Prüfungen. Dazu wurden die einzelnen<br />
Flächen in einem GIS ausgegeben. Hierzu wurde<br />
eine GIS-Applikation eingesetzt, die sehr weit verbreitet<br />
ist: GeoMedia von Intergraph. Die Flächen<br />
wurden mit ihren Ordnungszahlen im GIS abgelegt<br />
und die digitalen Planungsdaten hinterlegt. Damit<br />
könnte jeder Prüfer unmittelbar nachvollziehen, in<br />
welchen Bereich der Maßnahme welche Position<br />
fällt. Darüber hinaus wurde überlegt, welche GIS-<br />
Funktionalität für weitere Prüfung einsetzbar ist.<br />
So wurden als weitere Prüfmethode Flächen aus<br />
den Berechungsformeln einer Position miteinander<br />
verschnitten. Das Ergebnis lieferte die Flächen, die<br />
doppelt vorhanden waren. Bei dieser Art der geografischen<br />
Prüfung wurde offensichtlich, dass diese<br />
neue Methode dem Prüfer die Prüfung erleichtert<br />
und beschleunigt.<br />
Anwendungsbeispiele<br />
Im Prototyp wurde das digitale Aufmaß von<br />
Grünflächen mit einem Tachymeter ausgemessen.<br />
In der Grafik wird selektiert und der Position „Grünfläche<br />
anlegen“ zugeordnet. Dabei wird die nach<br />
GAEB-VB 23.005 XML Formel 020 („Zusammengesetzte<br />
Fläche“) bestimmte Fläche selbsttätig eingefügt.<br />
Wenn die Fläche nicht direkt mit einer GAEB<br />
23.005 XML-Formel berechnet werden kann, wird<br />
sie automatisch zerlegt.<br />
Abb. 3: CAD-Formel mit Grünfläche<br />
Abbildung 3 zeigt, wie sich die Inhalte der Flächen<br />
gemäß Formel 203 („Unregelmäßiges Vieleck“) zerlegen<br />
lassen. Die Ausrundungen werden in Flächen<br />
gemäß Formel 235 („Parabelsegment“) zerlegt. Da<br />
in der Formel 235 keine Koordinaten vorhanden<br />
sind, wird die Sehnen- und Stichlänge in die<br />
Formel 102 („Strecke zwischen Punkten“) zerlegt.<br />
Die Formel 102 besteht aus 2 Punkten, in denen die<br />
Gauß-Krüger-Koordinaten für die Sehnenlänge abgelegt<br />
werden können.<br />
Der Prototyp verfügt über moderne Möglichkeiten,<br />
Flächen zu berechnen und zu übergeben.<br />
Die mittels Tachymeter aufgemessenen Grünflächen<br />
werden der Position „Grünfläche anlegen“<br />
als Geometrie zugewiesen. Dies ist momentan leider<br />
in der GAEB-VB 23.005 XML nicht möglich.<br />
Daher müssen, wie in Abbildung 4 dargestellt, die<br />
Geometrien in die Formelflächen zerlegt werden.<br />
Abb. 4: Geometrie Grünfläche<br />
Werden die Prüfdaten, die über GAEB-VB<br />
23.005 XML übertragen sind, in ein GIS eingespielt,<br />
so stehen dem Anwender neue Prüfmethoden<br />
zur Verfügung. In Abbildung 5 wurde die ALK hinterlegt,<br />
um die Örtlichkeit zu prüfen. Eine weitere<br />
Möglichkeit wäre beispielsweise, dass Orthofotos<br />
der Landesvermessungsämter hinterlegt werden.<br />
Über Abfragen lassen sich die einzelnen Flächen berechnen<br />
und mit Position und Fläche beschriften.<br />
Abb. 5: GIS-Flächenabfrage<br />
Innerhalb eines GIS – wie VESTRA GIS<br />
GeoMedia – können weitere Prüfungen durchgeführt<br />
werden. In Abbildung 6 wurde überprüft, ob die mit<br />
GAEB-VB 23.005 XML übergebenen Flächen doppelt<br />
abgerechnet waren. Hierfür wurden die beiden<br />
Positionen 1.3 und 1.4 auf Überlagerung räumlich<br />
verschnitten. Die gelben Flächen kommen sowohl<br />
in der Position 1.3 als auch in 1.4 vor. Voraussetzung<br />
einer solche Prüfung ist, dass die Fläche mit ihren<br />
Geometrien auf Landeskoordinatensysteme aufsetzt.<br />
In der Diplomarbeit selber wurden nur einfache<br />
Prüfmethoden untersucht.<br />
PROFILE 2/2006
Abb. 6: GIS-Flächenverschneidung<br />
Abb. 7: In der GAEB-VB 23.005 XML müssen Flächen-<br />
Geometrien in die Flächen-Formel 203 („Unregelmäßige<br />
Vielecke“) und 235 („Parabelsegmente“) zerlegt werden,<br />
was eine sehr umständliche und unübersichtliche<br />
Methode ist. Die Abbildung zeigt, dass in der<br />
Diplomarbeit diese Zerlegung mit VESTRA GIS<br />
GeoMedia automatisch vorgenommen wird.<br />
Abb. 8: Geometrie Formelabfrage<br />
Abbildung 8 veranschaulicht die in Formeln zerlegte<br />
Flächen-Geometrie der Position 1.4 „Grünflächen<br />
anlegen“ (grüne Fläche) nach GAEB-VB<br />
23.005 XML. Die Grünflächen wurden in die Flächenformel<br />
203 „Unregelmäßiges Vieleck“ (braune<br />
Fläche) und 235 „Parabelsegment“ (blau schraffiert)<br />
zerlegt. Die Innenbögen wurden automatisch als<br />
Abzugsflächen (rot schraffiert) behandelt. Damit<br />
lässt sich sehr einfach und übersichtlich prüfen, wie<br />
in Formeln zerlegt wurde.<br />
PROFILE 2/2006<br />
Abb. 9: Manuelle Datenerfassung<br />
Fazit<br />
Innerhalb der Diplomarbeit wurden die Mengenberechnung<br />
für Flächen und ein Prototyp für<br />
die Verfahrensbeschreibung bearbeitet. Eine Aufgabe,<br />
die mit einem enormen Arbeitspensum<br />
verbunden war. Sie ließ sich meistern, da die<br />
Verfahrensbeschreibung in einer funktionellen<br />
Oberfläche umgesetzt werden konnte. Die<br />
Verwendung des Ribbon aus Office 2007 zeigt sehr<br />
anschaulich die vielen Möglichkeiten der modernen<br />
Benutzerführung. Der Einsatz der Summenformeln<br />
erleichtert für den Prüfer die Übersicht, so dass<br />
schnell deutlich wird, aus welchen Formeln die<br />
Position zusammengesetzt ist. Die direkte grafische<br />
Anzeige der Geometrie erwies sich als eine überaus<br />
sinnvolle Eingabehilfe, die dem Anwender sofort<br />
grobe Eingabefehler signalisiert. Die Umsetzung<br />
des Digitalen Aufmaßes war ein wichtiger Bestandteil<br />
der Diplomarbeit. Durch die automatische<br />
Zerlegung der Fläche in ein „Unregelmäßiges<br />
Vieleck“ (Formel 203) und in „Parabelsegmente“<br />
(Formel 235) konnte der Datenfluss veranschaulicht<br />
werden. Einer wichtigen Forderung vieler Prüfer, die<br />
Möglichkeit der Ortsbestimmung für die berechneten<br />
Flächen, konnte unter Verwendung der Formel<br />
„Strecke zwischen Punkten“ (Formel 102) entsprochen<br />
werden. Dadurch verdreifachen sich allerdings<br />
die Datensätze, was zu einer sehr umständlichen<br />
Methode der Datenübertragung führt.<br />
Die Diplomarbeit hat Lösungen für die Einbindung<br />
der Geometrie und klare Vorteile für die<br />
Prüfung aufgezeigt. Nun sollten Wege gefunden<br />
werden, wie aus dem vorliegenden Entwurf eine neue<br />
Verfahrensbeschreibung zur Mengenermittlung von<br />
der Planung bis zur Abrechnung entwickelt werden<br />
kann, die auch noch zukünftigen Anforderungen<br />
gerecht wird.<br />
Ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung ist<br />
die Umsetzung in eine REB-Verfahrensbeschreibung<br />
mit einem zertifizierten Prüfprogramm. Das eigentliche<br />
Dokument der GAEB-VB 23.005 XML ist<br />
sehr IT-technisch gehalten, so dass es für Anwender,<br />
egal ob Prüfer oder Ersteller, Verständnisprobleme<br />
geben kann. Hier sollte unterteilt werden in eine<br />
allgemeine Verfahrensbeschreibung und in eine ITtechnische<br />
Objektmodell-Beschreibung. In diesem<br />
Zusammenhang wäre zu überlegen, ob das XML-<br />
Modell durch eine moderne Datenmodellierung<br />
wie UML, Express oder ORM ersetzt wird. Die<br />
Modellierungsverfahren UML oder Express sind einfacher<br />
und leichter zu lesen und zu verstehen als die<br />
XML-Dokumentation. Als Datenaustauschformat<br />
könnte XML weiterhin vorgegeben werden. Auch<br />
würde sich die GAEB-VB 23.005 XML damit<br />
nicht auf ein Datenformat festlegen, sondern<br />
könnte leicht neuen Techniken angepasst werden.<br />
UML: Die Unified<br />
Modeling Language<br />
ist eine von der<br />
Object Management<br />
Group (OMG) entwickelte<br />
und standardisierte<br />
Sprache für<br />
Modellierung von<br />
Software und anderen<br />
Systemen<br />
Express: Definitionssprache<br />
des Normen-<br />
Paketes STEP (ISO-<br />
Standard 10303-11)<br />
ORM: Das von Dr.<br />
Tarry Halpin entwickelte<br />
Object Role<br />
Modeling dient dazu,<br />
im Rahmen der<br />
Datenmodellierung<br />
einen Ausschnitt der<br />
realen Welt zu beschreiben.<br />
Es beschreibt<br />
Objekte und<br />
ihre Beziehungen<br />
zueinander in einfachen<br />
Sätzen oder<br />
durch intuitive Diagramme.<br />
Weitere<br />
Informationen unter:<br />
www.orm.net<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
23
Dipl.-Ing. (FH)<br />
Christian Blattmann<br />
ist Abteilungsleiter<br />
Schulung bei der <strong>AKG</strong><br />
Software Consulting<br />
GmbH.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
24<br />
VESTRA-Zwangspunktmanager<br />
Von Dipl.-Ing. (FH) Christian Blattmann<br />
Die Projektierung einer Straße oder eines Gleiskörpers beginnt immer mit der<br />
Feststellung, welche Zwänge vorliegen, das heißt in welchen Bereichen sich die Maßnahme<br />
dem Bestand anpassen muss, wo z. B. bestimmte Abstände zu bestehenden<br />
Objekten (Gebäude, Versorgungseinrichtungen, topografische Besonderheiten)<br />
einzuhalten sind. Damit diese Objekte bei der Planung berücksichtigt werden können,<br />
sollten sie als Punkte oder Linien in der Projektdatenbank / Projektzeichnung<br />
vorliegen. Im Folgenden werden die Möglichkeiten vorgestellt, die sich bei der<br />
Projektbearbeitung mit VESTRA unter Verwendung von Zwangspunkten bieten.<br />
Beschreibung der Zwangspunktverwaltung<br />
Zwangspunkte sind immer einer Gruppe zugeordnet,<br />
eine Gruppe wiederum ist einer Achse zugeordnet.<br />
Alle Zwangspunkte werden mit Rechtswert,<br />
Hochwert und Höhe (Lagekoordinaten) und mit<br />
Station und Abstand (Achsbezug) in einem projektzentralen<br />
Zwangspunktspeicher abgelegt.<br />
Um eine Eindeutigkeit zu gewährleisten, ist der<br />
Zwangspunkt entweder „an die Achse gebunden“<br />
oder „von der Achse gelöst“: Ersteres bedeutet, dass<br />
der Zwangspunkt über Station und Abstand auf die<br />
Achse bezogen definiert ist und die Lagekoordinaten<br />
sich daraus ergeben. Von der Achse gelöst heißt, dass<br />
die Lagekoordinaten maßgebend sind und Station<br />
und Abstand sich daraus ergeben. Definiert man<br />
zum Beispiel einen bestehenden Kanaldeckel als<br />
„Zwangspunkt losgelöst von der Achse“, so werden<br />
die Station und der Achsabstand automatisch aktualisiert,<br />
sobald sich die Achsgeometrie ändert.<br />
Jeder Zwangspunkt kann einen Namen besitzen.<br />
Bei der Erfassung von Zwangspunkten aus der<br />
Projektdatenbank oder Projektzeichnung werden<br />
bereits vorhandene Punktnamen automatisch übernommen.<br />
Die Verwaltung der Zwangspunkte erfolgt über<br />
den Zwangspunktmanager. Hier können Zwangspunkte<br />
und Gruppen editiert oder gelöscht werden.<br />
Filterfunktionen ermöglichen schnelles und übersichtliches<br />
Kontrollieren des Punktbestandes.<br />
Im Zwangspunktmanager lassen sich auch so genannte<br />
Referenzen erstellen: Wurde zum Beispiel<br />
ein Zwangspunkt über Station und Abstand zu einer<br />
Achse definiert, so kann er als Referenz zu einer<br />
Zwangspunktgruppe einer anderen Achse eingefügt<br />
werden. Die Referenz kann nicht geändert<br />
Abb. 1: Zwangspunktmanager<br />
werden, passt sich automatisch an, sobald der eigentliche<br />
Zwangspunkt eine Änderung erfährt.<br />
Zwangspunkte aus dem Bestand<br />
Liegen in der Projektdatenbank oder Projektzeichnung<br />
Bestandsdaten z. B. einer topografischen<br />
Vermessung vor, so gibt es mehrere Möglichkeiten,<br />
diese als Zwangspunkte zu übergeben. Dabei können<br />
jeweils in der Grafik Punkte und Linien selektiert<br />
und für eine Achse als neue Gruppe übergeben<br />
oder einer bereits vorhandenen Gruppe<br />
angefügt werden. Im Achsmanager gibt es die<br />
Folgeberechnung Höhenzwangspunkt.<br />
Abb. 2: Selektionsdialog<br />
Über sie gelangt man in den Selektionsdialog,<br />
Punkte und Linien können ausgewählt und direkt<br />
als Zwangspunkte abgespeichert werden.<br />
Außerdem gibt es die neue Funktion Straßenbau<br />
/ Zwangspunktdiagnose / Zwangspunkte erfassen.<br />
Zudem können wie bisher für die Zwangspunktdiagnose<br />
Punktwolke benutzte Punkte als<br />
Zwangspunkte übergeben werden.<br />
PROFILE 2/2006
Im Zwangspunktmanager können Zwangspunkte<br />
mit Hilfe des Importassistenten auch aus einer Datei<br />
in eine Gruppe importiert werden.<br />
Zwangspunkte aus der Konstruktion<br />
Nicht alle Zwangspunkte ergeben sich aus dem<br />
Bestand. Während der Projektierung entstehen<br />
oft Punkte und Höhen, die für nachfolgende Berechnungen<br />
und Auswertungen wieder genutzt werden<br />
sollen. Hier wurde die Möglichkeit geschaffen,<br />
Höhenzwangspunkte für mehrere Verwendungen<br />
zu schaffen.<br />
Bei der Berechnung eines Achsschnittes kann optional<br />
für die erste Achse eine Zwangspunktgruppe<br />
erzeugt werden. Dabei wird die Gradientenhöhe<br />
als Zwangspunkthöhe berechnet. Haben beide<br />
Achsen Gradienten mit unterschiedlichen Höhen,<br />
werden zwei Zwangspunkte erzeugt. Kleinpunkte<br />
zu einer Achse können optional mit Übernahme<br />
der Höhe aus der Gradiente oder aus dem DGM<br />
berechnet werden. Jetzt können sie optional auch<br />
als Zwangspunktgruppe gespeichert werden. Bei<br />
der Berechnung einer Weiche werden automatisch<br />
auf dem Zweiggleis das Weichenende und die letzte<br />
durchgehende Schwelle als Höhenzwangspunkte<br />
berechnet. Diese stehen dann zum Beispiel für<br />
die Gradientenkonstruktion zur Verfügung. Bei<br />
der Berechnung einer Gleisverbindung werden 2<br />
Weichen eingerechnet, dementsprechend entstehen<br />
4 Zwangspunkte.<br />
Im Programmteil Gradiente / Querprofil können<br />
Zwangspunkte aus Horizonten gebildet werden. Die<br />
Zwangspunkte erhalten ihre Höhe aus einem frei<br />
zu wählenden Querprofilshorizont mit optionalem<br />
Höhenversatz. Der Abstand kann relativ zur Achse<br />
oder bezogen auf einen Spurrand des Deckenbuches<br />
definiert werden.<br />
Zwangspunktdarstellung / Auswertung<br />
Zwangspunkte können im Längs- und Querprofil<br />
dargestellt werden. Sie stehen zur Gradientenkonstruktion<br />
wie auch für Analysen zur Verfügung,<br />
z. B. für die Zwangspunktdiagnose in Lageplan,<br />
Längs- und Querprofil. In der Höhenplanzeichnung<br />
bietet sich die Möglichkeit, Höhenzwangspunkte<br />
über ein Band darzustellen. Ebenso können sie in<br />
der Querprofilszeichnung ausgegeben und beschriftet<br />
werden.<br />
Abb. 5: Zwangspunktdiagnose Deckenbuch<br />
PROFILE 2/2006<br />
Anwendungsbeispiel<br />
Für die Verwendung von Zwangspunkten gibt es<br />
eine Unzahl teils sehr spezifischer Beispiele; der<br />
hier beschriebene Fall behandelt die Planung eines<br />
Bahnübergangs. Um die Gradiente der zu querenden<br />
Straße zu bestimmen, soll die Schienenhöhe des bereits<br />
geplanten Gleises als Höhenzwangspunkte bereitgestellt<br />
werden.<br />
Abb. 3: Schienenpunkte im Lageplan<br />
Die Achse und die Gradiente des Gleises sind bekannt.<br />
Um die Schienenhöhen als Zwangspunkte zu<br />
übergeben, gibt es mehrere Möglichkeiten. So kann<br />
man zwischen der Gleisachse und der Straßenachse<br />
zwei Achsschnitte berechnen. Dabei würde man<br />
die Gleisachse seitwärts um jeweils den halben<br />
Gleisabstand verschieben. Als Ergebnis entstünden<br />
zwei Höhenzwangspunkte mit der Gradientenhöhe<br />
des Gleises an der entsprechenden Station.<br />
Abb. 4: Schienenpunkte im Längsprofil<br />
Im Programmteil Gradiente / Querprofil lassen<br />
sich Zwangspunkte den Gruppen entsprechend<br />
farblich differenzieren. Sie stehen dann bei<br />
der Gradientenkonstruktion zur Verfügung. Im<br />
Höhenplan können sie in gesonderten oder zusammengefassten<br />
Bändern ausgegeben werden.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
25
Dipl.-Ing. (FH) Philipp<br />
Rothenberger ist bei der<br />
Leonhard Weiss GmbH<br />
& Co. KG beschäftigt.<br />
Die Leonhard Weiss<br />
GmbH & Co. KG im<br />
Internet:<br />
www.leonhard-weiss.de<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
26<br />
VESTRA CAD auf dem Prüfstand<br />
Von Dipl.-Ing. (FH) Philipp Rothenberger<br />
Die Diplomarbeit „Begleitung eines Bauprojektes im Straßenbau von der Planung<br />
bis zur Bauausführung mit VESTRA CAD“ untersucht die Software der <strong>AKG</strong> auf<br />
Projekttauglichkeit im Bauwesen, und zwar zugeschnitten auf den Arbeitsablauf<br />
der Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG. In der Arbeit wurde u. a. die Genauigkeit<br />
eines maschinengesteuerten Graders untersucht. Die hierfür erforderlichen<br />
Messungen sind mit VESTRA CAD ausgewertet worden.<br />
Thema der Diplomarbeit<br />
Die Diplomarbeit wurde an der Fachhochschule<br />
Würzburg-Schweinfurt im Dezember 2005 beim<br />
Fachbereich Kunststofftechnik und Vermessung<br />
zum Abschluss des Studiums im Studiengang<br />
Vermessung und Geoinformatik eingereicht. Betreut<br />
wurde die Arbeit von Prof. Dipl.-Ing. Wolfram<br />
Schauberger seitens der Hochschule sowie von Dipl.-<br />
Ing. Hellmut Billinger von der Leonhard Weiss<br />
GmbH & Co. KG. Die <strong>AKG</strong> Software Consulting<br />
GmbH stellte für die Diplomarbeit kostenfrei eine<br />
VESTRA CAD Lizenz zur Verfügung.<br />
Schwerpunkt der Arbeit war einerseits die Überprüfung<br />
der Planungsdaten und deren Übertragung<br />
auf die Feldrechner und an die Baustelle. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt der Arbeit war, dass die Daten<br />
der Messung in VESTRA CAD überführt und<br />
dort ausgewertet wurden. Für die Bearbeitung der<br />
Diplomarbeit musste ein Bauprojekt im Straßenbau<br />
als Grundlage dienen, das möglichst viele<br />
Bearbeitungsschritte im Laufe der Bauausführung<br />
verlangte. Mit einer Verbindungsstraße im Raum<br />
Würzburg wurde ein Straßenbauprojekt gefunden,<br />
das diese Kriterien erfüllte. Ein kurz vor der<br />
Asphaltierung gemessenes Schotterplanum diente<br />
als Grundlage für die Erzeugung eines IST-DGM,<br />
welches mit einem aus der Planung abgeleiteten<br />
SOLL-DGM verglichen wurde. Die Diplomabeit<br />
beinhaltet eine Beschreibung der Kontrollmessung,<br />
den angesprochenen Vergleich und die Beurteilung<br />
der Ergebnisse.<br />
Maschinensteuerung<br />
Die Anforderungen an ein modernes Bauunternehmen<br />
steigen ständig. Die Vermessungstechniker<br />
und -Ingenieure sind es, die dafür sorgen, dass geplante<br />
Bauvorhaben zeitgemäß in die Örtlichkeit<br />
übertragen werden. Diese Aufgabe wird durch den<br />
Einsatz von maschinengesteuerten Baumaschinen<br />
(vor allem Raupen und Grader) wesentlich vereinfacht.<br />
Die Vorteile der Machinensteuerung im<br />
Überblick:<br />
• weniger geforderte Vermessungsarbeiten<br />
• Zeitersparnis bei der Bauausführung<br />
• Materialersparnis<br />
• Kostenersparnis<br />
• flächenmäßige Bauausführung<br />
Aufbereitung der Planungsdaten für die Maschinensteuerung<br />
Damit die Daten auch von den Maschinen gelesen<br />
werden können, müssen jene in einer gewissen<br />
Art und Weise vorliegen. Für eine Straße wird das<br />
Sollbuch der Trasse aus einer Deckenbuchberechung<br />
erzeugt. Dieses Deckenbuch wird bei der Leonhard<br />
Weiss GmbH & Co. KG mit der Software GEO-<br />
Samos des Ingenieurbüros Breining berechnet,<br />
als Grundlage dienen alle für das Bauprojekt relevanten<br />
Planungsdaten. Die Einstellungen für<br />
das Deckenbuch sind so zu treffen, dass sie firmeninternen<br />
Vereinbarungen entsprechen. Wie<br />
die Erfahrung gezeigt hat, liegt ein guter Wert für<br />
das zu wählende Stationsintervall (siehe Abbildung<br />
1 rechts oben) zwischen 2,00 und 2,50 m. Es bietet<br />
sich an, die Punktdichte bei Kuppen- und<br />
Wannenausrundungen gegenüber der Umgebung<br />
zu erhöhen. Grundsätzlich gilt jedoch, je weniger<br />
Punkte das aus dem Deckenbuch entstehende<br />
Sollmodell hat, desto schneller kann der Computer<br />
der Baumaschine die Trasse berechnen. Damit<br />
hängt auch zusammen, dass ein Modell maximal<br />
2.000 Meter lang sein darf und aus möglichst wenigen<br />
Querschnittspunkten definiert sein sollte.<br />
Abb. 1: Ausgabe eines Deckenbuches in GEO-Samos<br />
Nachdem alle Einstellungen vorgenommen sind,<br />
wird das Deckenbuch über den links unten befindlichen<br />
Button als eine so genannte 001-Datei ausgegeben.<br />
Nun wird das Programm geöffnet, welches den<br />
PC in der Maschine simuliert, das GP2 Tool 3D<br />
der Firma Wirth Elektroniksystem. Anschließend<br />
wird die 001-Datei geladen. Dabei kontrolliert die<br />
Software das erzeugte Deckenbuch auf Fehler und<br />
konvertiert es in eine Datei mit der Endung *.yxz.<br />
Abb. 2: Ausschnitt einer yxz-Datei<br />
PROFILE 2/2006
In diesem Format ist das Trassenmodell für den<br />
Bordcomputer des Graders lesbar. Um sicher zu gehen,<br />
dass die Konvertierung auch korrekt umgesetzt<br />
wurde, wird die erzeugte yxz-Datei neu in das<br />
GP2 Tool 3D geladen. Wenn dieser Import fehlerfrei<br />
abläuft und am simulierten Display des Graders<br />
eine Trasse mit den Informationen über Station,<br />
Querneigung usw. angezeigt wird, kann die Datei<br />
an die Baustelle bzw. an den Maschinisten übergeben<br />
werden.<br />
Für Böschungen, Kreisverkehre und Abbiegespuren<br />
ist die Grundlage der Maschinensteuerung<br />
keine Trasse bzw. Deckenbuch, sondern ein DGM.<br />
Zu diesem Zweck wird ein in VESTRA CAD berechnetes<br />
Geländemodell gemäß GAEB 22.114 exportiert.<br />
Die Dateiendung *.114 der daraus enstehenden<br />
Datei wird durch die Dateiendung DAT<br />
ersetzt. Genau wie bei der Sollmodellbildung aus<br />
einer Trasse wird auch die Datei in ein Format für<br />
die Maschinensteuerung umgewandelt. Modelle aus<br />
einer DGM-Berechnung haben die Dateiendung<br />
*.tri. Die Kontrolle der tri-Datei erfolgt analog zur<br />
yxz-Datei durch erneutes Laden.<br />
Übertragung der Planungsdaten an die<br />
Poliere<br />
Jede Baustelle wird von einem Vermesser betreut.<br />
Da dieser aber natürlich noch weitere Baustellen<br />
betreuen muss, ist er nicht ständig vor Ort. Damit<br />
die Poliere kleinere Probleme, die mit der Planung<br />
oder der Vermessung zu tun haben, selbst bearbeiten<br />
können, müssen die Planungsdaten auch für die<br />
Baustelle dauerhaft zur Verfügung stehen. Hierzu<br />
gehört in erster Linie, dass die Pläne stukturiert in<br />
einem oder mehreren Ordnern im Baucontainer<br />
vorhanden sind. Evtl. sind die Planungsdaten noch<br />
um Pläne oder Dokumente, die für das Bauprojekt<br />
wichtig sein könnten, zu ergänzen. Die Daten und<br />
Pläne vom Planungsbüro werden also in analoger<br />
Form dem Polier zur Verfügung gestellt.<br />
Zur Planungsdaten-Übertragung kann bisweilen<br />
auch die Bereitstellung eines weiteren Feldrechners<br />
gehören. Manche Bauarbeiter haben sich nämlich<br />
das einfache Vermessen und Abstecken mit einem<br />
GPS-Rover angeeignet. Für große Baustellen wird in<br />
der Regel ein Pfeiler für die GPS-Basisstation betoniert<br />
und die GPS-Anlage samt Rover verbleibt für<br />
die Dauer der Bauausführung an Ort und Stelle.<br />
Diese Anlage wird dann nicht nur für die Steuerung<br />
der Schubraupe mit GPS gebraucht, sondern auch<br />
um einfache Absteckungen oder Aufmaße durchführen<br />
zu können.<br />
Abb. 3: Grader im Einsatz (Quelle: Leonhard Weiss<br />
GmbH & Co. KG)<br />
PROFILE 2/2006<br />
Übertragung der Planungsdaten auf den<br />
Maschinen-PC<br />
Die Vermesser erzeugen die Daten für die Maschinensteuerung<br />
und kopieren diese auf eine 3,5 Zoll-<br />
Diskette. Die Modelldaten werden dann an den<br />
Maschinisten des Graders übergeben. Anschließend<br />
werden die Daten über das Diskettenlaufwerk des<br />
GP2-Bordcomputers eingelesen, um nochmals<br />
die Lauffähigkeit der erzeugten Daten zu prüfen.<br />
Falls die Daten bereits mit dem Wirth GP2 Tool<br />
3D funktioniert haben, treten gewöhnlich an dieser<br />
Stelle aber keine Probleme auf. Nach fehlerfreier<br />
Übergabe an den Wirth Maschinen-PC kann mit<br />
der Arbeit begonnen werden.<br />
Kontrollmessung<br />
Die zu erreichende Genauigkeit von maschinengesteuerten<br />
Baumaschinen wurde anhand einer<br />
Schottertragschicht untersucht, die ein so genannter<br />
ATS-Grader hergestellt hatte. Es wurde<br />
der IST-Zustand des Schotterplanums mittels<br />
Kontrollmessung bestimmt und mit dem aus der<br />
Planung ermittelten SOLL-Zustand verglichen.<br />
Bevor die Totalstation sowie die Komponenten<br />
des Maschinenkontrollsystems die Steuerung der<br />
Baumaschine übernehmen, muss diese im Baustellennetz<br />
stationiert werden. Zu diesem Zweck<br />
führt der Fahrer eine so genannte Freie Stationierung<br />
durch. Als Anschlusspunkte dienen die<br />
Polygonpunkte des Baustellennetzes.<br />
Planung der Messung<br />
Für die Kontrollmessung am Grader wurde ein<br />
Teilstück des bereits erwähnten Bauvorhabens herangezogen.<br />
Nach Fertigstellung des Schotterplanums<br />
in diesem Bereich wurde ein Flächennivellement<br />
durchgeführt, um die Genauigkeit des Graders zu<br />
verifizieren. Für die fertige Straße war eine Breite<br />
von 6,50 m vorgesehen, also 3,25 m für jede Spur. Um<br />
aber die ganze Trassenbreite inklusive Bankett zu erfassen,<br />
sollte das Flächennivellement eine Breite von<br />
7,00 m aufweisen. Im Abstand von 2,50 m wurden<br />
entlang der Achse jeweils fünf Punkte abgesteckt<br />
und anschließend in ihrer Höhe bestimmt.<br />
Abb. 4: Skizze für die Ausführung der Rasterpunkte-<br />
Absteckung<br />
Auswertung der Messung<br />
Da die Absteckung der Punkte nicht nach Sollkoordinaten,<br />
sondern nach Station und Achsabstand<br />
durchgeführt wurde, mussten zunächst die<br />
Koordinaten der Rasterpunkte für die Auswertung<br />
mit CAD erzeugt werden. Zu diesem Zweck wurden<br />
die Punkte mit VESTRA CAD zeichnerisch<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
27
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
28<br />
und mit entsprechender Punktnummer erstellt und<br />
anschließend exportiert. Nun können die Höhen<br />
aus der Nivellementauswertung den jeweiligen<br />
Punkten zugeordnet werden und man erhält so<br />
dreidimensionale Koordinaten für das aufgenommene<br />
Trassenstück. Eine Koordinatendatei, die alle<br />
Punkte enthält, wird nun wiederum in VESTRA<br />
importiert. Die eingelesenen Punkte ergeben ein digitales<br />
Geländemodell (DGM), wie es für die spätere<br />
Berechnung benötigt wird.<br />
Abb. 5: DGM des IST-Schotterplanums mit Höhenlinien<br />
Außerdem lassen sich in dem erstellten DGM sofort<br />
Höhenlinien darstellen, welche die Richtung<br />
der Querneigung und den Neigungswechsel zeigen.<br />
Abbildung 5 zeigt, dass die Ränder der Schottertragschicht<br />
etwas abrutschen, was normal ist, hervorgerufen<br />
durch das Verdichten des Schotters.<br />
DGM<br />
Die Leonhard Weiss GmbH & Co. KG verwendet<br />
VESTRA nicht nur für die Datenauswertung,<br />
sondern auch für die Datenvorbereitung, dazu<br />
zählt die Erzeugung von Deckenbuch und DGM.<br />
Das Digitale Geländemodell wird vor allem für<br />
Massenberechnungen und für die Maschinensteuerung<br />
verwendet. Ein DGM wird in VESTRA<br />
CAD importiert und dort über Dreiecksvermaschung<br />
nach dem Prinzip der Delaunay-<br />
Triangulation berechnet, wobei Bruchkanten, Innen-<br />
und Umringe automatisch berücksichtigt werden.<br />
Bei Erzeugung eines DGM in VESTRA CAD sollte<br />
man Bauabrechnung als Berechnungsalgorithmus<br />
wählen. Unter den Reitern Umring und Inring lässt<br />
sich jeweils ein Layer auswählen, der den Um- bzw.<br />
Inring enthält, falls diese vorhanden sind und benötigt<br />
werden.<br />
Abb. 6: Einstellungen in VESTRA zur DGM-<br />
Berechnung<br />
Die Berechnung selbst wird über die Menüfunktion<br />
DGM – Rechnen – Einzelnes Geländemodell<br />
gestartet. Berücksichtigt werden alle<br />
Zeichnungselemente, die vorher markiert wurden,<br />
wobei Punkte mit einer Höhe von 0.000 automatisch<br />
ignoriert werden. Nach der fehlerfreien<br />
Dreiecksvermaschung unter Berücksichtigung aller<br />
Bruchkanten, Innen- und Umringe lässt sich das<br />
DGM für weitere Betrachtungen heranziehen. Es<br />
bildet die Grundlage z. B. für Mengenermittlung,<br />
Modellverschneidungen, 3D-Perspektiven oder<br />
Höhenlinien. Der Im- und Export ist natürlich REB-<br />
und GAEB-konform. Für die Bauabrechnung können<br />
detaillierte Informationen auch über ein DGM<br />
in einer Liste oder im Microsoft Excel-Format ausgegeben<br />
werden.<br />
VESTRA CAD bietet auch die Möglichkeit zur<br />
nachträglichen Änderung eines Digitalen Geländemodells.<br />
Es können dabei Punkte eingerechnet und<br />
entfernt, aber auch neue Bruchkanten erzeugt werden.<br />
Für eine Massenberechnung zwischen zwei<br />
Zuständen, z. B. zwischen Urgelände und Baugrube,<br />
müssen selbstverständlich beide Modelle korrekt<br />
und als DGM vorliegen. Der Dialog wird über<br />
DGM – Auswertungen – Massenberechnungen gestartet.<br />
Nach der Berechnung werden die Auf- und<br />
Abtragsmassen ausgegeben. Außerdem können die<br />
Massenprismen und die Durchdringungslinie an<br />
den Lageplan übergeben werden. Für eine externe<br />
Prüfung kann die entsprechende Ergebnisliste ausgedruckt<br />
und jedes der betrachteten DGM einzeln<br />
gemäß REB oder GAEB abgespeichert werden.<br />
Vergleich der SOLL- mit der IST-Trasse<br />
Bevor der Vergleich zwischen den beiden Trassen<br />
durchgeführt werden kann, muss die SOLL-Trasse<br />
erzeugt werden. Die Lagekoordinaten, die bereits<br />
für die IST-Trasse herangezogen wurden, lassen<br />
sich wieder verwenden. Somit müssen nur noch<br />
die SOLL-Höhen für die Rasterpunkte bestimmt<br />
werden. Mit Hilfe von Gradiente und Querneigung<br />
lässt sich die Fahrbahnhöhe der fertigen Straße an<br />
jeder Stelle der Strecke (Station und Achsabstand<br />
bekannt) berechnen. Da jedoch die SOLL-Trasse<br />
der Schottertragschicht kontrolliert wird, muss<br />
von diesen Höhen anschließend nur noch die gesamte<br />
Aufbauhöhe der verschiedenen Tragschichten<br />
abgezogen werden. Diese Tragschichten sind laut<br />
Regelquerschnitt 14 cm Asphalttragschicht, 5 cm<br />
Asphaltbinder und 3 cm Splittmastixasphalt.<br />
Zunächst wird jedoch mit der Software GEO-<br />
Samos eine vorläufige Auswertung durchgeführt.<br />
Über die Achse der Verbindungsstraße, deren Gradiente<br />
und Querneigung bekannt sind, lässt sich mit<br />
dem Programm eine Trasse erzeugen, die der Planung<br />
entspricht. Anschließend werden die Punkte der IST-<br />
Trasse ebenfalls eingelesen. Nun lassen sich für jeden<br />
Punkt die Höhendifferenzen zu der geplanten<br />
Trasse berechnen und per Protokoll ausgeben. Um<br />
diesen Höhenunterschied genauer bestimmen zu<br />
können, werden die Werte aus dem Protokoll heraus<br />
kopiert und in das Tabellenkalkulationsprogramm<br />
Excel von Microsoft übernommen. Hier können<br />
mit einfachen Funktionen die Minimal- und<br />
Maximalabstände ermittelt werden.<br />
PROFILE 2/2006
Für weitere Betrachungen wurde ein zusätzliches<br />
drittes DGM erzeugt.<br />
• IST-DGM aus der Messung resultierend<br />
• Absolutes SOLL-DGM aus der Planung und<br />
dem Regelquerschnitt resultierend<br />
• Relatives SOLL-DGM<br />
Bei der Berechnung des relativen SOLL-DGM<br />
musste berücksichtigt werden, dass der zwangsläufig<br />
auftretende Fehler an den Randpunkten durch<br />
das seitliche Wegrutschen des Schottermaterials das<br />
Gesamtergebnis verfälschte. Das entstandene relative<br />
DGM des SOLL-Zustandes passte sich dem<br />
Niveau, das auf der Baustelle auch versucht wurde<br />
herzustellen, am besten an.<br />
Die Digitalen Geländemodelle des IST-Zustandes<br />
und des relativen Zustandes wurden übereinander<br />
gelegt und Höhenlinien im Abstand 2,5 cm eingezeichnet.<br />
Hier konnte man dann überprüfen, ob<br />
die Querneigungen und der Neigungswechsel im<br />
Verlauf des kontrollierten Trassenstücks auch so gebaut<br />
wurden, wie es die Planung vorsah.<br />
Abb. 7: Überlagerung der beiden DGM<br />
Abbildung 7 zeigt sehr deutlich, dass die Querneigung<br />
mit ihren Verziehungen und dem Neigungswechsel<br />
in dem roten DGM des IST-Zustandes sehr<br />
gut mit denen des blauen SOLL-DGM zusammen<br />
passt. Daraus konnte geschlossen werden, dass der<br />
Straßenverlauf gemäß Planung hergestellt wurde.<br />
Abb. 8: Öffnen eines externen DGM für die Massenberechnung<br />
Um die Unterschiede zwischen den verschiedenen<br />
Zuständen der Schottertragschicht anschaulicher<br />
darzustellen, wurde zusätzlich zu den bisherigen<br />
Auswertungen noch eine Massenberechnung<br />
zwischen diesen beiden DGM durchgeführt. Dazu<br />
verwendet man die Menüfunktion DGM – Auswertungen<br />
– Massenberechnung von VESTRA CAD.<br />
Nachdem die Berechnungsart (Massen zwischen<br />
zwei Modellen) gewählt worden ist, werden die beiden<br />
vorher erzeugten DGM einander zugeordnet.<br />
PROFILE 2/2006<br />
Abb. 9: Ergebnis der Massenberechnung<br />
Die Massenprismen und die Durchdringungslinien<br />
können an dieser Stelle in verschiedenen<br />
Layern gespeichert werden. Zusätzlich lassen sich<br />
die Farben für Auf- und Abtrag frei wählen.<br />
Abb. 10: Ergebnis der Massenberechnung (zeichnerische<br />
Darstellung)<br />
Die Maske für die Einstellung der Tiefenzonen, die<br />
sich dank der Massenberechnung farblich darstellen<br />
lassen, öffnet man über DGM – Auswertungen<br />
– Tiefenzonen/Höhenbereiche. Dort werden die zu<br />
zeichnenden Zonen nach Angabe ihrer Anzahl und<br />
eines Intervalls erzeugt. Jedem Höhenbereich kann<br />
hier eine Farbe zugeordnet werden.<br />
Abb. 11: Zeichnerische Darstellung der Tiefenzonen<br />
Die verschiedenen Blautöne stellen dabei die<br />
Bereiche dar, die zu hoch liegen. Zu tief hingegen<br />
sind die Stellen, die rot dargestellt sind.<br />
Fazit<br />
Wesentlicher Vorteil einer automatisch gesteuerten<br />
Baumaschine ist, dass eine geplante Trasse nicht nur<br />
linienhaft (früher alle 10 bis 20 m eine Absteckung)<br />
hergestellt werden kann, sondern auch flächenhaft<br />
über die ganze Trasse. An jeder Stelle des Modells<br />
oder der Trasse ist hier Lage und Höhe bekannt.<br />
Die Leonhard Weiss GmbH & Co. KG vertraut bei<br />
der Datenauswertung auf die Software VESTRA,<br />
die sich vielseitig und flexibel einsetzen lässt und allen<br />
Ansprüchen eines modernen Bauunternehmens<br />
ohne jede Einschränkung gewachsen ist.<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
29
Dipl.-Ing. Arno<br />
Brüggemann ist<br />
Geschäftsführer<br />
der <strong>AKG</strong> Software<br />
Consulting GmbH für<br />
den Bereich Kunden.<br />
QEDIT: manuelle<br />
Konstruktion im<br />
Querschnitt<br />
Katalog: gemäß Spur-<br />
Typ angebotene Auswahl<br />
von Definitionen<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
30<br />
VESTRA-Workshop Querschnitt:<br />
„Planen und Bauen im Bestand“<br />
Von Dipl.-Ing. Arno Brüggemann<br />
Die Funktionalität des Querschnitts in VESTRA und seine bedienerfreundliche<br />
Handhabung sind den meisten Anwendern hinlänglich bekannt. An dieser Stelle soll<br />
der Querschnitt unter dem Gesichtspunkt „Planen und Bauen im Bestand“ näher<br />
beleuchtet werden. Ziel ist es, einerseits Wege und Lösungen aufzuzeigen und<br />
anderseits zu neuen Ideen und Überlegungen anzuregen.<br />
Vorbemerkungen<br />
Die Anforderungen an die Querschnittsgestaltung<br />
haben sich im Laufe der Jahre deutlich gewandelt.<br />
Die Untersuchung von Varianten ist ebenso<br />
selbstverständlich wie das kurzfristige Einarbeiten<br />
von Änderungen in der Bauausführung. Auch<br />
die Abrechnung sucht wegen des immer stärkeren<br />
Termindrucks nach schnellen, zielgerichteten<br />
Lösungen. Die Arbeit des Ingenieurs steht heutzutage<br />
ständig unter dem Motto „Alles ist möglich“<br />
– steigende Anforderungen, enge Budget- und<br />
Termingrenzen, kein Projekt gleicht dem anderen<br />
und Flexibilität ist mehr gefragt denn je. Auf derartige<br />
Herausforderungen bietet VESTRA mit seinen<br />
vielfältigen Möglichkeiten die fachgerechte Antwort,<br />
damit Anwender auch künftig wettbewerbsfähig<br />
bleiben.<br />
Das Konzept des VESTRA-Querschnitts hat sich<br />
bewährt und wurde schon verschiedentlich vorgestellt:<br />
Kataloge sind kontextsensitiv angeschlossen<br />
und können bei Bedarf einfach und schnell angepasst<br />
werden. „Vorränge“ unterstützen den Aufbau<br />
der hierarchischen Definitionen. „Bedingungen“<br />
setzen Fallunterscheidung übersichtlich in die<br />
Programmlogik um, ohne den Anwender durch<br />
unnötige Details zu belasten.<br />
Spurmanager und der Horizontmanager gewährleisten<br />
jederzeit den Überblick darüber, welche<br />
Spuren mit welchem Typen belegt sind und<br />
welchen Inhalt die Querschnittsdatenbank aktuell<br />
aufweist.<br />
Abb. 1: Spezieller Querschnittsbaustein<br />
Querschnitt<br />
Der Querschnittskatalog in VESTRA besteht aus<br />
zwei Hauptbereichen, den festen Querschnittstypen<br />
und den freien Bausteinen. Die festen Typen sind<br />
durch Parameter konfigurierbar und decken einen<br />
großen Bereich der Querschnittskonstruktion ab.<br />
Die freien individuellen Bausteine werden menüge-<br />
steuert erfasst und sind in einer Makrosprache abgelegt.<br />
Jeder dieser Hauptbereiche ist in Abschnitte<br />
für die verschiedenen Anteile des Querschnitts gegliedert.<br />
Damit kann die jeweilige Definition von<br />
Fahrbahn, Gehweg, Radweg, Bankett, Böschungen,<br />
Planumslinie und Drainage übersichtlich bearbeitet<br />
werden.<br />
Die Abbildung 2 zeigt den festen Aufbautyp<br />
„Ausgleichsschicht mit Abfräsen“. Dabei wird eine<br />
Ausgleichsschicht unabhängig vom Deckenbuch aus<br />
dem Bestand und dem optionalen Abfräsen abgeleitet.<br />
Die Vorgabe der minimalen Stärke für diese<br />
Schicht bringt die bautechnischen Zwänge hinein.<br />
Für die Unterkante dieses Ausgleichshorizonts werden<br />
im QEDIT dann einfach zusätzliche Fräspunkte<br />
ermittelt und automatisch eingebunden. Die relative<br />
Tiefe zum Referenzhorizont (Bestand) an<br />
diesen Punkten wird zum Nachweis bequem als<br />
Excel-Liste ausgegeben, die Fräspunkte werden über<br />
die Funktion „Querprofilspunkte“ direkt an die<br />
Maschinensteuerung oder ein beliebiges Feldgerät<br />
exportiert.<br />
Abb. 2: Deckensanierung und Vollausbau<br />
Für das Bauen und Planen im Bestand ist der<br />
Einsatz von individuellen Bausteinen unumgänglich.<br />
Daher wurde in VESTRA die Makrosprache durch<br />
eine intelligente Nutzerführung bewusst in den<br />
Hintergrund verlegt. Der Anwender konzentriert<br />
sich auf die Aufgabenstellung, VESTRA bietet einen<br />
Fundus von zielgerichteten Befehlen. Natürlich<br />
beschränkt sich der Einsatz von freien Bausteinen<br />
nicht nur auf die Böschungen. Übergänge in Form<br />
von Steinen oder Rinnen sind ebenso möglich wie<br />
allgemeine Bausteine in Grün- / Mittelstreifen oder<br />
PROFILE 2/2006
Schichtenbausteine für die von der RStO abweichenden<br />
Aufbauten.<br />
Eine gewichtige Komponente für die Ausführung<br />
und Abrechnung ist die flexible Steuerung des<br />
Querschnitts durch externe Werte. Daher bietet<br />
VESTRA im Querschnitt an verschiedensten<br />
Stellen den Einsatz so genannter POLY-Dateien.<br />
In umfangreichen Projekten steuern externe Dateien<br />
über „Bedingungen“ die senkrechten Abbrüche<br />
von Banketten und Böschungen. Weiterhin werden<br />
externe Werte in Bausteinen als Variablen benutzt,<br />
die, wie ihr Name schon sagt, dann in der<br />
kompletten Querschnittsdefinition variabel eingesetzt<br />
werden können. Damit definiert man einfach<br />
und übersichtlich in der Vermessung ermittelte<br />
Böschungsneigungen, Böschungsdurchstoßpunkte,<br />
Gräben / Wildschutzzäune oder aus Bodenanalysen<br />
resultierende Felshorizonte, Grundwasserspiegel<br />
oder Kontaminierungen. Liegen die externen Werte<br />
an einer Station noch nicht vor, so benutzt VESTRA<br />
je nach eingestellter Option einen Vorgabewert<br />
oder weist über eine Protokollmeldung auf dieses<br />
Problem hin.<br />
Horizonte<br />
Die Querschnittskonstruktion bietet mit der<br />
Horizontbildung ein sehr effektives Werkzeug<br />
zur Bearbeitung und Erweiterung der Querschnittsdatenbank<br />
(QPE). So werden neue Linien-<br />
oder Flächenhorizonte erzeugt oder bestehende<br />
Horizonte bearbeitet (siehe Abbildung 3). Im<br />
Folgenden werden zwei Möglichkeiten gegenübergestellt.<br />
Die Bauausführung wird oft mit externen<br />
Zwängen konfrontiert. Zum Beispiel können<br />
Tiefenwerte eines Bodengutachtens zusätzliche<br />
Aushubschichten bedingen oder aber zu einer<br />
Position „Unbrauchbarer Boden“ führen. Solche<br />
Werte werden einfach als externe Tiefendatei in<br />
die Bildung eines parallelen Linienhorizonts eingebracht<br />
– entweder als Höhenversatz oder als echte<br />
Parallele zum Gelände. Der resultierende Horizont<br />
kann dann bequem zur Teilung des Erdabtrags in<br />
einen unbrauchbaren und einen verwertbaren Teil<br />
genutzt werden.<br />
Abb. 3: Horizontbildung<br />
Die Abrechnung erfordert oft eine Teilung nach<br />
Kostenträgern, die nicht über die Querschnittsdefinitionen<br />
festgelegt werden soll oder die zur<br />
Zeit des Querschnittsaufbaus noch nicht endgültig<br />
geklärt ist. Zur Lösung dieser Aufgabe bietet<br />
die Horizontbildung die Option „Senkrechter<br />
Abbruch von Horizonten“. Der Abstand wird absolut<br />
von der Achse aus oder relativ zu einer Spur<br />
festgelegt. Optional kann ein variabler Abstand<br />
PROFILE 2/2006<br />
für den Abbruch über eine externe Datei gesteuert<br />
werden. Der Stationsbereich wird einfach gewählt,<br />
ebenso die Liste der betroffenen Linien- oder<br />
Flächen-Horizonte. Als Ergebnis steht ein beliebig<br />
abgeschnittener Querschnitt zur Verfügung (siehe<br />
Abbildung 4). Wird nach der Mengenermittlung wieder<br />
der komplette Querschnitt benötigt, so ist durch<br />
Rechnen aller Profile die Querschnittsdatenbank<br />
wieder schnell aktualisiert.<br />
Abb. 4: Senkrechter Abbruch für die Abrechnung<br />
Daten<br />
Die Ergebnisse aller Bearbeitungen im Querschnitt<br />
werden automatisch in der Querschnittsdatenbank<br />
gespeichert. Damit steht die Basis für die Zeichnungsaufbereitung<br />
(HPLOT, QPLOT) und für<br />
weitere Berechnungen wie REB 21.013 oder REB<br />
21.003.<br />
Um die Daten des Querschnitts auch selektiv<br />
an den Auftraggeber weitergeben zu können, bietet<br />
VESTRA den Export von Querprofilspunkten.<br />
Dazu werden vom Auftraggeber gewünschte<br />
Punkte aus der Querschnittsdatenbank in einem<br />
Auswahldialog zusammengestellt. Die Punktnamen<br />
lassen sich über ein Schema aus den Komponenten<br />
Station, Querprofilsname und Seitenindex flexibel<br />
aufbauen. Als Ergebnis wird direkt eine Datei für<br />
die Maschinensteuerung geschrieben oder es wird<br />
eine Liste als Excel-Tabelle erzeugt. Alternativ führt<br />
der Weg über den Exportassistenten in alle gängigen<br />
Exportformate bis hin zum Universalkonverter, der<br />
jedes beliebige ASCII-Format erzeugen kann.<br />
Fazit<br />
Der VESTRA-Querschnitt ist ein komplexes Modul<br />
für die Einsatzgebiete Vermessung, Planung,<br />
Bauausführung und Abrechnung. Im Vordergrund<br />
stehen dabei zwei wichtige Aspekte, die für die wirtschaftliche<br />
Bearbeitung anspruchsvoller Projekte<br />
von großer Bedeutung sind. Die einfache und<br />
übersichtliche Benutzerführung von VESTRA<br />
schafft die Grundlage für die optimale Nutzung<br />
durch die Anwender. Die umfassende, praxisnahe<br />
Programmfunktionalität bietet Lösungen für jede<br />
auch noch so komplexe Aufgabenstellung. Damit dies<br />
auch weiterhin so bleibt, wird der Querschnitt mit jedem<br />
Programm-Update weiter entwickelt und wächst<br />
mit den Anforderungen aus der Praxis.<br />
POLY-Datei:<br />
Stationen und dazugehörige<br />
Werte wie<br />
Tiefen, Breiten etc.<br />
Horizontbildung:<br />
Konstruieren oder<br />
Ändern von Flächen-<br />
oder Linienhorizonten<br />
P<br />
R<br />
O<br />
F<br />
I<br />
L<br />
E<br />
31
00<br />
.000<br />
0+167.118<br />
hrt<br />
R= 0+182<br />
R=<br />
R=50.000<br />
0+000.00<br />
0+157.118<br />
R=<br />
2.00 m<br />
3,75 4,00<br />
R=<br />
3,75<br />
R=<br />
R=400.000<br />
2.00 m<br />
2.00 m<br />
Kreisachse 177<br />
0+000.000<br />
3,75<br />
R=<br />
R=400.000<br />
R=-7<br />
R<br />
R<br />
R=<br />
Achse Nr. 500<br />
R=<br />
0+000.0<br />
R=<br />
5.00 m<br />
2.00<br />
8.00 m<br />
Achse Nr. 100<br />
Einfahrt Autohaus Willig<br />
Achse Nr. 100<br />
R=37<br />
R=<br />
R=ì<br />
2.50 m<br />
15.00 m<br />
Achse Nr. 508<br />
2.5%<br />
R=<br />
R=<br />
1.50 m<br />
R=-4<br />
0+067.049<br />
4,00 4,00<br />
R=<br />
3.00 m<br />
2.50 m<br />
A=-6.455 0+057.197<br />
A=-6.455<br />
An<br />
2.5% 2.5%<br />
R=-7.500<br />
R=<br />
R=-7.500<br />
R=<br />
R=-27.000<br />
R=8.000<br />
R=<br />
0+021.000<br />
R=<br />
R=-4.000 0+035.695<br />
4,00 4,00<br />
Achse 814<br />
R=-56.500<br />
R=-7.500 0+048.000<br />
R=-27.000<br />
0+034.000<br />
2.5%<br />
R=8.000<br />
R=-7.500 0+038.000<br />
2.5%<br />
3.00 m<br />
R=<br />
R=44.5<br />
R=44.500<br />
R=-56.500<br />
1.50 m<br />
0<br />
0+007.00