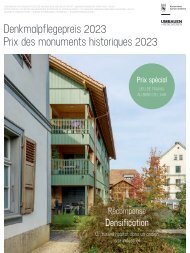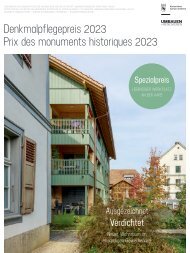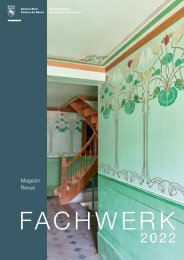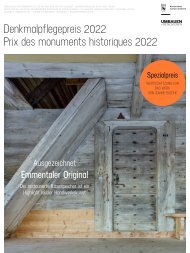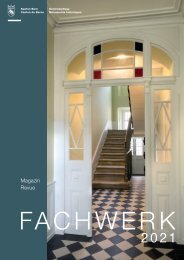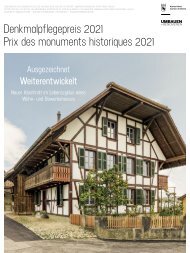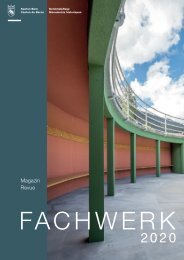Denkmalpflegepreis 2017
Sonderdruck der Denkmalpflege des Kantons Bern und der Zeitschrift UMBAUEN+RENOVIEREN, Archithema Verlag
Sonderdruck der Denkmalpflege des Kantons Bern und der Zeitschrift UMBAUEN+RENOVIEREN, Archithema Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sonderdruck der Denkmalpflege des Kantons Bern und der Zeitschrift umbauen+renovieren, Archithema Verlag<br />
www.be.ch/denkmalpflege und www.umbauen-und-renovieren.ch<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />
Denkmalpflege des Kantons Bern <strong>2017</strong><br />
Prix spécial<br />
Sauvegarde d’un<br />
témoin du patrimoine<br />
industriel à Péry<br />
Ausgezeichnet<br />
Die rote Perle am Thunersee<br />
Neue Leuchtkraft für ein Badehaus<br />
der Moderne
Licht, Luft<br />
und Farbe<br />
1<br />
1 Mit dem roten Badehaus<br />
erregte der Thuner<br />
Architekt Jacques Wipf<br />
Aufsehen. Im offenen<br />
Erdgeschoss parkierte<br />
man im Sommer das<br />
Auto, im Winter das Boot.<br />
Mit dem Badehaus für seine Familie setzte der Thuner Architekt Jacques Wipf 1930<br />
auf die neusten Architekturtrends. Seinen Enkeln ist die unverfälschte Erhaltung<br />
dieses Musterbeispiels der Moderne ein Anliegen. Für die nachhaltige Restaurierung<br />
werden sie mit dem <strong>Denkmalpflegepreis</strong> des Kantons Bern ausgezeichnet.<br />
Text: Elisabeth Schneeberger, Fotos: Christian Helmle 2<br />
2 Zum Baden fuhr man<br />
mit dem Boot vom flachen<br />
Ufer weg auf den See und<br />
wärmte sich danach auf<br />
der Terrasse des Badehauses<br />
wieder auf.<br />
2
3<br />
3 Im Inneren überrascht<br />
leuchtendes<br />
Gelb. Der Raum wurde<br />
in Anlehnung an den<br />
originalen Zustand umgestaltet,<br />
die ursprünglich<br />
unbehandelte<br />
Pavatexverkleidung<br />
gestrichen. Ein neuer<br />
Einbauschrank ist frei<br />
in den Raum gestellt.<br />
4 Die originalen Fenster<br />
haben zweifarbige<br />
Rahmen. Sie sind innen<br />
wieder postgelb, aussen<br />
blaugrün gestrichen<br />
und lassen sich ganz<br />
zur Seite klappen.<br />
5 Die Fensterläden<br />
erhielten wieder einen<br />
blaugrünen Ölfarbanstrich.<br />
6 Die Farbanalyse<br />
ergab, dass 1930 für<br />
die Aussenfassaden<br />
und das Treppenhaus<br />
reine Mineralfarbe<br />
verwendet wurde. Im<br />
Treppenhaus wurde<br />
der KEIM-Original-<br />
Farbton Nickeltitangelb<br />
nachgewiesen.<br />
E<br />
in leuchtend rotes, flach gedecktes Badehaus<br />
auf Stelzen: Mit dem avantgardistischen<br />
Bau von 1930 erregte der bekannte<br />
Architekt Jacques Wipf in seiner<br />
Heimatstadt Thun Aufsehen. Seine beiden Enkel<br />
haben der «Miniatur» im Stil des Neuen<br />
Bauens 2016 ihre Leuchtkraft zurückgegeben.<br />
«Es ist für mich ein Erlebnis, durch das gelbe<br />
Treppenhaus nach oben zu steigen und an<br />
den gelben Fensterrahmen, den blaugrünen<br />
Fensterläden und dem roten Mauerwerk vorbei<br />
ins Grüne zu blicken», sagt der Bauherr<br />
Dominik Müller, «und ich bin ein wenig stolz,<br />
ein direkt von der Architektur Le Corbusiers<br />
inspiriertes Gebäude zu besitzen.»<br />
Radikal einfach<br />
«So radikal konnte mein Grossvater sonst wohl<br />
kaum bauen», vermutet Dominik Müllers Bruder<br />
Christoph. Wipfs Heimatstil-Wohnhäuser<br />
in Thun oder das Grimsel Hospiz sprechen eine<br />
andere Architektursprache als das rote Haus.<br />
Dieses mutet im Werk des Architekten wie ein<br />
Vorreiter des von Wipf mitgestalteten Thuner<br />
Strandbades an, das zu den bedeutendsten Beispielen<br />
des Neuen Bauens im Berner Oberland<br />
gehört. Geradezu lehrbuchhaft präsentiert<br />
das Badehaus die damaligen Architekturtrends:<br />
die Devise «Licht, Luft und Sonne»,<br />
Le Corbusiers Architekturprinzipien des «Hauses<br />
auf Stützen» und der Nutzung des Flachdachs<br />
als Terrasse, die intensive Farbigkeit.<br />
Die einfache, funktionale Einrichtung des<br />
Gebäudes bot den Wipfs ursprünglich wenig<br />
Komfort für ihren sonntäglichen Familien- und<br />
Badeausflug. Der Kaffee wurde draussen<br />
4 5<br />
« Es ist für mich ein Erlebnis, durch das<br />
gelbe Treppenhaus nach oben zu steigen. »<br />
Dominik Müller, Bauherr<br />
6<br />
4<br />
5
7<br />
8 9<br />
« Es braucht Diskussionen und spezialisiertes Knowhow,<br />
um passende Lösungen zu entwickeln. »<br />
Christoph Müller, Bauherr<br />
10<br />
auf dem Rasen getrunken, auf den Terrassen<br />
wärmte man sich nach dem Seebad auf. Im<br />
freien Erdgeschoss stellte man im Sommer das<br />
Auto, im Winter das Boot unter.<br />
Der Vater der heutigen Eigentümer, der in<br />
der Region ebenfalls hoch geschätzte Architekt<br />
Karl Müller-Wipf, erweiterte das Badehaus 1954<br />
zum Sommer-Ferienhaus. Der Anbau mit versetzten<br />
Pultdächern und Panoramafenster zum<br />
See ist ein charakteristisches Werk der 1950er-<br />
Jahre: unspektakulär, aber bis ins Detail sorgfältig<br />
durchkomponiert sowie respektvoll und<br />
diskret hinter das Badehaus zurückversetzt.<br />
Wertschätzung über Generationen<br />
Mit grosser Wertschätzung widmet sich auch<br />
die dritte Besitzergeneration dem Seehaus.<br />
Für die Bauherren steht die originale Substanz,<br />
die auch ihre Erinnerungen materialisiert,<br />
an oberster Stelle. Sie liessen sich deshalb<br />
erst einmal Zeit. «Ich bin froh, dass wir<br />
gewartet haben. Früher hätten wir vielleicht<br />
nicht die geeigneten Materialien verwendet»,<br />
sagt Christoph Müller. «Aus allen Möglichkeiten<br />
hat sich während des Planungsprozesses<br />
die überzeugendste Lösung herauskristallisiert»,<br />
erklärt Fabian Schwarz, Bauberater der<br />
Denkmalpflege. «Die Bauherren haben den<br />
Wert des Gebäudes erkannt und es schliesslich<br />
mit wenigen, präzise abgestimmten Massnahmen<br />
instand gesetzt. Auf umfassende Eingriffe<br />
zu verzichten, braucht oftmals mehr Mut,<br />
als in Erneuerungen zu investieren.»<br />
Kristallines Leuchten statt neuer Glanz<br />
Eine Farbuntersuchung lieferte den bemerkenswerten<br />
Befund, dass das Badehaus über den originalen<br />
Mineralfarbanstrich verfügte. Für die<br />
Restaurierung wollten die Bauherren dieselbe<br />
farb- und alterungsbeständige Farbtechnik verwenden.<br />
Es widerstrebte ihnen jedoch, das Haus<br />
«in neuem Glanz» erstrahlen zu lassen.<br />
7 Ein lasierender Anstrich gab der<br />
Fassade das materialtypische «kristalline<br />
Leuchten» zurück – die Bearbeitungs- und<br />
Altersspuren blieben erhalten.<br />
8 Karl Müller-Wipf erweiterte das<br />
Badehaus 1954 um einen Wohnraum mit<br />
Kochgelegenheit, ein charakteristisches,<br />
bis ins Detail durchgestaltetes Werk der<br />
1950er-Jahre. Die Ausstattung blieb samt<br />
Möblierung original erhalten.<br />
9 Das Panoramafenster leitet den Blick auf<br />
den See. Die Vorhänge von 1954 werden<br />
brüchig: Christoph Müllers nächstes<br />
Projekt ist die Suche nach einem Stoff, der<br />
demjenigen möglichst nahe kommt, den er<br />
als 6-Jähriger mitauswählen durfte.<br />
10 Mit seinem Anbau, der sich dem rauen<br />
Charme des roten Betonkubus unterordnet,<br />
zeigte Karl Müller-Wipf 1954 Respekt<br />
vor dem Bestand – genau wie seine Nachfahren<br />
bei der Restaurierung des Baus.<br />
6<br />
7
« Auf umfassende Eingriffe zu<br />
verzichten, braucht oftmals<br />
mehr Mut, als in Erneuerungen<br />
zu investieren. »<br />
Fabian Schwarz, Bauberater der Denkmalpflege<br />
Kontaktadressen<br />
Planung und Ausführung<br />
Christoph Müller<br />
Dipl. Architekt ETH SIA<br />
Pfaffenbühlweg 46A<br />
3604 Thun<br />
T 033 335 58 48<br />
www.mume.ch<br />
ch.mueller@mume.ch<br />
Bauberatung Denkmalpflege<br />
Fabian Schwarz<br />
Denkmalpflege des Kantons Bern<br />
Schwarztorstrasse 31, Postfach<br />
3001 Bern<br />
T 031 633 40 30<br />
www.be.ch/denkmalpflege<br />
Küche<br />
Garderobe<br />
WC<br />
Aufenthaltsraum<br />
Farbuntersuchung<br />
Beate Dobrusskin, Gertrud Fehringer, Ueli Fritz<br />
Fritz & Fehringer Restauratoren<br />
Innere Schachenstrasse 1<br />
3315 Bätterkinden<br />
T 032 665 32 78<br />
gertrud.fehringer@web.de<br />
11<br />
Idealerweise ermöglicht die Mineralfarbe<br />
einen lasierenden Anstrich. So erhielt die Fassade<br />
das materialtypische «kristalline Leuchten»<br />
zurück; die ursprünglichen Bearbeitungsund<br />
die Altersspuren bis hin zur Markierung<br />
des Hochwasser-Pegelstandes von 2005 bleiben<br />
aber ablesbar.<br />
Dieses Resultat ist dem handwerklichen<br />
Geschick der Malerin und einer intensiven<br />
Teamarbeit zu verdanken: Christoph Müller,<br />
selbst ein erfahrener Architekt, plante die einzelnen<br />
Schritte gemeinsam mit dem Restaurator<br />
und dem Farbberater, den Handwerkern<br />
und dem Bauberater der Denkmalpflege. «Es<br />
braucht Diskussionen und spezialisiertes<br />
Know-how, um die passende Lösung zu entwickeln»,<br />
ist er überzeugt.<br />
Die Terrassengeländer und Fensterläden<br />
erhielten wieder einen blaugrünen Ölfarbanstrich.<br />
Im Inneren des Badehauses überrascht<br />
leuchtendes Gelb. Der Raum wurde in Anlehnung<br />
an den originalen Zustand umgestaltet.<br />
Der Riemenboden aus der Bauzeit wurde abgeschliffen,<br />
die ursprünglich unbehandelte Pavatexverkleidung,<br />
die teilweise ersetzt werden<br />
musste, wurde gestrichen. Ein neuer Einbauschrank<br />
ist frei in den Raum gestellt.<br />
Die Dächer beider Gebäudeteile wurden<br />
instand gesetzt. Im Wohnraum von 1954 blieb<br />
die originale Ausstattung unverändert.<br />
Sommerhaus mit Stil<br />
Das Seehaus bleibt ein Sommerhaus. Die Bauherren<br />
verzichteten auf eine technische Aufrüstung;<br />
die unverfälschte Architektur ist ihnen<br />
mehr wert als zusätzlicher Komfort.<br />
«Schon wenige Eingriffe würden reichen, um<br />
solch ein Gebäude zu verunstalten», sagt der<br />
Architekt. Mit der gleichen Sorgfalt, die sie<br />
für die Architektur aufbringen, bewahren die<br />
Brüder Müller auch das Firmenarchiv von vier<br />
Architektengenerationen – eine kostbare<br />
Quelle für das Verständnis der neueren gebauten<br />
Geschichte der Stadt Thun.<br />
11 Ein grosser Kamin<br />
prägt den Innenraum<br />
und betont die Senkrechte,<br />
während das<br />
Panorama-Fensterband<br />
zum See hin und die<br />
Oblichter einen horizontalen<br />
Akzent setzen.<br />
12 Das Badehaus von<br />
1930 ist zur Sonne hin<br />
ausgerichtet und vom<br />
See abgewandt. Im Anbau<br />
von 1954 hingegen<br />
spielt das Seepanorama<br />
die Hauptrolle.<br />
Stube<br />
Obergeschoss<br />
Unterstand<br />
Erdgeschoss<br />
N<br />
0 4<br />
12<br />
Restaurator<br />
Roger Tinguely<br />
Hohgantweg 1c<br />
3612 Steffisburg<br />
T 033 438 80 75<br />
www.artinguely.ch<br />
Farbberatung KEIM<br />
Rolf Spielmann<br />
KEIMFARBEN AG<br />
Wiesgasse 1, 9444 Diepoldsau<br />
T 071 737 70 10<br />
www.keim.ch<br />
Malerarbeiten<br />
Janick Dähler, Andrea Müller<br />
Dähler AG, Die Maler & Gipser<br />
Gurnigelweg 18, 3612 Steffisburg<br />
T 033 437 63 76<br />
info@daehler-thun.ch<br />
Schreinerarbeiten<br />
Erich Liechti<br />
Steghalten 22<br />
3633 Amsoldingen<br />
T 033 341 12 74<br />
erich.liechti@bluewin.ch<br />
Fritz Linder<br />
Schorenstrasse 46<br />
3645 Gwatt (Thun)<br />
T 033 336 48 48<br />
fritz_linder@sunrise.ch<br />
8<br />
9
Links Jacques Wipf und Edgar<br />
Schweizer: Strandbad Thun von<br />
1932/33. Foto 1933 (Fotograf:<br />
H.G. Keller. Stadtarchiv Thun).<br />
Rechts Jacques Wipf: Grimsel<br />
Hospiz, Guttannen. Studie mit kubischen<br />
Eckrisaliten, Kohlezeichnung<br />
auf Transparentpapier, 1929<br />
(Archiv Müller-Wipf, Thun).<br />
Mineralfarbe<br />
in der Praxis<br />
Der Malermeister Janick Dähler und seine<br />
Mitarbeiterin Andrea Müller plädieren für die<br />
häufigere Verwendung der umweltfreund -<br />
lichen Mineralfarbe an historischen Gebäuden<br />
und an Neubauten. Eine genaue Material analyse<br />
und die frühzeitige Kommunikation sind ihre<br />
Schlüssel zum Erfolg.<br />
Respekt vor dem<br />
Bestand als Familientradition<br />
Jacques Wipf und Karl Müller-Wipf haben das Bild Thuns im<br />
20. Jahrhundert mit ihren Bauten massgeblich mitgeprägt. Gründer des<br />
Architekturbüros Wipf war im Jahr 1896 Johann Jakob Wipf.<br />
j<br />
ohann Jakob Wipf (1856–1931) war als<br />
Architekt einige Jahre in Frankreich<br />
tätig, bevor er 1892 nach Thun kam<br />
und sich dort selbstständig machte.<br />
1921 übernahm Jacques Wipf das väterliche<br />
Büro. Nach seinem frühen Tod 1947 ging das<br />
Büro schliesslich in die Hände des Schwiegersohns<br />
Karl Müller-Wipf über.<br />
Jacques Wipf (1888–1947) diplomierte am<br />
Technikum Burgdorf und studierte danach in<br />
Stuttgart an der Hochschule für Technik. 1913<br />
trat er ins Architekturbüro von Walter Bösiger<br />
in Bern ein. Als selbstständiger Architekt in<br />
Thun ist sein breit gefächertes Werk stilistisch<br />
dem Heimatstil und der gemässigten Mo derne<br />
zuzuordnen. Seine Wohn- und Geschäftshäuser<br />
sind in Material und Form stets eingegliedert<br />
ins städtische Gefüge oder in die umgebende<br />
Landschaft. Ab 1925 realisierte Jacques<br />
Wipf in mehreren Etappen die meisten Kraftwerkbauten<br />
der Kraftwerke Oberhasli und<br />
wurde Hausarchitekt des Betriebs. Als fortschrittlicher<br />
Architekt wusste er auch die<br />
Grundsätze des Neuen Bauens geschickt anzuwenden.<br />
Mit seinem eigenen Badehaus und<br />
dem Thuner Strandbad entwarf er 1930 bis<br />
1932 zwei kompromisslos moderne Licht-Luft-<br />
Sonne-Bauten, die zu den wichtigen Beispielen<br />
dieser Bauauffassung im Berner Oberland<br />
gehören.<br />
Karl Müller-Wipf (1909–2010) erzielte schon<br />
früh bedeutende Wettbewerbserfolge. Nach der<br />
Übernahme des Architekturbüros seines<br />
Schwiegervaters führte er bis 1960 parallel dazu<br />
sein eigenes Büro in Bern weiter. Die Markuskirche<br />
in Bern, die Gewerbeschule in Solothurn<br />
oder die Sekundarschule Länggasse in Thun<br />
sind bedeutende Vertreter der gemässigt modernen<br />
Architektur der frühen Nachkriegsjahre.<br />
Dem Seehaus seines Schwiegervaters fügte<br />
er 1954 einen Wohnraum mit Kochgelegenheit<br />
an, ein geducktes Volumen, das sich dem rauen<br />
Karl Müller-Wipf: Mädchensekundarschule<br />
Thun, Länggasse, 1952–1954.<br />
Foto 1954 (Fotograf: Samuel Gassner.<br />
Stadtarchiv Thun).<br />
Charme des roten Betonbaus unterordnet, ohne<br />
seine eigene Handschrift zu verleugnen, und<br />
zeigte damit – wie später seine Nachfahren bei<br />
der Restaurierung des Seehauses – Respekt vor<br />
dem Bestand.<br />
Text: Daniel Wolf<br />
Foto: Ivo Dähler<br />
S<br />
ie haben bei der Fassadenrestaurierung<br />
des Seehauses Mineralfarbe<br />
eingesetzt. Was sind die wichtigsten<br />
Eigenschaften des Materials?<br />
JANICK DÄHLER: Silikat- beziehungsweise<br />
Mineralfarbe ist sehr nachhaltig. Der Anstrich<br />
bleibt jahrzehntelang schön und ist lange renovationsfähig.<br />
Er ist dampfdurchlässig, was sich<br />
auf den Feuchtigkeitshaushalt eines Gebäudes<br />
günstig auswirkt. Die etwas höheren Kosten<br />
werden durch die Dauerhaftigkeit wettgemacht.<br />
Wo setzen Sie Mineralfarbe ein?<br />
JD: Sooft es der Untergrund zulässt. Decken<br />
im Innenbereich streichen wir meist mit Mineralfarbe.<br />
Auch für Fassaden verwenden wir<br />
die Farbe häufig. Bei historischen Bauten ist<br />
dies naheliegend, aber auch bei Neubauten wäre<br />
es sinnvoll, die Aussenschichten nachhaltig aufzubauen<br />
und Mineralfarbe einzusetzen.<br />
Welche Schwierigkeiten bietet die reine<br />
Silikatfarbe in der Anwendung?<br />
JD: Die Farbe setzt einen rein mineralischen<br />
Untergrund voraus. Leider ist fast die Hälfte<br />
der Objekte, mit denen wir uns auseinandersetzen<br />
und die eigentlich einen mineralischen<br />
Verputz hätten, zwischen 1970 und 2000 mit<br />
Dispersions- oder Silikonharzfarbe überstrichen<br />
worden. Das verhindert die Behandlung<br />
mit Mineralfarbe.<br />
Wie eignet man sich die Kenntnisse an?<br />
JD: In der Theorie lernt man den Umgang mit<br />
dieser Maltechnik an der Berufsschule, in der<br />
Praxis im Handwerksbetrieb. Bezüglich Anwendung<br />
ist reine Silikatfarbe unproblematisch,<br />
etwas Fingerspitzengefühl ist bei der Mischung<br />
der Farbe und bei der Vorbereitung des<br />
Untergrunds notwendig. Bei Unsicherheiten<br />
haben wir die Möglichkeit, auf die Beratung<br />
der Hersteller zurückzugreifen.<br />
ANDREA MÜLLER: Die grosse Herausforderung<br />
beim Seehaus war sicher die lasierende<br />
Technik, sie ist schwieriger als ein deckender<br />
Anstrich. Eine solche Herausforderung anzunehmen,<br />
gehört aber zu meinem Berufsstolz.<br />
Wie sind Sie beim Seehaus vorgegangen?<br />
JD: Die Untersuchung des originalen Mineralfarbanstrichs<br />
ergab, dass dieser exakt mit dem<br />
reinen Farbton Nr. 9010 der Keim-Farbpalette,<br />
dem Klassiker unter den Mineralfarben, übereinstimmt.<br />
Es war daher naheliegend, für die<br />
Restaurierung diesen Farbton zu verwenden.<br />
AM: Der alte Anstrich war unterschiedlich<br />
stark verwittert. Er wurde gereinigt und ge-<br />
flickt, dann passten wir die Flickstellen dem<br />
bestehenden Anstrich an. Die Grundierung<br />
wurde mit zwei Schichten Lasur überzogen,<br />
die mit der Bürste aufgetragen wurden. Dafür<br />
haben wir jeweils Musterflächen hergestellt.<br />
Was empfehlen Sie einer Bauherrschaft,<br />
die ein historisches Gebäude besitzt?<br />
JD: Das Gespräch ist wichtig, und zwar bereits<br />
zu Beginn der Planung. Wenn sich die Bauherrschaft<br />
mit den Malern, der Bauberatung der<br />
Denkmalpflege und dem Restaurator zusammensetzt,<br />
hat sie eine ideale Basis, um mögliche<br />
Wege für die Restaurierung herauszufinden.<br />
Der Restaurator kann die originale<br />
Farbgebung und die Beschaffenheit des Untergrundes<br />
ermitteln. Wenn möglich wählt man<br />
die gleichen Materialien wie für die Erbauung<br />
des Gebäudes. Interview: Elisabeth Schneeberger<br />
Das Geheimnis hinter dem «kristallinen Leuchten»<br />
Basis der Silikatfarbe, der sogenannten Mineralfarbe, ist Quarz. Das Mineral wird zusammen<br />
mit Pottasche (Kaliumcarbonat) bei hohen Temperaturen zu Kaliwasserglas<br />
geschmolzen, dem Bindemittel der Silikatfarbe. Reine Silikatfarbe besteht aus den zwei<br />
Komponenten Pigment und Kaliwasserglas. Mineralfarbe benötigt einen mineralischen<br />
Untergrund (bspw. Kalkverputz, Beton). Beim Abbinden reagiert Kaliwasserglas chemisch<br />
mit dem Kalk des Untergrundes und mit den Pigmenten. Dies wird als Verkieselung<br />
bezeichnet. Die stabile Verbindung mit dem Untergrund macht den Mineralfarbanstrich<br />
ausserordentlich dauerhaft und lichtbeständig. Die direkte Lichtreflexion<br />
auf den Pigmenten lässt die Farben brillant wirken und verleiht ihnen das sogenannte<br />
kristalline Leuchten. Die Silikattechnik wurde im 19. Jahrhundert von Adolf Wilhelm<br />
Keim entwickelt. Als Alternative zur traditionellen Kalktünche ermöglichte sie leuchtend<br />
bunte Fassadenanstriche. Die Farbe wurde zu einem Thema in der Architektur;<br />
1919 propagierte der Deutsche Werkbund in seinem «Aufruf zum farbigen Bauen» die<br />
Farbe als «Ausdruck von Lebensfreude».<br />
10 <strong>Denkmalpflegepreis</strong> · <strong>2017</strong><br />
11
prix spécial <strong>2017</strong><br />
Sauvegarde d’un<br />
bâtiment industriel<br />
Le Prix spécial <strong>2017</strong> est attribué aux responsables de la sauvegarde<br />
de l’ancienne fabrique de pâte à papier à Péry-Rondchâtel pour leur travail<br />
exemplaire de réflexion sur l’exploitation et la restauration du site.<br />
Texte : René Koelliker, Photos: Jacques Bélat<br />
1 La restauration du bâtiment lui a<br />
redonné son aspect d’origine. Les éléments<br />
perturbants ont été évacués.<br />
1
L’<br />
ancienne fabrique de pâte à papier,<br />
construite en 1882, est un important<br />
témoin de l’histoire de l’exploitation<br />
industrielle de La Suze. Fondé le 17 février<br />
1865, l’ancien groupe de l’industrie du papier,<br />
avec siège à Biberist, fait bâtir une fabrique<br />
de pâte à bois à Rondchâtel. Cet édifice conserve<br />
son toit à la Mansart. Il est complété d’une tour<br />
carrée et présente des façades partiellement<br />
rythmées de pilastres peints. Le bâtiment est<br />
considérablement agrandi en 1910, puis connaîtra<br />
des transformations moins heureuses les<br />
années suivantes.<br />
En 2002, la production cesse et les installations<br />
sont enlevées. Les turbines hydrauliques<br />
sont modifiées pour produire de l’électricité. En<br />
2008 est présenté un nouveau projet d’installation<br />
électrique, plus performante et reprenant le<br />
droit d’eau de l’ancienne usine. Au mois de mars<br />
2011, la nouvelle concession est octroyée à condition<br />
d’élaborer un plan garantissant la pérennité<br />
des monuments historiques. Le projet prévoit<br />
de continuer à produire de l’électricité avec l’eau<br />
d’une source auparavant inexploitée. Aujourd’hui,<br />
l’eau actionne deux turbines qui servaient jadis<br />
au déchiquetage du bois. Cette «nouvelle» affectation<br />
a permis de donner l’impulsion nécessaire<br />
à la restauration de l’enveloppe des bâtiments<br />
anciens, réalisée entre 2013 et 2015.<br />
La restauration de l’enveloppe<br />
Pour restaurer les bâtiments de 1882 et 1910, il<br />
a d’abord fallu démolir les nombreux éléments<br />
ajoutés au cours du XX e siècle, par exemple le<br />
monte-charge, des constructions annexes ou<br />
des tuyauteries. Dans un second temps, la remise<br />
en état des façades et des crépis existants<br />
et la reconstitution des éléments décoratifs par<br />
l’emploi de coloris originaux ont permis de redonner<br />
la structure primitive. Pour respecter<br />
les traces laissées par l’histoire, les parties endommagées<br />
par les adjonctions ont été laissées<br />
en l’état, comme les murs de béton en façade.<br />
Les imposantes toitures, en partie à la Mansart,<br />
sur les deux bâtiments, les lucarnes et les<br />
éléments endommagés de la charpente ont été<br />
remplacés ou restaurés avec soin. À l’intérieur,<br />
aucun programme de restauration n’a été entrepris<br />
pour l’instant.<br />
Sauvegarde du patrimoine industriel<br />
Le Prix spécial de la Commission d’experts<br />
pour la protection du patrimoine du canton de<br />
Berne est attribué aux responsables de la sauvegarde<br />
de l’ancienne fabrique de pâte à papier,<br />
donc à l’entreprise Ciments Vigier SA et à<br />
M. Fritz Schwarz, chef du projet masterplan.<br />
Avec leur engagement hors de l’ordinaire, ils<br />
ont assuré la sauvegarde de cet édifice industriel<br />
isolé dans la gorge de la Suze, sa restauration<br />
et son exploitation. La réalisation confirme<br />
que chaque réussite dans le domaine de la sauvegarde<br />
d’un patrimoine historique dépend de<br />
personnes particulièrement engagées.<br />
C’est le travail d’équipe qui a convaincu le<br />
jury. Et en premier lieu la société Ciments<br />
Vigier SA qui, après avoir été obligée de garantir<br />
la pérennité de l’ancienne fabrique de pâte<br />
à papier, s’est engagée dans la restauration de<br />
l’extérieur du grand complexe: toiture, façades,<br />
fenêtres. Le soin qu’elle y a mis est une preuve<br />
de la responsabilité qu’elle assume envers le<br />
patrimoine architectural, adoptant ainsi une<br />
attitude devenue rare parmi les grandes entreprises<br />
privées.<br />
Cette enveloppe, remise en des conditions<br />
impeccables, contient une structure intérieure<br />
avec des témoins importants de son passé industriel.<br />
Olivier Burri, conseiller technique du<br />
Service cantonal des monuments historiques,<br />
s’est chargé d’organiser la mise en œuvre de<br />
l’opération selon les principes suisses pour la<br />
conservation du patrimoine architectural.<br />
C’est grâce à Fritz Schwarz que la vie active<br />
n’a pas disparu de ce lieu. Il connaît les vieilles<br />
machines, est capable de les faire tourner, règle<br />
les conditions d’utilisation de l’eau de source et<br />
continue à produire de l’électricité.<br />
2 Les nouvelles fenêtres du rez-de-chaussée<br />
essayent de donner une réponse de qua lité à<br />
celles conservées au premier étage.<br />
3 Une grande partie des fenêtres en fonte<br />
ont été conservées. Les rigoles et baquets<br />
pour récupérer l’eau de condensation sont<br />
également encore en place.<br />
Adresses<br />
de contact<br />
Maître d’ouvrage<br />
Ciments Vigier SA<br />
Thierry Gagnebin, directeur<br />
finances et administration<br />
Zone industrielle Rondchâtel<br />
2603 Péry<br />
T 032 485 03 00<br />
www.vigier-ciment.ch<br />
Planification (plan directeur)<br />
Rondchâtel Dynamo-Stations GmbH<br />
Fritz Schwarz, directeur<br />
Rondchâtel 237<br />
2603 Péry<br />
T 034 445 80 80<br />
Direction des travaux<br />
Landwirtschaftliches Bau- und<br />
Architekturbüro LBA<br />
Hanspeter Reusser, architecte ETS<br />
responsable du bureau régional<br />
Heiligenschwendi<br />
Beim Schulhaus 196<br />
3625 Heiligenschwendi<br />
T 033 243 27 02<br />
www.lba.ch<br />
Restauration<br />
Alain Fretz, restaurateur HFG<br />
Rue du Monnet 3<br />
2603 Péry<br />
T 078 649 44 10<br />
alain.fretz@bluewin.ch<br />
Maître d’œuvre<br />
Genossenschaft für leistungsorientiertes<br />
Bauen (GLB)<br />
Paul Blaser<br />
siège de l’entreprise, Seeland<br />
Grenzstrasse 25<br />
3250 Lyss<br />
T 032 387 41 41<br />
www.glb.ch<br />
Couverture et ferblanterie<br />
Bedachungen Wyss<br />
Andreas Wyss<br />
Finkfeld 7, 3400 Berthoud<br />
T 034 422 86 47<br />
www.wyssdach.ch<br />
2<br />
3<br />
Prix spécial <strong>2017</strong><br />
Commission d’experts pour la protection du patrimoine<br />
En <strong>2017</strong>, le Prix spécial de la Commission d’experts pour la protection du patrimoine est décerné<br />
pour la quatrième fois. Contrairement au Prix des monuments historiques qui est décerné pour<br />
un monument historique affecté à un usage ordinaire, le Prix spécial récompense la restauration<br />
soigneuse d’un bâtiment hors du commun, avec toutes les mesures que cela implique, le choix d’une<br />
solution remarquable ou l’action personnelle particulièrement méritoire du maître de l’ouvrage.<br />
Tous les types de constructions entrent en considération: églises, châteaux, auberges, maisons d’habitation,<br />
villas, bâtiments artisanaux et même des barrages. La Commission d’experts pour la protection<br />
du patrimoine, en tant que jury externe, désigne le lauréat du Prix spécial, apportant ainsi,<br />
ce qui est important, un regard extérieur. Les éléments décisifs sont d’une part les critères généralement<br />
reconnus, comme la qualité de la restauration, et d’autre part le choix de solutions particulièrement<br />
novatrices ou durables.<br />
Le Prix des monuments historiques et le Prix spécial ont tous deux pour but de faire connaître<br />
à un large public le travail du Service des monuments historiques et de favoriser les échanges avec<br />
les partenaires. Les deux donnent une idée de la richesse culturelle du canton de Berne, du Jura à<br />
l’Oberland, et du travail accompli dans la conservation du patrimoine, notamment par les propriétaires,<br />
les architectes et les maîtres d’état, en collaboration avec les services spécialisés.<br />
15
Denkmalpflege des Kantons Bern<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong> <strong>2017</strong><br />
Die Denkmalpflege des Kantons Bern zeichnet mit ihrem Anerkennungspreis eine Bauherrschaft<br />
aus, die ein Baudenkmal mit Alltagsnutzung in Zusammenarbeit mit der Fachstelle sorgfältig<br />
restauriert und weiterentwickelt hat. Auch weniger beachtete Gebäude rücken in den Fokus:<br />
Diese – auf den ersten Blick – unspektakulären Bauten sind aus architektonischer,<br />
geschichtlicher oder technischer Sicht oftmals sehr interessant und prägen die Identität<br />
unserer Dörfer und Städte genauso stark wie Herrschaftsbauten oder Kirchen, in deren Schatten<br />
sie meist stehen. Der <strong>Denkmalpflegepreis</strong> würdigt sowohl den respektvollen Umgang mit<br />
dem Baudenkmal als auch innovative Lösungen. Zu den Kriterien gehören die Qualität der Restaurierung,<br />
die Sorgfalt in der Ausführung und die ökologische Nachhaltigkeit der Massnahmen.<br />
Im Vordergrund steht die Werterhaltung, nicht die Wertvermehrung. Mit einem angemessenen<br />
Budget soll Wohn- oder Nutzungsqualität erhalten, optimiert oder geschaffen werden.<br />
Erziehungsdirektion des Kantons Bern<br />
Amt für Kultur/Denkmalpflege<br />
Direction de l’instruction publique du canton de Berne<br />
Office de la culture/Service des monuments historiques<br />
www.be.ch/denkmalpflege<br />
www.be.ch/monuments-historiques<br />
Die Denkmalpflege des Kantons Bern bedankt sich herzlich bei<br />
Christoph und Dominik Müller, den Fotografen Christian Helmle und<br />
Jacques Bélat sowie bei der Redaktorin Silvia Steidinger.<br />
Das Schweizer Magazin für Modernisierung<br />
erscheint sechsmal pro Jahr.<br />
Umbauen+Renovieren bietet Ihnen anschauliche<br />
Reports aus den Bereichen<br />
Umbau und Sanierung, Werterhaltung<br />
und Renovation sowie Umnutzung und<br />
Ausstattung. Dazu praktisches Wissen<br />
über Ausbau, Haustechnik, Baubiologie<br />
und Gestaltungsfragen vom Grundriss<br />
bis zur Farbe, von der Küche bis zum<br />
Badezimmer. Jede Ausgabe steht unter<br />
einem thema tischen Fokus, was die präsentierten<br />
Objekte für den Leser vergleichbar<br />
macht.<br />
www.umbauen-und-renovieren.ch<br />
www.archithema.ch<br />
2010<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />
Umnutzung und<br />
Restaurierung des<br />
Schulhauses Mauss in<br />
Mühleberg<br />
2011<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />
Aussenrestaurierung<br />
eines Wohnhauses in<br />
Hünibach bei Thun<br />
2012<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />
Innenumbau eines<br />
Reihenhauses in Wabern<br />
2013<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />
Innenrestaurierung eines<br />
Bauernhauses in<br />
Cortébert<br />
Impressum<br />
Herausgeber: Archithema Verlag AG<br />
Rieterstrasse 35<br />
8002 Zürich, T 044 204 18 18<br />
www.archithema.ch<br />
Denkmalpflege des Kantons Bern<br />
Schwarztorstrasse 31<br />
Postfach, 3001 Bern<br />
T 031 633 40 30<br />
www.be.ch/denkmalpflege<br />
Verleger: Emil M. Bisig<br />
emil.bisig@archithema.ch<br />
Chefredaktion: Britta Limper<br />
britta.limper@archithema.ch<br />
Redaktion: Silvia Steidinger<br />
silvia.steidinger@archithema.ch<br />
Grafik: Lars Hellman<br />
lars.hellman@archithema.ch<br />
Bildtechnik: Thomas Ulrich<br />
thomas.ulrich@archithema.ch<br />
Druck: AVD Goldach<br />
Sulzstrasse 12, 9403 Goldach<br />
2014<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />
Sanfte Sanierung eines<br />
Wohnhauses in Muri<br />
bei Bern<br />
2015<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />
Grosses Engagement und<br />
neue Nutzungen für eine<br />
Mühle bei Bern<br />
2016<br />
<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />
Sorgfältige Restaurierung<br />
eines Doppelhauses<br />
in Biel-Bienne<br />
© <strong>2017</strong> Archithema Verlag AG<br />
Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist<br />
nur mit Erlaubnis des Verlages, der<br />
Redaktion und der Denkmalpflege des<br />
Kantons Bern gestattet.<br />
16