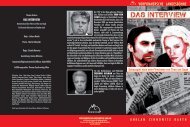DER GELDgott - Vorpommersche Landesbühne GmbH
DER GELDgott - Vorpommersche Landesbühne GmbH
DER GELDgott - Vorpommersche Landesbühne GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Theaterwissenschaftler Prof. Dr. Hans-Jochen Irmer zu Hacks' Umgang<br />
mit alten und neuen Mythen im „Geldgott“:<br />
Die Komödie nach Aristophanes' „Plutos“ entstand 1991, als die rechtselbischen Deutschen<br />
den real existierenden Kapitalismus zu spüren bekamen. Die „gelernten DDR-Bürger“<br />
mussten nun lernen, „was sich rechnet“. Ihre Lehrmeister kamen aus den „alten Bundesländern“<br />
und bestätigten zynisch, was Marx und Engels gelehrt hatten: „Die Bourgeoisie,<br />
wo sie zur Herrschaft gekommen, hat (...) kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch<br />
übrig gelassen, als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung“ (...)<br />
Der notleidende Bauer Chremylos (...) trifft einen blinden, arg ramponierten Bettler, der<br />
sich als Pluto, der Gott des Reichtums, zu erkennen gibt. Zeus hat ihn geblendet, weil er,<br />
statt allen gleichmäßig sich hinzugeben, die arbeitenden Menschen begünstigte (...)<br />
Das Stück für 1991 handelt vom Rückschritt der sozialistischen Länder in die Welt des Kapitals<br />
und von der Privatisierung des Lebens. Die Strukturelemente des klassischen Dramas<br />
stehen dem Dichter jetzt nicht mehr zu Gebote. Der Chor, die Lyrik, der dramatische Vers<br />
weichen einer lakonischen, scharf pointierten Prosa. Der Held und sein Widerpart danken<br />
ab, die neuen Rollen erfordern den Episodenschauspieler (...)<br />
Chremylos spricht von der Bühne herab einen getürkten Zuschauer namens Kohr an. Der<br />
Herr ist der einzige Theaterbesucher an diesem Abend, und seine Anwesenheit verdankt<br />
sich nur dem Umstand, dass er wegen einer Erkältung den Aufenthalt im Fußballstadion<br />
scheut. Alle anderen sind dort bei irgendeinem FC. Die Vorstellung „Der Geldgott“ muss<br />
trotzdem stattfinden, denn sie ist von der Firma K und U gesponsert, und Herr Kohr besitzt<br />
sämtliche Eintrittskarten: „ich bin vierhundert“. Er ist der auf den Nörgler reduzierte Chor (...)<br />
Der Geldgott ist der Glücksgott des Kapitalismus. „Pluto selber“ begreift das nicht, bis<br />
Chremylos ihm die Augen öffnet: Nicht Zeus, „Geld regiert die Welt“. Der Machtwechsel<br />
muss freilich demokratisch legitimiert werden. Fifine richtet „einige gedunsene Worte“ an<br />
die „Freunde, Arbeiter, Menschen“ und erklärt, Zeus sei zwar im Recht, weil Pluto „den<br />
Reichtum an einige Bevorzugte und Lieblinge verteilt hat, statt an die Befugten und Würdigen“,<br />
habe jedoch die falsche Maßnahme getroffen, „denn von nun an zwar kam das<br />
Geld unter die Leute, aber ohne Schlüssel oder Folgerichtigkeit, und seit auf die Art fast<br />
alle Leute reich sind, kann man sagen, dass fast keiner reich ist“. Der geheilte Geldgott<br />
erfüllt allerdings nicht die Erwartung seines Retters. Er segnet diejenigen, die Geld bereits<br />
haben. Ein Herr Lüsterblick und eine Frau Beutelrock, beide (...) finanzkräftig, können<br />
dem verschuldeten Herrn Chremylos einen Knebelungsvertrag aufnötigen, während Pluto<br />
ihn mit ein paar flotten Sprüchen über die Geldwirtschaft abfertigt und von dannen zieht.<br />
Der II. Akt besteht aus lauter Erkennungen und Schicksalswechseln; Nichtwissen wandelt<br />
sich in Wissen, das alsbald wieder als Nichtwissen sich erweist, jede Situation schlägt um<br />
in das ebenso fatale Gegenteil. Unversehens wird Pluto aufgehalten von zwei Damen mit<br />
schlimmer Botschaft von Zeus. Peter Hacks greift behutsam in die Mythologie ein: Die launische<br />
Fortuna ist die Mutter, Paupertas die Schwester des Geldgottes. Sie hinterlassen<br />
„Fortunas riesiges Füllhorn ...“<br />
<strong>DER</strong> GELDGOtt<br />
Komödie von Peter Hacks nach Aristophanes<br />
Regie: Jürgen Kern<br />
Bühne & Kostüme: Alexander Martynow<br />
Inspizienz/Regieassistenz/Souffl.: Dietmar Wurzel<br />
Hospitanz: Volker Klages<br />
Chremylos Daniel Tille<br />
Fifine, seine Sklavin Hanna Mauerer<br />
Pluto, der Geldgott Reiko Rölz<br />
Fortuna, die Glücksgöttin, seine Mutter Wiebke Gätjen<br />
Paupertas, die Göttin der Armut, seine Schwester Susanne Kehl<br />
Lüsterblick, ein reicher Alter Torsten Schemmel<br />
Beutelrock, eine reiche Alte Yvonne Klamant<br />
Herr Kohr Rainer Karsitz<br />
Aufführungsrechte: DREI MASKEN VERLAG, München<br />
Maske: Zuzana Vlasáková (Ltg.), Stefanie Gatter; Technischer Leiter: Hans-Jürgen Engel; Requisite: Team; Lichttechnik:<br />
Karsten Berlin (Ltg.); Bühnen- und Lichttechnik: Christopher Flesch, Christian Fuhrer, Rayk Henning,<br />
Reinhard Jürß; Tontechnik: Bernhard Flesch (Ltg.), Ilian Georgiev; Bühnentechnik: Wolfgang Klabuhn, Ray Neumann;<br />
Auszubildende: Sebastian Haff, Maxim-Paul Krüger, Reno Krause, David Behnke; Schlosserei und Werkstattleitung:<br />
André Lenz; Schneiderei: Waltraud Schultz (Ltg.), Ute Erstling, Sybille Kolpacki, Margitta Schurtz,<br />
Auszubildende: Anna-Pauline Kautz; Ausstattungsleitung: Jutta Dieckmann; Malsaal: Cathleen Dieckmann (Ltg.),<br />
Nicole Ihlenfeld; Tischlerei: Frank Schröder, Enrico Uek; Werbung: Petra Kruse, Sven Kuhlow; Satz & Layout: René<br />
Lembke; Titel: Alexander Martynow; Redaktion: Jörg Neumann<br />
Quellen: H.-J. Irmer u.a., "Staats-Kunst. Der Dramatiker Peter Hacks", Aurora Verlag; Material der Peter-Hacks-<br />
Gesellschaft, www.peter-hacks-gesellschaft.de; Die Peter-Hacks-Seite, www.peter-hacks.de; Sibylle Wirsing, "Geld<br />
und Glück wie Hund und Katz", <strong>DER</strong> TAGESSPIEGEL vom 28. September 1993; Bilder: Wikipedia<br />
VORPOMMERSCHE LANDESBÜHNE ANKLAM<br />
61. Spielzeit, Intendant: Dr. Wolfgang Bordel,<br />
Premiere am 13. Februar 2010 in der "blechbüchse" Zinnowitz<br />
www.vlb-anklam.de<br />
VORPOMMERSCHE LANDESBÜHNE<br />
<strong>DER</strong> <strong>GELDgott</strong><br />
Komödie von Peter Hacks nach Aristophanes<br />
A N K L A M Z I N N O W I T Z B A R T H
Gib ihm das Licht wieder,<br />
Dass er uns finde,<br />
Uns, die Bedürftigen:<br />
Denn Reichtum ist unser wahrestes Ziel<br />
Und tiefgehegteste Absicht.<br />
(Gebet der Fifine in „Der Geldgott“)<br />
<strong>DER</strong> TAGESSPIEGEL veröffentlichte am 28. September 1993 eine Rezension von Sibylle<br />
Wirsing:<br />
„Eine neue Komödie von Peter Hacks im alten Stil: Der Geldgott nach Aristophanes. Die<br />
Uraufführung am Theater Greifswald fand in Abwesenheit des Autors statt. Seinen Segen<br />
hatte er ihr im Voraus gegeben und eine Beschwörung dazu: Gott bewahre die Welt vor<br />
Stücken, die nur aufs hauptstädtische Staatstheater passen. Er möchte solche nicht geschrieben<br />
haben. Die andere Möglichkeit, dass seine Lustspiele nur noch in Vorpommern laufen,<br />
lässt er offen (...)“<br />
Peter Hacks, geboren 1928 in Breslau, studierte (und<br />
promovierte 1951) in München, ging 1955 nach Berlin,<br />
DDR. Er schrieb Dramen, Essais, Gedichte und Kinderbücher.<br />
Er begründete in den sechziger Jahren die „sozialistische<br />
Klassik" und gilt als einer der bedeutendsten<br />
Dramatiker der DDR, der meistgespielte war er mit<br />
Sicherheit.<br />
Einige seiner Dramen sind deutsche Bestseller; einige<br />
sind europäische Erfolge; das „Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn<br />
von Goethe“ ist ein Welterfolg. Mit mehr als 1000 Inszenierungen seiner Stücke an den<br />
Theatern, durch eine Fülle von Fernsehaufzeichnungen, Fernseh- und Hörspielen wurde<br />
Peter Hacks einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Dramatiker in der 2. Hälfte des<br />
20. Jahrhunderts.<br />
Zu seinen wichtigsten Bühnenwerken (manchmal auch Bearbeitungen älterer Stücke) gehören:<br />
„Das Volksbuch vom Herzog Ernst“, „Columbus oder Die Weltidee zu Schiffe“, „Der<br />
Müller von Sanssouci“, „Die Sorgen und die Macht“, „Moritz Tassow“, „Der Frieden“, „Die<br />
schöne Helena“, „Margarete in Aix“, „Amphitryon“, „Prexaspes“, „Adam und Eva“, „Die<br />
Vögel“, „Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern“, „Rosie träumt“, „Senecas Tod“, „Die<br />
Binsen“ ...<br />
... und – in der späten Schaffensphase – nach 1989: „Fafner, die Bisammaus“, „Der Geldgott“,<br />
„Der Maler des Königs“, „Die Höflichkeit des Genies“ und „Der Bischof von China“.<br />
Peter Hacks verstarb im August 2003.<br />
Zur antiken Vorlage<br />
„Der Geldgott“ des Peter Hacks geht auf „Plutos“ („Der Reichtum“), die letzte Komödie des<br />
griechischen Dichters Aristophanes, deren Text der Nachwelt erhalten blieb, zurück. Ihre<br />
erste Fassung entstand 408 v. Chr.; uns ist jedoch nur eine bearbeitete, dem Zeitgeschehen<br />
angepasste Version von 388 v. Chr. überliefert. In seinem letzten (unter eigener Regie!)<br />
aufgeführten Werk stehen bei Aristophanes nicht mehr die großen politischen Fragen der<br />
Zeit im Mittelpunkt, sondern individuelle und gesellschaftliche Probleme, wobei es in „Der<br />
Reichtum“ um die Verteilung von Besitz geht.<br />
Der anständige Chremylos (wörtlich übersetzt: „der kleine Räusperer“) muss in Armut leben,<br />
während zahlreiche Verbrecher ein immer größeres Vermögen anhäufen. Er wendet<br />
sich darum an das Orakel von Delphi, um zu erfahren, ob sein Sohn auch vom Weg der<br />
Tugend abkommen soll, um später ein besseres Leben als sein Vater führen zu können. Von<br />
Apollon erhält er den Rat, dem ersten Menschen, der ihm beim Verlassen des Tempels über<br />
den Weg läuft, zu folgen und ihn in seine Herberge einzuladen. Er trifft auf einen alten,<br />
blinden Mann: Plutos, der Gott des Reichtums. Weil dieser blind ist, kann er nicht sehen,<br />
wie ungerecht er seine Gaben verteilt. Um das zu ändern, lässt ihn Chremylos im Tempel<br />
des Asklepios heilen, worauf sich die Besitzverhältnisse wunschgemäß ändern. Penia, die<br />
Göttin der Armut und damit Gegenspielerin, gelingt es nicht, die Bürger mit einem Vortrag<br />
über die moralische Bedeutung der Armut zu überzeugen. Sie wird verjagt, Plutos dagegen<br />
gefeiert und mit einem Altar im Parthenon geehrt.<br />
Aristophanes, geb. zwischen 450 v. Chr. und 444<br />
v. Chr. in Athen; gest. um 380 v. Chr. ebenda, war ein<br />
griechischer Komödiendichter. Er gilt als einer der bedeutendsten<br />
Vertreter der griechischen Komödie, insbesondere<br />
der sogenannten „Alten Komödie“, und des<br />
griechischen Theaters überhaupt. Aristophanes zielte<br />
mit seinem Werk stets auch auf zeitgenössische Personen<br />
und Ereignisse ab, oft durch drastische Darstellungen<br />
und satirische Schärfe. Dabei persiflierte er teilweise Stilmittel<br />
anderer Dichter, z.B. von Euripides, und äußerte<br />
sich kritisch und spöttisch gegenüber Leuten wie Sokrates und den Sophisten.<br />
Seine Werke haben erkennbare Spuren in der Politsatire der europäischen, insbesondere<br />
der englischen Literatur hinterlassen. Goethe, der eine bearbeitete Fassung von „Die<br />
Vögel“ veröffentlichte, nennt Aristophanes im Prolog einen „ungezogenen Liebling der<br />
Grazien“. Heine stellt ihn in „Deutschland. Ein Wintermärchen“ als einen großen Dramatiker<br />
dar, der (wie Heine selbst) wegen seiner kritischen Haltung im Deutschland des 19.<br />
Jahrhunderts sicher verfolgt würde. Picasso illustrierte 1934 Szenen aus „Lysistrata“ für<br />
eine amerikanische Auflage. Peter Hacks löste mit seiner Bearbeitung von „Der Frieden“<br />
(1962) eine Welle von Antike-Bearbeitungen in der DDR aus. Schließlich wurde ein 1960<br />
entdeckter Asteroid dem Lustspieldichter zu Ehren „2934 Aristophanes“ getauft.<br />
Aus „Die Vögel“ stammen die Redewendungen „Wolkenkuckucksheim“ und „Eulen nach<br />
Athen tragen“, Ciceros „Ubi bene, ibi patria“ („Wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland“)<br />
hat seinen Ursprung im Werk „Der Reichtum“. Das Adjektiv „aristophanisch“ kennzeichnet<br />
heute eine Äußerung als geistvoll, witzig bzw. beißend spöttisch. Seine Komödien, vor<br />
allem „Lysistrata“, werden auch in heutiger Zeit immer wieder gespielt.<br />
Zur Mythologie<br />
Plutos (griech. für „Reichtum“, „Fülle“) ist in der griechischen Mythologie zunächst die<br />
Personifizierung des Reichtums, später der Gott der aus der Erde kommenden Reichtümer,<br />
also auch der Getreidevorräte, der Erdschätze und der keimenden Pflanzen.<br />
Plutos ist nicht zu verwechseln mit dem Gott der Unterwelt Pluto/Pluton (einem anderen<br />
Namen des Hades), obwohl beide möglicherweise die gleichen Ursprünge haben. In späterer<br />
Zeit werden die beiden Götter allerdings gelegentlich auch gleichgesetzt.<br />
Weil er seine Gaben wahllos verteilte, vermuteten die Griechen, Plutos sei von Zeus geblendet<br />
worden. Plutos wurde insbesondere in Eleusis verehrt. Im Kontext der Mysterien von<br />
Eleusis war Plutos das göttliche Kind, der kindliche Doppelgänger des Pluton.<br />
In der bildenden Kunst wird Plutos oft als Knabe mit einem Füllhorn dargestellt. Andere<br />
Darstellungen zeigen Plutos als kleinen Knaben auf dem Arm der Friedensgöttin Eirene,<br />
was den aufkeimenden Wohlstand in Friedenszeiten symbolisiert, oder auf den Armen der<br />
Schicksalsgöttin Tyche.<br />
Kauff & Unbesehen<br />
Produzent feiner Erzeugnisse<br />
Offizieller Sponsor<br />
Peter Hacks, aus: „Zehn Überlegungen, die kleineren Künste betreffend“ (Auszüge)<br />
1 Niemand wundert sich, dass im Kapitalismus die Kunst verkommt. Merkwürdiger ist<br />
die Unfähigkeit der Bourgeoisie zum Kunstgeschäft. Aber das Wort Kunstgeschäft<br />
besteht eben doch noch zu 50% aus dem Wort Kunst, auf dem zweiten Bein, dem<br />
Geschäft, allein steht die Sache wacklig.<br />
2 Erst vergammeln die Zwecke, dann die Mittel. Wo man die Tempel verfallen lässt,<br />
bröckelt es auch am Boulevard.<br />
4 Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Rekonstruktion der Kunst ist die Anerkennung<br />
des Gutgemachten. Gediegenes Handwerk hat in dieser Zeit der Verwahrlosung<br />
schon fast die Würde von Klassik.<br />
5 Es gibt große Kunstgattungen und kleine. Die großen – Epos, Drama, Roman – sind<br />
fähig zur Abbildung des Weltganzen. Den kleinen fehlt immer etwas. Der Graphik<br />
die Ausdehnung, dem Gedicht die Länge, dem Ballett die Mitteilungsmöglichkeit für<br />
verwickeltere Sachverhalte, dem Kinderbuch die Lebenserfahrung, dem Dokumentarspiel<br />
die Phantasie, der Operette die Reflexion, dem Fernsehen alles das.<br />
7 Eine kleine Gattung darf einen Gedanken vortragen, ohne den gegenteiligen Gedanken<br />
zu erwägen. Sie darf aktuell sein, ohne die Zeitgeschichte in die Weltgeschichte<br />
einzuordnen. Sie darf heiter sein und vom Ernst der Dinge absehen.<br />
8 So sind die kleinen Werke gemeinhin vergängliche Werke. Paradoxerweise gibt es<br />
klassische unter ihnen, unsterblich Vergängliches.