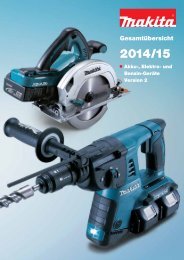7_Politische Rahmenbedingungen einer gesunden Entwicklung...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beiträge aus W issenschaft<br />
und Praxis<br />
Prof. Dr. Johann D. Hellwege<br />
<strong>Politische</strong> <strong>Rahmenbedingungen</strong><br />
<strong>einer</strong> <strong>gesunden</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
der Wirtschaft in den 80er Jahren<br />
2/85
B itte m e rk e n S ie vo r:<br />
2. Arbeitstagung<br />
des Institutes Mensch und Arbeitswelt<br />
<strong>Politische</strong> <strong>Rahmenbedingungen</strong> <strong>einer</strong> <strong>gesunden</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> der Wirtschaft in den 80er Jahren<br />
T hem a:<br />
Was bewegt zur Arbeit?<br />
Motivationstechnik oder anderes?<br />
8. und 9. November 1985 im Kongreßhaus Baden-Baden<br />
Im September 1985 beginnen wieder zweijährige<br />
Selbsterfahrungsgruppen<br />
zur Persönlichkeitsbildung<br />
Leitung: Prof. Affemann<br />
W ir b ie te n z w e i F o rm e n d e r G ru p p e n a rb e it a n :<br />
1. Gespräche, die wöchentlich einmal abends stattfinden.<br />
2. Blockgruppen, die sechsmal im Jahr 1’/2 Tage<br />
von Freitag morgens bis Samstag mittags Zusammenkommen.<br />
Ort ist jeweils der neue Sitz des Institutes in Baden-Baden.<br />
Interessenten wenden sich bitte baldmöglichst an die bisherige Adresse<br />
des Institutes Mensch und Arbeitswelt, Stuttgart.<br />
Herausgeber: Institut Mensch und Arbeitswelt, Stuttgart<br />
Druck und Vertag: Georg Kohl GmbH + Co, Brackenheim<br />
D ie w irts c h a ftlic h e K ris e d e r le tz te n J a h r e ...<br />
Die Weltwirtschaft und damit auch die deutsche Volkswirtschaft befindet<br />
sich in der längsten und tiefsten Krise der letzten fünfzig Jahre. Die<br />
Abwärtsbewegung begann in der Bundesrepublik Anfang der 80er<br />
Jahre.<br />
1979 war das letzte Jahr, in dem die gesamtwirtschaftliche Wachstumsdynamik<br />
ausreichte, um Produktion und Beschäftigung spürbarzu erhöhen<br />
und damit - obwohl ein geburtenstarker Jahrgang ins Erwerbsleben<br />
trat - die Zahl der Arbeitslosen merklich zu verringern. 1980 war das Jahr<br />
des Übergangs: Stagnationstendenzen wurden von wirtschaftlichen<br />
Rückschlägen abgelöst. Da es der Nachfrage nach deutschen Gütern<br />
und Dienstleistungen an Dynamik mangelte, expandierte auch die Nachfrage<br />
der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern nicht mehr-die Zahl der<br />
amtlich registrierten offenen Stellen ging erstmals seit Jahren zurück, von<br />
Anfang 1980 bis Ende 1980 um 50.000. Die Stammbelegschaften mußten<br />
zudem verstärkt kurzarbeiten - innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der<br />
Kurzarbeiter von 100.000 auf 400.000. In den vergangenen Jahren - von<br />
Anfang 1980 bis Ende 1984 - erhöhte sich nicht zuletzt aufgrund mangelnder<br />
wirtschaftlicher Entfaltung die Zahl der Arbeitslosen um<br />
V A Million.<br />
Die Abwärtsbewegung begann in der Bundesrepublik wie ein ganz normaler<br />
zyklischer Abschwung; jedenfalls hatte es für viele den Anschein.<br />
Doch seit nunmehr drei Jahren kommt ein sich selbst tragender Aufschwung<br />
nicht zustande. Zwar setzten sich in manchen Bereichen die<br />
expansiven Kräfte wieder durch. Aber in anderen Sektoren überwiegen<br />
nach wie vor stagnierende oder restriktive Elemente. Per Saldo kam nur<br />
ein leichtes konjunkturelles Plus zustande. Immerhin reichte 1984 das<br />
gesamtwirtschaftliche Wachstum aus, auch wenn es nach wie vor<br />
bescheiden ausfiel, um einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit<br />
1
nahezu zu verhindern. Daneben herrscht an der Preisfront weitgehend<br />
Ruhe Und die öffentlichen Haushalte spiegeln erste Konsolidierungsbestrebungen<br />
wider. Schließlich zeigt das Ausland ein reges Interesse an<br />
deutschen Produkten.<br />
u n d d ie P ro b le m fe ld e r d e r k o m m e n d e n J a h re<br />
So erfreulich es ist, daß sich erste konjunkturelle Erholungstendenzen<br />
ausbreiteten, darf doch nicht übersehen werden, daß dieses nur der erste<br />
Schritt sein kann. Denn einmal folgt jeder konjunkturellen Erholung<br />
irgendwann eine konjunkturelle Raute. Und zum anderen sind die Problemfelder<br />
und Verwerfungen der 70er Jahre, die die gegenwärtige Krise<br />
auslösten und verfestigten, bei weitem noch nicht beseitigt worden. Nach<br />
wie vor ergeben sich für die Bundesrepublik eine Reihe von Spannungsfeldem<br />
- seien sie nun wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer oder<br />
gesellschaftlicher und gesellschaftspolitischer Natur. Beispielhaft seien<br />
genannt:<br />
- Die Hypothek hoher Arbeitslosigkeit wird in naher Zukunft Politik, Wirtschaft<br />
und Gesellschaft belasten.<br />
- Der Trend zu immer kürzeren Arbeitszeiten erfordert wirtschaftlich effiziente<br />
und sozial verträgliche Lösungen. Interessengegensätze bei<br />
den Tarifparteien erschwerten bis zuletzt zukunftsweisende Absprachen.<br />
- Das Spannungsfeld Ökonomie/Ökologie scheint sich gegenwärtig<br />
nicht problemgerecht abbauen zu lassen.<br />
- Die Korrigierbarkeit bürokratischer Fehlentwicklungen, die im beachtlichen<br />
Maße zu Lasten der kleinen Leute gehen, erweist sich nach wie<br />
vor als äußerst begrenzt.<br />
- Die hohe Abgabenlast an Steuern und Sozialabgaben bremst die Leistungsbereitschaft<br />
und das Leistungsvermögen sowohl bei Unternehmern<br />
wie auch bei Arbeitnehmern.<br />
- Für einen durchgreifenden Abbau überholter und überzogener Subventionen<br />
fehlen aus dem politischen Raum nach wie vor überzeugende<br />
Lösungsvorschläge, die mit Nachdruck und Standhaftigkeit<br />
betrieben werden.<br />
- Die Eigenkapitalausstattung und Risikokapitalbeschaffung der Unternehmen<br />
erweist sich immer mehr als unzureichend und mindert die<br />
Widerstandskraft und Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen.<br />
- Die zukunftsorientierte Nutzung der neuen Technologien stößt auf vielfältigen<br />
Widerstand.<br />
- In den letzten Jahren hat sich ein Potential an Zukunftsangst aufgebaut,<br />
das ein sinnvolles Optieren auf Zukunftschancen kaum noch<br />
zuläßt.<br />
- Weltwirtschaftliche und weltpolitische Turbulenzen stellen eine nachhaltige<br />
Bedrohung für die deutsche Exportwirtschaft dar.<br />
In vielen Bereichen des Welthandels machen sich immer mehr protektionistische<br />
Regelungen breit.<br />
Die Verschuldung vieler <strong>Entwicklung</strong>sländer und einiger Staatshandelsländer<br />
stellt die internationalen Wirtschaftsbeziehungen - nicht<br />
zuletzt die der stark außenhandelsorientierten Bundesrepublik - vor<br />
ernsthafte Probleme.<br />
Fehlentwicklungen im Rahmen der EG gehen zwangsläufig zu Lasten<br />
aller Mitglieder, aber auch zu Lasten von Nicht-Mitgliedern.<br />
Umfang und Beharrungsvermögen dieser Problemfelder erschweren<br />
das wirtschaftliche Handeln in hohem Maße. Wirtschaften ist viel schwieriger<br />
als noch vor 10 oder 20 Jahren. Es gilt, erstarrte Fronten, verkrustete<br />
Strukturen und überholte Verhaltensweisen zukunftsorientiert aufzubrechen.<br />
Dabei ist sowohl wirtschaftliche Effizienz als auch soziale Verträglichkeit<br />
gleichermaßen zu beachten.<br />
A n s a tz p u n k te fü r e in e V e rb e s s e ru n g d e r R a h m e n b e d in g u n g e n<br />
Damit die Bundesrepublik auch in Zukunft wirtschaftlich und gesellschaftlich<br />
bestehen kann, ist dreierlei erforderlich:<br />
- Es muß ein akzeptabler Ausgleich geschaffen werden zwischen privaten<br />
Wünschen und öffentlicher Verantwortung.<br />
- Um für kommende Generationen Vorsorge zu treffen, müssen die<br />
Begabungen, Motivationen, Anstrengungen und Leistungen der Bürger<br />
voll zur Entfaltung gelangen.<br />
- Modernität darf nicht nur als ökonomischer Wettbewerbsvorteil verstanden<br />
werden, sondern auch als Herausforderung, um gesellschaftlich<br />
gestaltungsfähig zu bleiben.<br />
2<br />
3
A n s a tz p u n k t: ö ffe n tlic h e r H a u s h a lt<br />
Der amerikanische Ökonom Robert M. Solow urteilte einmal: „Wir kommen<br />
aufgrund der Vorsorge unserer Vorfahren gut weg. Wenn man<br />
bedenkt, wie arm sie waren und wie reich wir sind, dann hätten sie gut<br />
und gern weniger sparen und mehr konsumieren können.“ Es sieht so<br />
aus. als ob sich heute andere Motive und Verhaltensweisen durchsetzen<br />
würden.<br />
Einmal erweist sich neben dem Einkommen, über das der Mensch verfügen<br />
kann, immer mehr der Kredit, den er aufnehmen kann, als wirtschaftlich<br />
relevant, um private Wünsche zu erfüllen.<br />
Zum anderen wird der öffentliche Haushalt nicht nur zur Befriedigung<br />
öffentlicher Bedürfnisse benutzt, sondern immer mehr auch zur Erfüllung<br />
privater Wünsche. Gerade in der jüngeren Vergangenheit fanden private<br />
Wünsche oder Gruppenwünsche ihren Niederschlag in institutionalisierten<br />
Erwartungen. Diese wurden dann wiederum vielfach in (Rechts-)<br />
Ansprüche umgeformt. Die öffentlichen Haushalte sind immer weniger<br />
Drehscheibe öffentlicher Bedürfnisse, die begrenzt sind, als vielmehr<br />
Schwungrad zur Erfüllung privater Wünsche, die unbegrenzt sind. Auch<br />
für uns gilt ein Wort Mahatma Gandhis: Die Bedürfnisse sind begrenzt,<br />
die Begehrlichkeiten unbegrenzt.<br />
Die im politischen Geschehen zu akzeptierende ökonomische Restriktion<br />
wäre an sich schon der öffentliche Haushalt. Doch dieser ist zum<br />
„politischen Markt“ geworden. Verschiedene Gruppen haben sich zu<br />
immer ungehemmteren Antragstellern entwickeln können, da die<br />
Schwäche des politischen Willens, den drängenden (Wirtschafts-)Problemen<br />
zu begegnen, in der jüngeren Vergangenheit offensichtlich war.<br />
Sozialleistungen und Subventionen des Staates entwickelten eine Dynamik,<br />
die schon einzigartig ist. Hier gilt es den Hebel anzusetzen.<br />
Ü b e rzo g e n e S o z ia lle is tu n g e n<br />
Die Bürger werden durch den Staat in eine umfassende soziale Sicherung<br />
gehüllt - größtenteils über die existenzsichernden Ansprüche hinaus.<br />
Wurden 1973 noch 252 Mrd. DM an staatlichen Sozialleistungen<br />
gewährt, so waren es 1981509 Mrd. DM. Innerhalb von acht Jahren haben<br />
sich damit die Sozialleistungen des Staates verdoppelt. In den letzten<br />
Jahren hat sich der Aufwärtstrend zwar abgeschwächt (1983: 537 Mrd.<br />
DM). Aber dies reichte aus, um bei <strong>einer</strong> Reihe von sozialen Ausgabenkategorien<br />
wie bei den Leistungen für Gesundheit oder Wohnen die Fehl<br />
lenkung und Überversorgung weiter zu akzentuieren. Das Übermaß an<br />
sozialer Sicherung wurde über Jahre hinweg weniger als Übel, sondern<br />
vielmehr als staatliche Wohltat angesehen. Eigenverantwortung, Eigeninitiative<br />
und Eigenhilfe erlitten dadurch nachhaltigen Schaden.<br />
Der Irrglaube: man selbst kassiert, aber die anderen zahlen, hat in den<br />
70er Jahren leider viele Anhänger gefunden. 1980 wurde bei der Lohnsteuer<br />
(Einkommensteuer aus unselbständiger Arbeit), der größten Einzelsteuer<br />
77% des Steueraufkommens von Steuerpflichtigen gezahlt, die<br />
weniger als 75.000 DM verdienten. Eine Bilanz, die belegt, daß der Staat<br />
nichts zu verschenken hat. Der Abbau überzogener und überholter<br />
Sozialleistungen ist erforderlich, damit der einzelne selbst wieder kraftvoll<br />
zu handeln beginnt und der Staat sich auf das konzentrieren kann,<br />
was er besser kann als die Privaten.<br />
S c h ä d lic h e S u b v e n tio n e n<br />
Die deutsche Subventionspraxis umfaßt - so das Institut für Weltwirtschaft<br />
an der Universität Kiel - mehr als 10.000 Einzelpositionen von<br />
Bund, Ländern und anderen staatlichen Stellen. Wurden 1973 noch<br />
knapp 62 Mrd. DM an Subventionen vom Staatssektor geleistet, so waren<br />
es 1981 schon 113 Mrd. DM. Der Umfang der staatlichen Hilfen hat sich<br />
damit in acht Jahren fast verdoppelt. Auch in den letzten Jahren dürfte<br />
das Anstiegstempo nahezu unverändert geblieben sein. Die Subventionen<br />
stiegen damit schneller als z. B. die Steuern, die zur Finanzierung der<br />
Subventionen mit herangezogen werden. Unter den Subventionen dominierten<br />
eindeutig die Erhaltungssubventionen. Das Deutsche Institut für<br />
Wirtschaftsforschung in Berlin ermittelte, daß 1982 36% der Finanzhilfen<br />
und Steuervergünstigungen zur Erhaltung schwacher Wirtschaftszweige<br />
dienten; nicht eingerechnet die Zahlungen an die Bundesbahn, im Wohnungswesen<br />
und in der Regionalförderung.<br />
Die Hauptsubventionsempfänger sind heute noch die gleichen Branchen<br />
wie 1970: Die Eisenbahn, die Landwirtschaft, derKohlebergbau, der<br />
Schiffbau u.a.m. Es ist doch bemerkenswert, daß nicht einige herausgefallen<br />
und andere hinzugekommen sind.<br />
Das Urteil der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute fällt einheitlich<br />
aus: Die Vielzahl der Subventionen trägt zur jahrelangen Erhaltung nicht<br />
mehr wettbewerbsfähiger Branchen bei, nicht aber zur produktivitätsorientierten<br />
Umsetzung von Produktionsfaktoren.<br />
4<br />
5
Angesichts der weltwirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich die<br />
deutsche Wirtschaft gegenübersieht, ist eine Politik erforderlich, die sich<br />
nicht nur auf das Krisenmanagement beschränkt, sondern vor allem auf<br />
die Gestaltung <strong>einer</strong> zukunftsorientierten Wirtschaftsstruktur ausgerichtet<br />
ist. Darum ist ein nachhaltiger Abbau der Subventionen unverzichtbar.<br />
Am vielschichtigen Widerstand gegen die Durchforstung der Subventionen<br />
darf dieses Vorhaben nicht länger scheitern.<br />
A n s a tz p u n k t: S a c h k a p ita l u n d H u m a n k a p ita l<br />
Zur Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind nicht in<br />
erster Linie spezielle wirtschaftspolitische Maßnahmen gefragt. Sondern<br />
es sind verläßliche und innovationsfreundliche <strong>Rahmenbedingungen</strong> erforderlich.<br />
Die Erleichterung der Bildung von Risikokapital durch steuerund<br />
gesellschaftsrechtliche Verbesserungen oder der konsequente<br />
Abbau von staatlichen Reglementierungen seien beispielhaft genannt.<br />
Daneben brauchen wir eine Wirtschafts-, Bildungs-, Sozial- und Gesellschaftspolitik,<br />
die den Einsatz des Humankapitals in unserer Volkswirtschaft<br />
fördert, die den geistigen Fähigkeiten und der Kreativität der Menschen<br />
ausreichend Spielraum läßt. Dies würde die mittel- und langfristigen<br />
Investitions- und Beschäftigungsentscheidungen positiv beeinflussen.<br />
G e rin g e E g e n k a p ita la u s s ta ttu n g<br />
In jüngster Zeit wird die Eigenkapitalausstattung der deutschen Wirtschaft<br />
zunehmend als Achillesferse angesehen. Die Eigenkapitalquote<br />
der deutschen Unternehmen ist seit Ende der 60er Jahre rückläufig; sie<br />
ist nicht mehr allzu hoch. Nach Berechnungen der deutschen Bundesbank<br />
ist sie von über 30% auf unter 20% gesunken. Die Erosion der Eigenkapitalquote<br />
ist zu einem zentralen Thema der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik<br />
geworden. Denn eine ausreichende Eigenkapitalausstattung<br />
ist eine notwendige Bedingung, um die Wirtschaft zu modernisieren<br />
und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Insbesondere für kl<strong>einer</strong>e und<br />
mittlere Unternehmen reichen die Eigenmittel nicht aus, um die notwendigen<br />
zukunftsorientierten Investitionen finanzieren zu können.<br />
Die schlechte Eigenkapitalausstattung der deutschen Wirtschaft ist vor<br />
allem auf drei Ursachen zurückzuführen:<br />
- Die schwache Gewinnentwicklung.<br />
- Die steuerliche Benachteiligung von Eigenkapital.<br />
- Die Kapitalfehllenkung durch den Staat.<br />
Einer, der es eigentlich wissen müßte, Heinz Nixdorf, hat gesagt: „Was ich<br />
in 30 Jahren gelernt habe, ist die Erkenntnis, daß Profit die Basis für<br />
Eigenkapital ist, das sich in neue Arbeitsplätze umsetzen läßt."<br />
Vergleicht man die Ertragsbedingungen in den großen westlichen Industrieländern<br />
- USA, Japan, Großbritannien, Frankreich und Bundesrepublik<br />
Deutschland - so schneiden deutsche Unternehmen sehr schlecht<br />
ab. Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft war in<br />
den 70er Jahren die Nettoeigenkapitalrendite der großen Industrieunternehmen<br />
am niedrigsten in der Bundesrepublik; ähnlich niedrig war sie<br />
nur noch in Frankreich, dann folgte Großbritannien. In allen drei Ländern<br />
lag die Verzinsung des Eigenkapitals unter der Rendite von festverzinslichen<br />
Wertpapieren. Ganz anders dagegen die Situation in Japan und den<br />
USA: Deutlich höhere Eigenkapitalrendite, die zudem noch überder Verzinsung<br />
von Festverzinslichen lag. In den 80er Jahren hat sich nicht viel<br />
geändert. Auch 1982 war in der Bundesrepublik die Eigenkapitalverzinsung<br />
deutlich niedriger als die Fremdkapitalverzinsung. Wen wundert es<br />
da, daß die entscheidende Bedingung für einen sich selbst tragenden<br />
Aufschwung, nämlich deutlich steigende Investitionen und damit ausreichende<br />
Beschäftigungseffekte, nicht erfüllt wurde. Mäßige Gewinne und<br />
Gewinnerwartungen sowie hohe Zinsen für festverzinsliche Wertpapiere<br />
veranlaßten so manches Unternehmen, einen Teil s<strong>einer</strong> liquiden Mittel<br />
nicht für Investitionen auszugeben, sondern in Festverzinslichen anzulegen.<br />
Obwohl die Gewinnsituation für deutsche Unternehmen recht bescheiden<br />
ist, glauben viele Bürger an nahezu „phantastische“ Gewinne. Die<br />
Schätzungen liegen um ein Vielfaches über der tatsächlichen Rendite.<br />
Und obwohl die Gewinnentwicklung in den 70er Jahren rückläufig war,<br />
vermuteten die Bürger tendenziell steigende Renditen.<br />
Ohne ausreichende Gewinne ist eine interne Eigenkapitalbildung nicht<br />
möglich. Ohne ausreichende Gewinne ist aber auch die Eigenkapitalzuführung<br />
von außen sehr unwahrscheinlich und außerdem dürfte nur<br />
wenig Fremdkapital zur Verfügung gestellt werden und das, was zur Verfügung<br />
gestellt wird, dann selbstverständlich zu vergleichsweise hohen<br />
Zinsen.<br />
S tü tz u n g d e s E ig e n - u n d R is ik o k a p ita ls<br />
Vergleiche mit den Hauptwettbewerbsländern der Bundesrepublik zeigen,<br />
daß bei uns der einbehaltene Gewinn stärker besteuert wird als bei<br />
6<br />
7
unseren Konkurrenten. Die höhere Belastung geht zu Lasten von Investitionen<br />
und Arbeitsplätzen. Eine merkliche Korrektur ist darum notwendig.<br />
Bei der Zufuhr von Beteiligungskapital, der Eigenkapitalbeschaffung von<br />
außen, gibt es Barrieren im Steuerrecht und Gesellschaftsrecht. Hier gilt<br />
es, die entsprechenden <strong>Rahmenbedingungen</strong> zu schaffen, um die<br />
Hemmnisse zu beseitigen.<br />
Die externe Eigen-und Risikokapitalzuführung wird beispielsweise durch<br />
die Belastung mit Gesellschaftssteuer und Börsenumsatzsteuer<br />
erschwert. Es ist zu überlegen, ob nicht diese Kapitalverkehrssteuern<br />
abgeschafft werden sollten. Auf Bundes- und Länderebene werden in<br />
jüngster Zeit Vorschläge gemacht, durch die ein geeigneter gesetzlicher<br />
Rahmen für Kapitalbeteiligungs- und Kapitalanlagegesellschaften<br />
geschaffen werden soll. Hiervon würden insbesondere auch die kleinen<br />
und mittleren Unternehmen profitieren.<br />
Die bestehende Emissionspraxis wirkt offenbar restriktiv auf die Ausgabe<br />
neuer Aktien. Gute Erfahrungen, die man im Ausland mit mehr Wettbewerb<br />
in diesem Bereich gemacht hat, sollten genutzt werden. Nicht-börsennotierten<br />
Beteiligungstiteln, die gerade für kleine und mittlere Unternehmen<br />
von großer Bedeutung sind, sollte mehr Raum gewährt werden.<br />
Das kann dadurch gelingen, daß z. B. Versicherungsunternehmen das<br />
Recht eingeräumt wird, ihr „gebundenes Vermögen" in bestimmten<br />
Grenzen auch in nicht-börsennotierten Beteiligungstiteln anzulegen.<br />
Wenn die Eigenkapitalbasis der Unternehmen verbessert werden soll,<br />
bleibt schließlich gar nichts anderes übrig, als die Arbeitnehmer für Anlagen<br />
im Bereich des Produktivvermögens zu gewinnen. Die verstärkte<br />
Beteiligung der Arbeitnehmer ist sowohl eine gesellschaftliche, als auch<br />
eine wirtschaftliche Notwendigkeit.<br />
Der Staat hat in der Vergangenheit durch seine hohe Neuverschuldung<br />
einen großen Teil der volkswirtschaftlichen Ersparnisbildung in Anspruch<br />
genommen. Dabei hat er die Zinsen nach oben gedrückt und Kapital im<br />
beachtlichen Umfang in konsumtive Investitionen, wie Bürgerhäuser,<br />
Schwimmhallen und Sporthallen, gelenkt und nicht in produktive Investitionen.<br />
Das auffälligste an diesen Projekten sind die Folgekosten und<br />
nicht die Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen und Einkommen.<br />
Der Staat kann sicherlich geeignete <strong>Rahmenbedingungen</strong> für eine bessere<br />
Versorgung der Wirtschaft mit Eigenkapital schaffen und das sollte<br />
er auch in Zukunft tun. Aber die Stärkung der Ertragskraft und die Kapitalbeschaffung<br />
von außen ist auch ureigenste Aufgabe der Unternehmen<br />
selbst. Dieser Tage wurde berichtet, daß erstmals ein mittelständisches<br />
Unternehmen aus der Bundesrepublik eine DM-Anleihe im Ausland plaziert<br />
hat - und zwar mit Erfolg. Man muß sich fragen, warum geschah dies<br />
nicht schon früher und warum kommen nicht andere mittelständische<br />
Unternehmen auf die Idee, sich mit <strong>einer</strong> Mark-Auslandsanleihe Geld auf<br />
dem Euromarkt billiger zu beschaffen als bei der Bank zuhause?<br />
P fle g e d e s H u m a n k a p ita ls<br />
Die angemessene Beschaffung und die zukunftsorientierte Nutzung von<br />
Eigen- und Risikokapital ist unverzichtbar für eine Verbesserung der<br />
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, die Bewältigung des<br />
Strukturwandels sowie die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen.<br />
Aber genauso wichtig wie der optimale Einsatz des Sachkapitals ist die<br />
optimale Verwendung des Humankapitals. Der Mensch verbringt einen<br />
großen Teil seines Lebens am Arbeitsplatz und wird durch diesen nachhaltig<br />
geprägt.<br />
Auch wenn in den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik bei vielen<br />
Bürgern Freizeit bzw. Beschäftigung in der Freizeit an Wert gewonnen<br />
haben, so bedeutet dies nicht, daß die Deutschen heute weniger fleißig<br />
und tüchtig sind, als sie es vor dreißig oder zwanzig Jahren waren. Mancher<br />
Bürger arbeitet freiwillig in s<strong>einer</strong> Freizeit. Für Wohnung und Garten<br />
wird oft viel Eigenarbeit aufgewendet. Wenn allerdings - wie es in der jüngeren<br />
Vergangenheit der Fall war - durch Entscheidungen im politischen<br />
Raum Hemmnisse für Leistungswillige entstanden sind, z. B. durch die<br />
steigende Abgabenbelastung oder durch bildungspolitisch ausgelöste<br />
Verwerfungen, dann sind die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen<br />
<strong>Rahmenbedingungen</strong> falsch gesetzt worden.<br />
Moderne Techniken ermöglichen es heute, ein hohes Maß an individueller<br />
Arbeitsplatz- und Arbeitszeitsouveränität zu verwirklichen. Keineswegs<br />
zu Lasten des einen und zum Nutzen des anderen, sondern zum<br />
Vorteil von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Technik bietet die Voraussetzungen,<br />
die Arbeitszeit flexibler und freier zu gestalten. Der<br />
Gesetzgeber ist aufgerufen, Benachteiligung von Teilzeitarbeit gegenüber<br />
Vollzeitarbeit aufzuheben. Die Tarifparteien sind gefordert, entsprechende<br />
Rahmenverträge auszuhandeln, die auf der betrieblichen Ebene<br />
individuell und sozial verträglich umgesetzt werden können.<br />
Heute ist es technisch und organisatorisch möglich, die Arbeit abwechslungsreicher<br />
zu gestalten, den Frauen ein auf die individuellen Bedürf-<br />
8<br />
9
tisse abgestimmtes Nebeneinander von Berufs- und Familienleben zu<br />
ermöglichen, oder den Einstieg ins Erwerbsleben und den Ausstieg aus<br />
dem Arbeitsleben fließend zu gestalten. Dies alles würde die Arbeitsfreude<br />
und den Einsatzwillen vieler Arbeitnehmer verbessern. Hierdurch<br />
würde aus so manchem „durchschnittlichen" Mitarbeiter und Kollegen<br />
ein „guter“.<br />
Senkung der hohen Abgabenlasten, verstärkte Beteiligung der Arbeitnehmer<br />
am Produktivvermögen oder mehr individuelle Arbeitsplatz- und<br />
Arbeitszeitsouveränität sind Ansatzpunkte zur Verbesserung der <strong>Rahmenbedingungen</strong><br />
für das Humankapital in der Bundesrepublik. Erste<br />
Anfänge sind zwar zuletzt schon gemacht oder vorgesehen worden, aber<br />
sie reichen nicht aus. So zeigt z. B. die geplante Lohn- und Einkommensteuerreform<br />
sicherlich die richtige Richtung an, doch die Entscheidung<br />
der christlich-liberalen Regierung fiel zu zaghaft aus. Denn: Durch die<br />
beschlossenen Steuersenkungen wird die Grenzbelastung des Einkommens,<br />
die für die Entfaltung der Leistungswilligkeit vieler Bürger entscheidend<br />
ist, 1988 kaum niedriger sein als 1982 - dem Jahr, in dem diese<br />
Koalition die Regierungsgeschäfte übernahm. Die Verwerfungen der<br />
70er Jahre sind damit noch nicht beseitigt worden und nach 1988 wird die<br />
marginale Belastung der Einkommen erneut ansteigen.<br />
Eine umfassende, zielkonfomne Steuerreform zur Verbesserung der<br />
Bedingungen für Sach- und Humankapital schafft zudem erst die Voraussetzungen<br />
für einen angemessenen Abbau staatlicher Sozialleistungen<br />
und Subventionen. Schließlich könnten hiervon Signalwirkungen für<br />
einen erfolgreichen Widerstand gegen die protektionistischen Bestrebungen<br />
im Welthandel ausgehen.<br />
S ta a tlic h e R e g u lie ru n g e n v e rs u s M a rk tw irts c h a ft<br />
Nach dem 2. Weltkrieg hatte die Bewirtschaftung zwangsläufig graue und<br />
schwarze Märkte zur Folge. Damals wurden die staatlichen Restriktionen<br />
bald wieder abgebaut - zum Vorteil aller Bürger. Das deutsche Wirtschaftswunder<br />
der 50er und frühen 60er Jahre war die Folge.<br />
Heute führen z. B. hohe Abgaben an den Staat (Steuern, Sozialabgaben)<br />
und hohe Sozialleistungen (Lohnfortzahlung ...) zu Schwarzarbeit, illegaler<br />
Arbeitsvermittlung (Bauwirtschaft), Naturaltausch bei Unternehmern<br />
und Arbeitnehmern, Leistungserstellung ohne Rechnung, Steuerhinterziehung<br />
oder „Mißbrauch“ bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen.<br />
Immer wenn der Staat auf den Güter-, Dienstleistungs-, Kapital- und<br />
Arbeitsmärkten stark regulierend eingreift, reagieren die Betroffenen zur<br />
Sicherung des größtmöglichen Vorteils entsprechend ihren Fähigkeiten<br />
und Möglichkeiten. Das geht eindeutig zu Lasten der Gesamtheit.<br />
Warum sollte uns Deutschen nicht gelingen, was andere Länder bereits<br />
praktizieren. Dort werden nämlich aus den Fehlern der Vergangenheit<br />
weitreichende Konsequenzen gezogen.<br />
In Ungarn und China besinnt man sich auf die Eigenverantwortung und<br />
Eigeninitiative der Bürger und schwört der staatlichen Betreuung und<br />
Bevormundung teilweise ab. Eine Vielzahl von Leistungsanreizen werden<br />
nunmehr den Menschen angeboten, nicht aufgezwungen. Eine erstaunliche<br />
<strong>Entwicklung</strong>. Beide Volkswirtschaften sind in den Sog der Marktwirtschaft<br />
geraten. In Frankreich vollzieht in jüngster Zeit eine sozialistische<br />
Regierung die Wende: zu mehr Markt und weniger Staat. Dies alles mag<br />
als Fingerzeig gesehen werden, daß der Marxismus einem Trugschluß<br />
unterliegt, wenn er glaubt, im Kommunismus werde einmal die Nationalökonomie<br />
abgeschafft werden.<br />
Eigenverantwortung, Verantwortung des einzelnen ist der „Preis“, den wir<br />
für unsere freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zahlen<br />
müssen und auch gern zahlen sollten. Mehr Verantwortung fürden einzelnen<br />
Bürger bedeutet nicht politische und gesellschaftliche Führungslosigkeit.<br />
Diese zeigt sich in der Anhäufung von Einzelregulierungen, die<br />
dann fast zwangsläufig in politische und gesellschaftliche Unübersichtlichkeit,<br />
Widersprüchlichkeit und damit in Führungslosigkeit mündet.<br />
Setzung der richtigen <strong>Rahmenbedingungen</strong> ist in hohem Maße Ausdruck<br />
von Führungssouveränität.<br />
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, es geht nicht darum,<br />
die bestehenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften vollständig<br />
abzuschaffen und keine neuen Auflagen zu erlassen. Es gibt Bereiche<br />
wie den Umweltschutz, die ohne durchgreifende gesetzliche Regelungen<br />
nicht auskommen. Umweltschutz kann sicherlich nicht allein der Verantwortung<br />
des einzelnen gegenüber der Gesellschaft überlassen bleiben.<br />
Es geht darum, verstärkt marktwirtschaftliche Anreize, verbesserte <strong>Rahmenbedingungen</strong><br />
zur Erreichung der anzustrebenden Ziele einzusetzen.<br />
Selbst auf dem Gebiet des Umweltschutzes wäre das eine erfolgversprechende<br />
Strategie.<br />
10<br />
11
S tru k tu rp o litik u n d n e u e T e c h n o lo g ie n<br />
Nachdem die Wirtschaftspolitik der 70er Jahre ihr Vertrauen und ihre<br />
Hoffnungen in die Konjunkturpolitik und die Globalsteuerung setzte,<br />
diese aber immer weniger Erfolge vorweisen konnten, möglicherweise<br />
sogar für wirtschaftspolitische Mißerfolge verantwortlich waren, wurde als<br />
neuer vielversprechender Ansatz die zukunftsorientierte Strukturpolitik<br />
mit dem Schwerpunkt Technologiepolitik entwickelt. Sie wird von vielen<br />
zum Wegbegleiter für den Übergang in die postindustrielle Gesellschaft,<br />
in die Dienstleistungs-, Informations- und Freizeitgesellschaft ausersehen.<br />
Wie sollte eine solche Strukturpolitik, die sich, wenn sie erfolgreich sein<br />
will, erfahrungsgemäß auf das Setzen von <strong>Rahmenbedingungen</strong> konzentrieren<br />
müßte, aussehen?<br />
Während der 50er bis hinein in die 60er Jahre waren es in erster Linie ordnungspolitische<br />
Fragestellungen und im Anschluß daran konjunkturpolitische<br />
Maßnahmen, die die praktische Wirtschaftspolitik bestimmten. In<br />
spektakulären Firmenzusammenbrüchen, konzentriert auf bestimmte<br />
Branchen, und im viel zitierten Versagen der Globalsteuerung liegen<br />
wohl vor allem die Gründe, warum in jüngster Zeit die Strukturpolitik so an<br />
Bedeutung gewonnen hat und nunmehr im Vordergrund der wirtschaftspolitischen<br />
Diskussion steht.<br />
Strukturelle Fehlentwicklungen werden verstärkt für die schlechte Wirtschaftslage<br />
verantwortlich gemacht. Die Abfederung und Überwindung<br />
dieser Fehlentwicklungen steht im Mittelpunkt strukturpolitischer Überlegungen.<br />
S tru k tu rp o litis c h e S tra te g ie n<br />
Der Gedanke, daß vieles leichter zu bewältigen ist, wenn man etwas mehr<br />
Zeit hat, führte zur Strategie der „gezielten Erhaltung“ und „geordneten<br />
Anpassung“. Die Strategie der geordneten Anpassung akzeptiert den<br />
strukturellen Wandel vom Grundsatz her. Um die Übergangsprobleme zu<br />
mildern, soll sie innerhalb bestimmter Grenzen in einigen Ausnahmefällen<br />
durch die Strategie der gezielten Erhaltung abgefedert werden.<br />
So plausibel derartige strukturpolitische Strategien auch formuliert sein<br />
mögen, ihre Umsetzung in praktische Politik erweist sich in aller Regel als<br />
problemgeladen.<br />
Die Strategie der gezielten Erhaltung führte u. a. dazu, daß in Krisenbranchen<br />
im Extremfall einzelnen Unternehmen Subventionen in <strong>einer</strong> Höhe<br />
gezahlt wurden, die ausgereicht hätte, den jeweiligen Arbeitnehmern<br />
lebenslang die Löhne und Gehälter zu zahlen.<br />
Die Strategie der geordneten Anpassung birgt die Gefahr, daß neue Subventionstatbestände<br />
geschaffen werden, die ein reges Eigenleben entwickeln.<br />
Auf diese Art und Weise wird die Eigendynamik und Eigenverantwortung<br />
der Wirtschaft behindert. Solange Anpassungssubventionen<br />
nicht grundsätzlich auf der Basis der Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden,<br />
zeitlich begrenzt und degressiv gestaltet sind, überwiegen auf Dauer<br />
eher die Nachteile die Vorteile als umgekehrt. Diese Fehler gilt es im Rahmen<br />
strukturpolitischer Förderung zu vermeiden. In jüngster Zeit stand im<br />
Mittelpunkt der strukturpolitischen Debatte die Technologieförderung.<br />
Hier meinen die Politiker einen Leitstrahl für unsere Zukunft gefunden zu<br />
haben.<br />
D ie n e u e n T e c h n o lo g ie n : W e ttb e w e rb - u n d A rb e its p la tz s ic h e m d ...<br />
Für ein stark außenhandelsabhängiges Land wie die Bundesrepublik -<br />
die deutschen Ausfuhren (Waren und Dienstleistungen) belaufen sich<br />
auf ein Drittel des gesamten Bruttosozialprodukts - ist die Erhaltung und<br />
Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von essentieller<br />
Bedeutung. Als rohstoffarmer Produktionsstandort mit hohen Arbeitskosten<br />
kann sich die Bundesrepublik auf den Weltmärkten nur durchsetzen,<br />
wenn sie andere Produktionsvorteile geballt ins Feld führt: technisches<br />
Wissen, hochqualifizierte Arbeitskräfte und ihre Fähigkeit, neue<br />
und hochwertige Güter und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen.<br />
Als Vorwärtsstrategie wurde die Parole ausgegeben: „Unser Öl“ ist die<br />
technologische Frontlinie. Es sieht so aus, daß Unternehmen und Branchen,<br />
die dies beherzigen, ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder verbessern<br />
können. Die deutsche Textilindustrie, vor Jahren fast totgesagt, hat<br />
bewiesen, daß selbst einmal auf den Weltmärkten verlorenes Terrain<br />
durch Modernisierung und ständige Innovationen wieder zurückgewonnen<br />
werden kann. Der Textilindustrie gelang dies ohne staatliche Dauerhilfen<br />
- vielleicht gerade auch nur deshalb.<br />
Die Produktion und der Export von technologisch hochwertigen Gütern<br />
und Dienstleistungen ist zweifellos eine sehr wirksame Strategie für ein<br />
Land wie die Bundesrepublik, ihren hohen Lebensstandard zu halten und<br />
Vorsorge für kommende Generationen zu treffen. Sinkt die Wettbewerbs<br />
12<br />
13
fähigkeit im Hochtechnologiebereich, müssen wir uns verstärkt auf Märkten<br />
mit hoher Preiskonkurrenz bewegen, wo sich unser gegenwärtiges<br />
Realeinkommen auf Dauer wahrscheinlich nicht erwirtschaften läßt.<br />
... u m w e it- u n d s o z ia lv e rträ g lic h<br />
Die neuen Technologien bieten nicht nur gute Chancen zur Schaffung<br />
von wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen, sondern sie eröffnen auch zahlreiche<br />
Möglichkeiten zur Humanisierung der Arbeitsplätze und zur Verringerung<br />
der Umweltprobleme. Selbstverständlich gilt das nicht ohne Ausnahme.<br />
Aber es muß ja auch nicht alles, was technisch möglich ist, technisch<br />
gewollt, d. h. realisiert werden. Sei es im Bereich der neuen Informations-<br />
und Kommunikationstechniken oder in der Biotechnologie. Daß<br />
der Saldo der Auswirkungen bei den neuen Technologien positiv ausfällt,<br />
können Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer und Arbeitnehmer weitgehend<br />
selbst bestimmen. Daß dies gelingen kann, zeigt die Vergangenheit:<br />
- Der Erdölverbrauch wurde seit der ersten Ölpreisexplosion 1973 spürbar<br />
gedrosselt. Der rationellere und sparsamere Einsatz des Erdöls ist<br />
nicht zuletzt auf neue Techniken und Technologien zurückzuführen.<br />
- Ein modernes Stahlwerk ist wesentlich umweltfreundlicher und humaner<br />
als ein Werk, dessen Produktionstechniken veraltet sind.<br />
- In den vergangenen Jahren sind unsere Autos Zusehens umweltfreundlicher<br />
geworden. So wurde seit 1977 der Ausstoß an Stickoxyden<br />
je Pkw um rd. 35% verringert.<br />
- Mit Hilfe von Computern gesteuerte Sägesysteme können aus Baumstämmen<br />
ca. 10% mehr maßgerechte Bretter zuschneiden. Ein Beitrag<br />
zur weltweiten Schonung der Waldbestände.<br />
Dennoch gibt es heute eine tiefgreifende Technikskepsis. Ist sie aber<br />
wirklich tiefer verwurzelt und weiter verbreitet als noch vor einiger Zeit?<br />
Möglicherweise nicht. Es ist schon einige Jahre her, da sprach Ernst<br />
Bloch von „entorganisierter Technik“ oder „leichenhafter Technik“, die<br />
jeden Bezug zu den menschlichen Organen verloren habe. „Unsere<br />
Technik steht in der Natur wie eine Besatzungsarmee in Feindesland",<br />
formulierte er an anderer Stelle.<br />
Die Befürchtungen, das Zeitalter der neuen Informations- und Kommunikationstechniken<br />
werde zu <strong>einer</strong> neuen Entfremdung führen, zu <strong>einer</strong> kafkaesken<br />
Umwelt mit intelligenten, jedoch gefühllosen Apparaten, sind<br />
sicherlich nicht ganz unbegründet. Auf der anderen Seite sind uns positive<br />
Beispiele bekannt.<br />
Da schildert uns T. Ranald Ide den Fall Elies, <strong>einer</strong> Kleinstadt im Westen<br />
Kanadas, in der eine Anzahl von Landhäusern Kabelanschlüsse haben,<br />
mit denen sie Computer-Lernprogramme abrufen, über den Teleschirm<br />
im Supermarkt einkaufen können und jederzeit zu 500 Seiten aktueller<br />
Informationen aller Art (Wetter, Nachrichten, Getreidepreise, Bodenanalysen,<br />
Kunstdüngerberatungen usw.) Zugang haben. Die Menschen in<br />
Elie können außerdem eine Vielzahl an Fernsehprogrammen empfangen<br />
und haben eine Menge Computerspiele gelernt Sie sprechen miteinander<br />
über ein geräuschloses Telefonsystem, schreiben und speichern<br />
eigene Geschichten oder die Post wird elektronisch übermittelt. Diese<br />
Menschen haben alles andere als das Gefühl, entfremdet zu leben. Eher<br />
das Gegenteil ist der Fall: Obwohl sie im entlegenen Manitoba leben, fühlen<br />
sich diese Menschen als ein integrierter Teil der Welt. Die neuen Informations-<br />
und Kommunikationstechniken können sich also auch vorteilhaft<br />
auswirken. Fortschritt heißt auch wählen, auswählen. Diese Auswahl<br />
erfordert Mut. Diesen gilt es zu beweisen.<br />
D ie „T e c h n o lo g ie -L ü c k e “<br />
Im Gegensatz zur Zielsetzung, technologisch an der Spitze stehen zu<br />
wollen, stand der seit Anfang der 80er Jahre immer wieder gegebene Hinweis<br />
auf eine „Technologie-Lücke“ der deutschen Wirtschaft Öffentlichkeitswirksame<br />
Einzelfälle schienen der beste Beweis für diese Aussage<br />
zu sein. Als beispielsweise 1981 <strong>einer</strong> dergroßen deutschen Chemiekonzerne<br />
mit der berühmten amerikanischen Harvard-Universität einen Vertrag<br />
im Bereich der Molekularbiologie und Gentechnologie über mehrals<br />
100 Millionen DM abschloß, wurde dieser Vertragsabschluß von der<br />
Presse als Sensation dargestellt. Selbst die Aussage: Deutsche forschen,<br />
Japaner entwickeln, schien ihre Gültigkeit einzubüßen.<br />
Trost gab es anscheinend nur „in der Welt von gestern“: Deutschland<br />
stellt nach wie vor die besten Produkte des 19. Jahrhunderts her, lautete<br />
eine Parole (Bruce Nussbaum). „In der Welt von morgen“ schienen dagegen<br />
deutsche Unternehmer und Arbeitnehmer nur noch ein Hinterwäldler-Dasein<br />
fristen zu können.<br />
In letzter Zeit wird vieles wieder mit mehr Augenmaß gesehen. So werden<br />
zwar einzelne Schwachstellen im Forschungs- und Technologiebereich<br />
nicht geleugnet. Aberdas wird als ganz natürlich angesehen. Denn: Man<br />
14<br />
15
kann nicht überall Primus sein. Zudem kann man aus Fehlern lernen und<br />
seine Schwachstellen ausmerzen.<br />
Die deutsche Wirtschaft tritt wieder mit gesundem, realistischem Optimismus<br />
auf den Weltmärkten auf und weist zu Recht auf ihr vorhandenes<br />
und künftiges Leistungsvermögen hin. Optieren für die Zukunftschancen<br />
und gegen den Zukunftsschock ist eine gute Grundlage, um auch im<br />
Technologiebereich vom zu bleiben.<br />
T e c h n o lo g ie p o litik : m it g le ic h e r E lle m e s s e n<br />
Es wäre falsch, wenn der Staat den Unternehmen auf massive und weitgehend<br />
unkritische Art und Weise technologisch unter die Arme greifen<br />
würde. Ebenso gefährlich wäre es beispielsweise, wenn die Kommunalpolitiker,<br />
Bürgermeister oder Gemeindedirektoren, die von einem „Silicon<br />
Valley“ in ihrem Verantwortungs- und Entscheidungsbereich träumen,<br />
alle ihren mit Bundes- oder Landesmitteln finanzierten Technologiepark<br />
bekommen würden.<br />
Führende Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher<br />
Forschungsinstitute - HWWA, Ifo, IfW und RWI - meinen<br />
in ihrem jüngsten Gutachten vom Oktober 1984: „Bedenklich ist zudem,<br />
daß die Überlegungen immer zahlreicher werden, zusätzliche öffentliche<br />
Mittel für... Technologieprogramme einzusetzen. Solche Maßnahmen<br />
haben sich in der Vergangenheit zumeist als relativ teuer und wirkungslos<br />
erwiesen, versuchen doch die Wirtschaftssubjekte, wenn es diese<br />
Programme gibt, vor allem staatliche Mittel zu erlangen, anstatt sich in<br />
Eigenverantwortung am Markt um Lösungen für ihre Probleme zu bemühen.“<br />
Die wiederholten Versuche, korrigierend auf den Wirtschaftsablauf einzuwirken,<br />
führten in der Vergangenheit immer dazu, daß sich Unternehmen<br />
stärker nach kurzfristigen z. B. wirtschaftspolitischen Kriterien richteten<br />
und sich weniger an der Marktentwicklung orientierten. Dies gilt vom<br />
Grundsätzlichen her. Damit ist es auch für die Technologiepolitik als<br />
Richtschnur anzusehen.<br />
T e c h n o lo g ie is t n ic h t a lle s<br />
Im Rahmen der Technologiepolitik wird immer wieder gefordert Wirtschaft<br />
und Wissenschaft enger zu verzahnen. Auf diese Weise soll der<br />
Technologietransfer, die Umsetzung von technologischem Wissen in<br />
unternehmerische Innovation und Investition, verbessert werden. Zudem<br />
wird betont, daß auch außerökonomische Faktoren wie Kultur, Kunst und<br />
Bildung für die wirtschaftliche <strong>Entwicklung</strong> und Entfaltung eines Wirtschaftsraumes<br />
von ebenso großer Bedeutung sein können wie wirtschaftliche<br />
Faktoren.<br />
Das ist sicherlich richtig. Ren
den. Wenn dem Burschen, der auszog, das Fürchten zu lernen, niemals<br />
angst geworden sei, so komme es daher, daß er recht geistlos sei, spottete<br />
der dänische Philosoph und Theologe schon vor über 100 Jahren.<br />
Angst zu haben, ist also nichts grundsätzlich Neues. Angst hat es zu allen<br />
Zeiten gegeben. Ob das Angstgefühl heute weiter verbreitet und tiefer<br />
verwurzelt ist als früher, läßt sich nicht überprüfen. Wie denn auch? Ist die<br />
Angst vor dem Atomkrieg höher anzusetzen als in vergangenen Zeiten<br />
die Angst vor den großen Epidemien wie der Pest?<br />
Zudem haben sich die Menschen in unruhigen Übergangszeiten schon<br />
immer richtungslos gefühlt. Und uns wird immer wieder gesagt, wir<br />
befänden uns im Übergang zur postindustriellen Gesellschaft, zur Dienstleistungs-,<br />
Informations- und Kommunikations-, zur Freizeitgesellschaft<br />
oder auf ähnlichen, wenig vorhersehbaren Raden.<br />
In den vergangenen Jahren brachte die hohe Arbeitslosigkeit für viele<br />
eine große wirtschaftliche Ungewißheit, aber aufgrund der veränderten<br />
Strukturen des Glaubens, des Sinns, der Sitte oder der Ordnung entstand<br />
auch eine große geistige Unsicherheit. Nachdem viele Politiker den Bürgern<br />
über Jahre hinweg weismachen wollten, es gäbe so etwas wie hundertprozentige<br />
Sicherung, scheint das Fundament immer brüchiger zu<br />
werden - in einigen Bereichen schnell, in anderen langsam. Dem Sicherheitskult,<br />
dem viele huldigten, wurden die „Vertragsgrundlagen“ entzogen.<br />
Ist es da nicht verständlich, daß manch <strong>einer</strong> Angst vor der Angst<br />
bekam?<br />
In unserer Zeit des Umbruchs, während der Wanderung zwischen Altem<br />
und Neuem, muß Angst wieder etwas ganz „Natürliches“ werden, wenn<br />
wir die Zukunft meistern wollen. Da jeder Mensch aber nur ein gewisses<br />
Maß an Unsicherheit überstehen kann, bedarf es gewisser Hilfestellungen<br />
von außen - auch durch die Politik. Politiker können nicht erwarten,<br />
daß die Bürger sich ihnen ausgerechnet in unruhigen Zeiten unbesehen<br />
anvertrauen. Aber es sollte doch möglich sein, daß viele Bürger die Hoffnung<br />
auf Lösbarkeit der großen Probleme unserer Tage wiedergewinnen,<br />
nicht zuletzt dadurch, daß nach dem Krisenmanagement vergangener<br />
Jahre die Ziel- und Zukunftsorientierung wieder stärker in der Politik Einzug<br />
hält.<br />
Ob ein Land arm oder reich ist, hängt entscheidend davon ab, ob es<br />
bereit ist, seine Zukunft kraftvoll zu gestalten und dies auch schafft.<br />
Z u m A u to r:<br />
Johann Diedrich Hellwege wurde 1940 in Neuenkirchen, Kreis Stade<br />
geboren.<br />
Er studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie. Promotion und<br />
Habilitation an der Philosophischen Fakultät der Universität Köln. Forschung<br />
und Lehre in iberischer und lateinamerikanischer Geschichte.<br />
1977 wurde er Geschäftsführer des Wirtschaftsrats der CDU.<br />
1981 Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Bundesangelegenheiten,<br />
Hannover.<br />
Seit 1982 ist Prof. Dr. Hellwege Staatssekretär im Niedersächsischen<br />
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr.<br />
ie.iniH rtonniaH aQ<br />
iPuiv.~to>i A m . :r3\ä<br />
v.-i •. ,:v • 'iS'.esr-U<br />
c' - s';uü'?aörtooH : f 3\9<br />
s^U'äi, • iniJtc D .k jfl<br />
.■v-.v<br />
:T.3\!<br />
‘ . ,■ 3iw.Ti.v5 p'C-L.<br />
,, -" r., i-t<br />
..,« v f<br />
; lj.\ ’>\V.i 5<br />
•L8’y<br />
■;V;\: k VIPV, 'j<br />
• ■r-Hui-'ü’A ItoL<br />
MP. uiR p-i rv-j*.<br />
-nU.Vvä :ü\Ur:. i Y,'. Ar’1.1!ü8 - r,s'ufi'.. X ri ■ .’TSV'«<br />
nnums r.!u2iü v. nert:XvgA-OrU:<br />
C.'.lA \ Asrc-A:peneöfii:y y v A<br />
rieft A ip k .P'Opj 1;iO Y\ Vl-5<br />
>kl- x>o\0, x ,U.tvä-AC \Ü PV.'iVly.! RllQ'o .<br />
öiSi?- t-Vii!Lic.'iifcF: mQ<br />
18<br />
19
In dieser Reihe sind bisher folgende Hefte erschienen:<br />
1/80: S tiftu n g M e n s c h u n d A rb e its w e lt, Dr. Karl Lang<br />
2/80: W a n del in d e r A rb e its w e lt a u fg ru n d n e u e r T e c h n o lo g ie n - A u s w irk<br />
u n g e n a u f d e n M e n s c h e n - n o tw e n d ig e K o n s e q u e n z e n , Prof. Dr.<br />
Dr. Rudolf Affemann<br />
3/80: F ü h ru n g - F ü h ru n g s p e rs ö n lic h k e it - P e rs ö n lic h k e its b ild u n g , Prof.<br />
Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
1/81: M o d e rn e T e c h n o lo g ie v e rä n d e rt B ü ro -A rb e its p lä tz e , Willi Thol<br />
2/81: D ie A rb e its w e lt a u s d e r S ic h t e in e s A rb e itn e h m e rv e rtre te rs , Milo<br />
\fyzina<br />
3/81: D a s K ra n k e n h a u s u n d s e in e M ita rb e ite r,<br />
Prof. Dr. Dr. med. Rudolf Affemann<br />
4/81: A u f d e m W eg z u e in e r in fo rm a tio n s v e ra rb e ite n d e n G e s e lls c h a ft,<br />
Dr. Heinrich Hinkel<br />
5/81: P e rs o n a le K o m m u n ik a tio n - Ih re B e h in d e ru n g u n d F ö rd e ru n g in<br />
u n s e re r G e s e lls c h a ft, Prof. Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
6/81: H o c h b e g a b te - A u fg a b e n , P ro g ra m m e , P e rs p e k tiv e n ,<br />
Prof. Gottfried Kleinschmidt<br />
1/82: F ü h ru n g s p ro b le m e in d e r ö ffe n tlic h e n V e rw a ltu n g ,<br />
Jörg Zwosta<br />
2/82: W irts c h a fts w a c h s tu m u n d L e b e n s q u a litä t, Dr. Karl Lang<br />
3/82: A n fo rd e ru n g e n a n F ü h ru n g s k rä fte u n d A u s w a h l v o n F ü h ru n g s <br />
k rä fte n h e u te , Prof. Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
4/82: B e w e rb e r v o r 15 J a h re n - B e w e rb e r h e u te , E rfa h ru n g e n a u s d e r<br />
b e trie b s g ra p h o lo g is c h e n Praxis, Ursula Affemann<br />
5/82: P ro b le m e in d e r ju n g e n G e n e ra tio n a ls H e ra u s fo rd e ru n g e n a n d ie<br />
ä lte re G e n e ra tio n , Prof. Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
6/82: S o z ia le s L e rn e n in d e r T aylorix O rg a n is a tio n ,<br />
Dr. Rainer Zwiesele<br />
1/83: J u g e n d lic h e A u s lä n d e r - b e ru flic h in d e r S a c k g a s s e ?<br />
Dr. Dieter Jaehrling<br />
2/83: P e rs ö n lic h k e its b e z o g e n e W e ite rb ild u n g d u rc h in n e rb e trie b lic h e<br />
G e s p rä c h s g ru p p e n , Prof. Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
3/83: K o o p e ra tio n s g e re c h te U n te rn e h m e n s s tru k tu re n ,<br />
Dipl.-Ing. Heinrich Fromm<br />
4/83: D ie F ra u in d e r m o d e rn e n A rb e its w e lt<br />
Hilde Stumpf ' ,<br />
•• j j i| v i! i ■" ' ' . . . .<br />
5/83: M ö g lic h k e ite n z u r S ta b ilis ie ru n g in d e n B e trie b e n<br />
Prof. Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
6/83: F re m d lä n d is c h e A rb e its k rä fte - a u s lä n d is c h e M ita rb e ite r<br />
Willi Thol<br />
1/84: F e h lh a ltu n g e n im b e trie b lic h e n A llta g u n d W ege z u ih re r<br />
Ü b e rw in d u n g<br />
Dr. Heinrich Hinkel<br />
2/84: Wo lie g e n u n s e re F ü h ru n g s m ä n g e l?<br />
W ie k ö n n e n w ir b e s s e r fü h re n ?<br />
Prof. Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
3/84: T e ilz e ita rb e it - M ö g lic h k e ite n u n d C h a n c e n<br />
Prof. Dr. Eduard Gaugier<br />
'<br />
4/84: M ik r o e le k tro n ik im B ü ro - m ö g lic h e A u s w irk u n g e n a u f d e n M e n <br />
s c h e n<br />
Dr. Heinrich Hinkel<br />
5/84: W e rte w a n d e l - V e rkaufen a ls D ie n s tle is tu n g - V e rk ä u fe rp e rs ö n <br />
lic h k e it,<br />
Prof. Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
6/84: Z u s a m m e n a rb e it u n d F ü h ru n g im G ro ß b e trie b<br />
Peter Baum<br />
1/85: K ritis c h e J a h re -<br />
eine Selbsterfahrungsgruppe berichtet über ihre Erfahrungen in<br />
der Arbeitswelt der Jahre 1981-1983<br />
20<br />
21
2/85 P o litis c h e R a h m e n b e d in g u n g e n e in e r g e s u n d e n E n tw ic k lu n g<br />
d e r W irts c h a ft in d e n 8 0 e r J a h re n<br />
Prof. Dr. Johann D. Hellwege<br />
In der gleichen Zeit ist erschienen:<br />
Woran k ö n n e n w ir u n s h a lte n ? K o m p a ß d u rc h d ie K o n flik tfe ld e r<br />
u n s e re r Z eit, Rudolf Affemann, Herder-Taschenbuch 1980<br />
F ühren d u rc h P e rs ö n lic h k e it; S e lb s te rfa h ru n g s g ru p p e n b e ric h <br />
ten, Rudolf Affemann, Verlag Moderne Industrie 1983<br />
G e s u n d w e rd e n - G e s u n d b le ib e n ; Es lie g t a n uns, Rudolf Affemann,<br />
Herder-Taschenbuch 1983<br />
In V o rb e re itu n g s in d fo lg e n d e H e fte :<br />
3/85: S e e lis c h e G e s u n d h e it a ls M a ß s ta b fü r s o z ia l-o rg a n is a to ris c h e<br />
G e s ta ltu n g<br />
Prof. Dr. Karl-Klaus Pullig<br />
4/85: D a s S p a n n u n g s fe ld v o n E ffe k tiv itä t u n d H u m a n itä t in d e r W irts<br />
c h a ft d e r 8 0 e r J a h re<br />
Dr. Karl Lang<br />
5/85: W e rte w a n d e l u n d A rb e its w e lt<br />
Prof. Dr. Dr. Rudolf Affemann<br />
Prof. Dr. Gerhard W. Wittkämper<br />
6/85: A u s w irk u n g e n d e s B e ru fs v o n F ü h ru n g s k rä fte n a u f ih re F a m ilie n<br />
Helga Zwosta<br />
1/86: F ü h ru n g u n d Z u s a m m e n a rb e it im F ris e u rh a n d w e rk<br />
Reinhold Leger<br />
2/86: Was e rw a rte n H o c h s c h u la b s o lv e n te n v o n d e n B e trie b e n -<br />
Was e n ta rte n d ie B e th e b e v o n d e n H o c h s c h u la b s o lv e n te n ?<br />
Autorengemeinschaft <strong>einer</strong> Selbsterfahrungsgruppe.<br />
Anschrift: Institut Mensch und Arbeitswelt<br />
Rotenberger Steige 9, 7000 Stuttgart 60<br />
Telefon: (0711)337600<br />
22