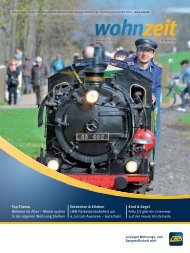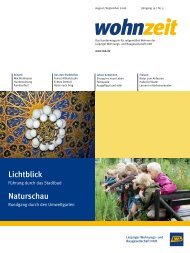VOM WERT DES WOHNENS - LWB
VOM WERT DES WOHNENS - LWB
VOM WERT DES WOHNENS - LWB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH<br />
Prager Straße 21, 04103 Leipzig<br />
Telefon: 0341 - 99 20<br />
www.lwb.de<br />
FORUM ZWEI | Mai 2006 Vom Wert des Wohnens<br />
FORUM ZWEI | Mai 2006<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong><br />
<strong>WOHNENS</strong>
FORUM ist eine zweimal im Jahr erscheinende<br />
Publikation der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft<br />
mbH (> www.lwb.de), die sich an einen<br />
ausgewählten, interessierten Leserkreis wendet.<br />
Thematisiert werden wohnungswirtschaftliche Entwicklungen<br />
und Trends, die sich im Spannungsfeld<br />
städtebaulicher Veränderungen und urbaner<br />
Lebenswelt spiegeln.<br />
FORUM ist kein Fachmagazin, sondern will den<br />
Blick dafür schärfen, dass die heutige Attraktivität<br />
der Städte maßgeblich den Leistungen der Immobilien-<br />
und Wohnungswirtschaft zu verdanken ist.<br />
Am Beispiel Leipzigs lässt sich gerade dies<br />
eindrucksvoll belegen.<br />
FORUM ZWEI | Mai 2006<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong><br />
<strong>WOHNENS</strong>
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
Zwei Drittel der Menschen<br />
in Deutschland<br />
leben in Städten. Aber<br />
diese Mehrheit und ihre<br />
Repräsentanten in den<br />
kommunalen Selbstverwaltungsorganenfinden<br />
sich nur ungenügend<br />
in der deutschen<br />
Politik wieder. Noch<br />
immer machen Bund und Länder vieles unter<br />
sich aus, noch immer warten die Städte auf eine<br />
Gemeindefinanzreform, immer mehr Lasten werden<br />
nach unten auf die Kommunen abgewälzt.<br />
Eine der schwerwiegendsten Folgen ist die mangelhafte<br />
Finanzausstattung der Städte, sind<br />
leere Kassen, hohe Schuldenberge und manchmal<br />
auch die Zwangsverwaltung. Um aus dieser<br />
Misere herauszukommen, gehen die Städte verschiedene<br />
Wege: Bürokratie- und Personalabbau,<br />
Ausbau kommunaler Unternehmen, aber<br />
auch der Verkauf städtischen Eigentums. Eine<br />
rege, mitunter auch aufgeheizte Diskussion<br />
dreht sich um die Kernfrage, ob Unternehmen<br />
der Daseinsvorsorge wie Wasserwerke, Stadtwerke<br />
oder kommunale Wohnungsunternehmen<br />
2<br />
verkauft werden sollen. Es gibt viele Argumente<br />
dafür. Noch mehr – wie wir meinen – allerdings<br />
dagegen.<br />
Genau hier wollen wir mit FORUM ZWEI ansetzen.<br />
Wir widmen uns dem Wert des Wohnens<br />
und fragen, welche Aufgaben kommunale Wohnungsunternehmen<br />
für ihre Eigentümer erbringen<br />
und woher kommunales Wohneigentum in<br />
Leipzig kommt. Wir illustrieren, warum sich<br />
Immobilienerwerb angesichts gefährdeter Rentenkassen<br />
und historisch niedriger Bauzinsen<br />
lohnt und trotzdem für viele Menschen nur ein<br />
Traum bleibt. Am anschaulichsten ist immer das<br />
Konkrete, lesen Sie deshalb in dieser Ausgabe<br />
auch über Menschen, die kommunalen Wohnraum<br />
brauchen und froh sind, dass sie sich nicht<br />
in einem vollkommen privatisierten Wohnungsmarkt<br />
versorgen müssen.<br />
Anregende Unterhaltung wünscht<br />
Peter Stubbe<br />
Geschäftsführer der <strong>LWB</strong><br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
INHALT<br />
Seiten 4 bis 9<br />
Städte sind kein „Geschäft“<br />
Interview mit Dr.-Ing. Irene Wiese-von Ofen<br />
über die Benachteiligung der Städte in<br />
Deutschland und warum Kommunen keine<br />
Wirtschaftsunternehmen sind<br />
Seiten 10 bis 17<br />
Wohnen im Renditeobjekt<br />
DIE ZEIT-Autor Roland Kirbach über<br />
Privatisierungen in der Wohnungswirtschaft<br />
und ihre Auswirkungen<br />
Seiten 18 bis 21<br />
Weltweiter Trend<br />
Auch in vielen anderen Ländern werden seit<br />
den 90er-Jahren Wohnungen in großem Stil<br />
privatisiert<br />
Seiten 22 bis 25<br />
Eigene vier Wände – (k)ein Traum für jeden<br />
Warum Eigentumsbildung derzeit so<br />
attraktiv wie nie ist und trotzdem für<br />
viele unerschwinglich bleibt<br />
Seiten 26 bis 31<br />
Kommunaler Wohnungsbau mit Tradition<br />
Warum Leipzig über einen großen Bestand an<br />
kommunalem Wohnraum verfügt<br />
Seiten 32 bis 40<br />
Wohnwerte<br />
Fünf Beispiele, warum Menschen auf<br />
kommunalen Wohnraum angewiesen sind<br />
3
Die deutschen Städte verzeichnen tiefe Löcher<br />
in ihren Haushaltskassen. Neben Sparprogrammen<br />
– meistens zu Lasten der sozial<br />
Schwachen – diskutieren viele Kommunalpolitiker<br />
den Verkauf stadteigener Unternehmen.<br />
Interessenten gibt es genug – Stromkonzerne<br />
schielen auf Stadtwerke, Investmentfonds auf<br />
Wohnungsgesellschaften. Da wird mächtig<br />
gezockt – und die Städte suchen nach neuen,<br />
innovativen Lösungen.<br />
4<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
STÄDTE SIND<br />
KEIN „GESCHÄFT“<br />
Gespräch mit Dr.-Ing. Irene Wiese-von Ofen,<br />
Architektin, Beigeordnete der Stadt Essen<br />
a. D., Vorsitzende des Verbandsrates des<br />
Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,<br />
Städtebau und Raumordnung e. V. und ehemalige<br />
Präsidentin der International Federation<br />
for Housing and Planning.<br />
Verbände wie der Deutsche Städtetag<br />
beklagen, dass die Städte in Deutschland<br />
rechtlich, politisch und finanziell<br />
links liegen gelassen werden, obwohl in<br />
ihnen zwei Drittel der Bevölkerung leben.<br />
Die Vorwürfe sind sicherlich nicht ganz unberechtigt.<br />
In Deutschland haben die Städte in der<br />
allgemeinen Wahrnehmung nicht die Bedeutung,<br />
die ihnen zusteht. Wir sind insoweit immer noch<br />
keine wirklich städtische Gesellschaft – allein<br />
der Vergleich mit Italien oder Frankreich zeigt,<br />
dass dort die Städte viel mehr im Bewusstsein<br />
von Politik und Gesellschaft sind, mehr in<br />
Entscheidungsfindungen einbezogen werden,<br />
selbstbewusster sind. Vielleicht hat das etwas<br />
damit zu tun, dass die deutsche Romantik vor<br />
zwei Jahrhunderten eine Geringschätzung von<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
Stadt erzeugte, die bis heute nachwirkt. Hinzu<br />
kam die Stadtflucht infolge der hohen Verdichtung<br />
durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert<br />
und dann vor allem die Zunahme des<br />
starken Verkehrs im 20. Jahrhundert.<br />
Unter umgekehrten Vorzeichen erleben wir nunmehr<br />
wegen des massiven Bevölkerungsrückgangs<br />
– beginnend in Ostdeutschland – erneut<br />
eine Abwendung von der Stadt, selbst wenn die<br />
Suburbanisierungstendenzen zurück zu gehen<br />
scheinen. In anderen europäischen Ländern ist<br />
Raumplanungspolitik stärker auf Städte ausgerichtet,<br />
in Deutschland hingegen genießen die<br />
Städte kein Primat. Dabei sind auch in Deutschland<br />
die Städte nach wie vor der Motor der wirtschaftlichen<br />
und kulturellen Entwicklung.<br />
5
SOZIALES ENGAGEMENT<br />
Viele Kommunen sind von der Schrumpfung<br />
der Bevölkerung betroffen, nahezu alle Städte<br />
haben große Haushaltsprobleme. Sollten sich<br />
Kommunen da nicht aus bestimmten Feldern<br />
der Daseinsvorsorge zurückziehen?<br />
Zunächst einmal muss man sich über den Begriff<br />
Daseinsvorsorge im Klaren sein. Unter diesem<br />
Banner läuft heute einfach zu viel. Die Frage ist,<br />
was tatsächlich die Aufgabe der Städte ist. Die<br />
Sorge für die Hilfsbedürftigen oder die Infrastruktur<br />
gehören zweifellos dazu. Auch die städtische<br />
Fürsorge für die medizinische Grundversorgung<br />
oder die Einhaltung gesetzlicher, beispielsweise<br />
hygienischer Vorschriften. Das heißt<br />
aber nicht, dass eine Kommune unbedingt ein<br />
städtisches Krankenhaus betreiben muss. Es<br />
> UNTERSTÜTZUNG FÜR SENIOREN<br />
Die <strong>LWB</strong> verfügt über vielfältige Wohnungen für<br />
ältere Menschen. Zu deren Unterstützung im Alltag<br />
und im Pflegefall kooperiert sie mit Trägern der<br />
Freien Wohlfahrtspflege, Vereinen und privaten Pflegedienstleistern.<br />
Angebote reichen von Beratung<br />
direkt durch das <strong>LWB</strong>-Sozialmanagement über die<br />
Vermittlung von Angeboten im vorpflegerischen<br />
Bereich, Beratungs- und Besuchsdienste bis hin zu<br />
Wohnungsanpassungsberatung, wenn die Senioren<br />
mit zunehmenden Beeinträchtigungen zu kämpfen<br />
haben. Zudem führt die <strong>LWB</strong> bedarfsgerechte Sanierungen<br />
für ältere Menschen durch.<br />
6<br />
geht also nicht um den Rückzug aus der<br />
Daseinsvorsorge, sondern um die saubere Definition,<br />
da es durchaus Bereiche gibt, die heute<br />
als Leistung von der Stadt erwartet werden, die<br />
aber eigentlich nicht zur Daseinsvorsorge gehören.<br />
Kernbereiche wie die Trinkwasserversorgung<br />
und die Abwasserentsorgung sind aber<br />
Aufgaben, die in die Obhut der Stadt gehören.<br />
Ein weiteres Beispiel sind bestimmte, in der Verantwortung<br />
der Verwaltung liegende Aufgaben.<br />
Überall, wo die Stadt von den Bürgern etwas<br />
erwartet, diese es aber nicht unbedingt gern tun,<br />
müssen ordnungspolitische Eingriffe hoheitlich<br />
möglich sein. Nehmen wir den Anschlusszwang<br />
bei Abwasseranlagen oder Straßenausbaubeiträge.<br />
Private können alles besser – fast schon<br />
ein Grundsatz mit religiösem Anstrich.<br />
Aber stimmt das auch?<br />
Nein. Private Unternehmen mit ähnlich großen<br />
Strukturen wie Behörden funktionieren nach<br />
ähnlichen Prinzipien und sind auch nicht a priori<br />
besser. Es ist ein gepflegtes Vorurteil, dass<br />
Städte weder über wirtschaftlich denkende Spitzen<br />
noch über flexibel handelnde Entscheider<br />
verfügen und Private wirtschaftlicher, schneller<br />
und effizienter in Entscheidungsabläufen sind.<br />
Große Unternehmen der Wirtschaft zeigen die<br />
gleiche Schwerfälligkeit großer Apparate. Was<br />
man in den Zeitungen bei wirtschaftlichen<br />
Schieflagen großer Firmen über verpasste<br />
Marktchancen liest, spricht keineswegs dafür,<br />
dass private Hände flinker handelten als öffentliche.<br />
Es ist nicht die Frage, wer was besser kann, sondern<br />
die nach dem jeweiligen Verantwortungsbereich.<br />
Beispiel Bauleitplanung: Es ist die städtische<br />
Aufgabe, in einem demokratischen Prozess<br />
die Voraussetzungen für Genehmigungsverfahren<br />
zu schaffen, verschiedene Interessen<br />
gegeneinander abzuwägen und dann per Ratsbeschluss<br />
den Rahmen zu bestimmen, innerhalb<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
7
HILFE FÜR MIGRANTEN<br />
Seit vielen Jahren verzeichnet die <strong>LWB</strong> einen Zuzug von ausländischen<br />
Bürgern, deren Integration in den Mietshäusern<br />
überwiegend reibungslos verläuft. Dabei wird im Vorfeld<br />
ausgelotet, dass Konflikte zwischen angestammten Bewohnern<br />
und den neuen Mietern durch kulturelle Unterschiede<br />
und Mentalitäten gar nicht erst aufkommen. So besteht<br />
eine enge Kooperation mit dem Verein „InJumi e.V.“ im<br />
Stadtteil Volkmarsdorf, dessen Mitarbeiter Migranten zu<br />
Themen des Wohnens und des gemeinschaftlichen<br />
Zusammenlebens bis zur Vermittlung bei<br />
8<br />
Nachbarschaftskonflikten beraten. Dafür stellt die<br />
<strong>LWB</strong> kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung.<br />
SOZIALES ENGAGEMENT<br />
dessen ein Bauvorhaben genehmigt werden<br />
kann. Dann hat der Private wiederum die Chance,<br />
in diesem Rahmen nach seinem Ermessen und<br />
Vermögen zu handeln. Dann muss es auch dem<br />
Investor überlassen bleiben, ob er und wie er<br />
sein Vorhaben gestaltet. Insofern ist die öffentliche<br />
Hand für die Rahmenbedingungen verantwortlich,<br />
die Gestaltungsfreiheit, die aber auch<br />
eine Gestaltungsverantwortung einschließt, liegt<br />
bei den Privaten.<br />
Zweite moderne These: Städte sollten wie<br />
Wirtschaftsunternehmen geführt werden, dann<br />
wird alles gut.<br />
Das geht gar nicht. Städte sollen wirtschaftlich<br />
denken und nicht Geld verplempern. Aber sie<br />
können nicht wie Wirtschaftsunternehmen handeln.<br />
Die entscheidende Aufgabe der Städte ist<br />
es, den sozialen Zusammenhalt zu bewahren. Sie<br />
haben viele Aufgaben, wie zum Beispiel im<br />
Bereich der Obdachlosenfürsorge, Krisenhilfe für<br />
Drogenabhängige, Einsatz von Streetworkern für<br />
arbeitslose Jugendliche, Konsensbündnisse für<br />
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Unqualifizierter,<br />
Betreuungsangebote für allein erziehende<br />
Mütter, Netzwerke zur Versorgung Alter und chronisch<br />
Kranker. Wie will man das finanziell bewerten,<br />
geschweige denn in Gewinn- und Verlustrechnungen<br />
bringen? Städte sind eben kein<br />
„Geschäft“. Sie werden nie unter Rentabilitätsgesichtspunkten<br />
als erfolgreich oder weniger<br />
erfolgreich zu beurteilen sein, denn sie sind Orte<br />
des nur bedingt planbaren Lebens, Sammelbecken<br />
von Starken wie Schwachen, Edlen wie<br />
Strolchen. Jenseits aller wirtschaftlichen Abwägungsprozesse<br />
sind und bleiben sie Orte sozialen<br />
Lebens.<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
Gibt es aus Ihrer Sicht Chancen, jenseits der<br />
groß angelegten Privatisierung von Daseinsvorsorge<br />
die städtischen Haushalte zu sanieren?<br />
Städte sind am nächsten an den Bürgern dran.<br />
Deshalb muss – Stichwort Finanzausgleich – die<br />
Finanzausstattung durch Bund und Länder<br />
anders und besser organisiert werden. Und man<br />
muss auch über andere Wege nachdenken. Vielleicht<br />
müssen Umlagen anders finanziert werden.<br />
Direkte kommunale Steuern sind auf den<br />
ersten Blick ein interessantes Instrument, weil<br />
dann die Leute viel unmittelbarer sähen, was mit<br />
ihrem Geld passiert. Nachteil ist, dass dann die<br />
Ungleichheit zwischen den Städten wahrscheinlich<br />
zunehmen würde. Ein Königsweg wurde da<br />
noch nicht entdeckt.<br />
Bleiben die Städte spätestens im<br />
Brüsseler EU-Gerangel auf der Strecke?<br />
Da sehe ich nicht so viel Ungemach. Aus Brüssel<br />
kommt eine ganze Reihe guter Initiativen. Zum<br />
Beispiel haben die Urban-Projekte und das daraus<br />
entstandene Urban-Netzwerk viel zur Stadtbzw.<br />
Quartiersentwicklung in Deutschland beigetragen.<br />
Stichpunkt Wohnungsbau und -bewirtschaftung.<br />
Welche Rolle fällt da in Zukunft den<br />
Städten zu?<br />
In erster Linie geht es um eine partnerschaftliche<br />
Aufgabe. Städte und Wohnungswirtschaft<br />
müssen stärker aufeinander zugehen. Das war<br />
über Jahrzehnte eine verlässliche Ehe, erst als<br />
sich beide in den 70er- und 80er-Jahren konsolidiert<br />
hatten, driftete da einiges auseinander.<br />
Aber nun ist wieder eine viel engere Zusammenarbeit<br />
gefragt – schon allein angesichts der<br />
Schrumpfungsprozesse. Hier sind beide Seiten<br />
mehr denn je aufeinander angewiesen.<br />
9
Internationale Investmentfirmen sind auf großer Einkaufstour.<br />
Bereits 800.000 vormals kommunale, landeseigene oder ehemalige<br />
Firmen-Wohnungen sind von den meist angloamerikanischen Unternehmen<br />
gekauft worden – bis zu drei Millionen Wohnungen sollen<br />
es noch werden. Soweit die Fakten. Ob es richtig ist, dass deutsche<br />
Kommunen eigene Wohnimmobilien in großem Stil verkaufen, darüber<br />
wird spätestens seit dem Komplettverkauf der Dresdner Woba<br />
vehement diskutiert. Eine Bestandsaufnahme.<br />
WOHNEN IM<br />
RENDITEOBJEKT<br />
Von Roland Kirbach, stellvertretender<br />
Ressortleiter, Redaktion Dossier, DIE ZEIT<br />
Noch sieht man den Häusern von außen<br />
nichts an – weder den schmucken<br />
Sechsfamilienhäusern im Bauhausstil<br />
in Berlin-Zehlendorf noch dem 16-stöckigen<br />
Wohnsilo in Kiels Robert-Koch-Straße<br />
noch dem Ensemble von acht Wohnblöcken im<br />
Münchner Vorort Laim. Sie sehen intakt aus wie<br />
ehedem, und doch ist nichts mehr, wie es war.<br />
Die verschiedenen Quartiere gehörten über Jahrzehnte<br />
gemeinnützigen oder kommunalen Wohnungsgesellschaften.<br />
Vorwiegend Rentner, einfache<br />
Arbeiter und kleine Angestellte bewohnen<br />
sie. Bisher lebten sie hier sicher und gemütlich,<br />
die Mieten waren günstig und die Vermieter<br />
meist kulant. Nun wurden die Wohnungen an<br />
vorwiegend angloamerikanische Finanzinvestoren<br />
verkauft. So sind die Berliner Wohnungen im<br />
Bauhausstil – als Sozialwohnungen 1924 von der<br />
gemeinnützigen Gehag errichtet – nun Eigentum<br />
der Investmentgesellschaft Oaktree Capital<br />
Management in Los Angeles.<br />
Andere gingen in den Besitz von Gesellschaften<br />
über, die Fortress, Apellas, Blackstone oder Cerberus<br />
heißen. Fast immer werden ganze Gesellschaften<br />
verkauft, sie behalten ihre traditionsreichen<br />
Namen bei, so dass die Mieter zunächst<br />
oft nichts vom Verkauf ihrer Wohnungen erfahren.<br />
Sie wundern sich allenfalls über einen<br />
neuen rüden Ton, der mit einem Mal Einzug hält,<br />
oder über plötzliche Mieterhöhungen. Mit der<br />
Gemütlichkeit ist es jedenfalls vorbei.<br />
„Wir haben die qualitativ besten<br />
Mietwohnungen der Welt“<br />
Privates Beteiligungskapital (Private Equity) von<br />
einer Billion Dollar haben die Fondsgesellschaften<br />
nach Expertenschätzungen bei Pensionskassen,<br />
Versicherungen und vermögenden Privatleuten<br />
eingesammelt; nun suchen sie weltweit<br />
nach Möglichkeiten, das Geld zu mehren –<br />
und werden bei deutschen Wohnungsgesellschaften<br />
fündig. Sehr zum Leidwesen etwa des<br />
Deutschen Mieterbunds (DMB), der beklagt,<br />
dass sich die Jagd nach schnellen, hohen Rendi-<br />
ten nicht mit der auf Langfristigkeit angelegten<br />
Investition in Wohnen vertrage. Vom Prinzip der<br />
„Bestandsbewirtschaftung“, das heißt, dass<br />
Gewinne vorwiegend in den Erhalt der Gebäude<br />
reinvestiert werden, wollten die neuen Vermieter<br />
in der Regel nichts wissen, sagt Ulrich<br />
Ropertz vom DMB. Doch bis sich die Vernachlässigungen<br />
auswirkten, wenn etwa Balkone<br />
wegen Baufälligkeit gesperrt werden müssen,<br />
seien die Investoren längst weitergezogen, so<br />
Ropertz. Auf fünf bis sieben Jahre ist das Investment<br />
höchstens angelegt – dann verkaufen die<br />
Fonds die Wohnungen meist wieder, weil die<br />
Anleger ihre Gewinne kassieren wollen.<br />
„Wir haben den qualitativ besten Mietwohnungsbestand<br />
der Welt“, erklärt Lutz Freitag,<br />
Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs-<br />
und Immobilienunternehmen, den Run<br />
auf deutsche Wohnungsgesellschaften. „Die frühere<br />
Wohnungsgemeinnützigkeit und der erfolgreiche<br />
soziale Wohnungsbau der Nachkriegszeit<br />
haben Schätze geschaffen, die jetzt gehoben<br />
werden.“<br />
Die gegenwärtig niedrigen Zinsen machen die<br />
Geschäfte zusätzlich lukrativ. Einen Großteil<br />
ihrer Milliarden-Deals finanzieren die Investoren<br />
billig auf Pump. Oft stammen nur zehn Prozent<br />
des Kaufpreises aus ihren eigenen Schatullen,<br />
den Rest besorgen sie sich bei Banken – zu Zinssätzen<br />
von nur vier Prozent. Da genügen bereits<br />
marktübliche Mieten, um über die Zeit der Investition<br />
eine Eigenkapitalrendite von 25 Prozent<br />
pro Jahr zu erzielen.<br />
Um das Ziel zu erreichen, wird der Verkauf möglichst<br />
vieler Wohnungen an die Mieter forciert –<br />
mit hohem Gewinn. Die Mieter zahlen bis zum<br />
Doppelten dessen pro Quadratmeter, was die<br />
Investoren beim Erwerb eines ganzen Wohnungspakets<br />
entrichten mussten. Ferner werden<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006 <strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
10 11
die Mieten bis zur Grenze des Zulässigen erhöht;<br />
es wird Personal entlassen, und es wird die<br />
geballte Einkaufsmacht eines Großunternehmens<br />
genutzt, etwa bei Renovierungen. Lieferanten<br />
werden, was die Preise angeht, unter<br />
Druck gesetzt.<br />
Dresden verkaufte seinen kompletten<br />
kommunalen Wohnungsbestand<br />
Rund 800.000 Mietwohnungen haben die internationalen<br />
Fonds in den vergangenen fünf Jahren<br />
in Deutschland bereits zusammengekauft.<br />
Dabei soll es nicht bleiben. Auf die 3,3 Millionen<br />
Wohnungen, die Kommunen und Länder derzeit<br />
noch halten, haben sie es abgesehen. Und so<br />
manche Stadt kann der Versuchung nicht widerstehen,<br />
auf diese Weise ihre desolate Haushaltslage<br />
zu verbessern, und trennt sich von<br />
ihren Wohnungsbeständen. Den größten<br />
Brocken hat bislang das hochverschuldete Berlin<br />
mit 66.000 Wohnungen verkauft. Allerdings<br />
sind dort noch immer 300.000 Wohnungen im<br />
Besitz des Landes.<br />
Bundesweites Aufsehen erregte jüngst der Verkauf<br />
der Dresdner Wohnungsbaugesellschaft<br />
Woba mit 48.000 Wohnungen, 1.300 Gewerbeeinheiten<br />
und 492 Mitarbeitern an den amerikanischen<br />
Investor Fortress. Es ist das erste Mal in<br />
Deutschland, dass eine Großstadt ihren kompletten<br />
Wohnungsbestand verkaufte, immerhin<br />
17 Prozent des städtischen Wohnungsmarkts.<br />
Fortress zahlte dafür 1,7 Milliarden Euro. Zieht<br />
man die aufgelaufenen Woba-Schulden von gut<br />
700 Millionen Euro ab, bleibt der Stadt ein<br />
Gewinn von 982 Millionen Euro. Das sind 240<br />
Millionen mehr, als sie braucht, um ihre gesamten<br />
Schulden zu tilgen. „Wir gewinnen die<br />
SOZIALES ENGAGEMENT<br />
12<br />
Hoheit über unseren Haushalt zurück“, sagte<br />
Dresdens Oberbürgermeister Ingolf Roßberg<br />
(FDP). Künftig entfallen 70 Millionen Euro an<br />
Schuldentilgung pro Jahr, die nun stattdessen<br />
für Soziales, Kulturelles oder für Infrastrukturmaßnahmen<br />
ausgegeben werden können.<br />
Die Verschuldung der Kommunen hat<br />
strukturelle Ursachen<br />
Dresden hat einen guten Zeitpunkt für den Verkauf<br />
erwischt. Der Markt läuft bereits heiß, die<br />
Investoren treiben in Bietergefechten die Preise<br />
hoch. Immer öfter bedienen sich die Finanzgesellschaften<br />
daher der Vermittlerdienste ausgeschiedener<br />
Politiker. So ist Sozialdemokrat Florian<br />
Gerster, ehemals Chef der Bundesagentur<br />
für Arbeit, in die Dienste von Fortress getreten,<br />
der Fondsgesellschaft, die in Dresden das Rennen<br />
machte. Für den Berliner Investor Apellas,<br />
hinter dem unter anderem der amerikanische<br />
Spekulant George Soros steht, verwendet sich<br />
der ehemalige Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion<br />
Friedrich Merz.<br />
Dass sich die Kommunen nun von ihren Schätzen<br />
trennen, beurteilt Professor Hartmut Häußermann,<br />
Stadt- und Regionalsoziologe an der<br />
Berliner Humboldt-Universität, eher kritisch.<br />
Schließlich habe die Verschuldung der Kommunen<br />
strukturelle Ursachen: „Sie liegen in den zu<br />
geringen Einnahmen aus den Steuern, die ihnen<br />
Bund und Länder zuteilen und die zur Finanzierung<br />
ihrer gesetzlichen Verpflichtungen nicht<br />
ausreichen“, so Häußermann. Der einmalige<br />
Erlös aus Wohnungsverkäufen bringe daher<br />
„lediglich in einem Haushaltsjahr eine Entlastung,<br />
langfristig bewirkt das nur wenig“.<br />
Der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude,<br />
> RAT BEI ZAHLUNGSPROBLEMEN<br />
Besonders einkommensschwache Haushalte neigen bei Geldknappheit<br />
zur teilweisen oder vollständigen Einstellung der<br />
Mietzahlungen. Dieses Verhalten kann am Ende zu Obdachlosigkeit<br />
führen. Dem versucht die <strong>LWB</strong> bereits frühzeitig zu<br />
begegnen. Dazu gehören die vorbeugende Aufklärung in der<br />
Mieterzeitung wie auch das persönliche Gespräch beim<br />
Bekanntwerden von Mietschulden. In Kooperation mit städtischen<br />
Ämtern und freien Trägern wird versucht, die selbstständige<br />
Lebensführung und die Zahlungsfähigkeit der Betroffenen<br />
wiederherzustellen und Zwangsräumungen zu vermeiden. So<br />
gelingt es sehr oft, drohende Obdachlosigkeit abzuwenden.<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
zugleich Präsident des Deutschen Städtetags,<br />
warnt allerdings davor, die Falschen an den Pranger<br />
zu stellen: „Der eigentliche Skandal ist nicht<br />
die Verzweiflungstat einzelner Kommunen, sondern<br />
die mangelnde Finanzausstattung der Kommunen,<br />
die solche Notverkäufe erzwingt.“<br />
Obwohl München mit 2.500 Euro pro Einwohner<br />
wesentlich höher verschuldet ist als Dresden mit<br />
1.500 Euro pro Kopf, lehnt es Sozialdemokrat<br />
Ude jedoch ab, die beiden städtischen Wohnungsgesellschaften<br />
mit 50.000 Wohnungen zu<br />
verkaufen. Ebenso das CDU-regierte Hamburg,<br />
der Stadtstaat ist sogar mit 11.365 Euro je Einwohner<br />
verschuldet. Stadtentwicklungssenator<br />
Michael Freytag wiederholte erst jüngst, die zwei<br />
kommunalen Wohnungsgesellschaften würden<br />
auf keinen Fall veräußert. Die Hansestadt wolle<br />
„die langfristige Steuerungsfähigkeit der Wohnungspolitik”<br />
in der Hand behalten.<br />
Die „soziale Entmischung“ in<br />
Deutschland nimmt zu<br />
Vielen Stadtkämmerern wäre es die liebste<br />
Lösung, einen Teil der eigenen Wohnungsbestände<br />
zu verkaufen, um etwas Liquidität zurückzugewinnen,<br />
ohne gleich die kommunale Wohnungsgesellschaft<br />
im Ganzen loszuschlagen und<br />
damit sämtlichen Einfluss auf die lokale Wohnungspolitik<br />
zu verlieren. Doch da machen die<br />
Investoren nicht mit. Dem Bundesverband deut-<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
scher Wohnungs- und Immobilienunternehmen<br />
sind keine solchen Teilverkäufe bekannt. Als<br />
Minderheitsgesellschafter einer kommunalen<br />
Wohnungsgesellschaft Rücksicht auf örtliche<br />
soziale Belange zu nehmen, läuft den Renditezielen<br />
der Fonds zuwider. „Ein Unternehmen<br />
macht keine Sozialarbeit, das ist auch gar nicht<br />
seine Aufgabe“, sagt Ulrich Weber offen, der<br />
Geschäftsführer des Investors Apellas.<br />
Mit der Privatisierung kommunaler Wohnungsgesellschaften<br />
wird ein Jahrhundertwerk aufgegeben.<br />
Der öffentlich geförderte Wohnungsbau<br />
ist eine Errungenschaft der Weimarer Republik –<br />
13
14<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
„Der eigentliche Skandal<br />
ist nicht die Verzweiflungstat<br />
einzelner Kommunen,<br />
sondern die mangelnde<br />
Finanzausstattung der<br />
Kommunen, die solche<br />
Notverkäufe erzwingt.“<br />
Christian Ude, Oberbürgermeister von München<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
15
eingeführt mit der politischen Absicht, „die<br />
extreme soziale Segregation, die durch den<br />
freien Wohnungsmarkt in den Städten entstanden<br />
war, abzubauen, also die proletarischen<br />
Wohnviertel zu beseitigen“, sagt Regionalsoziologe<br />
Häußermann. „Arme Leute sollten nicht<br />
auch schlecht wohnen.“<br />
Inzwischen nehme die „soziale Entmischung“ in<br />
Deutschland wieder zu, hat Rolf-Peter Löhr, stellvertretender<br />
Leiter des Deutschen Instituts für<br />
Urbanistik in Berlin, beobachtet: Wer es sich<br />
leisten kann, zieht aus Problemstadtteilen weg.<br />
Zurück bleiben Arme, Alte, Arbeitslose. Und es<br />
ziehen Menschen nach, die sich ihre bisherige<br />
Wohnung in einer besseren Gegend nicht mehr<br />
leisten können.<br />
Stadtentwicklung wird mit privaten<br />
Investoren schwieriger<br />
Ein jahrzehntelang gültiger Konsens werde jetzt<br />
aufgekündigt, beklagt der Präsident des Mieterschutzbundes,<br />
Franz-Georg Rips: der Konsens,<br />
dass „eine Wohnung nicht nur Wirtschaftsgut,<br />
sondern auch Sozialgut ist“. Die alten Eigentümer,<br />
egal, ob öffentliche oder private, hätten<br />
sich stets ihrer sozialen Verantwortung gestellt.<br />
„Vor allem Käufer aus den USA sehen das<br />
anders“, sagt Rips. Daran änderten auch jene<br />
Sozialchartas wenig, die beim Verkauf großer<br />
Wohnungspakete meist mit vereinbart werden<br />
und mit denen die neuen Eigentümer ihr soziales<br />
Engagement betonen möchten. Nur in einem<br />
einzigen Fall, beim Verkauf der 80.000 Wohnungen<br />
der Wohnungsgesellschaft Gagfah der<br />
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte an<br />
Fortress, sagt Rips, gingen die Vereinbarungen<br />
über das bestehende Mietrecht hinaus, etwa mit<br />
einem zehnjährigen Kündigungsschutz für alle<br />
Mieter.<br />
Zum sozialen Problem kommt das der Stadtentwicklung.<br />
Stadtplaner fürchten einen sinkenden<br />
Einfluss der Kommune auf die Entwicklung der<br />
Stadt, insbesondere wenn – wie vor allem in Ostdeutschland<br />
– wegen sinkender Einwohnerzahlen<br />
Wohnblocks abgerissen werden müssen. Der<br />
geordnete Rückbau ist bisher auch deswegen<br />
möglich gewesen, weil die Städte Einfluss auf<br />
ihre Wohnungsgesellschaften nehmen konnten.<br />
Wie aber wollen sie private Investoren dazu<br />
bewegen, Leerstände abzureißen?<br />
16<br />
In Dresden gehören Fortress zudem nun mehrere<br />
zentrumsnahe Brachflächen. Auf sie habe die<br />
Stadt ebenfalls keinen Zugriff mehr, bemängeln<br />
Kritiker des Verkaufs. Allerdings hat sich Dresden<br />
vertraglich so genannte Belegungsrechte für<br />
8.000 Wohnungen beim neuen Eigentümer gesichert,<br />
Wohnungen für Bedürftige, die auf dem<br />
freien Wohnungsmarkt scheitern und für deren<br />
Unterbringung dann die Kommunen zu sorgen<br />
haben.<br />
Diese Klientel wird noch wachsen, und dann<br />
werden die Kommunen froh sein, über eigene<br />
Gesellschaften zu verfügen, die diese armen<br />
Leute mit Wohnraum versorgen. Und mit der sie<br />
den Stadtumbau aufgrund demographischer<br />
Verwerfungen planen können. So argumentiert<br />
der Bundesverband deutscher Wohnungs- und<br />
Immobilienunternehmen und hat dafür den<br />
Begriff der „Stadtrendite“ kreiert. Sie schlage<br />
sich nicht unbedingt in klingender Münze nieder<br />
wie die betriebswirtschaftliche Rendite, ihr Fehlen<br />
könne eine Kommune jedoch teuer zu stehen<br />
kommen.<br />
> UNTERSTÜTZUNG JUGENDLICHER<br />
Für sozial benachteiligte Jugendliche hat die <strong>LWB</strong><br />
verschiedene Unterstützungsangebote initiiert und<br />
mit Partnern aufgelegt. So bekommen ehemals<br />
obdachlose Jugendliche sowie junge Leute aus zerrütteten<br />
Elternhäusern im Projekt „Krähenhütte“ die<br />
Chance, unsanierte Wohnungen auszubauen und zu<br />
niedrigen Mieten zu bewohnen. Einige der Erstbewohner<br />
wohnen später zufrieden und problemlos in<br />
eigenen Wohnungen außerhalb des Sozialprojekts.<br />
Zudem besteht seit einigen Jahren zwischen der <strong>LWB</strong><br />
und einem Beschäftigungsprojekt für gestrandete<br />
Jugendliche von der Diakonie Leipzig eine Vereinbarung,<br />
in deren Ergebnis sinnstiftende Arbeiten bei<br />
der <strong>LWB</strong> wie Reinigungs- und Grünpflegearbeiten in<br />
Verbindung mit einem geringfügigen Taschengeld<br />
realisiert werden.<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
SOZIALES ENGAGEMENT<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
17
WELTWEITER TREND: PRIVATISIERUNG<br />
KONTRA PREIS<strong>WERT</strong>EM WOHNUNGSBAU<br />
Seit dem Jahr 2001 wurden in Deutschland<br />
rund 800.000 kommunale Mietwohnungen<br />
allein an angloamerikanische<br />
Investment Groups verkauft. Die Privatisierung<br />
von kommunalen Wohnungsbeständen ist<br />
jedoch kein deutsches Phänomen, sondern ein<br />
Trend, der weltweit zu beobachten ist.<br />
Während in Deutschland die kommunalen Wohnungsunternehmen<br />
grundsätzlich gewinnorientiert<br />
wirtschaften, ist insbesondere in osteuropäischen<br />
Ländern kommunaler Wohnraum<br />
häufig ein Verlustgeschäft für Städte, da die<br />
Mieteinnahmen den Instandhaltungs- und Verwaltungsaufwand<br />
nicht decken. Mit einem Verkauf<br />
können die Kommunen deshalb zwei Fliegen<br />
mit einer Klappe schlagen: Sie entledigen<br />
sich eines großen Schuldenverursachers und<br />
bessern mit dem Erlös die gebeutelte Stadtkasse<br />
auf. Die Privatisierung von kommunalen<br />
Wohnungen wird inzwischen weltweit als Mittel<br />
18<br />
Privatisierung staatlichen oder kommunalen<br />
Wohnraums ist keine deutsche Besonderheit. Weltweit<br />
werden Wohnungen privatisiert, weltweit<br />
wachsen aber auch die Probleme, sozial Benachteiligte<br />
mit preiswertem Wohnraum zu versorgen.<br />
Dazu ein Überblick auf den nächsten Seiten.<br />
zur Schuldeneindämmung gesehen und in manchen<br />
Fällen sogar staatlich verordnet.<br />
USA: Mehr Privatisierung,<br />
weniger Sozialwohnungsbau<br />
Beispiel Dänemark: Im Jahr 1997 legte die dänische<br />
Regierung der Stadt Kopenhagen nahe,<br />
20.000 kommunale Wohnungen zu verkaufen,<br />
um die Schieflage der Stadtkasse auszugleichen.<br />
Ähnliches Szenario in Fernost. 2001 hat die<br />
japanische Regierung damit begonnen, 750.000<br />
öffentliche Mietwohnungen zu privatisieren. In<br />
den USA wurden seit 1996 mehr als 300.000<br />
öffentliche, vom Staat subventionierte Wohnungen<br />
in hochpreisige Mietwohnungen umgewandelt.<br />
Problematisch dabei ist, dass es keine<br />
Sozialwohnungsbau-Programme gibt, die die<br />
Verknappung von erschwinglichen Wohnungen<br />
ausgleichen.<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
Pulsierendes, urbanes Leben – Städte wollen attraktiver werden.<br />
Nicht selten wird diese Entwicklung zu einer Gefahr für die weniger<br />
Wohlhabenden, weil sie ihren preiswerten Wohnraum verlieren.<br />
19
Privatisierungswelle in Osteuropa<br />
In Ungarn, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei<br />
sowie den baltischen Republiken ist die Privatisierung<br />
von kommunalen Wohnungsbeständen<br />
seit den frühen 90er-Jahren rapide vorangeschritten.<br />
In Lettlands Hauptstadt Riga waren<br />
1999 rund 44 Prozent des öffentlichen Wohnungsbestands<br />
privatisiert. Experten rechnen<br />
aktuell mit einer Privatisierungsrate von über 80<br />
Prozent. Zu Beginn der Privatisierungsphase<br />
1991 lag der Anteil von privatem Wohneigentum<br />
in Riga lediglich bei 5,8 Prozent. Gleiches Tempo<br />
legte die Russische Föderation vor. Hier waren<br />
1995 bereits 35,9 Prozent aller kommunalen<br />
Wohnungen privatisiert. Besonders begehrt ist<br />
Wohnraum in Großstädten wie Moskau oder<br />
St. Petersburg.<br />
Politik bestimmt Anteil öffentlichen<br />
Wohnraums<br />
In tschechischen Städten ist die Privatisierungsquote<br />
völlig gegensätzlich. In Usti nad Labem<br />
waren 2003 mehr als 80 Prozent des kommunalen<br />
Wohnungsbestands privatisiert, während in<br />
Prag zirka die Hälfte aller städtischen Wohnungen<br />
in Privathand wechselten. In Brno wurden<br />
bis 2003 hingegen nur 19 Prozent der öffentlichen<br />
Wohnungen privatisiert. Das Beispiel der<br />
Tschechischen Republik ist exemplarisch für die<br />
Situation der kommunalen Wohnungsbestände<br />
weltweit: Die Anteile öffentlichen Wohnraums<br />
hängen stark von der jeweiligen Kommunal- bzw.<br />
Landespolitik ab. Außerdem beeinflussen Faktoren<br />
wie Sozialstruktur, Verschuldung einer Stadt,<br />
Management von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften<br />
und Gesetzgebung die Entwicklung<br />
des öffentlichen Wohnungsmarkts.<br />
20<br />
Internationale Mieterallianz warnt<br />
vor sozialen Folgen<br />
Die Internationale Mieterallianz (IUT) warnt vor<br />
der weiteren Privatisierung von kommunalen<br />
und staatlichen sowie von Sozialwohnungen.<br />
Denn in den meisten Fällen zögen die Verkäufe<br />
Mietsteigerungen nach sich und verknappten so<br />
den Markt für erschwingliche Wohnungen. Vor<br />
allem sozial Schwache und Geringverdiener würden<br />
unter dieser Entwicklung leiden. Je größer<br />
der Anteil von kommunalen Wohnungen am<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
Gesamtwohnungsbestand einer Gemeinde ist,<br />
umso höher ist seine dämpfende Wirkung auf<br />
das Mietniveau. Kritiker bezweifeln zudem die<br />
Nachhaltigkeit von Wohnungsverkäufen. Durch<br />
effektiveres Management und geänderte Satzungen<br />
könnten auch defizitäre kommunale Wohnungsunternehmen<br />
schwarze Zahlen schreiben.<br />
Gelegentlich greifen Staaten auch im Interesse<br />
der sozial Schwächeren ein: Um vor sozialen<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
> TAGESMÜTTER-PROJEKT<br />
Die <strong>LWB</strong> kümmert sich auch um junge Familien und<br />
ihre ganz eigenen Probleme. So bekommen Tagesmütter,<br />
die Kinder in einer <strong>LWB</strong>-Wohnung betreuen,<br />
für ein Jahr eine Mietvergünstigung als Starthilfe.<br />
Zudem verfügt die <strong>LWB</strong> über ein eigenes Vermietungsprogramm<br />
für Eltern mit dem Motto „Alles frei,<br />
Baby". Die <strong>LWB</strong> trägt in bestimmten Wohnungen im<br />
ersten Mietjahr sämtliche Kosten für das Kinderzimmer<br />
(Miete, Strom, Heizung und Wasser) und unterstützt<br />
auf diese Weise junge Familien. Alternativ<br />
können sich junge Eltern aber auch für ein „Pampers-Abo"<br />
entscheiden: Der Nachwuchs bekommt<br />
dann zwei Jahre lang zwei Windelpackungen im<br />
Monat.<br />
Notständen zu schützen und gleichzeitig den<br />
Ausverkauf kommunaler Wohnungen auszuschließen,<br />
hat die französische Regierung im<br />
Jahr 2000 mit dem so genannten „Gayssot-<br />
Gesetz“ größere Städte dazu verpflichtet, mindestens<br />
20 Prozent ihres Wohnungsbestandes<br />
als Sozialwohnungen vorzuhalten und bereitzustellen.<br />
21<br />
SOZIALES ENGAGEMENT
Auch nach dem Wegfall der Eigenheimzulage locken<br />
Kreditinstitute und Bausparkassen mit den unschlagbar<br />
niedrigen Bauzinsen und der größer werdenden Versorgungslücke<br />
im Alter. Fast scheint es, als ob sich eine<br />
breite Masse der Bevölkerung Wohneigentum so ohne<br />
weiteres anschaffen kann. Allerdings sprechen die Fakten<br />
– besonders im Osten der Republik – eine andere<br />
Sprache. Die Bildung von Wohneigentum bleibt eine<br />
wünschenswerte, aber für die Mehrheit der Menschen<br />
unerreichbare Alternative.<br />
22<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
DIE EIGENEN VIER WÄNDE –<br />
(K)EIN TRAUM FÜR JEDEN<br />
Sinkende gesetzliche Altersrente, Bauzinsen<br />
auf historischem Tiefstand, gute<br />
Erbanlage – die Argumente für einen<br />
Immobilienerwerb sind selten so treffend<br />
und richtig wie in diesen Zeiten. Und jeder,<br />
der sich auf diese Art und Weise mehr Sicherheit<br />
für das Alter schaffen kann, ist gut beraten, dies<br />
auch ernsthaft zu überdenken. Aber kann sich<br />
jeder eine Wohnung, eine Haushälfte oder ein<br />
Einfamilienhaus leisten? Natürlich nicht. Insofern<br />
muss dem größeren Teil der Bevölkerung –<br />
gerade in den ostdeutschen Ländern – auch<br />
weiterhin ein ausreichendes und qualitativ gutes<br />
Angebot an mietbarem Wohnraum zur Verfügung<br />
gestellt werden.<br />
Dies betrifft nicht nur Menschen, die von Hartz-<br />
IV leben müssen, arbeitslos sind, nur einen Verdiener<br />
in der Familie haben, mit niedrigen Renten<br />
auskommen müssen oder als Studenten<br />
sowieso jeden Cent drei Mal umdrehen müssen.<br />
Auch für Arbeitnehmer mit einem relativ niedrigen<br />
Einkommen bleiben die eigenen vier Wände<br />
ein unerfüllbarer Traum. Gerade die 50-bis 65-<br />
Jährigen sind zudem überdurchschnittlich mit<br />
Einkommensproblemen konfrontiert, da sie viel<br />
schwerer Arbeit finden und in der Regel kein<br />
Kapital aufbauen konnten, mit dem sie sich eine<br />
Wohnung leisten könnten. Bei einer konstant<br />
hohen Arbeitslosenquote von rund 20 Prozent,<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
zirka 80.000 Hartz-IV-Betroffenen und einem insgesamt<br />
noch immer relativ schwachen und problematischen<br />
regionalen Arbeitsmarkt ist nicht<br />
absehbar, dass sich die soziale Situation für diesen<br />
großen Bevölkerungskreis schlagartig bessert<br />
und hier neue Immobilien-Käuferschichten<br />
heranwachsen.<br />
Auch die Immobilienfinanzierung selbst baut vor<br />
vielen Menschen eine zu hohe Hürde auf. „Die<br />
Zeiten, in denen sich Banken und Sparkassen<br />
beim Kauf einer Immobilie mit einem Bruchteil<br />
an Eigenkapital zufrieden gaben, sind vorbei“,<br />
erklärt Tino Grund, Leiter Fürst Fugger Vermögensmanagement<br />
Leipzig. „Abgesehen von<br />
hohen Einkommen und vielleicht Beamtenbezügen<br />
sind 20 Prozent Eigenkapital und mehr<br />
heute eine Voraussetzung für einen Immobilienkauf.“<br />
Schwerer wird es in den nächsten Jahren<br />
auch für Selbstständige<br />
und Freiberufler,<br />
da sich die Ausgangsbedingungen<br />
für Kreditgeschäfte<br />
mit „Basel II“ für<br />
diese Gruppen verschlechtern<br />
werden.<br />
Tino Grund, Leiter<br />
Fürst Fugger Vermögensmanagement<br />
Leipzig<br />
23
24<br />
Für eine Eigentumswohnung mit einer Größe von<br />
80 Quadratmetern müssen in Leipzig in mittlerer<br />
Lage mindestens 80.000 Euro bezahlt werden.<br />
Hinzu kommen noch Nebenkosten wie Notargebühren,<br />
Grunderwerbssteuer, gegebenenfalls Kaution<br />
und ähnliches. Von insgesamt rund 90.000<br />
Euro müssen also 18.000 Euro per Bausparvertrag<br />
oder bar als Eigenkapital aufgebracht werden.<br />
Abgesehen von der niedrigeren Kaufkraft im Osten<br />
(die Kaufkraft-Kennziffer in Leipzig liegt bei 84,4<br />
Prozent des Bundesdurchschnitts) sind die ersparten<br />
Rücklagen im Osten bei weitem nicht so hoch<br />
wie in den alten Ländern. Zudem ist es durch den<br />
Wegfall der Eigenheimzulage nicht einfacher<br />
geworden, eine Immobilie zu finanzieren.<br />
„Darlehenszahlungen und Tilgung sollten 30 Prozent<br />
des verfügbaren Einkommens nicht übersteigen“,<br />
warnt Finanzfachmann Grund jeden Interessenten,<br />
der sich Wohneigentum anschaffen will.<br />
30 Prozent des Einkommens – das gilt übrigens<br />
auch für die Miete samt Nebenkosten. Bei letzterem<br />
kann man freilich durch Umzug den finanziellen<br />
Druck mindern. Wohneigentümer haben es in<br />
der Regel wesentlich schwerer, Lösungen mit ihrer<br />
finanzierenden Bank zu finden.<br />
Es gibt weitere, erschwerende Faktoren für den<br />
bedenkenlosen Eigentumserwerb. Leipzig kämpft<br />
auf absehbare Zeit mit hohen Leerständen – wer<br />
sich eine Eigentumswohnung anschafft, muss<br />
damit rechnen, dass er sie nur sehr schwer wieder<br />
los wird, wenn er zum Beispiel wegen eines<br />
Arbeitsplatzwechsels in eine andere Stadt umziehen<br />
muss. Dies gilt besonders für junge Leute und<br />
Familien, deren Erwerbsbiographie in Zukunft<br />
mehr Mobilität denn je verlangen wird. Was wird<br />
aber dann mit der Eigentumswohnung? Auch der<br />
Erwerb beispielsweise einer Plattenbauwohnung<br />
durch Senioren will genau durchdacht sein. Wer<br />
einmal kauft und sich dann vielleicht nach dem<br />
Verlust des Partners gern eine kleinere Wohnung<br />
nehmen möchte, hat Probleme, die eigenen vier<br />
Wände weiter zu verkaufen.<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
25
Die erste Blüte des kommunalen<br />
Wohnungsbaus führte in Leipzig zu<br />
einem enormen Zuwachs an Wohnungen<br />
für Arbeiter- und Angestelltenfamilien,<br />
endete aber jäh unter den finanziellen<br />
Zwängen der Weltwirtschaftskrise.<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
KOMMUNALER<br />
WOHNUNGSBAU<br />
IN LEIPZIG<br />
MIT TRADITION<br />
Von Dr. Thomas Nabert,<br />
Pro Leipzig e. V.<br />
Seit es in der Geschichte Städte gibt,<br />
seitdem gibt es in ihnen auch soziale<br />
Sicherungssysteme für Arme, Kranke,<br />
Alte oder Heranwachsende. Sie sind<br />
feste Bestandteile städtischer Kultur und haben<br />
sich bis heute u. a. in Form städtischer Krankenhäuser,<br />
Schulen, Bäder, Versorgungsanstalten<br />
oder Wohnungen gehalten. Der in den 20er-<br />
Jahren einsetzende kommunale Wohnungsbau<br />
hatte dabei über Jahrzehnte nicht nur eine soziale<br />
Funktion, sondern auch eine städtebauliche.<br />
Bis zu Beginn der 20er-Jahre gab es dafür<br />
jedoch keinen Bedarf. Leipzig galt um 1880 als<br />
eine Stadt der Mieter und des großbürgerlichen<br />
Wohnens. Der Wohnungsbau lag in festen Händen<br />
privater Unternehmen wie der 1872 gegründeten<br />
Leipziger Immobiliengesellschaft oder der<br />
von Karl Heine 1888 gegründeten Westend-Baugesellschaft.<br />
Nur jede fünfte gebaute Wohnung<br />
war vor 1914 eine Kleinwohnung.<br />
In Städten wie Berlin, Breslau oder Magdeburg<br />
lag der Anteil dieser Wohnungen zur gleichen<br />
Zeit bei etwa 80 Prozent. Dem zunehmenden<br />
Bedarf an günstigem Wohnraum versuchten<br />
zunächst einzelne wohlhabende Bürger der<br />
Stadt, allen voran der Verleger Herrmann Julius<br />
Meyer, zu beheben. Reichsgesetze schufen 1889<br />
außerdem die Grundlage für einen Aufschwung<br />
der Baugenossenschaften.<br />
26 27
28<br />
Die Nibelungensiedlung im<br />
Leipziger Süden – erbaut<br />
1929 bis 1931 – war die<br />
größte städtische Wohnanlage<br />
dieser Zeit.<br />
Erste kommunale Wohnungen in den<br />
Zwanzigerjahren<br />
Im Ersten Weltkrieg kam der Wohnungsbau dann<br />
zum Erliegen. 1919 fehlten schon 13.000 Wohnungen,<br />
zehn Jahre darauf mehr als das Doppelte.<br />
Privates Bauen hatte bedingt durch wirtschaftliche<br />
Verunsicherung und die gesetzlich<br />
geregelte Zwangsbewirtschaftung des Wohnraums<br />
jeglichen Anreiz verloren. Das war die<br />
Geburtsstunde des kommunalen Wohnungsbaus.<br />
Begünstigend wirkten in Leipzig dabei<br />
zwei Umstände: die Stadt hatte mit James Bühring<br />
und Hubert Ritter zwei herausragende<br />
Stadtbaudirektoren und dazu reichlich kommunalen<br />
Grundbesitz. Gebaut wurden kleinere,<br />
modern ausgestattete Wohnungen in offenen,<br />
teilweise durchgrünten Anlagen wie der Rundling<br />
in Lößnig oder der Lützner Plan in Neu-Lindenau.<br />
Diese erste Blüte des kommunalen Wohnungsbaus<br />
führte in Leipzig zu einem enormen<br />
Zuwachs an Wohnungen für Arbeiter- und Angestelltenfamilien,<br />
endete aber jäh unter den finanziellen<br />
Zwängen der Weltwirtschaftskrise. Die<br />
vom Dritten Reich finanzierten „Volkswohnungen“<br />
konnten dagegen kaum Akzente auf dem<br />
Wohnungsmarkt oder im Stadtbild setzen.<br />
Schweres Erbe des Zweiten Weltkriegs<br />
Der Zweite Weltkrieg war auch für den Wohnungsbestand<br />
Leipzigs verheerend: 38.000 Wohnungen<br />
wurden völlig zerstört und weitere<br />
52.000 beschädigt. Neben den ab 1954 gebildeten<br />
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften war<br />
die Stadt nun Träger des „volkseigenen“ Wohnungsneubaus.<br />
Bis Ende der 60er-Jahre ver-<br />
suchte die Kommune die dringende Schaffung<br />
von Wohnraum und den systematischen Wiederaufbau<br />
des zerstörten Leipzigs als Einheit zu<br />
gestalten. Im Rahmen der von der Partei- und<br />
Staatsführung der DDR verkündeten Wohnungsbauprogramme<br />
ab 1971 war dies dann kaum<br />
noch möglich. Stadt und Arbeiterwohnungsgenossenschaften<br />
wurden ohnehin zu bloßen Kontingentempfängern<br />
und Verwaltern der in staatlicher<br />
Regie gebauten Wohnungen. Ende der<br />
80er-Jahre gab es trotz Massenwohnungsbaus<br />
zirka 70.000 Wohnungssuchende in Leipzig.<br />
Rettung der Gründerzeit-Substanz<br />
Gestützt auf einen breiten politischen Konsens<br />
wurde nach 1990 das Hauptaugenmerk auf die<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
Rettung der das Stadtbild prägenden gründerzeitlichen<br />
Bausubstanz gerichtet. Bis zum Jahr<br />
2005 konnten etwa 80 Prozent des Altbaubestands<br />
saniert und damit vor dem Verfall geret-<br />
SOZIALES ENGAGEMENT<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
tet werden. Einen nicht geringen Anteil an dieser<br />
Leistung hatte das sich neu etablierende kommunale<br />
Wohnungswesen der Stadt mit ihrer Leipziger<br />
Wohnungs- und Baugesellschaft.<br />
> MEDIATION IM WOHNGEBIET<br />
Wo immer Streitereien und Diskrepanzen zwischen Mietern<br />
auftauchen, bemüht sich die <strong>LWB</strong> offensiv um Mediation<br />
und Schlichtung. Durch Hausbesuche und Gespräche werden<br />
bei Streitigkeiten um übertriebene Ordnungs- und<br />
Ruhebedürfnisse oder verschiedene menschliche Verhaltensweisen<br />
Lösungen gesucht. In schwierigen Fällen organisiert<br />
die <strong>LWB</strong> Mediationstermine zwischen den Streitparteien.<br />
Dadurch werden soziale Kompetenzen wie Kommunikation<br />
und Verantwortung der Mieter gestärkt, Gleichgültigkeit<br />
und selbst Vandalismus vorgebeugt.<br />
29
Der Poetenhof<br />
in Gohlis<br />
DIE NEUAUSRICHTUNG DER KOMMUNALEN<br />
WOHNUNGSWIRTSCHAFT NACH 1990<br />
Das Jahr 1990 markiert gewissermaßen eine<br />
Zäsur für die kommunale Wohnungswirtschaft.<br />
Mit der Wiedervereinigung und dem In-Kraft-Treten<br />
des Einigungsvertrages übernahm die Stadt<br />
Leipzig das ehemals volkseigene Wohnungsvermögen<br />
und gründete im Dezember 1990 die<br />
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH<br />
(<strong>LWB</strong>) als 100-prozentige Tochter. Im Gesellschaftervertrag<br />
wurde festgeschrieben, dass die<br />
<strong>LWB</strong> eine „sichere und sozial verantwortbare<br />
Wohnungsversorgung der breiten Schichten der<br />
Bevölkerung“ zu gewährleisten habe. Eine Aufgabe,<br />
die an die soziale Tradition des kommunalen<br />
Wohnungsbaus anknüpft.<br />
Vor allem markiert die Gründung der <strong>LWB</strong> aber<br />
einen wohnungswirtschaftlichen Neuanfang. Die<br />
staatlich gelenkte, planwirtschaftliche Wohnungspolitik<br />
der DDR hatte neben den Großwohnsiedlungen<br />
an den Stadträndern einen<br />
maroden und vernachlässigten Altbaubestand<br />
hinterlassen. In Leipzig waren 1990 von 90.000<br />
Altbauwohnungen zwei Drittel dringendst sanierungsbedürftig,<br />
25.000 Wohnungen standen<br />
leer. Die vordringlichste Aufgabe war daher in<br />
den 90er-Jahren die Rettung des Bestandes vor<br />
weiterem Verfall und die Schaffung von ausreichend<br />
Wohnraum. Für die <strong>LWB</strong> stand folglich<br />
nicht der Neubau im Vordergrund, sondern die<br />
Bestandserhaltung. Rund 1,5 Milliarden Euro<br />
investierte das kommunale Wohnungsunternehmen<br />
bis heute in Sanierungen und Moderni-<br />
30<br />
sierungen, in Zahlen sind dies rund 23.000<br />
sanierte Wohnungen, von denen mehr als zwei<br />
Drittel denkmalgeschützt sind. Ähnlich hoch ist<br />
die Investitionssumme, die mittelbar durch<br />
Grundstücks- und Immobilienverkäufe an Bauträger<br />
und Investoren generiert wurde.<br />
Heute sind gerade die liebevoll sanierten Wohnanlagen<br />
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
in vielen Stadtteilen wieder das Aushängeschild<br />
des kommunalen Wohnungsbaus der<br />
Stadt. Darauf sollte immer dann hingewiesen<br />
werden, wenn Abbrüche im Rahmen des Stadtumbaus<br />
kritisiert werden – in kaum einer anderen<br />
ostdeutschen Großstadt ist in den letzten<br />
Jahren mehr in den Denkmalschutz investiert<br />
worden als in Leipzig.<br />
Was die kommunale Wohnungswirtschaft nach<br />
1990 zu leisten hatte, um aus den staatlichen<br />
Wohnungsverwaltungen moderne und dienstleistungsorientierte<br />
Unternehmen zu machen,<br />
ist freilich kaum dokumentiert. Neben der<br />
Bestandserhaltung ging es auch um die massenhafte<br />
Klärung vermögensrechtlicher Ansprüche<br />
von Alteigentümern, die Vereinheitlichung<br />
des Mietrechts und die Anpassung an das Vergleichsmietensystem<br />
der alten Bundesländer<br />
oder um den Aufbau funktionierender Verwaltungen.<br />
Anfang der 90er-Jahre existierte noch<br />
kein funktionierender Wohnungsmarkt. Die <strong>LWB</strong><br />
verwaltete über die Hälfte der insgesamt<br />
258.000 Leipziger Wohnungen und dominierte<br />
damit den Markt. Heute sind es etwa 53.600<br />
Wohnungen.<br />
Allein die Veränderung im Wohnungsbestand ist<br />
Ausdruck einer Neuorientierung der kommunalen<br />
Wohnungswirtschaft, und sie zeigt im<br />
Grunde zweierlei. Erstens macht sie deutlich,<br />
dass der unternehmerische Schwerpunkt – im<br />
Gegensatz zur Zeit vor 1990 – nicht mehr auf<br />
dem Wohnungsneubau lag, sondern auf der<br />
Sanierung, Modernisierung und mit dem Stadtumbau<br />
auf einer städtebaulichen Erneuerung,<br />
die der Stadt wie dem Leipziger Wohnungsmarkt<br />
insgesamt zugute kam. Priorität hatte die Erhaltung<br />
der vorhandenen Bausubstanz.<br />
Und zweitens ermöglichte erst die veränderte<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
Bestandsgröße einen stärkeren Dienstleistungscharakter.<br />
Da die <strong>LWB</strong> heute nicht mehr die flächendeckende<br />
Versorgung der Leipziger mit<br />
Wohnraum gewährleisten muss, kann sie sich<br />
stärker auf ihre eigentliche Aufgabe und mithin<br />
auf die soziale Dimension des Wohnens besinnen.<br />
Einige Beispiele sind in dieser Ausgabe von<br />
FORUM dokumentiert. Der wohnungspolitische<br />
Einfluss auf den Markt ist mit 12 Prozent Anteil<br />
jedenfalls geringer als oft angenommen.<br />
Es ist unstrittig, dass die kommunale Wohnungswirtschaft<br />
auch künftig unterschiedlichste<br />
SOZIALES ENGAGEMENT<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
Aufgaben in den Städten wahrnehmen muss.<br />
Der noch immer hohe Leerstand in Ostdeutschland,<br />
ein nach wie vor großer Sanierungs- und<br />
Erhaltungsbedarf von historischer Bausubstanz,<br />
die Strukturschwäche vieler Regionen und die<br />
unmittelbaren sozialen (und finanziellen) Folgen<br />
für die regionalen Wohnungsmärkte wie die prognostizierte<br />
demographische Entwicklung haben<br />
unmittelbare Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft.<br />
Gerade hier wird die kommunale<br />
Wohnungswirtschaft künftig ihre Leistungsfähigkeit<br />
beweisen können.<br />
> GEMEINNÜTZIGE ARBEITSSTUNDEN<br />
In Absprache mit dem Jugendamt wurde die<br />
Möglichkeit geschaffen, dass straffällig<br />
gewordene Jugendliche ihre gemeinnützigen<br />
Arbeitsstunden bei der <strong>LWB</strong> ableisten.<br />
Schwerpunkt der Arbeit sind Reinigung und<br />
Pflege öffentlicher Flächen und die Beseitigung<br />
von Graffiti-Schmierereien. Der Einsatz<br />
der Jugendlichen erfolgt überwiegend problemlos.<br />
Teilweise erwirkt die gemeinnützige<br />
Arbeit eine positive Verhaltensänderung bei<br />
den jungen Leuten.<br />
31<br />
Von der <strong>LWB</strong><br />
sanierte Altbauten<br />
in der<br />
Riebeckstraße<br />
im Stadtteil<br />
Reudnitz.
Städte haben eine Fürsorgepflicht für ihre Einwohner. Wenngleich<br />
sie nicht allen alles bieten können, sind sie aber verpflichtet,<br />
ihren Bürgern gerade auch in schwierigen Lebenssituationen<br />
nach Kräften zu helfen. Auch mit preiswertem und<br />
gutem Wohnraum. Die <strong>LWB</strong> als kommunales Unternehmen<br />
stellt sich dieser Verantwortung. Fünf Beispiele, die zeigen,<br />
dass es jenseits von Rentabilität oder Gewinnmargen auch<br />
eine soziale Dimension des Wohnens gibt. Von Sibylle Kölmel<br />
32<br />
Gitta Jung mit ihrem vierjährigen<br />
Sohn Armin<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
Überall gibt es hier Perlen. Lose liegen<br />
sie auf dem Wohnzimmertisch vorm<br />
Fenster. In kleine Gläser gefüllt stehen<br />
sie im Regal. Fertig aufgezogene Perlenketten<br />
hängen an der Wand. Kleine, große,<br />
transparente. Dicke, schmale, runde und eckige.<br />
Vor allem aber sind diese Perlen eines: Bunt. So<br />
bunt wie eigentlich alles hier, in der Wohnung<br />
von Gitta Jung. Auf den Wohnzimmerboden hat<br />
sie einen roten Teppich gelegt. Der Flurschrank<br />
besitzt verschiedenfarbige Griffe, in ihrem<br />
Schlafzimmer hängen gelb-orange Vorhänge.<br />
„Farben sind mir sehr wichtig. Ich kann es nicht<br />
leiden, wenn alles gleich aussieht. Ich mag Buntes<br />
total gern“, erzählt die 27-jährige allein<br />
erziehende Mutter. Ende 2004, nach der Trennung<br />
von ihrem damaligen Freund, ist sie mit<br />
dem vierjährigen Armin hierher in die Rosenowstraße<br />
gezogen. In eine Sozialwohnung.<br />
Herrn Lein von der <strong>LWB</strong> hat sie in guter Erinnerung.<br />
„Der war schon sehr zuvorkommend. Trotz<br />
meiner hohen Ansprüche. Ich wollte unbedingt<br />
eine Badewanne. Außerdem sollte das Bad ein<br />
Fenster haben. Und einen Balkon hab ich mir<br />
auch gewünscht“, erzählt die gelernte Sportund<br />
Fitnesskauffrau. Sie lacht.<br />
Es gab sie tatsächlich, die Wohnung für Gitta<br />
und Armin Jung. Alle damals ersehnten Dinge<br />
sind in der Drei-Raum-Wohnung vorhanden. Für<br />
knapp 60 Quadratmeter bezahlt die junge Mutter<br />
hier 460 Euro Warmmiete. Ideal sei auch der<br />
großzügige und vor allem umzäunte Innenhof.<br />
„Da kann ich Armin allein spielen lassen, ohne<br />
mir Sorgen um ihn machen zu müssen. Da passiert<br />
ihm nichts."<br />
Zur Zeit bekommt die gebürtige Leipzigerin<br />
Hartz-IV. Und arbeitet als Kellnerin im Café<br />
Puschkin in der Karl-Liebknecht-Straße. „Ich<br />
finde in dem Beruf, den ich gelernt habe, einfach<br />
keine Arbeit. Das ist leider momentan ziemlich<br />
aussichtslos.“<br />
Für die Zeit, in der Gitta Jung kellnert, hat sie ein<br />
straff organisiertes Betreuungsprogramm für<br />
ihren Sohn ausgeklügelt. Neben der Oma kümmern<br />
sich auch die Nachbarn im Haus hin und<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
WOHN<strong>WERT</strong>E<br />
SCHNARCHENDE<br />
NACHBARN UND<br />
BUNTE PERLEN<br />
Die allein stehende Gitta Jung und ihr<br />
vierjähriger Armin freuen sich über echte<br />
Nachbarschaftshilfe<br />
wieder um den Vierjährigen. Wenn Gitta Jung<br />
mal später heimkommt. Voll des Lobes für die<br />
Hausgemeinschaft ist sie: „Der Umgang untereinander<br />
ist hier einfach klasse. Die sind alle<br />
sehr nett. Wir helfen uns immer gegenseitig.“<br />
Wenn es warm ist, unterhalten sich die Hausbewohner<br />
von Balkon zu Balkon. Quer über den<br />
begrünten Hof. Sehr nett sei das. Und jetzt, wo<br />
es Frühling wird, wolle man auch mal zusammen<br />
grillen. „Blöd ist, dass hier so wenig andere Kinder<br />
in Armins Alter wohnen. Das vermisse ich<br />
schon. Und ihm fehlen Freunde zum Spielen<br />
natürlich auch.“ Auch Mütter, denen es ähnlich<br />
geht wie ihr, wünsche sie sich für ihre Wohnumgebung.<br />
Schon mehrfach hat Gitta Jung mit dem<br />
Gedanken gespielt, eine Wohngemeinschaft für<br />
allein erziehende Mütter zu gründen. „Den Plan<br />
hab ich dann aber doch leider wieder verworfen.<br />
Das war mir irgendwie zu riskant. Man weiß ja<br />
nie, wer da so kommt. Ob man sich versteht.“<br />
Vielleicht sei sie aber auch nur einfach nicht<br />
mutig genug gewesen.<br />
In ihre jetzige Wohnung kommt sie immer gerne.<br />
Auch, wenn die Fußböden ein wenig uneben<br />
sind und dadurch manches Möbelstück ein bisschen<br />
schräg und wackelig steht. Die Küche und<br />
das Bad ein wenig eng sind.<br />
Immer, wenn etwas in der Wohnung nicht funktioniere<br />
oder kaputtgegangen sei, helfe die<br />
<strong>LWB</strong>, die einen Kiosk an der Ecke Rosenow-/<br />
Essener Straße hat, sehr zügig. „Die sind echt<br />
sehr unproblematisch. Man muss dann halt nur<br />
auch etwas sagen.“<br />
Dass es in dem 1998 voll sanierten Haus eher<br />
hellhörig ist, stört die junge Frau überhaupt<br />
nicht. Im Gegenteil. „Auch wenn es absurd<br />
klingt: Das ziemlich laute Schnarchen meiner<br />
Nachbarin beruhigt mich. Gerade dann, wenn<br />
ich aus der Kneipe komme. Ihr ist das total peinlich.<br />
Aber ich schlafe vom Zuhören oft ein.“<br />
33
BLOSS NICHT WEG AUS GRÜNAU<br />
Stephanie und Peter Korus fanden trotz Hartz-IV ihre passende Wohnung<br />
Ein bisschen riecht es hier noch nach frischer<br />
Farbe. Und auch die neue blaue<br />
Küche und der leere Balkon verraten,<br />
dass die Mieter dieser Wohnung noch<br />
nicht allzu lange hier leben. „Seit einem Monat<br />
sind wir jetzt erst in der Gärtnerstraße“, erzählt<br />
Peter Korus, 55. Davor wohnten er und seine Frau<br />
Stephanie lange Jahre in einem der Hochhäuser<br />
in der Neuen-Leipziger-Straße 18, im so genannten<br />
WK 7. Dort haben die beiden ihren Sohn<br />
bekommen und großgezogen. Haben Feste mit<br />
den Nachbarn gefeiert, den Trubel mit den vielen<br />
anderen Familien genossen, Freunde im gleichen<br />
Haus gehabt. „In so einem 11-Geschosser ist<br />
Stephanie und Peter Korus in ihrer Wohnung in Leipzig-Grünau.<br />
34<br />
immer was los. Bei den vielen Menschen. Einen<br />
Fernseher brauchte man da nicht. Wir haben uns<br />
dort sehr wohl gefühlt. Logisch, wenn man so<br />
lange da lebt“, erzählt Stephanie Korus und<br />
lächelt. Ein bisschen wehmütig klingt es.<br />
Einzige, kaum erwähnenswerte Nachteile dort<br />
seien gewesen, dass es manchmal ein wenig hellhörig<br />
war. Und dass die Fenster nicht richtig<br />
schlossen. „Es zog eigentlich immer. Wir mussten<br />
ständig heizen. Neue Fenster, die hätt' ich schon<br />
gern mal gehabt“, fährt die Leipzigerin fort.<br />
Ende 2005 steht fest, dass das Hochhaus abgerissen<br />
werden wird. Nach der Wende sind zahlreiche<br />
Mieter ausgezogen. Zu viele Wohnungen<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
stehen jetzt leer. Vor allem die großen, in denen<br />
vorher Familien gewohnt haben. Den Eheleuten<br />
Korus stehen der Abschied aus der vertrauten<br />
Umgebung und ein Umzug bevor. „Die <strong>LWB</strong> hat<br />
dann verschiedene freie Wohnungen aus ihrem<br />
Bestand rausgesucht und uns vorgeschlagen.<br />
Sie waren sehr bemüht und hilfsbereit. Der<br />
Umzug sowie alle zusätzlich anfallenden Kosten,<br />
wie beispielsweise der Nachsendeantrag oder<br />
die Telefonummeldung, wurden komplett bezahlt.“<br />
In der Gärtnerstraße, im Wohnkomplex 1 (WK 1),<br />
wohnt das Paar jetzt in einer Drei-Raum-Wohnung<br />
mit Balkon. Für 61 Quadratmeter bezahlen<br />
Stephanie und Peter Korus 389 Euro Warmmiete.<br />
Ein Wohnzimmer haben sie und ein Schlafzimmer.<br />
Und ein Enkelzimmer. „Als wir hierher<br />
umgezogen sind, war es für die zwei Enkel das<br />
Wichtigste, dass wir das Bettsofa aus der alten<br />
Wohnung mitnehmen. Damit Valentin und Maximilian<br />
immer herkommen und hier übernachten<br />
können“, schmunzelt Stephanie Korus.<br />
Zeit für die Enkel haben die Korus' momentan<br />
sehr viel, beide Eheleute sind arbeitslos. Peter<br />
Korus ist gelernter Mechaniker, ließ sich später<br />
zum Baumaschinenführer umschulen, absolvierte<br />
dann einige Praktika. Ohne Erfolg. Immer<br />
wieder wurden die Bewerbungen des gebürtigen<br />
Leipzigers abgelehnt. Heute bekommt er<br />
Hartz-IV. „Du kriegst den Tag schon irgendwie<br />
rum“, sagt er. Bitter sei das alles trotzdem und<br />
für ihn nicht nachvollziehbar. Mit gerade mal<br />
Mitte 50 auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr<br />
gebraucht zu werden, schon jetzt zum alten<br />
Eisen zu gehören. Da könne man schon mutlos<br />
werden. Seine Frau, 52 und gelernte Datentypistin,<br />
stimmt ihm kopfnickend zu. Stephanie Korus<br />
war zwischendurch immer mal wieder befristet<br />
beschäftigt, eine längere Anstellung ergibt sich<br />
schon seit einiger Zeit nicht mehr.<br />
Unterkriegen lassen die beiden sich trotzdem<br />
nicht, versuchen es zumindest. Sie gucken<br />
immer wieder nach Stellen, bewerben sich,<br />
hören sich um. Neben den Unternehmungen mit<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
> LEBENS<strong>WERT</strong>ES WOHNUMFELD<br />
Das Verantwortungsgefühl der <strong>LWB</strong> endet nicht an<br />
der Haustür. In den letzten Jahren hat Leipzigs Wohnungsunternehmen<br />
enorm in die Aufwertung des<br />
Wohnumfeldes investiert. Spielplätze, Rasenflächen,<br />
Oasen der Erholung – ein intaktes Drumherum fördert<br />
das soziale Leben im Kiez und trägt zum Wohlfühlen<br />
der Bewohner bei.<br />
den Enkeln sorgen sie für die pflegebedürftige<br />
Mutter von Stephanie Korus. Und gewöhnen<br />
sich an die neue Umgebung. Sitzen am Tisch in<br />
der neuen blauen Küche und gucken aus dem<br />
Fenster. Schauen, was da draußen so alles passiert.<br />
Wer wer ist, wer wo wohnt, wer wen kennt.<br />
„Es ist alles viel ruhiger hier, keine Frage. Hier in<br />
der Gegend gibt es weniger Familien mit kleinen<br />
Kindern. Anfangs war es fast wie auf dem Friedhof,<br />
so still. Man hört im Haus sehr wenige<br />
Geräusche. Mittlerweile haben wir uns daran<br />
gewöhnt und finden es angenehm“, erzählt Stephanie<br />
Korus. Manchmal nerve das Sirenengeheul<br />
der Krankenwagen, die auf der Antonienstraße<br />
nahe ihrer Haustür entlang fahren. Vermutlich<br />
aber werden wohl die Blätter der noch<br />
unbegrünten Sträucher und Bäume da bald<br />
einen Teil der Geräusche abfangen.<br />
Viel sauberer sei es hier in der Gegend. „Und im<br />
Haus machten alle bislang einen sehr netten<br />
Eindruck. Schön ist außerdem, dass die Schwester<br />
von meinem Mann gleich um die Ecke<br />
wohnt“, meint Stephanie Korus. Momentan geht<br />
das Paar viel spazieren. Oder unternimmt Radtouren,<br />
zum Kulkwitzer See beispielsweise. „Ich<br />
wohne seit 23 Jahren in Grünau und kenne die<br />
Gegend wie meine Westentasche“, sagt Peter<br />
Korus und lächelt. Hier einmal ganz wegzuziehen,<br />
da sind sie sich einig, sei unvorstellbar für<br />
beide.<br />
35<br />
SOZIALES ENGAGEMENT
DIE WOHLFÜHLWOHNUNG<br />
UND EIN ÄRGERNIS<br />
Sitta und Dieter Rückert konnten sich mithilfe vieler<br />
ihre Traumwohnung behindertengerecht ausbauen<br />
Kennen gelernt und verliebt ineinander<br />
haben sich Sitta und Dieter Rückert<br />
während eines Kuraufenthaltes. Beide<br />
waren jung an spinaler Kinderlähmung<br />
erkrankt. Schon früh stand fest, dass sie ihr<br />
Leben zu großen Teilen im Rollstuhl verbringen<br />
müssen.<br />
Das Paar, sie stammt aus Quedlinburg, er aus der<br />
Lausitz, entschloss sich, in einer größeren Stadt<br />
nach einer behindertengerechten Wohnung zu<br />
suchen. „Das war damals noch viel schwieriger<br />
als heute. Wohnmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer<br />
gab es in kleinen Städten so gut wie gar nicht“,<br />
erzählt die 61-jährige Sitta Rückert.<br />
36<br />
Die Rückerts zogen nach Leipzig. Zuerst wohnten<br />
sie in der Arndtstraße im Erdgeschoss. Da<br />
waren beide noch beweglicher, kamen teilweise<br />
ohne Rollstuhl zurecht. Und Nachbarn und<br />
Arbeitskollegen halfen, die Kohlen aus dem Keller<br />
in die Wohnung zu tragen.<br />
Dann zog das Paar in eine ihren Bedürfnissen<br />
entsprechende Wohnung in die Telemannstraße<br />
und blieb dort für zehn Jahre. Schon immer<br />
wichtig war für beide die Nähe zum Stadtzentrum<br />
und zum Arbeitsplatz. Denn gearbeitet<br />
haben Sitta und Dieter Rückert immer, bis zur<br />
Pensionierung. Sie als Sekretärin und er als<br />
Elektromechaniker.<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
Sitta und Dieter Rückert<br />
freuen sich über die Nähe<br />
ihrer <strong>LWB</strong>-Wohnung<br />
zur Leipziger Innenstadt.<br />
Zunehmend auf den Rollstuhl angewiesen, litten<br />
die beiden unter der fehlenden Auffahrtsrampe<br />
in der Telemannstraße. 1980 bot die <strong>LWB</strong> deshalb<br />
dem Paar eine Erdgeschoss-Wohnung in<br />
der Karl-Tauchnitz-Straße 17 an. Die beiden zogen<br />
um, waren aber bald mit dem neuen Domizil<br />
nicht sonderlich zufrieden: „Da unten haben<br />
wir uns nicht sehr wohl gefühlt. Mit dem Parkplatz<br />
direkt vor unseren Augen. Wir konnten<br />
auch die Fenster nicht geöffnet lassen, weil die<br />
Räume zu ebener Erde lagen“, erzählt Sitta Rückert,<br />
und Dieter Rückert nickt zustimmend. Als<br />
in der 10. Etage eine Wohnung frei wird, weil die<br />
Mieter in den Westen ausreisen, steigt das Paar<br />
auf. Zehn Jahre wohnen die Rückerts da oben.<br />
Über den Dächern von Leipzig, mit schöner Aussicht<br />
und mit dem geliebten Clarapark zu ihren<br />
Füßen. Das hohe Stockwerk sei für die Rollstuhlfahrer<br />
nie ein Hindernis gewesen. „Wenn<br />
der Fahrstuhl kaputt ist, dann ist er kaputt. Egal,<br />
ob wir in der ersten, fünften oder zehnten Etage<br />
wohnen“, sagt Dieter Rückert und lacht.<br />
Dann geht es dem heute 67-Jährigen gesundheitlich<br />
schlechter. Die Wohnung ist nicht ausreichend<br />
rollstuhlgerecht, der Türrahmen vom<br />
Bad zu eng. Das Ehepaar geht erneut auf Wohnungssuche.<br />
Guckt vieles an, nichts passt so<br />
richtig. Eine Wohnung im Mückenschlösschen<br />
ist zu groß und zu teuer. Der behindertengerechten<br />
Musterwohnung der <strong>LWB</strong> in der Volksgartenstraße<br />
fehlte die Badewanne.<br />
Die Rückerts verhandeln mit der <strong>LWB</strong>, eine Wohnung<br />
in ihrem Hochhaus in der Karl-Tauchnitz-<br />
Straße ihren Bedürfnissen gerecht umzubauen.<br />
Mit Fördermitteln der Stadt Leipzig, Pflegekasseund<br />
<strong>LWB</strong>-Geldern sowie einem privaten<br />
Zuschuss des Ehepaares gestalten Architekten<br />
und Handwerker eine Drei-Raum-Wohnung in<br />
der zweiten Etage um. Küche und Teile vom<br />
Wohnzimmer werden verändert, ein größeres<br />
Bad mit breiter, zweiflügeliger Schiebetür eingebaut.<br />
„Man hatte hier immer ein Ohr für uns<br />
und ist sehr auf unsere Wünsche eingegangen.<br />
Wir haben auch viel zusammen überlegt und<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
geplant“, fasst Sitta Rückert den Umbau zusammen.<br />
Im Sommer 2000 zieht das Paar dann in<br />
die veränderten Räumlichkeiten. Seitdem<br />
bezahlen sie für knapp 65 Quadratmeter 467<br />
Euro warm und fühlen sich sehr wohl. Auch, weil<br />
sie hier mittlerweile alle kennen. Das mache vieles<br />
leichter. „Wir sind eine gute Hausgemeinschaft<br />
und helfen uns gegenseitig. Hier wohnen<br />
ja auch noch andere Rollstuhlfahrer. Freiwillig<br />
zieht hier keiner aus“, sagt Sitta Rückert<br />
lächelnd.<br />
Eine Sache gibt es dann aber doch noch, über<br />
die sich die Quedlinburgerin ärgert. Es sind die<br />
Brandschutzvorschriften im Haus. Da spricht sie<br />
plötzlich schneller. Verliert ein bisschen ihre<br />
Ruhe. Fährt mit dem Rollstuhl zum Küchenschrank<br />
und holt die Mahnung des Vermieters.<br />
Dass sie die Bilder und den kleinen Teppich aus<br />
dem Hausflur räumen musste, damit könne sie<br />
sich gerade noch so arrangieren. Aber dass der<br />
Rollstuhl, mit dem sie außerhalb der Wohnung<br />
fährt, auch noch weg soll, das sei übertrieben.<br />
„Er stand schon immer hier. Er passt einfach<br />
nicht in die Wohnung. Und in den Keller können<br />
wir ihn nicht stellen. Da ist er zu weit weg. Das<br />
betrifft auch die anderen Rollstuhlfahrer hier. So<br />
etwas wäre für uns fast ein Grund, hier auszuziehen“,<br />
empört sie sich. Jede kleinste Veränderung<br />
in der räumlichen Umgebung oder im<br />
durchorganisierten Tagesablauf fordert von beiden<br />
Rollstuhlfahrern ein großes Umgewöhnen,<br />
ruft Unruhe hervor, kann zur Bedrohung werden.<br />
Neben der eigens für sie umgebauten Wohnung<br />
ist es auch die Lage, die die Rückerts so genießen.<br />
„Wir wohnen hier ideal. Man gelangt gut zu<br />
Treffen des Behindertenverbandes und zu kulturellen<br />
Veranstaltungen. Die Innenstadt ist in<br />
der Nähe. Wir können auch mal ohne Fahrdienst<br />
raus, in den Park zum Beispiel.“<br />
Denn das Spazierenfahren, draußen, an der frischen<br />
Luft, umgeben von Natur, das sei ihr Ein<br />
und Alles.<br />
37
Übers Internet haben sich Anne Geißler,<br />
Anja Rößler und Norman Staude<br />
gesucht und gefunden. Eines der mittlerweile<br />
zahlreichen virtuellen Schwarzen<br />
Bretter für Wohnungssuche hat die Mitbewohner<br />
zusammengeführt. „Anja war mir sofort<br />
sympathisch. Und ich ihr eben auch. Mittlerweile<br />
sind wir dicke Freundinnen“, erzählt die<br />
19-jährige Anne, die im 4. Semester an der Leipziger<br />
Uni Grundschullehramt studiert. Die beiden<br />
Studentinnen wohnen seit Oktober 2005<br />
zusammen, vor kurzem ist noch Norman eingezogen.<br />
In das Zimmer seines etwas schwierigen<br />
Vorgängers.<br />
Nicht sonderlich gute Erfahrungen habe man mit<br />
dem gemacht, erzählt Anne. Unzuverlässig sei<br />
er gewesen. Die zwei jungen Frauen trennen<br />
sich von ihm. „Fazit für uns war, dass man nicht<br />
mit jedem, der auf den ersten Blick nett scheint,<br />
Norman, Anja und Anna fühlen<br />
sich wohl in ihrer Dreier-<br />
WG in einer <strong>LWB</strong>-Wohnung.<br />
DIE DREILÄNDER-WG<br />
Anne, Anja und Norman haben in ihrer Studenten-WG sogar Laminat selbst verlegt<br />
38<br />
gut zusammenleben kann“, meint die 18-jährige<br />
Anja, die hier im 2. Semester Soziologie studiert.<br />
Trotz dieses prägenden Erlebnisses nehmen<br />
die beiden wieder einen Mitbewohner bei<br />
sich auf. „Das hat mich echt beeindruckt, wie<br />
selbstverständlich und optimistisch Anne und<br />
Anja mich hier haben einziehen lassen.“ Sagt<br />
Norman Staude, der vor kurzem nach Leipzig<br />
kam, um ein Studium zum Toningenieur zu<br />
beginnen. Der 26-Jährige war sich anfangs nicht<br />
ganz sicher, ob das WG-Leben so seine Sache<br />
ist. Jetzt aber gefalle es ihm gut. Auch, dass er<br />
in der Wohnung nun immer Leute um sich herumhabe.<br />
Der Mitbewohnerwechsel und letzte Spuren der<br />
vollzogenen Renovierungsarbeiten sind noch<br />
erkennbar. Kartons stehen rum, Telefonkabel liegen<br />
auf dem Flur, und Normans Zimmer ist noch<br />
alles andere als eingerichtet.<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
Dennoch ist es gemütlich hier. Die Küche mit der<br />
roten Wand und dem großen Tisch, der Balkon,<br />
der Holzboden im Flur, die alten Türen und die<br />
in warmen Farben gehaltenen Zimmer von Anne<br />
und Anja haben etwas Einladendes.<br />
Die Drei-Raum-Wohnung war teilsaniert. Bis auf<br />
das Bad haben sie fast alles selbst renoviert.<br />
„Das war total reizvoll und hat großen Spaß<br />
gemacht. Ich mache handwerkliche Dinge sehr<br />
gerne und kann das auch ganz gut. Das habe<br />
ich von meinem Papa“, erzählt Anne und<br />
lächelt. Auch das Laminat in ihrem Zimmer hat<br />
sie selbst verlegt. „Dadurch, dass die Studenten<br />
in den Wohnungen selbst gestalten können,<br />
kommt ja immer auch was sehr Individuelles in<br />
die Wohneinheiten“, meint Norman. „Gut nur,<br />
dass das Bad schon gemacht war. Fliesen verlegen<br />
ist nämlich nicht so mein Ding“, lacht er.<br />
Die Dreiländer-WG – Anne stammt aus Leipzig,<br />
Anja aus Gangloffsömmern in Thüringen und<br />
Norman ist Magdeburger – kommt nach der Uni<br />
immer gern hierher. Im Haus gibt es noch zwei<br />
weitere Wohngemeinschaften, leider habe man<br />
aber keinen Kontakt miteinander. „Aber das<br />
könnte man eigentlich auch bald mal ändern“,<br />
so Anne.<br />
Nervig sei, dass die Mauern so dünn sind. Man<br />
die Nachbarn oft höre. „Besonders vor den Prüfungen<br />
könnten die Wände hier ruhig dicker<br />
sein. Manchmal haben die Leute in der Wohnung<br />
über uns den Fernseher sehr laut an“,<br />
meint Anne. Da könne sie sich nur schwer dran<br />
gewöhnen.<br />
Und dann finden sie noch, dass die <strong>LWB</strong> nicht<br />
so ganz WG-orientiert sei. Wegen der Mietverträge,<br />
wo einer für den anderen einspringen<br />
muss. Lieber hätten die drei Studenten einzelne<br />
Verträge. „Das war gerade bei dem letzten Mitbewohner<br />
schwierig. Als er damals eine Mahnung<br />
bekam, waren wir automatisch alle betroffen“,<br />
erzählt Anne.<br />
Studentenfreundlich aber sei, dass die Kaution<br />
so gering ist. Und sie anfangs einen kompletten<br />
Monat mietfrei wohnen konnten.<br />
„Auch am Telefon sind die immer total nett. Hier<br />
ist ja auch ein ServiceKiosk gleich um die Ecke.<br />
Anfangs hatten wir Probleme im Bad, es lief<br />
immer nur heißes Wasser. Herr Wolke kam<br />
sofort und hat uns geholfen. Auch, als an der<br />
Tür eine Schwelle angebracht werden musste.“<br />
Das hätte sie schon beeindruckt, wie schnell<br />
und zuverlässig das immer erledigt wurde.<br />
<strong>VOM</strong> <strong>WERT</strong> <strong>DES</strong> <strong>WOHNENS</strong><br />
DER EINZIGE<br />
MANN IM HAUS<br />
VOLLER FRAUEN<br />
Gerd Kowalka entging nur knapp einer<br />
Zwangsräumung und konnte auf die Hilfe des<br />
<strong>LWB</strong>-Sozialmanagements bauen<br />
Die schwarze Katze streckt sich, macht<br />
einen Buckel, springt vom Stuhl.<br />
Durchs Zimmer schleichend, verfolgt<br />
sie wachsam, was geschieht.<br />
„Meine Nachbarin hat auch eine Katze. Die beiden<br />
Tiere sind oft zusammen. Sogar die Katzen<br />
haben hier ein soziales Umfeld“, erzählt Gerd<br />
Kowalka und lacht leise.<br />
Auf die gute Gemeinschaft im Haus und die netten<br />
Bewohner kommt der 46-Jährige immer wieder<br />
zu sprechen. Untereinander helfe man sich<br />
oft. Unternehme auch viel gemeinsam. „Heute<br />
zum Beispiel, da gabs ’ne Kaffeerunde, hier bei<br />
mir. ,Meine Kaffeetanten‘ sag ich zu denen<br />
immer.“ Dass er derzeit der einzige Mann im<br />
Haus ist, störe ihn überhaupt nicht.<br />
Viel Rot gibt es in Gerd Kowalkas Wohnzimmer.<br />
Rote Sessel, ein rotes Bettsofa, rötlich gemusterte<br />
Vorhänge, rote Teebecher, eine teilweise<br />
rot gestrichene Schrankwand.<br />
Draußen fährt ein Auto vorbei. Im Haus schlägt<br />
eine Tür. Dielen ächzen, leises Stimmengewirr<br />
ertönt.<br />
Ja, hellhörig sei es hier schon. Das sei aber egal.<br />
Auch das Klavier- und Spinettspiel der Mieterin<br />
in der Wohnung über ihm störe ihn nicht. Weil<br />
Gerd Kowalka ja selbst so gern Musik macht.<br />
„Da habe ich echt kein Recht dazu, anderen zu<br />
sagen, dass sie leise sein sollen“, grinst er.<br />
An der Wand hängen drei Gitarren, auf dem<br />
Tisch steht ein kleines Mischpult. „Musik ist<br />
meine Leidenschaft. Ich komponiere auch“,<br />
erzählt er, der gleich in zwei Leipziger Bands<br />
39
spielt. „Immerhin“ und „Speak on“ heißen die<br />
und auftreten tun sie auch, ziemlich oft sogar.<br />
Plötzlich springt der schlanke Mann von seinem<br />
Sessel auf, läuft zum Regal und kommt mit einem<br />
Foto zurück. „Im letzten Sommer haben wir Mieter<br />
hier sogar ein Hofkonzert veranstaltet.“<br />
Seit 1998 lebt Gerd Kowalka in der Hellerstraße<br />
in einer Ein-Raum-Wohnung im Erdgeschoss.<br />
1995 war der gebürtige Berliner nach Leipzig<br />
gegangen. Seine Mutter lebte schon länger in<br />
der sächsischen Großstadt, wollte ursprünglich<br />
einmal ein Studium hier beginnen. Er selbst, der<br />
Werkzeugmacher gelernt hatte und nach der<br />
Wende längere Zeit ohne Arbeit war, konnte in<br />
Leipzig bald als Elektriker Geld verdienen.<br />
„Anfangs bin ich noch viel zwischen Berlin und<br />
Leipzig hin und her gependelt. Eine sehr unruhige<br />
Zeit war das. Dann hab ich mit meiner Mutter<br />
zusammen in einer Wohnung in der Georg-<br />
Schwarz-Straße gelebt. Später sind wir hier in<br />
dieses Haus gezogen. Muttern hat in der gegenüberliegenden<br />
Wohnung gewohnt.“ Die räumliche<br />
Trennung sei gut gewesen, für zwei so<br />
starke Charaktere.<br />
1999 stirbt die Mutter an Krebs. Hinzu kommt<br />
Gerd Kowalkas desolate berufliche Situation.<br />
Seit dem Todesjahr der Mutter ist er durchgängig<br />
ohne Arbeit. Er verschuldet sich. Muss sein<br />
Auto verkaufen. Hat keine Krankenversicherung<br />
mehr. Kann irgendwann die Miete nicht mehr<br />
bezahlen und erhält eine Räumungsklage. Vier<br />
Tage Zeit bleiben ihm, die Wohnung zu räumen.<br />
Da ist er zu nichts mehr in der Lage. Bricht<br />
zusammen.<br />
Da sind es die Hausbewohner, die helfen. Ihm<br />
Halt geben. „Meine Nachbarin hat mich da rausgeholt.<br />
Sie ist mit mir zum Sozialen Dienst<br />
gegangen. Ich konnte einfach nicht mehr. Es<br />
40<br />
ging gar nichts mehr“, erzählt er. „Auch Frau<br />
Trinks vom Sozialmanagement der <strong>LWB</strong> hat mir<br />
damals wahnsinnig geholfen. Der bin ich so<br />
dankbar. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass ich<br />
hier wohnen bleiben konnte.“<br />
Langsam geht es Gerd Kowalka besser. Er<br />
bekommt wieder festen Boden unter den Füßen.<br />
Arbeitslos ist er weiterhin.<br />
Von sich selbst sagt er, dass er sehr viele Neigungen<br />
und eigentlich immer zu tun habe.<br />
Malen würde er auch gerne mehr, aber es fehle<br />
ihm einfach die Zeit.<br />
Im Keller und in der Küche hat er sich kleine<br />
Arbeitsplätze aufgebaut. „Dort habe ich mein<br />
ganzes Werkzeug. Ich bin handwerklich sehr versiert.<br />
Was Langeweile ist, weiß ich nicht“<br />
Da raschelt es an der Wand zur angrenzenden<br />
Wohnung. Ein Geheimzeichen, das nur er und<br />
die Nachbarin kennen. „Ich kann grad nicht.<br />
Später!“ ruft Kowalka.<br />
Nach einer Zeit erzählt er dann noch, dass ihn<br />
im Sommer die Wespen an den Mülltonnen stören<br />
würden. Und der Schimmel in manchen Teilen<br />
des Kellers. „Allerdings hab ich mit Abstand<br />
den besten Kellerraum erwischt. Brauch ich aber<br />
auch, wegen meinem Werkzeug.“<br />
Gerd Kowalka bezahlt für seine 45 Quadratmeter<br />
momentan 369 Euro warm. Ab 2008 soll die<br />
Miete steigen. Das macht ihm und anderen<br />
Hausbewohnern schon jetzt große Sorgen. „Für<br />
mich ist es unvorstellbar, hier irgendwann wegzuziehen.<br />
Auch, weil ich mich hier so anerkannt<br />
fühle. Ich habe in dieser Wohnung zum ersten<br />
Mal in meinem Leben das Gefühl, angekommen<br />
zu sein“, sagt Gerd Kowalka mit fester Stimme<br />
und ernstem Blick. Das glaubt man ihm sofort.<br />
FORUM ZWEI | MAI 2006<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Leipziger Wohnungs- und<br />
Baugesellschaft mbH (<strong>LWB</strong>)<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Prager Straße 21, 04103 Leipzig<br />
Telefon: 0341 – 9 92 42 01<br />
E-Mail: presse@lwb.de<br />
Internet: www.lwb.de<br />
Idee, Konzept, Koordination:<br />
Gregor Hoffmann, Andreas Nowotny (<strong>LWB</strong>)<br />
Texte:<br />
idea Kommunikation<br />
Gregor Hoffmann (<strong>LWB</strong>)<br />
Sibylle Kölmel<br />
Roland Kirbach<br />
Dr. Thomas Nabert<br />
Grafik & Produktion:<br />
idea Kommunikation<br />
Fotos:<br />
Klaus Sonntag, <strong>LWB</strong>, Photocase, Peter Hadasch,<br />
Punctum/Peter Franke, Archiv Pro Leipzig e. V.<br />
© <strong>LWB</strong> 2006