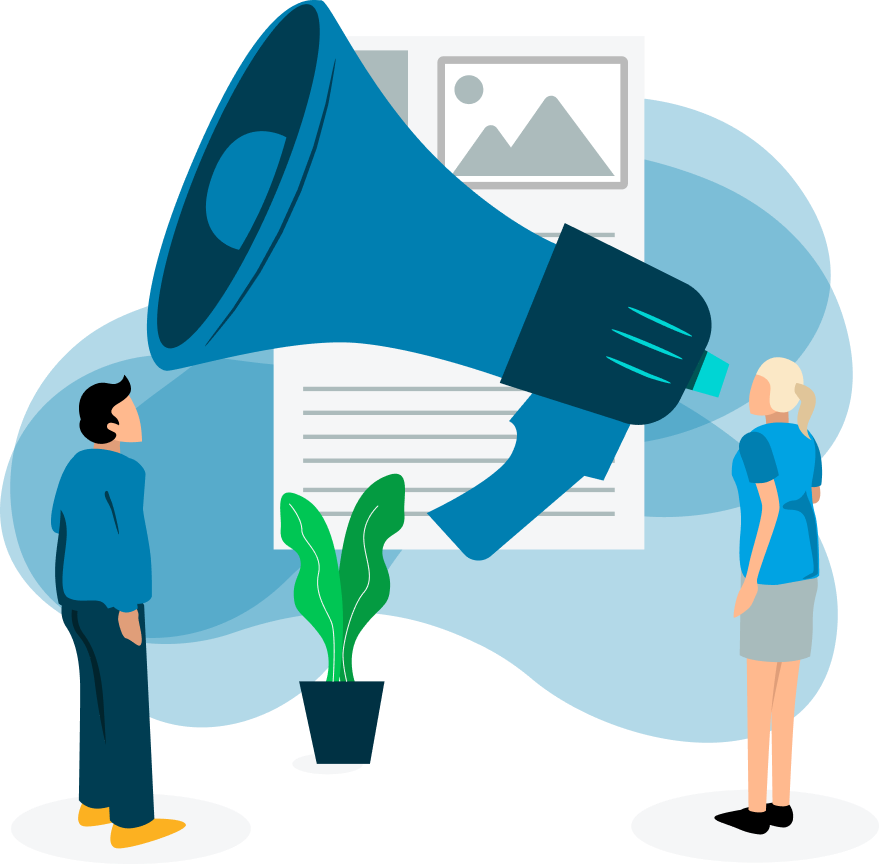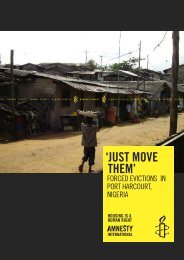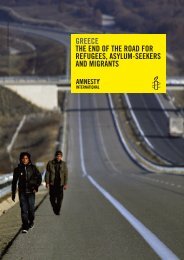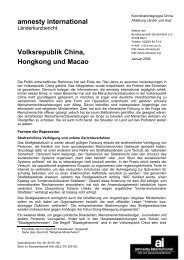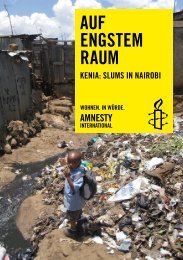amnestyjournal1113neu.pdf (4.13 MB) - Amnesty International
amnestyjournal1113neu.pdf (4.13 MB) - Amnesty International
amnestyjournal1113neu.pdf (4.13 MB) - Amnesty International
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
elaRusDer weißrussische Psychiater Igor Postnovwurde Mitte August festgenommen und indie Nervenheilanstalt Vitebsk eingewiesen,in der er bis zu seiner Festnahme selbstgearbeitet hatte. <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> befürchtet,dass Postnovs Zwangseinweisungpolitisch motiviert sein könnte. Der Psychiaterhatte in den vergangenen Monatenmehrere Videos auf YouTube veröffentlicht,in denen er Mängel im Gesundheitswesenund den Missbrauch öffentlicher Gelderanprangerte. In Weißrussland ist es um dieMeinungsfreiheit schlecht bestellt. Wer eswagt, Kritik an den staatlichen Behörden zuüben, riskiert Gefängnisstrafen.isRael/palästinaIsraelische Soldaten haben Ende August ineinem Flüchtlingslager nördlich von Jerusalemdrei Jugendliche erschossen und 19weitere Menschen schwer verletzt. Auchsechs Kinder mussten mit Schusswundenins Krankenhaus eingeliefert werden. DerVorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden,nachdem israelische Grenzpolizistendas Lager Kalandia gestürmt hatten,um einen palästinensischen Aktivisten festzunehmen.Die israelische Armee erklärte,die Lage sei eskaliert, nachdem Einwohnerdes Lagers die israelischen Beamten mitWurfgeschossen attackiert hätten. Dochörtliche Menschenrechtsorganisationen habengegenüber <strong>Amnesty</strong> dieser Darstellungwidersprochen.veReinigte aRabische emiRateAm 31.Juli sind in den Vereinigten ArabischenEmiraten 18 inhaftierte Regimekritikerin den Hungerstreik getreten, um gegenMisshandlungen zu protestieren. DasOberste Gericht des Landes hatte die MännerAnfang Juli gemeinsam mit 51 weiterenAngeklagten zu langjährigen Haftstrafenverurteilt. Nach Ansicht der Richter hattendie Männer Verbindungen zur verbotenenMuslimbruderschaft unterhalten und einenStaatsstreich geplant. <strong>Amnesty</strong> hatte denProzess als »unfair« und »politisch motiviert«bezeichnet. Die Menschenrechtsorganisationhat die Behörden aufgefordert,die Misshandlungsvorwürfe der Gefangenenzu untersuchen.Ausgewählte Ereignissevom 31.Juli bis6.September 2013.keniaEs ist eine Kampfansage: Kenia ist der ersteStaat der Welt, der seine Zusammenarbeitmit dem <strong>International</strong>en Strafgerichtshofaufkündigen will. Das Parlament hatam 6.September eine entsprechende Erklärungverabschiedet. <strong>Amnesty</strong> hatte dieAbgeordneten zuvor aufgerufen, gegen denAntrag zu stimmen. Die Entscheidung derParlamentarier gilt als Protest: KeniasStaatspräsident Uhuru Kenyatta und seinVize William Ruto sind in Den Haag wegenVerbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt.Beide Politiker sollen nach derPräsidentschaftswahl 2007 zu Gewalt angestachelthaben. Der <strong>International</strong>e Strafgerichtshoferklärte, der Parlamentsbeschlusshabe keinen Einfluss auf die beidenVerfahren.sOmaliaIn Somalia leben Frauen und Mädchen inFlüchtlingslagern in ständiger Angst vorVergewaltigung und anderen Formen sexuellerGewalt. Dies zeigt ein neuer <strong>Amnesty</strong>-Bericht.»Frauen und Kinder, die wegeneines bewaffneten Konflikts oder einer Dürregezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen,müssen in Somalia jetzt noch mitder Furcht vor sexuellen Übergriffen fertigwerden«, sagte <strong>Amnesty</strong>-Expertin DonatellaRovera. Laut Vereinten Nationen ereignetensich allein 2012 mindestens 1.700 Vergewaltigungenin somalischen Flüchtlingslagern.Mindestens 70 Prozent wurden vonbewaffneten Männern in Regierungsuniformenbegangen. 30 Prozent der Opfer warenunter 18 Jahre alt. Selten werden dieÜbergriffe strafrechtlich verfolgt.sRi lankaVier Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegswird Sri Lanka zunehmend autoritärregiert. »Der Krieg mag zwar vorbei sein,aber mittlerweile ist die Demokratie untergrabenund die Rechtsstaatlichkeit erodiert«,sagte Navi Pillay, die UNO-Hochkommissarinfür Menschenrechte, zum Abschlussihres siebentägigen Besuchs desInselstaats Ende August. Die Armee SriLankas hatte 2009 nach mehr als 25 JahrenBürgerkrieg die RebellenorganisationLTTE besiegt. Seither nehmen Schikanendurch Militär und Polizei wieder zu, so Pillay.Kritische Stimmen »werden attackiertoder sogar für immer zum Schweigen gebracht«.Auch <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> zeigtsich über die Repressionen im Land tiefbesorgt.6 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
eRfOlgeTeddybären-Attacke. Mehr als 800 Plüschtiere landeten im Juni 2012 auf belarussischem Boden.RegenbOgenfahnen in litauens hauptstadtlitauen Zum Schluss durften sie doch marschieren: Mit Regenbogenfahnenhaben Ende Juli rund 800 Menschen in der litauischenHauptstadt Vilnius für die Rechte von Schwulen und Lesbendemonstriert. Dabei hatte es zuvor lange so ausgesehen, alskönne die dritte »Baltic Pride«-Parade nicht stattfinden: SiebenMonate mussten die Veranstalter vor Gericht für ihr Demonstrationsrechtstreiten. Vilinius’ konservativer Bürgermeister ArtūrasZuokas hatte alles versucht, um die Parade wegen »SicherheitsinvasiOndeR kuscheltieRebelaRus Die Teddybären-Affäre nimmt ein glückliches Ende: DieBehörden in Belarus (Weißrussland) haben am 28.Juni die Anklagengegen Anton Suryapin und Syarhei Basharimau fallengelassen.Den beiden Belarussen drohten bis zu sieben JahreHaft, weil man ihnen zur Last legte, an einer spektakulären Protestaktionbeteiligt gewesen zu sein: Zwei junge Schweden hattenim Juli 2012 ein einmotoriges Flugzeug gechartert und warendamit illegal in den belarussischen Luftraum eingedrungen.Die Hobbypiloten schafften es fast bis zur Hauptstadt Minskund warfen unterwegs 879 Teddybären über Bord. In ihren Tatzenhielten die Stofftiere kleine Protestschilder, auf denen Parolenwie »Meinungsfreiheit für alle!« zu lesen waren. Ausgedachthatte sich die Aktion die schwedische PR-Agentur Studio Total.»Einen Diktator kann man fürchten oder hassen«, sagten dieschwedischen Werbeprofis nach ihrem Bären-Stunt. »Dochwenn die Leute anfangen, über ihn zu lachen, sind seine Tagegezählt.« Der belarussischen Regierung war freilich nicht zumLachen zumute. Alexander Lukaschenko, der die ehemaligeSowjetrepublik seit gut zwei Jahrzehnten autokratisch regiert,schasste den Chef der Luftwaffe sowie den obersten Grenzschützerdes Landes und ließ die schwedische Botschaft schließen.Den wahren Preis mussten allerdings andere tragen: Der20-jährige Journalistik-Student Anton Suryapin wurde wenigeTage nach dem Abwurf der Bären verhaftet und mehr als einenMonat in einer Gefängniszelle des Geheimdienstes festgehalten.Suryapin hatte als erster Fotos der abgeworfenen Plüschtiere imInternet veröffentlicht. Der Immobilienmakler Syarhei Basharimauwurde am 6.Juli 2012 unter dem Verdacht festgenommen,den Schweden beim illegalen Überqueren der Grenze geholfenzu haben. Er hatte zwei Kollegen der schwedischen Piloten eineWohnung in Minsk vermittelt. Die schwedischen Initiatoren hattenhingegen stets erklärt, dass die beiden Angeklagten vondem geplanten Flug nichts gewusst hatten. Anton Suryapin hatsich bei <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> für die Unterstützung bedankt.Foto: Studio Total /EPA/pabedenken« aus der Innenstadt zu verbannen. Doch das ObersteVerwaltungsgericht kippte schließlich das Verbot der Stadt.Auch in diesem Jahr fand die Parade unter massivem Polizeischutzstatt. Gegendemonstranten versuchten, die Tribüne zustürmen, 28 Personen wurden festgenommen. Die SchwulenundLesbenparade erregte in diesem Jahr international besondersviel Aufmerksamkeit, weil die ehemalige SowjetrepublikLitauen am 1.Juli den EU-Ratsvorsitz übernommen hatte.eRfOlge7
Sandstrände und Kokospalmen. Die Malediven sind der Urlaubstraum für Hochzeitspaare. Kaum ein Tourist weiß, dass nebenan die Scharia herrscht.pRÜgel im paRadiesDer Richterspruch hatte die Welt empört: Auf den Maledivensollte eine 15-Jährige ausgepeitscht werden, weil sie Sex vorder Ehe hatte. Die Jugendliche war zuvor jahrelang von ihremStiefvater missbraucht worden. Rund um den Globus solidarisiertensich Millionen Menschen mit der jungen Frau. Nun hatder Oberste Gerichtshof des Landes das Urteil aufgehoben.Aus der Luft wirken die Malediven fast unwirklich schön. BeimLandeanflug schimmert der Indische Ozean türkisblau in derSonne und die dicht bewucherten Koralleninseln liegen wieschwimmende Oasen im Meer. Doch schon auf dem Flughafender Hauptstadt Malé wird das Bild vom Inselparadies brüchig,denn einheimische und ausländische Passagiere gehen dort getrennteWege: Die Touristen werden auf eine der 87 luxuriösenRessort-Inseln geschippert, wo ihnen Alkohol ausgeschenkt undSchweinefleisch serviert wird. Die Einheimischen leben hingegenstrikt getrennt von den Feriengästen auf den restlichen 220bewohnten Inseln, auf denen die islamische Scharia herrscht.Auch in Sachen Sexualmoral wird auf den Malediven mitzweierlei Maß gemessen. Immer wieder werden einheimischeFrauen zu Prügelstrafen verurteilt, weil sie Sex vor der Ehe hatten.In diesem Jahr sorgte ein Urteil erstmals international fürWirbel: Eine 15-Jährige sollte öffentlich ausgepeitscht werden,weil sie mit einem Mann geschlafen hatte, mit dem sie nichtverheiratet war. Was den Fall besonders brisant machte: DasMädchen war ein Missbrauchsopfer. Weltweit solidarisiertensich Millionen Menschen mit der jungen Frau. Ende August hobder Oberste Gerichtshof des Landes das Urteil auf.Die Minderjährige war ins Visier der Sittenwächter geraten,nachdem auf dem Grundstück ihrer Familie im Juni 2012 eintoter Säugling gefunden worden war. Schnell stellte sich heraus:Die 15-Jährige war jahrelang von ihrem Stiefvater vergewaltigtworden. Nachdem sie durch den Missbrauch schwangergeworden war, tötete der Stiefvater das Neugeborene und verscharrteden Leichnam im Garten. Der Mann ist mittlerweile inHaft, ihm drohen bis zu 25 Jahre Gefängnis. Doch auch seineStieftochter landete auf der Anklagebank. Denn sie erzählte denermittelnden Polizisten nicht nur von ihrem Missbrauch, sondernvertraute ihnen auch an, dass sie mit einem anderen Manneinvernehmlichen Geschlechtsverkehr hatte. 100 Peitschenhiebeund acht Monate Hausarrest lautete im Februar 2013schließlich das Urteil.Es folgte eine beispiellose weltweite Solidaritätskampagne,die die maledivische Regierung am empfindlichsten Punkt traf:dem Tourismus, der den größten Wirtschaftszweig des Landesdarstellt. Aktivisten schalteten Anzeigen in Reisemagazinen,riefen im Internet zum Boykott des Urlaubsziels auf und sammeltenmehr als zwei Millionen Unterschriften. Auch <strong>Amnesty</strong><strong>International</strong> setzte sich für das verurteilte Mädchen ein.Die globale Empörung zeigte Wirkung: Die Regierung derMalediven zog schließlich selbst vor Gericht, um im Namen desMädchens Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Mit Erfolg:Der Oberste Gerichtshof kassierte den Schuldspruch. Das »Geständnis«der jungen Frau sei nichtig, so die offizielle Begründung,weil sie während des Verhörs schwer traumatisiert unddamit nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Das Mädchen istnun in Sicherheit – doch die Prügelstrafe existiert auf den Maledivennoch immer.Text: Ramin M. NowzadFoto: picture alliance8 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
einsatz mit eRfOlgWeltweit beteiligen sich TausendeMenschen mit Appellschreiben an den»Urgent Actions«, den »Briefen gegendas Vergessen« und an Unterschriften -aktionen von <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>. Dassdieser Einsatz drohende Menschenrechtsverletzungenverhindert und Menschenin Not hilft, zeigen diese Beispiele.fRauenRechtleRin in fReiheittunesien Die junge tunesische FeministinAmina Sboui ist wieder in Freiheit. Polizistenhatten die 18-Jährige am 19.Maifestgenommen, nachdem sie in der StadtKairouan den Schriftzug »Femen« aufeine Friedhofsmauer gesprüht hatte. »Femen«ist eine in Kiew gegründete Frauenrechtsgruppe,die vor allem durch ihreNach wochenlanger Haft entlassen.Die 18-jährige Feministin Amina Sboui.Oben-ohne-Aktionen bekannt gewordenist. Sboui wollte mit dem Graffito gegendie frauenverachtende Politik der Salafistenprotestieren. Seit der tunesischen Revolutionhat sich die Stadt Kairouan zueiner Hochburg der radikalen Islamistenentwickelt. Sboui wurde Anfang Augustnach wochenlanger Haft aus dem Gefängnisentlassen. <strong>Amnesty</strong> hatte sich mit einerweltweiten Online-Aktion für ihreFreilassung eingesetzt. Im Oktober wirdsich Sboui in Tunis vor Gericht wegen»Entweihung eines Friedhofs« verantwortenmüssen. Ihr droht eine Geldbuße.anwältin aus haft entlassensudan Die sudanesische Anwältin undAktivistin Asma Ahmed, die im Mai 2013vom sudanesischen Geheimdienst NSSfestgenommen worden war, ist seit dem11.Juni wieder auf freiem Fuß. Mehr alsFoto: Med Amine Benaziza/Reuterseinen Monat lang war Asma Ahmed ohneAnklage festgehalten worden. Sie befandsich lange Zeit in Einzelhaft und wurdemehrmals verhört. Als Anwältin hatteAsma Ahmed zahlreiche politische Häftlingeund gewaltlose politische Gefangenevor Gericht vertreten. Sie ist Mitgliedder Oppositionspartei »Sudan Peoples’Liberation Movement-North« (SPLM-N),die im September 2011 von der sudanesischenRegierung verboten wurde. IhreInhaftierung fand allem Anschein nachim Rahmen einer Festnahmewelle statt,die sich gegen SPLM-N-Aktivisten, Intellektuelleund Religionsführer richtete.blOggeR auf fReiem fussOman Der omanische Blogger Sultan al-Saadi wurde am 20.August aus der Haftentlassen, nachdem er 23 Tage ohne Anklagean einem unbekannten Ort in Einzelhaftfestgehalten worden war. Al-Saadiwar am 29.Juli an einer Tankstelle imNorden des Landes von 14 bewaffnetenMännern, zwölf davon in Zivil, festgenommenworden. Die Männer erklärten nicht,wer sie waren oder warum sie ihn festnahmen.Im Gefängnis durfte al-Saadiweder seinen Anwalt, noch seine Familiekontaktieren. Der 33-Jährige wurde mehrfachmisshandelt, unter anderem indemman ihn zwang, sich beim Verlassen seinerZelle eine schwarze Tüte über denKopf zu ziehen. Zudem behaupteten dieGefängniswärter fälschlicherweise, seineFamilie habe ihn aufgegeben und um seineInhaftierung gebeten. In Verhören wurdeal-Saadi zur Last gelegt, auf Twitterdie Regierung Omans kritisiert und mehrDemokratie gefordert zu haben.eX-ministeR wiedeR fReituRkmenistan Sieben Monate wurde er ineiner Drogenentzugsklinik festgehalten,seit Anfang Juli ist er wieder in Freiheit:Der ehemalige turkmenische Minister fürTourismus und Kultur, Geldimurat Nurmuhammedow,war am 5.Oktober 2012in der Hauptstadt Aşgabat festgenommenund in eine Entzugsklinik in der ProvinzDaşoguz eingeliefert worden. Nachforschungenvon <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> ergabenkeinerlei Hinweise auf eine Drogenabhängigkeitdes Ex-Ministers. Möglicherweiseist er durch seine Kritik an derturkmenischen Regierung ins Visier derBehörden geraten. Dies wäre nicht das ersteMal: Im Dezember 2011 hatte er ineinem Radio-Interview die turkmenischeRegierung scharf kritisiert. Wenige Tagespäter wurde das Bauunternehmen seinerFamilie von den Behörden geschlossen.hungeRstReik beendetmaROkkO Ali Aarrass, der in der Nähe dermarokkanischen Hauptstadt Rabat inhaftiertist, hat seinen Hungerstreik am7.August beendet, nachdem ihm die Behördenversichert hatten, seinen Forderungennachzukommen. Der 51-Jährige,der die belgische und die marokkanischeStaatsbürgerschaft besitzt, war am10.Juli in den Hungerstreik getreten,nachdem Wärter seine Zelle durchwühltund private Dokumente beschlagnahmthatten, darunter auch Briefe seiner Familieund Postkarten von Unterstützern. Danachverweigerte man ihm Rechte, dieGefangenen zustehen, wie Telefongespräche,die Möglichkeit zu duschen undHofgang. Seit dem 25.Juli hatte Aarrassden Hungerstreik verschärft und auchkeine Flüssigkeit mehr zu sich genommen.Im Jahr 2010 wurde er von spanischenBehörden als Terrorverdächtiger anMarokko ausgeliefert. Er soll in der Haftschwer misshandelt worden sein.Protest vor den Gefängnismauern.Unterstützer von Ali Aarrass in Sale, Marokko.Foto: Abdelhak Senna /AFP /Getty ImageseRfOlge9
panORamaFoto: Fabrice Coffrini /AFP/Getty Imagesschweiz: flÜchtlinge mÜssen dRaussen bleibenEine kleine Stadt sorgt für große Empörung: In dem Schweizer Ort Bremgarten im Kanton Aargau leben rund 6.500Einwohner – und seit Anfang August auch 23 Asylbewerber. Doch die Bewohner der neu eingerichteten Asylunterkunftmüssen harte Regeln befolgen: Die Flüchtlinge dürfen »sensible Zonen« der Stadt ohne Genehmigung nicht alleinbetreten. Dazu zählen: Schulplätze, Sportanlagen und auch das Freibad des Ortes. Bremgartens OberbürgermeisterRaymond Tallenbach von der rechtsliberalen FDP rechtfertigte die Verbote als »Vorsichtsmaßnahmen, damit es nichtzu sexuellen Belästigungen von Schülerinnen oder zu Drogenverkäufen durch Asylsuchende kommt«. <strong>Amnesty</strong> hat dieMaßnahmen scharf verurteilt. Ursprünglich sollten auch die Bibliothek, das Altersheim, Kirchen und Kirchvorplätzefür die Flüchtlinge tabu sein, doch nach internationalem Protest ruderten die Behörden zurück. »Die Schweiz führtRestriktionen ein, die an die Apartheid erinnern«, titelte etwa die britische Tageszeitung »The Independent«.10 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
nigeRia: eRsteR afRikanischeR staat RatifizieRt unO-waffenhandelskOntROllveRtRagNigeria ist der erste afrikanische Staat, der den globalen Waffenhandelskontrollvertrag der UNO (Arms TradeTreaty, ATT) ratifiziert hat. Das Abkommen soll verhindern, dass Waffenexporte zu Völkermord undKriegsverbrechen beitragen. Sieben Jahre lang hatten die Mitgliedsstaaten der UNO über den Vertrag verhandelt.<strong>Amnesty</strong> hatte sich für das Abkommen stark gemacht. Im April dieses Jahres hat die UNO-Vollversammlungden Vertrag schließlich mit breiter Mehrheit angenommen: 154 der 193 Mitgliedsstaaten stimmten dafür,23 Länder enthielten sich. Nur Syrien, Iran und Nordkorea votierten gegen den Vertrag. Das Abkommen trittallerdings erst in Kraft, wenn es mindestens 50 Staaten ratifiziert haben. Dies dauert in der Regel zwei bisdrei Jahre. Bisher haben neben Nigeria lediglich drei weitere Länder den Vertrag ratifiziert: Island, Guyana undder Inselstaat Antigua und Barbuda. Deutschland ist auf gutem Weg, es auch noch in diesem Jahr zu schaffen:Im Juni hat der Bundestag den Vertrag abgesegnet, nun müssen noch Bundesratund Europäisches Parlament zustimmen.Foto: Sven Torfinn / laifpanORama11
nachRichtenDer Staat als Henker. Demonstranten fordern auf dem »Weltkongress gegen die Todesstrafe« Mitte Juni in Madrid ein Ende staatlicher Exekutionen.stOp cRime, nOt livesBei Karibik denkt man an Strand, Palmenund Reggae, aber nicht an Hinrichtungen.Und doch gehören die englischsprachigenKaribik-Staaten zu den Verfechtern derTodesstrafe. Dagegen protestiert <strong>Amnesty</strong><strong>International</strong> am 10.Oktober, dem Welttaggegen die Todesstrafe.Trotz positiver Entwicklungen in den vergangenenfünfzig Jahren leben immernoch zwei Drittel der Menschheit in einemStaat, der hinrichtet. Als die UNO-Generalversammlung zuletzt 2012 übereine Resolution zur weltweiten Aussetzungder Todesstrafe abstimmte, votiertendie Staaten der englischsprachigen Karibikgeschlossen dagegen. Politiker undJustizbehörden der Region propagierendie Todesstrafe als Lösung für das Problemsteigender Mordraten.In allen Ländern der englischsprachigenKaribik ist die Todesstrafe in den Gesetzbüchernverankert und kann für Mord– und zum Teil auch für Hochverrat, Terrorakteoder militärische Straftaten – verhängtwerden. Hingerichtet werden jedochnur wenige Menschen. Dies ist vorallem darauf zurückzuführen, dass dieTodesstrafe in den meisten Ländern nachfünf Jahren in eine lebenslange Haftstrafeumgewandelt werden kann. <strong>Amnesty</strong>beobachtet mit Sorge, dass mehrere Länderin den vergangenen Jahren versuchthaben, Exekutionen auszuführen und einigenGefangenen schon den Hinrichtungsbefehlvorlesen ließen. Auch wennderen Anwälte die Hinrichtungen rechtzeitigstoppen konnten, ist eine solcheErfahrung für die Gefangenen und ihreAngehörigen traumatisch.Was sind die Probleme aus menschenrechtlicherSicht? Zum einen sinddie Justizsysteme in den Ländern derenglischsprachigen Karibik schlecht ausgestattet:Es fehlt an Personal, Rechtsbeiständen,Geschworenen und Zeugenschutzprogrammen.In Kombination mitKorruption und einer ineffektiven Polizeisind ordentliche Gerichtsverfahren deshalboft nicht möglich. In mehreren Fällenwurden letztlich für unschuldig befundeneAngeklagte unnötig lange inUntersuchungshaft festgehalten oderlandeten sogar für Verbrechen, die sienicht begangen hatten, im Todestrakt.Problematisch ist auch, dass die geis -tige Gesundheit der Angeklagten in denGerichtsprozessen nur unzulänglich überprüftwird. <strong>International</strong>e Standards verbietenHinrichtungen von Gefangenenmit geistiger Einschränkung. Laut derMenschenrechtsorganisation »DeathPenalty Project«, die vor allem in derKaribik aktiv ist, litten zwischen Februar2008 und Mai 2012 mindestens siebenzum Tode verurteilte Gefangene in Tri -nidad und Tobago an einer geistigen Behinderung.Besonders kritisch sieht <strong>Amnesty</strong>,dass in Barbados sowie in Trinidadund Tobago für Mord zwingend die Todesstrafevorgeschrieben ist, sodass die Tat -umstände nicht berücksichtigt werden.Der UNO-Menschenrechtsausschuss hatfestgestellt, dass dies gegen den <strong>International</strong>enPakt für bürgerliche und politischeRechte verstößt.Auf diese Missstände in den Staatender englischsprachigen Karibik macht<strong>Amnesty</strong> am 10. Oktober, dem Welttaggegen die Todesstrafe, aufmerksam. Inenger Zusammenarbeit unter anderemmit dem 2011 entstandenen Netzwerk»Greater Caribbean for Life« plant <strong>Amnesty</strong>verschiedene Aktionen, die die Zivilgesellschaftvor Ort in ihrem Kampf gegendie Todesstrafe unterstützen sollen.Text: Annette HartmetzSiehe auch Seite 82/83.Foto: Dani Pozo/AFP/Getty Images12 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
»Von einem Konflikt im Regenwald würde sonstniemand erfahren.« Eriberto Gualinga drehteunter anderem den von <strong>Amnesty</strong> koproduziertenDokumentarfilm »Kinder des Jaguar«.pORtRäteRibeRtO gualingaveRteidigeR desRegenwaldsIn Ecuador wehrt sich die indigene Gemeinschaft der Sarayakuseit Jahren gegen Unternehmen, die auf ihrem Gebiet nach Ölsuchen wollen. Eriberto Gualinga gehört zu den Sarayaku undist ein preisgekrönter Filmemacher.Eigentlich würde Eriberto Gualinga gern einen unpolitischenFilm drehen. Einen Film über das Leben im AmazonasgebietEcuadors. Oder einen Film über Musik, schließlich ist Gualingaselbst Musiker. Doch dazu hat der 35-Jährige keine Zeit. »DieSituation erlaubt es mir nicht, andere Themen zu bearbeiten.«Gualinga gehört zur indigenen Gemeinschaft der Sarayaku.Die Gemeinde hat rund 1.200 Mitglieder und lebt im Amazonasgebietim Osten Ecuadors, am Ufer des Bobonaza-Flusses.Für die Sarayaku sind der Fluss und der dichte Regenwald, derihn umgibt, die Existenzgrundlage. Doch seit der ecuadorianischeStaat vor mehr als zehn Jahren Konzessionsrechte anÖlunternehmen vergeben hat, ist diese in Gefahr.»In den vergangenen 30 Jahren gab es immer wieder Bestrebungen,auf unserem Gebiet Bodenschätze abzubauen«,sagt Gualinga. »Wir waren deshalb immer aufmerksam.« Als imJahr 2002 die ersten Hubschrauber von Ölunternehmen landeten,änderte sich die Situation schlagartig: Innerhalb wenigerMonate wurden Hunderte Brunnen angelegt und mehr als 1,4Tonnen Sprengstoff vergraben. Private Sicherheitskräfte undMilitäreinheiten sollten dafür sorgen, dass die Sucharbeiten reibungslosverliefen. Es folgten Monate des Protests. Die Sarayakustellten Sicherheitskräfte und Arbeiter zur Rede und blockiertenZufahrtswege, um sie an ihrer Arbeit zu hindern.Gualinga war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt und studierteKommunikations- und Filmwissenschaft. »Als die Protestebegannen, gab es eine Möglichkeit für mich zu filmen.« Die Videokamerawurde für ihn zu seinem wichtigsten Werkzeug. Denersten Film stellte er 2003 fertig. Schon bald berichteten Medienüber den Widerstand der Sarayaku, NGOs setzten sich fürsie ein. »Video, Internet und die Presse sind in unserem Kampfsehr wichtig«, sagt Gualinga. »Von einem Konflikt, der sich imRegenwald abspielt, würde sonst niemand etwas erfahren.«Die Sarayaku gingen mit ihrem Anliegen jedoch nicht nur andie Medien, sondern auch vor Gericht. Die juristische Auseinandersetzungmit dem Staat führte sie schließlich bis vor denInteramerikanischen Menschenrechtsgerichtshof in Costa Rica.In einem wegweisenden Urteil sprachen die Richter Ecuador imJuli 2012 schuldig, die Rechte der Sarayaku auf Eigentum undkulturelle Identität verletzt zu haben. In Gualingas Film »DieKinder des Jaguar« hat er diesen Erfolg festgehalten. Die halbstündigeDokumentation wurde von den Sarayaku und <strong>Amnesty</strong>gemeinsam produziert und gewann 2012 im Rahmen des »NationalGeographic All Roads Film Festival« einen Preis.Wenn Gualinga seine Filme im Ausland zeigt, ist er nichtnur Regisseur, sondern auch Sprecher der Gemeinschaft. Deröffentliche Druck sei weiterhin notwendig, denn bis heute istdie ecuadorianische Regierung ihren Verpflichtungen aus demUrteil nicht nachgekommen. Der Staat hat weder eine umfassendeRegelung zur Konsultation von indigenen Gemeinschaftenverabschiedet, noch den lebensgefährlichen Sprengstoffvollständig entfernt. Stattdessen hat die Regierung im November2012 eine weitere Runde zur Vergabe von Konzessionsrechtenausgeschrieben. Und erst kürzlich hat die Regierung angekündigt,im Yasuni-Nationalpark nach Öl zu bohren. »Ich habemeine Arbeit noch nicht beendet«, sagt Gualinga. Auch deshalbbringt er Jugendlichen bei, wie man mit der Kamera umgeht.Vor allem aber hofft er, dass der Widerstand der Sarayakuirgendwann nicht mehr notwendig sein wird.Text: Ralf RebmannDen Film »Kinder des Jaguar« können Sie sich in unserer iPad-Appansehen: www.amnesty.de/appFoto: Ralf RebmannnachRichten | pORtRät13
ROma-kindeR ingetRennten klassenSepariert. Roma-Kinder in einer Sonderklasse im slowakischen Plavecký Štvrtok.tropole Košice für Schlagzeilen: Dort ließdie Stadtverwaltung Mitte Juli eine zweiMeter hohe Mauer errichten, um ein großesRoma-Ghetto vom Rest der Stadt zutrennen. Košice ist in diesem Jahr gemeinsammit Marseille KulturhauptstadtEuropas. Die EU-Kommission fordert densofortigen Abriss der Mauer.Foto: <strong>Amnesty</strong>us-whistleblOweR manning zu 35 jahRen haft veRuRteiltslOwakei In der Slowakei hat ein neuesSchuljahr begonnen. Und noch immerwerden in dem osteuropäischen Land diemeisten Roma-Kinder in separaten Klasseneingeschult. Die ethnische Minderheitder Roma wird im slowakischen Bildungswesenseit Jahren systematisch diskriminiert:43 Prozent aller jungen Romawerden getrennt von der Mehrheitsbevölkerungunterrichtet, wie eine Studie derUNO im vergangenen Jahr dokumentierte.<strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> macht in einemneuen Bericht die slowakische Regierungfür diesen Missstand verantwortlich.Obwohl die Diskriminierungspraxisillegal sei, bleibe die Regierung des Landesuntätig. Schätzungen zufolge lebenrund 500.000 Roma in der Slowakei, dassind gut zehn Prozent der Gesamtbevölkerung.Die meisten Roma leben in Armutund werden gesellschaftlich ausgegrenzt.Zuletzt sorgte die ostslowakische MeusaEs ist eine harte Strafe. Und wohlauch ein Exempel, das Nachahmer abschreckensoll: Ein US-Militärgericht inFort Meade hat den Obergefreiten BradleyManning am 21. August zu 35 JahrenHaft verurteilt. Bei guter Führung kannManning frühestens in neun Jahren aufBewährung freikommen. Zudem wurdeder 25-Jährige unehrenhaft aus der Armeeentlassen. Manning soll 2010 rund700.000 vertrauliche Depeschen und Militärunterlagenan die EnthüllungsplattformWikileaks weitergeleitet haben. DieGeheimdokumente beleuchten unter anderemVergehen des US-Militärs in Afghanistanund im Irak. Manning, dermittlerweile erklärt hat, fortan als Frau lebenzu wollen, hat US-Präsident Obamanach der Urteilsverkündigung um Begnadigunggebeten. <strong>Amnesty</strong> unterstützt dasGnadengesuch: »Statt Manning ins Gefängniszu stecken, wäre die US-Regierungbesser beraten, die schweren Menschenrechtsverletzungenzu untersuchen,die US-Beamte im Namen der Terrorbekämpfungverübt haben«, sagte <strong>Amnesty</strong>-Expertin Widney Brown.Foto: <strong>Amnesty</strong>Lebensgefahr. Schwulenaktivist in Yaounde.schwulen-aktivist in kameRungefOlteRt und eRmORdetkameRun Es war ein grausiger Fund: Freunde habenden Journalisten und Schwulenrechtsaktivisten EricLembembe Mitte Juli tot in seiner Wohnung in KamerunsHauptstadt Yaounde entdeckt. Seine Leiche warvon schweren Folterspuren gezeichnet, wie die MenschenrechtsorganisationHuman Rights Watch berichtet.Genick und Füße waren zerschmettert, zudemwies der Leichnam Brandspuren auf, die offenkundigmit einem Bügel eisen herbeigeführt worden waren.Nur wenige Wochen vor seinem gewaltsamen Tod hatteLembembe öffentlich vor homo phoben Schlägertruppsgewarnt. Die Anwältin Alice N’kom, die LembembesFamilie vertritt, bezweifelt, dass Kameruns Behördenernsthafte Anstrengungen unternehmen, den Fallaufzuklären.14 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Barbara Tiefenbacher hat am Institut für Romistikder Prager Karlsuniversität die Geschichte, Kulturund Sprache der Roma erforscht. Derzeit arbeitetdie Wissenschaftlerin am Institut für Soziologieder Universität Wien.inteRviewbaRbaRa tiefenbacheR»ROma-feindschaftist cOmmOn sense«In Tschechien ist es im Juli und August mehrfach zu gewalt -tätigen Angriffen auf Roma gekommen. Hunderte Rechts -radikale versuchten, mit Steinen und Feuerwerkskörpern invon Roma bewohnte Siedlungen vorzudringen. Ein Gesprächmit der Wissenschaftlerin Barbara Tiefenbacher.Hatten Sie mit dieser Eskalation gegen Roma gerechnet?Nein. Es gibt zwar in Tschechien seit vielen Jahren einenlatenten Rassismus gegen diese Menschen, dass es zu regelrechtenAntiroma-Märschen kommt, war jedoch nicht zu er -warten. Diese Proteste entstanden dennoch nicht spontan.Sie waren also organisiert?Ja, anders ist nicht zu erklären, dass in acht Städten gleichzeitigmobilisiert wurde. Rechtsextreme machen schon langegegen Roma mobil. Die Nationalpartei »Narodní Strana« verbreitetevor einigen Jahren Wahlplakate, auf denen ein Flugzeugmit der Aufschrift »Air India Express« zu sehen war, verbundenmit den Worten »Zigeuner ins…«. Darunter stand »ins Flugzeug«.Das ist eine Anspielung auf »ins Gas« und zugleich eineAufforderung zur Deportation, da Roma angeblich keine Tschechensind. Das ist absurd. Angehörige von Roma-Communitiessind tschechische Staatsbürger. Viele kamen nach dem ZweitenWeltkrieg wegen der gesteuerten Binnenmigrationspolitik in dietschechischen Gebiete.Aber offensichtlich kommt die Propaganda an.Ja, Teile der Bevölkerung beteiligen sich sogar an den Angriffen.Eine Augenzeugin berichtete aus Budweis, dass Familiendie Mobilisierungen zu Ausflügen nutzen: Da gehen Elternmit ihren Kindern hin, essen, trinken, verfolgen das Spektakelund jubeln den Rechtsradikalen kräftig zu. Man kann in Tschechienüber Roma schimpfen wie über das schlechte Wetter. DieFeindschaft gegenüber diesen Menschen ist Common Sense.Wie ist diese aggressive Stimmung zu erklären?Das hängt mit der zunehmend schlechter werdenden wirtschaftlichenLage zusammen. Roma gelten als Sozialschmarotzer.Es zirkulieren Gerüchte, sie bekämen höhere Sozialhilfe.Das stimmt natürlich nicht. Dazu kommen alte Stereotype, diesich gehalten haben. Roma sind ja von den Nationalsozialistenals »Asoziale« in Konzentrationslager deportiert und ermordetworden.Setzt sich die Zivilgesellschaft für Roma ein?Ja, und zwar mehr als in der Slowakei oder in Ungarn. Menschenaus der Roma-Community und Nicht-Roma stellen sichgemeinsam gegen rechtsradikale Aufmärsche. Auch die katholischeKirche ist mittlerweile aktiv, der Pilsener Bischof FrantišekRadkovský hat sich an einer Kundgebung beteiligt. Aber es sindeinzelne Personen und Organisationen, deren Kapazitäten geringsind.Wie reagiert die Regierung?Zurückhaltend. Man kann keine Wähler gewinnen, wennman sich für Roma und gegen Rassismus ausspricht. PräsidentMiloš Zeman hat jüngst die Parole »Tschechien den Tschechen«kritisiert und in die Nähe der Nazi-Parole »Juden raus« gerückt.Aber die politischen Parteien sind vorsichtig.Haben die Roma Alternativen?Verfolgte Angehörige von Roma-Communities haben in anderenEU-Staaten kein Recht auf Asyl. Wenn sie dennoch kommen,haben sie kein Anrecht auf Unterstützung, weil davon ausgegangenwird, dass es diese Probleme innerhalb der EU nichtgibt. Dabei flüchten sie, weil sie rassistisch verfolgt werden.Fragen: Wolf-Dieter VogelFoto: privatnachRichten | inteRview15
Solidarität mit dem Whistleblower. Mit einer Edward-Snowden-Maske demonstriert ein Aktivist vor dem Bundeskanzleramt in Berlin.gläseRneR menschDie Dokumente des Whistleblowers EdwardSnowden lassen erahnen, dass dieGeheimdienste das Recht auf Privatsphäreund informationelle Selbstbestimmungtäglich millionenfach missachten.Vieles ist unklar: In welchem Ausmaßgreift der US-Geheimdienst NSA aufInternetdaten zu, welche Programmesetzt er zur Überwachung ein, und wenhat er im Visier? Fest steht, dass die NSAan Daten von Google, Facebook, Microsoft,Yahoo und Apple gelangen kann.Hier geht es nicht nur um einen politischenSkandal. Es geht um das Menschenrechtauf Privatsphäre und dasRecht auf informationelle Selbstbestimmung.Danach darf jeder Mensch selbstentscheiden, welche persönlichen Datener für welche Verwendung freigibt. Staatendürfen nur auf der Basis eines Gesetzesin dieses Recht eingreifen. Der Eingriffmuss zudem erforderlich sein fürdie Erreichung eines legitimen Ziels. Esreicht nicht aus, dass eine Überwachungsmaßnahmenützlich sein könnte, um eineterroristische Gefahr abzuwehren: Siemuss notwendig sein.Zwei Entwicklungen der vergangenenzehn Jahre erschweren einen effektivenSchutz vor ungesetzlicher Überwachung:Weil soziale Netzwerke intensiv genutztwerden, sind massenhaft persönliche Datenverfügbar. Der Datentransfer machtdabei nicht an nationalen Grenzen Halt.Zum anderen haben westliche Geheimdiensteseit dem 11.September2001 immer weitergehende Befugnisseund Kapazitäten zur Abwehr terroristischerGefahren erhalten. Die parlamentarischenKontrollmechanismen sind dieserEntwicklung nicht angepasst worden.Dies gilt für die USA, aber auch fürDeutschland, wie der unrühmliche Ausgangdes BND-Untersuchungsausschusseszeigt. Mangels konkreter Einzelfall -informationen scheidet auch eine wirksamegerichtliche Kontrolle fast immer aus:Das geheime amerikanische FISA-Gericht,das die NSA-Tätigkeiten überwachensoll, hat keinerlei Ermittlungskompetenzen.Alle nötigen Informationen werdenvon der NSA und dem Justizministeriumgeliefert.Weil sich die Geheimdienste also einerAufklärung entziehen können, werdensich NSA und BND weiter hinter pauschalenErklärungen verstecken, alleMaßnahmen seien gesetzeskonform. Wasbleibt, ist der Verdacht, dass die Privatsphäretäglich millionenfach verletztwird, und die Wut, dieser Ausspähungschutzlos ausgeliefert zu sein. Die Bedrohungder Privatsphäre hat aber auch Konsequenzenfür andere Menschenrechte:Wer fürchten muss, zum gläsernen Menschenzu werden, wird sich auch bei politischerTeilhabe zurückhalten.Dass die Öffentlichkeit überhaupt einenVerdacht haben kann, verdankt sieEdward Snowden. Er ist deshalb in denUSA inzwischen wegen Geheimnisverratsund anderer Delikte angeklagt, sein Passwurde annulliert. Dabei verdienen Whistleblowernicht nur deshalb Schutz, weilsie im Interesse einer demokratischenGesellschaft Gesetzesverstöße und Missständebekannt machen. Die Enthüllungvon Missständen im öffentlichen Interesseist gleichzeitig vom Menschenrechtauf Meinungsfreiheit gedeckt.Der Fall Snowden zeigt zwei besorgniserregendeEntwicklungen der US-amerikanischenPolitik in den vergangenenzehn Jahren: Im Kampf gegen den Terrorismusheiligt der Zweck die Mittel, währendGesetzesverstöße der eigenen Behördennicht aufgearbeitet werden.Text: Maria ScharlauFoto: Kay Nietfeld/dpa/pa16 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
kOlumne:lisacaspaRiunseRalleRRassismusZeichnung: Oliver GrajewskiWas bleibt vom NSU-Ausschuss? 12.000 Akten haben die elf Bundestagsabgeordnetendurchgearbeitet, 200 Zeugen verhört. Sie haben versucht, quälende Fragenzu beantworten: Warum hat niemand die Entstehung einer rechtsextremen Terrorzellein Deutschland antizipiert? Warum hat kein Ermittler die wahren Hintergründeder Morde an neun Menschen mit Migrationshintergrund und einer Polizistinerkannt? Die parlamentarischen Aufklärer sind überzeugt: Es lag auch an denNachteilen unseres föderalen Systems: Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und UweBöhnhardt lebten in Sachsen, die Männer mordeten in Bayern und Hessen sowiein Hamburg, Dortmund und Rostock. Unterschiedliche Polizeiermittler warenbefasst und wertvolle Informationen sind über Landesgrenzen hinweg verlorengegangen. Anhaltspunkte für staatliche Kumpanei mit den Rechtsextremen, füreinen Staat im Staate, fand der NSU-Ausschuss nicht. Die Wahrheit ist wohl einfacher,wenn auch nicht weniger schmerzhaft: Die allermeisten Ermittler warenschlicht überzeugt davon, dass solch brutale Morde an Migranten nur einenHintergrund haben können – eine Verstrickung der Opfer in Drogen- oder Mafia -geschäfte, in ausländische organisierte Kriminalität.»Routinisierte Verdachts- und Vorurteilsstrukturen« beklagt die SPD. Zu Recht.Der oftmals wohl auch unterbewusste Rassismus bei Polizei, Verfassungsschutzund in der Justiz behinderte die Aufklärung. Kritikwürdig ist auch, dass Politikerdie Deutung der Behörden unhinterfragt übernahmen und somit der »Spin« in derÖffentlichkeit vorgegeben war. Nicht weniger Schuld tragen wir Journalisten, diedas so beschämende wie falsche Wort »Döner-Morde« schufen. Bis heute beklagendie Familien der NSU-Opfer das enorme Misstrauen, dass ihnen seitens derErmittler entgegenschlug. Nachforschungen im persönlichen Umfeld von Mord -opfern sind normal – bei den NSU-Opferfamilien nahm die Polizei es offenbarsehr genau. Da wurden der Ehefrau eines Toten Fotos einer falschen Geliebtenihres Mannes vorgelegt, um vermeintliches Wissen aus ihr herauszupressen, zumTeil wurden Angehörige über Monate abgehört. Weil die Morde so brutal waren,notierten Ermittler, der Täter müsse »hinsichtlich seines Verhaltenssystems weitaußerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet« sein. Es tut weh,solche Passagen heute zu lesen.Sehr gewissenhaft ermittelten die Behörden in der Ceska-Mordserie – nur leiderin die falsche Richtung. Sie setzten auf Wahrsager und falsche Journalisten, eröffnetenfingierte Döner-Buden. Die Möglichkeit eines rechtsextremen Motivs wurdeimmer nur kurz erörtert und ohne genaue Begründung zu den Akten gelegt. Für dieZukunft braucht es also weniger strukturelle Reformen der Sicherheitsbehörden alsvielmehr Reformen in den Köpfen. Natürlich gibt es Drogenmafias, die Morde ver -üben. Es gibt aber auch Neonazis, die schlagen und morden, nur weil jemandnicht in ihr Weltbild passt. Wir sind häufiger mit rechtsextremer Gewalt konfrontiertals wir denken. Bis heute wird über die Zahl der Todesopfer rechtsextremer Gewaltgestritten: Offiziellen Angaben zufolge sind es 63 (seit 1990), die regelmäßig von»Zeit« und »Tagesspiegel« ermittelte Zahl liegt hingegen bei mindestens 152. Invielen Polizeiberichten und Gerichtsverhandlungen wird das eigentliche Motiv, dieFremdenfeindlichkeit, gar nicht als solches erkannt. Das muss sich ändern.Wir sind alle nicht frei von Vorurteilen und rassistischem Gedankengut. PauschaleVermutungen über Migranten, über Leute, die vermeintlich anders sind, wer kenntsie nicht? Wer erschrickt nicht manchmal über sich selbst, weil er in Schablonengedacht hat? Da müssen wir endlich ehrlicher, sensibler werden. Die Morde desNSU sind nicht mehr rückgängig zu machen. Sie sollten uns allen eine bittereLehre sein.Lisa Caspari ist Redakteurin bei »Zeit-Online«.nachRichten | kOlumne17
Thema: Russland18 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
*Die Menschenrechte haben es schwer in Russland.Der Staat misstraut seinen Bürgern zutiefst.19
Was, wenn das zufällig Kinder sehen? Demonstration in Amsterdam anlässlich des Staatsbesuchs von Präsident Wladimir Putin, 8.April 2013.20 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Foto: Cris Toala Olivares /ReutersPutins SpieleSeit Beginn der dritten Amtszeit von PräsidentPutin verschärft sich die Menschenrechtslagein Russland, und die Handlungsspielräumeder Zivilgesellschaft werdenimmer enger. Demonstrationen werdenverboten oder gewaltsam aufgelöstund mit immer neuen Gesetzen wird diefreie Meinungsäußerung beschnitten unddas so wichtige Engagement von Nichtregierungsorganisationenstigmatisiert.Mit einem neuen Gesetz, das es unterStrafe stellt, gegenüber Minderjährigen»nicht-traditionelle« sexuelle Beziehungenzu propagieren, werden Homosexuelle insVisier genommen, was die ohnehin homophobenTendenzen in der Bevölkerung zusätzlichbefeuert. Einzelne, die es wie PussyRiot oder der Oppositionsführer Nawalnywagen, den Präsidenten oder die Behördenöffentlich zu kritisieren, werden strafrechtlichverfolgt. Damit wird offensichtlich versucht,auch anderen Menschen den Mut zunehmen, frei und öffentlich ihre Meinungzu äußern. Auch der Alltag im Nordkaukasusist nach wie vor von Gewalt geprägt.Viele Zivilisten geraten dabei zwischen dieFronten von Sicherheitskräften und bewaffnetenGruppen: Zahlreiche Menschenwerden in undurchsichtigen Operationender Sicherheitskräfte Opfer von Verschwindenlassen,Folter und außergerichtlichenHinrichtungen.Angesichts der herannahenden OlympischenWinterspiele in Sotschi, die wiealle Großereignisse dieser Art für die Regierungeinen willkommenen Prestigegewinnmit sich bringen, ist es wichtig, aufdie Menschenrechtsverletzungen im Austragungslandaufmerksam zu machen. Vielefreuen sich auf die Spiele und auf diesportlichen Höhepunkte, die dieses internationaleEreignis präsentieren wird. UnserBlick sollte sich aber nicht darauf verengen,sondern auch den besorgniserregendenEntwicklungen in Russland gelten,die so gar nicht zur olympischen Idee passen.Wir wollen daher nicht nur die Sportleranfeuern, sondern auch die mutige russischeZivilgesellschaft, in der Hoffnung,dass sie diesen Mut nicht verliert.Marie von Möllendorf ist Europa-Referentin derdeutschen <strong>Amnesty</strong>-Sektion.thema | Russland21
Die Diskriminierung geht vor allem vom Staat aus. Anna Anissimowa, Direktorin der NGO »Coming Out«.22 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Am Ende desRegenbogensSexuelle Minderheiten gelten vielen in Russland als krank,pervers und gefährlich. Jetzt drängt die Regierung siemit diskriminierenden Gesetzen in die Illegalität.Von Johannes Voswinkel (Text)und Sergey Maximishin (Fotos)thema | Russland23
»Gebe Gott, dass die Nachbarn nichts erfahren.« Marina und Tanja mit ihrem Adoptivsohn Wadim.In Marinas* Wohnung sieht es gar nicht nach der Perversionaus, die viele hier vermuten würden: Legosteine sindüber den Boden verstreut, ein Regenbogen schmückt dieWand bis zur Decke, und der siebenjährige Wadim* malteine Wiese mit Bienen und Spinnen. Das kleine Kinderparadiesbefindet sich in einer typischen Hinterhofwohnung in SanktPetersburg, die man durch ein enges, düsteres Treppenhauserreicht. Doch an manchen Tagen kommt Unruhe auf. Dannschaut wieder eine Mitarbeiterin des Sozialamts vorbei. DennMarina hat ihren Sohn vor drei Jahren aus einem Kinderheimgeholt. Das Sozialamt kontrolliert, ob es ihm auch gut geht.Dann müssen die überzähligen Hausschuhe und die zweiteZahnbürste verschwinden. Offiziell ist Marina alleinerziehendeMutter. In Wirklichkeit hat Wadim zwei Mamas.Die 30-jährige Marina ist lesbisch und lebt seit langem mitihrer Partnerin Tanja* zusammen. Als sie in einem Heim fürHIV-infizierte Kinder arbeitete, lernte sie Wadim kennen. DerWunsch reifte heran, ihn großzuziehen. Für gleichgeschlechtlichePaare ist das undenkbar in Russland, für ein einzelnes Elternteilaber möglich. Marina gab sich als alleinstehende Frauaus. Die Psychologin, auf deren Gutachten es ankam, schien alleszu verstehen. »Sie war wohl gay-friendly«, sagt Marina. »Ichhabe Glück gehabt.« Marina bekam Wadim zugesprochen. Alssie ihren Eltern mitteilte, dass sie nun einen Sohn habe, kam alsAntwort: »Der arme Junge! Wäre er doch besser im Kinderheimgeblieben.« Marinas Geschichte erzählt vom stillen Leid, das vieleLesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender (LGBT) in Russlanddurchleben. Mit 17 Jahren verliebte sie sich in ihrem Dorf ineine andere junge Frau. »Ich wusste gar nicht, was mit mir geschah«,erzählt sie. »Ich hatte kein Vokabular dafür. Für Lesbenkannte ich nur Schimpfwörter.« Erst viel später fand sie imInternet Informationen über Homosexualität. Im Dorf war daskein Thema. Als die Eltern Verdacht schöpften, sperrten sieMarina ein, schlugen sie, suchten nach einer psychiatrischenHeilanstalt und brachten sie für einige Zeit bei Freunden in derFerne unter. Sie sei drogensüchtig, lautete die offizielle Begründung.Das klang besser als lesbisch.Marina lief davon. Sie lebte in einer Stadt mit knapp 400.000Einwohnern, traute sich jedoch nicht, mit Tanja auf der StraßeHand in Hand zu gehen. Auf dem Dach einer Bauruine trafensich die Frauen heimlich in schwindelnder Höhe. Dann zogenMarina und Tanja weiter in die Freiheit der anonymen Metro -pole, nach Sankt Petersburg, weit weg vom Dorf der Eltern, indem die Öffentlichkeit so bedrohlich war. »Gebe Gott, dass dieNachbarn nichts erfahren«, sagten die Eltern immer.Sexuelle Minderheiten gelten vielen in Russland als krank,pervers und gefährlich. Ein Gesetz, das laut offizieller Darstellung»Propaganda« für Homosexualität gegenüber Minderjährigenverbieten soll, sie aber in Wirklichkeit als unnormal und gefährlichverleumdet, stieß kaum auf Kritik. Präsident WladimirPutin hat es im Juni unterzeichnet. Seither sehen sich Nationalistentruppsund ikonenbewehrte Rollkommandos der Orthodoxieals legitime Vertreter des Volkswillens. Die Zahl der Pöbeleienauf der Straße nehme zu, erzählt Marina.Als Anfang September ein neuer Gesetzentwurf aus derKremlpartei »Einiges Russland« bekannt wurde, der vorsieht,Homosexuellen das Erziehungsrecht für ihre leiblichen oderadoptierten Kinder zu entziehen, bekam Marina »panische24 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Angst«. Mit Tanja beriet sie darüber, auszuwandern. Sie kenntmehr als zehn gleichgeschlechtliche Familien, die bereits dasLand verlassen haben.Marina schickt Wadim nicht in eine staatliche, sondern ineine private jüdische Schule. Sie hofft, dort auf größere Toleranzgegenüber Minderheiten zu stoßen. Manche Familie habe wegender Homophobie der Lehrer schon die Schule wechseln müssen,erzählt sie. Eine Lehrerin behandelte im Unterricht »deviantesVerhalten« und nannte als Beispiel die lesbischen Eltern einesder Kinder. »In diesem Fall haben sich die Schüler gegen dieLehrerin solidarisiert«, erzählt Marina, »bis sie in Tränen ausbrach«.Ein Beispiel junger Zivilgesellschaft.Marina engagiert sich in der Petersburger LGBT-Organisation»Coming Out« gegen Intoleranz und Homophobie. DasBüro der Nichtregierungsorganisation im Zentrum von SanktPetersburg steht voller Computer, Broschüren und Keksteller.Hinter einem Vorhang stapeln sich selbstgemalte Plakate derElterngruppe: »Ich liebe meinen Gay-Sohn. Jetzt soll er ein Pariawerden?« Der Blick über den Hinterhof fällt auf eine Jalousie inRegenbogenfarben am Fenster gegenüber. Dort hat eine befreundeteOrganisation, die LGBT-Filmfestivals veranstaltet,ihre Räume. Sie ist, wie »Coming Out«, von der Schließung bedroht.Denn beide Organisationen werden von zwei Gesetzen in dieZange genommen. Das Gesetz zur Arbeit der Nichtregierungsorganisationenschreibt vor, dass sich NGOs, die aus dem Auslandfinanziert werden und sich politischer Tätigkeit widmen, als»ausländische Agenten« registrieren müssen. Es spielt mit dertraditionellen Furcht vor äußeren und inneren Feinden undstigmatisiert die unliebsamen Gruppierungen.»Coming Out« findet kaum einen Sponsor in Russland.Wenn die Organisation Geld sammelt, kommt sie gerade malauf 100 Euro, um die Luftballons für eine Demonstration zu bezahlen.Einige Firmen unterstützen sie mit Rabatten. Aber ihrLogo drucken sie aus Vorsichtlieber nicht oder nur ganz kleinauf Broschüren und Plakate.Projektgelder kommen ausdem Ausland – so von der Heinrich-Böll-Stiftungoder aus demMenschenrechtsprogramm derEuropäischen Union. Der Fondsder russischen Regierung zurUnterstützung der Zivilgesellschaftist für »Coming Out« dagegenunerreichbar. LGBT geltenin Russland nicht als zu fördernde»soziale Gruppe«.Das Gesetz zur »homosexuellenPropaganda« wiederumhat seinen politischenZweck schon erfüllt, obwohl esin St. Petersburg bisher nur eineinziges Mal zu einer Strafeführte: »Die Gesellschaft ist gespaltenworden«, erklärt die geschäftsführendeDirektorin von»Coming Out«, Anna Anissimowa.»Die Mehrheit wurde gegendie Minderheit mobilisiert. DasGesetz rückt Homosexualität in»Die Gesellschaft istgespalten worden. DieMehrheit wurde gegen dieMinderheit mobilisiert.«die Nähe der Pädophilie.« Die Folgen sind eine allgemeine Homophobieund Einschüchterungen.Stadtverwaltungen lehnen fast jede LGBT-Demonstration ab,Polizisten beschimpfen Homosexuelle als »Päderasten« undbringen sie auf die Wache. Im staatlich kontrollierten Fernsehkanalverkündete der Journalist Dmitrij Kisseljow, er sei gegen Homosexuelleals Organspender. »Man muss ihnen verbieten, Blutund Sperma zu spenden«, rief er aus, »und ihre Herzen nach einemAutounfall in der Erde vergraben oder verbrennen«.Psychologen der staatlichen Kinderzentren klagen hinter vorgehaltenerHand, dass sie nicht wissen, was sie einem Sechzehnjährigen,der mit der Zuneigung zum eigenen Geschlecht nichtklarkommt, sagen sollen: »Können wir ihn jetzt noch beruhigen,das sei alles in Ordnung so? Oder ist das schon Propaganda?«Homosexuelle trauen sich kaum noch, sich in der Öffentlichkeitan der Hand zu fassen. Was, wenn das zufällig Kinder sehen?Dabei ist die Homophobie nach Meinung vieler LGBT-Aktivistenin Russland kaum größer als in anderen Ländern. Aber einigeBesonderheiten gibt es doch: Die sowjetische Vergangenheitsteckt noch immer in vielen Köpfen fest. Der Paragraph, derDie Pöbeleien auf der Straße nehmen zu. Marina, Tanja und Wadim wollen nicht erkannt werden.thema | Russland25
Homophobe begleitenalle Auftritte der LGBT-Aktivisten. »Orthodoxieoder Tod«, skandieren sie.Homosexualität unter Strafe gestellt hatte, ist erst 1993 abgeschafftworden. Die zuvor Verurteilten wurden nie rehabilitiert.Die ungeschriebenen Gesetze der sowjetischen Haftlager, durchdie Millionen gegangen sind, drangen tief in das Bewusstseinein. Homosexuelle gehörten zur untersten Kaste in der sozialenLagerpyramide. Dazu kam die ideologische Vorstellung, dass allegleich sein müssten in der Gesellschaft.Damals, so glauben viele bis heute, habe es kaum Homosexuellegegeben. In Wirklichkeit haben sie sich nur nicht offenbart.Verschwörungstheoretiker behaupten, LGBT seien einewestliche Waffe, um Russland von innen heraus zu zerstören.Die kruden Theorien finden Anklang, zumal das Wissen übersexuelle Minderheiten gering ist. Klischees herrschen vor:Schwule seien affektiert, zeigten ihren nackten Hintern, trügenStrumpfhosen. Kaum ein Prominenter outet sich in Russland.Sogar die wenigen TV-Stars oder Sänger, die »Coming Out«unterstützen, beginnen ihre Rede meist mit dem Satz: »Ich binzwar nicht schwul, aber verteidige ihre Rechte.«Die Diskriminierung in Russland geht vor allem vom Staataus. Er hat die Aggression gegen LGBT gleichsam legalisiert, stattGefühl der tiefen Ungerechtigkeit. Grigorij mit seinem Partner Dmitrij.für eine offene und tolerante Gesellschaft einzutreten. Die Botschaftwirkt sogar bei den sexuellen Minderheiten selbst. »VieleLGBT sind innerlich homophob«, sagt Anissimowa. »Sie haltenes für ganz normal, dass sie nicht mit ihrem Lebenspartner aufFirmenfeiern gehen können, ohne in Verruf zu geraten.« TäglicheDiskriminierung nehmen sie hin: Homosexuelle Mitarbeiterwerden ohne Grund entlassen, Gynäkologen behandeln Patientinnennicht, weil sie lesbisch sind, und Wohnungsvermieterlehnen gleichgeschlechtliche Paare ab.Ein Kreis von Homophoben begleitet alle Auftritte der LGBT-Aktivisten. Zumeist sind es kurzrasierte Männer in Sporthosenmit faschistisch wirkenden Symbolen. »Orthodoxie oder Tod!«,skandieren sie. »Bisher schubsen sie uns nur, schlagen abernicht«, sagt Anissimowa. »Noch machen sie vor allem eine Showfür die Medien und drohen uns nur: ›Wir bringen euch um undvergraben euch unter Büschen!‹ Das Übliche halt«, erzählt sie.Die verbalen Angriffe sind gesellschaftsfähig geworden. Am3. September hing an der Tür zum Saal für Pressekonferenzender Nachrichtenagentur Rosbalt in Moskau ein Zettel: »Homosund Bi’s – zischt ab!« Drinnen präsentierten selbsternannte Patriotenihr Projekt, das auf den »Informationskrieg gegen Russlandeine asymmetrische Antwort« finden soll: mit Denkmälernrussischer Helden, mit T-Shirts (»Wir sind Russen, Gott ist mituns«) und Souvenirmagneten in Form von Kalaschnikows undJagdgewehren. »Für Doppelflinten verboten!« steht darauf – inAnspielung auf das Jargonwort für Bisexuelle. Revanchegelüstefür die erniedrigenden neunziger Jahre, der jahrhundertealteVersuch, Russlands Identität in der Bedrohung seiner Feinde zusuchen, und der neue Schulterschluss des russischen Staatesmit der orthodoxen Kirche vermischen sich zu einem Weltbild,in dem LGBT-Aktivisten als westlich gesteuerte Dekadenz-Soldatenin einem Feldzug gegen Moskau erscheinen.Grigorij ist einer dieser Soldaten, aber er wirkt gar nicht so.»Ich finde, alle sollten lieb sein und sich versöhnen«, sagt derSchwule und ruft, weil es sokitschig klang, ein ironisches»Friede der Welt!« hinterher.Grigorij scheut Konflikte. Dassihn einst ein Mann in einemDorfladen geohrfeigt und beschimpfthat, erzählt er leichtenHerzens wie eine wunderlicheAnekdote. Auch der Verlustseiner Arbeit beschwert ihnkaum mehr. Früher war GrigorijTheaterpädagoge in einemKulturhaus für Kinder. Aber alssein Foto von einer Demonstrationfür die Rechte sexuellerMinderheiten ins Internet kam,bat ihn der Direktor zu kündigen.Zu groß war die Angst vorden Protesten der Eltern. Seithertritt Grigorij auf der Bühnedes LGBT-Klubs »Malewitsch«auf.Das Lokal ist nicht leicht zufinden. Der Weg führt von derMetrostation Moskauer Torüber einen öden Parkplatz zurgrellen Reklame einer Dis-26 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Mal eine Rauchbombe, mal ein Hakenkreuz am Eingang des Clubs. Grigorij schminkt sich für einen Auftritt im »Malewitsch«.count-Bar mit Billig-Gin. Durch eine Metallpforte darunter gehtes in einen dunklen Durchgang, in dem es streng riecht. ImHinterhof links um die Ecke liegt der Eingang, eine schwarzeMetalltür. Das Emblem des Klubs, einen herzförmigen Apfel inRegenbogenfarben, haben nicht etwa rabiate Homophobe abgeschlagen– Besucher nahmen es vielmehr als Souvenir mit. Das»Malewitsch« hatte bisher kaum Probleme: Mal flog eine Rauchbombein den Eingang, mal fand sich ein Hakenkreuz auf einemFass vor der Tür. Der St. Petersburger Stadtabgeordnete WitalijMilonow, der Homosexuelle mit religiösem Eifer verfolgt, bezeichnetedas Lokal per Twitter als Bordell. Ernsthafte Drohungengab es jedoch keine.Nach Mitternacht sitzt Grigorij im Schminkraum des »Malewitsch«und zieht den Lidschatten nach. Seine Paraderolle istdie Scherzfigur Milona, eine Mischung aus Milonow und Madonna.Der Abgeordnete wollte die Sängerin wegen ihrer Sympathiegestefür Schwule während eines Konzerts in St. Petersburgeinst sogar vor Gericht zerren. Grigorij betritt die Bühne,stottert und klimpert wild mit den Augen, wie es Milonowmanchmal tut. Dann verwandelt er sich in Madonna und singt»Boy Gone Wild«. Der Saal tobt.Mit seinem Partner Dmitrij könnte Grigorij eigentlich, wie erselbst sagt, unerkannt und unbehelligt leben. Wäre da nicht dasGefühl der tiefen Ungerechtigkeit, das ihn schon vor Jahren alsFreiwilligen zu »Coming Out« getrieben hat. »Ich finde gut, dassdiese Organisation den Dialog und das gemeinsame Verständnissucht«, erklärt er sein Engagement. »Sie will nicht die Machtstürzen, sondern mit ihr sprechen.« Die radikalen Kämpfer fürLGBT liegen ihm nicht. Schon ihre Slogans wie »Sodom in jedesHaus!« oder »Du bist selbst schwul!« hält er für kontraproduktiv.Er hat es lieber versöhnlich.Im September kommt ein neues Stück auf die »Malewitsch«-Bühne. Den Konflikt im Lehrerkollegium einer Schule zwischeneinem Homosexuellen und einem Homophoben schlichtetletztlich die Putzfrau, eine kirgisische Migrantin. Als Geste derSolidarität mit allen anderen Minderheiten, die es genausoschwer haben im heutigen Russland.Der Autor ist Russland-Korrespondent und lebt in Moskau.*Name geändertDiesen Artikel können Sie sich in unserer iPad-App vorlesen lassen:www.amnesty.de/appRussland-sOlidaRitäts-kOnzeRtMit ihrem Konzert »To Russia with Love« möchten welt -berühmte Musiker wie der Pianist und Dirigent DanielBarenboim, der Geiger Gidon Kremer und die PianistinMartha Argerich die politisch Verfolgten in Russland unterstützen.Das Konzert findet am 7.Oktober 2013 im Kammermusiksaalder Berliner Philharmonie statt. Vor demKonzert veranstalten <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> und andereOrganisationen im Foyer eine Podiumsdiskussion.Hotline: 030-47997466 | Online: www.eventim.deWeitere Informationen unter www.to-russia-with-love.orgthema | Russland27
Gehorche! Protestplakat auf einer Demonstration in Moskau, Februar 2012.Foto: Denis Sinyakov /ReutersMassenproteste gegen Putin. Demonstration in Moskau,Alles unterKontrolleSchikanen gegen Minderheiten, langjährige Haftstrafen für Oppositionelle:Mit aller Macht versucht die russische Regierung, jede kritische Regungin der Gesellschaft zu unterbinden. Von Peter Franck28 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Februar 2012.Foto: Max Streltsov/Saltimages/laifZweifel an einem fairen Verfahren. »Freiheit für die Gefangenen vom Bolotnaja!«Foto: Ilya Naymushin /ReutersBegleitet von Massenprotesten gegen die Ergebnisseder Parlaments- und Präsidentschaftswahlen trat PräsidentWladimir Putin im Mai 2012 seine dritte Amtszeitan. Seitdem ist es noch schwerer geworden für dieMenschenrechte in Russland. Hielten sich die russischen Behördenbereits zuvor oft nicht an geltende Gesetze, so ist seither zubeobachten, dass die Rechtsprechung der menschenrechtswidrigenPraxis angepasst wird: Die Vorschriften über Nichtregierungsorganisationen,die Bestimmungen über Landesverrat undzum Demonstrationsrecht wurden verschärft. Außerdem wurdenein Gesetz gegen die Propaganda »nicht-traditioneller« sexuellerBeziehungen und das sogenannte »Blasphemiegesetz«verabschiedet.Darüber hinaus gehen die Behörden mit großer Härte gegenEinzelne vor. Die Verurteilungen der Frauen von »Pussy Riot«,die strafrechtliche Verfolgung führender Persönlichkeiten derOpposition wie Alexej Nawalny, die Stilisierung der Proteste amBolotnaja-Platz zu »Massenunruhen« samt einer entsprechendenStrafverfolgung der Demonstranten sind dafür Beispiele.Insgesamt geht es der »Macht« offenbar um Einschüchterungund um eine staatliche Kontrolle aller gesellschaftlichen Aktivitäten.Vor der Sommerpause 2012 hatte das Parlament neue Bestimmungenüber »Nichtkommerzielle Organisationen« beschlossen,die im November vergangenen Jahres in Kraft tratenund als »Agentengesetz« bekannt geworden sind. Danach sindrussische NGOs, die meist als »Nichtkommerzielle Organisationen«gemeldet sind, verpflichtet, sich beim Justizministeriumals »ausländische Agenten« registrieren zu lassen, wenn sie ausdem Ausland finanziell unterstützt werden und »politisch tätig«sind (<strong>Amnesty</strong> Journal 4-5/2013). Zunächst blieb unklar, ob esder Staat bei einer bloßen Drohgebärde belassen würde.Am 14. Februar 2013 beendete Putin jedoch alle Spekulationen,als er in Anwesenheit des Chefs des InlandsgeheimdienstesFSB eine Rede vor Offizieren der Sicherheitskräfte hielt. Darinforderte er sie auf, die russische Bevölkerung zu schützen. Sowie niemand das Recht habe, Hass zu säen, die Gesellschaft aufzuwiegelnund das Leben, das Wohlergehen sowie den Friedenvon Millionen von Bürgern zu gefährden, habe niemand dasMonopol, für die russische Gesellschaft zu sprechen. Dies geltevor allem für Organisationen, die vom Ausland finanziert würdenund ausländischen Interessen dienten.Das Signal wurde verstanden. Am 11. März 2013 gab eineSprecherin der Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass ihreund andere Behörden mit einer groß angelegten Überprüfungvon NGOs beginnen würden. In der Folge erschienen überall imLand Vertreter unterschiedlichster Behörden bei Hunderten vonNGOs, darunter Beamte der Generalstaatsanwaltschaft, des Justizministeriums,der Steuerbehörden, des föderalen Migrationsdienstes,des föderalen Verbraucherschutzdienstes, des Katastrophenschutzministeriumsund des FSB. Sie tauchten bei denOrganisationen auf und forderten die Übergabe verschiedensterthema | Russland29
Papiere. Alles war von Interesse: Buchhaltungsunterlagen, Dokumente,die den Brandschutz betreffen, Veröffentlichungen, umnach Anhaltspunkten für extremistische Straftaten zu suchen.Betroffen waren bekannte Bürger- und Menschenrechtsorganisationen,Umweltgruppen und religiöse Organisationen bis hinzur katholischen Kirche. In Deutschland erregten die Überprüfungender Büros deutscher politischer Stiftungen und derAußenstelle des <strong>International</strong>en Sekretariats von <strong>Amnesty</strong><strong>International</strong> besondere Aufmerksamkeit, obwohl sie als nichtrussischeOrganisationen vom »Agentengesetz« selbst nicht unmittelbarbetroffen sind. Bei einigen Kontrollen war das offenbarvorab informierte staatliche Fernsehen dabei und berichtetein den Abendnachrichten über den Kampf der Behörden gegen»ausländische Umtriebe«.Und die Ergebnisse? Nach Angaben von Jens Siegert, demLeiter des Moskauer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, die seitJahren eng mit vielen russischen Organisationen zusammenarbeitet,haben (Stand Mai) 43 NGOs nach den Überprüfungen Bescheideerhalten, die von einer möglichen »Agententätigkeit«ausgehen. Allerdings hätten nicht alle betroffenen Organisationendie Ergebnisse der Überprüfung öffentlich gemacht. LautSiegert stellte die Staatsanwaltschaft in zehn Fällen fest, dassNGOs unter das »Agentengesetz« fallen. Ihnen wurde eine Fristzur Registrierung gesetzt. In einigen Fällen wurden bereits Strafzahlungenangeordnet. Einige der betroffenen NGOs wandtensich daraufhin an Gerichte und erzielten teilweise juristischeErfolge. So sind inzwischen drei Urteile aus St. Petersburg undPerm bekannt, in denen die Richter Bescheide aufhoben, weilsie im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft keine »politische Tätigkeit«der Organisationen feststellen konnten.Es ist bemerkenswert, dass es quer durch alle russischenNGOs eine unabgesprochene Übereinstimmung gab, sich keinesfallsals »ausländische Agenten« zu registrieren. Man verstanddie Absicht des Gesetzgebers genau: Mit der Selbstregistrierungsollten sich die Organisationen vor der eigenen Gesellschaftdemütigen und als »ausländische Agenten« außerhalb einesGemeinwesens stellen, das Präsident und Regierung als dasihre begreifen.Die Idee, das eigene Staatsvolk in schwieriger Zeit hinter sichEs geht der »Macht« umeine staatliche Kontrollealler gesellschaft lichenAktivitäten.zu bringen und Minderheiten auszugrenzen, dürfte auch hintereinem weiteren neu verabschiedeten Gesetz stehen. Es verbietetunter Androhung von Geldbußen, Propaganda für »nicht-traditionelle«sexuelle Beziehungen, wenn Minderjährige davonKenntnis nehmen können. Was unter einer solchen »Propaganda«im Einzelnen zu verstehen ist, bleibt offen. Das vom Parlamenteinstimmig beschlossene und von Präsident Putin EndeJuni 2013 unterzeichnete Gesetz schürt die ohnehin verbreiteteund insbesondere von der russisch-orthodoxen Kirche unterstütztehomophobe Stimmung in der russischen Gesellschaft.Angriffe auf Homosexuelle, die zudem im Internet gegen ihrenWillen »geoutet« werden, zeigen, wie schwer es sexuelle Minderheitenin Russland mittlerweile haben. Wenn der russische Staatsolchen Übergriffen nicht öffentlich und deutlich begegnet,kommt er seinen Schutzpflichten nicht ausreichend nach.Durch exemplarisch hartes Vorgehen gegen Einzelne wirdDruck auf all jene ausgeübt, die sich in Russland eine eigeneMeinung bilden und diese unabhängig in den gesellschaftlichenDiskurs einbringen wollen. Die Verurteilung der Frauenvon »Pussy Riot« zu zweijährigen Haftstrafen war zwar nachrussischem Recht gar nicht möglich (<strong>Amnesty</strong> Journal 10-11/2012). »Die Macht« konnte sich jedoch auf ihre Gerichte verlassenund ungeachtet weltweiter Proteste sind zwei der drei verurteiltenFrauen noch immer in Haft. Mit dem von Präsident PutinEnde Juni 2013 unterzeichneten »Blasphemie-Gesetz« wurde dieExemplarisches Vorgehen. Alexej Nawalny in seiner Wahlkampfzentrale.Ausgegrenzte Minderheiten. Aktivisten bei einer Gay-Pride-Kund30 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Grundlage dafür geschaffen, dass künftig in vergleichbaren Fällennicht erst der Vorwurf des »Rowdytums« bemüht werdenmuss, um zu einer Verurteilung zu gelangen.»Funktioniert« hat die Justiz auch im Fall des OppositionsführersAlexej Nawalny. Der Rechtsanwalt wurde im Juli 2013 inerster Instanz wegen angeblicher Veruntreuung zu fünf JahrenHaft verurteilt. Anschließend wurde er aber überraschend freigelassen,bis das Urteil rechtskräftig ist. Er kandidierte im Septemberfür das Amt des Moskauer Oberbürgermeisters. Ein Mitangeklagtererhielt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. <strong>Amnesty</strong>bewertete die Anklagen, die nach einem bereits zweimal eingestelltenErmittlungsverfahren schließlich doch noch erhobenwurden, als völlig inkonsistent und setzte sich für die beidenMänner ein.Kurz nach dem Prozess gegen Nawalny gab es Berichte,wonach der als Beratungsgremium Putins fungierende »Menschenrechtsrat«beschlossen habe, das Urteil solle von Expertennach seiner Rechtskraft öffentlich untersucht werden. Eineähnliche Untersuchung hatte der Rat im Auftrag von PräsidentMedwedew bereits nach der zweiten Verurteilung von MichailChodorkowski und Platon Lebedew durchgeführt. Der im Dezember2011 von der früheren Verfassungsrichterin TamaraMorschtschakowa vorgestellte Bericht kam zu dem Ergebnis,dass die Verurteilungen nicht gerechtfertigt gewesen seien, undregte an, die Urteile aufzuheben. Die Zivilcourage der Expertenhatte jedoch keinen Einfluss auf die Situation der beiden Männer,deren Inhaftierung sich 2013 zum zehnten Mal jährt.Stattdessen geht das Ermittlungskomitee der Staatsanwaltschaftgegen sechs Autoren des Berichts vor. Ende Juni 2013musste Tamara Morschtschakowa zur Vernehmung erscheinen.Die Ermittler begründen ihr Vorgehen damit, das Umfeld Chodorkowskishabe den Autoren des Berichts Geld zukommen lassen,um das Ergebnis zu beeinflussen. Sergej Gurijew, langjährigerRektor der »New Economic School« in Moskau, renommierterWirtschaftswissenschaftler und Berater der russischen Regierung,hatte ebenfalls an dem Bericht mitgewirkt. Nach seinerVernehmung in Moskau reiste er nach Frankreich aus und kündigteim Mai 2013 an, er werde nicht mehr nach Russland zurückkehren.Es sei besser, in Paris zu sein als in Krasnokamensk,gebung in St. Petersburg.Druck gegen Abweichler. Pussy-Riot-Unterstützer.Fotos: Sergey Ponomarev/NYT/Redux/laif, Mads Nissen /laif, Jeremy Nicholl/laifanna pOlitkOwskajaDie Journalistin und Buchautorin wurde am 7. Oktober2006 im Flur ihres Moskauer Wohnhauses erschossen.Sie hatte für die oppositionelle »Nowaja Gaseta« gearbeitetund war wiederholt durch »unfreundliche« Berichterstattungzum Krieg in Tschetschenien und durch kritische Artikelüber Präsident Wladimir Putin aufgefallen. Mittlerweilewurden zwar mehrere Personen im Zusammenhang mitdem Mord festgenommen und angeklagt. Der Chefredakteurvon »Nowaja Gaseta«, Dmitri Muratow, meint allerdings,dass auf der Anklagebank des Stadtgerichts inMoskau lediglich der mutmaßliche Todesschütze sowieder angebliche Organisator des Verbrechens und dessenKomplizen sitzen. »Der Auftraggeber für den Mord ist weiternicht bekannt«, kritisiert Muratow.soll er per Twitter unter Anspielung auf einen früheren HaftortChodorkowskis mitgeteilt haben.In Moskau hat inzwischen das »Bolotnaja-Verfahren« begonnen,in dem zwölf Demonstranten, die angeblich an körperlicheAuseinandersetzungen bei der Demonstration anlässlich derAmtseinführung Putins beteiligt gewesen sein sollen, vor Gerichtstehen. Es spricht viel dafür, dass gezielte Provokationendie Zusam men stöße mitausgelöst haben. Bei einigen Angeklagtenfehlen zudem Hinweise darauf, dass sie an den Auseinan -dersetzungen überhaupt beteiligt waren. Außerdem werden siewegen des schwerwiegenden Delikts der »Teilnahme an Massenunruhen«verfolgt. Damit drohen ihnen Freiheitsstrafen von biszu acht Jahren. Nach allen bisherigen Erfahrungen ist zu bezweifeln,dass sie ein faires Verfahren erhalten werden.Aber nicht nur die Metropolen des Landes sind betroffen.Auch in der Region Perm, zu der die deutsche Sektion von <strong>Amnesty</strong>seit über zehn Jahren intensive Kontakte pflegt, ist die zunehmendepolitische Kontrolle zu spüren. In diesem Jahr sahensich die Organisatoren des seit vielen Jahren im Gulag-Museum»Perm 36« veranstalteten Menschenrechtsfestivals »Pilorama«(<strong>Amnesty</strong> Journal 6-7/2010) gezwungen, das Kulturereigniskurzfristig abzusagen. Die Behörden hatten ihnen die Hälfte dervom Parlament dafür bewilligten Mittel entzogen, nachdem sienicht den gewünschten Einfluss auf das Programm bekommenhatten. Von offizieller Seite wurden die zivilgesellschaftlichenVeranstalter für die Absage verantwortlich gemacht: Man könnemit öffentlichen Geldern keine Veranstaltung unterstützen, aufder voraussichtlich die Regierung kritisiert werde, hieß es.Der Fall »Pilorama« macht deutlich, dass die Repräsentantendes russischen Staates den Bürgern grundsätzlich zutiefst miss -trauen. Die Vorstellung, dass diese unabhängig handeln und dabeiauch die Regierung kritisieren, ohne von außen »gesteuert«zu sein, ist der Vorstellungswelt vieler, die derzeit in RusslandMacht ausüben, fremd. Es bleibt zu hoffen, dass sich insbesonderedie jungen Menschen in Russland, die sich einmischen undihr Gemeinwesen kreativ mitgestalten wollen, nicht mehr einschüchternlassen. Und dass die NGOs, mit denen <strong>Amnesty</strong><strong>International</strong> seit langer Zeit zu sam men arbeitet, dem Druckstandhalten.Der Autor ist Sprecher der Russland-Ländergruppe der deutschen<strong>Amnesty</strong>-Sektion.thema | Russland31
»Die Kathedrale ist ein Ort der Heuchelei.« Pussy Riot.32 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
»PolitischeKunst istgefährlich«Zwei Mitglieder von Pussy Riot reisten kürzlich inkognito durch Europa unddie USA, um an das Schicksal ihrer inhaftierten Mitstreiterinnen zu erinnern.Im Interview sprechen die Frauen über ihr Selbstverständnis als Künstlerinnen,die Risiken ihrer Arbeit und die Berichterstattung der Medien.Foto: Sarah EickPussy Riot – was ist das noch mal genau?Viele denken, wir seien eine Punk-Band, doch das ist eingrandioses Missverständnis. Wir sind Medienkünstler! Natürlichist uns die Musik wichtig, aber sie ist eben nur ein Baustein unsererKunst. Wir geben ja auch keine Konzerte im herkömmlichenSinne, sondern machen Performances, die gefilmt unddann im Internet verbreitet werden. Unsere Auftritte sind immerüberraschend, immer illegal – und immer politisch. Wirwollen tatsächlich etwas bewegen.Pussy Riot will die Welt verändern?Ja, auch wenn es naiv klingen mag.Wie viele Frauen zählen zur Gruppe?Das ändert sich ständig, weil wir keine geschlossene Cliquesein wollen. Derzeit sind wir zu acht.Was sollen eigentlich diese komischen Mützen?Zunächst geht es natürlich darum, unsere Identität zu verbergen.Als wir Pussy Riot gründeten, war uns bereits klar: Werin Russland politische Kunst macht, lässt sich auf ein sehr gefährlichesSpiel ein. Aber unsere Sturmhauben haben auch einezutiefst politische Botschaft.Und zwar?In Russland sind die Masken das Symbol der OMON, einerSpezialeinheit der russischen Polizei. Die Einheit ist berüchtigt,weil sie besonders brutal gegen Demonstrierende vorgeht. DiePolizisten tragen die Sturmhauben in Schwarz. Wir tragen sie ingrellen, fröhlichen Farben. So eignen wir uns ein Herrschaftssymbolan – und zerstören es damit zugleich.Pussy Riot rebelliert also gegen den Staat?In erster Linie verstehen wir uns als Feministinnen. Wir wollendie klassischen Rollenbilder aufsprengen. Mit dem traditionellenFeminismus haben wir allerdings nicht mehr viel amHut.Wieso nicht?Im Unterschied zum alten Feminismus beteiligten wir unsnicht mehr an dem Kampf »Frauen gegen Männer«. Wir stellenvielmehr die Grenze zwischen den Geschlechtern als solche inFrage. Wir kleiden uns beispielsweise sehr mädchenhaft, handelnaber extrem männlich. Auch in unserem Namen spiegeltsich dieser Kontrast: »Pussy« assoziiert Weiblichkeit, »Riot« dasGegenteil. Unsere Botschaft lautet: Das Geschlecht ist nichts biologischVorgegebenes – man kann damit experimentieren!Männer dürfen bei Pussy Riot trotzdem nicht mitmachen. Istdas nicht ein Widerspruch?Stimmt, wir sind eine reine Frauengruppe. Und das soll auchso bleiben. Das heißt nicht, dass wir etwas gegen Männer haben.Das Problem ist nur: Sobald bei Pussy Riot ein Mann auftauchte,würden die Medien in ihm den Anführer der Gruppe sehen. Sofunktionieren einfach die eingespielten Rollenklischees.Gibt es denn überhaupt einen Anführer der Gruppe? Seit demProzess gegen Pussy Riot gelten die drei Verurteilten als eureWortführer.Ja, aber das ist Blödsinn. Nadja, Katja und Masha sind nichtunsere Wortführer, auch wenn es in den Medien immer wiederso dargestellt wird. In der Gruppe existieren schlichtweg keineHierarchien.Zumindest sind die drei inzwischen bekannt wie Popstars. Hatdas auch Neid geweckt?Nein, keine von uns strebt nach Ruhm. Wir lehnen überhauptjede Form von Personenkult ab. Es wäre aus unserer Sichtsogar wünschenswert, wenn mehr Kunst anonym produziertwürde. Stell dir vor, man wüsste bei einem Roman nicht, ob ihnthema | Russland33
ein Mann oder eine Frau geschrieben hat, ob der Autor alt oderjung ist. Man würde den Text viel unvoreingenommener lesen.Die hübsche Nadeschda »Nadja« Tolokonnikova ist in den Medienja fast zum feministischen Pin-up-Girl avanciert. Ist dasnicht besonders ironisch?Ja, klar. Aber so funktioniert die Massenkultur. Man sucht immereinen Anführer – und dabei spielen natürlich Alter und Ausseheneine Rolle. Das ist übrigens ein weiterer Grund, warum wirstets maskiert auftreten: Wir kämpfen gegen die Vermarktung desweiblichen Gesichts. Der Körper der Frau ist keine Werbefläche.Ihr versteht euch als subversive Künstler. Aber seid ihr inzwischennicht selbst Ikonen der Massenkultur?Es stimmt schon, Menschen auf der ganzen Welt imitierenund zitieren unsere Ikonografie: die neonfarbenen Strumpfhosen,die gehäkelten Sturmhauben. Den Sinn dahinter begreifennur wenige. Aber mit diesem Problem hat die moderne Kunstgenerell zu kämpfen. Nehmen wir als Beispiel den Dichter NikolajGogol. Er feierte in Russland riesige Erfolge, trotzdem fühlteer sich zeitlebens von seinen Lesern missverstanden.Ihr fühlt euch auch missverstanden?Als wir Pussy Riot ins Leben riefen, war uns von Anfang anklar, dass man uns auf sehr unterschiedliche Weise rezipierenwürde. Viele sehen in uns einfach eine schrille Musikband, unserensubversiven Charakter verstehen nur wenige auf Anhieb.Aber gerade weil wir in der Massenkultur so starke Resonanzfinden, gibt es die Hoffnung, dass sich unsere Ideen schleichendin den Köpfen der Menschen festsetzen.Ihr reist derzeit durch Europa und die USA. Warum?Wir wollen die Welt daran erinnern, dass Nadja und Mashanoch immer in Arbeitslagern ausharren. Es ist doch in solchenFällen immer das Gleiche: Ein paar Monate beherrscht das Themadie Schlagzeilen und dann scheint es plötzlich niemandenmehr zu interessieren. Damit rechnen die Machthaber in Russlandauch. Je weniger Menschen hinschauen, desto schärfer werdendie Repressionen. Deswegen ist es uns wichtig, dass die ganzeWelt den Fall genau beobachtet.Wie ist die Situation in den Lagern?Schlecht, wie in allen russischen Haftanstalten. Nadja undMasha sind getrennt voneinander in verschiedenen Straflagernuntergebracht. Beide leben jeweils mit rund 120 Frauen in einerBaracke. Alles ist darauf ausgelegt, den Häftlingen keinerlei persönlichenFreiraum zu lassen. Wenn eine Frau gegen eine Regeldes Lagers verstößt, wird die gesamte Baracke bestraft. Nachtsschlafen die Frauen auf engstem Raum in Etagenbetten. Undauch tagsüber müssen sie alles gemeinsam machen: Essen,Waschen, Marschieren. Und natürlich: Arbeiten.Die Frauen müssen Zwangsarbeit verrichten?Ja, man will sie in der Haft durch Arbeit umerziehen. Nadjaund Masha müssen Uniformen nähen. Das ist natürlich eineganz perfide Demütigung: Sie produzieren die Mäntel derjenigen,die sie festgenommen haben.Wie geht es den beiden psychisch?Masha ist sehr kampfeslustig. Sie hat erst kürzlich mit einemelftägigen Hungerstreik erreicht, dass die Behörden die Haftbedingungenetwas lockerten. Das war für sie ein großer Triumph.Als nächstes will sie im Lager ein Theater gründen. Natürlichwird das Schwierigkeiten mit der Lagerverwaltung geben. AberMasha hat sich das in den Kopf gesetzt. Und sie kann sehr hartnäckigsein.Und Nadja?Schon seit der Untersuchungshaft leidet Nadja unter extremenKopfschmerzen. Sie erhält jedoch keine vernünftige medizinischeBehandlung. Aber selbst wir können nur schwer einschätzen,wie es Nadja tatsächlich geht. In ihrem Lager sitzenviele politische Gefangene ein, deswegen hat die Lagerleitungeine sehr strikte Informationsblockade errichtet. Gestern erreichteuns endlich wieder ein Brief von ihr. Der erste seit zweiMonaten! Darin riss Nadja sogar ein paar Witze. Das lässt hoffen,dass es ihr besser geht.Masha und Nadja sind junge Mütter. Dürfen die beiden ihreKinder sehen?Als Nadja noch in Untersuchungshaft war, bekam sie ihreTochter einmal kurz zu Gesicht. Allerdings getrennt durch eineGlasscheibe. Seither waren die Kinder jeweils einmal zu einemKurzbesuch im Lager. Für die Kinder ist es natürlich extremhart, ihre Mütter nicht sehen zu können. Eigentlich sieht dasrussische Strafrecht vor, dass Mütter ihre Haftstrafe erst antretenmüssen, wenn die Kinder das 14. Lebensjahr erreicht haben.Doch im Fall von Pussy Riot gilt diese Regel anscheinend nicht.Ein weiterer Beleg für den Zynismus der Mächtigen. Die Kinderleiden unglaublich unter der Situation.Die Mütter vermutlich auch.Ja, natürlich. Allerdings möchte Masha überhaupt nicht, dassihr Sohn sie im Lager besucht. Sie will einfach nicht, dass er seineMutter in diesem Elend sieht. Sie meint, es wäre für den Kleinenzu traumatisierend.Eine Mehrheit der Russen befürwortet die harten Strafen gegenPussy Riot. Wie erklärt ihr euch das?Die Menschen werden durch die Medien regelrecht aufgehetzt.Das russische Fernsehen berichtet vollkommen einseitigüber uns. Und es wurden sehr schnell Legenden in die Welt gesetzt:Manche Russen glauben, dass wir in der Kathedrale unsereRöcke gelüftet hätten. Andere sind der Meinung, wir hättenim Altarbereich nackt getanzt. Die Stimmung gegen uns wurdedurch diese Gerüchte künstlich geschaffen.Hattet ihr befürchtet, dass euch das »Punk-Gebet« ins Gefängnisbringen könnte?Nein! Keiner hatte damit gerechnet. Aber in Russland passiertvieles, womit niemand rechnet. Das Urteil ist ja vollkommenabsurd: Drei junge Frauen landen im Arbeitslager, weil siein einer Kirche getanzt haben. Das konnte sich niemand vorstellen.Wir haben niemanden verletzt und nichts beschädigt. Wemsollen wir denn mit unserer Aktion geschadet haben?Aber könnt ihr nachvollziehen, dass Menschen sich in ihrenreligiösen Gefühlen verletzt sahen?Natürlich war uns vorher klar, dass wir auf Ablehnung stoßenwürden. Auch viele Oppositionelle, die zuvor mit uns sympathisierten,haben sich nach der Aktion von uns distanziert.Aber wir wollten niemanden beleidigen. Wir haben die Kathe-34 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
drale bewusst gestürmt, als kein Gottesdienst stattfand und nurwenige Gläubige anwesend waren. Besonders heilig ist der Ortaber ohnehin nicht!Was meint ihr damit?Die Kathedrale ist ein Ort der Heuchelei. In dem Gebäudegibt es nicht nur den Sakralraum, sondern auch Bankettsäle, dieman mieten kann. Oben wird gebetet, unten gefeiert – mit Musik,Tanz und halbnackten Frauen. Es ist eigentlich keine Kirche,sondern ein Supermarkt.Trotzdem: Die Kathedrale ist in Russland das Zentrum des religiösenLebens. Hätte euer Protest nicht woanders stattfindenkönnen?Nein, definitiv nicht! Kein anderer Ort hätte dieselbe Symbolikgehabt, kein anderer Ort hätte solche Reaktionen ausgelöst.Unsere Performance war schockierend, aber sie hat die Menschenzum Nachdenken gezwungen und sie aus ihrer Apathie gerissen.Insofern muss man sagen: Es war genau der richtige Ort! Aber wirwollen noch einmal klarstellen: Unser Protest richtete sich nichtgegen die Religion oder die Gläubigen. Wir wollten ein Zeichensetzten gegen die gefährliche Nähe zwischen Staat und Kirche,die sich in unserem Land etabliert hat. Die derzeitige Situation isteinzigartig in der gesamten russischen Geschichte: Die orthodoxeKirche ist nicht mehr autonom, sondern ein Instrument in denHänden der Mächtigen. Sie ist ein Werkzeug, mit dem die Machthaberdas Bewusstsein der Bevölkerung manipulieren.Was heißt das konkret?Patriarch Kyrill I., das Oberhaupt der Kirche, weist alle Gläubigenan, bei den Wahlen für Wladimir Putin zu stimmen. Daskommt einer moralischen Erpressung gleich. Kyrill I. hat enormenEinfluss, denn 100 Millionen Gläubige hören auf sein Wort.Wenn es jemanden gibt, der den orthodoxen Glauben beleidigt,dann ist es der Patriarch selbst. Er diktiert seiner Gemeinde, wensie wählen soll. Damit raubt er den Menschen praktisch ihrebürgerlichen Freiheiten.Das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« hat Anfang des Jahresberichtet, dass es dem russischen Geheimdienst gelungen sei,die drei inhaftierten Frauen während der Untersuchungshaftgegeneinander auszuspielen. Ist Pussy Riot de facto auseinandergebrochen?Natürlich kennen wir diese Gerüchte. Aber sie sind einfachnicht wahr. Die Gruppe hält nach wie vor eng zusammen. Wirhaben das Gefühl, dass man solche Legenden ganz bewusst lanciert,um Pussy Riot zu diskreditieren. Es ist ja nicht das einzigeGerücht, das im Umlauf ist.Meint ihr damit das Gerücht, Jekaterina »Katja« Samuzewitschsei aus der Haft entlassen worden, weil sie mit der Staatsanwaltschaftkooperiert habe?Ja. An diesem Fall lässt sich sehr schön studieren, wie solcheKampagnen funktionieren. Als Katja auf Bewährung freikam,war das für Pussy Riot ein großer Sieg. Und nun versucht man,es als Niederlage zu verkaufen: Katja sei nur deswegen freigekommen,weil sie die beiden anderen verraten habe.Foto: Sarah EickUnd an dem Gerücht ist nichts dran?Überhaupt nichts. Es ist einfach ein dummer Propaganda-Trick: Man versucht, jeden unserer Siege in eine Niederlage umzudeuten.Ein anderes Beispiel: Als Pussy Riot vor Gericht stand,haben sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit uns solidarisiert.Auch das war für uns ein immenser Triumph. Dochplötzlich schrieben russische Zeitungen: Die Unterstützung ausdem Ausland beweise, dass wir bezahlte Agenten des Westensseien.Hat das Urteil eure künstlerische Arbeit verändert?Wir wussten ja schon immer, dass politischer Aktionismusin Russland gefährlich ist, deswegen hat das Urteil unsere Vorgehensweisenicht grundsätzlich in Frage gestellt. Aber eine Sachehat sich natürlich ganz radikal verändert: Wir tragen nun auchVerantwortung für unsere Freundinnen im Arbeitslager. Bei jedemSchritt, denn wir machen, müssen wir mitberücksichtigen,welche Konsequenzen das für die beiden Inhaftierten habenkönnte.Um eure eigene Sicherheit sorgt ihr euch nicht?Wir fürchten nicht unbedingt, dass man uns verhaften wird.Natürlich werden wir im Internet immer wieder bedroht, beispielsweisevon fanatischen Christen. Das ist unheimlich, aberwir sind ja durch die Anonymität geschützt. Wir hatten allerdingsgroße Angst um Katja, als sie vor einem Jahr aus der Haftentlassen wurde. Ihr Bild ging schließlich um die Welt. Niemandwusste, was passieren würde, wenn sie sich wieder auf MoskausStraßen traut.Und? Was passierte?Die Menschen wollten ihr die Hand schütteln.Fragen: Ramin M. Nowzadpussy RiOtDas feministische Künstler-Kollektiv gründete sich 2011als Protest gegen die erneute PräsidentschaftskandidaturPutins. Markenzeichen der jungen Frauen sind grelle Kleiderund bunte Masken. Eine Perfomance auf dem RotenPlatz machte die Gruppe Anfang 2012 schlagartig bekannt.Nach einem »Punk-Gebet« in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale wurden im Februar 2012 drei Mitgliederfestgenommen und später wegen »Vandalismus« und»Rowdytum« zu je zwei Jahren Arbeitslager verurteilt. <strong>Amnesty</strong>hat die drei Verurteilten als gewaltlose politische Gefangeneanerkannt und fordert die sofortige Freilassungder beiden noch inhaftierten Frauen.Mehr zu Pussy Riot finden Sie in unserer iPad-App: www.amnesty.de/appthema | Russland35
Modell der harten Hand. Plakat mit Fotos von vermissten Personen im Büro der Bürgerrechtsorganisation »Memorial« in Inguschetien.Hinterden BergenGewalt, staatliche Willkür und Korruption sind in denKaukasus-Republiken alltäglich. Von Bernhard Clasen36 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Foto: Andrea Bruce/Noor/laifJeden Monat veröffentlicht das Internet-Portal »KavkaskijUzel« der russischen Menschenrechtsorganisation »Memorial«Statistiken über Tote und Verletzte im Nordkaukasus.Allein zwischen dem 8. Juli und dem 4. August 2013kamen demnach 44 Menschen in der Region ums Leben.Die monatlichen Zahlen variieren etwas, doch immer ergebensie das gleiche Bild: Gewalt prägt den Alltag im Nordkaukasus.Epizentrum der Auseinandersetzungen ist die knapp dreiMillionen Einwohner zählende Teilrepublik Dagestan. In keinerRegion Russlands wohnen so viele ethnische Gruppen auf so engemRaum zusammen wie in Dagestan. 14 Staatssprachen zähltdie Republik.Die Ernennung von Ramasan Abdulatipow zum Präsidentender Republik Dagestan Anfang des Jahres interpretierten vieleals Indiz dafür, dass Moskau tatsächlich an Stabilität in der Regiongelegen ist. Abdulatipow will sich am russischen Fortschrittin Gestalt von »Marktwirtschaft, Kapitalismus und Demokratie«orientieren, die feudalen Strukturen in seiner Heimat abschaffenund die Korruption bekämpfen. Es könne ja wohl nicht sein,dass sich Bezirkschefs nur dann in ihren Verwaltungsgebäudensehen ließen, wenn es darum gehe, den Haushalt zu verteilenund sich nicht einmal die Mühe machten, einen Blick in dieSchulen und Krankenhäuser zu werfen, so Abdulatipow.Zahlreiche Provinzgrößen und Bürokraten, ja sogar dieRegierung, wurden von Abdulatipow entlassen. Anfang Juniwurde Said Amirow, langjähriger Bürgermeister von DagestansHauptstadt Machatschkala, verhaftet und in ein Gefängnisnach Moskau transportiert. Mit dieser Verhaftung machte Abdulatipowdeutlich, dass es ihm ernst ist mit seinem Kampf gegendie Korruption. Österreichische und deutsche Wirtschaftsdelegationenbesuchten in diesem Jahr die Teilrepublik. MitGeld aus Moskau, dem Ausbau internationaler Handelsbeziehungenund dem Kampf gegen die Korruption scheint Abdulatipowdas Vertrauen der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerungzu gewinnen.Doch der Mann, der sich als Minister für Nationalitätenfragen,als russischer Botschafter in Tadschikistan und als Vermittlerim Tschetschenien-Konflikt einen Namen gemacht hat, setztnicht auf Ausgleich und Dialog, um die mörderischen Konfliktein den Griff zu bekommen. Bei einem Runden Tisch zum Thema»Grundzüge der neuen Politik in Dagestan: Erste Erfolge und gefährlicheTendenzen« diskutierten im Juli in Moskau russischeMenschenrechtler über das Vorgehen von Ramasan Abdulatipow.Er bekämpfe zwar in Dagestan die Kriminalität und dieKorruption und biete der Jugend neue wirtschaftliche Perspektiven,hieß es dort. Gleichzeitig seien jedoch Rückschritte zu beobachten.Eine bislang erfolgreiche Kommission zur Wiedereingliederungvon Aufständischen habe faktisch aufgehört zu existieren.Unter Abdulatipow ist der unter seinem Vorgänger MagomedsalamMagomedow erfolgreich installierte Dialog zwischentraditionellen Sunniten und einem gemäßigten Flügel der Salafistenzum Erliegen gekommen. Stattdessen nimmt die staatlicheRepression zu. Abdulatipows Devise, wie mit Islamisten umzugehenist, lautet: »Jede noch so geringe Zusammenarbeit mitden Banditen wird auf das Grausamste bestraft.« Die Dagestan-Spezialistin Ekaterina Sokiryanskaya berichtet von illegalen Verhaftungenund Misshandlungen von Personen, denen religiöserExtremismus vorgeworfen wird. Häuser von Angehörigen derAufständischen seien in Brand gesetzt worden, so Sokiryanskaya.Staatlich geduldete Bürgerwehren würden die Bewohnereinschüchtern. Tatsächlich treibe man mit diesen Methoden einenTeil der Opposition in die Hände der Aufständischen.Es ist ein Kampf ohne Regeln, der verfolgte Muslime radikalisiertund die Polizei, die viele Opfer in den eigenen Reihen zubeklagen hat, immer rücksichtsloser agieren lässt. Wer versucht,über das Vorgehen der Sicherheitskräfte zu recherchieren, lebtgefährlich. So wurde im Juli der Journalist Achmednabi Achmednabijewermordet. Er hatte unter anderem über Menschenrechtsverletzungenund Gesetzlosigkeit in Dagestan berichtet.Einen anderen Weg versuchte hingegen zunächst Junus-BekJewkurow, Präsident der kleinen, 400.000 Einwohner zählendenrussischen Teilrepublik Inguschetien, einzuschlagen. Derehemalige Berufssoldat, der neun Monat nach seinem Amtsantrittim Oktober 2008 bei einem Attentat schwer verletzt wurde,bemühte sich um einen Dialog mit seinen Kritikern.Es gehört zu Jewkurows Verdiensten, dass er 50 aufständischeIslamisten, die freiwillig ihre Waffen abgaben, begnadigteund ihnen half, in ein bürgerliches Leben zurückzukehren. Dochdann stagnierte der demokratische Aufbruch. Die Menschenrechtsorganisation»MASchR« und ein regierungskritischerImam werden zunehmend bedrängt. Staatliche Medien Inguschetiensbeschuldigen »MASchR« einer Zusammenarbeit mitausländischen Geheimdiensten. Und auf die Frage, warum ersich nicht in freien Wahlen im Amt bestätigen lasse, gab Jewkurowder Online-Zeitung »Gazeta.ru« im Sommer 2013 lapidarzur Antwort, es sei besser zu arbeiten, als Zeit durch Wahlkampfzu verlieren.Verhandlungen und Dialog stellten in Inguschetien undDagestan lange Zeit ein bewährtes Mittel dar, um Konflikte zudeeskalieren. Nun scheint das tschetschenische Modell der hartenHand dieses Vorgehen zusehends zu verdrängen. In derNachbarrepublik, wo im Juli 2009 die Menschenrechtlerin undJournalistin Natalja Estemirowa ermordet worden war, herrschtschon seit langem ein Klima der Angst. Vor allem Frauen sind inTschetschenien weitgehend rechtlos. Nachdem russische Menschenrechtlerim Juli vom Mord an drei Tschetscheninnen erfahrenhatten, wandten sie sich an deren Angehörige. Doch diesehatten Angst, sich zu dazu äußern.Ramsan Kadyrow, Präsident der Republik Tschetschenien, erklärte2008 in einem Interview, wie das Geschlechterverhältnisseiner Ansicht nach auszusehen habe: »Die Frau muss ihrenPlatz kennen. Die Frau ist ein Besitz, der Mann ist der Besitzer.Und wenn sich bei uns eine Frau nicht entsprechend verhält,sind ihr Mann, ihr Vater und ihr Bruder dafür verantwortlich.Und wenn eine Frau über die Stränge schlägt, wird sie unserenSitten entsprechend von ihren Verwandten getötet.«Swetlana Gannuschkina, Vorsitzende der Organisation »KomiteeBürgerbeteiligung« und Mitglied des »MenschenrechtszentrumsMemorial«, berichtet über die in Tschetschenienzwingend vorgeschriebene Kleiderordnung für Frauen. DerKopftuchzwang sei für viele erniedrigend. Immer wieder platzenbewaffnete junge Männer mitten in eine Vorlesung, überprüfen,ob Studentinnen und Professorinnen entsprechend gekleidetsind. Hinzu kommt, dass sogenannte »Ehrenmorde« inTschetschenien statistisch nicht erfasst werden. Sie kenne einDorf, in dem bereits neun Frauen ermordet worden seien, weilsie angeblich gegen den Ehrenkodex verstoßen hätten, berichtetGannuschkina. Eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, habendie betroffenen Frauen im Land Kadyrows kaum.Der Autor ist freier Journalist und lebt in Mönchengladbach.thema | Russland37
»<strong>Amnesty</strong> isthäufig unsereletzte Hoffnung«Batyr Akhilgov ist Rechtsanwalt und lebt in Inguschetien. Er vertrittunter anderem einen ehemaligen Guantánamo-Häftling vor Gericht.Wie würden Sie den Zustand des Justizsystems im Nordkaukasusbeschreiben?Das Kennzeichen dieses Systems, soweit es die Strafverfolgungbetrifft, ist vor allem Gewalt. Gefangene mit Gewalt unterDruck zu setzen, ist vollkommen alltäglich. Und das gilt nichtnur in »politischen« Verfahren. Wir diskutieren dies auch mitden Vertretern der Rechtsschutzorgane. Sie sehen einfach keinenanderen Weg, die von ihnen zu bearbeitenden Fälle abzuschließen.Das räumen sie im privaten Gespräch auch freimütigein. Letztlich ist alles auf die fehlende Professionalität zurück -zuführen. Folter ist der kürzeste Weg zum Geständnis und zur»Lösung« des Falls. Für Rechtsanwälte wird die Arbeit in diesemKontext »fabrizierter Anklagen« immer schwieriger. Es kommtzu Bedrohungen, körperlichen Übergriffen, Mordversuchen. Amschlimmsten ist es derzeit in Dagestan, aber auch in den übrigenRepubliken des Nordkaukasus kann man sich nicht sicherfühlen. In Inguschetien wurde vor Kurzem einer Anwältin eineGranate ins Fenster geworfen. Nur durch glückliche Umständegab es keine Verletzten. Außerdem werden die Anwaltskammernunter Druck gesetzt, gegen kritische Anwälte vorzugehen.Was hat Sie dazu bewogen, Anwalt zu werden?Ich bin vor zehn Jahren Rechtsanwalt geworden wegen meinesausgeprägten Gerechtigkeitsgefühls. Und wegen dieses Gefühlswar es für mich ausgeschlossen, unter den derzeitigenBedingungen in Russland Richter oder Staatsanwalt zu werden.Es blieb also nur der Beruf des Rechtsanwalts.Welche Mandanten vertreten Sie vor Gericht?Vor allem Islamisten und Personen, denen Extremismusvorgeworfen wird. In solchen Verfahren kann man wenigstensjuristisch arbeiten. In anderen Prozessen hat man als Rechtsanwaltoft nur eine Chance, wenn man bereit ist, Bestechungsgelderzu zahlen. Das Ergebnis des Prozesses hängt häufig alleindavon ab. Das ist in Extremismusverfahren anders. In solchenVerfahren spielen Bestechungsgelder praktisch keine Rolle, weildie Angst zu groß ist, bei der Annahme von Bestechungsgeldernertappt zu werden. In solchen Fällen setzt der Staat das Bestechungsverbotdurch. Natürlich hat man aber auch in Extremismusverfahrenals Strafverteidiger nur begrenzte Möglichkeiten;Freisprüche kommen praktisch nie vor. Aber in einzelnen Fällenkann es gelingen, Schwachpunkte der Anklage aufzudecken unddem Mandanten so ein paar Jahre Freiheitsstrafe zu ersparen.Und das bedeutet schon eine Menge.<strong>Amnesty</strong> hat im März einen Bericht veröffentlicht, der dokumentiert,wie Anwälte in den Republiken des Nordkaukasuseingeschüchtert, bedroht und angegriffen werden. Ein Anwaltwurde erschossen, und es besteht der Verdacht, dass staatlicheSicherheitskräfte ihn gezielt getötet haben. Kennen Sie Anwälte,die bedroht oder angegriffen wurden?Ja, ich bin selbst auch schon bedroht worden. Polizei und Ermittlungsbehördenkönnen praktisch alles machen. Es gab dennicht aufgeklärten Verkehrsunfall meines Kollegen MagamedAbubakarow, der bei einer Polizeikontrolle schwer verletzt wurde.Mein Kollege Rustam Matsev ist vor dem Besuch eines Mandantenim Gefängnis von einem Polizeiangehörigen aufgefordertworden, in Zukunft gut auf sich aufzupassen, denn er habeseinen Mandanten zum Lügen angestiftet. Die Anwältin SapiyatMagomedova wurde bei dem Versuch, einen Mandanten im Gefängniszu besuchen, gewaltsam aus der Haftanstalt entfernt.Sie wurde anschließend misshandelt, bis ein Kollege dafür sorgte,dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.Auch Sie selbst gerieten ins Visier der Behörden …In meinem Fall beschwerten sich Staatsanwaltschaft undGerichte wiederholt über mein Verhalten in verschiedenen Verfahren,in denen ich das Vorgehen der Ermittlungsbehördengerügt hatte. Das führte zu Verfahren vor der Anwaltskammer,die aber bislang zu meinen Gunsten ausgingen. Diese Verfahrenwaren für mich sehr aufwendig und hielten mich von meinereigentlichen Tätigkeit als Strafverteidiger ab. Derzeit erhalte ich38 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Foto: <strong>Amnesty</strong>/privatBedroht und angegriffen. Die Anwältin Sapiyat Magomedova sortiert die Unterlagen zu ihrem Fall. Dagestan, Juni 2012.keine Drohungen und kann meine Arbeit als Strafverteidigeraus üben, soweit das unter den geschilderten Bedingungen möglichist.Was unternehmen Anwälte, um sich zur Wehr zu setzen?Es arbeiten nur wenige Anwälte in Verfahren, in denen esum islamistisch oder extremistisch motivierte Straftaten geht.Wir ertrinken alle in Arbeit, sodass es auch aus diesem Grundkein organisiertes Vorgehen gibt, um unsere Situation zu verbessern.Dass es im Fall von Sapiyat Magomedova einmal zu einergemeinsamen Aktion gekommen ist, war eher Zufall, weilwir gerade zu einer Konferenz zusammengekommen warenund uns dann gemeinsam geäußert haben. Es gibt die Auffassung,dass das alles keinen Sinn hat und letztlich nichts bewirkt.Diese Erfahrung haben wir auch mit kritischen Erklärungen derAnwaltskammer gemacht, die letztlich nichts bewirkt haben.Was müsste sich am Justizsystem ändern?Entscheidend wäre der wirkliche politische Wille in Moskau,die derzeitigen Zustände von Grund auf zu verändern. UnserJustizsystem benötigt eine tiefgreifende Reform. Eine Schlüsselrollekommt dabei den Richtern zu, die nach meiner Auffassunggewählt werden sollten.Welche Bedeutung hat <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> für Ihre Arbeit?Die Arbeit von <strong>Amnesty</strong> ist für uns wichtig, weil dadurch Informationenüber die tatsächliche Lage international öffentlichwerden. Das gibt uns wenigstens einen gewissen Schutz, weilden Rechtsschutzorganen Reaktionen auf internationaler Ebenenicht gleichgültig sind. Wenn in konkreten Einzelfällen Hilfe erforderlichist, ist <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> häufig unsere letzteHoffnung.Interview: Peter FranckFoto: <strong>Amnesty</strong> /A. ChatelardinteRviewbatyR akhilgOvDer Rechtsanwalt lebt zurzeit in Inguschetien.Im Juli dieses Jahreswar er Gast der deutschen <strong>Amnesty</strong>-Sektion.Einer seiner Mandantenist der frühere Guantánamo-Gefangene Rasul Kudajew. Erist einer von ursprünglich 58 Angeklagten, die derzeit ineinem Verfahren in Naltschik, der Hauptstadt der TeilrepublikKabardino-Balkarien, wegen eines Rebellenüberfallsim Oktober 2005 vor Gericht stehen. Alle Umstände sprechendafür, dass auch er aufgrund eines Geständnissesangeklagt wurde, das auf Folter beruht. Im März 2013 hat<strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> unter dem Titel »Confronting theCircle of Injustice« einen Bericht über die schwierige Lagevon Rechtsanwälten im Nordkaukasus veröffentlicht.thema | Russland39
40 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Berichte42 Syrien: Bericht aus einer belagerten Stadt48 Ägypten: Land in Aufruhr52 Sudan: Der vergessene Krieg54 Porträt: Bushra Hussein56 Taiwan: Unschuldig im Todestrakt58 Interview: Andrew Gardner»Wann hat das alles ein Ende?«Die Chefredakteurin von »Oxygen« in einer zerstörten Schule.Sie will unerkannt bleiben, denn die syrische Regierung hatein Kopfgeld auf sie ausgesetzt.Foto: Carsten Stormer41
Stadt derIdealisten»Dies ist meine Heimat.« Nach zwei Jahren Krieg ist Zabadani fast vollständig zerstört.42 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Seit fast zwei Jahren wird die syrische Stadt Zabadani vonder Armee belagert. Die Menschen haben sich eingerichtetund trotzen dem Regime. Von Carsten StormerAm Morgen brachten sie den alten Mann. Die Kugel einesScharfschützen hatte den 72-Jährigen in den Rücken getroffen,die Lunge durchschlagen, war an einer Rippe abgeprallt undoberhalb der linken Niere wieder ausgetreten. »Er wird überleben,Insch’allah«, sagt Doktor Abdulhameed Al-Ghaibar, orthopädischerChirurg und Chefarzt des einzigen Krankenhausesvon Zabadani, einem Städtchen im Südwesten Syriens. Die Klinikhat ein Patientenzimmer mit vier Betten und einen Operationsraum,das muss reichen. Drei Ärzte sind ihm geblieben,die, wie er, nicht aus der Stadt geflohen sind, vor den Bomben,den Panzern, den Scharfschützen. 24 Stunden Bereitschaft. AbdulhameedAl-Ghaibar ist umgeben von Sandsäcken, ein Rollstuhlrostet im Korridor. Sein Reich zwischen Leben und Tod befindetsich im Erdgeschoss eines Hauses, das früher fünf Stockwerkehatte und nur noch eine Ruine ist – seit zwei Jahren wirdes Stein für Stein von den Panzergranaten der syrischen Armeeabgetragen. Zwei Stockwerke sind noch einigermaßen erhalten.»Eine Zeit lang sind wir noch in Sicherheit.« Doktor Al-Ghaibarstellt sich neben den Alten, der leise röchelt, prüft eine Kanüle,den Tropf, streicht ihm über den Kopf. Am Bett sitzen eine Tochterund zwei Söhne des Mannes, Wut und Tränen in den Augen.Doktor Al-Ghaibar ist ein kleiner, untersetzter Mann. DreißigJahre alt, dicke Brillengläser, ein Vollbart, durch den unermüdlichseine Finger gleiten, während er spricht. »Bin ich einTerrorist?«, fragt er. Seit zwei Jahren ist dieses notdürftige Krankenhaussein Zuhause. Hier schläft er, operiert er. Ohne Pause –weil ständig Menschen mit Schusswunden oder abgerissenenGliedmaßen auf seinem Operationstisch landen. Warum bleibter? Warum flieht er nicht aus der Stadt, wie so viele andere?»Weil es meine Pflicht ist, den Menschen zu helfen. Ich habeeinen Eid geschworen. Und dies ist meine Heimat.«Zufluchtsort in den BergenEs sind Sätze wie diese, die man überall in Zabadani hört. DieVorstadt von Damaskus war die erste syrische Stadt, die »befreit«wurde. Das war im Januar 2012. Aber frei ist hier niemand.Denn seitdem ist Zabadani eingekesselt. Auf den Bergen ringsumstehen Panzer und Artilleriestellungen der Armee, die dieStadt unaufhörlich beschießen; siebzig, achtzig Granaten fallentäglich. Kaum ein Haus, dessen oberste Stockwerke nicht zerstörtsind. Zabadani ist zu achtzig Prozent zerstört und die we -nigen verbliebenen Bewohner suchen Zuflucht in Kellern undErdgeschossen.Zabadani, 1.100 Meter über dem Meeresspiegel, umgebenvon bewaldeten Bergen, war einst Zufluchtsort reicher Syrer vorder Sommerhitze. Die Menschen waren stolz auf die Architekturihrer Stadt. Auf die Süße der Aprikosen. Auf die Schönheit derbeRichte | syRien43
Berge. Zabadani war reicher als andere Städte, die Einwohnergebildeter. Reiche Damaszener bauten hier Ferienhäuser undbrachten Wohlstand und Ansehen. Dann revoltierte das Volk gegenvierzig Jahre Diktatur und die Einwohner mussten sich entscheiden:Weiter Mitläufer zu sein und ungestört ihren Wohlstandzu genießen. Oder für ein gerechteres Syrien auf die Straßezu gehen. Die Menschen mussten nicht lange überlegen. Erst demonstriertensie, dann vertrieben sie die Soldaten, Polizisten,den Bürgermeister und Spitzel des Regimes. Die Regierungschickte Panzer und Scharfschützen. Die Villen aus dickem Mauerwerkdienen jetzt als Bunker vor dem Bombardement der Regierung.Doch noch immer ist ein letzter Rest dieses Stolzes geblieben.Neben Trotz und Hass auf das Regime ist dies einer derGründe, warum nicht alle Menschen aus Zabadani geflohen sind.Das alte Leben liegt begraben unter Trümmern. »Stadt derIdealisten« nennt man Zabadani inzwischen in Syrien, wegenMenschen wie Doktor Al-Ghaibar. Und weil sich die Bewohnerhier, anders als im Norden Syriens, nach zwei Jahren Krieg nochnicht radikalisiert haben. »Al-Qaida ist bei uns nicht willkommen«,sagt Doktor Al-Ghaibar und putzt seine Brillengläser.Träume von einem NeuanfangEin paar hundert Meter vom Krankenhaus entfernt läuft einejunge Frau an einem ausgebrannten Panzer vorbei, steigt überdie Schuttberge in den zerstörten Straßenzügen. Sie besucht erstdie ausgebrannte Moschee, dann die Kirche nebenan, deren Glockenturmvon einer Granate getroffen wurde, dann die Schulen,in denen schon lange nicht mehr unterrichtet wird. Ein Panoramader Verwüstung. Links und rechts Mauerreste voller Einschusslöcher,rostige Autowracks, Panzerschrott, metertiefeSchlaglöcher; Müll aus zwei Jahren Krieg. Penibel hält sie allesmit ihrer Kamera fest, macht sich Notizen für den nächsten Artikel.An einem Fenster ohne Scheiben erscheint ein Mann, beobachtetdie Frau auf der Straße und ruft herunter, sie solle besserverschwinden. »Kanas!«, sagt er. »Scharfschützen!« Dannzieht er sich wieder ins Innere der Ruine zurück. Kurz darauf erfolgtein Warnruf der Späher in den Bergen, die die Panzer beobachten.»Granate! Granate! Granate!«, krächzt es aus dem Funkgerät,das die Frau, wie alle verbliebenen Einwohner Zabadanis,immer bei sich trägt, um sich gegenseitig vor Angriffen oder Gefahrzu warnen. Die junge Frau rennt in einen offenen Hauseingang.Wartet den ersten Einschlag ab. Rennt weiter, geduckt, dieHände auf ihr Kopftuch gelegt, als wolle sie sich so vor herumfliegendenSplittern schützen. Sie flüchtet in eine Wohnung. Erschöpftund zitternd lehnt sie sich gegen die Mauer, ringt nachLuft. »Wann hat das alles endlich ein Ende?«, fragt sie undschließt die Augen.Selbst in der sicheren Wohnung umklammert sie den Kugelschreiberminutenlang, als müsse sie sich an etwas festhalten,darunter eine weiße Seite Papier. Still sitzt sie da, mit hängendenSchultern, als draußen die Waffen für einen Moment innehalten.Dann wieder das schrille Pfeifen der Panzergranaten, einKrachen, ganz in der Nähe. Das Minarett der Moschee ist getroffen.Gestein und Schrapnellsplitter prasseln gegen die Hauswand.Eine Staubwolke dringt durchs Fenster. Mit einem Ruckbeugt sich die zierliche junge Frau nach vorn. Und fängt endlichan zu schreiben.Sie nennt sich Nermin. Züchtig, mit Kopftuch, wie es sich imkonservativen Zabadani für Frauen gehört. Ihren richtigen Namenwill sie nicht nennen. Sie muss sich und ihre Familie schützenvor der syrischen Armee und der Geheimpolizei, die sie su-Das Wichtigste ist, nicht aufzugeben. Ein Verletzter wird in der Notfallstation deschen und ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt haben. Denn die 31-Jährige ist Chefredakteurin, Reporterin und Karikaturistin derregimekritischen Zeitung »Oxygen«. Ein Blatt mit 32 Seiten, dassie zu Beginn des Aufstands gegen das syrische Regime zusammenmit vier Freundinnen gründete. Damals, als plötzlich allesmöglich schien und sie endlich das sagen und schreiben konnten,was ihnen auf der Seele brannte, ohne dass jemand zensierteoder sie für ihre Gedanken ins Gefängnis warf. Als Menschenwie sie erst zu Hunderten, dann zu Tausenden und irgendwannzu Hunderttausenden auf die Straße gingen, um für mehr Chancenund Rechte zu demonstrieren. Als die Hoffnung bestand, dievierzigjährige Diktatur abzuschütteln. Sie träumten von einemNeuanfang: Freie Gedanken in einer freien Presse. So etwas gabes bis dahin nicht in Syrien.Der Traum ist inzwischen fast unter dem Schutt des Kriegesbegraben. Nermins Mitstreiterinnen flohen schon vor Monatenaus Zabadani – in die Flüchtlingslager im Libanon, in die befreitenGebiete des Nordens, zu Verwandten in anderen Teilen Syriens.Nur Nermin ist geblieben. »Weil es meine Pflicht ist«, sagtsie. Ihre Freundinnen liefern jetzt Texte aus dem Exil, per E-Mail,Skype, Twitter. Seit einigen Monaten erscheint »Oxygen« nurnoch als Netzzeitung. »Unsere Redaktion ist zerstört und wegender Blockade bekommen wir kein Papier mehr – oder es ist zuteuer.« Außerdem sind die meisten Bewohner aus Zabadani geflohen.Von den einst 40.000 Einwohnern sind nur noch etwa4.000 geblieben. »Und die bleiben aus Angst vor den Granatenmeistens den ganzen Tag in ihren Häusern.« Aber alle würden»Oxygen« im Netz lesen.44 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
einzigen Krankenhauses der Stadt behandelt.Vor der Revolution war Nermin Lehrerin für Englisch undInformatik in Damaskus. Jetzt sitzt sie hier im zweiten Stock eineszerschossenen Hauses, das als Redaktion herhalten muss,nachdem das alte Büro von mehreren Granaten getroffen wurdeund ausbrannte. »Sie wussten, wo wir die Zeitung drucken undhaben uns gezielt beschossen.« Mal wieder ist der Strom ausgefallen,ein Generator brummt. Der Drucker ist kaputt und dasInternet funktioniert auch nicht. In wenigen Stunden ist Redaktionsschluss.Und noch immer sind die Artikel ihrer Kolleginnennicht eingetroffen. Sie schließt eine Digitalkamera an ihrenLaptop, lädt die Bilder des Vormittags hoch: die zerstörte Moschee,eine zerschossene Schule, Menschen, die Grafittis aufWände schreiben – Hilferufe an die Welt, die sich von Syrienabgewandt hat.Leben in Trümmern. Kinderzimmer in Zabadani.»Sie haben uns dieRevolution geklaut unddie Werte verraten, für diewir auf Straße gingen.«»Verhandeln statt schießen«Von der Euphorie des Anfangs ist heute nicht mehr viel übrig.Die Hoffnung auf einen Neuanfang ist Hoffnungslosigkeit gewichen.Nur der Zorn ist geblieben und der Trotz, unter dem ständigenBombardement der Panzer und der Artillerie nicht einzuknicken.Und die Gewissheit, das Richtige zu tun. »Wir machenweiter«, sagt sie. »Bis wir siegen. Oder sie uns töten oder gefangennehmen.« Das Leben, das sie einmal kannte, existiert nichtmehr. Und so schreibt sie Woche für Woche gegen das Unrechtan. Gegen die Verhaftungen, gegen Folter, gegen die Zerstörungder Schulen, der Krankenhäuser, der Moscheen und Kirchen.Woche für Woche, seit zwei Jahren. Eine zermürbende, gefähr -liche Arbeit.ZabadaniDamaskusSyRIENbeRichte | syRien45
Lachen über Assad. Karikaturen gehören in jede Ausgabe der Zeitung.Traum von einer freien Presse. Reporter und Redakteure von »Oxygen« planen die nächste Ausgabe.46 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Es gibt inzwischen mehrere Revolutionszeitungen in Syrien.In Aleppo, in Damaskus. Die meisten sind Sprachrohre des bewaffnetenAufstands. »Oxygen« ist anders. »Wir kritisierennicht nur das Regime, sondern auch die Freie Syrische Armee«,sagt Nermin. »Denn sie haben uns die Revolution geklaut unddie Werte verraten, für die wir auf die Straße gegangen sind.« Infast jeder Ausgabe von »Oxygen« finden sich Artikel über Rebellen,die plündern, unschuldige Menschen erschießen oder sichgegenseitig bekämpfen. Und am meisten Sorge bereitet ihr dieschleichende Radikalisierung innerhalb der Freien Syrischen Armee.»Wie konnten wir es zulassen, Al-Qaida in unsere Reihenaufzunehmen? Mit welcher Rechtfertigung exekutieren mancheRebellengruppen unschuldige Menschen? Das macht uns nichtbesser als diejenigen, die wir bekämpfen.« Verhandeln stattschießen, nur so ist Veränderung möglich, glaubt sie. »Wir wolltenkeinen Krieg!«Es sind Aussagen wie diese, mit denen sich »Oxygen« in dieHerzen der Bevölkerung geschrieben hat. Doch innerhalb derFreien Syrischen Armee und der Revolutionskomitees hat sichdie Zeitung damit unbeliebt gemacht. Nermin und ihre Mitstreiterinnensind zwischen die Fronten geraten, weil sie sich nichtinstrumentalisieren lassen wollen. Auf den Straßen Zabadanisund im Internet wird die junge Frau manchmal als Verräterinund Nestbeschmutzerin beschimpft. Die neuen Herren mögenkeine Kritik. Einmal stand ein bewaffneter Mann in der Redaktionund drohte: Wenn ihr nicht für uns seid, seid ihr gegen uns.Passiert ist bislang nichts, aber sicherheitshalber hat sie zweiMänner als Reporter angeheuert, weil diese leichter Zugang zuden Rebellen bekommen, von denen einige nicht mit Frauensprechen wollen. »Als Frauen werden wir häufig nicht ernst genommen.Aber wir machen weiter, weil wir auf der richtigenSeite stehen.« Über 30.000 Leser folgen Nermin auf Facebookund auf ihrer Webseite, lesen Woche für Woche ihre Texte undReportagen. Und »Oxygen« expandiert: In der ProvinzhauptstadtRaqqa, im Norden Syriens, haben Mitstreiter im Mai eineRedaktion eröffnet.Die Ambulanz ist ein beliebtes ZielAuch Nermin hält es nicht ständig in Zabadani aus. Sie nimmtsich immer öfter Auszeiten, weil sie nachts von den Bombenund ihren toten oder verschwundenen Freunden träumt. Verbringtimmer mehr Zeit bei den Eltern, die in einen Vorort vonZabadani geflüchtet sind. »Meine Familie weiß nicht, was ichhier tue.« So sei es sicherer für sie. »Ich will sie nicht in Gefahrbringen. Sie glauben, dass es sich nicht lohnt, für unsere Sachezu sterben. Obwohl sie das Regime nicht unterstützen.« Erstheute Morgen ist sie in die Stadt zurückgekehrt, hat zwei Checkpointsder Armee passiert und zu Allah gebetet, dass die Soldatenihr die Angst nicht anmerken. Denn in ihrer Handtascheschmuggelte sie eine Mappe mit selbstgemalten Anti-Assad-Karikaturen,die in die aktuelle Ausgabe sollen. »Wenn sie micherwischt hätten, wäre ich jetzt tot oder im Gefängnis«, sagt siemit zitternder Stimme und holt die Mappe aus ihrer Tasche: einDutzend Blätter, auf denen das Leid Syriens gezeichnet ist. IhreArbeit sei wichtig, sagt Nermin. »Für die Wahrheit.« Aber sie istauch ein Drahtseilakt ohne Sicherung und Fangnetz. »ZumGlück kontrollieren die Soldaten Frauen so gut wie nie«, erzähltsie, und angesichts dieses kleinen Sieges huscht ein Lächelnüber ihr Gesicht. Die Zeitung muss pünktlich erscheinen. »Daserwarten unsere Leser. Das ist das Risiko wert.« Dann schlägt dienächste Granate ein. Das Lächeln ist verschwunden.auf deR fluchtVor dem Bürgerkrieg in Syrien sind mittlerweile mehr alszwei Millionen Menschen aus dem Land geflohen – daruntermindestens eine Million Kinder, viele von ihnen jüngerals elf Jahre. Die Zahl habe sich im vergangenen Jahr fastverzehnfacht, erklärte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR AnfangSeptember. Mehr als vier Millionen Menschen sollenzudem innerhalb Syriens auf der Flucht sein. Das CampZa’atri in Jordanien hat sich dabei mittlerweile zum zweitgrößtenFlüchtlingscamp der Welt entwickelt. Derzeit beherbergtes fast 130.000 Flüchtlinge aus Syrien. Die UNOhabt die internationale Gemeinschaft bereits mehrfach umHilfsgelder gebeten, denn es fehlt an Lebensmitteln, Bildung,verlässlicher Wasserversorgung und Unterkünften.So geht das den ganzen Tag. Die Einwohner Zabadanis habengelernt, mit der Gefahr zu leben, sie bleiben in ihren Häusernoder in dem, was davon übrig ist – umgeben von Mauern. Nurwer unbedingt muss, wagt sich auf die Straßen, wenn möglichnachts, auf Motorrädern ohne Licht, um kein Ziel abzugeben.Nur manche wagen sich tagsüber hinaus, weil sie der Gefahrüberdrüssig sind oder weil sie müssen. So wie Abu Hamid, dereinzige Krankenhausfahrer. Heute war ein relativ ruhiger Tag inDoktor Al-Ghaibars Krankenhaus. Der alte Mann wird es wohlschaffen, am Mittag kam eine Frau, der er Schrapnellsplitter ausdem Knie entfernen musste. Einem jungen Mann gipste er dasgebrochene Bein ein. Routine. Noch immer kracht es draußenund über das Funkgerät kommt die Nachricht, dass es jemandenirgendwo am Stadtrand erwischt hat. Abu Hamid verzieht dasGesicht. Draußen dämmert es, noch immer genug Licht, damitihn die Scharfschützen oder die Soldaten in ihren Stellungenauf den Bergen gut sehen können. Doch er zuckt nur mit denSchultern, grinst hinüber zu Doktor Al-Ghaibar, schickt ein StoßgebetRichtung Himmel und steigt dann in den weißen Kastenwagen,der als Ambulanz herhalten muss. Er hat Einschusslöcherim Kotflügel, in der Windschutzscheibe, in der Motorhaube.»Sobald mich die Armee sieht, beschießen sie mich. Ich bin einbeliebtes Ziel. Aber sie zielen nicht besonders gut«, sagt er undzündet sich eine Zigarette an, zieht den Rauch in die Lunge.»Daran habe ich mich gewöhnt.« Dann rast er los, im Schutz derschmalen Gassen. Zehn Minuten später ist er zurück. Im Auto einenToten und einen verwundeten Kämpfer: bärtig, blutverschmiert,bewusstlos, Schaum vorm Mund. Ein Metallsplittersteckt in seiner Schädeldecke. Es muss schnell gehen. Der Sauerstoffist knapp. Mit einem Skalpell schneidet Doktor Al-Ghaibarden Granatsplitter aus dem Schädel, verbindet den Kopf – undschickt den Mann nach Hause. Im Krankenhaus kann er nichtbleiben: »Zu gefährlich, weil wir ständig mit Granaten beschossenwerden. Jetzt ist er in den Händen von Allah!«, sagt er undwäscht sich das Blut von den Händen. Dann setzt er sich aufeine verschlissene Couch, schließt die Augen und wartet auf dennächsten Patienten. Irgendwer muss es ja machen. Das Wichtigs -te sei, nicht aufzugeben. Das sei auch das Schwierigste.Der Autor ist Journalist und lebt in Manila.Diesen Artikel können Sie sich in unserer iPad-App vorlesen lassen:www.amnesty.de/appbeRichte | syRien47
Kairo, 15. Juli 2013. Anhänger und Gegner Mursis sowie Sicherheitskräfte liefern sich Straßenschlachten.Foto: Massimo Berruti / Agence VU/laifLand in AufruhrSeit der Absetzung von Staatspräsident Mohamed Mursiüberschlagen sich in Ägypten die Ereignisse und diepolitisch motivierte Gewalt ist eskaliert. Angriffe aufreligiöse Minderheiten und sexuelle Übergriffe aufFrauen haben ebenfalls dramatisch zugenommen.Von Alexia KnappmannWie angespannt die Lage in Ägypten seit der Amtsenthebungvon Präsident Mohamed Mursi am 3. Juli 2013 ist, zeigt der deutlicheAnstieg politisch motivierter Gewalt. Allerdings war es bereitsim Vorfeld immer wieder zu gewalttätigen und teilweisetödlichen Zusammenstößen zwischen Anhängern und GegnernMursis gekommen.Einen Tag nach der Entmachtung Mursis, der seitdem aneinem unbekannten Ort festgehalten wird, wurde der ObersteVerfassungsrichter Adli Mansur als Übergangspräsident vereidigt.Am 9. Juli wurde der ehemalige Finanzminister Hazemal-Beblawi zum Chef der neuen Übergangsregierung ernannt.Zwar hieß es von Seiten der neuen Übergangsregierung, dieMuslimbrüder und die Freiheits- und Gerechtigkeitsparteimüss ten in den Übergangsprozess einbezogen werden. Vieldazu beitragen konnten diese aber nicht, da zahlreiche Führungsmitgliederund Vertraute der Muslimbrüder festgenommenwurden. Auch der Aufruf des Verteidigungsministers zuDemonstrationen, um das Militär in seinem Kampf gegen »Terrorismusund Gewalt« zu unterstützen, stand im Widerspruchzur Versöhnungsrhetorik. Immer wieder entlud sich die Spannungin Gewalt. So wurden am 5. Juli in Alexandria mindestens17 Menschen bei Zusammenstößen getötet – Anhänger wie GegnerMursis. Sicherheitskräfte erreichten den Ort erst, nachdembereits mehrere Menschen ihr Leben verloren hatten. Der 19-jährige Mohamed Badr al-Din wurde erstochen und von UnterstützernMursis von einem Dach geworfen. Am 19. Juli wurdenzwei Frauen und ein Mädchen von unbekannten Angreifernwährend einer Demonstration für den abgesetzten Präsidentenin der Stadt Mansoura erschossen.In Kairo wurden zudem mehrere Fälle von Folter durch Anhängerdes abgesetzten Präsidenten bekannt. Mindestens acht48 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Kairo, 4.Juli 2013. Gegner Mursis feiern dessen Absetzung auf dem Tahrir-Platz.Foto: Ed Giles/Getty ImagesLeichname wurden mit deutlichen Folterspuren in Kairoer Leichenhallengebracht. Fünf von ihnen wurden in unmittelbarerNähe der Pro-Mursi-Proteste gefunden. Einer der Überlebendendieser Übergriffe, der 21-jährige Mastour Mohamed Sayed, beschrieb<strong>Amnesty</strong> eindrücklich, wie er in der Nähe eines Sit-insam Rabaa al-Adawiya-Platz am 5. Juli von Mursi-Anhängern angegriffen,gefangen genommen und mit Elektroschocks traktiertwurde: »Ich hatte schreckliche Angst vor den Waffen, diesie auf mich gerichtet hielten. Sie packten mich. Sie nanntenuns ›Ungläubige‹. Dann wurden wir zum Sit-in gefahren. Ichwurde auf den Boden geworfen. Schließlich wurden wir untereinem Podest festgehalten. Ich wurde mit Stangen geschlagenund bekam Elektroschocks. Ich habe ein paar Mal das Bewusstseinverloren.« Er berichtete auch, dass er und weitere Mitgefangenegefragt worden seien, warum sie General Abdel Fattah al-Sisi unterstützten. Erst am folgenden Tag wurde er freigelassen.Nach Beobachtungen von <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> fanden Gefangennahmenund Folter von Anti-Mursi-Demonstranten meistunmittelbar nach gewaltsamen Zusammenstößen beider Lagerstatt.Gewalt gegen DemonstrierendeAuch die Sicherheitskräfte und das Militär gingen in den Wochennach der Absetzung von Mohamed Mursi wiederholt mitexzessiver und unverhältnismäßiger Gewalt gegen Demonstrierendevor. Die Situation eskalierte am 14. August, dem blutigstenTag seit der Revolution im Jahr 2011. Landesweit wurden alleinan diesem Tag mehr als 600 Menschen getötet, als Sicherheitskräftegewaltsam die Sitzblockaden von Unterstützern des abgesetztenPräsidenten in Kairo auflösten. Dabei spielten sich dramatischeSzenen ab. Ärzte berichteten, dass viele Menschenstarben, weil zahlreiche Verletzte nicht medizinisch versorgtwerden konnten. In der Leichenhalle von al-Zinhoum versuchtenVerwandte verzweifelt, die Leichname ihrer Angehörigenmit Eis zu kühlen, während sie auf eine Autopsie warteten. AlsReaktion auf die gewaltsamen Räumungen der Sitzblockadenriefen Mursi-Anhänger zu landesweiten Protesten auf. Dabeikam es erneut zu Zusammenstößen. Nachdem die Sitzstreiksvon Mursi-Anhängern durch Polizei und Armee geräumt wordenwaren, griffen Demonstranten in den folgenden Tagen inverschiedenen Städten Regierungsgebäude, Polizeistationen sowieSicherheitspersonal an. Die brutale Reaktion der Sicherheitskräfteund der Einsatz tödlicher Munition waren unverhältnismäßig.In den folgenden Tagen wuchs die Zahl der Toten auf mehrals 800 Menschen an, 3.800 Personen wurden verletzt. Sicherheitskräfteund Militärs unterschieden dabei nicht zwischengewalttätigen und gewaltlosen Demonstranten, weshalb auchunbeteiligte Zuschauer getötet wurden. Vor dem Einsatz vonSchusswaffen wurden die Demonstranten nicht ausreichendbeRichte | ägypten49
gewarnt, ein sicherer Ausweg für Verletzte wurde nicht gewährleistet.Stattdessen wurden sogar Feldkrankenhäuser von denSicherheitskräften angegriffen. Zudem gab es Berichte überMisshandlungen von Gefangenen durch Angehörige der Sicherheitskräfte,Festgenommene wurden teilweise geschlagen underhielten Elektroschocks.Anstieg der Gewalt gegen koptische ChristenSeit der Absetzung von Mohamed Mursi, insbesondere aber seitder gewaltsamen Auflösung der Protestlager seiner Anhänger,gab es aus mehreren Städten Berichte über zahlreiche Angriffeauf koptische Christen, ihre Kirchen, Geschäfte und Häuser. Dabeiwurden mehrere Menschen getötet. Am 5. Juli 2013 griff einebewaffnete Menschenmenge in der Nähe von Luxor innerhalbvon 18 Stunden mehr als hundert Häuser und Geschäfte vonChristen an. Trotz wiederholter Hilferufe griffen die lokalen Sicherheitskräftenicht effektiv ein, um die Gewalt zu beenden.»Der Angriff dauerte 18 Stunden. Es gab nicht eine Tür, an dieich nicht geklopft habe: Polizei, Militär, lokale Funktionäre, dieBereitschaftspolizei, das Gouvernement. Nichts wurde unternommen«,sagte Pater Barsilious, ein Priester aus Dab’iya.Vier koptische Männer kamen bei dem Angriff ums Leben,weil Sicherheitskräfte lediglich Frauen und Kinder evakuierten,die Männer jedoch wissentlich der gewaltbereiten Menschenmengeüberließen. Vier weitere Männer wurden schwer verletzt.Zwischen dem 14. und dem 20. August zählte die Organisation»Maspero Youth Union« landesweit 38 Kirchen, die niedergebranntwurden und weitere 23 Kirchen, die teilweise zerstörtwurden. Dutzende Häuser und Geschäfte wurden geplündertoder niedergebrannt. Die jüngsten Berichte über religiös motivierteGewalt gegen koptische Christen sind auch deshalb sehrbeunruhigend, da Anlass zu der Annahme besteht, sie könntenaufgrund einer unterstellten oder angenommenen Gegnerschaftzu Mohamed Mursi – und damit aus Vergeltung – ins Visiergeraten sein. Die Gewalt gegen Angehörige der koptischenMinderheit hat bereits seit der »Revolution des 25. Januar« starkzugenommen. Während der fast dreißigjährigen Regentschaftvon Hunsi Mubarak gab es insgesamt 15 gravierende Angriffeauf koptische Christen. Während der anschließenden 17-monatigenHerrschaft des Militärrates wurden mindestens sechs Angriffeauf Kopten bekannt. Während der einjährigen Amtszeitvon Mursi wurden weitere sechs Angriffe dokumentiert. Diestaatlichen Behörden müssen umgehend Maßnahmen ergreifen,um Christen und andere Minderheiten in Ägypten vor Angriffenzu schützen.Wiederkehrendes Muster sexueller ÜbergriffeAuch Frauen wurden erneut Opfer brutaler Angriffe. Die Demonstrationenvor und nach der Absetzung Präsident Mursislösten eine neue Welle sexueller Übergriffe auf Frauen aus. Bereitsin der Nacht vom 30. Juni zählte die Initiative »OperationAnti-Sexual Harassment/Assault« (OpAntiSH) 46 sexuelle Übergriffeauf Frauen rund um den Tahrir-Platz in Kairo. Insgesamtwurden in den ersten Tagen der Demonstrationen mehr als 170Angriffe gezählt.Diese Form von geschlechtsspezifischer Gewalt ist nicht neuin Ägypten. Auch in der Vergangenheit wurden Frauen bei Demonstrationenimmer wieder von gewalttätigen Mobs angegrif-Kairo, 20.August 2013. Sitzstreik von Mursi-Anhängern am Rabaa al-Adawiya-Platz.Nazla, 20.August 2013. Die koptische Kirche des Ortes hundert Kilometer50 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
fen, sexuell belästigt und teilweise vergewaltigt. Dabei folgendie Angriffe einem klaren Muster: Die Frauen werden von Dutzenden,wenn nicht Hunderten von Männern umringt, die ihnenKleider und Schleier vom Körper reißen und sie begrapschen.In manchen Fällen werden die Frauen auch Opfer vonVergewaltigung. Häufig kommen dabei Waffen zum Einsatz. DieTäter werden fast nie zur Rechenschaft gezogen, während dieOpfer sich nicht auf Hilfe durch die Sicherheitskräfte verlassenkönnen. Zwar gab das Innenministerium im Mai die Gründungeiner speziellen, nur aus Frauen bestehenden Polizeieinheit bekannt,die gegen sexuelle Belästigung und Gewalt an Frauenvorgehen soll. Diese Einheit wurde allerdings während der Demonstrationenrund um die Absetzung Mursis nirgendwo beobachtet.An Stelle der Sicherheitskräfte engagierten sich stattdessenFreiwillige und Menschenrechtsaktivisten. Unermüdlich undunter großem Risiko waren sie im Einsatz, um Frauen und Mädchenin Sicherheit zu bringen und sie medizinisch, psychologischund juristisch zu unterstützen.Die Tatsache, dass sich diese Angriffe auf Frauen bis zumheutigen Tag wiederholen, weist auf dramatische Weise auf diemassiven Versäumnisse aller bisherigen Regierungen hin, geschlechtsspezifischeGewalt gegen Frauen und Diskriminierunggezielt und effektiv zu bekämpfen. Dabei stellt die Gewalt imRahmen der Demonstrationen lediglich einen Ausschnitt dar.Eine Studie von UN-Women vom April 2013 zeigt, wie weit verbreitetdas Problem in Ägypten ist. Darin geben 99,3 Prozent[sic!] der befragten Frauen an, bereits eine Form der sexuellenBelästigung im Alltag erlebt zu haben. Fast 60 Prozent wurdensüdlich von Kairo wurde vermutlich von Mursi-Anhängern zerstört.Fotos: Luca Sola/Contrasto / laif, Scott Nelson/Redux/laif»Der Notstand wird dazumissbraucht, Menschen -rechts verletzungenzu begehen.«demnach bereits mindestens einmal Opfer physischer Übergriffe.Die Täter hingegen werden fast nie verurteilt. Stattdessensehen sich Frauen, die Angriffe oder Belästigungen zurAnzeige bringen wollen, häufig mit gleichgültigen Beamtenkonfrontiert. Dass keine der politischen Kräfte und Parteien dieGewalt vorbehaltlos verurteilt hat, unterstreicht diese Haltung.Einige Parteien instrumentalisierten die Vorfälle sogar, um ihreGegner zu diffamieren und zu »beweisen«, dass es sich bei denDemonstranten der Gegenseite um Kriminelle handele. All diesbelegt, dass es absolut unerlässlich ist, dass die ägyptischen Behördenendlich einen umfassenden Aktionsplan vorlegen, umdie sexuelle Gewalt und Diskriminierung im Land zu bekämpfen.Keine Versöhnung ohne AufklärungDie brutale Auflösung der Proteste und die hohen Opferzahlenlassen es als sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass es bald zueiner politischen Lösung kommt. Um überhaupt eine realistischeChance für einen Versöhnungsprozess zu erhalten, müssendie ägyptischen Behörden die Gewalt gegen Demonstranten,Frauen und Minderheiten umfassend und unabhängig untersuchenund die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. BisherigeUntersuchungen durch die ägyptischen Behörden habenbislang jedoch nicht zur Aufklärung und Gerechtigkeit für dieOpfer beigetragen. Menschenrechtsverletzungen, die durch Angehörigeder Sicherheitskräfte verübt wurden, führten in derVergangenheit fast nie zu Verurteilungen. Angesichts der angespanntenSituation wäre eine transparente Untersuchung, derenErgebnisse für alle Seiten nachvollziehbar sind und in derenKonsequenz die Verantwortlichen in fairen Verfahren angeklagtwerden, zentral für einen Versöhnungsprozess.Die bisherigen Kenntnisse über die eingeleiteten Untersuchungender Gewalt durch die Generalstaatsanwaltschaft gebenjedoch kaum Grund zur Hoffnung. Zwar wurden Angehörige derSicherheitskräfte und des Militärs in Verbindung mit der jüngstenGewalt gegen Demonstrierende vernommen. Kein einzigerwurde jedoch verhaftet. Stattdessen wurden Hunderte Mursi-Unterstützer in Verbindung mit den Ausschreitungen festgenommenund mehrheitlich gegen Kautionszahlungen wiederfreigelassen. Dass zudem der Notstand verhängt wurde, ist besorgniserregend,da bereits unter Husni Mubarak die staatlichenStellen regelmäßig den Notstand dazu missbraucht hatten,um die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen undMenschenrechtsverletzungen in Straflosigkeit zu begehen.Die Autorin ist Politikwissenschaftlerin und Ägypten-Expertin derdeutschen <strong>Amnesty</strong>-Sektion.beRichte | ägypten51
Niemandwird verschontSeit mehr als zwei Jahren bombardiert die sudanesischeRegierung die eigene Bevölkerung in den GrenzregionenSüdkordofan und Blue Nile. Sie lässt keine humanitäreHilfe von außen zu und die internationale Gemeinschaftignoriert die Ereignisse in diesen Regionen völlig.Von Franziska Ulm-Düsterhöft und Alfred BusseDarfurSUDANSüdkordofanSÜDSUDANBlue NileAls Dahia am 26. Februar 2013 mit ihrer vierjährigen Cousine ineinem sudanesischen Dorf in der Nähe der Grenze zu Äthiopienund Südsudan spielt, ertönen plötzlich Flugzeuggeräusche. Dasherannahende Antonow-Flugzeug lässt erst eine Bombe fallenund kurz danach zwei weitere.Dahias Cousine ist auf der Stelle tot. Die achtjährige Dahiawird an Kopf und Händen verletzt. Sie ist noch am Leben, als ihrVater sie erreicht. Zwei Stunden lang trägt Yusuf Fadil Muhammedseine Tochter auf den Armen durch die Wüste, in der verzweifeltenHoffnung, zur Grenze zu gelangen und medizinischeHilfe zu bekommen. Doch auf dem Weg dorthin stirbt sie.Der Unglücksort war nur eine von vielen Stationen, die Dahiamit ihrer Familie auf der Flucht vor den Antonows zurücklegte.Als vor mehr als zwei Jahren der Krieg zwischen der Regierungin Karthoum und den Rebellen in den sudanesischen BundesstaatenSüdkordofan und Blue Nile ausbrach, flohen ZehntausendeMenschen vor den willkürlichen Bombardierungenund Angriffen der sudanesischen Armee in den Südsudan. ZweiJahre später warten noch immer mehr als 200.000 Flüchtlingein Lagern im Südsudan auf eine Rückkehr in den Sudan. Dennobwohl die gewaltsamen Zusammenstöße zwischen sudanesischerRegierung und Rebellen abgenommen haben, geht dieGewalt gegen die Zivilbevölkerung weiter.Immer wieder lässt die sudanesische Regierung die Gebietein Südkordofan und Blue Nile bombardieren. Dabei werden Zivilistenverletzt und getötet, Häuser, Schulen, Gesundheitszentrenund Ackerland zerstört. Zudem wurden Dörfer auch durch Bodentruppenangegriffen: Zivilisten wurden gezielt attackiert undbeschossen, ihre Häuser geplündert und in Brand gesteckt.Zwar gibt die sudanesische Regierung an, ihr Kampf richtesich gegen die »Sudan Peoples’ Liberation Movement-North«(SPLM-N), Übergriffe gegen Zivilisten stellen jedoch keine Ausnahmedar. Es scheint, als wolle die sudanesische Regierung dieBewohner der betreffenden Gebiete für ihre vermeintlicheUnterstützung der SPLM-N bestrafen. Gleichzeitig erhaltenHilfs organisationen keinen Zugang zu der Region.Das Vorgehen der sudanesischen Regierung gegen die eigeneBevölkerung kann als Kriegsverbrechen gelten, wenn nichtsogar als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Satellitenbilderdokumentieren das Ausmaß der Übergriffe: Sie zeigen Dörfer,die von der sudanesischen Armee flächendeckend zerstört wurden– dabei wurden weder Häuser, noch Schulen oder Moscheenverschont. Flüchtlinge berichten, dass Menschen in ihren Häusernverbrannten oder erschossen wurden.Foto: Pete Muller/AP/pa52 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Flächendeckende Zerstörung. Flüchtlinge in Südkordofan, Mai 2012.Die Menschen fliehen vor den Angriffen von einem Ort zumnächsten, während die Versorgungslage immer dramatischerwird. Zahlreiche Ackerflächen wurden zerstört, Lebensmittellieferungenvon außen werden kaum zugelassen. Bildung und medizinischeVersorgung gibt es so gut wie gar nicht mehr.Auf diejenigen, die es über die Grenze in ein Flüchtlingslagerim Südsudan schaffen, wartet bereits die nächste Gefahr. Diemeisten Lager werden inzwischen von der SPLM-N kontrolliert,die dort neue Kämpfer rekrutiert – freiwillig oder unter Zwang.Verantwortlich für die Angriffe auf die Zivilbevölkerung istder Mann, der bereits durch schwere Menschenrechtsverletzungenin einer anderen Region bekannt wurde: Der sudanesischePräsident Omar al-Bashir wird seit 2009 mit internationalemHaftbefehl wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen dieMenschlichkeit in Darfur gesucht. Im Jahr 2010 wurde der Haftbefehlum den Straftatbestand des Völkermordes erweitert.Für die Menschen in Darfur gibt es auch zehn Jahre nach Beginndes Konflikts kaum Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit.Noch immer leben etwa 1,5 Millionen Menschen in Flüchtlingslagern.Mehr als 300.000 Menschen sind allein seit Januar2013 aus Darfur vor neuer Gewalt geflohen. Weitere 50.000Menschen suchten in den vergangenen Wochen Schutz im benachbartenTschad. Die Lage der Zivilbevölkerung spitzt sich invielen Gebieten im Osten und Süden Darfurs dramatisch zu.Nach UNO-Angaben fliehen die Menschen vor neuen Kämpfenzwischen der sudanesischen Armee und Rebellengruppen, aberauch vor inter-ethnischen Auseinandersetzungen. Die sudane -sische Armee setzt die teils wahllosen, teils gezielten Angriffeund die Bombardierung der Bevölkerung in Darfur fort. DieMenschen sind Angriffen, Plünderungen und sexueller Gewaltdurch Regierungstruppen und Milizen nach wie vor hilflos ausgeliefert.<strong>Amnesty</strong> und andere internationale Menschenrechtsorganisationenerhalten keinen Zugang zu dem Gebiet, wodurcheine unabhängige Berichterstattung behindert wird.Die Flüchtlingswellen der vergangenen zwei Jahre habenzwar zu Reaktionen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationenund anderer Organisationen geführt, es gibt jedoch keineinternationale Aufmerksamkeit für die katastrophale Situationin Blue Nile, Südkordofan und Darfur. Der Sicherheitsratder UNO und die Afrikanische Union haben bislang keinenDruck auf die sudanesische Regierung ausgeübt, die Menschenrechtsverletzungenzu stoppen und humanitäre Hilfe zuzulassen.Stattdessen setzt die internationale Gemeinschaft auf eineKooperation mit Sudan und Südsudan, in der verzweifeltenHoffnung, so wenigstens die Verhandlungen zwischen beidenLändern voranzutreiben und weiteren grenzüberschreitendenKonflikten vorzubeugen. Erfolgreich war sie damit bislang nicht.Franziska Ulm-Düsterhöft ist Afrika-Expertin, Alfred Busse ist Sudan-Experte der deutschen <strong>Amnesty</strong>-Sektion.beRichte | sudan53
Der Unbeugsame»Wir bringen ans Licht, was sie verstecken wollen.« Bushra Hussein während seines Besuchs des <strong>Amnesty</strong>-Sekretariats in Berlin im August 2013.54 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Foto: Sarah EickWeil er sich für die Menschenrechte einsetzt, wurde BushraHussein im Sudan ein Jahr lang inhaftiert und im Gefängnisgefoltert. Mit Hilfe von <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> konnteer nach Deutschland kommen, um die Folgen der Foltermedizinisch behandeln zu lassen. Von Daniel KreuzAls Bushra Hussein das kleine Modellflugzeug am Himmel sah,wusste er sofort: »Sie kommen.« Schnell lief der sudanesischeMenschenrechtsverteidiger vom Garten ins Haus. »Sie«, das warenMitarbeiter des Geheimdienstes NISS, die an jenem 25. Juni2011 auf der Suche nach Bushra Hussein waren.Er vermutete, dass an dem Gerät eine Kamera befestigt war,und er sollte Recht behalten: Innerhalb kürzester Zeit überflogdas Flugzeug mehrmals den Garten des Hauses in der HauptstadtKhartum. Wenige Minuten später verschafften sich vierMänner in Zivil Zutritt zur Wohnung des Menschenrechtsverteidigersund nahmen ihn fest. Damit begann sein Martyrium.Die Männer brachten ihn an einen unbekannten Ort, wo ervon neun Uhr abends bis sechs Uhr morgens gefoltert wurde: Erwurde mit Fäusten geschlagen, mit Gewehrkolben, mit Plastikrohren.Die ganze Zeit über erhielt er weder Nahrung noch Wasser.Immer wieder verlangten sie von ihm die Herausgabe einesUSB-Sticks, auf dem er seine Rechercheergebnisse über Menschenrechtsverletzungengespeichert hatte. »Aber ich wusste,wenn ich es ihnen sagen würde, würde es nur noch schlimmerwerden.« Also schwieg er.Am zweiten Tag hatte das Foltern ein Ende. Die Geheimdienstmitarbeiterbegannen, ihn besser zu behandeln: »Nichtgut, aber besser.« Auf einmal fragten sie höflich, ob er ihnen diegesuchten Informationen geben könne. »Ich merkte sofort, dassdie internationale Gemeinschaft begonnen hatte, Druck auszu -üben.« Verschiedene Organisationen, darunter <strong>Amnesty</strong>, hattenmit Kampagnen und Eilaktionen seine Freilassung gefordert.Bushra Hussein wurde 1962 in Taloudi im Sudan geboren.Der Röntgentechniker gründete in seiner Heimatregion Südkordofandie Menschenrechtsorganisation »Human Rights and DevelopmentOrganization« (HUDO), nachdem er bis 2009 Direktorder Hilfsorganisation »Sudan Social Development Organization«(SUDO) gewesen war. SUDO half Vertriebenen und bauteunter anderem Schulen und Gesundheitszentren. Gemeinsammit anderen Aktivisten betrieb Bushra Hussein zudem Menschenrechtsbildungund sammelte Beweise für Kriegsverbrechenund Menschenrechtsverletzungen, weshalb er früh insVisier der Behörden geriet.Jedes Mal, wenn hochrangige Vertreter des Regimes in dieRegion reisten, wurde Bushra Hussein festgenommen. Mal fürein oder zwei Tage, mal für eine Woche. »So oft, dass ich es nichtmehr gezählt habe.« Aber niemals sollte es so schlimm werdenwie im Juni 2011. Doch das Wissen, dass er nicht allein war, gabihm neue Kraft. Dass der öffentliche Druck schnell Wirkungzeigte, wundert ihn nicht: »Wenn du siehst, wie jemand ein Verbrechenbegeht, und du hast dessen Telefonnummer und rufstihn an und sagst: ›Ich weiß es‹, und legst sofort wieder auf. Wiewird sich diese Person wohl fühlen? Bestimmt nicht sehr gut«.Und genau so sei es auch mit der sudanesischen Regierung:»Sie mögen Leute wie mich und Organisationen wie <strong>Amnesty</strong>nicht, weil wir ans Licht bringen, was sie verstecken wollen.«Deshalb hätten sich auch die Männer, die ihn verhörten, schonam zweiten Tag anders benommen: »Selbst der Brief eines kleinenKindes kann einen Unterschied machen, denn er zeigt ihnen:›Ich weiß es.‹«Vier Wochen lang war Bushra Hussein in der Hand des Geheimdienstes.Im Juli 2011 brachte man ihn ins Kober-Gefängnisnach Khartum, wo er weder Kontakt zu seiner Familie noch zuseinem Anwalt aufnehmen konnte. Kurz nach seiner angeordnetenFreilassung wurde er im September 2011 erneut vom Geheimdienstfestgenommen und ohne Anklage inhaftiert. Im Januar2012 wurde er in den Gewahrsam der Generalstaatsanwaltschaftüberstellt. Als er am 27. Juni 2012 endlich freigelassenwurde, hatte Bushra Hussein fast ein Jahr im Gefängnis verbracht– und das nur, weil er sich für die Rechte anderer eingesetzthatte.Während seiner Haft trat er vier Mal in den Hungerstreik,um seine Freilassung zu erzwingen. Die Antwort war immerdieselbe: Er wurde in Handschellen und Ketten in eine kleine,dunkle, dreckige Zelle gesperrt. Nach seiner Freilassung war ergesundheitlich schwer angeschlagen. Doch dauerte es keinenMonat, bis Bushra Hussein wieder seine Arbeit aufnahm. Ersprach mit ehemaligen Gefangenen, die aus anderen Gefängnissenfreigelassen worden waren, um zu dokumentieren, welchePersonen noch inhaftiert waren. »Es passiert nicht selten, dassMenschen, die festgenommen wurden, für immer ›verschwinden‹.«Dieses Schicksal drohte auch Bushra Hussein. Im Dezember2012 erfuhr er, dass er erneut ins Visier des NISS geraten war,doch dass sie ihn dieses Mal nicht festnehmen, sondern entführenwollten: »Dann hätte es keine Zeugen gegeben …«Innerhalb weniger Stunden verließ Bushra Hussein Khartumund schlug sich bis in die ugandische Hauptstadt Kampaladurch. Von dort aus reiste er auf Einladung von <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>im vergangenen Mai nach Deutschland, wo er bis Septemberin Hannover medizinisch behandelt wurde.<strong>Amnesty</strong> wollte ihm die Möglichkeit geben, in Deutschlandseine Gesundheit wiederherzustellen und seine Menschenrechtsarbeitweiterzuführen. <strong>Amnesty</strong> finanzierte seinen Aufenthaltgemeinsam mit anderen Organisationen aus einemHilfsfonds für Menschenrechtsverteidiger. In Hannover wurdeer ehrenamtlich von <strong>Amnesty</strong>-Mitgliedern betreut. Sie halfenihm unter anderem dabei, eine Wohnung zu finden, organisiertenFahrdienste zu Arztterminen und zur Physiotherapie, halfenihm beim Einkaufen und übersetzten notwendige Informationen.Bushra Hussein ist ein unkomplizierter Mann mit einemfröhlichen und einnehmenden Wesen. »Noch beeindruckenderals seine Berichte über den Sudan war für uns alle der Menschselbst, der uns nun gegenüber stand«, erzählt Pamela Klagesvom <strong>Amnesty</strong>-Bezirk Hannover. »Der auch nach einem JahrHaft und Folter und nach seiner Flucht nicht den leisesten Zweifelan seiner Arbeit zeigt und seinen Weg weitergehen will. Unddas trotz allem, was es ihn schon gekostet hat.«Nach dem Ende seiner Behandlung in Deutschland kehrteBushra Hussein nach Uganda zurück. Im Sudan ist es für ihnzu gefährlich. Und obwohl er gehört hat, dass die sudanesischenBehörden auch in Uganda nach ihm suchen, setzt er sichdort weiterhin für die Menschenrechte in seinem Heimatlandein.»Nach allem, was ich im Sudan gesehen und im Gefängniserlebt habe, kann ich nicht einfach aufhören. Noch immer leidendort Menschen in den Gefängnissen. Deswegen gibt es fürmich einfach keine andere Möglichkeit, als weiterzumachen.«Der Autor ist ehemaliger Volontär des <strong>Amnesty</strong> Journals.beRichte | sudan55
Geraubte JahreMehr als zwei Jahrzehnte lang war das »Hsichih-Trio«in Taiwan von der Todesstrafe bedroht. Im vergangenenJahr wurden die drei Männer schließlich freigesprochen.Jetzt kämpfen sie für eine angemessene Entschädigung.Von Ralf RebmannDer Name Hsichih beschreibt nicht nur einen Bezirk in Taiwansbevölkerungsreichster Stadt New Taipei City. Er verweist auchauf einen der umstrittensten Fälle in der jüngeren Justizgeschichtedes Landes. Es geht um Mord, die Unabhängigkeit dertaiwanesischen Justiz und um das Schicksal von drei unschuldigenMännern, die jahrelang befürchten mussten, hingerichtetzu werden.»Jetzt sind wir wirklich frei«, sagt Liu Bin-lang. Zusammenmit Su Chien-hou und Chuang Lin-hsun ist er im Juni 2013 erstmalsnach Berlin gereist. Vorher war dies für die drei Männeraus Taiwan unvorstellbar. Seit 1991 – damals waren sie 19 Jahrealt – standen sie unter dem Verdacht, einen brutalen Mord begangenzu haben. Erst als ein Gericht sie im August 2012 zumdritten Mal für unschuldig erklärte und freisprach, durften sieTaiwan verlassen.»Ihr Prozess ist sehr bedeutend«, sagt Lin Hsin-yi. Lin ist dieVorsitzende der Organisation »Taiwan Alliance to End the DeathPenalty« und hat die Männer auf ihrer Europareise begleitet. Bedeutendsei er, weil es sich um den ersten neu aufgerollten Todesstrafen-Fallhandelt, der mit einem Freispruch endete. Auchin der Öffentlichkeit hatte der Prozess für Aufmerksamkeit gesorgt.Der Grund: Von 1991 bis 2012 wurde das Verfahren trotzdünner Beweislage dreizehn Mal wieder aufgenommen, sechsMal wurde das Todesurteil der Männer bestätigt, drei Mal wurdensie für unschuldig erklärt. »21 Jahre unseres Leben habenwir verschwendet, um unsere Unschuld beweisen zu können«,klagt Liu Bin-lang heute.Die Leidensgeschichte nimmt ihren Ausgang in der Nachtdes 23. März 1991. Yeh In-Ian und ihr Ehemann Wu Ming-hanwerden in ihrer Wohnung in Hsichih mit Dutzenden Messer -stichen tot aufgefunden. Fingerabdrücke führen die Polizei zueinem Soldaten, der die Tat gesteht. Im Verhör belastet er auchseinen Bruder, der wiederum seine Klassenkameraden Liu Binlang,Su Chien-hou und Chuang Lin-hsun als Komplizen nennt.Der Soldat wird im Januar 1992 hingerichtet. Sein Bruder kommtnach zwei Jahren Haft frei. Weiterhin auf der Anklagebank sitzenjedoch: Liu Bin-lang, Su Chien-hou und Chuang Lin-hsun.Sie werden später als »Hsichih-Trio« bekannt.»Das Justizsystem hat versucht, uns zu töten«, sagt ChuangLin-hsun. »Es ging nie darum, dass man unsere Schuld nachweist.Wir mussten ständig unsere Unschuld beweisen.« Heutekämpft er mit den gesundheitlichen Folgen der jahrelangenHaft. Er leidet an Diabetes, die Eindrücke der vergangenen Jahrehat er noch nicht überwunden. Auch nicht die mutmaßlichenMisshandlungen. Alle drei haben berichtet, während der Verhöregeschlagen und mit Elektroschocks gefoltert worden zu sein.Ihre »Geständnisse« unter Folter und die Aussage des Soldatensollten jahrelang die einzigen Beweise der Anklage bleiben.Schon bald erhält ihr Fall die Aufmerksamkeit nationaler undinternationaler Menschenrechtsorganisationen. Die »Taiwan Associationfor Human Rights« und die »Judicial Reform Foundation«setzen sich für die Männer ein, <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> startetEilaktionen für sie. Die Organisationen kritisieren, dass dieSchuldsprüche auf mutmaßlich durch Folter erzwungenen Geständnissenbasieren und diese Vorwürfe nie gründlich untersuchtwurden. Zudem könnten zahlreiche Spuren vom Tatortnicht mit Liu, Su und Chuang in Verbindung gebracht werden.Vor Gericht wird ihre Unschuld dennoch jahrelang angezweifelt.Das erste Todesurteil gegen die Männer ergeht im Februar1992. Der Oberste Gerichtshof weist es aufgrund mangelnderBeweise zurück. Bis zum Jahr 1995 werden Liu, Su und Chuangvom Hohen Gericht jedoch zwei weitere Male zum Tode verurteilt.In dieser Zeit kommt es nur deshalb nicht zur Hinrichtung,weil mehrere Justizminister sich weigern, das Todesurteilzu unterzeichnen. Im Jahr 2000 lässt der Oberste Gerichtshofden Fall nochmals aufrollen. Drei Jahre später werden sieschließlich erstmals für nicht schuldig erklärt und aus der Haftentlassen – nach elf Jahren im Todestrakt.56 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
»Jetzt sind wir wirklich frei.« Su Chien-ho,Liu Bin-lang und Chuang Lin-hsun.Foto: Ralf RebmannDoch der Prozess geht weiter. Der Oberste Gerichtshof zweifeltdie Unschuld der Männer in drei Verfahren zwischen 2003und 2011 an. Dann kommt Henry Lee, ein international anerkannterForensiker, der den Fall erneut untersucht, zu dem Ergebnis:Es gebe eine »hohe Wahrscheinlichkeit«, dass der Soldatallein den Mord verübt hat, da blutige Finger- und Schuhabdrückelediglich von einer einzigen Person am Tatort festgestelltwerden konnten. Auf diesen Bericht folgt im August 2012schließlich der dritte und letzte Freispruch.Dass die Verfahren so oft zwischen den Instanzen hin- undhergeschoben wurden, erklärt Lin mit Mängeln im taiwanesischenJustizsystem. »Wenn ein Richter bereits ein Todesurteilausgesprochen hat, ist es für einen anderen schwierig, das Urteilzu überstimmen, ohne dass er sein Gesicht verliert.« FragwürdigesBerufsethos und Unprofessionalität hätten dazu geführt,dass die Männer sechs Mal zum Tode verurteilt wurden. »VieleRichter haben die Tatumstände einfach nicht richtig untersuchenlassen.«Auch habe ihr Fall kaum Auswirkungen auf die Akzeptanzder Todesstrafe innerhalb der Gesellschaft gehabt, so Lin. In deröffentlichen Diskussion würde ihr Freispruch als Einzelfall abgetan.Zwar diskutiere man über Reformen im Justizsystem, »jedochnicht über eine Abschaffung der Todesstrafe«. Die Situationfür nationale Menschenrechtsorganisationen bleibt schwierig.»Einen Fall erneut zu eröffnen, wie es im Jahr 2000 geschah,ist derzeit fast unmöglich«, so Lin. »Die Regierung will keinzweites Hsichih-Trio.«Seit 2010 wurden in Taiwan 21 Personen hingerichtet, sechsdavon im April 2013. Aktuell sitzen 51 Personen im Todestrakt.<strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> spricht deshalb von einer »grausamenKehrtwende« und fordert die taiwanesische Regierung auf, einsofortiges Moratorium zu verhängen, wie es bereits zwischen2006 und 2009 in Kraft war.Liu, Su und Chuang kämpfen um Entschädigung. Im April2013 sprach ein Gericht jedem eine Summe von rund 167.000US-Dollar zu. Für die Dauer, die sie unschuldig in Haft gesessenhätten, sei der Betrag viel zu gering, kritisiert Lin. Bei einem späterenBerufungsverfahren lehnte ein Gericht im Juli die Forderungnach einer Erhöhung ab. Wie die »Taipei Times« berichtete,argumentierten die Richter unter anderem damit, dass die Männernicht nachweislich gefoltert wurden und die Justiz deshalbdavon ausgehen musste, dass sie schuldig gewesen seien.Die Frage, ob Chuang Lin-hsun noch Vertrauen in die Justizhabe, kann er nicht beantworten. »Wir haben so lange für unsereUnschuld gekämpft. Ob man der Justiz noch trauen kann odernicht, müssen die nächsten Generationen beantworten.«Der Autor ist freier Journalist und lebt in Berlin.»21 Jahre unseres Lebenhaben wir verschwendet,um unsere Unschuldbeweisen zu können.«beRichte | taiwan57
Die Polizei verschoss innerhalb weniger Tage fast ihren gesamten Jahresvorrat an Tränengas. Demonstration am Gezi-Park in Istanbul, Juni 2013.»Die Regierung versucjeden Protest zu unter»Die Regierung sieht in der Gewalt überhaupt kein Problem.« Verletzte Demonstranten am Taksim-Platz in Istanbul, Juni 2013.58 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
In der Türkei wurden seit Beginn der Gezi-Park-Protestezahlreiche Menschen inhaftiert, mehrere Personenstarben. Während die Aufklärung der Todesfälle kaumvorankommt, werden friedliche Proteste kriminalisiert.Ein Gespräch mit Andrew Gardner, Türkei-Expertevon <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>.In türkischen Fußballstadien ist es mittlerweile verboten,regierungskritische Lieder zu singen. Welche Formen desProtests sind in der Türkei überhaupt noch möglich?Die türkische Regierung hat Maßnahmen ergriffen, die auchsolche passiven Formen des Protests unterbinden sollen. EineMaßnahme betrifft Fußballfans, die sich inzwischen strafbarmachen, wenn sie in den Stadien die Slogans der Gezi-Park-Protesteskandieren. Es ist jedoch nicht klar, ob Personen deshalbauch strafrechtlich verfolgt wurden. Es war außerdem im Gespräch,dass Studierende ihre Darlehen und Unterkünfte in denWohnheimen verlieren, sollten sie an Demonstrationen teilnehmen.Die Regierung versucht, jegliche Form des Protests zuunterdrücken. Und vor allem diese beiden gesellschaftlichenGruppen bereiten ihr offenbar Sorgen.ht,drücken«Im Moment scheint es keine größeren Demonstrationen mehrzu geben …Es gibt immer noch Proteste, aber unregelmäßig und zumeistmit weniger Teilnehmern. Was sich überhaupt nicht veränderthat, ist die Reaktion der Polizei: Sie geht weiterhin mitübermäßiger Gewalt, Tränengas und Wasserwerfern gegen Personenvor, die von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen.Dieses Recht ist in internationalen Verträgen und in dertürkischen Verfassung garantiert. Die Behörden stellen es jedochauf den Kopf, indem sie behaupten, friedliche Demonstrationenwürden die Demokratie gefährden. Selbst Unbeteiligtewurden Opfer willkürlicher Aktionen der Polizeikräfte. DenTeilnehmern und mutmaßlichen Organisatoren der Protestedrohen außerdem Ermittlungen auf Grundlage der Antiterror-Gesetz gebung. Diese Situation ist sehr besorgniserregend.Wie viele Personen sind aufgrund der jüngsten Proteste inHaft?Darüber können lediglich die Behörden Auskunft erteilen.Bisher haben sie das nicht getan. Sicher ist jedoch, dass mehrerePersonen bei den Protesten gestorben sind. Zwei von ihnen, einPolizist und ein Demonstrant, sind vermutlich bei Unfällen umsLeben gekommen. Zu den anderen Todesfällen gehört AbdullahCömert, der Augenzeugenberichten zufolge in Antakya von einerTränengas-Granate getroffen wurde. Ali Ismail Korkmazwurde in Eskişehir von mehreren Personen derart verprügelt,dass er später an den Verletzungen starb. Wie sich später herausstellte,war ein Polizist daran beteiligt. Und dann gibt es nochden Fall von Ethem Sarısülük, der in Ankara von einem Polizistenmit scharfer Munition erschossen wurde.Fotos: NarPhotosWerden diese Fälle untersucht?Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, müssen sich diestaatlichen Sicherheitskräfte nur selten für Menschenrechtsverletzungenverantworten. Im Falle von Ethem Sarısülük wurdeder Tatort vier Tage lang nicht untersucht und die Beamtenunternahmen nichts, um Spuren sicherzustellen. Man weiß,welcher Polizeibeamte ihn erschoss. Aber selbst zwei Wochennach dem Vorfall wurde er weder festgenommen noch befragt.inteRview | andRew gaRdneR59
Bei Ali Ismail Korkmaz gab es drei Überwachungskameras, dieden Vorfall hätten aufzeichnen können. Dann stellte sich heraus,dass zwei Kameras nicht funktionierten. Und dann hieß es,das Material der dritten Kamera sei beschädigt gewesen. Im Fallvon Abdullah Cömert haben Augenzeugen mehrfach ausgesagt,dass die Tränengas-Granate ihn aus unmittelbarer Nähe traf. Erstarb Anfang Juni. Bis Ende August war noch keiner der Polizisten,die damals vor Ort waren, dazu befragt worden. Angesichtsdieser Entwicklungen fällt es schwer, optimistisch zu sein, dassdie Fälle gründlich untersucht werden.Wie rechtfertigen die türkischen Behörden den übermäßigenEinsatz der Gewalt?Die Regierung sieht in der Gewalt überhaupt kein Problem.Nur in wenigen Fällen hieß es, die Polizei sei unter Umständenzu brutal vorgegangen. Außerdem scheint die Polizei nicht darübernachzudenken, ihre Taktik zu ändern. Medienberichten zufolgehaben die Behörden jüngst 400.000 zusätzliche Tränengas-Granatengeordert. Normalerweise scheint der jährliche Bedarfbei rund 150.000 Granaten zu liegen. Dem Bericht zufolgewurden allein in den ersten zwanzig Tagen des Protests rund130.000 Granaten eingesetzt – also fast der gesamte Vorrat.Viele Demonstranten litten unter dem übermäßigen Einsatzdieses Tränengases. Gibt es für dessen Nutzung keine internationalenVorgaben?Es gibt keine spezifischen Regeln zu Tränengas, aber dazu,wann und wie staatliche Gewalt zum Einsatz kommen darf.Dazu zählen sowohl Tränengas als auch Wasserwerfer. Die VereintenNationen haben in ihren Grundprinzipien zur Anwendungvon Gewalt festgelegt, dass ihr Einsatz verhältnismäßigsein muss und nur dann erfolgen darf, wenn es unbedingt notwendigist. Außerdem muss die Gewaltanwendung ein legitimesZiel verfolgen. Die Auflösung eines friedlichen Protestes ist keinlegitimes Ziel. Die Art und Weise, wie die türkische Polizei dieDemonstrationen beendet hat, steht im Widerspruch zu all diesenPrinzipien. So zielten Polizisten direkt auf Personen odersetzten das Tränengas ein, um Demonstranten zu bestrafen, dieauf der Flucht waren.Auch Ärzte und Journalisten wurden angegriffen.Ärzte wurden festgenommen, weil sie verletzte Demonstrantenbehandelten. Ihre improvisierten Versorgungsstellen wurdenimmer wieder von der Polizei attackiert. Auch Anwälte warenbetroffen. In Istanbul wurde eine große Anzahl von Anwälten,die gegen Polizeigewalt demonstriert hatten, festgenommen.Von Seiten der Behörden wurde viel getan, um ihre Arbeitzu behindern und den Zugang zu Personen, die inhaftiert waren,zu verzögern. Journalisten, die bei den Demonstrationenwaren, wurden ebenfalls von Sicherheitskräften angegriffen –offenbar weil sie Journalisten waren.Hat die türkische Regierung versucht, auf die BerichterstattungEinfluss zu nehmen?Die Medien standen unter großem Druck, nicht über dieProteste zu berichten oder zumindest nicht aus der Perspektiveder Demonstranten. Wie die türkische Journalistengewerkschaftvor einiger Zeit mitteilte, haben rund 75 Journalisten ihren Arbeitsplatzverloren, weil sie über die Proteste berichten wollten.Sie wurden entweder zur Kündigung gezwungen oder direktentlassen. Die Zahl ist seither weiter gestiegen. Auch mehrerebekannte Journalisten waren betroffen, wie Yavuz Baydar, derOmbudsman der türkischen Tageszeitung »Sabah«, oder derKolumnist Can Dündar. Die Entlassungen kommen zu einemZeitpunkt, an dem sowieso schon viele kritische Journalistenihre Posten verlassen haben. Zudem sind gegen Journalistenweiterhin Strafverfahren unter der Antiterror-Gesetzgebunganhängig. Es gibt eine Selbstzensur der Medieninhaber, da dieseteilweise auch Bauunternehmer sind und von Aufträgen der Regierungprofitieren. Und natürlich kommt es auch bei den Journalistenselbst zu Selbstzensur.Welche Konsequenzen hat das für die Unabhängigkeit derMedien?Während der Gezi-Park-Proteste ist eine von CNN Türk ausgestrahlteDokumentation über Pinguine zum Symbol für dieSelbstzensur der Medien geworden. Informationen über die Protestewurden deshalb vor allem über soziale Medien wie Twitterausgetauscht. In Izmir wird gegen rund 38 Jugendliche strafrechtlichermittelt, weil sie über Twitter beispielsweise Informationenüber die Anzahl der verletzten Personen oder den Ort derPolizeieinsätze verbreitet haben. In Antakya gibt es einen ähnlichenFall, der 50 bis 60 Personen betrifft. Durch die jüngstenEntwicklungen hat das Vertrauen in die Medien noch weiter abgenommen.Wie haben Sie vor Ort gearbeitet?<strong>Amnesty</strong> hat vor allem zu Beginn der Proteste viel Aufmerksamkeiterhalten. Aber es war auch schwierig, die Proteste einfachnur zu beobachten. Es bestand immer die Gefahr, Opfervon willkürlicher Polizeigewalt zu werden – sei es als unbeteiligterZuschauer, als Journalist oder eben als jemand, der im Auftrageiner Menschenrechtsorganisation die Proteste beobachtet.Wie war die Zusammenarbeit mit der türkischen <strong>Amnesty</strong>-Sektion?Wir haben zusammen auf die Proteste reagiert. Die türkische<strong>Amnesty</strong>-Sektion gibt es schon seit mehr als zehn Jahren, undsie hat viele Mitglieder und Unterstützer. Das Büro liegt in derNähe des Taksim-Platzes, und die <strong>Amnesty</strong>-Aktivisten habensehr gut auf die Situation reagiert. Wir haben Statements undPressemitteilungen verfasst. Während der ersten Woche der Protestehat die türkische Sektion das Büro geöffnet und medizinischeHilfe für Demonstranten angeboten, die vor der Polizeigewaltfliehen mussten.Fragen: Ralf RebmannFoto: <strong>Amnesty</strong>inteRviewandRew gaRdneRAndrew Gardner, 36, arbeitet seit2007 als Türkei-Experte im <strong>International</strong>enSekretariat von <strong>Amnesty</strong><strong>International</strong> in London. Er beobachtetedie Gezi-Park-Proteste von Juni bis August undsprach mit Opfern von Polizeigewalt und deren Angehörigen.Gardner hat einen Master in Human Rights Law.Bevor er für <strong>Amnesty</strong> arbeitete, war er für NGOs in derTürkei und in anderen Ländern tätig.60 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
es gibt menschen,die steRben fÜR bÜcheR.In vielen Ländern werden Schriftsteller verfolgt, inhaftiert,gefoltert oder mit dem Tode bedroht, weil sie ihre Meinungäußern. Setzen Sie mit uns ein Zeichen für das Recht auffreie Meinungsäußerung!Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Menschenrechts -arbeit und retten Leben: Spendenkonto 8090100, Bankfür Sozialwirtschaft, BLZ 37020500.www.amnesty.de
Kultur: Buchmesse spezial64 Interview: Paulo Scott über Brasilien66 Porträt: Swetlana Alexijewitsch68 Arabellion: Abbas Khider im Gespräch70 Buchmesse: Ägyptens Exodus,Chinas iSlaves und mehr74 Bücher: Von »Das Spiel der Schwalben«bis »Israel ist umgezogen«76 Film & Musik: Von »Can’t Be Silent«bis »Hotel Univers«Bald nicht mehr sichtbar.Der Schriftsteller Paulo Scott beschreibt in seinemneuen Roman die elende Lage der Guaraní in Brasilien.Foto: Mauricio Lima/The New York Times/Redux/laif63
Aufgestanden gegen Ungerechtigkeit. Sozialproteste in Belo Horizonte, Juni 2013.»Brasilien ist eingrausames Land«Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesseist Brasilien. Obwohl die Bevölkerungsmehrheitafrikanische oder indigene Wurzeln hat, sindkaum Literaten aus ihren Reihen in der offiziellenDelegation vertreten. Ein Gespräch mit demSchriftsteller Paulo Scott über den Vernichtungskrieggegen die Indigenen, über subtilen Rassismusund soziale Proteste.Ihr Roman »Unwirkliche Bewohner« beschäftigt sich mit derSituation der Guaraní, einem indigenen Volk, das von seinemangestammten Land vertrieben wurde und heute in Camps vorsich hin vegetiert …Ich habe sieben Jahre für das Buch recherchiert und michmit der Kultur der Guaraní beschäftigt, insbesondere mit demMiteinander von Indigenen und »Nicht-Indigenen« in der brasilianischenGesellschaft, wenn man überhaupt von einem Miteinandersprechen kann. Wir befinden uns inmitten eines Vernichtungskriegs,der mit der Unterwerfung der indigenen Völkerbegann und an dessen Ende ihr Verschwinden stehen wird.Mit Billigung des brasilianischen Staates wird eine ganze Kulturdezimiert und zum Untergang verdammt.Ihr Buch hat den Preis der Fundação Biblioteca Nacional 2012gewonnen und war in Brasilien ein enormer Erfolg. Beginnt64 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Foto: Luiz Maximiano/laifdie Gesellschaft sich für das Schicksal der Indigenen zu interessieren?Ja, wenn auch subtil. So gibt es ein besseres allgemeines Verständnisfür diese historische Ungerechtigkeit. Es gibt kleineOrganisationen und Initiativen, die Wirkung erzielen, eine Wirkung,die vorher nicht möglich gewesen wäre. Auch das Internetspielt dabei eine wichtige Rolle. Die Leute haben heute einenbesseren Zugang zu Informationen und können leichter spenden,um jene Organisationen zu unterstützen, die gegen diewiderrechtlichen Vertreibungen und Enteignungen der indigenenGemeinden kämpfen. Das tun allerdings die wenigsten. Diemeisten sind mit ihren eigenen Problemen beschäftigt.Im Bundesstaat Mato Grosso do Sul werden bei LandkonfliktenMonat für Monat Guaraní ermordet. Die Bundesregierunghüllt sich dazu in Schweigen. Wohin führt diese Politik?Der Regierung sind durch die Zusammenarbeit der Behördenmit lokalen Interessenvertretern und den damit verbundenenAbhängigkeiten die Hände gebunden. Einige Regierungsmitgliederversuchen, diese Allianz zwischen den Räubern desindigenen Landes und den Behörden zu verhindern, aber das istnicht immer leicht, zumal sie oft nicht die nötige Unterstützungerfahren.Die Konsequenzen dieser Untätigkeit, die auf lokaler, regionalerund bundesstaatlicher Ebene vorherrscht, sind katastrophal.Die Selbstmordrate unter Jugendlichen ist in den indigenenGemeinden extrem hoch. Sie haben keine Hoffnung. DieGesellschaft gibt ihnen das Gefühl, sie wären ein Problem, einStörfall. Man nimmt ihnen ihr Land weg und sagt ihnen, dasssie nichts wert seien.Sie sind in Porto Alegre geboren, wo es auch indigene Gemeindengibt. Wie haben Sie selbst deren Diskriminierung und denRassismus wahrgenommen?Brasilien ist ein rassistisches Land, das von einer Elite dominiertwird, die jahrzehntelang jedes Bemühen um soziale undmaterielle Gleichheit unterbunden hat. Im Süden des Landes istder Rassismus noch offensichtlicher. Ich denke, dass meine Generation,also genau die, die jetzt an der Regierung ist, die indigeneKultur immer als etwas Exotisches gesehen hat, etwasFremdes, als etwas, was zudem untrennbar mit der Vorstellungvon einem Leben in Armut und Elend verbunden ist. Diese Menschenkommen als Figuren in Liedern und auf Gemälden voroder auf Volksfesten, aber eben nicht in der Realität. Eine Integrationscheint daher unmöglich, und so ist es einfacher zu sagen,dass es deshalb auch keine Lösung für das Problem gebe.Sie haben einmal gesagt, dass die brasilianische Literatur diesozialen Realitäten und den Rassismus ignoriert. Wie zeigt sichdieser Rassismus in Brasilien?Brasilien ist ein grausames Land, voller Heuchelei und Maskeraden.Wir tun so, als würde die Mischung verschiedensterEthnien und Hautfarben, die in der Vergangenheit so viel Gewaltzur Folge hatte, uns nun auf eine Stufe stellen und Gleichheitbedeuten. Das ist eine Lüge! Die meisten Brasilianer habenverschiedene ethnische Wurzeln und versuchen doch alle verzweifelt,so weiß wie möglich sein. Es gibt eine sehr subtile, fastideologische Abstufung, die verhindert, dass jemand mit dunklererHautfarbe gesellschaftlich aufsteigen kann. Es ist nichtnur eine Frage des Geldes, wie viele glauben. Die Brasilianerwissen nicht, wer sie wirklich sind. Und sie scheinen es auchnicht wissen zu wollen. Auch die brasilianische Literatur istnoch sehr zögerlich, was die Benennung dieser Probleme inunserer Gesellschaft betrifft. Es ist einfacher, über den europäischenHolocaust zu schreiben als über den Massenmord an denindigenen Völkern Brasiliens.Ausgangspunkt der aktuellen Proteste waren vor allem sozialeFragen wie Bildung, Gesundheitsversorgung, die Preiserhöhungfür öffentliche Verkehrsmittel, aber auch die Korruption.Werden diese Proteste Brasilien verändern?Es hat bereits einige bedeutsame Erfolge gegeben und ichhabe den Eindruck, dass die Ausschweifungen der Politik wenigergeworden sind. Aber wie beständig das ist und wie es weitergeht,ist ungewiss. In den vergangenen Jahren konnten die brasilianischenPolitiker machen, was sie wollten – es hatte keineKonsequenzen. Die Bürger konnten bislang nicht durchsetzen,dass die Parlamentsabgeordneten das tun, wofür sie bezahltwerden: Nämlich für das Wohl ihres Landes zu arbeiten undnicht, um ihre eigenen Taschen mit Geld zu füllen.In Europa gilt Brasilien als Land des Wirtschaftswunders unddie aktuellen Proteste zeigen Brasilianerinnen und Brasilianer,die selbstbewusst für Mitbestimmung und soziale Reformenauf die Straße gehen. Was hat sich in den vergangenenJahren verändert?Erstens haben wir heute eine stabilere und stärkere Demokratiein Brasilien als früher und zweitens macht es das Internetnahezu unmöglich, Informationen über die Unzufriedenheitder Menschen zurückzuhalten oder bestimmte Ereignisse undTaten zu verheimlichen. Man spricht von diesem Wirtschaftswunderund gleichzeitig sieht die Bevölkerung, wie Politikerschamlos ihre Macht missbrauchen und nichts gegen die strukturellenProbleme unternehmen. Das Leben in Brasilien ist teurerals je zuvor, die öffentlichen Dienstleistungen sind schlechtund extrem teuer, während die Banken gegenwärtig höhere Gewinneeinstreichen als jemals zuvor. Die Mängel in der Gesundheitsversorgung,insbesondere in den Favelas und auf demLand, waren noch nie so offensichtlich. Doch der nahezu unbegrenzteZugang zu Informationen setzt einer fast chronischenNaivität und Ignoranz ein Ende, wie sie unser Verhalten jahrelangbestimmt haben.Was ist das Thema ihres nächsten Romans?Ich werde das Thema Rassismus am Beispiel einer Familieim Süden Brasiliens behandeln – es geht um zwei Brüder verschiedenerHautfarben, etwas, das in Brasilien sehr häufig vorkommt.Fragen und Übersetzung: Sara FrembergFoto: Renato ParadainteRviewpaulO scOttPaulo Scott wurde 1966 in PortoAlegre geboren. Vor »UnwirklicheBewohner« hat er bereits einenRoman, zwei Erzählbände undeinen Gedichtband veröffentlicht. Er lebt und arbeitetin Rio de Janeiro.inteRview | paulO scOtt65
Hüterinder StimmenAm 13. Oktober wird der belarussischen Schriftstel -lerin Swetlana Alexijewitsch der Friedenspreis desdeutschen Buchhandels verliehen – einer Literatin,die trotz Repressionen der Regierung LukaschenkosTabus wie die Folgen des Afghanistan-Kriegs oderTschernobyl thematisiert. Von Barbara OertelDass die Staatsmacht mit dieser Härte und so erbarmungslosvorgegangen ist, hat mich vollkommenschockiert. Ich saß mit meinen Freunden in der Kücheund wir waren fassungslos. Wir hätten uns niemalsvorstellen können, dass das, was wir bei Alexander Solschenizynim Archipel Gulag gelesen hatten, nach der Perestroika und demZusammenbruch der Sowjetunion bei uns noch einmal Realitätwerden könnte«, sagt Swetlana Alexijewitsch.Als die belarussische Schriftstellerin über die Ereignisse imDezember 2010 in ihrer Heimatstad Minsk spricht, hält sie sichgerade in einer Wohnung in Berlin-Friedenau auf. Es ist Januar2011. Als Stipendiatin des Künstlerprogramms des deutschenAkademischen Austauschdienstes (DAAD) verbringt sie einenmehrmonatigen Arbeitsaufenthalt in der deutschen Hauptstadt– eine weitere Station einer elfjährigen Odyssee durch Westeuropa,die Alexijewitsch seit 2000 nach Paris, Stockholm, Münchenund auch nach Berlin geführt hat. Die preisgekrönteSchriftstellerin ist im persönlichen Gespräch zurückhaltend,eine Frau der leisen Töne, wobei jedes Wort mit Bedacht gewähltist. Doch bei dem Treffen in der Berliner Wohnung wird schonnach den ersten Sätzen spürbar, dass sie noch ganz unter demEindruck der Ereignisse vom 19. Dezember 2010 steht, die siehautnah miterlebt hat.An diesem Tag waren die Belarussen dazu aufgerufen, einenneuen Präsidenten zu wählen. Mit der Zulassung oppositionellerKandidaten hatte die Regierung Hoffnungen auf eine Liberalisierunggenährt. Doch diese Hoffnungen wurden im wahrstenSinne des Wortes am Abend des 19. Dezember zerschlagen, alsder Autokrat Alexander Lukaschenko Massenproteste gegen denWahlausgang zusammenknüppeln und einige seiner politischenWidersacher ins Gefängnis werfen ließ. »Dieser 19. Dezemberwird ein großes Trauma bleiben«, prophezeite Swetlana Alexijewitschdamals.Traumata, vor allem ausgelöst durch Erlebnisse während desKrieges, gebrochene Biografien, zerplatzte Träume, geheimeSehnsüchte, die großen und kleinen Katastrophen im Alltag des»Homo sovieticus« – das sind die Themen, die Alexijewitsch seitnunmehr über 30 Jahren umtreiben. Oder wie es in der Begründungder Jury für die Vergabe des diesjährigen Friedenspreisesdes Deutschen Buchhandels an die 65-Jährige heißt: »Geehrtwird eine Schriftstellerin, die die Lebenswelten ihrer Mitmenschenaus Belarus, Russland und der Ukraine nachzeichnet undin Demut und Großzügigkeit deren Leid und deren LeidenschaftenAusdruck verleiht.«Swetlana Alexijewitsch wird am 31. Mai 1948 im westukrainischenStanislaw (heute Iwano-Frankiwsk) geboren als Tochtereiner Ukrainerin und eines Belarussen. Nach dem Ende des Mi -litärdienstes ihres Vaters zieht die Familie nach Belarus, wo dieEltern in einem Dorf als Lehrer arbeiten. Nach ersten journalistischenArbeiten bei einer Lokalzeitung in Gomel nimmt Alexijewitschein Journalistik-Studium an der Staatlichen Universitätin Minsk auf. Nach ihrem Abschluss 1972 arbeitet sie für die»Land-Zeitung« in Minsk sowie das Literaturmagazin »Neman«.In dieser Zeit versucht sie sich an verschiedenen Genres wieKurzgeschichten, Essays und Reportagen. Und sie entwickelteine Methode, die ihr die größtmögliche Annäherung an das»wahre Leben« erlaubt, wie sie es formuliert. »Ich habe das Genremenschlicher Stimmen gewählt«, schreibt sie auf ihrer Homepageunter der Überschrift »Auf der Suche nach dem ewigenMenschen – anstatt einer Biografie«. » Meine Bücher erspäheund erlausche ich auf den Straßen und am Fenster. Reale Menschenerzählen von den großen Ereignissen ihrer Zeit – vomKrieg, dem Zusammenbruch des sozialistischen Imperiums,Tschernobyl. Diese Gesamtkonzeption ergibt die Geschichte desLandes.«Die Methode, Einzelschicksale literarisch zu einer Chronikder Sowjetunion und ihrer Nachfolgestaaten zu verdichten,wendet Alexijewitsch erstmals in ihrem Buch »Der Krieg hatkein weibliches Gesicht« an, das sie 1983 vollendet. Darin dokumentiertsie die Erlebnisse von Soldatinnen, Partisaninnen undZivilangestellten im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Wegendieses Buches, das als Vorlage für Theaterinszenierungen undeinen Dokumentarfilm dient und erst 1985 mit Beginn der Perestroikaerscheinen kann, wird Alexijewitsch angeklagt, dieEhre des »Großen Vaterländischen Krieges« beschmutzt zu haben.Die Zeitung, bei der sie beschäftigt ist, kündigt ihr. Im selbenJahr kommt ihr Buch »Die letzten Zeugen« heraus. Darinschildert die Autorin neben der Sicht von Kindern und Frauenauf den Krieg auch die Erfahrungen ihrer eigenen Familie imZweiten Weltkrieg und während der Stalinzeit. Das Tauwetterunter Michail Gorbatschow ermöglicht es auch Alexijewitschfreier zu arbeiten. In »Zinkjungen« aus dem Jahr 1989 kommenVeteranen aus dem sowjetischen Krieg gegen Afghanistan sowieMütter gefallener Soldaten zu Wort. Auch dieses Werk bringtAlexijewitsch mehrere Gerichtsverfahren in Minsk ein – derTitel »Zinkjunge« bezieht sich auf die Zinksärge, in denen diegefallenen Soldaten nach Hause gebracht werden. »Im Bannedes Todes« (1993) setzt sich mit Menschen auseinander, die den66 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
»Meine Bücher erspähe und erlausche ich auf den Straßen und am Fenster.« Swetlana Alexijewitsch (Mitte).Foto: Bettina Flitner/laifUntergang der Sowjetunion nicht verkraftet haben und darumihrem Leben ein Ende setzen wollen.Ein Jahr später kommt in Belarus Alexander Lukaschenko andie Macht. Sein Ziel ist es, die demokratische Verfassung auszuhebeln,die Massenmedien gleichzuschalten und jegliche kritischeStimme mundtot zu machen. Das hat auch Konsequenzenfür Swetlana Alexijewitsch. Ihr nächstes Werk »Tschernobyl.Eine Chronik der Zukunft« aus dem Jahr 1997 – ein erschütterndesund verstörendes Dokument über das Leiden und die Tragödiederer, die direkt von der Reaktorkatastrophe im April 1986 inder Ukraine betroffen waren – kann in ihrem Heimatland nichtmehr erscheinen. Überhaupt werden alle ihre Bücher, die mittlerweilein 35 Sprachen übersetzt sind, aus den Lehrplänen derSchulen gestrichen. Mit dem Preisgeld, das sie 1998 für den LeipzigerBuchpreis zur Europäischen Verständigung erhält, kauftAlexijewitsch russische Ausgaben ihres Tschernobyl-Buchesund bringt sie heimlich nach Belarus. Derweil verstärken sichdie Repressionen. Alexijewitsch wird unter anderem beschuldigt,für die CIA zu arbeiten. Ihr Telefon wird abgehört, sie darfnicht mehr öffentlich auftreten. Mit Unterstützung des Netzwerks»<strong>International</strong> Cities of Refuge Network« (ICORN) geht sie2000 für einige Jahre nach Paris.Heute lebt Alexijewitsch wieder in Minsk und das, obwohlLukaschenko nach wie vor mit unerbittlicher Härte gegen seineKritiker vorgeht. Nur dort könne sie Material für ihre Büchersammeln, sagt sie. Und sie wolle ihren Enkel aufwachsen sehen– den Sohn ihrer Nichte, derer sie sich nach dem frühen Tod ihrerSchwester angenommen hatte.Lukaschenko dürfte sich wohl kaum über die jüngste Auszeichnungfür Swetlana Alexijewitsch gefreut haben. Aber auchviele ihrer Landsleute waren geradezu empört wegen einesInterviews, das Alexijewitsch im Juni der »Frankfurter AllgemeinenZeitung« gab. Auf die Frage, warum sie auf Russisch undnicht auf Belarussisch schreibe, wird sie dort mit dem Satz zitiert:»Die belarussische Sprache ist sehr bäuerlich und literarischunausgereift.« Alexijewitsch verwahrt sich energisch gegendiese Darstellung. »Ich bin doch kein Kamikaze, dass ich solcheDinge sagen würde. Aber ich habe immer gesagt, dass ichzwei Mütter habe. Das belarussische Dorf, in dem ich aufgewachsenbin, und die russische Kultur, in der ich erzogen wurde.Wenn die russische Kultur meine Weltanschauung ist, dann istdie belarussische Kultur meine Seele.«Derzeit hat die Schriftstellerin, deren angeschlagene Gesundheitsie in diesem Sommer ins Krankenhaus zwang, bereitswieder Pläne für ein neues Buch. »Hundert Erzählungen überdie Liebe« soll es heißen.Die Autorin ist Journalistin und Osteuropa-Expertin und lebt in Berlin.pORtRät | swetlana aleXijewitsch67
»Leben«gesucht,»Tod«gefunden»Junge Araber haben gezeigt, dass sie zur Demokratie fähig sind.« Abbas Khider.Der deutsch-irakische Schriftsteller Abbas Khiderüber zweieinhalb Jahre Arabischer Frühling, dieSituation im Irak zehn Jahre nach der Invasionund die Rolle der Intellektuellen.Vieles ist in den arabischen Ländern in Bewegung geraten unddoch zeigen sich auch die Grenzen der Veränderung. Haben Sieals exil-irakischer Schriftsteller einen spezifischen Blick aufdiese Entwicklungen?Viele Araber hatten lange nicht das Gefühl, dass ihre Länderzu ihnen gehören. Die gehörten anderen. Früher den Kolonialmächten,danach den arabischen Herrschern – Generälen, Mo -narchen, Parteiführern. Der Arabische Frühling hat den Menschendas Gefühl zurückgegeben, sich das eigene Land zurückerobernzu können. Neu ist auch, wie schnell sich die Impulse vonTunesien aus verbreitet haben und dass die Araber plötzlichstolz auf sich sind, stolz darauf, was sie auf der Straße erreichthaben. Immer hieß es über die Araber: »Ihr seid unfähig zur Demokratie.«Gerade die arabischen Herrscher haben solche Sätzeüber die eigene Bevölkerung gesagt und oft haben Intellektuellezugestimmt. Die Situation heute ist eine andere. Junge Araberhaben gezeigt, dass sie zur Demokratie fähig sind. Darauf könnensie stolz sein und sie sind es auch.Im Westen haben wir von jüngeren Arabern gehört und gelesen:von Twitterern in Tunesien, Facebookern in Ägypten, Youtube-Nutzernin Libyen und Syrien. Gehen die Umbrüche alleinvon ihnen aus oder täuschen wir uns?Nein, Ältere waren kaum beteiligt. Nehmen wir mal die älterenSchriftsteller. Sie konnten gegen die Macht sein – im Exil.Die im Land blieben, waren gespalten. Sie redeten von Liebe undRevolution, tanzten aber für den Präsidenten. Dabei verloren sieauf Dauer die Fähigkeit, ein Land kulturell zu führen. Sie kritisiertennicht mehr den Präsidenten, sondern das Volk. Darauserwuchsen weitere Probleme. Am Ende hatten beide Seiten, dasVolk und die Intellektuellen, den Eindruck, nicht im selben Landzu leben.Hat sich das mittlerweile geändert?Viele Schriftsteller sind erst laut geworden, als die Veränderungenschon in Gang waren. Es ging ihnen vorher gut, sie be -kamen Geld vom Staat und aus dem Westen, sie lebten in einer68 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
»Die Islamisten, das sind die Dummen – so denkendie meisten jungen Künstler, auch ich bin davon nichtfrei. Das ist ein großer Fehler. Die Islamisten sind einTeil der Gesellschaft, man muss mit ihnen reden.«Foto: Isolde Ohlbaum/laifabgeschotteten Welt. 2005 habe ich eine Sammlung von Kurz -geschichten aus der arabischen Welt herausgegeben und darinnach dem Wort »Leben« gesucht. Es war kaum zu finden, ebensowie »Liebe« oder »Mensch«. Im Überfluss fand ich das Wort»Tod«. Das ist heute nicht mehr so, die Schriftsteller ändern sichund ihre Sprache. So optimistisch wie das Volk sind die Intellektuellenaber nicht. Wenn ich mit älteren Schriftstellern zusam -mensitze, etwa in Kairo, und sie fangen an zu sprechen, danndenke ich: »Was für großartige Ideen!« Aber wenn sie schreiben,kommt das nicht vor. Sie haben zwei Identitäten; eine, wenn siesich frei und sicher fühlen, das ist ihre private Identität. In ihreröffentlichen Identität ist davon nichts zu spüren. Wer bezahlt,bestimmt, das gilt leider immer noch für viele – arabischeSchriftsteller sind gute Geschäftsleute.Viele Schriftsteller in arabischen Ländern sagen, ihr Problemseien nicht die Herrscher oder die Bevölkerung, sondern dieIslamisten. Was ist da dran?Die Islamisten sind ein Problem. Aber sie sind auch einProdukt der Diktaturen. Im Kalten Krieg waren die Kommunistenstark in der arabischen Welt. Deswegen haben die Herrschergern mit den damals noch kleinen islamischen Parteienzusammengearbeitet, genauso wie die Amerikaner. In Ägyptenhat Sadat mit der Muslimbruderschaft kooperiert, um dieKommunisten auszuschalten. In Syrien war das so, im Irakauch. Danach gab es nur noch die Konkurrenz zwischen diktatorischenRegimen und Islamisten. Erst mit dem ArabischenFrühling hat etwas Neues angefangen, das aus diesem Dualismusausbricht.Wie gehen denn jüngere Intellektuelle in arabischen Ländernmit den Islamisten um?Ohne Dialog geht es nicht. »Die Islamisten, das sind dieDummen«, so denken die meisten jungen Künstler, und auchich bin davon nicht frei. Das ist ein großer Fehler. Die Islamistensind ein Teil der Gesellschaft und man muss mit ihnen reden.Die Islamisten sind teilweise stärker als vor der Revolution.Islamisten instrumentalisieren es gern, wenn arabische IntellektuelleUnterstützung aus dem Ausland bekommen. Dannsind sie auch noch Opfer ausländischer Interessen und nichtnur Opfer inländischer Repression. Wenn die Einmischung ausdem Ausland aufhört, ich meine hier nicht nur den Westen, sondernauch Saudi-Arabien und Katar, können sich die Islamistennicht mehr so leicht als Opfer darstellen. Damit wäre viel gewonnen.Warum hat der Arabische Frühling den Irak nicht erreicht?Die Revolution war nur in den nordafrikanischen Ländernerfolgreich, nicht in den arabischen Staaten Asiens. Sie ist inSyrien gestoppt worden und die Iraker starren gebannt dorthin.Im Irak löst das politische System keine Probleme, es produziertwelche. Die Frage im Irak ist: Ist das ein Land oder eine Ansammlungvon Banditen? Dazu kommen die Hinterlassenschaftender Amerikaner – vielerorts gibt es weder Strom noch Wasser,die Preise sind hoch, Sicherheit gibt es nicht, ein normalesLeben ist unmöglich.Gibt es keine Beispiele dafür, dass etwas besser wird?Die Bilder Saddam Husseins sind verschwunden, auch ausden Schulbüchern. Doch die Texte, die es unter Saddam gab,sind oft geblieben. Ein großer Saddam Hussein wurde entfernt,jetzt haben wir mehrere kleine Saddams. Den Irakern fehlenStolz, Hoffnung und Träume.Vor gut zehn Jahren begann die Invasion. In westlichenMedien wurde zum Jahrestag gefragt, ob sich der Irakkrieggelohnt habe. Wie beantworten Sie diese Frage?Kriege sind immer falsch. Und Saddam Hussein ist weg. AlsSaddam noch an der Macht war, versanken wir in einem Meeraus Blut und Traurigkeit. Es war uns egal, wer uns die Hand zurHilfe reichte und wie diese Hilfe aussah. Viele Iraker waren froh,als endlich die Amerikaner da waren. Dann begannen die neuenProbleme, die bis heute anhalten. Das Land ist kaputt, das Volkist erschöpft, nichts funktioniert. Damit sind nun auch die letztenHoffnungen zerstört. Im Irak wird sich nur etwas ändern,wenn sich in den Nachbarländern etwas ändert. Deswegen istder Fortgang der arabischen Revolution auch für den Irak sowichtig.Fragen: Maik SöhlerinteRviewabbas khideRAbbas Khider, geboren 1973 in Bagdad, lebt seit demJahr 2000 in Deutschland. Zuletzt erschien von ihm derRoman »Brief in die Auberginenrepublik«, der in Libyen,Ägypten, Jordanien und im Irak spielt und das irakischeSpitzel- und Folterregime zum Thema hat. Edition Nautilus,Hamburg 2013, 160 Seiten, 18 Euro.inteRview | abbas khideR69
Raus aus ÄgyptenAufgerieben zwischen Staat, Islamisten undökonomischer Krise: Chalid al-Chamissis Roman»Arche Noah« erzählt vom seit Jahren anhaltendenExodus junger Menschen aus Ägypten.Von Maik SöhlerWas ist das derzeit größte Problem Ägyptens? Das Militär,das mit einem Staatsstreich den demokratischlegitimierten Präsidenten Mohammed Mursi ausden Reihen der Muslimbrüderschaft abgesetzt hat?Oder die Islamisten, die mit gewaltsamen Protesten, aber auchmit gezielten Übergriffen auf liberale Demonstranten und vorallem auf Frauen Schlagzeilen machen? Oder der ökonomischeKollaps, der zur Verarmung großer Teile des ägyptischen Mittelstandesgeführt hat, ganz zu schweigen vonder Armut der breiten Masse?Nichts davon allein, sondern alles zugleich,meint der ägyptische Journalist undSchriftsteller Chalid al-Chamissi in seinemneuen Roman »Arche Noah«. Aus seinerSicht gibt es ein Problem, das alle anderenüberlagert: die Abwanderung von Ägypternaller Altersgruppen, sozialer Schichten undbeiderlei Geschlechts ins Ausland. Die genanntenund viele weitere Aspekte sind seinerAnsicht nach Ursachen der seit Jahrenanhaltenden Massenflucht. Sie habe begonnen,als Mubarak noch an der Macht war,und sie halte an, egal ob das Militär eine ihmgenehme Staatsführung einrichte oder obdie Muslimbrüder regierten.Chamissis Buch »Arche Noah« versammeltelf Geschichten von Ägyptern, die dasLand tatsächlich verlassen oder es zumindestverlassen wollen, aber mangels Geld, Beziehungenoder Glück vorerst zum Bleiben verdammtsind. Manchmal kreuzen sich ihreWege, gelegentlich stimmen die Gründeüberein, einige Male auch die Ziele, fast immeraber die Wünsche. »Das Leben hier inÄgypten sieht (…) so aus: keine Arbeit, keinGeld, keine Ferien, keine Freiräume«, berichtetzum Beispiel Achmad. Der Schleuser Mabrukergänzt: »Hier rauszukommen ist nämlichderzeit das Einzige, was das Land am Lebenhält, jawohl, das Einzige! Ich weiß, wovonich rede. Ich sage nur: Schattenwirtschaft.«Das Ägypten aus der Perspektive Chamissisist ein erstarrtes Land, in dem es anfast allem mangelt. Wenn es von etwas zuviel gibt, dann sind es Korruption, Unfähigkeit,Kontrolle und Islamisierung. Kleinunternehmerverzweifeln an rigiden, widersprüchlichenMaßnahmen des Staates und an der Bürokratie,die sich selbst mit viel Schmiergeld manchmal nicht umgehenlässt. Liebende sind konfrontiert mit rigiden islamischen Moralvorstellungenund mit enormen Summen, die als Brautgeld fälligwerden. Auf junge Ägypter wartet eine Jugendarbeitslosigkeitvon 70 Prozent, weder ein eigenes Einkommen noch eineWohnung stehen in Aussicht.Wer Geld hat, verlässt das Land so schnell es geht und ambes ten in Richtung USA oder Kanada. Wer keines hat, nimmtKredite auf oder versucht, eine Niere zu verkaufen, um nach Italienoder Spanien zu gelangen. »Arche Noah« ist ein gelungenes,zutiefst menschliches Buch, weil es viel vom Scheiternweiß und doch die Hoffnung nicht fahren lässt.Chalid al-Chamissi: Arche Noah. Aus dem Arabischen vonLeila Chammaa. Lenos Verlag, Basel 2013. 407 Seiten,22,50 Euro.Ägypten verlassen. Aldo arbeitete für zehn Jahre als Maurer in Italien.Foto: Nicolò Degiorgis/contrasto/laif70 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Digitales Sklaventum. Foxconn-Kantine in Shenzhen, China.Foto: Wang Yishu /China Foto Press /laif»Das Apple-Fließbandwar härter als andere«Das neue Sachbuch »iSlaves« versammelt Studien,Stimmen und Einschätzungen zur Situationchinesischer Arbeiter in Foxconn-Fabriken.Dort werden Smartphones, Spielkonsolen,Tablets und Laptops produziert. Von Maik SöhlerSo viele Bürger haben manche Kleinstaaten nicht: Aufmehr als 1,3 Millionen Beschäftigte kam der in Taiwanansässige Foxconn-Konzern im Jahr 2012. Der überwiegendeTeil arbeitet in China und stellt jene Geräte her,die im Westen große Teile von Arbeit und Freizeit prägen: Mobilfunkgeräte,Smartphones, Tablet- und Laptop-Computer, E-Book-Reader, Spielkonsolen, digitale Kameras und mehr.Die Arbeitsbedingungen, unter denen die iPads, Xboxen undPCs von Apple, Dell oder Hewlett Packard – nennen wir ruhigmal Produkt- und Firmennamen, so viel Antiwerbung muss sein– hergestellt werden, erinnern an jene, die Marx und Engels imEuropa des ausgehenden 19. Jahrhunderts vorfanden: Arbeitszeitenum die 100 Stunden pro Woche, niedrige Löhne, kaum sozialeAbsicherung, geringer technischer und gesundheitlicherArbeitsschutz, despotische Unternehmer und Vorarbeiter.Dieser Frühkapitalismus hat sich, ergänzt um effizienzsteigerndeElemente aus späteren Phasen des Kapitalismus, in TeilenChinas erhalten. Dort nämlich, wo die »iSlaves« arbeiten,die Fabrikarbeiter aus den Foxconn-Werken. Grundlage dieseskenntnisreichen Sachbuchs über die Arbeitsweise in der asiatischenIT-Industrie ist eine Studie chinesischer Soziologen, diemit (ehemaligen) Foxconn-Arbeitern sprachen. Auslöser der Studiewar eine Serie von Arbeitersuiziden in den Jahren 2010/2011mit mindestens 20 Toten.Foxconns Ruf war lädiert – und mit ihm der von Apple, Microsoft,Samsung und anderen. Foxconn versprach, für Abhilfezu sorgen, kündigte Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungenan. Hier setzt »iSlaves« an und weist nach, dass sich inden Werken bis heute nur wenig geändert hat. »Foxconn geht esum (…) einen hohen Profit (…) und dem werden alle Lebensbedürfnisseder Arbeiter untergeordnet«, schreibt Ralf Ruckus imVorwort.Von kontrollierten Wohnheimen über die ausbeuterischeProduktion, vom Einsatz von Millionen Schülerpraktikantenbis zur Enteignung von Bauern zum Bau neuer Fabriken ziehtsich das Foxconn-System. Dem Leser begegnen Verstöße gegenchinesisches Arbeitsrecht, vergiftete Arbeiter, unmenschlicheFührungsmethoden, Wohnungen als verlängerte Werkbank,Kinderarbeit, fehlende Gliedmaßen. Dies sei »Foxconns Erfolgsgeheimnis:Alles dient der Ausnutzung der Arbeitskraft. Foxconnzüchtigt die Arbeiter und Arbeiterinnen körperlich undgeistig, bestimmt ihre Arbeits- und Lebensweise und zwingt sie,24 Stunden pro Tag verfügbar zu sein«, schreiben die chinesischenSoziologen in ihrem Fazit.»Das Apple-Fließband war härter als andere«, formuliert esein Arbeiter. Interessant wäre zu wissen, wie viele Menschen diesenArtikel auf einem iPad lesen. »iSlaves« ist ein wichtiges Buch,weil seine Autoren ganz genau hingesehen haben.Pun Ngai u.a.: iSlaves. Ausbeutung und Widerstand in ChinasFoxconn-Fabriken. Herausgegeben und übersetzt vonRalf Ruckus. Mandelbaum Verlag, Wien, 2013. 264 Seiten,19,90 Euro.kultuR | buchmesse71
Zerrissenes LandRechtsfreier Raum. Die Situation in Somalia ist unübersichtlich und bedrohlich.Foto: Espen Rasmussen /Gamma /laifDer somalische Schriftsteller Nuruddin Farah zähltzu den wichtigsten Intellektuellen Afrikas. In allenseinen Romanen reflektiert er die Geschichte seinesHeimatlandes. So auch in seinem neuen Buch»Gekapert«. Von Wera ReuschSomalia ist meine Liebe, meine Obsession. Es ist dasLand, von dem ich träume, über das ich nachdenke, esist das einzige Land, das ich als mein Eigen betrachte«,sagt Nuruddin Farah. Der 67-jährige Autor musste Somaliain den siebziger Jahren aus politischen Gründen verlassenund lebt seither im Exil – unter anderem in Südafrika undin den USA. Somalia hat ihn jedoch nie losgelassen. Farahs bislangelf Romane spielen alle in seinem Heimatland und reflektierendessen Geschichte. Er selbst betrachtet die Distanz alsVorteil: »Ich hätte diese Dinge nicht schreiben können, wennich in Somalia geblieben wäre. Denn man kann den Boden, aufdem man steht, nur dann sehen, wenn man sich davon wegbewegt.«Farah greift die politischen Ereignisse mit einem gewissenzeitlichen Abstand auf – in seinen ersten Romanen bildete dieDiktatur Siad Barres den Hintergrund, während seine jüngstenBücher vom Bürgerkrieg handeln. In »Gekapert« besuchen dreiExil-Somalier 2006 ihr Heimatland: Ein Professor, der seit Jahrenin Amerika lebt, will in der Hauptstadt Mogadischu Freundebesuchen. Er wird begleitet von seinem Schwiegersohn Malik,einem New Yorker Journalisten, der über die politische Situationund über die Piraterie berichten will. Maliks Bruder fährt derweilin den Norden des Landes und sucht nach seinem Sohn, dersich in einer Moschee in den USA als Selbstmordattentäter hatteanwerben lassen.Die Situation vor Ort ist unübersichtlich und bedrohlich. Esgibt keinen Staat – die Ordnung, die es gibt, ist willkürlich undmenschenverachtend. Es gilt die Scharia. Die Bevölkerung wirdvon der Al-Shabaab-Miliz terrorisiert, die sich vor allem aus jungenMännern rekrutiert. Man kann so gut wie niemandem trauen– jeder versucht seine Haut zu retten und geht dabei rücksichtslosvor. Journalisten, die sich kritisch äußern, werden umgebracht.Der Roman schildert die Bemühungen der drei Exil-Somalier, zu verstehen, was in dem Land vor sich geht. Dabeibegegnen sie kosmopolitischen Intellektuellen, religiösen Fa -natikern und Vergewaltigungsopfern, skrupellosen Geschäftemachern,aufgehetzten Jugendlichen und Piraten. Je tiefer sievordringen, desto mehr geraten sie selbst in Gefahr.Farahs Roman schildert die Auswirkungen der politischenSituation auf die Menschen und deren Auseinandersetzung damit.Dabei werden zahlreiche Konfliktlinien deutlich, entlangderer sich die Gesellschaft und die Familien spalten, etwa zwischenJungen und Alten oder zwischen Religiösen und Säkularen.Seit Mitte der neunziger Jahre kann der Schriftsteller Somaliawieder besuchen. Viele seiner Recherchen und die andererJournalisten sind in den Roman eingeflossen. Dies lässt »Gekapert«phasenweise etwas didaktisch erscheinen, doch erfährtder Leser auf diese Weise viel Unbekanntes. Mit seinen Romanenverleiht Farah seinem zerrissenen Land eine Stimme in derWelt und hinterlässt der somalischen Jugend eineArt literarisierte Geschichtsschreibung.Nuruddin Farah: Gekapert. Aus dem Englischen von SusannUrban. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, 463 Seiten,26,95 Euro.72 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Das Schweigen brechenYejide Kilankos Roman »Der Weg der Töchter«schildert eine Jugend in Nigeria. Eine zentrale Rollespielt dabei die Auseinandersetzung mit sexuellerGewalt in der Familie. Von Wera ReuschDie Geschichte fängt beschaulich an. Moraya wächst ineiner Mittelschichtfamilie in der nigerianischen StadtIbadan in behüteten Verhältnissen auf. Die erste großeAufregung erlebt sie, als ihre kleine Schwester auf dieWelt kommt – denn Eniayo ist Albino. Doch während die Urgroßtantedies für ein großes Unglück hält, mahnen die aufgeklärtenEltern, es gebe keinen Grund, die Schwester zu verstecken, undMoraya solle gut auf sie aufpassen.Als Moraya zwölf ist, nimmt die Familie einen Cousin derMädchen auf. Der etwas ältere Bros T. ist durch arrogantes Verhalten,kleine Diebstähle und schlechte Schulnoten aufgefallen.Da seine Mutter nicht mehr mit ihm zurande kommt, soll ersich nun in Morayas Familie einfügen. Dies scheint zunächstauch zu gelingen – bis zu einer Nacht, als Bros T. die Abwesenheitder Eltern nutzt, um das Mädchen zu vergewaltigen. DieZwölfjährige ist völlig verstört und weiß sich nicht zu helfen,zumal es nicht bei einer Vergewaltigung bleibt. Angesichts derDrohungen ihres Cousins wagt Moraya nicht, über die Vorfällezu sprechen. Erst als Bros T. beginnt, auch ihre kleine Schwesterzu bedrängen, stellt sie ihnbloß. Der Junge wird weggeschickt,das unangenehmeThema wird in der Familiejedoch totgeschwiegen. Morayaist völlig alleingelassenund unternimmt einenSelbstmordversuch.Die nigerianischeSchriftstellerin Yejide Kilankolebt in Kanada und arbeitetals Kindertherapeutin.»Der Weg der Töchter«ist ihr erster Roman. In einemInterview erzählte die38-Jährige, dass ihre Arbeitsie zu diesem Buch inspirierthabe. »›Der Weg derTöchter‹ ist zwar ein Roman,er gibt aber sehr genauwieder, was derzeit vorsich geht«, sagte Kilanko.Sexuelle Gewalt gegen Frauenund Kinder sei nach wievor ein sehr großes Problemin der nigerianischenGesellschaft.In ihrem Roman bietetdie Schriftstellerin einehoffnungsvolle Perspektive:Foto: Pius Utomi Ekpei/AFP/Getty ImagesMoraya trifft schließlich auf Verständnis bei ihrer erwachsenenCousine Morenike. Die weiß, was das Mädchen durchmacht,denn sie wurde als 15-Jährige von einem einflussreichen Freundihres Vaters vergewaltigt. Morenike ist eine der eindrucksvollstenFiguren des Romans – die Universitätsdozentin lebt alleinmit ihrem Sohn, ist politisch aktiv und lebensklug. Dank ihrerUnterstützung gelingt es Moraya, wieder Würde und Selbstvertrauenzu erlangen.Ihr Schreiben sei insofern feministisch, als sich darin ihrepersönlichen Überzeugungen widerspiegelten, sagte Yejide Kilankoin einem Interview: »Ich glaube fest an den Wert und dasPotenzial von Mädchen, unabhängig von ihrer sozialen Lage. Ichglaube daran, dass Frauen Gleichberechtigung und Beteiligungan Entscheidungsprozessen verdienen, ob Zuhause, am Arbeitsplatzoder im öffentlichen Leben.«Die Autorin erzählt die Geschichte Morayas zwar sehr konventionell,in Form eines Rückblicks der Ich-Erzählerin. Überzeugendist jedoch insbesondere, wie sie die Folgen sexuellerGewalt darstellt, sei es die Scham und Verzweiflung der Protagonistin,die Entfremdung von ihrer Familie oder ihre gescheitertenLiebesbeziehungen – Kilanko schildert die jahrelangeTraumatisierung ihrer Protagonistin eindringlich,aber nicht sensationsheischend.Yejide Kilanko: Der Weg der Töchter. Aus dem Englischen vonUda Strätling. Graf Verlag, Berlin 2013, 384 Seiten, 18 Euro.Signal Frisur. Der Haarschmuck weist auf den sozialen und ökonomischen Status sowie die Heiratsfähigkeit hin.kultuR | buchmesse73
Ein Leben im FlurVoller Nöte und Enge, aber Hauptsache die Kinderlachen: Der libanesischen Zeichnerin Zeina Abirachedist ein beeindruckendes Porträt des Alltags imBürgerkriegs-Beirut der achtziger Jahre gelungen.Von Maik SöhlerZoom auf eine Großstadt: Wir sehen Beirut, die einst prosperierendeStadt im Libanon. Wir sehen gepflegte Häuser,Fernsehantennen. Doch je näher wir kommen, destomehr verändert sich der Blick auf die Stadt: Mauern,Sandsäcke, Einschusslöcher, Stacheldraht. Ost-Beirut im Jahr1984: Die Stadt ist geteilt in den muslimischen Westen und denchristlichen Osten – und wird es auch noch viele Jahre bleiben.Direkt an der Demarkationslinie liegt das Haus, in dem ZeinaAbirached, libanesische Illustratorin und Comic-Autorin, aufgewachsenist.Nächster Zoom in eine Wohnung, in der zwei Kinder auf ihreEltern warten. Heckenschützen verhindern vorübergehend ihreRückkehr. Nachbarn besuchen die Kinder, backen und spielenmit ihnen. Ausschnitte aus Bürgerkriegsgesprächen über denMangel an Strom, Benzin und Lebensmitteln. Zoom in einenFlur, das letzte bewohnbare Zimmer im Haus an der Demarkationslinie.Dort spielt sich der Alltag ab – beengt, fensterlos undweitgehend abgeschnitten von öffentlicher Kommunikation.Abiracheds neue Graphic Novel »Das Spiel der Schwalben«beherrscht souverän den Wechsel zwischen Zoom und Totale.Während die Kinder und die Nachbarn ihre Angst in dem kleinenFlur mit Geschichten, Bilderalben, Alkohol und Essen bannen,zeigen andere Zeichnungen den Alltag des Krieges: die Methode,sich von Haus zu Haus zu bewegen, ohne ins Visier der Heckenschützenzu geraten; Schutzcontainer, die Teilen Ost-Beiruts eineneue Geografie aufprägen; Tricks, um an Wasser zu kommen.Mal großformatig, mal kleinteilig erzählt Abirached inSchwarz-Weiß davon, wie die Gräuel und die Not des Krieges inBeirut an der Schwelle zum Flur ihrer Wohnung haltmachenmüssen. Jeder weiß, dass sie vor der Tür stehen und dass mansich ihnen stellen muss, doch den Eintritt verweigert man ihnenstandhaft. »Wissen Sie, ich glaube, wir sind hier mehr oder wenigerin Sicherheit«, sagte Abiracheds Großmutter damals einemTV-Team. Diesen Satz fand die Zeichnerin mehr als 20 Jahrespäter in einem Archiv und mit diesem Buch gibt sie ihm nuneinen liebevollen und detailreichen Rahmen.Solange im Flur die Nachbarn ihre Biografien austauschen,solange gemeinsam gewartet, gescherzt und gegessen wird, solangedie Kinder spielen und lachen können, solange bleibt derBeschuss der Straße außen vor – obwohl er gut zu vernehmenist. Doch auch Granaten haben ihren Alltag. Mit dem Alltag derMenschen ist er leider nicht kompatibel. »Sterben – Wegziehen –Wiederkehren. Das ist das Spiel der Schwalben«, hat jemand aneine Wand in Beirut geschrieben. Ihrer Familie und ihren Nachbarn,aber auch diesem Spiel der Schwalben hat Zeina Abirachedmit ihren Zeichnungen ein eindrucksvolles Denkmalgesetzt.Zeina Abirached: Das Spiel der Schwalben. Übersetzung:Paula Bulling und Tashy Endres. Avant-Verlag, Berlin 2013.182 Seiten, 19,95 Euro.Bilder eines Bürgerkriegs. Aus der Graphic Novel »Das Spiel der Schwalben«.Zeichnungen: Zeina Abirached74 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Wenn Realismus zum Klischee wirdWahrsagerei, Prostitution, Alkoholismus, Faulheit, organisierterDiebstahl, Kinderhandel und Zwangsarbeit – jedes Ressentiment,das schon mal gegen Angehörige der Bevölkerungsgruppender Sinti, Roma, Jenische, Kane, Xoraxane,Olah und andere vorgebracht wurde, taucht in Rolf BauerdicksSachbuch »Zigeuner« auf. Und zwar nicht als Vorurteil,sondern aus eigener Anschauung des Autors. Bauerdick istüber Jahrzehnte durch halb Europa gereist und hat Bild- undTextreportagen gemacht. All das gebe es tatsächlich, schreibter nun, nicht ohne auch Erklärungen zu liefern: die Armut inTeilen Osteuropas, staatliche Diskriminierung, Alltagsrassismus,ökonomische Ausgrenzung, städtebauliche Segregation.Weil die meisten seiner Gesprächspartner sich selbst als»Zigeuner« bezeichnen, übernimmt er diesen oft abwertendgebrauchten Begriff. Bauerdick will sich damit und mit seinemauthentischen Reportagestil abgrenzen von »PoliticalCorrectness« und akademischer Forschung zum Thema. DieAbgrenzung gerät schlicht – allzu schlicht. Ein weiteres Problemseines Buches besteht darin, dass Normalität bei ihmimmer die Normalität der Gescheiterten ist. Erfolgreiche Sintiin Deutschland, integrierte Gitanos in Spanien, osteuropäischeRoma mit Eigenheim und Festanstellung begegnenuns kaum. Bauerdicks Realismus reproduziertdie Klischees.Außen neu, innen altNetzwerk-, Nano- und Biotechnologie, Mikroelektronik undGenmanipulation, die Förderung von Start-up-Unternehmenund eine ökonomische Neuausrichtung auf den asiatischenMarkt treffen auf Talmud, Tora, religiöse Siedler und Ultra -orthodoxe – so sieht das Israel von heute aus, wenn mandem neuen Buch »Israel ist umgezogen« der Historikerin DianaPinto folgt. Und: Was als Gegensatz erscheine, sei in derRealität durchaus vereinbar. Denn, so Pintos These, Israel seiauf dem Weg in einen »autistischen Ultramodernismus«, derdie Probleme des Landes – Sicherheit, soziale Konflikte,Unterdrückung der Palästinenser und Ungleichbehandlungarabischer Israelis – hinter sich lassen wolle, indem er sichauf die Zukunft ausrichte. Kann es sein, fragt Pinto undunterstellt zugleich, Israel habe sich längst vom Westen abundAsien zugewandt, dass dem Land dabei »der Sinn fürGeschichte und die Fähigkeit, mit anderen zu interagieren,abhanden gekommen ist«? Und damit auch die Werte derNachkriegszeit: universelle Menschenrechte, demokratischerPluralismus und überstaatliches Recht? Man muss derAutorin nicht in allem folgen, um zu begreifen, dass Israelsich rasant verändert und dass diese Veränderungen nichtnur ihre guten Seiten haben. Bei Diana Pinto überwiegt jedenfallsdie Skepsis. Möge die Realität positiversein.Rolf Bauerdick: Zigeuner. Begegnungen mit einem ungeliebtenVolk. DVA, München 2013. 352 Seiten, 22,99 Euro.Diana Pinto: Israel ist umgezogen. Aus dem Französischenvon Jürgen Schröder. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag,Berlin 2013. 239 Seiten, 21,95 Euro.NSU und UmfeldNaziterrorismus in Deutschland allein auf die rassistischeMordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zureduzieren, wäre ein großer Fehler. Das begreift man nachwenigen Seiten des neuen Sachbuchs »Blut und Ehre« derRechtsextremismusexperten Andrea Röpke und AndreasSpeit. Zwar handeln große Teile ihres Überblicks zur »Geschichteund Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland« voneben jenem NSU, dem im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausendsneun Migranten und eine Polizistin zum Opfer fielen.Während die Verteidigung Beate Zschäpes beim Prozessin München ihre Mandantin als Teil einer isolierten Terrorzelledarzustellen versucht, widerlegen Röpke und Speit dieseBehauptung mit zahlreichen Fakten. Sichtbar wird so einganzes Netzwerk an Unterstützern vor allem aus der nazistischen»Blood-and-Honour«-Bewegung, die dem Buch seinenTitel gab: Blut und Ehre. Verdienstvoll ist auch die Rechercheder Herausgeber und weiterer Autoren, wenn es um rechteGewalt jenseits des NSU geht. Insbesondere die Hammerskins,gewaltbereite und an der Grenze zum Terrorismusagierende völkische Bruderschaften, werden als Nachfolgerdes im Jahr 2000 verbotenen »Blood-and-Honour«-Netzwerksidentifiziert und im Kontext der extremen Rechtenzwischen NPD, Rechtsrockbands und Autonomen Kameradschaftenuntersucht. Ein kenntnis- und detailreichesBuch.Kinder haben Rechte»Ich habe das Recht, nie Gewalt erleiden zu müssen. KeinMensch hat das Recht, auszunutzen, dass ich ein Kind bin.Kein Mensch der Welt.« Alain Serres fasst eine Auswahl der inder »Konvention über die Rechte des Kindes« durch die UNOverankerten Artikel in klare und unmissverständliche Worte.Worte, die sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsenegleichermaßen richten und die Aurélia Fronty zu poetischenund hoffnungsvollen Bildern inspiriert haben. In abstraktenSzenen, losgelöst von konkreten Orten und Begebenheiten,und in kräftigen Farben erzählt sie Doppelseite für Doppelseitevon der Vielfalt und Diversität der Kinder und deren Lebensumständen.Texte und Bilder bleiben stets um eine positiveAussage bemüht: Obwohl in der Ausformulierung derRechte stets deren Verletzung, Missachtung und die davonausgehende Bedrohung der Kinder mitschwingt, wird niemandan den Pranger gestellt. Dennoch wird klar, dass es biszur weltweiten Einhaltung der hier vorgestellten Kinderrechtenoch ein weiter Weg ist. Am Ende des Buchs wird entsprechenddie Frage gestellt: »Wann wird es so weit sein, dass jedesKind der Welt in seinen Rechten ernst genommen wird?«Das Bilderbuch bietet neben Informationen zu den Kinderrechtendie Gelegenheit, sich mit der Situation der Kinder inKrisengebieten, Entwicklungsländern aberauch nebenan auseinanderzusetzen.Andrea Röpke/Andreas Speit: Blut und Ehre. Geschichteund Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland. Ch. LinksVerlag, Berlin 2013. 288 Seiten, 19,90 Euro.Alain Serres (Text), Aurélia Fronty (Illustration): Ichbin ein Kind und ich habe Rechte. NordSüd-Verlag,Zürich 2013. 32 Seiten. 16,95 Euro. Ab 4 Jahren.Bücher: Maik Söhler, Marlene ZöhrerkultuR | bÜcheR75
Filmfestival der MenschenrechteDas Filmfestival der Menschenrechte im Nürnberger Filmhauswartet alle zwei Jahre mit höchst interessanten Beiträgenauf. Ab 2. Oktober 2013 ist es wieder soweit: Rund zehn Filmekonkurrieren um den »Nürnberger Filmpreis der Menschenrechte«.Und die gezeigten Werke werden immer irrwitziger –zum Beispiel »The Act of Killing« (DK/NOR/GB 2012) von JoshuaOppenheimer: Nach dem indonesischen Militärputsch1965 brachten die Paramilitärs innerhalb eines Jahres übereine Million politische Gegner um. Geahndet wurden dieMorde nie, die Täter sind zum Teil noch heute in Amt undWürden. Im Film erzählen sie stolz vom Kampf gegen die angeblichenKommunisten und demonstrieren Tötungsmethoden.Der Regisseur schlägt ihnen vor, die Taten »künstlerisch«in Szene zu setzen. Eine Idee, die ankommt: Die Totschlägersuchen Schauspieler, lassen Kostüme entwerfen, sehen sichschon als Filmstars. Das Projekt bringt die Männer schließlichzum Nachdenken: Ihnen dämmert, was sie den Menschen angetanhaben – und welche Nebenwirkungen die Taten bei ihnenselbst hinterlassen haben. Neben Produktionen aus allerWelt stellt das Festival die aktuellen Revolten ins Zentrum: »Esgibt Podiumsdiskussionen mit den Organisatoren der arabischenMenschenrechtsfilmfestivals aus Jordanien, Libyen undTunesien«, sagt Festival-Chefin Andrea Kuhn. Einen weiterenSchwerpunkt bilden die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellenund Transgender. Passend dazu ging der NürnbergerMenschenrechtspreis 2013 erstmals an eine Gay-Aktivistin: Kasha Nabagesera aus Uganda.2. bis 9. Oktober 2013. Nuremberg <strong>International</strong> HumanRights Film Festival. Infos: www.filmfestival-dermenschenrechte.deKunst statt KriegGewalterfahrung in Kunst zu verwandeln – das war das Programmdes israelischen Dramatikers Juliano Mer-Khamis.Mit seinem »Freedom Theatre« im palästinensischen FlüchtlingslagerJenin setzte er klassische wie moderne Stoffe in Beziehungzum Israel-Palästina-Konflikt. Dabei provozierte derSohn kommunistischer Eltern sämtliche Beteiligten. Die israelischeBesatzungspolitik ging er ebenso an wie die patriarchalearabische Gesellschaft. »Wir schlachten jede heiligeKuh«, sagte er dem <strong>Amnesty</strong> Journal 2010. Sein Theater stehtfür all das. In erster Linie ist es aber ein Projekt, in dem jungeLeute künstlerischen Widerstand gegen ihre Umgebung entwickelnsollen. Im Jahr 2011 wurde Mer-Khamis erschossen –der Täter wurde bis heute nicht gefunden. Um an den ungewöhnlichenKünstler zu erinnern, haben seine Schauspielermit Regisseur Udi Aloni ein Porträt des »Freedom Theaters«gedreht. Sie inszenieren »Alice im Wunderland« mit palästinensischenKindern und adaptieren »Warten auf Godot« alsTrauerspiel. Mer-Khamis’ Tochter Milay untersucht in ihrer»Antigone«-Bearbeitung männliche Ehrgefühle und Gewaltbereitschaft.Irgendwann in dieser denkwürdigenDokumentation fällt der Satz: »Juliano hatuns auf die Bühne gestellt und da bleiben wir.«Sexuelle SelbstbestimmungEs ist umstritten, ob es so etwas wie »queere« Musik überhauptgibt. Und fraglich ist auch, ob diese Musik für sich inAnspruch nehmen kann, in irgendeiner Weise politisch zusein. Die Antwort kommt aber von denen, die sie ablehnen.In Putins Russland etwa wäre der Sampler »Hugs and Kisses«,der von den Machern des gleichnamigen Hamburger Szene-Magazins zusammengestellt wurde, wohl verboten – wegen»Verbreitung homosexueller Propaganda«, wie das neu formulierteDelikt dort jetzt heißt. Queer steht nicht nur fürschwul oder lesbisch, sondern für Emanzipation und Eigensinn.So wenig, wie damit eine eindeutige sexuelle Orientierunggemeint ist, so vielfältig ist auch das Spektrum der musikalischenMöglichkeiten auf »Hugs and Kisses«. Es reichtvom altmodischen Disco-Bounce des dänischen Duos JuniorSenior bis zu basslastigem Elektropop aus Berlin, Washingtonund Buenos Aires, wo die »Kumbia Queers« zu Hause sind.Außerdem im Angebot: eine fingerschnippende Ballade imBeatles-Stil vom Songwriter-Wunderkind Scott Matthew, einekabarettreife Musical-Hymne von »Prinzessin Hans« undeine bewährte Genderdiskurs-Moritat von Bernadette LaHengst – »ein Mädchen namens Gerd«. Newcomer und alteGender-Hasen geben sich freundlich die Hand. Explizite Zeilenfinden sich beim Osloer Eurodance-Act Hungry Heartsund bei der Berliner HipHop-Intellektuellen Sokee, explizitpolitisch wird es erst am Schluss: »Free PussyRiot!« der unvermeidlichen Electro-Pop-Sängerin Peaches kommt auf stampfendenElectro-Beats daher.Compilation: Hugs and Kisses (Trikont)Straßenmusik-Star aus KinshasaWeil sein Vater in diplomatischen Diensten des Diktators Mobutustand, wuchs Jupiter Bokondji in Ostberlin auf. Als er 20Jahre alt war, kehrte er nach Kinshasa zurück und gründetedort seine Band Okwess <strong>International</strong>. Doch über den Kongohinaus ist ihr Ruf nie gedrungen. Dafür ist Jupiter Bokondjiheute ein unbestrittener Star der Musik-Szene von Kinshasa,mit jeder Menge Street Credibility. Mit treibenden Gitarrenund spritzigen Bläsern frischt er fast vergessene Rhythmen,Melodien und regionale Traditionen auf und verpasst ihneneine mächtige urbane Infusion. Die Gitarren-Grooves à laSantana und die polyrhythmische Percussion, die an FelaKuti erinnert, atmen jede Menge Siebziger-Jahre-Feeling. Inseinen Songs stellt er die Autorität jener Generationen in Frage,die das Land nach der Unabhängigkeit heruntergewirtschaftetund ins Chaos gestürzt haben: In einem Land, indem Kindern der Respekt vor den Älteren eingebläut wird,unerhört. Zugleich singt er gegen die Europa-Verklärung derJugend an, die der Misere im Kongo – Krieg, Korruption undArmut – nach Norden entfliehen will. 2012 nahm Bokondji ander »African Express«-Tour des britischen Popstars DamonAlbarn teil. Mit »Hotel Univers« feiert der48-Jährige jetzt seinen späten, aber verdienteninternationalen Durchbruch.»Art/Violence«. PAL/USA 2013. Regie: Udi Aloni u.a.Filmstart: 17. Oktober 2013Jupiter & Okwess <strong>International</strong>: Hotel Univers(Outhere Records)Film: Jürgen Kiontke | Musik: Daniel Bax76 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Foto: Neue Visionen FilmverleihMusik wirkt befreiend. Musiker in deutschem Flüchtlingsheim. Filmstill aus »Can’t Be Silent«.Sing es laut!Der Musikfilm »Can’t Be Silent« ist ein ebensobeeindruckender wie bedrückender Film überFlüchtlingsleben in Deutschland. Von Jürgen KiontkeViele Deutsche wissen nicht, was in Deutschland passiert.«Der Musiker Revelino, der in einem Asylbewerberheimversauert, stellt klar: »Es gibt Menschen, dieüberrascht sind, wenn wir sagen, dass wir mit fünf odersechs Personen in einem Raum leben.« Und zwar jahrelang.Dass Revelino diese Eindrücke in einem Film schildern kann,ist seinem Talent geschuldet. Der Musiker Heinz Ratz von derBand Strom und Wasser besuchte etwa 80 Flüchtlingsheime aufder Suche nach musikalischen Profis. Seitdem ziert der Zusatz»feat. Refugees« den Band-Namen. Künstler wie Revelino findenin Ratz’ Projekt eine Wirkungsstätte.Regisseurin Julia Oelkers hat die Musiker in ihrem Film»Can’t Be Silent« während einer Tournee porträtiert. Ohne Musik,sagen die Flüchtlinge aus Gambia, Russland, Ex-Jugoslawienund Afghanistan, wären sie schon tot. Doch wie sieht ihr Alltagaus, wie können sie sich bewegen? Die Residenzpflicht wird fürden Abend des Konzerts aufgehoben, das Publikum kommtzahlreich. Anschließend geht es zurück ins Heim. Wenn man esschafft, dort anzukommen – denn als Schwarzer ist man an einemBahnhof per se verdächtig und kann schnell festgesetztwerden.Die Band bietet einen Kurzurlaub von der überwältigendenIsolation. Oelkers besucht die Protagonisten in ihren sechs Qua-dratmeter großen Zimmern, gleich neben einem Gefängnis. DieEtagen haben breite Hinterausgänge, damit die Polizei währendder nächtlichen Abschiebungen genug Platz hat und nichtdurchs Haus lärmen muss.Dann wird es hochoffiziell: Die Kamera folgt Ratz und seinenMusikern ins Bundeskanzleramt, wo die AusländerbeauftragteMaria Böhmer Integrationsmedaillen an die Künstler verteilt.Mit den Auszeichnungen wandert die kleine Band davon.Es ist ein Witz und doch keiner: Zwei Wochen später kommt derAbschiebebescheid.Sam sagt: »Eine Sache ist wirklich schwer für mich zu verstehen:Wenn du auf der Bühne stehst, klatschen alle, tanzen undsind happy. Aber wenn du die gleichen Leute irgendwann späterwieder triffst, bist du jemand völlig anderer für sie. Wenn dunicht auf der Bühne stehst, sehen sie in dir nur den Flüchtling.«»Can’t Be Silent«: Ein bedrückendes Dokument des deutschenFlüchtlingsalltags – und ein höchst künstlerischer Film über denAspekt der Freiheit in der Kunst.Um die Situation der Flüchtlinge in Deutschland zu verbessern,engagiert sich <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> seit Jahren. Die Organisationsetzt sich gegen Abschiebungen ein und erstellt Gutachtenüber Menschenrechtsverletzungen in den Heimatländern.<strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> plädiert für einen rechtlich gesichertenAufenthalt, wenn Menschen akut gefährdet sind, und fordert einenfairen Zugang zu einem umfassenden Asylverfahren.In Zeiten, in denen auch Asylbewerber selbst öffentlich fürdie Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse demonstrieren, dürfte»Can’t Be Silent« mit seinem innovativen und unprätentiösenAnsatz für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen.»Can’t Be Silent«. D 2013. Regie: Julia Oelkers. www.cant-be-silent.deDen Trailer zum Film können Sie sich in unserer iPad-App ansehen:www.amnesty.de/appkultuR | film & musik77
Riefe gegendas veRgessenTag für Tag werden Menschen gefoltert,wegen ihrer Ansichten, Hautfarbeoder Herkunft inhaftiert, ermordet,verschleppt oder man lässt sie »verschwinden«.amnesty inteRnatiOnalveröffentlicht regelmäßig an dieserStelle drei Einzelschicksale, um andas tägliche Unrecht zu erinnern.<strong>International</strong>e Appelle helfen, solcheMenschenrechtsverletzungenanzu pran gern und zu beenden.Sie können mit Ihrem persönlichenEngagement dazu beitragen, dassFolter gestoppt, ein Todesurteilumgewandelt oder ein Mensch auspolitischer Haft entlassen wird.Schreiben Sie bitte, im Interesseder Betroffenen, höflich formulierteBriefe an die jeweils angegebenenBehörden des Landes.Sollten Sie eine Antwort auf IhrAppellschreiben erhalten, schickenSie bitte eine digitale Kopie anamnesty inteRnatiOnal.amnesty inteRnatiOnalZinnowitzer Str. 8, 10115 BerlinTel.: 030-420248-0Fax: 030-420248-488E-Mail: info@amnesty.de, www.amnesty.deSpendenkontoBank für Sozialwirtschaft (BfS), KölnKonto: 8090100, BLZ: 37020500oder Postbank KölnKonto: 224046-502, BLZ: 370100 50BIC: BFSWDE33XXXIBAN: DE23370205000008090100Foto: privatäthiOpienmenschenRechtsRatSeit 2009 behindern repressive Gesetze die Arbeit des äthiopischenMenschenrechtsrats (Human Rights Council – HRCO),der ältesten Menschenrechtsorganisation des Landes. Im Januar2009 erließ die Regierung eine Verordnung über Wohlfahrtseinrichtungenund Verbände. Offiziellen Angaben zufolge zielt siedarauf ab, einen Regulierungsmechanismus für die Zivilgesellschaftzu bilden, tatsächlich schränkt sie jedoch die Arbeit unddie Finanzierung von Menschenrechtsorganisationen ein, indemsie ihnen zum Beispiel verbietet, sich zu mehr als zehn Prozentaus ausländischen Quellen zu finanzieren.Nach Inkrafttreten der Verordnung wurde das Bankguthabendes Menschenrechtsrats im Wert von 566.000 US-Dollar eingefroren.Neun der zwölf Büros mussten geschlossen und mehrals fünfzig Mitarbeiter entlassen werden.Die Verordnung verbietet es NGOs auch, mehr als 30 Prozentihres Budgets für Verwaltungskosten auszugeben. Unter»Verwaltungskosten« können auch die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen,die Bereitstellung unentgeltlicherRechtsbeistände oder Lobbyarbeit fallen.Darüber hinaus wurde eine Behörde für Wohltätigkeitseinrichtungengeschaffen, die über umfangreiche Befugnisse verfügt.Unter anderem sind NGOs verpflichtet, der Behörde Informationenzur Verfügung zu stellen. Dazu zählen auch Aussagenüber Menschenrechtsverletzungen, die von Opfern und Zeugengemacht wurden, wodurch diese weiteren Gefahren ausgesetztsind.Die äthiopischen Behörden stehen der Arbeit des Menschenrechtsratsschon seit vielen Jahren feindselig gegenüber.Immer wieder sind Mitarbeiter der Organisation schikaniert,bedroht, angegriffen und festgenommen worden.Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den äthiopischenMinisterpräsidenten mit der Bitte, das eingefroreneBankguthaben des Menschenrechtsrats umgehend freizugeben,die Verordnung über Wohlfahrtseinrichtungen und Verbände zunovellieren und alle Vorschriften zu streichen, die äthiopischeMenschenrechtsorganisationen in ihrer Arbeit einschränken.Schreiben Sie in gutem Amharisch, Englisch oder auf Deutschan:Prime Minister Hailemariam DesalegnP.O. Box 1031Addis Ababa, ÄTHIOPIEN(Anrede: Dear Prime Minister / Sehr geehrter Ministerpräsident)Fax: 00251-11-155 202000251-11-55143 0000251-11-55112 44(Standardbrief Luftpost bis 20g: € 0,75)Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:Botschaft der Demokratischen Bundesrepublik ÄthiopienS. E. Herrn Fesseha Asghedom TessemaBoothstraße 20a, 12207 BerlinFax: 030-77206 24 oder 030-77206 26E-Mail: Emb.ethiopia@t-online.de78 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
Foto: privatdOminikanische Republikjuan almOnte heRReRaAm 28.September 2009 wurde Juan Almonte Herrera, ein Mitgliedder dominikanischen Menschenrechtsorganisation DominicanCommittee of Human Rights, von vier bewaffneten Männernin der Hauptstadt Santo Domingo verschleppt. Augenzeugen berichteten,bei den Männern habe es sich um Polizeibeamte derAbteilung zur Bekämpfung von Entführungen gehandelt.Obwohl ein Gericht Anfang Oktober 2009 die Freilassungvon Juan Almonte Herrera angeordnet hatte, bestritt die Polizei,dass er in Haft gewesen sei, und gab an, er sei ein entflohenerStraftäter. Ende Oktober 2009 fand man in einem Auto in SantoDomingo zwei Tote, die verbrannt waren. Die Schwester vonJuan Almonte identifizierte darunter den Leichnam ihres Bruders.Die Behörden sagten seiner Familie jedoch, die DNA-Testsseien negativ ausgefallen.Vier Jahre später sind Juan Almonte Herreras Familie undRechtsbeistände der Wahrheit immer noch nicht näher gekommen.Sie bringen den Fall deshalb nun vor die InteramerikanischeKommission für Menschenrechte. Sie kämpfen weiterhinfür Gerechtigkeit und warten auf eine offizielle Antwort bezüglichseines Verschwindens, obwohl sie bei den Justizbehördenschon dreimal vergeblich Anzeige erstattet haben. Zwei weitereStraftatverdächtige im Entführungsfall von Nagua, der auchJuan Almonte Herrera zur Last gelegt wurde, waren am 10.Ok -tober 2009 in Polizeigewahrsam gestorben.Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Generalstaatsanwaltmit der Bitte, den Verbleib von Juan Almonte Herrerabekanntzugeben. Dringen Sie auf eine vollständige und unabhängigeErmittlung seines Verschwindenlassens und die Veröffentlichungder Ergebnisse sowie darauf, die Verantwortlichenzur Rechenschaft zu ziehen. Fordern Sie eindringlich, Juan AlmonteHerrera umgehend freizulassen, sollte er sich in Haft befinden,oder ihn einer erkennbaren Straftat anzuklagen.Schreiben Sie in gutem Spanisch, Englisch oder auf Deutsch an:Procurador GeneralProcuraduría General de la RepúblicaAve. Jiménez Moya esq. Juan Ventura SimónPalacio de JusticiaCentro de los Heroes, Constanza, Maimón y Estero HondoSanto DomingoDOMINIKANISCHE REPUBLIK(Anrede: Señor Procurador General / Dear Public Prosecutor /Sehr geehrter Herr Staatsanwalt)Fax: 001809-532-25 84E-Mail: info@pgr.gob.do(Standardbrief Luftpost bis 20g: € 0,75)Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:Botschaft der Dominikanischen RepublikS.E. Herrn Gabriel Rafael Ant Jose Calventi GavinoDessauer Straße 28–29, 10963 BerlinFax: 030-25757761E-Mail: info@embajadadominicana.deFoto: privatiRakahmad ’amR ’abd al-QadiR muhammadDer im Irak geborene Palästinenser Ahmad ’Amr ’Abd al-QadirMuhammad wurde am 21.Juli 2006 in Bagdad festgenommenund über ein Jahr ohne Kontakt zur Außenwelt in Haft gehalten.<strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> vorliegenden Berichten zufolge wurde ergefoltert und gezwungen, zu »gestehen«, dass er einer bewaffnetenGruppe angehöre, die Sprengsätze legen wollte. Am17.Mai 2011 wurde Ahmad ’Amr ’Abd al-Qadir Muhammad aufder Grundlage des Anti-Terror-Gesetzes von 2005 zum Tode verurteilt.Seine Verteidigung hat darauf aufmerksam gemacht, dassAugenzeugen des Vorfalls, darunter auch Polizeikräfte, widersprüchlicheAussagen gemacht haben. Bei der Urteilsverkündungwies das Gericht darauf hin, dass Ahmad ’Amr ’Abd al-QadirMuhammad seine ihn selbst belastende Aussage im Prozesszurückgezogen habe. Des Weiteren wies das Gericht darauf hin,dass in einer Untersuchung durch das Institut für Rechtsmedizinim August 2008 Narben an seinem Körper gefunden wordenwaren.Dennoch bezog das Gericht bei der Verhängung des Todesurteilsdas »Geständnis« von Ahmad ’Amr ’Abd al-Qadir Muhammadausdrücklich in die Urteilsfindung mit ein, mit der Begründung,es sei zuverlässig, da es zeitlich näher an dem Verbrechenliege als die Aussage vor Gericht. Es ist nicht bekannt,dass eine umfassende und unabhängige Untersuchung der Foltervorwürfedurchgeführt worden wäre.Das Kassationsgericht hat das gegen Ahmad ’Amr ’Abd al-Qadir Muhammad verhängte Todesurteil bestätigt. Er befindetsich weiterhin im Todestrakt des Gefangenenlagers Camp Justicein Bagdad.Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den irakischenPräsidenten Jalal Talabani mit der Forderung, das gegen Ahmad’Amr ’Abd al-Qadir Muhammad verhängte Todesurteil umzuwandeln.Dringen Sie darauf, die Foltervorwürfe umgehend und umfassenddurch ein unabhängiges Organ untersuchen zu lassenund alle etwaigen Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. BittenSie ihn außerdem, Ahmad ’Amr ’Abd al-Qadir Muhammadin Übereinstimmung mit den internationalen Standards für faireGerichtsverfahren erneut vor Gericht zu stellen, ohne Rückgriffauf die Todesstrafe.Schreiben Sie in gutem Arabisch, Englisch oder auf Deutsch an:Präsident Jalal TalabaniConvention Centre (Qasr al-Ma’aridh)Baghdad, IRAK(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)E-Mail: info@pmo.iq(Standardbrief Luftpost bis 20g: € 0,75)Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:Botschaft der Republik IrakS. E. Herrn Hussain Mahmood Fadhlalla AlkhateebPacelliallee 19–21, 14195 BerlinFax: 030-81 4882 22E-Mail: info@iraqiembassy-berlin.debRiefe gegen das veRgessen79
aktiv fÜR amnesty»Die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen!« Salil Shetty und Selmin Çalışkan demonstrieren mit ICM-Delegierten gegen Gewalt in Ägypten.blutveRgiessen in ägypten stOppen!Führende <strong>Amnesty</strong>-Vertreter aus der ganzen Welt kamen MitteAugust zur <strong>International</strong>en Ratstagung (<strong>International</strong> CouncilMeeting, ICM) in Berlin zusammen. Sie forderten mit Protestaktionenein Ende des Blutvergießens in Ägypten und eine sofortigeund umfassende Aufklärung der exzessiven Gewalt durch Sicherheitskräfte.»Alle, die für den Einsatz tödlicher Gewalt verantwortlichsind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden«,sagte Salil Shetty, <strong>International</strong>er Generalsekretär von <strong>Amnesty</strong><strong>International</strong>. »Wir verurteilen das Vorgehen der ägyptischen Sicherheitskräfteauf das Schärfste«, ergänzte Selmin Çalışkan,Generalsekretärin der deutschen <strong>Amnesty</strong>-Sektion. »Wir appellierenan alle Seiten, keine weitere Gewalt anzuwenden undumgehend friedliche Verhandlungen aufzunehmen.« Das ICMist das höchste beschlussfassende <strong>Amnesty</strong>-Gremium auf internationalerEbene. Alle zwei Jahre kommen mehr als 450 <strong>Amnesty</strong>-Delegierteaus gut 60 Ländern zusammen, um über diepolitische Ausrichtung der Menschenrechtsorganisation zu entscheiden.Dieses Mal richtete Deutschland das Treffen aus. Angesichtsder aktuellen Ereignisse in Ägypten demonstrierten dieDelegierten in Berlin mit Nofretete-Masken gegen Polizei- undMilitärgewalt. Im Anschluss zogen die <strong>Amnesty</strong>-Aktivisten vordie ägyptische Botschaft.Foto: Christian Ditsch /<strong>Amnesty</strong>amnesty auf dem fRankfuRteR museumsufeRfestDas Museumsuferfest in Frankfurt am Main ist ein echter Publikumsmagnet:Bis zu drei Millionen Besucher strömen jährlichans Mainufer, um entlang der acht Kilometer langen Festivalmeilezu schlendern und Konzerten auf mehr als 20 Bühnen zulauschen. In diesem Jahr feierte das Freiluft-Fest, das immeram letzten Augustwochenende stattfindet, sein 25-jähriges Bestehen.Auch <strong>Amnesty</strong> war – wie bereits in den Jahren zuvor –mit einem Stand beim Museumsuferfest vertreten. 25 <strong>Amnesty</strong>-Mitglieder stellten den Festivalbesuchern die Arbeit der Menschenrechtsorganisationvor und sammelten 1.230 Unterschriftenfür Petitionen. Auch am sportlichen Highlight des Mainuferfestsnahm <strong>Amnesty</strong> teil: Beim traditionellen Drachenbootrennenauf dem Main belegte das 20-köpfige <strong>Amnesty</strong>-Team in derKlasse »Mixed Group« den 4. Platz.Das Boot ist voll. Das <strong>Amnesty</strong>-Team beim Bootsrennen auf dem Main.Foto: <strong>Amnesty</strong>80 amnesty jOuRnal | 10-11/2013
digitaleR spendenflOhmaRktzugunsten vOn amnestyShoppen für den guten Zweck – das Prinzip ist altbewährt.Viele <strong>Amnesty</strong>-Gruppen veranstalten schon seitJahren regelmäßig Flohmärkte und spenden die Erlöse fürdie Menschenrechte. Dabei sind schon beachtliche Summenzusammengekommen. Jetzt gibt es auch einen Spendenflohmarktim Internet: Seit Kurzem ist der Online-Marktplatz fraisr im Netz. Das Portal funktioniert im Grundewie eBay: Ob gebraucht oder neu, Selbstgebasteltesoder Dienstleistung, alles kann verkauft oder gekauft werden.Doch statt Auktionen gibt es Festpreise. Und bei jedemVerkauf fließt ein Teil des Erlöses an eine gemeinnützigeOrganisation. Der Verkäufer entscheidet, wem dieSpende zugute kommt und wieviel gespendet wird. Allerdingssind fünf Prozent des Verkaufspreises Pflicht.Auch <strong>Amnesty</strong> kann auf dem Online-Portal unterstütztwerden. Schauen Sie vorbei: www.fraisr.com/de/amnestyinternationalaktiv fÜR amnestyDurch ganz unterschiedliche Veranstaltungen geben<strong>Amnesty</strong>-Mitglieder den Opfern von Menschenrechtsverletzungeneine Stimme. Diese Aktionen vor Ortsind ein unentbehrlicher Teil der Arbeit von <strong>Amnesty</strong><strong>International</strong>. Mehr Informationen darüber findenSie auf http://blog.amnesty.de undwww.amnesty.de/kalenderimpRessum<strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>, Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V.,Zinnowitzer Str. 8, 10115 Berlin, Tel.: 030-4202 48-0, E-Mail:info@amnesty.de, Internet: www.amnesty.deRedaktionsanschrift: <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>, Redak tion <strong>Amnesty</strong> Journal,Zinnowitzer Str. 8, 10115 Berlin, E-Mail: journal@amnesty.de(für Nachrichten an die Redaktion)Redaktion: Bernd Ackehurst, Markus N. Beeko, Anton Landgraf (V.i.S.d.P.),Ramin M. Nowzad, Larissa ProbstMitarbeit an dieser Ausgabe: Birgit Albrecht, Daniel Bax, Alfred Busse,Selmin Çalışkan, Lisa Caspari, Bernhard Clasen, Peter Franck, Sara Fremberg,Annette Hartmetz, Jürgen Kiontke, Alexia Knappmann, Daniel Kreuz,Marie von Möllendorf, Ralf Rebmann, Wera Reusch, Barbara Oertel, MariaScharlau, Uta von Schrenk, Maik Söhler, Carsten Stormer, Franziska Ulm-Düsterhöft, Wolf-Dieter Vogel, Johannes Voswinkel, Marlene ZöhrerLayout und Bildredaktion: Heiko von Schrenk/schrenkwerk.deDruck: Hofmann Druck, NürnbergVertrieb: Carnivora Verlagsservice, BerlinBankverbindung: <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>, Kontonr. 8090100,Bank für Sozialwirtschaft (BfS), Köln, BLZ 37020500,BIC: BFSWDE33XXX, IBAN: DE23370205000008090100Das <strong>Amnesty</strong> Journal ist die Zeitschrift der deutschen Sektion von <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>und erscheint sechs Mal im Jahr. Der Verkaufspreis ist im Mitgliedsbeitragenthalten. Nichtmitglieder können das <strong>Amnesty</strong> Journal für 30 Euro pro Jahrabonnieren. Für unverlangt eingesandte Artikel oder Fotos übernimmt die Redaktionkeine Verantwortung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingtdie Meinung von <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> oder der Redaktion wieder. DieUrheberrechte für Artikel und Fotos liegen bei den Autoren, Fotografen oder beimHerausgeber. Der Nachdruck von Artikeln aus dem <strong>Amnesty</strong> Journal ist nur mitschriftlicher Genehmigung der Redaktionerlaubt. Das gilt auch für die Aufnahme inelektronische Datenbanken, Mailboxen, fürdie Verbreitung im Internet oder für Vervielfältigungenauf CD-Rom.ISSN: 1433-4356selmin Çalişkan ÜbeRtanzenEnde August fand in Berlin die <strong>International</strong>e Ratstagungvon <strong>Amnesty</strong> statt – das erste Mal in Deutschland seit1977. Wir waren 450 Delegierte aus mehr als 60 Ländernund haben vier Tage lang über unsere Bewegung gesprochen,zum Beispiel darüber, wie wir unsere Aktivistenund Aktivistinnen in den Ländern des globalen Südensweiter stärken können.Bei einer öffentlichen Aktion haben wir dazu aufgerufen,das Blutvergießen in Ägypten zu beenden und damitauch nach außen ein sichtbares Zeichen gesetzt. Wir habenNofretete-Masken aufgesetzt und eine umfassendeAufklärung der exzessiven Gewalt durch Sicherheitskräftegefordert. Anschließend sind einige von uns vor die ägyptischeBotschaft gezogen, wo wir ebenfalls gegen die Gewaltprotestiert haben.Die Diskussionen und Workshops waren sehr anregendund so vielfältig wie unsere Delegationen und Sektionen– von der Mongolei bis Südafrika. Das wünsche ich mirauch für die deutsche Sektion: So bunt wie die Ratstagungsoll auch <strong>Amnesty</strong> in Deutschland werden.Wie es bei <strong>Amnesty</strong> so üblich ist, wird viel geredet, undso sind erfrischende Pausen umso wichtiger: Ich habemich sehr gefreut, dass unsere Aktivisten und Aktivistinnengenauso tanzwütig sind wie ich. Besonders gefallenhat mir eine Abendveranstaltung, bei der wir das Zustandekommendes Waffenkontrollvertrags gewürdigt haben.Der Vertrag ist ein Meilenstein für die Menschenrechte,und wir sind sehr stolz darauf, nach 20 Jahren Lobbyarbeitdiesen Erfolg erreicht zu haben! Gefeiert haben wirdas mit viel Musik: Wir haben stundenlang Salsa getanzt!Außerdem gab es leckeres Essen: Die französische Delegationhatte einen ganzen Koffer mit Käse mitgebracht,die Finnen Elchwurst.Diese Tanz-Leidenschaft hat mich einmal mehr überzeugt,dass ich bei <strong>Amnesty</strong> am richtigen Platz bin. DieVerbindung von unseren sehr ernsten Belangen mit Lebenslusthat mir gefallen und passt zu meinem Lebenskonzept.Ein Ausspruch der US-Friedensaktivistin undAnarchistin Emma Goldman begleitet mich schon einganzes Leben lang: »If I can’t dance, I don’t want to bepart of your revolution.« – Wenn ich nicht tanzen kann,möchte ich an eurer Revolution nicht beteiligt sein.Selmin Çalışkan ist Generalsekretärin der deutschen Sektion von<strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>.Foto: <strong>Amnesty</strong>aktiv fÜR amnesty81
KARIBIK:TODESSTRAFEABSCHAFFEN!Die englischsprachige Karibik ist einUrlaubsparadies. Und eine Region, in derMenschen zum Tode verurteilt werden.In Trinidad und Tobago und in Barbadosist die Todesstrafe bei Mordfällen sogarzwingend vorgeschrieben.Ihre Stimme rettet Leben.www.amnesty.de/todesstrafe
FREIHEIT IST DERWERT, DER BLEIBTIHR TESTAMENT FÜRDIE MENSCHENRECHTEFoto: Kimimasa Mayama/ReutersGESTALTEN SIE DIE ZUKUNFTGründe, warum <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> bei Erbschaftenbedacht wird, gibt es viele: Manchmal sind es die eigenenErfahrungen, die man mit Unrechtsregimen gemacht hat.Oder es sind Beobachtungen auf Reisen, die eigene Überzeugung,etwas zurückgeben zu wollen. Wichtig ist derWunsch, über das eigene Leben hinaus die Zukunft gestaltenzu wollen. Eine Idee zu unterstützen, die einem amHerzen liegt: die Einhaltung der Menschenrechte.Seit 1961 setzt sich <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> weltweit fürOpfer von Menschenrechtsverletzungen ein. Und daAmnes ty <strong>International</strong> aus Gründen der Unabhängigkeitjegliche staatlichen Mittel ablehnt, können besondersErbschaften helfen, diese Arbeit auch in Zukunft sicherund langfristig planbar zu machen.Bedenken Sie <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> in Ihrem Testament.Gestalten Sie eine Zukunft, in der jeder Mensch in Würdeleben kann!Bei weiteren Fragen steht Ihnen Dr. Manuela Schulzunter der Telefonnummer 030-420248354 gerne zurVer fü gung. E-Mail: Manuela.Schulz@amnesty.de Bitte schicken Sie mir die Erbschaftsbroschüre »Freiheitist der Wert, der bleibt« kostenlos zu. Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über dieArbeit von <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong> kostenlos zu.Vorname, NameStraßePLZ, OrtTelefon, E-MailBitte einsenden an <strong>Amnesty</strong> <strong>International</strong>, ZinnowitzerStr. 8, 10115 Berlin oder faxen Sie: 030 -4202 48-488Weitere Informationen auf www.amnesty.de/spenden