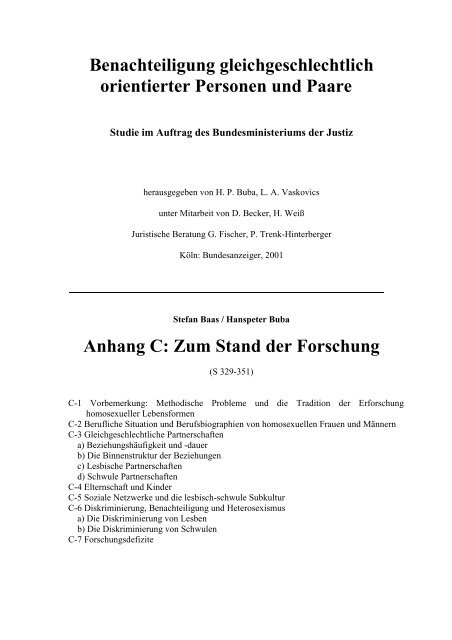Benachteiligung gleichgeschlechtlich orientierter Personen und Paare
Benachteiligung gleichgeschlechtlich orientierter Personen und Paare
Benachteiligung gleichgeschlechtlich orientierter Personen und Paare
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Benachteiligung</strong> <strong>gleichgeschlechtlich</strong><strong>orientierter</strong> <strong>Personen</strong> <strong>und</strong> <strong>Paare</strong>Studie im Auftrag des B<strong>und</strong>esministeriums der Justizherausgegeben von H. P. Buba, L. A. Vaskovicsunter Mitarbeit von D. Becker, H. WeißJuristische Beratung G. Fischer, P. Trenk-HinterbergerKöln: B<strong>und</strong>esanzeiger, 2001Stefan Baas / Hanspeter BubaAnhang C: Zum Stand der Forschung(S 329-351)C-1 Vorbemerkung: Methodische Probleme <strong>und</strong> die Tradition der Erforschunghomosexueller LebensformenC-2 Berufliche Situation <strong>und</strong> Berufsbiographien von homosexuellen Frauen <strong>und</strong> MännernC-3 Gleichgeschlechtliche Partnerschaftena) Beziehungshäufigkeit <strong>und</strong> -dauerb) Die Binnenstruktur der Beziehungenc) Lesbische Partnerschaftend) Schwule PartnerschaftenC-4 Elternschaft <strong>und</strong> KinderC-5 Soziale Netzwerke <strong>und</strong> die lesbisch-schwule SubkulturC-6 Diskriminierung, <strong>Benachteiligung</strong> <strong>und</strong> Heterosexismusa) Die Diskriminierung von Lesbenb) Die Diskriminierung von SchwulenC-7 Forschungsdefizite
C-1 Vorbemerkung: Methodische Probleme <strong>und</strong> die Tradition der Erforschunghomosexueller LebensformenJede empirische Analyse des <strong>gleichgeschlechtlich</strong> orientierten Teils der deutschenBevölkerung stößt auf einige gr<strong>und</strong>sätzliche, methodische Probleme: So sind z.B. die Anzahl derLesben <strong>und</strong> Schwulen <strong>und</strong> die Größe des homosexuellen Bevölkerungsanteils nach wie vorunbekannt <strong>und</strong> werden allenfalls vermutet oder geschätzt: "Die Vermutung liegt nahe, dass dieGruppe der offen oder verdeckt lebenden Männer mit homosexueller Selbstdefinition keinengrößeren Umfang hat als 4% der über 20-jährigen Männer" (Bochow 1993b: 125). AndereAutoren gehen davon aus, dass sich in der B<strong>und</strong>esrepublik 2,1% aller Frauen selbst alshomosexuell definieren (Schneider/Rosenkranz/Limmer 1998).Weiter wird die empirische Analyse <strong>gleichgeschlechtlich</strong> <strong>orientierter</strong> <strong>Personen</strong> auch dadurcherschwert, dass kein statistisches Datenmaterial zur Kennzeichnung dieses Bevölkerungsteils zurVerfügung steht. Anders als bei anderen Umfragen möglich <strong>und</strong> üblich ist hier Repräsentativitätnicht anhand eines solchen Datenmaterials prüfbar. Dies schließt zwar nicht aus, dass Ergebnissede facto repräsentativ sind; Repräsentativität lässt sich aber weder belegen noch widerlegen,bestenfalls plausibel machen. Schwierig ist auch der gezielte Zugang zu diesemBevölkerungsteil. Weder existiert Datenmaterial (z.B. Adressen oder sonstige personenbezogeneHinweise), das sich für die Ziehung einer Stichprobe <strong>und</strong> als Zugangsweg nutzen ließe, nochsind Ersatzverfahren (z.B. im Sinne einer Flächenstichprobe) einsetzbar, da es sich um einegesellschaftliche Minderheit handelt, so dass solche Zugangswege versagen.Legt man die üblichen Kriterien für die Repräsentativität von Stichproben zugr<strong>und</strong>e, habenbisherige empirische Untersuchungen bei Homosexuellen weder eine repräsentative Stichprobeerreicht, noch können sie aufgr<strong>und</strong> ihrer Daten allgemein gültige Aussagen über homosexuelllebende Menschen treffen. Inwieweit für empirische Ergebnisse Allgemeingültigkeit plausibelerscheint, kann aber näherungsweise anhand der Größe des Samples <strong>und</strong> der bei der Befragunggenutzten Zugangswege zum Feld abgeschätzt werden. Zu diesem Zweck haben wir die unszugänglichen empirischen Studien zu Schwulen <strong>und</strong> Lesben im Abschnitt "Forschungsdesign<strong>und</strong> Datenbasis verschiedener Studien" in diesem Anhang zusammengestellt. Die Übersichtzeigt, dass die in den 90er Jahren durchgeführten Studien teils nur geringe Stichprobengrößenerzielen, teils zwar große Stichproben erreichen (wie z.B. Bochow, 1997), gleichzeitig aber nureinige wenige Zugangswege zum Feld verwenden. Beispielsweise bildet für Bochow bei derErhebung 1996 das Beilegen des Fragebogens in einer Schwulenzeitschrift denHauptzugangsweg zu den Befragten; zusätzlich wird der Bogen über Jugendnetzwerke verteilt.Die Chance, an der Befragung teilzunehmen, war also auf diese Zugangswege begrenzt <strong>und</strong>insofern einseitig. Verglichen damit wählen Kling <strong>und</strong> Müller (1997) wesentlich mehr <strong>und</strong>unterschiedliche Zugangswege zum Feld, vermeiden also diese Einseitigkeit der Stichprobe <strong>und</strong>daraus resultierende Verzerrungen. Andererseits gelingt ihnen nur die Befragung von insgesamt224 <strong>Personen</strong>, beschränkt auf Sachsen-Anhalt, was kaum allgemein gültige Aussagen über dieRegion hinaus zulässt <strong>und</strong> auch keine ausreichende Basis für eine differenzierte empirischeAnalyse bietet. Die einzige Studie, die sowohl ein ausreichend großes Sample erreicht als auchdurch die Vielfältigkeit der Zugangswege eine Einseitigkeit der Stichprobenzusammensetzungzu vermeiden sucht, ist die von Knoll, Edinger <strong>und</strong> Reisbeck (1997) veröffentlichteUntersuchung.Die Ergebnisse bisher durchgeführter quantitativer Erhebungen bei Lesben <strong>und</strong> Schwulenzeigen einige Besonderheiten der Befragten: Erstens wohnen Teilnehmer bisherigerUntersuchungen überwiegend in Großstädten: Drei von vier der von Michael Bochow 1997befragten Männer wohnen in Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern (siehe auch Knoll/Edinger/Reisbeck1997). Dafür gibt es mehrere plausible Gründe: Möglicherweise ist es inGroßstädten eher möglich, eine homosexuelle Selbstdefinition zu treffen oder die
Homosexualität offen zu leben. Andererseits ist aber auch denkbar, dass Homosexuelle inkleineren Städten oder ländlichen Gebieten mit den bisherigen Erhebungsmethoden nicht erreichtworden sind. Durch Wanderungen allein scheint jedenfalls der weitaus höhere Anteilhomosexueller <strong>Personen</strong> in Städten wie Berlin, Köln, München oder Hamburg nicht erklärbar.Zweitens weisen alle bisherigen Untersuchungen einen ausgeprägten Mittelschicht-Bias auf,Angehörige der Unterschichten sind in bisherigen Untersuchungen kaum vertreten. Die befragtenMänner <strong>und</strong> Frauen haben eine überdurchschnittlich hohe Schulbildung, bei derBerufsausbildung dominieren deutlich die Hochschulabschlüsse (Akkermann/Betzelt/Daniel1990; Bochow 1997c). Wiederum ist denkbar, dass die Einstellung zur Homosexualität inunteren Schichten weniger liberal ist, <strong>Personen</strong> mit <strong>gleichgeschlechtlich</strong>er Orientierung diesedaher eher verdeckt leben <strong>und</strong> so empirisch kaum erreichbar sind. Vereinzelt wird aber auchbehauptet, Unterschichtberufe seien homosexuellenfeindlich <strong>und</strong> Homosexuelle deshalb dortunterrepräsentiert.Drittens kann generell davon ausgegangen werden, dass offen lebende Homosexuelle tendenziellauch eher an empirischen Untersuchungen teilgenommen haben.Diese <strong>und</strong> weitere Kennzeichen der Befragten sind im Bericht vermerkt. Es ist nichtentscheidbar, inwieweit solche Spezifika von befragten Lesben <strong>und</strong> Schwulen als Hinweis zuden besonderen Kennzeichen des homosexuellen Bevölkerungsteils gewertet werden können<strong>und</strong>/oder einen Beleg für Verzerrungen von Stichproben bisheriger Erhebungen beiHomosexuellen darstellen. Plausibel erscheint, dass beides zutrifft.Der Forschungsstand <strong>und</strong> damit das Wissen über homosexuelle Menschen <strong>und</strong> vor allem überdie Lebensverhältnisse lesbischer Frauen kann insgesamt als lückenhaft bewertet werden. LangeZeit, bis in die 70er Jahre hinein, dominierte die Suche nach den Ursachen von Homosexualität,die sog. Ätiologieforschung, das wissenschaftliche Geschehen. Hintergr<strong>und</strong> dieser Forschungenwar das oftmals von starker Homophobie getragene Ziel, der Homosexualität als sozialerFehlentwicklung oder als Krankheit entgegenwirken zu können. Stellvertretend für die auchinnerhalb der Wissenschaften geltenden Vorurteile gegenüber Homosexuellen stehtbeispielsweise Helmut Schelsky mit seinem überaus erfolgreichen Buch "Die Soziologie derSexualität": "Die homosexuelle Geschlechtsbeziehung entspricht in ihrer Verfehlung desgegengeschlechtlichen Partnerbezugs, ihrem autistischen <strong>und</strong> narzisstischen Verharren beimeigengeschlechtlichen Leibe <strong>und</strong> ihrer biologischen <strong>und</strong> sozialen Zwecklosigkeit wohl amoffenbarsten unserer Kennzeichnung des abnormen Sexualverhaltens" (1955: 75). Deutlich wirdin diesem zeittypischen Zitat, was die wissenschaftliche Erforschung von Homosexuellen langeZeit beherrschte: Die im Vergleich zu Heterosexuellen abweichende <strong>und</strong> damit als abnormgeltende Sexualität. Kaum einmal wurden andere Aspekte des Lebens von <strong>gleichgeschlechtlich</strong>orientierten <strong>Personen</strong> erforscht. 1Erst seit den 70er Jahren beschäftigen sich Psychologie <strong>und</strong> Soziologie in empirischenUntersuchungen mit mehr als nur der homosexuellen Sexualität: Als wegweisend für dieErforschung lesbischer Lebensverhältnisse können u. a. die empirischen Arbeiten von SigridSchäfer (1975), Ursula Linnhoff (1976), Susanne von Paczensky (1984) oder Ilse Kokula (1983)gelten. Reimut Reiche <strong>und</strong> Martin Dannecker haben sich 1974 erstmals umfassend mit denLebenswelten schwuler Männer, ihren Fre<strong>und</strong>schaften <strong>und</strong> Berufsbiographien auseinandergesetzt. Seit diesem vielversprechenden Anfang stagniert allerdings die Erforschung lesbischerLebensverhältnisse: Nicht nur in ihren jeweiligen Lebenswelten selbst wurden lesbische Frauenmarginalisiert <strong>und</strong> verschwiegen, auch in der Wissenschaft. Anders die wissenschaftlicheAuseinandersetzung mit homosexuellen Männern: Die Krankheit AIDS war letztlich dafürverantwortlich, dass für die Erforschung schwuler Sexualität, aber auch der Lebenswelten seitMitte der 80er Jahre umfangreiche Mittel zur Verfügung standen. Zumindest für schwuleMänner gibt es damit so etwas wie eine kontinuierliche Forschungstradition, die es erlaubt, biszum Anfang der 70er Jahre Vergleiche zu ziehen.
Die nachfolgende Übersicht über einige Forschungsergebnisse konzentriert sich auf die fürdie vorliegende Studie relevanten Themen. Alle angeführten Ergebnisse stehen unter den ebenbeschriebenen methodischen Vorbehalten mangelnder Repräsentativität sowie unter Umständenverzerrter (häufig auch zu kleiner) Stichproben.C-2 Berufliche Situation <strong>und</strong> Berufsbiographien von homosexuellen Frauen <strong>und</strong> MännernSeit der ersten umfangreichen Untersuchung über die Situation schwuler Männer in derB<strong>und</strong>esrepublik (Dannecker/Reiche 1974) wird die Theorie der (im Vergleich zuHeterosexuellen) anderen Berufsbiographie diskutiert. Martin Dannecker <strong>und</strong> Reimut Reichehaben Anfang der 70er Jahre eine berufliche <strong>und</strong> soziale Aufstiegsbewegung unterhomosexuellen Männern festgestellt, die folgende Aspekte aufweist:• das "Herausdrängen" aus Tätigkeiten der Produktion <strong>und</strong> des Handwerks inAngestelltenpositionen,• in Angestelltenpositionen eine Tendenz weg von der Industrieverwaltung "hin zurZirkulationsfront des Kapitals..., wo Waren <strong>und</strong> Menschen bewegt werden"(Dannecker/Reiche 1974a: 308),• in allen Stufen der Berufshierarchie Tendenz zu Beschäftigungen, die direkt mitMenschen zu tun haben: Diese werden dort unmittelbar körperlich, geistig, als Käuferoder Konsument behandelt.Ihre Untersuchung hat die zum damaligen Zeitpunkt zur heterosexuellen männlichenBevölkerung konträre Berufswahl <strong>und</strong> -biographie bestätigt. Schwule Männer nahmen Anfangder 70er Jahre große Anstrengungen auf sich, um beruflich in Tätigkeiten desDienstleistungssektors einzusteigen. Der enge Kontakt zu Menschen stellte sich dabei alsflüchtig <strong>und</strong> von kurzer Dauer heraus: "Dabei ist das Verhältnis zu diesen Menschen durchseinen einseitigen Objektcharakter bestimmt: Die Menschen sind auf die eine oder andere Weiseals Käufer, K<strong>und</strong>en, Patienten, Gäste, Schüler, Zuschauer zu behandeln, zu versorgen. Zweitensist es wesentlicher Inhalt vieler dieser Tätigkeiten, die Welt als schönen Schein vorzustellen, ummit dessen Hilfe besser verkaufen zu können" (Dannecker/Reiche 1974a: 322).Über 20 Jahre später gilt dies in Teilen immer noch, wie die bislang aktuellste Studie zumBerufsverhalten von Homosexuellen (Knoll/Edinger/Reisbeck 1997) bestätigt: DieÜberlegungen gewinnen auch Gültigkeit für die Berufsverläufe lesbischer Frauen. Den befragtenhomosexuellen Frauen <strong>und</strong> Männern wird eine kollektive Berufsbiographie bescheinigt, derenwesentliches Merkmal noch immer das Herausdrängen aus Industrie <strong>und</strong> Handwerk <strong>und</strong> derAufstieg in Angestelltenpositionen ist, die den Umgang mit Menschen zum Gegenstand haben.Die befragten Lesben <strong>und</strong> Schwulen sind überwiegend als Angestellte tätig, Männer oftmals inleitender Position bei Banken <strong>und</strong> Versicherungen oder als Lehrer, Lesben als Angestellte in"Frauenberufen": Dies sind insbesondere soziale, geistes- oder naturwissenschaftliche Berufe<strong>und</strong> Tätigkeiten im Ges<strong>und</strong>heitswesen. Neben diesen Berufen sind Lesben <strong>und</strong> Schwuleinsbesondere in bestimmten Bereichen der Dienstleistungen vertreten (Einzelhandel, Hotels <strong>und</strong>Gaststätten), in handwerklich-technischen Berufen dagegen im Vergleich zurGesamtbevölkerung unterrepräsentiert. Lesben arbeiten zudem seltener in kaufmännischenBerufen. Darüber hinaus verfügen Homosexuelle über ein hohes Durchschnittsnettoeinkommen:In der Studie von Knoll, Edinger <strong>und</strong> Reisbeck verdienen die befragten Männer im Durchschnitt3.267 DM, die Frauen 2.466 DM.Als zweites Merkmal vor allem schwuler Berufsbiographien wird in dieser Untersuchung einedeutliche Aufstiegstendenz behauptet: Ein Viertel der befragten Männer sindEntscheidungsträger in Personalfragen, 50% der befragten Schwulen wollen eineFührungsposition erlangen. Zwischen der mittleren <strong>und</strong> oberen Führungsetage existiert allerdingseine unsichtbare Barriere (Knoll/Edinger/Reisbeck 1997): Für Positionen im oberenManagement wird in der Regel immer noch eine Ehefrau im Hintergr<strong>und</strong> vorausgesetzt. Noch
positiver sieht Hinzpeter (1997) die berufliche Situation der Schwulen: Er geht davon aus, dassSchwule mit Ausnahme einiger besonders diskriminierter Bereiche wie Kirche oderB<strong>und</strong>eswehr, wo sie wegen eines angeblichen oder tatsächlichen Autoritätsverlusts keineFührungspositionen einnehmen dürfen, Karriere machen. Seiner Ansicht nach gebe es auchSchwule in Führungspositionen. Bedingt durch ihre Situation <strong>und</strong> Biographie, auch alsKompensation ihrer vermeintlichen Schwäche "Homosexualität" verfügen Schwule seinerMeinung nach über ein offenes Kommunikationsverhalten <strong>und</strong> eine große Spontaneität. DieTatsache, dass sie keine Kinder hätten, mache Schwule bei Versetzungen mobiler.Umstritten ist die seit Jahren immer wieder vorgebrachte Hypothese, dass homosexuelleMänner über spezifisch schwule Eigenschaften verfügen, die sie für bestimmte Berufe besondersgeeignet machen. "Insgesamt hat die Konzentration von Homosexuellen in bestimmtenBerufsgruppen nichts mit der Legende zu tun, sie seien durch natürliche Sensibilität, angeborenekünstlerische Talente oder eine spezifische Intelligenz oder Begabung ausgezeichnet. Vielmehrsind die soziale Logik <strong>und</strong> die Logik des Milieus verantwortlich für den Einfluss der sexuellenStrategien auf den beruflichen Werdegang" (Pollak 1984: 65 f.).Als Gründe für die Berufswahl <strong>und</strong> Leistungsorientierung von Lesben <strong>und</strong> Schwulen sehenKnoll, Edinger <strong>und</strong> Reisbeck (1997) den rauhen Umgangston <strong>und</strong> eine verhältnismäßig hoheDiskriminierung in typischen Arbeiterberufen. Homosexuelle weisen nach deren Ansicht(gegenüber den Berufen ihrer Eltern) eine hohe berufliche Mobilität auf <strong>und</strong> wählen unteranderem deswegen nicht die Berufe der Eltern, um der befürchteten Diskriminierung zuentgehen. Die Angst vor Ausgrenzung lasse Lesben <strong>und</strong> Schwule zudem einen Beruf wählen, derden Kontakt mit Menschen beinhaltet. Auch in dieser Studie wird wieder die Hypotheseaufgestellt, homosexuelle Menschen hätten durch die Bewältigung von Konflikten, etwa imVerlauf des Coming-out, eine erhöhte zwischenmenschliche Kompetenz, die sie zu solchenBerufen besonders prädestiniere (Knoll, Edinger, Reisbeck 1997).Immerhin vier von fünf Befragten waren im Prinzip zufrieden mit dem Beruf <strong>und</strong> demArbeitsklima, auch wenn sich nur die Hälfte sicher ist, keinen anderen Beruf ausüben zu wollen.Ein Drittel der Befragten kann sich als alternativen Beruf vor allem Tätigkeiten mit sozialemoder künstlerischem Engagement vorstellen.Die in diesem Abschnitt angeführten Ergebnisse basieren vielfach auf der Studie Knoll,Edinger <strong>und</strong> Reisbeck (1997). Wie aus der Übersicht zum Forschungsdesign der Datenbasisverschiedener Studien (im Anhang) ersichtlich, ist dies eines der wenigen Forschungsprojekte,das sowohl ein relativ großes Sample erreicht als auch durch eine Vielfalt von Zugangswegen zuden Befragten eine relativ ausgewogene Stichprobe zu erzielen sucht. Insofern erscheinen diehier angeführten Ergebnisse empirisch besser abgesichert als Ergebnisse zu anderen Themen.Allerdings ist auch die Studie von Knoll, Edinger <strong>und</strong> Reisbeck durch die eingangs erwähntenBesonderheiten gekennzeichnet. Auch in ihrer Stichprobe sind Befragte mit höheren Bildungs<strong>und</strong>Berufsabschlüssen (verglichen mit dem Bevölkerungsdurchschnitt) überrepräsentiert. Dieskann auf eine erhöhte Befragungsbereitschaft <strong>und</strong> einen besseren Zugang von höher Gebildetenzu einer solchen Befragung zurückzuführen sein, dies kann aber auch - zumindest tendenziell -besondere Kennzeichen von Homosexuellen widerspiegeln. Mangels genauerer Basisdaten,anhand derer sich Repräsentativität abschätzen ließe, muss offen bleiben, ob die zur beruflichenSituation <strong>und</strong> Berufsbiographie angeführten Ergebnisse die allgemeine Situation vonHomosexuellen oder eher die Besonderheiten der jeweiligen Stichprobe wiedergeben.C-3 Gleichgeschlechtliche PartnerschaftenDer Forschungsstand über lesbische Partnerschaften ist mehr als lückenhaft: NeuereErkenntnisse bezüglich Existenz, Dauer <strong>und</strong> anderer Charakteristika dieser Beziehungen liegennicht vor. Die wenigen Untersuchungen sind zum einen älteren Datums (Anfang der 80er Jahre)<strong>und</strong> weisen zum anderen deutliche Verzerrungen auf. So etwa die Untersuchung von
Akkermann, Betzelt <strong>und</strong> Daniel (1990): Bei den von ihnen Mitte der 80er Jahre befragten Lesbenhandelte es sich überwiegend um Studentinnen.a) Beziehungshäufigkeit <strong>und</strong> -dauerLesbischen Beziehungen wird gemeinhin nachgesagt, sie begännen langsamer <strong>und</strong>vorsichtiger als schwule Beziehungen, ein direkter sexueller Kontakt stände nur selten amAnfang einer Beziehung. Tatsächlich ist die Anzahl der Beziehungen im Lebensverlauf imVergleich zu Schwulen eher niedrig, bei 71 % der Mitte der 80er Jahre befragten Lesbenentwickelte sich aus dem ersten sexuellen Kontakt eine Liebesbeziehung(Akkermann/Betzelt/Daniel 1990). Mehr als die Hälfte (54%) der damals befragten Frauenlebten in festen Liebesbeziehungen, jede zehnte Frau in mehreren Beziehungen, 4% gabengelegentlich wechselnde sexuelle Kontakte an. Die durchschnittliche Dauer von Beziehungen lagdamals bei etwa 3 Jahren: Angesichts vieler sehr junger Frauen <strong>und</strong> Studentinnen, die damalsbefragt worden sind, vermutlich ein Wert, der deutlich unter der tatsächlichen durchschnittlichenDauer aller lesbischen Beziehungen liegt. Als gesicherte Erkenntnis gilt aber, dass die Dauer derBeziehungen mit dem Alter steigt, nur sehr junge Lesben scheinen zu eher kürzeren Beziehungenzu neigen. Auch der Zeitpunkt des Coming-out hat Einfluss auf lesbische Beziehungen. Sounterteilt Susanne von Paczensky (1984) die von ihr befragten Lesben nach dem Zeitpunkt desComing-out <strong>und</strong> der Tatsache, ob sie nach Entdeckung der Homosexualität noch heterosexuelleKontakte haben. Die größte Gruppe (40%) machen dabei die Lesben aus, deren Coming-out zueinem frühen Zeitpunkt stattgef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> die seitdem ausschließlich homosexuelle Kontaktehatten: Sie sind überwiegend fest befre<strong>und</strong>et <strong>und</strong> leben in getrennten Wohnungen. Haben Frauenmit frühem Coming-out nachfolgend auch heterosexuelle Kontakte, heiraten sie eher, als dass siefeste Beziehungen zu Frauen haben. Lesben, die erst sehr spät zu ihrer homosexuellen Identitätgef<strong>und</strong>en haben, leben zu 80% in festen Partnerschaften, die Hälfte von diesen auch mit derFre<strong>und</strong>in in einer gemeinsamen Wohnung.Mitte der 80er Jahre wohnten etwas weniger als die Hälfte der befragten fest befre<strong>und</strong>etenLesben mit der Partnerin zusammen. Von allen befragten Lesben wohnt damit etwa jede Viertemit der Fre<strong>und</strong>in zusammen, jeweils 37% wohnten allein oder in einer WG(Akkermann/Betzelt/Daniel 1990). In der jüngsten Untersuchung (Knoll/Edinger/Reisbeck 1997)wohnt ein Drittel aller befragten Frauen mit der Fre<strong>und</strong>in zusammen, vier von zehn Frauenwohnen allein, unabhängig davon, ob sie fest befre<strong>und</strong>et sind.Weitaus besser ist der Kenntnisstand über schwule Beziehungen: Sozusagen alsNebenprodukt mehrerer Untersuchungen über das Sexualverhalten schwuler Männer angesichtsder Bedrohung durch AIDS (siehe etwa die verschiedenen Studien von Michael Bochow), aberauch durch die Untersuchung von Dannecker <strong>und</strong> Reiche aus dem Jahr 1974 sowie einige neuereUntersuchungen ist es für einen Zeitraum von beinahe 30 Jahren möglich, die Entwicklungschwuler Partnerschaften nachzuzeichnen. Schwulen Männern aller Altersstufen wurde schonAnfang der 70er Jahre eine ausgeprägte Tendenz bescheinigt, feste Fre<strong>und</strong>schaften einzugehen.Damals lagen oft nur kurze Zeiträume zwischen einer alten <strong>und</strong> einer neuen Beziehung. 58% derdamals Befragten waren fest befre<strong>und</strong>et (Dannecker/Reiche 1974a), einzig Männer über 50 <strong>und</strong>solche unter 21 Jahren waren zu Beginn der 70er Jahre vergleichsweise weniger häufigbefre<strong>und</strong>et. Das Verhältnis befre<strong>und</strong>eter <strong>und</strong> nicht befre<strong>und</strong>eter Männer ist seitdem in etwakonstant geblieben: Schwankungen sind vermutlich eher methodisch bedingt als der Gesamtheitschwuler Männer geschuldet. So konstatierte Dannecker für die Mitte der 80er Jahre etwa 60%schwule Männer, die in festen Beziehungen lebten (Dannecker 1990). Bochow schätzt aufgr<strong>und</strong>seiner Studien den Anteil der homosexuellen Männer, die Ende der 80er <strong>und</strong> Anfang der 90erJahre einen festen Fre<strong>und</strong> haben, auf etwa die Hälfte aller Schwulen (Bochow 1993a; Bochow1994a; Bochow 1997c). Ein Drittel der Beziehungen dauerte Anfang der 70er Jahre nicht längerals ein Jahr, jede vierte Beziehung hingegen bestand länger als fünf Jahre. Analog zu denErgebnissen für lesbische Frauen steigt die Dauer der Beziehung mit dem Alter der Befragten:
Ende der 80er Jahre war in der Gruppe der 31- bis 35-Jährigen jeder Dritte über fünf Jahre festbefre<strong>und</strong>et, in der Gruppe der 35-bis 50-Jährigen waren es bereits über 40%. Allerdings habenältere Homosexuelle nach Beendigung einer Beziehung größere Probleme, eine neuePartnerschaft einzugehen. Im Gegensatz zu lesbischen Frauen steht am Anfang einer schwulenBeziehung meist ein sexueller Kontakt im Rahmen der Subkultur, aus dem sich eine Beziehungentwickelt.Für die 90er Jahre geht Michael Bochow davon aus, dass die Größenordnung der inBeziehungen lebenden Schwulen leicht gestiegen ist: In den zweijährlich durchgeführtenUntersuchungen von Michael Bochow lebten 1993/94 sowohl in Ost- als auch inWestdeutschland 55% der befragten Schwulen in festen Beziehungen (Bochow 1994a). In derletzten vorliegenden Untersuchung aus dem Jahr 1996 hatten 55% der ostdeutschen <strong>und</strong> 52% derwestdeutschen Schwulen einen festen Partner. Die Dauer der Beziehungen scheint aber in denmiteinander vergleichbaren Studien Bochows im Vergleich leicht gestiegen zu sein: 27% derBeziehungen dauerten 1996 länger als fünf Jahre, 14% zwischen drei <strong>und</strong> fünf Jahren, 18%zwischen ein <strong>und</strong> zwei Jahren <strong>und</strong> 28% unter einem Jahr (Bochow 1997c). Vor allem die Anzahlder über fünfjährigen Beziehungen ist gestiegen: 1993 bestanden 23% aller Beziehungen in denalten B<strong>und</strong>esländern mindestens fünf Jahre, 1996 28%. In den neuen B<strong>und</strong>esländern ist derenAnteil zwischen 1993 <strong>und</strong> 1996 von 20% auf 24% angestiegen (Bochow 1997c). Der Anteil deroffenen Beziehungen steigt mit der Dauer der Beziehung. In drei Viertel der Beziehungen miteiner Dauer von mindestens fünf Jahren gibt es sexuelle Kontakte auch außerhalb der Beziehung.Dieses Aufbrechen der Monogamie schwuler Partnerschaften in Abhängigkeit von der Dauer istein Spezifikum dieser Fre<strong>und</strong>schaften, auf das später noch eingegangen werden muss.Deutlicher als die Entwicklung fester Fre<strong>und</strong>schaften verändert sich die Wohnform <strong>und</strong> dieArt des Zusammenlebens: Zu Beginn der 70er Jahre wohnten 37% der damals fest Befre<strong>und</strong>etenzusammen (Dannecker/Reiche 1974a). Von einem "Zusammenwohnen" konnte aber nureingeschränkt die Rede sein, gab es doch keine gemeinsame Haushaltskasse oder gemeinsamangeschaffte Konsumgüter. In der Replikation dieser Studie (Danneckcr 1990) wohnten Ende der80er Jahre schon 42% der befre<strong>und</strong>eten Schwulen mit dem Fre<strong>und</strong> zusammen, die Hälfte vonihnen hatte eine Geld- <strong>und</strong> Gütergemeinschaft vereinbart. <strong>Paare</strong>, die nicht zusammenwohnen,haben weniger Angst vor Diskriminierung, sondern wollen häufig nicht ihre Autonomieverlieren.Unabhängig von einer Fre<strong>und</strong>schaft wohnen derzeit knapp 60% aller schwulen Männer allein(Knoll/Edinger/Reisbcck 1997; Bochow 1997c), etwa jeder fünfte Schwule zusammen mit einemFre<strong>und</strong> in einer gemeinsamen Wohnung. 2 Ostdeutsche Schwule wohnen häufiger als die in denalten B<strong>und</strong>esländern mit ihrem Fre<strong>und</strong> zusammen. Die Häufigkeit schwuler Beziehungen scheintim Übrigen kein westdeutsches Phänomen: In der kurz nach dem Beitritt zur BRDdurchgeführten Untersuchung in den neuen B<strong>und</strong>esländern (Starke 1994) lebten ebenfalls 59%der dort befragten Schwulen in einer festen Beziehung mit einem Mann, nur die Dauer scheintkürzer zu sein: Nur die Hälfte der Beziehungen dauerte länger als ein Jahr. Auch in dieserUntersuchung sind analog zu Beziehungen in den alten B<strong>und</strong>esländern drei von vierBeziehungen nicht monogam.b) Die Binnenstruktur der BeziehungenDie Wissensbildung <strong>und</strong> die Meinungen über die Beziehungen unter Männern oder Frauen isthäufig geprägt durch heterosexuell geprägte Vorstellungen über angebliche Eigenschaften vonMännern <strong>und</strong> Frauen. Oft fiel es den Forschenden - gleich welcher sexuellen Orientierung siesind - schwer, sich dem Forschungsgegenstand "homosexuelle Partnerschaften" zu nähern, ohnedass sie nicht versuchten, die traditionelle Geschlechterpolarität mit ihren Geschlechterrollen <strong>und</strong>angeblich natürlichen Charaktereigenschaften von Männlichkeit <strong>und</strong> Weiblichkeit auch aufhomosexuelle Menschen <strong>und</strong> Beziehungen zu übertragen. Homosexuelle Beziehungenwidersprachen der heterosexuellen "Normalität": Da Homosexuelle von dieser Polarität
abwichen, schrieb man den Lesben <strong>und</strong> Schwulen konsequenterweise entgegengesetzteEigenschaften zu: Der männliche Homosexuelle musste in dieser Sichtweise weiblicheEigenschaften besitzen. Die "Tunte", die typisch weibliche Eigenschaften in stark übertriebenerWeise verkörperte, galt - <strong>und</strong> gilt immer noch - als typische Personifizierung des Schwulen.Andererseits wurde die heterosexuelle Geschlechterpolarität oder auch Komplementarität inschwule <strong>und</strong> lesbische Beziehungen hineininterpretiert: Lesbische Beziehungen wurden in sichergänzende butch- <strong>und</strong> femme-Rollen aufgeteilt, in der Heterosexualität <strong>und</strong> damit dievermeintliche Normalität wiederhergestellt war. Dies waren nicht nur weit verbreitete Vorurteilein Öffentlichkeit <strong>und</strong> Wissenschaft, die Lesben <strong>und</strong> Schwulen bestätigten zudem im Rahmeneiner umfassenden Selbststigmatisierung die über sie herrschende Meinung.Immerhin werden heutzutage weibliche oder männliche Charaktereigenschaften <strong>und</strong> auch dieGeschlechterpolarität nicht mehr als quasi natürlich angesehen, sondern es wird davonausgegangen, dass auch lesbische <strong>und</strong> schwule <strong>Personen</strong> <strong>und</strong> deren Partnerschaften denResultaten eines typisch weiblichen oder männlichen Sozialisationsprozesses unterworfen sind.Aber auch so können neue Vorurteile entstehen: Lesbische Beziehungen gelten als harmonisch,gefühlvoll, ausgeglichen, romantisch <strong>und</strong> fernab jeglicher Sexualität. Schwulen Beziehungenwird Kurzlebigkeit unterstellt, sie werden meist auf gefühllose Sexualität reduziert.Und auch davon emanzipieren sich Lesben <strong>und</strong> Schwule zunehmend, wie etwa die Diskussionüber das schwule Selbstverständnis zeigt. Schwule <strong>und</strong> deren Partnerschaften werden vereinzeltsogar als Prototypen einer Individualisierung betrachtet, indem sie ihr Leben frei vongeschlechtsbezogenen Zuschreibungen <strong>und</strong> Vorgaben gestalten. Aber wie gestalten sich nunlesbische <strong>und</strong> schwule Beziehungen vor dem Hintergr<strong>und</strong> dieser zum Teil sehrwidersprüchlichen Meinungen <strong>und</strong> Ergebnisse? Gibt es so etwas wie typische schwule <strong>und</strong> lesbischePartnerschaften überhaupt? Dies wird im Folgenden zu klären sein.c) Lesbische PartnerschaftenAngesichts einer heterosexuellen Umwelt wird Beziehungen zwischen lesbischen Frauen vonlesbischer Seite eine zentrale Bedeutung zugeschrieben, da sie mit ihrer emotionalen Nähe,Zärtlichkeit <strong>und</strong> der Fähigkeit, die Partnerin zu verstehen, eine große Sicherheit bieten. AlsIdeale lesbischer Beziehungen gelten vor allem Romantik, Treue <strong>und</strong> Liebe: Auch wenn Lesbendurchschnittlich mehr Sexpartnerinnen haben als heterosexuelle Frauen, stehen damit lesbischeIdeale denen heterosexueller Frauen näher als schwule Ideale denen heterosexueller Männer.Lesben verbinden eher als Schwule sexuelle <strong>und</strong> emotionale Bedürfnisse. LesbischeBeziehungen der Gegenwart haben keine vordefinierten Rollen, die Rollenverteilung innerhalbder Partnerschaften orientiert sich an den jeweiligen Fähigkeiten <strong>und</strong> Präferenzen derPartnerinnen. Aber zugleich ist es genau diese Vorbildlosigkeit, die hohe Anforderungen anlesbische Beziehungen stellt, da vieles "selbst ausgedacht" werden muss (Meulenbelt 1987).Anja Meulenbelt kritisiert etwa die Neigung der Lesben, nur völlig gleichberechtigteBeziehungen für richtig zu halten, als neue Zwangsjacke. Auch hält sie die frauenspezifischeSozialisation für problematisch, in der Frauen gelernt haben, nicht für sich selbst, sondern fürandere zu sorgen: "Wenn beide beharrlich darauf achten, was die andere will <strong>und</strong> nicht wissen,was sie selbst wollen, bekommen beide nicht, wonach sie sich sehnen. Selbstsicherheit erscheintvielen Frauen als Egoismus" (Meulenbelt 1987: 147). Damit verb<strong>und</strong>en sei auch die Neigung,der gegenseitigen Übereinstimmung einen zu großen Stellenwert einzuräumen: "Sowohl durchdie Isolierung von außen als auch durch die erfahrene Sozialisation kann es passieren, dass dieBetonung in der Beziehung vor allem auf gegenseitige Übereinstimmung gelegt wird, dass eineunterdrückte Angst vor individuellen Unterschieden besteht, eine Neigung, die Unterschiede, diewir bei der anderen nicht sehen wollen, bei uns selbst zu unterdrücken. Aber bei allzu großerAnpassung wird die eigene Individualität unterdrückt, <strong>und</strong> damit auch die Sexualität"(Meulenbelt 1987: 148). Probleme bereitet auch das Abwägen zwischen Nähe <strong>und</strong> Distanz, wieunter anderem eine Befragung nordrhein-westfälischer Beratungsstellen für Leshen ergeben hat:
"So geschieht Abgrenzung innerhalb lesbischer Beziehungen oft erst sehr spät <strong>und</strong> dann eher imdestruktiven Sinne, indem die andere verletzt <strong>und</strong> abgewertet wird, nach der Devise: entwederabsolute Nähe oder Distanz durch Abwehr" (Berlage 1996: 120; zitiert nach: Ministerium fürFrauen, Jugend, Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit des Landes Nordrhein-Westfalen 1998: 34). DiesesAbwägen ist nach Ansicht von Meulcnbelt auch für eine befriedigende Sexualität erforderlich:"Um eine sexuelle Spannung fühlen zu können, ist nicht nur Nähe erforderlich, sondern auchAbstand. Nicht nur ein bestimmtes Maß an Vertrautheit ist notwendig, sondern auch ein Elementder Überraschung" (1987: 148). Neben diesen Problemen, die sich häufig aus ungenügendemFreiraum <strong>und</strong> mangelnder Selbständigkeit ergeben, werden noch Probleme des gemeinsamenAlltags wie etwa eine unterschiedliche Auffassung von Hausarbeit <strong>und</strong> Rollenkonflikte genannt(Akkermann/Betzelt/Daniel 1990). Seitensprünge sind häufig ein Gr<strong>und</strong> für Trennungen, auchinnerhalb lesbischer Beziehungen scheint Sexualität oftmals Konflikte zu erzeugen. Ihr wird inBeziehungen zwischen Frauen ein hoher Stellenwert zugeschrieben: Sie findet im Gegensatz zuden Schwulen überwiegend innerhalb von Beziehungen statt. Und doch kann sie in lesbischenBeziehungen zum Problem werden: Häufig ist Sexualität aufgr<strong>und</strong> einer sexualfeindlichenweiblichen Sozialisation ein Tabuthema, was etwa bei ungleichen sexuellen Bedürfnissen zuKonflikten führt. "Die Tabuisierung eigener Sexualität beruht zum Teil auf einerVerteidigungshaltung gegenüber dem gesellschaftlichen Vorurteil, Lesben nur über Sexualität zudefinieren" (Akkermann/Betzelt/Daniel 1990: 2). Dazu kommt auf der anderen Seite, dass Lustmit Männlichkeit verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> so abgelehnt wird, Passivität nicht genossen werden kann, wasAnja Meulenbelt zu folgendem Fazit veranlasst: "Wenn wir uns der herrschendenfeministischen/lesbischen Norm anpassen müssen, ist das nicht zwangsläufig angenehmer, alswenn wir uns patriarchalen Normen anpassen müssen. Ich glaube, dass Frauen, die nach der‚richtigen‘ Sexualität suchen, Recht haben, wenn sie behaupten, dass wir viel patriarchaleKonditionierung in unser Sexualleben mitgenommen haben. Doch andererseits bleibt vielleichtsehr wenig auf sexuellem Gebiet übrig, wenn wir uns alles verbieten, was auf irgendeine Art,infiziert‘ ist" (Meulenbelt 1987: 154).Trotzdem sind Lesben überwiegend mit ihren Beziehungen zufrieden(Akkermann/Betzelt/Daniel 1990): 90% der von ihnen befragten Lesben erleben in ihrenBeziehungen emotionale Nähe, erotische Spannung, sexuelle Befriedigung <strong>und</strong> geistigeVerb<strong>und</strong>enheit. Dies entspricht auch weitestgehend den Idealen der Lesben.d) Schwule PartnerschaftenImmer schon galten Schwule als liebesunfähig <strong>und</strong> hoch promiskuitiv, Beziehungen zwischenSchwulen eher als Ausnahme <strong>und</strong> nur von kurzer Dauer. Dies wurde von der im Vergleich zuLesben doch recht umfangreichen Erforschung Schwuler mittlerweile widerlegt: Nur sehr jungeSchwule wechseln häufig den Partner, ihre Beziehungen sind eher kurz, ansonsten wächst dieDauer der Beziehungen mit dem Alter der homosexuellen Männer.Auch Beziehungen zwischen schwulen Männern werden zunehmend freier von Vorgabenangeblich typisch männlicher Geschlechterrollen: Die Rollenverteilung in ihren Beziehungen istnicht komplementär. Die Machtverteilung innerhalb schwuler Beziehungen tendiert zurGleichheit, das Beziehungsideal geht von der Gleichberechtigung der Partner aus. Dies wird,ähnlich lesbischen Beziehungen, dadurch gestützt, dass beide Partner in der Regel ein eigenesEinkommen erzielen <strong>und</strong> damit vom Partner finanziell unabhängig sind. "Die <strong>Paare</strong> bauen ihreBeziehungen ohne Hilfe von klischeehaften Rollenbildern auf. . . Die weit verbreitete Annahme,dass ein Partner die ,männliche‘ <strong>und</strong> der andere Partner die ‚weibliche‘ Rolle spielt, gilt alsempirisch widerlegt... Vielmehr folgt die Beziehung dem Muster des ,besten Fre<strong>und</strong>es‘ <strong>und</strong> nichtdem Modell der ,Gattenbeziehung'" (Hoffmann/Lautmann/Pagenstecher 1993: 203). Schwuleneigen zu eher lockeren Beziehungen mit einer hohen gegenseitigen Unabhängigkeit, sievermeiden allzu große Nähe. Aber auch schwule Beziehungen befinden sich im Spannungsfeldzwischen Nähe <strong>und</strong> Distanz, Bindung <strong>und</strong> Autonomie. Enge Beziehungen wirken nach Ansicht
von Pingel <strong>und</strong> Trautvetter (1987) angstauslösend, unverbindliche Fre<strong>und</strong>schaften seienbeständiger, sie werden von schwulen Männern positiver erlebt. Für die im Vergleich zuHeterosexuellen kürzere Dauer schwuler Beziehungen sind nach Ansicht von Pingel <strong>und</strong>Trautvetter nicht irgendwelche Defizite schwuler Männer verantwortlich: "Wir wagen diePrognose, dass die Brüchigkeit heterosexueller Partnerschaften beim Wegfall von sozialerKontrolle <strong>und</strong> ökonomischer Abhängigkeit derjenigen der homosexuellen entspräche, so dassweder die angeblich frühkindlich narzisstische Störung noch eine anders begründeteBeziehungsunfähigkeit als besonderes Charakteristikum homosexueller Männer übrig bliebe"(Pingel <strong>und</strong> Trautvetter 1987: 82).Verbindliche Beziehungen schließen flüchtige sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehungnicht aus: Sexuelle Unabhängigkeit bzw. Freizügigkeit kann sogar entscheidend sein für einelebensfähige Beziehung <strong>und</strong> eine Beziehung stabilisieren, wenn dies zwischen den Partnernausgehandelt worden ist. Unter Treue verstehen schwule Männer zumeist nicht sexuelle Treue,der Zwang zur sexuellen Exklusiv-Beziehung besteht nicht. Es ist dieses Verhaltenhomosexueller Männer, etwa das gezielte Eingehen sexueller Kontakte im Rahmen der schwulenSubkultur, welches zum gesellschaftlichen Urteil der angeblichen extrem hohen Promiskuitätschwuler Männer geführt hat. Damit werde nach Ansicht von Martin Dannecker (1990) denSchwulen aber unrecht getan. Promiskuitiv sei jemand, der unfähig sei, feste Beziehungeneinzugehen. Aus einer hohen Anzahl von Sexualpartnern könne aber nicht zwingend auf diePromiskuität des schwulen Mannes geschlossen werden. Im Gegenteil: "Auszugehen ist also beiihnen von zwei gleichzeitig vorhandenen Objektbeziehungsmodalitäten: Da gibt es einerseits dasflüchtige, relativ zufallige Sexualobjekt, das vor allem dazu geeignet sein muss, rasche sexuelleBefriedigung zu verschaffen. Andererseits gibt es bei einer Mehrheit von ihnen gleichzeitig dashoch spezifische Objekt ,fester Fre<strong>und</strong>', an das dauerhafte sexuelle <strong>und</strong> zärtliche Interessengeb<strong>und</strong>en sind" (Dannecker 1994: 276). Dieses Aufbrechen sexueller Exklusivität ist nachAnsicht vieler Beobachter, Forscher <strong>und</strong> Autoren eine wichtige <strong>und</strong> zugleich moderne Eigenartschwuler Männer: In schwulen Beziehungen wird häufig ein Prototyp kommender, besondersindividualisierter Beziehungen gesehen.Aber auch innerhalb der schwulen Beziehungen wird der Sexualität eine wichtige Bedeutungbeigemessen, Beziehungen dann beendet, wenn keine sexuellen Kontakte mehr mit dem Partnererfolgen, sondern nur noch außerhalb der Beziehung. Schwule selbst messen der Sexualität <strong>und</strong>der sexuellen Attraktivität in Beziehungen eine sehr hohe Bedeutung bei (Dannecker 1990).Trotzdem: Je länger die Beziehung nun dauert, desto desexualisierter wird die Beziehung,parallel dazu werden die Beziehungen immer offener. Unabhängig von einem Verschwinden derSexualität aus der Beziehung: Schwule sind überwiegend sehr zufrieden mit ihrer Beziehung, dieam längsten dauernden Beziehungen weisen die höchste Zufriedenheit auf. Als die größtenGefahren für schwule Partnerschaften sehen homosexuelle Männer fehlende seelische Harmonie<strong>und</strong> fehlende sexuelle Harmonie (Dannecker 1990). Auch hier wird deutlich, welchenStellenwert Sexualität in schwulen Beziehungen besitzt. Als Gr<strong>und</strong> für eine angeblicheSeltenheit <strong>und</strong> kurze Dauer schwuler Beziehungen, so die Einschätzung <strong>und</strong> das Selbstklischeeschwuler Männer, gaben die von Dannecker 1990 befragten Männer vor allem die fehlendepositive Sanktionierung homosexueller Fre<strong>und</strong>schaften an, daneben noch die Verdoppelungmännlicher Rollenmuster.Die Einstellungen zur Treue in schwulen Beziehungen stehen dem tatsächlichen Verhaltengegenüber. Treue wird seit AIDS zu einem immer wichtigeren Wert: Zu Beginn der 70er Jahrelehnte ein Viertel der fest befre<strong>und</strong>eten Schwulen die sexuelle Untreue des Fre<strong>und</strong>es ab, einweiteres Viertel duldete das Fremdgehen des Partners, die Hälfte war zum damaligen Zeitpunktmehr oder weniger mit den sexuellen Kontakten außerhalb der Beziehung einverstanden. Diesexuelle Untreue war entsprechend keine Ausnahme, sie wurde auch nicht vor dem Fre<strong>und</strong>verborgen (Dannecker/Reiche 1974a). Ende der 80er waren infolge von AIDS nur noch 5% derin Beziehungen lebenden Schwulen mit dem Fremdgehen des Partners völlig einverstanden
(Dannecker 1990), ein Drittel lehnte Untreue ab, jeder fünfte duldete sie: über 44% hattenVorbehalte gegenüber 32% der fest Befre<strong>und</strong>eten 1971. Auch die Beziehungsideale sind deutlichvon Treuevorstellungen geprägt: sechs von zehn Schwulen haben Treue- bzw. Beziehungsideale,die sexuelle Untreue prinzipiell ausschließen: "Die Mehrheit der homosexuellen Männer hältdemnach entgegen ihrer Praxis an der allgemeinen Haltung gegenüber sexueller Untreue indieser Kultur fest. Dieser Haltung zufolge ist die sexuelle Untreue ein Verrat an der Liebe. Diewissende Duldung oder gar eine gegenseitige Akzeptanz der sexuellen Untreue ist von den auchvon homosexuellen Männern nach wie vor vertretenen Treueidealen her betrachtet nahezugleichbedeutend mit einem Sakrileg" (Dannecker 1990: 161).Da nun trotzdem viele feste Beziehungen aus flüchtigen sexuellen Kontakten in der Subkulturentstehen, sind es gerade diese Kontakte, die einer Beziehung gefährlich werden können, kanndieser rein sexuelle Kontakt doch jederzeit emotionalisiert werden.Eine knappe Wertung des Forschungsstandes zum Thema homosexuelle Partnerschaften mussneben der Frage der empirischen Absicherung von Ergebnissen auch die Erhebungszeitpunkteberücksichtigen, auf die sich vorliegende Studien beziehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind -ähnlich wie bei heterosexuellen <strong>Paare</strong>n - Formen der Partnerbindung <strong>und</strong> die Binnenstrukturender Beziehung einem relativen raschen Wandel unterworfen. Die aufgeführten Ergebnissebeziehen sich auf Erhebungszeitpunkte in den 80er Jahren. Auch wenn diese Studien diedamalige Situation zutreffend wiedergeben, bleibt zu klären, welche Kennzeichen homosexuellePartnerschaften gegenwärtig aufweisen <strong>und</strong> wie sie sich von heterosexuellen Partnerschaftenunterscheiden.C-4 Elternschaft <strong>und</strong> KinderEingangs sei nochmals in Erinnerung gerufen, dass die Ergebnisse zur LebensgestaltungHomosexueller mit methodischen Problemen behaftet (z.B. zu kleine bzw. verzerrteStichproben) <strong>und</strong> vielfach nicht ausreichend gesichert sind. Dies gilt insbesondere auch für denBereich Elternschaft. Beispielsweise gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine verlässlichenAngaben über die Zahl der Lesben <strong>und</strong> Schwulen, die mit Kindern zusammenleben, obwohldieses Thema zunehmend - wenn auch kontrovers - auch unter den Lesben <strong>und</strong> Schwulendiskutiert wird. Vertreten werden auf der einen Seite Positionen, die die lesbische Lebensweisemit der Ablehnung von heterosexuellen Lebensformen <strong>und</strong> von Mutterschaft verknüpfen (Rick1988). Das lesbische Selbstbild der 70er Jahre war bestimmt von der Idee, dass eine Lesbe vonMännern <strong>und</strong> Kindern unabhängig ist: "Das Aufbrechen heterosexueller Beziehungsmuster ist ...eine der wesentlichsten Voraussetzungen zur Zerstörung von Machtstrukturen, die die Frauunterdrücken, in dem Sinne, als sie ihr Macht nur innerhalb der Familie zugestehen ...Homosexuelle Beziehungen zwischen Frauen als Entwurf neuer Lebensformen, Zärtlichkeit fürdas eigene Geschlecht <strong>und</strong> Lust auf den Körper der Frau zuzulassen, dem Diktat derAufopferung für Kinder (<strong>und</strong> der selbstlosen Vergabe von Liebe ohne Gegenleistung), derInflation der Gefühle sozusagen, die die Frauen kaputtmacht, wie sie sie unter dem Wertverkauft, nicht mehr zu folgen, ist der Widerstand gegen die verordnete Identität der Mutter, eineMöglichkeit subversiv gegen die Allmacht der Familie vorzugehen" (Rick 1988, 258). Derlesbische Feminismus ging von der Unvereinbarkeit von Lesben <strong>und</strong> Kindern aus, mehr noch:Lesbisches Leben geriet zur radikalen politischen Praxis <strong>und</strong> machbaren Utopie, in der es gilt,"... weibliche Verhaltensmuster zu konstituieren, die sich nicht nach dem männlichen Begehrenrichten" (Rick 1988, 259).Dem stehen seit Anfang der 90er Jahre Sichtweisen gegenüber, die in der Verbindung von lesbischerLebensweise <strong>und</strong> Mutterschaft keinen Gegensatz sehen, sondern fordern, dass dieInstitution Mutterschaft neu überdacht <strong>und</strong> definiert werden solle (Streib 1991; Rieh 1991). Zumeinen wird der ehemalige Konsens der Unvereinbarkeit von lesbischer Lebensweise <strong>und</strong>(gewollter) Mutterschaft als dogmatisch <strong>und</strong> letztlich falsch kritisiert (Quadflieg 1991), zum
anderen wird die Nichtexistenz lesbischer Mütter in Frage gestellt: "Die Gründe für dievermeintliche Nichtexistenz lesbischer Mütter sind vielschichtig. Ganz wesentlich ist dasVerschweigen der Existenz frauenliebender Frauen an sich, das damit auch lesbische Mütterverneint <strong>und</strong> ohne Vorbild belässt ... In einer zwangsheterosexuell strukturierten Gesellschaft ...scheint lesbische Mutterschaft in ganz besonderem Maße etwas Undenkbares zu sein, etwasjenseits aller Vorstellungen <strong>und</strong> Bilder, die für Frauen entworfen wurden." (Streib 1991, 19).Eine erste Schätzung stammt von der Berliner Frauenzeitung Courage (5/1978, zitiert nach Streib1991: 20), welche die Zahl lesbischer Mütter in der BRD Mitte der 70er Jahre mit etwa 650.000veranschlagte. Gr<strong>und</strong>lage für diese Schätzung war die Annahme, dass von zwei MillionenLesben in der damaligen BRD jede dritte Mutter sei. 3Derzeit sind in Literatur, Diskussion <strong>und</strong> Realität zwei Gruppen lesbischer Mütterauszumachen: Zum einen diejenigen mit Kindern aus heterosexueller Vergangenheit, oftmals ausEhen. Diese sind im Rahmen von Ehescheidungen häufig in Sorgerechtsverfahren verwickelt, indenen beispielsweise Gutachter die Ansicht vertreten, Homosexualität sei eine Fehlentwicklung<strong>und</strong> das Sorgerecht den Vätern zu übertragen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> geht Leppers (1991) davon aus,dass viele Lesben bei der Drohung des Ehemannes, die lesbische Lebensweise zum Gegenstanddes Sorgerechtverfahrens zu machen, schon vorab auf das Sorgerecht verzichtet haben. Aberauch Gerichte haben in verschiedenen Urteilen der lesbischen Mutter das Sorgerecht verweigert,auch wenn sie nach Einschätzung von Leppers weniger eine mangelnde Erziehungsfähigkeit derMutter bemängeln, sondern eher befürchten, die Kinder erlebten <strong>gleichgeschlechtlich</strong>eLebensweisen <strong>und</strong> Partnerschaften als normal.Natürlich gibt es auch schwule Väter mit Kindern aus heterosexuellen Beziehungen, wieneuerdings der Fachbereich für <strong>gleichgeschlechtlich</strong>e Lebensweisen in Berlin zu bedenken gibt(Senatsverwaltung für Schule, Jugend <strong>und</strong> Sport 1997). Dort schätzt man die Zahl homosexuellerEltern b<strong>und</strong>esweit auf eine Million. Nach Ansicht der Berliner Behörde stammen Kinder zumeistaus vorhergehenden heterosexuellen Beziehungen: Jede dritte Lesbe <strong>und</strong> jeder fünfte Schwulehabe Kinder aus früheren heterosexuellen Beziehungen. Kinder bleiben nach einer Trennung vonEltern zumeist bei der Mutter: Dies gelte sowohl für lesbische Mütter als auch für schwule Väter,auch wenn diese den Kontakt zu den Kindern auch ohne Sorgerecht aufrechterhalten.Gleichzeitig gibt es die - derzeit noch recht wenigen - Lesben, die ein Kind adoptieren wollenoder eine künstliche Befruchtung wünschen. Derzeit können lesbische <strong>Paare</strong> in der BRD zumeinen gemeinsam keine Kinder adoptieren, nur einzelnen <strong>Personen</strong> <strong>und</strong> damit auch lesbischenFrauen ist es zumindest theoretisch möglich, ein Kind zu adoptieren. Zum anderen ist aufgr<strong>und</strong>standesrechtlicher Vorschriften der Ärzte in der BRD nicht verheirateten Frauen nicht möglich,mit Hilfe der Reproduktionstechnologie Mutter zu werden. Das der Adoptionsvermittlungzugr<strong>und</strong>e liegende Ideal der heterosexuellen Kleinfamilie, aber auch die von Männern dominierteFortpflanzungstechnologie wird von lesbischer Seite kritisiert (Burgert 1991): Diese stärke denheterosexuellen Kerngedanken, dass eine Frau Kinder haben solle <strong>und</strong> müsse. So bleibenLesben, die ein Kind bekommen möchten, derzeit nur zwei Möglichkeiten: DieSelbstinsemination <strong>und</strong> private Beschaffung von Sperma oder gezielte heterosexuelle Kontakte.Ein weiterer Diskussionsgegenstand ist die Situation der Kinder von <strong>gleichgeschlechtlich</strong>orientierten Elternteilen oder in <strong>gleichgeschlechtlich</strong>en Partnerschaften. Vor allem wird immerwieder die Verführung dieser Kinder zur Homosexualität thematisiert <strong>und</strong> die Gefahr dessexuellen Missbrauchs dieser Kinder beschworen. Demgegenüber sprechen (bislang nochvereinzelte) Untersuchungen (Rentier 1989; Rauchfleisch 1997; Senatsverwaltung für Schule,Jugend <strong>und</strong> Sport 1997) für die Hypothese, dass es keine erkennbaren Unterschiede gibt in derEntwicklung von Kindern hetero- oder homosexueller Eltern. Insbesondere entwickeln letztereeine Geschlechtsrollenidentität <strong>und</strong> ein Rollenverhalten, welches ihrem biologischen Geschlechtentspreche. Diese Kinder seien auch nicht häufiger homosexuell als Kinder heterosexuellerEltern. Ihre intellektuelle, emotionale <strong>und</strong> soziale Entwicklung unterscheide sich nicht vonKindern heterosexueller Eltern: In einigen Bereichen der sozialen Kompetenz sind Kinder
lesbischer oder schwuler Eltern nach Ansicht von Rauchfleisch anderen Kindern sogarüberlegen, sie entwickeln "... ein größeres Ausmaß an Toleranz <strong>und</strong> Einfühlungsfähigkeitgegenüber anderen Menschen ... <strong>und</strong> lernen in der Zwei-Mütter- respektive Zwei-Väter-Familieeinen wesentlich partnerschaftlicheren Beziehungsstil kennen als in vielen heterosexuellenFamilien, so dass sie später in eigenen heterosexuellen Beziehungen auch eher zum Aufbau einer,egalitären Paarbindung' fähig sind" (Rauchfleisch 1997: 79).C-5 Soziale Netzwerke <strong>und</strong> die lesbisch-schwule SubkulturAufgr<strong>und</strong> oftmals gestörter Beziehungen zur Herkunftsfamilie, aber auch zu heterosexuellenFre<strong>und</strong>en, zu denen der Kontakt im Verlauf des Coming-out häufig problematisch odereingestellt wird, erlangen lesbische <strong>und</strong> schwule Netzwerke eine besondere Bedeutung <strong>und</strong>werden bisweilen in den Rang einer sog. Wahlfamilie erhoben. "Kennzeichen dieser selbstgewählten Familien sind ihre fließenden Grenzen, die Tatsache, dass sie sich aus Geliebten,Fre<strong>und</strong>innen, Ex-Geliebten <strong>und</strong> Kindern in jeder denkbaren Kombination zusammensetzen,sowie die völlige Abwesenheit von Regeln, Vorbildern <strong>und</strong> Modellen" (Schwules NetzwerkNRW (Hrsg.) o.J.: 4). Im Gegensatz zu vielen Heterosexuellen messen homosexuelle MenschenWahlfamilien oder Fre<strong>und</strong>schaften eine große Bedeutung bei. Paarbeziehungen <strong>und</strong>Wahlfamilien werden nicht als konkurrierend begriffen, Wahlfamilien nicht auf diePaarbeziehung reduziert. Vor allem Lesben geben oftmals die Bezüge zu bisherigen Fre<strong>und</strong>enauf, Verbindungen zu lesbischen Frauen gewinnen dagegen an Bedeutung(Akkermann/Betzelt/Daniel 1990). Die Offenheit für lesbische Lebensweisen <strong>und</strong> derenAkzeptanz werden zum maßgeblichen Kriterium für Auswahl <strong>und</strong> Pflege heterosexuellerFre<strong>und</strong>schaften. Häufig wird die Frauen- <strong>und</strong> Lesbenbewegung aufgesucht, um Kontakt zuFrauen mit ähnlichen Vorstellungen der Lebensgestaltung herzustellen.Etwas heterogener scheinen schwule Netzwerke, auch wenn häufig ehemalige Partner zudiesen zählen. In der jüngsten Untersuchung (Bochow 1997c) leben nur 4% der befragtenwestdeutschen Schwulen ohne jegliche Fre<strong>und</strong>e. Die Mehrheit schwuler Männer hat sowohlheterosexuelle als auch homosexuelle Fre<strong>und</strong>e. Nur ein Drittel verfügt ausschließlich überhomosexuelle Männer im Fre<strong>und</strong>eskreis. 4 Damit hat sich die Kontaktsituation der Schwulen imVergleich zu den 70er Jahren entscheidend verbessert, wie sie zum damaligen Zeitpunkt vonHoffmüller <strong>und</strong> Neuer geschildert worden ist: "Weil die eigene Familie für den Homosexuellenkaum Bedeutung hat, kommt dem Bekannten- <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>eskreis, der peer-group, eine größereBedeutung zu. Dabei erscheint die Zusammensetzung dieser Gruppen äußerst heterogen, weilHomosexuelle einen Bekannten- <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>eskreis unter den aufgelegten Beschränkungen, denallgemeinen Diskriminierungen, nur schwer aufbauen können <strong>und</strong> deshalb auch bereit sind,diesen Kreis locker <strong>und</strong> unverbindlich zu halten. Denn sowohl die Arbeitssituation der meistenHomosexuellen wie auch die Subkultur ... stellen diesbezüglich Forderungen, die demHomosexuellen kaum Gelegenheit bieten, einen festen, intensiven Bekanntenkreis zu schaffen"(1977: 124 f.).Im Unterschied zur heterosexuellen Bevölkerung hat neben dem privaten Fre<strong>und</strong>eskreis oderder peer-group die sog. Subkultur eine große Bedeutung im Leben von Lesben <strong>und</strong> Schwulen.Dabei ist vor allem die lesbische Subkultur zu trennen in einen eher privaten <strong>und</strong> einen politischöffentlichenTeil, der von Beginn an eine große Nähe zur Frauenbewegung aufgewiesen hat. Dieschwule Subkultur war zu keinem Zeitpunkt zweigeteilt, der eher private Teil der Subkultur fürdas Leben schwuler Männer immer schon von größerer Bedeutung. Nur zu Beginn der 70er, vordem Hintergr<strong>und</strong> der ersten Reform des § 175 StGB <strong>und</strong> anderer gesellschaftlicher Umbrüche,existierte eine gemeinsame Homosexuellenbewegung, in der Lesben <strong>und</strong> Schwule zusammen fürihre Emanzipation eintraten. Nach einer doch recht kurzen Phase der Zusammenarbeit trenntensich deren Wege wieder, es bildeten sich getrennte Strukturen heraus. Die öffentliche Arbeit <strong>und</strong>Bewegung der Schwulen wurde seit den 80er Jahren nachhaltig von der damals aufkommenden
Krankheit AIDS bestimmt, die öffentliche Lesbenbewegung behielt ihre starke Affinität zurFrauenbewegung <strong>und</strong> kritisierte vor allem das Geschlechterverhältnis <strong>und</strong> männlich dominierteMachtstrukturen. Erst seit der öffentlichen Diskussion über das Für <strong>und</strong> Wider der "Homoehe"ist in Ansätzen wieder eine gemeinsame politische <strong>und</strong> öffentliche Arbeit von Lesben <strong>und</strong>Schwulen zu beobachten. 5Das Argument, eine homosexuelle Subkultur könne dazu beitragen, die Gesellschaft zuverändern, gewinnt vor dem Hintergr<strong>und</strong> der "Homoehe" wieder an Bedeutung: "Zunahme <strong>und</strong>Ausdifferenzierung der schwul-lesbischen Subkultur <strong>und</strong> Erfolg im Bemühen umgesellschaftliche Anerkennung von Homosexualität gehen Hand in Hand. Nur wenn sie durchviele Möglichkeiten der Identifikation in allen Lebensbereichen eine stabile <strong>und</strong> positiveIdentität entwickeln können, haben Schwule <strong>und</strong> Lesben den Mut <strong>und</strong> die Selbstsicherheit, sicherkennen zu geben <strong>und</strong> sich für gleiche Rechte <strong>und</strong> gegen Unterdrückung einzusetzen. In diesemProzess entsteht ein gesellschaftliches Bewusstsein von Homosexualität, das über Subkulturhinausreicht" (Knoll/Edinger/Reisbeck 1997: 82). So haben sich in dieser Untersuchung 80% derbefragten Frauen <strong>und</strong> Männer für Bereiche zwischen Abgrenzung <strong>und</strong> Integrationausgesprochen, in denen sie unter sich sind: Trotzdem ist es ihnen wichtig, als Lesben <strong>und</strong>Schwule in der Öffentlichkeit erkennbar zu sein (Knoll/Edinger/Reisbeck 1997). Die in immermehr Städten durchgeführten Christopher-Street-Day-Paraden etwa symbolisieren diesesdoppelte Anliegen. Trotzdem fühlen sich Homosexuelle in einem heterosexuellem Alltag oftfremd, ihnen fehlt ein essentieller Bestandteil zur Aufrechterhaltung ihrer Identität. Die dazunotwendigen "Wir-Gefuhle" können in einem heterosexuellen <strong>und</strong> für sich die Normalitätbeanspruchenden Umfeld oft nicht aufkommen. Durch die Aufrechterhaltung <strong>und</strong> Pflege einervor allem privaten Subkultur können homosexuelle Menschen beweisen, dass sie genau wieHeterosexuelle ein gemeinschaftliches Leben gestalten können.Die jeweiligen eher privaten Teile der Subkultur weisen allerdings so gut wie keineGemeinsamkeiten oder gemeinsame Historie auf. Gemeinsam ist ihnen noch ihre Funktion imLebensverlauf eines homosexuellen Menschen. Zwischen der ersten Idee oder Ahnung, sich eherzu <strong>Personen</strong> des eigenen Geschlechts hingezogen zu fühlen, dem Coming-out, derSelbstannahme <strong>und</strong> der Aufnahme sozio-sexueller Kontakte vergehen oftmals Jahre, in denen diejeweilige Subkultur wichtige Funktionen wahrnehmen kann. Die Subkultur unterstützt dieEntwicklung einer stabilen lesbischen oder schwulen Identität unter anderem durch ihrumfangreiches Angebot an Beratungsmöglichkeiten. Wesentlich ist aber beiden privatenSubkulturen, dass in ihnen Kontakt zu anderen Lesben oder Schwulen gef<strong>und</strong>en werden kann.Die Bedeutung der schwulen Subkultur sehen Dannecker <strong>und</strong> Reiche (1974a) darin, dass sienach der Aufnahme von Kontakten zu anderen Homosexuellen am Ende des Coming-out dieweitere Entwicklung des Homosexuellen übernehme <strong>und</strong> unterstütze: "In ihr geht es nur noch umdie Ausformung eines in seinen Gr<strong>und</strong>zügen fertigen Homosexuellen, der über die Partizipationan ihr mit Attributen versehen, gewissermaßen an den kollektiven homosexuellen Überbauangeschlossen wird" (65). 6 Daneben erwerben nach Ansicht von Dannecker <strong>und</strong> Reiche Schwuleim Rahmen einer spezifischen subkulturellen Sozialisation bestimmte Techniken, die es zubeachten gilt, um als Homosexueller anerkannt <strong>und</strong> auch erkannt zu werden. Die schwuleSubkultur vor allem großer Städte besteht in der Regel aus Bars, Clubs, Diskotheken,Gaststätten, Parks, bestimmten Straßen <strong>und</strong> Plätzen, Saunabädern, öffentlichen Toiletten (sog.Klappen) bis hin zu bestimmten Urlaubsorten <strong>und</strong> wird von Dannecker <strong>und</strong> Reiche (1974a) als"Sexmarkt" bezeichnet, da sie Sexualität zu verwirklichen hilft. Die Bereitschaft zu sexuellenKontakten wird durch den Aufenthalt in ihr offenbart, außerhalb der Subkultur dagegen ist esschwer <strong>und</strong> fast schon umständlich, Sexualpartner zu finden. Trotzdem ist die schwule Subkulturnicht auf ihre Funktion als Sexmarkt zu reduzieren, wenn man seine nochmalige Unterteilung inzwei Bereiche betrachtet: In Parks, Klappen oder Saunabädern dominiert eindeutig das sexuelleMoment, verbale Kommunikation <strong>und</strong> andere soziale Elemente werden an diesen Ortenweitgehend reduziert, zudem garantieren diese vollständige Anonymität. Etwa 10% der
Schwulen suchen ausschließlich solche Orte auf (Bochow 1997c). Es wird dies im Übrigen alsein Indikator für eine geringe Selbstakzeptanz angesehen, weisen diese Schwulen doch den imVergleich zu anderen Schwulen höchsten Grad an Geheimhaltung ihrer Homosexualität auf.In Bars, Clubs, Diskotheken u. ä. hingegen gilt der Doppelcharakter des Sexuellen <strong>und</strong>Sozialen: Diese Orte sind zugleich Sexmarkt <strong>und</strong> Kommunikationszentrum, Anknüpfungspunktfür viele soziale Aktivitäten <strong>und</strong> mit ihren Funktionen einem Fre<strong>und</strong>eskreis sehr ähnlich. Noch inden 70er Jahren galt die - in der Rückschau leicht anrüchig wirkende - Bar als zentrale Institutiondes schwulen Lebens, setzte sie doch auch ein gewisses Maß an Selbstakzeptierung voraus(Dannecker/Reiche 1974a), heute dürfte sie ihren Platz vor allem an schwule Diskotheken <strong>und</strong>"Kneipen" abgetreten haben. Neben diesem Doppelcharakter gilt, dass fest befre<strong>und</strong>ete Schwuleihren Partner überwiegend in diesem subkulturellen Zusammenhang kennen gelernt haben(Dannecker 1990): Schon in den 70ern galt, dass feste Fre<strong>und</strong>schaften oftmals aus flüchtigensexuellen Kontakten im Rahmen der Subkultur entstanden sind.Entgegen der Erwartung hat weder die Etablierung der emanzipatorischen Schwulenbewegungmit ihrer Vielzahl von Schwulengruppen noch der liberalere Umgang mit Schwulen <strong>und</strong>den Reformen des § 175 StGB zu einem Zusammenbruch dieses Teils der schwulen Subkulturgeführt. Im Gegenteil: Gerade die Bereiche der Subkultur, die flüchtige sexuelle Kontakteermöglichen, haben sich erweitert: Nach Dannecker (1990) ein Indiz dafür, dass gerade schwuleMänner am ehesten von der Liberalisierung der Sexualität, der Entkoppelung von Liebe <strong>und</strong>Sexualität profitiert haben. Aber nicht alle Schwulen suchen regelmäßig die Orte der Subkulturauf: Solche in Großstädten eher als in kleineren Städten oder ländlichen Gebieten. Das hängt nurnoch kaum damit zusammen, dass die schwule Subkultur in den 70ern eine Erscheinung dergroßen Städte wie Berlin, Hamburg oder München war. Aber auch wenn schwules Leben nochimmer vornehmlich in Städten wie Köln, Berlin oder München sichtbar wird, muss heutzutagedie schwule Infrastruktur der Provinz den Vergleich mit Großstädten nicht mehr scheuen, sie hatsich auch dort fest etabliert (Hinzpeter 1997). Noch in den 70ern haben Großstädte <strong>und</strong> vor allemBerlin Schwule beinahe magisch angezogen, sie boten Anonymität, den nötigen Freiraum für dasComing-out <strong>und</strong> schwules Leben fernab der Eltern <strong>und</strong> generell größere Toleranz gegenüberHomosexuellen. Von einer Landflucht der Schwulen kann aber in den 90ern nicht mehrgesprochen werden.In der bislang einzigen Studie über Schwule außerhalb großer Städte (Bochow 1998) zeigtsich, dass die Mehrheit der Befragten mit ihrer Lebenssituation in kleinen oder mittleren Städten<strong>und</strong> ländlichen Regionen in Niedersachsen zufrieden ist <strong>und</strong> diese Lebenssituation überwiegendfrei gewählt ist. "Der wesentlich umfassenderen Infrastruktur für homosexuelle Männer in dendeutschen Millionenstädten wird die Lebenssituation in der ‚Provinz‘ vorgezogen, da die hiergelebten homo- <strong>und</strong> heterosexuellen Fre<strong>und</strong>schaften <strong>und</strong> die schwulen festen Beziehungen alsverbindlicher wahrgenommen werden <strong>und</strong> das emotionale Klima in den homosexuellenNetzwerken der nicht-großstädtischen Regionen Niedersachsens als solidarischer empf<strong>und</strong>enwird. Diese Einschätzung erfolgt vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Kenntnis homosexuellerLebenswelten in den Großstädten ... In den ,gay communities‘ der Millionenstädte Deutschlands... wird homosexuellen Männern, die auf dem Land oder in Kleinstädten leben, häufig unterstellt,dass sie einem intensiven ,Sextourismus‘ in die näher gelegene Großstadt mit größeren schwulenSzenen frönen würden. Diese Unterstellung erweist sich für die meisten Befragten alsunzutreffend" (Bochow 1998: 165 f.). Trotzdem beklagen sich diese Schwulen, dass vor allemdie persönlichen Netzwerke in der Provinz doch letztlich zu klein seien, um alle Defiziteschwulen Lebens auffangen zu können.Ganz anders stellt sich die lesbische Subkultur dar: Sie ist - wie lesbisches Leben generell -unsichtbarer als die schwule Subkultur mit ihren sexualisierten Orten wie Klappen oder Parks,sie weist eine größere Nähe zur politischen Frauen- <strong>und</strong> Lesbenbewegung auf <strong>und</strong> beinhaltetoftmals nur die sog. Bars in größeren Städten. Aber auch der Schritt in die lesbische Subkulturbedeutet einen Schritt der Selbstannahme, einen möglichen individuellen Stabilisierungsversuch
<strong>und</strong> die Weiterentwicklung der lesbischen Lebensweise <strong>und</strong> Persönlichkeit. In der lesbischenSubkultur werden oftmals Partnerinnen gesucht, auch wenn dieses Motiv in bisherigenUntersuchungen von vielen befragten Lesben geleugnet wurde. Die bislang einzige <strong>und</strong> sehrdetaillierte Studie über lesbische Subkultur befasst sich mit derjenigen im West-Berlin der 70erJahre (Kokula 1983). Aber trotz der Sonderrolle Berlins für Lesben (<strong>und</strong> auch Schwule) dieserZeit <strong>und</strong> des großen zeitlichen Abstandes verdienen die Beobachtungen von Ilse Kokula nochimmer Beachtung. Als wichtigsten Bestandteil der lesbischen Subkultur neben der Bar <strong>und</strong> denEmanzipationsgruppen betrachtet Kokula die Cliquen. Die lesbische Gemeinschaft oderSubkultur setzt sich aus informellen Gruppen, den Cliquen zusammen, die sich zum einen ausInteresse an einer gemeinsamen Freizeitgestaltung zusammenfinden oder sich darüber hinaus imRahmen der Emanzipationsbewegung engagieren wollen. Diese informellen Gruppen sind damiterst das konstitutive Element in Bar <strong>und</strong> Emanzipationsgruppe, sie machen die lesbischeGemeinschaft aus. Cliquen haben einerseits einen Abwehrcharakter, bieten die Möglichkeit,Aggressionen abzuleiten, andererseits sind sie ein wichtiges Identitätsobjekt. In der Bar oderEmanzipationsgruppe findet die Lesbe Zugang zu anderen Lesben, wird Bestandteil einer Clique,schließt dort Fre<strong>und</strong>schaften unterschiedlichster Art, erwirbt eine Identität als Lesbe <strong>und</strong> findetso Zugang zur Subkultur. Kokula erachtet den Beitritt zu einer Gruppe lesbischer Frauen, denCliquen, als einen ersten Schritt aus der Isolation, da die Lesbe sich vorher von der Familie lösenmusste, um als Lesbe leben zu können. In diesen Cliquen werde die Sicherheit erworben, um alsLesbe gegen die Konventionen leben zu können. Der Bar räumt Kokula hingegen nur einegeringe Bedeutung ein, die Lesbe könne dort zwar in die Gemeinschaft eintauchen, etwa imRahmen des Coming-out, eventuell sei dort auch eine Partnerin zu finden, die Chancen dafüraber nicht groß. Aber auch der Gr<strong>und</strong> für die Teilhabe in Cliquen oder Emanzipationsgruppen istoftmals die Suche nach einer Partnerin. "Sowohl für die Clique als einem Teil der Bar als auchfür Bars selbst gilt wie für alle freiwilligen Organisationen, dass die Teilnahme von derBefriedigung von Elementarbedürfnissen abhängig gemacht wird. Werden diese Bedürfnissenach Klärung der eigenen Identität, dem Finden einer Partnerin (oder mehreren) <strong>und</strong> nach einerHilfestellung gegenüber der Umwelt nicht befriedigt, erfolgt ein Rückzug in die Privatheit"(Kokula 1983: 54). Im Prinzip dient die Bar nur als Anknüpfungspunkt für die Bildung vonCliquen, die dann im Folgenden auch eigene Wege außerhalb der Bar gehen.Im Berlin der 70er Jahre, wie von Ilse Kokula beschrieben, hatte aber nur eine geringe Anzahlvon lesbischen Frauen Zugang zu einer Bar oder Emanzipationsgruppe, die große Mehrheit vonihnen lebte isoliert, nicht einmal in Cliquen. In der Untersuchung von Akkermann, Betzelt <strong>und</strong>Daniel (1990) waren Mitte der 80er Jahre aber schon etwa die Hälfte der damals befragtenLesben in der Frauen- <strong>und</strong> Lesbenbewegung aktiv. Lesben in kleineren Städten oder ländlichenGebieten beklagten sich hingegen über mangelnde Kontaktmöglichkeiten zur Szene bzw. zuanderen Lesben.C-6 Diskriminierung, <strong>Benachteiligung</strong> <strong>und</strong> HeterosexismusHomosexuelle Menschen sind in ihrem Alltag vielerlei Vorurteilen, Stereotypen <strong>und</strong>generalisierenden Vorannahmen ausgesetzt. Die wichtigsten lassen sich wie folgtzusammenfassen:• Homosexualität wird mit Sexualität gleichgesetzt oder darauf reduziert. Sexualität wirdgegenüber anderen Persönlichkeitsbereichen überbewertet, die sexuelle Abweichung istim Vergleich zu anderen Bestandteilen homosexuellen Lebens bestimmend.• Lesben wird Männlichkeit, Schwulen Weiblichkeit unterstellt. Paradoxerweise aber gelten"weibliche Männer" auch nicht als "richtige Männer".• Die Rollenverteilung innerhalb homosexueller Partnerschaften erfolgt nach Einschätzungder Heterosexuellen immer vor dem Hintergr<strong>und</strong> Männlichkeit/Weiblichkeit: Die sohergestellte Geschlechterpolarität gilt trotzdem als abnorm.
• Alle Lesben sind Männerhasser.• Schwule sind haltlos, triebhaft, verführen andere zur Homosexualität. Insbesonderemissbrauchen schwule Männer kleine Jungen sexuell. Auch Lesben wird die Tendenz zurVerführung von Mädchen nachgesagt.Viele dieser stereotypen Vorstellungen haben eine lange Entstehungsgeschichte, es scheintaber, dass die Wirkungskraft dieser Vorurteile nachlässt. So zeigen etwa die Einstellungenheterosexueller Männer <strong>und</strong> Frauen gegenüber Homosexuellen weniger ausgeprägte Ablehnung,sondern eher Unwissen <strong>und</strong> Ahnungslosigkeit (Ministerium für Frauen, Jugend, Familie <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heit des Landes Nordrhein-Westfalen 1999). Allerdings ist nur eine kleine Gruppe von<strong>Personen</strong> recht genau über die Situation von Lesben <strong>und</strong> Schwulen informiert: Der persönlicheKontakt zu homosexuellen Menschen scheint so ausschlaggebend für die ihnenentgegengebrachte Toleranz. Homosexuelle scheinen kaum wahrgenommen zu werden, Lesbennoch weniger als schwule Männer. Sind doch Vorurteile vorhanden, wird Lesben oft unterstellt,sie hätten männliche Züge bzw. Schwule weibliche Züge.Die sexuelle Orientierung ist Befragten einer anderen Bevölkerungsumfrage relativ unwichtig(Bochow 1993b), trotzdem haben etwa sechs von zehn Befragten das Bedürfnis nach sozialerDistanz gegenüber Homosexuellen, wird Homosexualität doch als Fehlentwicklung, sexuelleStörung oder Laster gesehen. Viele Befragte können sich Zugangsregeln oder Berufsverbote fürhomosexuelle Menschen bei bestimmten Tätigkeiten vorstellen.Unterschiedlich ist die Einschätzung, wie groß der stark homosexuellenfeindlicheBevölkerungsteil ist: Die Befragung nordrhein-westfälischer Bürger (Ministerium für Frauen,Jugend, Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit des Landes Nordrhein-Westfalen 1999) geht davon aus, dassstark ablehnende Einstellungen nur bei einem geringen Teil der Bevölkerung existieren <strong>und</strong> oftaus Unkenntnis <strong>und</strong> einer Reduzierung der Homosexualität auf die andere Sexualität resultieren.Deutlich anders die Ergebnisse der b<strong>und</strong>esweiten Befragung: "... mindestens ein Drittel derBevölkerung kann als stark schwulenfeindlich eingestuft werden, ein weiteres Drittel istambivalent, das heißt nicht durchgängig antihomosexuell, aber keinesfalls frei von ablehnendenoder klischeehaften Einstellungen" (Bochow 1993b: 122). Auch wenn sich die Verbreitung starkhomosexuellenfeindlicher Ansichten reduziert hat, gehen solche Ansichten nach Bochow immernoch einher mit einer allgemeinen Sexualfeindlichkeit, der Orientierung an patriarchalenGeschlechterrollen <strong>und</strong> einer konservativen politischen Präferenz.Aber Lesben <strong>und</strong> Schwule müssen sich nicht nur mit Klischees auseinander setzen, siewerden von einem heterosexuellen Umfeld auch beleidigt, ignoriert, körperlich angegriffen, gemobbt<strong>und</strong> vieles mehr. Und dies in vielen Bereichen ihres Lebens: in der Familie, im Beruf, inSchule <strong>und</strong> Universität, auf der Straße <strong>und</strong> in der Öffentlichkeit. Die allgegenwärtige Präsenz desHeterosexuellen wird auch als Heterosexismus bezeichnet: "Unter Heterosexismus ist einideologisches System zu verstehen, in dem davon ausgegangen wird, dass die Heterosexualität<strong>und</strong> die aus ihr abgeleiteten Lebensformen allen anderen übergeordnet sind bzw. andereLebensformen überhaupt nicht existieren. Heterosexismus manifestiert sich bewusst <strong>und</strong>unbewusst in allen Bereichen der Gesellschaft in Form von Normen, Bräuchen, Gewohnheiten,Symbolen, Klischees u. ä." (Knoll/Edinger/Reisbeck 1997: 10). Mit ihren Institutionen der Ehe<strong>und</strong> Familie <strong>und</strong> den damit verb<strong>und</strong>enen Geschlechterrollen ist damit nach Ansicht von Knollu.a. der Heterosexismus ein soziales Ordnungsschema, das weit über den sexuellen Bereichhinaus das Zusammenleben der Menschen präge. Wesentlich sei dem Heterosexismus diegenerelle heterosexuelle Vorannahme im Alltag: "Dies bedeutet, dass in zwischenmenschlichenKontakten zunächst immer angenommen wird, dass die beteiligten Menschen heterosexuell sind.Diese Vorannahme hilft die Alltagskommunikation zu stabilisieren <strong>und</strong> vermeidet eineumständliche Orientierung über die sexuelle Identität der Beteiligten" (Knoll/Edinger/Reisbeck1997: 12 f.). Dieser unsichtbare <strong>und</strong> zugleich allgegenwärtige Heterosexismus ist neben anderenFormen der Antihomosexualität mitverantwortlich für aktive Diskriminierungen von Lesben <strong>und</strong>Schwulen. Diskriminierungen schaffen eine Diskrepanz zwischen der angestrebten <strong>und</strong>
tatsächlichen Lebensführung <strong>und</strong> können dann als Gewalt begriffen werden, "... wenn Menschenso beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische <strong>und</strong> geistige Verwirklichung geringer ist alsihre potentielle Verwirklichung" (Galtung 1971: 57; zitiert nach Reinberg/Roßbach 1995: 29).Die Autorinnen erweitern diesen Gewaltbegriff zur Beschreibung der gesellschaftlichenMechanismen der Lesbenunterdrückung um psychische <strong>und</strong> strukturelle Gewalt: "Eineingeschränktes Verständnis von Gewalt im Sinne von nur psychischer Gewalt würde derKomplexität dieser Mechanismen nicht gerecht. Die Verknüpfung von indirekter psychischerGewalt (Verhinderung von Selbstbewusstsein), struktureller Gewalt (gesellschaftlicherAntihomosexualität, patriarchalischer Geschlechterhierarchie/Zwangsheterosexualität) <strong>und</strong> derdirekten Gewalt (körperlicher <strong>und</strong> verbaler Angriffe, Kündigungen etc., aber auch direkterpsychischer Druckausübung) macht das gesamte Gewaltverhältnis aus, dem Lesben innerhalbihrer heterosexuellen Umwelt ausgesetzt sind" (Reinberg/Roßbach 1995: 29).Die bislang jüngste Untersuchung homosexueller Menschen im Alltag, insbesondere imBerufsleben (Knoll/Edinger/Reisbeck 1997) hat umfangreiche Diskriminierungen von Lesben<strong>und</strong> Schwulen aufgezeigt. R<strong>und</strong> 18% der Befragten haben angegeben, wegen ihrerHomosexualität eine Arbeitsstelle wahrscheinlich oder mit Sicherheit nicht bekommen zu habenbzw. wegen ihrer sexuellen Orientierung gewechselt zu haben. Annähernd ebenso viele Befragtehaben sich wegen ihrer Homosexualität bei bestimmten Arbeitgebern wie Kirche, B<strong>und</strong>eswehroder Polizei von vorneherein nicht beworben. Nach der subjektiven Einschätzung der befragtenLesben <strong>und</strong> Schwulen fühlen <strong>und</strong> fühlten sich 81% von ihnen am Arbeitsplatz diskriminiert, amhäufigsten wurde von verbalen Diskriminierungen berichtet wie Witzen, Getuschel, dem Geredevon Kollegen "hinter dem Rücken" oder einem unangenehmen Interesse am Privatleben derLesben <strong>und</strong> Schwulen. Diesen nicht zu unterschätzenden, weil "nur" verbalen Diskriminierungenfolgen strukturelle <strong>Benachteiligung</strong>en wie das Zurückhalten von Informationen, dieVerweigerung von Beförderungen, anderen Formen des Mobbing <strong>und</strong> auch sexuelleBelästigungen. Wahrscheinlichkeit <strong>und</strong> Ausmaß von Diskriminierungen stellten sich in dieserUntersuchung als unabhängig vom Beruf dar. Auch außerhalb des Berufslebens fühlen sich diebefragten Lesben <strong>und</strong> Schwulen deutlich benachteiligt: 90% gaben an, dass sie Situationen erlebthaben, in denen sie Witze, unangenehme Blicke, Beleidigungen <strong>und</strong> Bedrohungen ertragenmussten, aber auch körperlicher Gewalt <strong>und</strong> sexuellem Missbrauch ausgesetzt waren. Angesichtsdieser umfangreichen Diskriminierung ist nur ein kleiner Teil der Lesben <strong>und</strong> Schwulen bereit,die Homosexualität uneingeschränkt offen zu leben: Nur etwa jeder zehnte veröffentlicht amArbeitsplatz bewusst seine <strong>gleichgeschlechtlich</strong>e Orientierung, 28% verbergen ihreHomosexualität oder lassen die Kollegen im Ungewissen. Die Mehrheit (61%) wendet dieStrategie des Sich-Erkennen-Lassens an, bei der auf gezielte Nachfrage auch Auskunft erteiltwird. Über zwei Drittel der befragten Lesben <strong>und</strong> Schwulen können am Arbeitsplatz nur mitwenigen oder aber keinem Kollegen über ihre Homosexualität reden. Trotzdem gehen sie davonaus, dass wesentlich mehr Kollegen über die Homosexualität informiert sind, als die Befragtentatsächlich informiert haben.Trotz der umfangreichen Diskriminierung im Berufsleben von Lesben <strong>und</strong> Schwulen sind sieüberwiegend zufrieden mit Beruf <strong>und</strong> Arbeitsklima: Den Gr<strong>und</strong> dafür sehen Knoll u.a. in dergenerell hohen Bedeutung von Arbeit, auch <strong>und</strong> natürlich für homosexuelle Menschen.a) Die Diskriminierung von LesbenAbseits dieser Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Diskriminierung erfolgt diejenige vonhomosexuellen Frauen seit jeher weitaus subtiler als die von schwulen Männern. LesbischeLebensweisen werden nicht nur verschwiegen <strong>und</strong> marginalisiert 7 , sie leben auch seltener alshomosexuelle Männer ihre Neigung offen. Lesben sind vor allem zwei spezifischen Formen derDiskriminierung ausgesetzt: Zum einen werden sie "totgeschwiegen", zum anderen angegriffen(Reinberg/Roßbach 1995).
Lesben sind einer doppelten <strong>Benachteiligung</strong> ausgesetzt: sowohl als Lesbe als auch als Frau.Frauen wird häufig keine eigene Identität, sondern nur eine über den Ehemann vermitteltezugestanden, Lesben somit ignoriert <strong>und</strong> totgeschwiegen. Dies ist nach Ansicht von Reinberg<strong>und</strong> Roßbach ein gewichtiger Gegensatz zu Schwulen, die vor allem noch ihre Rollen imBerufsleben ohne Beeinträchtigung durch die Homosexualität erfüllen können. "Die Lesbe kehrtsich nicht nur ab von heterosexuellen, sondern damit auch von festgelegten hierarchischenBeziehungsstrukturen, die für Frauen gleichbedeutend sind mit materieller <strong>und</strong> sozialerAbhängigkeit vom Mann. Jede Lesbe erfährt, dass ihre Selbstbestimmung geknüpft ist an ihreLoslösung von der gesellschaftlich geforderten Erfüllung der heterosexuellen Frauenrolle, diemit der festgeschriebenen Funktion von Frauen auch ihre soziale <strong>und</strong> sexuelle Minderwertigkeitfestschreibt" (Reinberg/Roßbach 1995: 26). Lesben zeigen so nach Ansicht der Autorinnen, dasssie nicht von Natur aus von Männern abhängig seien: Eben dies sei eine Herausforderung für daspatriarchale System, ihre Diskriminierung richte sich "gegen ihre Verweigerung Männerngegenüber, gegen ihre Weigerung, die Erwartungen der heterosexuellen Frauenrolle mit ihrenDienstleistungen an Männern, an Familie <strong>und</strong> Kindern unter Hintanstellung eigener Interessen zuerfüllen. Insofern wird die Verknüpfung der Totschweige-Strategie realer Lebensumstände vonLesben mit der Verbreitung falscher, als pervers <strong>und</strong> krankhaft erklärter Schreckensbilderverständlich. Einerseits werden richtige Informationen über Lesben verweigert, Lesbenunsichtbar gemacht... Andererseits sollen gleichzeitig die über Lesben verbreiteten Zerrbilder dieSelbstakzeptanz von Lesben erschweren <strong>und</strong> andere Frauen abschrecken" (Reinberg/Roßbach1995: 27). Die Geheimhaltung wird vor allem in der Familie erwartet, dort häufig von denMüttern. Auch Kontaktabbruch oder -verweigerung in Familie, Berufsleben oder Fre<strong>und</strong>eskreisoder die häufige Unterstellung von Heterosexualität trotz besseren Wissens zählen Reinberg <strong>und</strong>Roßbach zur Totschweige-Strategie. Noch drastischer sind die Formen der Angriffs-Strategie:Sie reichen von Beleidigungen, Beschimpfungen bis hin zu körperlichen Angriffen <strong>und</strong>Vergewaltigungen. Täter sind meist Männer, die Übergriffe erfolgen in der Regel in derÖffentlichkeit.In verschiedenen Untersuchungen 8 haben sich neben den bisher genannten noch folgendeDiskriminierungen gezeigt:• Lesben in kirchlichen Einrichtungen müssen am ehesten mit einer Kündigung wegenHomosexualität rechnen. Ein anderer Gr<strong>und</strong> für Kündigungen ist der Irrglaube, Lesbenstörten das Betriebsklima, da sie sich an andere Frauen "heranmachten". Auch Erzieherinnenwird oft vorgehalten, sie verführten Mädchen zur Homosexualität.• Ursprüngliche Berufsziele wie etwa pädagogische Tätigkeiten oder solche in einemkirchlichen Arbeitsgebiet werden fallen gelassen.• Häufig kommt es zu heftigen <strong>und</strong> lang andauernden Konflikten mit der Familie oder• zur Verweigerung von Untermietverhältnissen für die Partnerin bzw.• zu Angeboten <strong>und</strong> Aufforderungen, heterosexuelle Handlungen vorzunehmen bis hin zurgewaltsamen Durchsetzung der männlichen Vorstellung von Sexualität (Vergewaltigungen).Diese erfolgen nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch durch ehemalige Partner.Verschiedene Faktoren beeinflussen nun die Offenheit bzw. Geheimhaltung bezüglich dersexuellen Orientierung: Die Mehrzahl der Lesben hält die Offenheit nicht für selbstverständlich,sondern muss sich dazu durchringen, auch wenn die befürchteten negativen Folgen, etwa in derFamilie, nicht immer eintreten. Entgegen der Vermutung sind Lesben aus der Unterschichtrelativ offen in Bezug auf ihre Homosexualität (von Paczensky 1984). Dasselbe gilt - fast schonzwangsläufig - für fest befre<strong>und</strong>ete Lesben; auch gibt es einen Zusammenhang zwischen derlesbischen Biographie <strong>und</strong> der Offenheit: Lesben, die ihre "lesbische Karriere" früh begonnenhaben, sind meist offener. Wie groß nun der Anteil der Lesben ist, die in verschiedenenLebensbereichen relativ offen mit ihrer <strong>gleichgeschlechtlich</strong>en Orientierung umgehen, kannkaum gesagt werden. Die einzelnen Untersuchungen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen
oder sind durch die Auswahl der befragten Frauen verzerrt. 9 Übereinstimmung besteht darüber,dass innerhalb der Familie die Mutter meist die erste Vertraute ist. Das Verhältnis zur Mutter istnach dem Coming-out meist wesentlich besser als zum Vater. Trotzdem verheimlichen vieleLesben ihre Lebensweise vor der Familie, weil sie materielle oder emotionale Konflikteerwarten. Am Arbeitsplatz scheint der Anteil an absoluter Geheimhaltung niedriger als in derFamilie, Gründe für eine mögliche Geheimhaltung sind aber weniger ökonomischer Art, sondernes wird eher eine Verschlechterung des zwischenmenschlichen Klimas befürchtet.Plausiblerweise ist die Offenheit im Fre<strong>und</strong>eskreis am größten: Dieser wurde ja, etwa vor demHintergr<strong>und</strong> des Coming-out, ggf. nach dem Kriterium der Offenheit für lesbische Beziehungenverändert oder ausgewählt.Trotzdem meinen Reinberg <strong>und</strong> Roßbach resümierend, dass Geheimhaltung nicht unbedingtvor Diskriminierung schützt, Offenheit nicht automatisch Diskriminierung bedeutet: "So könnenwir das Fazit ziehen, dass Geheimhaltung weniger den Lesben nützt als denen, die versuchen,Lesben unsichtbar zu halten. Deshalb scheint es uns sinnvoll, die Energien ... dort zu investieren,wo sie erfolgversprechend sind. Und das sind sie jedenfalls auf lange Sicht dort, wo sie derTotschweige-Strategie entgegenwirken" (Reinberg/Roßbach 1995: 158).b) Die Diskriminierung von SchwulenIm Vergleich zu lesbischen Frauen scheinen Schwule ihre <strong>gleichgeschlechtlich</strong>e Neigungoffener zu leben. Im Gegensatz zu homosexuellen Frauen müssen sie sich nicht mit denAuswirkungen einer heterosexuellen Totschweige-Strategie auseinander setzen. Der Anteil derwestdeutschen Schwulen, die in ihrem sozialen Umfeld (Eltern, Familie, Fre<strong>und</strong>e) ihreHomosexualität nicht verbergen, ist von 38% im Jahr 1987 auf r<strong>und</strong> zwei Drittel 1996 gestiegen(Bochow 1997c); in den westdeutschen Großstädten leben über 70% der Befragten offen schwul.Aber auch knapp die Hälfte der Schwulen, die in Städten mit weniger als 100.000 Einwohnernim sozialen Umfeld offen leben, scheint im Vergleich zu den Lesben recht hoch. 10Anders die Situation im Bereich der Arbeit: "Es ist nahe liegend, dass homosexuelle Männerim Kollegenkreis andere Thematisierungsstrategien im Hinblick auf ihre sexuelle Orientierungeinschlagen als in ihrer Familie. Wenn befürchtet wird, dass sich aus der Bekanntgabe der<strong>gleichgeschlechtlich</strong>en Orientierung Nachteile ergeben, wird diese verheimlicht. So erklärt essich, dass nur bei 2,4% der Befragungsteilnehmer die Homosexualität bekannt ist, aber nichtakzeptiert wird" (Bochow 1997c, 25): 22% der Westberliner Schwulen, jeweils 34% derOstberliner <strong>und</strong> Westdeutschen <strong>und</strong> 37% der Ostdeutschen reden ihren Kollegen gegenüber nichtvon ihrer Homosexualität, demgegenüber gehen 60% der Westberliner, 50% der Ostberlinerbzw. 45% der Westdeutschen <strong>und</strong> 40% der Ostdeutschen davon aus, dass ihre<strong>gleichgeschlechtlich</strong>e Neigung den Kollegen nicht nur bekannt ist, sondern auch von ihnenakzeptiert wird. Die Verheimlichung der Homosexualität ist nicht, wie die genannten Zahlen esvermuten lassen, abhängig von der Größe des Wohnortes, sondern von "... dem Grad der innerenAnnahme der eigenen Homosexualität, von der erworbenen Selbstsicherheit im Umgang mit dereigenen sexuellen Orientierung <strong>und</strong> von der Art der Einbettung in informelle homosexuelle <strong>und</strong>heterosexuelle Netzwerke" (Bochow 1998: 164).Neben diesen eher allgemeinen Aussagen zur Geheimhaltung <strong>und</strong> Diskriminierung vonHomosexualität beschäftigen sich viele Untersuchungen mit der <strong>Benachteiligung</strong> von Schwulenin verschiedenen Bereichen des Arbeitslebens, so etwa mit der Situation homosexueller Männerin der B<strong>und</strong>eswehr. Während Homosexualität kein Ausschlusskriterium für Wehrdienstleistendeist, stellen homosexuelle Vorgesetzte nach Auffassung des B<strong>und</strong>esministeriums für Verteidigungeine Gefährdung für Disziplin <strong>und</strong> Kampfkraft der Truppe dar <strong>und</strong> werden deswegen von derBeförderung ausgeschlossen (Lindner 1985). Zillich (1988) bemängelt die fehlendeAuseinandersetzung mit Schwulen der Unterschicht, die mit bisherigen Untersuchungen oftmalsnicht oder kaum erreicht worden sind (vgl. oben). Seiner Erhebung zufolge, die sich explizit nurmit Schwulen der Unterschicht beschäftigt hat, werden Homosexuelle am Arbeitsplatz nicht
ausschließlich diskriminiert. Homosexuelle Arbeitnehmer in den unteren Berufsgruppen seien inerster Linie eben Arbeitnehmer, erst später Homosexuelle. Die Thematisierung der<strong>gleichgeschlechtlich</strong>en Orientierung nehme im sozialen Austausch mit den Kollegen nur einenuntergeordneten Stellenwert ein, dafür komme dem Biographischen eine große Bedeutung zu:"Im Allgemeinen gilt..., dass die Umwelt auf den homosexuellen Mann nicht so sehr über seineaktuelle Arbeitsumgebung wirkt, sondern mehr über die antihomosexuelle Sozialisation <strong>und</strong> dieArt <strong>und</strong> Weise ihrer bisherigen Verarbeitung durch den betroffenen Mann. In dieser Perspektivedeterminiert die Arbeitssituation den homosexuellen Lebenszusammenhang also kaum" (Zillich1988: 179).Heftig diskutiert wird derzeit Gewalt gegen schwule Männer: Das Ausmaß antischwulerGewalt, also von Delikten, die sich gegen Männer richten, weil sie schwul sind oder dafürgehalten werden, ist allerdings unklar. Dobler (1994) schätzt die Dunkelziffer dieser Delikte, diemeist in der Öffentlichkeit <strong>und</strong> an schwulen Treffpunkten erfolgen, auf 90%. Hauptgründe fürdiesen extrem hohen Anteil nicht angezeigter Straftaten sei die Tatsache, dass viele Betroffeneihre Homosexualität nicht zugeben wollen oder Angst vor Diskriminierung bei der Polizei haben.Dobler stellt in seiner Untersuchung die These auf, dass der Hauptanteil schwuler Gewalt ebennicht aus Konflikten zwischen homosexuellen Freiern <strong>und</strong> Strichern in der schwulen Subkulturder Klappen oder Parks bestehe. Solche Delikte beträfen entgegen dein gängigen Vorurteil nureinen Teil dieser Gewalt. Er schätzt, dass jährlich in der B<strong>und</strong>esrepublik 30 Menschen infolgeantischwuler Gewalt getötet werden <strong>und</strong> geht von einer Zunahme antischwuler Gewalt aus:"Antischwule Gewalt gab es tatsächlich schon immer. Auch das Potential war wahrscheinlichimmer vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich heute eher entlädt, ist gegeben. Im Zugevon AIDS wurden Schwule vermehrt sichtbar ... Es kommt hinzu, dass die Hemmschwelle,Gewalt anzuwenden, sinkt. Ein allgemeiner Kriminalitätsanstieg ist überall zu verzeichnen. Seitder Wiedervereinigung ist ein Rechts-Trend vorhanden, der begleitet wird von einer Wellebrutaler rassistischer Gewalt, von der momentan nicht absehbar ist, wie sie sich entwickelt. ImZuge dieser Entwicklung entlädt sich auch der Hass gegen Schwule vermehrt gewalttätig"(Dobler 1994: 110). Kritisch steht Werner Hinzpeter dieser Ansicht gegenüber. Er schätzt etwanach Angaben des B<strong>und</strong>eskriminalamtes die Zahl der wegen ihrer Homosexualität getötetenSchwulen deutlich niedriger <strong>und</strong> behauptet einen entgegengesetzten Trend. Er unterstellt denVertretern der "Zunahme-Hypothese", dass von der Gewalt gegen Schwule zwingend auf einantihomosexuelles Motiv geschlossen werde. Die im Jahr 1995 getöteten Schwulen aber seienvon Strichjungen unter Ausnutzung der homosexuellen Veranlagung getötet worden, aber nichtwegen der Homosexualität: Es handele sich um Raubmorde. "Für schwule Männer, die Sexgegen Geld suchen, gibt es ein geringes Tötungsrisiko, wenn sie nicht aufpassen. Für alleanderen liegt die Gefahr, im Zusammenhang mit ihrer homosexuellen Neigung getötet zuwerden, praktisch bei Null" (Hinzpeter 1997: 18). Auch hält Hinzpeter die Dunkelzifferantischwuler Gewalt für zu hoch: Er schätzt sie nach Angaben der Berliner Polizei auf das DreibisVierfache der Anzeigen.Die bislang einzige empirische Untersuchung, die u.a. antischwule Gewalt thematisierte,stammt von Michael Bochow (1997c): Darin gaben 11 % der ostdeutschen Schwulen <strong>und</strong> 13%der Westdeutschen an, beschimpft, beleidigt oder angepöbelt worden zu sein. 3,5% derWestdeutschen <strong>und</strong> 4,1% der Ostdeutschen wurden Opfer körperlicher Gewalt, diese Zahl ist imVergleich zu vorhergehenden Erhebungen (Bochow 1993a; Bochow 1994a) deutlich gesunken:"Dieses Ausmaß antischwuler Gewalt ist ernst zu nehmen, zur Verharmlosung besteht keinAnlass. Aufgr<strong>und</strong> der Zahlen, die seit 1991 vorliegen, ist allerdings davor zu warnen, eineständige Zunahme antischwuler Gewalt zu behaupten" (Bochow 1997c: 101).Bei der Einschätzung, inwieweit die hier angeführten Ergebnisse zur DiskriminierungHomosexueller als empirisch abgesichert gelten können, ist zu berücksichtigen, dass ein Teil derangeführten Erhebungen sich nur auf relativ kleine Samples stützt oder nur sehr einseitigeZugangswege zum Forschungsfeld wählt (z.B. nur den Zugang über Schwulenzeitschriften), teils
auch die Situation in den 80er Jahren widerspiegelt (z.B. wie die Studie von Reinberg <strong>und</strong>Roßbach, 1995, deren Daten sich auf einen Erhebungszeitpunkt zu Beginn der 80er Jahrebezieht). Teilweise gilt diese Einschränkung jedoch nicht (z.B. für die Ergebnisse von Knoll,Edinger, Reisbeck, 1997). Generell bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass Diskriminierung bzw.<strong>Benachteiligung</strong> durchwegs an der subjektiven Wahrnehmung von Homosexuellen bemessenwird, <strong>und</strong> dabei oft ein sehr weitgefasster Begriff von Diskriminierung zugr<strong>und</strong>e gelegt wird: Oftwird alles einbezogen, was als <strong>Benachteiligung</strong> der sozialen Kategorie "homosexuell"empf<strong>und</strong>en wird, <strong>und</strong> zwar auch dann, wenn es sich nicht auf die eigene Person richtet oder garnicht als gezielte, individuelle <strong>Benachteiligung</strong> gemeint sein kann, weil die Homosexualität desInteraktionspartners gar nicht bekannt ist. Vielfach ist auch nicht auseinander zu halten, welche<strong>Benachteiligung</strong>en "einmal", also sehr selten <strong>und</strong> irgendwann früher, <strong>und</strong> welcheDiskriminierungen aktuell bzw. häufiger erlebt werden. Hinzu kommt, dass ausschließlichErfahrungen mit Diskriminierung, nicht aber die Gegenseite, also Erfahrungen mit Akzeptanz, indie Studien einbezogen werden.C-7 ForschungsdefiziteBei einem knappen Resümee zum Forschungsstand sind folgende Defizite festzuhalten:Der Großteil der empirischen Studien zu Homosexualität konfrontiert mit methodischenProblemen; auch wegen der Schwierigkeiten des Zugangs zum Forschungsfeld, basierenErgebnisse zum Teil auf zu kleinen Stichproben, meist auch auf Samples, bei denen - wegen derEinseitigkeit des Zuganges zu Befragten - u.U. erhebliche Verzerrungen vorliegen. Diesemethodischen Probleme gilt es durch ein ausreichend großes Sample <strong>und</strong> durch einen möglichstvielfältigen Zugang zum Feld möglichst zu vermeiden.Ein weiteres methodisches Problem stellt sich im Zusammenhang mit derOperationalisierung. Wie im Themenbereich Diskriminierung angemerkt, gilt es, die Interaktionzwischen Homo- <strong>und</strong> Heterosexuellen möglichst detailliert zu erfassen, möglichst vollständigabzubilden, also z.B. sowohl Erfahrungen mit Diskriminierung als auch Akzeptanzeinzubeziehen, allgemeine, gegen die soziale Kategorie gerichtete Diskriminierung von direkten,gezielten <strong>und</strong> personenbezogenen <strong>Benachteiligung</strong>en zu trennen <strong>und</strong> - soweit möglich - sowohldie Häufigkeit von Diskriminierungserfahrungen als auch Veränderungen im Zeitablauf zurekonstruieren.Als weiteres Problem ist anzumerken, dass in einzelnen Themenbereichen nur ältereForschungsergebnisse vorliegen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die gegenwärtige Situationnicht mehr kennzeichnen. Hinzukommt, dass in einzelnen Forschungsfeldern der Situation vonSchwulen in der Forschung wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde, als der Situationvon Lesben (vergleiche den Themenbereich Partnerschaft). In einzelnen Themenbereichen (wiez.B. Elternschaft <strong>und</strong> Homosexualität) beziehen sich Ergebnisse überwiegend aufUntersuchungen im Ausland oder auf Erhebungen mit sehr kleinen Stichproben, die keinegeneralisierbaren Aussagen zulassen.Eines der Ziele der vorliegenden Studie sollte daher sein, die angeführten methodischenProbleme - soweit möglich - zu vermeiden <strong>und</strong> die vorliegenden Ergebnisse, insbesondere imBereich Partnerschaft, Kenntnisse <strong>und</strong> Wünsche zur rechtlichen Situation Homosexueller,Diskriminierungs- <strong>und</strong> Akzeptanzerfahrungen zu ergänzen.Einzuschränken ist, dass der kurze Überblick über den Stand der Forschung keineVollständigkeit beabsichtigte, sondern sich auf die Themenbereiche <strong>und</strong> methodischen Fragenkonzentrierte, die auch die vorliegende Studie einbezieht. Beispielsweise blieben hier Studienzur Ausbildung sexueller Identität, zum Coming-out etc. unberücksichtigt, da diese Themen zwarin das eigene Forschungsvorhaben eingehen, aber nicht im Mittelpunkt stehen. Über die hiererwähnten Arbeiten hinaus wurden weitere Ergebnisse gesichtet <strong>und</strong> dokumentiert, ohne hier imEinzelnen beschrieben zu werden. Dieses selektive Vorgehen scheint sinnvoll, um das Hauptziel
dieses Abschnitts zu erreichen: eine Orientierungshilfe für die Konzeption des eigenenForschungsvorhabens zu schaffen.1 Eine Ausnahme stellen - zumindest international - die Arbeiten von Alfred Kinsey <strong>und</strong> seinen Mitarbeitern dar, diesich in den 40er <strong>und</strong> 50er Jahren zwar auch mit dem Vergleich von hetero- <strong>und</strong> homosexueller Sexualität beschäftigthaben, dies aber vorurteilsfrei <strong>und</strong> nur beschreibend.2 20% der Schwulen zwischen 25 <strong>und</strong> 54 Jahren wohnen mit dem Fre<strong>und</strong> zusammen, zwischen 18 <strong>und</strong> 24 Jahren13%, aber nur 3% der Schwulen über 64 Jahre (alle Ergebnisse für die alten B<strong>und</strong>esländer nach Bochow 1997c)3 Während nach Ansicht von Streib diese Schätzung zu niedrig angesetzt ist, halten Schneider, Rosenkranz <strong>und</strong>Limmer die Zahl für zu hoch: "Die Schätzung ist überhöht, da die Befragung sich an die feministische Leserschaftrichtete Die dort erzielten Ergebnisse wurden auf die weibliche Allgemeinbevölkerung hochgerechnet" (1998: 102).4Überdies konnte Bochow Zusammenhänge zwischen dem Vorhandensein eines gemischten oder schwulenFre<strong>und</strong>eskreises <strong>und</strong> der Offenheit bezüglich der sexuellen Orientierung aufzeigen. Männer ohne engerenFre<strong>und</strong>eskreis neigen eher dazu, ihre Homosexualität vor der Umwelt zu verbergen (Bochow 1997c).5 So hat sich erst jüngst die größte Organisation homosexueller Männer (SVD) durch die Koalition mit lesbischenFrauen zum LSVD erweitert (Lesben- <strong>und</strong> Schwulenverband in Deutschland).6 Wie das Wertesystem dieses kollektiven homosexuellen Überbaus beschaffen ist, wird an einer späteren Stelle zuanalysieren sein.7 Die Marginalisierung ging so weit, dass lesbische Frauen zu keinem Zeitpunkt der deutschen Rechtsgeschichte seitdem 19. Jahrh<strong>und</strong>ert unter die Bestimmungen des §175 StGB fielen.8 Akkermann/Betzelt/Daniel 1990; Reinberg/Roßbach 1995; von Paczensky 1984; Schäfer 1975; Linnhoff 19769So lebten etwa die von Akkermann, Betzelt <strong>und</strong> Daniel (1990) befragten Lesben, unter denen sichunverhältnismäßig viele Studentinnen befanden, zu 44% ihre Homosexualität gänzlich offen.10 Bei diesen Ergebnissen ist aber zu beachten, dass die von Bochow Befragten überwiegend in großen Städten leben<strong>und</strong> deswegen die Ergebnisse verzerrt sind. Im Einzelnen ergaben sich folgende Ergebnisse: im sozialen Umfeldlebten 75% der Westberliner offen, 65% der Ostberliner, 57% der Ostdeutschen <strong>und</strong> 62% der Westdeutschen(Bochow 1997c).