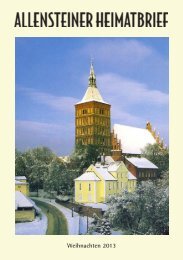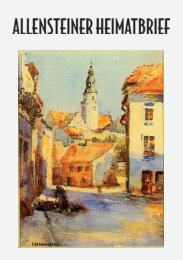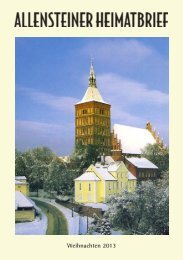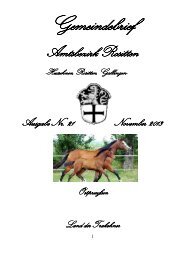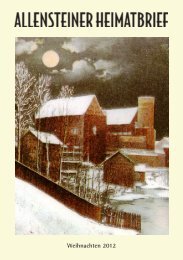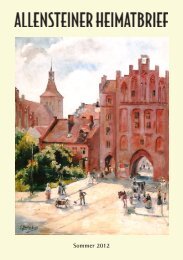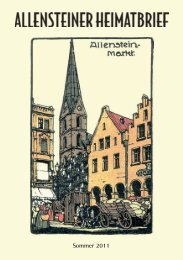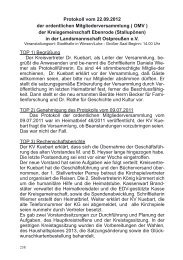Vor 60 Jahren in Allenstein - Stadtgemeinschaft Tilsit eV
Vor 60 Jahren in Allenstein - Stadtgemeinschaft Tilsit eV
Vor 60 Jahren in Allenstein - Stadtgemeinschaft Tilsit eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Berichte aus Allenste<strong>in</strong> 56Gretel aus Ostpreußen und das Testament 56Papst Johannes Paul II. wurde Ehrenbürger der Stadt Allenste<strong>in</strong> <strong>60</strong>St. Jakobus <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> wurde Basilika M<strong>in</strong>or 62Das jüdische Totenhaus <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> 63Leserbriefe 65Aus unserer Stadtgeme<strong>in</strong>schaft 72Programm 50. Jahrestreffen 72Unsere Reise nach Ostpreußen und Allenste<strong>in</strong> 73Aus unserer Allenste<strong>in</strong>er Familie 75Wir gratulieren 75Wir gedenken 78Verschiedenes 80Ostheim <strong>in</strong> Bad Pyrmont 80Kulturzentrum Ostpreußen <strong>in</strong> Ell<strong>in</strong>gen 81Ostpreußisches Landesmuseum <strong>in</strong> Lüneburg 82H<strong>in</strong>weise der Redaktion 83Bücherecke 84So mütterlich durch das Werk Agnes Miegels geführt... 84Angebote unserer Stadtgeme<strong>in</strong>schaft 87Titelbild:<strong>Vor</strong>dere Innenseite:H<strong>in</strong>tere Innenseite:Rückseite:Blick auf das Neue Rathaus <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>Aquarell von Frieda Strohmberg (etwa 1922)Der frühere „Russenerker“ Ecke Kleeberger StraßeErker an der H<strong>in</strong>denburgstraße (Foto: Christel Becker)Die Türme von Rathaus und Herz-Jesu-Kirche2
STADTGEMEINSCHAFTALLENSTEIN E.V.Liebe Allenste<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen und Allenste<strong>in</strong>er,liebe Freunde unserer Heimatstadt,als vor 80 <strong>Jahren</strong> <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> „Der Treudank“, das Landestheater für Südostpreußen,e<strong>in</strong>geweiht wurde, war dies e<strong>in</strong> bedeutsamer Tag für die Bevölkerungder Stadt und der Region. Der <strong>in</strong> dem südlichen der abgetrennten TeileOstpreußens lebenden Bevölkerung wurde damit ermöglicht, unmittelbaram kulturellen Leben <strong>in</strong> Deutschland teilzuhaben. Nahezu 20 Jahre hat „DerTreudank“ diese Aufgabe erfüllt.<strong>Vor</strong> <strong>60</strong> <strong>Jahren</strong> endete nicht nur das deutsche kulturelle Leben <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>.Für viele von uns hieß es, Haus und Hof, Freunde und Bekannte zu verlassenund die Heimatstadt für e<strong>in</strong>e ungewisse Zukunft aufzugeben. Wir haben fürdiesen Heimatbrief e<strong>in</strong>ige Beiträge ausgewählt, die uns diese Ereignisse, derensich <strong>in</strong> diesen Tagen viele Allenste<strong>in</strong>er er<strong>in</strong>nern werden, nochmals sehre<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glich vor Augen führen. Wir sollten sie vor allem an die weiterreichen,denen das persönliche Erleben erspart blieb. Es ist bee<strong>in</strong>druckend, dass es <strong>in</strong>dieser bedrohlichen Situation noch Menschen gab, die nicht zuerst an ihr eigenesÜberleben dachten.Die meisten von uns haben wieder e<strong>in</strong> Zuhause, neue Freunde und Bekanntegefunden. Die Stadtgeme<strong>in</strong>schaft ist vor 50 <strong>Jahren</strong> <strong>in</strong> Gelsenkirchen freundlichaufgenommen und dort heimisch geworden, und <strong>in</strong> diesem Jahr f<strong>in</strong>denwir uns zum 50. Mal <strong>in</strong> unser ehemaligen Paten- und jetzt Partnerstadt zusammen.Ich hoffe, dass viele von Ihnen im September den Weg nach Gelsenkirchenf<strong>in</strong>den werden. Verabreden Sie sich mit Freunden und br<strong>in</strong>gen Sie auch jüngereFamilienangehörige mit, damit wir dieses Doppeljubiläum gebührend begehenKönnen.Bis dah<strong>in</strong> b<strong>in</strong> ich mit allen guten WünschenIhr Gottfried Hufenbach3
STADTGELSENKIRCHENZum 50. Mal feiern Sie Ihr traditionellesJahrestreffen bei uns, zum 50. Mal freuenwir uns über Ihr Kommen. Das Treffender Allenste<strong>in</strong>er setzt seit Jahrzehnten e<strong>in</strong>Zeichen der Treue zur alten Heimat.Gleichzeitig ist es e<strong>in</strong> Symbol für die großeZuneigung der Allenste<strong>in</strong>er zu Gelsenkirchen.Unsere Stadt darf sich als zweiteHeimat der Allenste<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaftfühlen, die durch den Krieg und Vertreibungause<strong>in</strong>andergerissen wurde.Mit Ihrem Engagement stärken Sie dasBand zwischen den heutigen und ehemaligenAllenste<strong>in</strong>ern und leisten damite<strong>in</strong>en wichtigen Beitrag zur Verständigungzwischen Deutschen und Polen.Die Beziehungen zwischen den beidenStaaten s<strong>in</strong>d wieder offener, der Austauschist <strong>in</strong>tensiver geworden. Offizielle Kontakte s<strong>in</strong>d natürlich e<strong>in</strong> wichtigerBeitrag dazu, grundlegend aber s<strong>in</strong>d Begegnungen zwischen Bürger<strong>in</strong>nenund Bürgern, grundlegend ist das zwischenmenschliche Mite<strong>in</strong>ander, <strong>in</strong> demman sich auch ganz privat austauscht – sie legen das Fundament für e<strong>in</strong>freundschaftliches Mite<strong>in</strong>ander der Nationen und s<strong>in</strong>d der Grundste<strong>in</strong> für e<strong>in</strong>gee<strong>in</strong>tes Europa.Als Allenste<strong>in</strong>er, die e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Vergangenheit e<strong>in</strong>t, werden Sie bei IhremTreffen sicherlich auch über vergangene Zeiten plaudern, Ihre Kultur pflegenund ganz e<strong>in</strong>fach das Wiedersehen mit vertrauten Landsleuten genießen.Dabei wünsche ich Ihnen erfüllte Stunden.Frank BaranowskiOberbürgermeister4
<strong>Vor</strong> 80 <strong>Jahren</strong> – Die E<strong>in</strong>weihung desLandestheaters ÊDer Treudank“Von Paul PetersDen Wendepunkt <strong>in</strong> der Geschichtedes Allenste<strong>in</strong>er Theaters brachtedie Volksabstimmung von 1920.Nach dem Bekenntnis der BevölkerungSüdostpreußens zu Deutschlandam 11. Juli 1920 hatte Preußen(Innenm<strong>in</strong>ister Sever<strong>in</strong>g) zur kulturellenund wirtschaftlichen Förderungdes ehemaligen Abstimmungsgebietesunter der Bezeichnung „DerTreudank” e<strong>in</strong>e mit erheblichen f<strong>in</strong>anziellenMitteln ausgestattete Stiftung<strong>in</strong>s Leben gerufen. Hieraus e<strong>in</strong>enBetrag von etwa 1,5 MillionenMark für den Bau e<strong>in</strong>es Theatergebäudeszugesagt zu erhalten, ist derwohlwollenden Unterstützung diesesPlanes durch den Allenste<strong>in</strong>er Regierungspräsidentenund der Aufgeschlossenheitder Berl<strong>in</strong>er Stellen zudanken.Die Menschen sollten lebendigenKontakt mit dem deutschen Kulturleben<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Landesteil haben, dernicht nur als Folge des Kriegsausgangesmit dem übrigen Ostpreußen5
vom Reich getrennt worden, sondernauch <strong>in</strong> diesem <strong>in</strong>sularen TeilDeutschlands gegenüber dem Nordender Prov<strong>in</strong>z etwas zurückgebliebenwar. Kurz, ohne Königsbergse<strong>in</strong>e naturgegebene und historischüberkommene <strong>Vor</strong>rangstellung zubestreiten, sollte Allenste<strong>in</strong> mit Blickrichtungauf das ehemalige Abstimmungsgebietzu e<strong>in</strong>em zweiten,wenn auch bescheideneren Zentrumdes ostpreußischen Theaterlebensgemacht und durch e<strong>in</strong> eigenesHaus mit modernen technischenE<strong>in</strong>richtungen dem neuen Kunst<strong>in</strong>stitutdie notwendigen <strong>Vor</strong>aussetzungenfür e<strong>in</strong>en se<strong>in</strong>er hohen Aufgabeangemessenen künstlerischen Ranggegeben werden. Diese ihr vonvornhere<strong>in</strong> gesteckten Ziele bestimmtenauch Trägerschaft und organisatorischeStruktur der neuen Bühne:Nicht Stadttheater sollte sie werden,sondern Landestheater mit e<strong>in</strong>erGröße des künstlerischen Apparates,der e<strong>in</strong>e gleichzeitige täglicheBespielung Allenste<strong>in</strong>s und 19 andererStädte gestattete, und zwarDeutsch-Eylau, Osterode, Hohenste<strong>in</strong>,Neidenburg, Wartenburg,Guttstadt, Seeburg, Ortelsburg, Willenberg,Bischofsburg, Sensburg,Rössel, Rastenburg, Angerburg,Lötzen, Arys, Johannesburg, Lyckund Treuburg. Die <strong>in</strong>terne Gliederungergab sich so fast von selbst: Esmussten zwei komplette Ensemblesgebildet werden, e<strong>in</strong>es für gesprocheneund e<strong>in</strong>es für musikalischeWerke. In der letzten Kategorie sahendie kommenden Bühnenverhältnissee<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>beziehung auch derKunstgattung der großen Oper vor,womit dem neuen Theater das ihmzugedachte Format gegeben werdensollte. E<strong>in</strong> Zufall ermöglichte es,den Großteil e<strong>in</strong>es geschulten, bühnenerfahrenenOrchesters zu engagieren,nämlich das der KönigsbergerKomischen Oper, deren Schließungsich abzeichnete.Als Bauplatz für das Theater stelltedie Stadt ihr Gartenetablissement„Kaisergarten“ <strong>in</strong> der H<strong>in</strong>denburgstraße,also <strong>in</strong> der Ortsmitte, zur Verfügung.Rechtsträger<strong>in</strong> des Baueswurde die „Treudank GmbH” mitzwei Gesellschaftern, dem Kulturvere<strong>in</strong>Masuren – Ermland e.V. undder Stadt Allenste<strong>in</strong>, die das Grundstückmit Gaststättengebäude e<strong>in</strong>brachte.Der eigentliche Theaterbetriebwurde von e<strong>in</strong>er dafür spätergegründeten „Landestheater GmbH”durchgeführt, die das spielfertigeHaus von der „Treudank GmbH“ zurBenutzung erhielt und hierfür die laufendenKosten mit Ausnahme derBauunterhaltung übernahm. Gesellschafterder „Landestheater GmbH”waren die Stadt Allenste<strong>in</strong>, der Kulturvere<strong>in</strong>Masuren – Ermland e.V.und die damals bestehenden Besucherorganisationen,der Bühnenvolksbundund der Verband derVolksbühnenvere<strong>in</strong>e, beide mit demSitz <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>. Den <strong>Vor</strong>sitz <strong>in</strong> der Gesellschafterversammlungführte MaxWorgitzki. <strong>Vor</strong>sitzender des Aufsichtsrateswar nach dem Gesellschaftsvertragder jeweilige Oberbürgermeisterder Stadt Allenste<strong>in</strong>.Im Aufsichtsrat waren alle Gesellschaftermit Sitz und Stimme vertreten,die Stadt durch Mitglieder desMagistrats und der Stadtverordnetenversammlung,der Kulturvere<strong>in</strong>durch Mitglieder se<strong>in</strong>es <strong>Vor</strong>standes,die Besucherorganisationen durchdie <strong>Vor</strong>sitzenden ihrer Allenste<strong>in</strong>er6
Ortsgruppen. Geschäftsführer derLandestheater GmbH waren der jeweiligeIntendant als künstlerischerLeiter und e<strong>in</strong>e von der Stadt Allenste<strong>in</strong>zu stellende Person als kaufmännischerGeschäftsführer, die dieGesellschaft geme<strong>in</strong>sam vertraten.Erster künstlerischer Geschäftsführerwar Intendant Ernst Theil<strong>in</strong>g, ersterkaufmännischer GeschäftsführerStadtober<strong>in</strong>spektor Paul Peters.Der Bau des Theatergebäudes verzögertesich erheblich aus Gründen,die wohl hauptsächlich <strong>in</strong> den durchdie fortschreitende Inflation liegendenf<strong>in</strong>anziellen Schwierigkeiten zusuchen s<strong>in</strong>d. Bauplanung und -leitung lagen <strong>in</strong> den Händen desortsansässigen Architekten Feddersen,durch dessen Geschick die verlangteE<strong>in</strong>beziehung von Teilen desalten Gaststättengebäudes gelang.Der Gesamtbau umfaßte außer demTheatersaal mit rd. 700 Sitzplätzen(Parterre und e<strong>in</strong> Rang) e<strong>in</strong> geräumigesFoyer im Parterre und erstemStockwerk, Garderobe, e<strong>in</strong> Bühnenhausmit versenktem Orchesterraumund Seitenbühnen, Probe-, UmkleideundBüroräume, Werkstätten undRequisitenlagerraum. Die Gaststätte„Treudank” lag im Keller des Gebäudes,war aber <strong>in</strong>folge der Geländebeschaffenheitvon der Straße her zuebener Erde zu erreichen. Die technischeAusstattung des Bühnenhauseswar mit den Beleuchtungsanlagen,dem Rundhorizont und demSchnürboden modern. Leider wardem zunächst geplanten E<strong>in</strong>bau e<strong>in</strong>erHebe- und Drehbühne ke<strong>in</strong>e Erfüllungbeschieden.Das neue Haus wurde am 25. August1925 mit Goethes „Faust”, IntendantErnst Theil<strong>in</strong>g <strong>in</strong> der Titelrolle,würdig se<strong>in</strong>em Zwecke zugeführt,e<strong>in</strong> bedeutsames künstlerisches wiegesellschaftliches Ereignis, das <strong>in</strong>7
den Annalen Allenste<strong>in</strong>s festgehaltenzu werden verdient. Zu gleicher Zeitlief der Spielbetrieb im Bezirk an.Jede Stadt erhielt <strong>in</strong> der etwa siebenmonatigenSaison (Ende Septemberbis Ende April) m<strong>in</strong>destenssieben <strong>Vor</strong>stellungen, darunter etwazwei musikalische. Die Auswahl derStücke richtete sich nach den überwiegendbeschränkten Bühnenverhältnissen.Wo es sich aber ermöglichenließ, wie z. B. <strong>in</strong> Lyck mit e<strong>in</strong>emkle<strong>in</strong>eren ansprechenden Stadttheatergebäude,wurden auch Aufführungenmit e<strong>in</strong>er großen Anzahl Mitwirkender(Solisten, Chor, Ballett,Orchester) und dem Allenste<strong>in</strong>erBühnenbild geboten. Der Gesamtspielplanließ die Verpflichtungen desLandestheaters als Kulturbühne erkennen,ohne dass auf unterhaltendeDarbietungen verzichtet wurde, aufdie ja auch aus f<strong>in</strong>anziellen Gründennicht verzichtet werden konnte. Wertwurde betont darauf gelegt, zeitgenössischeBühnenwerke dem Publikumnahe zu br<strong>in</strong>gen. Dies konntejedoch – weder was die Zahl nochvor allem den <strong>in</strong>neren Gehalt odergar die Tendenz der Stücke ang<strong>in</strong>g –nicht ohne E<strong>in</strong>haltung gewisserGrenzen geschehen, die sich ausden Aufgaben des Landestheatersals e<strong>in</strong>er allen Bevölkerungskreisendienenden E<strong>in</strong>richtung und deutschenKulturbastion im östlichenRaume ergab.Zeittheater war auf den Brettern im„Treudank” zwar ke<strong>in</strong> avantgardistischesExperimentiertheater, gababer immerh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en den obwaltendenUmständen entsprechendenÜberblick des zeitgenössischenBühnenschaffens. So Stücke wie„Der Kreidekreis” von Klabund, dasArtistendrama „Kathar<strong>in</strong>a Knie”,schließlich auch Leo Weismantels„Nachfolge Christi Spiel”, welchesfür e<strong>in</strong>e Freilichtaufführung so geeigneterschien, daß sich daran derGedanke entzündete, mit ihm diejährlich für je zwei Sommerwochenim Hofe des Allenste<strong>in</strong>er Schlossesgedachten „Allenste<strong>in</strong>er Burgfestspiele”zu eröffnen, e<strong>in</strong>e kühne Idee,die es nicht gelang zu verwirklichen.Triumphe waren die <strong>in</strong> den zwanziger<strong>Jahren</strong> zahlreichen neuenSchöpfungen auf dem Gebiet derOperette; so Franz Léhars „Frasquita”,„Pagan<strong>in</strong>i”, ferner EmmerichKálmáns „Gräf<strong>in</strong> Mariza”, „Die Zirkuspr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong>”,Eduard Künneckes„Der Vetter aus D<strong>in</strong>gsda” und PaulAbrahams „Viktoria und ihr Husar“.Daß Klassiker, Romantiker und modernedeutsche Dramatiker undOpernkomponisten den Kern desSpielplans bestritten, verstand sichbei e<strong>in</strong>er Kulturbühne vom Rangedes Landestheaters von selbst. Anzum Teil festlichen Höhepunktenseien erwähnt „Wallenste<strong>in</strong>”, „Käthchenvon Heilbronn”, „Der Biberpelz”,„Fuhrmann Henschel”, „DieZauberflöte”, „Don Giovanni”, „Fidelio”,„Der Freischütz”, „Der fliegendeHolländer”, „Tannhäuser”, „Lohengr<strong>in</strong>”,„Siegfried”, „Die Meisters<strong>in</strong>gervon Nürnberg” (im dritten Akt unterstarker Beteiligung aus den Allenste<strong>in</strong>erGesangvere<strong>in</strong>en) und „Parsifal”.Auch bühnenwirksame Stücke bekannterausländischer Schriftsteller,wie Ibsens „Peer Gynt” mit derGriegschen Bühnenmusik und Gorkis„Nachtasyl” wurden dargeboten.E<strong>in</strong>ige Male wurden auswärtige Gästeherangezogen.8
Große künstlerische (und f<strong>in</strong>anzielle)Erfolge waren ausgangs der zwanzigerJahre die EnsemblegastspieleOtto Gebührs mit „Tee <strong>in</strong> Sanssouci”und Paul Wegeners mit „Maria Magdalena”.Besonders Paul Wegener,ganz <strong>in</strong> der Nähe von Allenste<strong>in</strong> aufdem Rittergut Bischdorf geboren,wo er auch während des Gastspielswohnte, riß das Allenste<strong>in</strong>er Theaterpublikumzu wahren Beifallsstürmenh<strong>in</strong>. Andererseits hat das Landestheaterauch Gastspiele gegeben,und zwar ausschließlich mit musikalischenWerken, so <strong>in</strong> Elb<strong>in</strong>g und <strong>in</strong><strong>Tilsit</strong>, wo nur Schauspielbühnen bestanden.Das Abstimmungsergebnisfand ‘nen besond’ren Lohn:Theater als Erlebnisder ganzen Südregion.Die Treue deutscher Wähler,der Dank des Vaterlands –und diese beiden Zählerergaben „Treudank“ ganz.Herrn Feddersen gebührteder Ruhm als Architekt.Ernst Theil<strong>in</strong>g man dann kürteals Intendant – perfekt.Es war ‘ne Landesbühne.Man spielte hier und dortdie Stücke, alt und kühne,Theaterkunst vor Ort.Egal, wo man auch spielte,ob Lyck, ob Allenste<strong>in</strong>,man immer darauf zielte,erbauend auch zu se<strong>in</strong>.Die Auswahl war nicht wenig:Bohème und Butterfly,Boccaccio, Schach dem König,auch Carmen war dabei.Man hörte gern e<strong>in</strong> Ständchenund auch das Wolgalied,wie eiskalt ist dies Händchen,das Lied, das zu dir zieht.Der TreudankFür das Theater warbenwir Schüler <strong>in</strong> der Näh‘.Plakate mit viel Farben,die h<strong>in</strong>gen im Foyer.‘s gab Prämien für die Besten.Sie wurden ausgewähltvon den Theatergästen,vom Kunstbewerb beseelt.In das Theater gehenwar Freude wie auch Pflicht,nicht Stücke nur zu sehen,auch Freunde, die man spricht.Zum Tanzen und zum Feierngab es den gelben Saal.Ihn etwas zu entschleiernbemüht‘ ich mich schon mal.Musik ganz andrer Arten,auch hier sehr oft zum Tanz,gab es im Treudankgarten,des Nachts im Lichterglanz.E<strong>in</strong> kurzer Weg, e<strong>in</strong> schneller,der führt‘ zu Speis‘ und Trankh<strong>in</strong>ab zum Treudankkeller.Dort saß man oft noch lang.Der Bau ist uns geblieben,auch se<strong>in</strong> bestimmter Zweck.„teatr“ jetzt geschrieben.Der „Treudank“ ist jetzt weg.Ernst Jahnke10
<strong>Vor</strong> <strong>60</strong> <strong>Jahren</strong> <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong><strong>60</strong> Jahre s<strong>in</strong>d seit Flucht und Vertreibung vergangen, und immer noch stehenuns die schrecklichen Tage, Wochen und Monate des Jahres 1945 deutlichvor Augen. So er<strong>in</strong>nere ich mich noch ganz genau (ich war damals <strong>in</strong> der Untersekunda,heute Klasse 10) an den Mittwoch, den 17. Januar 1945, als unsereKlassenlehrer<strong>in</strong> „Kutsche“ (Olga Kutschelis) uns morgens begrüßte mitder Mitteilung, dass wegen Kohlemangels die Schule geschlossen werdenmüsse und wir nach Hause gehen könnten. Man hörte zwar den Kanonendonner<strong>in</strong> der Ferne, aber davon oder sogar von Flucht war ke<strong>in</strong>e Rede. Ichwurde stattdessen noch am Donnerstag und Freitag von der Hitlerjugendzum Bahnhofsdienst e<strong>in</strong>geteilt, wo ich den Schwestern des Roten Kreuzeshalf, an verwundete Soldaten <strong>in</strong> den durchfahrenden Lazarettzügen Kaffee,Tee und belegte Brote zu verteilen.Der russische Schriftsteller Lew Kopelew (damals Major der Roten Armee)hat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Buch „Aufbewahren für alle Zeit“ mit ungeheurer Präsenz <strong>in</strong>schonungsloser Aufrichtigkeit sich selbst und dem Erlebten gegenüber denE<strong>in</strong>marsch der Roten Armee auf deutschen Boden, auch nach Allenste<strong>in</strong>, geschildert.Und tief bestürzt berichtet er von den Plünderungen, Vergewaltigungenund Morden der eigenen Truppen und Kampfgenossen. Nicht nurse<strong>in</strong> moralisches Empf<strong>in</strong>den, auch se<strong>in</strong> sozialistisches Bewusstse<strong>in</strong> lehntesich auf, und er versuchte, die Ausschreitungen zu verh<strong>in</strong>dern. Die Folge war,dass er am 5. April 1945 wegen „Propagierung des bürgerlichen Humanismus“,„Mitleid mit dem Fe<strong>in</strong>d“ und „Untergrabung der politisch-moralischenHaltung der Truppe“ verhaftet und zu zehn <strong>Jahren</strong> Straflager verurteilt wurde.Er sagte später e<strong>in</strong>mal: „Ich b<strong>in</strong> ke<strong>in</strong> Regimekritiker. Ich b<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Literat, der e<strong>in</strong>Gewissen hat. Ich trete nicht gegen das Regime auf, sondern für Menschen.“Lassen wir e<strong>in</strong>ige Zeitzeugen zu Wort kommen, die uns noch e<strong>in</strong>mal dieschreckliche Zeit vor <strong>60</strong> <strong>Jahren</strong> <strong>in</strong> Er<strong>in</strong>nerung rufen.Hanna Bleck-ParschauSonnabend, der 20. Januar 1945Von Eva M. SirowatkaDer Tag begann mit stundenlangemFliegeralarm, wie wir ihn bisher nochnicht erlebt hatten. Fe<strong>in</strong>dliche Tieffliegerbrausten über die Dächerh<strong>in</strong>weg. Wir saßen eng zusammengerücktim Luftschutzkeller e<strong>in</strong>esHauses <strong>in</strong> der Soldauer Straße. Detonationen!Irgendwo, vielleicht <strong>in</strong>der Stadtmitte, mussten Bombengefallen se<strong>in</strong>. Kalk rieselte von denWänden, die K<strong>in</strong>der we<strong>in</strong>ten.Wir erlebten bange Stunden, bisendlich die Entwarnung kam. VielSchaden konnten die Bomben nichtangerichtet haben. Wir sahen ke<strong>in</strong>eRauchwolken über der Stadt, das11
Telefon g<strong>in</strong>g noch. Da ich an diesemMorgen nicht dazu gekommen war,für die K<strong>in</strong>der Milch zu besorgen,überließ ich die beiden me<strong>in</strong>er Wirt<strong>in</strong>,nahm die Milchkanne und lief dieSoldauer Straße <strong>in</strong> Richtung Stadth<strong>in</strong>unter. Ich war noch nicht bei derBushaltestelle, da hörte ich über dieBäume des Evangelischen Friedhofse<strong>in</strong>en Tiefflieger h<strong>in</strong>wegbrausen.Obwohl es ke<strong>in</strong>en erneuten Alarmgegeben hatte, spürte ich <strong>in</strong>st<strong>in</strong>ktiv,dass dies e<strong>in</strong> sowjetisches Flugzeugwar. Ich lief und erreichte geradenoch den nächsten Hausflur, als ichDetonationen hörte. Dort, wo ichwenige Sekunden vorher gestandenhatte, sah ich E<strong>in</strong>schlaglöcher leichterBomben. Unvorstellbar, was ausme<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>dern gewordenwäre, wenn ich von diesem Gangnicht wiedergekehrt wäre!Was nun geschah, kam wie e<strong>in</strong>eLaw<strong>in</strong>e auf uns zu, der wir alle nichtmehr ausweichen konnten. Die Stadtwar <strong>in</strong> Aufruhr. Die uns<strong>in</strong>nigsten Gerüchteg<strong>in</strong>gen von Mund zu Mund,von Haus zu Haus, von Straße zuStraße. Die meisten packten <strong>in</strong> fieberhafterEile die Koffer und g<strong>in</strong>genzum Bahnhof. Es sollten dort schonTausende stehen und auf Züge warten.Niemand wusste, ob man nochüber Mohrungen – Marienburg weiterkam;<strong>in</strong> Richtung Königsberg,hieß es, würden noch Züge fahren.Von da aus stand der Weg nach Pillauund von dort der Seeweg offen.Später erschien es mir wie e<strong>in</strong> Wunder,dass es mir noch am selbenAbend gelang, me<strong>in</strong>e Mutter telefonischzu erreichen. Sie trieb mit Mühee<strong>in</strong> Fuhrwerk auf, das uns noch <strong>in</strong>derselben Nacht heim nach Spiegelbergbrachte.Auch das Dorf hatte Tiefflieger erlebt,auch hier waren leichte Bombengefallen, ohne jedoch Schadenanzurichten oder gar Todesopfer zufordern. Die Menschen des Dorfeswarteten von Stunde zu Stunde aufden Räumungsbefehl. In dieser Nachtvon Sonnabend zum Sonntag schliefenwir noch e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>ige Stundendaheim, <strong>in</strong> eigenen Betten.Der Sonntag brach grau und kalt an.Me<strong>in</strong> Vater, der zum Volkssturm e<strong>in</strong>gezogenwar, brachte uns am Morgendie Nachricht, dass sich die Dorfleute<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Stunde vor dem Gasthofe<strong>in</strong>f<strong>in</strong>den sollten. Wo die sowjetischenTruppen zur Zeit standen,wussten wir nicht genau. Es hieß, sieseien schon dicht vor Allenste<strong>in</strong>.Die meisten Bauern hatten sich ihreTreckwagen schon Tage vorher gerichtet.Aber immer noch hatten siegehofft, sie würden die Heimat nichtzu verlassen brauchen. Die Treckwagenwaren schwer beladen. Me<strong>in</strong>eMutter, die K<strong>in</strong>der und ich solltenuns dem Treck anschließen. Mutterbeschloss, ihr Fahrrad mitzunehmen.Es war ungewiss, ob sich für uns allee<strong>in</strong> Platz auf e<strong>in</strong>em der Treckwagenf<strong>in</strong>den würde. Wir packten die wenigenKoffer, die wir mitnehmen konnten,auf den Rodelschlitten, setztenme<strong>in</strong>en dreijährigen Sohn darauf. Ichverpackte me<strong>in</strong>e kaum e<strong>in</strong>jährigeTochter warm im K<strong>in</strong>derwagen. Sozogen wir <strong>in</strong> das Dorf. Heute nochist es mir nicht möglich, <strong>in</strong> Wortenauszudrücken, was uns bewegte,als wir uns von allem trennen mussten,was uns lieb und vertraut war.Alle<strong>in</strong> der Abschied von me<strong>in</strong>em Vaterwar bitter genug. Wir wusstennicht, ob es e<strong>in</strong> Wiedersehen gebenwürde. Nur wenige Leute blieben im12
Dorf zurück; ältere und kranke Menschen,aber auch e<strong>in</strong>ige wenige Familien,die Haus und Hof nicht verlassenwollten, komme, was wolle.Sie ahnten nicht, was für e<strong>in</strong> furchtbaresGeschehen über dieses Dorfhere<strong>in</strong>brechen sollte!aus Allenste<strong>in</strong>er Brief Nr. 5 (1981)Wagen an WagenUm Allerseelen<strong>in</strong> der dunklen Nacht,wenn vor uns stehen,die immer neu unserem Herzen fehlen, –Er<strong>in</strong>nerung erwachtan die alten Kirchen, die Hügel im Feld,wo sie schlafen, Vätern und Nachbarn gesellt,<strong>in</strong> verlorener Heimat über der See, –und an alle, die hilflos und e<strong>in</strong>sam starben,an alle, die s<strong>in</strong>kend im Eis verdarben,die ke<strong>in</strong>er begrub, nur Wasser und Schnee,auf dem Weg unserer Flucht – dem Weg ohne Gnade!Und wir ziehen im Traum verwehte PfadeWagen an Wagen, endloser Zug,der e<strong>in</strong> Volk von der Heimat trug!Von Norden, von Osten kamen wir,über Heide und Ströme zogen wir,nach Westen wandernd, Greis, Frau und K<strong>in</strong>d.Wir kamen gegangen, wir kamen gefahren,mit Schlitten und Bündel, mit Hund und Karren,gepeitscht vom W<strong>in</strong>d, vom Schneelicht bl<strong>in</strong>d, –und Wagen an Wagen.Zuckend wie Nordlicht am Himmel standverlassner Dörfer und Städte Brandund um uns heulte und pfiff der Todauf glühendem Ball durch die Luft getragenund der Schnee wurde rotund es sanken wie Garben die hilflos starbenund wir zogen weiter,Wagen an Wagen, - -13
und kamen noch e<strong>in</strong>mal, trügerisches Hoffendurch friedliches Land.Tür stand uns offenbei jenen, die nicht unser Leiden gekannt.Sie kamen, sie w<strong>in</strong>kten, sie reichten uns Brot, -sie luden die Notan warmem Herde zu sich als Gast.Scheune und Stroh rief Müde zur Rast.Doch wir konnten nicht bleiben.Wir zogen vorüberWagen an Wagen.Und hörten durch Sturm und Flockentreibendas Glockenlied ihrer Türme nochund hörten dochdas Dröhnen des Krieges, der h<strong>in</strong>ter uns zog.Und vom Wegkreuz bog,blutend, mit ausgebreiteten Armen,sich dorngekrönter Liebe Erbarmen.Wir konnten nicht halten, wir konnten nicht knien.Sie kamen h<strong>in</strong>ter uns, Wagen an Wagen, -unsre Herzen nur schrien:O blick nach uns h<strong>in</strong>!Wir wandern, wir wandern, endloser Zug,Volk, das die Geißel des Krieges schlug,entwurzelter Wald, von der Flut getragen, –Woh<strong>in</strong>?Woh<strong>in</strong>? —Agnes Miegel14
<strong>Vor</strong> der FluchtVon Ida GosdeckAm 21. Januar 1945, e<strong>in</strong>em Sonntag(Tag des Russene<strong>in</strong>falls <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>),gegen 13 Uhr, verließ ichme<strong>in</strong>en Arbeitsplatz im Landgerichtsgebäude<strong>in</strong> der Kaiserstraße.Kurz zuvor hatte uns LandgerichtspräsidentDr. Peetz beschworen:„Rette sich, wer kann!“Ich g<strong>in</strong>g durch die Magisterstraßeund bog <strong>in</strong> die H<strong>in</strong>denburgstraßee<strong>in</strong>. Auf den unteren Stufen der Freitreppezum Treudanktheater lagenLebens- und Genussmittel: Brot,Käse, Sch<strong>in</strong>ken, Konserven, Spirituosenu.a. Die Straße war menschenleer.Auf der Kreuzung H<strong>in</strong>denburg-/Bahnhofstraße fiel mir unwillkürliche<strong>in</strong> Vers e<strong>in</strong>, den ich nach dem ErstenWeltkrieg im OstpreußischenEvangelischen Gebetsvere<strong>in</strong> gelernthatte: „Gedenke an de<strong>in</strong>en Schöpfer<strong>in</strong> de<strong>in</strong>er Jugend, ehe denn die bösenTage kommen und die Jahreherzutreten, da du wirst sagen: Siegefallen mir nicht.“Ich war betroffen und blieb stehen.Ich dachte nun an den Gebetsraum,der zunächst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Holzhäuschenwar. Später wurden die Gebetsstunden<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em schönen Anbau desneuen Hauses des Regierungsober<strong>in</strong>spektorsBudz<strong>in</strong>ski, Kurze Straße,abgehalten. Kniend beteten wir, Gottmöge uns unsere Heimat erhalten.Prediger war Regierungsober<strong>in</strong>spektorBudz<strong>in</strong>ski; Gastprediger warenPfarrer F<strong>in</strong>ger und PostassistentWiede aus Allenste<strong>in</strong> sowie PredigerGoroncy vom Gebetsvere<strong>in</strong> Ortelsburg.In Gedanken g<strong>in</strong>g ich den Weg zurückund sah das Fotoatelier Pfeifer,das Vere<strong>in</strong>shaus der NeuapostolischenGeme<strong>in</strong>de und verweilte beim„Fernblick“ auf der Eisenbahnbrücke.E<strong>in</strong>ige Schritte weiter der altekatholische Friedhof: Über dem E<strong>in</strong>gangdie schwarzlackierte Tafel mitder tröstlichen Mahnung <strong>in</strong> goldenerSchrift: „Es ist e<strong>in</strong> heiliger und heilsamerGedanke, für die Verstorbenenzu beten (2.Makk.12,45)“Ich g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Richtung Tunnel. DerSchnee auf dem alten Friedhof lagunberührt. Die Telegrafendrähte amBahndamm wispelten zart. In derKönigstraße rechts das Hotel„Schwarzer Adler“, daneben dasHaus des Glasermeisters Skibowski,von dem aus wir bei Kriegsbeg<strong>in</strong>n imJahre 1914 nach Friedeberg flüchteten.L<strong>in</strong>ks die Löwenapotheke unddie Papierwarenhandlung Weiß,daneben die Auffahrt zur Kavalleriekaserne.Und über allem lag e<strong>in</strong>ewundersame Stille. Ich dachte anme<strong>in</strong>en Großvater Michael Dorka,der als Veteran nach dem ErstenWeltkrieg Jahr für Jahr um die Zeitder Kirschenernte jeweils für e<strong>in</strong>enTag Gast des Reiterregiments se<strong>in</strong>durfte.In der Wadanger Straße, h<strong>in</strong>ter demehemals Schleim’schen Kolonialwarengeschäft,er<strong>in</strong>nerte ich mich, dassich mir die Beschädigungen an e<strong>in</strong>emHaus <strong>in</strong> der Frauenstraße ansehenwollte. Tags zuvor nämlich, umdie Mittagszeit, wurde das Haus, <strong>in</strong>dem die Germania-Drogerie war und15
die Ärzt<strong>in</strong> Koch wohnte, von e<strong>in</strong>emkle<strong>in</strong>en, tieffliegenden Flugzeug ausbeschossen.Aus der Herrenstraße kam mir MarthaRomotzki (gest. 1969) entgegen. Aufe<strong>in</strong>em Schlitten zog sie zwei kle<strong>in</strong>eK<strong>in</strong>der: „. . . Das s<strong>in</strong>d die K<strong>in</strong>der vonunserer Käthe. Wir gehen zurGuttstädter Chaussee, wir wollennach Guttstadt.“ Die mir so vertrauteHerrenstraße, die Wadanger Schule– ohne Lebenszeichen. Die Verwundeten,die <strong>in</strong> der Landwirtschaftsschuleuntergebracht waren, wurdenbereits am 20.1.1945 gegen 22 Uhrweggefahren.Kaum hatte ich me<strong>in</strong>e Wohnung imzweiten Stock des Hauses Herrenstraße3 betreten, erschien der EisenbahnbeamteSabellek. „ . . . Inunserer Straße ist niemand mehr da.Der letzte Zug nach Marienburg gehtum 3 Uhr; wenn Sie gleich mitkommen,schaffen Sie es. Die Wagens<strong>in</strong>d überfüllt; ich sorge dafür, dassSie noch re<strong>in</strong>kommen.“ Bei Dunkelheitverließ der Zug langsam Allenste<strong>in</strong>.Um e<strong>in</strong> Uhr früh waren wir <strong>in</strong>Marienburg. Die Nacht war bitterkalt.Am 22.1.1945 gegen 11 Uhr sprachmich e<strong>in</strong> Eisenbahner an: „Als ichNachtdienst hatte, sah ich Sie hierstehen. Dieser Zug geht nach Berl<strong>in</strong>.Ich möchte schon, aber es wird kontrolliert.Mit diesem Zug dürfen nurParteigenossen und Frauen mit K<strong>in</strong>dernfahren. Auf Gleis 6 wird e<strong>in</strong> Militärzugrangiert, er soll nach Danzig.Ich erkundige mich. Bleiben Sie hierstehen.“ Nach kurzer Zeit kam derBeamte zurück: „Rasch, Sie werdenerwartet!“ Von Soldaten wurde ich <strong>in</strong>e<strong>in</strong>en Wagen h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>gezogen, undwährend der Zug anfuhr, gelang esdem freundlichen Eisenbahnbeamtennoch, me<strong>in</strong>en Koffer here<strong>in</strong>zuwerfen.Abends konnte ich mit e<strong>in</strong>emPersonenzug weiterfahren. UmMitternacht erreichte ich me<strong>in</strong>enneuen Dienstort: Kolberg/Pommern.Nach e<strong>in</strong>em Erlass des Reichsm<strong>in</strong>istersder Justiz bildete das AmtsgerichtKolberg das Aufnahmegerichtfür die Gerichte des LandgerichtsbezirksAllenste<strong>in</strong>.Dass ich auf me<strong>in</strong>em Fluchtweg vonEisenbahnern so viel Hilfe erhaltenhabe, ist für mich e<strong>in</strong>e liebe Er<strong>in</strong>nerung.aus Allenste<strong>in</strong>er Brief Nr. 5 (1981)Das Ende <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>von Gustav Wenger (verst.), bearbeitet von Hansjürgen WenzelAm Samstag, 20. Januar 1945, erfolgtenvormittags und nachmittagszwei Angriffe der sowjetischen Luftwaffe,die dem Hauptbahnhof Allenste<strong>in</strong>galten. Trotz starker Flakabwehrwaren neun Gleise und acht Weichenschwer beschädigt, zwei Lokomotivendurch Treffer betriebsunfähig, fünfGüterwagen entgleist, zwei mit Heuund Stroh beladene Güterwagenverbrannt. Schlimmer waren dieMenschenverluste: Durch Treffer <strong>in</strong>e<strong>in</strong>en Truppentransportzug starbenzwei Soldaten, e<strong>in</strong> Eisenbahner unde<strong>in</strong> Viehbegleiter, e<strong>in</strong>e Fliegerbombeauf Bahnsteig 1 tötete fünf Reisende,16
drei Soldaten und e<strong>in</strong>en Eisenbahner– von den Verletzten ganz zu schweigen.Allenste<strong>in</strong> hatte damals rund 50.000E<strong>in</strong>wohner; dazu waren zahlreicheFlüchtl<strong>in</strong>ge aus den Kreisen Lyckund Treuburg notdürftig untergebracht.Die planmäßigen Personenzüge<strong>in</strong> Richtung Marienburg warenschon vormittags überfüllt.Erst am 21. Januar, kurz nach 13.00Uhr, kam der Räumungsbefehl fürdie Bevölkerung; die Rote Armeestand bereits am Stadtrand. Unterdem Geschützdonner schwoll derFlüchtl<strong>in</strong>gsstrom <strong>in</strong> der Abenddämmerungbeängstigend an. Die Bahnsteigewaren derart überfüllt, daßman kaum durchkam. Reichsbahnober<strong>in</strong>spektorSchimanski leitete denBetrieb; sämtliche Eisenbahner gabenihr Letztes – vom Rangierarbeiterbis zum Amtmann – um die vollgestopften Räumzüge abzufertigen.Züge mit Militär standen sofort nachdem Ausladen wieder für Zivilpersonenzur Verfügung; sie konnten nurmehr <strong>in</strong> Richtung Marienburg,Rothfließ und Wormditt abgelassenwerden. Mit Mühe und Not konnteich me<strong>in</strong>e Frau und e<strong>in</strong>e Nachbar<strong>in</strong>noch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en gedeckten Güterwagenh<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zwängen, me<strong>in</strong>er Er<strong>in</strong>nerungnach e<strong>in</strong>er der alten Flachdach– G 10 Bauart „Kassel“ oder „Stett<strong>in</strong>“.Ich blieb auf me<strong>in</strong>em Posten: alsVerb<strong>in</strong>dungsmann zwischen Reichsbahnund dem Eisenbahn-Luftschutz-LeiterBergmann.Bis spät <strong>in</strong> die Nacht wurden an diesemSonntag etwa 25.000 Zivilpersonenabgefahren. Gegen 21.00 Uhrkam e<strong>in</strong> Wehrmachtstransport mitPanzern an der Westrampe <strong>in</strong> derNähe des Hotels Rittel an, dessenBegleitwagen nach der Entladungfür die Zivilbevölkerung freigegebenwurden (der aber nicht mehr herauskam).Gegen 23.00 Uhr begann dieBeschießung des Rangierbahnhofs;der Abtransport stockte.Unsere drei Bahnhofs-Rangierloks,G7und T 13, waren am 22. Januarnach Zurückziehung der polnischenund russischen „Fremdarbeiter“ nurmehr mit den RangieraufsehernPenzerz<strong>in</strong>ski, Behlau und OberrangiermeisterPoschmann besetzt. Um3.00 Uhr war das BefehlsstellwerkAp (Allenste<strong>in</strong> Pbf) im Ostteil desBahnhofs unbesetzt. Der Rangierbahnhoflag weiterh<strong>in</strong> unter Panzerbeschußund MG-Feuer; Züge konntennicht mehr abfahren.Beim Stellwerk Ao (Allenste<strong>in</strong> Ost)stand e<strong>in</strong> aus Neidenburg gekommenerZug, den alle Insassen, unterZurücklassen ihres Gepäcks, beiE<strong>in</strong>setzen des Beschusses fluchtartig<strong>in</strong> Richtung Allenste<strong>in</strong>er Stadtwaldverlassen hatten. Die auf demBahnhof stationierten Eisenbahn-Flakgeschütze mußten befehlsgemäßgesprengt werden; noch heutesehe ich den verzweifelten Blick desOberleutnants.Von 4.00 Uhr bis 0.00 Uhr hielt ichmich im Stellwerk Aw (Allenste<strong>in</strong>West) <strong>in</strong> der Nähe der Brücke Bahnhofstraße– Trautziger Straße auf, alsgegen 5.00 Uhr StellwerksmeisterWill angelaufen kam. Er schilderteaufgeregt, die Russen hätten ihm ander Westrampe die Uhr abgenommen,den <strong>in</strong> dem bereitstehendenZug wartenden Frauen Uhren,Schmuck und R<strong>in</strong>ge. Gleichzeitigbeobachteten wir, wie die Barackedes Bahnhofsoffiziers <strong>in</strong> hellen Flammenstand.17
Die sowjetischen Truppen nähertensich dem Bahnhofsgelände von Südenher. Gegen 6.30 Uhr fuhren e<strong>in</strong>zelnerussische Panzer von der Bahnhofsstraßeher auf die hochgelegene Eisenhahnbrückeund beschossen vondort den Rangierhahnhof. DeutscheTruppen besetzten die TrautzigerStraße (nördlich des Bahnhofs), dasStellwerk Aw, das Bahnbetriebswerk(Bw) und den Ablaufberg. Bei Tagesanbruchdes 22. Januar warendas Empfangsgebäude, die Güterabfertigungund die Bahnhofstraßeschon von den Sowjets besetzt. ImBahnhof standen noch drei Züge:Der bereits erwähnte Wehrmachtszugan der Westrampe; e<strong>in</strong> Zug anBahnsteig 4, Gleis 6 mit etwa 1.400Personen, darunter 200 Krankensowie Krankenschwestern aus demMarienhospital und dem H<strong>in</strong>denburg-Krankenhaus;der Hilfszug ausWerkstattwagen <strong>in</strong> der Nähe desBw, dem e<strong>in</strong>ige Räumwagen angehängtwaren, mit 12 Eisenbahnernvom Hbf, e<strong>in</strong>igen Bw-Angehörigen,dem Lokdienstleiter Senkowski undmehreren Flüchtl<strong>in</strong>gsfamilien.Von der rund 1.000 Mann starkenBelegschaft des Bahnhofs waren ander Ostseite bei Stellwerk Ap nebenmir nur mehr Zugschaffner Dorschund Reichsbahn-Obersekretär Schiersch<strong>in</strong>ganwesend. Wir beschlossen,wenigstens den Zug mit den Flüchtl<strong>in</strong>genund den Kranken aus Gleis 6hrauszubekommen und <strong>in</strong> RichtungGöttkendorf/Wormditt abzufahren,obwohl die Stellwerke schon nichtmehr besetzt waren. Wir versuchten,den Zug mit e<strong>in</strong>er Lok des Bw <strong>Tilsit</strong>(Lokführer Dost) zu bespannen. Infolgeverschneiter Gleise und mangelhafterFahrwegprüfung durch e<strong>in</strong>enRangierer entgleiste die Lok gegen7.30 Uhr bei e<strong>in</strong>er Gleissperre aufGleis 10. Nun wollten wir den Zugmit e<strong>in</strong>er auf Gleis 11 stehenden, mite<strong>in</strong>em Eisenhahnpionier als Lokführerbesetzten Panzerzuglok bespannen.Kaum war sie angefahren, erhielt siedurch e<strong>in</strong>en russischen Panzer vonder Eilgutrampe e<strong>in</strong>en Treffer <strong>in</strong> denDampfdom und fiel auch aus.E<strong>in</strong>e dritte Lok mit Pufferschadenund wenig Dampfdruck wurde vonLokführer Dost und dem zufällig anwesendenRohrmeister Rohde vomStädtischen Wasserwerk „spitz gemacht“.Ich entsann mich me<strong>in</strong>erKenntnisse aus der Ausbildungszeitund stellte vom Stellwerk Aw her dieFahrstraße zum Zug an Gleis 6. AmStellwerk machte ich e<strong>in</strong>e grausigeEntdeckung. Landgerichtsrat Dr. Q.,der Führer des örtlichen Volkssturms,unter dessen Befehl wir noch im Dezember1944 Panzergräben um Allenste<strong>in</strong>ausgehoben hatten, hattedort sich selbst, se<strong>in</strong>e Frau und se<strong>in</strong>ebeiden K<strong>in</strong>der im Alter von neunund zehn <strong>Jahren</strong> erschossen. Gegen10.00 Uhr setzte beim <strong>Vor</strong>bahnhofAllenste<strong>in</strong> West und bei Likusen heftigesArtilleriefeuer e<strong>in</strong>. Soldaten berichtetenuns, der Gegner sei ausRichtung Kortau im <strong>Vor</strong>marsch. DieAbfahrt nach Nordwesten <strong>in</strong> RichtungGöttkendort/Wormditt war damit<strong>in</strong> Frage gestellt. Also beschlossenwir, die Fahrt nach Nordosten <strong>in</strong>Richtung Rothfließ zu wagen. Wiezwei „gute Geister“ tauchten plötzlichStellwerksmeister Witt und KollegeKarner auf Bahnsteig 4 auf. Sielegten vom Stellwerk Ap aus dieWeichen zum Umsetzen der Lok aufdie Ostseite des Bahnhofs. Um10.45 Uhr war unser Zug abfahrbe-18
eit, erhielt jedoch Beschuß von denauf der Eilgutrampe stehenden Panzern.Lokführer Dost, gerade am Anfahren,hielt sofort an. E<strong>in</strong> Melderbrachtevom Kompanieführer e<strong>in</strong>er deutschenKampfe<strong>in</strong>heit, der unser Treibenbeobachtet hatte, die Nachricht,er werde die Panzer durch Granatwerferbeschußniederhalten. Gesagt,getan. Lokführer Dost konnte endlichum 11.10 Uhr mit RohrmeisterRohde als Heizer, mir als Transportleiterund Schaffner Dorsch als Zugführerabfahren. Leider erhielt derZug bei der Ausfahrt noch MG-Feuer,das e<strong>in</strong>em armen Flüchtl<strong>in</strong>g das Lebenkostete.Bis kurz vor Rothfließ g<strong>in</strong>g es ohneHalt durch – aber um 13.00 Uhr, 3 kmvor dem Bf Rothfließ, war Schluß.Fünf Flüchtl<strong>in</strong>gszügen vor uns hatteder Bahnhof Rothfließ wegen Überfüllungdie Annahme verweigert; siestanden auf der Strecke. Ich g<strong>in</strong>g zuFuß nach Rothfließ, um die Lage zuerkunden. Von den Zügen flehtenmich Frauen, die mich an der Uniformals Eisenbahner erkannten, an,endlich weiterzufahren. Auf e<strong>in</strong>igenoffenen Wagen bemerkte ich mehrereerfrorene Flüchtl<strong>in</strong>ge. Im BahnhofRothfließ erfuhr ich, daß auch dieweiter vorne liegenden BahnhöfeBischdorf und Korschen überfülltwaren. Endlich, nach fünf StundenWarten, ließ uns der Bf Rothfließ um18.00 Uhr e<strong>in</strong>fahren. Zu allem Überflußmeldete Lokführer Dost noch e<strong>in</strong>enLokschaden; und drei Stunden dauertees bis – gottlob! – der BahnhofRothfließ sogar e<strong>in</strong>e Ersatzlok stellenkonnte. Denken Sie e<strong>in</strong>mal, lieberLeser <strong>in</strong> Ihrer warmen Stube, an dieEmpf<strong>in</strong>dungen der Flüchtl<strong>in</strong>ge undKranken im Zuge: drei Stunden imZug bei –15° Außentemperatur, dieHeizung fiel aus, nichts zu Essen, dieFrauen ohne Nachricht vom Mannan der Front, die Ungewißheit, obund wann es weiter g<strong>in</strong>g, und e<strong>in</strong>„Führer“, der sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Bunker<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> verkroch und auf dem PapierPhantomarmeen h<strong>in</strong>- und herschob...Die Zwischenzeit hatte ichzu e<strong>in</strong>em Ferngespräch nach Korschengenutzt und den dortigen Aufsichtsbeamtengebeten, wenigstensdie Kranken <strong>in</strong> Korschen versorgenzu lassen, und hatte darüber die Abfahrt„me<strong>in</strong>es“ Zuges verpaßt. Mit e<strong>in</strong>emLeerzug gelangte ich nach Korschen,um dort zu erfahren, daß„me<strong>in</strong>“ Zug schon vorher, nämlich <strong>in</strong>Bischdorf, umgeleitet worden war.Später erfuhr ich, daß er über Heilsberg– Z<strong>in</strong>ten nach Königsberg gelangte– nachdem er drei Tage <strong>in</strong>Deutsch-Thierau gestanden hatte.In Korschen teilte mir FahrdienstleiterBuick mit, der Allenste<strong>in</strong>er Hilfszug seiauch noch herausgekommen. Gegen3.00 Uhr traf er <strong>in</strong> Korschen e<strong>in</strong>.Ihm wurde noch e<strong>in</strong>e Fahrtnummeraus Lötzen angehängt (Lazarettzug),und auch ich ergatterte dar<strong>in</strong> noche<strong>in</strong> Plätzchen. Am 23. Januar um7.30 Uhr g<strong>in</strong>g es weiter über Heilsberg– Z<strong>in</strong>ten nach Königsberg, woder Zug spät <strong>in</strong> der Nacht e<strong>in</strong>traf.Weiter g<strong>in</strong>g es über die noch offeneStrecke über Metgethen nach Fischhausen,von wo der Lazarettzug nachPillau weiterfuhr (E<strong>in</strong>schiffung derVerwundeten und Kranken). DerHilfszug traf am 24. Januar 1945 um10.00 Uhr <strong>in</strong> Germau e<strong>in</strong> und wurdeentladen; ausgeladen wurden Akten,Büromaterialen, Möbel, Schreib- undRechenmasch<strong>in</strong>en des Bw Allenste<strong>in</strong>,19
die im Stall des BahnhofsaufsehersTietz und im Schuppen e<strong>in</strong>es benachbartenBauern e<strong>in</strong>gelagert wurdenund sicher später beim Russene<strong>in</strong>marsche<strong>in</strong> schönes Feuerchennährten. Ich selbst fand, völlig ausgehungertund übermüdet (fünf Tagewar ich auf den Be<strong>in</strong>en gewesen),e<strong>in</strong>e kräftige Suppe und e<strong>in</strong> Nachtlagerbei Schmiedemeister Grönert <strong>in</strong>Germau.Wie es mir weiter erg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Ostpreußen?Chaotisch – hier e<strong>in</strong> Befehl – dae<strong>in</strong> Befehl. Am 28. Januar 1945 wurdeich nach Pillau abkommandiert,wo ich mit 17 weiteren Allenste<strong>in</strong>erEisenbahnern am 29. Januar um5.15 Uhr mit e<strong>in</strong>em Räumzug ausPalmnicken ankam. Hier traf ich imHafen durch Zufall me<strong>in</strong>e SchwesterAnna. Sie war mit drei kle<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>dernacht Tage von Skandau hierher unterwegsgewesen und konnte sich –unter Zurücklassung ihres gesamtenGepäcks – nach dem Reich e<strong>in</strong>schiffen.E<strong>in</strong> Stehplatz auf dem überfülltenSchiff kam ihr nach tagelangemWarten ohne Verpflegung wie e<strong>in</strong>Lotteriegew<strong>in</strong>n vor!Ich selbst wurde mit dem KollegenSzuszies abkommandiert <strong>in</strong> die Personalauffangstellezur Betreuung versprengterostpreußischer Eisenbahner,die im alten Ostbahnhof <strong>in</strong> Pillaue<strong>in</strong>gerichtet wurde. Wir erhielten besondereAusweise, um nicht Gefahrzu laufen, vom Sicherheitsdienst als„Versprengte“ aufgegriffen zu werden,denn Kamerad Heldenklau warunterwegs. Ab 4. Februar 1945 hattenwir im Hafen am alten Kurfürstenbollwerkdie E<strong>in</strong>schiffungen zuüberwachen. Und schon am 5. Februarerhielten wir e<strong>in</strong> neues Kommando:Vom Arbeiter bis zum Ober<strong>in</strong>spektorwurden wir für mehrereTage zum Holze<strong>in</strong>schlag e<strong>in</strong>geteilt.Die Kohlenvorräte für Lokomotivenwurden äußerst knapp, und das geschlageneHolz mußte zum Heizenverwendet werden. Abends brachtee<strong>in</strong> Arbeitszug das Holz zum LokbahnhofPillau, wo sich nach undnach große Stapel ansammelten(Anmerkung Wenzel: nur Birkenholzbrennt ohne Trocknung – aber imordentlichen Ostpreußen gab esdoch kaum Birkenholz, das „Unkrautdes Waldes“. wie mir e<strong>in</strong> alter KoblenzerRevierförster mal sagte).Bis zum 20. Februar 1945 war ichwieder <strong>in</strong> der Auffangstelle tätig: ZahlreicheEisenbahner aus dem RaumHeiligenbeil/Braunsberg, dem RaumGermau/Neukuhren und auch vielePrivateisenbahner der Königsberg-Cranzer Eisenbahn wurden von unszur E<strong>in</strong>schiffung oder zur Dienstleistungweitergeleitet. Am 18. Februar1945 wurden alle Eisenbahner derReichsbahn-E<strong>in</strong>satzgruppe zugeteiltund erhielten Feldpostnummern. Am20. Februar wurde ich Kurier derReichsbahndirektion Königsberg und„pendelte“ per Schiff durch e<strong>in</strong>e vone<strong>in</strong>em Eisbrecher gebrochene Fahrr<strong>in</strong>nedurch das Haff mit Dienstpostzwischen Pillau und dem Befehlszugdes Präsidenten im Heiligenbeiler Kessel.Mehrfach fuhr ich per Schiff vonPillau zur Auffangstelle nach Schwer<strong>in</strong>und zurück. Auf die letzte, mir am18. April 1945 anvertraute, Kurierpostnach Pillau wartete dort niemandmehr – der Fahrtauftrag wurdeüberholt durch den Absetzbefehl füralle Königsberger Eisenbahner vonSchwer<strong>in</strong> nach Neustadt (Holste<strong>in</strong>),wo ich das Kriegsende erlebte.aus Eisenbahnkurier – Special 5220
8.5.1945: Ende des Zweiten Weltkrieges <strong>in</strong> EuropaDer Zweite Weltkrieg begann am1. September 1939 um 4.45 Uhr.Er endete <strong>in</strong> Europaam 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr,<strong>in</strong> Asien am 2. September 1945 um 9.25 Uhr.Er dauerte sechs Jahre und e<strong>in</strong>en Tag.Oder 2.194 Tage, oder 52.641 Stunden.Durch den Krieg verloren<strong>in</strong> jeder Stunde 1.045,<strong>in</strong> jeder M<strong>in</strong>ute 17 Menschen ihr Leben.Insgesamt 55 Millionen.Als Soldaten, als Opfer des Luftkrieges,als Flüchtl<strong>in</strong>ge und Vertriebene,als Opfer der Gewaltherrschaft.Aber auch danach gab und gibt es weltweitimmer noch Kriege und Bürgerkriege,Unterdrückung und Verfolgung,Vertreibung und millionenfachen Mord.Lerne, Menschheit!Die Opfer mahnen zum Frieden21
Die Maler<strong>in</strong> Frieda StrohmbergVom süddeutschen Barock zur ostdeutschen Backste<strong>in</strong>gotikvon Dr. Ernst VogelsangWer er<strong>in</strong>nert sich noch an sie? Vermutlichnur wenige. Sie hatte zwischen1910 und 1927 das Allenste<strong>in</strong>erKunstleben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er beachtlichenWeise bereichert, dass es sich lohnt,ihrer Biographie nachzugehen undsie <strong>in</strong> unser Gedächtnis zurückzurufen.Frieda Strohmberg stammte ausSchwe<strong>in</strong>furt, wo sie am 13. November1885 als jüngste von vier Töchterndes Bankiers Karl Strohmbergund se<strong>in</strong>er Ehefrau Amalie Silbermanngeboren wurde. Die drei älterenSchwestern – Dora, Paula undElsa – sollten <strong>in</strong> ihrem späteren Lebennoch e<strong>in</strong>e bedeutsame Rollespielen.Der Vater verlegte 1893 se<strong>in</strong>e Privatbanknach Würzburg, wo FriedaStrohmberg aufwuchs. Schon frühzeigte sich ihre Neigung und Begabungzur Malerei, so dass sie mit 20<strong>Jahren</strong> zur künstlerischen Ausbildungnach München g<strong>in</strong>g. Der ausder Schule des Impressionismuskommende, damals bekannte AngeloJank wurde ihr Lehrer, der sie <strong>in</strong>das Handwerkliche, die Maltechnikund die damalige Kunstrichtung e<strong>in</strong>führte.Daneben bot die bayerischeKönigsresidenz mit ihren zahlreichenAusstellungen, Museen und Künstlernreiche Anregungen, die ihrerMalerei förderlich waren.1906 wechselte sie an die Kunstakademie<strong>in</strong> Brüssel. Hier lebte ihreverheiratete Schwester Dora, bei dersie wohnen konnte. Auch hier empf<strong>in</strong>gsie viele neue Impulse durch dieBauten, Museen und Künstler.Durch besondere Leistungen aufgefallen,wurde sie mit e<strong>in</strong>er Silbermedailleder Akademie ausgezeichnet –als Ausländer<strong>in</strong>!Ihre Lehrjahre beschloss sie an derKunstakademie <strong>in</strong> Kassel. Wiederkonnte sie bei der Familie ihrer ältestenSchwester Elsa leben, die mitdem angesehenen und damals rechtbekannten Arzt Dr. med. Willy Gotthilfverheiratet war. Durch den großenBekanntenkreis der Gotthilfswurde sie schnell <strong>in</strong> Kassel heimisch,22
wozu auch Stadt und Umgebungbeitrugen. Sie entwickelte sich zurLandschaftsmaler<strong>in</strong>, auch entstandenviele Blumenstücke und nichtzuletzt Porträts, mit denen sie nichtnur treffsicher das Äußere, sondernauch das Wesen ihres Gegenüberserfasste.So kamen genügend Aufträge ausder Gesellschaft, sie war gefragt,doch wusste sie, wie schwierig diematerielle Existenz freien Künstlertumsse<strong>in</strong> konnte. Nicht zuletzt auchdar<strong>in</strong> bestärkt durch ihren SchwagerGotthilf, ergänzte sie ihre malerischedurch e<strong>in</strong>e pädagogische Ausbildungund schloss die Kasseler Zeitmit e<strong>in</strong>em Examen als Zeichenlehrer<strong>in</strong>ab, das sie zu e<strong>in</strong>er Anstellung ane<strong>in</strong>er öffentlichen höheren Schule <strong>in</strong>Preußen berechtigte.Das preußische M<strong>in</strong>isterium fürgeistliche und Unterrichtsangelegenheiten<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> (Kassel gehörte zurpreußischen Prov<strong>in</strong>z Hessen) beantworteteihr Anstellungsgesuch positiv– es war e<strong>in</strong>e Zeichenlehrerstelle <strong>in</strong>Allenste<strong>in</strong> am dortigen Lyzeum, derLuisenschule, frei geworden. So kamsie von Mitteldeutschland zum 1.Oktober 1910 <strong>in</strong> den Osten.Es war der gewaltige Sprung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>eihr noch unbekannte und unterentwickelteWelt, so die damals gängigeMe<strong>in</strong>ung. Hatte man doch imReich (damit bezeichnete man <strong>in</strong>Ostpreußen das Deutschland westlichder Weichsel) die <strong>Vor</strong>stellung,dass e<strong>in</strong>e Versetzung <strong>in</strong> die östlichsteProv<strong>in</strong>z, sozusagen nach Sibirien,e<strong>in</strong>er Strafe gleichkam. Doch sollman hier gleich e<strong>in</strong>flechten, dass diemeisten der dorth<strong>in</strong> versetztenStaatsdiener hernach nicht mehr zurückgehenwollten.Hier nun empf<strong>in</strong>g die im WürzburgerBarock groß gewordene, durchMünchen, Brüssel und Kassel geprägtejunge Künstler<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Welt,deren Landschaft sich nicht nur alsunentdeckte Perle erwies, sondernderen Menschen <strong>in</strong> Anlage und Gemütauch anders waren. Des Lebensbreiter Fluss bewegte sich hier <strong>in</strong> ruhigerenBahnen.Allenste<strong>in</strong> selbst hatte <strong>in</strong> jener Zeitals Stadt e<strong>in</strong>en ungeahnten Aufschwungvon e<strong>in</strong>er Kle<strong>in</strong>stadt zu e<strong>in</strong>embeachtlichen Geme<strong>in</strong>wesenmittlerer Größe gerade h<strong>in</strong>ter sichund war nun unter der klugen Handihres Oberbürgermeisters Zülch dabei,sich stetig weiter zu entwickeln.Mit den staatlichen und kommunalenÄmtern, Schulen, e<strong>in</strong>er großen Garnisonund aufblühenden Wirtschaftwuchs auch e<strong>in</strong>e an Kultur, Kunstund Musik <strong>in</strong>teressierte Gesellschaftsschicht.In dieses Umfeld kam Frieda Strohmberg.Sie mietete sich <strong>in</strong> der Pensionvon Fräule<strong>in</strong> Nitsch <strong>in</strong> der Langgasse25 e<strong>in</strong>, wo bereits zwei Kolleg<strong>in</strong>nen –Me<strong>in</strong>ecke und Viertel – wohnten. DieLehrkräfte von Lyzeum und Oberrealschule,im Gegensatz zum staatlichenGymnasium beides städtischeAnstalten, bildeten e<strong>in</strong>e zwangloseGesellschaft, <strong>in</strong> der sich vielerlei Interessenmite<strong>in</strong>ander verbanden. Infesten Abständen traf man sich beispielsweisezu geme<strong>in</strong>samen Spaziergängendurch den Stadtwald, soes die Witterung zuließ, um im ländlichenGasthaus Osch<strong>in</strong>ski <strong>in</strong> Neu-Wadang e<strong>in</strong>zukehren, wo sich dievielerlei Begabungen austauschten.Es war e<strong>in</strong>e vielseitig gebildete und<strong>in</strong>teressierte Geme<strong>in</strong>schaft, <strong>in</strong> dieder Neul<strong>in</strong>g aus dem Reich stieß23
und, dank ihres bescheidenen, zurückhaltenden,fe<strong>in</strong>fühligen Wesens,sehr bald auch angenommen wurde.H<strong>in</strong>zu kam natürlich ihr Können.In den nun entstehenden Bildernsetzte sie sich mit der ostpreußischenLandschaft und der mittelalterlichenBackste<strong>in</strong>gotik ause<strong>in</strong>ander und fuhrmit der schon <strong>in</strong> Kassel so erfolgreichenPorträt-Malerei fort. E<strong>in</strong> private<strong>in</strong>gerichteter wöchentlicher Malkursus<strong>in</strong> Zeichnen, Aquarellieren undÖlmalerei öffnete ihr schnell den Zugangzur Allenste<strong>in</strong>er Gesellschaft,wodurch sich freundschaftliche Beziehungenzur Familie Zülch und derEhefrau des Landwirtschaftsrats Dr.August Trunz, Helene Trunz entwickelten.In der nach dem Ersten Weltkrieggegründeten Volkshochschule hieltFrieda Strohmberg zwischen 1920und 1927 zeitweise Lichtbildvorträgeüber Kunst<strong>in</strong>terpretationen, wofürdie Koppernikusschule die Aula undGerät zur Verfügung stellte. Im Unterrichtihrer Mädchenklassen schlugsie für die damalige Zeit neue Wegee<strong>in</strong>. Sobald Jahreszeit und Witterunges zuließen, g<strong>in</strong>g sie mit den höherenKlassen zum Malen und Zeichnen<strong>in</strong>s Freie, um das Schloss, dasHohe Tor oder die Jacobi-Kirche zuzeichnen. Die Unterstufe durfte Phantasiezeichnungenentwerfen; auch derEntwurf von Collagen war etwas völligNeues. Kle<strong>in</strong>e Schüler-Ausstellungenregten den Eifer an. Darüberh<strong>in</strong>aus übte sie <strong>in</strong> der OberstufeKunstbetrachtung sowie Bildbeschreibungund unterrichtete <strong>in</strong> Kunstgeschichte,alles D<strong>in</strong>ge, die über dendamaligen Zeichenunterricht h<strong>in</strong>ausg<strong>in</strong>gen.Sie erwies sich bei ihrenSchüler<strong>in</strong>nen als gute Pädagog<strong>in</strong>.Der Stil ihres Schaffens blieb derSpätimpressionismus, ohne sich allerd<strong>in</strong>gsan die bekannten <strong>Vor</strong>bilderwie Max Liebermann, Ludwig Dettmannu.a. zu klammern. Ihre Motivewaren aus dem Allenste<strong>in</strong>er Stadtbildgewählt, die Landschaftsbildergaben den ostpreußischen Sommer<strong>in</strong> vielfacher Form wieder. Von Freundengebeten machte sie manchmalkle<strong>in</strong>e Ausstellungen von besondersgelungenen Bildern im Zeichensaalder Luisenschule oder der Oberrealschule,gelegentlich auch imSchaufenster des RahmengeschäftesWodtke gegenüber dem Rathausund schließlich dann ebenfalls imFoyer des 1925 neu erbauten Landestheaters„Treudank“.Als für die Abstimmung im RegierungsbezirkAllenste<strong>in</strong> 1920 bescheideneHefte mit Bildern und Geschichtenaus dem Abstimmungsgebietfür die Wahlberechtigten gedrucktwerden sollten, bat man sieum Federzeichnungen mit Allenste<strong>in</strong>erMotiven. Solche Zeichnungenhatte sie bislang nie gemacht. Siegerieten ihr mühelos und waren sofortdruckreif.Als Frieda Strohmberg 1927 aus Allenste<strong>in</strong>fortzog, um <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> denZahnarzt Dr. Albert Jacoby zu heiraten,konnte sie auf e<strong>in</strong> erfolgreichesSchaffen dieser 17 Jahre im Ostenzurückschauen. Und das im H<strong>in</strong>blickauf ihr pädagogisches Wirken <strong>in</strong> derLuisenschule wie auch <strong>in</strong> ihremkünstlerischen Wirken als Maler<strong>in</strong>.Sie h<strong>in</strong>terließ <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Lücke.Ihre ostpreußischen Bilder h<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>der großen Berl<strong>in</strong>er Wohnung. Zwarmalte sie weiter, aber nicht mehr mitder Intensität wie <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>, wo esmalerisch soviel Neues zu „erbeu-24
ten“ gab. In Berl<strong>in</strong> galt e<strong>in</strong>e andereKunstrichtung, der Impressionismuswar <strong>in</strong>zwischen vorbei. Für den dortpraktizierten kritischen Stil e<strong>in</strong>esGeorge Groß oder Otto Dix konntesie sich nicht erwärmen, sie blieb beiihrer kultivierten Malweise, für diesich auch hier genügend Freundefanden.Die Jahre nach 1933 wurden für dasEhepaar zunehmend schwieriger,stammten doch beide Teile aus jüdischenFamilien. 1936 emigrierten sienach Brüssel, wo Frieda StrohmbergJacoby ihre Malerei noch etwas fortsetzenkonnte. Auf der Flucht vorden e<strong>in</strong>marschierenden deutschenTruppen im Mai 1940 fiel sie dabeimit ihrem Ehemann e<strong>in</strong>em Bombenangriffzum Opfer. E<strong>in</strong> genaues Todesdatumist nicht bekannt.Von den vielen ihrer Bilder ist nurwenig gerettet worden. Prof. Dr. E-rich Trunz, der bekannte Literatur-Historiker, Herausgeber der HamburgerAusgabe der Goethe-Werkeund Sammler der Prussica-Sammlung Trunz, konnte nur noch29 überkommene Werke der Maler<strong>in</strong>auflisten. Alles andere ist Unverstandund wirren Zeitläuften zum Opfer gefallen.MondnachtEs war, als hätt der HimmelDie Erde still geküßt,Daß sie im BlütenschimmerVon ihm nur träumen müßt.Die Luft g<strong>in</strong>g durch die Felder,Die Ähren wogten sacht,Es rauschten leis die Wälder,So sternklar war die Nacht.Und me<strong>in</strong>e Seele spannteWeit ihre Flügel aus,Flog durch die stillen Lande,Als flöge sie nach Haus.Joseph von Eichendorf(1788 – 1857)25
Das Musikleben Allenste<strong>in</strong>svon Karl He<strong>in</strong>rich DanehlIn e<strong>in</strong>em Führer der ostpreußischenKreisstadt Allenste<strong>in</strong> vom Jahre1899 geht der unbekannte Verfasservon der „bemerkenswerten Kanalisation“unvermittelt zum Allenste<strong>in</strong>erKunstleben über. Hier spricht er vonden Saal-Theatern und den Gartenkonzertender vier Militärkapellen,um mit folgendem Satz zu schließen:„Den Gesang pflegen die Liedertafel,der Cäcilienvere<strong>in</strong> und der EvangelischeKirchenchor.“Das war die sogenannte „gute alteZeit“, <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> g<strong>in</strong>g man zu Krollund <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> <strong>in</strong> den Kaisergarten.Heute nach 33 <strong>Jahren</strong> kann mitRecht behauptet werden, daß Allenste<strong>in</strong>e<strong>in</strong> Musikleben hat und daßes wenig Städte mit gleicher E<strong>in</strong>wohnerzahlim Reich gibt, die e<strong>in</strong>derartig reges Musikleben verzeichnenkönnen. Wie <strong>in</strong> allen D<strong>in</strong>gengab es auch im musikalischen Lebender Stadt Allenste<strong>in</strong> e<strong>in</strong> ständigesAuf und Ab. Auf Jahre mit zehnund mehr großen Künstlerkonzerten(1921) folgten Jahre mit recht kärglichenVeranstaltungen. Fanden <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em Jahre Konzerte stets ausverkaufteHäuser, so konnten dieselbenSolisten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anderen Jahrevor nur schwach besetzen Sälenspielen. Sieht man Zeitungsartikelund Besprechungen der vergangenenJahrzehnte durch, so tauchenselten Kritiken über die künstlerischenLeistungen der Konzertveranstaltungenauf, sondern vielmehrwird mehr die Interesselosigkeit desPublikums kritisiert.Zwei Faktoren bestimmen von vornhere<strong>in</strong>das Musikleben unsererStadt: Die Veranstaltungen der e<strong>in</strong>heimischenGesangsvere<strong>in</strong>e undKapellen und die Konzerte des 1896gegründeten Konzertvere<strong>in</strong>s. Vonden Gesangsvere<strong>in</strong>en wären zuerstdie Kirchenchöre an St. Jakobi, anHerz Jesu, an St. Josefi und derjunge St.-Franziskus-Chor, sowieder Evangelische Kirchenchor zuerwähnen. Diese Chorvere<strong>in</strong>igungen,die die ältesten unserer Stadt s<strong>in</strong>d,treten wenig oder gar nicht <strong>in</strong> diebreite Oeffentlichkeit; aber geradesie s<strong>in</strong>d es, die unter sorgender Leitung<strong>in</strong> stiller Kle<strong>in</strong>arbeit den Gesangpflegen und die Liebe zum Gesangund zur Musik <strong>in</strong> der Bevölkerungwach halten.Daneben stehen die Chorvere<strong>in</strong>igungen,die den Kunstgesang pflegen:die Allenste<strong>in</strong>er Liedertafel, derMadrigalchor (früher Oratorienvere<strong>in</strong>)und der Männerchor „Melodia“. Hierist es stets die Weitsicht der Vere<strong>in</strong>sführerund der leitenden Dirigentengewesen, wenn diese Chöre außerordentlichesgeleistet und bis zumheutigen Tage große Chorwerke undOratorien herausgebracht haben, diewie leuchtende Meilenste<strong>in</strong>e an demschwierigen Weg des Allenste<strong>in</strong>erMusiklebens liegen. Der Name e<strong>in</strong>esMannes fehlt nie, es ist der LeipzigerArnold Klesse, der 1896 bis 1925Dirigent der Liedertafel war, der1903 den Oratorienvere<strong>in</strong> gründete,der noch vor zwei <strong>Jahren</strong> den Allenste<strong>in</strong>erOrchestervere<strong>in</strong> <strong>in</strong>s Leben26
ief und allen Vere<strong>in</strong>igungen denStempel se<strong>in</strong>es lebendigen Künstlertumsaufdrückte. Im Jahre 1911wurde Allenste<strong>in</strong> als Ort für das OstpreußischeProv<strong>in</strong>zialsängerfest ausgewählt,e<strong>in</strong>e Auszeichnung, die unsererStadt nie wieder zuteil wurde.Dies bedeutet jedoch nicht e<strong>in</strong> Nachlassender Kräfte der Allenste<strong>in</strong>erChöre, sondern die Veranstaltunge<strong>in</strong>es solchen Festes, das Massenvon Sängern auf das Podium br<strong>in</strong>gt,scheitert stets an der Saalfrage. Wirbesitzen <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> trotz e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>wohnerzahlvon 44 000 noch immerke<strong>in</strong>en geeigneten Saalbau und ke<strong>in</strong>enKonzertsaal. Im Jahre 1911 erhieltAllenste<strong>in</strong> die für damalige Zeitgewaltigen Hallen der Gewerbeausstellung.Aber sie wurden niedergerissenund neue Säle wurden nichtgebaut. Bei allen großen Chorkonzertenerwies sich „der Saal“ desdeutschen Hauses – heute K<strong>in</strong>o Kapitol– und der Theatersaal des neuerbautenLandestheaters als viel zukle<strong>in</strong>. Die größten Oratorienkonzertefanden sonderbarer Weise währenddes Weltkrieges statt, wo reklamierteKünstler e<strong>in</strong> hervorragendes und billigesSolisten-Material stellten. Esgibt wohl ke<strong>in</strong> Oratorium, das <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>nicht zu Gehör gebrachtwurde. Prachtvolle Leistungen f<strong>in</strong>denwir: E<strong>in</strong> deutsches Requiem, Schöpfung,Jahreszeiten, Elias, Heilige Elisabeth,Paulus, Messias; erst im letztenW<strong>in</strong>ter hörten wir die Mattäus-Passion.Hoffentlich gel<strong>in</strong>gt es e<strong>in</strong>mal,alle Chöre zu e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaftzusammenzufassen, um Allenste<strong>in</strong>auch die größten Schöpfungendeutscher Tondichter zu vermitteln –es seien hier nur Beethovens Neunteund Wagners Parsifal erwähnt.Vergessen wir nicht die Chöre dervielen Allenste<strong>in</strong>er Schulen und ihreLeiter, die die Schüler <strong>in</strong> die deutscheSangeskunst e<strong>in</strong>führen. Hiers<strong>in</strong>d es zwei Musiklehrer, die e<strong>in</strong>enNamen weit über die Grenze unsererStadt besitzen: Bernhard Bartschund Johannes Herrmann. Dankbardenken viele an die reizenden Konzertedes frischen Mädchenchoresder Charlottenschule, den BernhardBartsch leitet, und dankbar s<strong>in</strong>d alleJohannes Herrmann, der wieder unsereHeimatlieder entdeckte und unverzagtmit der Jugend arbeitet.Höhepunkte und künstlerische Ereignissedes Allenste<strong>in</strong>er Musiklebenss<strong>in</strong>d bis auf den heutigen Tagdie Künstler-Konzerte des Allenste<strong>in</strong>erKonzertvere<strong>in</strong>s. Stets galt es, e<strong>in</strong>großes Defizit zu decken, für das <strong>in</strong>letzter M<strong>in</strong>ute die Stadt oder die Regierunge<strong>in</strong>traten. Das ist bis zumheutigen Tag geblieben und es istgut so, denn es verpflichtet die Veranstalter,stets nur die ersten Größennach Allenste<strong>in</strong> zu rufen undauch für e<strong>in</strong> volles Haus besorgt zuse<strong>in</strong>. Als es e<strong>in</strong>ige Jahre h<strong>in</strong>durchanders war, als aus Reichsmittelndas Konzertwesen betreut und jedesDefizit gedeckt wurde, ließ die Qualitätder Konzerte und damit auch derBesuch merklich nach, so daß derKonzertvere<strong>in</strong> an se<strong>in</strong>en Zuschüssenstarb und die junge Musikalische Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaftdie Betreuung derKonzerte <strong>in</strong> die Hand nahm. Damithat Allenste<strong>in</strong> wieder Künstlerkonzerte,die sich würdig an die großenAbende früherer Jahre anreihen.Hörten wir doch erst <strong>in</strong> diesem Jahrewieder das Kl<strong>in</strong>gler-Quartett, das bereits<strong>in</strong> den <strong>Jahren</strong> 1921,1923,1926,1927 und 1930 <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> spielte,27
sowie Edw<strong>in</strong> Fischer mit se<strong>in</strong>emKammerorchester. Auch wird <strong>in</strong> diesemJahre He<strong>in</strong>rich Schlusnus wiedernach Allenste<strong>in</strong> kommen, der imJahre 1921 sogar zweimal auf unsererBühne stand. Nennen wir dieNamen der großen Sänger: Rehkemper,Broderson (1921/1924/,Jadlowker (1921), Knote (1920), Korell(1918), Graveur (1932) und derSänger<strong>in</strong>nen: Lotte Leonhard (1919),1929, 1932), Emmi Leisner (1920),Julia Kulp, Frieda Leider (1917), SusanneDessoir, Sigrid Oneg<strong>in</strong> (1920),Eva Liebenberg (1932), Cläre Dux ,die <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> noch e<strong>in</strong>mal kurz vorihrer Abreise nach Amerika sang, sokönnen wir wirklich stolz se<strong>in</strong>; nennenwir weiter die Cellisten: Földesy(1917) und Kolessa (1932), von denGeigenkünstlern: nur Professor Havemann(1931), Hubermann (1917,1918, 1925), Jani Szanto (1917),Flesch (1920, 1921), Prof. Petschnikoff(1920), Alma Moodie (1932),Adols Busch (1922), aus der Scharder Pianisten: d’Albert, Kreutzer(1920), Schnabel ( 1919), Ansorge(1920), Friedberg ( 1921, 1924,1927), Pembaur (1922), Fischer(1921, 1931).Auch die drei deutschen Chöre, diesich e<strong>in</strong>en Weltruhm begründet haben,waren nach Allenste<strong>in</strong> gekommen.Der Leipziger Thomaner-Chor(1921), der Berl<strong>in</strong>er Dom-Chor(1922, 1927) und der MagdeburgerDom-Chor (1928). So haben im musikalischenLeben der Stadt Allenste<strong>in</strong>die letzten drei Jahrzehnte e<strong>in</strong><strong>eV</strong>ergangenheit geschaffen, welchedie Gegenwart verpflichtet.Dieser Beitrag stammtaus dem Jahre 1935Sommernacht auf der Krut<strong>in</strong>naE<strong>in</strong> Lied erfüllt die Sommernacht,e<strong>in</strong> Lied, das Herzen glücklich macht,man fährt auf Gottes Spurendurchs Zauberland Masuren.Die Fahrt, gestakt von Baum zu Baum,von Boot zu Boot, von Traum zu Traum,durchs Wasserspiel, dem klaren,ist mehr als nur e<strong>in</strong> Fahren.Man hört auf dem Krut<strong>in</strong>nen-Fluß,den man von Herzen lieben muß,geheimnisvolle Laute,vertraut‘ und unvertraute.Die Boote, lampion-bestückt,mit Band und frischem Grün geschmückt,<strong>in</strong> Engen und <strong>in</strong> Weitendurchs flache Wasser gleiten.E<strong>in</strong> Lied erfüllt die Sommernacht,e<strong>in</strong> Lied, das Menschen fröhlich macht,man fährt auf Gottes Spurendurchs Märchenland Masuren.Gert O. E. Sattler28
Er<strong>in</strong>nerung an die Sopranist<strong>in</strong> Elisabeth RoseMan hat dem Landestheater Südostpreußennachgesagt, dass es e<strong>in</strong>„Aufsteigertheater“ gewesen sei, andem sich junge Künstler ihre erstenSporen verdienten. Der bekanntesteunter ihnen war wohl der später alsDirigent des NDR-S<strong>in</strong>fonieorchestershochgeehrte Günter Wand, der <strong>in</strong>den zwanziger <strong>Jahren</strong> Kapellmeisterund Korrepetitor am Landestheaterwar.Als Marschall<strong>in</strong> im „Rosenkavalier“Ich möchte heute an Kammersänger<strong>in</strong>Elisabeth Rose er<strong>in</strong>nern, die später<strong>in</strong> Leipzig und Berl<strong>in</strong> ihre großenJahre als Sänger<strong>in</strong> und Gesangspädagog<strong>in</strong>hatte und Ehrenmitgliedder Deutschen Staatsoper Unter denL<strong>in</strong>den ist. Auch ihre Karriere begannam Landestheater <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>. ImJahre 1943 wurde die gebürtige Erfurter<strong>in</strong>vom Intendanten Franz-Joseph Delius für das Fach Operund Operette engagiert.Ihre Antrittspartie war die Leonoreaus dem „Troubadour“. Partner <strong>in</strong>dieser von Delius selber <strong>in</strong>szeniertenAufführung waren u.a. der Tenor A-lessandro Remo als Manrico und dieAltist<strong>in</strong> Elisabeth Aldor von der KönigsbergerOper als Azucena; diemusikalische Leitung hatte WalterBlaich. Es folgten noch <strong>in</strong> der gleichenSpielzeit 1943/44 die Pam<strong>in</strong>a<strong>in</strong> der „Zauberflöte“, die Mutter <strong>in</strong>„Hänsel und Gretel“ und die Eurydike<strong>in</strong> „Orpheus und Eurydike“. In derOperette sang sie die Saffi im „Zigeunerbaron“.Sie wirkte außerdem<strong>in</strong> mehreren Schlosskonzerten undBunten Abenden mit. Für e<strong>in</strong>e Anfänger<strong>in</strong>war das schon e<strong>in</strong> riesigesProgramm, das die damals Fünfundzwanzigjährigeoffenbar ohneSchwierigkeiten bewältigen konnte<strong>Vor</strong> allem aber: Sie kam beim Theaterpublikuman und hatte hervorragendeKritiken.So schrieb Erich M. Klemer <strong>in</strong> der AZvom 2.9.43: „In Elisabeth Roses Leonoreerlebt man e<strong>in</strong>e sehr fe<strong>in</strong>s<strong>in</strong>nigeund beseelte Verkörperung deranspruchsvollen Partie, für die siebedeutende Mittel e<strong>in</strong>zusetzen weiß.E<strong>in</strong> sicheres Stilgefühl, das Leidenschaft,H<strong>in</strong>gabe und Klage im natürlichenGlanz der Stimme vere<strong>in</strong>t,wird der dramatischen Bewegungwie der Kantilene gerecht, und auchdie mannigfachen Kadenzen undSkalen zeigen vorteilhaft die schönengesanglichen Möglichkeiten und diehohe Kultur der Sänger<strong>in</strong>.“29
Dieser verheißungsvolle Beg<strong>in</strong>n ihrerKarriere fand aber im Kriegssommer1944 durch die von Goebbels verfügteSchließung aller Theater vorerste<strong>in</strong> jähes Ende. Die Künstler<strong>in</strong>nenund Künstler und auch dasTheaterpersonal wurden dienstverpflichtetbzw. zur Wehrmacht e<strong>in</strong>gezogen.Frau Rose kam als Dienstverpflichtete<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Waffenfabriknach Erfurt. Hier stand sie <strong>in</strong> Wechselschichtenvon je 12 Stunden ander Masch<strong>in</strong>e und musste Gewehrteilestanzen. Sie sagte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Interviewüber diese Zeit: „<strong>Vor</strong> mir h<strong>in</strong>gan der Wand e<strong>in</strong> Bild Beethovensmit dem Spruch: ,Ich will demSchicksal <strong>in</strong> den Rachen greifen,niederbeugen soll es mich nicht.‘Das gab mir Kraft und war für miche<strong>in</strong>e der größten Hilfen <strong>in</strong> dieser erbarmungslosenZeit von Krieg undVernichtung.Nach Kriegsende fand Frau Rose <strong>in</strong>Stralsund wieder Anschluss an dasTheater. Danach folgten e<strong>in</strong> Engagement<strong>in</strong> Magdeburg und „ihre“zehn wichtigen Jahre <strong>in</strong> Leipzig. MaxBurghardt holte sie nämlich 1950 andas Leipziger Opernhaus. Sie sangdort im jugendlich-dramatischenFach bis zum Zwischenfach alle großenOpernpartien unter so prom<strong>in</strong>entenDirigenten wie Konwitschny,Seydelmann, Abendroth, Kempeund Bongartz. Mit Regisseuren wieHe<strong>in</strong>rich Voigt, Friedrich Ammermannund Joachim Herz, die ebenfallszur Spitzenklasse zählten, hatsie zusammen gearbeitet. Auslandsgastspieleführten sie nach F<strong>in</strong>nlandund Rumänien; Rundfunk- undSchallplattenaufnahmen folgten. Hier<strong>in</strong> Leipzig wurde sie auch zur Kammersänger<strong>in</strong>ernannt.Inzwischen wechselten Max Burghardtals Intendant und Franz Konwitschnyals Generalmusikdirektoran die Staatsoper Unter den L<strong>in</strong>dennach Berl<strong>in</strong> und holten im Jahre19<strong>60</strong> auch Elisabeth Rose nach Berl<strong>in</strong>an die Staatsoper, wo sie bis zuihrem Ausscheiden im Jahre 1978nicht nur e<strong>in</strong> umfangreiches, überwiegendklassisches Repertoire gesungenhat, sondern auch als begehrteMusikpädagog<strong>in</strong> an derBerl<strong>in</strong>er Hochschule für Musik ihrenreichen Erfahrungsschatz an die jüngereGeneration weitergeben konnte.E<strong>in</strong>e tiefe Enttäuschung ist geblieben.Der Mauerbau im August 1961war der zweite E<strong>in</strong>griff der Politik <strong>in</strong>ihren Weg als Künstler<strong>in</strong> nach demersten mit der Schließung der Theaterim Jahre 1944. Ihre Hoffnungenauf weitere Gastspiele <strong>in</strong> Westberl<strong>in</strong>und <strong>in</strong> der Bundesrepublik musstesie aufgeben, e<strong>in</strong> Schicksal, das siemit vielen bedeutenden Künstlernaus der ehemaligen DDR teilt. Heutelebt Frau Rose <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>. In Gesprächenmit ihr spielt die Allenste<strong>in</strong>erZeit immer wieder e<strong>in</strong>e wichtige Rolle.Sie hat die Stadt und ihre Menschen,mit denen sie sich sehr verbundenfühlte, nicht vergessen.Horst Kolberg, Pastor i.R.Paul-Ehrlich-Str. 17 c,30952 Ronnenberg30
Programm – <strong>Vor</strong>derseiteAuch das gehörte <strong>in</strong> dieser Zeit zum Theaterbesuch.Programm – Rückseite31
Der Allenste<strong>in</strong>er Professor Dr. Erich TrunzE<strong>in</strong>er der großen Literaturwissenschaftler des 20. Jahrhundertsvon Kurt DzikusProfessor Dr. Erich Trunz wäre am13. Juni 2005 e<strong>in</strong>hundert Jahre altgeworden. Se<strong>in</strong> wissenschaftlichesErbe gipfelt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er „Goethe-Edition“,der sogenannten „Hamburger Ausgabe“<strong>in</strong> 14 Bänden, mit der er weitüber die Grenzen der fachkompetentenLiteraturwissenschaftler auchbei allen Liebhabern der poetischenWerke Goethes im Inland sowie imAusland bekannt geworden ist. Derletzte Druck erfolgte im Goethe-Jahr1998 im renommierten Beck-Verlag<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bibliophilen Ausstattung sehenswürdigerGüte.Der Verfasser dieser biographischenSkizzen lernte als junger Student derGermanistik, nachdem er als Abiturientdes „Städtischen Gymnasiumsfür Jungen“ <strong>in</strong> Gelsenkirchen-Buer,das sich heute „Max-Planck-Gymnasium“nennt, erfolgreich verlassenhatte, im Sommersemester 1954 ander Universität Münster ProfessorErich Trunz kennen. E<strong>in</strong>e Zuneigungbei dem Studiosus zu se<strong>in</strong>em akademischenLehrer war geboren, obwohler bei der großen Menge derStudierenden unbemerkt gebliebenist. Geschätzte <strong>Vor</strong>lesungen, Sem<strong>in</strong>areund Fleißprüfungen mit persönlichenBegegnungen ließen dann die Absichtreifen, bei Erich Trunz das anstehendeStaatsexamen zu machen.Doch nach dem Sommersemester1957 verließ Professor Trunz die UniversitätMünster, weil er <strong>in</strong> Kiel e<strong>in</strong>enRuf auf den literaturwissenschaftlichenLehrstuhl angenommen hatte.Danach erfuhr der akademischeSchüler nur noch gelegentlich vondem Tun se<strong>in</strong>es Lehrers. Nach dennotwendigen Exam<strong>in</strong>a <strong>in</strong> Münsterwurde der GermanistikstudentDeutschlehrer am Max-Planck-Gymnasium<strong>in</strong> Gelsenkirchen-Buer. Durchdie Begegnung mit der Patenschaftzwischen dem Max-Planck-Gymnasiumund dem Allenste<strong>in</strong>er Gymnasiumerfuhr der junge Gymnasiallehrer,dass Professor Erich TrunzOstpreuße und Allenste<strong>in</strong>er war.Bemühungen, Erich Trunz für e<strong>in</strong>eFestveranstaltung aus Anlass der Allenste<strong>in</strong>erWiedersehenstreffen <strong>in</strong>Gelsenkirchen zu gew<strong>in</strong>nen, scheitertenallerd<strong>in</strong>gs. Doch es ergab siche<strong>in</strong>e erfreuliche Begegnung zwischenLehrer und Schüler am 9. März 1982<strong>in</strong> Gelsenkirchen, als Professor ErichTrunz mit dem „Nicolaus-Coppernicus-Preis“ als achter Träger geehrt wurde.Dieser Kulturpreis wurde damalsgeme<strong>in</strong>sam von der Stadt Gelsenkirchenund der Allenste<strong>in</strong>er Stadtgeme<strong>in</strong>schaftverliehen.Es ist bedauerlich, dass diese Ideee<strong>in</strong>er Ehrung für hohe kulturelle undwissenschaftliche Leistungen <strong>in</strong> Gelsenkirchenverlorengegangen ist.Damals, am 9. März 1982, erfolgtedie Verleihung im überfüllten Heimatmuseum„Der Treudank“ <strong>in</strong> Gelsenkirchen.Die Laudatio auf ErichTrunz hielt Professor Dr. Jörn Göresvom Goethe-Institut <strong>in</strong> Düsseldorf.„Der Treudank“ hat später nie mehre<strong>in</strong>esolche Präsenz von bedeutenden32
Erich Trunz (rechts) mit dem Nicolaus-Coppernicus-PreisProm<strong>in</strong>enten aus Politik, Kultur unddem Bereich der Kirchen erlebt. DieE<strong>in</strong>tragung <strong>in</strong>s „Goldene Buch“ derStadt Allenste<strong>in</strong> dokumentiert diesesEreignis.Nach diesem Festakt verg<strong>in</strong>gen wiederumetliche Jahre, bis sich <strong>in</strong> den90er <strong>Jahren</strong> der Schreiber dieserZeilen und se<strong>in</strong> akademischer LehrerErich Trunz <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em regelmäßigenBriefwechsel erneut begegneten.Seit dieser Zeit blieb die brieflicheKommunikation bis zum Ablebendes bedeutenden Literaturwissenschaftlersbestehen. Der letzte Briefan mich ist datiert vom 7. Januar2001. Ich hatte oft „me<strong>in</strong>en Professor“gebeten, Lebenser<strong>in</strong>nerungenzu veröffentlichen; er blieb allerd<strong>in</strong>gssehr zögerlich. Er verwies auf bekanntBiographisches, das vor allemse<strong>in</strong> Schüler Professor Dr. AlfredKelletat bei vielen Anlässen dargestellthat. Ich zitiere darum aus se<strong>in</strong>eman mich gerichteten Brief vom7. Januar 2001: „Da ich nichts Autobiographischesveröffentlichen wollte,habe ich zwei ostpreußische D<strong>in</strong>genur als Manuskript hier. Kelletat hatsie se<strong>in</strong>erzeit gekannt und hat sie <strong>in</strong>dem, was er über mich geschriebenhat, sogar erwähnt. Das e<strong>in</strong>e ist,Ostpreußische Jugender<strong>in</strong>nerungen‘,e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>es Heft, handschriftlichmit Zeichnungen dazu. Das andereist e<strong>in</strong> Schreibmasch<strong>in</strong>en-Manuskriptvon 42 Seiten, ,Er<strong>in</strong>nerungen anTeistimmen‘. Me<strong>in</strong> Jugendfreund v.Schleußner wuchs auf diesem Gutauf, ich war oft dort.“ Fast 96-jährigverstarb Professor Erich Trunz am26. April 2001 <strong>in</strong> der Universitätskli-33
nik <strong>in</strong> Kiel. Die Familie hat mich wissenlassen: „Dort ist er am 26. Aprilstill e<strong>in</strong>geschlafen.“ Beigesetzt wurdeErich Trunz auf dem Zentralfriedhof<strong>in</strong> Münster. Ich, se<strong>in</strong> Schüler, durftemit se<strong>in</strong>er Familie und e<strong>in</strong>igenFreunden ihn auf se<strong>in</strong>em letztenWeg begleiten.E<strong>in</strong> Hochschullehrer kehrte <strong>in</strong> dieStadt zurück, an deren Universität ere<strong>in</strong>ige Jahre wissenschaftliche tätigwar und lehrte.E<strong>in</strong> Ostpreuße wurde e<strong>in</strong> Westfale!E<strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>er fand se<strong>in</strong>e letzte Ruhestätte<strong>in</strong> Münster!In memoriam Erich Trunz.Schillers Glockchevom Max Worgitzk<strong>in</strong>ach dem Gedächtnis aufgeschrieben von Prof. Erich TrunzFestgemauert <strong>in</strong> der Erdensteht sich Form, aus Lehm gebrannt.Wart man – wird sich Glock schon werden,immer fest gespuckt <strong>in</strong> Hand.R<strong>in</strong>nt der Schwitz dem Puckel runter,wird sich Mensch erst richtig munter;viel Geschabber braucht er nicht,wenn er man dem Schnapsche kriegt.Menschlich Leben ohne Glockist wie Pfarrer ohne Rock.Jüngl<strong>in</strong>g sieht sich Mädchen stehn,spricht er: Lieblich anzusehn.Doch der Wahn liegt bald im Dreck,Hochzeitsglocke bläst ihm weg.Wird sich K<strong>in</strong>dchen erst geboren,schlägt der Glock ihm um die Ohren.K<strong>in</strong>dchen schreit bei Wassertaufen;Vater freut sich, kriegt zu saufen.kann er saufen, wie er will –guter Glockche, is er still!Stört ihm nich bei Mitternacht,stört ihm nich, wenn Morgen tagt.Saufen schönster Zeitvertreib –ganz egal, wenn Pfarrer schreit.Also is sich menschlich Lebenganz von Glockenton umgeben:Wenn im Dorfe Feuer ist,oder Mensch wird Spartakist;wegen edle Brüdereihaut dem Schädel ihm entzwei.Wird verrückt selbst Weibstück dann,haut mit Besen eignem Mann.We<strong>in</strong>t sich Mensch, schreit Mensch Hurra,immer is sich Glockche da;und kommt endlich Tod, der Racker,führt ihm Glock zum Gottesacker.Wird der Mensch erst größer nu,schlägt der Glock ihm immerzu.Schlägt <strong>in</strong> frühster Morgenstund:Wirst nu aufstehn, fauler Hund?Mittags freut ihm Glockenton:Komm, der Kumst is fertig schon.Erst wenn er nach dem Tage schwitzt,Mensch vergnügt im Kruge sitzt,Fertig is dem Glockche dannund fängt nu von vorne an.Geht sich <strong>in</strong> Masuren schnellerals bei ollem selgem Scheller.Bloß – wie soll se<strong>in</strong> Name se<strong>in</strong> ?Cuncurdia soll se<strong>in</strong> Name se<strong>in</strong>.Zwar, was is, das weiß ich nicht.Schad nuscht – is sich gut so der Gedicht.Aus.34
H.-J. Wischnewski, e<strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>er mit ProfilSchon am Abend des 24. Februar2005 erfuhr die Öffentlichkeit, dassder bekannte Politiker und ehemaligeBundesm<strong>in</strong>ister Hans-JürgenWischnewski 82-jährig am Nachmittag<strong>in</strong> der Kölner Universitätskl<strong>in</strong>ikverstorben sei. Politiker aller demokratischenParteien setzten <strong>in</strong> ihrenNachrufen dem Menschen mit e<strong>in</strong>erbewunderungswürdigen politischenTatkraft, Hans-Jürgen Wischnewski,e<strong>in</strong> berechtigtes ehrendes Denkmal.Die Allenste<strong>in</strong>er dürfen auf diesengroßen Sohn ihrer Vaterstadt ebenfallsstolz se<strong>in</strong>. Am 24. Juli 1922wurde Hans-Jürgen Wischnewski <strong>in</strong>Allenste<strong>in</strong> geboren. HistorischeMerkwürdigkeit ist, dass der Vaterals Zollbeamter von Gelsenkirchennach Allenste<strong>in</strong> versetzt worden war.Es sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e geheimnisvolle historischeAff<strong>in</strong>ität zwischen Allenste<strong>in</strong>und Gelsenkirchen zu geben: Gelsenkirchenund Allenste<strong>in</strong>/Olsztyn –Stadt e<strong>in</strong>er Patenschaft und zur gegenwärtigenZeit Partnerstädte, wiedie „Vere<strong>in</strong>barung zur partnerschaftlichenZusammenarbeit“ vom 18.September 2004 es dokumentiert.Hans-Jürgen Wischnewski erlebtedie ersten fünf Jahre se<strong>in</strong>er K<strong>in</strong>dheit<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er ostpreußischen Geburtsstadt.Im Jahre 1927 musste dieFamilie nach Berl<strong>in</strong> übersiedeln. Dortbesuchte der Knabe die Volksschuleund der Heranwachsende das Gymnasium.Er konnte noch – allerd<strong>in</strong>gsbereits während des Krieges – imMärz 1941 am Theodor-Körner-Realgymnasium<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> se<strong>in</strong> Abitur machen.Doch danach wurde er – wienahezu alle 18-Jährigen und 19-Jährigen<strong>in</strong> jenen Tagen – zunächst zum„Arbeitsdienst“ und dann zur Wehrmachte<strong>in</strong>gezogen. Der junge Soldatwurde schon früh zur Ostfront abkommandiert.In e<strong>in</strong>em Gespräch im„Bayerischen Rundfunk“ aus demJahre 2002 erzählte er von se<strong>in</strong>emErlebten: „Ich b<strong>in</strong> damals bis zumKaukasus gekommen, und wenn ichheute von den Ause<strong>in</strong>andersetzungendort lese, dann muss ich immerdaran denken, dass ich dort überallbereits gewesen b<strong>in</strong>.“Gegen Ende des Krieges wurdeHans-Jürgen Wischnewski Oberleutnantbei den Panzergrenadierenund damit blutjung zu e<strong>in</strong>em verantwortlichenKompaniechef. Bei Kriegsendegeriet er <strong>in</strong> amerikanische Gefangenschaft.Nach e<strong>in</strong>er kurzen Zeitdort wurde er nach Niederbayernverschlagen. Dort war er zunächstMetallarbeiter. Dabei wurde se<strong>in</strong> politischesInteresse früh geweckt: als35
Mitglied der Gewerkschaft IG Metallund seit August 1946 als Mitgliedder SPD. E<strong>in</strong>e Ausbildung zum Gewerkschaftssekretärbegann er 1952;dadurch kam er nach Köln. Somitwurde Köln se<strong>in</strong>e neue Heimat, derer bis zu se<strong>in</strong>em Tode treu gebliebenist. Als er 1957 <strong>Vor</strong>sitzender derKölner SPD wurde, war der politischeWeg vorgezeichnet. Im Jahre1957 – noch <strong>in</strong> der Adenauer-Ära –wurde er Mitglied des DeutschenBundestages. Bis zu se<strong>in</strong>em Abschied1990 blieb er dann bei vielenFragen und Problemen 33 Jahrebewegender Abgeordneter <strong>in</strong> demlegislativen Gremium unserer demokratischenStaatsordnung. ZahlreicheAufgaben und Positionen übernahmer verantwortlich und waranerkannter politischer Sachkenner<strong>in</strong> vielen Bereichen.In den Ländern des „Nahen Ostens“und <strong>in</strong> Algerien konnte er sich <strong>in</strong> gefährlichenund dramatischen Konfliktfällene<strong>in</strong>e anerkennende Autoritäterwerben; vielen bedeutendenPersönlichkeiten im Ausland wurdeer dadurch sogar zum Freund. Unterse<strong>in</strong>em liebevoll geme<strong>in</strong>ten Spitznamen„Ben Wisch“ war er <strong>in</strong> der Weltfast bekannter als mit se<strong>in</strong>em NamenHans-Jürgen Wischnewski. Se<strong>in</strong>egrößte menschliche und politischeLeistung vollbrachte er jedoch, als ermit Hilfe der „GSG-9“ unter demKommando des Oberst Wegener dieGeiseln aus der von Terroristen entführtenLufthansa-Masch<strong>in</strong>e „Landshut“im Oktober 1977 im somalischenMogadischu befreien konnte.In dem bereits erwähnten Interviewerzählte Hans-Jürgen Wischnewskivon diesen dramatischen M<strong>in</strong>utender Erstürmung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er überzeugendentiefen Weise, die fern ist vondem zuweilen nichtssagenden Geplappervieler Politiker: „Als derSturm dann aber begann, b<strong>in</strong> ich <strong>in</strong>e<strong>in</strong>e Ecke gegangen, <strong>in</strong> der michniemand sehen konnte, und habegebetet.“Über se<strong>in</strong> Leben bestimmende erzieherischeKräfte hat Hans-JürgenWischnewski selbst berichtet: „Me<strong>in</strong>Elternhaus war preußisch-protestantisch.In der Nazi-Zeit war me<strong>in</strong>eMutter <strong>in</strong> der ,Bekennenden Kirche‘aktiv. Zum Jahresprogramm gehörteaber auch jedes Jahr der Besuch <strong>in</strong>Sanssouci bei Friedrich dem Großen.Wir waren also schon e<strong>in</strong>e ausgeprägtpreußische Familie. Wobei diePreußen natürlich nicht nur Schlechtestaten, sondern auch sehr vielGutes geleistet haben. Sie warengroßzügig bei der Aufnahme vonFremden, wenn man zum Beispielan die Hugenotten denkt, Namenwie de Maizière oder andere. Dashat das Leben <strong>in</strong> unserer Familie <strong>in</strong>sehr starkem Maße bestimmt, und <strong>in</strong>dieser H<strong>in</strong>sicht b<strong>in</strong> ich auch erzogenworden. Ich hatte e<strong>in</strong> politisches Elternhaus,das freilich preußisch geprägtwar. Ich wollte damals <strong>in</strong>s,Jungvolk‘ e<strong>in</strong>treten, aber me<strong>in</strong> Vaterhat gesagt, dass das überhauptnicht <strong>in</strong> Frage käme. Später mussteich aber e<strong>in</strong>treten; denn das ist dannja zur Staatsjugend geworden. Ichmache auch gar ke<strong>in</strong> Hehl daraus,dass es sogar Spaß gemacht hat.Darauf haben sich die Nazis tatsächlichverstanden: Wir machten Fahrten,hatten Zeltlager usw. Welcherjunge Mensch macht das nicht gerne,wie ich ganz offen sagen muss?Das hat mir jedenfalls gefallen, undes wäre unredlich, wenn ich sagen36
würde, dass das ganz schrecklichgewesen wäre. Ich b<strong>in</strong> aber auch jedenSonntag zum K<strong>in</strong>dergottesdienstgegangen; denn me<strong>in</strong>e Familiewar ja auch sehr protestantisch.“In Fülle könnten lobende und ehrendeWorte, die wir nach dem Ablebenvon „Ben-Wisch“ gelesen und <strong>in</strong>Deutschland und <strong>in</strong> der Welt gehörthaben, zitiert werden. Auch Ehrungenund Verleihungen könnten die Wertschätzunghervorheben. Vielleichtwird aber die Er<strong>in</strong>nerung lebendigererhalten, wenn nur e<strong>in</strong>ige bedeutendeAuszeichnungen genannt werden.Im Jahre 1999 wurde Hans-JürgenWischnewski Ehrenbürger der StadtBethlehem. Und Georg Hermanowski– auch e<strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>er – hat<strong>in</strong> se<strong>in</strong>em „Ostpreußen-Lexikon“, das<strong>in</strong> der ersten Auflage im Adam KraftVerlag Mannheim 1980 erschienenist, <strong>in</strong> dem letzten Satz des lexikalischenArtikels über Hans-JürgenWischnewski <strong>in</strong> bewundernswürdigerWeise geschrieben: „Nachdrücklichbekennt er sich zu dem preußischenGrundsatz „Ich diene“.Von Hans-Jürgen WischnewskisPublikationen sollte genannt werden:„Reden über das eigene Land:Deutschland“, München 1989, Bertelsmann-Verlag.Beigesetzt wurde Hans-JürgenWischnewski auf dem Kölner Melaten-Friedhofan der Seite se<strong>in</strong>er FrauGika.Kurt DzikusDie LadungIm Rechtsstreit Kalweit gegen Grzankam‘s auf die Zeug<strong>in</strong> Tolksdorf an.Trotz Ladung zum Beweisterm<strong>in</strong>die Zeug<strong>in</strong> aber nicht erschien.Der Richter dacht‘ schon voll Verdrussan e<strong>in</strong>en Ordnungsgeldbeschluss,als er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Aktenbanddann doch noch dieses Schreiben fand:„Verehrtes hohes Amtsgericht!Ich komme zum Term<strong>in</strong>e nicht.Ich komme vielmehr demnächst nieder.Doch melde ich mich danach wieder.In fünf, sechs Wochen ist’s soweit.Ich gebe, wie gesagt, Bescheid.“Der Richter hat drauf für acht Wochenden Rechtsstreit erst mal unterbrochen.Doch noch vor Ablauf dieser Fristdies Schreiben e<strong>in</strong>gegangen ist:„Verehrtes hohes Amtsgericht!E<strong>in</strong> Junge ist’s, sechs Pfund Gewicht.Ich fühle frei mich von Beschwerdenund kann jetzt neu geladen werden.“Der Richter lächelt drob verschmitzt.Zum Ref’rendar, der bei ihm sitzt,reicht er die Akten vis-à-vis:„Das, Herr Kollege, machen Sie!“Ernst Jahnke37
Die bekennende Evangelische Kirchengeme<strong>in</strong>de<strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> 1933-1945Der Beg<strong>in</strong>n des Kirchenkampfes <strong>in</strong> der Evangelischen Kirche der AltpreußischenUnion und <strong>in</strong>nerhalb der Ostpreußischen Prov<strong>in</strong>zialkirche1933/34Von Pfarrer i.R. Wolfgang F<strong>in</strong>gerWenn Hitler <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Rede vom23.3.1933 die sittliche Bedeutungder beiden christlichen Konfessionenfür das Volksleben betont und imSommer e<strong>in</strong>e Kirchene<strong>in</strong>trittsbewegungmit Massentrauungen von Mitgliedernder NSDAP und Taufen ihrerK<strong>in</strong>der <strong>in</strong>szeniert hatte, dannkonnte Super<strong>in</strong>tendent Wedemannbetroffen fragen: „Wer wollte es daverantworten, die Kirchentüren vorden Massen des Volkes zu verschließen?“(Ernst Wedemann: Lebenser<strong>in</strong>nerungen,unveröffentlicht,S. 204). Doch bei den nun mit atemberaubendemTempo erfolgendenweiteren Maßnahmen der NSDAPstellten sich die anfänglichen AussagenHitlers als e<strong>in</strong>e bewußte Täuschungheraus. Se<strong>in</strong> Ziel war „e<strong>in</strong>Reichskonkordat für die deutschenKatholiken und e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitlicheReichskirche für die Protestanten,um damit die beiden großen Kirchenje auf ihre Weise mit dem DrittenReich zu verb<strong>in</strong>den und alle oppositionellenAnsätze von dieser Seiteauszuschalten.“ (Klaus Scholder: DieKirchen und das Dritte Reich, S. 11).Und „bald ließ der Löwe, der zunächstmit Samtpfoten aufgetretenwar, se<strong>in</strong>e Krallen spüren“ (Wedemann,a.a.O.): So wurden dieReichskirchenwahlen vom 23. Juli1933 durch den massiven E<strong>in</strong>satzder Partei für die sog. „DeutschenChristen“, e<strong>in</strong>er ihrer zahlreichenNebenorganisationen, zu e<strong>in</strong>em großenErfolg für diese. Darüber h<strong>in</strong>auswar der am 26. Mai 1933 geradezum Reichsbischof gewählte BethelerPastor, Fritz von Bodelschw<strong>in</strong>gh,wegen angeblicher politischer Unzuverlässigkeitzum Rücktritt gezwungenund auf der Nationalsynode derDeutschen Evangelischen Kirche (DEK)am 27. September 1933 durchLudwig Müller, vorher Wehrkreispfarrer<strong>in</strong> Königsberg und glühender VerehrerHitlers, ersetzt worden. Ähnlichesereignete sich <strong>in</strong> Königsberg, wo derGeneralsuper<strong>in</strong>tendent der Ostpr.Prov<strong>in</strong>zialkirche, Dr. Gennrich, amtsenthobenund der <strong>in</strong> Ostpreußenvöllig unbekannte – zuweilen gewalttätige– Nationalsozialist Fritz Kesselam 5. Oktober 1933 zum Bischofvon Königsberg ernannt wordenwar.Freilich formierte sich auch die bekennendeOpposition <strong>in</strong>nerhalb derEvangelischen Kirche auf verschiedenenEbenen. <strong>Vor</strong> allem hatte dasmutige Verhalten der Gruppe „Evangeliumund Kirche“, zu der auch derBerl<strong>in</strong>er Pfarrer Mart<strong>in</strong> Niemöller gehörte,auf der preußischen Generalsynodevom 5./6. September 1933<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> Signalwirkung auch aufOstpreußen gehabt. Die E<strong>in</strong>führung38
der „politischen Zuverlässigkeitsklausel“und des „Arierparagra-phen“ <strong>in</strong>die kirchliche Gesetzgebung wurdevon ihr als Versuch, Staat und Kirche„gleichzuschalten“, strikt abgelehnt,ehe sie die Tagung der sog. „braunenSynode“ aus Protest geschlossenverließ. Durch dieses Ereignisund die anschließende Gründungdes Pfarrernotbundes hatte der Kirchenkampfund die Sammlung bekennenderGeme<strong>in</strong>den zur BekennendenKirche (B.K.) im Gegensatzzu den Deutschen Christen (D.C.) <strong>in</strong>Preußen begonnen. Um Letzteres zuverh<strong>in</strong>dern, reagierte die neue D.C.-Kirchenleitung <strong>in</strong> Ostpreußen mitBeg<strong>in</strong>n des Jahres 1934 darauf mitVerhaftungen, Amtsenthebungen undZwangsversetzungen bekenntnistreuerPfarrer und Super<strong>in</strong>tendenten. Sowurde der spätere Allenste<strong>in</strong>er Super<strong>in</strong>tendentFritz Rzadtki, geradenach sechs Wochen Haft im KonzentrationslagerSonnenburg <strong>in</strong> se<strong>in</strong>eGeme<strong>in</strong>de Schneidemühl zurückgekehrt,nach Turoscheln (Masuren)strafversetzt. Der Pfarrernotbundaber hatte durch <strong>Vor</strong>träge <strong>in</strong> denGeme<strong>in</strong>den, auch <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>, mitAufklärung und Werbung für die B.K.begonnen. Zur gleichen Zeit wurde„Der Mythos des 20. Jahrhunderts“,e<strong>in</strong>e antichristliche neuheidnischePropagandaschrift auf rassistischerGrundlage, <strong>in</strong> die breite Öffentlichkeitgebracht. Alfred Rosenberg warder Verfasser und als Chefideologeder NSDAP mit der Überwachungder gesamten geistigen und weltanschaulichenSchulung der Parteiund der ihr gleichgeschalteten Verbände,e<strong>in</strong>schl. der Deutschen Christen,am 24. Januar 1934 beauftragtworden.Demgegenüber wurde die Synodeder Bekennenden Kirche <strong>in</strong> Barmen(29.-31. Mai 1934) das herausragendehistorische Ereignis des begonnenenKirchenkampfes! Ihre Bedeutungliegt vor allem <strong>in</strong> derTheologischen Erklärung zur gegenwärtigenLage der DeutschenEvangelischen Kirche! (vgl. AHBWeihnachten 2004, S. 20). Ihre situationsbezogenenAussagen zur Bibelund den reformatorischen Bekenntnissenwaren glaubensstärkendund richtungweisend für denE<strong>in</strong>zelnen und für die Geme<strong>in</strong>schaftbekennender Geme<strong>in</strong>den im weiterenVerlauf des Kirchenkampfes gegendie Ideologie und den Terror derNationalsozialisten und ihrer „DeutschenChristen“.Super<strong>in</strong>tendent WedemannAuch zwischen Ernst Wedemann,dem über Allenste<strong>in</strong> h<strong>in</strong>aus hoch geachtetenSuper<strong>in</strong>tendenten des ermländischenKirchenkreises Allenste<strong>in</strong>39
und dem gerade für Ostpreußene<strong>in</strong>gesetzten D.C.-Bischof Fritz Kesselkam es bald zu tiefgreifendenMe<strong>in</strong>ungsverschiedenheiten. Dies erläutertWedemann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Schreibenvom 8. November 1934 an dasKonsistorium <strong>in</strong> Königsberg so: „DasReichskirchenregiment hat seit Juli1933 Gewalt und Willkürherrschaftaufgerichtet. Ich b<strong>in</strong> zum Super<strong>in</strong>tendentenberufen worden von e<strong>in</strong>erKirchenbehörde, die bewußt aufdem Boden der Heiligen Schrift desAlten und des Neuen Testamentsund der Bekenntnisse der EvangelischenKirche stand. Das jetzt bestehendeKirchenregiment habe bewiesen,daß es diesen Boden verlassenhabe. Ich könne es daher nicht mehrals die Behörde anerkennen, der ichGehorsam schuldig sei. Die Antwort,die ich aus Berl<strong>in</strong> zu erwarten hatte,konnte nur <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er Absetzung besetzen.Da fügte sich’s so wunderbar,daß gerade <strong>in</strong> diesen Tagen dasunparteiische Gutachten e<strong>in</strong>es vomStaat berufenen Juristen erschien,daß alle Gesetze, Verordnungen undVerfügungen, die der Reichsbischoferlassen hatte, rechtsungültig seienund daß dadurch die Kirchenleitungenvon Reichsbischof Müllers Gnadendas Recht zum Bestehen verlorenhatten.“ (Wedemann, a.a.O., S.205 f.). Folglich unterblieb auch dieAbsetzung von Super<strong>in</strong>tendent Wedemann,wenngleich sich der Druckdes NS-Staates auf die Vertreter derKirchen und auf das Geme<strong>in</strong>deleben<strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> ständig erhöhte.Ungeachtet dieser ganz realen Bedrohungenevangelischer Geistlicherdurch die Nationalsozialisten hattesich am 29. Oktober 1934 die ostpreußischeBekenntnissynode gebildet,zu der Pfarrer und Geme<strong>in</strong>degliedergehörten, ebenfalls derostpreußische Bruderrat. Zu diesenneuen kirchenleitenden Gremien derBekennenden Kirche und zu führendenPersönlichkeiten wie PfarrerMart<strong>in</strong> Niemöller u.a. hatte die„Kirchliche Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft“ <strong>in</strong>Allenste<strong>in</strong> durch LandgerichtsratKramer und Kaufmann Reizuch Verb<strong>in</strong>dungaufgenommen. Beide Männerwaren engagierte Glieder derKirchengeme<strong>in</strong>de und gehörtenschon lange vor 1933 dem „Bekennerbundder Kirche“, e<strong>in</strong>er Gruppebewußt christlicher Laien Südostpreußensim Gegensatz zu den zahlreichen„völkischen“ Bewegungenjener unruhigen Zeit nach dem ErstenWeltkrieg an.Pfarrer Wilhelm F<strong>in</strong>gergeb. 12.12.1881 <strong>in</strong> Johannisburg/Ostpr.gest. 9.10.1958 <strong>in</strong> HildesheimGeme<strong>in</strong>depfarrer <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> vom1. Advent 1925 bis 21.1.194540
Geme<strong>in</strong>sam mit Super<strong>in</strong>tendentWedemann, Pfarrer F<strong>in</strong>ger und PfarrerSchwede ergriffen sie die Initiativezur Bildung e<strong>in</strong>es vorläufigen Bruderratesund e<strong>in</strong>er Großveranstaltungder B.K. Dazu mieteten sie für den25. November 1934 den größten öffentlichenVersammlungsraum, denes <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> gab. LandgerichtsratKramer schrieb am 27. März 1935darüber an Pfarrer Niemöller: „Nachdemuns e<strong>in</strong>e Versammlung politischverboten war, zogen wir <strong>in</strong> die Pfarrkirche,die bis auf den letzten Platzgefüllt war. Danach hat die Mitgliederzahl,anhand der ausgegebenen„Roten Mitgliedskarten“, die 1000überschritten und die Geme<strong>in</strong>de istwach und lebendig . . . Die DeutschenChristen, die zunächst dieOberhand hatten, führen e<strong>in</strong> kümmerlichesSchattendase<strong>in</strong>“ (vgl. HugoL<strong>in</strong>k: Der Kirchenkampf <strong>in</strong> Ostpreußen,S. 34).Diese überwältigende „Parte<strong>in</strong>ahme“für die Sache des Evangeliumskonnte die evangelischen Christen <strong>in</strong>Allenste<strong>in</strong> leider nur für kurze Zeit mitFreude erfüllen; denn die Gestapo –e<strong>in</strong>e durch den NS-Staat neugeschaffenePolizeie<strong>in</strong>heit – ließ mit ihremgezielten Terror gegen Geme<strong>in</strong>degliederund Pfarrer nicht lange aufsich warten: So wurde Landgerichtsrat„Kramer se<strong>in</strong>es Amtes enthoben,war e<strong>in</strong>dreiviertel Jahre ohne Gehalt,kam aber durch se<strong>in</strong>en Bruder, denJägermeister, der sich bei Gör<strong>in</strong>g fürihn e<strong>in</strong>gesetzt hatte, wieder <strong>in</strong> se<strong>in</strong>Amt. Kaufmann Reizuch, der Leiterder Landeskirchlichen Geme<strong>in</strong>schaft,wurde geschäftlich geschädigt,durfte ke<strong>in</strong>e Lehrl<strong>in</strong>ge e<strong>in</strong>stellenund von der Partei diffamiert.“ (vgl.H. L<strong>in</strong>k, a.a.O., S. 94 f.). Ähnlich erg<strong>in</strong>ges Regierungsober<strong>in</strong>spektorKranzhöfer und Telegraphen-Ober<strong>in</strong>spektorFidorra. Als Mitglieder des„Ostpreußischen Gebetsvere<strong>in</strong>s“ undder Bekennenden Kirche mußten siesich von der Gestapo beobachtenund verhören lassen. Ganz nüchternund e<strong>in</strong>deutig beurteilt Super<strong>in</strong>tendentWedemann die damalige Situationder Evang. Kirche <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> unddarüber h<strong>in</strong>aus, wenn er schreibt:„Allenste<strong>in</strong> stand bei dieser neuenGestaltung der D<strong>in</strong>ge nach wie vorzur B.K., was den Glaubensgrundund die Amtsführung anbetraf. Esbegann der Kirchenkampf, e<strong>in</strong>e Bewegung,die als Waffen nur das WortGottes, e<strong>in</strong> unerschütterliches Bekenntniszum Evangelium und Leidensbereitschafthatte.“ (We., S. 205).Ja, Leidensbereitschaft und Zivilcourages<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Folgezeit die starkenTugenden gewesen, die Geme<strong>in</strong>degliederund Pfarrer gegenüber Vertreterndes NS-Staates gezeigt haben.Denn es wurden oft stundenlangeHausdurchsuchungen <strong>in</strong> den dreiPfarrwohnungen durchgeführt, umfestzustellen, ob Schriften der B.K.gelesen und zur Verteilung aufbewahrtwurden. Das waren Methoden,die die ganze Pfarrfamilie <strong>in</strong>Angst und Schrecken versetzt haben.Immer mehr Pfarrer, Hilfspredigerund Vikare der ostpreußischen BekennendenKirche wurden mit Redeverbot,Amtsenthebung oder Haftbestraft. Von heute auf morgenstanden sie und ihre Familien mittellosda. Also wurden Kollekten für dieBetroffenen gesammelt, obwohl dasReichsgericht diese rechtswirksamverboten hatte. „Nach e<strong>in</strong>er Razziaauf verbotene Kollektengelder saß41
e<strong>in</strong>e größere Anzahl von Pfarrernund Super<strong>in</strong>tendenten im Allenste<strong>in</strong>erGefängnis. Gendarmen mußtensie e<strong>in</strong>liefern. Ich selber und PfarrerF<strong>in</strong>ger wurden <strong>in</strong> diesem Zusammenhangvon der Gestapo festgenommenmit der Beschuldigung, fürdie Bekennende Kirche gesammeltzu haben. Wir hatten Gelder, die aufdem Altar niedergelegt waren, zurUnterstützung der Bekennenden Kirchenach Hause genommen, um siean ihren Bestimmungsort abzuführen.Wir wurden verhaftet und demGericht überwiesen. Wir befandenuns also im Anklagezustand. DerRichter ließ uns frei nach sechsstündigerHaft. Wir wurden verurteilt, 400RM Strafe zu zahlen. Nach e<strong>in</strong>igerZeit wurden wir durch e<strong>in</strong>e Amnestievon dieser Strafe befreit.“ (We., S.206 f.). Beide Geistliche galten aberals vorbestraft. Welch e<strong>in</strong>e Behandlungdieser unbescholtenen, ehrsamenPersönlichkeiten unserer Heimatstadt!(wird fortgesetzt)Der SommerWeißt du, wie der Sommer riecht?Nach Birnen und nach Nelken,nach Äpfeln und Vergissme<strong>in</strong>nicht,die <strong>in</strong> der Sonne welken,nach heißem Sand und kühler Seeund nassen Badehosen,nach Wasserball und Sonnenkrem,nach Straßenstaub und Rosen.Weißt du, wie der Sommer schmeckt?Nach gelben Aprikosenund Walderdbeeren, halb verstecktzwischen Gras und Moosen,nach Himbeereis, Vanilleeisund Eis aus Schokolade,nach Sauerklee vom Wiesenrandund Brauselimonade.Weißt du, wie der Sommer kl<strong>in</strong>gt?Nach Vogelweise,die durch die Mittagsstille dr<strong>in</strong>gt:E<strong>in</strong>e Lerche zwitschert leise,dumpf fällt e<strong>in</strong> Apfel <strong>in</strong> das Gras,der W<strong>in</strong>d rauscht <strong>in</strong> den Bäumen.E<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d lacht hell,dann schweigt es schnellund möchte lieber träumen.42
Die Marjell mit dem Mediz<strong>in</strong>ballvon Hans-Ulrich StammMit Ostpreußen verhält es sich e<strong>in</strong>wenig wie mit dem amerikanischenBundesstaat Texas: An beiden Stellender Erde gibt es nach Me<strong>in</strong>ungder Ostpreußen wie der Texaner e<strong>in</strong>eReihe von D<strong>in</strong>gen, die größer oderschöner s<strong>in</strong>d als anderswo – odergar beides. In manchen Fällen magdas e<strong>in</strong>e liebenswürdige Übertreibungse<strong>in</strong>, doch vom ostpreußischenSommer läßt sich mit Gewißheitsagen, daß er tatsächlich meistschöner war als anderenorts. Werkönnte zum Beispiel e<strong>in</strong>en Sommeran der Samlandküste aus se<strong>in</strong>emGedächtnis streichen mit Tagen, andenen die Sonne fast während ihresganzen Laufes senkrecht über demLand zu stehen schien. E<strong>in</strong>e Sonnevon nahezu unwirklicher Intensität,wie man sie <strong>in</strong> diesen nördlichenBreiten nie vermutet hätte. E<strong>in</strong>e Sonne,die förmlich greifbar wurde, wennman aus dem Schatten des Waldesoder der Gärten h<strong>in</strong>austrat an denfreien, breiten Strand – und schmerzhaftspürbar, wenn man sich dortvoreilig die Schule auszog.E<strong>in</strong> solcher Sommer war es auch, <strong>in</strong>dem Hans der Marjell mit dem Mediz<strong>in</strong>ballzum erstenmal begegnete. Eswar bereits der dritte Sommer desletzten Krieges, aber am Strand vonRauschen merkte man doch nichtviel davon. Noch stand die Sonnehoch und warf ihr südliches Licht aufLand und Menschen – auf vorwiegendältere allerd<strong>in</strong>gs und wenigerjunge im Gegensatz zu vergangenen<strong>Jahren</strong>. Daß Hans und Günter mit ihrensiebzehn <strong>Jahren</strong> noch unter derkle<strong>in</strong>er gewordenen Zahl der Jungenwaren, verdankten sie <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>iedem Umstand, daß sie zu spät damitbegonnen hatten, ihre Geisteskräfteanzustrengen und <strong>in</strong>folgedessendas Klassenziel nicht erreichthatten. Die Eltern, vor wenigen <strong>Jahren</strong>mit Sicherheit noch ob solchen Anlassesvergrämt, hatten es h<strong>in</strong>gehenlassen, blieben ihnen die Söhne aufdiese Weise doch noch e<strong>in</strong> Jahr erhalten.Ohne Standpauke und dasAndrohen täglicher late<strong>in</strong>ischer undmathematischer Ferien waren dieKoffer gepackt worden.Nun also lagen sie da im weißen Sandoder vielmehr auf ihren Bademänteln,denn der Sand war zu heiß, undsangen das Lob der Faulheit. Mitgeschlossenen Augen und Lippennatürlich. Bis . . .„Aua!“ brüllte Hans plötzlich. Mit beidenHänden griff er <strong>in</strong> die Magengegend,wuchtete e<strong>in</strong> unförmigesbraunes Etwas von se<strong>in</strong>em Bauchund feuerte es bl<strong>in</strong>dl<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> die Gegend,um dann mit ungewohnterEnergie aufzuspr<strong>in</strong>gen und gleichdarauf <strong>in</strong> e<strong>in</strong> neues Gebrüll zu verfallen,weil se<strong>in</strong> Fuß dem heißen Sandzu nahe gekommen war.Zornfunkelnd spähte er umher. Se<strong>in</strong>Blick fiel auf zwei Mädchen, die gemächlichheranschlenderten. Siemochten im gleichen Alter se<strong>in</strong> wieer und se<strong>in</strong> Freund, der nur müdedie Augen geöffnet hatte, ohne dieKörperhaltung auch nur zu verändern.Die vordere, rank und schlank,43
hatte dunkles Haar, das <strong>in</strong> der Sonnerötlich schimmerte, und trug e<strong>in</strong>enzweiteiligen roten Badeanzug, wieman den Bik<strong>in</strong>i damals noch schlichtnannte, über dunkelbraun gebrannterHaut. In ihren grünen Augen sprühtengoldene Fünkchen, als sie halbspöttisch fragte: „Hat’s weh getan?– War aber nicht so geme<strong>in</strong>t.“Sie war offensichtlich die Werfer<strong>in</strong>,denn ihre Freund<strong>in</strong>, etwas wenigerhübsch und wohl auch sonst etwaszurückhaltender, blieb im H<strong>in</strong>tergrund.„Hör mal“, brummte Hans, „ist dasvielleicht 'ne Art, e<strong>in</strong>en armen Menschenbei e<strong>in</strong>er friedlichen Beschäftigungzu stören? Das grenzt ja fastan Wehrkraftzersetzung."„Nun hab dich man nicht“, lachte dieGrünäugige, „aber wenn du Lusthast: heute Abend zwischen achtund neun im Lärchenpark beim Kurkonzert– l<strong>in</strong>ks vom Pavillon. E<strong>in</strong>verstanden?“ Hans griff nach derschmalen, aber kräftigen braunenHand, die sich ihm entgegenstreckte.„E<strong>in</strong>verstanden“, sagte er versöhnlich.Und mit Selbstüberw<strong>in</strong>dungbrachte er es sogar fertig, mitbloßen Füßen über den Sand zu gehenund den Mediz<strong>in</strong>ball aufzuheben,den ihm das Mädchen mit dengrünen Augen auf den Bauch geschleuderthatte. Er konnte sich jaschließlich nicht blamieren.„Danke“, lachte sie und deutete e<strong>in</strong>enKnicks an, ehe sie auf langenBe<strong>in</strong>en über den Sand zurückspurtete<strong>in</strong> Richtung auf „Gandhi“, denweißhaarigen Gymnastiklehrer, deram Strand für sportliche Betätigungder darauf erpichten Badegästesorgte.Etwas argwöhnisch betrachtete dieMutter an diesem Abend die <strong>Vor</strong>bereitungenihres Sohnes, der sich derHitze zum Trotz <strong>in</strong> se<strong>in</strong> bestes Jackettwarf, sogar e<strong>in</strong>en Schlips umband,was ihm verhältnismäßig zuwiderwar, und am Ende auch nochzum Kamm griff. „Gehst du mit unszusammen?“ fragte sie. „Nee“,murmelte der Sprößl<strong>in</strong>g gedankenversunken,was dem Vater e<strong>in</strong> heimlichesLächeln entlockte.Pünktlich um acht Uhr erschienHans im Lärchenpark, steuerte dieMusikmuschel an, <strong>in</strong> der e<strong>in</strong> Mar<strong>in</strong>e-Musikkorps konzertierte, und begannwürdevoll auf und ab zu promenierenund sche<strong>in</strong>bar unauffälligdie Umstehenden zu fixieren. Aberweder er noch Freund Günter vermochtendie Grünäugige oder derenFreund<strong>in</strong> zu erspähen.„Dussel“, brummelte Günter, „hättestdu dir doch wenigstens denNamen sagen lassen.“„Du hast gut reden“, gab Hans zurück,„du hast ja mit der anderenüberhaupt ke<strong>in</strong> Wort gewechselt.“„Mmmm . . .“E<strong>in</strong>silbig traten sie den Heimweg an.Auch Rückfragen bei Gandhi führtenzu nichts. Gewiß, er entsann sichder beiden jungen Damen, wußteauch, daß sie vor e<strong>in</strong>er Woche gekommenwaren und eigentlich dreiWochen hatten bleiben wollen, abermehr konnte er nicht sagen, schongar nicht die Namen, leider . . .Für Hans war es direkt e<strong>in</strong>e Erlösung,als die Ferien vorbei warenund es nach Königsberg zurückg<strong>in</strong>g.„Suchst du noch immer die Marjellmit dem Mediz<strong>in</strong>ball?“ neckte ihn derFreund.44
Die Antwort konnte alles heißen. Jedenfallsbegann Hans e<strong>in</strong>e verhältnismäßigemsige Tätigkeit zu entfalten.Fast jeden Nachmittag erschiener im Schülerrudervere<strong>in</strong>, um Umschauunter dessen weiblichen Mitgliedernzu halten, hielt um die Zeitdes Schulschlusses die Mädchenschulender Nachbarschaft abwechselndunter Kontrolle – ohne Erfolg.E<strong>in</strong>mal, im November, glaubte er siebei e<strong>in</strong>em Ballettabend <strong>in</strong> der Garderobewiederzuerkennen, aber ehe ersich Gewißheit verschaffen konnte,war sie <strong>in</strong> der Dunkelheit verschwunden,die mutmaßliche Marjell mitdem Mediz<strong>in</strong>ball.E<strong>in</strong> paar Monate später war HansSoldat, kam nach Holland zur Ausbildung,dann nach Belgien, zurücknach Deutschland, wiederum <strong>in</strong> denWesten und dann von heute aufmorgen <strong>in</strong> den Osten, wo der großeBrand bis an die Grenzen Ostpreußensvorgedrungen war. Zweimalgab es für ihn Urlaub <strong>in</strong> dieser Zeit,und jedesmal ließ er den Blick durchdie – beim zweiten Besuch schonzerbombte – Vaterstadt streifen mitder stillen Hoffnung, irgendwo dochnoch die Marjell mit dem Mediz<strong>in</strong>ballwiederzuf<strong>in</strong>den. Dabei war er sich<strong>in</strong>sgeheim klar darüber, daß er ja garnicht e<strong>in</strong>mal wußte, ob sie wirklichaus Königsberg war. Der Sprachenach hätte er freilich darauf wettenmögen. Warum er sie unbed<strong>in</strong>gtwiedersehen wollte, wußte er dagegenziemlich genau: der grünen Augenmit den goldenen Pünktchenwegen, mit denen sie ihn damals sospitzbübisch angeblitzt hatte: „Nunhab dich man nicht so . . .“Hans war mittlerweile Fahnenjunker-Unteroffizier geworden, als er kurzvor dem letzten Kriegsweihnachtenim Goldaper Grenzgebiet verwundetwurde – an ziemlich unpassenderStelle und bei unpassender Gelegenheit.Se<strong>in</strong> Kompaniechef hatte ihnselbst zum Hauptverbandsplatz gefahrenund dann dafür gesorgt, daßer nach der Operation zu e<strong>in</strong>emKrankentransportzug befördert wurde,der ihn <strong>in</strong> e<strong>in</strong> rückwärtiges Lazarettbr<strong>in</strong>gen sollte. Nach der ärztlichenVersorgung wartete zum erstenmalseit Monaten wieder e<strong>in</strong> weißes Bettauf Hans, ungewiegt schlief er e<strong>in</strong>.E<strong>in</strong>e Frauenhand rüttelte ihn amnächsten Morgen wach. Als Hansdie Augen öffnete, warf er e<strong>in</strong>en zunächstnoch halb verschlafenen,dann ziemlich ungläubigen Blick aufdie neben ihm stehende Schwester,um dann sofort wieder die Lider zuschließen.Das darf nicht wahr se<strong>in</strong>, dachte er,die grünen Augen mit den goldenenPünktchen! Da stellt man e<strong>in</strong>e halbeStadt auf den Kopf, zerbricht sichden eigenen Schädel durch halb Europaund dann das – und bei solcherGelegenheit . . .„Nur Fieber messen“, sagte dieSchwesternstimme, „nun haben Siesich man nicht so!“„Das habe ich schon mal von Ihnengehört, me<strong>in</strong> Fräule<strong>in</strong>“, sagte Hans.„Unmöglich. – Sie s<strong>in</strong>d doch gesternAbend erst gekommen, Herr“ – ihrBlick suchte nach der Tafel amKopfende – „Herr Erckens“.„Stimmt“, erwiderte der Patient mitnoch immer geschlossenen Augen.„Aber diesmal ist es ke<strong>in</strong> Mediz<strong>in</strong>ball,sondern e<strong>in</strong> Granatwerfersplitter,und auch nicht der Bauch, sonderndas Gegenteil. Und wenn ich fragendarf, gibt es hier vielleicht e<strong>in</strong>en Lär-45
chenpark? Und darf ich auch um IhrenNamen bitten?“„Ach du grieses Katzchen“, schlugsie <strong>in</strong> komischem Entsetzen dieHände zusammen. Mit verhaltenerStimme erzählte sie, warum sie anjenem Abend nicht erschienen war:Als sie vom Strand kam, hatte ihreMutter gerade die Nachricht erhalten,daß der Vater im Osten gefallenwar. Noch am gleichen Nachmittagwaren sie zurückgefahren samt derKus<strong>in</strong>e, die sie an jenem Tag amStrand begleitet hatte, so daß ke<strong>in</strong>eMöglichkeit mehr bestanden hatte,irgendwo e<strong>in</strong>e Nachricht zu h<strong>in</strong>terlassen.Und Gertie, wie Grünaugehieß, war bald danach Schwesternhelfer<strong>in</strong>geworden.„Für mich bleibst du die Marjell mitdem Mediz<strong>in</strong>ball“, sagte Hans. „Unddiesmal gibst du mir um Himmelswillen e<strong>in</strong>e Adresse, an die ichschreiben kann, wenn irgend etwasschief gehen sollte. Verwandtschaftim Reich, wenn es geht. Es sieht jaso aus . . .“ Er brach ab.„Morgen früh br<strong>in</strong>ge ich sie dir mit“,versprach Gertie, „ich muß jetzt weiter.“Sie hauchte ihm e<strong>in</strong>e Kußhandzu und verließ das kle<strong>in</strong>e Krankenzimmer.Es gab ke<strong>in</strong> morgen früh. Noch <strong>in</strong>der Nacht mußte das Lazarett Tapiaufür Kurlandkämpfer geräumt werden,die bisherigen Insassen wurden andie Weichsel verlegt, und nur mitMühe entkam Hans dort wenig späterden vorstoßenden Sowjettruppen,gelangte auf abenteuerlichenWegen <strong>in</strong> den Heiligenbeiler Kesselund von dort schließlich <strong>in</strong> den Westen.Von Gertie fand er ke<strong>in</strong>e Spur.Bis er an e<strong>in</strong>em sommerlichen Spätnachmittagkurz nach der Währungsreformauf e<strong>in</strong>er Bank am HamburgerAlsterufer saß und Zeitung las.Nach e<strong>in</strong>iger Zeit ließ er das Blatts<strong>in</strong>ken und blickte über die glitzerndeWasserfläche. Fast wie der Schloßteich<strong>in</strong> Königsberg, dachte er. Erhörte leichte Schritte <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Nähe,ohne ihnen Beachtung zu schenken.Dann legten sich zwei kühle Händeüber se<strong>in</strong>e Augen, und e<strong>in</strong>e Frauenstimmesagte: „Rate mal, wer ichb<strong>in</strong>.“Die Stimme – sie war etwas herberund reifer geworden, aber unverkennbardie gleiche.„Hab dich man nicht so“, sagte Hans,„du Marjell mit dem Mediz<strong>in</strong>ball.“Und als sich die Hände lösten, griffer nach den Gelenken und fügte h<strong>in</strong>zu:„Und jetzt wird nicht mehr weggelaufen.Diesmal ist es nicht derBauch, auch nicht die andere Seite,diesmal ist es nämlich das Herz.“46
E<strong>in</strong> Bergmann fährt nach Allenste<strong>in</strong>von Kurt DzikusIn den Häusern der Auguststraße <strong>in</strong>Gelsenkirchen-Buer wohnten dieKumpels mit ihren Familien, die sozialSchwächeren. Woher stammtendiese Menschen? – Die meisten warenaus Masuren, aus den Gebietenum Osterode, Ortelsburg, Sensburg,hierher gezogen. Sie hatten ihre Lebensgewohnheitenund Sitten mitgebracht,aber vor allem ihre Sprache,die als slawische Sprache derpolnischen sehr ähnlich ist. Die masurischeSprache blieb dann überfünf Jahrzehnte die Mutterspracheneben der deutschen Sprache. DieK<strong>in</strong>der der Zugewanderten lerntennur vom H<strong>in</strong>hören die Sprache derEltern oder gar nicht. Man schämtesich der masurischen Sprache, weilman von der e<strong>in</strong>heimischen Bevölkerungabwertend als „Polacken“ bezeichnetwurde. Dabei kl<strong>in</strong>gt dochdiese Sprache weich und schmeichelnd.Hören Sie selbst! So wurdeme<strong>in</strong> Vetter liebevoll von se<strong>in</strong>er Großmuttergerufen: „Moi kochanie Wnuczek!“(Me<strong>in</strong> liebes Enkelsöhnchen!)E<strong>in</strong>ige der älteren Bewohner,schwerblütig und vielleicht geistignicht so wendig, haben die deutscheSprache nicht mehr erlernen können.Der Klang des Masurischen istmir jedoch aus den Tagen me<strong>in</strong>erK<strong>in</strong>dheit noch wohl vertraut. Im Übrigenverkümmerte die klangvolleSprache zu e<strong>in</strong>er re<strong>in</strong>en Gebrauchssprache.E<strong>in</strong>mal war sie Gottesdienstsprachehier <strong>in</strong> der evangelischenKirche <strong>in</strong> Erle, <strong>in</strong> der noch1949 masurische Gottesdienste gefeiertwurden. Zum anderen bedientensich die Erwachsenen dieserSprache, wenn die K<strong>in</strong>der die Inhalteder Gesprächsgegenstände nichthören durften.Viele Masuren wollten eigentlichauch gar nicht <strong>in</strong> Erle bleiben. Siekamen, um im Bergbau Geld zu verdienen.Sie wollten eisern sparenund mit dem Ersparten zurück <strong>in</strong> dieHeimat und dort „Majentek“ (e<strong>in</strong>enkle<strong>in</strong>en Besitz) kaufen. Der mühevolleAlltag, die Sorge um die Familiemachten solche Pläne und Träumezunichte.Die Liebe zu dem „Land der dunklenWälder und kristallnen Seen“ bliebaber bei Eltern und K<strong>in</strong>dern. Als 18-Jähriger sollte me<strong>in</strong> Vater 1924 Landund Verwandte <strong>in</strong> Ostpreußen kennenlernen. Unter Mühen hat dieFamilie e<strong>in</strong> zweites Schwe<strong>in</strong> aufgezogenund gemästet. Der Erlös fürdas schlachtreife Tier wurde für dieFahrt nach Ostpreußen verwandt.E<strong>in</strong> Opfer der Familie ohnegleichen!Das Mästen e<strong>in</strong>es Schwe<strong>in</strong>s und dasHalten e<strong>in</strong>er oder mehrerer Ziegen,genannt Bergmannskühe, warennämlich lebensnotwendig für die E-xistenz der Familien mit e<strong>in</strong>er großenAnzahl von K<strong>in</strong>dern.Heimatliebe und das Verhältnis zurnotwendigen Tierhaltung mag darumfolgende Schmunzelgeschichte, vonder ich nicht genau weiß, ob sie sichtatsächlich so ereignet hat, kennzeichnen.Der Nachbar O. hatte e<strong>in</strong> Ferkel gekauftmit der Absicht, es zur47
Schlachtreife großzuziehen. Als dasSchwe<strong>in</strong> herangewachsen war, verlores von e<strong>in</strong>em Tag auf den anderendie Fresslust. Selbst den leckerstenSchwe<strong>in</strong>efraß verschmähte es,und es litt an beängstigender Magersucht.Weder schmeichelndeSchmatzlaute noch Schläge brachtenes zum Schwe<strong>in</strong>etrog und zumFressen.Da wurden 1920 die Masuren zurAbstimmung über die ZugehörigkeitOstpreußens zu Deutschland oderzu Polen nach Allenste<strong>in</strong> gerufen,und viele fuhren vom Ruhrgebiet <strong>in</strong>die alte Heimat. So rüstete sich auchNachbar O. für diese Reise. Reisefertigim fe<strong>in</strong>sten Gehrock, den Hutauf dem Kopf, schüttete er se<strong>in</strong>emfressunlustigen Schwe<strong>in</strong> den Fraß füre<strong>in</strong>e Woche <strong>in</strong> den Trog und sprachwütend: „Entweder du frisst, oder dugehst kaputt!“ Nach der Woche <strong>in</strong>Allenste<strong>in</strong>, wo die Abstimmung e<strong>in</strong>eüberwältigende Mehrheit fürDeutschland ergeben hatte, kam O.zurück <strong>in</strong> die Auguststraße. Se<strong>in</strong> ersterGang war der <strong>in</strong> den Stall, umnach dem Schwe<strong>in</strong> zu sehen. Kaumhat das Schwe<strong>in</strong> den Nachbarn erblickt,schrie es vor Hunger. DerTrog war leergeleckt, die Balken desSchwe<strong>in</strong>estalls waren halb aufgefressen,aber das Schwe<strong>in</strong> war nichtverendet. Nachbar O. beeilte sich,dem Tier den Fraß zu br<strong>in</strong>gen. DasSchwe<strong>in</strong> – oder auch die „Korre“genannt – verschlang von nun an alles,was <strong>in</strong> den Trog kam. NachbarO. freute sich bereits über die ansehnlichenRundungen – da stelltesich nach drei Wochen die alte Fressunlustwieder e<strong>in</strong>. Doch Nachbar O.zog schleunigst se<strong>in</strong>en Gehrock an,setzte se<strong>in</strong>en Festtagshut auf, nahmden Eimer mit dem Schwe<strong>in</strong>efraßund drohte se<strong>in</strong>em Schwe<strong>in</strong>, <strong>in</strong>demer den Trog voll schüttete: „Ich fahrwieder nach Allenste<strong>in</strong>!“ – Und dasSchwe<strong>in</strong> stürzte sich mit größterFressbegier auf den Trog.aus „Beiträge zur Stadtgeschichte“Band XV 1989„100 Jahre Auguststraße“,Gelsenkirchen – BuerDer PomuchelskoppVon Georg Hermanowski„Mußt denn ausgerechnet mit demdammlichen Pomuchelskopp gehen?“fragte die Mutter, um ihreTochter besorgt. Sie konnte es e<strong>in</strong>fachnicht begreifen, wie Mütter esnie fassen können, wenn die Töchterden von ihnen Auserwählten zurückweisenund ihren eigenen Kopfdurchzusetzen trachten. Nun, wenndie Erna den Sohn des Fleischersdurchaus nicht wollte, sollte sie eseben lassen; aber ausgerechnet diesen– ne<strong>in</strong>, das konnte sie wirklichnicht begreifen.Nicht e<strong>in</strong>mal bis zwei hatte er zählenkönnen, als Erna ihn am vergangenenSonnabend zum Kaffee mitgebrachthatte. Mit se<strong>in</strong>en großenSchellfischaugen hatte er den Napfkuchen,der mit so viel Liebe undRos<strong>in</strong>en gebacken war, angestiert,und trotz wiederholter Aufforderung48
nicht gewagt zuzugreifen. Sie hattebeim besten Willen ke<strong>in</strong> Sterbenswörtchenaus ihm herauspressenkönnen, nicht e<strong>in</strong>mal, als sie versuchthatte, mit ihm über die Ernteund über das Wetter zu sprechen. Erhatte immer nur genickt; und erstganz zum Schluß war e<strong>in</strong> schüchternes„Ich weiß nich“ über se<strong>in</strong>e Lippengekommen. Vielleicht hatte siees sich auch nur e<strong>in</strong>gebildet undse<strong>in</strong> müdes Schulterzucken für e<strong>in</strong>Ich-weiß-nich gehalten.„Gehst am nächsten Sonnabend mitzum Tanzen?“, hatte Erna gefragt.Und er hatte, stumm wie e<strong>in</strong> Fisch,genickt; und auch, als sie ihm vorgeschlagenhatte, sie sollten sich umvier unter der L<strong>in</strong>de treffen, hatte ernur, wenn auch e<strong>in</strong> wenig lebhafter,genickt.Erna zog die gestreifte Baumwollbluseund den breiten Plisseerock anund suchte nach dem schwarzenLackgürtel, den sie nirgends f<strong>in</strong>denkonnte. Ab und zu warf sie e<strong>in</strong>en flehendenBlick zur Mutter h<strong>in</strong>über,wagte jedoch ke<strong>in</strong>e Frage zu stellen,da sie genau wußte, daß die Mutterihr grollte.-„Er ist wenigstens treu“, sagte sieschließlich, und es klang wie e<strong>in</strong>eSelbstrechtfertigung. „Er wird sich’snicht e<strong>in</strong>fallen lassen, e<strong>in</strong>e andereMarjell zum Tanz aufzufordern. Fürihn b<strong>in</strong> nur ich da,.“ Und das schienihr sehr wichtig. Wenn sie tanzeng<strong>in</strong>g, wollte sie e<strong>in</strong>en Jungen für sichalle<strong>in</strong> haben und nicht e<strong>in</strong>en, derimmer über ihre Schulter h<strong>in</strong>wegnach anderen Mädchen schielte.„Das kann ich mir denken“, sagte dieMutter spöttisch. „Und der kann sicherse<strong>in</strong>, daß ihn ke<strong>in</strong>e andere auffordert.Wer will schon mit so e<strong>in</strong>em . . .“„Das ist me<strong>in</strong>e Sache“, unterbrachErna sie schnippisch. „Ich geh ja mitihm und nicht du!“Wütend warf die Mutter die Tür zu,im Augenblick wollte sie nichts mehrvon ihrer Tochter wissen.Erna fand den schwarzen Lackgürtelauch ohne die Hilfe der Mutter. Sietrat vor den Spiegel und schnürte ihnso fest um ihre Taille, wie es nurg<strong>in</strong>g. Sie war e<strong>in</strong> hübsches Mädchen,das wußte sie, und sie hättegewiß manchen anderen habenkönnen, wenn sie nur gewollt hätte.Aber sie wollte nun e<strong>in</strong>mal ihn. Ergefiel ihr; und sie war sicher, daß erihr immer treu bleiben würde.Als sie zur L<strong>in</strong>de kam, wartete erschon auf sie. Er zog e<strong>in</strong> Gesicht, alshätte er bereits e<strong>in</strong>e Stunde odernoch länger gewartet, und als sie ihndanach fragte, antwortete er nur mite<strong>in</strong>em vielsagenden „Hm!“. Sie wardas gewohnt, hängte sich lässig anse<strong>in</strong>en Arm, und sie schaukelten ü-ber das Kopfste<strong>in</strong>pflaster zum „LachendenElch“.Die Musik spielte schon zum Tanz;die Paare drehten sich auf dem Parkett.An e<strong>in</strong>em der Seitentische fandensie Platz. Sie bestellte e<strong>in</strong>e TasseKaffee; der Ober sah ihn fragendan. Mit dem Daumen wies er auf dasBierglas se<strong>in</strong>es Nachbarn, und alsder Ober ihn fragte, ob er auch e<strong>in</strong>Glas Bier wünsche, nickte er nur.Gierig schlürfte sie ihren Kaffee, denner war nicht mehr heiß – und zu Hausgab es nur Malzkaffee! –, er abernippte nur an se<strong>in</strong>em Glas undwischte den Schaum mit dem Handrückenvon se<strong>in</strong>em Mund. Dann fragtesie ihn, ob er nicht tanzen wolle.Schwerfällig erhob er sich. Zaghaftergriff er ihre Hand und führte sie49
zum Parkett. Se<strong>in</strong> Blick war auf ihrstrohblondes Haar gerichtet, und ermußte an den Häcksel denken, densie am <strong>Vor</strong>mittag geschnitten hatten.Unwillkürlich wanderte se<strong>in</strong> Blick vonihrem blonden Haar zu anderem blondenHaar; denn es gab viel blondesHaar im Saal, genau soviel wieHäcksel auf dem Boden ihrer Tenne.„Trampel mir doch nich immer aufdie Schlorren“, sagte sie und weckteihn damit unsanft aus se<strong>in</strong>em Häckseltraum.Überrascht schaute er auf.Sie glaubte ihm vom Gesicht ablesenzu können, er wolle künftig besseraufpassen, und kehrte zufriedenmit ihm zu ihrem Tisch zurück.„Bleiben wir e<strong>in</strong> bißchen hucken“,sagte sie, als die Musik wieder zuspielen begann. Er nickte, sie trankihren Kaffee, und er stierte <strong>in</strong> se<strong>in</strong>Bierglas; auch das Bier war blondwie Stroh . . .„De<strong>in</strong> Bier wird ganz schal“, sagtesie nach e<strong>in</strong>er Weile.„Och“, me<strong>in</strong>te er und trank e<strong>in</strong>enSchluck.Sie wartete, daß er sie wieder zumTanz auffordern würde; aber siewartete vergebens. Sie wartete übere<strong>in</strong>e halbe Stunde. Sie schaute dentanzenden Paaren zu; er stierte verträumt<strong>in</strong>s se<strong>in</strong> Glas. Als die Kapellezur Damenwahl aufspielte, fordertesie ihn nicht auf. Ruhig blieb sie aufihrem Stuhl sitzen, und da sie denKaffee bereits ausgetrunken hatte,machte sie sich mit Milch und Zuckerzu schaffen.Schon hatte der Tanz se<strong>in</strong>en Höhepunkterreicht, als plötzlich e<strong>in</strong>strohblondes Mauerblümchen mite<strong>in</strong>em herzallerliebsten Stubsnäschen,das bisher still neben e<strong>in</strong>emPfeiler gesessen hatte und noch zuke<strong>in</strong>em Tanz aufgefordert wordenwar, an ihrem Tisch auftauchte undihm aus großen, wassergrünen Augenlächelnd e<strong>in</strong>en Blick zuwarf. Erwußte nicht, wie ihm geschah, sahzuerst Erna, dann die andere hilfesuchendan und erhob sich schließlichschüchtern, um dem Blondschopfauf die Tanzfläche zu folgen.Das hatte Erna nicht erwartet; sie riefsogleich nach dem Ober, bezahlteihren Kaffee – „Ne<strong>in</strong>, das Bier soll erselbst bezahlen!“ – und verließ wutschnaubendden Tisch. Sie hatteden Ausgang noch nicht erreicht, alsder Tanz zu Ende war und er siee<strong>in</strong>geholt hatte. Scheu legte er dieHand auf ihre l<strong>in</strong>ke Schulter.„Nimm die Patsche von me<strong>in</strong>er Bluseund zerknautsch sie mir nich“,sagte sie ärgerlich. „Mutter hat siegrad frisch geplättet!“Sie wollte weitergehen; doch beimZurückfluten der Paare von derTanzfläche war vor der Tür e<strong>in</strong> Gedrängeentstanden; sie aber hattedas Gefühl, er versperre ihr denWeg. Treuherzig schauten se<strong>in</strong>egroßen, fragenden Augen sie an.„Kannst ja mit der druschligen Marjellweitertanzen“, sagte sie eifersüchtig.„Brauchst mich ja nich, duWengt<strong>in</strong>er!“Er sah sie noch immer genausotreuherzig an, und diesem Blickkonnte sie nicht widerstehen. Graddieser treue Kälberblick hatte es ihrja angetan. Ihre Wut schmolz dah<strong>in</strong>.„Na“, sagte sie schließlich, „hast esdir überlegt?“Er nickte, und das konnte sowohl jaals auch ne<strong>in</strong> heißen; für sie war ese<strong>in</strong> Ja.„Dann komm“, sagte sie. Und siekehrten zu ihrem Tisch zurück. Sie50
tanzten nicht mehr; nachdem sie e<strong>in</strong>ehalbe Stunde vergebens auf se<strong>in</strong>eAufforderung gewartet hatte – siewar jetzt stur! –, stand sie auf undverließ endgültig den Saal.Er folgte ihr auf den Fersen und holtesie kurz vor der L<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>. Sie g<strong>in</strong>genjetzt nebene<strong>in</strong>ander, doch um e<strong>in</strong>enMeter getrennt. Ke<strong>in</strong>er hatte seit ihrem„Komm“ e<strong>in</strong> Wort gesprochen.Nun war sie die erste, die dasSchweigen brach.„Da steht ja die druschlige Marjell!“sagte sie plötzlich.Er sah nur das strohblonde Haar.Häcksel, dachte er. Erna zog wütenddie Schultern hoch und warf sich <strong>in</strong>Positur. Herausfordernd blieb sie vordem Mädchen stehen, stemmte dieHände <strong>in</strong> die vom Lackgürtel e<strong>in</strong>geschnürtenHüften und blitzte ihreNebenbuhler<strong>in</strong> heftig an. „Biest!“zischte sie, drehte sich auf demrechten hohen Absatz um, so daßdieser gefährlich knirschte, und verließden L<strong>in</strong>denbaum.Er blieb ratlos stehen. Verstohlenschaute er nach dem Blondschopf,sah sich nach Ernas blondem Haarum.„Was stehst wie <strong>in</strong> Ochs vorm Berg?“fragte das fremde Mädchen. „Weißtnich, wo du h<strong>in</strong>sollst? Erst hast michbeim Tanzen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Tour fixiert, undjetzt . . . Na, lauf ihr doch nach!“Er wußte nicht, ob er ihrem Rat folgensollte.„Oder liebst sie vielleicht nich?“ fragtedas Mädchen.Er schüttelte den Kopf; und wiederkonnte es ja oder ne<strong>in</strong> heißen; für siewar es e<strong>in</strong> Ne<strong>in</strong>. Doch dann fiel ihme<strong>in</strong>: Er hatte sie ja gar nicht fixiert; erhatte beim Tanzen nur blondesStroh gesehen, nur an den Häckseldaheim gedacht. Und er g<strong>in</strong>g weiter.Sie ließ ihn zehn Schritte gehen undräusperte sich dann. Aber er schautesich nicht um. Nach weiterenzehn Schritten räusperte sie sichwieder, diesmal lauter. Ihn störte esnicht.Das war ihr denn doch zu bunt!Als Erna, ehe sie <strong>in</strong> die lange Dorfstraßee<strong>in</strong>bog, sich noch e<strong>in</strong>mal umdrehte,sah sie, wie das Mädchenihm nachlief und ihn beim Arm ergriff.„Komm endlich, du Dämlack!“sagte die andere.Und Erna sah beide <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Nebenstraßeverschw<strong>in</strong>den.Als sie heimkam, saß ihre Mutterbeim Ofen und stopfte Socken.„Nun“, fragte sie, „hast ihn nich mitgebracht?“Erna schüttelte den Kopf. Sie setztesich zum Fenster und schaute h<strong>in</strong>aus.„Hast denn gar nichts zu erzählen?“fragte die Mutter. Erna blieb stumm.„Hat er dich etwa . . . sitzenlassen?“Erna schüttelte den Kopf. (Es konnteja, es konnte auch ne<strong>in</strong> heißen.)„Was hat er denn gesagt?“ wolltedie Mutter wissen.„Nichts“, erwiderte Erna, „garnichts!“Jetzt war es an der Mutter, den Kopfzu schütteln: „Hab ich dir nich immergesagt, daß er e<strong>in</strong> dammlicher Pomuchelskoppist?“ Erna nickte nurnoch und g<strong>in</strong>g schlafen.51
Der Sitz der Allenste<strong>in</strong>er BezirksregierungVon Stanis¹aw Piechocki (übersetzt von Elisabeth Ritter)Zur Wende des 19. Und 20. Jahrhundertswar Allenste<strong>in</strong> nach Königsbergdas zweitwichtigste Zentrum <strong>in</strong>Ostpreußen. In der Stadt an der Allewurde das Landgericht angesiedelt,dessen Berufungs<strong>in</strong>stanz das Oberlandesgericht<strong>in</strong> Königsberg war. Diegroßstädtischen Ambitionen derStadt erreichten ihren Höhepunkt jedochim Jahre 1905 mit der Ansiedlungder Bezirksregierung, <strong>in</strong> derenZuständigkeitsbereich folgende Kreisefielen: Allenste<strong>in</strong>, Osterode, Neidenburg,Rastenburg, Sensburg, Ortelsburg,Lötzen, Lyck und Johannisburg.Im Jahre 1910 wurde Allenste<strong>in</strong> alsStadtkreis selbstständig, an derenSpitze fortan ke<strong>in</strong> Bürgermeister, sonderne<strong>in</strong> Oberbürgermeister stand.E<strong>in</strong>drucksvolle Bauten, <strong>in</strong> denen dieRegierungsorgane ihren Sitz hatten,sollten das Prestige der Bezirksregierungund der Stadt erhöhen. Zügigmachte man sich an den Bau e<strong>in</strong>esVerwaltungsgebäudes für dieBezirksregierung sowie e<strong>in</strong>es städtischenRathauses.Die Büroräume der Bezirksregierungbefanden sich zunächst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em großenprivaten Altbau am heutigen PlatzBema 3/4a (nach dem Krieg war hierdas Gesundheitswesen der Eisenbahnangesiedelt). Sogleich machte mansich an die Umsetzung des Bauvorhabense<strong>in</strong>es neuen repräsentativenSitzes. Angesiedelt wurde er auf demGelände e<strong>in</strong>es trockengelegten Teiches.An der Errichtung des Gebäudekomplexeswaren seit 1908 mehrereUnternehmen beteiligt, wobei dieBaufirma des Allenste<strong>in</strong>er UnternehmersAlbert Dilewski die wichtigstewar. Zur Jahreshälfte 1911 wurde derBau abgeschlossen.52
Das monumentale, viergeschossigeGebäude der Bezirksregierung mite<strong>in</strong>em ausgebauten Dachgeschossund weitläufigem Keller wurde zugroßen Teilen aus Verblendste<strong>in</strong> errichtetund hatte e<strong>in</strong>en nahezu quadratischenGrundriss. Fundamentund Grundmauern bis zum Hochparterrebaute man unter Verwendungvon bearbeiteten F<strong>in</strong>dl<strong>in</strong>gen,die dem Gesamtbauwerk den Ansche<strong>in</strong>e<strong>in</strong>er Festung verliehen. Fürdie Umrahmung der Fenster undGesimse an der Fassade verwendeteman h<strong>in</strong>gegen den aus Schlesienimportierten hellen Wartauer Sandste<strong>in</strong>.Der Haupte<strong>in</strong>gang wurde ausSte<strong>in</strong>en gebaut, die aus dem schlesischenWünschelburg herantransportiertwurden, was bis zu e<strong>in</strong>emgewissen Grad den rohen Ansche<strong>in</strong>,den die solide Konstruktion des Gebäudesfür e<strong>in</strong>en außenstehendenBeobachter haben konnte, milderte.Das Gebäude deckt e<strong>in</strong> Mansarden-Satteldach aus Keramikdachziegeln.In den 20er und 30er <strong>Jahren</strong> wurdees mehrmals umgebaut, bevor esletztlich se<strong>in</strong>e endgültige Form erhielt.Die Monumentalität des Gesamtkomplexeswird von drei Innenhöfenund stark exponierten ungewöhnlichenTürmen – ähnlich dem Turme<strong>in</strong>er mittelalterlichen Burgru<strong>in</strong>e –noch unterstrichen. Der auf der Achsedes mittleren Turmes liegendeHaupte<strong>in</strong>gang wurde mit besondererSorgfalt <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Portals ausgeführt,das mit e<strong>in</strong>em Giebeldreieckund Büsten verziert wurde. Auf beidenSeiten der ste<strong>in</strong>ernen Treppenstufenverdienen zudem metallengläserneLaternen besondere Aufmerksamkeit,die im Sommer <strong>in</strong>mittengrüner Büsche vers<strong>in</strong>ken. Vollendetwird der Gesamte<strong>in</strong>druckdurch den außergewöhnlichen Reizdes wilden We<strong>in</strong>s, der reich an denMauern des ganzen Gebäudesrankt.Von der Innenausstattung verdienenvor allem das künstlerisch angelegteTreppenhaus und die mit Auf-Putz-Mustern dekorierten breiten Flurebesondere Aufmerksamkeit. DieWände, Gewölbe und Decken verzierte<strong>in</strong> aufwändiger Stuck mit Figuren,Rosetten und Gesimsen. VonAnfang an war das Gebäude mit e<strong>in</strong>erZentralheizung, Feuerlöschernund elektrischem Licht ausgestattet.Zudem hatte es e<strong>in</strong>e Telefonzentralemit 117 Durchwahlen. Außer denBüros der Bezirksregierung befandensich im Gebäude kle<strong>in</strong>ere Institutionenund Ämter, u.a. das StaatlicheGesundheitsamt, das den <strong>in</strong> den<strong>Jahren</strong> 1936/37 errichteten Gebäudeflügelzur Roonstraße h<strong>in</strong> e<strong>in</strong>nahm.An dieser Stelle lohnt es durchaus zuerwähnen, dass das besagte StaatlicheGesundheitsamt <strong>in</strong> den <strong>Jahren</strong>1936-1945 von den Allenste<strong>in</strong>er Heilanstalten(Prov<strong>in</strong>zialirrenanstalt <strong>in</strong> Kortauund dem Evangelischen Paul-H<strong>in</strong>denburg-Krankenhaus) durchgeführteZwangssterilisierungen unddie verbrecherische Euthanasie derNationalsozialisten beaufsichtigte.Die amtlichen Sachberichte wurdenzu großen Teilen auf Verfügung desPräsidenten der Allenste<strong>in</strong>er Bezirksregierungunmittelbar vor der Evakuierungdes Amtes am 20. und 21.Januar 1945 vernichtet (e<strong>in</strong>ige Geheimdokumentewurden sogar nocheilig im Innenhof der Bezirksregierungverbrannt). Der verbliebene53
Rest wurde bereits nach Ende desKrieges als deutsches Altpapier vernichtet.Während des Zweiten Weltkriegeshatte die Gestapo im Erdgeschossdieses Gebäudes ihren Sitz. Mangelangte zu ihr, <strong>in</strong>dem man durchdas Tor und den Innenhof an derKleeberger Straße h<strong>in</strong>durch g<strong>in</strong>g.Dem 1995 verfassten Bericht e<strong>in</strong>esehemaligen Zwangsarbeiters <strong>in</strong> Ostpreußenzufolge fertigten Gestapofunktionäre<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em der ZimmerPersonalakten von Ausländern füre<strong>in</strong>e spezielle Kartei an. Der Verfasserdes besagten Berichts, der nachdem Krieg <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> wohnte,wurde 1943 an diesen Ort gebracht,um fotografiert zu werden und e<strong>in</strong>enF<strong>in</strong>gerabdruck zu h<strong>in</strong>terlassen.Im Gebäudekomplex befand sich allerd<strong>in</strong>gske<strong>in</strong>e Dienstwohnung desRegierungspräsidenten. Er wohnteseit 1909 <strong>in</strong> der Allenste<strong>in</strong>er Burg,dort, wo sich heute die Büroräumedes Museums vom Ermland undMasuren bef<strong>in</strong>den. Zunächst hatteman vor, für den Regierungspräsidentene<strong>in</strong>e freistehende Villa <strong>in</strong> derUmgebung der Bezirksregierung zuerrichten. Das Bauvorhaben wurdeletztlich jedoch nicht verwirklicht,weil man der Me<strong>in</strong>ung war, dass e<strong>in</strong>eWohnung auf der Burg erheblichrepräsentativer sei. Aus diesemGrund wohnten auf der Burg folgendePräsidenten der Allenste<strong>in</strong>er Bezirksregierung:Hans von Hellmann(1914), Matthias von Oppen (1924),Max von Ruperti (1932), Dr. KarlSchmidt (1937).Darüber h<strong>in</strong>aus befand sich <strong>in</strong> demGebäude <strong>in</strong> der Freiherr-von-Ste<strong>in</strong>-Straße im Jahre 1920 die lokaleKommission der Alliierten, die denVerlauf der Volksabstimmung überwachensollte. Hier waltete zudemihr <strong>Vor</strong>sitzender Ernst Rennie.Nach dem Zweiten Weltkrieg, ausdem das Bauwerk mit ger<strong>in</strong>gemSchaden <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es verbranntenDaches des l<strong>in</strong>ken Seitenflügels hervorg<strong>in</strong>g,fand hier die Direktion derPolnischen Eisenbahn ihren Sitz.Nachdem die Allenste<strong>in</strong>er Direktionder Staatlichen Bahn 1963 geschlossenwurde, übernahm die DanzigerDirektion ihre Aufgaben. Später, <strong>in</strong>sbesondere<strong>in</strong> den 90er <strong>Jahren</strong>, siedeltensich <strong>in</strong> dem Bürogebäude e<strong>in</strong>eReihe von Institutionen und Firmenan, die nicht mit der Bahn verbundenwaren. So hatte hier beispielsweisedie Redaktion des Allenste<strong>in</strong>erNachmittagsblattes „Dziennik Pojezierza“ihre Büroräume.Ende der 90er Jahre befand sichfast das ganze Gebäude im Besitzder Staatlichen Polnischen Bahn, die<strong>in</strong> ihm eigene Agenturen, wie etwadas Büro zur Ertragskontrolle, denBetrieb für Warentransporte, das Informationszentrumsowie die Krankenversorgungder Bahn unterbrachte.Darüber h<strong>in</strong>aus hatten hiere<strong>in</strong>e Abteilung der Stiftung „Semafor“,e<strong>in</strong>e Werbeagentur und im Untergeschossdes rechten Seitenflügelse<strong>in</strong> ch<strong>in</strong>esisches Restaurantihren Sitz.E<strong>in</strong> weiteres <strong>in</strong>teressantes Detail ausder Geschichte des Gebäudes ist,dass die lokalen Machthaber aufWoiwodschaftsebene 1946 erhebliche<strong>Vor</strong>behalte gegenüber der Übernahmedes Gebäudes durch dieBahn, die bereits seit 1945 dort residierte,hegten. Sie hielten sich fürdie eigentlichen Erben des vorherigenNutzers, also der Bezirksregie-54
ung. Ihre sehr <strong>in</strong>tensiven Bemühungenendeten letztlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Fiasko.Die Allenste<strong>in</strong>er Bahndirektiongalt <strong>in</strong> der Stadt an der Alle von Anfangan als e<strong>in</strong>e der mächtigsten lokalenInstitutionen. Reiste ihr Chefdienstlich nach Warschau, so wurde– der Position e<strong>in</strong>es höheren Funktionärsangemessen – auf der StreckeAllenste<strong>in</strong>-Warschau e<strong>in</strong> speziellerSalonwaggon an den Schnellzugangekoppelt.Ob sich <strong>in</strong> der nächsten Zeit etwasan dem Charakter des Gebäudesändert, wird die Zeit zeigen. Im Jahre2002 g<strong>in</strong>g das Gebäude von derStaatlichen Polnischen Bahn <strong>in</strong> denBesitz des Allenste<strong>in</strong>er Magistratsüber. Im ersten Stock des Gebäudessoll <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong>e Abteilung desHöchsten VerwaltungsgerichtesPlatz f<strong>in</strong>den. Das Gebäude soll Sitzdes z.Zt. auf verschiedene Gebäudeverteilten Marschallamtes werden.aus „Allenste<strong>in</strong>er Nachrichten“Nr. 3 vom 25.3.2005Schwieriger FallDe K<strong>in</strong>derchens hucken bedutt <strong>in</strong>ne Schul,E Tafel hängt anne Wand,Dem F<strong>in</strong>ger dem haben se tief <strong>in</strong>ne Nas,Dem Griffel fest <strong>in</strong>ne Hand.Der Mart<strong>in</strong> is dammlich, er weiß es nich,Drum kriegt er e<strong>in</strong>s iebergerissen.„Bis morgen frieh“, sagt der Lehrer streng,„Me<strong>in</strong> Jungche, da wirst du das wissen!“Der Lehrer steht annem Pult und tutNach ihre Eltern se fragen,Auch wie der Vatche mit <strong>Vor</strong>namen heiß,Das missen se alle ihm sagen.„Nun „, fragt der Lehrer am andern Tag,„Wie heißt er denn, Karl oder Fritz?Vielleicht gar August?“ Der Mart<strong>in</strong> der grientUnd dreht <strong>in</strong>ne Hand se<strong>in</strong>e Mitz.„De Muttche läßt sagen“, so legt er denn los,„Daß se leider das auch nich weiß.Se wär all froh, wenn se wenigstens wußd,Wie der Vater mit Nachnamen heiß.“Dr. Alfred Lau55
BERICHTE AUS ALLENSTEINDen nachfolgenden Bericht schickte uns Annemarie Günther und schreibtdazu: „Während me<strong>in</strong>er Arbeit <strong>in</strong> der Bruderhilfe lernte ich Anfang 1990 <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>e<strong>in</strong>e Deutsche kennen, die mir aus ihrem Leben erzählte. Ihre Erlebnisse– auch im H<strong>in</strong>blick darauf, dass wir <strong>in</strong> diesem Jahr an die <strong>60</strong>-jährigeWiederkehr unserer Flucht denken – schienen mir außergewöhnlich zu se<strong>in</strong>,dass ich sie anregte, alles aufzuschreiben. Da sie sehr <strong>in</strong>telligent ist, tat sie esgern. Allerd<strong>in</strong>gs wollte sie den Bericht <strong>in</strong> der 3. Person verfassen, um nichterkannt zu werden. Sie lebt heute noch <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>.“Gretel aus Ostpreußen und das TestamentAn e<strong>in</strong>em schönen, warmen Feiertagim Juni 1922 kam <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ostpreußischenFamilie das sechste K<strong>in</strong>d zurWelt. Es geschah zwischen See undWald unter e<strong>in</strong>er Eiche auf e<strong>in</strong>emschön gelegenen Bauernhof. DieMutter schaffte es nicht mehr, rechtzeitigzur Geburt nach Hause zukommen. Mit Hilfe ihrer Freund<strong>in</strong>Anna brachte Mutter Hedwig dasK<strong>in</strong>d zur Welt. In e<strong>in</strong>er Schürze trugensie es nach Hause. Das K<strong>in</strong>dwar e<strong>in</strong> Mädchen und wurde Gretelgenannt.Es herrschte Not bei den Eltern.Wohl war der Hof ziemlich groß,doch er bestand meist aus Sandbodenund Wald. Die Ostpreußen sagten:„Sandke ist gut Landka, wennman eggt, ist schön glatt, wenn manmäht, ist ke<strong>in</strong> Schwatt.Gretel war zwei Jahre alt, als sieschwer krank wurde. Ihre Mutterspannte das Pferd an, fuhr mit derKle<strong>in</strong>en zu e<strong>in</strong>er Klosterschwesterund bat um Hilfe. Diese stellte e<strong>in</strong>edoppelte Lungenentzündung festund tat alles, um das K<strong>in</strong>d zu retten.Gretel kam durch, musste danachaber erst wieder das Laufen lernen.Sie wurde e<strong>in</strong> fröhliches K<strong>in</strong>d; nurwuchs sie sehr langsam. Ihre dreiJahre jüngere Schwester überholtesie bald. E<strong>in</strong> Bekannter nannte sie„Liliput“. Schon mit fünf <strong>Jahren</strong> kamsie <strong>in</strong> die Schule. Sie lernte gut undwar sehr aufgeweckt, so dass derLehrer Freude an ihr hatte. Er nanntedie Kle<strong>in</strong>e „Brotkrümel“.Als sie älter wurde, musste Gretel zuHause schwer arbeiten. Sie hattezehn Geschwister, darunter warennur zwei Jungens. So musste Gretel<strong>in</strong> jungen <strong>Jahren</strong> Männerarbeit verrichten.Oft wurde es ihr zu viel. Alssie als 14-Jährige die Volksschulebeendet hatte, g<strong>in</strong>g sie auf dieLandwirtschaftsschule. Als sie nachelf Monaten nach Hause zurückkehrte,erkannten die Eltern und Geschwistersie kaum; denn aus demzarten, kle<strong>in</strong>en Mädchen war e<strong>in</strong>ekräftige, normal große junge Damegeworden. Da die Not zu Hauseimmer noch groß war, musste Gretelihr Brot selbst verdienen und bei e<strong>in</strong>emBauern Dienst tun. Als sie 18Jahre alt war, verheirateten ihre Elternsie mit e<strong>in</strong>em 28-jährigen Mann.Sie zog <strong>in</strong> die Stadt. Schon mit 19<strong>Jahren</strong> wurde sie Mutter. Als derkle<strong>in</strong>e Toni zwei Jahre alt war, wurde56
Gretels Mann Soldat und musste <strong>in</strong>den Krieg. Gretel blieb mit ihremK<strong>in</strong>d alle<strong>in</strong>e und war glücklich. Siefühlte sich jung und frei, hatte ihr eigenesGeld und liebte ihr K<strong>in</strong>d.Im November 1944 kam die traurigeNachricht, dass ihr Mann vermisstsei. Diese Nachricht machte Gretelsehr ängstlich und beklommen, undsie konnte nicht mehr froh undglücklich se<strong>in</strong>. <strong>Vor</strong> allem tat ihr dasK<strong>in</strong>d Leid, das nun ohne Vater war.Sie liebte es desto mehr und wolltealles tun, um den Vater zu ersetzen.Sie wusste von zu Hause, was esheißt, nicht geliebt zu se<strong>in</strong>. Ihre ganzeLiebe galt ihrem K<strong>in</strong>d. Doch nichtlange dauerte dieses Glück. DennEnde Januar 1945 war die Russenfrontherangerückt. Mit den Nachbarng<strong>in</strong>g sie <strong>in</strong> den Schutzkeller aufder anderen Straßenseite. Die Russenkamen mit großem Hallo, durchsuchtenalle Häuser von oben bisunten und kamen auch <strong>in</strong> den Keller.Betrunken, mit aufgepflanzten Gewehren,suchten sie junge Männer,aber sie fanden nur Alte, Frauen undK<strong>in</strong>der. Die Frauen holten sie raus,und unter Schlägen musste jedeFrau drei bis vier Russen „bedienen“.Auch Gretel musste ran. Sie rief:„Me<strong>in</strong> Gott, möge die Erde mich bedecken!So e<strong>in</strong>e Schande! Me<strong>in</strong>Gott, wofür? Was habe ich Bösesgetan?“ Jede Frau jammerte undklagte. E<strong>in</strong>e Kompanie Russen nachder anderen zog mit großem Hallodurch die Stadt. Die Leute lagen ermordetauf der Straße, über sie fuhrenPanzer, alle Invaliden wurden erschossen.Manche Menschen nahmensich vor Furcht das Leben. Überallbrannten die Häuser, alle Lädenwurden geplündert. In den kommendenWochen starben vieleschwächere Menschen vor Hunger,stärkere suchten <strong>in</strong> den verlassenenHäusern etwas zum Essen, sammeltensich <strong>in</strong> den stehen gebliebenenHäusern <strong>in</strong> Gruppen, um sich zu helfenund sich gegenseitig zu beschützen.So verlief der Monat Februar.Am 3. März hatte die Gruppe Gretelim Keller versteckt, weil wieder Russenbandenschlimm hausten. Diesewaren der Russenfront gefolgt. GretelsVersteck wurde von e<strong>in</strong>er Frauverraten. Die Russenbande suchteFrauen und Männer zur Arbeit, angeblichfür zwei Tage. Auch Gretelmusste mit. Der kle<strong>in</strong>e Toni rief nachihr und we<strong>in</strong>te, Gretel wollte dasHerz brechen. Sie wollte ihn mitnehmen,aber es war nicht erlaubt.Sie kehrte sich immer wieder umund rief: „Tonichen, nur zwei Tage,dann kommt Mutti zurück. Bleibschön artig bei den Leuten!“ Da bekamsie e<strong>in</strong>en Hieb mit dem Gewehrkolben<strong>in</strong>s Kreuz, und man jagtesie auf e<strong>in</strong>en Platz. Dort standenviele alte Männer und Frauen undHunderte von kranken Pferden. Jederbekam 22 Pferde, die er zu führenhatte, und e<strong>in</strong> unendlich langerMarsch begann. Immer weiter undweiter; marschieren von morgens bisabends, und des Nachts wurden dieFrauen vergewaltigt. Mit wundenHerzen vor Sehnsucht nach denK<strong>in</strong>dern und anderen Lieben zogendie Menschen dah<strong>in</strong>, seufzend. We<strong>in</strong>enwar verboten. Jeder musstesich etwas zum Essen aus den Kellernder verlassenen Häuser suchen.Das war auf deutschem Gebiet nochmöglich. Alte Menschen, die nichtmehr weiter konnten, wurden er-57
schossen. E<strong>in</strong>e junge Frau gebar e<strong>in</strong>K<strong>in</strong>d und wurde <strong>in</strong> ihrem Blut alle<strong>in</strong>gelassen. Drei Wochen lang g<strong>in</strong>g esimmer weiter nach Posen. Die Pferdesollten dort nach Russland verfrachtetwerden. Nur die Hälfte derMenschen und e<strong>in</strong> Drittel der Pferdeerreichte das Ziel. Die Menschenschworen sich: „Nach Russland fahrenwir nicht; vorher nehmen wir unsdas Leben! Dabei hilft e<strong>in</strong>er dem anderen.“Gott wollte es wohl nicht; dennplötzlich hieß es: „Die Ausfuhr istverboten.“ So waren sie die ersten,die nicht nach Russland mussten.Aber niemand wurde nach Hauseentlassen. Der Marsch g<strong>in</strong>g weiterüber Gnesen nach Sprengersfelde,e<strong>in</strong>em Gut, wo Pferde und Menschenuntergebracht wurden. Alsder Zug von Elenden durch Gnesenzog, wurden die Menschen mit Ste<strong>in</strong>enbeworfen und mit Knüppeln geschlagen.Auf dem Gut wurden dieMenschen zu verschiedenen Arbeitene<strong>in</strong>geteilt. Gretel wurde e<strong>in</strong>emUkra<strong>in</strong>er zugeteilt, doch als diesersah, dass Gretel schwanger war,übergab er sie e<strong>in</strong>em jüdischen Tierarzt.Ja, Gretel war schwanger,doch wer war der Vater? Der Judehatte ke<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>der und wollte dasK<strong>in</strong>d später übernehmen. Dieser jüdischeTierarzt half den Deutschen,so gut er konnte. So überließ er denMenschen die Grütze, die eigentlichfür se<strong>in</strong>e Pferde bestimmt war.Gretel war sehr gläubig. Sie beteteoft und bat Gott, ihren Sohn wiederzuf<strong>in</strong>den,und sie bat um e<strong>in</strong>e glücklicheHeimkehr. Doch e<strong>in</strong>es Tagesfiel sie auf die Knie und betete:„Gott, gibt es dich wirklich? Warumwillst du mich nicht erhören? E<strong>in</strong>Ste<strong>in</strong> müsste sich doch erbarmen!“Und dann stand sie auf und sagte:„Es gibt ke<strong>in</strong>en Gott“, und sie wurdeungläubig. Aber nicht für immer. Soverg<strong>in</strong>gen sieben Monate <strong>in</strong> demLager. Gretel betete nie mehr, hatteaber neben ihrem eigenen Leid vielMitgefühl für die leidenden Menschenum sie herum. Sie vergossviele Tränen, auch aus Mitgefühl fürdie Pferde, die krank und elend warenund unbarmherzig behandeltwurden. Im Lager schlief man aufStrohpritschen, <strong>in</strong> denen es vonLäusen und Flöhen nur so wimmelte.Gegessen wurden Grütze und Pferdefleisch.Im Oktober 1945 wurden alleschwangeren und kranken Frauen <strong>in</strong>Lastwagen gepackt, nach Berl<strong>in</strong> gefahrenund auf die Straße gesetzt.Jede bekam e<strong>in</strong> Brot, Mehl und e<strong>in</strong>eFlasche Öl. Sie blieben zwei Tageauf der Straße, dann brachte dasStadtkommando von Ostberl<strong>in</strong> sie <strong>in</strong>e<strong>in</strong> Lager bei Strelitz, wo sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emTanzsaal e<strong>in</strong>quartiert wurden. Dieserwar schon überfüllt. Jeden Tag starbendie Menschen vor Hunger undKälte und viele an Typhus.Gretel war nun hochschwanger. Dalernte sie e<strong>in</strong>e Frau kennen, die ihre<strong>in</strong>es Tages zuflüsterte: „Liebe, guteFrau, Sie tun mir so leid, ich sehe,wie tapfer Sie trotz allem s<strong>in</strong>d. Ichwohne bei e<strong>in</strong>er Hausfrau imDienstmädchenzimmer. Heute willich schwarz <strong>in</strong> den Westen, die Frauweiß nichts davon. Sie können me<strong>in</strong>Zimmer haben.“ So wurde es gemacht.Gretel überraschte amnächsten Morgen die Hausfrau. Zuerstgab es Ärger und böses Blut,aber die Frau nahm den Tauschdann h<strong>in</strong>.58
Die armen Flüchtl<strong>in</strong>ge lebten von Pilzen,selbst die Blätter von den Bäumenwaren ihre Nahrung. AufSchutthalden wurden Kartoffelschalengesammelt und auf der Küchenplattegebraten. Gretel g<strong>in</strong>g auchbetteln, aber trotz ihres Zustandeswurden ihr die Türen nicht geöffnet.„Wir heven nix, wir geven nix!“ Sog<strong>in</strong>g Gretel oft nachts aufs Feld undsuchte Kartoffeln, die sie sich für denW<strong>in</strong>ter sammelte, um etwas zumEssen zu haben, wenn das K<strong>in</strong>d dawar. Am 15. Dezember kam dasK<strong>in</strong>d zur Welt. Unter den Lagerleutenwar e<strong>in</strong>e Hebamme, die Gretel half.Der Bürgermeister sorgte endlichdafür, dass den Lagerleuten e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>geMenge an Lebensmitteln zugeteiltwurde. So wurde pro Kopf e<strong>in</strong>halbes Pfund Zucker und e<strong>in</strong> PfundMehl im Monat ausgegeben. AlsGretel an das Versteck g<strong>in</strong>g, um dieKartoffeln zu holen, auf die sie ihreganze Hoffnung gesetzt hatte, wardas Versteck leer. Gretels Entsetzenwar groß. Sie war verzweifelt. Wiesollte sie ihr K<strong>in</strong>d durchbr<strong>in</strong>gen? Esgab ke<strong>in</strong>e Pilze mehr und ke<strong>in</strong>e Blätter.Die Brust war leer, das Kle<strong>in</strong>ewe<strong>in</strong>te vor Hunger, und Gretel we<strong>in</strong>tevor Trostlosigkeit. Sie nahm dasK<strong>in</strong>d <strong>in</strong>s Bett, wickelte es fest e<strong>in</strong>,um es zu ersticken. Sie konnte dasWe<strong>in</strong>en nicht mehr ertragen. Da g<strong>in</strong>gmit e<strong>in</strong>em Mal die Tür auf und e<strong>in</strong>Russe kam here<strong>in</strong>. „Was machenSie da?“, fragte er. „Wir wollen sterben“,antwortete Gretel. „Wir habennichts mehr zu essen.“ „Und die Wirt<strong>in</strong>hat?“ fragte der Russe. „Ja“, erwiderteGretel. Der Russe verließdas Zimmer und brachte nach e<strong>in</strong>erhalben Stunde Gretel e<strong>in</strong>en SackKartoffeln. Die Freude war bei Gretelriesig groß, aber der Hass der Wirt<strong>in</strong>war größer. Diese Kartoffeln rettetenGretel und ihrem K<strong>in</strong>d das Leben.Aus e<strong>in</strong>er Büchse machte Gretel e<strong>in</strong>Reibeisen, aß selber die Schalen undgab das Innere dem K<strong>in</strong>d. So verg<strong>in</strong>gder W<strong>in</strong>ter, im Frühl<strong>in</strong>g halfenjunge Brennnesseln weiter, aus denenGretel Sp<strong>in</strong>at kochte.Im Mai erlaubten die Russen, dieerste Post zu schreiben. Gretel meldetesich bei ihren Eltern <strong>in</strong> Ostpreußenund bekam tatsächlich Antwort.Unter dem <strong>Vor</strong>wand, mit dem K<strong>in</strong>dzum Arzt nach Berl<strong>in</strong> zu müssen, erhieltGretel von der Behörde die Erlaubniszu reisen. Von Berl<strong>in</strong> ausmachte sie sich nach Ostpreußenauf. Sie erreichte nach 18 Tagen –unter unbeschreiblichen Umständen– ihre Heimat. Doch ihre Eltern erkanntenihre Tochter nur schwer, siewar e<strong>in</strong> zerlumptes, verschwollenesWesen. Dann war wohl die Freudedoch groß; aber das Russenk<strong>in</strong>dwar für sie e<strong>in</strong>e Schande. Das trafdie arme Gretel so schwer, dass siezusammensank und wochenlangdarniederlag.Die Mutter wollte ihr Kle<strong>in</strong>es <strong>in</strong>s Waisenhausgeben; aber Gott erhörteGretels Gebete. Das K<strong>in</strong>d wurde nichtaufgenommen. Dafür nahm fürs erstedie Schwester das Kle<strong>in</strong>e zu sich,bis Gretel gesünder wurde und diePflege selbst übernehmen konnte.Gretels Mutter gewöhnte sich allmählichan das hübsche, kle<strong>in</strong>eMädchen und gewann es auch lieb.Nach acht <strong>Jahren</strong> heiratete Gretelund lebt bis heute noch recht zufrieden<strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>.Nur etwas bedrückt sie schwer: dasSchicksal ihres Sohnes Toni. AlsGretel im Lager <strong>in</strong> Strelitz war, ver-59
suchte sie e<strong>in</strong>ige Male, <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> nachihrem Sohn zu forschen. Sie erfuhr,dass die Leute, denen sie bei ihrerVerschleppung das K<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>terlassenhatte, von den Polen nach Berl<strong>in</strong>vertrieben wurden. Dort hatten siedas K<strong>in</strong>d noch bei sich. Dann verlorensich die Spuren. Viel später erfuhrGretel, dass e<strong>in</strong>e Schwester dasK<strong>in</strong>d ohnmächtig auf e<strong>in</strong>er Bank <strong>in</strong>Berl<strong>in</strong> gefunden hatte und mit <strong>in</strong>sWaisenhaus nahm.Gretel forschte über das Rote Kreuz<strong>in</strong> Warschau und Berl<strong>in</strong> und hatte 14lange Jahre ke<strong>in</strong>en Erfolg. Sie betete<strong>in</strong>brünstig zu Gott und bat ihn umHilfe. Und e<strong>in</strong>es Tages kam ausHamburg vom Roten Kreuz dieNachricht, dass e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>d se<strong>in</strong>e Muttersucht. Gretel erkannte auf demFoto, dass es ihr Sohn sei und nahmvoller Freude Verb<strong>in</strong>dung auf. Doches dauerte noch e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb Jahre,bis sie die Erlaubnis bekam, zu ihremSohn zu fahren. Sie konnte dasWiedersehen nicht erwarten. Wieviele Erlebnisse sollten ausgetauschtwerden! Wie mag er heute leben?Wie freute sie sich darauf, ihn <strong>in</strong> dieArme zu nehmen!Und dann kam e<strong>in</strong>e furchtbare Enttäuschung.Mit ihrer Tochter zusammenfuhr Gretel 36 Stunden mitder Bahn von Allenste<strong>in</strong> nachDeutschland, bis sie das Ziel erreichte.Von der fremden Frau, die denSohn aufgenommen hatte, wurdesie eiskalt empfangen. Der Sohnkam mittags. Gretel wollte ihn <strong>in</strong> dieArme nehmen. Doch er lehnte abund sagte kalt: „Ich habe gehört,dass du me<strong>in</strong>e Mutter bist“, das waralles. Der Sohn war <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er kaltenAtmosphäre groß geworden. Materiellhatte er alles, was er brauchte.Aber Wärme und Liebe fehlten ihm.Drei Wochen blieb Gretel dort, abersie fand ke<strong>in</strong>en Weg zu dem Herzenihres Jungen.Auch als Toni heiratete, bessertesich das Verhältnis Mutter-Sohnnicht. Die Pflegeeltern ihres Sohneshaben Gretel öfter zu verstehen gegeben,dass alle, die <strong>in</strong> Polen wohnen,auch so e<strong>in</strong> Ges<strong>in</strong>del wie diePolen s<strong>in</strong>d. Sie wissen nicht, wie vieleDeutsche noch <strong>in</strong> ihrer alten Heimatleben und wie viele schwereSchicksale der unsägliche Krieg mitsich gebracht hat.Papst Johannes Paul II. wurde Ehrenbürger der StadtAllenste<strong>in</strong>Der Gedanke, Papst Johannes Paul II. die Ehrenbürgerschaft der Stadt Allenste<strong>in</strong>anzutragen, entstand, nachdem der Papst der Stadt das Mosaik-Marienbildnis, das im Hohen Tor (Altstadtseite) angebracht ist, zum 650.Stadtjubiläum geschenkt hatte. Am 28.4.2004 wurde das Marienbildnis <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erMauernische des Hohen Tores angebracht und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er feierlichen Zeremoniean diesem neuen Standort von Erzbischof Dr. Edmund Piszcz und imBeise<strong>in</strong> des Stadtpräsidenten e<strong>in</strong>geweiht.<strong>60</strong>
Papst Johannes Paul II. und Erzbischof Piszcz(aus der Allenste<strong>in</strong>er Diözesanzeitung)Ausschlaggebend für die Ehrenbürgerschaft waren auch die guten Kontaktedes Papstes zum Ermland und der Stadt Allenste<strong>in</strong>, die seit langer Zeit bestehen.Als junger Krakauer Geistlicher machte er mit Jugendlichen Camp<strong>in</strong>gurlaub<strong>in</strong> der Nähe von Allenste<strong>in</strong> und <strong>in</strong> der Stadt selbst. Viele Jahre später, am11. September 1977, vertrat er bereits als Kard<strong>in</strong>al den erkrankten polnischenPrimas Wyszynski während der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum derMarienersche<strong>in</strong>ung im Wallfahrtsort Dietrichswalde bei Allenste<strong>in</strong>. In der Allenste<strong>in</strong>erKonkathedrale St. Jakobus hatte er während dieses Allenste<strong>in</strong>-Aufenthaltes gepredigt. Unvergessen bleibt auch se<strong>in</strong>e Visite bereits als PapstJohannes Paul II. <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> am 6. Juni 1991. Zu erwähnen bleibt auch dieErhebung des Bistums Ermland zum Erzbistum Ermland am 25. März1992.All diese Fakten unterstützten die Idee, dem Oberhaupt der katholischenKirche die Ehrenbürgerschaft der Stadt Allenste<strong>in</strong> anzutragen. Der Präsidentder Stadt Allenste<strong>in</strong>/Olsztyn Malkowski begab sich im Auftrag derStadtverwaltung und mit Zustimmung der Diözese Ermland nach Rom, umPapst Johannes Paul II. zu bitten, die Ehrenbürgerschaft der Stadt Allenste<strong>in</strong>/Olsztynanzunehmen. Die treue Haltung des Ermlandes zur katholischenKirche würdigend und se<strong>in</strong>e persönlichen Kontakte zur Stadt Allenste<strong>in</strong>/Olsztyn und se<strong>in</strong>er Bewohner betonend, stimmte er dieser Bitte gern zu.61
Übergeben wurde die Ehrenbürgerurkunde am Dienstag, dem 1. März 2005im Gemeli-Kl<strong>in</strong>ikum <strong>in</strong> Rom an den Sekretär des Heiligen Vaters, ErzbischofStanislaus Dziwisz. Aus Krankheitsgründen konnte der Papst die Ehrenbürgerurkundenicht persönlich entgegennehmen. E<strong>in</strong>e Delegation aus sechsPersonen aus Allenste<strong>in</strong>/Olsztyn mit dem Stadtpräsidenten Malkowski, dem<strong>Vor</strong>sitzenden des Stadtrates Dabkowski, zwei weiteren Ratsvertretern sowi<strong>eV</strong>ertretern der katholischen Kirche Allenste<strong>in</strong>s, den Geistlichen Dr. Andrzej Les<strong>in</strong>skiund Zolnierzkiewicz, überreichten die Ehrenbürgerurkunde. Neben dieserUrkunde wurde auch e<strong>in</strong>e Replik der Bronzetür der Basilika St. Jakobus <strong>in</strong>Allenste<strong>in</strong> überreicht, auf der auch die Visite des Papstes <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> dargestelltist. Aus Allenste<strong>in</strong> waren auch 150 Personen mit drei Bussen zu diesemAnlass nach Rom angereist, die jedoch auf Grund des Krankheit des Papstesauf e<strong>in</strong>e Audienz verzichten mussten.Am 2. April 2005, e<strong>in</strong>en Monat nach der Entgegennahme der Ehrenbürgerurkundeder Stadt Allenste<strong>in</strong>, ist der Heilige Vater, Papst Johannes Paul II., <strong>in</strong>se<strong>in</strong>en Privatgemächern im Vatikan an den Folgen se<strong>in</strong>er schweren Erkrankunggestorben.Bruno MischkeSt. Jakobus <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> wurde Basilika M<strong>in</strong>orAm 16. November 2004 fanden dieFeierlichkeiten zur Erhebung derKonkathedrale der Erzdiözese ErmlandSt. Jakobus d. Ältere zur BasilikaM<strong>in</strong>or statt.Die Erhebung wurde durch den A-postolischen Nuntius <strong>in</strong> Polen, ErzbischofJozef Kowalczyk zelebriert.Neben Erzbischof Dr. EdmundPiszcz und den WeihbischöfenWojtkiewicz und Jezierski der ErzdiözeseErmland <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> nahmenauch die Bischöfe aus den neuenDiözesen Elb<strong>in</strong>g und Lyck an dieserFeierlichkeit teil.Folgende Kirchen der ErzdiözeseErmland tragen ebenfalls den Titele<strong>in</strong>er Basilika oder Basilika M<strong>in</strong>or:1. der Dom zu Frauenburg – Hauptkathedraleder Erzdiözese – Basilika,62
2. die Kollegiatskirche <strong>in</strong> Guttstadt –Basilika M<strong>in</strong>or,3. die Wallfahrtskirche <strong>in</strong> Dietrichswalde– Basilika M<strong>in</strong>or,4. die Wallfahrtskirche <strong>in</strong> Spr<strong>in</strong>gborn– Basilika,5. die Kirche Mariä Heimsuchung <strong>in</strong>Heilige L<strong>in</strong>de – Basilika M<strong>in</strong>or,6. die St. Georgskirche <strong>in</strong> Rastenburg– Basilika M<strong>in</strong>or,7. die Konkathedrale St. Jakobus d.Ältere der Erzdiözese Ermland <strong>in</strong>Allenste<strong>in</strong> – seit dem 16. November2004 – Basilika M<strong>in</strong>or.Bruno MischkeDas jüdische Totenhaus <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>von dem berühmten Architekten Erich Mendelsohn geplant und erbaut, wirdvon der Allenste<strong>in</strong>er Kulturgeme<strong>in</strong>schaft Borussia übernommen.Das neben dem jüdischen Friedhof an der Seestraße stehende Totenhaus derehemaligen Jüdischen Geme<strong>in</strong>de Allenste<strong>in</strong>s, mitsamt dem Friedhofsgelände,ist am 12. Januar 2005 <strong>in</strong> die Obhut der „Kulturgeme<strong>in</strong>schaft Borussia“ übergebenworden. Der <strong>Vor</strong>sitzende der Borussia, Prof. Robert Traba, und die<strong>Vor</strong>sitzende der Stiftung zur Bewahrung jüdischen Erbes, Monika Krawczyk,unterzeichneten den symbolischen Mietvertrag mit 30 <strong>Jahren</strong> Laufzeit.Wie Prof. Traba anschließend erläuterte, wird <strong>in</strong> diesem Gebäude e<strong>in</strong> wissenschaftlich-kulturellesZentrum für die Bevölkerung der Stadt Allenste<strong>in</strong> entstehen.Dar<strong>in</strong> werden sich e<strong>in</strong>e Bibliothek mit angegliedertem Lesesaal, e<strong>in</strong> Archiv,e<strong>in</strong>e Galerie, e<strong>in</strong> offenes Kulturzentrum sowie e<strong>in</strong> Verlagszentrumbef<strong>in</strong>den. Es wird aber auch Platz für Dauerausstellungen zum religiösen Le-63
en der jüdischen Geme<strong>in</strong>de Allenste<strong>in</strong>s und des Regierungsbezirks Allenste<strong>in</strong>bleiben. Bis diese Pläne mit der Öffnung des Mendelsohn-Hauses Wirklichkeitwerden, werden sicher noch drei Jahre vergehen, sagte Prof. Traha.Auch die Pflege und Erhaltung des jüdischen Friedhofes gehören dann zu denAufgaben der Kulturgeme<strong>in</strong>schaft Borussia.Anmerkung des Verfassers: Erst im Jahre 1525 genehmigte Herzog Albrechtvon Hohenzollern die Ansiedlung von Bürgern jüdischen Glaubens für die GebieteOstpreußens. Die erste Jüdische Geme<strong>in</strong>de entstand etwa um das Jahr1700 <strong>in</strong> Königsberg. Die preußische Staatsbürgerschaft erhielten sie erstnach dem Jahre 1812. In Allenste<strong>in</strong> lebten im Jahre 1895 erst 588 Juden, alsogerade 2,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Sie siedelten sich <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>vorwiegend im südlichen Teil der Stadt an, um die Liebstädter Straßeherum.Tomasz Kursaus der polnischen Zeitung „Gazeta Wyborcza Olsztyn“gekürzt und übersetzt von Bruno MischkeAllenste<strong>in</strong>er Gesellschaft Deutscher M<strong>in</strong>derheit (AGDM)www.agdm.olsztyn.plHaus Kopernikus, ul. Partyzantów 3, PL 10-522 OlsztynTel. / Fax 0048 89 523 6990, Email agdm_allenste<strong>in</strong>-olsztyn@o2.plÖffnungszeiten: Di, Do und Fr 9 bis 12 Uhr, Mi 13 bis 16 Uhr.Die AGDM ist Besuchern gerne bei der Suche nach Privatquartieren behilflich.E<strong>in</strong>zelreisende können auch im Haus Kopernikus übernachten.64
LESERBRIEFEAllenste<strong>in</strong> gestern – Olsztyn heuteWeihnachten 2003 schlug me<strong>in</strong>e Tochter Elke e<strong>in</strong>e Reise <strong>in</strong> me<strong>in</strong>e HeimatstadtAllenste<strong>in</strong> vor. Da ich seit 1989 schon mehrmals dort war, übernahm ichdie <strong>Vor</strong>bereitung der Reise. Mit sieben Personen wollten wir im August 2004<strong>in</strong> zwei Autos nach Ostpreußen fahren. Im Internet hatte ich Angebote überHotels und Pensionen e<strong>in</strong>geholt. Unsere Wahl fiel auf die Pension Laska <strong>in</strong>Deuthen, <strong>in</strong> der wir vier Zimmer buchten.Am 8. August 2004 um 7.00 Uhr g<strong>in</strong>g es dann auf der Autobahn RichtungStett<strong>in</strong> nach dem Grenzübergang Pomellen/Kolbaskowo und dann weiter ü-ber Bromberg, Graudenz, Osterode, Deuthen. Nach 12 ½ Stunden Fahrt mitdrei Pausen waren wir am Ziel angelangt und wurden von Eugenius Laskaherzlich begrüßt. Schnell wurde das Gepäck auf die Zimmer verteilt, und mite<strong>in</strong>em L<strong>in</strong>ienbus g<strong>in</strong>g es noch <strong>in</strong> die Altstadt zum Essen <strong>in</strong> e<strong>in</strong> griechischesLokal am Hohen Tor.Am nächsten Tag erfolgte nach e<strong>in</strong>em ausgiebigen Frühstück die Besichtigungder Altstadt mit Jakobikirche, Schloss, Pfarrkirche, Hohem Tor, altemRathaus, Laubengängen und Johannisbrücke. Eugenius hatte für e<strong>in</strong>en Tagspäter e<strong>in</strong>en Kle<strong>in</strong>bus mit Fahrer zu e<strong>in</strong>er Fahrt nach Zoppot und Danzig bestellt.Zu Hause hatte ich e<strong>in</strong> umfangreiches Programm erstellt. Aber me<strong>in</strong>eLeute wollten auch mal richtig faulenzen, im Garten liegen, lesen und Kartenspielen. So waren wir noch mit dem Auto <strong>in</strong> Marienburg, im Freilichtmuseumbei Hohenste<strong>in</strong>, am schönsten Fluss <strong>in</strong> Masuren, der Krutyna, und <strong>in</strong> Nikolaiken.Mit der polnischen Eisenbahn PKP fuhren wir zu e<strong>in</strong>er Wanderung umden Schill<strong>in</strong>gsee nach Alt-Jablonken. Gerne hätte ich noch den OberländerKanal, Heilige L<strong>in</strong>de, Frauenburg und Grunwald gezeigt.Die meiste Zeit blieben unsere Autos <strong>in</strong> der Garage. Zu Fahrten <strong>in</strong> die Stadtnutzten wir den L<strong>in</strong>ienbus. Der Besuch des Sportplatzes Jakobstal war fürmich e<strong>in</strong>e Enttäuschung. Wo e<strong>in</strong>st H<strong>in</strong>denburg Allenste<strong>in</strong> gegen Schalkespielte, entsteht langsam e<strong>in</strong> Biotop. Zur Bushaltestelle g<strong>in</strong>gen wir am Mummelteichvorbei durch die Parkanlagen <strong>in</strong> Jakobsberg. Das Abstimmungsdenkmalist verschwunden. Es passt nicht <strong>in</strong> die heutige Geschichte. Mit e<strong>in</strong>emkle<strong>in</strong>en Motorboot fuhren wir von dem Anleger an der Badeanstalt aufdem Okullsee bis nach Abstich. Viel Spaß hatten wir beim Baden im Okullseean der Halb<strong>in</strong>sel h<strong>in</strong>ter dem Flugplatz. Am Abend bummelten wir durch dieAltstadt vom Hohen Tor bis zur Johannisbrücke. Die letzten Baulücken s<strong>in</strong>dhier geschlossen, und es ist e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kaufs- und Flaniermeile entstanden, aufder reges Leben herrscht.Von me<strong>in</strong>em polnischen Freund Stanislaw waren wir zu se<strong>in</strong>em 80. Geburtstage<strong>in</strong>geladen und lernten polnische Gastfreundschaft kennen. Stanislawwohnt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Plattenbau an der alten Feuerwehr. Am Stadtrand s<strong>in</strong>dmehrere Siedlungen <strong>in</strong> Plattenbauweise entstanden. Die Stadt ist auf über65
170.000 E<strong>in</strong>wohner angewachsen. Es gibt <strong>in</strong>zwischen Großmärkte wie Realmit 35 Kassen, Le Clerk, Max Duet, Baumärkte und e<strong>in</strong>e Markthalle.Die Tage <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> verg<strong>in</strong>gen viel zu schnell und haben allen sehr gut gefallen.In der Pension Laska waren wir gut untergebracht und versorgt. Gerngebe ich Tipps zu Reisen nach Allenste<strong>in</strong>. Adresse der Pension: Eugen Laskaulica Owocowa 19, 10-803 Olsztyn 9. Tel./Fax: 0048-89/5271144, email: e-laska@wp.plHans-Günter Kanigowski, Rabenrodestr. 2b, 38110 BraunschweigTel.: 05307/5335, email: Hans-Guenter@Fam-Kanigowski.deFolgende Neuigkeitenaus der „Gazeta Olsztynska“ hat Walburga Klimek für uns:Die Stadt Allenste<strong>in</strong> hat mit der Firma Michel<strong>in</strong> (Eigentümer der Reifenfabrik <strong>in</strong>Allenste<strong>in</strong>) e<strong>in</strong>en Vertrag unterschrieben. Die Fabrik wird ausgebaut, und <strong>in</strong>Zukunft sollen 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.66Pierre Michallat, der Vertreter der Firma Michel<strong>in</strong> undJerzy Malkowski, der Präsident der Stadt Allenste<strong>in</strong>nach der Unterzeichnung des VertragesAnfang Februar gab es e<strong>in</strong>e Sensation: Zum ersten Mal wurde <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>e<strong>in</strong>e Herzoperation durchgeführt, e<strong>in</strong>em Patienten wurden zwei Bypässe e<strong>in</strong>gesetzt.Alles ist gut gegangen. Weitere Patienten warten ebenfalls auf diesenE<strong>in</strong>griff. Bis Ende des Jahres sollen noch <strong>60</strong>0 Personen operiert werden.Die Stadtverwaltung hat verschiedene Investitionen geplant. U.a. soll e<strong>in</strong> Gebäudemit e<strong>in</strong>em Konzertsaal für die Allenste<strong>in</strong>er Philharmonie errichtet werden.Unlängst war e<strong>in</strong> Wettbewerb für Architekten ausgeschrieben worden.28 Projekte wurden e<strong>in</strong>gesandt. Den ersten Preis erhielt e<strong>in</strong>e Firma aus Posen.Ob dieser Plan verwirklicht wird, ist aber noch fraglich. Der Bau der Phil-
harmonie ist seit langer Zeit e<strong>in</strong> Thema. Bis jetzt ist das SymphonieorchesterUntermieter <strong>in</strong> der Musikschule.Die Mühle an der Eisenbahnbrücke <strong>in</strong> der Nähe des Bahnhofs ist seit e<strong>in</strong>igerZeit außer Betrieb. Das Gebäude wurde zum Verkauf angeboten. <strong>Vor</strong> e<strong>in</strong> paarTagen las ich <strong>in</strong> der Zeitung, dass sich e<strong>in</strong> Käufer gefunden hat, er will <strong>in</strong> demGebäude e<strong>in</strong> Warenhaus e<strong>in</strong>richten.Sonst gibt es nicht viel zu berichten. Den W<strong>in</strong>ter haben wir nun h<strong>in</strong>ter uns, <strong>in</strong>den nächsten Tagen soll es wärmer werden. Ende März hatten wir nochNachtfrost bis –7° C. Stellenweise liegt noch Schnee, aber im Garten s<strong>in</strong>d dieersten Schneeglöckchen aus der Erde gekommen.Die 89-jährige Eva Czimczik aus Travemünde, früher wohnhaft <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>,Adolf-Hitler-Allee, schickt uns dieses Mai-Gedicht und schreibt dazu, dass siesich an e<strong>in</strong>en 1. Mai <strong>in</strong> tiefem Schnee er<strong>in</strong>nern kann, woraufh<strong>in</strong> sie und ihreFreund<strong>in</strong>nen dieses bekannte Lied damals umgedichtet haben. Sie hat es nunaus ihrer Er<strong>in</strong>nerung aufgeschrieben und uns geschickt.Der Mai ist gekommen, bei uns fällt noch Schnee.Ke<strong>in</strong> grünendes Blättchen, woh<strong>in</strong> ich auch seh‘.Die sommerlichen Fetzen, die hängen noch im Schrank,wer den Pelz muss versetzen, der friert und wird krank!Waldmeister florieret im Schaufenster fe<strong>in</strong>,er wird importieret vom Rhe<strong>in</strong> und vom Ma<strong>in</strong>.Wir tr<strong>in</strong>ken den Maitrank im gefütterten Rock,er ist unser Labsal, doch wir nennen ihn Grog!Es stürmet und wettert noch immer da drauß‘,da wand’re, wer Lust hat, ich bleibe zu Haus.Der Ofen ist warm und die Fenster s<strong>in</strong>d zu,ostpreußischer Frühl<strong>in</strong>g, wie schön bist doch Du!Anmerkung der Redaktion: Es muss der 1. Mai 1935 gewesen se<strong>in</strong>,an dessen tiefen Schnee ich mich auch noch gut er<strong>in</strong>nere.Me<strong>in</strong>e Jugend im Allenste<strong>in</strong>er Kanu-Vere<strong>in</strong>Günther Kraft, Weimarische Straße 2, 10753 Berl<strong>in</strong>, schreibt uns:Da ich leider me<strong>in</strong>er Kriegsverletzung wegen, die mich immer mehr quält,nicht mehr zu den Treffen nach Gelsenkirchen kommen kann, möchte ichmich e<strong>in</strong>mal anders bemerkbar machen und zeigen, dass ich mich noch dazugehörigfühle. In Gedanken b<strong>in</strong> ich noch immer wieder zu Hause <strong>in</strong> der geliebtenHeimat.Und dazu gehörte nun e<strong>in</strong>mal der Okullsee – manche sagten und schriebenauch der „Uckelsee“. Seit me<strong>in</strong>em ersten Schuljahr war er e<strong>in</strong>er der Haupt-67
punkte me<strong>in</strong>es Lebens. Im Sommer war das Bootshaus des AKV me<strong>in</strong> zweitesZuhause, und im W<strong>in</strong>ter liefen wir von dort aus Schlittschuh, und ich er<strong>in</strong>neremich noch an das Motorrad-Rennen auf dem Eis <strong>in</strong> den 30er <strong>Jahren</strong>.So habe ich nun me<strong>in</strong>e Er<strong>in</strong>nerungen an den See und das Bootshaus aufgeschrieben,und vielleicht wird dadurch auch bei anderen Wassersportlern,Seglern, Ruderern, Schwimmern die Er<strong>in</strong>nerung an heimatliche Gefilde wiederetwas aufgefrischt:In me<strong>in</strong>er frühen K<strong>in</strong>dheit hatten me<strong>in</strong>e Eltern e<strong>in</strong>en Schrebergarten an derverlängerten Roonstraße. Im Jahre 1926 mussten wir ihn aufgeben, weil dasGelände bebaut werden sollte. Nun war me<strong>in</strong> Vater, im Memelland geborenund <strong>in</strong> <strong>Tilsit</strong> aufgewachsen, von Jugend auf mit Booten vertraut, hatte auf derMemel gerudert und gesegelt, und so entschloss er sich, e<strong>in</strong> Faltboot zu kaufenund <strong>in</strong> den Allenste<strong>in</strong>er Kanu-Vere<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zutreten. Damals war ich im erstenSchuljahr.Es gab verschiedene Firmen, die Faltboote bauten. Unseres war von derBootswerft Klepper. Es war e<strong>in</strong> Zweier; Vater saß h<strong>in</strong>ten, Mutter <strong>in</strong> der Mitte,me<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>er Bruder rückwärts zwischen beiden und ich vorn <strong>in</strong> der Spitze. Dieerste Probefahrt erlebte ich auf der Alle. Wir bauten das Boot auf e<strong>in</strong>er Wiesenahe des Marienhospitals auf, paddelten e<strong>in</strong> paar Kilometer stromauf nachSüden und dann wieder stromab zurück. Das gefiel uns allen gut. Das Bootwurde abgebaut und auf dem kle<strong>in</strong>en Bootswagen wieder <strong>in</strong> die Schillerstraßegebracht. Später schaffte dann Vater e<strong>in</strong> Segel an, das wir auf unseremBoot aufsetzen konnten, dazu Seitenschwerter, so dass man beim Kreuzennicht so sehr abgetrieben wurde.Im Jahre 1926 war von Wassersportfreunden der Allenste<strong>in</strong>er Kanu-Vere<strong>in</strong>AKV gegründet worden. Der erste <strong>Vor</strong>sitzende war der Chef des E-Werks <strong>in</strong>der Königstraße, Dr. Geßner. Später übernahm der Studienrat vom Gymnasium,Walter Preuß, dieses Amt. Das Haus am Okullsee war das dritte Bootshausdort, nachdem sich Ruderer und Segler bereits Häuser gebaut hatten.68
H<strong>in</strong>ter den Bootshäusern landwärts befand sich das Wasserwerk. UnserBootshaus bestand damals aus e<strong>in</strong>em etwas höheren quadratischen Haupthausund e<strong>in</strong>em flachen Nebenbau, der im Laufe der Zeit immer weiter verlängertwurde. Zuletzt sah es mit allen Stegen so aus, wie es auf dem Foto zusehen ist. So übernahmen es dann auch die Polen. Leider ist es dann <strong>in</strong> denersten <strong>Jahren</strong> der polnischen Herrschaft abgebrannt. Heute steht e<strong>in</strong> ganzanderes Bootshaus dort.Im Jahre 1930 gab es e<strong>in</strong> großes Vere<strong>in</strong>sfest, das <strong>in</strong> der Badeanstalt stattfand.Wenn ich dieses Bild betrachte, versuche ich, e<strong>in</strong>zelne Personen zu erkennen.Da sitzt rechts der Rechtsanwalt Bortz, ich f<strong>in</strong>de die mit uns befreundeteFamilie Krumm mit ihren Töchtern Inge und Janne, die Familie Broscheitmit Klaus und Annemarie, den Vere<strong>in</strong>svorsitzenden Stud.Rat Walter Preußvom Gymnasium – er hatte am Bootshaus auch noch e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Segeljolle –,die Familien Oelberg, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zweier-Kanadier paddelten, Stud.Rat Dr.Ehrhardt von der Copernicus-Schule mit Frau und Tochter Sigrid, sie hattene<strong>in</strong> Paddelboot ganz aus Eisen, Stud.Rat Niestroy, auch von der Copernicus-Schule, die beiden Damen Liebe, die Familie Lappoen, Familie Mehlow mitder Ursel, Familie Borchert mit den Jungen Siegfried und Peter, die BrüderRogalli, Major Seck mit Familie, Frau Dietrich mit ihrem Sohn und natürlichauch me<strong>in</strong>e Eltern. Die drei Knaben, die da vorn sitzen, s<strong>in</strong>d von rechts me<strong>in</strong>Freund Klaus Broscheit, me<strong>in</strong> Bruder Gerhard und ich.Der Okull-See, unser Paddelrevier, hatte vier Teile, die durch See-Engen verbundenwaren. Der östliche Teil, an dem die Bootshäuser standen, war das<strong>Vor</strong>derwasser. Dort befand sich auch die Badeanstalt. Das Motorschiff „GeheimratBelian“ hatte se<strong>in</strong>e Landungsbrücke zwischen Segler- und Ruder-69
haus. Von dort aus konnte man nach Abstich und Göttkendorf „schippern“.Das <strong>Vor</strong>derwasser hatte westlich der Badeanstalt e<strong>in</strong>e schmale Bucht, die„Bl<strong>in</strong>d-Arm“ oder „Bl<strong>in</strong>ddarm“ genannt wurde. Bei den Polen heißt sie „ZatokaMila“ (Liebesbucht). Auf der Südseite reicht e<strong>in</strong>e Halb<strong>in</strong>sel <strong>in</strong> den See, die das<strong>Vor</strong>der- vom Mittelwasser trennt. Weil sie auf der Landkarte an die dänischeHalb<strong>in</strong>sel er<strong>in</strong>nert, nannten sie die Okullseeschipper Kap Skagen.Das Mittelwasser – die Polen nennen es „Pacyfik“ – hat zwei weitere schmaleAusgänge, e<strong>in</strong>en nach Norden zum Göttkendorfer Teil und e<strong>in</strong>en nach Westenzum H<strong>in</strong>terwasser. Diese Enge, wo es am Südufer gleich tief wurde, wardas Ziel vieler Segler, weil sie mit den Booten bis ans Ufer fahren konnten.Wenn ich mich recht er<strong>in</strong>nere, nannten sie diese Stelle „Adams<strong>in</strong>sel“.Das H<strong>in</strong>terwasser reichte bis Abstich. Dort befand sich direkt am Ufer e<strong>in</strong>eGastwirtschaft, wo unser Vere<strong>in</strong> meist das An- und Abpaddeln feierte. Amsüdlichen Ufer hatte es auf dem Exerzierplatzgelände direkt am Strand e<strong>in</strong>eQuelle. Diese Stelle fuhren meist die Paddler an.Die großen Feste im Vere<strong>in</strong> waren im Frühjahr das Anpaddeln und im Herbstdas Abpaddeln. Dann war die ganze Paddelflotte unterwegs. Das Ziel warmeist der Krug <strong>in</strong> Abstich, wo gefeiert und Kaffee getrunken wurde,. Auchwurde Ball gespielt. Dazwischen gab es noch e<strong>in</strong> Sommerfest, und ich er<strong>in</strong>neremich, dass die Jungens am nächsten Tag im Bootshaus herumsuchtenob da nicht vielleicht e<strong>in</strong>e Sektflasche noch halbvoll zu f<strong>in</strong>den wäre.70
Das ganze Südufer des Okullsees vom „Bl<strong>in</strong>d-Arm“ bis kurz vor Abstich gehörtezum Exerzierplatz Deuthen der Reichswehr. Dort am Ufer hatten dieWassersportvere<strong>in</strong>e ihre Sonntagsziele. Viele der Kanuten paddelten zu dererwähnten Quelle. Man konnte mit dem frischen Wasser Kaffee kochen, undman konnte dort auch zelten und übernachten. Man konnte dort baden und<strong>in</strong> der Sonne liegen. Die Herren spielten auch oft Faustball.Für die K<strong>in</strong>der war der Exerzierplatz e<strong>in</strong> Abenteuerspielplatz-Paradies. Wirspielten Indianer und Trapper, schossen mit Pfeil und Bogen auf Ungeheuer,bauten Burgen, spielten Räuber und Soldat. Zwischendurch wurde gebadet,wir lernten schwimmen, tauchen und auf Bäume klettern. Inzwischen hattendie Mütter auf den Spirituskochern das Essen heiß gemacht. In den Sommerferienwurde auch oft gezeltet. Es war e<strong>in</strong>e herrliche Zeit!In den 30er <strong>Jahren</strong> wurde Wert auf Leistungssport gelegt. Der Vere<strong>in</strong> erwarbRennboote: E<strong>in</strong>er, Zweier und auch Zehner-Kanadier. Ich <strong>in</strong>teressierte michbesonders für den E<strong>in</strong>er. Das gestattete man mir auch – <strong>in</strong>zwischen war ichschon 16. Nachdem ich e<strong>in</strong>- bis zweimal gekentert war, hatte ich den Bogenraus, man konnte so richtig durch die Wellen flitzen. Aber dann tra<strong>in</strong>ierte ichmit me<strong>in</strong>em Freund Hellmuth Schiersch<strong>in</strong>g mit dem Zweier. Auf e<strong>in</strong>er Regattamit den Osteroder Kanuten ließen wir die beiden Osteroder Männer klar h<strong>in</strong>teruns. Wir waren beide mächtig stolz, als wir uns tags drauf <strong>in</strong> der Allenste<strong>in</strong>erZeitung im Sportteil wiederfanden.Es waren damals viele neue Gesichter im Bootshaus: der schon genannteHellmuth, se<strong>in</strong>e Schwester und der Schwager, me<strong>in</strong> Freund und KlassenkameradUlrich Hoffmann, viele länger dienende Soldaten aus der großen Allenste<strong>in</strong>erGarnison – ich sehe manche noch vor mir, aber auf ihre Namenkann ich mich nicht mehr bes<strong>in</strong>nen. Mit Hellmuth fuhr ich noch Regatten <strong>in</strong>Osterode und Elb<strong>in</strong>g, immer mit Erfolg. Leider ist er auch schon nicht mehr <strong>in</strong>dieser Welt.Me<strong>in</strong> Okull-See, me<strong>in</strong> Bootshaus, me<strong>in</strong> Boot, me<strong>in</strong>e Heimatfreunde – wennich e<strong>in</strong>en glücklichen Traum habe, gleite ich über die Wellen des Okull-Sees.Grabsuche – wer kann helfen?Me<strong>in</strong>e Mutter – Emilie H<strong>in</strong>z geb. Falk (21.10.1915) – wurde am 22. Januar1945 <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Kämmereigasse auf der Straße zusammen mit e<strong>in</strong>igenNachbarn (u.a. Frau Steffen, Herr Wölki) von russischen Soldaten erschossen.Ich sah die Toten noch e<strong>in</strong>ige Tage auf dem Schulhof der Eichendorff-Schule(am Anfang der Kämmereigasse, gegenüber der Feuerwache)liegen. Trotz <strong>in</strong>tensiver Bemühungen konnte ich bisher leider nicht <strong>in</strong> Erfahrungbr<strong>in</strong>gen, wo sie ihre endgültige Ruhestätte gefunden haben.Wer hat davon gehört oder gelesen? Wer kennt jemanden, der darüber etwaswissen könnte? Für e<strong>in</strong>e Antwort wäre ich sehr dankbar.Bodo H<strong>in</strong>z, früher Kämmereigasse 5 <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>,jetzt Beethovenstr. 9, 48691 Vreden, Tel.: 02564-3104171
AUS UNSERER STADTGEMEINSCHAFTProgramm 50. Jahrestreffenvom 16. bis 18. September 2005 <strong>in</strong> Gelsenkirchen – Schloss HorstFREITAG,15.00 Uhr Hotel ibis16. SEPTEMBER 2005 Stadtversammlung19.00 Kolp<strong>in</strong>ghausZwangloses Beisammense<strong>in</strong>SAMSTAG,11.00 Uhr Propsteikirche17. SEPTEMBER 2005 Ökumenische Gedenkandacht13.00 Uhr Schloss HorstEröffnung der Ausstellung„Ostpreußische Impressionen“Öffnung der Bücher- und Verkaufsstände15.00 UhrFeierstunde „50 Jahre Stadtgeme<strong>in</strong>schaft“Musikalische GestaltungBläser- und Posaunenchor Erleunter Leitung von Hans-Günter NowotkaBegrüßungsansprache<strong>Vor</strong>sitzender der Stadtgeme<strong>in</strong>schaftGrußworteOberbürgermeister der Stadt GelsenkirchenPräsident der Stadt Allenste<strong>in</strong>Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen18.00 Uhr Tanz und UnterhaltungKapelle Oskar Delberg24.00 UhrEnde der VeranstaltungSONNTAG,10.00 Uhr Propsteikirche18. SEPTEMBER 2005 Katholischer Gottesdienst10.00 Uhr AltstadtkircheEvangelischer Gottesdienst11.00 bis 13.00 Uhr TREUDANKUnser Heimatmuseum lädt zum Besuch e<strong>in</strong>72
Unsere Reise nach Ostpreußen und Allenste<strong>in</strong>f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> diesem Jahr vom 15. bis 29. Juni statt. <strong>60</strong> Jahre Vertreibung und 50Jahre Stadtgeme<strong>in</strong>schaft Allenste<strong>in</strong> können dazu auch Anlass geben. DasWiedersehen mit der unvergessenen Heimatstadt bleibt aber immer derHauptreisegrund. Doch dieses Mal kommt noch etwas anderes h<strong>in</strong>zu: di<strong>eV</strong>erknüpfung mit e<strong>in</strong>er Urlaubsreise an die Ostseeküste von Stett<strong>in</strong> bis Memelund <strong>in</strong>s Baltikum mit Wilna und Kowno. Die Reiseroute und die Übernachtungsortemachen dies deutlich.Am 15. Juni fährt der Plewka-Reisebus von Düsseldorf ab und nimmt die Mitreisendenan vielen Orten auf, so <strong>in</strong> Gelsenkirchen, Hannover und Berl<strong>in</strong>-Michendorf. Die erste Übernachtung ist <strong>in</strong> Stett<strong>in</strong>, wo es am nächsten Tag e<strong>in</strong>eStadtrundfahrt gibt, bevor es entlang der Ostseeküste über Kösl<strong>in</strong> undStolp nach Danzig weitergeht. Hier kann man schon am Abend e<strong>in</strong>en erstenSpaziergang durch die erstaunlich wiederhergestellte Altstadt machen, durchdie es am nächsten <strong>Vor</strong>mittag e<strong>in</strong>e ausführliche Führung gibt. Auch wer dasberühmte Krantor, den Langen Markt, die Frauengasse und die Marienkirche,den Neptunbrunnen und das Rechtsstädtische Rathaus schon e<strong>in</strong>mal oderöfter gesehen hat, wird bei jedem Gang durch die geschäftigen Straßen mitden prächtigen Bürgerhäusern stets aufs neue begeistert se<strong>in</strong>.Danach geht die Fahrt über den Grenzübergang Heiligenbeil (Mar<strong>in</strong>owo) nachKönigsberg, das jetzt russisch ist und Kal<strong>in</strong><strong>in</strong>grad heißt. Wer die schöneHauptstadt Ostpreußens von früher kennt, wird betrübt se<strong>in</strong> und es am liebstenbeim jetzigen Namen belassen. Dennoch s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige markante Gebäudestehen geblieben, die am <strong>Vor</strong>mittag des vierten Reisetages besucht werden,so der Hauptbahnhof und der Nordbahnhof, die Börse und das Schauspielhaus,e<strong>in</strong>ige Stadttore und vor allem der wiederaufgebaute Dom mit dem unversehrtgebliebenen Kant-Grabmal. Am Nachmittag ist Gelegenheit zum Besuchdes Bernste<strong>in</strong>museums, vielleicht auch des Tiergartens und zu e<strong>in</strong>emStadtbummel.Der fünfte Reisetag ist e<strong>in</strong> Sonntag und bietet als erstes Reiseziel den BadeortRauschen, der im Gegensatz zu Cranz weitgehend se<strong>in</strong>en Charme undse<strong>in</strong>e Betriebsamkeit behalten hat. Über Cranz geht dennoch die Weiterfahrtzur Kurischen Nehrung mit der berühmten Vogelwarte Rossitten nach Nidden,wo wir drei Nächte bleiben. Den sicherlich bekannteste Ort der KurischenNehrung lernen wir am nächsten Tag bei e<strong>in</strong>em Rundgang kennen. Dieblauen Häuser mit den blumengeschmückten <strong>Vor</strong>gärten, die Hohe Düne, deralte Friedhof mit den deutschen und kurischen Grabdenkmälern und natürlichdas Thomas-Mann-Haus vermitteln unvergessliche E<strong>in</strong>drücke.Am siebenten Tag geht es von der Nordspitze der Nehrung mit der Fährenach Memel (Klaipeda), wo uns e<strong>in</strong>e Stadtrundfahrt mit Führung die historischeAltstadt näher br<strong>in</strong>gt. Das alte Rathaus, der Simon-Dach-Brunnen mitdem Standbild von Ännchen von Tharau vor dem Theater und die ehemaligeKaiserliche Hauptpost mit ihrem hohen Turm und dem mittäglichen Glocken-73
spiel s<strong>in</strong>d nur e<strong>in</strong> paar der sehenswerten Baudenkmäler. Der Nachmittagsteht für eigene Erkundungen zur Verfügung. Marktstände mit vielen Bernste<strong>in</strong>angebotenkann man beim Stadtbummel aufsuchen. Danach geht es zurückzum Hotel <strong>in</strong> Nidden.Am nächsten Tag geht die Fahrt über Kaunas (Kowno) mit Gelegenheit zumMittagessen nach Wilna (Vilnius), der Hauptstadt Litauens. Was es da an architektonischenDenkmälern zu sehen gibt, wie die St.-Stanislaw-Kathedrale(Dom), die Kirchengruppe von St. Anna und St. Bernhard, die alte Universitätund den Ged<strong>in</strong>as-Turm auf dem Burgberg mit dem e<strong>in</strong>drucksvollen Rundblicküber die Stadt, das zeigt uns e<strong>in</strong>e ausführliche Besichtigung am neunten Reisetag.Der zehnte Tag br<strong>in</strong>gt uns über Kaunas und Suwalken <strong>in</strong>s südliche Ostpreußen.Treuburg, Lyck und Nikolaiken <strong>in</strong> Masuren liegen auf der weiteren Streckenach Allenste<strong>in</strong>, wo wir im Novotel am altbekannten Okullsee für vier TageQuartier beziehen. Sonnabend, der 25. Juni, ist der „Tag der M<strong>in</strong>derheiten“,an dem sich verschiedene Chöre und Tanzgruppen – auch der deutsche Vere<strong>in</strong>e<strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> – folkloristisch präsentieren. Es bleibt aber auch Zeit für eigeneUnternehmungen wie auch am darauffolgenden Sonntag. Wer nichtmehr ganz rüstig auf den Be<strong>in</strong>en ist, kann sich deutschsprachige Taxifahrerzum Hotel bestellen. Für den 13. Reisetag ist e<strong>in</strong>e Ausflugsfahrt nach Osterode,e<strong>in</strong>e zweistündige Schiffsfahrt auf dem Oberländischen Kanal mit se<strong>in</strong>en„geneigten Ebenen“ und schließlich e<strong>in</strong>e Besichtigung der Marienburg,dem Sitz des e<strong>in</strong>st so mächtigen Deutschen Ordens, vorgesehen.Am 14. und vorletzten Tag geht es zurück über Thorn an der Weichsel, demGeburtsort des auch <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> tätig gewesenen Astronomen Nikolaus Kopernikus,dessen Geburtshaus und vor dem Rathaus auch dessen Denkmalebenso wie die große Johanneskirche bei e<strong>in</strong>em Altstadtbummel zu sehens<strong>in</strong>d. Die letzte Übernachtung erfolgt an diesem Tag im Hotel SEN, ca. 75 kmvor dem Grenzübergang Swiecko-Frankfurt/Oder, den wir am Mittwoch, den29. Juni, passieren. Über Berl<strong>in</strong> und Hannover, das wir gegen 16 Uhr erreichen,geht die Rückfahrt <strong>in</strong>s Ruhrgebiet. Gegen 20 Uhr ist dann auch für dieam weitesten westlich wohnenden Teilnehmer die 15-tägige Superreise beendet.Dr. Ernst JahnkeInformationen über Familie RYSZEWSKI gesuchtNorddeutscher mit familiären Wurzeln <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>/Ostpreußen sucht zur Erstellung v.Biographien/Familienchronik für die eigene Familie (Rudolf Ryszewski, JommendorferStraße, Allenste<strong>in</strong>/Ostpreußen) Personen, die hierzu Angaben machen können bzw.Unterlagen besitzen wie- Kirchenurkunden (Geburts-/Vermählungs-/Sterbedaten) von ca. 1890- 1945,- Belegungslisten der Friedhöfe und Fotos von Friedhöfen und Grabste<strong>in</strong>en bis 1945.Hans J. Ryszewski, Pestalozzistraße 55, 27474 Cuxhaven,Telefon und Telefax: 04721-2 37 2574
AUS UNSERER ALLENSTEINER FAMILIEWir gratulierenDr. He<strong>in</strong>z Daube zum 80. GeburtstagAm 12. August 2005 wird unser Ehrenmitgliedund langjähriger <strong>Vor</strong>sitzenderDr. He<strong>in</strong>z Daube 80 Jahrealt.16 Jahre, von 1983 bis 1999, warHe<strong>in</strong>z Daube <strong>Vor</strong>sitzender derStadtkreisgeme<strong>in</strong>schaft Allenste<strong>in</strong>.Er übernahm das Amt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er für dieStadtkreisgeme<strong>in</strong>schaft sehr schwierigenZeit. Er war es, der die Kreisgeme<strong>in</strong>schaftwieder aufbaute, neueMitarbeiter gewann, zur Geschlossenheitaufrief und neue Wege fand.Ihm verdanken wir die Wiederbelebungder Kontakte zu den Vertreternder Stadt Gelsenkirchen, die er mitgroßem Erfolg betrieb.Unvergessen s<strong>in</strong>d die großen Jahrestreffen<strong>in</strong> Gelsenkirchen, an denenregelmäßig mehrere 1000 Menschenteilnahmen. Das Hans-Sachs-Haus fasste die Massen nicht, sodass e<strong>in</strong> großes Zelt zusätzlich aufgestelltwerden musste. Am Sonntagabendnach diesem Ereignis ludHe<strong>in</strong>z Daube die Stadtvertreter zumDank für ihre Arbeit zu e<strong>in</strong>er gemütlichenRunde e<strong>in</strong>. In fröhlicher undentspannter Atmosphäre wurdeNachlese gehalten. Unvergessens<strong>in</strong>d auch diese Stunden.Als dann nach Beendigung deskommunistischen Regimes 1990 dieBetreuung der deutschen Volksgruppe<strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e neue zentraleAufgabe wurde, setzte sichHe<strong>in</strong>z Daube mit ganzer Kraft für dieProbleme der M<strong>in</strong>derheit e<strong>in</strong>. Nachreiflicher Überlegung legte er denGrundste<strong>in</strong> für die Entstehung des„Haus Kopernikus“ und setzte sichfür die Bereitstellung der Mittel fürden Erwerb e<strong>in</strong>.Alle, die unter se<strong>in</strong>er Regie <strong>in</strong> diesen<strong>Jahren</strong> mit ihm für das Wohl derKreisgeme<strong>in</strong>schaft arbeiteten, denkengerne an diese Zeit und das Engagementvon He<strong>in</strong>z Daube zurück.Alle Allenste<strong>in</strong>er hier und dort dankenHe<strong>in</strong>z Daube für se<strong>in</strong>e Arbeitund se<strong>in</strong>e Gedanken um unsereHeimat. Sie gratulieren mit gutenWünschen für se<strong>in</strong> weiteres Leben.Annemarie Günther75
Paul Genatowski wurde 80Der 17. Februar 2005 war der Tag, an dem „unser Paul“ (Genatowski) <strong>in</strong> denClub der 80-Jährigen aufgenommen wurde. Herzliche Glückwünsche von allen,die ihn kennen und schätzen. Wir alle danken ihm für se<strong>in</strong>en selbstlosenE<strong>in</strong>satz und se<strong>in</strong>e Liebe zur Arbeit, nicht nur im Büro der Stadtgeme<strong>in</strong>schaftüber Jahre h<strong>in</strong>aus.Als Zweitjüngstes von acht K<strong>in</strong>dern der Familie Genatowski ist Paul <strong>in</strong> derSchubertstraße <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> aufgewachsen. Er war engagierter Messdiener <strong>in</strong>der St.-Josefi-Kirche an der Wadanger Straße. Nach der Schulzeit – e<strong>in</strong>schl.Handelsschule – begann er e<strong>in</strong>e Lehre im Landratsamt Allenste<strong>in</strong> bis zur E<strong>in</strong>berufung<strong>in</strong> den Kriegsdienst. Nach der Gefangenschaft kam Paul 1948 zuse<strong>in</strong>er jüngsten Schwester und se<strong>in</strong>er Mutter <strong>in</strong> den Südschwarzwald. DieMutter hat hier auch ihre ewige Ruhe gefunden. Mit drei Schwestern hat PaulKontakt: se<strong>in</strong>e älteste Schwester Angelika ist mit 90 <strong>Jahren</strong> als lustig und unverwüstlichnicht nur <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>/Olsztyn bekannt. Außer der jüngstenSchwester im Schwarzwald lebt e<strong>in</strong>e Schwester <strong>in</strong> Tangermünde.1954 zog es Paul nicht nur <strong>in</strong>s Ruhrgebiet, sondern gleich bis unter Tage.Zunächst war er Kumpel <strong>in</strong> Mülheim, dann <strong>in</strong> Gelsenkirchen „auf Dahlbusch“.Beim ersten Treffen (1954) der Allenste<strong>in</strong>er war Paul schon dabei. Im Rentenalterhat sich der bewährte Junggeselle der Stadtgeme<strong>in</strong>schaft Allenste<strong>in</strong> zurVerfügung gestellt. Das war 1968. Mit Herbert Brede teilte er sich die Arbeit,nicht nur <strong>in</strong> der Geschäftsstelle. Dann musste Paul mit mir das Büro teilen(Ende 1985). Es klappte auf Anhieb gut; denn ich möchte behaupten: „Paul,Du warst und bist e<strong>in</strong> tofter (guter) Kumpel! Halte Dich tapfer, wir brauchenDich noch!Elfriede Hensezum Geburtstag95 Jahre Mathilde Kneffel, geb. Blazijewski, früher Grünberger Weg 19, jetzt47057 Duisburg, Neue Fruchtstr. 14, am 25.04.2005Ursula Bleyer, geb. <strong>in</strong> Braunsberg, dann wohnhaft <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>,Roonstr. 12, jetzt 24116 Kiel, Schillerstr. 19, am 10.05.2005,angezeigt von Lothar Herdis-Engels, Nähr<strong>in</strong>gweg 3,24159 Kiel85 Jahre Gertrud Blazejewski, 44623 Herne, Sod<strong>in</strong>ger Str. 11, St.Elisabeth-Stift, am 07.04.200584 Jahre Franziska Nowacki, geb. Schill<strong>in</strong>g, früher Lötzener Str. 10, jetzt18195 Tess<strong>in</strong>, Am Gärtnergrund 21, am 17.06.200583 Jahre Paul Kaber, früher Zimmerstr. 14, jetzt 27749 Delmenhorst,Klosterdamm 67, am 23.08.1922Christa Haußmann, geb. Graupner, früher Kaiserstr. 11, jetztKarwendelstr. 40, 12203 Berl<strong>in</strong>, am 30.11.200576
82 Jahre Dr. Mart<strong>in</strong> Quedenfeld, früher F<strong>in</strong>kenstr. 19, jetztSchneeglöckchenstr. 20, 10407 Berl<strong>in</strong>, am 01.08.2005Günther Kl<strong>in</strong>gberg, aus der Schillerstr. 31,jetzt Gundelf<strong>in</strong>ger Str. 21, 10318 Berl<strong>in</strong>, am 21.10.200581 Jahre Ewald Paprotka, früher Schubertstr. 8, jetzt 70599 Stuttgart,Im Asemwald 24/14, am 16. 07.2005Walter Schmidt, früher Liebstädter Str. 22, jetztGroß-Berl<strong>in</strong>er-Damm 52, 12487 Berl<strong>in</strong>, am 27.09.2005Kurt Krießbach, früher Allenste<strong>in</strong>, jetzt Pf<strong>in</strong>gstbrunnenstr. 33,65824 Schwalbach, am 25.10.2005Gert Kehler, Horst-Wessel-Str. 25, jetzt Mendelsonstr. 1,31141 Hildesheim, am 01.03.2005Alfred Manfeldt, früher Allenste<strong>in</strong>, jetzt Westfalenstr. 54,45770 Marl, am 02.01.2005Horst Graupner, früher Kaiserstr. 11, jetzt Im Melchersfeld 54,41468 Neuss, am 06.08.2005Siegfried Wohlfarth, früher Schlageterstr., jetzt Allerskehre 11,22309 Hamburg, am 14.01.2005Hubertus Zühlke, früher Soldauer Str., jetzt Wörthstr. 9, 49082Osnabrück, am 04.08.200580 Jahre Georg Kaber, früher Zimmerstr. 14, jetzt 04932 Prösen,Riesaerstr. 92, am 03.09.2005Maria Krauß, geb. Schill<strong>in</strong>g, früher Lötzener Str. 10, jetzt 18190Sanitz, Buchenweg 23a, am 06.01.2005Hubert Gorny, früher Wadanger Str. 26a, jetzt 57203 Kreuztal,Postfach 1246, am 05.02.2005Horst Goede, früher Wadangerstr. 10, jetzt Allersberg 31,65191 Wiesbaden, am 30.03.2005Otto Kauer, früher Memellandstr. 7, jetzt Leiblstr. 6, 41539Dormagen, am 30.09.200575 Jahre Eva Vollbrecht, geb. Czeczka, früher Lötzener Str. 22, jetzt96100 Selb, Plößberger Weg 36, am 14.09.2005Irmgard Nickel, früher Masurensiedlung, Neidenburger Str. 21,jetzt 33647 Bielefeld, Hauptstr. 133, am 04.04.200574 Jahre Ruth Vogt, geb. Graupner, früher Kaiserstr. 11, jetzt Im Teich 49,64569 Nauheim, am 25.06.200572 Jahre Gerda Zimmermann, geb. Kollender, früher Tannenbergstr. 36b,jetzt 61194 Niddatal, Bogenstr. 7, am 09.03.2005Karl He<strong>in</strong>z Kapte<strong>in</strong>a, früher Roonstr. 83, jetzt 58509 Lüdenscheid,Oenek<strong>in</strong>gerweg 106, am 07.04.200571 Jahre Lothar Wissel<strong>in</strong>g, früher Händelstr. 19, jetzt 18273 Güstrow,Str. d. DSF 54, Tel. 03843/33 44 45, am 29.03.200570 Jahre Peter Barczewski, früher Str. d. SA, jetzt 19406 Ruchow,Dorfstr. 15, am 27.06.200577
Wir gedenkenNachrufGedenktafel <strong>in</strong> der Propsteikirche GelsenkirchenAm 6. April 2005 verstarb <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> der bekannte Schriftsteller, Historikerund ehemalige Richter am Amtsgericht Olsztyn/Allenste<strong>in</strong>, Stanislaw Piechocki,im Alter von 50 <strong>Jahren</strong>. Herr Piechocki war e<strong>in</strong> profunder Kenner der Allenste<strong>in</strong>er<strong>Vor</strong>- und Nachkriegsgeschichte. Aus se<strong>in</strong>er Feder stammen nebenBelletristik auch folgende dokumentarisch recherchierte Bücher zu Allenste<strong>in</strong>erThemen:1. Czysciec zwany Kortau – Fegefeuer Kortau, 19932. Dzieje olsztynskich ulic – Geschichte der Allenste<strong>in</strong>er Straßen, 1994 und 19983. Olsztyn styczen 1945 – Allenste<strong>in</strong> im Januar 1945, e<strong>in</strong> Porträt der Stadt, 20004. Ratusz w Olsztynie – Das Allenste<strong>in</strong>er Rathaus, 20015. Olsztyn magiczny – Das magische Allenste<strong>in</strong>, 2002Herr Piechocki war auch Gast bei unseren Allenste<strong>in</strong>er Treffen und arbeitetegern mit der AGDM (Allenste<strong>in</strong>er Gesellschaft Deutscher M<strong>in</strong>derheit) <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>zusammen, wo er neben <strong>Vor</strong>trägen auch <strong>in</strong>teressante Beiträge für die„Allenste<strong>in</strong>er Nachrichten“, dem Mitteilungsblatt der AGDM lieferte.Se<strong>in</strong> plötzlicher Tod hat nicht nur se<strong>in</strong>e Familie <strong>in</strong> tiefe Trauer gestürzt, der wirhiermit unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen, sondern auch die Stadtgeme<strong>in</strong>schaftAllenste<strong>in</strong> e.V. mit Sitz <strong>in</strong> Gelsenkirchen trauert um ihn.Wir werden Herrn Piechocki e<strong>in</strong> ehrendes Andenken bewahren.Bruno Mischke78
Gregor RadigkMaria Buhlau, geb.Sosnowskigeb. am 13.02.1925, früher Wadanger Str. 15, gest. am15.07.2004 <strong>in</strong> Kassel, angezeigt von Ingrid Kuhngeb. am 04.07.1920, früher Zimmerstr. 10 u. GrünbergerWeg 22, gest. 15.11.2004, zuletzt wohnhaft28195 Bremen, Diepenau 5, angezeigt von ChristelSosnowski, 45966 GladbeckHerbert Skibowski geb. 19.08.1927, früher Liebstädterstr. 18, verst. am15.09.2004 <strong>in</strong> 21031 Hamburg, Habermannstr. 59,angezeigt von der Ehefrau Waltraud SkibowskiGert August geb. 30.07.1924, verst. am 30.03.2004, zuletzt wohnhaft<strong>in</strong> 32361 Pr. Oldendorf, Niederfeldweg 4, angezeigt vonWilhelm Koch, 32361 Pr. OldendorfMartha Czeczka geb. Vogel am 18.03.1910, früher Lötzener Str. 22, verst.am 21.01.2005 <strong>in</strong> Hamburg, angezeigt von Tochter EvaVollbrecht, 95100 Selb, Plößberger Weg 36Magdalena Karp geb. Biernath am 12.04.1921, verst. 21.12.2004, zuletztwohnhaft <strong>in</strong> LeverkusenUrsula Kunze geb. Zimmermann am 01.12.1923 <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>, verst. am15.12.2004, zuletzt wohnhaft <strong>in</strong> 69126 Heidelberg,Konstanzer Str. 51Mathilde Kneffel geb. Blazijewski am 25.04.1910 <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong>,Grünberger Weg 19, verst. Februar 2005, zuletztwohnhaft <strong>in</strong> 47057 Duisburg, Neue Fruchtstr. 14Juliane Redanz geb. Handmann am 23.02.1931 <strong>in</strong> Ortelsburg/Ostpr.,verst. 03.03.2005 <strong>in</strong> Hamburg, zuletzt wohnhaft <strong>in</strong>22880 Wedel, Schulstr. 19Christel Dragon geb. Kollender, früher Liebstädter Str. 45, verst. am30.07.2004 <strong>in</strong> Neunkirchen/Bayern, im Alter von75 <strong>Jahren</strong>, zuletzt wohnhaft <strong>in</strong> 91099 Poxdorf,Mühlweiherweg 5a, angezeigt von Schwester Re<strong>in</strong>hildeSchwartz, CalifornienHermann Tharra geb. 26.05.1913, früher Adolf-Hitler-Allee, verst.07.02.2005, zuletzt wohnhaft <strong>in</strong> 37154 Northeim, Lukas-Cranach-Str. 2a,angezeigt von Sigard Müller, 37154 Northeim, Markt 16Klaus Wagner geb. 17.10.1925, früher Kaiserstr. 19, verst. am25.04.2005, zuletzt wohnhaft <strong>in</strong> 22305 Hamburg,Burmester Str. 979
VERSCHIEDENESOstheim <strong>in</strong> Bad PyrmontSeniorenfreizeitenFreizeiten im Ostheim, das s<strong>in</strong>d geme<strong>in</strong>same Urlaubstage mit e<strong>in</strong>em Programmangebot,das für jeden Gast etwas zu bieten hat. Der Tag beg<strong>in</strong>ntnach dem Frühstück mit morgendlichem S<strong>in</strong>gen oder Gymnastik. Am <strong>Vor</strong>mittagwird Bad Pyrmont mit se<strong>in</strong>en Sehenswürdigkeiten und E<strong>in</strong>kaufsmöglichkeitenerkundet. Nach der wohlverdienten Mittagsruhe laden das Haus odere<strong>in</strong>es der vielen Cafés im Ort zum Kaffeetr<strong>in</strong>ken e<strong>in</strong>, oder man beteiligt sich ane<strong>in</strong>er geführten Wanderung. E<strong>in</strong> Nachmittag ist für e<strong>in</strong>e Halbtagsfahrt <strong>in</strong> dienähere Umgebung reserviert. Am Abend werden Diavorträge oder Videofilme,Tanz- oder Spielabende angeboten, man sieht fern oder spielt geme<strong>in</strong>samKarten und tauscht Er<strong>in</strong>nerungen an die Heimat aus. Am letzten Abend feiernwir nach ostpreußischer Art Abschied, zu dem jeder nach se<strong>in</strong>en Möglichkeitenbes<strong>in</strong>nliche und lustige Beiträge beisteuern kann. Sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaftmit ostpreußischen und ostdeutschen Landsleuten, wie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>ergroßen Familie.SommerfreizeitMontag, 11. Juli bis Montag, 25. Juli 2005, 14 TageHerbstliche OstpreußentageMontag, 26. September bis Donnerstag, 6. Oktober 2005, 10 TageAdventsfreizeitMontag, 28. November bis Montag, 5. Dezember 2005, 7 TageWeihnachtsfreizeitDonnerstag, 15. Dezember 2005 bis Montag, 2. Januar 2006, 18 TageAnmeldungen richten Sie bitte, nur schriftlich, an:Ostheim – Jugendbildungs- und TagungsstätteParkstraße 14, 31812 Bad PyrmontTel.: 05281 – 93 61 0, Fax: 05281 – 93 61 11Internet: www.ostheim-pyrmont.deEmail: <strong>in</strong>fo@ostheim-pyrmont.de80
Kulturzentrum Ostpreußen <strong>in</strong> Ell<strong>in</strong>genAusstellungen und Veranstaltungen im Deutschordensschloss09.07. – 11.09.2005 Der Maler Alfred Teichmann17.09.05 – Frühjahr 06 Kurt Schumacher Deutscher und Europäer17.09. - 30.10.2005 Schätze aus dem Nationalmuseum DanzigDanziger Malerei des 19. Jahrhunderts20.11.2005 10. Bunter HerbstmarktKab<strong>in</strong>ettausstellungen09.07. - 11.09.2005 Andreas AlbertZeichnungen und Fotos von der Kurischen Nehrung17.09. - 27.11.2005 Walter und Edith von Sanden-GujaAusstellungen <strong>in</strong> Ost- und WestpreußenKönigsberg, Dt.-russ. HausKönigsberg, KunstgalerieSaalfeldArno Holz zum 75. TodestagGorod i Ijudi – Königsberger GesichterGeschichte der Stadt Saalfeld(zur 700-Jahrfeier)Öffnungszeiten: April bis September Di – So 10 - 12 und 13 - 17 UhrOktober bis März Di - So 10 - 12 und 14 - 16 UhrKulturzentrum OstpreußenSchloßstr. 9, 91792 Ell<strong>in</strong>genTel.: 09141 - 86 44 0, Fax: 86 44 14Internet: www.kulturzentrum-ostpreussen.deE-Mail: <strong>in</strong>fo@kulturzentrum-ostpreussen.de81
Ostpreußisches Landesmuseum <strong>in</strong> LüneburgDauerausstellungenLandschaftenKurische Nehrung, Masuren, Oberland,Rom<strong>in</strong>ter Heide, ElchwaldJagd- und Forstgeschichte Besondere Tierarten, Trophäen, JagdwaffenGeschichte Landesgeschichte von den Prußen bis 1945Ländliche WirtschaftAckerbau, Tierzucht, FischereiGeistesgeschichteWissenschaft, Bildung, LiteraturBernste<strong>in</strong>Entstehung, Gew<strong>in</strong>nung, BedeutungKunsthandwerkBernste<strong>in</strong>, Silber, Keramik, Z<strong>in</strong>nBildende KunstKunstakademie Königsberg, KünstlerkolonieNidden, Lovis Cor<strong>in</strong>thWechselausstellungen04.06. - 18.09.05 Solidarität <strong>in</strong> schwerer ZeitDie Ostpreußenhilfe des 1. Weltkrieges18.06. – 18.09.05 Wanderungen am Meer und im GebirgeDer Maler Arthur Kuhnau aus Königsberg09.07. - 23.10.05 Man nannte sie „Umsiedler“Ostpreußen <strong>in</strong> der DDR03.09. – 23.10.05 Ans Licht geholtMitarbeiter und Schulk<strong>in</strong>der zeigen Kostbarkeitender Sammlung08.10.05 - 29.01.06 Gustav Boese (1878-1943) –der „Hausmaler“ des Memellandes05./06.11.05 17. MuseumsmarktLandschaften & Traditionen26.11.05 -19.02.06 Spielzeug vergangener K<strong>in</strong>derträumeÖffnungszeiten: Di – So 10 – 17 UhrOstpreußisches LandesmuseumRitterstraße 10, 21336 LüneburgTel.: 04131 - 75 99 50, Fax: 75 99 511Internet: www.ostpreussisches-landesmuseum.deE-Mail: <strong>in</strong>fo@ostpreussisches-landesmuseum.de82
H<strong>in</strong>weise der RedaktionRedaktionelle BeiträgeEs wird gebeten, Beiträge jeweils bis zum 31.März bzw. 30.September an dieGeschäftsstelle zu senden.Bei allen E<strong>in</strong>sendungen wird das E<strong>in</strong>verständnis vorausgesetzt, dass die RedaktionÄnderungen und Kürzungen vornimmt und den Zeitpunkt der Veröffentlichungbestimmt. E<strong>in</strong> Rechtsanspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.Geburtstage ab 70 JahreFür die Veröffentlichung im AHB müssen die Geburtstage <strong>in</strong> jedem Jahr erneutmitgeteilt werden. Bitte Namen (bei Frauen auch den Geburtsnamen),Geburtsdatum und Anschrift mit Postleitzahl angeben. Bitte Geburtstage vonJuli bis Dezember spätestens im März und von Januar bis Juni bis Ende Septembere<strong>in</strong>senden.Familien- und TodesanzeigenFür Familien- und Todesanzeigen verwenden Sie bitte e<strong>in</strong> separates Blatt. Bitteschreiben Sie deutlich und übersichtlich und im gleichen Format, wie Sie esim AHB unter der entsprechenden Rubrik f<strong>in</strong>den. Bitte vollständige Angabenmachen, an Um- und Abmeldungen denken und so bald als möglich e<strong>in</strong>senden.Fotos und DokumenteBitte senden Sie nur Orig<strong>in</strong>ale e<strong>in</strong>, wenn sie im Archiv der Stadtgeme<strong>in</strong>schaftverbleiben sollen. Für erbetene Auskünfte und Rücksendungen legen Sie bittePorto bei.Bitte haben Sie e<strong>in</strong> wenig Geduld, wenn die Antwort sich etwas verzögert,denn auch die Mitglieder der Redaktion arbeiten ehrenamtlich.SpendenEs wird gebeten, auf den Überweisungen außer dem Namen auch den Geburtsnamender Ehefrau anzugeben.Der Heimatbrief – De<strong>in</strong>e Brücke zur Heimat.Nur De<strong>in</strong>e Spende kann ihn erhalten!Konto Nr. 501 025 900 Volksbank Gelsenkirchen, BLZ 422 <strong>60</strong>0 0183
BÜCHERECKESo mütterlich durch das Werk Agnes Miegelsgeführt...Zum Buch von Marianne KoppSie war doch die berühmteste Schriftsteller<strong>in</strong> Ostpreußens. Weder nur „Balladendichter<strong>in</strong>“noch Heimatdichter<strong>in</strong>, auf was sie oft reduziert wird, hat AgnesMiegel sowohl <strong>in</strong> Lyrik als auch <strong>in</strong> Prosa Bedeutendes geschaffen. Am 9.März ist der 126. Geburtstag von der „Mutter Ostpreußen“ gewesen.Marianne Kopp gelang es mit ihrer Biografie der Dichter<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>en wichtigenBeitrag zu e<strong>in</strong>er erneuten Würdigung von Leben und Werk Agnes Miegels zuleisten.Die Lektüre des Buches von Marianne Kopp beg<strong>in</strong>ne ich mit dem Umschlagfoto.Es fesselt ganz me<strong>in</strong>e Aufmerksamkeit...Der große <strong>Vor</strong>teil jeder hohen Kunst ist, dass sie universal wirkt und sich vielseitigbetrachten und <strong>in</strong>terpretieren lässt. Das ermöglicht eben das Titelfotodes Buches „Agnes Miegel – Leben und Werk“ (Husum 2004). Was für Spannungenzeigen sich <strong>in</strong> der vom Verlag zusammengebastelten Collage! Tiefnachdenklichblickt Agnes Miegel auf das Königsberger Stadtviertel nebendem Kneiphof, wo sie ihre glücklichsten K<strong>in</strong>derjahre verbracht hat. Nicht weitdavon lebte sie bis zur Flucht. So e<strong>in</strong> Industrieausschnitt wie auf dem Bildsollte Agnes Miegel nicht fremd gewesen se<strong>in</strong>. Wie es auch <strong>in</strong> dem Buchsteht: „[Sie] wendet sich [...] der bunten Wirklichkeit zu [...], nimmt begierigBilder, Leute und Gerüche auf, Markttreiben und Atmosphäre auf den Straßen[...] um sie her“. So realistisch wird von Karl Storch d. Ä. (1864-1954) das„Hundegatt <strong>in</strong> Königsberg“ gezeigt. Klar, die Rauchwolken auf dem Bild könnenauch die im H<strong>in</strong>tergrund des Bildes liegende Königsberger Industrie darstellen.So viel aber der re<strong>in</strong>e Realismus. Es bleibt jedoch die zweite Perspektive,die mich aufgeregt und unruhig macht. All diese Farbeffekte wecken <strong>in</strong>mir noch weitere Konnotationen auf. Ich sehe e<strong>in</strong>e im H<strong>in</strong>tergrund brennendeStadt und zwei fliehende Dampfschiffe. Und ich lese <strong>in</strong> dem Buch weiter:„Hier [auf dem Kneiphof] wird das kle<strong>in</strong>e Mädchen geboren, während e<strong>in</strong>Brand <strong>in</strong> der Nachbarschaft Aufruhr und Lärm verursacht. [...] In der Tatsche<strong>in</strong>en diese Umstände ihrer Geburt schon auf ihre Besonderheit h<strong>in</strong>zuweisen,ihren Zugang zu e<strong>in</strong>er andren Wirklichkeit [...]“. Auch der Zugang zu denHerzen und Gefühlen der Leserschaft...Wir s<strong>in</strong>d aber immer noch bei dem Bild. Im August 1944 „legen zwei Bombenangriffedie Innenstadt Königsbergs <strong>in</strong> Schutt und Asche. [...] Agnes Miegelbegreift nur langsam, warum noch vor kurzem jeder Weg <strong>in</strong> die Stadt e<strong>in</strong>Abschiedsnehmen war“. Marianne Kopp zitiert an der Stelle das Gedicht „Abschiedvon Königsberg“, dessen Verse ich hier für sich sprechen lasse:84
Es forderte zum Fackeltanze dich,Gekrönte Vaterstadt, der grimme Tod.Wir sah'n von se<strong>in</strong>em Mantel dich umloht[...]Und sahen de<strong>in</strong>en furchtbaren Freier TodAus de<strong>in</strong>er Gassen leeren Masken starrenUnd durch den grauen Rauch stromabwärts fahrenMit zuckender Beute auf verglühendem Boot.Es darf doch mit der Umschlagcollage ke<strong>in</strong> Zufall gewesen se<strong>in</strong>. Sicherlich hatMarianne Kopp ke<strong>in</strong> Buch über Königsberg geschrieben, sondern über AgnesMiegel. E<strong>in</strong>e Stadt kann aber viele andere Motive generieren – e<strong>in</strong>e Kettenreaktion,e<strong>in</strong>en Schmetterl<strong>in</strong>gseffekt, die sich frei entwickeln lassen.Als ich Marianne Kopp fragte, warum sie gerade e<strong>in</strong> Buch über Agnes Miegelschreibt, sagte sie, sie f<strong>in</strong>de viel Fasz<strong>in</strong>ierendes an ihrem Werk, an ihrem besonderenErzählstil. Außerdem gäbe es nicht viele Forscher, die das bedeutendeWerk Miegels zu schätzen verständen. Es war höchste Zeit, die Dichter<strong>in</strong>aus der Vergessenheit zurück zu rufen. So gelang es Marianne Kopp, dasBuch zum 125. Geburtstag der Dichter<strong>in</strong> herauszugeben und erneute Anerkennungihres Schaffens zu ermöglichen.Zu bewundern ist es, wie viele verschiedene Motive Agnes Miegel <strong>in</strong> ihre Prosaund Lyrik e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>det. Die ganze Sammlung passt gar nicht zu der populärstenBeschreibung ihrer Werke – sie ist ke<strong>in</strong>e Heimatdichter<strong>in</strong> – nicht nur! Ihrepoetische Begabung und ihr Wissen lassen sich nicht so e<strong>in</strong>fach abklassifizieren.Ihr Werk – was Marianne Kopp bestätigt – „lädt immer wieder zu e<strong>in</strong>erneuerlichen Betrachtung e<strong>in</strong>“.Ich habe das Buch „Agnes Miegel – Leben und Werk“ gelesen, und denke, eswird vielen Leser<strong>in</strong>nen und Lesern ähnlich gehen wie mir: Ich bemerkte, dassdas Buch nach gründlichen wissenschaftlichen Recherchen geschriebenworden ist, bemerkte auch, wie viel von der Leidenschaft und dem persönlichenEngagement der Autor<strong>in</strong> dar<strong>in</strong> steckt. Marianne Kopp hat mich – lasstuns e<strong>in</strong>e Redewendung Agnes Miegels paraphrasieren – so mütterlich durchAgnes Miegels Welt geführt...Arkadiusz LubaArchivmaterial aus NachlässenBitte, werfen Sie bei der Auflösung von Nachlässen zeitgeschichtliche Dokumenteaus der ostpreußischen Heimat wie Urkunden, Karten, Bilder und Bücher nicht<strong>in</strong> den Müll. Stellen Sie diese Unterlagen der Stadtgeme<strong>in</strong>schaft zur Verfügung!85
E<strong>in</strong> Gang durch Allenste<strong>in</strong> vor 1945.Die Fotos werden ausführlich erläutertund durch e<strong>in</strong>e Schilderung derStadtentwicklung, e<strong>in</strong>e Zeittafel unde<strong>in</strong>en Stadtplan ergänzt. Die 1999erschienene Neuauflage enthält außerdeme<strong>in</strong>e gezeichnete historischeKarte von Ostpreußen mit den Wappender ostpreußischen Städte.Was die Bürger <strong>in</strong> der Zeit von derJahrhundertwende bis 1945 getanund erlebt haben. Behandelt werdenStadt und Staat, die Volksabstimmungvon 1920, kirchliches und kulturellesLeben, Wirtschaft, Garnison,Schulen, Sport etc. Der Text wirddurch zahlreiche Bilder veranschaulicht.Beide Bildbände ergänzen e<strong>in</strong>ander und vermitteln e<strong>in</strong>en lebendigen E<strong>in</strong>druckvon unserer Heimatstadt. Sie sollen dazu beitragen, die Er<strong>in</strong>nerung an unsereHeimatstadt zu bewahren und auch unseren Nachkommen zeigen, wie schöndas alte Allenste<strong>in</strong> war. Sie s<strong>in</strong>d nur noch über unsere Geschäftsstelle zu erhalten.Achtung Koppernikus – Schüler!Im diesem Jahr feiert die Koppernikus-Schule ihren 110. Geburtstag. DieStadtgeme<strong>in</strong>schaft beabsichtigt, zu diesem Anlass die Geschichte der Schuleherauszugeben. Sie wurde von Dr. Ernst Vogelsang verfasst und stellt e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>maliges Zeitdokument dar. Umfang etwa 130 Seiten, Preis 17 Euro.Interessenten werden gebeten, möglichst bald ihre Bestellung an unsere Geschäftsstellezu senden.86
Angebote unserer Stadtgeme<strong>in</strong>schaftGeschichte der Stadt Allenste<strong>in</strong> von 1348 – 1943 von Anton Funk 64,00 EuroPatenschaftschronik Allenste<strong>in</strong> <strong>in</strong> Gelsenkirchen2,50 EuroTelefonbuch von Allenste<strong>in</strong> 19421,50 EuroSüdostpreußen und das Ruhrgebiet (broschiert)1,50 EuroBerichte über die Luisenschule1,00 EuroStadtplan von Allenste<strong>in</strong> <strong>in</strong> schwarz – weiß1,00 EuroAufkleber, Motiv Allenste<strong>in</strong> (siehe AHB 223)1,00 EuroDas Gesamtwerk von Hedwig Bienkowski-Anderson5,00 EuroVertrauen sieht überall Licht von H. Bienkowski-Anderson 2,00 EuroGeliebtes Leben von H. Bienkowski-Anderson2,00 EuroLobet den Herrn / Gesang- und Gebetsbuch für das Ermland 1,50 EuroAllenste<strong>in</strong> <strong>in</strong> 144 Bildern von Johannes Strohmenger9.50 EuroBilder aus dem Leben <strong>in</strong> Allenste<strong>in</strong> von He<strong>in</strong>z Matschull 9,50 EuroAllenste<strong>in</strong>er Gedichtchen von Ernst Jahnke12,00 EuroFegefeuer, genannt Kortau von Stanislaw Piechocki10,00 EuroKle<strong>in</strong>er Stadtführer Allenste<strong>in</strong>3,00 EuroIm VierfarbendruckStadtplan von 19404,00 EuroStadtkarte „Allenste<strong>in</strong>“, gez. von H. Negenborn4,00 EuroKreiskarte „Allenste<strong>in</strong> Stadt und Land“, gez. von H. Negenborn 5,00 EuroFaltkarte „Ostpreußen und Danzig“, mit 85 Wappen7,50 EuroVier Aquarelle Allenste<strong>in</strong>er Motive, Reproduktionen DIN A3, p. St. 1,50 EuroReiseführer Ostpreußen, Westpreußen und Danzigmit Skizzen, Karten und Fotos, 7. Auflage12,50 EuroStraßenkarte Südliches Ostpreußen mit Stadtplan von Allenste<strong>in</strong>,zweisprachig mit Lupe, Maßstab 1:200.0009,50 EuroH<strong>in</strong>zu kommen die üblichen Kosten für Porto und Verpackung.Bestellungen richten Sie bitte an unsere Geschäftsstelle:Stadtgeme<strong>in</strong>schaft Allenste<strong>in</strong>Vattmannstr. 1145879 Gelsenkirchen87
ImpressumHerausgeberStadtgeme<strong>in</strong>schaft Allenste<strong>in</strong> e.V., www.StadtAllenste<strong>in</strong>.de<strong>Vor</strong>sitzender: Gottfried Hufenbach, Danziger Str. 12, 53340 Meckenheim, Tel. (02225) 700 418RedaktionKurt Dzikus, Ste<strong>in</strong>kuhle 15, 45897 Gelsenkirchen, Tel. (0209) 597 723Christel Becker, Sassenfelder Kirchweg 85, 41335 Nettetal 1, Tel. (02153) 5135Hanna Bleck, Lüd<strong>in</strong>ghauser Straße 69, 48249 Dülmen, Tel. (02594) 5551Bruno Mischke, Alter Weg 68, 47918 Tönisvorst, Tel. (02156) 8519Geschäftsstell<strong>eV</strong>attmannstraße 11, 45879 Gelsenkirchen Telefon (0209) 29 131, Fax (0209) 40 84 891Email: StadtAllenste<strong>in</strong>@t-onl<strong>in</strong>e.deDie Geschäftstelle ist am Dienstag (Gretel Bohle, Bob Z<strong>in</strong>s) und am Freitag (Bob Z<strong>in</strong>s)von 10.00 bis 13.00 Uhr mit Ausnahme der Sommer- und Weihnachtsferien geöffnet.Heimatmuseum „Der Treudank“Besuch während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle oder nach Vere<strong>in</strong>barung.Spenden für den AHBKonto Nr. 501 025 900, Volksbank Gelsenkirchen, BLZ 422 <strong>60</strong>0 01Ersche<strong>in</strong>ungsweiseZweimal jährlich im Sommer und zu WeihnachtenAuflage4000 ExemplareHerstellungDCM Druck Center Meckenheim88