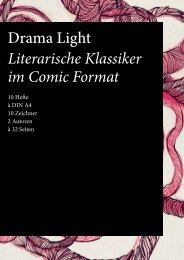Meeting Chuck – Sex & Gewalt - Rosa Design
Meeting Chuck – Sex & Gewalt - Rosa Design
Meeting Chuck – Sex & Gewalt - Rosa Design
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
magazin für gegenwartskultur<br />
magazin für<br />
gegenwartskultur<br />
no.24 1 winter 2007<br />
www.goon-magazin.de<br />
<strong>Chuck</strong><br />
Palahniuk<br />
an den rändern ist die zukunft 1 s.42<br />
Jeff Wall<br />
that could be real 1 s.62<br />
Dirty<br />
Projectors<br />
die historisierung des klangs 1 s.22
Das müssen<br />
Sie erleben!<br />
Apple iPod inkl. Beratung<br />
ab 78,99 Euro<br />
Erleben Sie bei GRAVIS faszinierende Produkte im passenden Ambiente!<br />
Lassen Sie sich in Ruhe beraten und lernen Sie die neuesten Trends<br />
kennen. Und dann machen Sie es sich gemütlich – und genießen Sie!<br />
Ganz in Ihrer Nähe und im Internet: www.gravis.de<br />
GRAVIS ist ausgezeichnet mit dem European Seal of E-Excellence<br />
für sein europaweit einzigartiges und innovatives Lifestylekonzept<br />
für digitale Produkte und anspruchsvolle Marken.<br />
editorial<br />
no. vierundzwanzig 1 24<br />
von sebastian hinz<br />
Ein guter Anfang wäre: Die Welt könnte so schön sein. Das ist ein einfacher Gedanke, von<br />
allen Gedanken aber vielleicht der wichtigste. Man könnte sagen, wenn auf dieser Welt<br />
hier und da etwas leuchtet, habe es sein Licht von diesem Gedanken empfangen. Derart<br />
gute Anfänge schreibe ich leider nicht, und dennoch muss manchmal – wenn auch nur<br />
stellvertretend – an diesen Gedanken erinnert werden. Denn darin schlummert der Geistesblitz<br />
von Produktivität, der Funke Kreativität. Mancher mag meinen, hier würde übertrieben.<br />
Vielleicht. Aber man vergesse nicht die Worte des Philosophen Wolfgang Welsch:<br />
Übertreibung ist ein Prinzip der Wirklichkeit selbst: Die morgige Wirklichkeit wird die<br />
Übertreibung der heutigen sein – das ist es, was man ›Entwicklung‹ nennt.<br />
Die Kunst, von der wir hier reden, ist durch eine unmittelbare Verbindung zur Welt<br />
bestimmt, in Klammern: ohne dabei gleich Volkskunst sein zu müssen. Oder wie es bei<br />
René Pollesch einmal zu hören war: Das ist jetzt kein Alltag hier, das ist Kunstkacke, aber<br />
irgendwo muss es doch Widerstand geben. In welches Verhältnis sich Kunst dabei genau<br />
zur Welt begibt, verändert sich dabei allerdings, einstens: von Zeit zu Zeit, und heutzutage:<br />
von Werk zu Werk. Eine probate Strategie, sich zur Welt zu verhalten, im Prinzip seit<br />
den altsteinzeitlichen Höhlenmalereien von Lascaux, war die Nachahmung. Die Wiederholung<br />
des Gesehenen bestimmte Bildhauerei, Malerei als auch die Poesie in erheblichem<br />
Maße. In Lessings Schrift »Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie«, im<br />
Jahre 1766 erschienen, können folgende Sätze nachgeschlagen werden: Wenn es wahr ist,<br />
dass die Malerei zu ihren Nachahmungen ganz andere Mittel oder Zeichen gebraucht als<br />
die Poesie; jene nämlich Figuren und Farben in dem Raume, diese aber artikulierte Töne<br />
in der Zeit. Und etwas später: Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander<br />
existieren, heißen Körper. Folglich sind Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften,<br />
die eigentlichen Gegenstände der Malerei. Gegenstände, die aufeinander, oder deren Teile<br />
aufeinander folgen, heißen überhaupt Handlungen. Folglich sind Handlungen der eigentliche<br />
Gegenstand der Poesie. Blättert man auf Seite 43 dieses Hefts, liest man dagegen<br />
diese Worte des Schriftstellers <strong>Chuck</strong> Palahniuk: Bücher haben meistens eine intellektuelle<br />
und eine emotionale Komponente, aber nur sehr selten eine physische. Körperliches wird<br />
tendenziell als kulturell minderwertig betrachtet – Pornographie, Horror: alles low-art.<br />
Um beim Leser Mitgefühl auszulösen, so richtig körperlich, von Kopf bis Fuß, muss man<br />
<strong>Gewalt</strong> oder <strong>Sex</strong> nehmen, oder Krankheiten, manchmal Drogen. Damit kann man Leser<br />
auf einem physischen Level einbinden, ihnen eine ganze Realität erschaffen.<br />
Nun, die Zeiten haben sich halt geändert. Zwar gilt es noch immer eine ganze Realität<br />
zu erschaffen, doch die letzten hundert Jahre samt ihrer rasanten technischen und<br />
medialen Entwicklungen sind nicht ohne Folgen für die Künste geblieben. Die Unterscheidungen<br />
zwischen den Gattungen zu negieren scheint dabei nur eine wichtige Aufgabe.<br />
Dass das Prinzip der Nachahmung in diesem Zusammenhang wieder salonfähig<br />
zu werden scheint, ist einigermaßen überraschend, aber anhand einiger Themen dieser<br />
Ausgabe belegbar. Da legen die New Yorker Combo Dirty Projectors und ihr Vordenker<br />
David Longstreth mit dem Album »Rise Above« eine Version von Black Flags Meilenstein<br />
»Damaged« aus dem Jahre 1981 vor, das aus der bloßen Erinnerung entstanden, eine<br />
Nachahmung ist, die sich komplett dem Signum Nachahmung entzieht (S.22). Oder: Der<br />
kanadische Fotograf Jeff Wall nennt seine Lichtbilder »my near documentary-pictures«,<br />
weil die so real erscheinen, mit der Idee der Dokumentation eng verwandt, aber eben nur<br />
fast dokumentarisch sind (S.62). Andere Fotokünstler haben diese Arbeitsweise der Imitation,<br />
Inszenierung oder Re-Inszenierung inzwischen übernommen, wie beispielsweise der<br />
Franzose Éric Baudelaire für sein Diptychon »The Dreadful Details« aus dem letzten Jahr.<br />
Auf dem Schreibtisch liegt aufgeklappt eine Ausgabe von Kultur & Gespenster, ein<br />
Artikel von Gustav Mechlenburg. Folgende Zeilen stechen hervor: Kunstwerke gewinnen<br />
über die künstlich erzeugten Unbestimmtheitsstellen ihren Wirklichkeitsbezug zurück,<br />
den sie als autonome Werke vorsätzlich verspielen. Vielleicht, wusste schon Henry Miller,<br />
muss man durch Ströme von Scheiße waten, um einen Keim Wirklichkeit zu finden.<br />
editorial 1 3
ingredients no. 23<br />
fetzen<br />
6 Die Künstler der Ausgabe 24: Bruno Colajanni 1 Anna <strong>Rosa</strong> Stohldreier 8 CTM08: »Open Circuit«<br />
10 Walter Moers 11 Neue Heimat: Berlin Contemporary 12 material: Let’s Ride<br />
14 Régine Chopinot 1 Platten, die mich geformt, gebildet, gebessert haben: Marcus Schmickler<br />
1 CKIN2U 16 Worauf man in diesem Winter nicht verzichten kann: A. J. Weigoni 1 Ecko Star Wars Edition<br />
Europäischer Humor mit Efterklang s.20 Die Revolution der Kunst – Jonathan Meese im Interview s. 0<br />
töne<br />
20 Efterklang<br />
22 Dirty Projectors<br />
24 Michaela Melian<br />
2 Feu Thérèse<br />
26 A Whisper In The Noise<br />
27 Kapital Band I<br />
28 Zwiegespräch: Frank Bretschneider + Sun Electric<br />
30 Musikszene Bristol<br />
reviews<br />
34 epiphany outlet<br />
3 Louis Philippe<br />
The Clientele<br />
36 beep street<br />
37 Luke Vibert<br />
Phon°noir<br />
38 Doom & Gloom<br />
Vashti Bunyan<br />
39 the relay<br />
4 1 ingredients<br />
worte<br />
42 <strong>Chuck</strong> Palahniuk<br />
46 Polarliteratur<br />
48 Larissa Böhning<br />
49 Mark M. Danielewski<br />
0 Jonathan Meese<br />
4 performativ<br />
Adam Olschewski<br />
Roman Simić<br />
6 Virginie Despentes<br />
Michael Lentz<br />
7 Monika Maron<br />
8 »Propaganda«<br />
»Machiavelli«<br />
9 das dispositiv<br />
»Du kannst im Prinzip prima ein<br />
ganzes Stück machen, das einfach nur<br />
ein Ton ist, der sich verändert.«<br />
sun electric im Gespräch<br />
mit Frank bretschneider<br />
Seite 30<br />
bilder zeichen<br />
»Die Hauptwaffe der Kulturbesitzenden<br />
war Geschmack.«<br />
anthony waine über Kitsch und Kunst<br />
Seite 86<br />
»Grey’s Anatomy« und Co. – Zur Poetik der TV-Serie s.66 Ecocriticism – zur ökologischen Ästhetik s.88<br />
62 Jeff Wall<br />
66 Zur Poetik der TV-Serie<br />
68 Italo Western Collection<br />
69 »The Darjeeling Limited« von Wes Anderson<br />
70 Paul Hornschemeier<br />
72 »Tim & Struppi« von Hergé<br />
74 Jiro Taniguchi<br />
7 Orange Box<br />
76 »Super Paper Mario«<br />
77 Hommage à Mega Man<br />
78 white cubes<br />
79 Gilbert & George 1 Peter Bialobrzeski<br />
80 »Persepolis« 1 »Gefahr und Begierde« von Ang Lee<br />
81 »Fullmetal Alchemist«<br />
»The Saddest Music In The World« von Guy Maddin<br />
82 »Die Simpsons – Das Spiel«<br />
»Sinking Island« & »Ankh – Kampf der Götter«<br />
83 schnittstellen<br />
RLM<br />
8 Einleitung<br />
86 Anthony Waine<br />
88 Ecocriticism<br />
90 Paul Virilio<br />
91 Sophie Tottie<br />
»Das vermessene Paradies«<br />
92 Simon Spiegel<br />
»New Ghost Entertainment-Entitled«<br />
93 genealogie der superhelden<br />
Conan – Der Barbar<br />
standards<br />
6 Impressum<br />
94 termine im Winter<br />
98 kolumne<br />
Miau.<br />
ingredients 1
heft-verschönerung<br />
anna rosa stohldreier<br />
ludag<br />
Der gebürtige Italiener aus Palermo nutzt seine Kunst<br />
nicht, um die Realität zu verschönern. Bruno Colajanni<br />
möchte die Realität zelebrieren, ohne an Realismus zu<br />
denken und ist deshalb unter dem Namen Ludag auf der<br />
Suche nach Emotionen im Detail. »Sentimental Graphic«<br />
nennt der Wahlberliner schlicht seine Werke. »Seit meiner<br />
Kindheit schaue ich mir gerne die Realitätselemente an, bei<br />
denen ich mit der Vorstellungskraft herumspielen kann«,<br />
erinnert sich der 28jährige. »Du kannst Dir dort kleine<br />
Schnipsel der großen Vision von Realität herausschneiden<br />
und dann hineinfokussieren. Plötzlich siehst Du eine<br />
Pflanze lächeln oder eine Wolke spucken. Es ist eine Art<br />
Macro-Welt«, die Bruno Colajanni in dieser Ausgabe in<br />
den Rubrikenbildern entdecken lässt.<br />
www.ludag.com<br />
6 1 fetzen<br />
Anna <strong>Rosa</strong> Stohldreier von <strong>Rosa</strong>design<br />
beschäftigt sich neben dem<br />
nie enden wollenden Kampf gegen<br />
fleischfressende Würstchen auch<br />
mit konzeptionellen Maßnahmen<br />
zur Förderung sinnvoller Verkäufe.<br />
Sie arbeitet in ihrem Studio am<br />
Weichselplatz als Kommunikationsdesignerin<br />
und Illustratorin für<br />
diverse Zeitschriften, Agenturen,<br />
Verlage und eigene Kunden. Dabei<br />
entstehen ironisch-polemische,<br />
sarkastisch-böse Illustrationen über<br />
das Menschliche am Menschen, das<br />
Scheitern. So auch »Burnout XXl XP<br />
meets human file«, ein Handbuch mit<br />
illustrativen Lösungsansätzen und<br />
scheiternden Erklärungsversuchen<br />
rund um das<br />
Thema Mensch<br />
und Computer.<br />
www.rosadesign.de<br />
impressum<br />
herausgeber<br />
goon ® media e.V.<br />
Sebastian Hinz, Postfach 12 69 29, 10609 Berlin<br />
sebastian@goon-magazin.de<br />
redaktion<br />
Dan Gorenstein, Astrid Hackel, Sebastian Hinz (ViSdP),<br />
Zuzanna Jakubowski, Jens Pacholsky, Jochen Werner<br />
Email: vorname@goon-magazin.de<br />
schlussredaktion Mareike Wöhler<br />
praktikantin Vera Hölscher<br />
art direction & gestaltung<br />
Daniel Rosenfeld 1 layout@goon-magazin.de<br />
controlling & cash-management<br />
Falk Stäps 1 falk@goon-magazin.de<br />
abonnementverwaltung & vertrieb<br />
Jens Pacholsky 1 abo@goon-magazin.de<br />
anzeigenleitung & marketing<br />
Stefan Gerats 1 anzeigen@goon-magazin.de<br />
Es gilt die Anzeigenpreisliste I/2007<br />
internetauftritt<br />
Daniel Rosenfeld 1 layout@goon-magazin.de<br />
Stefan Gerats 1 stefan@goon-magazin.de<br />
Sebastian Munz 1 slade.de/projekte<br />
titelbild © Andreas Chudowski<br />
Desweiteren danken wir ihrer Mitarbeit:<br />
Cornelis Hähnel, Renko Heuer, Andreas Huth, Tilman Junge, Ireneusz<br />
Kmieciak, Anne Kraume, Patrick Küppers, Brock Landers, Caroline Lang,<br />
Susanne Lederle, Kurt Mohr, Sabine Lenore Müller, Stefan Murawski,<br />
Robert Pick, Matthias Penzel, Konrad Roenne, Kerstin Roose, Fabian<br />
Saul, Julia Saul, Annika Schmidt, Nina Scholz, Alexander Schubert,<br />
Markus von Schwerin, Eileen Seifert, Martin Silbermann, Lea Streisand,<br />
Falko Teichmann, Robert Wenrich, Rebecca Pohl, Olivia Schofield, Judith<br />
Taudien, Ronald Klein, Marcus Roloff, Agnieszka Mucha, Christoph Voy,<br />
Thomas Ebke, Bernd Weintraub, Klaus Esterluß, Gabriela Radko, Don<br />
Davis, Anna <strong>Rosa</strong> Stohldreier, Bruno Colajanni<br />
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck – auch nur auszugsweise – darf<br />
nur mit vorheriger und schriftlicher Einwilligung der Redaktion erfolgen.<br />
Alle Urheberrechte liegen bei der Redaktion, sofern nicht anders<br />
angegeben. Die Urheberrechte der Artikel, Fotos und Illustrationen bleiben<br />
bei den Verfassern, Fotografen und Illustratoren. Für unaufgefordert<br />
eingesandtes Material aller Art wird weder Verwendung garantiert noch<br />
Verantwortung übernommen.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung<br />
der Redaktion wieder. Für ihre Artikel übernehmen die Autoren<br />
die presserechtliche Verantwortung.<br />
Wir behalten uns vor, unvollständig eingesandte Promos, gebrandte CD-<br />
Rs, gefadete, geaudiostampte und sonst wie ungenügend aufgemachte<br />
CDs nicht oder entsprechend unzulänglich zu besprechen. Für eine repräsentative<br />
Kritik ist das komplette Artwork essenziell, ist ein finished<br />
product die Mindestanforderung. Wir sind nicht in erster Linie Dienstleister,<br />
sondern fanatisch Besessene.<br />
leserbriefe post@goon-magazin.de<br />
goon ® wird bundesweit vertrieben mit freundlicher Unterstützung von:<br />
www.publicity-werbung.de<br />
Erscheinungsweise: vierteljährlich<br />
Das nächste Heft erscheint im März 2008<br />
Für Freunde der<br />
ägyptischen<br />
Popkultur.<br />
Das neue Werk der<br />
Gewinner des<br />
Deutschen<br />
Entwicklerpreises<br />
2005.<br />
Von den<br />
Machern von<br />
Jack Keane.<br />
Der Adventure-Hit<br />
des Jahres - ab sofort<br />
überall erhältlich.<br />
www.ankh-game.de<br />
© 2007 published by XIDER Games. XIDER Games is a trademark of bhv Software GmbH & Co. KG. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.<br />
All rights reserved.
goon<br />
präsentiert<br />
fetzen<br />
Composer inside<br />
electronics<br />
Unfälle, Nichtvorhersehbares, Fehler,<br />
Ungeordnetes, kurz: das Geratewohl,<br />
stehen im Mittelpunkt der club<br />
transmediale.08. Und zu allem<br />
Überfluss werden auch noch Maschinen<br />
aufgeschraubt<br />
text: sebastian hinz<br />
fotos: pickled feet, matthias hell, xavier van wersch<br />
Auf der Bühne stehen ein Schallplattenspieler, eine Vinylschneidemaschine<br />
und elektronische Filter. Nachdem<br />
die beiden Musiker Christian Marclay und Flo Kaufmann<br />
ihren erhöhten Arbeitsbereich betreten haben, ist den<br />
Teilnehmenden bewusst: Nicht nur die Instrumentenauswahl<br />
ist hier ungewöhnlich. Die Performance beginnt mit<br />
einer leeren Schallplatte. Christian Marclay, der seinen<br />
Plattenspieler wie ein Musikinstrument benutzt, nimmt<br />
diese schwarze Tonkonserve und erzeugt Klänge, die von<br />
Flo Kaufmann aufgezeichnet und in einen Vinylrohling<br />
geschnitten werden. Danach reicht er die so gefertigte<br />
Schallplatte an Marclay, der sie wiederum als Material<br />
für weitere Klangmanipulationen einsetzt, die erneut von<br />
Kaufmann aufgezeichnet und in Polyvinylchlorid gekerbt<br />
werden. So wissen beide Künstler zu keinem Zeitpunkt,<br />
mit welchem Material sie als nächstes arbeiten werden.<br />
»Tabula Rasa« nennen Marclay und Kaufmann ihre<br />
Darbietung, die bei der club transmediale.08 – die in diesem<br />
Jahr unter dem Motto »Unpredictable« (engl. unberechenbar,<br />
unvorhersagbar) steht – erst zu ihrer fünften<br />
Aufführung kommt. Doch an dieser Performance werden<br />
zwei Prinzipien deutlich, die in der zeitgenössischen<br />
Musik gerade eine Renaissance erleben: die Aufgabe<br />
künstlerischer Kontrolle zugunsten von Zufall und das<br />
musizierende Hantieren an offenen Systemen. Doch beide<br />
Methoden sind der Modernen Musik nicht unbekannt.<br />
Der Zufall<br />
Hinter dem Experimentieren mit dem Unvorhergesehenen<br />
und seiner bewussten Integration in den kreativen<br />
Prozess verbirgt sich nicht selten die Suche nach lebendigem,<br />
spontanem, authentischem Erleben. Daher ist<br />
es oftmals verknüpft mit der utopischen Vorstellung des<br />
untrennbaren Ineinanderfallens von Kunst und Leben.<br />
Eine Idee, die sich insbesondere in der Improvisation<br />
durchsetzte, dieser sowohl von der Hoch- als auch von<br />
der Subkultur beargwöhnten »Kunst ohne Werk« (Derek<br />
8 1 fetzen<br />
Bailey). Doch dieser spontane Entwurf von Musikern, entstehend<br />
in der Kommunikation mit Mitmusikern, hat sich<br />
in unserer Kultur etabliert: im Free Jazz, in der Neuen Improvisationsmusik,<br />
aber auch im Battle des HipHop oder<br />
in der DJ-Culture. Und selbst wenn man so denkt wie der<br />
Minimalist Steve Reich: »Wenn ein Typ sagt, ich improvisiere<br />
darüber, wie ich mich fühle, dann ist meine Antwort:<br />
Fuck you. Ich interessiere mich nicht dafür, wie du dich<br />
fühlst«; auch abseits der Improvisation liegt der Zufall. Ob<br />
nun Serielle Musik oder Musique concrète, ob Turntablism<br />
oder Generative Musik: der Teufel steckt im System.<br />
Linearität wird durch komplexe Kontingenz erweitert und<br />
ersetzt. Aus den irregulären, chaotischen Umwelt- und<br />
Naturgeräuschen entstehen ebenso Kompositionen, wie<br />
aus mathematischen Algorithmen oder sogar kurzzeitigen<br />
Falschaussagen in logischen Schaltungen, die man<br />
allgemein glitch nennt. Eine Erweiterung musikalischer<br />
Konzepte durch Momente des Zufalls ermöglicht, neue<br />
Codes für die Kunst und das kulturelle Selbstverständnis<br />
des modernen Menschen zu finden.<br />
Das offene System<br />
Auf Bastler und Erfinder war von Anbeginn insbesondere<br />
die elektronische Musik angewiesen. Ihre Entwicklung<br />
wird maßgeblich durch die experimentelle Entwicklung<br />
neuer technischer Geräte und Instrumente vorangetrieben.<br />
Aber auch in anderen Musikgattungen wird Eigenbau<br />
wieder bedeutsam zur Generierung eines individuellen<br />
Sounds. Rafael Toral, Wolf Eyes, Machinefabriek, Xavier<br />
van Wersch: ganz verschieden in Herkunft und musikalischem<br />
Stil, gewinnt für eine neue Generation von Musikern<br />
und Elektrotechnikstudenten das selbstgebaute<br />
Instrument oder der manipulierende Eingriff in bestehende<br />
Schaltkreise, um Geräten neue Klänge und Geräusche<br />
zu entlocken, an Bedeutung. Vorbild für diese Bewegung<br />
des »Circuit Bending« ist David Tudor. Ihn den größten Pianisten<br />
des letzten Jahrhunderts zu nennen, wäre wohl keine<br />
Übertreibung, seine weit blickenden Arbeiten als Komponist<br />
elektronischer Musik werden da manchmal vernachlässigt.<br />
Tudor glaubte, dass den Geräten ein unbekanntes,<br />
objekt-spezifisches Klangmaterial und neue musikalische<br />
Formen innewohnen würden, die mit der allmählichen<br />
Verfertigung eines neuen Instrumentes in Erscheinung treten.<br />
»The object should teach you what it wants to hear.«<br />
David Tudor war auch derjenige, der am 29. August<br />
19 2 im Auditorium der New Yorker Harvard-Universität<br />
am Flügel Platz nahm, den Klavierdeckel schloss, und exakt<br />
4 Minuten und 33 Sekunden an seinem Instrument<br />
ausharrte, um den Deckel dann wieder zu öffnen. Tudor<br />
spielte – nichts. Oder »4’33«, die berühmteste Komposition<br />
von John Cage. Die Zuhörer reagierten mit Irritation,<br />
begannen zu tuscheln, verließen den Saal oder empörten<br />
sich. Manche wussten nicht einmal, dass sie überhaupt<br />
eine Komposition gehört hatten. Das war der entscheidende,<br />
unvorhersehbare Teil der Darbietung.<br />
SCOUT NIBLETT<br />
„Schön anzuhörende Eigenwilligkeit, Musik als ausufernder<br />
Spaziergang mit vielen Pausen, Ausfallschritten,<br />
Reisespielchen.“ laut.de<br />
Scout holte sich für ihr 4. Album Verstärkung – der große<br />
Will Oldham (aka Bonnie “Prince” Billy) ist als Duettpartner<br />
auf 4 Stücken zu hören!<br />
Tabula rasa<br />
„Mindestens Birthday Party und Joy Division<br />
dürften iLIKETRAINS zu ihren...ungleich epischeren<br />
Stücken...inspiriert haben: ...ausdrucksstark pocht das<br />
Schlagzeug, willenlos und verloren...sirren die Gitarren.<br />
I Love You But I‘ve Chosen Darkness hatten den besseren<br />
Bandnamen, iLIKE TRAINS aber haben die Songs.“<br />
Spiegel Online<br />
www.beggarsgroup.de www.myspace.com/beggarsgermany<br />
fetzen<br />
Zurück zur oben angeführten Performance von Christian<br />
Marclay und Flo Kaufmann: Jede der von Flo Kaufmann<br />
geschnittenen Schallplatten trägt die vorigen Klanggenerationen<br />
als Spuren und Schichten in sich. Die letzte Vinylscheibe<br />
der Aufführung beinhaltet in gewisser Weise<br />
die gesamte Aufführung und kann sie doch nicht wieder<br />
erklingen lassen. Doch wann ist der Zeitpunkt für die letzte<br />
Schallplatte gekommen? Dazu hat der britische Technopionier<br />
Aphex Twin eine Idee: Ein Stück sei zu Ende, sagt<br />
er, wenn die Maschinen abgeschaltet sind.<br />
»club transmediale.08 – Festival for adventurous music and<br />
related visual arts« findet vom 25. Januar bis 2. Februar 2008 in<br />
verschiedenen Berliner Lokalitäten statt. Am Eröffnungsabend in<br />
der Volksbühne am <strong>Rosa</strong>-Luxemburg-Platz wird kein geringerer<br />
als Pierre Henry auftreten. Neben dem Festival gibt es auch<br />
eine Workshop-Reihe zu Hardware-Hacking, Circuit Bending<br />
und Open Systems, konzipiert von Martin Howse und Derek<br />
Holzer. Mehr Informationen: www.clubtransmediale.de<br />
„Solo bow from singer one of the Delgados‘ co-leaders<br />
and its creative engine. Needless to say, fans will fi nd<br />
much to like!“<br />
„The High Priestess of the scottish indie scene Emma<br />
Pollock shows here that she can certainly cut it on her<br />
own, and this record has been worth the wait“
fetzen<br />
Walter moers<br />
Echo, das sprechende Kätzchen (i.e. Krätzchen) ist kurz<br />
vor dem Verhungern, als der gefürchtete Schrecksenmeister<br />
von Sledwaya Eißpin ihm einen verhängnisvollen<br />
Tausch anbietet. Er werde ihn bis zum nächsten<br />
Schrecksenmond kulinarisch verwöhnen und dann sein<br />
wertvolles Kratzenfett auskochen, um es für seine alchimistischenArbeiten<br />
weiter<br />
10 1 fetzen<br />
zu verarbeiten. Mit »Der Schrecksenmeister« hat Hildegunst<br />
von Mythenmetz das berühmte kulinarische Märchen<br />
von Gofid Letterkerl über »Echo, das Krätzchen« neu<br />
interpretiert. Die Übersetzung dieses Werkes liegt nun<br />
von Walter Moers vor, der nach »Ensel und Krete« und<br />
dem autobiografischen »Die Stadt der träumenden Bücher«<br />
ein weiteres Hauptwerk zamonischer Literatur übersetzt<br />
hat. Mythenmetz wollte mit diesem neuen Ansatz<br />
das Werk von Letterkerl, dessen Stil er als »sperrig wie ein<br />
Kleiderschrank und gewöhnungsbedürftig wie Trompaunenmusik«<br />
bezeichnet, einem neuen Publikum und einer<br />
neuen Generation von Lesern schmackhaft machen. Der<br />
Stil ist wie gewohnt frisch und erheiternd. Mit einem fantastischen<br />
Auge für die Kleinigkeiten des Lebens wird der<br />
Stadt Sledwaya und dem Herrschaftssitz von Eißpin Leben<br />
eingehaucht. Leider müssen jedoch die Leser<br />
von Moers’ Übersetzung mit einer gekürzten Fassung<br />
vorlieb nehmen: Moers hat die etwa 700 Seiten<br />
Mythenmetz’scher Abschweifungen schlicht weggelassen,<br />
so dass der Roman auf schlanke 380 Seiten<br />
geschrumpft ist. Für den normalen Leser sicherlich<br />
hilfreich, aber für die Literaten unter den Lesern eine<br />
Schmach. sm<br />
»Der Schrecksenmeister. Ein kulinarisches Märchen<br />
aus Zamonien von Gofid Letterkerl. Neu erzählt<br />
von Hildegunst von Mythenmetz« von Walter<br />
Moers, Piper, München 2007, 384 S., € 22,90<br />
goon_halbeseite_quer 22.11.2007 14:19 Uhr Seite 1<br />
Karten 030.890023<br />
www.schaubuehne.de<br />
DAS<br />
LETZTE BAND<br />
von Samuel Beckett<br />
Regie: B.K. Tragelehn<br />
ab: 3. Dezember 2007<br />
Eine Produktion der Stiftung<br />
Schloss Neuhardenberg<br />
BETRUNKEN<br />
GENUG ZU<br />
SAGEN ICH<br />
LIEBE DICH?<br />
von Caryl Churchill<br />
Regie: Benedict Andrews<br />
Deutschsprachige<br />
Erstaufführung<br />
ab: 5. Dezember 2007<br />
DEUTSCHLAND-<br />
SAGA<br />
Uraufführungsreihe im Studio<br />
• Die 70er Jahre •<br />
ab: 30. Januar 2008<br />
BRICKLAND<br />
von Constanza Macras<br />
Regie und Choreographie:<br />
Constanza Macras<br />
Uraufführung<br />
ab: 14. Dezember 2007<br />
DEUTSCHLAND-<br />
SAGA<br />
Uraufführungsreihe im Studio<br />
• Die 60er Jahre •<br />
ab: 3. Januar 2008<br />
PENTHESILEA<br />
von<br />
Heinrich von Kleist<br />
Regie: Luk Perceval<br />
ab: Februar 2008<br />
neue heimat – berlin<br />
contemporary<br />
Legten nicht so viele Leute derart großen Wert auf<br />
Kleinigkeiten wie einen geregelten Lebensunterhalt,<br />
Berlin würde bei seiner Anziehungskraft auf Künstler<br />
und gegenwartskulturelle Autoren bald aus allen<br />
Nähten platzen. Sie fanden in Berlin eine »Neue Heimat«,<br />
und dieser Umstand ist Anlass zu einer schönen<br />
Ausstellung in den weiten Räumen der Berlinischen<br />
Galerie. 29 in Berlin lebende Künstler nähern sich dem<br />
Thema äußerst vielschichtig, wobei eine Behandlung<br />
von Heimat als ›Heim‹ und ›Wohnen‹ dominiert. Trotz<br />
des trauten Klangs von Felsgefügtheit erweist sich<br />
›Wohnen‹ als ungewisse und temporäre Angelegenheit.<br />
Tea Mäkipää zeigt in einer riesigen Konstruktion<br />
ein ganzes Haus. Nur ist dieses Haus aller häuslichen<br />
Dinge wie Dach, Wänden, Möbeln entblößt. Übrig<br />
bleiben, in leichter Schräglage, mit dem Geflecht der<br />
Wasser- und Stromleitungen nur Elemente, die von<br />
der Abhängigkeit dieses angeblichen Schutzraumes<br />
von äußeren Netzwerken zeugen. Mona Hatoum lässt<br />
einen ganzen Hausrat an feinen Drähten hin und her<br />
gleiten, Florian Slotawa schließlich errichtete eine<br />
Skulptur aus Umzugskartons, Schutzfolie und Klebeband.<br />
Das erinnert tatsächlich an Berlin, und vielleicht<br />
ist es nicht zuletzt ihre transgressive Wohnkultur, welche<br />
die Strahlkraft der Metropole ausmacht. Angeregt<br />
streift man also durch die Exponate und spielt mit der<br />
Frage, ob nicht der Umzugsunternehmer Hans Zapf,<br />
der einst in Sachen Weltrevolution nach Berlin kam,<br />
in einer tieferen Schicht der Wahrheit der prägendste<br />
Performance-Künstler dieser Stadt ist. pk<br />
»Neue Heimat – Berlin Contemporary« ist noch bis<br />
zum 7.1.2008 in der Berlinischen Galerie zu sehen<br />
Foto: 1:1 (2005), © Tea Mäkipää, Sound: Tony Ikonen<br />
fetzen<br />
Garage<br />
Chopinot Little Dance Garage<br />
5.6.7.8.9.12.13.14.15.16.19.20.21<br />
dezember 2007 20:00 uhr<br />
Kunsthaus Tacheles<br />
Oranienburgerstr. 54-56a - Berlin<br />
Fon: 030 - 280 96 123
material<br />
Let’`s Ride<br />
Winterzeit ist Snowboard-Zeit! Holt eure Bretter raus,<br />
ob auf der Zugspitze oder im Volkspark. Und: Wer hat<br />
denn bitte behauptet, dass man für Qualität auf Style<br />
verzichten muss?<br />
Forum, Boot<br />
shepherd,<br />
€ 269,00<br />
Flow, Board<br />
solitude wx,<br />
€ 60,00<br />
12 1 material<br />
Giro, Goggles<br />
Verse in olive,<br />
€ 44,9<br />
Technine,<br />
Board boom<br />
box, € 399,9<br />
Grenade, Gloves<br />
maniFesto in<br />
coffee, € 109,9<br />
Burton, Board<br />
the last supper,<br />
€ 90,00<br />
Zimtstern, Unisex<br />
Beanie audience,<br />
€ 33,00<br />
iDiom, Jacket<br />
slant Zip in tartan<br />
blue, €4 0,00<br />
Rome, Board<br />
machine,<br />
€ 429,00<br />
R.E.D., Women’s<br />
Helmet aletta in<br />
eggplant, €110,00<br />
686, Women’s<br />
Smarty Jacket<br />
royale,<br />
€ 299,00<br />
K2, Women’s<br />
Board mix,<br />
€ 449,00<br />
Head,<br />
Women’s<br />
Board<br />
pearl,<br />
€ 279,9<br />
anon, Women’s Goggles<br />
the majestic in<br />
dagger, € 90,00<br />
Special Blend,<br />
Mitten Foreman<br />
in white, € 69,00<br />
Nitro, Women’s<br />
Boots riVal, in<br />
brown/petal,<br />
€ 169,90<br />
Rip Curl,<br />
Women’s<br />
Board,<br />
brooklyn<br />
botanic<br />
Garden,<br />
€ 419,9<br />
Icetools, Boardbag<br />
wheeler,<br />
€ 90,00<br />
material<br />
material 1 13
fetzen<br />
plattentektonik mit marcus schmickler<br />
platten, die mich<br />
geformt, gebessert<br />
und gebildet haben<br />
Ich könnte wirklich viele Platten aufzählen, die ich nicht<br />
missen möchte (z.B. die gerade erstandene Doppel-CD<br />
»Day is Done« von Mike Kelley). Doch hier geht es um eine<br />
Platte, die mich vor langer Zeit schwer beeindruckt hat:<br />
Jürg Wyttenbachs Einspielung von Giacinto Scelsis<br />
»Quattro Pezzi per Orchestra«. Heute, ungefähr 16 Jahre<br />
nach Entdeckung dieser Aufnahme, kommt mir Scelsis<br />
Komposition vielleicht etwas eindimensional vor, doch sie<br />
war, neben »Lontano« von György Ligeti, meine Initiation<br />
in zeitgenössische Orchestermusik. Das Faszinierende<br />
besteht für mich auch heute noch in der Übereinkunft<br />
vieler Gegensätze: In der Musik von Giacinto Scelsi (190 -<br />
1988) heben sich gleich mehrere Widersprüche auf, etwa<br />
ihr vordergründiger Minimalismus, der sich ins Gegenteil<br />
umkehrt. »Quatro Pezzi per Orchestra« generiert mit einfachen,<br />
aber individuellen Mitteln eine enorme Effizienz.<br />
Ich bewundere daran den Mut zum radikal Anderen sowie<br />
die detaillierte Behandlung von Klang, die vielleicht eine<br />
bestimmte Art des Microsounds in der Instrumentalmusik<br />
re-popularisiert hat. Einzigartig ist auch der leichtfüßige<br />
Umgang mit komplizierten Verhältnissen von Komposition<br />
und Improvisation und Autorenschaft: Scelsi<br />
improvisierte, meistens nachts, auf einer frühen Form von<br />
Du zeigst im Dezember deine Soloperformance »Garage«<br />
im Berliner Kunsthaus Tacheles. Was bedeutet »Garage«<br />
für dich?<br />
»Garage« ist eine künstlerische Reflexion und ein Laboratorium.<br />
Anders als in der Zusammenarbeit mit meiner<br />
Compagnie habe ich hier im Dialog mit der Musik und<br />
dem Licht ein ganz anderes Potenzial: Ich versuche, zum<br />
Einfachsten zurückzugehen und alle rationalen Erfahrungen<br />
zu vergessen.<br />
Welche Rolle spielen für dich Improvisation und Intuition?<br />
»Garage« ist jenseits aller Improvisation: Sie dient oft der<br />
Konstruktion, aber mein Vorgehen ist im Gegenteil eher<br />
dekonstruktiv. Ich habe in den letzten 30 Jahren sehr viel<br />
Know-how sammeln können, aber heute gibt es in der<br />
Kunstszene zuviel davon: Meine Aufgabe ist, alles wieder<br />
zu vergessen.<br />
Du machst dich gegen Kommerzialisierung und<br />
Institutionalisierung im Tanz stark.<br />
Ob man innerhalb oder außerhalb der Institutionen<br />
steht: Frei zu bleiben ist schwer.<br />
Ich bin gut zwanzig Jahre oben geblieben, innerhalb der<br />
Heimorgel, nahm dies auf Band auf und übergab die Bänder<br />
an ›Kopisten‹, die aus diesen Tapes präzise Partituren<br />
schufen. Giacinto Scelsi ist es gelungen, eine völlig individuelle<br />
Sprache zu formen, wie es nur wenigen gelingt.<br />
Solche Platten zu entdecken ist für mich immer wieder ein<br />
Glück, und manchmal fürchte ich, es könnte schwieriger<br />
werden, sie zu finden. Doch es hört niemals auf ...<br />
Marcus Schmickler ist international bekannt für seine Arbeit in<br />
zeitgenössischer und elektronischer Musik. In letzter Zeit entstanden<br />
zahlreiche kammermusikalische Kompositionen, viele davon unter<br />
Einbeziehung von elektronischer Musik. Darüber hinaus arbeitet er<br />
auch an Theater-, Film- sowie außergewöhnlichen Popmusik und<br />
Improvisations-Projekten. Er lebt und arbeitet in Köln. In den letzten<br />
Jahren erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen und ist rund<br />
um die Welt auf Bühnen und Festivals vertreten<br />
Soeben erschienen von ihm gleich mehrere<br />
neue Veröffentlichungen: »Altars Of Science«<br />
bei Editions Mego, »R/S One«, eine Kooperation<br />
mit Pita, bei Erstwhile Records, sowie<br />
»TheMonstrousSurplus« unter seinem Pseudonym<br />
Pluramon bei Karaoke Kalk. Dieses Jahr<br />
erschien auch seine Zusammenarbeit mit dem<br />
Saxophonisten Hayden Chisholm bei Häpna<br />
die choreographin régine chopinot interview: astrid hackel<br />
14 1 fetzen<br />
Institutionen, gerade weil es so schwer ist, frei zu sein. Die<br />
Schwierigkeit besteht darin, sich dennoch nicht von der<br />
Welt abzukapseln, sich nicht einschläfern zu lassen. Ich<br />
reise sehr viel und kenne die Schwierigkeiten unabhängiger<br />
Compagnien gut. Für mich ist es an der Zeit,<br />
jenseits des Komforts nach Alternativen zu suchen. Es<br />
gibt schon sehr viele, die das Diktat der liberalen Gesellschaft,<br />
die Dominanz des Geldes und des Entertainments,<br />
nicht akzeptieren wollen. Die Poesie, das Fest, die Freude<br />
am Denken, das sind Elemente, für die man kein Geld<br />
braucht. Ich habe lange Zeit in Vietnam gearbeitet, wo die<br />
Bedingungen sehr hart sind. Gleichzeitig handelt es sich<br />
um eine künstlerisch reiche Kultur. Hier habe ich verstanden,<br />
dass man aus sehr wenig sehr viel machen kann. aha<br />
»Garage«, Solo von Régine Chopinot, 05. – 09., 12. – 16,<br />
19–21.12., Kunsthaus Tacheles, Berlin<br />
© Frederic Yovino<br />
goon<br />
verlost<br />
fetzen<br />
ck in2u – sWdyt (so<br />
What do you think)?<br />
Calvin Klein bewies zu Beginn der 1990er Jahre, erst mit<br />
ihrer Unterwäschekampagne und dann mit der Unisex-<br />
Imagewerbung der Düfte ck one und ck be, dass sie wie<br />
kein anderes Label in der Lage sind, die Gefühlslage<br />
der jungen Generation auszuloten. Damals ging es in<br />
den Kulturwissenschaften wie auch in der Popkultur um<br />
die Emanzipation von binären Geschlechterstereotypen<br />
– symbolisch vertreten durch eng anliegende Boxershorts<br />
für sie und ihn und ein Parfüm für beide. Die Zeiten<br />
haben sich geändert, und wieder kommt aus dem Hause<br />
Calvin Klein eine analytische Momentaufnahme der<br />
Jugendkultur. Mit dem Duft ck IN2U (Text-Sprache für<br />
»in to you«, also ein mehrdeutiges »interessiert an dir«)<br />
spricht Calvin Klein eine Generation an, die sich über<br />
ihren Kommunikations-Stil definiert, und benennt diese<br />
auch: Die Generation der Technosexuellen. Nummern,<br />
Buchstaben und Piktogramme, in Textnachrichten, auf<br />
MySpace-Seiten, in Foren, Blogs und Chats – ck IN2U<br />
richtet sich an eine Generation, die Kontakte via technischer<br />
Hilfsmittel sucht. Zum ersten Mal ist dabei ein<br />
ck-Duft nicht unisex – er wird also nicht geteilt: Es gibt<br />
ck IN2U FOR HER und ck IN2U FOR HIM. Identitätsunterschiede<br />
zählen wieder, und wenn auch nur, um zueinander<br />
zu finden. Und so ergänzen sich ck IN2U FOR HER<br />
und FOR HIM trotz ihrer olfaktorischen Gegensätzlichkeiten:<br />
»spontan und verführerisch« trifft »charismatisch<br />
und ungehemmt«. Aber auch der jeweilige Duft kann<br />
sich bei jedem ganz anders entwickeln: Wir möchten<br />
widererkennbar, aber auch unterscheidbar sein. Präzise<br />
beobachtet, Mr. Klein.<br />
Wir verlosen je 3 Flakons ck IN2U FOR HER und ck IN2U FOR HIM.<br />
Email an tombola@goon-magazin.de. Stichwort: technosexuell.<br />
fetzen 1 1<br />
die<br />
Ausgabe<br />
Nr. 5<br />
LA<br />
MER<br />
GELÉE<br />
erscheint<br />
im<br />
Januar<br />
2008<br />
mit unveröffentlichten<br />
Texten von<br />
Elfriede Jelinek<br />
Olivier Le Lay<br />
Christian Prigent<br />
Odile Kennel<br />
Antoine Brea<br />
Katja Roloff<br />
Elke Erb<br />
Alban Lefranc<br />
Monika Rinck<br />
François Athané<br />
Rüdiger Fischer<br />
mit Zeichnungen von<br />
Arnika Müll<br />
Jean-François Magre<br />
www.lamergelee.com
fetzen<br />
Worauf man in diesem Winter nicht verzichten kann<br />
... erklärt a. j. Weigoni<br />
Wenn es in Deutschland um die hiesige Sprache geht,<br />
kommt man eigentlich gar nicht an A. J. Weigoni vorbei.<br />
Der Wahl-Düsseldorfer (auf das Präfix besteht er) ist<br />
Lyriker, Wortespieler, Gedankenakrobat und Schriftsteller.<br />
Seine Hörbücher sind weniger gesprochenes Wort als<br />
eine Reise in deren Innerstes – feingefühlig, experimentierfreudig<br />
und bei alledem humorvoll. A. J. Weigoni<br />
feiert im Januar seinen 0. Geburtstag und gibt auf einer<br />
Doppel-CD Einblicke in seine kleinteilige Rekonstruktion<br />
der deutschen Sprache.<br />
Warum können wir in diesem Winter nicht auf die<br />
deutsche Sprache verzichten?<br />
Winter. Das Wort erinnert zuerst an eine schneebedeckte<br />
Landschaft. Schon sind wir mitten im Kitsch. Und hereingefallen.<br />
Wir brauchen also weniger Sprache als Poesie.<br />
Poesie ist gemeingefährlich. Ohne sich durch Logik, Vernunft<br />
oder Benimmregeln beeinflussen zu lassen, dringt<br />
sie in das Gehirn und löst dort ohne Umwege heftige<br />
Gefühle aus. Wie es der Zufall will, schreibe ich gerade an<br />
16 1 fetzen<br />
einem Zyklus, bei dem mich der kalte Blick auf den Alltag<br />
interessiert. Mit kühlem Herzen habe ich Anteilnahme<br />
und Emotionen unterdrückt, um sie auf diese Art und<br />
Weise umso deutlicher zu machen und das Halluzinatorische<br />
der Normalität hervorzukehren.<br />
Wie kann Deine Sprache dem gefühlsleeren Alltag etwas<br />
entgegensetzen?<br />
Leben am Wundrand der globalisierten Gesellschaft, das<br />
ist das Thema dieser Geschichten. Es sind Geschichten<br />
eines Übergangs: vom Sozial- zum Individualstaat. Wir<br />
lernen Untote kennen, die in der Liebe Erlösung suchen.<br />
Diese Darsteller verkaufen sich oder lassen sich kaufen.<br />
Was geschieht, bleibt Reflex auf den Alltag, der niemanden<br />
mehr anspornt, weil dahinter kein Traum mehr<br />
ist und eine Moral schon gar nicht. Diese Welt hat keinen<br />
Notausgang. Deshalb kann ich dem als Schriftsteller nur<br />
mit schwarzem Humor begegnen.<br />
»Gedichte – HörBuch« von A. J. Weigoni ist über das Tonstudio<br />
an der Ruhr erhältlich. Weitere Infos unter www.weigoni.de<br />
street Wars<br />
Marc Ecko feiert den 30. Geburtstag der<br />
Weltraumsaga »Star Wars« mit einer<br />
limitierten Kollektion, die nichts mehr<br />
mit geeky Fan-Shirts und Stormtrooper-<br />
Halloween-Kostümen zu tun hat. »Es ist<br />
kein Geheimnis, dass ich ein absoluter Fan<br />
von ›Star Wars‹ und George Lucas bin«,<br />
sagt Marc Ecko. »Unsere Aufgabe war es,<br />
in den Lucasfilm-Archiven zu graben und<br />
die reiche Bildsprache, die ›Star Wars‹ zur<br />
bekanntesten Fabel der letzten 100 Jahre<br />
gemacht hat, mit der Populärkultur zu<br />
vereinen.« In einer Kombination bekannter<br />
»Star Wars«-Motive mit tragbarem<br />
Streetwear-Style enthält die Linie unter<br />
anderem solche Schmuckstücke wie den<br />
Hoth-Parka, das Bounty Hunter-Jacket,<br />
ein »Darth Vader is Dead« Graphic-Tee<br />
und den »Fett for Real« Zip-Hoodie.<br />
Streets of Coruscant, here I come.<br />
Die »Star Wars« Modelinie von Marc Ecko wird<br />
in dieser Holiday-Saison in internationalen<br />
Special-Stores erhältlich sein.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Konzertagentur<br />
Berthold Seliger
töne<br />
Illustration:<br />
bruno<br />
colajanni,<br />
ludaG.com<br />
töne<br />
»Das Visionäre am<br />
Kunstwerk bleibt ein<br />
historisches Zitat.<br />
Man zitiert die Vision<br />
von damals. Vielleicht<br />
kann man sie noch<br />
transportieren,<br />
vielleicht sogar in die<br />
Gegenwart übersetzen:<br />
das was damals galt,<br />
könnte, aha!, eben auch<br />
noch jetzt gelten.«<br />
Dave Longstreth über das neue<br />
Album der dirty projectors<br />
Seite 24<br />
»Zwei Leute sind<br />
schon Mal weniger<br />
Minimal als einer«<br />
Max Lodendauer von sun<br />
electric im Gespräch<br />
Seite 30<br />
20 Efterklang<br />
22 Dirty Projectors<br />
24 Michaela Melian<br />
2 Feu Thérèse<br />
26 A Whisper In The Noise<br />
27 Kapital Band I<br />
28 Zwiegespräch: Frank<br />
Bretschneider + Sun Electric<br />
30 Musikszene Bristol<br />
reviews<br />
34 epiphany outlet<br />
3 Louis Philippe<br />
The Clientele<br />
36 beep street<br />
37 Luke Vibert<br />
Phon°noir<br />
38 Doom & Gloom<br />
Vashti Bunyan<br />
39 the relay
No Goalsi,No Records<br />
efterklang aus Kopenhagen behaupten zwar, sie hätten weder Ziele noch eine neue<br />
Platte im Gepäck, doch glaubt das fünfköpfige Kammer-Indie-Gespann immerhin an<br />
die Existenz eines dezidiert europäischen Humors. Eine unscharfe Momentaufnahme<br />
aus dem inzwischen verlassenen Studio der Band<br />
text, interview: renko heuer foto: nan na hvass<br />
»Wir sind keine Brasilianer, zumindest nicht in diesem<br />
Ego-Sinne. Uns geht’s musikalisch wie buchstäblich<br />
darum, den Ball möglichst lange in der Luft zu halten.«<br />
rasmus stolberg<br />
Von Aufbruchs- oder Untergangsstimmung keine Spur:<br />
Efterklang, heute ausnahmsweise sogar siebenköpfig,<br />
inklusive einem Ami-Gastmusiker (zu dessen bzw. deren<br />
Humor wir später kommen), sitzen und stehen, z.T.<br />
gar in Socken, in ihrem Noch-Proberaum im Süden Kopenhagens<br />
und zelebrieren das, was sie generell viel zu<br />
selten, derzeit aber tagtäglich von morgens bis abends<br />
tun: Sie proben, spielen diejenigen Songs endlich auch<br />
mal gemeinsam, die zuvor in unzähligen Sessions digital<br />
zu solchen verkettet wurden. Rasmus Stolberg, neben<br />
Songwriter Casper Clausen der schnurrbärtigere Kopf<br />
der Band, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen,<br />
hat für alles sogar noch ein Extragrinsen in der Hinterhand:<br />
Zwar müssen Efterklang nach über fünf Jahren<br />
das mit apokryph-vergilbten Buchseiten und einem gut<br />
versteckten Alphorn-Poster tapezierte Studio in Kürze<br />
räumen, weil die Mieten auch am Rande der dänischen<br />
Metropole explodiert sind, zwar stehen ab Ende des Monats<br />
etliche Gigs in ganz Europa an, zwar soll zwei Tage<br />
nach unserem Zusammentreffen ein überaus aufwendiges<br />
Video inklusive »Feuerwehrauto, Pyrotechnik, Slo-Mo-Shots,<br />
Kindern, einem Clown« (und dem Kameramann von Martin<br />
de Turah) gedreht werden, zwar lebt Rasmus nach<br />
wie vor von einem Studentendarlehen, das er sich nur<br />
dadurch sichert, dass er sich selbst als Praktikant anheuert<br />
–, aber das kreative Chaos, bestehend aus unzähligen<br />
obskuren Instrumenten, einem Heer von Flöten, Kabeln<br />
und Gestänge, einer heute auf Jungfernfilm befindlichen<br />
3-Chip-Kamera, faltigen Saftpackungen, wieder und wieder<br />
benutzten Wasserflaschen, um ihn und seine (offiziell)<br />
vier Buddies, lässt gar keinen Raum für Hektik oder gar<br />
Verzweiflung. Ein Song sitzt noch nicht ganz, doch warum<br />
auch die Dinge überstürzen: Efterklang haben ihren eige-<br />
nen Rhythmus. Marschmusik interessiert sie, soviel steht<br />
fest, definitiv nur in klanglicher Hinsicht.<br />
Malville, Fußball und Rumraket<br />
Dass Rasmus und Casper, die sich schon seit ihrer Kindheit<br />
kennen, auch mit Schlagzeuger/Trompeter Thomas<br />
Kirirath Husmer (»Ich bin sonst Lehrer und doch der einzige,<br />
der wirklich versucht, ein Musiker zu sein.«), Rune<br />
Fonseca Mølgaard (Piano) und Mads Brauer (Produktion)<br />
sehr eng befreundet sind, liegt auf der verkaterten Hand:<br />
Konstant reden die fünf Bandmitglieder durch- und – vor<br />
allem – füreinander. Der redselige Thomas, ein Mann der<br />
Melville-Metapher (»Wir haben gemeinsam ein Schiff gebaut.«),<br />
bezeichnet Rasmus als besten Fußballer der Band,<br />
woraufhin Rasmus einwirft, dass Casper das nur ungern<br />
hören wird, während der zeitgleich sein Statement abgibt<br />
(»Ich sehe Fußball wie Kampfsport, Rasmus erkennt darin<br />
eine Art abstrakten Balletttanz.«) und über das von Rasmus<br />
geführte Rumraket-Label redet (dessen erste erfolgreiche<br />
Schwarze-Zahlen-Rakete das Grizzly-Bear-Album aus<br />
der Prä-Warp-Ära war), um gleich im Anschluss die Rolle<br />
von Thomas verschmitzt als die des »Mannes für jegliche<br />
Drecksarbeit« zu definieren. Der Vibe ist eher Zivi-Bude<br />
als Studio-Headquarter, eher Atelier als Office.<br />
Goal, Record, Boxparaden<br />
Der konstante Dialog, der an diesem allzu bald verlassenen<br />
Ort stattfindet, sei es über die einzelnen Songs (ein<br />
Wort, das den weitschweifigen »Album-Versatzstücken«<br />
von Efterklang kaum gerecht wird), über graphische Dinge<br />
(Efterklang sind Handarbeiter wie Mugison), über Film<br />
– »Bitte schreib in deinen Text, dass ich ›Lost In Translation‹<br />
abgrundtief hasse.« (There you go, Rasmus!) –, über die<br />
politics im Geschäft, oder über unterschiedliche Ziele und<br />
Motivationen, läuft nie ohne einen touch von »vorläufiger<br />
Definitivität« und zugleich nie ohne doppelten Bedeu-<br />
»Insgesamt funktioniert unsere Musik<br />
wohl eher wie Kino. Wie ein Film, der<br />
sich an keiner Stelle wiederholt.«<br />
tungsboden ab. Wie beispielsweise die Worte »goal« und<br />
»record« hier gleich mehrfach verdreht werden – à la<br />
»We don’t like goals« (auf ihr Fußballspiel bezogen) und<br />
»there is no new record« (auf die Rekordzahl von 40 Ballkontakten<br />
ohne Bodenberührung bezogen) bzw. deren<br />
Gegensätze (auf Musik bezogen) –, ist auch ihr neues Album<br />
»Parades«, der Nachfolger zu »Tripper« (2004), ein<br />
bombastisch-ungewisser Trip in die kollektive Unschärfe:<br />
Waren auf dem Vorgänger ganze 40 Albumgäste am Trip<br />
beteiligt, sind es auch dieses Mal »gut 35« umtriebige<br />
Dänen, mit deren Hilfe sie ihr »Schiff« (Thomas), »eine<br />
riesige Skulptur« (Casper), in eine entlegene Umlaufbahn<br />
befördert haben, in der sie derzeit ganz alleine sind. Nicht<br />
ohne Grund gab es dieser Tage schon erste Vergleiche<br />
mit Radiohead (wobei die niemals klanglicher Natur sein<br />
könnten!), denn die unzähligen Instrumentalformationen,<br />
Staccato-Bläser-, Electronica- und Glockenspiel-Einlagen,<br />
Gast-Chöre und -Streicher, die über-, unter-, neben- und<br />
nacheinander verschachtelten Avant-Bombastrock-Melodien,<br />
voller Pomp und Prunk und Liebe zum eklektischelektronischen<br />
Detail, die durch Untiefen und zugleich<br />
über epische Bögen führenden Spitzen, machen sie ganz<br />
klar zu den ultimativen Drama-Kings der Stunde. »Insgesamt<br />
funktioniert unsere Musik wohl eher wie Kino. Wie ein<br />
Film, der sich an keiner Stelle wiederholt. Was das genaue<br />
Gegenteil eines Popsongs ist: Der nämlich basiert auf der<br />
Wiederholung: Statt von A nach B nach C und zurück zu<br />
gehen, legen wir die Strecke zwischen A und G zurück, ohne<br />
dabei jemals zurück zu schauen. Und unterdessen haben<br />
unzählige Melodien und Themen kurze Gastrollen.« So ist<br />
ihr neuester Film auch treffend nach diesen Paraderollen<br />
benannt: »Die Paraden, um die es im Titel geht, sind einerseits<br />
die Melodien selbst, wie sie marschieren, andererseits<br />
sind es die einzelnen Songs, die gemeinsam eine noch größere<br />
Parade ergeben. Und dann ist es auch unser neuer Hang<br />
zu Marschmusik. Im Dänischen steht der Titel zudem für<br />
das Parieren beim Boxen, also eine Abwehr – doch ist das<br />
eher eine zusätzliche Bedeutung, die genauso wenig geplant<br />
war, wie die deutsche Gonorrhoe-Anspielung bei unserer ersten<br />
LP«, erläutert Rasmus. Casper ergänzt: »Es geht immer<br />
um Überraschungen, um neue Richtungen, wobei wir uns<br />
nach und nach einem überdimensionalen Gesamtbild annähern.«<br />
Von Anfang bis Ende<br />
Während sich Casper, der auch schon einen Soundtrack<br />
für einen Animationsfilm beigesteuert hat, wünscht, dass<br />
man ihr Album »mindestens drei Mal von Anfang bis Ende<br />
hört, um es zu verstehen«, zeichnet sich die Kommunikation<br />
innerhalb der neunköpfigen Live-Band dann doch<br />
zum Teil durch Missverständnisse aus: Auf die Frage, ob<br />
die Tatsache, dass es insgesamt 11 Songs sind, ein weiterer<br />
Fußball-Insider sei, kann selbst kollektives Gelächter den<br />
anwesenden (und hier leider namenlosen) Gastmusiker<br />
aus den USA nicht von der perplexen Zwischenfrage abhalten:<br />
»Wirklich? Krass.« Rasmus’ Retourkutsche: »Schau,<br />
das ist europäischer Humor, es gibt ihn doch!«<br />
»Parades« von Efterklang ist bereits bei The<br />
Leaf Label/Hausmusik/Indigo erschienen<br />
20 1 töne<br />
töne 1 21
Erhaben über das Zerstörte<br />
Mit der Black-Flag-Reminiszenz »Rise Above« gelingt David Lengstreth und seiner Band<br />
dirty projectors ein neuer spiritueller Umgang mit einem historisierten Kunstwerk<br />
und ein großartiges Assoziations-Album<br />
Dave Longstreth wollte sehen, ob er das Black Flag-Album »Damaged« selbst<br />
machen könne, nicht als Cover, sondern als »original creative act«.<br />
text: fabian saul fotos: christoph voy<br />
27. Juli 1984, Newport, Jockey Club. Betrete den großen<br />
Raum. Bar links, auf der Rechten die Toiletten. Du<br />
musst, aber nicht so nötig, noch nicht. Pretty good crowd.<br />
Hmm. Get a Foster. Da ist Shorty. Der Sound ist gut. Jimmy<br />
D schmeißt heute den Laden. Wer ist auf der Bühne?<br />
Näher, noch ein Stück näher... Black Flag! Rise Above!<br />
We’re born with a chance / Rise above, we’re gonna rise above<br />
/ I am gonna have my chance / Rise above, we’re gonna rise<br />
above / We are born with a chance / Rise above, we’re gonna<br />
rise above / And I am gonna have my chance / Rise above,<br />
we’re gonna rise above / We are tired of your abuse / Try to<br />
stop us, it’s no use.<br />
Punk ist Geschichte. Offensichtlich kann man den ganzen<br />
großen Popgeschichts-Baum durchschauen, kann den einen<br />
Ast auf den größeren, an dem er hängt, zurückführen.<br />
Punk, das war der eine Ast dort. Da hängt Hardcore dran.<br />
Der amerikanische Auswuchs. Und dort sind auch Black<br />
Flag. Wisst ihr noch? 27. Juli. Jockey Club.<br />
Jetzt, 23 Jahre später, kann man das erklären. Man<br />
kann sehen und hat verfolgt, dass Hardcore, dass Black<br />
Flag, weitere Triebe sprießen ließen. Da sind unzählige<br />
neue dazugekommen. Und so ein Ast, der hat bekanntlich<br />
Kurven, kaum sichtbare Abzweigungen, einiges, was<br />
man nur mikroskopisch erblicken kann, unzählige Quer-<br />
verbindungen. Aber, gewiss ist: Das ging immer weiter, da<br />
war und ist ein Weg. Was damals, aus der Perspektive der<br />
gewesenen Gegenwart, sich vielleicht als Vision abzeichnete<br />
– try to stop us, it‘s no use – verkommt gar lächerlich<br />
zur Passage zwischen einem A an einem und einem B am<br />
anderen Ende. Das Kunstwerk selbst, das Album, der<br />
Song, der Klang, wird entmystifiziert, während fleißig<br />
historisiert wird. Die Größe der Äste bestimmt sich dabei<br />
immer aus dem Blick und aus der Distanz, die man einnimmt.<br />
Mit Blick und Distanz der westlichen (Pop-)Kultur<br />
ist Punk in jedem Fall ein Ast beachtlichen Durchmessers.<br />
Am Ende dieses Prozesses der Geschichtsschreibung hat<br />
man feine, kleine, historisierte Kunstwerke vorliegen und<br />
kann auf sie zugreifen: Black Flag, »Damaged«, 1981. So<br />
wollte man das ja. Und das funktioniert. Nun kann man<br />
fein säuberlich ein Ästlein brechen und ihm neues Leben<br />
einhauchen.<br />
Covern: Das Kleid des Anderen noch einmal aufpolieren,<br />
noch einmal anziehen und dabei ein wenig vom eigenen<br />
Schweiß in ihm hinterlassen. Die Platte, das Album, der<br />
Song sind dabei geschlossene, fertige Kunstwerke, eine<br />
recht inflexible Masse, die man zwar neu färben kann,<br />
selten aber wirklich neu formen. Das Visionäre am Kunstwerk<br />
bleibt ein historisches Zitat. Man zitiert die Vision<br />
von damals. Vielleicht kann man sie noch transportieren,<br />
vielleicht sogar in die Gegenwart übersetzen: Das was<br />
damals galt, könnte, aha!, eben auch noch jetzt gelten.<br />
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bleibt es<br />
nur ein weiteres Stück im stets wieder zu belebenden Pop-<br />
Museum. Ein Wachsfigurenkabinett! Sucht euch eine aus!<br />
Anhauchen genügt! Ja, die funktionieren noch!<br />
7. November 2007, Berlin, West Germany. Wer ist auf der<br />
Bühne? Näher, noch ein Stück näher... Dirty Projectors.<br />
Rise Above.<br />
David Longstreth ist ein Getriebener. Ein schier endlos<br />
dahinsprudelndes Fass unvergleichlicher Energie. Visionär.<br />
Sein Studium in Yale abgebrochen, widmet er sich<br />
seit 2002 mit ganzer Leidenschaft der Musik. Album, EP,<br />
Live, Folk, Pop, Punk: Stets sich neu erfindend, Herausforderungen<br />
suchend, und dennoch nie kurz gedacht, immer<br />
intelligent, fordernd. Gast auf der neuen LP von Chris<br />
Schlarb, zusammen mit Zach Condon von Beirut auf der<br />
»Friend EP« von Grizzly Bear, mit seinem Kollektiv Dirty<br />
Projectors auf David Shrigleys »Worried Noodles«. Und<br />
nun die siebente eigene Veröffentlichung binnen fünf Jahren:<br />
»Rise Above«. Der Titel der Platte ist dem Eröffnungssong<br />
der Platte »Damaged« von Black Flag aus dem Jahre<br />
1981 entliehen.<br />
Das Kunstwerk selbst, das Album, der Song, der Klang, wird<br />
entmystifiziert, während fleißig historisiert wird.<br />
Und damit steht am Anfang die Proklamation: Die ist eine<br />
Black-Flag-Reminiszenz. Dies ist dann auch schon das einzige<br />
wirklich konzeptionelle, was Lengstreth macht. Dann<br />
beschließt er, statt der eigentlichen Platte sein Gedächtnis<br />
zu benutzen. Die Platte selbst hat er vor Jahren gehört.<br />
Und so ist es nicht die »Damaged« von 1981, sondern<br />
das, was Longstreth von ihr im Kopf hat, um das es geht.<br />
Longstreth ist der Filter, durch den die Platte gegangen ist,<br />
noch bevor sich das zu Hörbarem geformt hat. So kommt<br />
das bei Coverversionen übliche Spiel mit den bestehenden<br />
Themen und Arrangements, ihre teils wohl behutsame<br />
Neuordnung, ihr teils absichtlich schludriges Übergehen,<br />
bei dieser Platte nicht zum Tragen.<br />
Die immer auch rhythmisch vielfältige Soundlandschaft<br />
zehrt sich aus Holzbläsern, Violinen, Drums, Klavieren,<br />
Gitarren, choralen Gesängen, teils arrangiert, teils<br />
improvisiert; Themen werden aufgenommen, abstrahiert,<br />
verworfen, Originaltexte mischen sich mit eigenem lyrischem<br />
Material.<br />
So gesehen handelt es sich um kein Konzeptalbum, sondern<br />
um ein Assoziations-Album. Das Original ist dabei<br />
ein Fundus von Ideen, Inspirationen, Themen, auf die<br />
man frei zugreifen kann. Das ist weit entfernt von der<br />
klassischen Coverversion. Vielmehr nähern sich die Dirty<br />
Projectors dem Kern des Materials. Sie legen die in ihm<br />
verborgene Rohmasse frei, formen sie neu, spüren dem<br />
Geist nach. Longstreth ist mehr Spiritueller als Visionär,<br />
geht mehr assoziativ denn konzeptionell vor. Das eröffnet<br />
eine prinzipielle Dimension im Umgang mit bestehenden<br />
Kunstwerken und zeigt an diesem gelungenen Beispiel<br />
neue Möglichkeiten auf.<br />
Er wollte sehen, ob er das Album selbst machen könne,<br />
nicht als Cover, sondern als »original creative act«. Und<br />
so wird zwar im Albumtitel der direkte (historische) Bezug<br />
proklamiert, doch das, was tatsächlich passiert, ist etwas<br />
Anderes: Die Dirty Projectors verändern den Zugriff, in<br />
dem sie sich über das eigentliche historisierte Kunstwerk<br />
erheben, auch über dessen eigenhändige Zerstörung, und<br />
dem Extrakt nachspüren. David Longstreth hat ihn nicht<br />
mehr vorliegen, den Ast. Er weiß gar nicht mehr so genau,<br />
wie der aussah. Aber einmal, da hat er ihn gesehen. Und er<br />
pflanzt dessen Geist fort, ohne dabei das Geschichtsbuch<br />
zur Hilfe zu nehmen. Er will es nicht und er braucht es<br />
nicht einmal. Weil das hier vorliegende Kunstwerk, »Damaged«<br />
von Black Flag, plötzlich auch sein eigenes geworden<br />
ist.<br />
»Rise Above« von Dirty Projectors ist bereits bei Rough<br />
Trade/Beggars Group/Rough Trade erschienen<br />
»Worried Noodles« von David Shrigley und anderen<br />
ist bereits bei Tomlab/Indigo erschienen<br />
22 1 töne<br />
töne 1 23
Rave hinter<br />
geschlossenen Türen<br />
Vom Schwarzwald an die amerikanische<br />
Westküste: Die Musikerin und Künstlerin<br />
michaela melian weiß, dass es<br />
manchmal nur ein kleiner Schritt von<br />
»Baden Baden« nach »Los Angeles« ist<br />
text, interview: nina scholz<br />
Los Angeles ist ein mythischer Ort. Vielleicht wie bei keiner<br />
anderen Stadt, schießen einem sofort Bilder in den<br />
Kopf: glitzernde Metropole, heiße Sonne, braungebrannte<br />
Bikinimädchen, aber auch düstere Motels, alternde Filmstars,<br />
Gangs. Um diese Klischees und Wahrheiten zu kennen,<br />
muss man nicht dort gewesen sein. »Los Angeles«<br />
heißt auch das zweite Album von Michaela Melian, und<br />
das hat mit dem Vorgänger »Baden Baden« mehr gemein<br />
als zwei Städte im Titel, deren offensichtlichste Bilder sich<br />
um Glam und Trash drehen. »Los Angeles« ist kein raues,<br />
hartes, lautes Album geworden. Zwar verhandelt es Orte,<br />
die mit Schmerz, Wissen, Traurigkeit, Exzessen, Versprechungen<br />
und Hoffnungen durchzogen sind, die Tracks<br />
sind aber, selbst dort wo sie tanzbar sind, sanfte Einladungen<br />
zum Zu- und Wiederhören. Das zentrale Stück<br />
»Föhrenwald«, das genau wie alle Musikstücke Michaela<br />
Melians zu ihren Ausstellungsstücken produziert wurde,<br />
loopt ein Stück traditionelle, jüdische Musik, dass sie im<br />
Archiv Föhrenwald bei ihren Recherchen gefunden hatte.<br />
Am Anfang hätte sie gar nicht gewusst, dass »Föhrenwald«<br />
so groß wird, erzählt sie im Gespräch. Aber dann sei ihr die<br />
Monstrosität des Themas immer mehr bewusst geworden.<br />
Föhrenwald, das nah an ihrem Wohnort Wolfratshausen<br />
liegt, ist eine Ende der 1930er gebaute Siedlung, die erst<br />
als Lager für Zwangsarbeiter, nach dem Krieg als exterritoriale<br />
Siedlung für jüdische displaced persons, später<br />
dann zur Unterbringung heimatvertriebener Familien<br />
genutzt wurde. »Ich dachte, ich kenne mich mit Nachkriegsgeschichte<br />
aus, vieles weiß man ja auch, aber da liegt auch<br />
noch einiges vergraben.« Und so begann sie zu suchen,<br />
zu recherchieren und Beteiligte in sensiblen Gesprächen<br />
auf Tonbänder aufzunehmen. Es entstanden die Bilder,<br />
bei denen sie Schemen der Gebäude erst nachzeichnete,<br />
dann abnähte, um diese dann per Projektor an eine Wand<br />
werfen zu lassen. Der gleichförmige Loop des jüdischen<br />
Stückes mit dem ruhigen Basslauf, die beunruhigenden,<br />
sich überlagernden Tonbandstimmen, das Klicken des Diaprojektors<br />
ziehen den Betrachter an, lassen ihn nicht los,<br />
verstören. Die Installation lädt ein, aber erklärt und tröstet<br />
nicht. »›Föhrenwald‹ war das schwierigste Stück. Egal wen<br />
ich gefragt habe – von den Holocaustüberlebenden bis hin zu<br />
den Vertriebenen – alle haben schlimme Geschichten erlebt,<br />
genauso wie die Leute, die dort gelebt haben. Die Tragweiten<br />
kann man natürlich nicht vergleichen, deswegen habe ich die<br />
jüdischen Personen absichtlich ins Zentrum gestellt.« Dass<br />
der Track auf der Platte melancholisch und beruhigend<br />
klingt, einer ihrer schönsten ist, stört sie nicht weiter: Ihre<br />
Musikstücke lässt sie noch viel mehr los als ihre Kunstwerke<br />
in Ausstellungen. Auf der einen Seite sind ihre Arbeiten<br />
Produkte sehr genauer Recherche und Überlegungen, auf<br />
der anderen Seite vertraut sie ihnen und den Freiräumen,<br />
die sie lassen. »Ich finde das macht nichts. Man kann das<br />
Stück ohne das Wissen hören. Vieles kann man trotzdem dadurch<br />
erfahren und vielleicht macht es ja auch neugierig.«<br />
Oft sind die Stücke für das Album von ihr noch einmal<br />
umprogrammiert und neu gestaltet worden. Teilweise, um<br />
die Effekte in den Ausstellungen, ohne deren Exponate die<br />
Tracks auskommen müssen, deutlicher hervorzuheben,<br />
teilweise aber auch einfach, weil sie sonst in dem Konzept<br />
des Albums störend und nicht stimmig gewirkt hätten.<br />
»Convention« war zuerst eine Installation im Hamburger<br />
Club The Better Days Project, wurde dann nachgebaut<br />
und in der Gender-Ausstellung »Das achte Feld« im Kölner<br />
Museum Ludwig gezeigt. Hinter einer Tür hört man<br />
Technomusik, der Pawlow’sche Rave-Effekt ist schon nach<br />
wenigen Sekunden erreicht: Man möchte hinter diese Tür<br />
gelangen und all die Versprechungen einlösen lassen, die<br />
der Club impliziert. Der Track »Convention« erfüllt genau<br />
dies, aber dafür musste er umgeschrieben und aus seiner<br />
Monotonie erlöst werden: Was wie ein klassischer Einspieler<br />
eines Filmsoundtracks beginnt, sich erstmal den<br />
ruhigeren Stücken auf »Los Angeles« anschließt, zieht nach<br />
und nach an, bis das Discoversprechen deutlich hervortritt<br />
und ein Dancefloorstück ausbricht, man das erste und einzige<br />
Mal zu wippen, ja zu tanzen beginnt. »Convention«<br />
ist, genau wie das Nico-Cover »Manifesto«, welches das<br />
Album beschließt, ein Bekenntnis zu Pop, Glam und Disco.<br />
Michaela Melian ist sich der Schönheiten, Abgründe und<br />
Komplexitäten bewusst. Sie verdeutlicht und beleuchtet<br />
die Situation, um im nächsten Augenblick wieder den Vorhang<br />
herunterzulassen. Um all das zu transportieren, muss<br />
Michaela Melian keine schweren Geschütze auffahren. Die<br />
Reduktion der Produktionsmittel reflektieren, kontrastieren<br />
und verdeutlichen das sogar noch. Besonders klar wird<br />
das bei »Stift«, das durch wenige Loops, die übereinander<br />
gelegt wurden, den Hörer in eine positive Gefangenschaft<br />
nimmt, nicht mehr loslässt, aber auch nie in eine Melodie,<br />
einen Refrain entlässt. Die Spannung entsteht durch die<br />
leisen Widersprüche in ihrer Musik, genau wie in ihrer<br />
Kunst gestaltenden Arbeit. So wachsen kleine und große<br />
Fragezeichen, die den Betrachter und Hörer binden. »Es<br />
wird einem ja erstmal nicht viel geboten, es schreit ja keiner<br />
rum, wie das sonst öfter der Fall ist. Aber natürlich soll es<br />
neugierig machen, ohne einen einzulullen.« Das hat sie in<br />
jeder Hinsicht erreicht: »Los Angeles« ist eine komplexes<br />
und großartiges Popalbum.<br />
»Los Angeles« von Michaela Melian ist<br />
bereits bei Monika/Indigo erschienen<br />
Zeit zum Erinnern<br />
Manchmal ist das Paradox nicht weit:<br />
feu thérèse erschaffen Neues aus<br />
ihrer Erinnerung<br />
text, interview: sebastian hinz<br />
Längst ist es so, dass die zeitgenössische Musik in<br />
ihren Grundzügen festgelegt ist: Folk, Rock, Pop,<br />
HipHop, Techno, Jazz. Selbst eine Verfeinerung<br />
dieser Musikstile bis in die kleinsten Differenzierungen<br />
hat stattgefunden. Es gibt scheinbar<br />
nichts mehr, was es nicht gibt. Und wo die Neuerfindung<br />
so schwer fällt, setzt das (meist schlechte) Gedächtnis ein.<br />
Zitat, Sample, Remix oder Coverversion sind wesentlicher<br />
Teil der postmodernen Musikwelt. Doch so wichtig Montage,<br />
Collage und Kopie als Techniken für die Popmusik<br />
sind, ihnen obliegt es durch die kulturelle Revolution der<br />
neuen elektronischen Medien externer Speicherung (also:<br />
des künstlichen Gedächtnisses) stets etwas Vollendetes,<br />
oder eben leicht – per Mausklick – Verfügbares. Allerdings<br />
gibt es zunehmend Künstler, die dieses Zu-Ende-Gekommene<br />
als Gegenstand der Erinnerung und kommentierender<br />
Aufarbeitung weiterleben lassen; auch Feu Thérèse<br />
gehörten dazu.<br />
»To play with static sounds which are deconstructed by<br />
sounds in motion.«<br />
luc ferrari<br />
Die kanadischen Musiker Jonathan Parant, Alexandre St-<br />
Onge, Stephen Oliveira und Luc Paradis erinnerten sich<br />
zunächst an den französischen Komponisten Luc Ferrari,<br />
der am 22. August 200 , unmittelbar vor Beginn der Arbeit<br />
an ihrem selbst betitelten Debütalbum »Feu Thérèse«,<br />
im italienischen Arezzo gestorben ist. Luc Ferrari galt als<br />
einer der wichtigsten Repräsentanten der Musique concrète,<br />
einer Spielart der modernen Komposition, welche<br />
die Manipulation von Geräuschen aus Natur, Umwelt und<br />
Technologie in den Mittelpunkt stellt. Doch für das Quartett<br />
aus Montréal war es weniger Konkretes, nicht das Verwenden<br />
von Arbeitstechniken oder die Neuinterpretation<br />
von Stücken, sondern der Geist der Musik von Luc Ferrari,<br />
der sich dann auf dem Debüt nebst dem Eröffnungsstück<br />
»Ferrari en Feu« wiederfinden ließ. »Für jeden einzelnen<br />
von uns ist die Musik von Luc Ferrari sehr wichtig,<br />
allerdings auf sehr unterschiedliche, individuelle Art<br />
und Weise«, erklärt Schlagzeuger Luc Paradis. »So sehr uns<br />
seine Arbeit auch beeinflusst hat, ist er eher dahingehend eine<br />
Inspiration für uns, wie grenzenlos Musik sein kann.«<br />
»One thing is certain: even if they don’t know where<br />
they’re going they all go the same.«<br />
alexandre st-onge<br />
Aus neurowissenschaftlicher Sicht sei jede Erinnerung nur<br />
Erfindung, sagte der Hirnforscher Wolf Singer einmal,<br />
was auch als Charakterisierung der kreativen Prozesse<br />
von Feu Thérèse gut passen würde. Die vier Musiker, die<br />
auch bei Fly Pan Am, Et Sans oder Shalabi Effect spielen,<br />
beweisen auch auf ihrem zweiten Album »Ça va cogner«<br />
(engl: It’s gonna hit) eine stilistische Breite, die Krautrock<br />
und französischen Chanson, Musique concrète und Vierviertelpop<br />
umfasst. Es ist eine Erinnerung an einen Sound<br />
und eine Zeit, als Pop noch Subkultur war. Doch nicht als<br />
Nostalgie präsentiert, sondern als avancierter Vorschlag<br />
für die Gegenwart. Luc Paradis: »Es gibt eine Menge Bands,<br />
welche die Musik von den 1960er bis zu den 1980er Jahren<br />
recyceln, ohne dieser etwas ihnen Eigenes zu verleihen. Sie<br />
bevorzugen, diese zu imitieren. Feu Thérèse hingegen glauben<br />
an die Kraft der Rockmusik, Hemmnisse und Grenzen<br />
zu überwinden und machen daher Musik, welche bekannte<br />
Klänge in neue Klänge übersetzt. We are not afraid of sound<br />
and music!«<br />
»Ça Va Cogner« von Feu Thérèse ist bereits<br />
bei Constellation/Alive erschienen<br />
24 1 töne<br />
töne 1 2
Pure Bodies Of Truth<br />
Mit dem kongenialen »Dry Land« beleben a Whisper in the noise<br />
alte Wahrheiten und treffen dabei einen wunden Punkt unserer Zeit<br />
text, interview: fabian saul<br />
»As we were«. Dies sind die ersten Worte, die nach einer<br />
halben Minute losbrechen, und es gehört zur Genialität<br />
der soeben vorgelegten Platte von A Whisper In The Noise,<br />
die zentrale Botschaft dem Gesamtwerk im ersten Satz<br />
voranzustellen.<br />
A Whisper In The Noise ist das Musikprojekt von<br />
West Thordson aus Minnesota. Nach drei in Eigenregie<br />
veröffentlichen Alben in den letzten vier Jahren, erscheint<br />
– zunächst nur in Deutschland – ihr Debüt auf Exile On<br />
Mainstream Records. Und das, was Thordson mit »Dry<br />
Land« geschaffen hat, ist zunächst ein vollkommen unzeitgemäßes<br />
Album. Denn gemäß unserer Zeit hat das Album<br />
als Kunst-Format so gut wie ausgedient. Gemäß unserer<br />
Zeit ist das Vertrauen in eine wie auch immer geartete Authentizität<br />
gering. Gemäß unserer Zeit gilt es, Wahrheiten<br />
entsprechend zu verschlüsseln, sollen sie einen Empfänger<br />
erreichen. Diese Gefallen tun uns A Whisper In The<br />
Noise nicht. Und genau das ist ihre Qualität.<br />
Die klaren Impulse<br />
»Dry Land« ist zunächst eine dichte, geschlossene Platte.<br />
Stetig ist da Thordsons sanftes Piano. Wechselnd umgibt<br />
sich dieses mit Violinen, Cello, Gitarren, Drums, Synthesizern.<br />
Es ist erstaunlich, wie wenig Aufmerksamkeit und<br />
Präsenz die einzelnen Klangelemente benötigen, wie sehr<br />
die Gleichzeitigkeit der Elemente dennoch eine Nachdrücklichkeit<br />
erzeugt. Sie werden nicht in ein Gefüge aufgenommen,<br />
sondern bilden dieses erst selbst. Ein dicht<br />
gewobener Teppich. Es passt gerade eine Melodie durch<br />
die Maschen. Thordsons Stimme und die choralen Varianten<br />
aus dem Background erheben sich dann leicht, nur<br />
ganz leicht, eben deutlich, über diese Basis. Das erinnert<br />
erstaunlich an die Beschaffenheit von »The Western Lands«,<br />
der diesjährigen Veröffentlichung von Gravenhurst.<br />
»Ich versuche immer eine Spannung zwischen harmonischen<br />
Klängen und dunklen, mystischen Klängen zu<br />
kreieren. Es schafft gewissermaßen eine Sehnsucht nach<br />
meiner Heimat.« Stets scheinen die Klänge auf Bilder zu referieren.<br />
Sei es das schroffe, wechselvolle Minnesota oder<br />
eine andere Landschaft der Extreme: Filmisch-bildhafte<br />
Assoziationen begleiten die Musik essenziell. Und das<br />
funktioniert nur durch den großen Bogen, den A Whipser<br />
In The Noise über die elf Songs der Platte spannen. »Dry<br />
Land« passt eben nicht in das mp3-Zeitalter des ständigen<br />
Zugriffs, der zufälligen Wiedergabe, der Ohrstöpsel in der<br />
U-Bahn. »Dry Land« ist ein Album, und das braucht Zeit.<br />
Das Werk muss sich entfalten können. In dieser Hinsicht<br />
kann es hilfreich sein, auf die ganz kleinen Impulse, auf<br />
das Flüstern im Rauschen zu achten. Es ist das kaum hörbare<br />
Rauschen, das wir allzu oft komprimiert haben: Wir<br />
hören es schlichtweg nicht mehr. Die Ästhetik dieser Platte<br />
möchte einen zwingen, noch einmal die großen Boxen<br />
sanft erklingen zu lassen.<br />
»True love will find you in the end«<br />
Für Thordson bleibt die entscheidende Operation die des<br />
Verbindens. Wirkliche Verbindung schaffen in einer Zeit<br />
der Gleichzeitigkeit von totaler Vernetzung und vollkommener<br />
Entfremdung des Individuums von seiner Umgebung.<br />
»Es ist einfach, die Verbindung zu verlieren in einer<br />
Zeit, in der der größte Teil der Interaktion mit Musik durch<br />
Computer passiert.« Es geht um Verbindung zur Musik,<br />
zwischen den einzelnen Stücken, zwischen Konsument<br />
und Künstler.<br />
So ist nicht nur die Studioarbeit, sondern auch die<br />
Live-Performance, die vielleicht rohste Form des Verbindens,<br />
für Thordson von großer Bedeutung. Er ist es, der alle<br />
Stücke komponiert, zumindest deren Idee, deren Kern.<br />
»Meistens beginnt es mit einer Art Gefühl von einem Lied.<br />
Und dann beginne ich der Idee einen Körper zu geben, der<br />
mir pur und wahr erscheint.« Neben der Gesamtheit, die<br />
»Dry Land« als Kunstwerk ausmacht, sind es eben diese<br />
direkten und kaum verschlüsselten Wahrheiten, die diese<br />
Platte genial unzeitgemäß und damit schon wieder treffend<br />
machen. »True love will find you in the end.« Dass<br />
man das vermeintlich Wahre so aussprechen kann, geht<br />
nicht mehr, Hey, geht gar nicht. Doch. Thordson spricht<br />
genau diese Wahrheiten, in Worten wie in Klängen, aus,<br />
und wir blicken mit eben noch hart-kaltem und gleich<br />
schon verheult-gequollenem Gesicht auf und bemerken:<br />
Darf ich? »Dry Land« antwortet nicht »Ja«, sondern: Ihr<br />
müsst! Und vielleicht haben wir nur auf jemanden gewartet,<br />
der das so sagt. Altes, wiedergeboren in einer neuen<br />
Zeit, wird wieder neu.<br />
»Dry Land« von A Whisper In the Noise ist bereits<br />
bei Exile On Mainstream Records erschienen<br />
Umgestülpte Popmusik<br />
Vom Knochenmark ins Außenrum und dann von oben wieder zurück.<br />
kapital band 1 zählen sich durch ihre eigenen Mikrokosmen, »Playing by Numbers«<br />
text: dan gorenstein<br />
Noch bevor ein Ton erklingt, muss gezählt werden, muss<br />
der gemeinsame Rhythmus aus der Polyrhythmik des<br />
Universums gehoben werden, damit man sich einig wird<br />
und Musik erklingt. Den Unterschied zwischen dem Stimmen<br />
eines Instrumentes und dem Augenblick, in dem das<br />
dann zu Musik wird, macht letztlich nur eine Zahlenfolge<br />
aus, der Rhythmus, sei es nun Beat oder Off-Beat. Wenn<br />
man so will, ist jeder Umgang mit Musik ein Ausmessen<br />
des von ihr erzeugten Zeitstrahls, ein Abzählen der Baumringe<br />
einer CD oder Platte, des Tapebandwurms, der eigenen<br />
Gehörgänge.<br />
Der rote Faden Zeit<br />
Das neue Album der Berlin-Wien-Connection Kapital Band<br />
1 ist, genau genommen, nichts weiter als eine Feier dieses<br />
Umstandes. Fast schon eine Beweisführung. An der Grenze<br />
zwischen der kalten Logik eines mathematischen Satzes<br />
und dem warmen Klang eines Musikinstrumentes blüht diese<br />
Platte, neben dem Grenzpfeiler. Bald neigt sie sich zur<br />
einen Seite, bald zur anderen. Ein Triptychon des Marsches<br />
durch die Sphären der gezählten Musik. Schon das Titelgebende<br />
Stück »Playing by Numbers« skizziert den Beat, zwischen<br />
On und Off, den roten Faden Zeit, auf dem wir die<br />
nächste halbe Stunde balancieren werden. Aber wir werden<br />
ihn nie in der Hand halten, wir wissen nur ungefähr, wo er<br />
liegen sollte. Die Musik umspielt den Beat, trifft ihn aber<br />
nicht, denn auf den Punkt kann er gar nicht getroffen werden.<br />
Wir suchen ihn im kleinstmöglichen Intervall. Musikalisch<br />
und auch vom Namen her ist Track eins die Pforte in<br />
das Hauptstück der Platte: »Playing the Night in Vienna«.<br />
Wo vorher noch ein Musikstück mit einem zumindest<br />
ideellen Beat durchmessen werden konnte, ist nun nur<br />
noch die Nacht. Kein Song, sondern Geräuschkulisse.<br />
Doch auch die wird mit denselben Instrumenten durchzählt,<br />
dem Musiksein unterworfen. Der Wind pfeift, Autos<br />
brummen, man hört ein Murmeln, die Position des<br />
Mikrofons wird zum Instrument, die Lautstärke wird zum<br />
Instrument, es sind noch immer die Instrumente aus dem<br />
ersten Stück zu hören, sie gliedern sich ein. Die Musik<br />
stülpt sich nach außen, das Instrument wird zum Geräusch<br />
und das Geräusch zum Instrument. Irgendwann hört man<br />
Musik, verzerrt von den Straßenschluchten, durch Wände<br />
gedämpft. Einen Augenblick lang ist da so eine Hoffnung,<br />
sind da andere, die noch nicht alles zählen, doch auch das<br />
verebbt im sphärischen Rauschen der Wiener Nacht.<br />
Manifest des Zwangsverstärkers<br />
Fast schon ironisch der Ausklang des Albums, das einzige<br />
Stück mit Gesang: Manifest eines Zwangsgestörten, verdammt,<br />
die Ewigkeit zu zählen, die Wellen, die Sterne, die<br />
Stufen, die Tage. Einer, der gegen die Götter anzählt, dem<br />
jede Ordnung zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint<br />
und der sie sich deshalb immer wieder erzählen muss. Aber<br />
auch das ist Kalkül, denn jede gute Abhandlung bringt ihre<br />
eigene Kritik schon im Appendix mit sich, und natürlich<br />
muss jede Ordnung auch erzählt werden, ansonsten ist sie<br />
nichts weiter als Wahn.<br />
»Playing By Numbers« von Kapital Band 1 ist<br />
bereits bei Mosz/Hausmusik erschienen<br />
26 1 töne<br />
töne 1 27
zwiegespräch<br />
immer diese<br />
begrifflichkeiten<br />
Gespräch mit frank bretschneider<br />
und sun electric<br />
text, interview: jens pacholsky fotos: tilman junge<br />
Minimal ist nicht gleich Minimal und das Gegenteil auch<br />
nicht – nun ja – Vangelis. Manchmal können gerade in der<br />
elektronischen Musik, die letztlich auf Sound an sich basiert,<br />
die vermeintlich leeren Räume voller Leben stecken.<br />
Sun Electric, die als Erfinder des Ambient House und somit<br />
als Vertreter der Fülle gelten, veröffentlichen mit »Lost<br />
+ Found (1998-2001)« wiederentdeckte Stücke, die ganz<br />
und gar nicht überbordend zwischen Jazz, Electronica<br />
und Ambient grooven. Frank Bretschneider hat dagegen<br />
als Minimalist ein komplexes Album geschaffen. Dabei liegen<br />
sie recht nah beieinander im Gespräch über Minimal,<br />
Gerüche, Zufälle und ihre Basis im Einzelklang.<br />
Eure aktuellen Alben repräsentieren nicht gerade den Ruf,<br />
der ihnen vorauseilt. Macht ihr Euch überhaupt Gedanken<br />
um diese Differenzierung der Stile?<br />
Frank bretschneider: Minimalismus war immer Bestandteil<br />
der elektronischen Musik. Und es wird immer<br />
die Pole geben, von der minimalen Musik aus Kalifornien<br />
aus den 19 0er Jahren und dem Bombastischen wie Vangelis<br />
zum Beispiel.<br />
max lodenbauer: (lacht) War das jetzt eine Anspielung?<br />
tom thiel: Nicht Minimal heißt ja nicht aufgebläht. Es<br />
kann auch heißen, dass Brüche drin sind, die das Ganze in<br />
eine andere Richtung bringen, neue Sounds reinkommen.<br />
Ich denke, es ist auch ein Unterschied, ob man allein Musik<br />
macht oder zu zweit.<br />
ml: (lacht) Zwei Leute ist schon mal weniger Minimal, als<br />
nur einer.<br />
tt: Ich glaube, es ist auch unterhaltsamer, zu<br />
zweit zu spielen. Wenn man allein spielt, hat<br />
man eben alles unter Kontrolle.<br />
Fb: Das ist wahrscheinlich auch so etwas.<br />
Ich bin wirklich ein Control Freak. Was ich<br />
mache, soll so sein, wie ich es mir vorstelle.<br />
Da ist relativ wenig Raum für Improvisation<br />
oder Zufälle.<br />
ml: Aber Du hast doch sicher auch kleine Sachen,<br />
die sich leicht verändern und wo durch<br />
andere Kombinationen Anderes entsteht.<br />
Fb: Ja, aber ich bin da in dem Sinne schon eher Komponist.<br />
Das sind dann Sachen, wo ich ganz sorgfältig bestimmte<br />
Breaks plane, baue und konstruiere. Natürlich kommen<br />
Einzelteile auch durch Zufall.<br />
ml: Zufall im Sinne von Terry Rileys »In C«? Da sind Änderungen<br />
ja auch vorgegeben, aber trotzdem eben nicht<br />
genau, wann.<br />
Fb: Ich habe schon eine ganz genaue Vorstellung, wie<br />
sich der Track entwickelt. Wenn der sich entwickelt, dann<br />
entwickelt sich auch diese Vorstellung und kommt auf einen<br />
bestimmten Punkt. Und den möchte ich ganz gezielt<br />
erreichen. Wenn jetzt was reinkommen würde, das gut<br />
passen, aber den Charakter des Tracks verändern würde,<br />
würde ich das gnadenlos rausschmeißen, weil…<br />
ml: …es gehört nicht zum Stück.<br />
Frank, kannst Du Dich eigentlich mit dem Begriff Minimal<br />
identifizieren?<br />
Fb: Aber ohne jetzt auf diesem alten Minimal-Begriff zu<br />
sitzen.<br />
ml: Wegen des Vergleichs mit Terry Riley?<br />
Fb: Ja, das verbinde ich eben mit Minimal. Aus welchem<br />
Grunde Richie Hawtin unter Minimal läuft, weiß ich nicht.<br />
Das hat sich so eingebürgert.<br />
ml: Das ist die neue Form des Minimal, die hat nichts mit<br />
den alten Jungs zu tun.<br />
Fb: Das ist so wie bei R&B.<br />
ml: Minimal waren ursprünglich Leute wie Philip Glass,<br />
Terry Riley, Steve Reich. Diese repetitiven…<br />
Fb: …Komponisten und Computer-Komponisten. Sehr<br />
frühe elektronische Musik aus den 19 0er Jahren, die oftmals<br />
nur auf einem Pattern beruhte.<br />
ml: Repetitiv und auf den ersten Blick immer das Gleiche…<br />
Fb: …mit minimalen Veränderungen…<br />
ml: …wo man, wenn man genau hinhört, merkt, dass sich<br />
da etwas tut.<br />
Das passiert bei Richie Hawtin allerdings auch…<br />
tt: Das ist ja eigentlich auch die Grundidee von Techno,<br />
dass die eigentliche Geschichte auf die Basis draufmoduliert<br />
ist.<br />
Fb: Aber der Begriff kommt aus einem anderem Kontext.<br />
Damals kam das aus der akademischen Musik. Und heute<br />
ist es eine Funktionsmusik, die für einen ganz bestimmten<br />
Zweck hergestellt ist – für den Dancefloor.<br />
ml: Mit dem Ambient war es auch so. Im Ursprung war<br />
Ambient, diese Erfindung von Brian Eno, reine Funktionshintergrundmusik.<br />
Oder wie Erik Satie meinte: »Die<br />
Musik soll sein wie ein Duft im Raum«.<br />
Das ist dann viel ausschweifender geworden, wie bei The<br />
Orb und Future Sound Of London.<br />
ml: Ja ja, das ist Bombast.<br />
Das sind keine kleinen Gerüche mehr…<br />
ml: (lacht) Da stinkt es dann schon.<br />
Die Begriffe ändern sich natürlich. Aber es ist auch eine<br />
Frage des Ansatzes, z.B. aus wenig viel zu machen. Frank<br />
Bretschneiders Album ist sehr minimal, nur Rhythmus und<br />
perkussive Elemente, das aber unheimlich dicht klingt.<br />
Fb: Das ist jetzt Deine Wahrnehmung. Das kann ich erstmal<br />
gar nicht so nachvollziehen. Für mich ist es immer<br />
noch relativ mager. Es gibt maximal vier bis fünf Spuren.<br />
tt: Was mir an Deinen Sachen sehr gefällt, ist diese gewisse<br />
funkiness.<br />
Ich denke, dieser Funk-Aspekt macht das Album auch so voll.<br />
Fb: (lacht) Dann habe ich scheinbar wirklich was erreicht,<br />
was ich schon lange erreichen wollte.<br />
Das liegt vielleicht auch am Ansatz elektronischer Musik,<br />
die viel stärker als andere Stile vorrangig auf dem Sound<br />
an sich basiert.<br />
Fb: Ich arbeite auch immer gleichzeitig am Stück und am<br />
Sound – sowohl des ganzen Stücks als auch der einzelnen<br />
Bestandteile.<br />
ml: Du kannst im Prinzip prima ein ganzes Stück machen,<br />
das einfach nur ein Ton ist, der sich verändert.<br />
»Aus welchem Grunde Richie Hawtin<br />
unter Minimal läuft, weiß ich nicht.<br />
Das hat sich so eingebürgert.«<br />
frank bretschneider<br />
Fb: Das gibt es aber bei anderen Musikarten auch. Denk<br />
nur mal an Mönchsgesänge.<br />
ml: Ja, aber man kann schon mit der Modulation viel machen,<br />
z.B. wenn man den einen Ton rhythmisch moduliert<br />
und dann nichts von all den Melodien spielt, dann ist das<br />
tonal keine Komposition im herkömmlichen Sinn. Weil<br />
das Stück nicht aus irgendwelchen Harmonien entsteht.<br />
Obwohl die dann wieder in so einem Sound immanent<br />
sind.<br />
tt: Da gibt es aber auch eine Entwicklung. In der Mitte<br />
der 1990er war es immer das Ziel, möglichst ausgefallene<br />
Klänge zu finden. Das hatte sich irgendwann ausgereizt.<br />
Du kannst heute damit niemanden mehr hinter dem<br />
Ofen hervorlocken. Daniel Möller hat dazu mal etwas<br />
sehr Gutes gesagt. Dass in den 1980er Jahren diese ganzen<br />
elektronischen Geräte missbraucht wurden. Und heute<br />
kauft man diese Sachen, und die ganzen Sounds, die darin<br />
abgespeichert sind, sind bereits pre-abused. Heute kommt<br />
es nicht mehr auf diesen besonderen Einzelsound an, der<br />
alles schlägt, sondern auf das Gefüge.<br />
Die elektronische Musik versucht auch seit einigen Jahren,<br />
aus dem Repetitiven heraus zu kommen, gerade mit<br />
Electronica. Max, Du gehst mit Deinem anderen Projekt<br />
Chica & The Folder ja eher in Richtung Songs.<br />
ml: Die Wellen gehen immer rauf und runter, genau wie<br />
analog und digital.<br />
Fb: Die andere Antwort wäre so etwas wie Jan Jelinek, der<br />
mit »Tierbeobachtungen« ein ganz stark loopbasiertes Album<br />
gemacht hat. Es gibt immer Leute, für die bestimmte<br />
Dinge gerade zu Ende sind, und andere Leute greifen genau<br />
das wieder auf.<br />
ml: Und dann hörst Du den einen und denkst, »jetzt kann<br />
ich den Loop aber nicht mehr hören…«<br />
Fb: Genau.<br />
ml: …dann kommt der andere doch mit einem Loopteil<br />
und Du denkst: »Boah, ist aber doch schon geil.«<br />
tt: An Jan Jelinek musste ich jetzt auch gerade denken.<br />
Der würde jetzt nämlich sagen: »Für was anderes als geloopte<br />
Musik taugt die ganze Elektronik eh nicht.«<br />
»Lost + Found<br />
(1998-2000)« von Sun<br />
Electric ist bereits<br />
bei Shitkatapult/MDM<br />
erschienen<br />
»Rhythm« von Frank<br />
Bretschneider ist<br />
bereits bei Raster-<br />
Noton erschienen<br />
»Under The Balcony«<br />
von Chica & The<br />
Folder ist bereits<br />
bei Monika/Indigo<br />
erschienen<br />
28 1 töne<br />
töne 1 29
They are<br />
rebuilding the<br />
city<br />
Musik aus Bristol<br />
text: falko teichmann<br />
fotos: liz eve | liz@fotohaus.co.uk<br />
I<br />
Vor fast drei Jahrzehnten schuf eine Gruppe junger Musiker<br />
um den Sänger und Politdichter Mark Stewart unter<br />
dem Namen The Pop Group (gemeinsam mit dem Dubproduzenten<br />
Dennis Bovell) mit dem Album »Y« in Bristol<br />
den Urtext für vieles, was über die Jahre aus der Stadt<br />
an der Westküste Englands kommen sollte. Gleichzeitig<br />
legten sie ein Arsenal aus Bezügen, Einflüssen und Haltungen<br />
vor, das bis heute in sich stets wandelnder Form<br />
der Anwendung die Quellen eint, aus denen sich Musik<br />
in Bristol speist: Produktionsweise und Soundsystemkultur<br />
von Dub und Reggae, Weltmusik, Krautrock, psychedelische<br />
Experimente und nüchterne Anverwandlung,<br />
Popkultur als Möglichkeit jenseits ihrer selbst, ästhetische<br />
Unabhängigkeit und Hype-Resistenz. Und dabei ergibt<br />
sich trotz aller Präsenz dieser Verweise und Haltungen<br />
kein homogenes Klangbild, kein Sound of Bristol, der sich<br />
eindeutig verorten ließe. Mit Ausnahme jener Laune des<br />
Zeitgeists, die unter dem Namen Trip Hop für eine Zeit<br />
eng mit dem Namen der Stadt verbunden war und langfristig<br />
den offiziellen Blickwinkel der Berichterstattung<br />
über in Bristol entstandene und entstehende Musik bestimmt<br />
hat.<br />
Gleich zu Beginn jenes Zeitlupenhypes zur Mitte der<br />
letzten Dekade wurde damit der Blick abgelenkt von einer<br />
anderen, sich bis in unsere Tage fortschreibenden Geschichte<br />
musikalischen Schöpfergeistes in und um Bristol,<br />
in der sich singuläre künstlerische Visionen, Do-It-Your-<br />
self-Ethos, fein gewobene Verknüpfungen von Individuen<br />
und Kollektiven und einige der brillantesten Veröffentlichungen<br />
und Werkkörper der zurückliegenden Jahre zu<br />
einer vielfach in sich verschlungenen Chronologie bündeln,<br />
deren nun folgende Untersuchung den Bereich gesicherter<br />
Fakten und historischer Genauigkeit gelegentlich<br />
hinter sich lassen muss, um zwischen Fansein und Feldforschung<br />
einen eigenen Weg durch die Echokammer der<br />
Erinnerung zu finden.<br />
II<br />
Für »Loveless«-Junkies auf Entzug oder Hörer, denen<br />
Slowdive zu wenig »psycho candy« waren, ersetzten Flying<br />
Saucer Attack um 1993 herum »shoegazing« durch<br />
»bliss«, und so weit sie dabei ausholten, so sehr blieben<br />
Dave Pierce und seine Mitstreiter doch bei sich, in ihrem<br />
Haus aus Melancholie und Feedback. Unzählige Singles<br />
und ein halbes Dutzend Alben zeichnen den Weg nach,<br />
auf dem sich verzerrter Garagenpop, das ambiente Ende<br />
von Krautrock, pastorale Folkmelodien und furchtloses<br />
Driften einen Weg zwischen Retro und Experiment<br />
bahnten. Ein regelmäßiger Gast bei den psychedelischen<br />
Seancen der ersten Jahre war ein junger Mann namens<br />
Matt Elliott, der kurze Zeit später zu seinem eigenen Weltraumflug<br />
durch weißen Krach, Bewusstseinserweiterung<br />
und sakralen Drum’n’Bass aufbrechen sollte, um darüber<br />
zu einer Schlüsselfigur für die Bristolszene der 1990er Jahre<br />
zu werden.<br />
Aus Matt Elliotts unerreichter Synthese von ma-<br />
nischen Breakbeats, Indie, White Noise, orthodoxen<br />
Chören und seelenvollem Industrial, die er unter dem Namen<br />
The Third Eye Foundation entwickelte, entstanden<br />
klassische Werke wie »Ghost«, »You Guys Kill Me« und »In<br />
Version«, wobei letzteres wie ein Familienalbum die Protagonisten<br />
der Mittneunziger-Bristol-Szene mit Elliots an<br />
Dubtechniken geschulten Neubearbeitungen von Bands<br />
wie Crescent, Amp und Hood (die zwar in Leeds lebten<br />
und aufnahmen, aber personell und soundästhetisch dem<br />
musikalischen Geschehen in Bristol immer nahestehen<br />
sollten) versammelt, um am Ende der LP in einer letzten<br />
atemberaubenden Zusammenarbeit mit Flying Saucer<br />
Attack zu gipfeln, bei der die Erinnerung an den gemeinsamen<br />
Aufbruch in nostalgische Elektroakustik zerfällt<br />
und mit der Titelreferenz an David Bowman, Hauptfigur<br />
in Kubricks »2001«, das ursprüngliche Selbstverständnis<br />
als Klangkosmonauten im inneren Raum zu einer finalen<br />
Überhöhung führt.<br />
Sowohl Flying Saucer Attack als auch The Third Eye<br />
Foundation sollten sich in Folge auf dem noch jungen Plattenlabel<br />
Domino wieder finden, und mit den dort ebenfalls<br />
veröffentlichenden Movietone in der zweiten Hälfte<br />
der 1990er Jahre die kleine Bristolfraktion im Programm<br />
dieser Stil prägenden Londoner Plattenfirma bilden.<br />
Mit besagten Movietone, der Band von Kate Wright<br />
und Rachel Brook, und dem Projekt Foehn von Debbie<br />
Reynolds formulierten weibliche Stimmen dann die musikalischen<br />
Bruchstellen weiter aus: Im Fall von Foehn in<br />
Form fiebriger Fragmente aus Klangclustern, Minimalkrach<br />
und Sehnsuchtsmelodien, während Movietone ihr<br />
elliptisches Songwriting immer weiter aus dem Kontext<br />
urbaner Geräusche in monochrome ländliche Szenarien<br />
überführten – eine Entwicklung, die sich auch im Werk<br />
von Crescent, einer der langlebigsten, und wandelbarsten<br />
Bands Bristols, wiederfindet.<br />
Wie sich die Band um den Sänger und Komponisten<br />
Matt Jones dabei über einen Zeitraum von fünfzehn<br />
Jahren immer näher auf den emotionalen Kern ihrer Vision<br />
zubewegt hat, bis hin zum jüngst erschienen Album<br />
»Little Waves«, erschließt sich wahrscheinlich am ehesten<br />
indem man die Bandgeschichte über den Tonkopf der<br />
Geschichte rollen lässt und bei den verzerrten Epen des<br />
Frühwerks beginnt, auf denen Matt und sein Bruder Sam<br />
Jones mit Unterstützung von u.a. Matt Elliott Factory-Gitarren<br />
und Jazz aus einem Kellerloch zusammen denken<br />
und sich im weiteren Verlauf über Dubabstraktionen, Noisereduzierung<br />
und verschleppten Cineastenblues immer<br />
klarer die Konturen eines großen Songwriting-Talents<br />
herausstellten, das nach Jahren des Umherwanderns Ende<br />
des letzten Jahrzehnts eine späte Heimat bei Fat Cat<br />
Records fand. In den Jahren bis dahin sorgten zwei kleine,<br />
für die Musikszene Bristols in den 1990er Jahren jedoch<br />
maßgebliche, Labels für die Veröffentlichung zentraler<br />
Werke Crescents.<br />
Das Debüt mit dem lakonischen Titel »Now« erschien<br />
1994 beim Label Planet Records, das für viele der bereits erwähnten<br />
Künstler als wichtige Plattform fungierte. Mit ihrem<br />
dritten Album »Collected Songs« platzierten sie sich<br />
am Ende des Jahrzehnts in einem erweiterten Kontext von<br />
Musikern aus Bristol und veröffentlichten auf dem<br />
30 1 töne<br />
töne 1 31
von der lokalen Musiklegende Fat Paul betriebenen<br />
Label Swarffinger, auf dem neben The Experimental<br />
Popband, Spleen (dem Soloprojekt von PJ Harveys erstem<br />
Schlagzeuger Rob Ellis) und Morning Star einige der<br />
unfassbarsten Veröffentlichungen der späten Neunziger<br />
von Bands wie Teenagers in Trouble, Voices of Kwahn und<br />
Pregnant herauskamen. Die mit Swarffinger einsetzende<br />
endgültige Atomisierung jeglicher ästhetischer Parameter<br />
sowie die Auflösung von Trennlinien zwischen musikalischen<br />
Gruppierungen markiert den endgültigen Beginn<br />
dessen, was sich heute als Bristols Multiversum der Mikroszenen<br />
darstellt.<br />
III<br />
Nach der Jahrhundertwende wurde es für eine Weile still<br />
um die Musik aus Bristol. Es wollte sich nach der Implosion<br />
der 1990er-Jahre-Szene, dem Verschwinden von Planet<br />
Records und Swarffinger sowie einem eher spärlichen Fluss<br />
an Veröffentlichungen, aus denen Alben von Crescent,<br />
Movietone und Manyfingers hervorstachen, nicht mehr<br />
jene Begeisterung einstellen, die über Jahre von Interessierten<br />
mit dem Wort Bristol verbunden wurde. Selbst die<br />
frühen Platten des jungen Nick Talbot, der als Gravenhurst<br />
nach seinem sich zum Teil der Liebe zur Musik der Stadt<br />
verdankenden Umzug nach Bristol seine ersten Songs auf<br />
Warp veröffentlichte, stimmten eher nostalgisch, mit ihren<br />
verfeinerten Variationen von in den zehn Jahren zuvor<br />
Eine sorgfältige Auswahl<br />
von 10 Alben aus Bristol<br />
»Y« von The Pop<br />
Group 1979<br />
Politik, Punk<br />
und Funk treffen<br />
Satie, Lee Perry und<br />
Amnesty International<br />
unten auf dem<br />
Schulhof. Agit Prop,<br />
Tribalismus und die<br />
zornigen Kinder<br />
des Kalten Krieges.<br />
Ein ideologischer<br />
Veitstanz. Visonärer<br />
Wahnsinn.<br />
»Aftermath EP«<br />
von Tricky 1994<br />
Die dunkle Seite des<br />
Sound Systems, er<br />
selbst nannte es Hip<br />
Hop Blues, Mark<br />
Stewart hat koproduziert,<br />
Japans<br />
»Ghosts« und die<br />
Tonspur von Blade<br />
Runner driften<br />
durch den Mix,<br />
während Tricky und<br />
Martina vom Ende<br />
der Welt singen.<br />
Looking for People.<br />
»Flying Saucer<br />
Attack« von Flying<br />
Saucer Attack 1994<br />
Breitwand-LoFi aus<br />
dem Wohnzimmerstudio.<br />
David Pearce<br />
bricht zu seiner ekstatischen<br />
Pilgerfahrt<br />
auf, tiefer hinein<br />
in den magischen<br />
Sound aus Psychpop,<br />
Ambientkraut<br />
und Traumwaffen.<br />
etablierten Versatzstücken jenes verschwindenden Klangs,<br />
den eine kleine Szene von Bands aus Bristol über einige<br />
Zeit in die Welt getragen hatte.<br />
Dass sich natürlich trotzdem im Abseits medialer<br />
Beachtung und jenseits offiziell zirkulierender Veröffentlichungen<br />
immer noch einiges im Westen Englands tat, ließ<br />
sich dann 2004 durch die von Matt Jones zusammengestellte<br />
und als CD-R herausgegebene Compilation »Little<br />
Waves« (nicht zu verwechseln mit dem bereits erwähnten<br />
letzten Album von Crescent) erahnen. Neben einigen<br />
vertrauten Namen fanden sich auf dieser Zusammenstellung<br />
viele unbekannte Künstler, die selbst, wie sich später<br />
herausstellen sollte, nur einen kleinen Ausschnitt eines<br />
viel größeren, sich selbst knüpfenden Netzes aus neuen<br />
Namen, Sounds und DIY-Veröffentlichungen darstellten.<br />
Wo die Bristol-Bands der 1990er Jahre zum Teil bei mittelgroßen<br />
Indielabels aufgehoben waren oder zumindest bei<br />
den überregional beachteten lokalen Plattenfirmen unterkamen,<br />
bewegten sich die meisten der neuen Bands und<br />
Künstler dieser sich anbahnenden »Bristol Renaissance«<br />
nicht mal mehr in der Nähe etablierter Veröffentlichungswege.<br />
Die neuen Technologien zur Vernetzung, Vervielfältigung<br />
und Verbreitung von Musik sehr wohl zu nutzen<br />
wissend, verzichtete man von nun an fast gänzlich auf die<br />
fadenscheinigen Verheißungen einer heißlaufenden Verwertungsmaschine,<br />
und setzte dem Profitminimalismus<br />
der Indie-Industrie ein Update erprobter DIY-Strategien<br />
entgegen.<br />
Aus den kleinen Wellen wurden Stromschnellen,<br />
kreative Wirbel, Unterströmungen und schließlich ein<br />
steter Fluss von Songs, Ideen, Konzepten und Konzerten,<br />
für den der Stadtteil Stokescroft zum Delta werden sollte,<br />
in dem sich in den letzten Jahren ein vielfältig schim-<br />
»Ghost« von<br />
The Third Eye<br />
Foundation 1997<br />
Die Platte, die ihr<br />
Autor am liebsten<br />
nicht gemacht hätte.<br />
Eine Reise durch ein<br />
brennendes Gehirn.<br />
Darkstep Drum and<br />
Bass, Kevin Shields<br />
Choräle, Samplerschamanismus.<br />
Musik für den Rave<br />
unter dem schwarzen<br />
Monolithen.<br />
»vs. Fat Paul«<br />
von Teenagers in<br />
Trouble 1997<br />
Postmodernes<br />
Rabaukentum, ein<br />
Bandname wie ein<br />
T-Shirt-Slogan, der<br />
Pate an den Reglern,<br />
und die Kids feiern<br />
auf dem Müllhaufen<br />
der Geschichte:<br />
Slacker Core,<br />
Allman Brothers,<br />
Dusty Springfield,<br />
Break Beats, Free<br />
Jazz, Grand Funk<br />
Railroad, The Godz.<br />
Weit draussen.<br />
merndes Biotop außergewöhnlicher Musik entwickelt hat.<br />
Das schlagende Herz jener urbanen Enklave ist das Cube<br />
Microplex Cinema, ein in Konzept, Ökonomie und Architektur<br />
außergewöhnlicher Ort. Eine sich stetig personell<br />
erneuernde Gruppe von (unendgeldlich arbeitenden)<br />
Enthusiasten erfüllt seit neun Jahren das kleine Auditorium<br />
mit dem Erlebnis Underground, das weit über den<br />
begrenzten Ereignishorizont von Medien und Marketing<br />
hinaus die Legende über ein mit der Kunst versöhntes Leben<br />
weiterspinnt. Und wie sich von diesem Vortex aus die<br />
Musik Bristols in den letzten Jahren zu einem Kaleidoskop<br />
von Stilen entwickelt hat, in dem jede Band, jeder Künstler<br />
für ein ureigenes Genre zu stehen scheint, lässt die Ver-<br />
»Operation Dismantled<br />
Sun« von<br />
Voices Of Kwahn<br />
1998<br />
Zart verglühende<br />
post-industrielle<br />
Landschaften.<br />
Feldaufnahmen,<br />
wie aus einem<br />
Katastrophengebiet,<br />
in dem ein Alien<br />
Liebeslieder singt.<br />
Elektrische Traumtraktate<br />
und letzte<br />
Rituale. Eine der<br />
seltsamsten Platten<br />
der 90er Jahre.<br />
»Collected Songs«<br />
von Crescent 1999<br />
Ihr Opus Magnum.<br />
Bristol Beatnik Noir.<br />
Weisse Räume.<br />
Sonnenaufgänge in<br />
Schwarzweiss. Tape<br />
Echos, Ölfässer,<br />
Mikrophone, Schellackplatten.<br />
Songs<br />
wie Asche und Rost,<br />
Poesie wie träger<br />
Schnee. Als würde<br />
Ian Curtis den Blues<br />
singen mit den<br />
Geistern des Dub.<br />
»The Blossom<br />
Filled Streets« von<br />
Movietone 2000<br />
Der Frühling nach<br />
dem Winter von<br />
»Collected Songs«,<br />
somnambuler<br />
Swing, Amateur<br />
Bossa Nova, das<br />
träge Fliessen von<br />
Nachmittagen,<br />
überbelichtete Urlaubsfotos,<br />
Jazz Age<br />
Lyrik, handkolorierteSonnenuntergänge,<br />
Fußabdrücke<br />
im Sand. Ein Juwel.<br />
mutung zu, dass in unserer Zeit, nach dem endgültigen<br />
Ende des Konsens zwischen Kritikern und Konsumenten,<br />
die universale Sprache des Pop sich oft am deutlichsten in<br />
ihren lokalen Dialekten artikuliert.<br />
Um diesem babylonischen Dorf unabhängigen Sprechens<br />
gerecht zu werden, setzt sich dieser Artikel im Digitalen<br />
fort und ergänzt in Form eines Bristol Index aus<br />
Namen, Veröffentlichungen, Beziehungen und Veranstaltungen<br />
(angereichert durch Verlinkungen und knapp<br />
gehaltene Kommentare), nebst einer Liste persönlicher<br />
Lieblingsplatten, die Darstellung einer der faszinierendsten<br />
und virilsten Musikszenen unserer Zeit.<br />
»Manyfingers« von<br />
Manyfingers 200<br />
Die erste Soloarbeit<br />
von Chris Cole,<br />
kongenialer Drummer<br />
bei Crescent,<br />
Movietone und Matt<br />
Elliott, auf der sich<br />
multiinstrumentales<br />
Flechtwerk, virtuoses<br />
Looping, akkustischer<br />
Ambient und<br />
sonore Schwermut<br />
zu einem postelektronischenMeisterwerk<br />
versammeln.<br />
»Wrong Faced Cat<br />
Feed Collapse« von<br />
SJ Esau 2007<br />
Sam Wisternoff ist<br />
Bristols Mann bei<br />
Anticon. Exzentrisches<br />
Songwriting,<br />
sympathischer<br />
Irrsinn, gesamplete<br />
Hauskatzen, Hip-<br />
Hop-Hybride und<br />
experimenteller<br />
Indie. Der Beginn<br />
einer großen Underground<br />
Karriere.<br />
32 1 töne<br />
töne 1 33
epiphany outlet text: renko heuer<br />
Eine spannende Ansicht von Rasmus Stolberg, seines<br />
Zeichens Träger einer beeindruckenden Gesichtsbürste,<br />
soll als Basis und Ausgangsthese der neuesten Epiphanienstudie<br />
dienen. Der Efterklang-Mastermind Stolberg<br />
argwöhnt, dass »das Album [...] eine tote Kunstform [ist].<br />
Üblicherweise hat man doch so oder so nur drei Singles und<br />
dann noch ca. sieben Songs, die im Idealfall nicht vollkommen<br />
grottenschlecht sind. Doch sind die letztendlich auch<br />
egal, denn die Hörer wollen nur die drei Superhits hören.<br />
Insofern ist das Album leider Gottes schon längst tot, denn<br />
warum sollte eine große Firma demnächst noch Geld für die<br />
anderen sieben Songs ausgeben, wo es doch allen Beteiligten<br />
eigentlich nur um die drei Verbleibenden geht?!« Nicht<br />
schlecht, die Idee und besonders gewichtig, wenn man<br />
bedenkt, dass der Mann derartige Dinge studiert (oder<br />
zumindest so tut). Aber bewegen wir uns doch gemeinsam<br />
in den delikaten Bereich der subjektiven Empirie (sic! und<br />
somit zu slaraffenland, einem gleichfalls delikaten<br />
Signing auf Stolbergs stets stilsicherem Label Rumraket.<br />
Diese Herren aus dem »Milch- und Honigland«, ebenfalls<br />
aus Kopenhagen, bewerkstelligen es mit »Private Cinema«<br />
lockerleicht, ein vielschichtiges und doch in sich geschlossenes<br />
Werk vorzulegen, das eben jener These einen<br />
argen Hieb in den theoretischen Unterleib verpasst: Ob<br />
es nun vereinzelte Noise-Anwandlungen, Indie-Exkurse<br />
oder -zesse, Postrock-Stunts oder simple Klangpolaroids<br />
sind – von Wegwerf-Singlebörse kann hier keine Rede sein.<br />
Ebenfalls in der Nachbarschaft von Mr. Stolberg befinden<br />
sich grizzly bear, die mit ihrer »Friend EP« (Warp<br />
Records) endlich Tonträger-Nachschub abliefern. Und<br />
siehe da: Zwar erscheint die Mischung aus Cover-Songs<br />
und Daniel-Rossen-Solo-Bonustracks zunächst etwas beliebig,<br />
aber es ist und bleibt der mächtigste Brooklyn-Bär<br />
auf weiter Flur. 2:0 für die Contra-Seite. Weiter geht’s<br />
mit unserem Lieblingsschweden josé gonzález. Der<br />
Nachfolger (»In Our Nature«, Peacefrog) des einstigen Biochemie-Studenten<br />
hat zwar mit »Teardrop« (von Massive<br />
Attack), dem Cover-Nachfolger zu seiner »Heartbeats«-<br />
Sony-Bildschirm-Gummiball-Erfolgsstory, eine ausdrückliche<br />
Single im Kaffeesatz, mit der er Mann und Frau<br />
gewiss in jedem Starbucks zu begeistern weiß, doch hält er<br />
auch auf Albumlänge die Qualität des Erstlings. Auch sein<br />
Singer/Songwriter-Bruder fink, mit »Distance & Time«<br />
(Ninja Tune) ebenfalls in der zweiten Akustik-Runde, dazu<br />
mit seinem für manche Ohren schon zu weich gespülten<br />
Mastercard-Hit ähnlich singleverliebt (auf den ersten TV-<br />
Blick), hält das Level, wenn er seine minimalistischen Folk-<br />
Anekdoten weiterspinnt und zwischendurch dezent mit<br />
den Zähnen knirscht. Zähneknirschen hat auch »Breaking<br />
Kayfabe« (Big Dada) von cadence Weapon zunächst<br />
ausgelöst: Doch nun, mit dem nötigen Abstand, ist auch<br />
Rollie Pemberton, so die Tonfall-Waffe aus Edmonton<br />
bürgerlich, als Komplett-Gewinner zu bezeichnen: Nicht<br />
nur kombiniert er Aesop Rocks Kantigkeit mit Illogics<br />
gefühlvollem Tiefgang, obendrein reanimiert er den<br />
spacig-digitalen Bounce von APC und liefert ein nahtlos<br />
berauschendes Future-Rap-Masterpiece. Im Zukunftsrap<br />
bewandert ist bekanntlich auch Scott Herren, zumindest<br />
immer dann, wenn er sich prefuse 73 schimpft (»Preparations«,<br />
Warp Records). Während er alles in allem<br />
erfreulicherweise an »One Word Extinguisher« und nicht<br />
die späteren Dinge anknüpft, ist er doch der erste, der<br />
Stolbergs These unterstreicht: »Let It Ring« und »Spaced<br />
+ Dissonant« sind stellenweise einfach zu dick und deftig,<br />
um sie nicht den anderen Tracks vorzuziehen. Doch soll es<br />
bei diesem einen Punkt auch bleiben: Denn the bumblebeez<br />
(»Prince Umberto and the Sister of Ill«, Modular)<br />
rocken so krass zwischen ultraklassischen Referenzen<br />
– Beasties, Beck, Biz Markie, Jon Spencer, Timbo, Neptunes,<br />
Daft Punk etc. – und sinnbefreitem Ozzie-Wahnsinn, dass<br />
auch hier auf Albumlänge kein Auge trocken bleibt. Kommen<br />
wir zum Fazit: Herr Stolberg, so akkurat ihre These<br />
den Mainstream-Markt der Katastrophen-Britneys und<br />
Pelz-R-Kellys auch beschreiben mag, im Bereich der Epiphanien<br />
wird immer noch mittelfristig, sprich: auf Albumlänge,<br />
operiert. Der Bart muss also ab.<br />
Walking On Air<br />
Mit seinem neuen Studiowerk könnte<br />
louis philippe ungeduldigen Final-<br />
Fantasy-Fans Linderung verschaffen<br />
text: markus von schwerin<br />
Die Absicht, Owen Palletts beliebtes Ein-Mann-Orchester<br />
als eyecatcher zu nützen ist offensichtlich – aber auch legitim.<br />
Weisen doch die Alben, die der kanadische Violinist<br />
unter jenem Namen veröffentlichte, eine frappierende<br />
Ähnlichkeit mit der Arbeit des normannischen Wahl-Londoners<br />
auf: Die ausgefeilten Streicherpartituren, der leidenschaftliche<br />
Einsatz ihrer Falsettstimmen und nicht zuletzt<br />
die Vorliebe für romantische Lyrismen (man vergleiche nur<br />
Dreams of Leaving<br />
Von gebrochenen Herzen, furchtlosem<br />
Empfinden und der Fragilität des Realen:<br />
»god save the clientele«<br />
text: jochen werner foto: andy willsher<br />
»Broken hearts are for assholes«, so sang 1977 Frank Zappa<br />
und formulierte so, Ironie hin oder her, einen der dümmsten<br />
Sätze aller Zeiten. Die vier Briten von The Clientele,<br />
die bereits 200 mit »Strange Geometry« Melancholie in<br />
vollendete Popmusik gegossen haben, wissen es natürlich<br />
besser. Oft geht es in ihren Songs um das Gehen, durch<br />
Parks oder durch die nächtliche Stadt, in der violet hour<br />
am Rande der Nacht. Das ist kein Zufall, denn die Band<br />
um Sänger Alasdair MacLean ist sich dessen sehr bewusst,<br />
dass es eben um eines geht: jeden Weg ganz zu gehen, auch<br />
wenn sein Verlauf nur allzu oft festzustehen scheint. Die<br />
ätherische Schönheit der Musik von The Clientele ereignet<br />
sich stets im ganz Konkreten, das aber seltsam entrückt<br />
und so fragil erscheint, dass es bei der geringsten Berührung<br />
zu zerstäuben droht. Zunächst findet sich MacLean<br />
in einer Welt wieder, die der unseren ähnlich scheint und<br />
die doch unendlich fremd wirkt. Stimmen von Freunden<br />
34 1 töne<br />
töne 1 3<br />
review<br />
Palletts »The Sea« mit »Miss Lake« von Philippes aktuellem<br />
Album) eint diese Ausnahmemusiker. Doch gut möglich,<br />
dass Pallett seinen vermeintlichen Paten nie gehört<br />
hat. Denn nur wenige der seit 1987 erschienenen Louis-<br />
Philippe-LPs gelangten nach Nordamerika, und in Europa<br />
wurden sie gleich mehrmals Opfer von Insolvenzen. Bei<br />
den seit 2004 via Fan-Subskription ermöglichten CDs ist<br />
die Verfügbarkeit aber vorerst gesichert. Und die Begeisterung<br />
für Philippes art-by-demand-Einstand »The Wonder<br />
Of It All« ist kaum verklungen, da legt er mit »An Unknown<br />
Spring« bereits das nächste Beispiel seiner Kompositions-<br />
und Arrangierkunst vor. Stets auf dem Klavier basierend,<br />
werden die kunstliedartigen Stücke um Klangfarben ergänzt,<br />
die nicht nur den »Pet Sounds« (mit dem Plektrum<br />
gespielte Bässe, Schellenkranz, Kesselpauken etc.) entnommen<br />
sind, sondern auch Bouzouki- und Melodica-Soli<br />
mit einschließen. Faszinierend, wie in den Strophen von<br />
»House Of Sleep« das Covent Garden String Quartet Louis<br />
Philippes sanften Erzählton subtil untermalt, um dann im<br />
Refrain einen dramatischen Tempowechsel zu vollziehen,<br />
den der Sänger virtuos meistert. Überhaupt der Gesang:<br />
Was hier Louis Philippe erneut als Chor-Arrangeur geleistet<br />
hat, lässt nicht nur an Colin Blunstones legendäre<br />
Zusammenarbeit mit den King’s Singers denken, sondern<br />
zeigt auch, dass der in diesem Punkt oft gepriesene Sufjan<br />
Stevens durchaus noch dazulernen kann.<br />
»An Unknown Spring« von Louis Philippe ist<br />
bereits bei Dandyland/Cargo erschienen<br />
dringen in seinen Kopf und doch kaum zu ihm durch,<br />
denn er sieht sich mit einer Schönheit konfrontiert, die<br />
ihn gefangen nimmt, seinen Blick fesselt. In das Erleben<br />
dieser Empfindung stürzt er sich ungebremst hinein, und<br />
plötzlich scheint alles ganz einfach: »You got my name /<br />
Pick up my number / Come on darling / Let’s be lovers!« Das<br />
Ende freilich ist vorgezeichnet: »The leaving you will break<br />
my heart«. Dann schweigen The Clientele, denken still bei<br />
sich »Frank Zappa is for assholes« und lächeln ein wenig<br />
schmerzvoll, denn sie wissen: Wer nicht imstande ist, sich<br />
das Herz brechen zu lassen, der ist gar kein Mensch.<br />
»God Save The Clientele« von The Clientele ist bereits<br />
bei Pointy/Track & Field/Rough Trade erschienen
eep street text: jens pacholsky<br />
Was passiert eigentlich, wenn so ein Protonenstrahldeflektor<br />
explodiert und Musiker in den Wirkungsbereich<br />
fallen? Ganz einfach: Es knallt, das Summen der Atome<br />
verstummt »und die Erde steht still.« Behauptete zumindest<br />
Philip K. Dick vor genau 0 Jahren. Heute spüren wir<br />
es, doch keine Panik. anthony b & dejah haben einfach<br />
ihre Freunde mitgerissen und nutzen den Stillstand,<br />
um entspannt ein und denselben Titel aus allen Perspektiven<br />
zu betrachten. Auf »More Power Remixes« (Metatronix)<br />
wird der Dancehall-Banger dadurch zum Booty-Baby<br />
(Nick Fury), Baile Funk Cyborg (DMX Krew) und Science<br />
Fiction Dub (Eliot Lipp). Die Funcken-Brüder machen aus<br />
ihm einen Minimal Panjabi Hallraum (als Quench) und<br />
verfrickelte Lawinenmusik (als Funckarma), während The<br />
Bug das Sirenen-Inferno entzündet und High Priest zum<br />
Outta Space & Time Boogie aufruft. An einer Stelle hat<br />
der Laserstrahl in der Scheidewand der Zeit einen Spalt<br />
geöffnet, der tonikom die Jahre von 1992 bis 1996 zugleich<br />
erkunden lässt, als man noch Breakbeats in sanfte<br />
Ambientflächen tunken durfte, ohne für kitschig gehalten<br />
zu werden. So muss sich die als Tonik bekannt gewordene<br />
New Yorkerin auf »Epoch« (Hymen) genau deshalb hänseln<br />
lassen, wenn sie mit einfachen Klängen riesige Räume<br />
baut, die dem Kritiker zum pastellfarbenen Sonnenuntergang<br />
passen, durch ihre Ernsthaftigkeit und Vehemenz<br />
aber jedem IDM-Schüler ein Liebesflüstern entlocken. Der<br />
hänselnde Mann auf der anderen Seite ist übrigens richie<br />
haWtin, der zu diesem Zeitpunkt längst das Pompöse<br />
hinter sich gelassen hat und nun im zeitlichen Stillstand<br />
die spartanisch gesäten Einzelatome von der Wand pflückt,<br />
die er anno 1996 zu einer Minimal-Techno-Blaupause in<br />
Schwingungen versetzte. Remastered von Pole und bereits<br />
vor elf Jahren von Thomas Brinkmann mittels Timestretching<br />
und diverser String-Theorien variiert, wird das<br />
Ganze nun als »Concept 1 / Variations« (Minus) auf Doppel-CD<br />
(wieder)hörbar. Ein leichtes Brummen gibt es da,<br />
puckernd und scheinbar stagnierend, das im quantenphysikalischen<br />
Sinne aber immer wieder zu Verkrümmungen<br />
führt, die heute noch ihren Einfluss beweisen. Direkt an<br />
Richie vorbei raste auch der Kalifornier flying lotus,<br />
der auf seinem Weg klammheimlich Atome von allen<br />
Seiten klaute. Auf seiner EP (»Reset«, Warp) fusioniert er<br />
diese zu verschiedenen Verbindungen des elektrifizierten<br />
HipHop. Ganz zum versprochenen Neustart der Musikrezeption<br />
reichen die Exkurse gen House, Hinkefußgroove<br />
und hypnotische Electrotrips aber nicht. Alice Coltranes<br />
Neffe kann sein Hehlerdasein nicht dementieren und variiert<br />
zwischen den Stilen anderer. Push Button Objects, Dabrye<br />
und A Tribe Called Quest nicken auf seinen Teilchen.<br />
Auch Boxcutter, Scuba, Elemental und ihre hotflush<br />
records Kumpel schnappten sich auf ihrer Flucht in die<br />
Tiefe alle Nase lang Atome und verknüpfen diese nun zu<br />
den längsten Frequenzen für zeitlosen Dubstep. An diese<br />
koppeln sie auf »Space & Time« (Hotflush) Ambient, IDM<br />
und Acid und halten mit Referenzen zu B12 und FSOL das<br />
Kind Dubstep weiter spannend. Ganz in der Nähe hat sich<br />
Napalm Deaths Mick Harris vor Jahren schon zum scorn<br />
geschlagen und trommelt im »Stealth«-Modus (Ad Noiseam)<br />
gnadenlos seinen Metal-Dub. Dieser versank bereits<br />
vor Dubstep und Co. in endlosen Hallräumen und enorm<br />
reduzierten Bass- und Drumpattern, verwirbelt sich auf<br />
seinem elften Album aber stärker als je zuvor mit Kernspaltungssplittern,<br />
die der Gravitation Scorns anheim gefallen<br />
sind und nun bedächtig um seinen massiven Sound<br />
Ellipsen drehen. Ach, und fast hätten wir ihn direkt neben<br />
einem zerborstenen Stahlpfeiler vergessen: Mit großer<br />
Beule und jämmerlich benommen sitzt da nach vielen<br />
Geniestreichen μ-ziq. Alle die Jahre kompositorische Brillanz<br />
ist dem einzig echten Aphex-Twin-Kollaborateur beim<br />
Aufprall abhanden gekommen. Die Amnesie führt zu unmotivierter<br />
Skizzenmusik, die auf der Stelle tritt und die<br />
Komplexität und Rätselhaftigkeit des Titels »Duntisbourne<br />
Abbots Soulmate Devastation Technique« (Planet μ) nie erreicht.<br />
Holt ihn da mal bitte einer raus?<br />
In Nomine Viberti<br />
Unser liebster Eklektizist luke vibert<br />
setzt der elektronischen Musik endlich<br />
dort ein Denkmal, wo es hingehört: In<br />
Cornwall<br />
text: jens pacholsky foto: sebastian hinz<br />
Von wegen Chicago, vergesst Detroit. Redruth is the place<br />
to be. Idyllisch gelegen zwischen grünen Hainen, Sonntagsgottesdienst<br />
und den dreißig Zigaretten danach, die<br />
Luke Vibert als designierter Kettenraucher in seiner Heimatstadt<br />
Cornwall zu genießen weiß. Ganz entspannt<br />
inmitten analoger Klanggeneratoren und digitaler Scheinwelten<br />
konstruiert der Tausendsassa nicht Musik, er spielt<br />
mit ihr. »Chicago, Detroit, Redruth« ist daher wie alle seine<br />
fünfzehn Alben: ein vor Freude strahlender Spaziergang,<br />
der weniger urbane Coolness atmet, als vollkommen luftig<br />
durch die Lande zu ziehen, wo sich auch zwischen Kühen<br />
gut raven lässt. Die perfekte Gelegenheit für Luke Francis<br />
Vibert, all seine Personae auf ein Familienfest einzuladen<br />
und deren Facetten zu verschmelzen, die sein 13jähriges<br />
Schaffen ausmachen. Da gibt es zuckersüße Schlaraffenlandmelodien<br />
über Jazz-Breaks, Acid-Pumpen mit Disco-<br />
Kitsch, oben drauf gefüllte Bassrollen und nicht zuletzt<br />
die »cornish nonchalance«, die all seinen Alter Egos so gut<br />
steht (Wagon Christ, The Ace Of Clubs, Kerrier District,<br />
Plug etc.) Im Hintergrund spielt der Pater Orgel und feuert<br />
den Knabenchor an. Die Dreifaltigkeit ist nichts dagegen.<br />
Das durfte auch Elektronikpionier Jean Jacques Perrier<br />
erfahren, dessen kunterbunte Moog Synthesizer-Klänge<br />
Luke Vibert endlich ordentlich die psychedelischen Hüften<br />
schwingen lässt. Seit der Ankündigung 2001 haben wir<br />
darauf gewartet.<br />
»Chicago, Detroit, Redruth« von Luke Vibert<br />
ist bereits bei Planet µ/NTT erschienen<br />
»Moog Acid« von Jean Jacques Perrier und Luke Vibert<br />
ist bereits bei Lo Recordings/Groove Attack erschienen<br />
36 1 töne<br />
töne 1 37<br />
review<br />
Auditives Suchspiel<br />
Der Berliner Matthias Grübel alias<br />
phon°noir schickt auf seinem zweiten<br />
Album die Wahrnehmung auf die Suche<br />
nach Geräuschen und Klängen<br />
text: vera hölscher<br />
Weniger ist manchmal mehr. Im Fall von Phon°noirs<br />
zweitem Werk »The Objects Don’t Need Us« kann man zwar<br />
nicht von wenig reden. Denn der Nachfolger vom minimalistischen<br />
LoFi-Erstling »Putting Holes Into October Skies«<br />
von 2006 ist insgesamt etwas komplexer ausgefallen, und<br />
so finden sich in den halbelektronischen, meist melancholischen,<br />
zwischen Experimental Pop und Postrock oszillierenden<br />
Tracks diesmal mehr Brüche, mehr Rhythmen<br />
und auch mehr Instrumente wieder, angetrieben durch in<br />
die Melodien verwobene Alltagsgeräusche. Aber so wie bei<br />
einem Film bestimmte Requisiten erst beim zweiten Mal<br />
bewusst ins Auge fallen, lässt sich auch die Geräusch- und<br />
Klangkulisse von Phon°noirs Musik erst nach und nach erfassen.<br />
Unter sich wiederholende Loops mischen sich wie<br />
kleine Morsezeichen zahlreiche Geräusche, mal knistert<br />
oder knackt, mal gluckst und klackert es, oder man hört<br />
Vogelgezwitscher und das Klingeln einer Kasse. Da wo Explosions<br />
In The Sky mit ihren psychedelischen Gitarren in<br />
einen Trancezustand versetzen, erreicht einen Phon°noir<br />
mit seinen zaghaften Geräuschen und Klängen, die sich<br />
übereinander schichten, miteinander verschmelzen und<br />
ihre ganz eigene Wucht entwickeln. Genauso verhält es<br />
sich mit dem Gesang. Für »The Objects Don’t Need Us«<br />
hat sich Phon°noir Gäste ins Studio geholt. Aber ohne<br />
dass man dessen im ersten Moment wirklich gewahr wird,<br />
singt beispielsweise Marie-Sophie Kanske von der Dresdner<br />
Formation Transatlanticism bei »Invisible at Last« leise<br />
im Hintergrund, versteckt sich fast hinter Phon°noirs<br />
flüsternder Stimme und bestimmt dennoch den Song entscheidend<br />
mit. Nur einer der elf »quiet explosions«.<br />
»The Objects Don’t Need Us« von Phon°noir<br />
ist bereits bei Sub <strong>Rosa</strong>/Alive erschienen
eview<br />
Von Katastrophen<br />
und anderen<br />
Kleinigkeiten<br />
Da heißt es, früher sei alles besser<br />
gewesen. Die Compilation doom &<br />
gloom: early songs of angst and<br />
disaster 1927 – 1945 erzählt das<br />
Gegenteil<br />
text: markus hablizel<br />
Als ich einmal den Süden der USA durchstreifte, stolperte<br />
ich hauptsächlich über zwei Dinge: Essen und das Böse.<br />
Ersteres war gemeinhin frittiert, letzteres war etwas<br />
einfallsreicher und kam in mannigfaltiger Gestalt daher:<br />
Mord, Totschlag, Überschwemmung, Feuer, Ehebruch,<br />
Politik, Liebe, Alkohol, Drogen, Waffen, Sklaverei, Satan,<br />
Gott, Nachbarn, Frau, Mann, Hund. Alles eine Frage der<br />
Perspektive. Mir waren die Erzählungen über all die Katastrophen<br />
und Schicksale meist ein willkommener und Nackenhaar-aufstellender<br />
Digestif nach allzu viel Frittiertem.<br />
»Doom & Gloom: Early Songs Of Angst And Disaster 1927<br />
– 1945«, dieses (wieder einmal) fantastisch kompilierte Trikont-Album,<br />
will und kann aber selbstredend mehr. Zwar<br />
Portrait of<br />
the artist as a<br />
young girl<br />
vashti bunyan revidiert<br />
mit einer Retrospektive der<br />
Jahre 1964 – 67 ihr Folk-<br />
Image<br />
text: markus von schwerin<br />
Zwei Jahre ist es her, dass Vashti Bunyans Rückkehr international<br />
gefeiert wurde – außer in Deutschland, wo lediglich<br />
die Geschichte von der fallengelassenen Entdeckung des<br />
Stones-Managers aufgegriffen wurde, die 1968 mit einer<br />
Kutsche zu den Hebriden aufbrach und die Selbstversorger-Idylle<br />
auf ihrem lange verkannten Album-Debüt »Just<br />
Another Diamond Day« stilisierte. Diesen Liedern, deren<br />
melodischer Zauber erst zwei Generationen später entdeckt<br />
wurde, verpasste damals Produzent Joe Boyd mittels<br />
Banjos und Blockflöten ein Folk-Gewand, das gar nicht im<br />
Sinne der Sängerin war. Die auf dem im Jahre 2000 wieder<br />
erzählen Big Bill Broonzy, Charley Patton, die Carter Family,<br />
Bessie Smith, Roy Acuff und all die anderen, weniger<br />
bekannten Protagonisten US-amerikanischer roots music<br />
ebenfalls Geschichten von Explosionen, Kriegen, Feuern<br />
oder geborstenen Dämmen aus ihrer jeweils ganz eigenen<br />
Perspektive, doch in der Gesamtschau ergibt sich deutlich<br />
mehr als bloß ein Gruselkabinett von Natur- und anderen<br />
Katastrophen. Die 24 Songs evozieren das Bild einer sich<br />
zunehmend säkularisierenden (westlichen) Gesellschaft,<br />
die immer wieder über die eigene Geschwindigkeit, den<br />
ihr eigenen Willen zur Macht und ihre eigenen Heilsversprechen<br />
stolpert und dann erstaunt feststellt, dass<br />
Fortschritt und Technik nicht nur Gutes mit sich bringen.<br />
Zeppeline gehen in Flammen auf, Kriege werden angezettelt,<br />
Züge entgleisen, Atombomben vernichten, unsinkbare<br />
Schiffe sinken und Dämme brechen. Was sich wie ein<br />
feuchter Unterrichtsmaterial-Traum kulturpessimistischer<br />
Zeigefinger-Pädagogen anhört, ist in Wahrheit aber eine<br />
Sammlung unfassbar einnehmender Songs.<br />
Die Compilation »Doom & Gloom: Early<br />
Songs Of Angst And Disaster 1927 – 1945« ist<br />
bereits bei Trikont/Indigo erschienen<br />
aufgelegten Debütalbum (und nun auch auf der Compilation<br />
»Some Things Just Stick In Your Mind«) enthaltenen Bonusstücke<br />
von 1966/67 hatten da schon mehr mit Bunyans<br />
Comeback-Album »Lookaftering« gemein. Nicht nur, was<br />
die sparsame Begleitung betrifft, sondern auch inhaltlich:<br />
Während »Just Another Diamond Day« von Flora- und Fauna-Beobachtungen<br />
lebte, verarbeiteten Bunyans Texte davor<br />
und danach hauptsächlich Emotionales – ohne dabei<br />
auf Naturmetaphern zu verzichten. Welch poetische Kraft<br />
ihrer Liebeslyrik immer schon innewohnte, dokumentiert<br />
nun diese Sammlung an (größtenteils bis dato) unveröffentlichten<br />
Frühwerken. Bunyans gehauchte Reflexionen<br />
über die Kurzlebigkeit aller Glücks- und Sicherheitsgefühle<br />
sollten einen dabei nicht über den Humor und die<br />
dramaturgischen Kniffe ihrer Texte hinwegtäuschen. Dazu<br />
wurden die eingängigen Melodien von der Autodidaktin<br />
mit einer Selbstverständlichkeit auf der Akustischen umgesetzt,<br />
wie man es erst Jahre später bei Joni Mitchell und<br />
Leonard Cohen beobachten sollte. Songs, die auch Hits<br />
für die Herman’s Hermits hätten abwerfen können und<br />
Vashti Bunyans Selbstverständnis als »pop artist« (siehe<br />
Linernotes) mehr als plausibel machen.<br />
»Some Things Just Stick In Your Mind« von Vashti Bunyan ist<br />
bereits bei Fat Cat/PIAS/Rough Trade erschienen<br />
Angestoßen durch das neue Soloalbum (»Trees Outside The<br />
Academy«, Ecstatic Peace) von thurston moore, Gitarrist<br />
von Sonic Youth, ist es zu einem Nachdenken über das<br />
Ergebnis des Musizierens in der Gruppe kontrastiert mit<br />
dem einer Einzelperson gekommen. In aller Deutlichkeit<br />
ist hier ja ein Gegensatz zu den Werken seiner Hauptband<br />
hörbar, erkennbar vor allem durch die Abkehr vom elektronisch<br />
verzerrten Klang. Zwar beginnen die Songs oft lärmend,<br />
doch wird’s danach regelrecht freundlich: Thurston<br />
wollte mal was mit Geigen machen! In Abgrenzung zu den<br />
meisten anderen Songwriter-Platten, die monatlich im<br />
Dutzend ihre Veröffentlichung erfahren, umweht einen<br />
hier wenigstens noch transitorisch Flüchtiges und Unseriöses,<br />
das also, was Pop-Musik einst so spannend machte,<br />
von Leuten, die Captain Beefheart, Arto Lindsay, Iggy Pop,<br />
Scott Walker, Lou Reed, John Cale hießen. Auch kompositorisch<br />
ist das aufregender, um nur »Honest James«, das<br />
exzellente Duett mit Christina Carter zu erwähnen, das<br />
sich in den ersten zwei Dritteln auf eine David-Grubbsgleiche<br />
Verknüpfung von Akustikgitarren konzentriert,<br />
um dann den Fokus komplett auf das Zusammenwirken<br />
zweier Stimmen zu verlagern. Die Stimmkunst Christina<br />
Carters ist mehr als je zuvor auch der Kern der neuesten<br />
Veröffentlichung (»Likeness«, Kranky) der charalambides,<br />
ihrem gemeinsamen Projekt mit Tom Carter, bei<br />
der sich die Selbstlaute über die bedingungslos langsam<br />
vorgetragenen traditionals ziehen und dabei mal ins Flirren,<br />
mal ins Schweben, mal ins Umkippen geraten, was<br />
dieses Album quasi ununterscheidbar von Christina Carters<br />
Solowerken macht. Polarisierend verhalten sich die<br />
jüngsten Werke von oren ambarchi. In der Tradition<br />
von Keith Rowe, dem Begründer des Improv-Ensembles<br />
AMM, mit dem Ambarchi bereits mehrfach zusammenarbeitete,<br />
und dem es nicht um die Flachheit der Oberfläche<br />
geht, sondern um die Gestaltung von etwas, das sich auf<br />
der Oberfläche abspielt, ist hier (»In The Pendulum’s Embrace«,<br />
Touch) jede Note so gewählt und pointiert gesetzt,<br />
dass ein einzelner Ton zum Erlebnis wird. Den Stücken<br />
text: sebastian hinz the relay<br />
Sun I’ll Be the Same<br />
des 38jährigen Australiers wohnt ein Ertasten der Welt mit<br />
skeptischer Vorsicht inne. Seine Kollaboration mit Chris<br />
Townend ist da die genaue Antithese: Diese Formation<br />
trägt völlig verdient den Namen sun. Die Musik auf ihrem<br />
zweiten Tonträger (»I’ll Be The Same«, Staubgold) ist<br />
eine chancenreiche Öffnung, eine der Welt zugewandte<br />
Bejahung. Nicht »Fever, A Warm Poison«, sondern »Mosquito«,<br />
»Right Now« oder »Smile« heißen die Stücke hier<br />
frohlockend. Noch einmal anders verhält es sich beim norwegischen<br />
Trompeter arve henriksen. Während seine<br />
Soloarbeiten, wie das kürzlich erschienene »Strjon« (Rune<br />
Grammofon) den Sound betreffende Fragen ins Zentrum<br />
stellen, also wie es möglich ist, dass eine Trompete nur<br />
selten nach Trompete klingt, sondern eher nach Flöte, verschnupfter<br />
Lerche oder Plattenspieler ohne Nadel, geht es<br />
bei supersilent (»8«, Rune Grammofon), dessen vierter<br />
Teil Henriksen nunmehr seit zehn Jahren ist, um die Unmittelbarkeit<br />
eines kollektiven Musizierens, was hier leider<br />
zu oft in temperamentarme Synthesizerskizzen und hüftsteife<br />
Arhythmik mündet. Supersilent ist die Kakophonie<br />
für den Augenblick, Arve Henriksens Trompetenspiel das<br />
ungläubige Kopfschütteln für die Ewigkeit. Ebenfalls einer<br />
der Weltbesten an seinem Instrument ist der Schlagzeuger<br />
Steve Reid, der ja bereits mit James Brown, Dionne Warwick,<br />
Miles Davis, Archie Shepp oder im Sun Ra Arkestra<br />
arbeitete. Seit einiger Zeit werkelt er nun mit Kieran Hebden<br />
herum, dessen Produktionen als Four Tet auch diesen<br />
zu einem der wichtigsten Protagonisten zeitgenössischer<br />
Musik werden ließen. Beide zusammen sind die Köpfe<br />
des steve reid ensembles, und man kommt beim<br />
Hören dieser Musik (»Daxaar«, Domino) nicht umhin zu<br />
glauben, dass diese Zusammenkunft genau jene aufgrund<br />
von fehlendem Know-How entstandenen Leerstellen der<br />
Solowerke zu komplettieren versucht. Musikalisch ist es<br />
genau das Album geworden, das seit Jahren von Doug<br />
Scharins Rasselbande Him erwartetet wird; daneben ist es<br />
eine geniale Zusammenführung der Talente zweier hervorragender<br />
Einzelmusiker.<br />
38 1 töne<br />
töne 1 39
worte<br />
Illustration:<br />
bruno<br />
colajanni,<br />
ludaG.com<br />
worte<br />
»In der Antarktis<br />
umzukommen, ist<br />
ziemlich einfach.«<br />
Die Schriftstellerin jean mcneil,<br />
Polarromane<br />
Seite 48<br />
»Ein Kind zu sein, ist heute<br />
wahnsinnig gefährlich.«<br />
jonathan meese<br />
Seite 2<br />
»Ich möchte Sachen<br />
dokumentieren, die von<br />
der herrschenden Kultur<br />
nicht anerkannt werden.«<br />
chuck palahniuk über seine<br />
Rolle als Schriftsteller<br />
Seite 44<br />
42 <strong>Chuck</strong> Palahniuk<br />
46 Polarliteratur<br />
48 Larissa Böhning<br />
49 Mark M. Danielewski<br />
0 Jonathan Meese<br />
reviews<br />
4 performativ<br />
Adam Olschewski<br />
Roman Simić<br />
6 Virginie Despantes<br />
Michael Lentz<br />
7 Monika Maron<br />
8 »Propaganda«<br />
»Machiavelli«<br />
9 das dispositiv
<strong>Meeting</strong><br />
<strong>Chuck</strong> –<br />
<strong>Sex</strong> & <strong>Gewalt</strong><br />
Dabei ist er doch nur eine Art Buchhalter: der Autor chuck palahniuk<br />
text, interview: matthias penzel übersetzung: rebecca pohl<br />
fotos: andreas chudowski<br />
<strong>Chuck</strong> Palahniuk, studierter Journalist und gelernter Lkw-<br />
Mechaniker schrieb seinen ersten Roman über Frauen<br />
und was sie bewegt, also Vogue, Diät- und Beauty-Fetischismus,<br />
Supermodels. Triefend vor schwarzem Humor,<br />
wurde »Invisible Monsters« von allen Verlagen abgelehnt.<br />
Zu krass. Palahniuk zog daraus seine Konsequenzen, begab<br />
sich mit seinem nächsten Roman noch tiefer in die<br />
Katakomben US-amerikanischer Unkultur, schrieb über<br />
Männer und was die bewegt – wenn nichts mehr für<br />
wahre Gefühle sorgt. »Fight Club« wurde – auch Dank<br />
Finchers Verfilmung – zum Hit. Andere Alpträume der<br />
Hinterhöfe kamen in »Flug 2039« (Suizidsekte), »Der Simulant«<br />
(<strong>Sex</strong>manie), »Lullaby« (killende Kinderliedchen),<br />
»Das Protokoll« (Immobilien und Kunst), »Die Kolonie«<br />
(Künstlerdorf) zum Ausdruck, dazwischen zwei hierzulande<br />
unveröffentlichte Essaybände (über <strong>Sex</strong> und <strong>Gewalt</strong><br />
bzw. Portland und Marilyn Manson, dem Palahniuk die<br />
Tarotkarten legte) und nun »Das Kainsmal«.<br />
In »Invisible Monsters« rächen sich verstümmelte Models,<br />
in »Fight Club« prügelt man sich aus Jux und Dollerei. In<br />
»Das letzte Protokoll« werden Künstler im Namen der<br />
Kunst verstümmelt, in »Die Kolonie« verrückt. Warum so<br />
viel <strong>Gewalt</strong>?<br />
Für mich geht es nicht so sehr um <strong>Gewalt</strong> als eher um das<br />
Bedürfnis, sich lebendig zu fühlen und sich selbst sehr körperlich<br />
wahrzunehmen. Bücher haben meistens eine intellektuelle<br />
und eine emotionale Komponente, aber nur sehr<br />
selten eine physische. Körperliches wird tendenziell als<br />
kulturell minderwertig betrachtet – Pornographie, Horror:<br />
alles low-art. Um beim Leser Mitgefühl auszulösen, so richtig<br />
körperlich, von Kopf bis Fuß, muss man <strong>Gewalt</strong> oder<br />
<strong>Sex</strong> nehmen, oder Krankheiten, manchmal Drogen. Damit<br />
kann man Leser auf einem physischen Level einbinden, ihnen<br />
eine ganze Realität erschaffen. Das ist mein Ziel.<br />
Es sind bei mir aber immer auch Figuren, die mit einer<br />
sehr körperlichen Sache beschäftigt sind, die sich dadurch<br />
lebendig fühlen; die außerdem das zerstören, was<br />
sie um sich herum vorfinden, weil sie etwas Besseres erreichen<br />
wollen. Die Zerstörung des gegenwärtigen Wohlbefindens<br />
zugunsten eines besseren Zustands ist so ein<br />
wiederkehrendes Thema bei mir.<br />
Auch dein Ziel? Sollen auch Leser aus ihrem Wohlbefinden<br />
herausgerissen werden?<br />
Ja. Ich glaube, dass sie wollen, dass das zerstört wird. Irgendwie<br />
wollen sie durch die Erfahrung verändert werden.<br />
Sie wollen am Ende des Buchs nicht derselbe Mensch sein,<br />
der sie waren, als sie angefangen haben, das Buch zu lesen.<br />
Burroughs und Bowie unterhielten sich in einem Interview<br />
für den Rolling Stone einmal darüber, wie fantastisch es<br />
wäre, wenn Musik töten könnte – was du in »Lullaby«<br />
aufgegriffen hast. Besucher deiner Lesungen sind angeblich<br />
ohnmächtig geworden – auch phantastisch oder nur ein<br />
PR-Gag?<br />
Nein. Ich habe aus »Die Kolonie« die ›Perlentaucher‹-Geschichte<br />
vorgelesen, und dabei sind mittlerweile über 200<br />
Leute in Ohnmacht gefallen. In Brighton habe ich vor 900<br />
Leuten gelesen und 13 sind kollabiert. Die Leute vom St<br />
John’s Hospital haben die Leute rausgetragen, und am Ende,<br />
so erzählte man mir, sah die Lobby aus wie in einem<br />
Krisengebiet: überall Menschen auf Bahren.<br />
Alle vorher im Publikum vom Verlag platziert –<br />
ein PR-Coup?<br />
No no no. Gar nicht. Sogar in Italien, wo sie einen Schauspieler<br />
engagiert hatten, um es auf Italienisch vorzulesen,<br />
sind Leute ohnmächtig geworden – bis zu fünf pro Veranstaltung.<br />
Die waren richtig wütend, weil sie das Gefühl<br />
hatten, das Gesicht verloren zu haben. Das tut mir ein<br />
bisschen leid, aber ich muss natürlich den Umstand lieben,<br />
dass die Worte einer Geschichte – nur die Worte! – auf<br />
Menschen so eine Wirkung haben können. Keine Musik,<br />
keine Bilder, sondern nur Worte. Das liebe ich wirklich.<br />
Destruktion und Kicks: In einem Essay in »Stranger<br />
Than Fiction« variierst du das Thema: Da geht es darum,<br />
Zugehörigkeiten zu zerstören, um Ziele zu erreichen. Hat<br />
man die erreicht, gerät man wieder in Zugehörigkeiten,<br />
also Abhängigkeiten. Das Muster: Isolation, gefolgt von<br />
dem Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit,<br />
gefolgt von Isolation ...<br />
Es ist eine Formel, die man bei allen meinen Figuren<br />
findet. Sie haben alle eine ideale Isolation erreicht – in<br />
»Invisible Monsters« durch Schönheit, wo sie so attraktiv<br />
sind, dass sie Menschen dominieren, so sehr, dass die ihnen<br />
nicht zu nahe kommen; in »Das letzte Protokoll« geht<br />
das über Bildung, wo alles erklärt und somit weggewischt<br />
werden kann, sodass man jede Form von Macht mit Hilfe<br />
seiner Bildung, seines Intellekts, zerstört. In »Fight Club«<br />
ist einer mit seiner Karriere so erfolgreich, dass es ihn in<br />
seinem Job isoliert. Sie alle haben es so gewollt, und doch<br />
gehen sie hin und zerstören diese Isolation – auf sehr reale<br />
Art und Weise, sodass es sie zurück in die Gemeinschaft<br />
mit anderen Menschen zwingt. Ich schätze, das ist so ein<br />
Muster aus meinem Leben, das ich in den Leben all meiner<br />
Mitmenschen wiedererkenne.<br />
»Um beim Leser Mitgefühl auszulösen,<br />
so richtig körperlich, muss man<br />
<strong>Gewalt</strong> oder <strong>Sex</strong> nehmen, oder<br />
Krankheiten, manchmal Drogen.«<br />
Ist die Formel auch auf deinen Schreibprozess übertragbar?<br />
Auf jeden Fall. Jedes meiner Bücher ist für mich so eine Art<br />
Ausrede, ein Problem, das ich nicht lösen, aber auch nicht<br />
ertragen kann, intensiv auszuleuchten – um es so zu bewältigen.<br />
Psychologen nennen das ›Durcharbeiten‹; meine<br />
Arbeit, das Schreiben, ist so ein Durcharbeiten. Egal,<br />
um was für ein Problem es sich handelt, ich versuche<br />
42 1 worte<br />
worte 1 43
dann, so tief wie nur möglich da einzutauchen, viele<br />
Fälle zu untersuchen, mit anderen darüber zu sprechen<br />
und mit Leuten zusammenzukommen, die sich darüber<br />
irgendwie artikulieren. So bringe ich das zum Köcheln,<br />
rühre dann etwas hinzu, und verwandle es – nach der ersten<br />
oder zweiten Fassung – in etwas, wo sich mein ganzer<br />
emotionaler Ärger über das Problem erschöpft. Wenn ich<br />
mich über ein Problem nicht mehr ärgere, neigt es dazu,<br />
vollständig zu verschwinden. Das ist fast wie Magie: Ich<br />
begebe mich in das Schlimmste des Problems hinein, und<br />
dann ist meine Angst weg und das Problem verschwindet;<br />
so wird es durch die Arbeit irgendwie isoliert. Schreiben,<br />
die Gedanken und Ängste organisieren – und am Ende<br />
kommt ein Buch dabei raus, und ich begebe mich wieder<br />
unter die Menschen.<br />
Jedes Buch als Therapie für dich?<br />
So wurde es mir beigebracht, vor Jahren, als ich mit dem<br />
Schreiben anfing 1991 oder 1993: Das Schreiben selbst<br />
muss nützlich sein, so unterhaltsam und so therapeutisch,<br />
dass es egal ist, ob man sein Buch am Ende verkauft kriegt<br />
oder nicht. Es muss eine Belohnung geben, sonst kann<br />
man nicht schreiben. Also muss das Schreiben selbst eine<br />
Belohnung sein. Sogar wenn man es gedruckt kriegt, besteht<br />
die Möglichkeit, dass es sich nicht gut verkauft, dass<br />
man schlechte Kritiken bekommt oder dass ein furchtbarer<br />
Film daraus gemacht wird. Es gibt so viele Aspekte,<br />
an denen man scheitern kann, dass das Schreiben selbst<br />
ausreichend Belohnung sein muss.<br />
In »Stranger Than Fiction« schreibst du: »Man bleibt in<br />
seiner Erzählwelt, bis man sie zerstört.« Wer kontrolliert<br />
hier wen, wie kommt es, dass die Erzählwelt nicht dich<br />
zerstört? Wie versuchst du, sie zu haben, nicht von ihr – der<br />
Erzählwelt – besessen zu werden?<br />
Nein. Ich versuche nicht, wirklich nicht, sie zu besitzen.<br />
Ein befreundeter Schriftsteller meint, ich sei die Art Tier,<br />
die ihre Jungen auffrisst, und wenn ich am Ende eines<br />
Buches angekommen bin, weiß ich meistens, was bis zum<br />
Schluss des zweiten Akts im nächsten passieren wird. Darüber<br />
hinaus muss es mich dann überraschen. Es ist nicht<br />
fertig, bis es mich wirklich überrascht. Mein Vater – und<br />
wenn er mir nichts anderes beigebracht hat, so doch diese<br />
eine Sache – sagte: »Mach nie mit der einen Schluss, bevor<br />
du nicht mit der nächsten gehst««<br />
Ich weiß nicht, ob das gesund ist.<br />
Wenn man schreibt schon. Es ist die einzige Sache, die das<br />
letzte Buch löst – wenn man die nächste Idee kriegt und<br />
die so aufregend und fesselnd ist, dass es okay wird, der<br />
vorigen Idee einen Stoß zu geben. Das bestimmt den Zeitpunkt,<br />
wann ein Buch wirklich fertig ist: Wenn es mich<br />
überrascht und wenn ich die nächste Idee habe. Dadurch<br />
wird es auch leicht, das vorige loszulassen, raus in die Welt,<br />
mit der Idee eines anderen auf dem Umschlag und den<br />
Interpretationen von allen anderen und der Wertung,<br />
der Meinung von wieder anderen: alles nicht so schlimm,<br />
denn ich muss es ja nicht besitzen, weil ich mich längst in<br />
die nächste Sache verliebt habe.<br />
Deshalb schreibe ich so, wie ich es tue. Aber das Schreiben<br />
ermöglicht mir auch, mit Menschen zusammen zu<br />
sein und ich habe sehr früh entschieden, dass Schreiben<br />
meine anhaltende Entschuldigung sein würde, um mit<br />
Menschen zusammen zu sein. Wenn ich jetzt auf Partys<br />
gehe, erzähle ich den Leuten, woran ich gerade arbeite,<br />
lade sie so ein, mir von ihrem Leben zu erzählen und von<br />
den Erfahrungen, die sie mit den Motiven gemacht haben,<br />
die ich erkunde. Ich erwähne vielleicht einen kleinen Aspekt<br />
davon, woran ich arbeite, aber den Rest des Abends<br />
verbringe ich nur damit, zuzuhören. So wird meine Arbeit<br />
zu einer Spiegelung der Erfahrungen einer großen Anzahl<br />
von Menschen statt nur meiner eigenen Vorstellung.<br />
»Meine Figuren sind keine<br />
heimlichen Kannibalen«<br />
Deine Figuren sind eher Außenseiter als Exzentriker.<br />
Warum?<br />
Außen: Das ist es, wo die Zukunft ist. An den Rändern<br />
konventioneller Gemeinschaften findet man soziale Erfahrungen,<br />
man erfährt dort, wie sich Menschen selbst<br />
sehen und wie sie sich in gesellschaftlichen Strukturen zueinander<br />
in Beziehung setzen. Es findet also in der Randzone<br />
statt, dass Menschen mit verschiedenen Formen von<br />
Gemeinschaft experimentieren, auch mit verschiedenen<br />
Formen von Identität – wenn sie eine Identität finden,<br />
entweder eine Sichtweise oder eine Art, sich auszudrücken.<br />
Dort entstehen neue Gemeinschaften, die – nenn es Underground<br />
oder Randzone – dann zu Dominanten, zu Teilen<br />
des Mainstreams werden. Das Neue entsteht dort. Die<br />
Art, wie man sich die Schuhe bindet oder Klamotten trägt,<br />
ist fesselnd und irgendwie wirklich attraktiv, und dann<br />
wird sie zur vorherrschenden Mode oder zur prägenden<br />
Kunstform oder Sichtweise. Zeitgeist. Doch solche Experimente,<br />
die Ursprünge für das Neue können nur dort<br />
wirklich stattfinden.<br />
Aber die Außenseiter in deinen Büchern sind doch eher<br />
krank als Trendsetter.<br />
Tyler Durden oder Rant Casey – man braucht eine Figur,<br />
die das Verhalten irgendwie vorlebt, die eine Seinsweise<br />
vorlebt und diese irgendwie als Subkultur anstimmt. Eine<br />
Figur, die das bezwingend und interessant vorlebt. Das tun<br />
meine Figuren. Sie sind keine heimlichen Kannibalen. Sie<br />
sind eher Werbeträger, sehr lautstarke, sehr präsente, manifeste<br />
Menschen. Also sind sie nicht wie heimliche, eher<br />
wie sehr öffentliche Sonderlinge. Sie sind wie Anführer.<br />
Wie sonderlich bist du?<br />
Ich bin nicht wirklich sonderlich. Ich bin ein ziemlich<br />
langweiliger Mensch. Wie ein Buchhalter. Aber ich bin<br />
einer dieser langweiligen Leute, denen andere ihre Geschichten<br />
erzählen, weil ich die thematisch organisieren<br />
und verknüpfen kann, zur Illustration größerer Anliegen.<br />
Das ist eigentlich alles, was ich tue.<br />
So eine Art unbeschriebenes Blatt?<br />
Aber ein unbeschriebenes Blatt, das getrieben ist, Dinge<br />
zu bewahren, die ich für wertvoll halte. Wenn Leute mir<br />
Geschichten erzählen, die ich außergewöhnlich finde, bin<br />
ich gezwungen, einen Weg zu finden, diese irgendwie zu<br />
erhalten, als Teil von etwas Größerem, damit sie nicht verloren<br />
gehen, denn ich kenne die herrschende Kultur.<br />
»Jeder hat Viagra schon mal ausprobiert.«<br />
Also Historiker?<br />
Ja, die herrschende Kultur wird vieles nicht dokumentieren.<br />
Ich möchte Sachen dokumentieren, die von der herrschenden<br />
Kultur nicht anerkannt werden.<br />
In »Das Kainsmal« geht es um Unsterblichkeit und<br />
Autounfälle, Muschilecken und Ständer, Schlangen und<br />
Spinnen, Silver Clouds und Lamborghinis – ist das ein<br />
Jungsbuch?<br />
Den Fehler, so zu denken, hatte ich bei »Fight Club« gemacht,<br />
aber danach kamen so viele Frauen auf mich zu,<br />
die sagten: »Mann! Gibt es in dieser Gegend einen Fight<br />
Club? Vielleicht einen für Frauen?«, dass ich diese Unterscheidung<br />
irgendwie aufgegeben habe. Männer und Frauen<br />
haben die gleichen Impulse, und ich versuche Figuren<br />
zu schaffen, die fast ohne Geschlecht sind. Ihre Namen<br />
mögen geschlechtsspezifisch sein, sie haben vielleicht ein<br />
physisches Geschlecht in Bezug auf ihren Körper, aber<br />
mein Ziel ist es, keine wirklich gender- oder rassenbasierte<br />
Geschichte zu haben.<br />
Ein Abschnitt in »Kainsmal« konzentriert sich auf<br />
angeschwollene Penisse.<br />
Wo mein Workshop vor Lachen gebrüllt hat. Alle Frauen<br />
in meinem Workshop haben den Teil geliebt, sie haben so<br />
doll gelacht.<br />
Stimmt es, dass Gift einen Ständer verursacht?<br />
Ja.<br />
Wie hast du das recherchiert? Hast du beispielsweise für<br />
diesen Part Viagra ausprobiert?<br />
Ja. Und ich habe mit Ärzten gesprochen, und ich habe mit<br />
Toxikologen gesprochen. Sie haben bestätigt, dass Priapismus<br />
eine Nebenwirkung von Spinnengift ist.<br />
Und Viagra? Wir würden gern mehr darüber hören.<br />
Jeder hat Viagra schon mal ausprobiert! Es ist ziemlich<br />
grauenvoll. Als vor einigen Jahren mein Vater getötet<br />
wurde und wir sein Haus ausgeräumt haben, haben wir<br />
überall Rezepte für Viagra gefunden – in seinem Auto,<br />
im Schlafzimmer und in der Küche. Wir waren so aufgebracht<br />
und in Trauer, aber jedes Mal, wenn wir wieder eine<br />
halbleere Viagraflasche fanden, haben wir angefangen zu<br />
lachen. Weil es schien, dass mit seiner neuen Freundin<br />
alles gut lief, und ich habe eines dieser halbleeren Fläsch-<br />
chen mit nach Hause genommen, und aus Neugier habe<br />
ich es ausprobiert. Es ist eben so ein Produkt unserer Zeit,<br />
also musste ich es sehen.<br />
In »Das Kainsmal« erfahren wir viel über die Hauptfigur<br />
– Rant Casey — durch die Perspektiven anderer. Was willst<br />
du mit diesem Verfahren erreichen?<br />
Drei sehr gute Gründe für diese Technik. Erstens: Ich finde,<br />
mündliche Berichte sind leicht verdaubar, sehr sehr<br />
einfach zu konsumieren, so wie Snacks. Sie sind wie Kartoffelchips:<br />
so klein, dass man sich ständig dabei erwischt,<br />
wie man noch einen Chip legitimiert, andauernd, immer<br />
und immer wieder. Zweitens: oral history ist keine Form<br />
von Fiktion, und dadurch kann man so viel unglaublichere<br />
Geschichten erzählen. So wie Orson Welles, der einem in<br />
»Krieg der Welten« diese alberne Invasionsgeschichte von<br />
Marsmenschen auftischt – aber in Form von Nachrichtensendungen<br />
im Radio erzählt, wodurch das Ganze eine<br />
Glaubwürdigkeit bekommt, nämlich weil die so erzeugte<br />
Angst sehr real wird. Oder »Citizen Kane«, erzählt in Form<br />
der Wochenschau. Wieder eine nicht-fiktionale Form, die<br />
benutzt wird, um eine fiktionale Geschichte zu erzählen.<br />
Oder »Blair Witch Project«: verloren gegangenes Material<br />
eines Dokumentarfilms von Menschen, die von Hexen<br />
umgebracht wurden? Man sieht, die Form trägt die<br />
Geschichte, obwohl die Geschichte albern ist. Der dritte<br />
Grund für diese Technik ist, dass sie es mir ermöglicht, die<br />
Geschichte so zusammenzusetzen, wie es ein Cutter beim<br />
Film tun würde. Denn wir können einen Film gucken, und<br />
wir kennen jump cuts und intercutting, und wir kommen<br />
damit klar, wenn zwei Aussagen sich widersprechen, weil<br />
wir sie als Zuschauer in Beziehung zueinander setzen. Wir<br />
schaffen den Zusammenhang zwischen den Informationsbruchteilen,<br />
die uns in der fortwährenden Collage von Visualitäten<br />
zur Verfügung gestellt werden. Deshalb erlaubt<br />
es mir diese Technik, langatmige, wortreiche Übergänge<br />
zwischen zwei Perspektiven oder Informationen wegzulassen.<br />
Sie stellt sich vielmehr dar wie ein Film.<br />
Dazu kommt, dass das Präsentieren einer Figur, die<br />
nie wirklich selbst auftritt, diese Figur zu einem Symbol<br />
macht, durch die andere sich selbst präsentieren. So wie<br />
du die Welt beschreibst, lernen wir mehr über dich als<br />
über die Welt.<br />
Sind konventionelle Erzählweisen in der Welt von heute<br />
obsolet?<br />
Für manche vielleicht nicht. Aber Filme sind für ein derart<br />
anspruchsvolles Publikum gemacht worden, dass ich<br />
von neuen Büchern mehr erwarte als von früher geschriebenen.<br />
Bücher sollten mit Narration so experimentieren<br />
wie es im Film gemacht wird, bei Videos, ja, sogar im Fernsehen.<br />
»Das Kainsmal« von <strong>Chuck</strong> Palahniuk, übersetzt von Werner<br />
Schmitz, Manhattan HC, München 2007, 352 S., € 14,95<br />
44 1 worte<br />
worte 1 4
Eis, Eis, Baby<br />
Protagonist und Bühnenbild: Eislandschaften im Polarroman<br />
text, interview: kirstin werner foto: torsten sachs /<br />
alfred-wegener-institut für polar- und meeresforschung<br />
»Das Eis knackt – mal mehr, mal weniger. Es schnalzt, als<br />
würde jemand mit der Lederpeitsche peitschen. Und dabei<br />
war die von mir für eine Gletscherspalte gehaltene Kluft ja<br />
nur die Spur eines Heißwasserschlauchs.«<br />
diana magens, wissenschaftlerin am alfred-wegener-institut<br />
für polar- und meeresforschung und momentan für das<br />
internationale bohrprogramm andrill in der antarktis<br />
unterwegs<br />
Literatur handelt von Menschen, nicht von Orten. Landschaften<br />
bilden in Erzählungen oft nur die Kulisse für das<br />
zwischenmenschliche Tun. Da haben es Geschichten, die<br />
an Flecken spielen, an denen kaum jemand lebt, wohl eher<br />
schwer. Denn, wie die Schriftstellerin Tina Uebel treffend<br />
sagt: »Im Polarroman ist das Eis der Protagonist.«<br />
Am 1. März 2007 startete das Internationale Polarjahr<br />
(IPY). Mit dieser groß angelegten Kampagne machen<br />
Wissenschaftler aus weltweit mehr als sechzig Nationen<br />
auf die sensiblen Lebensräume in Arktis und Antarktis<br />
aufmerksam. »Wie sich die Natur an den Polen entwickelt,<br />
steht in unmittelbarem Zusammenhang zu den von Menschen<br />
bewohnten Gebieten«, erläutern die Polarforscher ihre<br />
gemeinsamen Projekte. Das Polarjahr dauert bis 1. März<br />
2009 an: In zwei kompletten Nord- und Südsommern werden<br />
die Gebiete jenseits der Polarkreise erkundet. Der so<br />
genannte »Outreach« spielt dabei zunehmend eine Rolle.<br />
Journalisten, Künstler und Lehrer sind eingeladen, der<br />
Allgemeinheit, vor allem der nachwachsenden Generation,<br />
ihre Eindrücke von der faszinierenden, den meisten<br />
aber unbekannten Gegend kundzutun. Auch Literatur<br />
kann einen Beitrag zu dieser Öffentlichkeitsarbeit leisten.<br />
»Der Thematik mit Literatur zu begegnen, vereinfacht es,<br />
eine Beziehung zum Eis und ein weitergehendes Interesse<br />
für die wortwörtlich weißen Flecken auf der Landkarte zu<br />
entwickeln«, meint Tina Uebel, Autorin des Polarromans<br />
»Horror Vacui«.<br />
Urlaub am Südpol<br />
Im Roman hat Tina Uebel die Eindrücke ihrer Antarktisreise<br />
auf einem russischen Eisbrecher partiell verwertet:<br />
»Die Reise war zunächst schlicht die Erfüllung eines Lebenstraumes.<br />
Erst ein halbes Jahr später wurde mir klar,<br />
dass sich die Antarktis und spezifisch der in ›Horror Vacui‹<br />
beschriebene Trip – den ich zwar nicht gemacht habe, der<br />
aber ziemlich exakt so als ›Pauschalreise‹ buchbar ist – als<br />
ideale Kulisse eignet«, erzählt die Hamburgerin. Vier Extremtouristen<br />
machen sich auf den Weg zum Südpol. Von<br />
zwei Guides geführt, quälen sie sich über das unwegsame<br />
Eis. Der Spaziergang zum südlichsten Punkt der Erde<br />
wird aus den Perspektiven der vier Urlauber geschildert.<br />
»Die Protagonisten stehen unter dem Einfluss der extremen<br />
Landschaft, deren Dimensionen gar nicht zu begreifen sind.<br />
Insofern verhalten sie sich auch jenseits der ›Normalität‹«,<br />
beschreibt die Autorin, Literaturveranstalterin und freie<br />
Journalistin die kleine Reisegruppe. In den Köpfen der vier<br />
macht sich im Verlauf der Wanderung auf unterschiedliche<br />
Weise der ›Horror vacui‹, die Angst vor der totalen<br />
Leere, breit. Dennoch ist die beeindruckende Schneelandschaft<br />
ihr Antrieb weiterzugehen, ihre Motivation ist das<br />
Eis. Zwischen Faszination und Lähmung wandeln die vier<br />
physisch und psychisch Geschwächten über das gefrorene<br />
Land: »Dass ich noch immer stehe, überrascht mich selbst.<br />
Wenn die schützende Haut des Schlafsacks, des Zeltes, der<br />
Gespräche, der Gegenwart anderer von mir abgezogen ist<br />
wie die Pelle von einer Kartoffel, scheint es mir jedes Mal<br />
verwunderlich, dass noch genug übrig bleibt, was sich auf<br />
den Weg machen könnte. Auf den Weg über das Eis. Soviel<br />
Eis, es tut fast weh.«<br />
Das Eis – Protagonist und Bühnenbild<br />
Mit dem IPY wird eine öffentliche Debatte über die Relevanz<br />
der Polargebiete für das globale Klima losgetreten,<br />
die auch in der Literatur geführt werden könnte: »Literatur<br />
kann wissenschaftliche Ideen und Szenarien transportieren.<br />
Es reicht schon aus, wenn Fragen wie der Klimawandel<br />
oder der Verlust von Ökosystemen eine Person in einer Erzählung<br />
direkt betreffen«, meint die britische Autorin Jean<br />
McNeil. Denn über die Identifikation des Lesers mit den<br />
Figuren gelingt der Roman. Die Herausforderung des<br />
Polarromans ist somit eine Gratwanderung: Das Eis ist einerseits<br />
Protagonist, andererseits nur das Bühnenbild, vor<br />
dem sich die Handlung vollzieht. Während in Romanen<br />
wie John Griesemers »Niemand denkt an Grönland« die<br />
Arktis als befremdendes Niemandsland im Hintergrund<br />
verschwimmt, dreht sich in Christoph Ransmayrs Roman<br />
»Die Schrecken des Eises und der Finsternis«, in »Fräulein<br />
Smillas Gespür für Schnee« von Peter Høeg oder in Tina<br />
Uebels »Horror Vacui« alles um das Eis und dessen Wirken<br />
auf die Romanfiguren.<br />
Geschichten vom Pol<br />
Science-Fiction-Romane versetzen ihre Handlung gern<br />
in die oft außerirdisch anmutende Umgebung der Polargebiete.<br />
»Das Zusammenspiel von klaustrophobischer<br />
Enge auf Polarstationen mit der tödlichen Weite der Landschaft<br />
begünstigt wahrscheinlich auch Krimis. Andere Geschichten«,<br />
meint Tina Uebel, »gestalten sich naturgemäß<br />
knifflig, sie setzen eine genaue Kenntnis der Umstände in<br />
den dort marginalen menschlichen Lebenswelten voraus.«<br />
Geschichten vom Pol sind auch deshalb so rar, weil die Re-<br />
cherche schwierig ist und die persönliche physische Erfahrung<br />
notwendig, wozu nur wenige Autoren Gelegenheit<br />
haben. Vielleicht sind Polarromane aber auch so selten,<br />
weil bisher kaum Nachfrage bestand. Geschrieben wurde<br />
schon seit den ersten Entdeckungsreisen ins unbekannte<br />
Land. Die Helden des heroischen Zeitalters wie Shackleton,<br />
Amundsen oder Scott haben ihre Expeditionen gewissenhaft<br />
in Tagebüchern festgehalten. »Vielleicht besteht<br />
der Antrieb Tagebuch zu schreiben darin, der unmenschlichen<br />
Landschaft etwas Menschliches einzuhauchen«, vermutet<br />
die in Kanada geborene Jean McNeil. Heute löst das<br />
Internet das Tagebuch zunehmend ab, in persönlichen<br />
Rundmails lesen Familie, Freunde und Bekannte vom Leben<br />
auf der Polarstation. E-Mails und Weblogs schützen<br />
vor dem Vergessen. »Die Eindrücke sind so extrem wie die<br />
Landschaft. Derart fremd und intensiv, nicht vergleichbar<br />
mit dem, was man in seiner Normalexistenz erlebt. Eine<br />
nachträgliche Beschreibung aus der Erinnerung müsste<br />
verwässert klingen«, beschreibt Tina Uebel die Notwendigkeit,<br />
das Erlebte noch vor Ort aufzuschreiben. »Viele der<br />
Natureindrücke in »Horror Vacui« entstammen wortwörtlich<br />
meinem Tagebuch.«<br />
Antarktisches Drama<br />
Anfang Februar 2008 wird die Schriftstellerin Jean McNeil<br />
für mehrere Wochen mit der ›Polarstern‹, dem deutschen<br />
Forschungseisbrecher des Alfred-Wegener-Instituts für<br />
Polar- und Meeresforschung, in die Antarktis reisen. Ein<br />
Künstler-Stipendium der für Antarktisforschung zustän-<br />
digen Organisation Großbritanniens, der British Antarctic<br />
Survey, ermöglichte der Autorin bereits vor einigen Jahren<br />
einen Aufenthalt im Eis. Ihre Eindrücke fasste sie in<br />
dem Genre übergreifenden Band »The Ice Diaries« zusammen.<br />
Trotz der Bezauberung, sagt sie, besäße das Leben<br />
dort etwas Beklemmendes: »Man ist mit vielen Leuten auf<br />
engstem Raum zusammen gepfercht. Da kann man nicht<br />
einfach weglaufen – in der Antarktis umzukommen, ist<br />
ziemlich einfach. Aber genau das gibt dem Ganzen etwas<br />
Dramatisches: Die Landschaft färbt das menschliche Miteinander<br />
ein. Die Antarktis habe ich daher als einen sehr<br />
inspirativen Ort zum Geschichtenerzählen empfunden.«<br />
Weiterlesen<br />
»Horror Vacui« von Tina Uebel, Kiepenheuer &<br />
Witsch, Köln 2005, 272 S., € 17,90<br />
»Die Schrecken des Eises und der Finsternis« von Christoph<br />
Ransmayr, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am<br />
Main 1987 (Neuauflage 2005), 275 S., € 8,95<br />
»Die Entdeckung der Langsamkeit« von Sten Nadolny, Piper,<br />
München 1983 (Neuauflage 2007), 368 S., € 10,00<br />
»Amundsen. Bezwinger beider Pole« von Tor Bomann-<br />
Larsen, marebuchverlag, Hamburg 2007, 703 S., € 29,90<br />
»Pole, Packeis, Pinguine« von Karoline Stürmer, Deutscher<br />
Taschenbuch Verlag, München 2007, 304 S., € 14,95<br />
tina uebel empfiehlt<br />
»Die schlimmste Reise der Welt« von Apsley Cherry-<br />
Garrard, Semele Verlag, Berlin 2006, 656 S., € 26,90<br />
46 1 worte<br />
worte 1 47
Die Drehung<br />
der Schraube<br />
larissa boehnings<br />
Roman-Debüt »Lichte Stoffe«<br />
text, interview: susanne lederle<br />
Evi geht in einem Pelzmantel in die Badenwanne und ihr<br />
Mann rasiert einer streunenden Katze das verfilzte, kotverdreckte<br />
Fell. Eine Beinahe-Affäre später liest Evi die<br />
nackte Katze von der Straße auf und wärmt sie mit dem<br />
ruinierten Pelzmantel. Dieser Pelzmantel ist das einzige,<br />
was sie aus dem Besitz ihrer verstorbenen Mutter behalten<br />
hat. Evi ist ein ›Besatzungskind‹, die Tochter eines<br />
schwarzen GI und einer Berliner Hutmacherin. Diese<br />
warnte bisweilen die Kundschaft im Geschäft vor ihrer<br />
Tochter: »Die färbt ab!«<br />
Erst nach dem Tod der Mutter erfährt Evi von einem<br />
Degas-Gemälde, unterschlagener Beutekunst, das ihr Vater<br />
einst der Mutter schenkte, dann bei seiner Rückkehr<br />
in die USA aber doch mitnahm.<br />
Versammelte Larissa Boehnings Debüt, ihr Erzählband<br />
»Schwalbensommer«, noch Geschichten über die Befindlichkeiten<br />
der ›Generation Golf‹, wächst ihr erster Roman<br />
»Lichte Stoffe« weit über die Zustandsbeschreibungen<br />
dieses So-Dahin-Lebens hinaus. Er erweitert es um die<br />
Dimension der Eltern- und Großelterngeneration, um<br />
die Frage, was Heimat sein und ob man eine brauchen<br />
könnte, um eine scheinbar erbliche Zurückweisung durch<br />
die Eltern und deren Kompensationsversuche. Diese Eltern-Kind-Störung<br />
lässt sich auf das Verhältnis der Deutschen<br />
zu den Amerikanern übertragen. Denn man »hasst<br />
doch immer nur das, was einem zu ähnlich ist«.<br />
Von Mimikry-Stoffen<br />
Boehning studierte Kulturwissenschaft, Philosophie,<br />
Kunstgeschichte und arbeitete ausschließlich als Graphikdesignerin,<br />
als das Literarische Colloquium Berlin ihre<br />
Texte zur Autorenwerkstatt Prosa annahm. Es folgten die<br />
Teilnahme beim Open Mike und das Alfred-Döblin-Stipendium<br />
der Akademie der Künste.<br />
Boehning dreht in ihren Texten Merkwürdigkeiten,<br />
die ihr als Graphik-<strong>Design</strong>erin begegnen, gern »ein<br />
Schräubchen weiter«: Evis Tochter Nele lebt als Turnschuh-<br />
<strong>Design</strong>erin in den USA. Ihre Diplomarbeit beschäftigt<br />
sich mit einer Art ziviler Tarnkleidung aus »Mimikry-Stoffen«,<br />
die ihren Träger hinter dem Stoff zurücktreten und<br />
verschwinden lassen soll, »als trage jemand die zu ihm<br />
passende Welt mit sich herum«. Als Nele an der Entwicklung<br />
einer ›transparenten‹ Turnschuh-Marke mitwirken<br />
soll, die über ihr scheinbares Nicht-Vorhandensein, »ihre<br />
vollkommen unauffällige, nicht bewusst wahrnehmbare<br />
Allgegenwart« ihren Weg an die Füße der Konsumenten<br />
finden soll, macht sie Schluss mit dem »Leben ohne Ankommen«<br />
und nimmt an Stelle ihrer Mutter die Suche<br />
nach Großvater und Gemälde auf. Diese seien die eigentlich<br />
»lichten Stoffe«, die Boehning als »Fäden, die schnell<br />
reißen, aber eigentlich überall vorhanden sind zwischen<br />
Menschen, innerhalb der Familie« beschreibt. Dort, wo sie<br />
»eigentlich am stärksten sein sollten, sind sie am lichtesten,<br />
am durchsichtigsten.«<br />
Lügen oder getarnte Turnschuh-Marken werden zur<br />
Wahrheit, »weil jemand sie glaubt«. Schließlich erfindet<br />
auch Nele eine Lüge, die zur Wahrheit wird, weil ihre<br />
Mutter sie glaubt. »Kunst kann mehr transportieren als<br />
Menschen aussprechen«, sagt Boehning. So spricht der Roman<br />
nicht mehr nur von Turnschuhen und totgeschwiegenen<br />
Vätern, sondern von Kunst und Literatur: Lügen,<br />
die die Wahrheit sprechen.<br />
Die impressionistisch leichte und schwebende Erzählweise<br />
erhellt in Vor- und Rückblenden immer genau<br />
so viel, wie notwendig ist, um eine sirrende Spannung<br />
aufrecht zu erhalten. Am Ende wundert man sich beinahe,<br />
dass aus all den einzelnen, fragilen Lichtzipfeln seiltänzerisch<br />
sicher und scheinbar mühelos ein vollständiges Bild<br />
der Geschichte entstehen konnte, das tatsächlich einem<br />
Degas-Gemälde gleicht: Eine Geschichte, die »sich auflöst,<br />
um sich zugleich spüren zu können.«<br />
»Lichte Stoffe« von Larissa Boehning,<br />
Eichborn, Berlin 2007, 324 S., € 19,95<br />
Fliehe den Pfad.<br />
mark z. danieleWskis »Das<br />
Haus. House of Leaves« ist ebenso<br />
Anleitung zum nichtlinearen<br />
Lesen wie virtuose Postmoderne-<br />
Parodie<br />
text: jochen werner<br />
»Unerachtet der prosaischen Aufklärung musste ich doch<br />
noch immer, vorübergehend, nach dem öden Hause hinschauen,<br />
und noch immer gingen im leisen Frösteln, das<br />
mir durch die Glieder bebte, allerlei seltsame Gebilde von<br />
dem auf, was dort verschlossen.«<br />
e. t. a. hoffmann<br />
»In every dream home a heartache.«<br />
roxy music<br />
und so lässt Danielewski die Erzählung von »Das Haus. House of Leaves« in zahlreiche Nebenstränge mäandern,<br />
die sich um sein enigmatisches Zentrum herum verknoten. Dieses Zentrum, daran besteht im Grunde<br />
niemals ein Zweifel, ist leer. Muss leer sein. »Das Haus. House of Leaves« ist ein Roman über Architektur und<br />
über das Nichts und wie sich die erstere über das zweitere legt und so den Anschein erweckt, aus dem Nichts<br />
ein Etwas zu schaffen. Danielewski erzählt, wie sich die Leere, das absolute<br />
Abhandensein, ihren Platz in den unsichtbaren Zwischenräumen<br />
unserer Leben neu erobert; wie sie sich, wo ihre Existenz erst einmal<br />
(an)erkannt wird, in ihrer eigenen Logik verzweigt und verästelt und<br />
immer umfassender wird, werden kann, weil sie nicht mehr an den Rahmen<br />
der Veräußerung gebunden ist. Die einzige Logik, der das Haus in Danielewskis Buch folgt, ist die des Regelwerks<br />
seiner individuellen Kombinatorik. Überdies ist »Das Haus. House of Leaves« aber auch eine furiose<br />
Parodie auf die Systematisierungsversuche des Nicht-Systematischen durch die Glätter und Schubladendenker<br />
von academia. Jede Fußnote darin, so sie nicht wieder auf einen ganz eigenen Nebenpfad führt und so den<br />
›Gegenstand‹ des Buches – gewandet in die Mimikry eines durch viele Hände gewanderten, von, keineswegs<br />
vertrauenswürdigen Autoren, Redakteuren und Kopisten durchgearbeiteten und in der Textwelt noch einmal<br />
verdoppelten Manuskriptes – für Dutzende von Seiten fast völlig im Stich lässt, verspottet jene Leser, Deuter<br />
oder Sortierer, die ein Sinnzentrum, einen decodierbaren Kern eines Romans erwarten oder ihn dort zu erkennen<br />
glauben, wo er per definitionem fehlen muss. Somit muss Danielewskis Buch auch so umfangreich<br />
sein, wie er es geschrieben hat – müsste im Grunde noch viel länger sein, müsste sich ebenso wie die Flure des<br />
Hauses in unendliche Weiten erstrecken, sich zusammenziehen und ausdehnen, erzählte Zeit wie Erzählzeit<br />
gleichermaßen falten, und irgendwann den Leser – den Bewohner dieses Romans – einfach verschlucken. 172<br />
Edgar Allan Poe, E. T. A. Hoffmann, Sigmund Freud,<br />
Jacques Derrida, Daniel Myrick, Eduardo Sánchez,<br />
Stephen King, Rainer Maria Rilke, Stanley Kubrick,<br />
W. J. T. Mitchell, Roland Barthes, Jorge Luis Borges,<br />
Und dabei müsste es rein gar nichts sagen, müsste nur Räume öffnen und schließen. Weil dies jedoch ein nicht<br />
erfüllbares Ideal für einen Konzeptroman dieses Zuschnitts darstellt, kommt Danielewski um eine Erzählung<br />
doch letzten Endes nicht ganz herum. Die minutiöse, dokumentarisch-protokollarische Nacherzählung des<br />
an »The Blair Witch Project« gemahnenden, fiktiven Dokumentarfilms »The Navidson Record« ordnet »Das<br />
Haus. House of Leaves«, das doch so gerne Antithese zur Erzählliteratur wäre, letztlich dann doch nur einem<br />
Genre zu: dem Schauerroman. Stephen King für Literaturstudenten. Zwischen diesen beiden Polen seiner<br />
Arbeit, in den unendlichen, schweigenden Zwischenräumen geht letztlich auch der Autor selbst verloren, was<br />
nur zu einem Schluss führen kann: »Das Haus. House of Leaves« ist mehr Spielzeug als Literatur, und<br />
172 Natürlich ist eines der grundlegenden Verfahren der Popliteratur – und wir wollen einmal davon ausgehen, dass es sich bei<br />
Danielewski um einen Pop-Autoren handelt – das schlichte Vollschreiben von Seiten. Egal, womit. Alles ist gleich viel wert.<br />
Nichts anderes verbirgt sich hinter der jüngst florierenden Listen-Literatur, und nichts anderes rechtfertigt das endlose Verzetteln<br />
in Aufzählungen, Fußnoten, Quellenangaben, mittels derer Danielewski seine Geschichte buchstäblich in Stücke schießt. 173<br />
173 Aber ebenso selbstverständlich verbirgt sich hinter dieser Methode eine schiere Finte eines<br />
Autors, der so dem Zwang entgeht, etwas zu sagen zu haben. Immer ist da ein Wall von Ironie, der<br />
zwischen Text und Gegenstand einerseits bzw. Text und Leser andererseits treten kann. Um zwischen<br />
den Fußnoten und den Fußnoten zu den Fußnoten175 nicht verloren zu gehen wie die Protagonisten<br />
in den endlos verzweigten Zwischenräumen ihrer eigenen vier Wände176 , bedarf es schon eines<br />
überwältigenden schriftstellerischen Talentes, über das Danielewski eher nicht verfügt. 174<br />
174 Dafür ist er ein furioser Handwerker und ein virtuoser Taschenspieler. Auf den immerhin über 800 Seiten von »Das Haus.<br />
House of Leaves« verblüfft er immer wieder mit formalen Spielereien, die seinen Roman durchaus zu tragen vermögen.<br />
175 Vgl. ebd.<br />
176 Ist nicht aber das des Ziel des Romans? 177<br />
177 Macht das wirklich einen Unterschied?<br />
»Das Haus. House of Leaves« von Mark Z. Danielewski,<br />
aus dem Amerikanischen von Christa Schuenke,<br />
Klett-Cotta, Stuttgart 2007, 827 S., € 29,90<br />
48 1 worte<br />
worte 1 49
»Wir müssen<br />
uns nur<br />
wieder<br />
entschnüren«<br />
jonathan meese ist mutter parsival – Performance an der Deutschen Stattsoper in Berlin am 16.3.2005<br />
jonathan meese über ein Leben<br />
im Spiel, die Diktatur der Kunst und<br />
den revolutionären Druck der totalen<br />
Veränderung<br />
text, interview: kerstin roose<br />
fotos: jan bauer / courtesy contemporary fine arts, berlin<br />
Seit 2004 bist du immer wieder an der Volksbühne tätig.<br />
Was bedeutet es für dich, gerade an diesem Haus zu<br />
arbeiten?<br />
Für mich ist das ein familiäres Energiezentrum. Da sind<br />
Leute, die ich mag. Ich kenne die, ich finde die toll. Ich<br />
habe da niemanden kennen gelernt, den ich nicht mag.<br />
Niemanden! Das gibt es nicht, weil das ja Leute sind, die<br />
an einer großen Sache arbeiten. Das ist auch in der Kunst<br />
selten zu finden, weil es dort so vereinzelt ist. Ich habe<br />
Glück gehabt, dass ich damals von solchen Leuten angesprochen<br />
wurde. Und man muss weitermachen. Man hat<br />
da angeheuert, wie auf einem Schiff und jetzt fährt man<br />
durch die Meere. Ich finde es gut, wenn man bei seinen<br />
Figuren bleibt.<br />
Könntest du rückblickend deine Begegnung mit »De Frau«<br />
beschreiben?<br />
Das war für mich ein ultimatives Kunstgeschehen. »De<br />
Frau« war die Diktatur der Kunst. Und für mich dieses<br />
Jahr das ultimative Kunstwerk – und auch für alle Zeiten,<br />
das ist nicht mehr weg zu diskutieren. Ich war auch nicht<br />
wirklich ein Regisseur. Für mich war das wie so ein Tierbabyzoo.<br />
Wie eine Insel, wo man sich getroffen hat, die<br />
geheimnisvolle Insel des Dr. No, und dort waren acht Statuen,<br />
die haben miteinander gespielt.<br />
Du meinst im wahrsten Sinn des Wortes, im<br />
ursprünglichen Sinn von ›spielen‹?<br />
Absolut. Die Kritiker konnten damit gar nicht umgehen.<br />
Das verstehen die gar nicht.<br />
0 1 bilder<br />
bilder 1 1
jonathan rockford (don‘t call me back) – Solo show in the Appel Museum, Amsterdam, Netherlands, 2007<br />
Im Feuilleton wurde der Inszenierung teilweise der<br />
Stempel eines ›Kindergeburtstages‹ aufgedrückt. Wie<br />
reagierst du auf solche Wertungen?<br />
Ich finde es langweilig. Weil es das auch nicht ist. Das ist<br />
die allererste Schicht im Bonbon. Die ist aber ganz dünn.<br />
Wenn du die weglutschst, dann kommt sofort etwas ganz<br />
anderes zum Vorschein. Und ich glaube, davor haben die<br />
Leute Angst. Das dreht nämlich alles um, das ist ein Paradigmenwechsel.<br />
Im Grunde genommen ist es gefährlich.<br />
Ein Kind zu sein, heute, in dieser Zeit, ist wahnsinnig gefährlich.<br />
Das merken die Leute und deshalb wollen die das<br />
auch nicht. Die sind selber so versteinert und verknöchert,<br />
die peilen auch nicht, dass man da einfach auf die Bühne<br />
geht und loslegt. Die denken, das ist geplant, strukturiert,<br />
das hat ein Ziel, einen Anfang, ein Ende, das ist Kindertheater,<br />
Kasperletheater. Stimmt ja auch! Aber das ist doch<br />
super. Was ist schöner als Kasperletheater oder Kindergeburtstag?<br />
Das ist so ernst und so herrlich, wundervoll,<br />
charmant und präzise. Da wird ein Jahr wieder neu eingeläutet:<br />
neues Spiel, neues Glück. Man selbst setzt wieder<br />
alle Hebel in Gang. Die Fahrt geht los, man nimmt Fahrt<br />
auf und manche Leute peilen das nicht. Aber das ist ihr<br />
Problem, es wird sie wegschwemmen, in ihre eigene Erstarrtheit.<br />
Mit diesem Wagnis des freien Spielens riskiert man sehr viel.<br />
Man macht sich damit auch sehr verletzbar.<br />
Ja, das stimmt. Deshalb bin ich auch sehr erschöpft. Das<br />
begreifen die Leute aber immer gar nicht. Ich bin wahnsinnig<br />
erschöpft. Aber das gehört auch dazu, das muss<br />
man sich gönnen.<br />
Woher kommt dennoch diese hypnotisch wirkende Energie,<br />
mit der du deine Arbeiten, die Performances betreibst?<br />
Ich glaube an die Revolution der Kunst. Und da kann man<br />
so frei aufspielen. Da kann man einfach Dinge machen,<br />
die man sonst nicht machen kann, da kann ich alles machen.<br />
Das wird nur nicht mehr erlaubt. Natürlich wird es<br />
erlaubt, aber man muss es sich fast schon mit Waffengewalt<br />
holen. Es ist so weit weg.<br />
Aber wird dir nicht mittlerweile relativ viel erlaubt? Weil<br />
du dich als Künstler oder auch als Jonathan Meese etwas<br />
weniger im normativen Korsett des realen Alltags bewegst?<br />
Ja, das stimmt. Ich find das auch super. Ich weiß auch nicht,<br />
wie es dazu gekommen ist. Aber das ist auch sehr anstrengend.<br />
Man soll immer in die Realität gezogen werden. Die<br />
Leute wollen mich immer wieder so anketten oder mir<br />
dann sagen, dass das alberner Scheiß ist. Natürlich ist das<br />
alberner Scheiß, aber was soll es denn sonst sein? Das ganze<br />
Leben ist ein alberner Dreck, so wie es gelebt wird heute.<br />
Wie leben denn die Menschen? Das ist doch Wahnsinn:<br />
totale Bevormundung, die Leute fühlen sich frei, sind aber<br />
komplett unfrei. Das Gefühl wird den Leuten die ganze<br />
Zeit vermittelt, keine Frage, aber wie dann letztendlich<br />
gelebt wird, dass ist eine ganz andere Sache.<br />
Ist es nicht auch nachvollziehbar, dass man sich aus<br />
gewissen Ängsten heraus bestmöglich in seinem kleinen<br />
realen Leben einrichtet?<br />
Doch. Aber das kann man sagen. Man kann das mal auf<br />
den Tisch bringen. Ich habe auch wahnsinnig viel Angst.<br />
Gerade – kurz bevor ich dich getroffen habe – habe ich<br />
gedacht, das Schlimmste ist die Angst. Uns wird so eine<br />
wahnsinnige Angst gemacht. Aber Angst vor Spielen brauchen<br />
wir nicht zu haben.<br />
Dann bildet das Spiel, die Kunst für Dich auch so etwas wie<br />
einen Schutzraum?<br />
Absolut. Da können wir auch Angst haben, aber wir wissen,<br />
dass diese Angst uns nichts anhaben kann. Das ist einfach<br />
ein wunderbarer Sandkasten. Kunst ist eh Spielzeug.<br />
Auch jemand wie Hitler ist in der Kunst ein Spielzeug. Alles<br />
ist ein Spielzeug: Wasser, ein Lolli, Scheiße – und das<br />
kannst du mischen und manschen, wie du willst. Du tust<br />
damit auch niemandem weh. Niemandem! Wer sich dort<br />
provoziert fühlt, hat selbst ein riesiges Problem. Denn die<br />
Kunst ist doch gerade dieser Ort. Man muss es sich ja nicht<br />
angucken.<br />
Lässt sich die Realität derart von ihren bösen Geistern<br />
reinigen?<br />
Absolut. Die reinigt sich nur durch den Katalysator Kunst.<br />
Und die Kunst ist mächtiger als die Realität. Und ich glaube,<br />
sie wird sie auch irgendwann ersetzen, das ist dann die<br />
Diktatur der Kunst. Wenn die Diktatur der Kunst herrscht,<br />
wenn die Kunst größer ist, so groß, dass die Realität weggedrängt<br />
wurde, dann wird eine neue Gesellschaftsordnung<br />
existieren.<br />
In welcher Gesellschaftsordnung würde man dann leben?<br />
Im Spiel. Im Grunde genommen lebt man erst dann wirklich.<br />
Wir sind noch in so einer Zwischen- oder Vorform.<br />
Wir denken immer, wir leben. Aber wir vegetieren. Die<br />
meisten. Ich auch. Wir vegetieren alle. Wir hängen alle<br />
am Tropf der Realität, dieser einen einzigen, bitteren<br />
Realität. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten. Wir<br />
müssen unsere Chance nutzen. Wir haben uns selbst so<br />
abgeschnürt, alles. Wir müssen uns nur wieder entschnüren,<br />
das ist nicht so schwierig. Da kann man helfen (lacht).<br />
Man hat noch nichts verloren. Und die Kunst kann das<br />
regeln. Wenn ich also meine zugeschnürte Hand in die<br />
Kunst lege, dann wird sich das aufweichen, dann wird wieder<br />
Blut fließen können, dann wird wieder Stoffwechsel<br />
passieren. Das kann ich aber nicht in der Realität. Wenn<br />
ich mich zu sehr in der Realität aufhalte und glaube, dass<br />
das das Heilmittel ist, dann werde ich immer verkrampfter,<br />
ich werde mich immer mehr zuschnüren. Weil diese<br />
Realität wie ein Raum ist, der immer enger wird. Wie in<br />
diesen Horrorfilmen. Und irgendwann mal, da wirst du<br />
zu so einem kleinen Würfel zerdrückt. Dann bist du Würfelzucker.<br />
Für irgendwelche miesen Typen. Und das muss<br />
man nicht sein.<br />
Kannst Du das noch genauer erklären, also wie man<br />
sich die Ablösung vom Tropf der Realität durch die Kunst<br />
vorstellen kann?<br />
Im Grunde genommen ist das wie zwei Höhleneingänge.<br />
Bislang sind die Menschen immer nur in die eine Höhle<br />
gegangen und da ist alles zertrampelt, da ist überhaupt<br />
kein Spielraum mehr. Komischerweise sind sie trotzdem<br />
nie in die andere Höhle gegangen. Oder nur ein ganz<br />
kleines bisschen. Oder nur ganz wenige. Und das ist nicht<br />
schwierig, das ist auch nichts Besonderes. Du brauchst<br />
keine Fähigkeiten, um da rein zu gehen. Du musst es nur<br />
machen. Aber komischerweise gibt es diese eine Höhle,<br />
wo noch fast niemand drin war. Da muss man einfach<br />
reingehen. Das ist die Höhle namens Kunst. Und die ist<br />
wahrscheinlich fünf Milliarden – Tausend – Trillionen mal<br />
größer als diese eine Realität, die wir haben. Das ist aber<br />
kein Paralleluniversum.<br />
Kein Paralleluniversum, aber in welchem Verhältnis stehen<br />
diese zwei Höhlen zueinander?<br />
Die eine ist zertrampelt, überfüllt und so uncharmant,<br />
problematisch und wichtig geworden. Das ist die, in der<br />
wir uns gerade befinden. Da können wir nur noch ohnmächtig<br />
werden, weil wir keine Luft mehr zum Atmen<br />
haben. Das andere ist der revolutionäre Druck der totalen<br />
Veränderung. Das ist die andere Höhle. Die sagt eigentlich<br />
nur:»Es kann und es wird sich total verändern.« Das ist wie<br />
eine Botschaft. Die kommt aber nicht von mir, die kommt<br />
von der Höhle. Die Höhle sagt: »Ihr seid alle willkommen<br />
und hier, in dieser Höhle, kann gespielt werden.« Aber<br />
wir gehen auf dieses Angebot nicht ein, zumindest wenige<br />
und zu wenige. Das ist schade. Ich kann das auch nicht<br />
richtig erklären, weil ja noch niemand in der Höhle war.<br />
Aber ich habe schon mal reingeguckt, das kann ich schon<br />
zugeben. Und ich war auch schon ein paar Schritte drin.<br />
Und bist Du umgekehrt? Oder wurdest Du wieder raus<br />
gesogen?<br />
Ich wurde raus gesogen, ja. Meine Befindlichkeit ist auch<br />
noch zu groß. Da ist noch zuviel Ich. Aber das ist auch okay,<br />
wir sind halt so: Menschen. Aber zum Beispiel jemand wie<br />
Captain Ahab, also bestimmte Figuren aus bestimmten<br />
Büchern, die sind in der Höhle drin.<br />
Das klingt für mich doch eher nach einer Parallelwelt.<br />
Ja, aber irgendwann wird diese Parallelwelt so stark, dann<br />
wird sie die Gesetze für die reale Welt formulieren. Aber selber.<br />
Das ist wie Risse in der Höhle, und dann wird ein Austausch<br />
stattfinden. Die können wir aber nicht bauen, die<br />
Risse. Die können wir nicht selber erzeugen. Wir können<br />
nur spielen und hoffen, dass diese Risse sich selbst bilden.<br />
Das komplette Interview unter www.goon-magazine.de<br />
jonathan meese, 1970 in Tokio geboren, lebt und arbeitet in<br />
Berlin und Hamburg. Neben zahlreichen Ausstellungen und<br />
Performances weltweit ist er seit 2004 immer wieder auch an<br />
der Berliner Volksbühne tätig. Dort hat er die Bühnenbilder zu<br />
Frank Castorfs Inszenierungen »Kokain« und »Die Meistersinger«<br />
entworfen und mit »De Frau« seine erste Regiearbeit<br />
präsentiert. Im Februar 2008 wird er erneut als Bühnenbildner<br />
an Frank Castorfs »Faust«-Inszenierung beteiligt sein.<br />
2 1 worte<br />
worte 1 3
performativ text: astrid hackel<br />
Mit der Parole »Kampnagel besetzen!« hat Amelie Deuflhard,<br />
die Ex-Chefin der Berliner Sophiensæle, nicht nur<br />
die Weichen für die einstige Topadresse unter den Off-<br />
Spielstätten, eine ehemalige Maschinenfabrik in Hamburg,<br />
neu gestellt – sie macht mit der Anspielung auf die<br />
lange Tradition der Hamburger Hausbesetzungen, wie die<br />
der Roten Flora oder der Hafenstraße, auch auf die lokale<br />
Verankerung einer international arbeitenden Institution<br />
aufmerksam. Poppig, punkig und politisch ist die neue<br />
Website, aber auch global, diskursiv und interdisziplinär.<br />
Statt klassisch-konventioneller Buttons gibt es auf WWW.<br />
kampnagel.de originell-verquere Foren wie »Bühne<br />
und Beute«, »Treibstoff Wissen«, »Meins/Deins« und »Musicflash«.<br />
Deuflhard und ihr Team setzen auf einen radikalfulminanten<br />
Neubeginn und gleichzeitig auf Kontinuität:<br />
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit freien Gruppen wie<br />
She She Pop oder Showcase Beat le Mot soll fortgesetzt<br />
werden; die wichtigste Aufgabe sieht Deuflhard jedoch<br />
nach wie vor darin, neuen, talentierten KünstlerInnen<br />
Räume zu eröffnen und Koproduzenten für ihre Arbeiten<br />
zu finden. Der Berliner Regisseur David Marton ist so eine<br />
Entdeckung. Seine vielgelobte, musikalische Adaption<br />
»der feurige engel« nach einem Roman von Valeri<br />
Brjussow steht Mitte Dezember auf dem Programm.<br />
Marton konfrontiert eine im 16. Jahrhundert spielende<br />
Geschichte über Hexen und Dämonen mit der Gegenwart<br />
und fragt nach den Möglichkeiten, die unvorhersehbaren<br />
Momente als Zufall oder Fügung ins Leben zu integrieren.<br />
Es sind diese auf das antike Theater zurückverweisenden<br />
Konflikte, die immer wieder neu theatralisiert und aktualisiert<br />
werden, weil sie eine menschliche Grunderfahrung<br />
widerspiegeln. Die Regisseurin Britta Schreiber nimmt<br />
sich in Braunschweig gerade »us amok« vor, ein Stück<br />
über den ›Unabomber‹ Theodore Kaczynski, dessen Briefbombenattentate<br />
in den USA zwischen 1978 und ’9 für<br />
Schlagzeilen sorgten. Dessen Autor, Marc Becker, interessierte<br />
unter anderem genau dieses Moment: dass da ein<br />
hochbegabter Mathematikprofessor seinen Dozentenjob<br />
David Marton »Der feurige Engel«<br />
© David Baltzer<br />
aufgibt und seine Wohnung verlässt, um in den Tiefen<br />
der Wälder von Montana ein sehr einfaches, quasi vorindustrielles<br />
Leben zu führen. Bei Becker fungiert es als<br />
eine Art Folie für die Identitätssuche von vier jungen, mit<br />
der Gesellschaft irgendwie unzufriedenen Leuten, die am<br />
Ende des Stücks kurz vor der Entscheidung stehen, eine<br />
radikale Veränderung, eine Explosion herbeizuführen.<br />
Nach Antworten auf die gesellschaftlichen Probleme<br />
suchten auch die jungen Aktivisten der RAF. Diese stand<br />
zu Beginn der Spielzeit, als sich der so genannte Deutsche<br />
Herbst zum dreißigsten Mal jährte, nicht nur in Zeitungen<br />
und Fernsehen, sondern auch auf den Bühnen im Mittelpunkt.<br />
Ein Gros der Dramentexte fokussiert die Gesichter<br />
der RAF, allen voran Ulrike Meinhofs. Auch sie verkörpert<br />
eine radikale Wandlung – von der emanzipierten konkret-<br />
Journalistin zur Untergrund-Terroristin. »der tod des<br />
eichhörnchenmenschen« von Mal /gorzata Sikorska-Miszcuk<br />
ist ein Stück über Ulrike Meinhof. Marcin<br />
Liber brachte es zusammen mit dem Teatr ustausta/2xu<br />
aus Polen zur Uraufführung. In dem rasanten »Bühnencomic«<br />
(HAU) werden nicht nur Fragen nach Gut oder Böse<br />
und der Legitimität von <strong>Gewalt</strong> gestellt, es geht auch um<br />
die Machart von Nachrichten und wie durch sie Wirklichkeit<br />
konstruiert wird. Liber setzt auf den Wechsel schneller<br />
Spielszenen mit Foto- und Videomaterial aus den 1970er<br />
Jahren und der Gegenwart. Im Zusammenspiel mit electronoise<br />
und deutlicher Symbolik ergänzen Pop, Punk und<br />
Politik Libers diskursiv-analytische Formsprache.<br />
»Der feurige Engel«, Regie David Marton, 19., 20., 21.12.,<br />
Kampnagel Hamburg<br />
»US Amok« von Marc Becker, Regie: Britta Schreiber, 6.,<br />
7., 12., 19. und 27.12., Staatstheater Braunschweig<br />
»Der Tod des Eichhörnchenmenschen« von Malgorzata Sikorska-<br />
Miszcuk, Regie: Marcin Liber, 14., 15.12., HAU 3, Berlin<br />
Anleitung zur<br />
deutsch-polnischen<br />
Versöhnung<br />
adam olscheWskis Debütroman<br />
überzeichnet interkulturelle<br />
Liebesbeziehungen<br />
text: agnieszka mucha<br />
Deutsche Männer sind attraktiv, arbeitsam, dröge. Polnische<br />
Frauen gutaussehend, feierfreudig, arbeitsscheu,<br />
unschlagbar: Obwohl wir wissen, dass alles nur konstruiert<br />
ist, bestimmen vereinfachende Stereotype unsere<br />
Wahrnehmung.<br />
In seinem Debütroman »Ewa« bedient sich Adam<br />
Olschewski dieser Vorurteile, um einen erschreckenden<br />
»Kampf der Geschlechter und Kulturen« zu zeichnen.<br />
Protagonisten sind die junge Polin Ewa und ihr Lebensgefährte,<br />
der Deutsche Rainer. Die beiden lernen sich auf einer<br />
Zugfahrt kennen, als Ewa einen Kellner zur Schnecke<br />
macht, weil es im Bordrestaurant kein Aspirin mehr gibt.<br />
Da hilft ihr Rainer, selbstlos wie er ist, mit einer Schmerztablette<br />
aus. Statt sich einfach zu bedanken, fühlt sich<br />
Ewa herausgefordert und nervt Rainer, bis er sich mit ihr<br />
unterhält. Auf Seite 90 ist sie schon bei ihm eingezogen,<br />
und während er arbeitet, fährt sie mit seinem Benz zum<br />
Einkaufen oder liegt, eingelegte Gurken und Schokolade<br />
essend, vor dem Fernseher. Alles könnte wunderbar sein,<br />
bliebe da nicht langsam die Liebe auf der Strecke.<br />
Blitzschnell, in rasanter Sprache erzählt der 1966 in<br />
Polen geborene und in Deutschland lebende Journalist Olschewski<br />
die Geschichte einer sich stetig intensivierenden<br />
Hassliebe, die in Spott und Verachtung mündet. Virtuos<br />
wechselt er die Personenrede: der Liebesroman wird zum<br />
Thriller. Die furiose Ewa verwandelt sich in Barb Wire,<br />
Inbegriff des Kitsch und der trashig-weiblichen Heldenperson.<br />
Rainer ist nicht schuld, aber das ihm fehlende<br />
Östrogen. »The Story of Us« in Hardcore-Version. Die Gegensätze<br />
zwischen Polen und Deutschen sind nur eine der<br />
die Realität regierenden Dichotomien, deren Ausgangspunkt<br />
der scheinbar unüberbrückbare Gegensatz der<br />
Geschlechter ist. Konstruierte Klischees finden in diesem<br />
Roman auf allen Ebenen ihre Widerspiegelung.<br />
»Ewa« von Adam Olschewski, Rogner &<br />
Bernhard, Berlin 2007, 343 S., € 19,90<br />
Drei Sommer später<br />
Weil man nie ganz dahinter steigt:<br />
roman simićs »In was wir uns verlieben«<br />
text: astrid hackel foto: christian kortüm<br />
Sie atmen schwere, nasse Erde und alte Häuser oder Parfüm<br />
und Formalin, die Geschichten des kroatischen Autors<br />
Roman Simić. Leise Geschichten über Menschen, die<br />
ein Stück ihrer Bodenhaftung verloren haben und deren<br />
Gedanken, paralysiert von fremd gewordenen Kindheitserinnerungen,<br />
unablässig um ein leeres Zentrum kreisen,<br />
aus dessen unergründlichen Tiefen ab und zu ein metaphysisches<br />
Problem aufsteigt. »Ich stelle mir bisweilen vor,<br />
dass wir jede Erinnerung wieder zurückholen können, so<br />
wie eine Fotografie, die [...] erst drei Sommer später zur Entwicklung<br />
gegeben wird.«<br />
Simićs Erzählungen beziehen gerade aus der Langsamkeit,<br />
den fehlenden Worten und der Tatsache heraus,<br />
dass man nie ganz hinter die Handlung und ihre Protagonisten<br />
– die Voraussetzungen, den Ist-Zustand, die Möglichkeit<br />
einer Lösung – steigt, ein enormes Tempo. Ihm<br />
gelingt es, Alltägliches als ein Konglomerat aus Absurdität<br />
und Tragik, Nähe und ironischer Distanz zu schildern. Der<br />
Leser wird zum unfreiwilligen Zeugen einer privaten Auseinandersetzung,<br />
die keiner verbalen Äußerung bedarf<br />
und sich wie zufällig vor seinen Augen abspielt, als säße<br />
er als Anhalter bei Roko und seinem Vater oder bei den<br />
jungen Liebenden mit im Auto, die sich gerade gegen ein<br />
Kind entschieden haben, weil sie selbst kaum über die<br />
Runden kommen. Doch man spürt aus jeder zähen Sekunde,<br />
die verstreicht, wie schlecht es sich anfühlt und wie<br />
wenig sie sich gegenseitig dabei helfen können, mit dem<br />
Verlust fertig zu werden.<br />
»In was wir uns verlieben« versammelt Liebesgeschichten<br />
im weitesten Sinne, weil jede einzelne Geschichte<br />
diese Frage impliziert und variiert, wodurch die Liebe zu<br />
einer universellen Metapher für die Daseinsberechtigung<br />
jedes Einzelnen wird.<br />
»In was wir uns verlieben« von Roman Simić, aus dem<br />
Kroatischen von Alida Bremer, Buch mit Audio-CD, Voland<br />
& Quist, Dresden und Leipzig 2007, 224 S., € 18,90<br />
4 1 worte<br />
worte 1<br />
ADAM OLSCHEWSKI<br />
Ewa<br />
Roman<br />
ROGNER & BERNHARD<br />
review
eview<br />
Ausbeutung von<br />
Fremdbiographien?<br />
In »Pazifik Exil« literarisiert michael<br />
lentz Literaten<br />
6 1 worte<br />
text: annika schmidt<br />
»Letzte Ausfahrt Heimat«<br />
hieß es in Michael Lentz<br />
erstem Roman »Liebeserklärung«<br />
(2003) metaphorisch.<br />
In seinem neuen,<br />
zweiten Roman »Pazifik<br />
Exil« wird diese Phrase variiert<br />
zur wortwörtlichen<br />
»letzten Ausfahrt, Amerika«.<br />
Denn den Figuren<br />
Bertolt Brecht, Franz<br />
Werfel, Lion Feuchtwanger,<br />
Arnold Schönberg,<br />
Thomas und Heinrich<br />
Mann bleibt angesichts<br />
des NS-Regimes nur das<br />
pazifische Exil. Lentz<br />
interessiert sich dort<br />
weniger für ihre faktische Lebens-, als vielmehr<br />
ihre mögliche Gedankenwelt. Denn »Geschichte<br />
ist Geschichte, und jeder hat seine eigene Version von ihr.«<br />
Und die Variante des Lyrikers Lentz ist natürlich kein<br />
Psychogramm, kein historischer Roman, kein politisches<br />
Engagement, sondern sprachbesessene wie sprachkritische<br />
Reflexion. In kühlem, verknapptem Duktus webt<br />
er unzählige Leitmotive in den Text, wechselt ständig<br />
die Erzählperspektive und umklammert den Roman mit<br />
einer lyrisch-mythologischen Allegorie. Die zentralen<br />
Themen Exil, Erzählen und Erinnern werden – ganz nach<br />
Walter Benjamins Methode des konstellativen Denkens<br />
– in immer anderen Zusammenhängen neu kombiniert,<br />
strapaziert oder gar destruiert. Die Künstler, ihre Lebensumstände,<br />
ihre Schriften bilden dafür lediglich den Hintergrund.<br />
Sie sind nicht Motiv, nur Material. Respektlos?<br />
»Ausbeutung von Fremdbiographien? Ja, was um Himmels<br />
willen soll ein Roman denn anderes sein?«, so Lentz’ Werfel.<br />
Vielleicht eine anständige chronologische Erzählung?<br />
Aber etwas von vorn nach hinten glatt durch zu erzählen,<br />
das ginge gar nicht, so Lentz’ Schönberg. Und Emotionalität<br />
hält sein Brecht schon für emotionale Erpressung. Und<br />
was Erzählen wissen soll, weiß sein Thomas Mann auch<br />
nicht. Die Figuren von Lentz wollen bei empfindsamer Erinnerungs-Trümmer-Literatur<br />
also einfach nicht mitspielen.<br />
Und das ist literarisch und gut so.<br />
»Pazifik Exil« von Michael Lentz, S. Fischer,<br />
Frankfurt am Main 2007, 463 S, € 19,90<br />
Kein Glück, aber ein<br />
roter Hut in Mexiko<br />
monika maron hat in »Ach Glück«<br />
die Geschichte von Johanna mit<br />
neuer Stringenz und gewohnter<br />
Sprachschönheit fortgesetzt.<br />
text: patrick küppers<br />
Schlimmer als ein Feind ist es manchmal, keinen Feind<br />
mehr zu haben. Monika Maron wurde bekannt mit Geschichten<br />
von Frauen, die sich gegen das System der Enge<br />
und Langeweile in der DDR auflehnen und doch darin<br />
leben müssen. Die DDR verschwand. Die große Freiheit<br />
hielt Einzug, und dennoch steht Johanna, in ihrer frischen,<br />
schlagfertigen Intelligenz ganz eine Maron-Figur,<br />
an einem völligen End- und Totpunkt ihrer Lebensbezüge<br />
und weiß nicht, wie ihr geschah. Diesen ennui hat Maron<br />
in dem verstörend richtungslosen Roman »Endmoränen«<br />
von 2002 beschrieben. »Ach Glück« schließt an dieses<br />
Buch an, und schon die kompositorische Stringenz macht<br />
hier eine neue Dynamik in Johannas Geschichte deutlich.<br />
Sie verlässt den allerkleinsten Kreis der Lebensgewohnheiten<br />
und wagt den Sprung ins Ungewisse. Um einer<br />
ihr persönlich unbekannten Frau auf einer vagen Suche<br />
zu helfen, fliegt sie nach Mexiko. Während des gesamten<br />
Buches sitzt Johanna im Flugzeug, liest Briefe und denkt<br />
nach. Unterdessen streift ihr Mann Achim ebenso durch<br />
Berlin wie durch seine Erinnerungen.<br />
Die wendige Ironie, die spröde Schönheit in der<br />
Schreibe Monika Marons lassen »Ach Glück« nie auch nur<br />
in die Nähe von platter Glücksformelliteratur geraten. Da<br />
ist einfach Johanna, die sich fragt, ob, wenn man versucht,<br />
sich neu zu erfinden, das Alter nicht egal ist. Ihre neunzigjährige<br />
unbekannte Freundin, die mit einem roten Hut in<br />
Mexiko auf sie wartet, hat es ihr vorgelebt.<br />
Und wir tun nichts lieber, als Johanna<br />
auf dem Weg dahin und darüber hinaus<br />
zu begleiten.<br />
»Ach Glück« von Monika Maron,<br />
S. Fischer Verlag, Frankfurt<br />
a.M. 2007, 224 S., € 18,90<br />
zensiert<br />
Feministische Hure<br />
virginie despentes übt Kritik am PorNo<br />
text: annika schmidt<br />
Die deutschsprachige Veröffentlichung von Virginie Despentes<br />
pro-pornographischem Essay »King Kong Theorie«<br />
erscheint gerade rechtzeitig. Denn die konservativ-feministischen<br />
Zeitschrift »Emma« startet zum dritten Mal<br />
– nach 1978 und 1988 – eine PorNo-Kampagne. Und<br />
natürlich muss in den Artikeln – neben Film, Musik und<br />
MySpace – die Mode mal wieder als Spiegel der angeblichen<br />
Pornographisierung der Gesellschaft herhalten.<br />
text: jochen werner foto: nici.cat – fotolia.com<br />
zensiert<br />
»sei unbesorgt ich werd wenn wir uns / wiedersehn an dir<br />
vorübergehen dem / blinden der sich vor mir bückt eine /<br />
liebe vor die füsse werfen« – um Verlust, Verlangen, Melancholie<br />
geht es häufig in den Gedichten des Münchner<br />
Lyrikers Albert Ostermaier. So scheint es dann auch nur<br />
folgerichtig, dass der Suhrkamp Verlag nun unter dem<br />
Titel »Für den Anfang der Nacht« eine Sammlung von Liebesgedichten<br />
aus insgesamt sechs zwischen 199 und 2006<br />
publizierten Lyrikbänden des Dichters (von »HerzVersSagen«<br />
bis »Polar«) vorlegt. Das schmale Bändchen ist in vier<br />
thematische Abschnitte gegliedert, umfasst insgesamt 83<br />
Gedichte – darunter auch neun bisher unveröffentlichte<br />
Texte – und bietet einen durchaus brauchbaren Einstieg<br />
in das Werk Ostermaiers. Zwar sind nicht alle ausgewählten<br />
Gedichte zu den größten Würfen des Dichters zu zählen,<br />
auch leidet manch ein Text an der Herauslösung aus<br />
dem konzeptuellen Kontext des Einzelbandes – und doch<br />
scheint es immer wieder unmöglich, sich der Sprachgewalt<br />
Ostermaiers zu entziehen. Dieser ordnet seine Zeilen in<br />
mehr oder minder symmetrischen, langen und schmalen<br />
So stört sich die Leiterin des Campus Verlags Annette C.<br />
Anton am Schlüpfer-Monopol des String-Tangas, denn<br />
ihr sei es wichtig, sich selbst auch in Unterwäsche »einen<br />
halbwegs würdevollen Anblick« zu bieten und nicht »wie<br />
eine Stripperin« auszusehen. Genau diese Verknüpfung<br />
von <strong>Sex</strong>arbeit und Würdelosigkeit bemängelt die Autorin<br />
des verfilmten Romans »Baise-moi« Despentes. Denn das<br />
einzige moralische Problem an Prostitution und Pornofilmen<br />
sei die gesellschaftliche Aggressivität, mit der die<br />
working girls behandelt werden würden. Es gebe einerseits<br />
die Nachfrage nach (Bildern von) willigen Frauen.<br />
Andererseits und paradoxerweise würden die Darstellerinnen<br />
unter dem Deckmantel des Schutzes der »Würde<br />
der Frau« gerade für die Befriedigung dieser Erwartungshaltung<br />
in einen Teufelskreis von Missbilligung, Schamgefühl<br />
und Stigmatisierung gedrängt. Eine tatsächliche Hilfe<br />
wäre nach Despentes weder das Verbot ihrer Tätigkeit<br />
noch die Zensur bestimmter sexueller Darstellungs- und<br />
Ausdrucksformen, sondern die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.<br />
Virginie Despentes möchte also, dass<br />
sich <strong>Sex</strong>arbeiterinnen von der »Einheitskategorie Opfer«<br />
im Besonderen und Menschen von festgeschriebenen<br />
Geschlechterrollen im Allgemeinen befreien. Sie erfindet<br />
die Queer-Theorie oder die »feministische Hure« (Carol<br />
Queen) nicht wirklich neu. Aber manches kann den Por-<br />
Nolern einfach nicht oft genug erklärt werden.<br />
»King Kong Theorie« von Virginie Despentes,<br />
aus dem Französischen von Kerstin Krolak,<br />
Berlin Verlag, Berlin 2007, 173 S, € 18,00<br />
gegen den wind deinem herzschlag zu<br />
review<br />
albert ostermaiers Liebesgedichte lassen die Sprache taumeln, aber nicht fallen<br />
Spalten an, durch die er seine Leser atemlos, ohne Punkt<br />
und Komma und mit sich stetig steigerndem Tempo hindurchtreibt.<br />
Hemmungslos emotionale Bilder auf der<br />
schmalen Grenze zum Kitsch verwebt er in waghalsige<br />
Reimschemata, die er immer dichter zuschnürt, bis die<br />
Sprache selbst ins Taumeln (aber nicht ins Fallen) gerät.<br />
Das macht ihn unter den Autoren der deutschen Gegenwartslyrik<br />
zum vielleicht entschiedensten Poeten.<br />
»Für den Anfang der Nacht. Liebesgedichte« von Albert<br />
Ostermaier, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2007, 138 S., € 6,00<br />
worte 1 7
eview<br />
Der reine<br />
Machiavelli<br />
panajotis kondylis’ Frühschrift<br />
zeigt den Renaissance-Denker als<br />
Produkt seiner Zeit und verzichtet<br />
auf die politische Nutzbarmachung<br />
text: andreas huth<br />
Zur großen Zahl von Machiavelli-Biographien<br />
und<br />
Interpretationen hat sich<br />
ein neues, aber nichts desto<br />
weniger interessantes<br />
Buch gesellt. Es stammt<br />
von dem Philosophen und<br />
Historiker Panajotis Kondylis<br />
und besticht durch<br />
seine kühle Brillanz und<br />
nüchterne Auseinandersetzung<br />
mit dem Leben des florentinischen Beamten<br />
und Gelehrten. Kondylis verfasste dieses Buch als<br />
23jähriger und obwohl er sich hier noch ganz am<br />
Anfang seiner Entwicklung befand, ist das Werk<br />
von großer Reife. Es vermeidet die so häufige<br />
Nutzung von Machiavellis Ideen für die aktuelle<br />
politische Situation und damit alle über die Renaissance<br />
hinausgehenden Interpretationen und<br />
stellt knapp, aber aufschlussreich die zeithistorischen<br />
Bedingungen dar, die das Werk Machiavellis<br />
prägen.<br />
Hier zeigt sich Kondylis, der 1948 in Griechenland<br />
geboren wurde, dort in seiner Jugend<br />
während der Diktatur wegen Mitgliedschaft in<br />
der kommunistischen Partei einige Jahre auf einer<br />
Gefängnisinsel zubringen musste und später zum<br />
Studium nach Deutschland ging, als eigenständiger<br />
Kopf, der anschaulich historische Fakten<br />
mit der wirtschaftlichen, geistigen und sozialen<br />
Entwicklung der Zeit verbindet. So ist beispielsweise<br />
seine Herleitung des ›neuen Geistes‹ in<br />
der Renaissance aus dem ab dem Anfang des 1 .<br />
Jahrhunderts dominierenden kaufmännischen<br />
Denken, aus dessen Umgang mit Zahlen, Mengen<br />
und nicht selbst produzierten, also abstrakter<br />
gewordenen Waren auch deshalb lesenswert, weil<br />
sie die üblichen geistesgeschichtlichen Muster<br />
ignoriert und die Ökonomie als wichtige Triebfeder<br />
auch von kulturellen Entwicklungen zeigt.<br />
»Machiavelli« von Panajotis Kondylis, aus dem<br />
Griechischen von Gaby Wurster, Akademie Verlag,<br />
Berlin 2007, 184 S. € 39, 80<br />
Die Mechanik der<br />
Manipulation<br />
Das Pendant der Psychoanalyse:<br />
edWard bernay’s »Propaganda«<br />
text: matthias penzel<br />
Original erschien »Propaganda«<br />
1928 in Amerika. Verfasst<br />
von einem Neffen Sigmund<br />
Freuds – Edward Bernays<br />
(1891 - 199 ) –, ist es mit seiner<br />
systematischen Darstellung<br />
von Öffentlichkeitsarbeit in<br />
unseren Alltag eingedrungen<br />
wie die Psychoanalyse. Sicht-<br />
und unsichtbar. Bernays<br />
trennt nicht groß zwischen Politik,<br />
Konsum, Kunst oder Wissenschaft,<br />
wenn er klarstellt,<br />
wie und vor allem warum die<br />
in diesen Bereichen Tätigen<br />
– Minderheiten – sich des Instrumentariums der PR bedienen<br />
müssen, um der Mehrheit zu vermitteln, warum sie sich für oder<br />
gegen Ideen, Produkte usw. entscheiden soll. Fast prophetisch<br />
stellt er fest: »Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir<br />
noch nie gehört haben« – im Supermarkt, beim Wählen von Politikern,<br />
Hobbies, Seife. Zu den Methoden der »Public Relations« (wie<br />
er sein Buch später umbenannte) gehört an erster Stelle der Wille,<br />
zu vermitteln, den Zirkel der Elite / Minderheit zu verlassen, um<br />
auf die Mehrheit Einfluss auszuüben, und zwar mit »neutralen Experten«,<br />
Erläuterung von möglichen Synergien, Mehrwert, mehr<br />
Lebensqualität für den Verbraucher. Wertungen interessieren<br />
ihn bei diesem Mehrwert wenig – wenn er erfrischend, aber auch<br />
kühl analytisch über das Image von Museen oder Politikern oder<br />
Macy’s spricht. Daher überrascht es nicht, dass er für den Ersten<br />
Weltkrieg warb, genauso wie für Zigaretten (als Symbol emanzipierter<br />
Frauen), die Erfindungen Thomas Edisons und Henry<br />
Fords. Manchem mag aufstoßen, wie sehr sich Bernays weigert zu<br />
werten, zugleich kann man das in manchen Bereichen als bittere<br />
Pille, die es in Demokratien zu schlucken gilt, sehen. Oder man<br />
kann sich erinnern, dass der Fließband-Erfinder Ford tatsächlich<br />
nicht nur auf Profitmaximierung aus war, dass die Zeiten wirklich<br />
anders waren. In einigem ist die non-emotionale Sprache Bernays,<br />
sein Predigen für die Begreifbarkeit, also eine Art Sinnlich-machen<br />
von Ideen und Gütern, der Weltsicht von Werbe-Textern sehr<br />
nahe. Auch dazu mag man stehen, wie man will – die Mechanik<br />
der Manipulation ist ohnehin in Gang, und dieses übersichtlich<br />
geschriebene Büchlein erinnert einen daran, dass das zwar nicht<br />
immer so war, dass das aber auch nicht erst durch Saatchi & Fernsehen<br />
so geworden ist.<br />
»Propaganda« von Edward Bernays, aus dem Englischen, Orange-Press,<br />
Freiburg 2007, 158 S., € 18,00<br />
In Thomas Meineckes interessant-theoretischem Roman<br />
musik, der nun auch als Taschenbuch vorliegt, kommt es<br />
zu einem Dialog zwischen zwei Anhängern unterschiedlicher,<br />
urbaner Musikstile: HipHop (Frage) und Jazz (Antwort):<br />
»Frage: Was hat das mit dem Leben in der Großstadt<br />
zu tun? Antwort: Wo kommst du her? Frage: Von der Straße.<br />
Antwort: Du meinst, du lebst auf der Straße? Frage: Nein,<br />
aber ich weiß, was auf der Straße los ist. Antwort: Wenn<br />
du das weißt, weißt du auch, daß man genau das meiden<br />
sollte. Frage: Mann, du bist nicht hip.« Eingebettet in die<br />
paradoxe Situation, dass hier der Fragende die Antworten<br />
gibt, während der Antwortende die Fragen stellt, wird ein<br />
Diskurs über den Sound der Großstadt aufgemacht. Im<br />
Vorbeigehen wird nach Authentizität, Eindeutigkeit, das<br />
wahrheitsgemäße Abbilden einer Metropole durch die<br />
Kunst, Geschlecht und Hautfarbe, also nach großstadtrelevanten<br />
Unterscheidungsmerkmalen gefragt. Literatur<br />
schafft, das zeigt sich hier, auf 2 Zeilen mehr zu sagen als<br />
jede gescheite, wissenschaftliche Anthologie.<br />
sound and the city heißt eine fingerdicke Abhandlung<br />
zum gleichen Thema. Es geht ihr in erster Kontur<br />
um zwei Dinge: Zum einen soll der Begriff ›Sound‹<br />
akademisch nutzbar gemacht werden. Es gilt ihn vom Geräusch,<br />
Klang und Laut abzugrenzen, also als etwas Hergestelltes,<br />
Manipuliertes und Künstlerisches zu definieren.<br />
Was in der leider oft zu umständlichen Schreibe so klingt:<br />
»Der Sound der Stadt ist künstlich und daher Provokation<br />
für Kunst, auch für Musik, die provozieren will, um im<br />
Fortschritt urbanen Denkens mit fortschreiten zu können.«<br />
Zum anderen soll die Stadt als Keimzelle der populären<br />
Kultur festgeschrieben werden. An dieser Stelle wäre es<br />
spannend gewesen, dem Übergeordneten des städtischen<br />
Sounds weiter nachzugehen, beispielsweise zu thematisieren,<br />
weshalb Musik, die stilistisch von Afroamerikanern<br />
geprägt wurde (HipHop, Soul, R&B) unter der Einordnung<br />
›Urban‹ rangiert oder überwiegend von Weißen<br />
geprägte Genres wie Country oder Folk Assoziationen des<br />
Ländlichen und Natursymboliken wachrufen. Ein Reader<br />
dieses Namens ruft ja genau solche Unterscheidungen her-<br />
text: sebastian hinz das dispositiv<br />
vor. Doch leider verlieren sich die Beiträge überwiegend<br />
im Spezifischen und hängen sich an ›Markenzeichen‹, wie<br />
dem Sound gewisser Städte zu gewissen Zeiten (Bsp. Geoff<br />
Stahl: »Musicmaking and the City. Making Sense of The<br />
Montréal Scene«, oder: Christian Manfred Stadelmeier:<br />
»Die Entwicklung der afroamerikanischen Blueskultur<br />
im urbanen Kontext – das Beispiel Chicago in den 1940er<br />
und 19 0er Jahren«): Was aus journalistischer Sicht eine<br />
interessante Geschichte sein kann, ist als akademischer<br />
Beitrag dann doch zu durchsichtig.<br />
Eine Ausnahme bildet Malte Friedrichs Aufsatz »Lärm,<br />
Montage und Rhythmus. Urbane Prinzipien populärer<br />
Musik«. Er erinnert daran, dass nicht bloß der Sound der<br />
Städte etwas Produziertes ist, auch die Stadt selbst wird<br />
nur noch »in eine reine Simulationswelt transformiert«.<br />
Friedrich fragt, wie diese auf den Sehsinn abzielende Umformung<br />
der Städte damit umgeht, dass die Stadt auch<br />
Ort des steten Musikkonsums geworden ist und appelliert<br />
an eine Kulturtechnik des Hörens, die in den Cultural<br />
Studies und Kulturwissenschaften aus Gründen des Aufwandes<br />
und der Nicht-Kompatibilität mit vorhandenen<br />
Theorien bislang ausgeklammert wurde: »Es kommt hinzu,<br />
dass Musik, genauso wie andere kulturelle Artefakte, in bestimmten<br />
sozialen Kontexten entsteht, in denen auch Codes<br />
bereitgestellt werden, über die überhaupt erst die Bedeutung<br />
des kulturellen Artefakts erzeugt werden kann. Diese Codes<br />
vorausgesetzt, kommt es zur Entstehung von bestimmten<br />
Bedeutungen einzelner Musikstücke, die sich auf die zu<br />
hörenden Klänge oder ihre Verweisstruktur beziehen und<br />
insofern bedeutungsgenerierend sind.« Wo wir wieder bei<br />
Thomas Meinecke wären.<br />
»Musik« von Thomas Meinecke, Suhrkamp,<br />
Frankfurt am Main 2007, 370 S., € 10,00<br />
»Sound and the City. Populäre Musik im urbanen Kontext«,<br />
herausgegeben von Dietrich Helms und Thomas Phleps,<br />
[transcript] Verlag, Bielefeld 2007, 166 S., € 16,80<br />
8 1 worte<br />
worte 1 9<br />
© Wouter Buytaert
ilder<br />
Illustration:<br />
bruno<br />
colajanni,<br />
ludaG.com<br />
bilder<br />
TV-Serien werden zuhause<br />
geguckt, die Protagonisten<br />
ersetzen nicht selten<br />
dem Zuschauer die<br />
Familie. Deshalb ist<br />
das große Thema der<br />
TV-Serie die Heimat<br />
oder Heimatlosigkeit.<br />
Über die Poetik der tV-serie<br />
Seite 68<br />
Eltern verlassen ihre<br />
Kinder mitunter, auch<br />
wenn das nicht in die<br />
Weltsicht der CDU passt.<br />
Stillstehende Zeit, Bewegung<br />
und Wandel bei paul<br />
hornschemeier<br />
Seite 72<br />
62 Jeff Wall<br />
66 Zur Poetik der TV-Serie<br />
68 Italo Western Collection<br />
69 »The Darjeeling Limited«<br />
von Wes Anderson<br />
70 Paul Hornschemeier<br />
72 »Tim & Struppi« von Hergé<br />
74 Jiro Taniguchi<br />
7 Orange Box<br />
76 »Super Paper Mario«<br />
77 Hommage à Mega Man<br />
reviews<br />
78 white cubes<br />
79 Gilbert & George<br />
Peter Bialobrzeski<br />
80 »Persepolis« 1 »Gefahr und<br />
Begierde« von Ang Lee<br />
81 »Fullmetal Alchemist«<br />
»The Saddest Music In The World«<br />
von Guy Maddin<br />
82 »Die Simpsons – Das Spiel«<br />
»Sinking Island« & »Ankh<br />
– Kampf der Götter«<br />
83 schnittstellen
That Could Be Real<br />
overpass, 2001, Transparency in lightbox, 214 x 273,5 cm<br />
jeff Walls Arbeiten bewegen sich<br />
auf dem schmalen Pfad zwischen<br />
Fotografie, Film und Malerei,<br />
Stofflichkeit und Entmaterialisierung,<br />
Inszenierung und Dokumentation<br />
– Eine Bestandsaufnahme<br />
text: eileen seifert fotos: jeff wall,<br />
jack foster / deutsche guggenheim<br />
Eine Straße. Irgendwo in Amerika. Zu sehen drei Figuren,<br />
die nebeneinander laufen. Links ein Mann asiatischer<br />
Herkunft. Rechts ein ›weißes‹ Pärchen. Der Mann, der<br />
mit der Linken seine Freundin hält, macht mit der rechten<br />
Hand eine unauffällige Geste: Er zieht, dem Asiaten leicht<br />
zugeneigt, sein Auge in eine schlitzartige Form. Jeff Walls<br />
Fotobild »Mimic« (1982) zeigt mit einer nachäffenden<br />
Gebärde ganz unverhohlenen, öffentlichen Rassismus.<br />
Durch den winzigen Fingerzeig werden die dargestellten<br />
Menschen in ein Dreigestirn psychologischer <strong>Gewalt</strong> katapultiert.<br />
Ein Augenblick nur, der Teil einer ganz alltäglichen<br />
Situation auf der Straße sein könnte – irgendwo in<br />
Amerika. Doch wirkt dieser Moment, trotz seiner Beiläufigkeit,<br />
theatralisch, irgendwie filmisch. Der Konjunktiv ist<br />
schließlich wörtlich zu nehmen, denn die ganze Situation<br />
ist komplett inszeniert. Die Idee der Nachahmung, die Titel<br />
und Inhalt dieses einen Bildes ist, kann als Synonym<br />
für Jeff Walls gesamte Arbeitsweise gelten. Seit den 1970er<br />
Jahren sind Imitationen, Inszenierungen oder Re-Inszenierungen<br />
des Alltags substanzielles Kennzeichen für den<br />
1946 in Vancouver, Kanada geborenen Künstler. »My near<br />
documentary-pictures« nennt Wall selbst jene Trugbilder,<br />
die so real erscheinen, mit der Idee der Dokumentation<br />
eng verwandt, aber eben nur fast dokumentarisch sind.<br />
Jeff Wall hat Kultur- und Kunstgeschichte studiert<br />
und sich ausgiebig – sowohl theoretisch als auch praktisch<br />
– mit Malerei und Film auseinandergesetzt, bevor er mit<br />
der Fotografie begann. Besonders die alten Meister wie<br />
Goya, Velázquez und Tizian beeindruckten ihn. Die<br />
Was diese Künstlichkeit beschwört, ist<br />
eine Art Hyperrealität: Situationen,<br />
die eben einfach realer – und genau<br />
deshalb ja synthetischer – wirken,<br />
als die Realität selbst es je könnte.<br />
62 1 bilder<br />
bilder 1 63
war game, 2007, Gelatin-silver print, 243.8 x 289.6 cm<br />
Affinität zu den genannten Medien legte er dann auch<br />
niemals ab, sondern kombinierte deren Strategien, Gesetzmäßigkeiten<br />
und Bildtypologien als Organisationsformen<br />
im fotografischen Bildraum: »I had the feeling that it<br />
was possible to bring much of what I’d liked in the cinema<br />
of the 1960’s and 1970’s together with what I’d always liked<br />
about painting in a form of photography that […] would<br />
not start out accepting the existing canon.« Eine Neuerung<br />
in der Fotografie strebte er an – etwas, das sich zwischen<br />
Malerei und Kino, zwischen der Dokumentation und den<br />
konstruierten, filmisch-fiktiven Bildern befand.<br />
Das magische Licht<br />
Eine wichtige Rolle für die Herstellung dieses Zwischenzustands<br />
spielt die Technik, mit der Wall fast alle seine Arbeiten<br />
präsentiert: Großdias in riesigen Leuchtkästen (oft ca.<br />
2 x 4 m), die so zuvor nur aus der Werbung bekannt waren.<br />
Mit dieser Aneignung und Übertragung in den künstlerischen<br />
Bereich wird Wall ein genialer Kunstgriff nachgesagt.<br />
Nicht überraschend, denn die leuchtenden Kästen<br />
sind heute sein Markenzeichen. Die darin ausgestellten<br />
Fotos sind Bilder, die mit Präsenz strahlen und dabei die<br />
vorteilhafte Eigenart besitzen, nie flach wie bloße Fotografien<br />
zu wirken. Vielmehr ist ihnen die Verwandtschaft<br />
zu den aus sich heraus leuchtenden Bildern aus Film und<br />
Fernsehen immanent: nicht statisch, sondern changierend<br />
zwischen Stofflichkeit und Entmaterialisierung. Sich<br />
der ambivalenten Anziehungskraft dieser Technik durchaus<br />
bewusst, meint Wall, dass die Faszination um seiner<br />
Arbeiten von der verborgenen Stelle des Lichts herrührt<br />
– eine Art Kontrollraum, eine Vorführkabine, die quasi das<br />
Bild aussendet. Deshalb sind seine Arbeiten so einmalig<br />
– abgesehen davon, dass sie Unikate sind –, weil sie nur als<br />
Original auf diese Weise funktionieren. Walter Benjamins<br />
Begriff der Aura kann hier in einer anderen Dimension gelesen<br />
werden. Doch klar dürfte wohl sein, dass die Bilder<br />
in ihrer Reproduktion, abgedruckt in einem Buch etwa,<br />
etwas verlieren bzw. ›nur‹ noch Fotos sind.<br />
Malerische Kompositionen<br />
Von besagtem Licht wie die Motten angezogen, scharen<br />
sich Besucher um Walls Werke, die aber entgegen ihrer<br />
um Aufmerksamkeit heischenden Verpackung gar nichts<br />
Auffälliges zeigen: nur »landscapes«, »lifescapes« und »interiours«,<br />
wie Wall seine Motivgruppen nennt und damit<br />
eben Landschaften (doch mit brisanten Einzelheiten:<br />
»The Bridge«, 1980), nachgestellte Alltagsszenen (die sich<br />
aus Walls eigener Erinnerung speisen: »The Storyteller«,<br />
1986) und moderne fotografische Genredarstellungen<br />
(»Rainfilled Suitcase«, 2001) meint. Zudem sind es vornehmlich<br />
leere und bedrückende Räume, die Wall beschreibt.<br />
– Suburbane Zonen, Niemandsland, Nicht-Orte,<br />
die zeitlos scheinen und nur vereinzelt Figuren enthalten<br />
(»Passerby«, 1996; »Flooded Grave«, 1998-2000).<br />
Gleich einem Filmregisseur bereitet Wall das Setting vor,<br />
wie ein Maler komponiert er die Bilder bis ins Detail. In<br />
Castings werden Schauspieler und Kleidung ausgewählt,<br />
der Ort / das Studio geschmückt, Szenen, Gemütszustände<br />
gespielt, alte Stoffe transponiert. Manchmal setzt sich<br />
Wall dabei selbst ins Bild, wie z.B. bei »Picture for Woman«<br />
von 1979, welches der Künstler als ein zeitgenössisches<br />
»Remake« von Manets berühmtem Gesellschaftsportrait<br />
»Bar in den Folies-Bergères« bezeichnet.<br />
»My near documentary-pictures«<br />
nennt Wall selbst jene Trugbilder, die<br />
so real erscheinen, mit der Idee der<br />
Dokumentation eng verwandt, aber<br />
eben nur fast dokumentarisch sind.<br />
Kunstgeschichtliche Zitate tauchen auch in anderen<br />
Bildern auf (»A Sudden Gust of Wind (after Hokusai)«,<br />
1993) und reichen bis zur ausgereiften Inszenierung in<br />
dramatischer Schlacht- oder Historienbildmanier. Bei<br />
»The Vampire’s Picnic« (1991) wird dieser Bezug in einer<br />
nächtlichen Horrorszene von äußerst bizarrem Humor<br />
auf die Spitze getrieben: Das opulente Mahl – vampirische<br />
Zeitgenossen verspeisen ihre Opfer – wirkt gleichzeitig<br />
wie ein Historienbild und das Set einer Filmszene. Alles<br />
ist wohl platziert, aufeinander abgestimmt und arrangiert.<br />
Nachgeholfen wurde dabei mit der digitalen Bildbearbeitung,<br />
einzelne Fotos wurden später am Computer zum<br />
Bild komponiert. Solche Arbeiten brachten Wall auch<br />
die Baudelaire’sche Bezeichnung »Maler des modernen<br />
Lebens« ein – wäre dies kein Foto, dann mindestens ein<br />
dicker Ölschinken.<br />
»The violence you see in my pictures is social violence«<br />
Auch wenn Wall die große Museumskunst zitiert und auf<br />
traditionelle Bildstrategien zurückgreift, bewegt er sich<br />
damit eher auf formaler Ebene. Inhaltlich dreht sich alles<br />
um das Jetzt, die Gesellschaft und ihre sozialen Missstände.<br />
Die Figuren, die in den Bildern auftauchen, würden<br />
dabei repräsentative Rollen übernehmen, ohne – wie etwa<br />
im Falle des Portraits – jemals sie selbst zu sein, so betont<br />
Wall. Vielmehr sind sie Darsteller, die oft gesellschaftliche<br />
Opfer und zwanghafte, kühle, fassadenartige Figuren verkörpern:<br />
Der verschwitzte Mann unter dem Küchentisch<br />
in »Insomnia« (1994) ist so eine pathologische Scheinexistenz,<br />
die auch der Abwasch auf der Spüle nicht verschleiern<br />
kann. Oder der allein lebende Angestellte in seinem<br />
spärlichen Zimmer in »Polishing« (1998), der geschäftiges<br />
Schuheputzen mimt und dabei bedrückend unfrei wirkt.<br />
Der Charakter des Gespielten wirkt dann wie eine Momentaufnahme,<br />
nur keine Zustandsbeschreibung. Häufig<br />
scheint es, als seien die Bilder Teile von Geschichten, vor<br />
denen schon etwas passiert ist und nach denen es auch<br />
weitergehen muss. Warum überhaupt klar wird, dass Dargestelltes<br />
arrangiert wurde, ist manchmal nur auf ein sub-<br />
tiles Gefühl zurückzuführen. Zumal es schwieriger wird,<br />
dies herauszufinden, wenn keine Menschen in vielleicht<br />
doch verräterischen Posen anwesend sind.<br />
»The Destroyed Room« (1978) ist so ein Bild. Ein komplett<br />
verwüsteter Raum: menschenleer. Überall liegen<br />
Sachen herum; das Bett ist umgeworfen; die Matratze<br />
diagonal aufgeschlitzt. Auf den ersten Blick die Situation<br />
nach einem Einbruch oder ähnlichem. Chaos. Doch so<br />
sortiert, dass es unheimlich gewollt erscheint. Was diese<br />
Künstlichkeit beschwört, ist eine Art Hyperrealität: Situationen,<br />
die eben einfach realer – und genau deshalb ja<br />
synthetischer – wirken, als die Realität selbst es je könnte.<br />
Im Zeitalter der Simulation ist Wall mit einer solchen<br />
Bildstrategie absolut aktuell. Anstatt auf den mythischen,<br />
Bresson’schen Augenblick zu warten, imitiert er ihn lieber,<br />
was ihn wohl ungleich mehr Aufwand kosten dürfte.<br />
Schließlich wird beim inszenierten Zufall eben gar nichts<br />
dem Zufall überlassen.<br />
Reportage und Fiktion – ein Dialog<br />
Jeff Walls Werk könnte durchaus als Absage an die klassischen<br />
Formen der Fotografie verstanden werden – die<br />
zufällige Momentaufnahme (»der perfekte Augenblick«)<br />
und das vermeintlich Authentische (»So ist es gewesen«)<br />
scheinen in seiner Arbeit eher unwichtig. Mit seinen neuen<br />
Schwarzweiß-Bildern verneigt sich der Künstler jedoch<br />
mit einem tiefen Knicks vor der Reportage-Fotografie, von<br />
der er sich Jahrzehnte distanzierte – übrigens nicht, weil<br />
er sie nicht schätzt, sondern weil, wie er sagt, Meistern<br />
wie Walker Evans und Robert Frank kaum mehr etwas<br />
hinzuzufügen war: »The classical or canonical mode of art<br />
photography, defined form by Evans and Frank, had gotten<br />
very static, very tired in the work of their followers and supporters.«<br />
Die Deutsche Guggenheim Berlin zeigt jetzt eben<br />
solche rein dokumentarischen Arbeiten Walls, die von<br />
älteren Arbeiten flankiert werden. Im Dialog der Reportage<br />
mit der Inszenierung stellt sich die Frage nach dem<br />
fotografischen Realismus, und darüber hinaus werden, anschaulich<br />
getrennt, zwei Dinge gezeigt, die Wall zufolge eigentlich<br />
in jeder einzelnen Fotografie gleichzeitig präsent<br />
sind: der Charakter des Dokumentarischen neben dem<br />
Konstruierten, Vorgestellten und Künstlichen.<br />
Was Wall nachstellt, sind nämlich oft Momente, die<br />
sich so bestimmt schon einmal zugetragen haben. Nur<br />
weil sie nicht eindeutige Situationen der Vergangenheit<br />
darstellen oder sich gleich einem<br />
re-enactment explizit darauf beziehen,<br />
sind sie nicht weniger<br />
›wahr‹ oder aussagekräftig. Die<br />
künstlerische Fiktion, die die Realität<br />
imitiert, mag in Momenten<br />
gar die Realität verdichten. Zurück<br />
bleibt der Betrachter, mit<br />
der vagen Vermutung: That<br />
could be real.<br />
Die Ausstellung »Jeff Wall: Belichtung«<br />
ist noch bis zum 20.1.2008 in der Deutschen<br />
Guggenheim Berlin zu sehen<br />
64 1 bilder<br />
bilder 1 6
Meredith Grey wird<br />
nicht sterben<br />
Amerikanische Psychopathologie:<br />
Mit ausgereifteren Konzepten, höheren<br />
Produktionskosten und vor allem einer<br />
neuen Ernsthaftigkeit macht die TV-Serie<br />
wieder von sich reden<br />
text: dan gorenstein fotos: buena vista home entertainment<br />
© 2006 american broadcasting companies, inc.<br />
Kino und Literatur haben sich nie richtig angefreundet.<br />
Zu aufwendig, überlaufen und zugleich kurzlebig die Produkte<br />
des einen Mediums, zu behäbig, nahezu blutleer<br />
die seines Gegenübers. Wo der Film zeigt und dazu seine<br />
ganze Kraft aufwendet, da denkt die Literatur nach, verliert<br />
sich in Abschweifungen und Randnotizen. Schon die<br />
Rezeptionsdauer scheidet die beiden Kunstformen: Wo<br />
der Film kaum zwei Stunden, allenfalls drei in Anspruch<br />
nimmt, überdeckt so manches Buch ganze Jahreszeiten,<br />
geradezu Lebensabschnitte, mit seiner Präsenz. Der Leser<br />
hat stets den Vorteil, sich in seinem Kunstwerk einnisten<br />
zu können, sich darin eine gemütliche Höhle Lebenszeit<br />
zu schaufeln. Der Film weiß darauf keine Antwort zu geben,<br />
seine kleine Schwester, die TV-Serie, sehr wohl.<br />
Die Renaissance des Fernsehens<br />
Im Grunde ist es seltsam, dass es so lange brauchte, bis<br />
die TV-Serie ihr volles ästhetisches Potential ausschöpfen<br />
durfte. Lange Zeit war es nur dem Film vergönnt, die bewegten<br />
Bilder im kunst- und medientheoretischen Olymp<br />
zu vertreten, der TV-Serie standen zwar die selben künstlerischen<br />
und technischen Mittel zur Verfügung, nicht aber<br />
das nötige Geld. Gleichzeitig haben aber gerade Serien<br />
das öffentliche Bewusstsein und den Zeitgeist geprägt im<br />
Land des Fernsehens. Trotzdem blieben sie bis auf wenige<br />
Experimente wie etwa »Twin Peaks« ziemlich konservativ.<br />
Mittlerweile gibt es aber so viele von diesen Experimenten,<br />
diesen Serien von ungeahnt hoher Qualität, dass es Zeit<br />
ist, sich die Möglichkeiten dieser Erzählform näher anzusehen.<br />
Die Renaissance der TV-Serie wird gemeinhin dem<br />
amerikanischen Pay-TV-Sender HBO zugerechnet, und<br />
tatsächlich ist es so, dass die meisten aktuellen Eigenproduktionen<br />
von HBO weit über dem ansonsten recht niedrigen<br />
Niveau der gängigen amerikanischen TV-Serie, von<br />
Sitcoms ganz zu schweigen, liegen. Die erstaunlich hohe<br />
Qualität dieser Serien aber scheint die anderen Sender anzustecken,<br />
und deshalb wird nun allerorts von dem neuen<br />
Phänomen TV-Serie gesprochen. Dabei wird Qualität oft<br />
mit Produktionskosten verwechselt und Hype mit Zeitgeist.<br />
Wiedererkennung, Dauer, Kommentar<br />
Die Serie hat dem Film zuallererst ihre Länge voraus. Was<br />
früher die Erbsünde der Serie war, nämlich die Langsamkeit,<br />
fast schon Unbeweglichkeit der Erzählung, wenn es<br />
denn überhaupt eine gab, ist weitestgehend abgeschafft:<br />
Die Handlung zieht sich nicht mehr zentimeterweise von<br />
einer Folge zur nächsten, sondern umgekehrt passiert in<br />
einer Episode so viel, dass es kaum möglich ist eine auszulassen,<br />
ohne die Handlung aus den Augen zu verlieren.<br />
Es gibt keine relevanten und irrelevanten Folgen mehr<br />
wie bei »Akte X«, sondern reinen Inhalt, einen durchgängigen<br />
Plot. Die Dauer der Serie wird zu ihrem Vorteil. Ihre<br />
Spannweite ermöglicht es ihr, Plotstücke oder Randerzählungen<br />
über Wochen zu dehnen, sie von einer Staffel<br />
in die nächste mitzunehmen, verloren geglaubte Figuren<br />
nach Jahren wiederzuerwecken. Und da die Erzählung<br />
auf längere Distanz konzipiert ist, ist das eine gute Sache.<br />
Zudem können Charaktere ganz anders eingeführt und<br />
auch wieder abgeführt werden; mit zunehmendem Mut<br />
der Produzenten können sogar Hauptfiguren unverhofft<br />
oder langwierig sterben. Was nicht nur die lähmende<br />
Vorhersehbarkeit aus den Serien vertreibt, sondern auch<br />
Kunstproblem und Sparringspartner No. 1, den Tod, auf<br />
den Plan ruft.<br />
Gleichzeitig haben typischere Serien, die sich von Episode<br />
zu Episode hangeln, ihre Flexibilität entdeckt. Einerseits<br />
können sie kommentierend in öffentliche Debatten<br />
eingreifen wie »South Park«, andererseits können sie sich<br />
folgenweise aus dem vorgegebenen ästhetischen Korsett<br />
lösen und zum Experiment übergehen, wie die viel gerühmte<br />
»Buffy«-Musical-Folge.<br />
Krankenhaus und Heimatstadt<br />
Was aber allen neuen und alten, guten und schlechten TV-<br />
Serien gemeinsam ist, das ist ein fester Ort, eine Umgebung,<br />
in der sie stattfinden. Wahrscheinlich hat es damit<br />
zu tun, dass diese genuin amerikanische Erzählform eben<br />
diese emotionale Heimat, die sie ihren Zuschauern bietet,<br />
in ihrer Struktur wiedergeben muss. TV-Serien werden zu<br />
Hause geguckt, die Protagonisten ersetzen nicht selten<br />
dem Zuschauer die Familie. Deshalb ist das große Thema<br />
der TV-Serie die Heimat oder Heimatlosigkeit. Von dem<br />
zutiefst amerikanischen Versuch, Religiosität, Nächstenliebe<br />
und vor allem die Familie als sinnstiftende Werte zu<br />
etablieren, wie es in »Eine himmlische Familie« versucht<br />
wird, über die amerikanische Kleinstadt und deren allzu<br />
normalen Wahnsinn in »Gilmore Girls« bis hin zur absoluten<br />
Hoffnungslosigkeit der todesversessenen Krankenhausserien<br />
wie »Emergency Room« oder »Grey’s Anatomy«<br />
ist es stets die Frage nach Heim und Geborgenheit, die<br />
sich in den Vordergrund drängt. Das wohl prominenteste<br />
Beispiel ist die Serie »Lost«, die in wechselnder Perspektive<br />
die Untiefen ihrer Protagonisten und der Insel, auf<br />
der sie gestrandet sind, auslotet, aber auch ständig die<br />
Feindseligkeit der verlorenen Gesellschaft evoziert und<br />
mit dem naturzustandähnlichen Inselleben in Verbindung<br />
bringt. Von den klassischen Serien jedoch ist nur die<br />
Krankenhausserie wirklich dazu in der Lage, die transzendentale<br />
Obdachlosigkeit des Zuschauers wie der Figuren<br />
offen zu legen, sie darf getrost als Wegbereiter der neuen<br />
Ernsthaftigkeit im Fernsehen betrachtet werden. Kein<br />
Wunder, dass mit Lars von Triers »Geister« auch eine der<br />
anerkannten großen Kunstserien in einem Krankenhaus<br />
spielt.<br />
Was HBO dem hinzufügen kann, das ist die Verschiebung<br />
des Todes in die Familie und damit in die Gesellschaft<br />
wie z.B. in »Six Feet Under«, die Entdeckung<br />
des Todes als gesellschaftsbildender Mörtel wie in der<br />
soziologisch-historischen Planskizze »Deadwood«, oder<br />
die Entmystifizierung der Antike und deren Todeskulte<br />
in »Rom«. Trotzdem können auch diese Serien ihren territorialen<br />
Charakter nicht kaschieren, auch wenn sie die<br />
Möglichkeit des Todes in greifbare Nähe rücken: Eine<br />
gewisse Unsterblichkeit und Weichheit hängt auch ihren<br />
Protagonisten an. Denn oberste Maxime der TV-Serie ist<br />
und bleibt die Fortführung, und dazu muss sie in der Lage<br />
sein, den Zuschauer in ihre Mitte zu nehmen und ihm ein<br />
Zuhause zu geben.<br />
aktuelle Veröffentlichungen<br />
»Lost – 3. Staffel – Teil 1«, ab 6.12.2007 auf DVD<br />
(Touchstone/Buena Vista Home Entertainment)<br />
»Gilmore Girls – 7. Staffel – Teil 1«, ab 7.12.2007<br />
auf DVD (Warner Bros. Home Entertainment)<br />
»Grey’s Anatomy – 3. Staffel – Teil 2«,<br />
ab 17.1.2008 auf DVD (Touchstone/Buena<br />
Vista Home Entertainment)<br />
66 1 bilder<br />
bilder 1 67<br />
Verlosung<br />
Wir verlosen eine DVD-Box »Lost – 3. Staffel Teil 1«<br />
sowie drei Marienstatuen. Einfach Mail mit Betreff »La<br />
Isla Bonita« an tombola@goon-magazin.de senden.<br />
goon<br />
verlost
Koch Media hebt die italo Western collection aus der Taufe – und präsentiert<br />
einen eindrucksvollen Querschnitt durch ein Genre zwischen Psychedelik, Prügel und<br />
Kapitalismuskritik<br />
text: jochen werner fotos: koch media home entertainment<br />
»Was versteht man unter ›Western‹? Das ist der Ort, an dem<br />
die Sonne untergeht«, so lautet die recht offene Bilanz von<br />
Regisseur Damiano Damiani. Dabei schien das Genre seit<br />
den frühesten Tagen der Kinematographie untrennbar<br />
mit dem amerikanischen Kino verbunden und diente den<br />
USA als unbestechlicher Seismograph des politischen Klimas.<br />
Von der heroischen Verklärung des Genozids an den<br />
Indianern als Gründungsmythos bis zu den zynischen Abgesängen<br />
der Spätwestern an Heldentum und Rechtmäßigkeit<br />
des Mordens zeichnete er mal sensible, öfter grobe<br />
Skizzen nordamerikanischer Befindlichkeit. Ein seltsamer<br />
Gedanke also, einen italienischen Western zu inszenieren<br />
– und die wenigen vorherigen Versuche waren auch allesamt<br />
an fehlender kultureller Eigenständigkeit gescheitert,<br />
bis Sergio Leone 1964 mit »Für eine Handvoll Dollar« die<br />
erfolgreiche Blaupause für eine ganze Welle lieferte. Dieser<br />
nämlich wusste, dass man im Grunde alles anders machen<br />
müsste, um glaubwürdig zu wirken: Sein Film war dreckiger,<br />
zynischer, finsterer als alles, was zuvor zu sehen war<br />
und schuf so das Regelwerk für den Italo-Western. Schnell<br />
traten weitere Filmemacher auf den Plan, die das kreative<br />
oder kommerzielle Potenzial des Modegenres erkannten.<br />
So entstand eine Strömung, deren ästhetischer Einfluss<br />
bis heute sträflich unterschätzt wird. Lediglich der von<br />
Film zu Film epischere Leone wurde in den Kanon des Cinéasmus<br />
aufgenommen, die oft gar radikaleren Werke der<br />
Filmemacher in seinem Schatten sind nicht selten dem<br />
Vergessen anheim gefallen. Sie diesem zu entreißen, tritt<br />
nun die neue »Italo Western Collection« von Koch Media<br />
an – und bietet mit den ersten drei Veröffentlichungen<br />
einen durchaus repräsentativen Überblick über das Spektrum<br />
des Genres.<br />
Viva la rivoluzione!<br />
Das beginnt mit Damiano Damianis »Töte Amigo« (1966),<br />
in dem die politischen Subtexte des Italo-Western offen<br />
zutage treten. Vor dem Hintergrund der mexikanischen<br />
Revolution wird der Gauner El Chuncho vom Erzkapita-<br />
listen zum Kämpfer für die gute Sache bekehrt. Von Anbeginn<br />
war die Welt der Italo-Western als zynisches Zerrbild<br />
eines fehlgeleiteten Kapitalismus zu lesen, und mit seinem<br />
einzigen Genrebeitrag legt Damiani einen politisch<br />
bewussten wie temporeichen Höhepunkt im Subgenre<br />
des Revolutionswestern vor. Eher ästhetisch interessant<br />
präsentiert sich »Yankee« (1966) von Tinto Brass, der später<br />
mit »Caligula« (1979) sein Hauptwerk vorlegte. Dieser<br />
vermag vor allem durch einen verspielten, gelegentlich<br />
ins Psychedelische verschwimmenden Stil zu überzeugen,<br />
der zeitweise gar den Surrealismus von Alejandro Jodorowskys<br />
»El Topo« (1970) vorweg zu nehmen scheint. Als<br />
schwächster unter den Filmen der ersten Staffel muss Sergio<br />
Martinos »Der Tod sagt Amen« (1970) gelten. Der oft<br />
unterbewertete Filmemacher kurbelte seine erste Regiearbeit<br />
noch als ambitionsloses Vehikel für B-Star Anthony<br />
Steffen herunter, markierte aber doch – zufällig wohl eher<br />
– eine entscheidende Wegmarke im Italo-Western. So folgt<br />
»Der Tod sagt Amen« zwar narrativ einem bewährten Erfolgsschema<br />
des Genres, dessen Reiz auch immer nicht<br />
zuletzt in seinen grafischen <strong>Gewalt</strong>darstellungen und<br />
seiner zynischen Attitüde lag; doch durchtränken hier<br />
bereits immer dominantere Einlagen kruder Komik den<br />
rauen Grundton, die den letzten Höhenflug mit den Blödelfilmen<br />
mit Bud Spencer und Terence Hill prägen. Im<br />
Anschluss wurde der Italo-Western – von einer Handvoll<br />
Schwanengesänge wie Martinos zweitem und letztem<br />
Genrebeitrag »Mannaja« (1977) eskortiert – in einem anonymen<br />
Wüstengrab verscharrt. Schön, dass sich mit Koch<br />
Media nun eines der essenziellen deutschen Labels für B-<br />
Movies und Filmkunst seiner vergessenen Meisterwerke<br />
angenommen hat.<br />
»Töte Amigo« von Damiano Damiani,<br />
»Yankee« von Tinto Brass und »Der Tod<br />
sagt Amen« von Sergio Martino, seit<br />
19.10.2007 auf DVD (Koch Media)<br />
Begleitend zur Italo Western Collection ist der<br />
Dokumentarfilm »Denn sie kennen kein Erbarmen<br />
– Der Italowestern« von Hans-Jürgen Panitz und Peter<br />
Dollinger als DVD mit Soundtrack-CD erschienen<br />
Poetik des Abschieds<br />
Drei Brüder auf der Suche nach dem real life: »The Darjeeling Limited« von Wes anderson<br />
text: dan gorenstein foto: 20th century fox<br />
Der Zug hat schon längst die Barke als Transportmittel ins<br />
Jenseits abgelöst. Als Emblem der frühen Moderne und<br />
des alten Fortschrittglaubens hat er natürlich auch im Film<br />
seine Spuren hinterlassen. Von der frenetisch gefeierten<br />
»Ankunft eines Zuges« der Gebrüder Lumière bis zu den<br />
Melancholietransportern in Wong Kar-Wais »2046« haben<br />
Züge sich gerade wegen ihrer Abgenutztheit zu Symbolen<br />
des Abschiedes und eben des Todes gewandelt.<br />
The Businessman<br />
Am Anfang von Wes Andersons fünftem Film »The Darjeeling<br />
Limited« sieht man Bill Murray rücksichtslos einem<br />
Zug hinterher jagen. Bepackt mit Koffern und vom Alter<br />
gezeichnet wie Steve Zissou, scheint er sein Äußerstes<br />
zu geben. Er wird den Zug nicht einholen. Statt dessen<br />
wechselt der Film in Zeitlupe, und Adrien Brody zieht<br />
mit einem viel größeren Koffer in der Hand geschmeidig<br />
an Bill vorbei, springt auf den Zug und sieht dann, einen<br />
Moment nur, den alten Mann auf dem Bahnsteig zurückbleiben.<br />
Bill Murray wird in diesem Film keine Rolle mehr<br />
spielen, er bleibt der abgehetzte businessman, seine Geschichte<br />
wird hier nicht erzählt. Diese Szene ist Wes Andersons<br />
Abschied von seinem großen Schauspieler: Nach<br />
»The Life Aquatic With Steve Zissou« (»Die Tiefseetaucher«,<br />
200 ) hatte Bill Murray verlauten lassen, er würde keinen<br />
Film mehr mit Wes Anderson machen können, es sei ihm<br />
zu anstrengend.<br />
68 1 bilder<br />
bilder 1 69<br />
Real Life<br />
Im Zug angekommen, stellt sich heraus, dass Adrien Brody<br />
einer der drei Whitmanbrüder ist, Peter Whitman. Er<br />
und sein Bruder Jack (Jason Schwartzman) wurden von<br />
dem ältesten Whitmanbruder, Francis (Owen Wilson),<br />
nach Indien und auf besagte Zugfahrt eingeladen, um<br />
wieder Brüder zu sein, ihrer einjährigen Entfremdung ein<br />
Ende zu setzten. Denn vor einem Jahr war ihr Vater gestorben<br />
und die offenbar reiche Familie hatte sich, wie zuvor<br />
die »Royal Tenenbaums«, in alle Winde zerstreut. Tod, Entfremdung,<br />
Abschied. Drei Brüder reisen durch das Land<br />
des Todes und der Wiedergeburt, und dennoch braucht es<br />
den halben Film, bis sie an sich vorbeikommen, in real life<br />
und raus aus dem Zug. Nachdem sie wegen ihrer unzähligen<br />
Streitereien, Marotten und Neurosen aus dem Zug<br />
geschmissen werden, sitzen sie, hinter einer Phalanx aus<br />
Louis-Vuitton-Koffern, am Lagerfeuer und beginnen zum<br />
ersten Mal während der Reise, tatsächlich nachzudenken.<br />
Und dann auf einmal, wie stets bei Wes Anderson, schiebt<br />
sich der ganze Klamauk beiseite, beulen sich die ansonsten<br />
seltsam flach wirkenden Charaktere aus, und Jack<br />
bringt ihre Misere auf den Punkt: »I wonder if the three of<br />
us would’ve been friends in real life. Not as brothers, but as<br />
people.« Auch wenn die Filme von Wes Anderson ein wenig<br />
am Leben vorbei erzählt scheinen, und selbst wenn<br />
er sich in scheinbar unbedeutenden Nebenplots verliert,<br />
unmögliche Figuren zeichnet, an der kleinsten Kleinigkeit<br />
eines Filmsets herumtüftelt, bleibt er Chronist eben jenes<br />
Lebensgefühls, das sich in der Kluft zwischen dem real life<br />
und dem Anderen abspielt: dem Stunt, dem Flachen und<br />
von der passenden Musik Umschmiegten und dem Scheitern<br />
dahinter, dem Menschsein und der damit verbundenen,<br />
nicht tot zu kriegenden Würde.<br />
»The Darjeeling Limited« von Wes Anderson,<br />
ab 3.1.2008 im Kino (20th Century Fox)
Erinnerung ist ein<br />
Sandwich, keine<br />
Schildkröte<br />
Stillstehende Zeit, Bewegung und<br />
Wandel in paul hornschemeiers<br />
»Komm zurück, Mutter« und »The Three<br />
Paradoxes«<br />
text: mareike wöhler illustrationen: paul hornschemeier<br />
»[...] I think what has always been the most interesting to<br />
me is that there’s this exterior reality and then the interior<br />
reality of what’s going on inside people’s houses and inside<br />
their minds ...«<br />
paul hornschemeier, interview in mome #1<br />
Löwenhüter innerer Realitäten<br />
Eltern verlassen ihre Kinder mitunter, auch wenn das<br />
nicht in die Weltsicht der CDU passt. Die Mutter in Paul<br />
Hornschemeiers Comic »Komm zurück, Mutter« bringt<br />
sich aufgrund einer schweren Krankheit um und hinterlässt<br />
ihren Sohn und einen Ehemann, der ob des Verlustes<br />
depressiv wird und das Kind sowie seine Logikvorlesungen<br />
zunehmend vernachlässigt. Bereits im deprimierenden<br />
Epilog schwebt der entgleiste Vater ziellos durch eine desolate<br />
Landschaft seiner Trauer, um seine Frau zu suchen.<br />
Eine Zeit lang gelingt es dem siebenjährigen Thomas<br />
– mit Hilfe einer von der Mutter geschenkten Löwenmaske,<br />
die ihn stärker macht und seinen Schmerz vorm Leser<br />
leidlich versteckt –, den Schein zu wahren: Er versorgt den<br />
Vater und sich mit Sandwiches, versucht das im Haus zunehmende<br />
Chaos zu beseitigen und das ›Reich‹ der Mutter<br />
(Zimmer, Garten, Grab) zu hüten. Doch eines Tages<br />
macht er am Telefon einen Fehler, der alles auffliegen lässt.<br />
Die Geschichte, die Themen wie Verantwortung und das<br />
Abschiednehmen verhandelt, wird als Erinnerung des<br />
erwachsenen Thomas erzählt. Doch immer wieder übernimmt<br />
das Kind in ihm die Erzählung. Dann ändert sich<br />
der exakte, in trüben Farben gehaltene Zeichenstil des<br />
mit seiner Katze Margo in Chicago lebenden 30-jährigen<br />
Hornschemeier: In bunteren Strichzeichnungen agieren<br />
Tiere statt Menschen, füllt krakelige Schrift die Sprechblasen<br />
– eine kongeniale bildliche Umsetzung von Thomas’<br />
Überforderung und Hilflosigkeit, die sich auch in seine<br />
schweren, gleichnisreichen Träume tragen, während der<br />
schlaflose Vater in der Dachkammer über ihm die tote<br />
Mutter anfleht.<br />
Diese Geschichte von Vater und Sohn ist, einem<br />
beiden ähnelnden Foto im Anhang zum Trotz, nicht autobiografisch,<br />
sondern als Buch im Buch hochgradig konstruiert.<br />
In dieser konzeptorientierten Schreibweise lässt<br />
Hornschemeier die inneren Lebensrealitäten seiner Figuren<br />
begreifbar werden, indem er Erinnerung als Prozess<br />
auffasst, über den Thomas’ Vater, selbst Autor des fiktiven<br />
Sachbuchs »Evolution der Symbole«, vorlesen wird: »Menschen<br />
schaffen sich kleine Erklärungssysteme. / Sachen, die<br />
eigentlich gar nicht stimmen, aber die man leichter versteht<br />
als die komplizierte Wirklichkeit.«<br />
Autografische Mischpalette mit Erinnerung<br />
Während »Komm zurück, Mutter« ursprünglich in drei<br />
Heften im Rahmen der Anthologie Forlorn Funnies erschien,<br />
ist Hornschemeiers jüngste, in zwei Jahren am<br />
Stück gezeichnete Graphic Novel »The Three Paradoxes«<br />
formal extremer, brüchiger und schlüssiger zugleich. Als<br />
autobiografische Metaerzählung angelegt, geht es auch<br />
hier um die Erinnerung eines Erwachsenen, um familiäre<br />
Beziehungen sowie die Möglichkeit persönlichen Wandels:<br />
Der Erzähler, der Comiczeichner Paul – Hornschemeiers<br />
autografischer Avatar – besucht seine Eltern in deren<br />
Haus in Ohio und arbeitet dort an dem Strip »Paul and<br />
the Magic Pencil«. Als er mit der Arbeit nicht vorankommt,<br />
begleitet er seinen Vater auf einem Spaziergang zu dessen<br />
Büro und unterhält sich mit ihm. »›The Three Paradoxes‹<br />
has become, for me, an almost smothering case of life imitating<br />
art imitating life, etc., ad nauseam. For two years I<br />
have been drawing and writing a book about myself drawing<br />
and writing a book that I cannot finish, a book I cannot<br />
seem to end, and I couldn’t end the book about the book with<br />
no end. Though, maddeningly, in the book within the book, I<br />
am suffering from a conceptual block – writer’s block of sorts<br />
– while in reality it was closer to a LIVING block.«<br />
Hornschemeier, der auch als Colorist für Marvel und<br />
DC arbeitet, spielt seit langem die technischen Aspekte<br />
der Comicherstellung (Cover, Layout, Farbe, Tinte, Druck<br />
und Präsentation) durch. Sein Avatar, der auf ein Treffen<br />
mit einer Frau aus Deutschland wartet, in deren E-Mails er<br />
sich verliebt hat, fotografiert für sie während des Spaziergangs<br />
Orte, an denen ihn Flashbacks aus seiner Kindheit<br />
überfallen. Das Hin- und Herblenden zwischen fünf grafisch<br />
sehr unterschiedlichen Stories, Realitäten und Zeiten<br />
– Buntstiftskizzen in non-photo blue, Rasterpunktzeichnungen<br />
mit wackeligem Panelrahmen oder vergilbten<br />
Comicseiten aus erfundenen Heften mit ausgefransten<br />
Rändern – ist dabei mehr als ein formales Experiment: Die<br />
in sich schlüssigen Stories werden nicht nur mit-, sondern<br />
auch ineinander verschränkt, so gebrochen und doch sehr<br />
geschickt in die Gesamterzählung eingebettet.<br />
Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Stillstehende<br />
Pfeile ins Herz der Comiczeit<br />
Kern des Comics ist eine vorsokratische Superphilosophenstory,<br />
in der die Negation der Realität von Bewegung<br />
in der Zeit durch Zenon von Elea und seinen Lehrer<br />
Parmenides verhandelt wird. Zenon formulierte neben<br />
dem Paradox von Achilles und der Schildkröte auch das<br />
vom fliegenden Pfeil, der sich scheinbar bewegt. In Wirklichkeit<br />
ruht er jedoch, da er in jedem Augenblick in einem<br />
bestimmten Raumteil ist, sich die Flugbahn aus unendlich<br />
vielen solcher Augenblicke zusammensetzt und An-einem-<br />
Ort-sein eben Ruhen heißt. Dies zeigt, dass die Idee der<br />
Bewegung in der Zeit zu unmöglichen Konsequenzen<br />
führt, egal, ob Zeit Kontinuität oder Diskretheit vorgibt.<br />
Die strukturelle Praxis in Comics besteht nach Thomas<br />
A. Bredehoft nun darin, Raum zu benutzen, um<br />
Zeit zu repräsentieren. Nach Pascal Lefèvre sind Comics<br />
notwendigerweise ein diskontinuierliches, elliptisches<br />
Medium, da sie – anders als Filme – nur Fragmente von<br />
Ereignissen repräsentieren können. Und Michael Hein<br />
schlägt vor, »die Geschichte eines Comicstrips als ein Unternehmen<br />
zu betrachten, welches nicht die Zeit gestaltet,<br />
sondern Zeit verbringt im Ungewissen.« Mit dem Zenonexkurs<br />
bringt Hornschemeier mit einem uralten philosophischen<br />
Diskurs eine frische, treffende Zeitmetapher<br />
in die Ästhetik des Comics ein, deren Forscher sich mit<br />
Zeit, Bewegung sowie dem Zwischenraum zwischen den<br />
Panels befassen. Die vorgetäuschte Textur der auf alt getrimmten<br />
Comic-Materialien lässt dem Leser Vergangenheit<br />
imaginär greifbar werden. Eine Lektüre unter dem<br />
Gesichtspunkt der eingefrorenen Zeit und des negierten<br />
Wandels führt zugleich zur Feststellung von Nichtzeit und<br />
Diskontinuität im sich aus Einzelpanels zusammensetzenden<br />
Comic. Kann Erinnerung Zeit auflösen? Protagoras<br />
nimmt Zenon nach der Präsentation der Paradoxa zur<br />
Seite: »Whatever freedom, whatever solace you are seeking ...<br />
It is not in these thoughts.«<br />
Während Paul auf der narrativen Ebene auf die<br />
Schlussidee zum Comicstrip und das ersehnte Treffen<br />
wartet, gibt es auch zeichnerisch fast keine explizite Bewegungsdarstellung.<br />
Benachbarte Panels zeigen oft dieselbe<br />
Topographie; die so erzeugte Langsamkeit und Kontinuität<br />
wird erst durch die grafischen Wechsel der Erzählmodi<br />
aufgebrochen. Auch das Fehlen von Seitenzahlen bremst<br />
Linearität, Kausalität und den Fluss der Erzählzeit ab.<br />
Die im Ausgelassenen, Ungewissen, Paradoxen verbrachte<br />
Zeit ist wesentlicher Bestandteil von Hornschemeiers<br />
Arbeiten, in denen man zugleich stillstehen und<br />
spazierengehen kann, um sich über dieses schwierige<br />
Leben Gedanken zu machen: »I would say that mainly a<br />
lot of the gist of the book is looking for some kind of control or<br />
certainty in life, debating whether or not that actually exists;<br />
whether or not one can actually influence anything, whether<br />
one can take control of various aspects of one’s life; whether<br />
one can change from where one has been in the past.« Manche<br />
Künstler, zumeist die besten, lassen diejenigen, die<br />
sich mit ihren Arbeiten befassen, mit Fragen statt Antworten<br />
zurück.<br />
»Komm zurück, Mutter«<br />
von Paul Hornschemeier,<br />
Carlsen, Hamburg<br />
2007, 128 S., € 16,00<br />
www.forlornfunnies.com, www.fantagraphics.com<br />
»The Three Paradoxes«<br />
von Paul Hornschemeier,<br />
Fantagraphics, Seattle<br />
2007, 80 S., $ 14,95<br />
70 1 bilder<br />
bilder 1 71
Der Held des<br />
(kleinen)<br />
20. Jahrhunderts<br />
Zum 100. Geburtstag hergés ein kleiner<br />
Rückblick und Ausblick auf »Tintin«,<br />
seine berühmteste Schöpfung<br />
text: patrick küppers<br />
illustration: aus »auf den spuren von tim & struppi«<br />
Die ersten Schritte führten Tintin, den unangefochtenen<br />
Star unter den Helden des frankobelgischen Comics, 1929<br />
in das »Reich der Sowjets«. Die Bilderfolgen erschienen in<br />
der Jugendbeilage des erzkatholischen Blattes Le XXe Siècle,<br />
genannt Le Petit Vingtième. Das kleine 20. Jahrhundert<br />
also, wie es Hergé, der vor nun hundert Jahren als Georges<br />
Rémi nahe Brüssel geboren wurde, in 23 »Tintin«-Alben,<br />
hierzulande wohl bekannter unter dem deutschen Titel<br />
»Tim & Struppi«, darstellte. In schöner, teilweise grandioser<br />
Zeichnung, die zunehmend nicht nur als comicgeschichtliches,<br />
sondern sogar als kunsthistorisches Ereignis<br />
gesehen wird, entfaltet sich ein globales Panorama. Außer<br />
Australien erschließt sich jeder Kontinent und sogar der<br />
Mond als Handlungsraum für die Zentralfigur.<br />
Verminte Geschichte. Vom Fassen einer Gegenmacht<br />
Wenn am 20. Jahrhundert so einiges auszusetzen ist, so<br />
gilt dies in geringerem Maße auch für dessen Kleinfassung<br />
in den »Tintin«-Comics. Schon das ›Sowjetreich‹ war eine<br />
antikommunistische Karikatur, wenngleich diese auch<br />
vom 1937 tatsächlich losbrechenden Staatsterrorismus<br />
in der UdSSR noch deutlich übertroffen wurde. Schwerer<br />
wiegt die etwas sehr harmonische Darstellung des kolonialen<br />
Kongo (»Tim im Kongo«) angesichts des abscheulichen<br />
Völkermordes, den die belgische Krone hier seit<br />
1890 betrieb. Weiter vermintes Gelände sind auch Ausrutscher<br />
Hergés in die antisemitische Ikonographie. Da gibt<br />
es nichts kleinzureden, aber doch muss man feststellen,<br />
dass Hergés Karikatur, etwa bei dem Bankier Bohlwinkel<br />
in »Der geheimnisvolle Stern«, eher einem amoralischen<br />
Kapital galt, welches dem Profit alles unterordnet. Diesem<br />
Kapital ein jüdisches Gesicht zu geben, war unter westlichen<br />
Illustratoren bis 194 leider üblich. In arabischen<br />
Ländern ist das noch immer so. Der Vorwurf eines tief<br />
sitzenden Antisemitismus ist an solchen Bildern jedenfalls<br />
kaum festzumachen, und anderenorts gab Hergé dem<br />
kritisierten Kapital etwa in den Waffenhändlern Dawson<br />
oder Basil Bazaroff auch neutralere, angelsächsische Gesichter.<br />
Ständiges Movens der Albenhandlung ist eine dunkle<br />
Gegenmacht, vor der Tintin seine Freunde und auch alle<br />
anderen Verfolgten zu bewahren sucht. Das amoralische<br />
Kapital bildet eine Seite dieser Gegenmacht. Sie findet<br />
sich wiederholt symbolisiert in dicken Geldbündeln, die<br />
Tintin zu korrumpieren suchen – freilich vergebens. Auf<br />
der anderen Seite stehen autoritäre Polizeistaaten, wie<br />
Tintin sie im Ostblockstaat »Bordurie« kennen lernt, oder<br />
auch in den Operettendiktaturen, die das südamerikanische<br />
»San Theodoros« heimsuchen. Auch Oberschurken<br />
wie der Drogen- und Sklavenhändler Rastapopoulos<br />
(zwischendurch ist er auch Filmproduzent) oder der Apparatschik<br />
Sponsz sind nur Exponenten jeweils einer Seite<br />
jener Gegenmacht.<br />
Tintin als Superheld<br />
Die Bezeichnung »Superheld« aber will auf Tintin nicht<br />
recht passen. Er ist ein Hänfling mit Hund, der kaum<br />
etwas mit den Muskellagerstätten US-amerikanischer Provenienz<br />
gemein hat. Und dennoch sehen schon mehrere<br />
Generationen von Kindern und Erwachsenen in aller Welt<br />
in ihm ein Vorbild und eine Identifikationsfigur.<br />
Tintin ist ein Kindmann. Von Alkohol, Tabak und<br />
Frauen hält er sich fern, sein Auftreten ist höflich und bescheiden.<br />
Ihn binden weder Wohnsitz noch Arbeit noch<br />
Geldnöte, sein klares, offenes Gesicht kann nichts ver-<br />
bergen. Wenn man nichts über seine Familie oder seine<br />
Vergangenheit erfährt, so liegt das daran, dass diese nicht<br />
existieren. Somit ist Tintins Bewegungsfreiheit im »kleinen<br />
20. Jahrhundert« vollkommen, wozu sich seine Befähigung<br />
trefflich fügt, jede Art von Vehikel (vom U-Boot über<br />
den Panzer bis zur Mondrakete) zu bedienen. Schließlich<br />
ist Tintin noch ein herausragender Faustkämpfer.<br />
Er entspricht damit in etwa dem, was sich viele Kinder<br />
vom Erwachsensein versprechen, und zeigt zudem in<br />
seiner Ungebundenheit und Begeisterungsfähigkeit eher<br />
kindliche Eigenschaften, deren Verlust Erwachsene oftmals<br />
als schmerzlich empfinden. Züge von Nebenfiguren<br />
entsprechen dieser Tendenz: Kinder wie der Chinese<br />
Tschang oder der Indio Zorrino verfügen über erstaunliche<br />
Reife und Mut, und bei Hauptfiguren wie den Detektiven<br />
Dupond und Dupont, dem Professor Tournesol<br />
sowie natürlich dem Kapitän Haddock und auch dem<br />
Hund Milou, fällt unentwegt die Maske des Erwachsenen<br />
zugunsten einer sympathischen Kindsköpfigkeit. Aus solchen<br />
stets vollendet gezeichneten Kontrasteffekten gewinnen<br />
die Comics eine unerschöpfliche Komik. Kontraste,<br />
wie sie bei Tintin nicht auftreten. Sein hybrider Charakter<br />
kennt keine Brüche und ist erstaunlich überzeugend.<br />
Hergé evoziert durch diesen Charakter ein Drittes,<br />
das sich den Polizeistaaten auf der einen und dem menschenverachtenden<br />
Kapital auf der anderen Seite entzieht.<br />
Ein Freiraum, in dem Menschlichkeit ohne ideologische<br />
(auch: geldideologische) Beschränkung walten kann. In<br />
Tintin legte Hergé den humanistischen Kern jener europäischer<br />
»Jugendbewegungen« wieder frei, den die verschiedensten<br />
Ideologien von ihrem Beginn um 1900 an<br />
erfolgreich zu pervertieren suchten. Die bedingungslose<br />
Freundschaft und Solidarität Tintins gegenüber Tschang,<br />
Zorrino, dem Afrikaner Coco und auch dem ewig aufmüpfigen<br />
Araber Abdallah ist dafür immer wiederkehrendes<br />
Motiv und Symbol. Tintin ist ein Pfadfinder, wie Hergé<br />
einer war. Nur hat sich Tintin völlig von dem Gedanken<br />
der »Gruppe« gelöst. Diese ›Einsamkeit‹ Tintins ist sicherlich<br />
zweischneidig. Hergé hatte aber erfahren, wie sich<br />
<strong>Gewalt</strong>staaten und Ideologien gerade dieses Gruppengedankens<br />
bemächtigten und daraus einen Gruppenzwang<br />
machten. Dagegen setzte er ein intelligentes Individuum,<br />
das selbständig, spontan und mutig zu einem richtigen<br />
und menschlichen Handeln findet.<br />
In diesem Typus und der in ihm enthaltenen Botschaft<br />
einer globalen Verständigung und Sympathie gerinnt in<br />
den »Tintin«-Alben die Hoffnung des verunglückten (kleinen)<br />
20. Jahrhunderts. In dieser Hoffnung besteht auch<br />
die ungebrochene Aktualität von Hergés Helden Tintin<br />
für das 21. Jahrhundert und darüber hinaus.<br />
Alle 21 Bände von »Tim & Struppi« sind im Carlsen Verlag erhältlich<br />
»Auf den Spuren von Tim & Struppi« von Michael<br />
Marr, Carlsen, Hamburg, 208 S., € 35,00<br />
Verlosung<br />
Wir verlosen drei Pakete mit den Alben »Kohle an Bord«,<br />
»Die Krabbe mit der goldenen Schere« und »Das Geheimnis<br />
des Einhorn«. Einfach Mail mit Betreff »Ich möchte Teil einer<br />
Jugendbewegung sein« an tombola@goon-magazin.de senden.<br />
72 1 bilder<br />
bilder 1 73<br />
goon<br />
verlost
text: zuzanna jakubowski<br />
illustration: jiro taniguchi (aus »vertraute fremde«)<br />
Nicht nur von der Breite ihres Buchrückens her erinnern<br />
Jiro Taniguchis durchaus schon einmal 400 Seiten<br />
umfassende, abgeschlossene Manga-Romane an die seit<br />
den 1990er Jahren den alternativen Comicmarkt dominierenden,<br />
amerikanischen graphic novels und ihre europäischen<br />
Nachempfindungen. Auch die wiederkehrenden<br />
Themen und Motive des Aufwachsens und der Selbstfindung<br />
in einer von Anonymität bestimmten Gesellschaft,<br />
die autobiographischen Zwischentöne und die feinfühligen<br />
Charakterportraits hat das umfassende Werk des<br />
vielfach ausgezeichneten japanischen Mangaka mit dem<br />
in der westlichen Welt zuletzt szenebestimmenden Genre<br />
gemein. Schuf Taniguchi zu Beginn seiner Karriere noch<br />
klassische Fortsetzungsgeschichten im Stil der üblichen<br />
– vor speedlines und close-ups strotzenden – Krimi-, Samurai-<br />
und Science-Fiction-Genres, entwickelte er schon in<br />
den 1980ern seinen unverkennbaren, von den frankobelgischen<br />
Comics beeinflussten Realismus abseits von Bambiaugen<br />
und Stachelhaarfrisuren. Mit seiner fünfteiligen<br />
Serie »Botchan no Jidai« über Schriftsteller der Meiji-Ära<br />
(1867–1912) begründete er den literarischen Manga und<br />
schuf die erste seiner zahlreichen, sensiblen Analysen einer<br />
Kultur im Umbruch.<br />
Im Angesicht der Natur<br />
In der Tradition des in den 19 0er Jahren entstandenen<br />
Independent Manga-Genres ›gekiga‹, das sich vor allem<br />
– in Opposition zu den frühen Werken Osamu Tezukas<br />
– für eine realistischere Darstellung in japanischen Comics<br />
einsetzte, sind Taniguchis Geschichten geprägt von<br />
sozialkritischen Tönen: »Die Stadt und das Mädchen«<br />
thematisiert Kindesprostitution, allein erziehende Mütter<br />
und das korrupte Großstadtleben, »Vertraute Fremde« ab-<br />
Die Liebe zum<br />
Hintergrund<br />
jiro taniguchis poetische Autorenmangas<br />
erfassen in kleinen Gesten individuelle und<br />
gesellschaftliche Zusammenhänge<br />
wesende Väter und Alkoholismus, aber auch das Trauma<br />
des Zweiten Weltkriegs und das Wirtschaftswunder der<br />
Nachkriegszeit. In der Geschichtensammlung »Der Wanderer<br />
im Eis« steht das Individuum der gewaltigen Natur<br />
gegenüber und muss lernen, mit ihr und nicht gegen sie<br />
zu handeln: Die Helden sind Goldgräber und Walfänger,<br />
Scheidungskinder und Bärenjäger. Nach und nach fügt<br />
sich aus den einzelnen Erzählungen das feinfühlige Bild<br />
eines individuellen und gesellschaftlichen Entwicklungs-<br />
und Emanzipationsprozesses zusammen.<br />
Raum zur Kontemplation<br />
Ungewöhnlich für den üblicherweise durch Handlung<br />
und Dialog vorangetriebenen Manga ist Taniguchis – den<br />
bandes dessinées entnommene – Liebe zum Hintergrunddetail,<br />
vor dem die Figuren beinahe verwechselbar werden.<br />
Großstadtdschungel, Kleinstadtidylle und wilde Natur<br />
werden auf dem Papier lebendig; klare Linien, ausladende<br />
Tableaus und intime Perspektiven bestimmen die Panels.<br />
Die wahre Kunst dabei besteht darin, den universaltypischen<br />
Figuren – der schönen Frau mittleren Alters, dem<br />
erschöpften Geschäftsmann, dem eigenbrötlerischen<br />
Naturburschen, dem entfremdeten Jungen oder dem<br />
kessen Schulmädchen – in kleinen Gesten Individualität<br />
zu verleihen. Ein Kunststück, das Taniguchi meisterlich<br />
beherrscht. Er lässt seinen Figuren viel Raum, zeigt sie<br />
dem Leser gerade auch in handlungsfreien Momenten<br />
der Kontemplation – im Wasser treibend, am Fuß eines<br />
Berges stehend oder den Wolken nachschauend –, so dass<br />
sie trotz idealtypischer Oberfläche an Tiefe gewinnen.<br />
Von Jiro Taniguchi bisher in deutscher Übersetzung erschienen:<br />
»Der Wanderer im<br />
Eis«, Shodoku /<br />
schreiber&leser, München<br />
2006, 240 S., €14,95<br />
»Die Stadt und das<br />
Mädchen«, Shodoku /<br />
schreiber&leser, München<br />
2007, 336 S., €16,95<br />
Demnächst erscheint:<br />
»Die Sicht der Dinge«, Carlsen,<br />
Hamburg 2008, 288 S., € 14,00<br />
»Vertraute Fremde«,<br />
Carlsen, Hamburg<br />
2007, 409 S., € 19,90<br />
»Gipfel der Götter<br />
– Kamigami no<br />
itadaki«, Shodoku<br />
/ schreiber&leser,<br />
München 2007, 320 S., € 16,95<br />
Neues Töten<br />
Die PC-Spielesammlung the orange box ist eine Kaufempfehlung für alle,<br />
die einen Monat lang nichts anderes zu tun haben wollen<br />
text: robert wenrich<br />
Das Computerspiel »Half-Life 2« ist zwar betagt, aber<br />
immer noch eine grandiose Hatz durch dystopisches<br />
Gelände: Gordon Freemans Kampf gegen die extraterrestrische<br />
Faschistenbande wäre samt seines ersten und<br />
eines zweiten, brandneuen Add-ons für 40 Euro verkauft,<br />
wenn nicht billig, so doch immerhin preiswert. Nur ist die<br />
»Orange Box« mehr als eine branchenübliche ›Gold-Version‹<br />
und entzieht sich, weil sie noch mit zwei weiteren, außergewöhnlichen<br />
und heiß ersehnten Shootern aufwartet,<br />
jeder Preisdiskussion.<br />
Jenseits der Wurmlöcher: »Portal«<br />
Im Gegensatz zu »Team Fortress 2« ist »Portal« ein Vergnügen<br />
für den Herrn Einzelspieler. Als Versuchskaninchen<br />
wird man darin von einer HAL-9000-Kopie – wie das Orginal<br />
moralisch eher indifferent – durch 3D-Rätselkomplexe<br />
gelotst; stets Kuchen in Aussicht stellend, sollte man nur<br />
den nächsten Wachroboter überwinden. Die Levels sind<br />
grau und weiß und von klinischer Strenge, das Rätselinventar<br />
ist knapp. Es besteht aus Kisten, Knöpfen, Türmechaniken<br />
und Zeitdruck. Alles eher unscheinbar, wenn das<br />
Spiel nicht noch ein crazy feature zu bieten hätte: Denn bei<br />
»Portal« ist der Spieler mit einer Portalkanone bewaffnet,<br />
mittels derer er Wurmlöcher in Levelwände und -decken<br />
bohren kann. Hat man beispielsweise einen Abgrund zu<br />
überwinden, öffnet man diesseits wie jenseits ein Portal<br />
und hat die Kluft überwunden. Liegt ein Schalter auf<br />
einem entfernten Plateau, so zielt man auf die Decke darüber,<br />
schießt sich danach den Boden unter den Füßen auf<br />
und schon landet man wie gewünscht in luftiger Höhe.<br />
Ähnlich beseitigt man die Roboter: Portal über sie, Portal<br />
unter eine Kiste, und die Gravitation erledigt den Rest;<br />
die iBiester verabschieden sich stilsicher mit »No hard<br />
feelings«. So durch die Level laufend und durch Nutzung<br />
der Fallbeschleunigung fliegend, wird »Portal« zu einem<br />
großen gymnastischen Spaß – inklusive raumzeitlicher<br />
Verstörungen – und lädt trotz kurzer Dauer zu mehrmaligem<br />
Spielen ein.<br />
Unermüdliches Killerkarussell: »Team Fortress 2«<br />
Wirklich geadelt jedoch wird »The Orange Box« durch den<br />
letzten Titel, der über annähend zehn Jahre (und wie man<br />
heute sieht: erfolgreich) entwickelt wurde. »Team Fortress 2«<br />
ist ein Online-Rollenshooter, in dem der Spieler in eine von<br />
zehn Rollen schlüpft und mit seinem Team versucht – mitunter<br />
durch Verursachung von Personenschäden –, die Gebiete<br />
bzw. Dokumente des gegnerischen Teams zu erobern.<br />
Das Spiel punktet dabei mit wunderbar geschlossenem <strong>Design</strong><br />
und, bei Computerspielen so oft und so schmerzlich<br />
vermisst, mit viel Humor. Nächtelang erstürmt und verteidigt<br />
man in saftiger, an die 1940er Jahre angelegter Grafik<br />
verlassene Reservoirs, Güterbahnhöfe und Bergwerke. Als<br />
Pyro in den Stollen die Arglosen abzufackeln, die feindliche<br />
Unterstützung als getarnter Spion zu erdolchen oder<br />
als Feldarzt den halbtoten Kameraden zu zweiter Luft zu<br />
verhelfen – dank des guten Balancings ist jeder der zehn<br />
Charaktere nützlich, spielbar und liebenswert; unermüdlich<br />
dreht sich deswegen das Killerkarussell.<br />
Das taktisch fordernde »Team Fortress 2« ist ästhetisch<br />
wie dramaturgisch anspruchsvoll, im Ganzen ein bezauberndes<br />
Stück Software, und liefert handfeste Beweise,<br />
warum man Computerspiele zu den darstellenden Künsten<br />
zählt.<br />
»The Orange Box«ist für PC und X-Box 360<br />
bereits erhältlich, die Version für PlayStation 3<br />
erscheint am 17.1.2008 (Electronic Arts)<br />
74 1 bilder<br />
bilder 1 7
Neues aus dem<br />
Dahinterland<br />
Schreiben, Falten, Wenden<br />
– in seinem dritten Abenteuer<br />
als Papierfigur dringt<br />
mario bis in die Tiefen der<br />
Selbstreflexivität vor<br />
text: bernd weintraub<br />
Im Jahr 2000, vier Jahre nachdem er den Weg in die dritte Dimension ebnete,<br />
verlor Mario seinen Schatten. Sein zweidimensionales Alter Ego löste<br />
sich von seinem Meister und begann, auf eigene Faust das Pilzkönigreich<br />
zu erkunden, weniger aktiv, dafür jedoch gründlicher. Nun war aber der<br />
Schritt in die dritte Dimension, in die materielle Welt, schon getan, es gab<br />
kein Zurück mehr, und so wurde Marios alte Flachheit in ihr physisches<br />
Pendant, in Papier, umgemünzt.<br />
Mario und das epische Theater<br />
Schon »Paper Mario« (2000) und »Paper Mario und das Äonentor« (2004)<br />
kommentieren sich selbst und frühere Mario-Spiele. Beide Spiele problematisieren<br />
ihren eigenen Stand zwischen ihrem Genre (dem behäbigen<br />
japanischen Rollenspiel) und ihrer Hauptfigur (Mario, der Bewegung),<br />
indem sie sich eines theatralischen Filters bedienen: des Übergangs vom<br />
Papier zur Bewegung. Beide inszenieren sich als Erzählungen, die eigentlich<br />
in einem Theater stattfinden, und selbst die Kämpfe werden auf einer<br />
Theaterbühne (inklusive Publikum) ausgetragen. Wenngleich es eine<br />
Brecht’sche Bühne ist, denn der Orchestergraben ist längst zugeschüttet<br />
und die Menge bewirft die Protagonisten mit Dosen oder Items, springt auf<br />
der Bühne herum, schlägt sich in die Kulissen.<br />
Vom Theater zur Kulissenskizze<br />
Mit »Super Paper Mario« wird dieser Ansatz weitestgehend aufgegeben, das<br />
verlorene »Super« hält wieder Einzug in den Titel und damit auch ins Spiel.<br />
Super Papier-Mario ist beweglicher, er löst seine Probleme auf direktem<br />
Weg, durch Hüpfen. Dennoch ist die Handlung ebenso komplex und die<br />
Charaktere so vielfältig, wie es sich für ein Rollenspiel gehört. Der Referenzrahmen<br />
ist jedoch nun nicht mehr die Bühne, sondern die technische<br />
Bauzeichnung: Neben unzähligen Schrifttypen und Akzenten, in denen<br />
sich die Gemüter und Stimmungen der Protagonisten ausdrücken, sticht<br />
vor allem die Umgebung ins Auge, die vor dem Betreten eines neuen Kapitels<br />
in klaren, schwarzen, meist geraden Strichen auf den Bildschirm skizziert<br />
wird, ehe sie eingefärbt wird und damit die typische Mario-Ästhetik<br />
annimmt. Allein in diesem Verfahren offenbart die Welt von »Super Paper<br />
Mario« bereits ihre Gemachtheit, die V-Effekte aber reißen nicht ab.<br />
Was ist ›A‹?<br />
Der Clou des Spiels besteht in einem neuen Trick, den Mario erlernt: dem<br />
Flipping. Dadurch kann er die zweidimensionale Papierlandschaft um<br />
90 Grad in eine dreidimensionale Polygonlandschaft drehen. Wo vorher<br />
Striche waren, sind nun Flächen. Massive Berge entpuppen sich als papieren,<br />
und was zuerst als wohlgeordnete Treppe erschien, zerfasert zu einem<br />
Haufen Säulen. Die Figuren kommentieren die Steuermechanismen, ja<br />
ihre Situation als Videospielfiguren, mit Aussagen wie: »Drücke einfach A,<br />
um zwischen 2D- und 3D- Ansicht zu wechseln. Nun, was sagst du? Das zieht<br />
einem die Schuhe aus, nicht wahr? Was A ist? Sollten wir von Bewohnern einer<br />
anderen Dimension beobachtet werden … Diese Wesen würden es verstehen.<br />
Dir fehlen Bartlänge und Verstand dazu.« Mit »Super Paper Mario« erfüllen<br />
Nintendo und Intelligent Systems die obersten Kriterien moderner Kunst,<br />
Selbstreflexivität und Kommentar. Die sprichwörtliche Geduld des Papiers<br />
macht so etwas in der bewegten Welt der Videospiele möglich.<br />
»Super Paper Mario«, für die Wii erhältlich (Nintendo)<br />
Ein Hoch auf den blauen Bomber!<br />
Der Videospiel-Held mega man wird Zwanzig. Gratulation und Resümee<br />
text: dan gorenstein<br />
Seine wildesten Partys hat er schon hinter<br />
sich. Die großen Weltrettungsaktionen, die<br />
Zeit der ungebrochenen Begeisterungsstürme.<br />
Er gilt als das meistmissbrauchte Computerfirmenmaskottchen.<br />
Hat versucht, es dem Klempner<br />
nachzutun. Hat Fußball gespielt, sich mit dem Rest der<br />
Capcom-Bagage geprügelt, er ist Rennen gefahren, ja, er<br />
hat sich sogar den Kindern als neuer Yu-Gi-Oh! in seiner<br />
»Battle Network«-Reihe angebiedert. In Ehre gealtert ist<br />
der blaue Bomber Mega Man wahrlich nicht. Aber wann<br />
immer er sich in seine alte Kampfrüstung schwingt, den<br />
»Megabuster« lädt und gegen acht »Robot Master« in den<br />
Kampf zieht, ist er so jung, als wäre es noch einmal 1987.<br />
Dann gleitet er durch die Levels, als hätte er nie etwas<br />
anderes getan, und wir glauben ihm sogar, dass es so ist,<br />
drücken ein Auge zu.<br />
Rocker, Revolutionär …<br />
1987 nämlich war er ein Rocker so wie Mick<br />
Jagger, ein Revoluzzer so wie Wladimir<br />
Iljitsch Uljanow. Er mag zwar nicht<br />
Konzerthäuser gefüllt oder gar die Jugend<br />
emanzipiert haben, und auch<br />
der Sozialismus hat sich ganz ohne<br />
sein Zutun aus den Wirren der Geschichte<br />
erhoben. Aber damals hat<br />
er vielen Leuten gezeigt, wo die Reise<br />
hingehen wird, hat Seite an Seite<br />
mit seinem großen Vorbild Mario<br />
für ein besseres gameplay gekämpft<br />
und ist dabei an Orte vorgedrungen,<br />
die selbst Nintendos Klempner erst Jahre<br />
später entdecken sollte. Mario hat uns<br />
damals zwar den Levelfluss gebracht, hat<br />
uns aus den eng begrenzten Einzelbildschirmen<br />
herausgeführt, Mega Man aber hat als erster die<br />
Level als Ganzes verlassen. Jeder seiner Widersacher<br />
brachte seinen eigenen, frei anwählbaren Level<br />
mit sich. Der Spieler konnte die Reihenfolge, in der<br />
er gegen die Kampfroboter antreten wollte, selbst<br />
wählen; das mag heute banal klingen, aber ohne<br />
diese Neuerung hätte es weder »Grand Theft Auto«<br />
noch »Super Mario Bros. 3« gegeben.<br />
… und Tänzer<br />
Überhaupt sind es weniger die Levels,<br />
die die »Mega Man«-Spiele<br />
ausmachen als vielmehr die<br />
Roboterbosse. Jeder hat seinen<br />
eigenen Rhythmus, sei-<br />
ne Stärken und Schwächen. Sie kündigen sich stets durch<br />
eine Schleusentür an, dahinter die Schleuse; eine Aufforderung,<br />
sich zu sammeln, den Level zu vergessen und sich<br />
ganz auf den Kampf gegen den Boss zu konzentrieren.<br />
Mega Man wird in Japan Rock Man genannt; den Namen<br />
trägt er tatsächlich als Verweis auf den Musikstil, und vor<br />
allem an den Endgegnern zeigt sich warum. Denn der<br />
Kampf auf engstem Raum, auf einem Bildschirm, kann<br />
nichts anderes sein als ein Tanz: Das akribische Einprägen<br />
und flüssige Absolvieren klar definierter Schrittfolgen.<br />
Tanz und Musik sind tatsächlich die beiden Momente,<br />
welche die Spielreihe bestimmen. Die klassischen »Mega<br />
Man«-Tracks gehören zum Besten, was eine 8-Bit-Konsole<br />
je an Sound produziert hat, und auch heute noch tragen<br />
die Melodien auf dem DS im neuesten Spiel »Mega Man<br />
ZX« den Spieler wie selbstverständlich durch die nach<br />
wie vor liebevoll gestalteten Levels. In seinen besten Momenten,<br />
heute wie damals, ist Mega Man,<br />
genauso wie sein alter Kampfgefährte<br />
Mario, reine Bewegung, Flow; kein<br />
Bomber, sondern ein Tänzer.<br />
»Mega Man ZX« ist für den Nintendo DS erhältlich (Capcom)<br />
76 1 bilder<br />
bilder 1 77
white cubes text: eileen seifert<br />
Norbert Bisky: »Armageddon« (2007), Öl auf Leinwand, 280x400cm, Courtesy Galerie Crone, Berlin;<br />
Leo Koenig Inc., New York, © VG-Bild Kunst Bonn 2007<br />
»Kunst für alle« – so tönte es demokratisch im kunstolympischen<br />
Jahr 2007. Das öffentliche Interesse an Veranstaltungen<br />
wie documenta 12, Skulpturenprojekt Münster<br />
oder der Biennale in Venedig war groß und reflektierte<br />
ähnlich den Schlangen vor einschlägigen Schauen, dass<br />
die einst elitäre Hochkultur endlich wieder im Volke angekommen<br />
ist. Nachdem die Neue Nationalgalerie zuletzt<br />
Platz für die »Schönsten Franzosen« geschaffen hatte,<br />
wurden diese nun zurück zum Big Apple gesendet und<br />
wurde die eigene Sammlung neu arrangiert. Dazu gibt es<br />
eine Retrospektive des griechisch-italienischen Arte Povera-Begründers<br />
Jannis Kounellis zu sehen, der bereits seit<br />
den 1960er Jahren so genannte ›arme‹ Materialien in der<br />
Kunst verwendet und damit in einer Liga mit ehemaligen<br />
Kollegen wie Beuys spielt. Kounellis’ größter Coup war<br />
die Ausstellung lebendiger Pferde in einer blütenweißen<br />
Galerie – inklusive Stallgeruch. Ein durchaus ironisch-kritischer<br />
Angriff auf die glatte Kunstwelt. Im labyrinth<br />
– einem Irrgarten aus rund 160 Stahlelementen – zeigt<br />
Kounellis jetzt etwa 20 Arbeiten aus insgesamt 0 Jahren.<br />
Auf eine mindestens ebenso lange Zeit bezieht sich der<br />
Titel der neuen Ausstellung in den Kunstwerken: history<br />
Will repeat itself. Die künstlerische Variante<br />
des populären re-enactments – der historisch korrekten<br />
Inszenierung und Aufführung vergangener gesellschaftlicher<br />
Ereignisse – ist durch die Befragung der Gegenwart<br />
im Hinblick auf ihre Vergangenheit geprägt. Dabei setzen<br />
sich internationale Künstler kritisch mit einer medial<br />
präsentierten Geschichte auseinander, die wiederum<br />
auf die Medienbasiertheit unseres kollektiven Gedächtnisses<br />
verweist. Welch starke Bilder die Medien beim<br />
Betrachter hinterlassen, ist auch die Frage, die Norbert<br />
Bisky in seiner Malerei beleuchtet. Seine Gemälde voller<br />
Blondschöpfe und Blauäugigkeit verlinken sich mit propagandistischen<br />
Helden-Bildern deutscher Geschichte<br />
und zeitgenössischer Werbe-Ästhetik. Nur manches Mal<br />
wird ein strahlender Himmel von schwarzen Fliegern<br />
verdunkelt, die goldschnittige Jungenhaftigkeit durch<br />
Foto: Bernd Borchardt<br />
abgetrennte Häupter getrübt – Abgründe, die unter der<br />
kitschig-klischeehaften Oberfläche lauern. ich War’s<br />
nicht lautet das unschuldige Statement, unter dem Biskys<br />
aktuelle Bilder gemeinsam mit Arbeiten zu sehen sind,<br />
auf die sie sich beziehen (u.a. von Georg Baselitz, Walter<br />
Leistikow, Jim Dine). Mit der heutigen, schnelllebigen,<br />
durch Mobilität und Migration geprägten Zeit, in der die<br />
eigene Identität zum Zufluchtsort geworden ist, beschäftigt<br />
sich hingegen die Ausstellung neue heimat in der<br />
Berlinischen Galerie, eine interessante Zusammenschau<br />
von 29 in Berlin lebenden deutschen und internationalen<br />
Künstlern. Die Definitionen des Heimatbegriffs drehen<br />
sich um Lebensräume, Behausungen, Erinnerungen. Im<br />
Hamburger Bahnhof residiert – in Form seiner schier unerschöpflichen<br />
Sammlung – ja immer wieder Herr Flick.<br />
Diese Tage ist eine erste umfassende Ausstellung, zusammengestellt<br />
aus seiner Sammlung und Leihgaben, zum<br />
Künstler Roman Signer zu sehen. Signers Werke – Objekte,<br />
Zeichnungen, Fotografien, Super-8-Filme, Videos und eine<br />
Außenskulptur im Innenhof – geben Aufschluss über<br />
sein Schaffen seit den 1970er Jahren. Doch auch besinnt<br />
man sich des alten Museumsauftrags besonnen und zeigt<br />
daneben die nicht unwichtigen Neuerwerbungen zeitgenössischer<br />
Videokunst und Malerei. von bill viola bis<br />
aernout mik reicht das von der Arbeit »Refraction« des<br />
Niederländers Mik dominierte Spektrum. Zudem gibt es<br />
Filme von Jack Goldstein und der Künstlergruppe Die<br />
tödliche Doris sowie Gemälde von Dexter Dalwood, Eberhard<br />
Havekost, Raoul de Keyser und Chris Newman zu<br />
bestaunen.<br />
»Janis Kounellis: Labyrinth«, Neue<br />
Nationalgalerie, Berlin, bis 24.2.2008<br />
»History Will Repeat Itself – Strategien des Reenactment in der<br />
zeitgenössischen Kunst«, Kunstwerke, Berlin, bis 13.1.2008<br />
»Norbert Bisky – Ich war’s nicht«,<br />
Haus am Waldsee, Berlin, bis 13.1.2008<br />
»Neue Heimat – Berlin Contemporary«,<br />
Berlinische Galerie, bis 7.1.2008<br />
Nimm 2<br />
gilbert & george<br />
haben für die Kunst<br />
das Duo erschaffen. Ein<br />
fruchtbarer Entwurf,<br />
wie die diesjährige<br />
Retrospektive im<br />
Münchener Haus der<br />
Kunst verriet<br />
text: sebastian hinz<br />
foto: »george the cunt and gilbert<br />
the shit«, hatje & cantz, abb.6<br />
Don Quijote y Sancho Panza. Terence Hill e Bud Spencer.<br />
Paul Simon and Art Garfunkel. In Literatur, Film und<br />
Musik ist es ein bewährtes Konzept, eine Doppelspitze in<br />
die Welt zu schicken. Ungleiche Paare, zwei fremdelnde<br />
Charaktere und doch zwei Seiten derselben Medaille. Für<br />
die Bildende Kunst haben Gilbert Prousch und George<br />
Passmore diese Idee nutzbar gemacht und sich selbst als<br />
die Figuren Gilbert & George inszeniert, bis diese nicht<br />
mehr von den Künstlern Prousch & Passmore zu unterscheiden<br />
waren. Sie sind zu ›lebenden Skulpturen‹ geworden<br />
und halten das nach eigenen Aussagen für ihre<br />
Cyborgs der<br />
Globalisierung<br />
peter bialobrzeski zeigt in seinen<br />
Fotografien urbane Totenräume und<br />
verlorene Orte des Übergangs<br />
text: jens pacholsky fotos: peter bialobrzeski<br />
Anträge auf Bau- und Neustrukturierungsprojekte sind<br />
wie kleine Utopien. Sie erzählen von der Zusammenführung<br />
der Menschen, der Überbrückung architektonischer<br />
Gegensätze, vom Fortschritt und der Spiegelung des Technologiezeitalters.<br />
Modern möchten die Stadtverwalter ihre<br />
Reviere erscheinen lassen, glänzend und einladend. Orte<br />
des Lebens sollen sie sein, selbst wenn der tausendste Standardbau<br />
eines Konsum- oder Bürotempels, der äußerlich<br />
Individualität vortäuscht, in ein Neubaugebiet verpflanzt<br />
wird. Peter Bialobrzeski hat sich mit seiner alten Kamera<br />
in die Räume dieser Neuerschließungen begeben und gleichermaßen<br />
beeindruckende wie desillusionierende Bilder<br />
aus 28 Städten und 14 Ländern gefunden. Dabei ging es<br />
dem Fotografen und Dozenten an der Hochschule für<br />
Künste in Bremen weniger um die Architektur an sich.<br />
Vielmehr ihre (fehlende) Verbindung zur Umwelt, die<br />
größte Erfindung. Ob in knallbunten Pop-Art-Gebilden,<br />
kaleidoskopischen Prismen, roten Fotografien oder Kohlezeichnungen,<br />
seit ihrem ersten Zusammentreffen am 2 .<br />
September 1967 in der Skulpturenklasse der Kunsthochschule<br />
im englischen Oxford (»Es war Liebe auf den ersten<br />
Blick«), zieren sie die Mehrzahl ihrer Werke gemeinsam. So<br />
sind die Ausstellungsstücke nicht nur eine Beschäftigung<br />
mit der Gegenwart, mit Politik, Gesellschaft, Kunst, sondern<br />
ebenso eine Projektion der zwei beiden in der Zeit.<br />
Die Kunst von Gilbert & George ist auch die Geschichte<br />
von Gilbert & George.<br />
»Gilbert & George. Die große Ausstellung« fand<br />
Schaffung von globalen und globalisierten »Un-Orten«, ist<br />
es, die sich in seinen breitformatigen Aufnahmen offenbart<br />
– modernisierte Räume, die im Übergang verloren gingen.<br />
Ein goldener Shoppingpalast steht da vor zerfallenden<br />
Ziegelhütten, deren Wellblechdächer mit dem Debris der<br />
Stadt am Boden gehalten werden. Einsame Inseln der Industrie<br />
und des Kapitals, zuweilen mitten im Nichts, die<br />
gerade im Zwielicht der Dämmerung, nach Feierabend,<br />
zu entleerten Totenräumen transformieren und in den<br />
simplen Perspektiven des 46-Jährigen zu unbezwingbaren<br />
Cyborgs erstarren.<br />
»Lost in Transition« von Peter Bialobrzeski,<br />
Hatje Cantz, Ostfildern 2007, 128 S., € 39,80<br />
78 1 bilder<br />
bilder 1 79<br />
review
eview<br />
Chronik einer<br />
doppelten<br />
Vertreibung<br />
persepolis ist eine außergewöhnlich<br />
gelungene Verfilmung des gleichnamigen<br />
Comics von Marjane Satrapi<br />
text: patrick küppers illustration: prokino<br />
Ein Kind träumt eine Welt, die dem Traum eines Verrückten<br />
gleicht. Während ihr Onkel Anouche der achtjährigen<br />
Marjane die Geschichte seines Exils erzählt, sieht sie sein<br />
scharfes Profil durch in betörende Arabesken erstarrte<br />
Landschaften wandern. Die Reisen des Onkels sind der<br />
epische Weg eines Prinzen aus tausendundeiner Nacht.<br />
Er hat aber zur Enttäuschung Marjanes keine Prinzessin<br />
mitgebracht, und seine Hoffnungen nach dem Sturz des<br />
Schahs zerschlagen sich schnell. Auch die neuen, religiösen<br />
Machthaber sperren ihn ein, richten ihn sogar hin.<br />
Für die Zeichnerin Marjane Satrapi bedeutet »Persepolis«<br />
das Glück der Kindheit und ein großes, reiches Land, in<br />
Fehler im System<br />
ang lees »Gefahr und Begierde« stellt auf eindringliche Weise<br />
die Unberechenbarkeit des anarchischen Herzens dar<br />
text: vera hölscher foto: tobis film<br />
Kontrolle und Macht sind zwei der Dinge, nach denen der Mensch strebt. Doch selbst<br />
in Zeiten des elektronischen Fingerabdrucks und Google Earth bleibt ihm die Kontrolle<br />
über ein vitales Element verwehrt: das Herz. Der Unberechenbarkeit des Herzens<br />
widmet Regisseur Ang Lee sich auch in seinem neuen Film »Gefahr und Begierde« und<br />
legt den Schauplatz dieses leise agierenden Dramas in das von Japan besetzte China der<br />
1940er Jahre. Ebenso unfreiwillig wie die junge Studentin Wang Jiazhi (Tang Wei) in den<br />
Widerstand geraten ist, kann sie sich ihrer Gefühle für den Geheimdienstler Mr. Yi (Tony<br />
Leung Chiu Wai), welcher durch ihre Hilfe ermordet werden soll, nicht erwehren.<br />
Während beide nach und nach in einen Sog aus körperlicher Obsession, Leidenschaft,<br />
Liebe und Hass geraten, muss Jiazhi den inneren Konflikt zwischen auszuführendem<br />
Auftrag und Gefühlen austragen.<br />
Zur Darstellung der emotionalen Beziehung zwischen Wang Jiazhi und Mr. Yee bedient<br />
sich Lee weniger an Worten, es sind vielmehr kleine Gesten und Blicke, unter deren<br />
zurückhaltender, ruhiger Oberfläche sich die unterdrückte Leidenschaft, die innere<br />
Zerrissenheit und die Ambivalenz zwischen gegenseitigem Miss- und Vertrauen umso<br />
heftiger regen und in explosiven, atemberaubend intensiven und ehrlichen <strong>Sex</strong>szenen<br />
zum Ausbruch kommen. Verstärkt wird der Ausdruck widersprüchlicher Empfindungen<br />
noch durch die wunderschöne, ebenso wie die Charakterzeichnung dezente und unaufdringliche<br />
Szenerie des damaligen, von einer gespaltenen Gesellschaft geprägten China<br />
und die klassische, schwermütige Musik, und am Ende scheint einmal mehr klar, dass<br />
der Gedanke des freien Willens eine einzige Illusion ist.<br />
80 1 bilder<br />
»Gefahr und Begierde« von Ang Lee, seit 18.10.2007 im Kino (Tobis)<br />
dem sie aufwuchs. Beides versank vor den großen Augen<br />
der kleinen Marjane in einem Strudel von Blut, <strong>Gewalt</strong><br />
und Terror, und aus beidem wurde sie vertrieben. In zwei<br />
erfolgreichen Comicbänden hat Satrapi, die heute in Paris<br />
lebt, ihre Geschichte in eine Art phantastisch-expressionistischen<br />
Realismus gefasst. Gerafft und mit einer überarbeiteten<br />
Linienführung, liegt davon nun eine gelungene<br />
Filmfassung vor. Der Film, für den Satrapi mit Vincent<br />
Paronnaud zusammenarbeitete, entwickelt den unverkennbaren<br />
Stil der Comics zu einer eigenen Sprache weiter<br />
und bringt zugleich die Comicbilder zur vollen Entfaltung;<br />
einige Passagen zu Beginn des Films werden dadurch zu<br />
großen Momenten des Zeichentrick überhaupt. Es bleibt<br />
also am Ende der Triumph der Phantasie. Der unbedingte<br />
Widerstand dagegen, sein Träumen aufzugeben, ist die ästhetische<br />
Kraft des Comics und nun auch des Films.<br />
»Persepolis« von Marjane Satrapi & Vincent<br />
Paronnaud, seit 22.11.2007 im Kino (Prokino/Fox)<br />
Teile, verbinde,<br />
herrsche!<br />
Der Anime fullmetal alchemist<br />
beschreibt die aufgeteilte Welt als einen<br />
traurigen Ort voller unerlöster Figuren<br />
text: dan gorenstein illustration: panini video<br />
In einem Land, in dem es scheinbar nur zwei gesicherte<br />
Wissenschaften gibt – die Alchimie und die Kunst des Prothesenbaus<br />
– sind die Brüder Edward und Alphonse Eldric<br />
Staatsalchimisten: »Hunde des Militärs«, wie sie sich selbst<br />
nennen. Beide sind nach einem Experiment verkrüppelt:<br />
Edward hat eine Arm- und eine Beinprothese, Alphonse<br />
ist gar völlig körperlos, sein Bewusstsein alchimistisch an<br />
eine leere Ritterrüstung gebunden. Gemeinsam suchen<br />
diese seltsamen Existenzen ihre Tragödie rückgängig zu<br />
machen, das Kernproblem der Alchimie zu überwinden:<br />
das Gesetz des äquivalenten Tausches. Denn Alchimie<br />
betreiben heißt in erster Linie Opfer bringen. Um etwas<br />
zu bekommen, muss man etwas anderes aufgeben. Die<br />
einzige Möglichkeit, dieses Prinzip zu umgehen, ist der<br />
sagenumwobene Stein der Weisen. Und wie sich im Verlauf<br />
der Anime-Serie »Fullmetal Alchemist« herausstellt,<br />
ist auch der nur durch erhebliche (Menschen-)Opfer zu<br />
erlangen.<br />
Jedes Element der Serie lässt sich durch das Gesetz<br />
des äquivalenten Tausches beschreiben: Ed opfert seine<br />
Freiheit, um Zugang zu den vom Militär verwalteten Bibliotheken<br />
zu erhalten. Dennoch bleibt der Eindruck bestehen,<br />
dass jeder Tausch auch Verlust in sich trägt. Der<br />
Prozess fordert seinen Tribut; es wird eben nicht nahtlos<br />
das Eine in das Andere übersetzt, sondern es gibt Abnutzungserscheinungen.<br />
Die meisten Figuren, denen die Brüder<br />
begegnen, haben diese Einsicht schon längst hinter<br />
sich, sind allesamt seelisch und körperlich verstümmelt,<br />
jagten einst hehren Zielen nach, die längst zur Pragmatik<br />
oder Menschenverachtung verkommen sind. Die Teile<br />
sind eben doch weniger als ihre Summe.<br />
»Fullmetal Alchemist« erscheint fortlaufend<br />
auf 12 DVDs bei Panini Video<br />
A Crown of<br />
Frozen Tears<br />
Eine sensationelle Edition von<br />
»The Saddest Music in the World«<br />
würdigt das Werk des kanadischen<br />
Filmemachers guy maddin<br />
text: jochen werner foto: cinema surreal<br />
review<br />
Wie müsste sie wohl klingen, die traurigste Musik der<br />
Welt? Diese Frage nimmt die kanadische Brauereimogulin<br />
Lady Port-Huntly (»If you’re sad and like beer, I’m<br />
your lady!«) zum Anlass, einen Wettbewerb in Winnipeg,<br />
Kanada – der »Welthauptstadt der Sorgen« – auszurufen,<br />
der klären soll, welche Nation über das traurigste Liedgut<br />
verfügt. Vor diesem skurrilen Hintergrund kleidet Guy<br />
Maddin ein familiäres Fünfecksmelodram in die Mimikry<br />
eines Länderkampfes zwischen Kanada (»Red Maple Leaves«),<br />
den USA (Broadway!) und – Serbien. Der leidgeprüfte<br />
›Gavrilo The Great‹ nämlich tritt an, um das Leid der<br />
neun Millionen Gefallenen des auf serbischem Boden begonnenen<br />
Ersten Weltkriegs zu besingen ... Guy Maddin<br />
gehört seit 20 Jahren zu jenen bedeutenden Regisseuren<br />
des Weltkinos, deren Werk in Deutschland nahezu vollständig<br />
ignoriert wird. Mit einer ganz individuellen Handschrift<br />
versehen und mit Techniken und Stilmitteln des<br />
frühen (Stumm-)Films inszeniert, bersten seine Filme nur<br />
so vor visueller und narrativer Imaginationskraft – und<br />
lassen doch nie vergessen, dass sie im Grunde auf bizarre<br />
Weise autobiografische Tragödien sind, verschüttet unter<br />
dicken Schichten von Ironie und Selbstreferentialität. Mit<br />
»The Saddest Music in the World« erscheint nun die erste<br />
deutsche DVD eines Maddin-Films in einer sensationellen<br />
Edition, die zusätzlich vier Kurzfilme sowie mit »Cowards<br />
Bend the Knee« einen weiteren Langfilm des Regisseurs<br />
enthält. Eine kleine Werkschau und vielleicht die wichtigste<br />
DVD des Jahres.<br />
»The Saddest Music in the World« von Guy Maddin, seit<br />
2.11.2007 auf DVD (Cinema Surreal/b-ware!media)<br />
bilder 1 81
eview<br />
Das Buch zum Buch<br />
zum Spiel<br />
Mit einem Parforceritt durch die<br />
Philosophie des Gnothi Seauton<br />
verschaffen sich die gelben Springfielder<br />
nach Jahren der Verwurstung endlich<br />
Zutritt zum Olymp der erwähnenswerten<br />
Videospiele: die simpsons – das spiel<br />
text: dan gorenstein<br />
Jedes Zeitalter findet seine eigene Metaphorik, um die<br />
Welt zu beschreiben. Mal ist sie ein Buch, dann wieder ein<br />
Uhrwerk, und schließlich: ein Videospiel. Und trotzdem<br />
lässt es sich nicht wegdiskutieren: Das Buch prägt noch bis<br />
heute unsere Sicht auf die Welt, gliedert sie in Seiten, Abschnitte<br />
und Kapitel. So auch für Bart, der in seinem Spiel<br />
eben jenes, nämlich die Anleitung zum Simpsons-Game,<br />
aus dem Himmel vor die Füße geworfen bekommt. In den<br />
Epistemologien seiner Zeit geschult, schlägt er darin natürlich<br />
sofort seine Videospiel-Kräfte nach, an eine Einleitung<br />
scheint er nicht zu denken.<br />
Nach und nach erfahren alle Simpsons von ihren neuen<br />
Kräften und toben sich sofort in der ihnen zu Füßen liegenden<br />
Welt aus, bis sie mit einer neuen Kraft konfrontiert<br />
werden: dem Plot. Die Aliens Kang und Kodos besetzen<br />
Springfield, und weil mit großer Videospiel-Power große<br />
Verantwortung kommt, versuchen sich die Simpsons als<br />
Weltretter. Nur leider sind ihre Kräfte nicht stark genug,<br />
und also müssen sie ins Herz der Videospiele reisen, um<br />
den Cheating-Guide zu finden. Natürlich wirft dies Fragen<br />
auf, und so wird aus der Suche nach neuen Kräften<br />
die Suche nach demjenigen, der ihnen das angetan hat:<br />
dem Schöpfer, Matt Groening. Der aber denkt nicht daran,<br />
Rede und Antwort zu stehen; nein, er bombardiert die<br />
Simpsons mit Anwälten und »Futurama«-Charakteren.<br />
Und während Kang und Kodos weiterhin munter die Welt<br />
zerstören, bleibt den Simpsons keine andere Wahl, als sich<br />
mit dem Schöpfer Groenings kurzzuschließen: dem Weltenautor,<br />
-uhrmacher und -spieler, mit Gott.<br />
»Die Simpsons – Das Spiel«, für Nintendo DS,<br />
Nintendo Wii, PlayStation 2, PlayStation 3, Sony<br />
PSP und XBOX 360 erhältlich (Electronic Arts)<br />
Das Artefakt<br />
und die Spur<br />
Daedalic Entertainment treibt mit<br />
zwei neuen Veröffentlichungen die<br />
Renaissance des point-and-clickadventures<br />
voran<br />
text: bernd weintraub<br />
Der Blick, den wir auf die Welt werfen, bestimmt, was<br />
wir sehen. Bei Computerspielen ist es tatsächlich so, dass<br />
nur dieser Blick uns die virtuelle Welt sehen lässt. Denn<br />
ohne ihn, ohne das, was wir auf Monitoren oder Fernsehern<br />
zu sehen bekommen, findet die virtuelle Welt nicht<br />
statt. Momentan dominiert der immersive Blick, der Blick<br />
durch die Windschutzscheibe des Schädels, der gefälschte<br />
Blickausschnitt des Egoshooters. Ohne weitere Hilfsmittel<br />
kann sich die Spielwelt wohl kaum enger um den Spieler<br />
schließen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit,<br />
den Spieler an seine virtuelle Umgebung zu fesseln: das<br />
Detail. Während Egoshooter davon leben, Raumveränderung<br />
und Bewegung in eins zu setzen, macht das Pointand-Click-Adventure<br />
das exakte Gegenteil; es etabliert<br />
einen unveränderlichen Raum, der zur Aufgabe wird und<br />
dadurch in das Bewusstsein des Spielers eindringt. Dieser<br />
wird zum Forensiker in einer Welt, die weniger dynamisch<br />
als vielmehr pittoresk ist. Die Spuren und Gegenstände<br />
werden aus ihrer Umgebung herausgelesen, in neue Umgebungen<br />
imaginiert, zweckentfremdet und vor allem<br />
kommentiert wie in »Ankh – Kampf der Götter«, denn das<br />
Point-and-Click-Adventure war schon immer selbstrefentiell<br />
und auf eigene Kosten komisch. Mit »Sinking Island<br />
– Mord im Paradies« erreicht dieses ein wenig in die Jahre<br />
gekommene Genre jedoch eine Ernsthaftigkeit und Spannung,<br />
die sowohl in der Intensität als auch inhaltlich mit<br />
den großen Egoshootern mithalten kann, und auf seine<br />
Art ist auch »Sinking Island« selbstreferentiell, denn es<br />
legt den Grundmechanismus seines Genres offen: die Polizeiarbeit.<br />
»Ankh – Kampf der<br />
Götter«, für PC erhältlich<br />
(Daedalic/Xider/Deck 13)<br />
»Sinking Island – Mord im<br />
Paradies«, für PC erhältlich<br />
(Daedalic/Xider/White Birds)<br />
Bislang galten Videospiele als Zeitverschwendung. Ein lukratives<br />
Geschäft für Händler und Hersteller, denn es gab<br />
ja den Markt und die entsprechenden Abnehmer, aber<br />
eine Nullnummer für den Endverbraucher. Die Spiele wurden<br />
gespielt, vom Standpunkt der Produktivität jedoch hat<br />
man dabei nur verloren. Deshalb waren Videospiele bis<br />
jetzt eher Kinderkram; sobald das Individuum sich vollständig<br />
in die Gesellschaft eingegliedert hatte, war fürs Spielen<br />
keine Zeit mehr. Gleichzeitig brachte die Heimcomputerrevolution<br />
der 1980er Jahre eine Reihe von Erkenntnissen<br />
mit sich, die von den Herstellern als Repräsentanten der<br />
produktivitätsorientierten Gesellschaft fruchtbar gemacht<br />
werden konnten: Inhalte werden schneller und exklusiver<br />
aufgenommen, wenn sie über einen Bildschirm vermittelt<br />
werden (das wusste man schon von der Einführung des Kinos<br />
bzw. des Fernsehens), und durch die Interaktion des<br />
Konsumenten mit den Inhalten wird die Verbindung gar<br />
noch weiter intensiviert. Je intuitiver das Interface, desto<br />
größer die Bereitschaft, sich mit den Inhalten auseinander<br />
zu setzen. Die Unzufriedenheit mit der unproduktiven<br />
Nutzung von Computerspielen und den Möglichkeiten,<br />
die sie auf der anderen Seite boten, mündete zunächst<br />
in einen Haufen Lernsoftware für Kinder. Wenn Kinder<br />
schon Computerspiele spielen mussten, dann konnten sie<br />
doch wenigstens etwas dabei lernen, so die Idee. Das wahre<br />
Potential aber lag im Umkehrschluss: Wenn man schon etwas<br />
lernen muss, warum es nicht spielerisch tun? Nintendo<br />
hat 200 diese Idee konsequent mit dr. kaWashimas<br />
gehirn-jogging – Wie fit ist ihr gehirn? marktfähig<br />
gemacht. Ende 2004 bereits ist der Nintendo DS in<br />
Japan erschienen, die erste groß angelegte Konsole mit<br />
einem Touchscreen; und ohne dieses Eingabeschema, diese<br />
Schnittstelle, wäre »Gehirn-Jogging« niemals zu einem<br />
derart großen Erfolg geworden. Das Konzept ist einfach<br />
perfekt: vom promovierten Wissenschaftler im Titel, der<br />
für die nötige Seriosität sorgt, über den an Intelligenztests<br />
erinnernden sparsamen Umgang mit Farben bis zum<br />
Versprechen, das Training nehme nur ca. zehn Minuten<br />
in Anspruch, fördere aber bei regelmäßigem Absolvieren<br />
text: dan gorenstein schnittstellen<br />
die geistige Flexibilität. Es stimmt einfach alles: Einfache<br />
Kopfrechenaufgaben, Leseübungen und natürlich Sudoku.<br />
Die einfachen logikorientierten Zahlenrätsel sind nicht<br />
zufällig nahezu zeitgleich von Japan nach Europa herübergeschwappt.<br />
Mit dem Erfolg kamen die Nachahmer<br />
und Nachfolger. So das jüngst erschienene big brain<br />
academy für die Wii. Das prominenteste Feature dieser<br />
wesentlich verspielteren Reihe, die ihr Debüt ebenfalls<br />
auf dem DS gab, ist ein als »Gehirn-Sprint« bezeichneter<br />
Modus. Hier treten die Spieler nicht mehr gegen die Zeit,<br />
also gegen sich selbst, sondern gegen bis zu drei andere<br />
Spieler an, was das Ganze näher an Party-Games heranrückt.<br />
Für den DS ist nun auch ein zweiter Teil zum Originalspiel,<br />
dr. kaWashima: mehr gehirn-jogging,<br />
erschienen: andere Trainingsaufgaben, optimierte Handschriftabfrage,<br />
neue Sudoku. Der notwendige Nachfolger<br />
für all diejenigen, die seit fast zwei Jahren täglich mit ihrem<br />
Gehirn um den Block laufen. Eindeutiger im Hinblick auf<br />
die Ergebnisse sind das Programm english training<br />
– spielend englisch lernen sowie der Nachfolger<br />
practise english! meistern sie typische alltagssituationen.<br />
Mit den für »Gehirn-Jogging« entwickelten<br />
Methoden werden spielend Aussprache und<br />
Vokabelfülle verbessert. Dieses Programm ist nun eindeutig<br />
an ein erwachsenes Publikum gerichtet, denn man lernt<br />
die Sprache nicht neu, man entrostet sie. Jüngster Zuwachs<br />
in der von Nintendo als »Touch! Generations« bezeichneten<br />
Spielefamilie ist augen-training – trainieren und<br />
entspannen sie ihre augen. Wie der Name sagt,<br />
handelt es sich hierbei um ein Programm zur Schulung der<br />
visuellen Auffassungsgabe – ein extrem wichtiges Training<br />
für professionelle Computerspieler.<br />
»Augen-Training – Trainieren und entspannen<br />
Sie ihre Augen« (Nintendo DS)<br />
»Big Brain Academy« (Nintendo DS, Nintendo Wii)<br />
»Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging – Wie fit ist Ihr Gehirn?« (Nintendo DS)<br />
»Dr. Kawashima: Mehr Gehirn-Jogging« (Nintendo DS)<br />
»English Training – Spielend Englisch lernen« (Nintendo DS)<br />
»Practise English! Meistern Sie typische Alltagssituationen« (Nintendo DS)<br />
82 1 bilder<br />
bilder 1 83
das goon® abo + prämie*<br />
Sun Electric<br />
Lost + Found:<br />
1998 – 2000<br />
cd | shitkatapult<br />
A Whisper<br />
In The Noise<br />
Dry Land<br />
cd | exile on<br />
mainstream<br />
Frank<br />
Bretschneider<br />
Rhythm<br />
cd | raster noton<br />
Richie Hawtin<br />
Concept 1 /<br />
Variations<br />
2cd | minus<br />
V.A.<br />
Space &<br />
Time<br />
cd | hotflush<br />
ADAM OLSCHEWSKI<br />
Ewa<br />
Roman<br />
ROGNER & BERNHARD<br />
Bernd M. Scherer<br />
und Detlef Diederichsen<br />
(hrsg.)<br />
Das vermessene<br />
Paradies. Positionen<br />
zu New York<br />
sachbuch | verlag<br />
theater der zeit<br />
Adam<br />
Olschweski<br />
Ewa<br />
roman | rogner &<br />
bernhard<br />
Roman Simić<br />
In was wir uns<br />
verlieben<br />
erzählungen + cd |<br />
voland & quist<br />
<strong>Chuck</strong> Palahniuk<br />
Das Kainsmal<br />
roman | manhattan<br />
verlag / randomhouse<br />
Niclas Östlind,<br />
Louise Fogelström<br />
(hrsg.)<br />
Fiction Is No<br />
Joke<br />
bildband | hatje cantz<br />
zuzahlung €<br />
Jiro Taniguchi<br />
Gipfel der<br />
Götter 1 – Kamigami<br />
no<br />
itadaki<br />
comic | shodoku /<br />
schreiber & leser<br />
zuzahlung €<br />
Guy Maddin<br />
The Saddest<br />
Music In The<br />
World<br />
dvd (amaray-version)<br />
| cinema surreal<br />
/ b-ware!media<br />
Tinto Brass<br />
Yankee<br />
dvd | koch media<br />
home entertainment<br />
magazin für kulturtheorie<br />
no.2 1 winter 2007<br />
text: zuzanna jakubowski illustrationen: anna rosa stohldreier (www.rosadesign.de)<br />
»The best that has been thought and<br />
tellektuelles Interesse an der vermeintlichen<br />
said in the world.« So stellte Mathew<br />
low culture. Nicht zufällig eröffnet ein Inter-<br />
Arnold –Verteidiger der binären<br />
view mit dem britischen Germanisten An-<br />
high culture/low culture Opposithony<br />
Waine anlässlich seiner aktuellen<br />
Die goon® kommt zu Dir nach<br />
Hause in deinen Briefkasten. Nur für<br />
Dich allein. Niemand kann sie Dir<br />
wegnehmen, und dazu gibt’s auch<br />
noch eine fantastische Prämie.<br />
Standardabo<br />
4 Ausgaben + Prämie für 1 ,-€<br />
(Deutschland),<br />
2 € (Österreich / Schweiz)<br />
Auch als Geschenkabo zu haben!<br />
Standardabo-I/O<br />
4 Ausgaben des goon® Magazins + 1<br />
Ausgabe des I/O Magazins + Prämie*,<br />
für 20 € (Deutschland),<br />
32 € (Österreich/Schweiz)<br />
Auch als Geschenkabo zu haben!<br />
tion des vorletzten Jahrhunderts<br />
– die haftende Definition von<br />
Kultur auf. Der Titel seines Werks<br />
»Culture and Anarchy« bringt seine<br />
kanonisierte Position auf den<br />
Punkt: Anarchie, das ist die Popu-<br />
Veröffentlichung zu Literatur und Pop in<br />
Deutschland diese zweite Ausgabe »Zeichen«<br />
und verortet die historischen und<br />
aktuellen Geschmackskriege um high<br />
und low, Kitsch und Kunst auch auf dem<br />
Kontinent. Jenseits von Feuilleton und<br />
Förderabo<br />
lärkultur. Raymond Williams for-<br />
Fanzine besteht erneut das Unterfangen,<br />
4 Ausgaben + Prämie +<br />
goon® T-Shirt** für 0 €<br />
Im Falle eines Geschenkabos benötigen<br />
wir natürlich noch Namen und<br />
mulierte daraufhin im Gegenzug<br />
sein »culture is also ordinary«:<br />
konsumunabhängig und hinterfragend,<br />
dennoch involviert – quasi von innen<br />
Adresse des Geschenkempfängers!<br />
Die Cultural Studies waren<br />
heraus – kritisch über Popkultur nach-<br />
geboren, und mit<br />
zudenken.<br />
Sende einfach eine email mit Abo- und Prämienwunsch,<br />
Namen und Adresse an abo@goon-magazine.de und wir<br />
machen 84 1 bilder dich glücklich!<br />
*Die Prämien gibt es, solange der Vorrat reicht. Der Zahlungseingang<br />
entscheidet über die Vergabe.<br />
**Die T-Shirts gibt es in schwarz, rot und blau jeweils mit dem goon-Schriftzug<br />
auf der Vorderseite in allen gängigen Größen (auch als Girlie-Shirts).<br />
ihnen ein in-<br />
zeichen 1 8
From Gutter to Kitsch. Von Alltag und Pop<br />
Ein Interview mit dem britischen Germanisten anthony Waine anlässlich seiner<br />
aktuellen Veröffentlichung zu Literatur und Pop in Deutschland<br />
text, interview: mathias penzel<br />
»Theorien der Populärkultur«, »Populäre Kultur«, ja, sogar<br />
»Kulturschutt« ist nun auch auf den Schreibtischen<br />
hiesiger Wissenschaftler angekommen, wie Sebastian<br />
Hinz in der letzten Ausgabe des goon Magazins festgestellt<br />
hat – und sich sodann wunderte, wie konfus Gegenstand<br />
und Termini verhandelt werden. Wie Pop hierzulande das<br />
Licht der Welt erblickte – beginnend mit ersten Befruchtungen<br />
bis hin zu den Komplikationen der Geburt – erläutert<br />
nun das Werk eines Engländers. Anthony Waines<br />
»Changing Cultural Tastes« zeigt auf, weshalb hierzulande<br />
Intelligenzija und ›der kleine Mann‹ immer wieder aneinander<br />
gerieten. Es geht um das Bildungsbürgertum auf<br />
der einen Seite, auf der anderen um Volk, Kitsch und Pop.<br />
Es geht um Kultur und Ideologie, um Eliten und Demimonde,<br />
um Josef von Sternberg und Jelinek, Brecht und<br />
Brinkmann, Erwin Piscator und Hans Fallada. Zu seinem<br />
äußerst beeindruckenden Buch stand Anthony Waine Rede<br />
und Antwort.<br />
Es ist ja noch nachvollziehbar, wenn sich ein Germanist der<br />
Lancaster University mit Martin Walser, Bertolt Brecht und<br />
Anna Seghers beschäftigt – wie kommt er aber dazu, auf<br />
240 Seiten darauf zu pochen, die Deutschen hätten ihren<br />
eigenen Weg ins Pop-Zeitalter gefunden?<br />
Zur Entstehung des Buches und zum persönlichen Ansatz:<br />
Ich stamme aus der englischen East Midlands-Arbeiterklasse.<br />
Als Kind, d.h. in den Nachkriegsjahren bis in die<br />
frühen 60er Jahre hinein, haben mich meine Eltern in eine<br />
bunte, bodenständige und vor allem solidarische und<br />
Wärme stiftende Fabrikarbeiterkultur eingeführt, und ich<br />
nahm mit Freude daran teil. Hinzu kommt die Tatsache,<br />
dass meine Mutter in den Bergwerkerdörfern der nordostenglischen<br />
Grafschaft Durham aufgewachsen ist, und<br />
wir fuhren in den Schulferien zu dieser zweiten Heimat<br />
im Norden, die ebenfalls eine sehr stark integrierende,<br />
kommunale Populärkultur für die Freizeitgestaltung der<br />
Bergwerkerfamilien angeboten hat. Hier habe ich wieder<br />
eine ganz andere Lebensweise einer weiteren Schicht der<br />
Arbeiterklasse kennen und schätzen gelernt. Diese konkreten<br />
Erlebnisse haben meine Vorstellung von the people<br />
und deren culture, d.h. way of life, für immer mitgeprägt.<br />
Was bedeutet das für Dein Schreiben?<br />
Für das Buch bedeutet das: Ich gehe nicht von Theorien<br />
aus. Sie interessieren mich kaum. Ich bleibe so pragmatisch<br />
wie möglich. Doch mein ursprüngliches Interesse<br />
an Deutschland bezog sich nicht gleich auf deren ›popular<br />
culture‹. Es begann mit dem Studium der klassischen<br />
deutschen Literatur – 1964 in Newcastle. Während ich<br />
Goethe, Eichendorff und Hebbel las, konnte ich – selbst-<br />
verständlich – miterleben, wie die englische Pop-Musik<br />
entstand. Die britische Pop-Revolution lief ja schon auf<br />
vollen Touren. Einer meiner Kommilitonen war beispielsweise<br />
der damalige Fine Art-Student Bryan Ferry,<br />
der später mit Roxy Music, dann solo wichtige Akzente<br />
setzte. 1966 kam ich dann für ein Jahr nach Deutschland<br />
ins schläfrige Ammerland zwischen Oldenburg und Leer.<br />
Hier erlebte ich so eine Art Pop-Kolonialisierung des<br />
norddeutschen Jugendbewusstseins. Dieses Phänomen<br />
verfolgte ich noch intensiver als Lektor an der Universität<br />
Hamburg von 1968 bis 1970. Hier verwebte sich populäre<br />
Kultur, versinnbildlicht durch die Beatles und den Star<br />
Club, mit der Politisierung der die Welt auf den Kopf stellenden<br />
Studentenbewegung.<br />
Aus all diesen sozialen, politischen und persönlichen<br />
Erfahrungen schöpft mein Buch. Es ist der in meinem<br />
Kopf permanent ablaufende Dialog zwischen Großbritannien<br />
und Deutschland, auch zwischen dem intellektuell<br />
Erlernten und dem sinnlich Reizbaren, der mich mit der<br />
Masse der gewöhnlichen Menschen verbindet, zu der ich<br />
gehöre.<br />
Der erste Teil des Titels Deines neuen Buches »Changing<br />
Cultural Tastes« kann auf zweierlei Weise verstanden<br />
werden: ›Changing‹ als Gerundium, als substantiviertes<br />
Verb, das den bzw. die Wechsel kultureller Geschmäcker<br />
betrifft, aber auch als Aktionswort.<br />
Genau. Das soll auf zweierlei Weise verstanden werden.<br />
Ein bisschen hochtrabend ausgedrückt, will ich auf die Dialektik<br />
des Kulturprozesses hinweisen. Schriftsteller, Theaterproduzenten,<br />
Künstler, Filmemacher spiegeln nicht<br />
nur die gesellschaftliche Wirklichkeit wider, sondern sie<br />
produzieren neue Realität und helfen dem Individuum, an<br />
dem Wandel der Geschmäcker mitzuarbeiten. Noch lieber<br />
als ›Wechsel‹ würde ich das Wort ›Wandel‹ verwenden, es<br />
klingt durchdringender und auch evolutionärer.<br />
»Changing Cultural Tastes« dokumentiert die<br />
Grabenkämpfe zwischen ernster, anspruchsvoller<br />
Leitkultur und dem als trivial bezeichneten Gossenkind,<br />
dem Populären.<br />
Mir gefällt dein Ausdruck ›Grabenkämpfe‹, denn erst als<br />
das Manuskript fertig war, ist mir klar geworden, wie über<br />
Jahrhunderte hinweg regelrechte Schlachten in der Arena<br />
der Kultur ausgetragen wurden, und die Hauptwaffe der<br />
Kulturbesitzenden war Geschmack. Man könnte fast von<br />
Geschmackskriegen in den europäischen Gesellschaften<br />
seit dem Mittelalter sprechen. In meinem Land sprach<br />
ein Matthew Arnold von dem Kampf der culture gegen<br />
die anarchy. In Deutschland wurde diese Schlacht seit der<br />
Mitte des 18. Jahrhunderts besonders bitter und aggressiv<br />
geführt, insbesondere von dem aufsteigenden Bürgertum.<br />
Eigentlich aus politischer Ohnmacht heraus hat sich das<br />
Bürgertum gegenüber dem dekadenten Adel ganz oben<br />
und dem geschmacklosen Pöbel ganz unten zu behaupten<br />
versucht. Seinen einmaligen Status festigte es durch Sprache,<br />
Bildung und Geschmack.<br />
Gerade bei standesbewussten Gesellschaften – wie der<br />
französischen oder auch der englischen – erwartet man<br />
solche Trennlinien.<br />
Stimmt. Es ist, um einen englischen Ausdruck zu gebrauchen,<br />
purer Snobismus. Aber in welch anderem Land, in<br />
welch anderer Sprache außer Deutsch, gibt es die so tolle<br />
und totalitäre Demarkation wie in dem meines Erachtens<br />
bewusst alliterativen Wortpaar ›Kunst‹ und ›Kitsch‹?<br />
Kitsch ist so einmalig als ein Stück Kriegspropaganda gedacht,<br />
dass es in jede andere Sprache der Welt vollkommen<br />
unverändert eingeführt worden ist.<br />
Das klingt fast so, als wären diese Reinheitsgebote für<br />
Kultur eine Grundlage für die Ideen von reinrassigen<br />
Menschen, entarteter Kunst ...<br />
Ganz so ideologisch anti-deutsch würde ich das nicht<br />
sehen. Es hat vielmehr mit Klasse, Status und Diskriminierung<br />
zu tun. Durch meine philologischen<br />
Recherchen für das Buch entdeckte ich, dass das<br />
Schlüsselwort ›Geschmack‹ bis ins 18. Jahrhundert<br />
auf zweierlei Weise verwendet wurde: für den über<br />
den Mund und den, der über die Nase wahrnehmbar<br />
war. In gewissen süddeutschen Dialekten<br />
ist dieser zweite Sinn von ›schmecken‹ noch gebräuchlich.<br />
Häufig wurde das nasale Schmecken<br />
für etwas Unangenehmes verwendet.<br />
Die von dir so bezeichneten Reinheitsgebote<br />
für Kultur lassen sich nun sehr schön an<br />
dem Wort ›Kitsch‹ illustrieren. Kein Mensch<br />
weiß, was der eigentliche Ursprung von<br />
›Kitsch‹ ist. Da es in einigen Dialekten das Wort<br />
›Kitsche‹ gegeben hat, als Bezeichnung für einen<br />
Stock, mit dem man zum Beispiel Kot von<br />
der Straße entfernt, vermute ich, dass die Prägung<br />
von ›Kitsch‹ um 1880 auf übel riechenden<br />
Straßendreck anspielen sollte. Kitsch ›schmeckt‹<br />
schlecht. Kunst entspricht dem Reinheitsgebot, während<br />
Kitsch ... na ja ... Scheiße ist. Übrigens haben 40<br />
Jahre später die guten Dadaisten (Mathew Arnolds<br />
Anarchisten!) den Spieß umgedreht. Einer ihrer Slogans<br />
hieß lapidar: Kunst ist Scheiße.<br />
In der Rubrik Das Dispositiv hat Sebastian Hinz<br />
in einer der letzten goon Ausgaben die Verwirrung<br />
beschrieben, die aufgrund der Begriffsvielfalt im<br />
deutschen Diskurs entsteht, wenn es um die Übersetzung<br />
des englischen Konzepts von »popular culture« geht. Was ist<br />
Deine Position zu dieser Problematik?<br />
Das ganze erste Kapitel meines Buches setzt sich mit der<br />
Geschichte der Kultursprache in Deutschland gewissermaßen<br />
›von außen betrachtet‹ auseinander. Es geht von<br />
dem Begriff ›Volk‹ aus, über ›Kitsch‹ bis hin zu ›Pop‹. Das<br />
Buch endet mit dem Versuch, zwischen dem volkskund-<br />
lichen Begriff ›Alltagskultur‹ und dem englischen ›Popular<br />
Culture‹ zu unterscheiden – ohne für oder gegen das Eine<br />
oder Andere zu argumentieren. Deutschlands Weg in die<br />
moderne Kultur ist anders verlaufen als unser anglo-amerikanischer<br />
Weg, und das schöne anglo-amerikanische<br />
Modell, so sehr ich es persönlich mag, darf für mich nicht<br />
als Maßstab gelten. Zumal die Begriffsvielfalt in Deutschland,<br />
wie ich in meinem Buch zeige, sehr stark historisch<br />
begründet ist, so dass sie auch in Zukunft weiterhin Probleme<br />
aufwerfen wird.<br />
In diesem Zusammenhang möchte ich aber betonen,<br />
dass mein Buch sich nicht auf das Phänomen ›Pop‹ konzentriert.<br />
Pop culture ist zwar ein Teil von popular culture<br />
und wird als solches auch erwähnt; das Buch untersucht<br />
jedoch das Gesamtbild von popular culture, die sich in<br />
einem fortlaufenden Entwicklungsprozess seit dem Beginn<br />
der Menschheit befindet. Insofern betrachtet mein<br />
Buch popular culture von einem anthropologischen wie<br />
auch von einem sozialhistorischen Blickwinkel aus.<br />
»Changing Cultural Tastes. Writers and the Popular in<br />
Modern Germany« von Anthony Waine, Berghahn<br />
Books, New York, 2007, 240 S., $ 80,00 / £47,00<br />
86 1 zeichen<br />
zeichen 1 87
Mensch essen Seele auf<br />
Die Antwort von Anime und Wissenschaft<br />
auf das Zeitalter globaler selbstzerstörung<br />
text: sabine lenore müller<br />
»Im Gegensatz zum buddhistischen Kulturkreis ist Tierethik<br />
heute d e r blinde Fleck in der abendländischen Theologie-<br />
und Philosophiegeschichte.«<br />
franz alt<br />
Anima, die Seele, die Kraft, die die leblose Materie bewegt.<br />
Der winzige Funken Pneuma, auf den wir so stolz sind,<br />
den wir in diverse Jenseitsszenarien zu retten bestrebt<br />
oder den wir wenigstens näher kennen zu lernen gewillt<br />
sind. Anima, nach C. G. Jung die innere Persönlichkeit,<br />
der »Archetyp des Lebens […] von Urzeiten herkommende<br />
und dem lebenden System eingegrabene Erbmasse«. Schon<br />
Aristoteles sieht ›Seele‹ als Ursache des Lebens und der<br />
Wahrnehmung, als treibendes Prinzip aller Lebewesen<br />
– Pflanzen, Tiere, Menschen. Allerdings unternimmt er<br />
Klassifizierungen und beschreibt unterschiedliche Anteile<br />
an »Seelenvermögen«. Demzufolge besitzen Pflanzen<br />
nur ein vegetatives Vermögen, Tiere darüber hinaus die<br />
Fähigkeit zu Wahrnehmung und Emotion, der Mensch<br />
allein aber Vernunft, basierend auf phantasia, der Kraft<br />
zur Durchdringung der Wahrnehmungseindrücke, der<br />
Fähigkeit zu kreativer Vorstellung, und orexis, dem Strebevermögen.<br />
Diese idealistische Vorstellung geht leider<br />
nicht auf: Das Strebevermögen hat dermaßen überhand<br />
genommen, dass die Vorstellungskraft darüber auf der<br />
Strecke geblieben ist. Die Zerstörung der natürlichen<br />
Ressourcen des Planeten, das Anheizen des Klimas durch<br />
exzessiven Kohlendioxidausstoß ist nicht vernünftig! Der<br />
Verlust der aktiven Vorstellungskraft hat zu einem Verlust<br />
der Vernunft und des Mitgefühls geführt. Es ist der Verstand,<br />
der sich von der Erkenntnis seiner Eingebundenheit<br />
und Verbrüderung mit allen Lebensformen entfernt<br />
hat, der so zur Superwaffe wird, die in der Lage ist, alles<br />
was lebt und auch sich selbst auszulöschen. Diesen Verstand<br />
zu re-integrieren, die Bombe zu entschärfen und<br />
Ideen für ein alternatives Weiterleben zu entwickeln, ist<br />
Ziel der relativ jungen geisteswissenschaftlichen Schule<br />
des Ecocriticism, die nicht nur den Zusammenhang<br />
zwischen »Kunstwerken und der Umwelt« (Glotfelty) in<br />
Augenschein zu nehmen bestrebt ist, sondern diesen Zusammenhang<br />
auch auf seine »ökologische Vernünftigkeit«<br />
(Buell) befragen und letzten Endes einen »Wandel in der<br />
Wahrnehmung und im menschlichen Handeln« (Etok) bewirken<br />
will. Essentiell dabei ist, dass die Position des Wissenschaftlers<br />
auch neu bestimmt wird und nicht mehr als<br />
eine dem betrachteten Gegenstand überlegene, sondern<br />
eine spezifisch mit der Materie verwobene gedacht wird.<br />
Auch in der deutschen Wissenschaft sind diese Gedanken<br />
angekommen.<br />
Ökologische Ästhetik<br />
So will zum Beispiel Lars Hannings »Ökologische Ästhetik.<br />
Theoretische Kunstbetrachtung aus materialistisch-konstruktivistischer<br />
Sicht« einen »integrativen Naturalismus«<br />
entwerfen, der es ermöglicht, dass derjenige, welcher<br />
sich mit Naturwissenschaft, Natur und Kunst beschäftigt,<br />
nicht mit dem betrachteten Gegenstand jedes Mal die<br />
»Kosmologie oder die Wissenschaftstheorie wechseln muss«.<br />
Dass jede Perspektive konstruiert und damit arbiträr ist,<br />
allerdings der in die Welt eingebundenen Wahrnehmung<br />
als objektiv erscheint, führt Hanning zu der Überlegung,<br />
dass, wenn der Mensch sich über die komplexen Perspektiven<br />
und »kulturell-ästhetischen Situationen« ein Bild<br />
machen will, er am Besten damit beginnt, sich auf seine<br />
Eingebundenheit in das »Supersystem Natur zu besinnen«.<br />
Die Wiederentdeckung der Seele im Sinne der Anima, als<br />
treibende Lebenskraft, die Menschen, Tiere, Pflanzen glei-<br />
Sie sind immer in Feierlaune, etwas<br />
dümmlich, aber im Rudel sehr<br />
mutig – kurz: sehr menschlich.<br />
chermaßen bewegt und in dieser Bewegung verbindet, ist<br />
ein tief verwurzeltes menschliches Begehren. Der Schmerz<br />
über die imaginäre Entfremdung und Isolation kann gerade<br />
im urbanen und medialen Kontext fortschreitender<br />
Globalisierung oft nur über den Konsum von ›Natur‹ in<br />
Form von Parks, Filmen, Zoos und dem Einverleiben von<br />
Fleisch überwunden werden. Darin aber vertieft sich die<br />
Kluft: Der Verlust von Seele kann überhaupt nur dann<br />
überwunden werden, wenn die Position der Überlegenheit<br />
in Frage gestellt wird. Randy Malamud, der sich mit<br />
Zoos und der Kontemplation von Tieren befasst, fragt sich<br />
daher, ob unsere Erlösung nicht vielleicht in der Unwissenheit<br />
liegt, denn es sei denkbar, dass eine Verbindung<br />
besteht zwischen der Unwissenheit im Sinne Francis Bacons<br />
und der Animalität. Wenn sich Kunst kontemplativ<br />
mit Tieren befasst, so werde immer das betrachtet, »was<br />
der Mensch nicht ist« – daher könnte die Beschäftigung<br />
mit Tieren und ihren Repräsentationen uns Wege aus der<br />
intellektuellen Entfremdung zeigen, die die globale ökologische<br />
Krise verursacht.<br />
»Marderhunde, Marderhunde, wollt ihr etwas spielen?«<br />
Als ein gutes Beispiel dafür erweist sich ein auf einer Erzählung<br />
von Kenji Miyazawa basierender Anime. Die Idee<br />
zu diesem Film hatte Hayao Miyazaki, der durch seine<br />
Filme immer wieder daran erinnert, dass sich Anime von<br />
animare herleitet – zum Leben erwecken! Und die Filme<br />
des Studio Ghibli erwecken zuerst die phantasia, die<br />
Vorstellungskraft für die großen Zusammenhänge des<br />
Schuldigwerdens an der Natur und die Notwendigkeit<br />
der demütigen Abbitte des Menschen, die niemals eine<br />
qualvolle Bußübung, sondern ein glückliches Eintauchen<br />
in den harmonischen Urzustand ist. Die Protagonisten<br />
von Isao Takahatas »Pom Poko« (1994) sehen aus wie<br />
eine Kreuzung aus Waschbär und Schakal, heißen Marderhunde<br />
und sind das Neozoon in deutschen Wäldern<br />
schlechthin. Seit ein gieriger Pelzhändler versuchte, sie<br />
in der Ukraine anzusiedeln, hat sich ihr Lebensraum bis<br />
nach Finnland und nunmehr auch bis westlich der Elbe<br />
ausgebreitet. Sie fressen alles, sehen aus wie Muffs auf vier<br />
Beinen, knurren und haben Ganovengesichter, soweit das<br />
westliche Wissen über unsere neuen Mitbewohner. In Japan<br />
allerdings weiß man aus vielen Jahrhunderten intensiven,<br />
weil räumlich gedrängten Zusammenlebens einiges<br />
mehr: Tanuki sind fähig, sich in jede denkbare Form zu<br />
verwandeln und gehen nur dann auf vier Beinen, wenn<br />
Menschen in der Nähe sind. Sie sind immer in Feierlaune,<br />
etwas dümmlich, aber im Rudel sehr mutig – kurz: sehr<br />
menschlich. Zur Handlung: In den späten 1960er Jahren<br />
rotten sich Marderhundkampfgruppen zusammen, um<br />
den Bau der Vorortsiedlung Tama New Town bei Tokyo<br />
zu verhindern. In der Erkenntnis, dass der Mensch ihr<br />
eigentlicher Feind ist, überwinden die Anführer der verschiedenen<br />
Gruppen ihre Zwistigkeiten und beschließen<br />
den ganz großen Kampf: Dazu muss zunächst die vergessene<br />
Kunst der Verwandlung wiedererlernt werden. Als<br />
Menschen getarnt, mischen sich die Tanuki unter die<br />
Bevölkerung und sorgen für Unruhen und Störung der<br />
Baumaßnahmen. Mit Hilfe der Marderhundoberpriester<br />
fokussieren sie ihre magischen Kräfte so weit, dass sie eine<br />
Geisterparade zuwege bringen, die allerdings als Werbegag<br />
eines Vergnügungsparks von den Medien entschärft wird.<br />
Aller Widerstand schlägt fehl und die Marderhunde teilen<br />
sich in zwei Gruppen: Die einen leben als Menschen weiter,<br />
die anderen, die sich nicht verwandeln können oder wollen,<br />
bleiben Marderhund. Am Ende des Films stößt der als<br />
Mensch lebende Karriere-Tanuki Shokichi zufällig auf eine<br />
Gruppe alter pelziger Freunde, die sich auf einer Lichtung<br />
zum Feiern treffen. Schnell sind Aktenkoffer und Schlips<br />
fortgeworfen und ein Freudenfest wird gefeiert.<br />
Vielleicht war die Menschwerdung letztendlich keine<br />
gute Idee? Zurück in den Wald, mal wieder ausgelassen<br />
feiern? Wer ähnliche Fragen und Symptome an sich entdeckt,<br />
sollte »Pom Poko« sehen, damit die Antwort auf<br />
obige Frage nicht lautet: »Wir können nicht, wir können<br />
nicht, wir lernen noch!«<br />
»Ökologische Ästhetik« von<br />
Lars Hanning, Königshausen<br />
& Neumann, Würzburg<br />
2007, 422 S., € 49,80<br />
»Pom Poko« von Isao<br />
Takahata, seit 11.06. auf DVD<br />
erhältlich (ufa/Universum)<br />
88 1 zeichen<br />
zeichen 1 89
90 1 zeichen<br />
Blind und haltlos<br />
In »Panische Stadt« verliert der Raum-Forscher<br />
paul virilio die Bodenhaftung<br />
text: annika schmidt<br />
»Worauf werden wir warten, wenn wir nicht mehr warten müssen um anzukommen«,<br />
fragte sich 197 der Geschwindigkeits-Theoretiker und Verschwindens-Ästhetiker<br />
Paul Virilio. Die panischen Auswirkungen des Verschwindens der (Warte-)Zeit,<br />
der Räumlichkeit und letztendlich sogar der Endlichkeit durch die Unmittelbarkeit<br />
audiovisueller und virtueller Welten untersucht der französische Architekt<br />
und Städteplaner in seinem jetzt erschienenen Essayband »Panische Stadt«.<br />
Politik der Psychose<br />
So verschwinde beispielsweise die Wirklichkeit im »INFOWAR«. Denn das Recht<br />
des Stärkeren liege heutzutage auf Seiten des wirklichkeitsauslöschenden »<strong>Gewalt</strong>streichs,<br />
des Medienputsches, in dem die Geschwindigkeit die rohe <strong>Gewalt</strong>, die<br />
materiale Kraft in den Schatten stellt. Und diese Geschwindigkeit ist die des Lichts<br />
elektromagnetischer Wellen, ohne das die Globalisierung der Macht wie eine Luftspiegelung<br />
verschwände.« Die »Hyperterroristen« bedienen sich laut Virilio der<br />
manipulativen Massenkommunikationsmittel. Aber die durch Schockästhetik generierte<br />
»Psychose [sei auch] ein terroristisches Regierungsmittel, dessen wir uns seit<br />
dem 20. Jahrhundert auf das schändlichste bedienen.« Denn wir befänden uns jetzt<br />
in einer Phase der »ekstatischen Kommunikation« und ihrer »hysterischen Umschaltung«.<br />
Die Bilder sind kriegsentscheidend. Das »ikonoklastische Delirium« löse<br />
die öffentliche Meinung zugunsten einer »globalisierten kollektiven Erregung«<br />
– einer »Gefühlsdemokratie« – auf, die zu einer politischen Trance führe, wie sie<br />
auch die Massenpropagandaveranstaltungen des NS-Regimes auslösten.<br />
Poetik der Paranoia<br />
Virilios Verständnis der wirklichkeits- und sinntorpedierenden Struktur des Terrorismus<br />
und der meinungszersetzenden Panik-Mache der staatlichen Kriegsführung<br />
ist nur allzu sinnvoll, jedoch beschrieb Jean Baudrillard dies schon vor dreißig<br />
Jahren in seiner Simulationstheorie, und das begrifflich schärfer. Auch die Ausführungen<br />
Virilios hier zu der »Ortsdämmerung« oder der gentechnischen »Wüste<br />
der Serie« sind weniger erhellende Begriffs- und Theoriebildungen, als vielmehr<br />
nebulöse Wortspielereien. Wenn er der Popkultur jegliche Subversivität abspricht<br />
und der Gleichgültigkeit des Expressionismus und des Surrealismus die Begünstigung<br />
Auschwitz, zuschreibt, verfällt er der eigenen polemischen Panik-Poesie.<br />
Und letztendlich verliert er jeglichen Lebensweltbezug und kippt vom poetischprophetischen<br />
vollends ins paranoid-psychotische Universum: »Schließlich wird<br />
der Tag verklingen und das Dämmerlicht eines verlassenen Planeten in der Nacht<br />
verlöschen, in der dunklen Nacht einer elektromagnetischen Leere, wo die ZAHL den<br />
NAMEN, alle Namen ablöst und das Wahrscheinliche mit all seiner Rechenkraft das<br />
Erscheinende unterwirft. [...] Heißt das, wir sind am Ende? Nein, denn jetzt – blind<br />
und haltlos unterwegs – ist auch ein Ende nicht mehr abzusehen.«<br />
»Panische Stadt« von Paul Virilio, aus dem Französischen von<br />
Maximilian Probst, Passagen Verlag, Wien 2007,147 S., € 19,90<br />
Fiktion ist kein Witz<br />
Die Künstlerin sophie tottie etabliert<br />
das Bild als eine selbständige Sprache<br />
text: zuzanna jakubowski foto: sophie tottie<br />
Als junge Kunststudentin hat die zwischen Berlin, Stockholm<br />
und Malmö lebende Sophie Tottie die Wände ihres<br />
Universitätsateliers gelb bemalt, um ein Bild des Raumes<br />
selbst zu schaffen. Nun zeugt ein präzise gestalteter und<br />
unter Mitwirkung der Künstlerin entstandener Katalog zu<br />
ihrer diesjährigen Ausstellung »Fiction Is No Joke« davon,<br />
dass ihre auf keine greifbare Bedeutung reduzierbaren Installationen<br />
weiterhin immer auch um die Dimensionen<br />
Die Polyphonie der Großstadt<br />
Ein Ausstellungs-Reader spürt den<br />
beWegungen neW yorks nach<br />
text: zuzanna jakubowski<br />
»Betrachten wir noch einmal die Stadt. Sie ist mehr als nur ein Geflecht von Beziehungen<br />
und eine Ansammlung von Gebäuden, sogar mehr als ein geopolitischer<br />
Schauplatz – sie ist eine Folge sich vollziehender historischer Prozesse.« Bis zum 4.<br />
November war im Berliner Haus der Kulturen der Welt die interdisziplinäre Ausstellung<br />
»New York« mit Filmprogramm, Musik, Konferenzen, Lesungen, Performances<br />
und natürlich auch ausgestellter Kunst zu Gast. » Das vermessene Paradies.<br />
Positionen zu New York«, so der vollständige Titel des Begleit-Readers zur Ausstellung,<br />
verlängert nun die Faszination für den Big Apple. Neben Aufsätzen aus den<br />
unterschiedlichsten Disziplinen beinhaltet der innovative Band auch Gedichte,<br />
Anekdoten, Kurzgeschichten, Comics, Fotos (Gregg LeFevres wunderbare Körperstadt/Stadtkörper!),<br />
Straßenkarten und Interviews mit Künstlern, DJs, New<br />
Yorkern. Performativität zwischen geschmackvollen Buchdeckeln; im Kleinen wird<br />
vollzogen, was im Großen veranschaulicht wird: Das Paradies wir vermessen, die<br />
Stadt aus allen Richtungen eingekreist, ihre Spuren bis ins 19. Jahrhundert verfolgt.<br />
Immer wieder sind die Boroughs, die Kieze New Yorks von Bedeutung, eine<br />
Struktur die den Berliner an seinen eigenen dezentralisierten Lebensraum erinnert.<br />
Zwischen Gentrifizierung (»Latte macchiato in Harlem«) und der sich wandelnden<br />
Clubszene in New York (»Wie es war und wie es ist«) wird im Sinne der Urban<br />
Studies hier ein Portrait der Großstadt entworfen, das gelungen zwischen persönlichem<br />
und sozialwissenschaftlichem changiert.<br />
»Das vermessene Paradies. Positionen zu New York«, herausgegeben von Bernd M.<br />
Scherer und Detlef Diederichsen, Verlag Theater der Zeit, Berlin 2007, 280 S., € 15,00<br />
review<br />
und Zeichen der Ausstellungsorte ergänzt werden. Der<br />
Katalog selbst nimmt dabei in seiner Abbildung und Interpretation<br />
der Arbeiten aus u.a Berlin, Helsinki, Malmö<br />
und Bagdad eine Multiperspektivität ein, die nur im Sinne<br />
der Künstlerin sein kann. Totties Arbeiten, die mit suggestiven<br />
Titeln wie »Hegel’s House«, »Einstein RGB« und<br />
»Ktitic Voyager« auf eine tiefer liegende Bedeutung zielen,<br />
sind Rätsel, die nicht gelöst werden wollen. Die Künstlerin<br />
selbst attestiert in einem dem Band beigefügten Interview<br />
dem kunstinteressierten Publikum eine auf Konsum ausgerichtete<br />
Wahrnehmung: »Diese Haltung stößt auf Probleme<br />
in einer Zeit, die danach giert, rasch zu verstehen,<br />
›worum es geht‹, um das Bild damit abhaken und weitergehen<br />
zu können«. Interpretationsversuche forciert Tottie<br />
daher durch eine Vielzahl von Zeichen und Symbolen, nur<br />
um den Betrachter durch ihre Unschlüssigkeit wieder auf<br />
die Oberfläche zurückwerfen. Der geglückte Katalog ist in<br />
seiner Komplexität selbst mehr Durchführung als Einstieg<br />
in das Netzwerk Sophie Totties.<br />
»Fiction Is No Joke« herausgegeben von Niclas Östlind,<br />
Louise Fogelström, Vorwort von Bo Nilson, Texte von<br />
Stefan Jonson, Jessica Morgan, Niclas Östlind, Margaretha<br />
Rossholm Lagerlöf, Sophie Tottie, detsch/englisch,<br />
Hatje Cantz, Stuttgart, 2007, 184 S., € 35,00<br />
zeichen 1 91
eview<br />
Auf der Suche nach dem<br />
Realitätsinkompatibilitätsklassifikator<br />
simon spiegel obduziert den Science-Fiction-Film und führt die Organe seiner<br />
Wirkung ans Licht<br />
text: stefan murawski illustration: don davis<br />
In seinem streng analytischen und grundlagenbildenden<br />
Werk zum Science-Fiction-Film distanziert sich Simon<br />
Spiegel vom gängigen Verständnis der Science Fiction als<br />
Genre; vielmehr als ein Modus sei sie zu begreifen. Aufbauend<br />
auf dieser These untersucht er anschließend anhand<br />
Embleme des<br />
Ungesicherten<br />
Von metaphorisierten geistern zu<br />
geisterhaften Metaphern findet der<br />
Reader »New Ghost Entertainment-<br />
Entitled« nahezu alles, was in der Welt der<br />
Essayistik zu dem Thema gedacht werden<br />
könnte<br />
92 1 zeichen<br />
text: dan gorenstein<br />
illustration: michanolimit<br />
Dieser knappe Reader entstand aus<br />
einer Kooperation zwischen dem<br />
Kunsthaus Dresden und der Or Gallery<br />
Vancouver. Im Rahmen einer<br />
Kunstausstellung mit Filmprogramm<br />
haben sich die Autoren<br />
dem Thema Geister gewidmet.<br />
Wie sich herausstellt ein fruchtbares<br />
Thema. Denn das Halbvorhandene,<br />
das abwesend Anwesende sind zentrale<br />
eines großen Kanons ausgewählter Filme deren Poetik<br />
und erläutert ihre Wirkung auf den Zuschauer anhand<br />
der Analyse von Bildern, Effekten, Themen, Konzepten<br />
und Strukturen, welche er mit bekannten Beispielen belegt.<br />
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Klassifikation der<br />
Science Fiction, die seiner These nach stets ein Novum<br />
biete und dadurch nicht kompatibel mit der realen Welt<br />
sei. Über den rein filmischen Aspekt hinaus bietet Spiegels<br />
Buch einen interessanten historischen Überblick über ihre<br />
Ursprünge in der Literatur und den daraus resultierenden<br />
Boom der Science-Fiction-Filme. Auf der beigelegten<br />
DVD befinden sich, als Ergänzung zum Text, sechzehn<br />
Ausschnitte aus im Buch besprochenen Filmen, die jedoch<br />
leider recht willkürlich gewählt erscheinen, sodass nicht<br />
zu jedem Kapitel ein passender Clip existiert. Die meisten<br />
Ausschnitte werden jedoch dem Science-Fiction-Kundigen<br />
ohnehin bekannt sein. Alle anderen dürften zweifellos einen<br />
schweren Zugang zu dieser rein akademischen Arbeit<br />
finden.<br />
»Die Konstitution des Wunderbaren. Zu einer Poetik<br />
des Science-Fiction-Films« (Buch & DVD) von Simon<br />
Spiegel, Schüren, Marburg 2007, 385 S., € 24,90<br />
Kategorien und Denkmuster moderner Kulturwissenschaft.<br />
Ihren prominentesten Paten haben die Gespenster<br />
im jüngst verstorbenen Jacques Derrida und dessen Marxbuch<br />
gefunden, welches hier auch reichlich zitiert wird.<br />
Vom Mystizismus gereinigt und zur Denkfigur umgearbeitet,<br />
entwickelt das Phänomen Gespenst oder<br />
auch Geist eine ungeheure Spannkraft, die von der Beschreibung<br />
japanischer Horrorfilme, über Winkelzüge<br />
amerikanischer Außenpolitik, bis hin zu W. G. Sebalds<br />
phantomhafte Schmetterlingsjäger reichlich Gedankenspiele<br />
zulässt. Zwischen den Aufsätzen finden sich<br />
Fotografien, Ausstellungstücke, Gedankenfetzen zu einzelnen<br />
Kunstprojekten und Filmstills, die vor allem die<br />
ästhetische Tiefe der Metapher zur Geltung bringen. Auch<br />
wenn es an manchen Stellen knarrt und knackt, bietet der<br />
Reader einen guten Einstieg in wie auch Überblick über<br />
das komplexe Problem des Geisterhaften, evoziert mögliche<br />
Arbeitsweisen und stellt nicht zuletzt unter Beweis,<br />
dass eine schön gewählte Metapher ein weites Feld kultureller<br />
Phänomene nicht nur rezipierbar, sondern sogar<br />
interessant macht. Eine Bibliografie zum Weiterlesen wäre<br />
schön gewesen.<br />
»New Ghost Entertainment-Entitled« herausgegeben von<br />
Karin Pesch, Verbrecher Verlag, Berlin 2007, 96 S., € 8,00<br />
Social Networking mit der Axt<br />
conan der barbar, texanische Zivilisationskritik, ist wieder da<br />
text: robert wenrich illustration: cary nord<br />
Drei Tage vor dem Tod seiner komatösen Mutter, der er die<br />
letzten Jahre gewidmet hatte, nimmt sich Ron E. Howard<br />
dreißigjährig das Leben. Zu diesem Zeitpunkt existieren<br />
etwa zwei Dutzend Geschichten um den Barbaren Conan,<br />
von denen er zeitlebens 17 in der Zeitschrift Weird Tales<br />
veröffentlichen kann. Dadurch lernt er Lovecraft kennen<br />
und schätzen, wenngleich er nie zu dessen Horror-Posse<br />
gehörte. Dieser Lovecraft, selbst nie frohgemut, stirbt ein<br />
Jahr nach Howards Tod, zuletzt bei seiner Tante lebend, an<br />
Krebs; beide Eskapisten.<br />
Das Versagen des Überbaus<br />
Doch während Lovecrafts Metier stets die Beschreibung<br />
kosmischen Übergrauens in Providence, RI bleibt,<br />
träumelt sich Howard aus Versatzstücken halbseidener<br />
Rassentheorie und europäischer Frühgeschichte seinen<br />
Gegenentwurf zu einem Leben zusammen, das er nie<br />
wirklich akzeptieren konnte. Conans Welt ist vorantik,<br />
gerade erst beginnt sich die Zivilisation herauszubilden,<br />
Staaten sind nicht mehr als Reichsflecken um eine Hauptstadt,<br />
und das vormals geerdete Dasein bekommt nun<br />
Höhe und Hierarchie. Allerdings sieht der von den Wirren<br />
des Ölbooms und der Prohibition geprägte Howard darin<br />
das Übel. Staatliche Willkür, Übergriffe, Rechtsunfreiheit<br />
und -ungleichheit und die enorme Korruption seiner Zeit:<br />
Wenn die Institutionen die Diskurshoheiten stellen, ist die<br />
eigentliche Barbarei zwischen den Menschen eingerichtet.<br />
In Conans Epoche jedoch gibt es noch kein zementiertes<br />
staatliches <strong>Gewalt</strong>monopol. Die Moral entsteht zwischen,<br />
thront aber nie über den Menschen, und die Selbstjustiz<br />
steht noch in Konkurrenz mit der des Reiches. Gerechtigkeit<br />
kann noch installiert werden, indem man kriminellen<br />
Hierophanten die Schädel einschlägt.<br />
Das Herz eines Boxers<br />
Nur der einzelne Mann aber und sein Handschlag zählen,<br />
wenn die Institutionen versagen. Conan geht keine Verträge<br />
ein, sondern Schwüre. Howard, selbst Amateurboxer,<br />
inszeniert so gut wie alles als Kampf. Etwas naiv vielleicht,<br />
genealogie der superhelden<br />
aber wirksam. Seine absolute Freiheitsphantasie gondelt<br />
seit mittlerweile siebzig Jahren durch die amerikanische<br />
Kultur, brachte neben vielen Spin-Offs auch die indiskutablen<br />
Conan-Filme der 1980er Jahre hervor und begründete<br />
das heute so beliebte Fantasy-Genre mit: Dass »Der<br />
Herr der Ringe« ohne Howards Conan nicht möglich gewesen<br />
wäre, ist sicher keine gewagte These.<br />
Nun erscheint bei Dark Horse seit 2003 eine neue<br />
Conan-Serie. Autor ist der berühmte Kurt »Astro City«<br />
Busiek, Illustrator der Kanadier Cary Nord – könnte es<br />
denn einen Geeigneteren geben? Die beiden inszenieren<br />
Howards Abenteuer mit einer überzeugenden Werktreue.<br />
Besonders der Wechsel zwischen der menschenleeren<br />
Wildnis und den Städten, die aus wenig mehr bestehen als<br />
Schenken, Schatzkammern und Karzern, gelingt ihnen.<br />
Nords dynamisches Zeichnen verdient dabei ein großes<br />
Lob. Direktkoloriert ergeben sich vor allem bei den Kämpfen<br />
bemerkenswerte Panels, und das große Leben, das sich<br />
der bange Muttersohn Howard ausmalte, wird zwischen<br />
Schlangengeistern und Eisfesten – am Fluchtpunkt aller<br />
Jugendträume – Ereignis.<br />
»Conan« von Kurt Busiek und Cary Nord ist in vier<br />
Sammelbänden bei Panini erschienen<br />
Der fünfte Band »Conan: Die Juwelen von Gwahlur und Die<br />
Töchter von Midora« von P. Craig Russell, Jimmy Palmiotti<br />
und Mark Texeira ist soeben bei Panini erschienen<br />
Howards Geschichten können beim australischen<br />
Gutenberg-Projekt als Hypertext gelesen werden<br />
Die Genealogie der Superhelden wird im nächsten Heft fortgesetzt.<br />
zeichen 1 93
goon<br />
präsentiert<br />
goon<br />
präsentiert<br />
termine<br />
musik<br />
11 Years Icon –<br />
The elecTronIc sessIon<br />
7.12. Berlin, Icon<br />
11 Years Icon –<br />
The Drum & Bass sessIon<br />
8.12. Berlin, Icon<br />
amanDa rogers<br />
6.12. Berlin, NBI<br />
BarBara morgensTern<br />
16.12. Berlin, Kleist-Haus<br />
Booka shaDe<br />
18.1. Augsburg, Ostwerk<br />
Bruno PronsaTo<br />
21.12. Zürich | CH, Q Club<br />
25.12. München, Harry Klein<br />
18.1. Brüssel | B, P3P<br />
25.1. Zürich | CH, City Fox<br />
26.1. Köln, tba.<br />
16.2. Berlin, Watergate<br />
carIBou<br />
2.12. Schorndorf, Manufaktur<br />
5.12. Nürnberg, MUZ Club<br />
6.12. Wien | A, B72<br />
7.12. Berlin, Lido<br />
8.12. Hamburg, Uebel&Gefaehrlich<br />
DelBo<br />
6.12. Hamburg, Uebel&Gefaehrlich<br />
7.12. Hannover, Kulturpalast<br />
8.12. Münster, Amp<br />
13.12. Greifswald, Klex<br />
14.12. Halle, Druschbar<br />
15.12. Leipzig, Ilses Erika<br />
DJ VaDIm & Yarah BraVo<br />
14.12. Leipzig, Distillery<br />
15.12. Münster, Skaters Palace<br />
28.12. Hamburg, Naitclub (Vadim only)<br />
29.12. Berlin, Cassiopeia<br />
30.12. Dresden, Schleife<br />
DuDleY PerkIns &<br />
georgIa anne mulDrow<br />
20.12. Berlin, Bohannon<br />
21.12. Antwerpen | B, Trixx<br />
22.12. Jena, Kassablanca<br />
27.12. Breda | NL, tba<br />
29.12. Bern | CH, Wasserwerk<br />
30.12. Winterthur | A, Albani<br />
goon<br />
präsen-<br />
tiert<br />
goon<br />
präsen-<br />
tiert<br />
goon<br />
präsen-<br />
tiert<br />
goon<br />
präsen-<br />
tiert<br />
enon<br />
10.12. München, Orangehouse<br />
11.12. Köln, Tsunami<br />
12.12. Leipzig, UT Connewitz<br />
13.12. Dresden, Starclub<br />
ewan Pearson<br />
21.12. Berlin, Watergate<br />
FooD For anImals<br />
6.12. Düdingen | CH, Fr Katz Festival Bad<br />
Bonn<br />
10.12. Konstanz, Kantine<br />
11.12. Berlin, M12<br />
12.12. Hamburg, MS Stubnitz<br />
14.12. Den Haag | NL, State X Festival<br />
Iron & wIne<br />
16.1. Wien | A, Szene<br />
17.1. Dachau, St. Jacob-Kirche<br />
18.1. Brüssel | B, Ancienne Belgique<br />
20.1. Hamburg, Fabrik<br />
21.1. Aarhus | DK, Voxhall<br />
25.1. Kopenhagen | DK, Vega<br />
26.1. Köln, Kulturkirche<br />
27.1. Amsterdam | NL, Paradiso<br />
28.1. Frankfurt, Mousonturm<br />
29.1. Bielefeld, Forum<br />
30.1. Berlin, Passionskirche<br />
JamIe lIDell<br />
22.12. Saarbrücken, Electricity Festival<br />
kIlll<br />
6.12. Linz | A, Qujochoe<br />
7.12. Düdingen | CH,<br />
Fr Katz Festival Bad Bonn<br />
11.12. Hamburg, Kampnagel<br />
12.12. Berlin, Lido<br />
13.12. Brüssel | B, Recyclart<br />
14.12. Den Haag | NL, State X<br />
luke VIBerT<br />
11.1. Berlin, Icon<br />
lullaBYe orchesTra<br />
9.12. Leipzig, UT Connewitz<br />
olaFur arnalDs<br />
14.12. Den Haag | NL, State X New Forms<br />
15.12. Münster, Gleis 22<br />
16.12. Leipzig, Café Panam<br />
18.12. Marburg, Kfz<br />
19.12. Jena, Rosenkeller<br />
21.12. Karlsruhe, Lutherkirche<br />
PaPIer TIgre<br />
8.12. Lille | F, Le CCL<br />
9.12. Kopenhagen | DK, Lades<br />
10.12. Hamburg, Fundbüro<br />
11.12. Opava | CZ, Jam<br />
goon<br />
präsen-<br />
tiert<br />
goon<br />
präsen-<br />
tiert<br />
goon<br />
präsen-<br />
tiert<br />
12.12. Dresden, AZ Conni<br />
13.12. Berlin, Schokoladen<br />
goon Magazin Release-Party<br />
14.12. Prag | CZ, Klub 007<br />
15.12. Halle, Objekt 5<br />
17.12. Wien | A, Fluc<br />
18.12. Rosenheim, Asta Kneipe<br />
19.12. Innsbruck | A, tba.<br />
20.12. Nürtingen, Klub Provisorium<br />
ParTY & laBor<br />
3.12. Leipzig, tba<br />
4.12. Würzburg, Café Cairo<br />
5.12. Esslingen, Komma<br />
ParTY arTY Vol. 24 – a nIghT oF<br />
VIBes From DIFFerenT TrIBes<br />
15.12. Berlin, 103 Club<br />
rockY VoTolaTo<br />
11.2. Berlin, Bassy<br />
12.2. Köln, Metropolis Kino<br />
13.2. Münster, Gleis 22<br />
14.2. Bremen, TBA<br />
15.2. Erlangen, E-Werk<br />
16.2. München, Feierwerk<br />
17.2. Wien | A, B72<br />
18.2. Zürich | CH, Hafenkneipe<br />
19.2. Karlsruhe, Cafe Nun<br />
22.2. Giessen, MuK<br />
23.2. Braunschweig, Nexus<br />
scouT nIBleTT<br />
1.12. München, Bavarian Open<br />
@ BR Funkhaus<br />
3.12. Wien | A, Chelsea<br />
4.12. Leipzig, UT Connewitz<br />
5.12. Berlin, Lido<br />
10.12. Hamburg, Uebel&Gefaehrlich<br />
12.12. Köln, Gebäude 9<br />
sTars oF The lID<br />
16.12. Dresden, Scheune<br />
The heaVY<br />
5.12. Berlin, Cassiopeia<br />
The herBalIser<br />
28.12. Berlin, Icon<br />
Volcano The Bear<br />
6.12. Genf | CH, L’écurie<br />
7.12. St. Gallen | CH, Palace<br />
8.12. Düdingen | CH, Fr Katz Festival Bad<br />
Bonn<br />
94 1 termine<br />
termine 1 9<br />
töne 1 9<br />
Henisiusstr. 1 - 86152 Augsburg - 0821-4300757 -<br />
www.duophonic.de - info@duophonic.de<br />
goon<br />
präsentiert<br />
termine<br />
food for animals<br />
Vergesst Public Enemy, vergesst Dälek. Hiergegen<br />
sind die einen gebrochene Rentner, die anderen<br />
mittlerweile gelangweilte Poeten. Vulture<br />
V und Ricky Rabbit haben uns ja wirklich lange<br />
warten lassen, mit der »Scavenger EP« im Eigenvertrieb und einer raren 7 Inch<br />
auf dem entschlafenen Bomb Mitte Label immer nur angefüttert. Nun wird<br />
mit Rapper Hy als Verstärkung und dem Debütalbum »Belly« endlich die volle<br />
Ladung Noise-Hop in den Rachen geprügelt. Zerbrochene Beats, Krachgewitter<br />
und soziopolitische Manifeste heißt das bei Food For Animals, HipHop aus<br />
purer Energie. Und live haben die Jungs aus Maryland, Georgia bisher noch<br />
jeden Laden zum kopfnickenden Moschen gebracht.<br />
goon<br />
präsentiert<br />
Food For Animals vom 6. – 14.12 in Deutschland und angrenzenden Staaten<br />
papier tigre<br />
Musik aus Frankreich, das bedeutet für die ältere<br />
Generation vor allem Serge Gainsbourg, Jacques<br />
Brel und Edith Piaf, die Jüngeren denken da<br />
schon eher an Elektro-Bands wie Daft Punk, Air<br />
oder das momentan hoch gehandelte Duo Justice.<br />
Dass es jedoch mal wieder Zeit ist für guten französischen Rock á la Noir Désir,<br />
beweist die dreiköpfige Combo Papier Tigre aus Nantes. Während Bands wie die<br />
Britpopper Keane die Gitarre aus ihrer Musik verbannt haben, verzichten Papier<br />
Tigre lieber auf einen Bass und legen auf die aussagekräftigen sechs Saiten der<br />
Gitarre besonderen Wert. So schmeißen sie einem auf ihrem im Frühjahr bei<br />
Collectif Effervescence erschienenen selbstbetitelten Debütalbum ihre frickeligen,<br />
dröhnenden Gitarren, kombiniert mit exaltiertem Gesang und gejagt vom<br />
donnernden Schlagzeug, um die Ohren. Und wenn die Jungs am 13. Dezember<br />
auf der Releaseparty der Goon 24 im Schokoladen richtig loslegen, wird es auch<br />
am nächtlichen Berliner Himmel garantiert »No Stars Or Clouds« geben.<br />
goon<br />
präsentiert<br />
Papier Tigre zur Releaseparty der 24. Ausgabe am 13.12. im Schokoladen<br />
enon<br />
Stillstand ist Rückschritt, dieses Motto hat sich<br />
CM<br />
die Indierock-Band Enon aus dem US-amerikanischen<br />
Osten offenbar ganz besonders zu Herzen<br />
MY<br />
genommen. Das gilt zwar zum Einen selbstver-<br />
CY<br />
ständlich für die Musik. Enon versuchen mit jedem<br />
neuen Album, sich weiter und vor allem auch immer einen etwas anderen<br />
CMY<br />
Sound zu entwickeln, dabei aber natürlich trotzdem ihrem Easy Listening-Rock<br />
K<br />
und ihre stets mit einem Augenzwinkern versehenen gesellschaftskritischen<br />
Texte beizubehalten. Doch die musikalische Komponente allein macht das<br />
Weiter in der Entwicklung von Enon nicht aus. Ebenso hat sich bei dem Trio in<br />
seiner bisherigen Bandgeschichte nach zwei der bisher drei Alben die Besetzung<br />
geändert, so dass von der Anfangsbesetzung seit dem Album »High Society« aus<br />
dem Jahre 2002 nur noch John Schmersal dabei ist. Nun aber veröffentlichen<br />
Enon, zu denen neben Schmersal seit einigen Jahren also auch Toko Yasuda und<br />
Matt Schulz gehören, im Oktober hierzulande ihr viertes Studioalbum »Grass<br />
Geysers…Carbon Clouds«, das wie all die vorigen Alben in ungewohnter Kontinuität<br />
bei Touch & Go erscheinen wird. Und wir wollen hoffen, dass Enon<br />
auf ihrer Deutschlandtour im November und Dezember in hoffentlich gleich<br />
gebliebener Zusammensetzung ein paar ihrer neuen Songs spielen werden.<br />
Enon vom 27.11. bis 13.12. unterwegs in Deutschland<br />
C<br />
M<br />
Y<br />
Anzeige goon okt 07 .pdf 26.10.2<br />
VINYL-<br />
DUBPLATES-<br />
PRESSUNGEN<br />
500 12" LP 1155 €<br />
zzgl. Mwst.<br />
inkl. Überspielung und Vollentwicklung, 2 Testpressungen,<br />
s/w Etiketten, Papierinnenhülle,4 farbiges Cover<br />
12 “ Maxi 28 €<br />
Einzelanfertigung zzgl. Mwst.<br />
duophonic
goon<br />
präsen-<br />
tiert<br />
termine<br />
aufführungen<br />
Betrunken genug zu sagen<br />
ich lieBe dich<br />
von Caryl Churchill<br />
Regie: Benedict Andrews<br />
5.12. Berlin, Schaubühne<br />
Breaking news –<br />
ein tagesschauspiel<br />
Regie: Helgard Haug / Daniel Wetzel<br />
(Rimini Protokoll)<br />
5. – 10.1. Berlin, HAU 2<br />
cinema Fury: the imitation<br />
Regie: Caden Manson, Big Art Group,<br />
NYC<br />
25. – 27.1., Berlin, HAU 1<br />
das leBen ein traum<br />
Musiktheater nach Pedro Calderon de la<br />
Barca, Regie: Johan Simons, NT Gent<br />
4. – 6.1. Berlin, HAU 1<br />
das letzte Feuer<br />
von Dea Loher<br />
Regie: Andreas Kriegenburg<br />
26.1. Hamburg, Thalia Theater<br />
der Feurige engel<br />
von David Marton<br />
19. / 20. / 21.12. Hamburg, Kampnagel<br />
der tod des<br />
eichhörnchenmenschen<br />
von M. Sikorska-Miszcuk<br />
Regie: Marcin Liber<br />
14./15.12. Berlin, HAU 3<br />
deutschlandsaga –<br />
die 50er Jahre<br />
Drei Uraufführungen:<br />
Fräuleinwunder, Backfischtod in Bad<br />
Nauheim und Rialto<br />
1./2.12. Berlin, Schaubühne<br />
gertrud nach Einar Schleef,<br />
Regie: Armin Petras<br />
21.12. Frankfurt/M., Schauspiel Frankfurt<br />
goB squad‘s kitchen<br />
(You‘ve never had it so good)<br />
13.12. Berlin, Volksbühne<br />
little dance garage<br />
Tanz-Solo von Régine Chopinot<br />
5. – 9. / 12. – 16. / 19. – 21.12., Berlin,<br />
Kunsthaus Tacheles<br />
mamma medea<br />
von Tom Lanoye, Regie: Stephan Kimmig<br />
8.12. München, Kammerspiele<br />
us amok<br />
von Marc Becker, Regie: Britta Schreiber<br />
6. / 7. / 12. / 19. / 27.12., Braunschweig,<br />
Staatstheater<br />
ausstellungen<br />
christine hill<br />
Volksboutique Official Template<br />
Interaktives Ausstellungswerk<br />
2.11. – 27.1., Berlin, ifa-Gallerie<br />
JeFF wall<br />
noch bis 20.1., Berlin,<br />
Deutsche Guggenheim<br />
mawil Ausstellung zur Eröffnung des 2.<br />
Comicfestival Hamburg, Vernissage:<br />
6.12. Hamburg, Kunstverein Linda<br />
reza aBedini Wenn Schrift Bild wird<br />
Zeitgenössisches Grafikdesign<br />
30.11. – 27.1., Stuttgart, ifa-Gallerie<br />
textBild Werke von Jürgen Palmtag<br />
und Oliver Grajewski<br />
Comic Ausstellung<br />
4.11. – 20.1., Albstadt, Galerie Albstadt<br />
walter Bortolossi<br />
It isn’t only Pop (but I like it)<br />
Malerei<br />
24.11. – 26.1., Berlin, Egbert Baqué Contemporary<br />
Art<br />
festivals<br />
58. internationale<br />
FilmFestspiele Berlin<br />
7. – 17.2. Berlin<br />
ÄpFel, nüsse, Fink und star<br />
2. Comicfestival Hamburg<br />
7. – 9.12., Hamburg, Kulturhaus 73<br />
around the world in 14 Films<br />
30.11. – 8.12. Berlin, Babylon Mitte<br />
cinema! italia!<br />
Neues italienisches Kino<br />
29.11. – 5.12. Heidelberg, Karlstorkino<br />
1. – 7.12. Frankfurt/M., Deutsches Filmmuseum<br />
6. – 12.12. Freiburg, Kino Friedrichsbau<br />
6. – 12.12. Tübingen, Kino Museum<br />
13. – 19.12. Berlin, Babylon Mitte & Filmkunst<br />
66 Fantasy Filmfest<br />
Focus asia nights<br />
Filmprogramm: »13 Beloved«, »A Battle of<br />
Wits«, »Alone«, »Flash Point«, »Highlander:<br />
The Search for Vengeance«, »Protégé«,<br />
»Soo«, »XX«<br />
1./2.12. Berlin, CinemaxX Potsdamer Platz<br />
1./2.12. Hamburg, CinemaxX Dammtor<br />
Festival des gescheiterten<br />
Films<br />
22. – 31.12. München, Maxim<br />
11. – 13.1. Wien | A, BSL<br />
17. – 20.1. Frankfurt/M., Orfeos Erben<br />
23. – 29.1. Berlin, Babylon Mitte<br />
21.2. Bremen, Schauburg<br />
22. – 24.2. Köln, Filmhaus<br />
lesungen<br />
Finn-ole heinrich<br />
liest aus »Räuberhände«<br />
7.12. Cuxhaven, Café Ringelnatz<br />
18.1. Hannover, enercity expo café<br />
poezone 5: Bella triste – Junge Texte<br />
und neue Autoren mit Sina Ness, Christian<br />
Schloyer und Thomas von Steinaecker,<br />
moderiert von Martin Kordic<br />
1.12. Heidelberg, Deutsch-Amerikanisches<br />
Institut<br />
lyriktreFFen – ein tunnel<br />
üBer der spree<br />
mit Nora Bossong, Ulrike Draesner, Daniel<br />
Falb, Matthias Göritz,<br />
Hendrik Jackson, Monika Rinck, Hendrik<br />
Rost, Christian Schloyer,<br />
Kathrin Schmidt, Volker Sielaff und Jan<br />
Wagner<br />
4.12. Berlin, Literarisches Colloquium<br />
roman simić<br />
liest aus »In was wir uns verlieben«<br />
12.12. Berlin, südost Europa Kultur e.V.<br />
14.12. Leipzig, Horns Erben<br />
15.12. Dresden, Büchers Best<br />
17.12. Hildesheim, Kulturfabrik<br />
verstransFer: soFia – Berlin<br />
Mit Ekaterina Yossifova, Uljana Wolf,<br />
Georgi Gospodinov und Uwe Kolbe,<br />
moderiert von Alexander Gumz<br />
18.12. Berlin, Literaturwerkstatt<br />
96 1 termine<br />
termine 1 97<br />
töne 1 97<br />
goon<br />
präsentiert<br />
termine<br />
gob squad’s kitchen<br />
(you‘ve never had it so good)<br />
Ausgehend von Andy Warhols Film »Kitchen« aus<br />
dem Jahre 196 begibt sich Gob Squad, unterwegs<br />
in Hamburg, Nottingham und Berlin, auf eine<br />
Zeitreise durch Video-, Performance-, Tanz- und<br />
Soziokultur, hinein in die New Yorker Kunst- und Underground-Szene der<br />
1960er Jahre. Jeden Abend rekonstruieren sie aufs Neue diese Ära des Auf-,<br />
Ab- und Umbruchs. »Kitchen« zeigt Menschen, die in einer Küche abhängen,<br />
viel mehr passiert nicht. Dennoch bringt es die hedonistische experimentelle<br />
Energie der aufkommenden Popkultur auf den Punkt.<br />
»If tomorrow I find somebody who is pretty much like me and I put her here to<br />
sing, she can be Nico while I go and do something else.« (Nico)<br />
goon<br />
präsentiert<br />
13.12. Berlin, Volksbühne<br />
äpfel, nüsse,<br />
fink und star<br />
Die junge deutsche Comicszene hat in Hamburg ihre<br />
Hochburg, jetzt hat sie dort auch ein kleines aber feines<br />
Comicfestival: Zum zweiten Mal findet dieses Jahr Ȁpfel,<br />
Nüsse, Fink & Star« statt. Neben einer kleinen Comicmesse<br />
im Kulturhaus 73 mit Verlagen und Zeichnern aus Deutschland, der<br />
Schweiz, Italien und Russland wird es eine Werkschau des Berliner Comiczeichners<br />
Mawil in der Galerie Linda e.V., eine Ausstellung in der Galerie<br />
Hinterconti mit Beteiligung bekannter Grössen der Hamburger Off-Szene<br />
wie Moki oder Nina Braun und auch eine Ausstellung des aus Bologna stammenden<br />
Comickollektivs Canicola in den Räumen des Vorwerkstift geben.<br />
Vernissage am 6. Dezember, es folgt ein ganzes Wochenende mit verschiedenen<br />
Eröffnungen, Partys und jeder Menge Comics.<br />
goon<br />
präsentiert<br />
6. – 9. Dezember: Hamburg, Comicfestival »Äpfel, Nüsse, Fink und Star«<br />
asian hot shots<br />
berlin<br />
Das asiatische Kino ist ja im Verlauf der letzten<br />
Jahre nach einem langen Schattendasein in den<br />
Nischen des Obskurantismus endlich nach und nach in das Bewusstsein der<br />
deutschen Kino- bzw. Videothekengänger eingesickert. Dem sich zwangsläufig<br />
aufdrängenden Übersättigungseffekt durch das mit den High- und Lowlights<br />
einher kommende, zahlreiche Mittelmaß tritt nun mit den Asian Hot<br />
Shots Berlin erstmals ein ambitioniertes Filmfestival entgegen, das es sich zur<br />
Aufgabe gemacht hat, aufregende und (noch) unbekannte Produktionen aus<br />
Independent-, Arthouse-, Mainstream- wie Experimentalfilm auf die große<br />
Leinwand des Berliner Kinos Babylon Mitte zu bringen. Zusätzlich zu den<br />
sechs Sektionen des Filmprogramms bieten die Asian Hot Shots ein umfangreiches<br />
Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Workshops<br />
bis hin zu Konzerten und Partys, so dass für den asiaphilen Kulturjunkie eigentlich<br />
keine Wünsche offen bleiben.<br />
Asian Hot Shots Berlin, vom 16. – 22.1.2008 im Babylon Mitte, Berlin
kolumne text: lea streisand foto: brock landers<br />
Wahnsinn in Gesellschaft<br />
»Man sagt uns, dass eine Zahl Gefangener simillini feminis<br />
mores stuprati et constupratores« (Das ist nicht sein<br />
Ernst?!), »dass sie ex hoc obscaeno sacrario cooperti stupri<br />
suis alienisque zurückkämen«, wütend schlage ich das Buch<br />
zu: »Der Typ hat ja wohl’n Rad ab!« Franzi nimmt erstaunt<br />
einen zerkauten Bleistift aus dem Mund. Ein Pfeilhagel<br />
von Blicken prasselt auf mich nieder. Bibliotheken sind<br />
sakrale Orte. Hier wird gedacht. Niedere Tätigkeiten wie<br />
Essen, Trinken, Rauchen, Reden sind verboten. In diesen<br />
Tempeln des Wissens geben wir uns der Illusion hin, der<br />
Mensch sei tatsächlich eine geistreiche Kreatur. Hier tun<br />
wir so, als ob die Aufklärung doch irgendwas gebracht<br />
hätte. Und genau hier überfallen uns unsere körperlichen<br />
Gelüste und Gebrechen mit umso größerer <strong>Gewalt</strong>. Zuerst<br />
kommt der Hunger: »Toblerone«, schießt es mir durch<br />
den Sinn, »Oder einfach nur ne Stulle.« Zehn Minuten<br />
und einen Schokoriegel später lese ich: »Die Correction, die<br />
der Ort der schwersten Strafe in der Anstalt ist, enthielt ...«<br />
da rutscht mein Ellenbogen vom Tisch. Das ist Phase zwei:<br />
Müdigkeit! Kaffeegestärkt sitze ich wieder und beneide<br />
meine Freundin um die Leidenschaft, mit der sie in ihrem<br />
Pschyrembel blättert. Mediziner beschäftigen sich mit<br />
realen Problemen, nicht mit den kruden Hirngespinsten<br />
irgendwelcher Franzosen. Ihr Bruder macht irgendwas<br />
mit Kommunikation, auch was Anständiges mit Zukunft,<br />
nicht so sinnlos Künstler und Geisteswissenschaftler wie<br />
unsereiner. Er hat ihr ein neues Telefon besorgt mit integriertem<br />
Diktiergerät. Zurück zu Foucault: »Stets herrscht<br />
(...) diese schockierende Mischung von jungen, leichten<br />
Mädchen mit alten Frauen, die ihnen nur die zügelloseste<br />
Kunst der Verderbnis zeigen können.« Mein Kopfkino<br />
spielt plötzlich dreckige kleine Samstagabendfilme:<br />
Schulmädchenreport 1 bis 3 und so. Ich schaue mich um<br />
und bemerke diesen Jungen: Eine seidig schimmernde<br />
Haarsträhne fällt ihm ins Gesicht, wenn er sich über den<br />
Brockhaus beugt. Gedankenverloren wandert seine Hand<br />
98 1 kolumne<br />
in den Nacken und bleibt dort liegen. Die Hände! Groß<br />
und kräftig und – zurück zur Lektüre: »Diese Visionen<br />
werden lange Zeit mit Nachdruck die späten Abende des 18.<br />
Jahrhunderts beleben.« Ja, das kann ich mir vorstellen! Ich<br />
gucke hoch, was Adonis macht: Oh mein Gott, er streckt<br />
sich, reibt sich die Schläfen, streicht mit den Fingern über<br />
die geschlossenen Lider. Lass mich das machen! Da öffnet<br />
er die Augen, guckt ... und ich falle tot um. Wer glaubt,<br />
die Atmosphäre in Diskotheken sei hormongeschwängert,<br />
der soll einmal eine Bibliothek besuchen. Es ist jedes Mal<br />
dasselbe: Erst kommt der Hunger, dann die Müdigkeit<br />
und zum Schluß die Geilheit. Adonis sieht mit einem Mal<br />
so hinreißend verschlafen aus, dass es meiner kompletten<br />
Willenskraft bedarf, nicht eine Seite aus meinem Foucault<br />
heraus zu reißen und zu notieren: »Willst du mit mir schlafen?<br />
Kreuz an: Bei mir, bei dir, oder gleich hier.« Hab ich<br />
ein Glück, dass Gedanken frei und unleserlich sind! Ich<br />
wäre schon längst eingesperrt worden. Apropos: »Für<br />
einen Augenblick werden sie durch das unerbittliche Licht<br />
des Werkes von de Sade herausgeschnitten ...« Ein Geräusch<br />
zerschneidet die Stille. Es ist die aufgezeichnete Stimme<br />
eines Mobiltelefons, erst leise, dann immer lauter: »Nimm<br />
ihn in den Mund. – Nein. – Du nimmst ihn sofort in den<br />
Mund! – Nein!.« Alle im Raum sind jetzt wach. »Unverschämtheit«,<br />
grunzt jemand. Ich gucke zu Franzi: Schulterzucken.<br />
Sie schaut Adonis an, der zu mir, ich schüttele den<br />
Kopf. Unsere Blicke wandern zu der Tasche neben Franzi.<br />
»Nimm ihn in den Mund«, sagt die Tasche, »Nein«. Meine<br />
Freundin ist kreideweiß. Wir beide wissen, dass die Tasche<br />
nicht mir gehört. Franzi zittert. »Mach es aus«, flüstere<br />
ich. »Nein«, ruft die Tasche. Und dann ist es vorbei.<br />
Zornesbleich murmelt Franzi: »Ich bring ihn um«, und<br />
meint wohl ihren Bruder. Adonis grinst und beugt sich<br />
nach vorn. »Zigarette danach?« fragt er mit abgrundtiefer<br />
Stimme. Heirate mich, denke ich.<br />
ILLuSTrATIoN | GrAfIKDESIGN | foToGrAfIE<br />
51 internationale künstler<br />
karin aue<br />
violaine barrois<br />
katharina borchert<br />
steven burke<br />
luke broWn<br />
roberto christen<br />
carlos dieciocho<br />
jenny dupont<br />
oona eberle<br />
ingo fischer<br />
ryan gallagher<br />
silvia gehrke<br />
andreas glumm<br />
kristian goddard<br />
alexander güngör<br />
nathanaël hamon<br />
maxWell holyoke-hirsch<br />
i like draWing<br />
jellofishy<br />
chrissi jülich<br />
dennis kastrup<br />
evgeny kiselev<br />
koa<br />
martin kretschmer<br />
nicolas lampert<br />
hanna martus<br />
masako<br />
maria eva mastrogiulio<br />
ray ogar<br />
daniel pagan<br />
michael petersohn<br />
johan potma<br />
manfred renner<br />
nils rigbers<br />
nathalie roland<br />
sabine schmidt<br />
therese schreiber<br />
toni schWitter<br />
skWak<br />
hydro74<br />
jan mathias steinforth<br />
fabian stuhlinger<br />
yvonne sussmann<br />
kate sutton<br />
tim tsiu<br />
jeffrey tzu kWan koh<br />
brian ulrich<br />
esme valk<br />
ans van der vleuten<br />
lami thui vo<br />
oliver Wiegner<br />
jetzt online bestellen | 8 euro | WWW.iomagazin.de