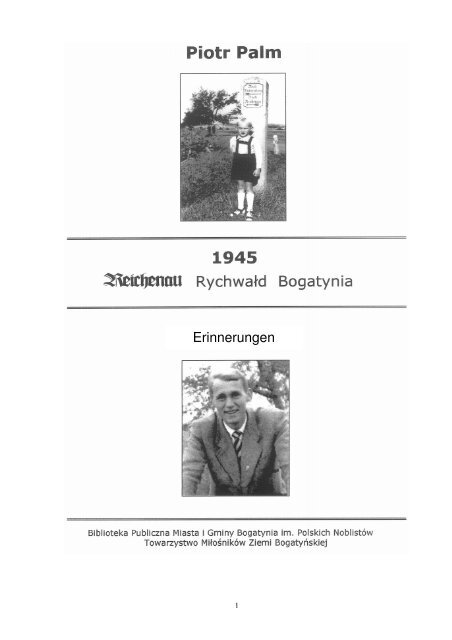Erinnerungen
Erinnerungen
Erinnerungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Erinnerungen</strong><br />
1
<strong>Erinnerungen</strong><br />
Aus Reichenau und aus dem frühen Bogatynia; aufgeschrieben für Kinder und Enkel; alle<br />
Rechte vorbehalten; von PETER PALM<br />
1. Die Vorfahren<br />
Jeder Mensch kann sich als Kind seiner zwei direkten Eltern sehen, aber auch in der<br />
Zusammensetzung von vier Großeltern oder aber von 8 Urgroßeltern abstammend. Letztere<br />
erweiterte Sicht ist interessant, denn manchmal überspringen Eigenschaften eine Generation.<br />
Von meines Vaters Seite ist als Urgroßvater ein Zimmerer-Meister von hohem Wuchs<br />
und kräftiger Statur (und hohen Schultern) der einzige große Mensch in der Ahnenreihe, der<br />
aber seine Körpergröße konsequent weiter vererbte. Bei meinem Enkelsohn sehe ich<br />
zumindest schon die hohen Schultern, die aber sein 1,94 m großer Vater nicht hat, wohl aber<br />
ich, der Großvater.<br />
Die Vorfahren von meines Vaters Seite lebten alle auf der böhmischen Seite.<br />
Vorgenannter Zimmerer-Meister hatte es in Brüx (Most) zu beträchtlichem Vermögen<br />
gebracht, seine Söhne studierten in Prag Architektur, aber alles war in Brüx durch Bergbau<br />
unterhöhlt worden, bis 1896 die Stadt sich durchaus plötzlich im Ganzen absenkte und sich<br />
mit zerstörten Gebäuden in einer Binge befand. So im Näheren heimatlos geworden und an<br />
Vermögen stark gemindert, beschloss die Familie sich näher der Heimat meiner Urgroßmutter<br />
2<br />
Man sieht ihm an, dass er es körperlich<br />
und geistig geschafft hat. auf der<br />
Baustelle
zu begeben, einer geb. Nemethy, einer Enkelin des ehemaligen bekannten Oberamtmannes<br />
gleichen Namens der böhmischen Grafschaft Friedland.<br />
Aufgrund rheumatischer Beschwerden der Urgroßmutter kaufte man sich mit dem<br />
Restvermögen im aufstrebenden Moorbad Oppelsdorf auf sächs. Seite ein, erbaute die<br />
Pension „Waldesruh“ und erwarb ein kleines Haus am Ende der „Villenstraße“. Mein<br />
Großvater, der eigentlich viel lieber Arzt geworden wäre, (er bemühte sich ständig um ärmere<br />
Kranke) verdiente sein Geld anfänglich als freier Architekt (dabei Schule in Bad Oppelsdorf,<br />
Brunnenhäuschen) im ganzen Bezirk und lernte in Haindorf-Ferdinandstal meine Großmutter<br />
kennen (als sie krank war). Sie hatten 2 Söhne.<br />
Großmutter entstammte einer zahlreichen Gastwirts- und Fleischer-Familie (5 Kinder).<br />
Ihre Großeltern hatten noch selbst im Walde die Steine gebrochen und in Ferdinandstal die<br />
Gaststätte und Fleischerei „Waldschlösschen“ errichtet.<br />
3
Wilhelm und Martha geb. Linke. Heirat 11.02.1908<br />
4
Soweit die Vorfahren von Seiten des Vaters, hierzu noch zwei Anekdoten:<br />
– Als der Bruder meines Vaters an einem Schulausflug von Oppelsdorf in das Museum<br />
Schloss Friedland teilnahm wurde ihm gesagt: „Wenn ihr in der Galerie am Bild von<br />
Nemethy vorbeikommt, kannst Du ja durchblicken lassen, dass Du sein Nachkomme bist.“<br />
Wieder zurück wurde er gefragt: „Wart ihr am Bild von Nemethy?“, Antwort: „Ja.“, „Hast<br />
Du durchblicken lassen?“, Antwort: „Nein, die haben gesagt, dass er gern einen getrunken<br />
hat“.<br />
– Wenn an der Wallfahrtskirche in Haindorf Anfang Juli die Kirchweih gefeiert wurde,<br />
kamen zahlreich Roma , um u. a. an den Geschäften teilzunehmen. Die Roma, damals noch<br />
fahrendes Volk mit Pferden, wurden vom Förster auf einer Waldwiese oberhalb<br />
Ferdinandstal eingewiesen, wo der Tross bleiben musste. Waren die Geschäfte in Haindorf<br />
schlecht gegangen, so war unser Anwesen in Ferdinandstal, vor dem Wald, die letzte<br />
Chance, um die Lage zu verbessern und es fehlte wohl oft ein Huhn oder eine andere<br />
Kleinigkeit. Eines Tages aber kam ein alter Roma zu meinem Urgroßvater und sagte<br />
sinngemäß: „Herr Linke, meine Frau ist krank, wir kommen nicht mehr weiter, bitte helfen<br />
Sie uns.“ Urgroßvater konnte nur den Heuboden und Decken anbieten, verpflichtete den<br />
Gast auf Handschlag dort nicht zu rauchen und versorgte die Beiden täglich mit<br />
ausreichend Speisen. (Mein Vater als Kind sah den alten Roma mit seiner kurzen<br />
Stummelpfeife noch vor dem Haus sitzen.) Nach ca. 1 Woche war die Frau wieder gesund<br />
und der alte Roma sagt: „Herr Linke, ich habe kein Geld um zu bezahlen, aber ich habe<br />
Zeichen für meine Brüder gemacht, das ist auch gut.“ Niemand hat jemals diese Zeichen<br />
gesehen, aber niemals wieder ist durch Roma etwas verschwunden.<br />
5<br />
Ehepaar Andree ca. 1944
Von meiner Mutter Seite, einer geb. Preibisch aus Reichenau, diese Familie dort ansässig<br />
seit dem 18. Jahrhundert, damit genügend Zeit für Reichenauer Einheirat, so dass wir uns<br />
auch als Nachkommen der ersten deutschen Siedler von ca. 1250 sehen können und zur Hälfte<br />
der örtlichen Wenden, wobei der Name Preibisch selbst slawischen Ursprung ist. Von<br />
Urgroßvater Preibischs Mutter weiß ich, dass sie als meine Ur-Urgroßmutter die Witwe des<br />
Goldschlägers Leupolt war, vermögend und sehr schön, mit einem Kranz wunderschöner<br />
Töchter, die sie mit in die Ehe brachte und über welche, für meine Mutter noch deutlich<br />
spürbar wir mit fast allen großen Bauernwirtschaften in Reichenau aktuell verbunden waren.<br />
Die Ur-Urgroßeltern erbauten auch über dem Uferweg als 389 a das neue Bauernhaus im<br />
klassizistischen Stil (dort 18. mein Urgroßvater geboren), mit ursprünglicher Freitreppe vom<br />
Uferweg; von der Bevölkerung damals als „Glaspalast“ angesprochen. Sie pflanzten um den<br />
Hof herum 97 Kirschbäume (Abnehmer damals evtl. schon u. a. Firma Rolle, von den letzten<br />
Bäumen habe ich noch profitiert). Ansonsten war die kleine Bauernwirtschaft von ca. 10 ha<br />
mehr die Grundlage für einen Fuhrbetrieb, denn die meisten Kesselhäuser der zahlreichen<br />
Fabriken mussten lange Zeit noch von Pferdegespannen mit Kohle versorgt und von Asche<br />
entsorgt werden; außerdem stand auf jedem Bauernhof eine elegante Kutsche „Landauer“<br />
genannt, für sozusagen Taxidienste für die Bevölkerung (und bei uns auch noch ein<br />
Leichenwagen). Urgroßvater Preibisch hat mir lange Lebenszeit ein Rätsel aufgegeben, indem<br />
ein Wagen aus seiner Zeit abgestellt war mit seinem Namen und dem Zusatz „D. R. G. M.“<br />
(Deutsches-Reichs-Gebrauchs-Muster hat sich später für mich erschlossen ca. Patent). Der<br />
Boden des Wagens ging zwecks Kohle-Entladung über eine Kurbel zu öffnen und das Patent<br />
wurde für ca. 5.000,00 Reichsmark = heute ca. 100.000,00 € in die USA verkauft.<br />
Urgroßvater war „Kirchenvater“ in Reichenau. Für meine Mutter war es durch aus ein Schock<br />
als sie als 6-jährige erlebte, wie ihr bewunderter Vater sonntags auf dem Klavier seiner Eltern<br />
Töne anschlug und dessen Vater das Klavier zu- und ihm auf die Hände schlug und sagte:<br />
„Heute ist Sonntag!“. Urgroßmutter war eine geborene Trenkler von einem großen Hof in<br />
Markersdorf und allzeit eine sehr heitere Frau. Sie hatten 4 Kinder. Vom anderen<br />
Urgroßvater, d. h. vom Vater meiner Reichenauer Großmutter, weiß ich , dass er als Sohn des<br />
Leutevogtes Seidler auf dem Schloss in Großhennersdorf geboren wurde. Die Urgroßmutter<br />
nahe bei in Burkersdorf in der „Alten Schäferei“ als Tochter des Groß-Schäfermeisters<br />
Gäbler. Die Beiden gingen später mit ihren 5 Kindern nach Reichenau, wo der Haupternährer<br />
dann als Fuhrmann arbeitete.<br />
Als ich 1943 als 3 ½-jähriger nach Reichenau kam, fehlte aus dem Kreis der Großeltern<br />
schon der Vater meines Vaters, der nach einem Sturz auf einer Baustelle schon 1937<br />
verstorben war. Am 1. Weltkrieg nahm er als Österreichischer Pionieroffizier teil und war<br />
später in den Dienst der Firma Rolle in Reichenau getreten (damals größte Obstwein- und<br />
Marmeladenfabrik Deutschlands), die u. a. für ihren Neubau in Niederoderwitz und für<br />
Lockerungs-Sprengungen von Baumpflanzungen auf ihren großen Plantagen einen Fachmann<br />
brauchte (das Sprengbuch habe ich noch, ebenfalls die Baufoto-Dokumentation vom<br />
Erweiterungsbau der KOSA Niederoderwitz). Er liegt auf dem Waldfriedhof in Oppelsdorf<br />
begraben. Meine Großmutter hatte später den etwa zur gleichen Zeit verwitweten (die<br />
Familien waren sich früher schon gut bekannt) Carl Andreè, Bürgermeister in Oppelsdorf und<br />
Inhaber der Pension „Villa Clara“ auf der Villenstraße, geheiratet; er war uns immer ein guter<br />
Stiefgroßvater.<br />
6
So habe ich in der „Villa Clara“ den ausklingenden Pensionsbetrieb noch erlebt, d. h. es<br />
roch immer gut nach Kaffee, die Bäder wurden bereitet, irgendwo in den Parks spielte Musik<br />
und die Leute spazierten vorbei. Der Krieg spielte nur soweit eine Rolle, als mir die<br />
Großmutter immer die Geschichte eines Schäferhundes, Liebling der Familie, vorlesen<br />
musste, der dann zum Militär geholt und für die Front als Retter ausgebildet wurde, was er so<br />
tapfer tat, dass viele Dankschreiben von Soldaten eintrafen, bis eines Tages vom Ende der<br />
Straße zwei Soldaten auf das Haus zugingen, die einen Korb zwischen sich trugen, der mit<br />
einer Ehrenschleife bedeckt war ... Weiter haben wir die Geschichte nie kennen gelernt, weil<br />
wir immer ab dieser Stelle, Großmutter und ich , auf dem Sofa saßen und weinten. Mit und<br />
ohne Großmutter waren wir vor 45 oft in Ferdinandstal, wo ihr Bruder inzwischen die<br />
Gaststätte führte. Dort hing ein Bild in der Gaststube auf dem gezeigt wurde, wie Wölfe einen<br />
Schlitten, die bewaffneten Männer darauf und die durchgehenden Pferde anfielen, Ausgang<br />
ungewiss. Was nützt mir die ganze Malkunst Anderer, wenn ich dieses Bild bis heute nicht<br />
wieder gefunden habe. Ab 1943, als mein Vater eingezogen wurde, mieteten wir die<br />
Wohnung im Obergeschoss des Hauses der Eltern meiner Mutter, so dass ich nahe bei den<br />
Großeltern Preibisch aufgewachsen bin.<br />
Ich will zum Wohnen im damaligen Reichenau vermerken, dass dieses anders als heute<br />
eigentlich nur in der Wohnküche stattfand. Nur dieser Raum war an den Wochentagen<br />
beheizt, das Wohnzimmer wurde nur an Wochenenden erwärmt und genutzt, wenn Besuch zu<br />
erwarten war. An den Schlafzimmerwänden glitzerte im Winter der Frost und als Seelen- und<br />
Körpertrost wurde ein mit Warmwasser gefüllter Bettwärmer ca. ½ Stunde vor dem<br />
Schlafengehen ins Bett gestellt.<br />
7<br />
Hochzeitsbild Edwin und Lina (geb.<br />
Seidler) Preibisch.<br />
Man fuhr mit der Kutsche bis nach<br />
Oybin zur Trauung in der Kirche dort.
Die Wohnküche war gleichfalls Körper-Reinigungsstelle, wochentags mit den<br />
Möglichkeiten eines Handwaschbeckens, samstags mit Ganzkörper-Zinkbadewanne.<br />
Letzteres evtl. auch in der Waschküche im Keller, wo der Wäschekessel dann entsprechend<br />
geheizt, die größeren Mengen Warmwasser lieferte. In den meisten Häusern war die<br />
Abortgrube zu riechen, manchmal auch in den Kleidern der Bewohner. Wie komfortabel man<br />
heute in Deutschland auf ca. 40 m² beheizter Fläche pro Person lebt, ist bekannt. Mit dem<br />
Schwinden/Verteuern von Energie und der Zunahme von CO2 in der Atemluft wird man unter<br />
Druck kommen in Richtung Ehemals und es wird Verstand nötig sein, um Oberhalb zu<br />
bleiben. Ansonsten ist bescheidenes Leben aber nicht gleichzusetzen mit unglücklichem<br />
Leben. Eine der schönsten Kindheitserinnerungen meiner Mutter war, dass die Familie sich<br />
abends in der Wohnküche zur „Dunkelstunde“ versammelte, d. h. um Licht zu sparen, öffnete<br />
man das Feuerloch des Ofens, die Familie saß drumherum und erzählte sich Geschichten.<br />
Großvater war ruhig, freundlich und klug, mit einer guten Ausbildung in seiner Jugend<br />
zum Webmeister über die Firma Preibisch, die sich die entfernten Verwandten gleichen<br />
Namens gern in verantwortliche Positionen qualifizierte, so ihn als Versandleiter, bis zum<br />
Niedergang der Firma in der Weltwirtschaftskrise. 1912 kam im neu gebauten Haus auf<br />
eigenem Grund neben dem Hof, Uferweg 389 b, meine Mutter als erstes von 4 Kindern zur<br />
Welt.<br />
Im I. Weltkrieg lag Großvaters Kompanie an der Somme und es überlebten davon nur 17<br />
Soldaten. An der Hauptkampflinie konnten die Soldaten nur durch das ständige<br />
Hineinspringen in frische Granattrichter einen Beitrag zur Erhaltung ihres Lebens leisten.<br />
Nachts schliefen sie tief unter der Erde, wo die Einschläge nicht durchdringen konnten, so die<br />
Selektion durch den Tod über 3 Jahre. Ein Hitler, der unweit davon im gleichen Einsatz war,<br />
verlor die Orientierung. Großvater wendete sich noch mehr der Natur zu und freute sich über<br />
jeden Tag den er später in der geliebten Heimat in Frieden verleben durfte.<br />
8<br />
Meine Mutter Anneliese geb. Preibisch,<br />
als 1. Kind. Geb. 09.01.1912.
Großmutter, wie schon erwähnt, stammte aus der großen Familie eines einfachen<br />
Fuhrmannes und konnte trotz guter Leistungen in der Schule keine weitere Ausbildung<br />
bekommen. Sie erzählte, dass sie einmal einen fälligen Hausaufsatz vergessen hatte und<br />
diesen in ihrer Not dann von einem weißen Blatt ab las, mit gutem Ergebnis. Die beiden<br />
lernten sich bei der Arbeit kennen und hatten mit dem Hausbau auf eigenem Grund und der<br />
Ehemann als zukünftiger Hoferbe und der Hof durchaus mit Barvermögen versehen, einen<br />
guten Start. Das sah nach dem I. Weltkrieg aber ganz anders aus. Zwei weitere Kinder wurden<br />
geboren, es gab nur einen Verdiener, die Stammfirma brach zusammen, das Barvermögen des<br />
Hofes holte die Inflation und das Haus musste weiter abbezahlt werden. In dieser Situation<br />
versuchten die jungen Eheleute über Wasser zu bleiben indem sie jeden Monat im Voraus das<br />
Geld für alle Belange in die winzigen beschrifteten Schubfächer eines Vertikos taten; d. h. wo<br />
dort nichts mehr war, konnte finanziell nichts mehr sein. Leider war wohl auch oft bei der<br />
Sparte „Ernährung“ zu wenig. „Der Schnellzug ist über die Butterbrote gefahren“ sagten die<br />
Kinder und bei meiner Mutter wirkte sich das so aus, dass sie nicht genommen wurde als sie<br />
eine Lehre beginnen sollte sondern, für ein Jahre zurückgestellt, in einer Fleischerei<br />
(Lehmann) mit aushelfen musste, damit sie zu Kräften käme. Diese Zurückstellung ist für<br />
meine Mutter wohl ein tiefer Schock gewesen, denn bis ins Alter gab sie nur ungern<br />
Auskunft, woher sie wohl die guten Kenntnisse beim Fleischkauf habe.<br />
Bruder Roland trat in Löbau eine Gärtnerlehre an (Gärtnerei existiert Eingangs Löbau<br />
von Herrnhut her noch), Bruder Kurt setzte später ebenfalls eine Gärtnerlehre durch.<br />
9<br />
Ilse u. Kurt Preibisch Meine urgroßm.<br />
Seidler<br />
Tante Luise<br />
Christine Knebel<br />
Ilse Sprenger aus Haindorf<br />
Meine Großeltern Andree<br />
Standesperson<br />
Edwin u. Lina Preibisch<br />
Meine Urgroßvater Linke aus Haindorf /<br />
Ferdinandstal<br />
Hochzeitsfoto vor der Kirche in Bad.<br />
Oppelsdorf
Mit Kurgästen der „Villa Clara“; 2. von links Christel Jung<br />
Für intelligente Mädchen aus einfachen Verhältnissen gab es damals eine Chance der<br />
fälligen Fabrikarbeit zu entgehen, indem man sich in konzentrierten bezahlbaren „Kursen“<br />
berufliche Fähigkeiten aneignete. So absolvierte meine Mutter eine Ausbildung als Stenotypistin<br />
und Maschineschreiberin, in welchen beiden Fächern sie später bei öffentlichen<br />
Wettbewerben mit hunderten von Teilnehmern vordere Plätze erreichte (die Urkunden haben<br />
wir noch). Die jüngste Schwester Ilse konnte später schon eine gediegenere kaufmännische<br />
Ausbildung erhalten. Meine Mutter aber, damals die Älteste unter einem ganzen Schwarm<br />
von Cousinen, konnte durchaus beneidet, außerhalb Reichenau bei der Firma „Weinbrand<br />
Wilthen“, erst in Wilthen selbst, dann in Bautzen, dann bei der Außenstelle Stettin, Geld<br />
verdienen und ein selbstständiges Leben führen. Die Großeltern Pampl in Oppelsdorf hatten,<br />
wie schon erwähnt, ein kleines Haus am Ende der Villenstraße erworben, wo mein Vater Karl<br />
1908 und später sein Bruder Kurt geboren wurden. Wenn man auch inzwischen knapp bei<br />
Mitteln war, so war die Anstellung Großvaters als Architekt bei Rolle doch vergleichsweise<br />
gut bezahlt und mein Vater wuchs auch sonst im wie immer sonntäglichen Milieu des<br />
Kurbades auf und alles gefiel ihm so gut, dass er eigentlich nicht mehr wollte. Jedenfalls<br />
schwieg er lieber über seine 2 Gymnasialjahre in Zittau, die wahrscheinlich keine Ruhmesblätter<br />
waren. Er absolvierte dann eine Maurerlehre bei Firma Weickelt in Reichenau, dabei<br />
stürzte er in der Ziegelei Oppelsdorf hoch vom Gerüst ab und blieb aber zum Glück bis zum<br />
Gürtel tief in einem Braunkohlehaufen stecken; als eine junge Frau in die Kalklöschgrube<br />
gefallen war, durfte er sie mit herausziehen, schleunigst völlig entkleiden und immer und<br />
immer wieder mit Wasser übergießen. Die sonstigen Prüfungen bestand er auch, so dass er<br />
dann auf der Baugewerbe-Schule in Zittau als junger Mann zum Abschluss als Bautechniker<br />
kam. Worauf wieder Jahre in Arbeitslosigkeit im schönen Bad Oppelsdorf kamen und<br />
Bekanntschaft und Heirat mit meiner Mutter, die ihn aber auch 1937 zu einem Bewerbungsschreiben<br />
bei der Aufbauleitung des Flugplatzes Kamp veranlasste.<br />
2. Kamp<br />
So stehen denn jetzt meine jungen Eltern allein auf dem Plan, Mutter vorerst noch in Stettin,<br />
Vater erstmals vom Leben so richtig ergriffen auf dem Anmarsch nach Kamp (Luftlinie ca.<br />
120 km östlich von Stettin), wo ihm die Flugplatz-Bauleitung einen PKW bis Bahnhof<br />
10
Treptow entgegen schickte und zwei Ingenieure zur Begrüßung, Ehre und Verpflichtung<br />
gleichermaßen. Ich weiß es selbst noch vom Berufsanfang, man kommt dann plötzlich in eine<br />
gehobene Gemeinschaft, die aber auch Leistung verlangt. Es wird wohl eine Probezeit<br />
gegeben haben, nach deren positiven Ablauf zwei Verdiener in der Ehe waren, worauf nach<br />
damaliger Regelung die Ehefrau die Arbeit aufzugeben hatte, d. h. meine Mutter kam auch<br />
mit nach Kamp, in eine Wohnbaracke für kinderlose Ehepaare. Allerdings kam sie auch in<br />
eine wunderschöne Lebenszeit und eine wunderschöne Gegend. Abgesehen von dem Kranz<br />
der anderen jungen Familien in der ca. 20 Personen zählenden Bauleitung, den ich nur im<br />
Unbewussten noch kenne, kann man die schöne Landschaft heute noch sehen. Die Wohnung<br />
befand sich auf den Ausläufern der Dünen, der Weg zum Strand ca. 200 m, der Weg zum<br />
Seebad Deep ca. 1,5 km, nach Kolberg 12 km, nach Treptow 10 km.<br />
Letzte Tage in Kamp (Flugplatz)<br />
– Meine erste persönliche Erinnerung (ich wurde 1939 geboren) war, dass ich von 2 Radfahrern<br />
überfahren wurde, Bauarbeiter, die furchtbar schimpften.<br />
– Als zweite Erinnerung tauchen ausklopferbewaffnete Mütter auf, nachdem wir wieder<br />
einmal den Zaun zum Flugfeld durchbrochen hatten.<br />
– Erinnerlich auch Fische, die in der Pfanne mit den Schwänzen schlugen.<br />
– Als ich nach 62 Jahren erstmals wieder in das Kamper Wohnzimmer kam, wusste ich sofort,<br />
wo der ca. 1,20 m hohe Ofen gestanden hatte, auf welchen wenn er kalt war, ich auch schon<br />
mal strafgesetzt wurde, wie auf einen hohen Felsen.<br />
– Erinnerlich auch die letzte Nacht in Kamp, als an den Wänden schon die Pakete standen und<br />
ich den Lichtschalter nicht finden konnte und alles umriss. Eine Nachbarin holte dann<br />
meine Eltern von Abschiedsbesuchen zurück, wegen meines furchtbaren Geheuls und<br />
ständigen Krachens.<br />
Aber auch im Unterbewusstsein ist manches wahrscheinlich haften geblieben:<br />
– Das Wachgebäude zum Kasernenbereich spricht mich heute noch an, auch die charakteristisch<br />
gebauten Militär-Wohnhäuser, auch wenn diese in Deep stehen, wie gute alte<br />
Bekannte von nebenan, mit dem Hinweis aus Kinderzeit „hier bist auch Du gleich zuhaus“.<br />
11
– Ca. 20 Jahre nach Kamp war ich erstmals wieder am Meeresstrand (39 – 42 vom März bis<br />
November fast täglich) und ich musste immer wieder sehen und lauschen, da war etwas<br />
Altbekanntes um mich herum.<br />
3. Reichenau 1943<br />
Die erste Zeit von 1942 – 1944 liegt im Unbewussten. Natürlich werde ich in dieser Zeit<br />
schon mein neues Umfeld aufgenommen haben, was aber von späteren Bildern überdeckt<br />
wird.<br />
Neben unserer direkten Wohnung mit meiner lieben Mutter, kleinen Schwester und<br />
vertrauten Kamper Möbeln, mit Rundumblick auf anfänglich unbekannte Objekte, ist sicherlich<br />
die Wohnküche mit meiner Großmutter im Erdgeschoss sofort das Zentrum geworden,<br />
welches es bis zur Großjährigkeit dann auch geblieben ist. Großmutter war eine feste Instanz<br />
und Zuflucht von Anfang an. Der berufstätige Großvater trat erst in den Folgejahren in<br />
anderer Weise in den Vordergrund, als mir bewusst wurde, dass ich von ihm immer gute<br />
Antworten bekam.<br />
Im Umfeld des Hause traf man auf Nachbarkinder, die alle Oberlausitzer Mundart<br />
sprachen. Anfänglich wurde ich abgewiesen und ausgeschlossen mit der Begründung: „... dar<br />
koan jo no gorne richtsch radn“, worauf zur Verzweiflung meiner Mutter das vornehme Nord-<br />
Hochdeutsch mit Stock und Stein – „S-T“ schnellstens von mir abfiel und ich ein akzeptierter<br />
Oberlausitzer Quirler wurde. Die umwohnenden Kinder hatten in damaliger Sicht alle nur<br />
Mütter, die Väter waren im Kriege. Die anwesende Großväter-Generation stellte einigermaßen<br />
einen Ersatz dar, aber manchmal unterhielten wir uns doch über die abwesenden Väter,<br />
wie stark die wären, was für Muskeln die hätten, usw.<br />
12<br />
Vater in Uniform in Nordfrankreich
Wenn man das Reichenauer Wohnhaus verließ, stand man wohl im dichtest bepflanzten<br />
Garten Sachsens. Das war dem Umstand zuzuschreiben, dass Großvater eigentlich auch gern<br />
Gärtner geworden wäre, seine 2 Söhne das aber beruflich verwirklicht hatten und man sich<br />
dann zu dritt am vorhandenen Areal ausgelassen hatte. Es stand aber alles genau richtig und<br />
Bäume und Sträucher waren von bester Sorte und sehr ertragreich. Das Trio war auch in den<br />
umliegenden Bauernschlauen am Fuß des Gebirges am Flüsschen „Schläte“ zum Veredeln<br />
und Pflanzen übergegangen, was mir in späteren Jahren alles vom Großvater übergeben<br />
wurde, nebst den Pilzwörtchen der Familie dort.<br />
Urgroßvater Preibisch mit den Familien der Söhne Edwina und Otto sowie seiner Dochter Gertrud.<br />
Vorn Irene und Ilse.<br />
Es erschloss sich mir bald, dass ich als kleiner Nachwuchs in einem Preibisch-Nest saß,<br />
denn nebenan war der Preibisch-Hof auf dem der Bruder Erich meines Großvaters<br />
wirtschaftete. Auf der anderen Seite des Gartens stand ein kleines Umgebindehaus, welches<br />
Bruder Otto bewohnte, wobei das Gelände bis zur Dorfstraße und bis zum Uferweg mit<br />
Bäumen, Wiese und Hang ca. 0,75 h noch zum Hof gehörte. In Richtung Nieder-Reichenau<br />
folgten dann der Brückner-Bauer sowie Apelt- und Scholz-Bauer, in Richtung Ober-<br />
Reichenau ein weiter kleiner aufgegebener Hof vom entfernt verwandten Robert Preibisch,<br />
der aber jetzt von den befreundeten Scholz-Jungens bewohnt wurde und mit zum nächstfolgenden<br />
Heidrich-Hof gehörte. Die Felder dieser Bauernhöfe lagen in Richtung Lichtenberg<br />
hinter der Oppelsdorfer Straße, reichten aber ursprünglich in Reichenau bis an die Höfe heran.<br />
Doch irgendwann war ein ca. 150 m breiter Streifen von Siedlungshäusern dazwischen gebaut<br />
worden. In Richtung Lichtenberg endeten die Flurstreifen der Höfe am Fuße des Kahleberges<br />
und des Gickelsberges am klaren Gebirgsbach Schläte jeweils mit einem kleinen Bauernwald,<br />
was dann abgewandelt als Heidrichs, Preibischs oder Brückners Schläte bezeichnet wurde.<br />
Sobald die Äcker die Lichtenberger Straße erreichten, stand dort eine mächtige uralte Linde<br />
mit Spuren von Blitzschlägen, die man als Landschaftsmarkierung gleichfalls immer hofbezogen<br />
benannte.<br />
13
Erich Preibisch mit Familie<br />
Unter den Preibischs wurde ich als kleiner Nachwuchs sehr freundlich aufgenommen.<br />
Zum Brücken-Bauer stellte sich ebenfalls ein gutes Verhältnis ein und zum Heidrich-Bauern<br />
frequentierte ich mit meinen Scholz-Freunden, wobei uns „Hederch“ Edmunt immer von<br />
weitem schon zu rief- „Macht Euch ja lucker“, was von seiner und unserer Seite aber als eine<br />
Art Pflichtübung ohne weitere Bedeutung angesehen wurde. Jedenfalls vertrugen wir uns<br />
prächtig auf seinem Hof.<br />
Von Kleintieren und Kühen auf den Höfen will ich derweil nicht berichten, denn für uns<br />
Jungs war die Arbeit der Männer vor allem interessant und damit verbunden waren damals die<br />
Zugtiere. Bei Hederch Edmund standen die Pferde Hans und Harras, beide über 24 Jahre alt<br />
und Harras kam eines Tages nicht mehr hoch. Über dem Pferdestall war eine Futterkammer<br />
mit Säcken voll Zuckerrüben-Schnitzel und Edmund, der sehr wohl wusste, warum wir uns<br />
um ihn herumdrehten, ging dann wohl mit uns dort hinauf und wir durften uns jeder eine<br />
Handvoll nehmen. Bei Onkel Erich stand ebenfalls ein alter „Hans“ im Stall (das jüngere<br />
Pferd musste abgegeben werden) und ein ersatzweise herangezogener riesiger rotbunter<br />
Ochse „Fritz“. Auf Fritz war ich sofort stolz, denn er verfügte über größte Kräfte. Wenn ein<br />
damals seltener LKW im Straßengraben landete, so wurde Fritz geholt und es gab nur zwei<br />
Möglichkeiten, entweder der LKW stand wieder auf der Straße oder Fritz hatte die Stränge<br />
zerrissen. Beim Brückner-Bauer stand ein Schimmel im Stall. Außer durch Kuh- und<br />
Pferdeställe zeichneten sich die Höfe durch Scheunen mit Dreschmaschinen und Maschinen<br />
zur Heuernte aus. Bei Edmund in der Scheune stand auch ein hochmechanischer Mähbinder,<br />
der von 3 Pferden zu ziehen war, das Getreide schnitt, zu Garben bündelte, mit einer Schnur<br />
umband, einen Knoten machte und die fertige Garbe seitlich auswarf. Das war schon was!<br />
Ansonsten waren vorhanden:<br />
– eisenbereifte hölzerne Ackerwagen, deren Seitenteile auch durch sogenannte Leitern für den<br />
Heu- und Getreidetransport ersetzt werden konnten,<br />
– sogenannte leichte und schwere „Rollwagen“ mit kleineren einsenbereiften Rädern unter<br />
einer nach außen etwas gehobenen Plattform für Säcketransport und Umzüge,<br />
– leichte sogenannte „Jagdwagen“, wahlweise umrüstbar für den Transport von Menschen<br />
oder Gütern, eine Vorstufe von Kutschen,<br />
– sogenannte „Landauer“, d. h. Kutschen für insgesamt bis 8 Personen und einer Innenausstattung<br />
die heute von manchem PKW nicht erreicht wird,<br />
14
– Jauchewagen aus Holz oder schon verzinktem Metall, die schon im Frühjahr, wenn von der<br />
Sonne erwärmt, ein herrlicher Sitzplatz mit Heizung für die nackten Beine boten. Aber<br />
nicht hinten nahe der Einfüllöffnung, dort gab es Düfte, die den heute bekannten<br />
Schnüfflern leicht zu einem Vollrausch verholfen hätten.<br />
Das Alles ist heute eine nach ca. 2.500 Jahren historischem Bestand weitgehend und<br />
schnell untergegangene Welt, aber solches erst in den letzten 50 Jahren. Der bekannte Opfer-<br />
Wagen im Norddeutschen Museum, der von den Altvorderen schon ca. 500 Jahre vor Christus<br />
im Moor versenkt wurde, war von gleicher Bauart und hätte damals noch bis ca. 1950 mit auf<br />
den Feldern eingesetzt werden können. Vorgenannte Wagen mussten auch alle einen sicheren<br />
Kutschbock haben (mit Vor-, Rück- und Seitengeländer) sowie intakte Bremsen aus<br />
Holzklötzen, die Kutschen waren entsprechend vorn und hinten beleuchtet. Für Tiere und<br />
Menschen wurden sogenannte Pferdedecken mitgeführt, die Polizei achtete auf alles. Bei allen<br />
Fahrzeugen mussten öfters die Räder abgezogen werden, um die Achsen mit schwarzem Fett<br />
(Wagenschmiere) zu schmieren, denn Kugellager und Wartungsfreiheit kannte man in diesem<br />
Bereich noch nicht.<br />
Die Anschirrung der Pferde und die Anspannung über Ortscheite und das Waagscheit,<br />
der Ausgleich der Kräfte der Zugtiere über dieses (verkehrte Wog), kann man heute noch auf<br />
Turnieren beobachten. Während die Zügelung der Pferde sehr kompliziert ist, erfolgte das bei<br />
den Ochsen nur über einen links gehangenen Strick. Wollte man links fahren, so zog man<br />
daran und rief „hierum“, wollte man rechts fahren, so schlug man mit dem Strick leicht gegen<br />
die Seite und rief “hutterum“. Das „Brr“ für das Stehen bleiben habe ich später bei den Polen<br />
auch vernommen.<br />
Damen kostümiert zur Jahrtausend Feier der Oberlausitz Juli 1933<br />
Im beschriebenen engen Bereich der Höfe fehlen heute ca. 5 Gebäude und es existieren<br />
auch nicht mehr die öffentlichen Wege durch die Höfe zwischen Oberer Dorfstraße und dem<br />
Uferweg und hinter den Höfen an der Böschungskante entlang. Diese Wege mussten zu<br />
unserer Zeit bleiben (obwohl sie Grundstücke zerschnitten), weil sie über 100 Jahre<br />
bestanden. Die Bauern sahen sie wohl auch als kurze Wege ihrer Kundschaft an, dem Wesen<br />
nach wird es sich wohl um sogenannte „Wasserwege“ gehandelt haben, denn vor der<br />
Verlegung von Wasserleitungen musste alles Vieh in der Erlbach getränkt werden, Brunnen<br />
gab es erst auf dem Niveau des Uferweges (einen kenne ich noch), von wo man sich das<br />
15
Wasser ins Haus tragen musste und die Wäsche wurde vor allem im Erlbach auf Waschstegen<br />
gewaschen. Meine Mutter ist 1916 von einem solchen, als 4-jährige neben ihrer Mutter ins<br />
Wasser gefallen. Der Preibisch-Hof besaß von Anfang an allerdings auch schon eine selbst<br />
verlegte Wasserleitung aus einem eigenen Brunnen hinter der Oppelsdorfer Straße.<br />
4. Reichenau 1944<br />
Meine <strong>Erinnerungen</strong> an dieses Jahr beginnen mit hohen Schneewehen an der Oppelsdorfer<br />
Straße, auf der Lichtenberger Seite, die größere Jungens ausgehöhlt hatten und in welche sie<br />
von oben hinein rutschen konnten.<br />
Erinnerlich auch die prächtigen Pferdeschlitten, von Pferden gezogen in Prunkgeschirr<br />
mit Glöckchen, aber auch die hakenförmigen Bremse dort habe ich wahrgenommen und als<br />
technisch richtig eingeordnet. Erste eigenständige Versuche auch mit anderen Kindern von<br />
Hügeln Schlitten zu fahren und der Ärger der großen Jungs, wenn so ein kleiner in die Quere<br />
kam, stammen auch aus dieser Zeit. Wegen der Kälte stellte ich mich in der Wohnung der<br />
Scholze-Jungs so nahe zum Aufwärmen an das Feuerloch, dass mein Mantel ein Loch bekam.<br />
Das war ein Schrecken und schwerer Heimgang, denn für neue Kleidung hatten wir nur knapp<br />
Geld und außerdem gab es sogenannte „Kleiderkarten“. Aber da war auch schon der Frühling<br />
nahe bei und auf den Höfen wurde es lebendiger. Der gute Ochse Fritz, der ewig nicht aus<br />
einem Stall herausgekommen war und dessen Kräfte ungemein zugenommen hatten, der<br />
wurde unberechenbar und für friedliche Zugdienste unbrauchbar und ich durfte nicht in seine<br />
Nähe.<br />
Der Ochse bekam also eines Morgens nichts zu fressen und ein Korb mit Heu wurde vor<br />
dem Stall vor einen starken Birnbaum gestellt. Dann ging Onkel Erich in den Stall, alle Türen<br />
blieben offen, dann sauste er als erster aus dem Stall am Seil den wilden Fritz, der sich<br />
16
ersatzweise auf den Heukorb stürzte, während Erich hinter dem Baum stehend das Seil dort<br />
befestigte. Dann schoben wir den großen schweren Ackerwagen mit den breiten Rädern von<br />
hinten an den fressenden Fritz heran und schirrten ihn an. Wir bestiegen den Wagen (ich<br />
konnte kaum über die Seitenbretter sehen), Tante Ida löste hinter dem Baum stehend das Seil<br />
und der Ochse stürmte in die Freiheit. Die wilde Fahrt ging natürlich erst mal durch den<br />
„öffentlichen Verkehrsraum“, der aber damals von KFZ wenig frequentiert war, bis man<br />
hinter der Oppelsdorfer Straße die Felder und Feldwege erreichte, immer im zügigen<br />
Ochsentrab, in einer Art hussitischen Sturmwagen, über Wiesen und durch Gräben, durch die<br />
Schläte und bis vor Lichtenberg und wieder zurück, zuletzt gemächlich, die wilde Kraft war<br />
weg, der Ochse war wieder der gute alte Fritz geworden.<br />
Schwester Jutta und im Hintergrund Urgroßvaters Patent – kohlewagen<br />
Mit Onkel Erich war ich dann oft auf den Feldern, wo es dann auch langweilig wurde für<br />
einen kleinen Jungen beim Pflügen und Eggen und wo durch die Selbstüberlassung dann die<br />
ruhige Beobachtung der Umwelt eintrat, sowohl der Landschaft als auch der Tiere bis hin zu<br />
den Kleinsten. Weniger ruhevoll war es bei der Heuernte, die sich damals selbst auf kleinen<br />
Flächen in der sogenannten „Schläte“ erstreckte, wo man altersmäßig durchaus auch schon<br />
einen Rechen handhaben konnte und auch als kleiner Junge nicht beiseite stehen konnte,<br />
wenn in Hast vor dem drohenden Gewitter das trockenen Heu auf Haufen gesetzt oder auf den<br />
Wagen geladen wurde. Die Beladung des Wagens war eine Kunst für sich. Auf dem Wagen<br />
waren meist 2 Personen, die einerseits das mit 3-zinkigen Heugabeln hochgereichte Heu von<br />
den Gabeln abnahmen, anderseits diese großen Ballen dann bis hoch über die Leitern allseits<br />
gleichmäßig einbauten. Ganz oben darauf wurde dann straff der sogenannte „Heubaum“ in<br />
Längsrichtung gebunden. Dann durfte man selbst auf die ca. 4 m hohe Fuhre und der Wagen<br />
schwankte heimwärts, um vor dem Regen noch die Tenne der Scheune zu erreichen. Einmal<br />
fiel der Wagen vor der Scheune um und Tante Edith (Erichs Tochter) darunter und musste<br />
schnell freigegraben werden und hatte sich mit der Heugabel ins Bein gestochen.<br />
Im Spätsommer lief dann die Getreideernte. Der von den Pferden gezogene Mähbinder<br />
konnte nur seitlich schneiden, weshalb um das Feld herum erst eine Breite für 3 Zugtiere von<br />
Hand gemäht werden musste, d. h. wie vor Jahrhunderten mit großen Getreidesensen, mit<br />
aufgesetzten senkrechten Bügeln, damit mit dem Schwung der Sense das geschnittene Korn<br />
17
seitlich mit ausgetragen wurde und auf Schwad liegen blieb, die Ähren nach außen. Diesen<br />
Schwad nahmen Frauen dann auf, bis zur Menge einer Garbe (d. h. wie ein Ährenstrauß von<br />
ca. 30 cm Durchmesser), die dann mittels aus demselben Material geformten Strohseilen<br />
umbunden wurden, wobei jeweils ca. 7 Stück zu sogenannten „Puppen“ gegeneinander<br />
gestellt wurden, Die Ähren waren immer nach oben, damit sie nach Schlechtwetter sofort auf<br />
dem Felde wieder trocknen konnten. Es war immer ein Kampf mit dem Wetter, die Garben<br />
trocken zu bekommen, denn nur so konnten sie in die Scheune eingelagert werden (vorher<br />
Beladung und Transport wie bei Heu, aber mit 2-zinkigen Gabeln). Bei Feuchtigkeit verdarb<br />
Stroh und Ähre, es konnte auch zur Selbstentzündung in der Scheune kommen. Auf das<br />
trocken eingelagerte Getreide warteten natürlich auch die Mäuse, weshalb die Katzen<br />
angesehene Mitarbeiter auf dem Hofe waren, denen man an langweiligen Regentagen nicht<br />
die Barthaare abschneiden durfte, wie von mir getan, da war was los, man spricht heute noch<br />
in der Familie davon.<br />
Auf dem Felde war die Ernte auch durch Räuber bedroht. Kleintierhalter z. B. fuhren mit<br />
Fahrrad und Decke nächtens auf das Feld, das Fahrrad wurde auf Lenker und Sattel gestellt,<br />
das Hinterrad von Hand mittels der Pedale schnell gedreht, die Ähren in die Speichen<br />
gehalten und damit ausgedroschen und auf der untergelegten Decke sammelten sich die<br />
begehrten Körner.<br />
Eine schwere und staubige Arbeit war das maschinelle Dreschen des eingelagerten<br />
Getreides. In den Scheunen hingen auch von Früher noch die Dreschflegel, die ich nur einmal<br />
im Einsatz erlebte, als bei defekter Dreschmaschine eine kleine Kornmenge für die Hühner<br />
benötigt wurde. Im Hause ganz oben am Südgiebel, befand sich ein helles und freundliches<br />
Zimmer, in welches dann das über die Dreschmaschine in Säcke abgefüllte Getreidekorn in<br />
Zentnerlasten hoch getragen und breit geschüttet wurde, damit es Onkel Erich mittels einer<br />
18<br />
Zu Besuch in Bad Oppelsdorf bei<br />
Tante Luise
Holzschaufel in Zeitabständen umschaufeln und somit trocken halten konnte. Aus dieser<br />
Beobachtung der gesamten Arbeit konnte man später leicht verstehen „.. unser täglich Brot<br />
gib uns heute“.<br />
Indem ich ein etwas „spillriges“ Knäblein war, durfte ich durchaus auch auf dem<br />
Preibisch-Hofe mit Frühstücken, wo ich schon ausreichend früh erschien, um die Unternehmungen<br />
des Tages mit Onkel Erich nicht zu verpassen. Das Frühstück an Werktagen war<br />
immer eine dicke graue Suppe aus Roggenmehl, in welche in der Mitte einige Esslöffel Milch<br />
gegeben wurde. Brot ist mir kaum erinnerlich, dann begann der Bauer sein schweres<br />
Tagewerk, wahrscheinlich in meiner Familie so seit Jahrhunderten.<br />
Es war damals natürlich eine schwere Zeit, mit knappsten Lebensmittelkarten-Rationen.<br />
Insgeheim, weil verboten, röstete Erich einmal auf einem Kuchenblech Gerstenkörner, die<br />
dann gleich in der Handmühle zu Kaffee-Ersatz vermahlen wurden, welcher „Kaffee“ auch<br />
gleich aufgebrüht und von den Damen bereits erwartet wurde. Es gab natürlich auch<br />
uninteressante Arbeitseinsätze auf dem Preibisch-Hof, wie langwieriges Rüben verziehen<br />
oder Rauchpumpen von Hand und Breitfahren auf dem Feld (wo ich aus Geruchsgründen<br />
besser nicht dabei sein sollte), auch das Mist fahren war so eine anrüchige Sache und für den<br />
Bauer mit Hand-Beladung, -Entladung und Ausbreitung auf dem Feld eine Knochenarbeit, bei<br />
der ich kaum auf freundliche Beachtung hoffen konnte. Da kam es mir ganz gelegen, dass ich<br />
auch zum benachbarten Brückner-Bauer ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hatte, wo<br />
ich zwar nicht so in die Tagesarbeit integriert war, aber genau wusste, wann man wohin mit<br />
dem Schimmel fuhr, damit ich dabei sein konnte. Indem Erich und Brückner-Bauer auch<br />
befreundet waren, nannten sie mich freundlich untereinander den „Großknecht“ und dachten<br />
bei meiner Anwesenheit wahrscheinlich an die Zeit mit ihren Kindern zurück und auch noch<br />
weiter an die eigene Kindheit, denn damals änderte sich die Zeit nicht so schnell wie heute.<br />
19
Trauer und Bedrückung herrschte in der Familie von Edwin Preibisch, denn Roland erlag<br />
den Verwundungen, die er an der Westfront empfangen hatte. Kurt, der jüngere Sohn war an<br />
der Ostfront. In der Familie von Erich Preibisch war Sohn Heinz an der Ostfront verschollen.<br />
Mein Vater war in Frankreich in amerikanische Gefangenschaft gekommen. Im Nachbarhaus,<br />
bei Otto Preibisch (der ebenfalls eingezogen war), war eines Tages ein gut aussehender junger<br />
Mann von ca. 19 Jahren auf Fronturlaub, also Gottfried Preibisch, einziges Kind der sehr<br />
freundlich zu mir war, ich kann mich heute noch an seine blauen Augen und seine lockigen<br />
schwarzen Haare erinnern, er ist bei Monte Casino geblieben.<br />
Im Herbst 44 unternahm Großvater mit mir eine Wanderung entlang der Schläte bis nach<br />
Oppelsdorf, dort über Leupolts Berg bis zur „Keilschänke“ vor Kohlige (heute dort an der<br />
Grenze vor Uhelna nur noch der Wirtsgarten und Reste des Kellers), wo ich also auch die<br />
Erinnerung an die Gaststube und ein Malzbier behalten habe. Auf dem Rückweg in der<br />
Schläte auch an einer Birke vorbei, die Roland gepflanzt hatte, es war eine Trauerbirke.<br />
Erinnerlich für mich auch, dass ich bei jedem Sirenen-Feueralarm sofort nach Onkel<br />
Erich suchen musste, damit er die Trompete von der Wand nahm, um am Abhang über<br />
Reichenau stehend, mehrmals ein Trompetensignal zu blasen „Kamerad, Kamerad komm<br />
schnell herbei, es brennt, es brennt, es brennt“. Aus meiner heutigen Sicht stammt diese<br />
Maßnahme wohl aus einer Zeit, als es in Reichenau noch keine Sirenen gab und die<br />
Kirchglocken so schnell nicht zu erreichen waren. Auch konnte man von oben wohl auch gut<br />
zeigen, in welcher Richtung es brannte. Das Ganze war 1944 bereits Brauchtum, welches<br />
Erich als ehemaliger aktiver Feuerwehrmann den Auftrag hatte, weiterzuführen. Weihnachten<br />
1944 ging Großvater mit mir in die Kirche. Die Solostimme beim Gesang war seine Nichte<br />
20<br />
Gottfried Preibisch
Christine, wie ich damals erfahren habe. Es war ein Kriegsweihnacht und das hat wohl wie<br />
ein Schleier über diesem Fest gelegen und das Herz wird einem bei der Niederschrift nicht<br />
leichter, indem man jetzt weiß, dass es die letzte Weihnachtsfeier Reichenaus war.<br />
5. 1945 bis 7. Mai<br />
Ich lerne Kurt Preibisch, den Bruder meiner Mutter, der auf Heimaturlaub ist, kennen. Er<br />
wurde 1941, 20-jährig, eingezogen und ist in Russland auf dem Vormarsch und auf dem<br />
Rückzug als einfacher Soldat immer an vorderster Front gewesen. Bei seiner Kompanie<br />
wurde die Mannschaft wohl mehrmals ersetzt, bis 1945. Von den vier Preibisch-Kindern ist er<br />
dabei der ruhigste und der Heimat und der Natur (Gärtnermeister) wohl am engsten verbundene<br />
gewesen. Welch Kontrast mögen die wenigen Tage im Vaterhause für ihn gewesen sein,<br />
das Spiel mit mir, dem er die Dampfmaschine aus seiner Kindheit vorführte, was mir noch so<br />
gegenwärtig ist, als wäre es gestern gewesen. Dann fuhr er wieder an die Ostfront, mit dem<br />
letzten Zug nach Königsberg hinein, danach umschlossen die russischen Truppen die Stadt.<br />
Sein Glück war, dass er im Schneefeld einsam auf Vorposten gestellt, zeitig gefangen<br />
genommen wurde, von Russen, die sich in weißen Umhängen aus dem Schnee erhoben. Bei<br />
den späteren schweren Kämpfen wurden dann kaum noch Gefangene gemacht.<br />
Aus dieser Zeit sind mir auch noch Bilder von Flüchtlingstrecks erinnerlich, die Pferdegespann<br />
für Pferdegespann vor unserem Haus auf der oberen Dorfstraße standen oder sich<br />
zögerlich vorbei bewegten. Dabei viele Planwagen, einige sogar mit Ofenrohr, auch die ersten<br />
luftbereiften Ackerwagen habe ich gesehen, aber auch viele bedenkliche Wagen ohne<br />
Bremsen, die aus flacheren Regionen zu uns ins Bergland kamen. Zu vermerken ist auch, dass<br />
viele Volksgenossen sich eher vor der Aufnahme der Flüchtlinge drücken wollten, während<br />
das scheinbare Raubein Heidrich, Edmund, sie sich geradezu von der Straße holte und seinen<br />
21<br />
Ilse und Kurt Preibisch
ganzen Hof voll stellte. Von den Flüchtlingen, als zeitweilig untergestellt, blieb auf seinem<br />
Hof ein schwarzer Junghengst namens „Hans“ zurück, den ein anderes Pferd schwer mit dem<br />
Huf geschlagen hatte. Wir Kinder hatten sofort zu ihm das innere Verhältnis als zu einem<br />
lieben Altersgenossen, nur das er eben ein Pferd war, aber er gehörte in unserem Lebensbereich<br />
dazu und wir beobachteten seine Gesundung und weiteren Werdegang mit freundlicher<br />
Anteilnahme.<br />
In der Nacht vom 13. zum 14. Februar fuhr die jüngere Schwester meiner Mutter, Ilse<br />
Preibisch, mit dem letzten Zug auf Dresden Hauptbahnhof ein und überlebte im<br />
Luftschutzkeller dort die Liquidierung der Wohnviertel, mit einer Bombensetzung, wie in<br />
amerikanischen Labors zur Tötung der Zivilbevölkerung erprobt. Nach diesem 1. Angriff, bei<br />
welchem der Hauptbahnhof fast unversehrt geblieben war und zum Zufluchtsort vieler<br />
geworden war, wurde sie glücklicherweise von einem Offizier angesprochen: „Fräulein,<br />
gehen Sie lieber mit zum Elbufer“, dort überlebte sie dann den 2. schweren Angriff, der<br />
planmäßig dem Hauptbahnhof und den Menschen dort galt. Am Morgen wurde sie von<br />
Kradfahrern in Richtung Ostfront mitgenommen und erreichte irgendwann Reichenau, wo ein<br />
Flüchtling bei uns die Tür öffnete und sagte: „Fräulein, hier können Sie nicht rein, hier ist<br />
alles voll“.<br />
In diesen Tagen auch, als die Kämpfe um Lauban tobten, was auch bei uns zu hören war,<br />
nahm mich der Brückner-Bauer beiseite und fragte mich etwas, was ich nicht gleich verstand.<br />
Er wiederholte also: „Ich habe Dich gefragt, ob Du schwarz siehst?“. Ich verstand gefühlsmäßig,<br />
das die Generation der Erwachsenen Unterstützung braucht und verneinte und meinte, die<br />
Wehrmacht wird es schon noch richten. In den folgenden Wochen gewann ich auch erste<br />
„Fronterfahrungen“, denn meine Mutter ging mit mir bis nach Friedland, wo es auf die Lebensmittelkarten<br />
etwas mehr gab. Auf dem Wege dorthin wurden wir von einem Tiefflieger<br />
angegriffen (meinten wir) und suchten Deckung im Straßengraben. Der Angriff galt aber<br />
wohl eher einem Bauern mit Gespann unweit auf einem Felde, was dann in der Zeitung stand.<br />
Am 22. April gab es Fliegeralarm (wohl der Generation der ein solches grausiges schnelles<br />
Auf- und Abgeheul der Sirene erspart bleibt). Wir standen im Keller, Ilse hatte sich mit mir<br />
unter einen Türsturz gestellt und bei dem beklommenen Warten, dem Flugzeuggeräusch (ca.<br />
200 m Flughöhe), sich nähernden Einschlägen, die sich mit Sausen ankündigten, brach für<br />
mich die sichernde Autorität der Erwachsenenwelt zusammen. Es wurde begrifflich, dass im<br />
Krieg alle zur Tötung freigegeben sind. Ein Einschlag war ca. 100 m von uns entfernt etwa an<br />
der unteren Dorfstraße vor Lichtners Fabrik, die nächste Detonation (die mich an die Kellertür<br />
warf) nur ca. 50 m nah am Pferdestall des Brückner-Bauer, die nächste Bombe fiel als<br />
Blindgänger auf die obere Dorfstraße, direkt vor dem Turmaufbau vor Altmann-Dachdeckers<br />
Haus, in welchem Zimmer unsere Spielfreunde (Langer Jürgen und Schwester) waren. Von<br />
ca. 65 abgeworfenen Bomben sollen 10 gezündet haben. Auf der unteren Dorfstraße vor<br />
Lichtners Fabrik hatte die Bombe ein Mädchen getötet und nur ein Schatten von ihr soll an<br />
der Wand gewesen sein, weshalb ich einige Zeit nicht zur „Wally“ nahe dort gehen durfte, um<br />
unsere Magermilch abzuholen. Im Pferdestall beim Brückner-Bauer war das Gewölbe eingestürzt<br />
und auf den Schimmel gefallen, dessen Rücken seitdem angeblich etwas durch gebogen<br />
war, was auch zu stimmen schien. Um diese Zeit auch flog ein größeres deutsches Flugzeug<br />
im Tiefflug brennend über uns hinweg, um in Oppelsdorf nahe der Reibersdorfer Straße<br />
abzustürzen. Der Ort ist mir bekannt, denn Stiefgroßvater Carl Andreè, Besitzer der Villa<br />
Clara, war als Bürgermeister mit seinem Fahrrad mit als erster vor Ort, die Besatzung hatte<br />
den Aufprall nicht überlebt.<br />
In diesen letzten Kriegstagen bekamen wir auch Soldaten als Einquartierung ins Haus, in<br />
einem Fall musste ich für einen Hauptmann den Stahlhelm aus der ehemaligen Preibisch-<br />
Fabrik holen und kam dort mitten unter eine Kompanie, wo ich mich durchfragen musste.<br />
Am 06. Mai 1945 ca. 5.00 Uhr früh wurden wir durch eine laute Auseinandersetzung vor<br />
unserem Haus geweckt. Eine Wehrmachtsstreife hatte einen Offizier festgenommen und der<br />
Steifenführer schrie: „Degradiert ihn, degradiert ihn“ und der Offizier rief: „Ihr blöden<br />
22
Hunde, der Krieg ist doch vorbei“, Schüsse haben wir keine gehört. Auf dem Preibisch-Hof<br />
stand ein Wehrmachts-Werkstatt-Wagen ohne Benzin, der dann von der Besatzung mittels<br />
eines Beiwagen-Motorrades vom Hof auf die Wiese gezogen wurde, abgestellt an der Oberen<br />
Dorfstraße und am Zaun zu Heidrich. Die Soldaten bauten dann zwischen Motorrad und<br />
Seitenwagen noch einen Notsitz und nahmen eine junge Frau mit Kind mit in Richtung West.<br />
Abends am 06. Mai 1945 sollten wir Reichenau in Richtung Westen verlassen. Die<br />
Pferdewagen rumpelten mit etwas von unserer Habe bis auf die Oppelsdorfer Straße, als wir<br />
dort aber die Höhe gewonnen hatten, blieben wir stehen, denn der Himmel im Westen war<br />
blutrot. Heidrich Edmunt, Onkel Erich und Großvater berieten sich und sagten dann: „Was<br />
uns erwartet, das soll uns zu Hause antreffen“, worauf wir wieder umkehrten und die<br />
Reichenauer nach uns auch. Die Scholz-Jungens waren mit ihrer Mutter und der Großmutter<br />
im Handwagen voraus gegangen über Oppelsdorf nach Kohlige, wo sie unter Fliegerbeschuss<br />
kamen, aber unverletzt blieben. Meine Schwiegermutter war mit meiner Frau und deren<br />
Schwester im Säuglingsalter ebenfalls von Oppelsdorf aus in dieser Richtung auf der Flucht<br />
und kam ebenfalls unter diesen Beschuss, ebenfalls unverletzt. Als wir wieder unsere Häuser<br />
erreichten, brannte der zurückgelassene Wehrmachts-Werkstatt-Wagen lichterloh und erhellte<br />
die ganze Wiese. Als Kinder waren wir aber froh, dass wir in unser Bett konnten, denn es war<br />
spät geworden.<br />
Am 07. Mai 1945 lag Brandgeruch in der Luft und das Feuer am Werkstatt-Wagen<br />
brannte verhalten. Über die Wiese lief der zurückgelassene mittelgroße Hund des Werkstatt-<br />
Wagens. Die junge Hündin Kora nahm gern Asyl auf dem Preibisch-Hof und wurde die<br />
Stammmutter von Generationen von Hunden, ihre Gene werden wohl heute noch in der<br />
wilden Hundepopulation von Bogatynia zu finden sein. Sorgenvolle Spannung lag über den<br />
Erwachsenen, denn die Front musste nahe sein. Gegen 14.00 Uhr heulten alle Sirenen<br />
Panzeralarm. Es war die letzte hoheitlich Handlung der deutschen Verwaltung aus eigener<br />
Entscheidung. Es war wie der anhaltende Todesschrei des alten deutschen Reichenau, als die<br />
Sirenen verklungen waren, war alles anders.<br />
6. 1945 – 7. Mai bis 22. Juni<br />
Aus den Gesprächen hatte ich schon entnommen, das die Sieger die Frauen haben wollten.<br />
Der hohe Wert der Frauen war für mich als 6-jähriger schon erfasslich, was sich in der<br />
Realität dahinter verbarg, war für mich aber plakativ nicht vorstellbar. Die Furcht der<br />
Erwachsenen vor dem was kommen würde, führte dazu, dass am 8. Mai als die Wehrmacht<br />
kapitulierte, ich mich bewaffnete, d. h. ich übertrat das Verbot, ein Beil überhaupt anzufassen<br />
und stellte mir von den drei Stück, die Großvater hatte, das kleinste und schärfste hinter die<br />
Schuppentür, um einem Bedränger unserer Frauen damit in die Beine zu hacken. Bald tauchte<br />
auf der oberen Dorfstraße auch ein Mann in brauner Uniform auf, der große Schwierigkeiten<br />
mit einem Damenfahrrad hatte, ob aus technischen oder alkoholischen Gründen blieb unklar.<br />
Wir waren als Kinder instruiert worden, dass wir auf keine Fall sagen sollten, wo unsere<br />
Mütter wären, am besten hemmungslos weinen und schreien. Alle Frauen machten sich in<br />
diesen Tagen kleidungsmäßig so alt wie möglich und die Gesichter mit Dreck unansehnlich.<br />
Nach allen Seiten musste gesichert werden, auf Abstand, ob fremde Männer sich nähern.<br />
Indem unser Garten in Reichenau, wie bereits erwähnt, sehr dicht bepflanzt war, dabei sogar<br />
direkt vor dem Hause eine kleine Baumschule aus dichten Wachholdersträuchern, versteckten<br />
sich meine Mutter und Tante Ilse dort und stets auch einige Frauen aus der Nachbarschaft.<br />
Dieses Versteck bot bei Entdeckung auch die Möglichkeit, dass alle in alle Richtungen<br />
auseinander laufen konnten.<br />
Ich war soweit einbezogen, dass ich in der Nähe des Dickichtes, wo freie Sicht war, auf<br />
dem Boden mit Steinchen spielte und ohne zu den Versteckten hinzusehen, hörbar vor mich<br />
hin sprach, ob Männer sich näherten oder gehen. Die Gefahr war sehr groß, als Mutter und<br />
Tante und zwei weitere Frauen im winzigen Taubenschlag in unserem Haus versteckt waren.<br />
23
Ein Russe ging mit meinem Großvater durch das Haus und verlangte, dass an der<br />
Wandschräge das Bild (hinter dem die Luke zum Traubenstall war) abzunehmen sei. Das alles<br />
war in einem Abstand von ca. 2 m zu den versteckten Frauen, da durfte im Holzverschlag<br />
keine Nadel zu Boden fallen. Großvater machte deutlich, dazu müsse er erst eine Leiter holen<br />
Der Russe folgte ihm in diese Richtung und vergaß die Sache. Im Nachbarhaus versteckte<br />
Baggerfahrer Slawisch auch Frauen, als die Russen vorn hinein kamen, konnten die Frauen an<br />
der Hangseite aus dem Haus springen und sich dann bei uns verstecken. Alles musste völlig<br />
geräuschlos vor sich gehen, gefürchtet war die Hederch Liese, die den Mund nicht halten<br />
konnte.<br />
Slawskis Haus<br />
Erinnerlich ist mir auch noch der gestiefelte Offizier, der in unserem Garten mit meiner<br />
Schwester spielte und sie immer wieder nach der Mutter fragte. Damals auch die Erkenntnis<br />
bei mir, dass Freundlichkeit gefährlich sein kann. Onkel Erich hatte die damals hochschwangere<br />
Tochter Edith im Obergeschoss des Hofes regelrecht eingemauert und im Erdgeschoss<br />
im Flur einen Kindersarg mit Kerzen aufgestellt. Als zwei Kerle mit einem Motorrad auf den<br />
Hof geknattert kamen, ging er entschlossen zum Sozius, fasste den am Ärmel und zeigte zum<br />
Haus und sagte: „Zum Kommandanten, dawai“, worauf die Beiden hoch erschrocken sofort<br />
Vollgas wieder abfuhren. (Erich war einer der zwei Reichenauer, die mit der Auszeichnung<br />
des Eisernen Kreuzes 1. Klasse aus dem 1. Weltkrieg kamen, allerdings bei ihm nicht durch<br />
Tötung von Feinden, sondern er hatte allein die gestaffelte Front durchbrochen und im<br />
Hinterland eine Fernsprechleitung angezapft, so dass das französische Kommando längere<br />
Zeit abgehört werden konnte.)<br />
Die Siegersoldaten waren durch die aufgefundenen Weinvorräte bei Firma Rolle längere<br />
Zeit stark alkoholisiert und im Zentrum von Reichenau wurde viel vergewaltigt bis der<br />
russische Kommandant dann langsam wieder Ordnung einführte. Die Deutschen in den<br />
Reichenauer Betrieben produzierten in dieser Zeit immer weiter, Materialreserven waren<br />
vorhanden, Abnehmer würden sich finden. Nach ihrer Meinung waren die Anderen die<br />
Fremdlinge im Lande. Niemand war sich bewusst, dass es umgekehrt sein könnte.<br />
Irgendwann steckten in den Uniformen Polen, ein Kontingent der Kosciuszkowcy mit eckigen<br />
Mützen (von den Deutschen Elitepolen genannt) war nur einige Tage in Reichenau (das jetzt<br />
24
Rychwaĺd heißt) und bewegte sich weiter in Richtung Westen. Von Anfang an gab es einen<br />
polnischen Kampfkommandanten (Lewy?) in Rychwaĺd, von den Deutschen „Spitzbart“<br />
genannt. Indem dieser seine Schreibarbeiten in Deutsch im Büro der Firma Brendler durch<br />
meine Tante erledigen konnte und dort für Polnisch auch schon Frau Jenny Fischer zur<br />
Verfügung stand, bekam unsere Familie einen Fernkontakt zu diesem damals mächtigen und<br />
umgänglichen Mann.<br />
In dieser Zeit mussten die Deutschen bei schwerer Strafandrohung die Radioapparate und<br />
die Feldstecher abgeben. Indem das mir verständliche Wort Fernglas nicht verwendet wurde,<br />
konnte ich mir unter Feldstecher nur die wie ein langer Schuhanzieher aussehenden Distelstecher<br />
vorstellen, mit denen ins Feld gestochen wurde und ich erschrak mächtig, als ich die<br />
unsrigen Stecher noch auf dem Karnickelstall vorfand, weshalb ich diese sofort unter den<br />
Kohlen vergrub. Niemand sage, der Junge war einfältig, diese Zeit mit Krieg und Nachkrieg<br />
war für alle verrückt und unvorstellbar.<br />
Einige Wochen lag an der Oppelsdorfer Straße, nahe der Kreuzung Richtung<br />
Lichtenberg, ein „Kettenkrad“, d. h. ein kleines Fahrzeug vorn mit Rad und Lenker wie ein<br />
Motorrad, hinten beidseitig Kettenantriebe wie ein Panzer, dabei Sitze für bis 6 Soldaten und<br />
Anhängemöglichkeit für eine kleine Panzerabwehrkanone. Es war klar, es fehlte nur Benzin,<br />
aber alles kombinieren half nichts, ich war eben noch zu klein. Zuerst fehlten die Räder und<br />
irgendwann war das Ding dann ganz weg, aber auf der Siedlung nach Lichtenberg habe ich<br />
noch Jahrzehnte lang 1-achsige Handwagen gesehen, mit hartgummibereiften, kugelgelagerten<br />
Rädern vom Kettenkrad, beneidenswert; noch heute halte ich in dieser Gegen Ausschau,<br />
die Dinger waren doch unverwüstlich. (Im Heeresmuseum in Dresden aber habe ich das<br />
Kettenkrad original wiedergefunden.)<br />
7. 1945 – 22. Juni bis Jahresende<br />
Vom 22. Juni ist mir nur das Nachher bewusst, was auch logisch ist, denn die Maßnahme<br />
wurde gegenüber den Deutschen geheimgehalten (wäre wohl auch nicht geglaubt worden)<br />
und lief wie ein Donnerschlag ab ... „aufstehen, mitnehmen was man in den Händen tragen<br />
kann, den Schlüssel außen in die Tür stecken, alles sofort, bei Todesstrafe“. Allerdings hatte<br />
es auch Listen gegeben, die ca. 10 % der Deutschen von der Vertreibung zurückstellte, als<br />
erforderlich für die weitere Betreibung der Fabriken. Dort war auch mein Großvater, Edwin<br />
Preibisch, als Webmeister eingetragen, womit auch seine gesamte Familie zurückgestellt war.<br />
Vom 23. Juni ist mir erinnerlich, dass aus den deutschen Fabrik-Fachleuten Rettungstrupps<br />
zusammengestellt wurden, für das Vieh auf den verwaisten Bauernhöfen, bei den Rettern<br />
auch meine Mutter, dabei mir erinnerlich auch der Sohn von Dr. med. Hauptmann. Für mich<br />
wurde der Einsatz auf den umliegenden 3 Bauernhöfen zum großen Auftritt, denn ich wusste<br />
genau, wo etwas lag und wo es lang ging. Die Tiere waren zu füttern, zu tränken und auszumelken,<br />
allerdings waren die Kühe bei den ungeschickten Griffen der ungeübten fremden<br />
Leute ziemlich renitent. Kritisch wurde es auf Seiferts-Hof, vielleicht kamen wir dorthin<br />
etwas zu spät, jedenfalls waren die Tiere sehr unruhig. Die Pferde, zwei feurige Rappen,<br />
ließen niemand in den Stall, ständig waren die ausschlagenden Hinterhufe in der Türöffnung<br />
zu sehen. Der Ochse war in der Scheune eingesperrt und donnerte gegen das Tor. Ein Mann<br />
ging mit mir in das Innere des Hauses, wo auf dem Tisch noch die angefangene Mahlzeit<br />
stand, ein angeschnittenes Brot, ein geöffnetes Glas Leberwurst. Er bereitete mir eine<br />
Wurstschnitte, mit der ich dann vor meiner Mutter erschien, um sofort eine kräftige Ohrfeige<br />
(das Brot fiel herunter) wegen Stehlens zu bekommen. Den Erwachsenen war noch nicht<br />
bewusst, was eigentlich passiert war. In der Folge übernahm meine Mutter Erichs und<br />
Brückner-Bauers Hof. Es ist mir erinnerlich wie wir auf dem Feld die Kühe hüteten und wie<br />
diese Biester sich gegenseitig ansahen und dann die Schwänze hoben um einige hundert<br />
Meter weiter zu galoppieren. Nach ca. 1 Woche war Brückner-Bauer wieder da und übernahm<br />
seinerseits auch weitgehend die Pflege auf Erichs Hof. Bei Heidrichs kam der Sohn Walter<br />
25
mit Familie und auch Edmund mit Frau zurück. Nachbar Slawski, als Baggerfahrer in der<br />
Grube Türchau, bezog auch ganz legal wieder sein Haus. Nach ca. 3 Wochen waren Onkel<br />
Erich Preibisch und Tante Ida auch wieder da. Im Allgemeinen wurden die zurückgekehrten<br />
deutschen Landwirte geduldet, da neben der Fürsorge für das Vieh auch die Ernte einzubringen<br />
war. Mein Großvater, Edwin Preibisch, war ohne Unterbrechung in Lichtners Fabrik<br />
beschäftigt. Für die Sperrstunde hatte er einen russischen „Propusk“. Die Deutschen mussten<br />
eine Zeit lang eine weiße Armbinde tragen, mit einem blauen Steifen in der Mitte. So in etwa<br />
jeder dritte Deutsche war nach einigen Wochen wieder anwesend, die Arbeit auf den Höfen<br />
und in den Fabriken und Werkstätten wurde aufrecht erhalten, wahrscheinlich teilweise schon<br />
mit polnischen Leitungspersonal und Arbeitern. In der zweiten Hälfte des Jahres 45 wurden<br />
auch erste Höfe von den Polen übernommen. Bei Heidrichs durch Mutter und Sohn Janecki,<br />
die plötzlich mit auf dem Hofe waren und denen plötzlich alles gehörte. Viel mehr als auf<br />
materielle Werte, war der junge Pole aber um die Zuneigung der jungen Inge Heidrich<br />
bemüht, was auch erwidert wurde, so herrschte auf diesem Hofe eine gewisse Eintracht (und<br />
vorweggenommen, übers Jahr wurde auch ein ganz legaler deutsch/polnischer Hoferbe<br />
geboren).<br />
Bei Ernst Preibisch, einem Cousin von Großvater, waren er und seine Familie am 08. Juli<br />
zurückgekehrt. Zu dem eingesetzten jungen polnischen Bauern entwickelte sich eine gewisse<br />
Vater-Sohn-Beziehung und Ernst als erfahrener Landwirt nahm ihn intensiv in die Lehre. Was<br />
auch notwendig war, denn der junge Pole hatte sich als Landwirt deklariert und zu einer<br />
Hofübernahme bekannt, um sofort aus der Armee entlassen zu werden.<br />
Es ist mir auch noch erinnerlich, wie Pan und Pani Wierzbicka erschienen und erstmalig<br />
auf den Preibisch-Hof zugingen. Sie in einer knapp sitzenden Uniformjacke über dem Rock,<br />
er mit umgehangener Jagdflinte und erinnerlich auch der Schreckensruf meiner Großmutter:<br />
„Um Gottes Willen, ein Flintenweib, auch das noch!“.<br />
Erich und Ida und die Neuen mussten sich die Wirtschaft teilen, d. h. den Deutschen<br />
wurden die restlichen Räume zugeteilt und die Sachen, die sie dort behalten durften, wahrscheinlich<br />
im Falle von Wierzbickis mit Anstand.<br />
Es dauerte nur kurze Zeit und das „Flintenweib“ klopfte zum Erschrecken der Großmutter<br />
an unsere Tür, mit der Frage nach einem Gewürz, welches in unserer Küche zu haben war<br />
und einmal sie dort, war es passiert! Die beiden kräftigen Damen fanden Gefallen aneinander<br />
und auf dem Wege ins Dorf oder aus dem Dorf, oder sonst auch, saßen Pani Wierzbicka und<br />
Großmutter nur zu gerne in der Küche zusammen, die eine konnte kein Deutsch, die andere<br />
kein Polnisch, trotzdem erzählte man sich in langen Sessionen alle Neuigkeiten aus dem Dorf,<br />
bei unerhörten Sachen wurde der Vortrag oder die Kenntnisnahme akustisch durch kräftiges<br />
Klatschen auf die eigenen Schenkel unterstrichen, die Damen hatten ja. Es schallte durchs<br />
ganze Haus.<br />
Bei Wierzbickis war auch ein Sohn Namens Zdzisĺaw, ca. doppelt so alt wie ich, der<br />
interessanterweise ein Fahrrad hatte, mich akzeptierte – und zu langen Ausflügen auf der<br />
Querstange mitnahm. Mit Wierzbickis kam eine schwarze gutmütige Stute Namens „Murdel“<br />
auf den Hof. In diesem Herbst hatten die deutschen Bauern zum großen Teil noch allein<br />
geerntet, aber die Herbstbestellung geschah schon erstmalig gemeinsam mit den eingesetzten<br />
polnischen Wirten. Im November veranlasste die sowjetische Administration in Zittau, dass<br />
mittels der Kleinbahn die unbewirtschafteten Kartoffelfelder zwischen Oppelsdorf und<br />
Reibersdorf abgeerntet wurden, zugunsten des überfüllten und hungernden Zittau.<br />
Im November kam der Vater der Scholz-Jungen aus der Gefangenschaft zurück und ging<br />
zuerst allein über die Neiße nach Reichenau-Rychwaĺd zurück. Sein Bruder und Nachbar der<br />
Scholz-Friseur am Uferweg, neben Baggerfahrer Slawski, war auch wieder anwesend und<br />
übte seinen Beruf zu deutsch/polnischer Zufriedenheit aus. Alfred Scholz bekam sofort Arbeit<br />
im Kesselhaus bei der ehemaligen Firma Lindemann, (d. h. auch eine Aufenthaltsgenehmigung)<br />
und holte dann nächtens seine Familie mit herüber, so dass ich mit meinen Hauptfreunden<br />
wieder vereinigt war.<br />
26
Was die Polen unter uns betraf, so sollte man sehen, dass sie sich in jeder Beziehung in<br />
der Fremde“ ansiedelten, d. h. die anwesenden Polen waren für sie auch Unbekannte. Natürlich<br />
begannen bei den Polen die Versuche für ein gesellschaftliches Leben untereinander. Zu<br />
diesem Zwecke brauchte es im allgemeinen auch Alkohol, weshalb Wierzbickis unten in der<br />
Küche, über dem Brühkessel, eine Kartoffel-Destillation aufbauten, mit geheimnisvollem<br />
Glucksen in den Rohren und von unvergesslicher Ausdünstung. Die geladenen Gäste waren<br />
aber ziemlich rabiater Natur, jedenfalls beschloss zu nächtlicher Stunde einer, dass es Zeit sei,<br />
die Ehefrau zu erschießen, welche dann angeschossen durch das Haus flüchtete und in größter<br />
Not von Erich unter dessen Schreibtisch geschoben wurde. Erich setzte sich davor und<br />
obwohl der rasende Pole mehrmals mit rauchender Pistole durch das Zimmer stürmte,<br />
akzeptierte er irgendwie, d. h. es schien in sein Weltbild zu passen, dass der deutsche Bauer<br />
zu nächtlicher Stunde am Schreibtisch sitzt und schreibt. So avancierte mein listig-lustiger<br />
Onkel Erich neben seinem EK I noch zum anerkannten Retter einer Polin.<br />
Bei uns erschienen irgendwann zwei Soldaten, die uns mitteilten, dass wir uns zwecks<br />
Ausweisung am Folgetag bei der Kommandantur melden sollten. In Vorbereitung dessen<br />
gingen sie durch das Haus, um von allem das Beste in Säcke verschwinden zu lassen, die sie<br />
mitnahmen. Tante Ilse ging aber sofort zum Kommandanten, der seine Hansel antreten ließ,<br />
zwei fehlten, die erst noch gesucht und geholt werden mussten, die waren es. Umgehend<br />
waren die Säcke mit Inhalt wieder in unserer Wohnung. Erinnerlich ist mir auch ein Kerl, der<br />
mit einer Spitzhacke im Keller die Wand bearbeitete, weil er einen weiteren Keller dahinter<br />
vermutete. Auch für mich als Kind war das Wissen um die Rechtlosigkeit in der wir uns<br />
befanden eine schwere psychische Belastung, wir hatten Angst um unsere Erwachsenen. Vor<br />
Weihnachten bekamen die Polen eine Sonderzuteilung Butter und Zdzisĺaw nahm mich auf<br />
dem Fahrrad mit zur Abholung. Zurückgekommen händigte er mir 2 Stück als Weihnachtsgeschenk<br />
aus, welche meine Mutter aber sofort wieder zu Pani Wierzbicka brachte, im<br />
Hintergrund Zdzisĺaw mit rotem Kopf. Frau Wierzbicka sagte aber, dass alles seine Richtigkeit<br />
habe, die kluge Frau hatte wahrscheinlich begriffen, dass ihr Sohn damit auch ihr ein sehr<br />
schönes Weihnachtsgeschenk bereitete.<br />
8. Das Jahr 1946<br />
Irgendwann im Februar kam Hans Scholz, ein damals ca. 17-jähriger älterer Bruder von<br />
Gottfried und Klaus zur Familie zurück (westlich von Neiße und Oder hungerte man) und<br />
entsprechend seiner bisherigen Tätigkeit in der Landwirtschaft arbeitete er in Reichenau<br />
/Rychwaĺd als Melker im Stadtgut, welches etwa hinter der jetzigen Stadtbibliothek (als<br />
ehemaliges Preibisch-Gut) gelegen war.<br />
Als erste Datensammlung vermerkte ich damals, dass angenehmerweise am 07.03. G.<br />
Scholz Geburtstag hatte und am 07.04. meine Schwester. Das Jahr fing also immer gut an.<br />
Wie jedes Jahr wieder erblühte auf der Wiese hinter unserem Haus in Schneeglöckchen „RP“,<br />
d. h. Roland Preibisch, von ihm gepflanzt als er fort ging, wie schmerzvoll wohl für Eltern<br />
und Geschwister im Hause, da er zu den Lebenden niemals zurückkehren würde. Im April<br />
tauchte ein junger Mann namens Kurt Stein auf, der unbedingt mit mir Freundschaft schließen<br />
wollte und das auch untermauerte, indem er einen 1-achsigen kleinen Wagen mit langer<br />
Deichsel mitbrachte und mich stundenlang durch die Botanik fuhr. Alles angenehm aber<br />
etwas unverständlich für mich, bis sich der wahre Grund langsam herausstellte, denn er wollte<br />
dafür meine Tante Ilse haben. Ich begriff aber schon damals, dass ich diese nicht ganz<br />
verlieren würde und ich habe mir lebenslang keinen besseren Onkel vorstellen können, als er<br />
es war. Zurückgekehrt war auch die Schwester meines Großvaters mit ihrer Familie. Träger<br />
des Aufenthaltes war die jüngere Tochter, Christine Knebel, die als Weberin arbeitete und<br />
Aufenthaltserlaubnis bekommen hatte. Die ältere Tochter, Irene, war in Zittau geblieben, sie<br />
war ein kühnes Mädchen, welches sich von der Grenze und selbst Neißehochwasser nicht<br />
abhalten ließ und an arbeitsfreien Tagen ganz konsequent in dunkler Nacht die Seiten<br />
27
wechselte. Mitte Mai brachte Irene unseren Vater aus amerikanischer Gefangenschaft zu uns<br />
zurück, der sich am 17.05. in Rychwaĺd anmeldete und Aufenthaltserlaubnis bekam und<br />
Arbeit als Maurer.<br />
Anmeldung meines Vaters in „Rychwałd“<br />
Als eine gewisse Friedens-Dividende lernte ich in diesem Frühjahr erstmals komfortable<br />
selbst gemachte Sandalen kennen, mit einer Sohle aus Autoreifen, die genau bis in den<br />
Spätherbst hielten, dann waren sie durchgelutscht. Bei den früheren Kriegs-Sandalen, bestand<br />
die Sohle aus Holzstäbchen, die oben mit einer dünnen Kunstledersohle überklebt waren und<br />
die es immer schafften ganz gefährlich zu zwicken. Für die Sandalen der neuen Art schwanden<br />
in den Fabriken die Schlagriemen von den Webstühlen, auch hatten die Fabriken einen<br />
großen Verbrauch an Glühbirnen, denn wer eine solche zu damaliger Zeit privat brauchte,<br />
konnte diese nirgends kaufen, nur in einem unbeobachteten Augenblick in einer Lampe auf<br />
Arbeit schnell umwechseln.<br />
Da hatten die Betriebselektriker dann viel zu laufen. Es ist mir erinnerlich, dass ich<br />
meine Mutter bei Brendler von der Schicht abholte und dass vor der Pförtner ein großer Stau<br />
von Menschen war, der kontrolliert und abgetastet wurde, dabei auch eine polnische Frau, die<br />
sich das sehr energisch von Männerhand verbat. Textilien hatten damals eine sehr hohen Wert<br />
und wären auch gern über die Mauern des Fabrikgeländes gegeben worden, wenn da nicht<br />
polnische Wachmänner gewesen wären. Ein junger von ihnen, ein gewisser Milan, offenbarte<br />
sich gegenüber meiner Tante Ilse, dass er viel lieber qualifizierte Büroarbeit wie sie machen<br />
würde, als den stupiden Wachdienst. Sie ermutigte ihn eine Lehre im Büro zu beginnen, was<br />
er auch tat, wobei er auch sehr tüchtig war, eine Fernstudium anschloss und schließlich<br />
Hauptbuchhalter wurde. Einen ganz ähnlichen Werdegang vollbrachte ein gewisser Wozniak,<br />
bis zum technischen Direktor. Im Juli bekamen wir Nachricht, dass in Oppelsdorf eine damals<br />
83-jährige Tante Luise meines Vaters verblieben war. Sie war der Aussiedlung entgangen,<br />
indem sie einen tschechischen Pass von früher vorzeigen konnte, wohnte ganz allein im<br />
Albertbad und lebte von der Gnade der neuen Administration und der neuen Nachbarn. Wie<br />
gesagt, ganz allein im großen Hause, wenn unten jemand klopfte, zog sie sich große Männerstiefel<br />
an, stapfte damit kräftig herum und fragte mit tiefer Stimme, wer denn da sei. Es ist<br />
mir erinnerlich, wie wir mit Wierzbicki, Murdel vorgespannt und den leichten Plattenwagen<br />
angehangen den bescheidenen Umzug zu uns nach Rychwaĺd durchführten. Wenn ich mich<br />
heute frage, warum wohl Onkel Erich nicht kutschiert hat, so gebe ich die Antwort, dass<br />
Wierzbicki einem Deutschen das wertvolle Gespann nicht anvertrauen konnte, denn man<br />
durfte es ihm wegnehmen; vielleicht hatte Wierzbicki versteckt sogar die Schrotflinte mit.<br />
So war denn unser Haus ziemlich voll geworden, Ilse und Kurt übergaben ihr beheizbares<br />
Zimmerchen im Obergeschoss an Tante Luise und zogen nach unten, wo die Großeltern<br />
ihnen die gute Stube mit Veranda übergaben, sie selbst beschränkten sich auf die Wohnküche<br />
und das Schlafzimmer. Ich schlief in einem winzigen Zimmer neben genannter Wohnküche,<br />
in welcher sich von Großmutter freundlich regiert, sowieso das Zentrum befand, nebst der<br />
28
Speisekammer, in welcher einmal, ist mir erinnerlich, nur noch eine Speckschwarte hing.<br />
Doch obwohl es manchmal sehr knapp war, haben wir Hunger nicht kennen gelernt.<br />
Da wir immer mit unserer Aussiedlung rechnen mussten und wussten, wie knapp die<br />
Nahrung westlich der Neiße ist, wurde sooft es gelang Brot auf Vorrat gekauft, in Scheiben<br />
geschnitten und geröstet, d. h. somit haltbar gemacht. Für mich für lange Zeit eine feine<br />
Sache, da immer eine große Kommode, die Schubfächer mit Röstbrot gefüllt, vorhanden war<br />
und niemand den langsamen Schwund durch mich so richtig bemerkte.<br />
Ende August bekamen wir über Irene Nachricht, dass die Mutter meines Vaters im<br />
Walde beim Pilze suchen eine schweren Schlaganfall bekommen hatte, der dann auch zum<br />
Tode führte. Mit Irenes Hilfe konnte unser Vater an der Beerdigung seiner Mutter in Zittau<br />
teilnehmen. Vor diesem Schicksalsschlag war in unserem Hause im August Hochzeit gewesen<br />
mit einer großen Tafel im Wohnzimmer und Veranda, Onkel Erich und Tante Ida waren auch<br />
dabei und viele junge Leute aus dem ehemaligen Reichenau und Tante Ilse hieß von da an<br />
Stein. Kurt Stein arbeitete bei der ehemaligen Firma Brendler als Webmeister.<br />
In dieser Zeit kam dann auch der Vater von Kurt, Hans Stein, als Kommunist in<br />
Buchenwald inhaftiert gewesen, zeitweise in unser Haus. Da lag erst einmal eine gewisse<br />
Spannung in der Luft, denn mein Vater und er kannten sich von früher! Da war mal so eine<br />
Wehrübung des Jung-Stahlhelms (Stahlhelm = Bund der Soldaten des I. Weltkrieges) im<br />
Gelände angesetzt gewesen, von der auch die Reichenauer Kommunisten wussten. Sie<br />
rückten also zu Dritt aus, dabei auch Hans Stein, um zumindest einen dieser Reaktionäre zu<br />
erwischen und abzustrafen. Mein Vater, der einsam auf Vorposten lag, sah die drei in der<br />
Abenddämmerung kommen, Ortscheite in der Hand. Er schmiegte sich unsichtbar in den<br />
dichten Klee, aber der Zufall wollte, dass sie über ihn stolperten. Dann ging alles blitzschnell,<br />
Vater Karl hatte sich den Mittelsten vorgenommen und würgte ihn und würgte ihn, währenddessen<br />
die handlungsfähigen Kommunisten ihm mit den Ortscheiten auf den Kopf<br />
schlugen. Bei dem allgemeinen Gebrüll kamen die anderen Stahlhelmer hinzuglaufen, aber<br />
am Ende ging alles so aus, dass jede Partei ihren Halbtoten schnell zum Arzt schaffte,<br />
meinem Vater wurde die ganze Kopfhaut mit Watte unterstopft, erzählte er. Aber einmal<br />
familiär vereint, war das alles vergessen, man sagte „Karl“ und „Hans“ zueinander und spielte<br />
abends Skat.<br />
Auch an den Arbeitsplätzen in den Fabriken waren alle Kriegsbeile begraben, wahrscheinlich<br />
waren alle froh, den Krieg überstanden zu haben und nicht zu hungern. Auch wäre<br />
es wohl der Produktion nicht bekommen, wenn jemand gegen die zumeist deutschen Webmeister<br />
gehandelt hätte. Anders war es in den Nächten. Die Besitznamen durch Polen waren<br />
erfolgt, leer stehende Häuser und Gehöfte ausgeplündert, da blieben für nachrückende Polen<br />
nur noch die von Deutschen bewohnten Häuser, die auszurauben waren. Unser Haus wurde<br />
abends in eine Festung verwandelt. Vor jedes Fenster im Keller und im Erdgeschoss kam von<br />
innen eine Holzplatte, die mit einer Stange fest gegen einen Wandanschluss abgesteift wurde.<br />
Die Türen wurden ähnlich gesichert, wohl dem, der einen großen Hund hatte. In der Nacht<br />
hörte man dann die verzweifelten Hilferufe wo eingedrungen wurde, auch das Ächzen und<br />
Stöhnen, wenn die Leute zu Boden geschlagen wurden. Die Banden waren schwer bewaffnet,<br />
die Deutschen rechtlos, außerhalb ihres Hauses erst recht vogelfrei, einzige Gegenmaßnahme<br />
blieb mit Stürzen und Pfannen bei offenen Fenstern Lärm machen, Weigelt Paul ließ eine<br />
Sirene heulen. Angst hatte ich vor der Behandlung, die einer Frau wiederfahren war, die man<br />
still machte durch Einwickeln in die Bettdecke und Umschnüren mit einer Wäscheleine. Sie<br />
überlebte, war aber ganz blau.<br />
Unser Nachbar schräg gegenüber, Hermann Broksch, bekam eine große Familie zur<br />
Einquartierung, die morgens mit den Werten verschwunden war. Er lag mit eingeschlagenem<br />
Schädel in der Jauchegrube. Es gab Fälle, wo die deutsche Familie nur mit Gewehren in<br />
Schach gehalten wurde, während man das ganze Haus ausgeraubte. Unter dem Strich aber,<br />
haben wir Deutschen im Reichenauer Zipfel, aus dem für Banden schwer herein und heraus<br />
29
zu kommen war, viel weniger Drangsal erlebt als unsere Landsleute auf dem flachen Lande,<br />
in Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern und Ostpreußen.<br />
Im November wurde die Familie von Ernst Preibisch ausgewiesen, obwohl der polnische<br />
Jungbauer dagegen unternahm, was er nur konnte. Diese 2. Ausweisung erfolgte schon so,<br />
dass der Transport in Güterwagen erst fast 8 Tage nach Osten fuhr (sehr zur Sorge der<br />
Transportierten), aber dann wiederum eine reichliche Woche nach Westen, in die spätere<br />
DDR.<br />
Mit Ernst Preibisch ging wohl der maßgeblichste und letzte „Kirchenvater“ aus<br />
Reichenau hinaus, der in den 30er Jahren gegen die von den Nazis propagierten sogenannten<br />
„Deutschen Christen“ gestanden hatte. Indem die eingesetzten „DC“ – Pfarrer keine Gemeinde<br />
in der Kirche vor fanden, wurde für die oppositionellen Pfarrer jeweils kurzfristige<br />
Hausarreste verhängt. Die Gemeinde versammelte sich aber unter dem geöffneten Fenster des<br />
Pfarrhauses, durch welches der Arrestierte den Gottesdienst abhielt. Das war der sogenannte<br />
„Kirchenkampf“.<br />
Vetter Ernst Preibisch bleibt Landwirt; in Großschönau<br />
Als nahe das Gasthauses „Zum Hirsch“ niederbrannte, war die deutsche Feuerwehr schon<br />
so geschwächt, dass sie neue Mitglieder werben musste, so auch meinen Vater, der u. a. als<br />
Bausachverständiger entscheiden sollte, wie lange das brennende Objekt noch steht. Brände<br />
gab es in dieser Zeit sehr viele; ich hatte mir aber abgewöhnt zu Onkel Erich zu laufen, denn<br />
die Trompete hing jetzt außerhalb seines Bereiches und er wollte sowieso nicht blasen. Auch<br />
ich verstand, dass die Polen wohl übel reagiert hätten, wenn im Falle eines Brandes noch ein<br />
Deutscher von oben auf der Trompete geblasen hätte.<br />
Die Nachbarschaft in unserem unmittelbaren Umfeld hatte sich Ende 46 ca. so verändert,<br />
von Norden beginnend, entgegen dem Uhrzeigersinn:<br />
− Brückner-Bauer hatte aufgegeben, denn der Sohn und Hoferbe war nicht aus dem Krieg<br />
zurückgekehrt. An seiner Stelle war ein Franzose, der mit einer Deutschen aus der<br />
Nachbarschaft zusammenlebte, beides sehr angenehme Leute.<br />
− In Ehrentrauds Haus waren Neudels eingezogen, sozusagen als polnische Verwandte dieser<br />
Familie, dabei auch die 17-jährige Tochter Ina, ein sehr anmutiges Mädchen, von der ich<br />
gern viel mehr beachtet worden wäre.<br />
− Ein Haus weiter, in Englers Villa, wohnte Familie Warchol, die uns auch sehr gute<br />
Nachbarn wurden.<br />
− Im Haus mit dem Turm (bei ehemals Altmann-Dachdecker) war die polnische Familie<br />
Jarosz eingezogen. Sie bekamen ein Kind Namens Stanislaus. Vater Jarosz arbeitete mit<br />
meinem Vater bei BZPB.<br />
30
− Leubners wohnten weiter in ihrem Haus, mit Schwiegersohn Heinz Jirch.<br />
− Bei ehemalig Brocksch-Hermann wohnte eine polnische Familie, dahinter der Zimmermann-Maler.<br />
− Bei Heidrich-Bauer lebte deutsch und polnisch einvernehmlich durcheinander, nur die<br />
Mutter von Jan Jackiewicz war mit der Situation nicht so richtig einverstanden. Inge<br />
Heidrich war von Jan hoch in anderen Umständen.<br />
− Im Nebenhaus, bei ehemals Otto Preibisch, wohnte jetzt ein kinderloses polnisches Ehepaar<br />
namens Artelt, von ihm nahmen wir immer an, dass er deutscher war, als er zugab.<br />
− Für mich war ganz maßgeblich, dass zwischen Artelt und Heidrich/Jackiewicz meine<br />
Scholz-Freunde wohnten, wie seit alten Zeiten.<br />
Hier noch ein kleines Erlebnis, was alles wechselseitig passieren kann, wenn man als<br />
kleiner Junge nur eine Viertel-Portion ist in der Welt der Erwachsenen. Wir waren auf der<br />
Rückfahrt auf einem staubigen Weg bei Bräuers Fabrik. Es war in der warmen Mittagszeit,<br />
das Pferd Murdel ging halb schlafend, Wierzbicki und ich saßen ebenfalls dösend in großer<br />
Ruh auf dem schmalen Ackerwagen auf einer Bohle, die quer über den Wagen gelegt war.<br />
Nur, dass es eben von unten stuckerte und Wierzbicki auf seiner Seite auf der Bohle über den<br />
Wagenrand hinaus gerutscht war; so begann für mich plötzlich ein wundersames Schweben<br />
mit immer schnellerer Luftfahrt, am Ende ein weiter Freiflug in den Straßengraben.<br />
Wierzbicki rutschte entsprechend unter den Wagen und das Hinterrad lief über seinen Fuß. Da<br />
war wirklich eine plötzliche Situationsänderung aus heiterem Himmel und Halbschlaf. Als ich<br />
aus dem Graben kroch, sah ich Murdel in einer Staubwolke davon preschen, Wierzbicki lief<br />
humpelnd hinterher und rief: „Br, br“.<br />
Weihnacht 46 haben wir in einem deutlich volleren Hause gefeiert als im Vorjahr,<br />
dadurch auch alles viel geborgener und wärmer für uns Kinder und wie immer mit dem<br />
Klavierspiel von Großvater. Die Kirche wird wohl verwaist und aufgegeben gestanden haben.<br />
9. Das Jahr 1947<br />
Es fing gut an, wie ein echtes Friedensjahr, und die jungen Erwachsenen, die wir in Gestalt<br />
von Kurt und Ilse im Haus hatten, beschlossen hineinzufeiern. Staunend sahen wir Kinder,<br />
was ausgelassene Erwachsene im Vorfeld zustande bringen. Da war die Jahreszahl 1947 in<br />
vier fröhlich hereintanzende große Figuren aufgelöst, die Zahlen mit Armen, Beinen und<br />
Gesichtern versehen. Über den Kreis der Gäste kann ich nur mutmaßen:<br />
− War Webmeister Kurt Lachmann mit Frau schon dabei, oder der junge Webmeister Kurt<br />
Beyer mit polnischer Freundin Lydia, oder gar schon Rudi Fischer mit Warschauer Freundin<br />
Jenny, der aus Buchenwald zurückgekehrt war und mit Ilse und Jenny bei ehemals<br />
Brendler arbeitete, oder Rudi Serebtz mit polnischer Freundin, später ein Fußballstar von<br />
Bogatynia, oder Ulla Zosel mit ihrem polnischen Freund und späteren Ehemann; sicher<br />
aber Gerhard Hirsch, der einarmig zeitig aus dem Krieg zurückgekehrt war und seine<br />
Versehrtheit bei Sport und Arbeit mit Fassung trug, als Chemiker eher ein Mann des<br />
Geistes als welcher er auch später in Deutschland weiter studierte. Ein liebenswerter<br />
vornehmer Mensch, den ich 2000 leider zum letzten Mal begegnet bin. Seine ältere<br />
Schwester und meine Mutter waren eng befreundet.<br />
Das Leben normalisierte sich auch auf anderen Gebieten, Kinder kamen zur Welt, zuerst<br />
bei Jan Jackiewicz und Inge Heidrich deren Sohn Siegmund war eigentlich der natürliche<br />
Erbe auf dem Heidrich-Hof, aber alle Tragödien haben Scheinlösungen eingebaut.<br />
Ende Februar wurde in unserem Haus mein Vetter Dieter Stein geboren, als Geburtshelfer<br />
der alte Dr. Hauptmann, den mein Vater und Kurt Stein nebst Utensilien auf einem<br />
Hörerschlitten herbei zogen. (Vorweggenommen: – Siegmund und Dieter waren 10 Jahre<br />
später in Zittau wieder zusammen in einer Schulklasse.)<br />
Ich selbst wurde an diesem Tage zur Familie von Großvaters Schwester ausquartiert und<br />
habe dort auch übernachtet, dabei sicher auch Christine angetroffen, die als Weberin arbeitete<br />
31
und wahrscheinlich auch die kühne Irene, die in Zittau arbeitete, sich aber wie schon berichtet<br />
von der Grenze nicht abhalten ließ.<br />
Erich baute sich Frühjahr mit Wierzbickis Genehmigung aus einer leichten Kutschachse<br />
einen Handwagen, mit zwei Deichseln, zwischen denen er gehen wollte, Ida sollte hinten<br />
schieben, im Falle der Ausweisung. Im April war es soweit, Heidrich-Bauer und Preibisch-<br />
Bauer mussten gehen. Dabei auch Inge Heidrich und ihr Kleinkind Siegmund. Wohl 3 – 4mal<br />
hat in den Folgejahren Jan sich Frau und Kind nächtens über die Neiße zurückgeholt,<br />
immer nur für kurze Zeit, denn die Behörden und seine Mutter waren dagegen. Zeitweise war<br />
er inhaftiert, dann wurde er wahrscheinlich 49 aus der Region entfernt.<br />
Im Frühjahr 47 brachte mir u. a. eine Anstellung als Ziegenhirt; d. h. diese nützlichen<br />
Tiere waren schleichend überall eingestallt worden, u. a. auch von unserer Großmutter und<br />
bei Wierzbickis und ... und..., jedenfalls gab es 4 dieser Tiere in der Nachbarschaft, die ich<br />
früh auf die Weide bis über die Oppelsdorfer Straße bringen, mittags umpflocken und abends<br />
zurückbringen musste. Großmutters Kalkül dabei, wenn ich Wierzbickis Ziege mit versorge,<br />
dann kann unsere auch dort mit weiden. Der erste Weidegang war eine üble Sache, die Biester<br />
zogen lange Ketten mit, womit sie sich oft an Gegenständen und untereinander verhedderten<br />
und hatten sowieso keine Lust irgendwohin zu folgen. Am Ende stand ich zwei Ziegenketten<br />
in der Hand, auf der Oberen Dorfstraße, eine Ziege wollte weidewärts, die andere heimwärts,<br />
ein Lastauto musste vor mir stoppen und zwei Ziegen plünderten überhängende Sträucher von<br />
Vorgärten. Es durfte nur einmal passiert sein, dass alle mich so schwach sahen! Außerdem<br />
war ich einige Mal zu Fall gekommen als ich auf Ketten der unberechenbaren Tiere trat. Beim<br />
nächsten Trieb stellte ich voll auf Terror ab, mittels einer Gerte, mit der ich diese schwierigen<br />
Tieren den Weg wies und sie nicht zum Stillstand kommen ließ. Es war ein einziges Getöse<br />
und Gerassel und Funkensprühen der Ketten auf der Schotterstraße, nicht nur das Auge sah,<br />
auch das Ohr hörte sofort den Stillstand, damit hatten die Ziegen verloren. Die Eigentümerinnen<br />
beschwerten sich zwar etwas über die forsche Gangart, das wäre der Milchleistung<br />
abträglich, aber selbst machen wollten sie es auch nicht.<br />
Mit dem Abgang der deutschen Bauern war auch für die polnischen Wirte eine härtere<br />
Zeit angebrochen, die sich teilweise deutsche Arbeitskräfte auf dem Weg von der Fabrikarbeit<br />
oder sonst im Ort zwangsrekrutierten. Ilse versorgte unseren Großvater in dieser Zeit zum<br />
Schutz mit einem aktuellen Fabrikausweis. Im Falle Wierzbicki hatte unser Haus die Ernteunterstützung<br />
unternommen, auf dem Jackiewicz/Heidrich-Hof die Familie Scholz, in beiden<br />
Fällen war ich wahlweise mit dabei. Zur Getreideernte bei Wierzbicki die Erinnerung, wie<br />
stolz dieser war, einen doppelten Hektarertrag zum Vorjahr erzielt zu haben. Ansonsten waren<br />
wir, was seine bäuerlichen Qualitäten anbelangte, eher skeptisch: – „vielleicht za Buga ein<br />
Pferdchen und eine Kuh“ meinte mein Vater. Andererseits aber punktete Wierzbicki bei<br />
unseren Männern als Jäger. Es blieb nicht unbemerkt, dass er mit Flinte und Fahrrad in den<br />
Wald fuhr und umgehend mit erlegten Füchsen und Hasen zurückkehrte, das schien seine<br />
starke Seite zu sein. Ansonsten war er, obwohl auch jähzornig, ein umgänglicher gutmütiger<br />
Bursche, der für uns ein Schutz war. Als ein Schäferhund auf der Wiese vor dem Hof die<br />
Ziegen anfiel, erschien er sofort mit der Flinte. Die Besitzer des Hundes wollten ihr Tier<br />
retten und beschimpften ihn als Deutschen-Freund. Daraufhin schoss er gerade in die Luft als<br />
sie weiter schimpften, schoss er noch einmal aber schon schräger. Für mich war das eine<br />
beruhigende donnernde Machtdemonstration in unserer Ecke. Meine Mutter schneiderte für<br />
sich und für uns Kinder schon seit Kriegszeiten. Auf diesem Feld zeigte sich auch Frau<br />
Wierzbicka sehr bewandert, so dass die beiden sich austauschten und ein achtungsvolles<br />
Verhältnis zueinander hatten.<br />
In diesem Jahr starb 84-jährig auch Tante Luise, sie wachte vom Nachmittagsschlaf nicht<br />
mehr auf. Die Beerdigung fand schon in dem Bereich des evangelischen Friedhofs statt, wo<br />
auch heute die meisten neuen Gräber vorzufinden sind. Indem unsere Familie ein Trauerfall<br />
getroffen hatte, nahm auch der ehemalige polnische Kampfkommandant teil, der sich sogar<br />
anbot, zu sprechen.<br />
32
Während die Welt der Erwachsenen sich einigermaßen arrangiert hatte, gab es unter der<br />
Übermacht polnischer Kinder reichlich Exemplare, die den Krieg mit anderen Mitteln an uns<br />
Wenigen fortsetzen wollten. Wir Kleineren konnten uns nur schützen, indem wir uns im<br />
Umfeld größerer Jungen oder Erwachsener aufhielten, trotzdem kam es oft zu Überfällen mittels<br />
scharf geworfener Schottersteine. Es kam zur Gegenwehr von uns auf gleicher Ebene, zu<br />
Angriffen und Gegenangriffen mit Feuerschutz, wie im Krieg. Unvergessen wird mir bleiben,<br />
wie Klaus Scholz, der ca. 4 Jahre älter war als wir, allein gegen einige gleichaltrige Gegner<br />
vorging, damit wir Kleinen uns ungetroffen zurückziehen konnten. In diesen Zeiten hatten wir<br />
sicherheitshalber immer einige Schottersteine in der Hosentasche, bzw. wussten, wo solche<br />
abgelegt waren. Natürlich bemühten wir uns bei unserer Minderzahl auch als Friedensstifter<br />
aufzutreten, d. h. näher wohnende polnische Kinder oder einzeln Gehende wurden von uns<br />
freundlich behandelt bzw. einbezogen.<br />
Trotzdem war damals jeder Gang in den Ort ein Wagnis und nur zu oft musste ich einkaufen<br />
gehen. Als ich den Auftrag bekam, in die Weberei BZPB regelmäßig das von Oma<br />
gekochte Mittagessen zu schaffen, war das ein Weg voll durch fremde Interessensphären, von<br />
teilweise rigorosen bekannten Feinden besetzt. Indem mir klar war, dass bei einem solchen<br />
Treffen Weglaufen nicht meine Sache wäre, andererseits meine Hände durch den wertvollen<br />
Essenstopf auch doppelt gebunden waren, musste ich mir in der Sache schon Gedanken zu<br />
Strategie und Taktik machen. Strategisch verlegte ich den Weg über die obere Dorfstraße am<br />
Friedhof vorbei, bis nahe zu Bräuers Fabrik und dann zu BZPB. Taktisch nahm ich den<br />
ehemaligen Militärhund Kora am Bande mit, obwohl ich wusste, dass er nur den Rückzug<br />
mitgemacht hatte und im Bedarfsfalle eher auf Flucht setzte. Und Drittens ging ich, sobald ich<br />
bei Neudels um die Ecke war zum Schnelllauf über, denn logischerweise konnte durch solche<br />
Zeitraffung ja weniger passieren, außerdem konnte ich mich eventuellen Feinden schnell<br />
annähern, durchlaufen und weiterlaufen, ohne dass man es in diesem Fall als Flucht auslegen<br />
konnte. Insgesamt musste ich diesen Weg aber nur 3-mal machen, denn es kam mit Großmutter<br />
zu Streitereien über die Art der überbrachten Mahlzeiten.<br />
Indem wir uns viel selbst überlassen waren, war es ein Glück, dass Klaus Scholz und<br />
Horst, Sohn von Webmeister Lindner (wohnte nahe Akku-Weigelt), schon Schuljahre hinter<br />
sich gebracht hatten, also Lesen und Schreiben konnten und auch die Grundrechenarten.<br />
Besonders durch Klaus seinen Einfluss lernten wir bei Scholzes in der Bastelstube das Alphabet<br />
und das Lesen, sozusagen in aller Stille und spielend. Ich reihte mich zu Hause also in die<br />
Reihe der Lesenden ein, las Kinderbücher, Märchen, Onkels Krimihefte und dann nahm ich<br />
mir ein dickeres Buch vor, wo obenauf geschrieben war „Roman“, also genau wie ein polnischer<br />
Spielfreund gerufen wurde, dann aber den Untertitel „Kreuzweg der Liebe“. Ich weiß<br />
noch, dass man interessanterweise mit einem Motorboot auf dem Nil fuhr, zum Schutz einen<br />
großen Hund namens Fox hatte und man den Einen nicht leiden konnte, weil er ein<br />
Hochstapler war. Unklar war, warum die Fähigkeit in die Höhe zu stapeln einen Mann abwertete.<br />
Ich zog mich also aus diesem Buch zurück und nahm nur den Namen des tapferen<br />
Hundes Fox mit. Im Jahr 1947 wird es wohl auch stattgefunden haben, dass im damals stalinistischen<br />
Polen aus dem evangelischen Pfarramt die Dokumente aus vielen Jahrhunderten in<br />
die Kesselhäuser gefahren wurden, die Heizer standen bis zu den Knien darin und schaufelten<br />
in die Flammen. Dieser Vorfall wird bei vielen Deutschen wohl endgültig zur Überzeugung<br />
geführt haben, dass in dieser Heimat keine Bleibe mehr ist.<br />
Am Ende des Berichtes zum Jahr will ich sozusagen als Warnung für meine Enkel, dass<br />
Gefahr für jeden immer allgegenwärtig ist noch folgendes berichten:<br />
− Ich war allein in Wierzbickis Scheune und stand am Rande der Dreschbühne, d. h. ca. 2 m<br />
über dem Estrich der ebenerdigen Tenne. Unten auf der Tenne lag ein ca. 0,70 m hoher<br />
Schwad Stroh, in den beschloss ich steif hineinzuspringen um mich mit der Federkraft des<br />
Strohs im Trampolineffekt nach oben wegschnellen zu lassen. Was ich von oben nicht<br />
bemerkt hatte, war dass der Schwad nur ganz locker hingestreut lag, d. h. weitgehend mit<br />
Luftlöchern, mit wenig Strohsubstanz. Nach dem Sprung lag ich auf dem Boden und<br />
33
glaubte vor Schmerz beide Beine gebrochen und bewegte mich dann die ca. 10 m bis zum<br />
Scheunentor nur mit Armkraft auf dem Boden. Konnte dann aber, erst zögerlich, dann<br />
immer besser wieder gehen.<br />
10. Das Jahr 1948<br />
Es begann mit der Ausweisung unserer Familie. Wir waren ja auf so etwas gefasst. Von den<br />
Trocken-Röstbrot-Vorräten, die zu meiner Genugtuung 3 Schubfächer einer großen Kommode<br />
voll immer bereitgehalten wurden, habe ich ja bereits berichtet. Zusätzlich war jedes<br />
Familienmitglied mit einem Reisekorb (seiner Größe angemessen) ausgerüstet. Unter die<br />
Reisekörbe waren Holzrahmen mit Holzachsen und Rädern aus einer Holzscheibe gebaut,<br />
vorn eine Schnur zum Ziehen, also ein Gefährt, welches bis zu einem Stellplatz aushalten<br />
würde. Damals war somit gestattet, mitzunehmen was eine Person bewegen und zusätzlich<br />
auf sich tragen konnte. Meine Eltern gingen mit uns noch einmal durch die traute Wohnung,<br />
der Erinnerung wegen. Es kam der Abschied von den Großeltern und Kurt und Ilse. Vor dem<br />
Haus im morgendlichen Halbdunkel stand eine Traube Menschen, die oben in unsere<br />
aufgegebene Wohnung wollten, was ihnen aber verwehrt wurde. Mit Rucksack auf dem<br />
Rücken und Wäsche-/Reisekorb am Bändel ging es die ca. 200 m bis zu Akku-Weigelt, wo<br />
vor dem Haus ein offener LKW stand. Zdzisław Wierzbicki ging mit und zog meiner<br />
Schwester den Reisekorb. Wir waren zeitlich die Ersten auf dem LKW, der immer voller<br />
wurde. Dann kam ein Mann, der verlas Namen von Familien, die dableiben mussten. Wir<br />
gehörten dazu und waren eine halbe Stunde später wieder in unserer Wohnung. Vom 16.01.48<br />
habe ich von meinen Eltern Ausweise mit Lichtbild, wo der Wohnsitz Bogatynia, Naus-Nr. ...<br />
bis auf Widerruf bestätigt wurde (Geburtsort meines Vaters dabei vermerkt „Oplówka“). Ein<br />
weiterer Rückkehrer hielt sich ganz im Stillen in unserem Haus auf. Es war Kurt Preibisch,<br />
der jüngste Bruder meiner Mutter, der wie bereits unter 5. geschildert vor der Erstürmung von<br />
Königsberg in russische Gefangenschaft gekommen war. Irene brachte ihn nächtens über die<br />
Neiße und ich war erstaunt, wie wohlgenährt er trotz russischer Gefangenschaft aussah. Er<br />
war aber durch Wasser aufgeschwemmt und somit in einem sehr bedenklichen Gesundheitszustand,<br />
was auch die Grundlage für seine frühe Entlassung gewesen war. Internes Vorfühlen<br />
ergab, dass Kurt von der Administration nicht geduldet worden wäre, so konnte er höchstens<br />
im Dunkeln seinen geliebten Garten besuchen. Nach ca. 3 Monaten Erholung musste er sich<br />
wieder mit Irene nach Zittau begeben. Er wäre wohl nie von Reichenau weggegangen. Auf<br />
seinem letzten schweren Krankenlager 1990, ließ er sich das sonnenbeschienene Giebelfoto<br />
des Vaterhauses auf A4 vergrößern und schnitt aus einer Gärtnerzeitung an Gewächsen aus,<br />
was er nehmen wollte, d. h. er beklebte damit das Vorfeld des Fotos und pflanzte somit noch<br />
ein letztes mal in seinem Garten und vor seinem Haus.<br />
Nach erfolgter Zurückstellung bei Aussiedlung wurde mein Vater als „Kierownick“<br />
(=Leiter) eingestellt und ein längerer Verbleib im polnischen Umfeld wurde wahrscheinlich,<br />
weshalb unsere Eltern in der polnischen Grundschule wegen unserer Aufnahme vorstellig<br />
wurden. Die Antwort des damaligen Direktors war aber: „... das ist eine Schule nur für<br />
polnische Kinder.“<br />
So konnte ich an dieser Schule in den Folgejahren nur vorbeigehen und habe noch gut in<br />
Erinnerung, wie vom Kirchberg bis an die Pforten der Schule zunehmend herausgerissene<br />
zinnerne Orgelpfeifen lagen. Ein Vergnügen für die große Pause, damals von mir ohne Emotionen<br />
auch so eingeordnet. Heute bin ich froh, dass ich diesen Direktor mit seiner Lehrerschaft<br />
nicht kennen gelernt habe. Erinnerlich ist mir aber, wie bedrückt meine Großeltern<br />
waren (Großmutter sprach sogar von einer Silbermannorgel, was aber wohl nicht zutrifft),<br />
denn die Preibischs hatten immer auch sogenannte „Kirchenväter“ gestellt und es schwang in<br />
der Familie noch eine Erinnerung mit, wie sehr die Kirchgemeinde sich angestrengt hatte, um<br />
diese Orgel zu bekommen.<br />
34
Wie bereits erwähnt, hatten wir Kinder unter der Anleitung von Klaus Scholz bereits<br />
spielend das Lesen gelernt, dabei spielte Indianer-Literatur zunehmend eine Rolle. Indem wir<br />
nur ein kleiner Stamm waren, verteilte Klaus großzügig an alle Häuptlingsposten, aber mit der<br />
hintersinnigen Auflage, Tagebuch zu führen. Ich war voll zufriedengestellt zum Junghäuptling<br />
„Flinker Hirsch“ avanciert und legte mir also entsprechend Weisung des Oberhäuptlings<br />
eine A4-große Kladde an, mit der Aufschrift „Flinger Hisch“. Weiter gedieh die Sache nicht,<br />
Oberhäuptling hatte wohl auch zuviel andere Ablenkung. Die Auffindung dieser meiner<br />
ersten Schreibanstrengung brachte außer Erheiterung meiner Eltern auch zu Bewusstsein, dass<br />
Zeit zum Handeln gekommen sei. Indem mein Vater jetzt besser verdiente, konnte meine<br />
Mutter zu Hause bleiben und sich der Bildung der Kinder widmen. So saßen in unserem<br />
Wohnzimmer außer meiner Schwester und mir bald auch noch Gottfried Scholz, Manfred<br />
Pieche und Edda Hüttmann und mühten sich mit Lesen, Schrieben und Rechnen. Das war<br />
aber im Wesentlichen nur eine ca. 3-Tage-pro-Woche-Vormittagsschule, die viel Freizeit ließ.<br />
Einen geringen Teil dieser Freizeit belegte noch die Christenlehre, die von den Schwestern<br />
Else und Margarete im Stiftsgebäude am Reichenauer Krankenhaus abgehalten wurde.<br />
Schwester Else war Diakonissin und Operationsschwester und sie soll in der Umbruchszeit als<br />
Ärzte fehlten, selbst operiert haben, um Leben zu retten (wurde gesagt).<br />
Bei Scholzes wurde der neue Arzt erwartet und er kam mit einem BMW-Motorrad (statt<br />
Fußrasten Fußbretter), Lederkappe und brauner Lederjacke, selbst die Böschung fuhr er<br />
hinauf. Er nannte sich Dr. Joschko und es stellt sich heraus, dass er auch Deutscher war.<br />
So festigten wir Restdeutschen unsere Positionen, obwohl wir zu dieser Zeit noch<br />
weitgehend rechtlos, weil staatenlos waren. Es ist mir erinnerlich, wie ein junger Mann, auf<br />
dem Wirtschaftshof vor Scholzes Haus, alles daransetzte, Alfred Scholz aus der Fassung zu<br />
bringen. Dieser als ehemaliger Bademeister in Reichenau, mit keinem Gramm Fett auf dem<br />
Körper und muskulös, war eigentlich keiner, den man ungestraft an der Jacke ziehen, auf die<br />
Hacken treten, am Ärmel zupfen konnte, es sei denn man setzte auf die Rechtlosigkeit der<br />
Deutschen. Als der Tunichtgut wahrnahm, dass Alfred Scholz seine Beherrschung verlor,<br />
speichte er davon. Zur rechten Zeit, denn ihm wurde eine Schaufel nachgeworfen, die durch<br />
die Luft schwirrte und zwischen Scheunenwand und Schuppen hin- und her prallte, wie ich es<br />
bis dahin noch nicht gesehen hatte.<br />
Auch die Administration von Bogatynia, die manchmal in der Verlegenheit war, nomadisierende<br />
Pärchen kurzzeitig unterzubringen, bediente sich gern der von Deutschen bewohnten<br />
Häuser. So auch bei Scholzes. Trotz der großen Familie, wurde dort einquartiert. Die<br />
Untermieter, Mann und Frau, waren nicht die Besten zueinander. Der Streit eskalierte soweit,<br />
dass er sie, mit dem Messer in der Hand, um das Haus trieb. „Alfred geh dazwischen“ rief<br />
Frau Scholz, „er bringt sie um!“. Der aber sagte nur ganz ruhig: „Ach, lass nur, die brauchen<br />
das“. Die wilde Jagd ging wieder in das Haus hinein, die Treppe hinauf, ins Zimmer der<br />
Untermieter, dann war Stille, mörderisch für Frau Scholz. Aber dann fing das Eisenbett der<br />
Untermieter an, Töne von sich zu geben. Die Deckenbalken überm Erdgeschoss bewegten<br />
sich. „Siehst Du, die brauchen das“, sagte Alfred Scholz.<br />
Hans der Älteste der Scholze-Jungen arbeitete auf dem „Majątek“ (=Preibisch-Gut) als<br />
Schweizer, weshalb Gottfried Scholz, der mit mir etwa gleich alt ist, dort zeitweise als<br />
Hütejunge tätig war. Da ging ich natürlich manchmal mit. Indem Gottfried sozusagen einen<br />
Angestellten-Status hatte, konnten wir uns gegen Schlechtwetter jeder einen brauchbaren<br />
Sack aussuchen, bei dem wir einen Zipfel in den anderen steckten und so eine Kapuze<br />
bekamen, die uns kleinen Kerle maßgeblich bedeckte. Sicher haben wir auch Kartoffeln mitgenommen,<br />
auch wussten wir, wo auf dem Felde Pferdemöhren angebaut waren, wo<br />
Brennholz zu finden war, usw. Einmal waren wir mit dem Austrieb weit weg auf dem Felde<br />
bei einem Erdhügel = Wasserbehälter, wo zufällig ein Wärter zugegen war, der uns eintreten<br />
ließ in eine kleine Arbeits-/Aufenthaltsstube mit Tisch und Stuhl, ganz unerwartet in der<br />
Feldeinsamkeit. Heute glaube ich, diesen Behälter eingebaut zwischen Gebäuden zu erkennen.<br />
Wenn abends die 52 Kühe wieder im Stall waren, wo auch der Bulle stand, der keinen<br />
35
Freigang hatte, dann wartete der in ähnlicher Funktion anwesende große Herr Ziegenbock<br />
bereits im Park auf uns, zum Kräftemessen. Zentrum der Jagd war ein damals noch vorhandenes<br />
trockenes Brunnen-Rondell mit schräg nach innen abfallendem Boden. In dessen Schräge<br />
konnten Mensch und Tier im Rundlauf große Geschwindigkeiten erreichen, wobei man bei<br />
zunehmendem Vorsprung auch schnell hinter dem Bock sein konnte. Das veranlasste diesen<br />
zu plötzlicher Kehrtwendung, worauf man hinausspringen musste und der Freund musste, um<br />
zu retten, im wahrsten Sinne des Wortes „einspringen“ und wieder vorn rennen, um den Herrn<br />
des Parks abzulenken.<br />
Mit Gottfried waren wir auch im Herbst Kartoffeln lesen. Wir waren sozusagen plötzlich<br />
gesuchte Arbeitskräfte, bekamen bei den Bauern auch Mittagessen (dabei lernten wir erstmalig<br />
die gute polnische Küche kennen), manchmal gab es auch Schnitten auf dem Feld, aber<br />
ansonsten war die Realität des Kartoffel-Auflesens dann auf dem Feld doch sehr hart. Oft<br />
haben wir die letzten Kartoffeln unseres Abschnitts direkt vor den Pferdehufen aufgelesen,<br />
dann waren die vollen Körbe bis zum Wagen zu tragen und dort in den hohen Wagen zu<br />
entleeren. Fast zuviel für so kleine Kerle, aber wir haben es geschafft. Die Härte war schnell<br />
vergessen und das Drumherum lockte immer wieder zu einem Einsatz bei einem weiteren<br />
Bauern. Als ich dann Nachricht bekam, ich solle meine Vergütung abholen, waren es auf dem<br />
Handwagen mehr als 3 Zentner Winterkartoffeln, für meine Eltern eine unerwartete Absicherung<br />
der Ernährung bis zum Frühjahr; für mich auch die erste Erfahrung, dass man durch<br />
Arbeit verdienen kann.<br />
Ansonsten hielt ich natürlich wie früher engen Kontakt zum Wierzbicki-Hof, besonders<br />
bezüglich Ausfahrten. Es gab da sozusagen ein Interessengeflecht:<br />
− Frau Wierzbicka wusste, dass sie über mich abends zumindest das Fuhrwerk wieder bekam,<br />
− der Pan wusste, dass er über mich evtl. das Fuhrwerk los wurde (nicht selbst lenken<br />
musste),<br />
− das Pferd Murdel wollte auf jeden Fall auch nach Hause,<br />
− und ich wollte unbedingt mit Pferd und Wagen durch den Ort fahren.<br />
Erinnerlich ist mir eine Fahrt zur Mühle nach Markersdorf und alleinige Rückfahrt,<br />
desgleichen auch eine Fahrt zur niederen Mühle, dort dann ein gewisses Warten mit Pferd und<br />
voll geladenem Rollwagen in Erwartung wie der innere Kampf bei Wierzbicki ausgehen<br />
würde; der trinkfeste Müller lockte und er gab das Zeichen zu meiner Abfahrt. Als ich merkte,<br />
dass ich mich der Hubbrücke näherte (am Wehr vor ehemals Preibisch), wo geheimnisvoll<br />
eine Null, ein Komma, eine 5 und ein „t“ daran standen, war der Weg schon so eng, dass eine<br />
Umkehr unmöglich war. Vor der Brücke schaute Murdel noch einmal kurz zu mir zurück,<br />
dann donnerten wir darüber und alles ging gut, eben deutsche Wertarbeit. Ansonsten war<br />
Murdel ein so kluges Pferd, dass es vor der Brückenrampe zu Hoffmanns Laden von selbst<br />
Anlauf nahm und ich hielt mich für den Rest der Fahrt auf der langsam aufsteigenden<br />
Hauptstraße und konnte dann auf dem Hofe Frau Wierzbicka alles übergeben.<br />
Am Ende dieser Jahresschilderung will ich für meine Enkel noch vermerken, wie<br />
gefährdet kleine Jungen in ihrer Unerfahrenheit manchmal sind:<br />
− In der Scheune bei Wierzbickis waren zeitweise zwei Ochsen im hinteren Teil frei laufend<br />
eingestallt. Aus Erzählung meines Vaters wusste ich, dass auf dem Rittergut in Oppelsdorf<br />
auch ein solches Zugtierpaar sich ganz eng mit einem Jungen angefreundet hatte, nur mit<br />
ihm waren sie bereit zu arbeiten. War er krank, ließen sie sich zwar vor den Wagen spannen,<br />
beim ersten Hüh liefen sie aber unabänderlich mit dem unglücklichen Kutscher bis<br />
nach Reibersdorf und zurück auf den Hof, womit die Schicht beendet war. Bei diesen<br />
Ochsen wollte ich also der befreundete unabkömmliche Junge werden. Ein verdeckter<br />
Zugang zu den Tieren war schnell gefunden und ich begann die Ochsen an mich zu gewöhnen.<br />
Die Dummheit ging nach einigen Tagen soweit, dass ich mich auf einen liegenden<br />
Ochsenfreund setzte, als der Ochse aber seinen Kopf herumschlug und das Horn neben<br />
meiner Wade seinen Körper traf, war der Verstand sofort wieder da und ich schnell vom<br />
Tier herunter und an der Wand herauf, wo das lose Brett war, und fort!<br />
36
11. Das Jahr 1949<br />
Hier will ich eingangs von Einkaufpflichten berichten. Eine ernste Sache, für welche man seit<br />
1990 jede Menge großflächige Hallen in die Gegend setzte und die Bevölkerung weitgehend<br />
mit PKW ausrüstete. Von 1945 an war das für unsere Großfamilie aber weitgehend eine<br />
Sache für einen kleine Jungen, nämlich meine. Es gab zwar damals weiterhin Lebensmittelkarten,<br />
d. h. die Fresslust war gebremst, aber es gab nur kleine Läden für viele Leute und<br />
vom Auto lediglich die unter 8. beschriebenen Sandalen unter den Füßen. Vor den Geschäften<br />
waren viele Menschen, die in Schlangen anstanden. Wer vormittags nicht an die Reihe<br />
gekommen war, der blieb über die 1 – 2-stündige Mittagszeit vor verschlossener Ladentür<br />
gleich stehen. Wenn diese dann geöffnet wurde, dann war der Druck von hinten so groß, dass<br />
ich einige Male ohne Bodenberührung in den Laden geschwommen bin, wie ich heute weiß,<br />
eine gefährliche Situation. War man glücklich mit der Ware zu hause angekommen, dann gab<br />
es die Nachaufträge, was die Frauen vergessen hatten, wobei mich Kurt Stein als mein Freund<br />
und Onkel aber unter der Hand zur Verweigerung aufforderte. Wenn uns das Schicksal schon<br />
außerhalb regulärer Schulbildung gestellt hatte und uns damit mit viel Freizeit bedachte, so<br />
war doch irgendwie klar, dass die Freizeit unter den gegebenen Umständen weitgehend in<br />
Nutzen zu verwandeln war. Eine solche Richtung hatte Brennholzbeschaffung. Zwar gab es in<br />
den Haushalten ausreichend Braunkohle, diese brannte aber sehr träge. Brauchte man<br />
plötzlich Flamme, z. B. um Teewasser zu kochen, so konnte das nur über Beifügung von Holz<br />
erreicht werden, ebenso das Anfeuern.<br />
Wir trafen uns zu diesem Zweck mit unseren Leiterwagen (vorher die Räder abgezogen<br />
und die Achsen abgeschmiert), Säge und Beil dabei und fuhren als „Karawane“ in den damals<br />
in Richtung Reibersdorf/Türchau noch vorhandenen Hartbusch. Natürlich mit viel Gaudi<br />
unterwegs, z. B. konnte Leiterwagen an Leiterwagen gebunden werden, im vordersten Wagen<br />
saß einer, der die Deichsel mit den Füßen bediente, alle anderen schoben wie die Feuerwehr<br />
und sprangen bergunter auf. Natürlich ging das fußgelenkte Berg abfahren auch mit<br />
Einzelwagen. Gegen Feierabend kamen wir dann mit Wagen voll geladen mit trockenem<br />
Brennholz auf den heimischen Hof zurück. Wie schon erwähnt, waren wir als Helfer bei den<br />
anliegenden Landwirten auch gern gesehen, z. B. wenn das Heu in die Scheune gebracht<br />
wurde, war es erwünscht, dass es zur Volumenverkleinerung „eingetreten“ wurde. Wie schon<br />
Generationen vor uns, benutzten wir die Gelegenheit von hoch liegenden Balken „einzuspringen“,<br />
und ebenso wie die vor uns hatten wir abends eine voll von Heu zerkratzte und<br />
zerstochene Haut, die sich nur mit Schmerzen reinigen ließ. Indem wir so auf den Höfen<br />
eingeführt waren, standen uns besonders bei Jan Janecki auch an den Schlechtwettertagen die<br />
Scheunen für Spring- oder Ringkampfveranstaltungen offen. Auf Janeckis Hof spielten wir<br />
auch über Jahre ausdauernd Fußball, dabei auch Herr Scholz und Onkel Kurt, also Groß und<br />
Klein in gemischten Mannschaften ausgewogen aufgeteilt.<br />
Die Auseinandersetzungen zwischen Kindern im Ort hatten etwas nachgelassen, vielleicht<br />
auch, weil die gegenseitige Bewaffnung abschreckend geworden war. Die Schottersteine<br />
waren Hochleistungs-Katapulten gewichen, die Kieselsteine zum Verschießen wurden<br />
durch Bleiecken ersetzt, die sich jeder selbst goss und vereinzelte. Wierzbicki, der sich immer<br />
sehr für Waffen interessierte, war beeindruckt, als ich eine solche Bleiecke ca. 1 cm tief im<br />
Holz des Scheunentores versenkte. Er sagte ganz begeistert, das würde auch für einen Hasen<br />
reichen, man müsste nur besser treffen können. Katapult und Bleiecken waren sozusagen eine<br />
unsichtbare, immer vorhanden Waffe in der Hosentasche. Glücklicherweise gab es keine<br />
Unfälle. Gleichermaßen einige hundert Meter weit konnte man mit Pfeil und Bogen schießen,<br />
wenn der Bogen entsprechend und der Pfeil aus trockenem Schilf mit an der Spitze eingelagertem<br />
Nagel war. Aber diese Waffe war unhandlich und auffällig, sie bleib gleichermaßen<br />
ohne Unfälle.<br />
Als ich im Erlbach den Lauf eines historischen Gewehrs fand, baute ich heimlich in<br />
Wierzbickis Scheunen-Werkstatt, aber eigentlich auf der Werkbank meines Urgroßvaters, die<br />
37
fehlenden Holzteile an und den Abzugshahn dazu, einen Riemen fand sich auch. Mit dem<br />
fertigen Gewehr auf dem Rücken spazierte ich absichtlich über Wierzbickis Hof, der heftig<br />
erschrak und mir das Gewehr abnahm, dann aber immer wohlwollender grinste und mir das<br />
Ding zurückgab. Gegenüber meinen Eltern äußerte er sich sogar begeistert.<br />
Wenn ich wusste, dass Murdel auf der Weide war, hielt ich mich gegen Abend gern in<br />
Wierzbickis Nähe auf, der erfahrungsgemäß nach des Tages Last und Müh (oder was er dafür<br />
hielt) ungern den Weg zur Weide noch anfügte. Er sah in diesem Fall dann zufällig mich und<br />
sagte in seinen breiten z-za-Buga-Dialekt: „... Aj, Pioter, geh Du“, worauf ich natürlich nur<br />
gewartet hatte. Die Weide befand ich gleich hinter der Oppelsdorfer Straße auf einem<br />
umzäumten Wiesenstück mit einem gemauerten tiefen Brunnen (von welchem meine Vorfahren<br />
wie bereits berichtet aus Holzrohren eine Wasserleitung bis zum Hofe gelegt hatten, bevor<br />
öffentliche Wasserversorgung kam), heute ist das Grundstück bebaut. Ich wollte natürlich<br />
reiten, was nicht so einfach war, denn das große Pferd war sozusagen nackt. Das „Tor“ der<br />
Weide bestand aus einem kniehohen und einem brusthohen Stacheldraht, die jeweils mit<br />
Schlaufen an Nägeln des einen Pfahls hingen. Murdel wartete schon dort, während ich zuerst<br />
den kniehohen Draht beiseite räumte. Dann drückte ich Murdel nahe an den Pfahl und<br />
kletterte auf den Kopf des Holzes, um von dort mit einem Sprung das Pferd zu erreichen, was<br />
aber selten gelang, da Murdel meist wieder einen Schritt beiseite gegangen war. Also wieder<br />
alles von vorn, bis ich dann oben saß, wobei Murdel aber nahe am Pfahl bleiben musste,<br />
damit ich mich an der Mähne festhaltend soweit herunter beugen konnte, um ebenfalls den<br />
oberen Tordraht aus seiner Schlaufe zu heben. Dann ging es stolz heimwärts, wobei das gute<br />
Pferd wahrscheinlich absichtlich im Schritt ging.<br />
Wie bereits erwähnt, wurde Jan Janecki wegen seines Festhaltens an seiner deutschen<br />
Familie aus der Region entfernt. Der Wirt nach ihm hatte auch unser befreundetes Pferd Hans<br />
(er war 44/45 als verwundetes junges Flüchtlingspferd auf dem Heidrich-Hof geblieben)<br />
übernommen. Hans war vor einen Wagen gespannt, der schwer mit Mist beladen war und den<br />
er nicht aus der Senke raus ziehen konnte. Der unbeherrschte neue Bauer hatte schon eine<br />
Holzlatte auf ihm zerschlagen, Hans sprang nur noch in die Stränge und wurde von diesen<br />
entsprechend zurückgeworfen und drohte auf den glatten Steinen der Mistsenke zu Boden zu<br />
gehen. Wir standen entsetzt dabei. Glücklicherweise war es die Zeit, wo Alfred Scholz von<br />
der Arbeit kam, den seine Jungs sofort holten. Er durfte helfen. Hans barg geradezu seinen<br />
Kopf an ihm und wurde langsam beruhigt. Dann gingen wir alle an den Wagen, ich weiß noch<br />
wie das Pferd zu uns zurückblickte und dann ruhig, kräftig und nicht nachlassend den Wagen<br />
her auszog, von Alfred Scholz geführt.<br />
In der zweiten Hälfte des Jahres erkrankte ich schwer an Gelbsucht. Ich meine zu wissen,<br />
dass ich in einer schweren Fiebernacht nahe daran war, auf die andere Seite hinüber zugehen.<br />
Bei meiner Schwäche war es für meine Genesung eine sehr große Hilfe, zu wissen, dass<br />
wieder ein deutscher Staat gegründet war. Wir waren nicht mehr staatenloses Freiwild, es<br />
konnte nur noch besser werden.<br />
In unserem Haus und drumherum wuchs in dieser Zeit immer spürbarer die Generation<br />
der 1947 geborenen heran. Hauptversammlungsraum war wie früher Großmutters Küche.<br />
Nach der Geburt meines Vetters Dieter Stein war Kora zu uns übergegangen (bei Wierzbickis<br />
blieb eine Tochter von ihr), um sich besorgt um seine Erziehung zu kümmern. In einer Zeit,<br />
wo andere Kleinkinder noch krabbeln, lief Dieter schon, indem er sich an Kora festhielt.<br />
Wenn man ihn haben wollte, musste man nach Kora rufen, die erschien dann ganz langsam<br />
aus der damals noch dichten Bepflanzung des Gartens, mit dem angekrallten Schützling. Sie<br />
war in den Folgejahren immer in der Nähe der größer und älter werdenden Spielschar zu<br />
finden, wenn einer von diesen Kumpels ein Spielzeug mitnehmen wollte, hielt sie ihn<br />
angeblich von hinten fest.<br />
Zum Ende des Jahresberichts will ich noch den wahrscheinlich für mich gefährlichsten<br />
Vorgang bringen. Es muss im Spätherbst gewesen sein, wo ich mit Wierzbicki Mist<br />
ausbringen war. Er beauftragte mich den leeren Wagen auf den Hof zurückzufahren. Es waren<br />
38
fremde Pferde vorgespannt, die zurückgegeben werden mussten. Ein solcher Mistwagen hatte<br />
bei der Leerfahrt keine Seitenbretter, alles wurde flach auf den Wagenboden gelegt. Als ich<br />
auf dem Feldweg war, ließ ich die fremden Pferde leichtsinnigerweise beschleunigt laufen,<br />
welche Fahrt mit den fremden Rössern immer schneller wurde, ich dabei frei stehend auf dem<br />
schmalen Bodenbrett, der Ackerwagen über Steine springend. Die Tiere ließen sich nicht<br />
zügeln und zur Oppelsdorfer Straße war es nicht mehr weit, gegenüber war der Straßengraben.<br />
Eine gewisse Ermattung und vorhandener Pferdeverstand und auch mein zügeln, ließ vor<br />
der Straße die Tiere wieder vernünftig werden, da war ich sehr froh.<br />
12. Das Jahr 1950<br />
Es war mein letztes Jahr nur in Reichenau und ich muss nachdenken, über was denn noch<br />
nicht berichtet wurde.<br />
Da wäre zu Jahresanfang im Winter über das Skifahren zu berichten. Noch mein Vater<br />
musste in seiner Kindheit/Jugend in Oppelsdorf nach einem alten Fass suchen, dessen Dauben<br />
mit seitlich angenagelten Riemen zu Schneeschuhen wurden.<br />
Stöcke fanden sich im Gebüsch. Da hatten wir es mit aufgefundenen Restbeständen<br />
schon besser. Weihnachten 49 war die Bescherung für mich scheinbar sehr sparsam geworden,<br />
womit ich mich schon abfinden wollte, als die Eltern mir lächelnd empfahlen, doch noch<br />
unter den Tisch zu sehen. Dort lagen ein Paar lange Skier der damaligen Spitzenklasse aus<br />
zweiter Hand. Das war ein innerer Jubel. Nicht lösbar durch meine Eltern war die Frage von<br />
Winterschuhen. Diesbezüglich versorgte ich mich immer selbst aus einem Haufen Uralt-<br />
Schuhe auf dem Hausboden von früheren Preibisch-Generationen. Gleichfalls hatte ich<br />
herausbekommen, dass Socken nicht unbedingt lebensnotwendig waren. Man konnte auch gut<br />
39<br />
Familie Scholz
mit Fußlappen leben. Noch heute beherrsche ich ganz automatisch die Handgriffe, die für das<br />
Anlegen von Fußlappen notwendig sind. In diesem Winter aber erinnere ich mich, dass ich<br />
auf dem Boden nur die Auswahl zwischen hoch hackigen hoch geschnürten Damenschuhen<br />
aus der Kaiserzeit hatte und den abgelegten Arbeitsschuhen eines Preibischs, der schon im<br />
Erwachsenenalter gewesen sein musste. Für letztere stellte ich notgedrungen die Skibindung<br />
ein. Es stellte sich heraus, dass selbst doppelte Fußlappen diese Schuhe nicht ausfüllten,<br />
weshalb ich sie im Kaninchenstall straff mit Heu ausfütterte. Anfangs ging auch alles gut, die<br />
Schwierigkeit mit den langen Skiern nahm aber zu, als das Heu in den großen Schuhen<br />
zerkrümelte, d. h. Kurvenfahren war fast immer ein stiller Versuch mit Sturz. Wir fuhren auch<br />
schon viele Jahre Schlittschuhe, diese konnten wir bei Paul Weigelt zeitweise abgeben für die<br />
Erneuerung des Schliffs, dann brauchte es nur noch guter Riemen, um die Dinger fest an die<br />
Schuhe zu binden und so ausgerüstet konnte man auf dem Eis des Husaren-Teiches Eishockey<br />
spielen, die Schläger schnitt sich jeder aus dem Gesträuch. Im Husaren-Teich, d. h. im abgesoffenen<br />
ehemaligen Bergwerk dort, hatte ich bis 50 auch Schwimmen gelernt. Alle meine<br />
Sportausübungen war in der Regel an die sehr sportliche Scholz-Familie (Vater und 3 Söhne)<br />
gebunden, die damals schon über 3 Fahrräder verfügten und Gottfried und mich auf der<br />
Querstange mitnahmen.<br />
Von links: Webmeister Walter Wildner, Chemiker Gerhard Hirsch, Johannes Scholz, Elektriker Werner<br />
Zimmermann, Webmeister Achim Schulz, Färber Max Ludwig, Webmeister Kurt Beyer, Webmeister Kurt<br />
Lachmann, meine Person.<br />
Vorn sitzend: Webmeister Kurt Stein und Jungen Gottfried Scholz, der kleine Wolfgang Wildner, Rainer<br />
Colavincenzo und andere Söhne.<br />
In diesem Jahr fanden wir uns über Mundpropaganda auch sonntags auf den Fußballplätzen<br />
in Markersdorf (nahe Colarinzezo-Gärtner) bei Bräuers Fabrik oder auf einer vereinbarten<br />
brauchbaren Wiese zusammen, um Alt- und Jung miteinander Fußball zu spielen.<br />
Gleichfalls begann in diesem Jahr die Freundschaft mit Manfred Horn/Domagalla und<br />
Klaus Joschko. Beide aus besser gestellten Arztfamilien, die schon damals jährlich ihren<br />
Seeurlaub machten, was für mich natürlich eine fremde und verzichtbare Sache war. Manfred<br />
war bis 1950 bei tschechischen Verwandten aufgewachsen und hatte dort auch die Schule<br />
besucht. Nach seine Übersiedlung nach Bogatynia besuchte er die polnische Grundschule und<br />
konnte sich sprachlich schnell umstellen. Schwieriger hatte es Klaus Joschko, der bis ca. 1949<br />
vom Großvater (Dr. vet.) geschult wurde, schnell einen hohen Wissensstand bekam, dieses<br />
40
Wissen in der polnischen Grundschule wegen Sprachschwierigkeiten aber nur schwer anwenden<br />
konnte. Er war der älteste von vier Brüdern (ein fünfter gesellte sich später noch hinzu)<br />
und stand wie seine Mutter feststellte, sozusagen früh verernstet und einsam an der Spitze,<br />
weshalb aus mütterlicher Fürsorge meine Person, die äußerlich als wohlerzogen galt, ihm als<br />
Freund zur Seite gestellt werden sollte.<br />
Diese Einschätzung wurde aber sofort, sozusagen bei meinem ersten Besuch bei<br />
Droschke, stark ausgehebelt. Ich fand in Klaus einen hoch interessierten Partner in Fragen<br />
Waffen und indem für ein Katapult die Zutaten im Umfeld augenblicklich nicht beschaffbar<br />
waren, entschlossen wir uns einen Bogen zu bauen. Klaus beschaffte sofort ein großes Messer<br />
aus der Küche, ein Fliederstrauch mit bestem zähen Holz stand nahe bei. Als wir diesen mit<br />
vereinten Kräften zu Boden gebogen hatten, Klaus mit Körpergewicht hielt und ich am Fuße<br />
den Lebensnerv sozusagen schon durchschnitten hatte, kam Frau Dr. zufällig vorbei, um sich<br />
an uns zu erfreuen. Kurzum, die mütterliche Ermahnung dieser temperamentvollen Dame<br />
hielt sich zwar in Worten, war aber so durchdringend, dass wir wie nasse Lappen verblieben.<br />
Wir wurden zwar nicht eilends wieder getrennt, aber einen Bogen haben wir nie mehr gebaut,<br />
man braucht dazu eine beruhigte Erinnerung. Für mich sprach wohl auch, dass ich mich den<br />
kampflüsternen drei Kleinbrüdern als Sparringspartner zur Verfügung stellte, d. h. ich wurde<br />
(einvernehmlich) in ein abgelegenes verdunkeltes Zimmer gebeten, wo alles was Joschko hieß<br />
mich zu Boden rang, allerdings ging der Erfolg nie soweit, dass ich dort bewegungslos wurde,<br />
auch wurde sich im Zeitlupentempo bewegt, um kleinere Kämpfer nicht zu beschädigen. So<br />
herrschte den im Hause Joschko lange Zeit ganz erstaunliche Ruhe, höchstens dass ab und zu<br />
ein Stuhl um fiel.<br />
41<br />
Dr. med. Joschko mit Söhnen Klaus und<br />
Werner
Bei Joschkos zu einem Kinder – Geburstag<br />
Viel lauter ging es zu beim Fußballspielen auf dem Hofe, auch dort rang die Joschko-<br />
Mannschaft verbissen um den Sieg. Als eine zu Besuch weilende Dame eine jugendliche<br />
Anwandlung bekam, sich einmischte und auf das Joschko-Tor schoss, stellte Klaus erbittert<br />
und für die Besucherschar hörbar klar: „.. mit krummen Beinen schießt man kein Tor!“, was<br />
solange zum Spielabbruch führte, bis er sozusagen gewaschen und gekämmt sich öffentlich<br />
entschuldigte, wobei aber alle Anwesenden das alte Siebenbürger Sprichwort kannten –<br />
„Kinder und alte Leute sagen die Wahrheit“ – und die Sache zumindest im Ansatz unterschwellig<br />
bestätigt fanden.<br />
Das Leben in Bogatynia wurde in dieser Zeit durch interessante Filme aufgewertet. Der<br />
erste bewusste Kinobesuch des Lebens, mit meiner Schwester, auf den Plätzen 96 und 97 war<br />
„Tarzan“, später folgten „Zorro“ und dann „Der Graf von Monte Christo“, auch „Wolfsblut“<br />
(von Jack London) wurde gegeben.<br />
Was die Wolfsabkömmlinge von Bogatynia, also die Hunde anbelangte, so gab es unter<br />
diesen eine große Gruppe von Freigängern, die von Hochzeit zu Hochzeit ausrückten. Wenn<br />
es bei Kora soweit war (und dazu kam noch ihre Tochter Foxine, die bei unserer Familie<br />
lebte), so waren ständig ca. 20 Freier um unser Grundstück herum, darunter auch riesengroße,<br />
die kleine Konkurrenten unwillig in den Hintern bissen und ansonsten nächtens so tief<br />
grollten, dass es klang, als belagere ein Löwenrudel unser Haus. An einem dunklen stürmischen<br />
Abend, als alle schon zur Ruhe gehen wollten, klinkte es an unserer Haustür. Von uns<br />
wurde Innen gefragt: „Wer ist denn da?“ aber Draußen herrschte Schweigen, nur die Klinke<br />
ging weiter. Großmutter schlussfolgerte, dass es verfolgte Neißegänger sein könnten, die sich<br />
nicht äußern durften und öffnete im Dunkeln die Haustür. Herein zur Tür kam würdevoll ein<br />
großer Schäferhund, der ohne sich umzusehen durch den langen Flur schritt und die Tür zur<br />
Küche öffnete, wo die heiße Braut Kora wartete. Im Kriegsrat der Männer wurde beschlossen,<br />
zur Wiedergewinnung des Heims keinen Frontalangriff zu wagen, sondern die Türen nach<br />
Außen zu öffnen und durch die Veranda mit Spießen und Stangen einzudringen. Ein diesbezügliches<br />
Handeln führte dann auch zum würdevollen Abgang des Liebespaares. Als Kurt zur<br />
Frühschicht ging, sah er im Frühnebel das Paar an der Wegkante sitzen und in die Stadt<br />
hinunter sehen, wobei Kora an die breite Brust des Geliebten anlehnte. Ansonsten ging das<br />
Leben einen ruhigen Lauf, da war es schon eine Ausnahme, wenn morgens bei Wierzbicki in<br />
der Scheune die Dreschmaschine wummernd anlief. Da ging man nebenbei nachsehen, wer<br />
wohl was machte und stellte fest, dass niemand das Stroh von der Tenne schaffte, also nahm<br />
42
man ohne Überlegung eine Gabel, um einen Moment zu helfen, bald aber kam die Ernüchterung,<br />
weil niemand Erwachsenes kam und man einmal eingereiht schlecht weggehen konnte.<br />
Da schleppte man also und schleppte und die Dreschmaschine ging bis Mittag auch nicht<br />
kaputt. Dann war noch eine Hoffnung „Die könnten mich ja zum Mittagessen mitnehmen!“,<br />
aber dann gingen alle ohne sich umzusehen ins Haus und ich musste in meine Richtung gehen,<br />
und am Nachmittag, wenn die Maschine wieder anlief, war ich wie unter Zwang wieder<br />
dabei. In dieser Zeit begann ich mir bewusst zu werden, mit was für guten Großeltern ich<br />
bedacht war und ich machte das deutlich in dem ich deren Haushalt mit Holz und Kohle<br />
versorgte. Auch sah ich im Garten, dass die hintere Bank nur noch ein Sitzbrett besaß und zu<br />
reparieren war. Eine 2-m-Bohle war schnell gefunden, den Wierzbicki hatte eine solche an<br />
den Wegrand geworfen. Als er aber nach Tagen sein Wertstück suchte, war das bereits von<br />
mir eingebaut und jemand hatte mich wegschleppen sehen. Großvater bot finanzielle Sühne<br />
oder Rückgabe an. Als wir uns aber bei der Affäre in die Augen sahen, erließ Wierzbicki<br />
alles.<br />
Damit in etwa endet mein aktiver Lebenslauf mit ihm. In späteren Jahren, als Erwachsener<br />
zu Besuch in Bogatynia, war ich auch immer bei Wierzbickis, die dann in einer Stadtwohnung<br />
wohnten. Er arbeitete als Wache (mit Gewehr!) am Sprengstofflager der Kohlegrube.<br />
Das Jahr will ich wieder mit dem Unangenehmen beschließen:<br />
− Die ca. 200 in Bogatynia und Umgebung verbliebenen Deutschen stellten eine Liste der<br />
Verdienenden auf und eine solche von alleinstehenden Alten, die keinerlei Bezüge hatten.<br />
Es kam zu einer Umlage der Verdienenden an die Bedürftigen. Es war aber noch die Zeit<br />
des Stalinismus und ehrgeizige Geheimdienstler stellten das als eine entdeckte Verschwörung<br />
der Deutschen heraus. Da waren wir alle in großer Gefahr, aber die Anwesenheit<br />
deutscher Staaten und die Intervention der Betriebsdirektoren ließen es nicht zu einer<br />
Deportation kommen, nur verhört wurde.<br />
− Gedenken will ich hier auch der vielen polnischen Kinder, die von 45 an mit Munition<br />
spielten und zerrissen oder verkrüppelt wurden. Dabei denke ich auch an einen jungen<br />
Deutschen, der ein Maschinengewehr vergrub, mit dem Kinder gespielt hatten. Das brachte<br />
ihm Jahre schweren Straflagers ein. Er wohnt heute noch in Bogatynia.<br />
− Die Brotverteilung an die Läden erfolgte in Bogatynia durch einen gedeckten Pferdewagen,<br />
mit dessen Kutscher wir befreundet waren und auf dessen Wagen wir hinten mitfahren<br />
durften. Einmal begingen wir den Fehler, hinten aufzuspringen ohne uns bei ihm gemeldet<br />
zu haben. Er dachte es wird Brot gestohlen und schlug mit der Peitsche nach hinten. Der<br />
erste Hieb traf mich auf das linke Auge und während ich noch erstarrt saß, kam der zweite<br />
Schlag auf das rechte Auge. Ich fiel mit den Händen vor dem Gesicht vom Wagen und<br />
Gottfried führte mich, dann ich sah nichts mehr. Nach ca. 15 Minuten kam aber langsam<br />
wieder das Licht auf beide Augen. Ich glaube bei der Niederschrift heute noch meine<br />
Verzweiflung bis zum ersten Lichtschimmer zu spüren. Unglück kommt eben unverhofft<br />
oft will ich meinen Enkeln sagen und man sollte alle Handlungen im Voraus gut bedenken,<br />
um ihm zu entgehen.<br />
13. Das Jahr 1951<br />
Weihnachten und Wintervergnügen wie schon beschrieben. Nachzutragen wäre noch das vor<br />
allem winterliche Basteln mir Märklin- und Stabilbaukästen. Teils ererbt, teils in emsiger<br />
Suche auf Schutthalden gefunden und mit Drahtbürste und Farbe wieder aufbereitet, bauten<br />
wir mit diesem Material auf tischgroßen Holzplatten eine durchgehende Transmissionswelle<br />
auf, setzten einen E-Motor oder eine Dampfmaschine als Antrieb an diese und links und<br />
rechts angetriebene selbst gebaute Maschinen aller Art. Auf gleicher Material-Basis auch<br />
lenk- und bremsbare LKWs und Anhänger.<br />
Vor Ostern in diesem Jahr bekam unser Vater einen Hinweis, dass sein Elternhaus in Bad<br />
Oppelsdorf am Ende der Villenstraße leer stehe. Beim Osterspaziergang mit der befreundeten<br />
43
Familie Reimer (er aus Siebenbürgen, sie Tochter vom Zückert-Schneider) wurde uns das<br />
bestätigt. Erinnerlich ist mir auch, dass wir in Donaths Bierstuben einkehren konnten. Nach<br />
eingehender familiärer Aussprache entschieden sich die Eltern wegen des Hauses in der<br />
Gemeindeverwaltung vorzusprechen. Dort trafen sie auf den Bürgermeister Szymków und auf<br />
Frau Jagodzinska. Letztere, eine gut Deutsch sprechende Südpolin (aus dem ehemaligen<br />
Österreich) mit entsprechend freundlichem Wesen, setzte sich sehr für die neue Nachbarschaft<br />
ein, denn sie wohnte auch auf der Villenstraße, im Haus welches bis 1945 die Familie Bernert<br />
gemietet hatte (aus welcher meine Frau Karin stammt). Wir konnten also das Haus mieten<br />
und im Vertrag ist erstaunlicherweise das Haus als Eigentum, über welches zur Zeit nicht<br />
verfügt werden kann, vermerkt. So konnten wir denn das Grundstück betreten. Von Außen<br />
gesehen links vom Gartentor nahe am Zaun waren damals noch die Gräber von Mutter und<br />
Tochter Hartdorf zu sehen, unseren Mietern, die 1945 den Freitod gewählt hatten und u. a.<br />
von meiner Schwiegermutter mit geborgen wurden. Aber davon wussten wir damals nichts.<br />
Das Haus selbst war abgewohnt, der Fußboden teilweise brüchig, vom Mobiliar nichts mehr<br />
vorhanden, auf dem Hofe Unordnung. Für die Instandsetzung hatten wir im Grunde keine<br />
Geld. Von BZPB, dem Arbeitgeber meines Vaters, gab es aber eine Unterstützungserklärung<br />
und unter den restlichen Deutschen gab es viel nachbarliche Solidarität, d. h. nur die Schnitten<br />
und den Tee für das Abendbrot boten wir für Arbeit. Dabei für mich immer wieder erinnerlich<br />
Alfred Scholz, der Mann mit den goldenen Händen, bei dem ich in dieser Zeit viele handwerkliche<br />
Praktiken zum ersten Mal sah. Seine größeren Jungs waren von Fall zu Fall auch<br />
anwesend. Zuletzt der Reichenauer Zimmermann Maler und dann sind wir irgendwann im<br />
Frühsommer eingezogen.<br />
Wir waren aber nicht die einzigen Deutschen, denn in Wald war das alte Ehepaar August<br />
Scholze nicht ausgesiedelt worden. In dem Schwester Else, die Diakonissin war, in der<br />
Friedehofskapelle regelmäßig sonntäglichen Gottesdienst hielt, konnten versprengte Deutsche<br />
dort mit den anderen Kontakt aufnehmen und halten. So auch August Scholze, der nach dem<br />
Tode seiner Frau Betreuung vor Ort durch die Schwestern Else und Margarete erhielt, in die<br />
deutsche Rentenumlage einbezogen wurde und sonntags von Familie zu Familie zum Essen<br />
ging. So war er uns auch schon von früher bekannt. Unser Nachbar war der Bürgermeister<br />
Szymków, dessen Frau gut deutsch sprach, da sie in einer deutschen Familie dienstverpflichtet<br />
war, aber ohne Groll, denn sie wurde freundlich behandelt. Sie hatte bald engen Kontakt<br />
zu meiner Mutter. Ihre zwei Söhne waren zwar jünger als meine Schwester, konnten aber<br />
noch ins Spiel einbezogen werden. Bald waren wir auch mit Dr. Jarmata und Familie bekannt,<br />
sowie mit Familie Kaminski (aus Litauen) mit den Söhnen Rajmund, Richard und Stanislaus.<br />
Ganz glücklich waren meine Eltern über die Reaktion des Schulleiters Nadachowski, der auf<br />
Deutsch gesagt hatte: „Diese Kinder sofort in die Schule!“.<br />
So ging ich denn mit 12 Jahren Anfang September erstmalig in die Schule, mit meiner<br />
Schwester in die 3. Klasse. Die Sache drückte mir gewaltig auf die Psyche, besonders wenn<br />
wir in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Aller Blicke sah ich dann auf mich gerichtet, da<br />
ich inmitten der Kleinen als notorischer Sitzenbleiber erscheinen musste. Dazu kamen noch<br />
die Jarmata-Zwillinge Clara und Dangola, zwei sehr hübsche Mädchen, mit denen wir im<br />
Ansatz schon bekannt geworden waren, die vom Äußeren wie aus einer anderen Welt kamen<br />
und die auch in den Pausen 2 Klassen über mir Zurückgeblieben eingeordnet waren, da durfte<br />
ich mir wirklich kein Hoffnungen machen. Trotzdem beschloss ich wenigstens von Ferne eine<br />
zu verehren, praktischerweise die mit den deutschen Rufnamen Clara, als ich sie aber übers<br />
Jahr besser auseinander halten konnte, merkte ich , dass es Dangola war. Den Bruder der<br />
beiden, der ca. 5 Jahre älter war, ein Fahrrad mit Tretlager-Gangschaltung fuhr und im Bad<br />
vom 10-m-Turm Kopfsprung machte, habe ich mir nie getraut anzusprechen.<br />
Im Oppelsdorfer Bad sah ich in diesem Jahr auch ein wunderschönes junges deutsches<br />
Ehepaar, scheinbar Lichtjahre von uns armen Häuslerleuten entfernt, die ich mir als<br />
Erscheinung einprägte, weil es mir nicht vorstellbar war, dass sie als Siegfried und Margot<br />
Domagalla jeweils in mein Leben treten würden.<br />
44
Im Schulunterricht ergab sich erst einmal eine kritische Phase, da die Lehrerin für mich<br />
wie aus sprachlichem Nebel agierte. Dieser Nebel lichtet sich aber von Monat zu Monat mehr,<br />
dabei war unsere Klassenlehrerin Frau Nadachowska eine sehr angenehme Frau, die ich zu<br />
verehren begann und der gegenüber ich niemals Versagen wollte. So kam es, dass ich vor<br />
Weihnachten das beste Diktat schrieb und ganz unvorhergesehen zum Halbjahr schon in die<br />
vierte Klasse versetzt wurde, für mich wahrlich ein Riesengeschenk. Indem wir jetzt zur<br />
Schule gingen, gibt es von diesem Jahr weniger Ereignisse als früher zu berichten. Natürlich<br />
waren wir weiterhin mit Reichenau verzahnt, die Großeltern und Steins waren bei uns und wir<br />
bei ihnen. Von Bogatynia hatten wir 2 mittelgroße Hündinnen mitgebracht, die schlaue Kora-<br />
Tochter Foxine (sie sah immer wie ein junger Schäferhund aus) und Thedda. Letztere fand<br />
sich in unserem Reichenauer Kaninchenstall und als ich den für mich fremden Hund mit dem<br />
Besen vertreiben wollte, brach sie vor Angst uns Schwäche zusammen. Mit so nachgewiesener<br />
Bedürftigkeit durfte sie bleiben und schloss sich uns glücklich an.<br />
Da in Oppelsdorf nur zum Nachbarn und zur Straße Zaun stand, hatte ich Veranlassung<br />
dort häufig vom Hause einen mittelgroßen kräftigen Hund zu vertreiben, der aber immer<br />
wieder erschien. Als ich an einem Winterabend die Haustür öffnete, lag er vor dieser und<br />
konnte nicht flüchten, denn er war am Abstreicher angefroren. Vater und ich trugen ihn<br />
vorsichtig, denn er konnte ja bissig sein, mit dem Abstreicher in die Wohnküche. Wir konnten<br />
aber unbesorgt sein, denn Tarzan, so wurde er genannt, war die Gutmütigkeit in Person und<br />
wir trugen einen Vertriebenen zurück in sein Paradies, denn er war (wie wir später erfuhren)<br />
im Hause groß geworden und später zu anderen Leuten gekommen, die ohne ihn weg zogen.<br />
Vom Jahresende habe ich die Erinnerung, dass wir am Kretscham auf den Autobus nach<br />
Bogatynia warteten, es war Frost und kein Schnee und ich hatte mein Weihnachtsgeschenk,<br />
einen Fußball, zum Spielen bei mir.<br />
14. Das Jahr 1952<br />
Es begann wie immer mit Wintersport, aber jetzt am anderen Ort mit teilweise neuen Teilnehmern.<br />
Der andere Ort war Leupolts Berg, der damals nur auf seiner Kappe bewaldet war, ganz<br />
vorn zu Oppelsdorf mit einer uralten halb verbrannten Linde als Aussichtspunkt mit Bänken.<br />
Der heutige Wald am Hang zur Straße war damals noch eine Viehweide, aber diese oberhalb<br />
des Schnees schon braun von Birkenschwuppen bis 1 m hoch, welche in Begriff waren, die<br />
Weide in Besitz zu nehmen. Als Mutprobe habe ich eine Schussfahrt durch diesen Bewuchs,<br />
der mir grade noch erträglich gegen die Beine schlug, gemacht. Heute steht dort Hochwald.<br />
Schon zu meines Vaters Zeiten war Leupolts Berg ein Abenteuerplatz der Oppelsdorfer<br />
Jungen, welcher Platz aber zeitweise von den Lichtenberger Jungen angegriffen wurde (die<br />
ihre scharfen Hofhunde mitbrachten) und verteidigt werden musste (alles unter der Hand<br />
abgesprochen). In Bezug auf die Übermacht der kräftigen Lichtenberger Bauernjungen und<br />
deren schlimme Hunde, konnte nur donnernde Abschreckung helfen, weshalb ein Oppelsdorfer<br />
eine historische Reiterpistole seines Vaters von der Wand nahm, (die wollte er bis Feierabend<br />
wieder hin hängen) welche im Geäst der Linde angebunden wurde, mit einer langen<br />
Drachenschnur am Abzug. Damit es richtig donnert, schüttete man doppelt Schwarzpulver auf<br />
die Pfanne. Als die Lichtenberger nahe genug heran waren, zog man aus der Ferne ab und es<br />
gab einen Donnerschlag, der weithin widerhallte. Die bösen Hunde liefen in Voraus Richtung<br />
Lichtenberg, die Besitzer hinterher. Der Sieg war also vollkommen und man rollte die<br />
Abzugsschnur ein bis zur Pistole, von der fand sich aber nur noch der Kolben am Fuße der<br />
Linde und mein späterer Vater musste der Auseinandersetzung mit seinem Vater einsam<br />
entgegen gehen.<br />
Bald waren wir nicht mehr der neueste Zuzug in Oppelsdorf, denn aus Südostpolen, wohl<br />
wegen einer Grenzänderung wegen Erdöl dort, kamen die Bauernfamilien der Brüder<br />
Legażynski ins Dorf. Einer wurde auf Donaths Gut nahe der Kirche gesetzt, der andere auf<br />
Robert Flaschners Hof, der schon einige Zeit leer stand (von dort auch unser Hund Tarzan).<br />
45
Zum Hof und den Personen dort hatten wir schon immer ein enges Verhältnis (Robert<br />
Flaschner war meines Vaters guter Freund, ich und auch meine spätere Frau Karin waren bis<br />
45 dort Milch holen.) und rasch waren wir mit den neuen Wirten (dort auch die Söhne Franek<br />
und Józek im Alter meiner Schwester) gut bekannt geworden. Es war schnell zu sehen, dass<br />
die Legażynskis ordentliche und tüchtige Bauern darstellten und dass sie als Spätumsiedler<br />
nicht auf Rosen gebettet wurden, da die Höfe 1952 nach Leerständen nur sehr spärlich ausgerüstet<br />
standen und irgendeine Unterstützung wird es wohl nicht gegeben haben. Als Milchkunde<br />
habe ich diesen schweren Anfang der Familie wahrgenommen. Zu Legażynskis hatten<br />
wir schnell ein sehr gutes nachbarschaftliches Verhältnis, auch stellte man fest, dass man in<br />
der Vorgeneration gemeinsam unter Österreich war, besonders verunsicherte unglückliche<br />
Umsiedler sind ja dankbar für jedes gute Wort und für jede entdeckte Gemeinsamkeit in der<br />
neuen fremden Heimat. Erinnerlich sind mir die Schwierigkeiten, die der Bauer aus Südostpolen<br />
anfangs mit unserem schweren lehmigen Boden hatte. Der bei uns anliegende ca. 1 ha<br />
große Acker war etwas zu tief umgeackert worden und oben lagen harte ausgetrocknete<br />
Lehmschollen, von der Egge kaum zu zerstören. Legażynski ging breitbeinig die Furchen<br />
entlang und der hagere große Mann zertrümmerte in tagelanger Arbeit mit einem langstieligen<br />
schweren Hammer mit gewaltigen Schlägen die Lehmbatzen. Sein offener Kittel flatterte im<br />
Herbstwind. Das war ein Pole, wie wir einen solchen noch nicht kennen gelernt hatten, da<br />
kämpfte ein Mann um eine gute Ernte, um seine Familie durchzubringen (ein kleines Mädchen<br />
war noch dazugekommen).<br />
Im Frühjahr ergab sich in meinem inneren Leben ein Wendepunkt. Ich saß allein im<br />
Garten auf einem Holzstapel und sah über alles darüber hin. Langsam stieg in mir ein tiefes<br />
Glücksgefühl hoch, ganz unbeschreiblich. Plakativ vergleichbar, als wenn die Sonne aus<br />
dunklen Wolken über die Landschaft scheint, nur dass dieses Gefühl bis zur letzten Stunde in<br />
Oppelsdorf bei mir blieb. Ich ging also durch Haus und Garten und sah, was alles zu machen<br />
war und war froh darüber. Natürlich blieb ich auch ein 12-jähriger Junge und baute auf die<br />
Zweige des großen Ahornbaumes eine Hütte, an dem waagerechten Ast eines hohen Baumes<br />
in der anderen Gartenecke zum Feld eine Schaukel, aber ich sortierte auch auf dem Hof das<br />
Holz in brauchbar und in Feuerholz. Wir hatten ein weißes Zieg-Zickel eingestallt und ca. 6<br />
Hühner. Der Mist wurde gesammelt und kam im Herbst auf drei ca. 20 m² Gartenflächen, die<br />
ich umgrub. Im Spätherbst wurden für die heranwachsende Ziege viele Säcke mit Laub gesammelt<br />
als Einstreu. Ein Stadel mit Heu wurde auch angelegt.<br />
Die deutsche Gemeinschaft hatte sich immer mehr gefunden und gestaltete am Wachberge<br />
in Markersdorf ein Sommerfest. Bei der geringen Zahl der Deutschen und deren Verstreutheit<br />
ging das natürlich nur, wenn ca. jeder Zweite an Vorbereitung und Durchführung<br />
teilnahm, es war also ein großer Anlauf erforderlich. Für uns Kriegs-/Nachkriegskinder war<br />
dieses Fest wie ein Wunder. In der oberen Ecke des großen Gartens spielte eine deutsche<br />
Kapelle, dabei die Webmeister Wildner und Stein sowie der technische Zeichner Galenski. Es<br />
gab betreute Spiele für Kinder wie Sackhüpfen, Reifenwerfen u. a. An einer Kletterstange<br />
oben hingen Preise. An einem hohen Mast war ein stolzer Adler aus Sperrholz angebracht.<br />
Geschossen wurde unter Aufsicht mit uralten Armbrüsten, die mit Hebel von zwei Männern<br />
gespannt wurden und den mindestens 40 m entfernten stolzen Adler immer mehr Federn<br />
nahmen. Ich durfte auch schießen und habe den Vogel empfindlich getroffen (man konnte ja<br />
seit Jahren Pfeile gut berechnen). Laduschek, Vater und Sohn, spielten Szenen aus dem<br />
Volksleben, Essen und Trinken gab es reichlich. Es war ein gelungenes Heimatfest geworden,<br />
die Rest-Reichenauer hatten den Kindern und sich ein Stück gute Erinnerung vorgeführt.<br />
46
Erntedankfest in der Evang Friedhofskappelle<br />
Frau Joschko, Fam. Rudolf Fischer, Siegfried Domagalla, mit Ehefrau; meine Eltern<br />
Viel für den Zusammenhalt der Reichenauer bewirkten die sonntäglichen Gottesdienste,<br />
die von Schwester Else in der evangelischen Friedhofskapelle abgehalten wurden. Auch hier<br />
stand das alte Reichenau scheinbar wieder auf, es wurde nur Deutsch gesprochen, man traf<br />
viele Bekannte, hörte Neuigkeiten, traf Verabredungen. Zum Erntedank war die Kapelle<br />
wunderbar geschmückt. Wo wir auch hingestellt waren, von den Rest-Reichenauern gab sich<br />
jeder Mühe, dass Nichts schlechter ausfalle als früher, der Umgang miteinander war wohl<br />
auch herzlicher.<br />
47
Eine andere Form des Zusammenfindens waren sozusagen die Führung eines Salons bei<br />
Frau Dr. Joschko, wo empfohlene Ehepaare auf dauerhafte Gesellschaftsfähigkeit geprüft<br />
wurden und dabei sich auch gegenseitig kennen lernten.<br />
Wir hatten dabei den Bonus einer landschaftlich schönen Außenstelle und es war für<br />
mich wie ein Wunder, dass das junge schöne Paar Siegfried und Margot Domagalla (bekannt<br />
aus dem Schwimmbad) zu uns zu Besuch kam, ebenfalls Rudolf Fischer mit seiner blonden<br />
Frau Jenny, natürlich auch Joschkos. Siegfried Domagalla gehörte als Flugzeug-Ingenieur zur<br />
deutschen Olympiamannschaft Schwimmen und war als Flieger im Einsatz, zuletzt als<br />
Nachtjäger. Rudolf besaß einen tschechischen Pass, hatte den Wehrdienst abgelehnt und war<br />
ins KZ Buchenwald gekommen. Er war in einem Alter, wahrscheinlich in einer Schulklasse,<br />
mit meinem Onkel Kurt Preibisch, dessen Weg ich bereits beschrieben habe. Auch Rudolf<br />
kam schwer beschädigt aus deiner Haft zurück. Krieg ist wie das Aufstoßen der Tore zur<br />
Hölle, die jungen Männer können dann nur zwischen Teufel und Beelzebub wählen. Ich<br />
glaube auch nicht, dass man sich gegenseitig die Vergangenheit vorgeworfen hat, man sah<br />
wohl mehr ein gemeinsames Unglück, welches über alle gekommen war. Auch fand man sich<br />
als Fortsetzung des Unglücks im Stalinismus wieder und in einer ethnisch zerstörten Landschaft.<br />
Mein Vater war im konservativen Jung-Stahlhelm-Verein Mitglied, welche Organisation<br />
dann in die SA (Sturm-Abteilung) Hitlers überführt wurde. Die Führung der SA strebte<br />
aber 1934 einen Aufstand gegen Hitler an, da er die Großindustrie nicht verstaatlicht hatte.<br />
Das führte dann zur Erschießung der SA-Führung durch die SS (Schutzstaffel), wobei die SA<br />
dann als zweitrangige Massenorganisation verblieb. Als 1938 allen SA-Mitgliedern strengstens<br />
verboten wurde, sich auf die böhmische Seite zu begeben, hielt sich Vater nicht daran<br />
und besuchte die Großeltern in Haindorf und wurde aus der SA entfernt.<br />
Rudolf Fischer, Siegfried Domagalla und mein Vater.<br />
Flasche halbvoll.<br />
Im neuen Schuljahr, in der 5. Klasse angekommen, machte unsere Schule einen Ausflug<br />
in den Schafbusch, um Pilze und Beeren zu suchen. Dabei kamen wir dem umgeeggten<br />
Grenzstreifen sehr nahe. Einig liefen darauf entlang. Ein Bengel mit großen Schuhen ein<br />
Stück hinein, usw. Am Nachmittag desselben Tages war Gottfried Scholz und Rainer<br />
Colavinzenzo (Sohn des Gärtners aus Markersdorf) zu Besuch bei mir und wir gingen<br />
Richtung Sommerau, als auf der Reibersdorfer Straße ein LKW mit Soldaten in Oppelsdorf<br />
48
einfuhren, wir dachten ein Manöver. Es war aber alles viel schlimmer, denn lt. militärischem<br />
Grenz-Frontbericht war eine starke Bande, Männer, Frauen und Kinder an der Grenze gewesen<br />
und sollte im Raum Oppelsdorf aufgespürt werden. Der Fährtenhund ging durch den Ort<br />
und hielt Frank Legażynski am Bein fest. So kam durch so ein Tier mit überlegenen<br />
Fähigkeiten alles heraus. Schlimm an diesem Tage für unsere Lehrer, schlimm am Folgetag<br />
auch für uns. Trotzdem wurde ich am Jahresende vorgezogen in Klasse 6 versetzt.<br />
Im September verstarb Großvater Edwin Preibisch in Reichenau. Er war schon einige<br />
Jahre Rentner des polnischen Staates und hatte uns oft mit Kora und Enkel Frank Dieter Stein<br />
in Oppelsdorf besucht. Eingangs bei der Niederschrift dieser <strong>Erinnerungen</strong> dachte ich, dass er<br />
dabei die zentrale Person werden würde. Aber es gibt nicht viel zu berichten, wenn einer still,<br />
gütig und klug nur immer anwesend ist. Großmutter bestand darauf, dass der Trauerzug, wie<br />
früher Brauch, auf der Hauptstraße durch den Ort gehen sollte. Großvater wurde auf dem<br />
jetzigen evangelischen Friedhof beigesetzt. Als ich nach Oppelsdorf zurückging, kämpfte ich<br />
gegen einen gewaltigen Herbststurm an. In meiner Trauer wurde mir bewusst, dass wir<br />
Menschen schwach und den Gewalten und der Zeit ausgeliefert sind. Die Verstorbenen<br />
bleiben aber bei uns solange wir Ihrer gedenken, es ist wirklich so, dass die Liebe über allen<br />
Gewalten steht.<br />
In Oppelsdorf arbeitete ich weiter an der Aufrüstung meines Hofes. Als ich im Geiersgraben<br />
eine mindestens 60 cm dicke Holzrolle fand, wollte ich diese als Hackklotz haben. Ich<br />
holte mein Beil und gängelte die Rolle dann mit Fußtritten die ca. 2 km bis nach Hause, die<br />
Feldwege entlang, wobei man aller ca. 3 m mit dem Beil wieder die Richtung korrigieren<br />
musste. Nach dieser Anstrengung gab es aber in der Gartenecke unter dem großen Ahorn<br />
einen einmaligen Hackplatz mit riesigem Hackklotz, den Großteil des Grundstückes hatte ich<br />
bei der Arbeit vor Augen und wenn es plötzlich regnete, kamen die Tropfen nicht gleich<br />
durch das Blätterdach, sondern es rauschte nur über mir. Aus Derbstangen wurde zur Komplettierung<br />
noch ein großer Sägebock gebaut. Zum Sägen war eine Schrotsäge vorhanden, d. h.<br />
eine ca. 1,30 m lange Handsäge ohne Bügel, eigentlich für 2 Mann, aber wer das Geschick<br />
und die Kraft hatte, brachte es auch solo.<br />
Im Geiersgraben, gegenüber dem Waldfriedhof, befand sich ehemals eine Fasanerie, die<br />
damals schon Ruine war. Von der Umzäunung grub ich zwei Betonsäulen aus, 2,50 m lang,<br />
die ich unter größter Anstrengung allein auf den Handwagen = Leiterwägelchen geladen habe,<br />
also eine Last von mindestens 0,25 t, die Waldhöhe herunter und nach Hause bugsiert, als<br />
Reck und zum Teppich klopfen dort wieder eingegraben habe. Die steile Waldrampe hinunter<br />
hing ich einen Tannenwipfel als Schleppe an den Leiterwagen, sonst wäre die Sache nicht zu<br />
halten gewesen. Unserem Grundstück direkt gegenüber im Park befanden sich aus deutscher<br />
Zeit noch ausgehobene mannstiefe Splitterschutzgräben, die von der neuen Bevölkerung mit<br />
Schutt verfüllt wurden, eine Fundgrube für mich. Von dort konnten wir unseren Garten mit<br />
Metall-Klappstühlen und –Tischen ausrüsten, nur die Bretter mussten erneuert werden und<br />
dazu fand sich dort auch altes Material. Im unteren Park fand ich eine leere hölzerne<br />
Heringstonne. Brauchbar, um eine Hundehütte für einen mittleren Hund herzustellen. Die<br />
Frontseite war neu zu verbrettern und den Eingang hielt ich absichtlich ganz eng, damit nicht<br />
zuviel Wärme entweicht. Das Ding war schnell fertig und auf vier Feldsteine gesetzt, den<br />
Boden mit einem Stück alter Matratze ausgelegt. Die Hundehütte mit Blick auf den Hauptteil<br />
des Gartens wurde begeistert angenommen. Bald war zu sehen, dass sogar beide Hündinnen,<br />
Foxine und Tedda, darinnen Platz fanden. Als strenger Frost kam verschwand der dickfellige<br />
Tarzan gleichfalls innen und ebenfalls und gleichzeitig unsere 3 Katzen. Es herrschte wohlige<br />
Ruhe in der Hütte, nur leises Schnarchen und Schnurren war zu hören. Die Idylle wurde<br />
gestört, wenn zum Fressen gerufen wurde, dann vibrierte das Hunde-Katzen-Heim erst, dann<br />
erschien im engen Schlupfloch ein Hunde- und ein Katzenkopf, die Katze zog sich mit einem<br />
Aufschrei zurück und der erste Hund sprang heraus, dann die Katze usw. usw. Kurze Zeit<br />
später lag die ganze Bande wieder in der Tonne, Heuschuppen und Stall wurden so nicht<br />
angenommen.<br />
49
15. Das Jahr 1953<br />
Das neue Jahr begann also schulisch sehr glücklich für mich, denn ich war altersmäßig unter<br />
Meinesgleichen angekommen, dabei scheinbar auch endlich vereint in einer Klasse mit den<br />
Jarmata-Zwillingen, mit der Möglichkeit, mich in die Nähe von Dangola zu setzen. Aber das<br />
Schicksal oder die Eltern wollten, dass ab Neujahr die Töchter nach Bogatynia zur Schule<br />
gingen. Ich war mit der vorgezogenen Versetzung in der Ausbildung unter die Fittiche von<br />
Herrn Nadachowski gekommen, der die beiden letzten Klassen betreute, denn die<br />
Volksschule endete in dieser Nachkriegszeit mit der 7. Klasse. Wenn ich an diesen meinen<br />
Lehrer denke, wird mir das Herz warm. Wir waren trotz des Einzugsgebietes von Oppelsdorf,<br />
Sommerau und Lichtenberg nur 7 – 8 Schüler und es war ein sehr intensives Lernen möglich.<br />
Zumindest ich habe diesen Lehrer immer als einen älteren Freund empfunden, der mich an<br />
seinem Wissen teilhaben lässt. Ansonsten hatte uns der Winter im Griff und der gutmütige<br />
Tarzan mit seinem dicken Fell lag im Hofe auf der Seite und unsere 4 Hühner standen auf ihm<br />
und wärmten sich die Füße. Wenn zum Fressen gerufen wurde, erschien er nicht (unsere<br />
Hunde hatten es durchaus knapp) und schlug nur mit dem Schwanz auf den Schnee, denn er<br />
wurde gebraucht.<br />
Indem ich von Schlittenhunden und Skijöring gelesen hatte, schärfte sich mein Blick auf<br />
die Hundebande und ich schnitt aus einem alten Sofa auf der Schutthalde die unterseitigen<br />
Bänder heraus, für Hundegeschirre. Diese waren schnell gemacht und so jagte ich denn<br />
abends auf Skiern, die Milchkanne in der Hand, mit Hundesaus durch den Ort. Der Leithund<br />
war ohne Zweifel Foxine, in Verstand und Ehrgeiz den anderen weit überlegen, äußerlich<br />
lebenslang wie ein junger Schäferhund anzusehen. Tedda hatte soviel Verstand, dass sie sich<br />
nicht ohne Grund in die Stränge warf, sie lief also nur locker mit. Tarzan wäre bestimmt ein<br />
guter Zughund gewesen, wenn er jemals begriffen hätte, was man von ihm wollte. Alle drei<br />
waren aber in heißer Liebe zu meiner Mutter entbrannt, diese war ihr Lebensmittelpunkt und<br />
alle geschilderten Zugschwächen waren aufgehoben, wenn sie meiner Mutter nachlaufen<br />
konnten, z. B. nach Reichenau. In dem Falle konnte ich auf den Schlitten oder Leiterwagen<br />
aufladen, was ich wollte, meine Schwester kutschierte und die Meute stob davon, um Frauchen<br />
einzuholen. Foxine war beim Leiterwagen vor den Quergriff der Deichsel gespannt,<br />
denn sie reagierte auf leisen Seilzug nach links oder rechts, verstand auch „Halt“ und „Lauf“.<br />
Links und rechts der Deichsel liefen Tedda und Tarzan.<br />
In diesem Frühjahr stand ich vor ca. 60 m² Gartenfläche, die schon im Herbst mit Mist<br />
versehen, erstmalig umgegraben worden war und jetzt mit dem Handkultivator nur gelockert<br />
zu werden brauchte, um dann mit dem Eisenrechen die ca. 1 m breiten Beete anzulegen. Das<br />
Pflanzen war Sache meiner Mutter und ich war froh, das alles mit ihr gemeinsam tun zu<br />
können.<br />
Unsere Jungziege war ausgewachsen und hatte spitze Hörner bekommen, die sie auch<br />
gern einsetzte. Indem sie jetzt selbst Mutter geworden war, wurde es Zeit, sie zu melken.<br />
Diesbezügliche Versuche sich ihrem Euter zu nähern, wertete das verzogene Ding aber als<br />
unzulässige Annäherung. Meine Mutter gab schließlich auf und so kam die Reihe an mich.<br />
Ich schloss die Stalltür, sie drohte mit den Hörnern. Nach einiger Zeit des Kampfes war der<br />
Entstand so, dass sie aufrecht in der Ecke stand, von meiner Schulter hinein gedrückt, den<br />
Kopf hilflos oben, nur mit den Vorderläufen konnte sie auf meinen Rücken klopfen, unten<br />
aber hatte ich beide Hände frei zum Melken. Sie gab zwar nicht viel Milch, aber es war sehr<br />
gute, die Herkunft im Geschmack nicht anzumerken und bei der täglichen Gabe von ca. 2 l<br />
war eine Überschuss, aus dem man mittels eines Leinensäckchens wunderbaren Quark machen<br />
konnte, so fettig, dass Butter nicht dazu sein musste, mit Salz, Zwiebeln und Kräutern<br />
zur Vollendung gebracht. Später habe ich erfahren, dass es im unweiten Oderwitz den ersten<br />
Ziegenzüchter-Verein Deutschlands gegeben hat. Ein Professor auf der Grünen Woche in<br />
Berlin stellte unlängst klar, dass um 1900, als die TBC als unheilbare Krankheit grassierte, die<br />
ärmere Landbevölkerung verhältnismäßig geringe Verluste hatte, geschützt durch die gehalt-<br />
50
volle Milch der eingestallten Ziegen, sonst hätte es eine flächendeckende Katastrophe<br />
gegeben. Aber so ein nützliches Tier verlangt auch gewisse Vorkehrungen. Meine Eltern<br />
pachteten, wie es zu der Zeit in Oppelsdorf üblich war, eine Parzelle, dabei ½ Morgen Acker<br />
und ½ Morgen Wiese mit Obstbäumen, d. h. in der Summe 0,33 ha = 3.333 m². Der Acker<br />
war für Kartoffeln und Futterrüben vorgesehen, das Gras der Wiese musste zu Winterheu für<br />
die Ziege werden. So ging ich denn in den Sommerferien, wie Herr Jagodzinski mir geraten<br />
hatte, schon Vier Uhr früh mit der Sense zum Hauen, wahrlich ein Erlebnis , wenn man sich<br />
überwunden hat. Es ist still und kühl, alles ist sehr friedlich und man schafft viel. Die Sense<br />
muss man aber am Abend vorher schon dengeln, sonst hat man keine Freude an der Sache.<br />
Das Heu wiederum verlangte einen Schuppen, der aber schon im Frühjahr errichtet wurde.<br />
Gleichfalls hatte ich am ersten Morgen der Sommerferien begonnen aus Eisenrädern eines<br />
Pfluges einen hoch belastbaren einachsigen Wagen zu bauen, mit einer langen Deichsel. Der<br />
war gut für die Transporte vom und zum Feld und zum Holz holen aus dem Wald.<br />
Ich will hier gleich bekennen, dass ich zu einem schlimmen Holzräuber geworden war,<br />
immer in Angst vor dem Förster, den wir ansonsten aber gut kannten. Im Walde (immer im<br />
Geyersgraben Richtung Sommerau) suchte ich mit einem Rest Gewissen eine Stelle, wo die<br />
Fichten eng gewachsen waren und dann war so ein 20- cm – Stamm im Nu umgelegt, in 1,5 –<br />
2 m lange Stücke geschnitten und aufgeladen, obenauf altes Reisig und die Schnittstellen mit<br />
Erde geschwärzt, auch den Baumstumpf. Der Förster hat mich nie erwischt, aber in Form<br />
schwerer Gewitter gab es durchaus Ermahnung von oben. Da hastete man mit schlechtem<br />
Gewissen und schwer beladenem Wagen dem rettenden Hofe zu und hoffte auf guten<br />
Ausgang, aber das Gewitter kreiste einen ein und schickte 300 m im Voraus einen Blitz in den<br />
Acker, wo der nächste im ebenen Gelände einschlagen würde, konnte man sich ausrechnen<br />
und um die Sache nicht auf die Spitze zu treiben, ließ man wenigstens das scharfe Beil aus der<br />
Hand fallen. Nachdem der nächste Blitz viel weiter hinten einschlug, wurde es wieder geholt.<br />
Im Mai siedelten meine Scholz-Freunde nach Deutschland aus. Materiell stand die<br />
Familie mit ihrem Fleiß zeitbezogen immer gut da. Hans arbeitete inzwischen bei BZPB als<br />
Maurer-Anlernling, Klaus lernte bei der selben Firma Elektriker unter der Obhut von Vater<br />
und Sohn Zimmermann. Bei beiden älteren Scholz-Brüdern hatte sich aber der Vorteil<br />
gehabter deutscher Schulbildung in den Nachteil des Ausschlusses wegen Alters von einem<br />
polnischen Bildungsweg ergeben, d. h. die theoretischen Berufsabschlüsse waren bei beiden<br />
fast nicht vorstellbar. Einige junge Deutsche konnten diese Hürde noch nehmen, wenn es der<br />
Zufall wollte, dass sie eine polnische Partnerin fanden.<br />
51
Gemischte D / P Mannschaft Stehend 2. von links Gotfried Scholz, 3. Horst Lindner, 5. Klaus Scholz,<br />
vorn liegend Hans Scholz.<br />
Gottfried, in meinem Alter, war ganz abgeschlagen, denn in Bogatynia hätte er (vergl.<br />
Kapitel 10) vielleicht aus Gnade später eine Aufnahme in eine untere Klasse gefunden, aber<br />
wahrscheinlich keine freundliche Förderung wie ich in Opolno Zdrój und somit die<br />
Grundschule erst als Erwachsener verlassen. Aus diesen Gründen bemühte sich Herr Scholz<br />
intensiv um Ausreise, unterstützt von einem ältesten, bisher nicht genannten Sohn, der in<br />
Leutersdorf/Sa. ansässig war und man kam auch außer der Reihe so zum Erfolg. Obwohl ich<br />
vom Reichenauer Leben etwas abgekoppelt war, so war doch mit Scholzes Weggang für<br />
mich wieder ein Stück heimatlicher Rückhalt weggebrochen.<br />
Ich wendete mich noch mehr Oppelsdorf zu. Die Kartoffeln waren vom Unkraut zu<br />
befreien ebenso der Gemüsegarten, in der LPG arbeitete ich in den Sommerferien um Stroh<br />
für die Einstreu. In der neuen Schulklasse hatte ich wie erwähnt gleichaltrige neue Freunde<br />
gefunden. Einer von ihnen, Konstantin Kozimor aus Sommerau, eröffnete mir, dass er einen<br />
Fahrrad-Rahmen zu verkaufen habe. Das war ein Angebot, welches mich wie ein Blitz<br />
durchzuckte und auf ehrliche Freundschaft schließen ließ.<br />
Zur Nachkriegsgeschichte des technischen Artikels Fahrrad muss ich berichten, dass die<br />
Fahrraddichte schon zu Kriegsende wegen Frontbedarfs sehr gering war, wobei nach 45 für<br />
Deutsche sich ein weiterer Schwund durch fremde Aneignung ergab. Was dann noch da war,<br />
wurde sorgfältig behütet und in den ersten Nachkriegsjahren bis ca. 1950 nur sehr zögerlich<br />
eingesetzt, da einer stark mit Scherben bedeckten Fläche praktisch Null Nachschub an<br />
Schläuchen und Bereifung gegenüberstand. Horst, der Sohn von Webmeister Lindner, fuhr<br />
auf einem Familien-Damenfahrrad, dessen Reifen vom Vater gekonnt mit Gartenschlauch<br />
belegt waren. Das fuhr sich also etwas schwer, etwas schwammig, aber auf Gummi, dem<br />
Scherben und Nägeln nichts anhaben konnten. Wer sonst an polnischen Jugendlichen und<br />
Kindern ein Fahrrad hatte, der fuhr in der Regel mit viel Lärm und Funkensprühen auf deren<br />
Blechreifen. Aber selbst eine solche Karre bleib für mich unerfüllte Sehnsucht. Als in<br />
Bogatynia ein Metall-Laden in den ersten 50er Jahren begann, Reifen und Fahrradschläuche<br />
zu verkaufen, konnte ich mir einen Schlauch schon leisten und suchte mir vom Schutt eine<br />
28er Felge und alte Bereifung. So konnte ich am eigenen Objekt üben, was ich bei stolzen<br />
Radbesitzern gesehen hatte, d. h. Aufziehen der Bereifung und des Schlauches und das<br />
Aufpumpen. Die Löcher in der Bereifung wurden mit einem Stück Altreifen innen oder außen<br />
52
überdeckt. Bereifte Felgen hatte ich also schon. Der Rahmen kostete 38 zł und noch heute<br />
blicke ich bei der Fahrt durch Sommerau zum Dachboden des Hauses, wo ich das Wertstück<br />
mit zitternden Händen in Empfang nahm. Der Rahmen hatte vorn eine etwas krumme Gabel<br />
und ein Tretlager ohne Pedalen, aber ich war auf dem Weg zum Fahrrad endlich über den<br />
Berg. Es dauerte noch Monate, bis alles weitere Zubehör erworben war, teils weil es nichts<br />
gab, teils weil es mir an Geld fehlte. Aber dann war der Stand erreicht, dass es eigentlich nur<br />
noch an Speichen und der Kette fehlte. Herr Jagodzinski, der nach Breslau fuhr, versprach<br />
mir, Speichen zu kaufen, was er auch einhielt, aber es gab dort aktuell nur Vorderrad-<br />
Speichen, weshalb er für beide Räder solche erwarb. So ausgestattet, begann ich in der<br />
Waschküche anhand des Speichenlaufs bei Vaters Dienstrad zuerst das Vorderrad einzuspeichen,<br />
das klappte ganz gut. Für das Hinterrad waren die Speichen natürlich etwas zu lang,<br />
evtl. wäre das durch schrägen Verlauf auszugleichen gewesen, ich hielt mich aber an das<br />
Muster des Speichenlaufs und bog die Speichen mit der Kombizange unter einfach ca. 1 cm<br />
zurück. Auch das gelang brauchbar, ich konnte das bei noch fehlender Kette bereits im Garten<br />
nach der Fußabstoß-Methode des Freiherrn von Drais erproben. Als Siegfried Domagalla den<br />
Stand der Dinge sah, spendierte er mir eine Kette. Die erste Fahrt ging zur Großmutter nach<br />
Reichenau. Bereifung, Schutzbleche, Kette, Sattel waren neu, der Rest neu angestrichen, ich<br />
fuhr in Reichenau als erfolgreicher junger Mann vor. Heute haben die einfachsten Fahrräder<br />
Gangschaltungen, damals gab es nur einen Gang und selbst der konnte in der Nachkriegszeit<br />
nicht gewählt werden, sondern er stellte sich beim Zusammenbau ein. Im Falle meines<br />
Fahrrades lag der Gang sehr niedrig, d. h. man fuhr leicht aber langsam, das war aber günstig<br />
für eine Ergänzung meiner Ausrüstung, die im Folgejahr eintrat.<br />
Im ersten Halbjahr wurden zwei junge Mädchen und vier junge Männer, darunter ich,<br />
von meiner Mutter für die Konfirmation vorbereitet. Diese fand am 5. Juni durch den Superintendenten<br />
Steckel (aus Liegnitz) statt. Nach uns wird es wohl Reichenauer Konfirmanden<br />
nicht mehr gegeben haben.<br />
Fritz Geisler, meine Person, Mädchen?, Brigitte Glaser aus Markersdorf, Horst Lindner<br />
und Felix Babitsch<br />
Steckel war wahrscheinlich Superintendant ohne unterstellte Pfarrer und so als Reisepfarrer<br />
für den ganzen Bereich Niederschlesien zuständig. Für mich war sein Erscheinen ein erster<br />
Hinweis, dass wir in der Tiefe des schlesischen Raumes verstreut mit restlicher deutschen<br />
53
Infrastruktur noch vorhanden waren. Meine Mutter sieht auf den Konfirmationsbildern etwas<br />
angegriffen aus, denn sie hatte bis zum Morgengrauen an meinem gewendeten (d. h. aus<br />
einem Altanzug gefertigten) Konfirmationsanzug gearbeitet. Die Schwestern Else und<br />
Margarete schenkten mir eine Brieftasche aus Kunstleder (habe ich noch) und der Trumpf bei<br />
allen Geschenken kam von Fr. Dr. Joschko als Lederetui mit Kugelschreiber und Drehbleistift.<br />
Wir fühlten uns aber alle nicht als arm oder unglücklich.<br />
Eine Bereicherung des Lebens war auch die Freundschaft mit Eduard Konizszewski aus<br />
meiner Schulklasse. Er war ein lustiger Bursche und kam gern vom „Ziegfaberch“ wo er<br />
wohnte übers Feld zu mir gelaufen, nannte mich lachend und freundlich einen typischen<br />
Deutschen, bei dem alles eine Ordnung haben musste und trotz der Tierhaltung kein Strohhalm<br />
herum lag. Sogar der Misthaufen war von Birkenstämmchen eingefasst und es durfte<br />
nichts danebenliegen, denn langsam hatte ich alles gut in Griff bekommen. Wir sammelten<br />
gemeinsam Schrott und Altstoffe und zogen dann zwei hochbeladene Wagen bis nach<br />
Reichenau in ehem. Preibischs Fabrik. Dort wurden alle Wertstoffe angekauft, sogar das Fell<br />
eines Maulwurfs, den die Hunde am Vortag erbissen hatten, wurden wir los. Die leeren Wagen<br />
schafften wir zu meiner Großmutter, lehnten deren freundliche Einladung zum Mittagessen<br />
ab und gingen mit viel Geld in der Tasche in die Stadt. Am Bahnhof war damals noch die<br />
Gaststätte „Żytawska“, wo wir Platz nahmen und zuerst eine Suppe, Vorspeise und ein Bier<br />
bestellten, wobei wir uns so gewichtig benahmen, dass die Kellnerinnen ohne Argwohn auch<br />
das zweite Bier und das große Schnitzel brachten. Wir zahlten generös mit Trinkgeld und<br />
begaben uns hoch zufriedengestellt zu unseren Wagen und zogen mit diesen ins schöne<br />
Oppelsdorf zurück.<br />
Einmal kam Eczka strahlend übers Feld und erzählte mir sein neueste Beobachtung. Sein<br />
Vater und der Schneider saßen schon lange beisammen und tranken vom selbst gemachten<br />
Obstwein. Irgendwann wollte der Schneider auf Toilette gehen, als aber eine neue Flasche<br />
geöffnet wurde, verschob er das, saß dann aber wie abwesen und schräg auf seinem Stuhl<br />
etwas nach vorn gebeugt und Eczka sah wie durch die Kunststopfung des Gesäßes der<br />
Schneiderhose sich ganz feine Würstchen mit leisem Geknatter durchzwängten. Weiterer<br />
Ablauf ungewiss, denn er wollte mir den Spaß sofort mitteilen.<br />
54
16. Das Jahr 1954<br />
Vom Anfang dieses Jahres ist mir erinnerlich, dass ich die Zaunfelder für 2 x 40 m Zaun auf<br />
gefrorenem Boden zusammen genagelt habe. Lieferant für das Material der erforderlichen 24<br />
Pfähle und der 48 Riegel war in beschriebener Art und Weise des Vorkapitels der Geyersgraben<br />
gewesen. Die erforderlichen 600 Stück Stachelten standen ebenfalls dort als junge<br />
Birkenbäumchen. Herr Jagodzinski besorgte aus Breslau die Nägel. Es war mir schon eine<br />
Genugtuung, als im Frühjahr der Zaun stand und das Grundstück auch zu den Feldseiten<br />
geschlossen war, damit waren auch unsere Hunde besser unter Kontrolle, was auch gut für<br />
Radfahrer war. Zu den Radfahrern gehörte jetzt auch ich und hatte damit ein großes Stück<br />
persönliche Freiheit gewonnen. Aber der Mensch wünscht sich ja stetig mehr. Es war mir<br />
schon bekannt, dass es in Bogatynia vereinzelt Fahrrad-Anhänger gab, während ich immer<br />
noch häufig mit einem meiner Eisenbahnerstreik Handwagen aus Bogatynia schwere Lasten<br />
nach Oppelsdorf ziehen musste. Das waren manchmal 3 – 4 Zentner und man musste sich<br />
genau den Weg aus dem Reichenauer Tal überlegen und längere Wege fahren, um Steigungen<br />
zu vermeiden. Der Anfang wäre ein Rahmen für einen solchen Fahrradanhänger gewesen,<br />
aber alles Horchen und Spähen war bisher vergebens gewesen, bis ich im Vorbeigehen ohne<br />
solches Suchen, in den Hof der Reichenauer Nachbarin, der verwitweten Frau Artelt sah und<br />
es mich durchzuckte. Da stand ein solcher Rahmen, selbst bei nochmaligem Hinsehen, immer<br />
noch an die Wand gelehnt. Die Verhandlungen mit der Dame verliefen erfolgreich. Großmutter<br />
gab das Geld und der Rahmen zumindest war da.. Für den Wagenkasten konnte ich die<br />
Bretter von Großvaters ehemaliger Voliere nehmen, die Beschaffung von Rädern und Bereifung<br />
dauerte noch einige Monate, aber am Ende war ich ein junger Mann mit Fahrrad und<br />
Anhänger. Das war damals viel wert. So als hätte man heute einen Klein-LKW. (Den<br />
Anhänger habe ich heute noch im Gebrauch.)<br />
Herr Jagodzinski war Imker mit vielen Bienenstöcken und ich hatte für ihn in Abendkühle<br />
und Dunkel bereits Schwärme aus den Linden geholt, dabei auch manchen Stich<br />
ausgehalten. Herr Colavinzenco, Gärtner in Markersdorf, ebenfalls Imker, wollte mir 3 gebrauchte<br />
Beuten übereignen. Es war der erste Einsatz des Gespanns Fahrrad und Hänger, bis<br />
nach Markersdorf. Zwar musste ich das Gespann mit 3 Beuten beladen, schwer aus dem<br />
Reichenauer Tal schieben, aber auf der Ebene ging es locker im Sattel weiter, dabei fast<br />
geräuschlos, sozusagen glücklich gleitend nach Oppelsdorf. Herr Jagodzinski spendete einen<br />
Schwarm und einige Ausrüstung, so war ich Jungimker geworden.<br />
In der Mitte des Jahres endete die Grundschule für Nawrotówna, Helena, Biernacki,<br />
Ryszard, Kozimor, Konstanty, Koniuszewski, Edward, meine Person und aus Lichtenberg<br />
Olbrecht Jan und Irgendwen werde ich wohl vergessen oder verwechselt haben. Wie üblich<br />
kam denn in den Sommerferien die Arbeit auf dem Oppelsdorfer Rittergut, die Arbeit auf<br />
unserem Pachtland, die Arbeit im Garten.<br />
Aufgrund eines guten Zeugnisses war ich für den Besuch des polnischen Lyzeums in<br />
Zgorzelec vorgesehen und der Antrittstermin im angeschlossenen Internat kam heran. Die<br />
Anfahrt konnte man mit der Buslinie Opolno-Zdrój – Jelena Góra, die nur 1 x am Tag verkehrte,<br />
Abfahrt ca. 6.00 Uhr, unternehmen. Das Internat befand sich, wenn man vor dem<br />
Lyzeum steht im links angrenzenden Gebäude, dabei ein Eingang für Jungen, ein Eingang für<br />
Mädchen. So standen wir Anfänger, einander unbekannt, mit unseren großen Koffern (Bettsachen<br />
waren mitzubringen) erst vor dem Gebäude, dann im Gebäude herum. eine ordnende<br />
Hand schien es nicht zu geben, einige Zimmer waren verschlossen und so traute ich mich am<br />
Ende in ein großes verwüstetes, scheinbar aufgegebenes Zimmer zu gehen (1. OG, Ecke<br />
Str./Schulhof), sofort von einem Schwarm von Interessierten umgeben. Wie es genau weiter<br />
gegangen ist, weiß ich nicht mehr, aber am Ende waren wir eingerichtet, einigermaßen gewaschen,<br />
lagen zeitig zu Bett und gehörten nicht zu denen, die von älteren Jahrgängen, die erst<br />
später kamen, aus den Zimmern geworfen wurden. Am ersten Schultag traf ich dann auch auf<br />
Manfred Horn, der schon ein Jahr am Lyzeum absolviert hatte, da er aufgrund seiner anfangs<br />
55
tschechisch/später polnisch erfolgten Schulbildung keine Sprachschwierigkeiten hatte und die<br />
Grundschule in Bogatynia ziemlich jung abschließen konnte; er wohnte in Zgorzelec privat.<br />
Für die Internatsschüler gab es im Kellergeschoss Frühstück, welches immer aus einer großen<br />
Tasse Malzkaffee und einem Brötchen mit einer Scheibe Wurst bestand. Mittagessen gab es<br />
in einem anderen Gebäude für alle, die Abendbrotregelung war Privatsache. Obwohl für Außenstehende<br />
uninteressant gebietet es doch die Achtung und Dankbarkeit das Lehrerkollegiums<br />
der damaligen Zeit zu erwähnen:<br />
− Zuerst die wohl interessanteste Persönlichkeit, einen Professor für Mathematik, der im<br />
Vorkriegspolen Abgeordneter im Sejm war und wohl deshalb von der Polizei verpflichtet<br />
wurde, im Schulgebäude in oder nahe der Bibliothek zu wohnen. Er wurde im allgemeinen<br />
als der „Szlachcic“ bezeichnet, abends war manchmal zu sehen, wie der ältere Herr im<br />
Nachthemd auf der Leiter stand, um sich ein Buch aus dem Regal zu holen. Er hatte aber<br />
die Sympathie der Jugend gewonnen und auch ich habe immer ausgesucht höflich gegrüßt,<br />
um das zu zeigen. Manfred Horn hatte bei ihm Unterricht und er nannte ihn klug und gütig.<br />
Sein Name war wahrscheinlich Swidzinski oder ähnlich.<br />
− Direktor war Herr Palieter, der 1955 aber mit Familie nach Frankreich ausreiste, nach ihm<br />
kam Herr Radzik, dessen Schwester in unserer Klasse war, wo er auch Biologie unterrichtete.<br />
− Stellvertretende Direktorin war Frau Rajchel, die Französisch unterrichtet, eine kleine energische<br />
Person, immer mit Zigarette.<br />
− Klassenleiterin war Kazimiera Mita, eine strenge gelernte Archäologin, die Geschichte<br />
lehrte.<br />
− Frau Lorenz lehrte Polnisch und obwohl die Fälle dieser Sprache bei mir nie in Fleisch und<br />
Blut übergegangen sind, stand ich immer auf „Gut“.<br />
− Die herzensgute Frau Ostrowska lehrte Mathematik. Ihr Sohn Jacek war bei uns in der<br />
Klasse und der größte Rabauke. Sie glaubte mathematisch an mich, seitdem mir in einer<br />
Sternstunde an der Tafel einmal eine selbstständige geometrische Ableitung gelang. Ihr<br />
Nachfolger im Fach war Herr Bober.<br />
− Chemie gab der schon ältere Herr Kwasniewski, der vom Studium her wahrscheinlich<br />
Deutschkenntnisse hatte, denn er gebrauchte bei Tages-Leistungen gern das deutsche<br />
Sprichwort von der Schwalbe, die noch keinen Sommer macht.<br />
− Russisch lehrte die ältere Dame Wołowska.<br />
− Physik und Geographie gab die junge Frau Lisicka.<br />
− Sport hatten wir beim 30jährigen blonden Wilhelm Nowicki aus Pommern.<br />
− Für Wehrunterricht/Ertüchtigung war Herr Wiatrowski zuständig.<br />
Den Kreis der Schülerinnen und Schüler aus unserer Klasse könnte ich heute noch<br />
nennen, dabei hatte ich bei mindestens 20 % begründeten Verdacht, dass sie Deutsch verstehen,<br />
vom Familiennamen her, von erwähnter Verwandtschaft, einige haben wahrscheinlich<br />
gleich gut deutsch gesprochen, aber sie haben das eisern unter der Decke gehalten. Anders<br />
ich, der ich immer unmissverständlich klargestellt habe, wer ich bin, was im ersten Schritt für<br />
viele eine Sache war, die Einordnung erforderte, mir aber dann auch Anerkennung wegen<br />
klarer Haltung einbrachte. Kritisch war es zuerst im Milieu des Internats, wo unter den Neuen<br />
sich eine Rangordnung ausbilden musste, wobei mich also einer als ausgewiesenen Deutschen<br />
unterordnen wollte und mir vor versammelter Mannschaft mit Wucht auf den Rücken sprang,<br />
was ich aber aus hielt um ihn dann meinerseits über die Schulter platt auf die Dielen zu<br />
werfen, wo er erst einmal liegen blieb, weil die Luft raus war. Damit blieb meine Unabhängigkeit<br />
gewahrt. Das erste Schuljahr fuhr ich nur einmal im Monat nach Hause, der<br />
Fahrtkosten wegen. Man konnte auch ab Zgorzelec Moys mit der Bahn fahren. im Bahnhof<br />
Ostritz war scheinbar das dichte stalinistisch/sozialistische Grenzregime aufgehoben, denn<br />
dort stiegen im Wechsel deutsche und polnische Reisende in Züge. Für mich war es total<br />
aufwühlend so viele unbekannte Deutsche zu sehen, bis heute träume ich von dieser scheinbar<br />
durchbrochenen Grenzstelle. Gleichzeitig stiegen in Ostritz aber auch polnische Posten zu, in<br />
56
jeden Waggon einer und die Fenster mussten geschlossen werden, denn die Gleise laufen<br />
teilweise auch westlich der Neiße, die Ausweise wurden während der Fahrt kontrolliert. Als<br />
die Großmutter von Klaus Joschko, die kein Wort Polnisch sprach, diese Strecke befuhr,<br />
reichte sie dem Posten in ihrer Nervosität aus der Handtasche statt Ausweis eine prachtvolle<br />
in Französisch gehaltene Speisekarte aus dem Hotel Adlon, die dieser ratlos hin und her<br />
wendete, dann mit Verbeugung zurückgab, wobei er abschließend zackig vor ihr salutierte<br />
und mit militärischer Kehrtwendung die Hacken zusammenschlagend abging. In Türchau<br />
musste man auf die Kleinbahn nach Reichenau umsteigen. Seit 1951 konnte man mit dieser<br />
auch von Reichenau bis Kleinschönau fahren. Allerdings waren die starken Lokomotiven 45<br />
im Zittauer Depot geblieben und dann durch kleinere Dampfloks von nur ca. 1/3 Leistung<br />
ersetzt worden. Die Erstfahrt 1951 nur mit Lok ließ diese in Reibersdorf über eine Straße aus<br />
den verschmutzten Schienen springen und in einen Hof hineinfahren. Indem dieser aber<br />
gepflastert war, soll man einfach rückwärts wieder auf das eigentliche Gleis gefahren sein.<br />
Die Schwäche dieser Lokomotiven machte es aber unmöglich, ohne Schwung an Brendlers<br />
Fabrik vorbei aus dem Reichenauer Tal hinauszufahren, d. h. man konnte nicht wie früher im<br />
Schritt, der Schaffner mit roter Fahne voraus, die ersten drei Straßen ab Bahnhof überqueren,<br />
sondern man musste ab Abfahrt Volldampf geben, um Geschwindigkeit zu bekommen, dabei<br />
laut pfeifen. Die Gefährlichkeit der kleinen Bahn sprach sich schnell herum und die Bäuerlein<br />
aus Za Buga waren sehr unruhig, wenn sie sich den Gleisen mit ihrem Pferdchen näherten.<br />
Wenn man dann noch 20 – 30 m entfernt war und das Ungeheuer fing zu pfeifen an, was<br />
dann? Würde das Pferdchen stehen oder durchgehen, oder was? Und da war man schon<br />
wieder ein Stück gefahren. Also Vorwärts! Vorwärts! Und so kam es zur Wettfahrt, bei denen<br />
die Bahn noch ein Stückchen vom Wägelchen erwischte, aber keiner kam zum Halten, das<br />
Pferdchen lief noch hunderte Meter weiter um sein Leben und die „Tschiuchtschia“ musste<br />
mit Schwung die Höhe nach Wald-Oppelsdorf gewinnen. Auch der Autobus wurde ab und zu<br />
gestreift. Ich habe erlebt, wie danach bei Fahrerwechsel die Gefahr eines „Feuerteufels aus<br />
dem Gebüsch“ beschrieben wurde. Einmal bekamen wir nach Zgorzelec über eine Stunde<br />
Verspätung, weil bei leichtem Frühnebel der Fahrer konsequent den Schaffner ca. 20 m<br />
voraus laufen ließ, um die Gleise zu suchen.<br />
17. Das Jahr 1955<br />
Hier wäre im Nachgang zu berichten, dass ich endlich mit Clara und Dangola in einer<br />
Klasse vereint war, wobei es in diesem Alter zwischen Jungen und Mädchen zu einer Auseinanderläufigkeit<br />
der Entwicklung kommt, d. h. die Mädchen sind einerseits biologisch weiter,<br />
anderseits sehr kompliziert und die Jungs fangen an, vom sportlichen Heldentum und sonstigen<br />
Bewährungen zu träumen und wollen ungebunden sein. Kurzum, es wurde in dieser<br />
Phase, trotz gegebenen Möglichkeiten, nichts aus uns. Als ich bei der Niederschrift des<br />
Vorkapitels bei Dangola und Clara nach dem Namen des alten Mathematikprofessors<br />
(Schlachcic) fragte, nannten beide, obwohl hunderte Kilometer getrennt sofort den Namen<br />
eines auch in meiner Erinnerung sehr gut aussehenden jungen Mathelehrers. So kommt nach<br />
50 Jahren noch an den Tag, wo die jungen Mädels ihre Augen hatten.<br />
Der Sportlehrer fand heraus, dass ich gut Hochsprung-tauglich war, sozusagen am<br />
Standort konkurrenzlos und ich wurde in die Zgorzelecer Leichtathletik-Mannschaft, einem<br />
herausgehobenen Kreis, eingereiht. Äußerer Ritterschlag war, dass man einen schicken<br />
Trainingsanzug bekam und Spikes. Nächster Vorteil war, dass man voll gesponsert (sogar mit<br />
Taschengeld) in Schlesien, nach Breslau, Hirschberg, Waldenburg, Schweidnitz, Glatz zu<br />
Wettkämpfen (mit Hotelübernachtung ) fahren konnte und so als armer Junge auch ein Stück<br />
von der Welt sah; in Schlesien auch noch Landsleute traf, so den Sprinter Peter Klose, den<br />
Kugelstoßer Martin ... und andere. Unsere Zgorzelecer Spitzenkönner war Lucjan Kijewski,<br />
der ca. 11.4 sek/100 m lief und entsprechend auch ein guter Weitspringer war, Henryk<br />
Bieniewski warf den Speer in die 60er Meter, außer ihm gab es noch einen anderen guten<br />
57
Kugelstoßer und Ewa Tajner war auf dieser Strecke und mit dem Speer auch sehr gut. Ich<br />
hielt mich mit 1,78 m im Hochsprung in dieser Mannschaft. Auch mit den KK-Sportschützen<br />
bereiste ich Schlesien, indem ich bei 300 möglichen in der Regel mindestens 270 Punkte<br />
schaffte. So war den das 2. Halbjahr auf dem Lyzeum angenehm verlaufen und ich ging mit<br />
einem guten Zeugnis in die Oppelsdorfer Sommerferien, ausgerüstet auch mit Trainingsplan<br />
und mit einem Speer zum Üben. Als mein Vater aus Scherz eine Tür zu hielt, konnte ich ihn<br />
weg schieben und das sooft ich wollte, d. h. ich war mit 16 Jahren der Kräftigste in der<br />
Familie geworden. Die Ferien waren wie im Vorjahr mit gern getaner Arbeit in Haus, Garten<br />
und Feld, sowie bei der LPG ausgefüllt. Ein Huhn überlebte mein Speerwurftraining nicht.<br />
Frau Joschko mit Söhnen von links Peter, Michel, Dieter, Wermer, Klaus<br />
Schulabschluss Klaus<br />
58
Klaus Joschko, der ein Jahr jünger ist als ich, begann im Herbst in der ersten Klasse des<br />
Lyzeums in Zgorzelec seine Ausbildung und wir zogen gemeinsam in ein Privatzimmer, als<br />
Untermieter bei einer deutsch/polnischen Witwe. Unser erstes Frühstück bestand immer aus<br />
einer Haferflockensuppe mit Milch, Mittagessen gab es in der Mensa und das Abendbrot<br />
bereiteten wir uns aus eigenen Vorräten, wobei durch die Fürsorge von Frau Dr. Joschko und<br />
Klausens angeborenen starken Sorgetrieb, ich irgendwie besser gestellt war als früher.<br />
Gleichfalls ließen mich meine Eltern jetzt wöchentlich nach Hause kommen, was auch der<br />
häuslichen Wirtschaft zugute kam, denn ich konnte in ½ – 1 Tag Wochenendarbeit schon<br />
vollwertige Leistungen vollbringen.<br />
In Oppelsdorf mussten die Haushalte reihum Männer stellen für nächtliche Streifgänge.<br />
Ich vertrat meinen Vater immer bei Wasilewski (früher Herwig-Bauer) mit dem wir in dieser<br />
Sache zusammengespannt waren. Wasilewski ließ es ruhig angehen. Als Imker bewirtete er<br />
mich immer zuerst in der Küche mit Weißbrot und Honig. Dann gingen wir mit Stöcken los,<br />
eine Schleife durch das schlafende friedliche Wald-Oppelsdorf und kamen nach Mitternacht<br />
dann beim Wächter im warmen Kuhstall der Kolchose (Rittergut) an, wo immer ein interessantes<br />
Erzählen begann, z. B. Märchen, Gruselgeschichten an die der alte Wächter spürbar<br />
glaubte, Erlebnisse Wasilewski mit Wölfen. Er erzählte wie er z. B. als junger Bursche bei<br />
Regen durch nächtliches Feld und Wald seinem Dorfe zustrebte und hinter sich immer ein<br />
„Tschlap-Tschlap“ zu hören glaubte, wenn er plötzlich still stand, ging es hinter ihm noch<br />
einmal „Tschlap“, dann war Ruhe. Die Gruselgeschichten des alten Wächters bezogen sich<br />
teilweise auf ganz aktuelle Vorgänge in Oppelsdorf und es war im nächtlichen Milieu und<br />
dem gefühlten Aberglauben des Erzählers ganz schwer, einen kühlen Kopf zu behalten und<br />
sich davon zu distanzieren. Dass es schnell unangenehm werden kann, erlebte ich selbst, als<br />
ich einmal erst spät abends von Zgorzelec nach Reichenau kam und aufgrund tagheller<br />
Vollmondnacht nicht bei Großmutter blieb, sondern mich auf den Fußweg nach Oppelsdorf<br />
begab. Nahe der Kreuzung mit der Lichtenberger Straße fand ich an einem Obstbaum einen<br />
dürren Ast, der mit einem Knall abbrach und eine ca. 1,50 m langen Stock von bester Festigkeit<br />
und derben Format ergab. Siegfried Domagalla, der einmal im feindlichen Hinterland<br />
notgelandet war und durch Partisanengebiet zurückgehen musste, hatte mir geraten, bei nächtlichen<br />
Alleingang immer auf der Mitte einer Straße zu bleiben, wohin ein Angreifer aus dem<br />
Graben oder aus einem Gebüsch einige Meter zurücklegen muss, Chance für eigenes<br />
Handeln. Als ich in Richtung Oppelsdorf die Schläte überquert hatte, sah ich entfernt rechter<br />
Hand auf freiem Feld 5 große Hunde mit Jagdgekläff dahinstürmen. Plötzlich raste diese<br />
Meute auf mich zu und die Hunde sprangen zu beiden Seiten von mir über die Straße, um<br />
Richtung Lichtenberg weiter zu jagen. Das war die erste unangenehme Situation. Einige<br />
hundert Meter weiter, am tiefsten Punkt der Straße, in einer Linkskurve, sah ich dann zwei<br />
große graue Schäferhunde am linken Straßenrand sitzen. Ich verblieb auf der rechten Seite<br />
und ging festen Schrittes, den Stock aufstoßend, an dem Pärchen vorbei, im Augenwinkel sah<br />
ich, dass sie sitzen blieben. Die Möglichkeit über die Wiesen, an Herfords Scheune vorbei<br />
nach Oppelsdorf zu gehen, habe ich nicht genutzt, sondern bin bis zum Bergschlösschen auf<br />
der Straße gegangen, an der damals noch beidseitig Obstbäume standen, auf die ich mich im<br />
Falle eines Angriffs schnell begeben konnte. Unterm Strich war es rückblickend wohl gut,<br />
dass ich in jener Nacht den großen festen Stock hatte.<br />
Gefährlich sind aber auch Tiere, die keine Reißzähne haben, wenn sie so heimtückisch<br />
sind, wie unsere Ziege es war. Diese durfte im Spätherbst frei im Garten herumlaufen und<br />
kein Besucher achtete auf sie, sondern mehr auf die Gunst der Hunde, wenn er unseren Garten<br />
betreten wollte, z. B. um am Haus etwas abzulegen. Auch war es kaum bemerkenswert, dass<br />
die Ziege dann vor dem Gartentor stand, durch welches man hinaus wollte. Wenn man dann<br />
aber weiter in diese Richtung ging, zeigte sich, dass eine Ziege, die sich auf die Hinterbeine<br />
stellt, bis an die Hörnerspitzen etwa so groß ist wie ein Mensch. Mit diesen Hörnern ging sie<br />
dann tief hinunter und ackerte damit ein Stück im Kiesweg, um den Kopf dann plötzlich<br />
hochzureißen, wobei Dreck und scharfkantige Kiesel auf den Besucher prasselten. Spätestens<br />
59
dann waren erste Schreckensschreie zu hören. Damen haben aber immer eine Tasche bei sich<br />
und konnten diese, wie Toreros das rote Tuch, zwischen sich und die Ziege halten bis das<br />
rettende Tor erreicht war. Als Klaus und Manfred mich besuchen wollten, machte ich sie auf<br />
die Gefahr aufmerksam. Die kühnen jungen Männer wollten sich aber vor Lachen fast ausschütten.<br />
Im Herbstwind hörte ich dann immer scheinbar meinen Namen rufen, unterbrochen<br />
von einem „Rums“. Die Kampf-Ziege hatte die beiden Helden null-komma-nichts in die<br />
Waschküche gejagt und lauerte vor der Tür, die sie bei jedem Öffnen mit einem „Rums“ mit<br />
Kopfstoß wieder schloss.<br />
Im Herbst 55 war ich in einer echten selbst verschuldeten Gefahr, als wir mit Klaus in<br />
Zgorzelec in einem Steinbruch waren und ich die Wand durchsteigen wollte. Es ging bis zu<br />
einem Punkt, wo es immer schwieriger wurde, d. h. es ging nicht mehr Vorwärts und nach<br />
Rückwärts auch nicht, den ein Stück Fels war abgebrochen. So hing ich denn hoffnungslos in<br />
der Wand, nach Unten ca. 8 – 10 Meter war es zwar sichtlich nicht unbedingt tödlich, aber<br />
doch bis nahe daran. Da hing ich also mit dieser Perspektive in der Wand, meine Fußspitze<br />
begann sich als Nähmaschine zu betätigen, Klaus sauste gleichermaßen verzweifelt umher<br />
und verschwand nach Oben. Als ich schon der an mir zerrenden Schwerkraft nachgeben<br />
wollte, schwebte von Oben ein Stahlseil ein und der stämmige Schlesier zog mich hinauf. Da<br />
war man als Sachse wieder mal gerettet.<br />
18. Das Jahr 1956<br />
Nach dem Weggang meiner Scholz-Freunde waren meine Partner für Wintersport vor allem<br />
Klaus Joschko und Manfred Horn geworden. Es ist mir erinnerlich, dass wir in diesem Jahr<br />
vom Reichenauer Steinberg auf Skiern eine Schussfahrt ins Tal unternommen haben, heute<br />
würden wir dort auf Wohnblocks prallen. Damals aber wurden wir weiter Unterwärts auf dem<br />
Feld freundlich von kleinen Kerlen begrüßt, darunter Wolfgang Wildner und mein Vetter<br />
Dieter Stein, vielleicht auch der Stanislaus Jarosz, die sich dort eine Sprungschanze gebaut<br />
hatten und weit sprangen, dabei dramatisch aufklatschten, aber wie aus Gummi standen und<br />
es schien ihnen alles nichts auszumachen. Die Aufforderung auch zu springen lehnten wir<br />
wegen anderer Verpflichtungen ab, es drohte zu sehr Misslingen und Autoritätsverlust. Diese<br />
jüngste deutsch/polnische Generation war in sich zusammengewachsen und besuchte auch<br />
ganz normal von der 1. Klasse an die polnische Schule.<br />
Die nächste Generation unter der Obhut meiner Großmutter;<br />
Wolfgang Wildner, Sigrid Dudek, Gerlinde Fischer, Dieter Stein<br />
60
Beim Spiel wurde der ältere Wildner Junge etwas durch die Aufsicht über den jüngeren<br />
Bruder gebremst. Als der Kleine für mich hörbar beim Spiel im Dorfbach einmal Hilfe wegen<br />
voller Hosen anforderte, wurde er von Dieter und Wolfgang mundartlich und prompt belehrt:<br />
„Doas musste aushaln, a enner Stunde isses horte un Du merkst nischt mih“. So war auch über<br />
spät geborene Söhne das alte Reichenau damals noch anwesend. Schwester Jutta ging ab<br />
Herbst 1956 auf das neu eingerichtete Gymnasium in Reichenau. Mit ihr von Oppelsdorf noch<br />
Franek Legażynski und Rajmund Kaminski, in der Klasse traf sie auch auf Peter Ludwig.<br />
Von meinem Schuljahr ist mir erinnerlich, dass wir an der ersten mehrtägigen Wanderung<br />
in den Ostsudeten teilnahmen, d. h. am Rande des Glatzer Kessels, die Plakette habe ich<br />
noch. Erinnerlich ist mir, dass damals in den langen Gebirgsdörfern meist nur die untersten<br />
Häuser in der Nähe der Bahnstation bewohnt waren. In leer stehenden Gehöften befand sich<br />
noch viel an zweitrangigem Mobiliar und Ausrüstung.<br />
Wenn ich in den Vorkapiteln nur die sommerliche Arbeit erwähnt habe, so ist es abschließend<br />
an der Zeit, darauf hinzuweisen, dass es für uns auch ganz herzliches gesellschaftliches<br />
Leben gab. Die Schwestern Else und Margarethe verlebten in unserer Sommerfrische<br />
den Jahresurlaub, Klaus Joschko war Ferienwochen bei mir, an den Wochenenden kamen<br />
Onkel und Tante und befreundete Familien zu Besuch, bei letzteren besonders die von Rudolf<br />
Fischer und Siegfried Domagalla. Siegfried besaß ab 56 ein neues Motorrad, 350 cm³,<br />
Zweitakt, Marke russische Ischewesk. Ich wurde aufgefordert, auf dem Feldweg damit zu<br />
fahren, unvergesslich!<br />
Als neue Person erschien in unserem Kreis Direktor Markowitzsch, der mit Siegfrieds<br />
Schwester, der verwitweten Frau Lehman, verbunden war. Er stammte aus einer jüdischen<br />
Familie in Posen. Der Vater war im 1. Weltkrieg noch treu und bewusst preußischer Offizier<br />
gewesen. Als das Gebiet zu Polen kam, achtete er auf eine gleich gelagerte gute Ausbildung<br />
seines Sohnes in Deutsch, d. h. Markowitsch stand mindestens zur Hälfte im deutschen<br />
Kulturkreis. Als polnischer Soldat kam er in sowjetrussische Gefangenschaft und nach<br />
Sibirien. Von Hitlers Gesetzten und auch durch begangene Verbrechen am Judentum fühlte er<br />
sich sozusagen aus dem deutschen Kulturkreis ausgestoßen und kam als Offizier und Rächer<br />
mit der sowjetisch-polnischen Armee aus dem Osten. Als er aber in Oberschlesien sah, dass<br />
die deutschen Weberinnern genauso abgearbeitet und verbraucht an den Maschinen standen<br />
wie die in Posen und in der Sowjetunion, wusste er mit seiner Rache nichts mehr anzufangen.<br />
Er hätte ja Veranlassung gehabt, unsere Gesellschaft zu meiden, er fühlte sich aber eher zu<br />
uns hingezogen, tauschte und las wieder deutsche Literatur, unterhielt sich gern mit mir auf<br />
Spaziergängen in und um Oppelsdorf zu tiefgründigen Fragen. Ein eigener Sohn von ihm in<br />
geschiedener Ehe war in der Sowjetunion geblieben.<br />
Wie schon gesagt, die Gesellschaft traf sich ganz ungezwungen, jeder brachte einen Teil<br />
zu den Mahlzeiten mit,. aus Donaths Bierstube konnte man damals noch vom Fass einen Krug<br />
Bier holen, man tauschte Bücher und Ansichten darüber und erzählte sich Geschichten von<br />
Früher, denn Fernsehern gab es glücklicherweise damals noch nicht, dabei auch folgende<br />
Begebenheit, die ich weitergeben will:<br />
− Im alten Bad Oppelsdorf gab es den Taxi-Unternehmen Willi Schäfer mit einem alten<br />
offenen Phänomen. Ein kurender Herr mietet das Taxi an einem lauschigen Sommerabend,<br />
da er in Zittau das Nachleben wahrnehmen wollte. Man fuhr also voller Genuss und<br />
langsam im offenen Wagen durch die Natur, der Fahrgast in Frack und gestärktem weisen<br />
Hemd hatte sich eine Zigarre angesteckt, aber während der Fahrt kratzte er sich seltsam oft<br />
oder schlug sich mit der Hand auf den Frack. In Zittau angekommen, erhellte sich das<br />
seltsame Gebaren, denn vom gestärkten Hemd waren durch Funkenflug und Glimmbrand<br />
nur die Manschetten und der Kragen übrig geblieben.<br />
Zur Erheiterung der Gesellschaft gab es auch Hundefuhre-Schaufahren, d. h. unser<br />
Gespann, gehoben durch die Aufmerksamkeit der Gäste, gelenkt durch Jutta, paradierte<br />
geradezu die Villenstraße rauf und runter und alle Manöver klappten bestens.<br />
Was sonst noch alles unter den Tieren auf dem Hof geschah – nachfolgend:<br />
61
Die Geschichten von den lieben Tieren, die ich hier abschließend aufschreiben möchte,<br />
sind nur einige von vielen. Eines aber haben sie alle gemeinsam, nämlich, das Haus mit dem<br />
großen Garten, in dessen Bereich das alles geschah.<br />
Unser Grundstück lag am Fuße des Sudetengebirges, in dörflicher Einsamkeit, von Wald<br />
und Getreidefeldern umschlossen. Der Wald hatte sich von dem das Grundstück umgebenden<br />
Birkenholzzaun nicht ganz aufhalten lassen und hatte eine Vertreter bis in den Garten hinein<br />
und am Zaune entlang um das ganze Haus geschickt. So wuchsen denn am Zaune Bäume und<br />
Sträucher aller Arten, die es bei uns gibt. Neben das kleine schon über hundert Jahre alte Haus<br />
hatte sich eine Reihe mächtiger Tannen gestellt, die mit ihren untersten Ästen gerade noch<br />
über das Dach strichen. Sie schützten das kleine Haus vor Blitz und Nordwind. Es wäre<br />
müßig diesen Erdwinkel noch genauer zu beschreiben wie es wirklich war. Jeder male sich<br />
selbst aus, wie er sich ein solches Haus in der Einsamkeit wünschen würde und wird dann<br />
auch sicherlich das Richtige treffen. Der Garten umfasste ein kleines Reich der verschiedensten<br />
Tiere. Im Obstgarten hatten die Stare und die Bienen ihre Häuser. Im Hof befand sich die<br />
Hochburg des Tierreiches, nämlich der Stall. Dieser war ursprünglich ein Schuppen gewesen<br />
und mit der Zunahme derer die ihn bewohnen wollten immer größer ausgebaut worden. Die<br />
markantesten Persönlichkeiten im Stall waren Frau Ziege, ungefähr 6 Hühner, ein einsamer<br />
Erpel und eine Kaninchenfamilie. Nachts kamen noch drei pflichtvergessene Katzen, angeblich<br />
um Mäuse zu fangen, in Wirklichkeit aber um zu schlafen. Für die Sicherheit der<br />
Bewohner sorgten drei Hunde, die eine Hundehütte an den Stall angebaut hatten. In einem<br />
Separatstall befanden sich die Raben Jakob und Johann.<br />
Die Tiere besaßen eine weitgehende Selbstverwaltung. Das Amt der Polizei und des<br />
Abwehrdienstes übten die Hunde aus. Sie verjagten die Hühner aus dem Gemüsegarten und<br />
bissen manches Wiesel tot. Die Katzen, denen die Schädlingsbekämpfung oblag, waren faul<br />
und pflichtvergessen; sie führten das Leben einer Rentnerschicht. Die Mäuse mehrten sich in<br />
Haus und Garten. Im Heuschuppen schliefen die Katzen nicht mehr, weil sie dort angeblich<br />
von den Mäusen gestört wurden. Nur während der Zeit der großen Katzenhochzeiten schrien<br />
und kreischten sie so furchtbar und greulich, dass die Mäuse von selbst in den Wald<br />
auswanderten. Einen Teil dessen, was ich in dieser Tiergemeinschaft beobachtete will ich<br />
nachfolgend erzählen.<br />
August der Starke<br />
August war ein Kaninchenherr. Er hatte eine unter seinesgleichen seltene Kraft und Größe.<br />
Schließlich war er als letzter seines Stammes übrig geblieben, aber keiner wollte ihn ob seiner<br />
Schönheit schlachten. Er bekam eine Art Gnadenbrot, jedoch behagte August das einsame<br />
Rentnerdasein hinter Gittern nicht besonders. Eines schönen Tages war er jedenfalls ausgebrochen.<br />
Das erste, was in einem solchen Fall zu tun war – die Hunde, drei an der Zahl, hinter<br />
Schloss und Riegel zu setzen. Danach wurden die Nachforschungen nach dem Verbleib<br />
Augusts aufgenommen. Aber alles Rufen und mit Stöcken an die Bäume schlagen führte zu<br />
keinem Erfolg. August erschien nicht. Schließlich wurde ein Hund zum Suchen zur Hilfe<br />
geholt. Dieser erhielt vorher eine Predigt, dass er August auf keine Fall beißen oder fressen<br />
dürfe, sondern nur suchen solle. Der Hund wedelte mit dem Schwanz und spielte scheinheilig<br />
den Braven. Dann wurde er auf die Spur gesetzt und fegte sogleich wie verrückt in der<br />
Gegend umher und hatte nur noch Mord im Sinne. Vor einem Ziegelhaufen verhielt er, bellte<br />
wie toll und versuchte die Steine wegzuräumen. Während man noch überlegte, wie August<br />
unter den Ziegeln vorzuholen sei, geschah das Unerwartete. Plötzlich fuhr August wie ein<br />
Blitz unter den Steinen vor, stürzte sich auf den Hund und ohrfeigte ihn wie rasend. Der Hund<br />
machte das dümmste Gesicht, das ein Hund machen kann und dachte überhaupt nicht an<br />
Gegenwehr. Ein um sich schlagender Hase war für ihn etwas, für was er einfach kein<br />
Programm hatte. August wurde wieder eingefangen, aber die Freiheit, die er einmal gekostet<br />
hatte, konnte er nicht mehr entbehren. Er brach immer wieder aus, verließ aber dabei nie das<br />
Gebiet des Gartens. Sämtliche Hunde, die sich ihm näherten, wurden in Flucht geschlagen.<br />
62
Am Ende war es soweit, dass oftmals ein Hund mit aller Kraft um die Hausecken sauste und<br />
hinterher der streitbare Hase. Angesichts solcher Tatsachen wurde August freigesprochen.<br />
Abends suchte er selbst seinen Stall wieder auf. Er erhielt den Beinamen „der Starke“.<br />
Die Raben Jakob und Johann<br />
Letzte glückliche Zeit in Oppelsdorf<br />
An sie erinnere ich mich besonders gern. Jakob und Johann stammten aus einem Nest. Jakob<br />
war herausgefallen und hatte sich verletzt. Er fand bei uns seine Pflege. Johann rettete ich vor<br />
einem blutigen Ende. Bevor ich ihn bekam, musste ich erst einer Waldohreule nachjagen, die<br />
ihn mit sich schleppte. Die beiden Raben gewöhnten sich rasch an ihre Umgebung. Sehr bald<br />
waren sie voll ausgewachsen und hatten ein gewichtiges Wort im Garten mitzureden. Es lag<br />
wohl in ihrem Charakter, dass sie für die anderen bald der böse Geist Mephisto wurden. Sie<br />
hielten mit ihren Streichen alles in Bewegung und Aufregung. Bei diesem teuflischen Werk<br />
kamen ihnen ihre großen, spitzen Schnäbel sehr zustatten. Wie jeder ordentliche Teufel, so<br />
hatte auch jeder von ihnen einen versteckten Schatz. Alles was blinkte und glitzerte, wurde<br />
gestohlen. Beim Aufsuchen des Schatzes wurde strengste Vorsicht gewahrt. Glaubten sie sich<br />
schließlich unbelauscht, so breiteten sie wohl ihre Schätze in der Sonne aus, betrachteten sie<br />
von allen Seiten, sortierten und verstecken sie wieder beim leisesten Geräusch. Aber nicht nur<br />
solche Schätze wurden gelagert, auch Futter, Fleischstückchen, welche sie nicht mehr verschlingen<br />
konnten, wurden vergraben. Allerdings bezeigten unsere Hunde für diese fressbaren<br />
Schätze reges Interesse. Oft konnte man beobachten, wie ein Rabe zu seinem Versteck eilte,<br />
während ein Hund, von ihm ungesehen sich hinterher schlich. Nachdem der Rabe sein<br />
Vorratsmagazin verlassen hatte, fraß der Hund alles weg. Der Ärger des Raben, wenn er seine<br />
leere, verwüstete Vorratskammer bemerkte, ist unbeschreiblich. Er setzte sich ungefähr fünf<br />
Minuten an den Rand der Grube und dachte angestrengt nach, wer der Täter sein konnte. Den<br />
Rest des Tages verbrachte er unbeweglich vor sich hin brütend auf einem Baum. Die Wut in<br />
ihm musste schrecklich toben. Eine Menschenhand, die ihn streicheln wollte, bekam sofort<br />
einen fürchterlichen Schnabelhieb. Aber dann erhellte sich seine Miene, er hatte ein Objekt<br />
seiner Rache erspäht!<br />
Die Katzen bekamen ihre Milch in einer Schüssel auf einem Steinpflaster. Beim Milchtrinken<br />
haben sie die Gewohnheit den Schwanz lang auf der Erde auszustrecken. Während die<br />
Katze im Genuss ihrer Milch schwelgte, schlich sich der Rabe auf den Zehenspitzen von<br />
63
hinten an. Beim Katzenschwanz machte er halt. Wie ein Holzfäller seine Axt, so hob er seinen<br />
spitzen, fingerlangen Schnabel zum furchtbaren Hieb. Das harte Steinpflaster machte den<br />
Hieb noch schmerzhafter. Die Katze schrie so furchtbar, wie selbst auf den höchsten<br />
Katzenhochzeiten nicht geschrien wird. Dabei sprang sie mit allen vier Beinen steif in die<br />
Luft und fiel in ihre Milch, die natürlich „für die Katz“ war. Der schwarze Teufel wusste nun<br />
nicht, was er vor Freude anstellen sollte. Er krächzte, schlug mit den Flügeln und tanzte von<br />
einem Bein auf das andere. Die Katze raste inzwischen halb irrsinnig vor Schmerz und<br />
Schreck im Garten umher. Der Schwanz war dick geworden und an der Hiebstelle hatte sich<br />
ein Knoten gebildet. Erst nach stundenlangem Lecken ging die Geschwulst wieder weg. Nach<br />
einer solchen Genugtuung, hatte der Rabe sein seelisches Gleichgewicht wiedergewonnen. Es<br />
gab für die Raben auch noch eine andere Art Tierquälerei. Sie bemerkten einen Hund, der mit<br />
sich und der Welt zufrieden, an einem Knochen knabberte. Einer der Raben postierte sich vor<br />
dem Knochen, der andere nahm am Schwanz Aufstellung. Sobald die Plätze eingenommen<br />
waren, begann der eine Rabe die Offensive, indem er dem Hund auf bekannte Art in den<br />
Schwanz hackte. Der Hund fuhr wutschnaubend herum und bekam sofort einen zweiten Hieb<br />
auf die Nase. Während der Hund laut heulte und sich mit der Pfote die Nase massierte,<br />
schleppten die Attentäter den Knochen mit vereinten Kräften bis aufs Schuppendach. Sobald<br />
der Hund zu sich gekommen war und den Verlust entdeckt hatte, geriet er in rasend Wut. Er<br />
versuchte die Schuppenwand hochzuklettern, was den Beiden auf dem Dach die größte<br />
Freude machte. Allmählich beruhigte sich der Hund und versuchte es auf die andere Art,<br />
indem er sich hinsetzte und „schön“ machte, was aber die beiden Gauner nicht beeindrucken<br />
konnte. Sie nahmen den Knochen und rollten ihn hin und her. Der Hund sauste dementsprechend<br />
immer um den Schuppen herum. Diese Belustigung wurde stundenlang getrieben.<br />
Meist siegte aber die Gerechtigkeit, weil nämlich die beiden Raben oft untereinender in Streit<br />
gerieten und das Streitobjekt zu dem rechtmäßigen Besitzer entglitt. Die Raben zeigten auch<br />
einen schädlichen Ehrgeiz. Der eine hatte sich in den Kopf gesetzt, dass nur jede fünfte<br />
Steckzwiebel stehen dürfe. Den Rest zerrte er, sooft sie auch wieder eingesetzt wurde, heraus.<br />
Eines Tages wurde ein Teil der Stangenbohnen geerntet. Die Raben halfen beim Pflücken<br />
eifrig mit. So schön, so gut. Aber, die beiden hörten nicht auf zu arbeiten, pflückten zwei<br />
Tage hintereinander, bis auch die letzte Bohne auf der Erde lag.<br />
Wurde im Garten umgegraben, so verschlangen die Raben eine Unmenge Regenwürmer.<br />
War der Kropf voll, dass die Regenwürmer wieder zum Schnabel heraus krochen und sich<br />
nicht mehr schlucken ließen, so wurde sehr klug eine Vorratskammer gegraben. Die Regenwürmer<br />
wurden aufgelesen und hineingeworfen. Dann wurde ein Blatt darüber gedeckt und<br />
darauf Erde gescharrt. Das Ganze wurde schön fest getreten. Nach zwei, drei Tagen wurde<br />
dann die Vorratskammer geöffnet. Natürlich war sie leer. Der Zorn war groß, der Rabe hatte<br />
die Hunde im Verdacht uns sann auf Rache.<br />
Damit beginnt eigentlich diese Geschichte von neuem.<br />
19. Januar, Februar und März 1957<br />
Das Vorjahr hatte in Ungarn einen Aufstand gegen die sowjetische Vorherrschaft gebracht<br />
und auch in Polen zu Lockerungen geführt. Die Generation der älteren Deutschen war mit<br />
dem Verbleib in einer polnisch dominierten Welt in eine Sackgasse geraten, in deren bescheidenen<br />
wirtschaftlichen Verhältnissen sie in der Regel aufgrund der Sprachbarriere zusätzlich<br />
zurückgesetzt waren, gleichzeitig lief die Lebenszeit ab und man konnte sich ausrechnen, dass<br />
man in Deutschland sich wieder ganz unten einreihen muss.<br />
Aus diesem Grunde wurde die von polnischer Seite neu eröffnete Möglichkeit zu Ausreise<br />
von allen (dabei Dominoeffekt) angenommen. Ein einfacher Grenzverkehr zum wechselseitigen<br />
Besuch von Verwandten und Freunden und zur Arbeitsaufnahme in Deutschland trat<br />
erst 1972 ein und war damals bei der Beweglichkeit des sozialistischen Lagers nicht zu<br />
erwarten.<br />
64
Mutter mit Raben und Hund Foxine<br />
65<br />
Mutter mit Frau Sznajder und?,<br />
sowie Hund Tarzan
Nicht in der damaligen Sicht war auch die später eingetretene Möglichkeit des BRD-<br />
Doppelpasses für Schlesier, was Arbeit in der BRD und Wohnen in der schlesischen Heimat<br />
ermöglichte. Ich wäre wahrscheinlich blind auf letztere Möglichkeit zu gesteuert, wenn ich<br />
einige Jahre älter gewesen wäre und dann eine feste Bindung an ein polnisches Mädchen<br />
gehabt hätte. Mit und ohne Eltern im Lande wäre bei unserem geringen Einkommen für mich<br />
nur Erwerbsarbeit und ein Fernstudium in Frage gekommen. Als mich 56 erste Aufforderungen<br />
trafen, an einer Disko teilzunehmen, musste ich ablehne, denn ich hatte weder Halbschuhe<br />
noch Jacke und Hose, ich ging immer noch in Kleidung, die meine Mutter aus einem<br />
warmen Deckenstoff nähte, trug im Sommerhalbjahr selbst gemachte Sandalen oder Tennisschuhe<br />
und im Winterhalbjahr ein Paar hohe Arbeitsschuhe. Oberkleidung war, auch in der<br />
kalten Jahreszeit, ein blauer, innen gummierter Regenmantel. Ich habe unter dieser Bescheidenheit<br />
aber nicht gelitten, sonder fand das ganz normal und auskömmlich. Aber wie gesagt,<br />
eine andere Welt mit höheren Anforderungen klopfte schon an.<br />
Ich hatte also aufgrund meiner Jugend keine Handhabe, um meine Eltern von der<br />
Ausreise abzuhalten oder um selbst einen anderen Weg zu gehen, aber ich war innerlich<br />
entsetzt und verzweifelt, wie alles was wir uns erhalten und aufgebaut hatte, aufgegeben<br />
wurde.<br />
1. Mai 1950<br />
Ab Februar verpackte ich in zweiwöchiger Arbeit die Wohnungseinrichtung von Frau<br />
Lehmann, dann fing im März bei uns die gleiche Arbeit an, Rudolf Fischer schrieb auf die<br />
zerlegten Sachen mit schwarzer Farbe unsere neue Adresse in Deutschland. In Reichenau bei<br />
Onkel und Tante und Großmutter Preibisch geschah das Selbe. Als alles in Türchau in einen<br />
Waggon verladen war, übernachteten wir irgendwo. Am nächsten Tag musste ich noch einmal<br />
nach Oppelsdorf zurückgehen, um mich am Gemeindeamt abzumelden, dann war noch etwas<br />
bei unseren Nachmietern abzugeben. Als ich auf dem Hofe war, krachte es hinter mir und<br />
unsere Ziege steckte den Kopf durch das Schuppenfenster. Tarzan lag an der Kette und<br />
winselte mich an (die beiden Hündinnen lebten nicht mehr). Ich musste gehen und dann auch<br />
das Gartentor von außen aus der Hand lassen.<br />
Tod unglücklich und gebeugt ging ich von Oppelsdorf fort.<br />
66
1. Mai 1955<br />
67<br />
Die kühne Irene ca. 1955
Bei Familie Joschko mit oben die med. Schwestern, links Else dann Margarete<br />
Manfred Horn bestand 1957 in Zgorzelec sein<br />
Abitur mit „Sehr gut”; es wurde aber im<br />
Westen nicht anerkannt und er mußte die<br />
Prüfung wiederholen.<br />
ENDE<br />
Ich werde später aufschreiben, wo und wie ich diese Prüfung bestanden habe...<br />
68<br />
Klaus Joschko machte sein Abitur 1960 in<br />
Berlin
Stellungnahme<br />
Als ich gehen musste, war ich schon ein politischer junger Mensch, der sich einordnen<br />
konnte. Ich sagte mir, wenn die Welt so ist, dass man entweder vertreibt (bei Hitlers Sieg<br />
wäre ich gewiss irgendwo in Uniform zum Vertreiber geworden) oder vertrieben wird, so ist<br />
mir besser getan, wenn ich Vertriebener bin.<br />
Später habe ich klar gesehen, dass die strategischen Vertreiber nicht die Polen waren,<br />
sondern die großen Siegermächte:<br />
− Die Amerikaner waren es gewohnt, dass sie den verzweifelten Tausenderlei der einst 15<br />
Millionen Indianer die Heimat nahmen und die Unterlegenen tausende Kilometer weiter in<br />
unfruchtbare Reservate warfen.<br />
− Der Stalinismus verfuhr mit verdächtigen Völkerschaften nicht anders im Riesenreich<br />
Sowjetunion.<br />
− Die englische Politik wollte schon nach dem ersten Weltkrieg Deutschland im Osten stark<br />
reduzieren, so einfach aus Ansichtssache, obwohl nie ein Deutscher Englands zum Teil<br />
blutigen Herrschaftsbereich in Frage stellte.<br />
Heute sehe ich, dass auch eine Zwischenlösung unter polnischer Verwaltung der Deutschen<br />
Ostgebiete möglich gewesen wäre. Wir konnten, ca. 9 Millionen die wir waren, die im<br />
Osten vertriebenen ca. 1,6 Millionen Polen unter uns aufnehmen. Man konnte für sie Siedlungen<br />
bauen, viele unser Bauernhöfe wurden frei, da alle Söhne gefallen waren, auch Wohnungen<br />
und Arbeitsplätze wurden so frei. Der polnische Staat wäre zudem als Garant anwesend<br />
gewesen. Ganz von selbst hat sich, in meinen <strong>Erinnerungen</strong> nachlesbar, eine Vielzahl von<br />
sofort eingetretenen deutsch/polnischen Liebesbündnissen ergeben, die zu lebenslangen Ehen<br />
wurden. Wenn ich zudem auf die letzten ca. 150 Jahre Deutscher Geschichte blicke, so sehe<br />
ich Deutschland historisch bei unseren großen Städten und im Ruhrgebiet, auch auf dem<br />
flachen Land, mit wahrscheinlich Millionen ethnisch polnischer Familien aufgesiedelt. Auch<br />
in den letzte 50 Jahren weilten ständig ca. 2 Millionen Polen in Deutschland, von denen viele<br />
auf angenehme Weise durch zwischenmenschliche Beziehungen festgehalten bei uns bleiben,<br />
was ein ganz selbstverständlicher Vorgang ist und für uns beste Staatsbürger ergibt. Für eine<br />
interne Deutsch/Polnische Sühnelösung in den Deutschen Ostgebieten ohne neue Ungerechtigkeit<br />
war aber die Zeit noch nicht reif. Der Ostblock als Reich des proletarischen Internationalismus<br />
befand sich in einer totalen Verkrampfung. Lockere zukunftsweisende Lösungen<br />
waren nicht vorstellbar.<br />
Auch sollten wir im Rückblick sehen, dass man uns in Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern<br />
und Ostpreußen zwar alles nehmen konnte, im Nachgang noch unter der Erde nach von<br />
uns versteckten Sachen suchte, dass man aber das wertvollste geistige Gut, was über diesem<br />
preußischen Land lag, nicht wahrgenommen hat, so dass unsere ca. 250 Jahre lange (1685 –<br />
1933) preußische Tradition von Toleranz und gewissenhafter Pflichterfüllung in der Solidargemeinschaft<br />
des Staates, bei uns geblieben ist. Dieses wertvolle Erbe sollten wir jeder für<br />
sich erwerben, um es für Deutschland zu nutzen.<br />
Die jetzt in unserer Heimat leben, sie sollen gut leben!<br />
69