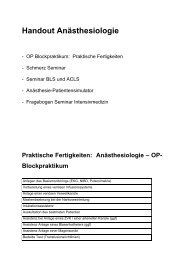Soziale Faktoren im Laufe der Kranken-Karriere Sommersemester ...
Soziale Faktoren im Laufe der Kranken-Karriere Sommersemester ...
Soziale Faktoren im Laufe der Kranken-Karriere Sommersemester ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
II Sozialisationstheoretische AnsätzeAus <strong>der</strong> Vielfalt <strong>der</strong> hier vorgelegten Ansätze soll stellvertretend das Modell „<strong>der</strong> produktivenRealitätsverarbeitung“ von Hurrelmann (1986) vorgestellt werden. HurrelmannsAnsatz bemüht sich, an<strong>der</strong>e Ansätze zu integrieren und setzt ihn explizit in Bezugzur Gesundheit. Im Konsens mit den meisten an<strong>der</strong>en, neueren Sozialisationstheoriengeht Hurrelmann davon aus, dass die Persönlichkeitsbildung sich in <strong>der</strong> Wechselwirkungvon sozialen und natürlichen Umweltfaktoren und bio-psychischen Personenfaktorenvollzieht. Das Individuum setzt sich nach diesem Modell sowohl suchend alsauch gestaltend mit den jeweiligen Umweltbedingungen auseinan<strong>der</strong> und ist um einenAusgleich <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen und <strong>der</strong> eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessenbemüht. Die Gesellschaft wie<strong>der</strong>um gilt als ein von Menschen geschaffenes und permanentweiterentwickeltes soziales System. Die Gesellschaft gibt einen von Menschengeschaffenen Rahmen vor, <strong>der</strong> gleichzeitig durch die Handlungen <strong>der</strong> Menschen aufrechterhaltenund weiterentwickelt wird. Anhand <strong>der</strong> Pubertät lässt sich das Gesagteverdeutlichen: „Biophysische und biochemische Prozesse beeinflussen psychische Dispositionen,gesellschaftliche und ökologische <strong>Faktoren</strong> beeinflussen zeitliche Abläufeund Mikrostrukturen dieses Entwicklungsprozesses.“ (Hurrelmann 1994:154f.) Die Transitionvom Kind zum Jugendlichen, die Ablösung von <strong>der</strong> Familie und <strong>der</strong> Anschluss aneine Peer-Gruppe, die Krise des Selbstkonzeptes und Selbstwertgefühls stellen latenteGefährdungen für eine gelungene Sozialisation dar, insofern ist die Adoleszenz einebeson<strong>der</strong>s vulnerable Lebensphase. Bei Krisen in <strong>der</strong> Entwicklung kann es zu psychischenErkrankungen kommen, selbst bei „normaler“ Entwicklung ist die Annahme vongesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen wie Rauchen möglich (vgl. Siegrist 1998:112).Neben psychologischen Merkmalen <strong>der</strong> Eltern spielen <strong>der</strong>en sozialökonomische Verhältnisse(Bildung, Einkommen, berufliche Position) eine wesentliche Rolle.Abb. 1.3: Modell Entstehungsprozess Verhaltensauffälligkeit und Krankheit(Hurrelmann 1994: 159)Persönlichkeits- und UmweltmerkmaleStufe 1) Entwicklungsaufgaben, Anfor<strong>der</strong>ungen des Statusübergangs (Schulleistungen, Ablösung vomElternhaus Gleichaltrigenbeziehungen, usw.)Personale und <strong>Soziale</strong> Ressourcen bei <strong>der</strong>Bewältigung von Anfor<strong>der</strong>ungenStufe 2) Risikofaktoren für Verhaltensauffälligkeiten/ Krankheit <strong>im</strong> Jugendalter (Schulversagen, Konflikte mitEltern, Isolation von Freunden, usw.)Personale und <strong>Soziale</strong> Ressourcen bei <strong>der</strong>Bewältigung von RisikofaktorenStufe 3) Auftreten von Symptomen <strong>der</strong> Verhaltensauffälligkeit / Krankheit (Delinquenz, Drogenmißbrauch,psychosomatische Beschwerden)Personale und <strong>Soziale</strong> Ressourcen bei <strong>der</strong> Bewältigungvon Verhaltensauffälligkeiten / KrankheitStufe 4) Verfestigung und Verstärkung <strong>der</strong> Symptome und Entwicklung einer "abweichenden <strong>Karriere</strong>" (alsKranker, Delinquenter, usw.)5
III.Gesundheitssoziologische AnsätzeU. Gerhard (1979) legte ein soziologisches Modell <strong>der</strong> Belastungen vor, in dem sie dreiArten des Bewältigungsverhaltens unterscheidet:1. Psychophysiologische Bewältigungskapazitäten betreffen die Anpassung des Körpersan physische Belastungen und außergewöhnliche Lebensereignisse.2. Psychologisches Bewältigungsverhalten bezeichnet die Bedeutungszuschreibungsowie psychische Verarbeitungsbereitschaft und –vermögen.3. <strong>Soziale</strong>s Bewältigungsverhalten ist „...aktive Beeinflussung <strong>der</strong> Umwelt, um die eigeneSituation bei <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung mit schwierigen Lebensereignissen und–situationen zu verbessern“ (vgl. Hurrelmann 1994:160).Alle Formen des Bewältigungsverhaltens sind angewiesen auf das Vorhandensein vonentsprechenden Ressourcen und die Fähigkeit, diese auch effektiv einzusetzen. Sowohldas Volumen <strong>der</strong> Ressourcen, als auch die Fähigkeit, sie effektiv einsetzen zukönnen, sind sozialschichtabhängig verteilt. Auf diese Tatsache stellen medizinsoziologischeModelle des Lebensstils ab. "Politische Machtstrukturen, ökonomische Produktionsverhältnisse,soziale Ungleichheitsmuster, kulturelle Wert- und Normenhierarchien,Muster <strong>der</strong> Bearbeitung und Manipulation <strong>der</strong> physischen Umwelt, sowie normierte Vorstellungendes Umgangs mit dem Körper kanalisieren als kollektive Vorgaben die Spielräumeund Möglichkeiten <strong>der</strong> persönlichen Ausdrucksformen des Verhaltens." (Hurrelmann,1994:162)Diese Möglichkeiten sind je nach Bildungsgrad, Einkommen und beruflicher Positionverschieden, es lassen sich jedoch Gruppen mit ähnlichen Lebensstilen beobachten.Lebensstile sind eingebettet in die Lebenslage einer Person, d.h. geprägt von den ökonomischen,den kulturellen und sozialen Ressourcen. Der Lebensstil prägt den Umgangmit dem eigenen und mit fremden Körpern, mit Belastungen und Krankheit.<strong>Soziale</strong> Schichten:Aufgrund <strong>der</strong> MerkmaleBildung, Einkommenund beruflicher Status(meist <strong>der</strong> Männer) konstruiertesoziale Großgruppe.Ein gemeinsamesIdentitätsgefühl <strong>der</strong>Mitglie<strong>der</strong> ist nicht notwendig,es sind Schichten„auf dem Papier“(Bourdieu).Damit wurden bereits eine Reihe von sozialen Einflüssen aufdie Erhaltung von Gesundheit, bzw. die Entstehung vonKrankheit benannt. Im Folgenden sollen einige Ergebnisseaus <strong>der</strong> Forschung über den Zusammenhang von sozialerSchicht (Bildung, beruflicher Status, Einkommen) und <strong>der</strong>Mortalität und Morbidität in <strong>der</strong> BRD und an<strong>der</strong>en Industriestaatenreferiert werden (vgl. Mielck 2000).Morbidität = ErkrankungsfälleMortalität = Sterbefälle6
Für die Mortalität gilt:Bildung:Männer ohne Abitur haben eine um 3,3 Jahre kürzere Lebenserwartung als Männer mitAbitur, bei Frauen beträgt <strong>der</strong> Unterschied 3,9 Jahre. Es gibt Hinweise darauf, dassTotgeburten und die perinatale Säuglingssterblichkeit bei steigendem Bildungsgrad <strong>der</strong>Mütter kontinuierlich abnehmen. Für Finnland wurde ermittelt, dass <strong>der</strong> Unterschied in<strong>der</strong> Lebenserwartung für 25jährige Männer mit oberer und unterer Schulbildung6,3 Jahre beträgt.Beruflicher Status:Die Gesamt-Mortalität n<strong>im</strong>mt mit steigendem beruflichem Status ab. So haben z.B. einfacheBeamte und Angestellte sowie un- und angelernte Arbeiter eine um 2,3 Mal sohohe Mortalität wie höhere und leitende Beamte und Angestellte und freie Akademiker.Die Frauen und Männer in niedrigen Statusgruppen haben nicht lediglich eine deutlicherhöhte Mortalität, Todesfälle treffen sie auch in jüngerem Lebensalter.Einkommen:Mit zunehmendem Einkommen n<strong>im</strong>mt die Mortalität relativ gleichförmig ab. Die Sterblichkeitist in <strong>der</strong> untersten Einkommensgruppe mehr als doppelt so hoch wie in <strong>der</strong> o-bersten. Mit zunehmendem Alter nehmen die Unterschiede zwischen den Einkommensgruppenvon 5,7 Mal in <strong>der</strong> Altersklasse 35-39 auf 1,7 Mal in <strong>der</strong> Altersklasse von55-59 Jahren ab. Ebenso ist die Säuglingssterblichkeit in den unteren Einkommensklassendeutlich höher als in den unteren.Für die Verteilung <strong>der</strong> Morbidität wurde festgestellt:Bildung:Der Gesundheitszustand ist bei niedriger Schulbildung schlechter als bei höherer. Diesgilt auf Krankheiten spezifiziert z.B. für die Zahngesundheit, die Herzinfarkt-Prävalenzo<strong>der</strong> Pseudokrupp.Beruflicher Status:Auch hier lässt sich allgemein festhalten, dass die Morbidität mit sinkendem beruflichemStatus ansteigt. So sind die unteren Berufsgruppen z.B. deutlich häufiger von behandlungsbedürftigenpsychischen Erkrankungen betroffen, als die oberen.Einkommen:Der Gesundheitszustand wird mit abnehmendem Einkommen meist stufenweiseschlechter. Das gilt z.B. für chronische Bronchitis, Herzinfarkt und Schlaganfall. Für Allergienzeigt sich allerdings ein umgekehrter Zusammenhang, sie treten in den unterenEinkommensgruppen seltener auf, als in den oberen.Untersuchungen, die mit allen drei Schichtvariablen arbeiteten, stellten fest, dass sich<strong>der</strong> Gesundheitszustand stufenweise verschlechtert, je niedriger die soziale Schicht ist.Die meisten chronischen Krankheiten treten in unteren sozialen Schichten häufiger aufals in oberen.Abschließend lässt sich sagen, die „gesundheitliche Benachteiligung von Personen miteinem geringen sozio-ökonomischen Status ist umso größer, je schwerer eine Erkrankungist.“ (vgl. Mielck 2000)7
1.2 Phase 2: In <strong>der</strong> Grauzone zwischen gesund und krankDas Wort „Grauzone“ führt zu <strong>der</strong> in diesem Zusammenhang wichtigen Überlegung,wer eigentlich als krank bezeichnet wird. In <strong>der</strong> Forschung gilt es als gesichert, dassKrankheit und subjektive Beschwerden allein noch keinen Arztbesuch des Betroffenenprognostizieren lassen, auch müssen subjektive Beschwerden nicht in einem Zusammenhangmit medizinischen Befunden stehen und vice versa. Das heißt nicht nur, dasssich viele Kranke nicht bei den Ärzten einfinden, son<strong>der</strong>n auch, dass viele Patientenkeine somatisch diagnostizierbare Erkrankung aufweisen. Zahlreiche Studien belegen,dass <strong>der</strong> größte Teil von Erkrankungen nicht in ärztliche Behandlung führt.Die Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchungen schwanken leicht und sind nicht ohne weiteresmiteinan<strong>der</strong> vergleichbar, trotzdem lassen sie das Ausmaß <strong>der</strong> Situation erkennen:Zwischen 50 und 75% <strong>der</strong> Bevölkerung n<strong>im</strong>mt regelmäßig Symptome wahr, die alsmögliche Krankheitsanzeichen gedeutet werden. Eine ärztliche Untersuchung an11.000 Gesunden erbrachte einen Anteil von 91% Personen mit signifikanten Abweichungenvon medizinischen Normen (Schenthal 1960 zit. nach Herschbach 1999:8). Lediglich5% - 30% <strong>der</strong> Betroffenen gehen aber mit ihren Beschwerden zum Arzt. Eine Studievon Eisenberg (1980 zit. nach Herschbach 1999:8) kam zu dem Ergebnis, dass 75% - 90%<strong>der</strong> selbst diagnostizierten Gesundheitsstörungen selbstbehandelt, bzw. innerhalb desLaienhilfesystems behandelt werden.Ebenso ist das Phänomen, dass sich viele Menschen ohne diagnostizierbare somatischeStörung in Arztpraxen einfinden, empirisch gut belegt. Die Angaben für Patientenmit einer eindeutig und ausschließlich somatisch erklärbaren Erkrankung in verschiedenenBereichen des professionellen Medizinsystems 1 liegen zwischen 16% und 41%.Bei einem Teil dieser Patienten sind die Störungen wie<strong>der</strong>um weniger organischen Ursprungsals vielmehr das Ergebnis von emotionalem Stress. Bei den Patienten, die keinesomatisch feststellbaren Symptome aufweisen, fällt die Verbreitung von funktionellenund psychogenen Störungen auf (vgl. Herschbach 1999:9f.).Die Fehlversorgung wird verständlicher, wenn zwischen krank sein, sich krank fühlenund als krank gelten unterschieden wird. Sein steht für die Ebene naturwissenschaftlich-empirischfeststellbarer Abweichungen von medizinisch als normal definierten Körperzuständen,die in diesem Sinne als objektiv gelten (Arzt-Sicht). Fühlen repräsentiertdie Ebene des subjektiven Gesundheitszustandes und umfasst Zustände wie Schmerzenund Befindlichkeitsstörungen (Patienten-Sicht). Der Aspekt gelten spricht die Legit<strong>im</strong>ationsebenean. Als krank wahrgenommen zu werden, verän<strong>der</strong>t die Haltung undFor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Gesellschaft dem Betreffenden gegenüber (gesellschaftliche Sicht).So tritt z.B. die For<strong>der</strong>ung nach <strong>der</strong> Alltagsbewältigung hinter <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung zur Gesundungund zur Hilfesuche zurück. Durch diese Differenzierung wird klar, dass dieGruppe <strong>der</strong> <strong>Kranken</strong> nicht deckungsgleich ist mit <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Patienten. Denn werkrank ist, muss nicht zwangsläufig auch als krank gelten. Es kann z.B. eine nur sehrschwer o<strong>der</strong> noch nicht diagnostizierbare Krankheit vorliegen. Auch sich krank zu fühlenreicht ohne ärztlichen Befund für eine gesellschaftliche Entlastung nicht aus.1 Die Untersuchungen wurden u.a. in Allgemeinarztpraxen, in Polikliniken, in <strong>Kranken</strong>haus-Ambulanzenund Allgemeinkrankenhäusern durchgeführt.8
Abb. 1.4Subjektive Krankheitstheorien und Aussagen zur subjektiven Krankheitstheorie2Tabelle No. 2+3: Aussagen zur subjektiven KrankheitstheorieTabelle No. 4: Subjektive KrankheitstheorienBegriffe <strong>der</strong> „<strong>Kranken</strong>- und Patienten-<strong>Karriere</strong>“.<strong>Kranken</strong>-<strong>Karriere</strong>:a) Hilfesuchen: Von<strong>der</strong> Symptomwahrnehmungbis zumArztbesuchb) Patienten-<strong>Karriere</strong>:Vom Arztbesuch biszur Heilung/ TodDie Begriffe "Patient" und "Patienten-<strong>Karriere</strong>" beschreibenjeweils Anteile <strong>der</strong> umfassen<strong>der</strong>en Begriffe des "<strong>Kranken</strong>"und <strong>der</strong> "<strong>Kranken</strong>-<strong>Karriere</strong>".Die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Krankheit erstreckt sich in <strong>der</strong>Zeit und es werden zwei Hauptphasen unterschieden. Dieerste Hauptphase umfasst den Zeitraum von <strong>der</strong> Symptomwahrnehmungbis zum Arztbesuch (Krankheitsverhalten, Hilfesuchen,Konsultationsverhalten). Die zweite Phase bildetdie Zeit vom Arztbesuch bis zur Heilung, Rehabilitation o<strong>der</strong>Tod. Diese Phase wird als Patienten-<strong>Karriere</strong> bezeichnet undvon <strong>der</strong> vorhergehenden durch die Struktur ihrer Organisati-2 Quelle: CAWAC-Umfrage in Deutschland. Kaufmann, M., Ernst, B.: „Was Frauen mit Krebs erfahren,empfinden, wissen und vermissen“. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 97, Heft 47, 24. Nov. 2000: A3191-A31949
on unterschieden. Balint nennt sie die organisierte Phase <strong>im</strong> Gegensatz zur unorganisiertenersten Phase (vgl. Lang/ Faller 1998:277).Diese Unterscheidung bezieht sich auf die Art <strong>der</strong> Institutionen, mit denen <strong>der</strong> Kranke inKontakt tritt. In <strong>der</strong> ersten Phase sind die Institutionen eher private und informelle wiedie Familie und <strong>der</strong> Freundeskreis, in <strong>der</strong> zweiten Phase handelt es sich um formelleund offizielle Institutionen, <strong>der</strong>en Handeln verbindlichere soziale Folgen nach sich zieht.Der Begriff des <strong>Kranken</strong>rollenverhaltens bei Kasl/ Cobb bezeichnet alle Verhaltensweisen,die bei erfolgter Diagnose mit dem Ziel <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>herstellung <strong>der</strong> Gesundheit o<strong>der</strong>zumindest Lin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Krankheit erfolgen (vgl. Faltermaier 1994:127). Beide Phasen zusammenwerden auch als <strong>Kranken</strong>-<strong>Karriere</strong> benannt (vgl. Wilker/Bischoff/Novak 1994:210) 3 .Welche <strong>Faktoren</strong> sind es, die Menschen einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen lassen?Den verschiedenen Theorien, die sich dem Thema widmen, ist gemeinsam, dass siediese Phase des Krankheitshandelns als einen Prozess verstehen, <strong>der</strong> von <strong>der</strong>Symptomwahrnehmung bis zur Zuweisung in das professionelle Medizinsystem reicht.Siegrist fasst den allgemeinen Erkenntnisstand folgen<strong>der</strong>maßen zusammen: Eine allgemeinanerkannte Theorie für die erste Phase des Krankheitshandelns gibt es nicht,die vorliegenden teilen jedoch folgende Auffassungen.Von <strong>der</strong> Symptomwahrnehmung an werden vier Entscheidungsstufen postuliert:a) Verleugnung o<strong>der</strong> Selbstmedikation,b) Mitteilung an bedeutsame an<strong>der</strong>e Mitmenschen,c) Zuweisung zum Laiensystem,d) Zuweisung zum professionellen System.Im Allgemeinen lassen sich hierzu folgende Hypothesen formulieren:"Die Wahrscheinlichkeit, den Prozess des Hilfesuchens zu initiieren, ist um so größer,je schmerzhafter, je sichtbarer, auffälliger ein Symptom ist, je bedrohlicher die möglicherweisezugrunde liegende Krankheit erscheint, je stärker das Symptom das Alltagshandelnbehin<strong>der</strong>t, je länger ein Symptom anhält bzw. je häufiger es wie<strong>der</strong>kehrt und jegeringer das Risiko ist, dass die aus <strong>der</strong> Symptombewertung resultierende <strong>Kranken</strong>rollemit an<strong>der</strong>en zentralen Aktivitäten kollidiert“ (Siegrist 1995:204).Am Beginn steht die Wahrnehmung einer Befindlichkeitsstörung o<strong>der</strong> Beschwerde alsSymptom. Das Symptom steht für die Möglichkeit einer (ernsthaften) Erkrankung undlöst Befürchtungen aus. „Die als Krankheitssymptome gedeuteten Missempfindungenwerden zugleich als Ursache für die Einschränkung <strong>der</strong> Fähigkeit betrachtet, sozialeFunktionen wie bisher erfüllen zu können.“ (Wilker/Bischoff/Novak 1994: 209).3 Diese Einteilung ist nicht zwingend, für He<strong>im</strong> (1986) z.B. beginnt die Patientenkarriere bereits mit <strong>der</strong>Symptomwahrnehmung (vgl. Lang/ Faller 1998:275).10
a) Verleugnung o<strong>der</strong> SelbstmedikationVerleugnung o<strong>der</strong> Selbstmedikation ist selbst kein Hilfesuchen bei an<strong>der</strong>en, eher eineeigenständige Suche nach Abhilfe, die sich aus eigenen Erfahrungen und Wissen e-benso wie aus Verhaltensdispositionen speist. Die erste Reaktionsmöglichkeit auf eineSymptomwahrnehmung besteht darin, die eigene Wahrnehmung zu leugnen und keineBehandlung einzuleiten. Ein Schritt weiter ist die zweite Reaktionsmöglichkeit: DieSymptomwahrnehmung wird akzeptiert, aber verharmlost. Handlungsbedarf wird zwarprinzipiell gesehen, aber als (noch) nicht nötig eingeschätzt. Als dritte Möglichkeit bleibtdie Selbstbehandlung. Je nach <strong>der</strong> persönlichen Laienätiologie, Vorstellungen die sichPatienten über die Krankheitsursache machen, können Ausruhen, Spazieren gehen,Hausmittel, frei erhältliche o<strong>der</strong> von <strong>der</strong> letzten Krankheitsepisode übrig gebliebeneverschreibungspflichtige Medikamente Bestandteile <strong>der</strong> Behandlung sein.b) Mitteilung an bedeutsame MitmenschenEine Mitteilung an bedeutsame Mitmenschen thematisiert die weitere Suche <strong>der</strong> Betroffenennach Informationen und/ o<strong>der</strong> Entlastungen innerhalb <strong>der</strong> Familie, des FreundesundBekanntenkreises. Die Mitteilung bedeutet aber mehr: Aus einer int<strong>im</strong>en, privateAngelegenheit wird ein „sozialer Tatbestand“ (Lang/ Faller 1998:271). Der Betroffene giltzumindest Teilen seines sozialen Umfelds als krank, er erhält die soziale Rolle des<strong>Kranken</strong>. Damit verbunden ist die mehr o<strong>der</strong> weniger ausgesprochene Erwartung, dass<strong>der</strong> Kranke sich um Heilung bemüht.c) Zuweisung zum LaiensystemEs findet eine Zuweisung zum „Laiensystem“ statt. Die soziale Umwelt reagiert, Informationenund Behandlungsangebote folgen. Weiter oben wurde auf die Studie von Eisenstadtverwiesen, die feststellte, dass das Laiengesundheitssystem 75- 90% allerBeschwerden/ Symptome/ Erkrankungen behandelt. Es darf vermutet werden, dass dieErgebnisse <strong>der</strong> Behandlungen zumindest für die Betroffenen befriedigend waren.d) Zuweisung zum professionellen SystemNeben dem näheren Verwandten- und Bekanntenkreis lassen sich <strong>im</strong> Laiengesundheitssystemauch Personen finden, die in best<strong>im</strong>mten Gesundheitsfragen als beson<strong>der</strong>skompetent gelten. Sind die Ergebnisse <strong>der</strong> Behandlungen <strong>im</strong> Laiengesundheitssystemunbefriedigend o<strong>der</strong> werden die Symptome als zu schwerwiegend für die in diesemSystem zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bewertet, kann das Laien-Zuweisungssystem 4 zu einer Arztkonsultation raten o<strong>der</strong> drängen. Selbstverständlichkönnen vom Laiensystem auch an<strong>der</strong>e Vertreter des professionellen Medizinsystemswie psychologische Psychotherapeuten, Apotheker, Physiotherapeuten o.ä. o<strong>der</strong> alternativeHeiler empfohlen werden.4 Laien-Zuweisungssystem (lay referral system) ist ein etwas unklarer Begriff von Freidson (1970 zit.nach Siegrist 1995:205). Ob es sich dabei um die in Gesundheitsfragen als beson<strong>der</strong>s kompetent undzuständig geltenden Personen und Institutionen handelt, wie es bei Wilker/Bischoff/Novak (1994:209f.)und Lang/Faller (1998:273) scheint o<strong>der</strong> um jeden bedeutsamen an<strong>der</strong>en, wie es bei Siegrist(1995:205) aussieht, bleibt ungeklärt.11
In dieser Entscheidungsfolge zeigen sich schichtspezifische Unterschiede:Angefangen bei <strong>der</strong> Symptomwahrnehmung, für sie ist ein best<strong>im</strong>mtes Wissen nötig,eine gewisse Aufmerksamkeit für den Körper und ein differenziertes Körpererleben.Diese Voraussetzungen sind bei den Angehörigen <strong>der</strong> verschiedenen sozialen Schichtenin unterschiedlichem Maße gegeben. Daneben sind auch die schichtspezifischenWert- und Normenorientierungen Ausschlag gebend.Weiterhin beeinflussen Strategien <strong>der</strong> Angstabwehr, <strong>der</strong> Verleugnung und <strong>der</strong> Bagatellisierungdie Symptomwahrnehmung, die teils auch von den jeweiligen Werthaltungenabhängt, ebenso aber von psychologischen Merkmalen.Zwischen Selbsthilfe und sozialer Schicht besteht ein kurvilinearer Zusammenhang(U-Kurve): Akademiker, Selbstständige und leitende Angestellte auf <strong>der</strong> einen, un- undangelernte Arbeiter auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite erklären in Befragungen in <strong>der</strong> Regel einehöhere Bereitschaft zur Selbsthilfe und <strong>im</strong> Umkehrschluss kann das bedeuten, dass sieseltener das professionelle Medizinsystem in Anspruch nehmen als Angehörige <strong>der</strong>Mittelschichten.Die Gründe sind schichtspezifisch: „In unteren sozialen Schichten kompensiert Selbsthilfe(bzw. nachfolgende Konsultation des Laiensystems) die soziale Distanz zum Arzt,während qualifiziert Ausgebildete besser zu unterscheiden vermögen, bis zu welchemPunkt einer Symptomerfahrung Eigenaktivitäten ohne kontraproduktive Folgen angemessensind.“ (Siegrist 1995:204). Menschen mit höherem Bildungsniveau wird ebensoeine intelligente non-compliance attestiert, sie gelten als eher in <strong>der</strong> Lage kontraproduktiveärztliche Anweisungen zu erkennen und zu ignorieren.Wird eine Symptomwahrnehmung an signifikante An<strong>der</strong>e mitgeteilt, kann das sozialenDruck erzeugen, <strong>der</strong> entwe<strong>der</strong> die Verleugnung und Bagatellisierung för<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> zueiner weiterführenden Behandlung drängt. Dabei zeigte sich in Untersuchungen die e-minent wichtige Bedeutung <strong>der</strong> Familie und des nahen Bekanntenkreises für die pr<strong>im</strong>ärenDefinitionsprozesse von ‚gesund’ und ‚krank’ und dies nicht nur bei Kin<strong>der</strong>n undJugendlichen, son<strong>der</strong>n auch bei Erwachsenen (vgl. Siegrist 1995:205). Da in den unterensozialen Schichten eine zeitliche Perspektive vermutet werden kann, die sich mehr aufdas Jetzt bezieht, während Mittelschichtangehörige eher zukunftorientiert sein dürften,werden Symptomwahrnehmungen weniger als möglicher Anfang einer chronischenKrankheit gesehen und vermutlich leichter verdrängt. Ebenso ist die Scheu vor ärztlichenUntersuchungen in <strong>der</strong> Unterschicht verbreiteter, was diese Tendenz stärken dürfte.Daneben spielt die berufliche Stellung eine wesentliche Rolle. Für den angelerntenArbeiter sind krankheitsbedingte Ausfallzeiten problematischer, als für den gehobenenBeamten.12
Abb. 1.5: Krankheitsverhalten und <strong>Soziale</strong> Schicht(Koos 1954:306)Prozentsatz von Befragten in je<strong>der</strong> sozialen Gruppe, die bei spezifischen Symptomendie Notwendigkeit ärztlicher Konsultation bejahten*:SymptomGruppe IGruppe IIGruppe III(N=51) (N=335) (N=128)Appetitlosigkeit 57 50 20Hartnäckiges Rückenweh 53 44 19Fortgesetztes Husten 77 78 23Hartnäckige Glie<strong>der</strong>- und Muskelschmerzen 80 47 19Blut <strong>im</strong> Stuhl 98 89 60Blut <strong>im</strong> Urin 100 93 69Übermäßige Vaginalblutungen 92 83 54Anschwellen <strong>der</strong> Fußknöchel 77 76 23Gewichtsverlust 80 51 21Zahnfleischbluten 79 51 20Chronische Müdigkeit 80 53 19Kurzatmigkeit 77 55 21Hartnäckiges Kopfweh 80 56 22Ohnmachtsanfälle 80 51 33Schmerz <strong>im</strong> Brustkorb 80 51 31Kloß in <strong>der</strong> Brust 94 71 44Kloß <strong>im</strong> Unterleib 92 65 34* Prozentsätze auf- und abgerundet; Gruppe I: Oberschicht, Gruppe III: Unterschicht.13
1.3 Phase 3: Im <strong>Kranken</strong>versorgungssystemDie sozialen Einflüsse <strong>im</strong> <strong>Kranken</strong>versorgungssystem sollen beispielhaft für die Arzt-Patienten-Beziehung und die Situation von <strong>Kranken</strong> <strong>im</strong> sozialen System <strong>Kranken</strong>hausbetrachtet werden.Die Arzt-Patienten-BeziehungFür die Betrachtung <strong>der</strong> sozialen Einflüsse auf die Arzt-Patienten-Beziehung spieltdas Phänomen <strong>der</strong> sozialen Distanz eine entscheidende Rolle. Mit dem Fachbegriffsoziale Distanz wird <strong>der</strong> Umstand angesprochen, dass sich Mitglie<strong>der</strong> von verschiedenenSozialschichten unterschiedlich „gut verstehen“. Wie mehrfach <strong>im</strong> Text angedeutetwurde, verinnerlichen die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> verschiedenen sozialen Schichten neben demgemeinsamen Normen- und Wertekanon <strong>der</strong> jeweiligen Gesellschaft (z.B. westlichchristlicheGrundüberzeugungen) auch jeweils schichtspezifische Normen und Werte(z.B. <strong>der</strong> Grad an Zukunftsorientierung, Aufstiegserwartungen). Diese Normen betreffenVerhaltensweisen, Formen des Auftretens und des Benehmens, erwartete Interessensgebieteund vorausgesetzte Fähigkeiten.Abb. 1.6: Entstehung und Verlauf von Krankheiten - SchichtmerkmaleMerkmale typischer Verhaltensweisen von Angehörigen aus <strong>der</strong> sozialen Unter- undMittelschicht:Merkmal Unterschicht MittelschichtErziehungszieleErziehungsverhalten- Gehorsam- Regelbefolgung- Ordnung- Reaktion auf faktisches Verhalten- eher körperliche SanktionenZukunftsorientierung - eher gegenwartsbezogene Haltung- niedriges AnspruchsniveauSprachstileher restringierter Sprachcode:- kurze, unvollendete Sätze- unzulängliche Syntax- formelhafte Redewendungen- Vermischung von Tatsachen undBegründungen- Eigenverantwortung- Selbständigkeit- Reaktionen auf Handlungsabsichten- eher verbale Argumentationenund Liebesentzug als Sanktionsmittel- eher zukunftorientierte Haltung;- Bereitschaft, Belohnungen aufzuschieben- hohes Anspruchsniveaueher elaborierter Sprachcode:- komplexe Satzkonstruktionen- genaue grammatikalische Ordnung- variable Auswahl von Adjektivenund Adverbien- explizite Artikulation von AbsichtenVon den Vorurteilen, die Mitglie<strong>der</strong> verschiedener Schichten gegenseitig hegen können,einmal abgesehen (obwohl auch sie natürlich eine Rolle spielen), erzeugen die unterschiedlichenNormen und Werte, ebenso wie die unterschiedlichen Fähigkeiten, einesoziale Distanz zwischen den Schichten. Denn die schichtspezifischen Werte, Normenund Fähigkeiten stellen gleichzeitig den Inhalt von Erwartungen an den an<strong>der</strong>en dar. ImFalle einer Übereinst<strong>im</strong>mung <strong>der</strong> Werte, Normen und Fähigkeiten hat die Interaktionund Kommunikation eine höhere Chance zu gelingen. Bevor die direkten Probleme, diesich aus <strong>der</strong> sozialen Distanz ergeben können, besprochen werden, ist ein Blick auf14
den gesellschaftlichen und organisatorischen Rahmen <strong>der</strong> Arzt-Patienten-Beziehungnotwendig.Gesellschaftliche Institutionen wie das <strong>Kranken</strong>versorgungssystem und die Ärzteschaftsind auf den „Erhalt <strong>der</strong> zentralen Werte einer Gesellschaft bezogen“ (Schachtner1999:40), <strong>im</strong> Falle <strong>der</strong> Ärzteschaft heißt <strong>der</strong> zu erhaltende Zentralwert Gesundheit, dessenhohe Wertschätzung sich an seiner Spitzenposition in sämtlichen einschlägigenBevölkerungsbefragungen in <strong>der</strong> BRD ablesen lässt. Zum Schutz des Wertes Gesundheitist <strong>der</strong> ärztliche Berufstand mit einer Reihe von Vollmachten und Sanktionsmittelnausgestattet. Die Ärzteschaft erfüllt so u.a. die gesellschaftliche Funktion als Agenten<strong>der</strong> sozialen Kontrolle. Insgesamt wird dadurch die Arzt-Patienten-Beziehung zu einerasymmetrischen sozialen Beziehung, die von einem deutlichen Kompetenzgefälle gekennzeichnetist. Von dieser Voraussetzung ist die Interaktion zwischen Arzt und Patientgeprägt. Der Arzt hat Experten-, Definitions- und Steuerungsmacht in <strong>der</strong> Arzt-Patienten-Beziehung. Als Experte hat er einen allgemein anerkannten Wissensvorsprungund das staatlich zuerkannte Definitionsmonopol darüber, wer als krank zu geltenhat. Das Definitionsmonopol hat Folgen, aus ihnen ergibt sich die Steuerungsmacht.Sie betrifft Rahmen und Gestaltung <strong>der</strong> Begegnung, wie die Wartezeit, Unterbrechungenund Beendigung des Kontaktes. Daneben aber auch die Konsequenzen <strong>der</strong> Begegnung,die einschneidende Wirkungen auf alle Lebensbereiche des <strong>Kranken</strong> habenkönnen (z.B. Anerkennung einer Berufsunfähigkeit).Die Patienten verfügen allerdings über eine gewisse „Gegenmacht“: zumindest dieSteuerungsmacht <strong>der</strong> Ärzteschaft schwindet bei größerer Konkurrenz und in Abhängigkeitvom Grad <strong>der</strong> Spezialisierung des Arztes. Untersuchungen belegen, dass die Patientenzentriertheitvon Ärzten unter Wettbewerbsbedingungen steigt. Zum Zusammenhangvon Ärzteangebot und Inanspruchnahme lässt sich allgemein feststellen: „Je mehrÄrzte pro Einwohner verfügbar sind, desto höher ist die Inanspruchnahme; je höher <strong>der</strong>Anteil von Fachärzten an <strong>der</strong> gesamten Ärzteschaft, desto höher ist die Inanspruchnahme;Personen, die einen spezifischen Arzt (gleichviel, ob Hausarzt o<strong>der</strong> Spezialist)ausgewählt haben, weisen eine höhere Zahl von Arztkonsultationen auf“ (Siegrist1995:209). Auch die Expertenmacht <strong>der</strong> Ärzteschaft reduziert sich in den Augen <strong>der</strong> Öffentlichkeitmehr und mehr auf Fragen <strong>der</strong> naturwissenschaftlichen Medizin. AlternativeMedizinen bieten alternatives Expertenwissen und <strong>im</strong> Zweifelsfall steht es dem <strong>Kranken</strong>frei, einer ihm genehmen Lesart „Glauben zu schenken“.In <strong>der</strong> Arzt-Patienten-Beziehung treffen unter einem soziologischen Blickwinkel zweisich ergänzende Rollenerwartungen aufeinan<strong>der</strong>.Rollenerwartungen an Ärzte:♦ universale Hilfsbereitschaft♦ fachliche Kompetenz♦ Uneigennützigkeit♦ reine Sachlichkeit♦ affektive NeutralitätRollenerwartungen an Kranke:♦ Befreiung von Alltagspflichten/Verantwortung♦ Wille zur Gesundung♦ Verpflichtung, professionelle Hilfein Anspruch zu nehmenDiese Rollenerwartungen sind charakterisiert als Sätze, die sagen was sein soll. <strong>Soziale</strong>Normen haben einerseits einen Ordnungsaspekt, d.h. sie geben uns Verhaltensorien-15
tierungen für best<strong>im</strong>mte Situationen. An<strong>der</strong>erseits haben soziale Normen einen darauserwachsenden Herrschaftsaspekt, denn soziale Normen regeln das tägliche Verhaltenmehr o<strong>der</strong> weniger verbindlich. Über den Weg <strong>der</strong> Gesetzgebung, als eine Form sehrverbindlicher Normen, wird (legit<strong>im</strong>e) Herrschaft ausgeübt. Unverbindlicher sind die sozialenNormen, die den Umgang mit Krankheit regeln. Allerdings verlieren sie dadurchihre Ordnungs- und Herrschaftsfunktion nicht vollständig. Gerade <strong>der</strong> Umgang mitKrankheit ist von starken Verhaltenserwartungen geprägt. In wie weit den Rollenerwartungenentsprochen werden kann, hängt neben psychologischen <strong>Faktoren</strong> auch vonden sozialschichtspezifischen Normen, Werten und Fähigkeiten ab.Berufliche Sozialisation:♦ Aneignung von Fachwissen♦ Verinnerlichung beruflicherNormen♦ Verinnerlichung beruflicherRollenerwartungen♦ Übernahme berufsgruppenspezifischerWerte, Orientierungenund EinstellungenUm Phänomene <strong>der</strong> sozialen Distanz zu verstehen,ist es wichtig, sich über die Zusammensetzung<strong>der</strong> Ärzteschaft klar zu werden. Ärzte undÄrztinnen unterliegen einer beruflichen Sozialisation,die den Blick auf Krankheit verän<strong>der</strong>t. DieVorstellungen über Krankheitsentstehung und –behandlung spitzen sich zu in Richtung auf naturwissenschaftlicheModelle. Emotionale undkognitive Distanzierung von Leid durch Witze undZynismus, Verwandlung <strong>der</strong> Person in einen Fall,sowie exzessiver Fachjargon werden erlernt. DerEinzelfall verliert durch die Routine und die Typisierungvon Krankheiten an Bedeutung.Damit entfernen sich die Vorstellungen <strong>der</strong> Ärzte über Krankheit und Krankheitsentstehungvon denen <strong>der</strong> Patienten, für die Krankheit persönliches Leid ist und <strong>der</strong>en Krankheitsbegriffi.d.R. unspezifisch und umfassend ist. Damit wird er zwar möglicherweiseallen möglichen Bedingungsfaktoren <strong>der</strong> Krankheit gerecht, ist wissenschaftlich aberungenügend. Der Krankheitsbegriff verengt sich zusehends vom Patienten über denAllgemeinarzt zum Facharzt hin, was eine Verständigung erschwert.Zugleich ist in keinem an<strong>der</strong>en Studienfach <strong>der</strong> Grad an Selbstrekrutierung so hoch wiein <strong>der</strong> Medizin. 24%-30% <strong>der</strong> MedizinstudentInnen stammen aus Arztfamilien. Die Entscheidungzum Arztberuf fällt früh: 37% <strong>der</strong> MedizinstudentInnen wollten bereits mit 15Jahren Arzt/ Ärztin werden, stammen sie aus Arzt- o<strong>der</strong> Apothekerfamilien, waren esbereits 51%. Überhaupt stammt über 50% <strong>der</strong> Medizinstudierenden aus Akademikerfamilien(lediglich 5% aus Arbeiterfamilien) und damit aus <strong>der</strong> (oberen) Mittelschicht (vgl.He<strong>im</strong>/ Schuller, 1992). Hieraus resultiert soziale Distanz zu vielen Patienten.<strong>Soziale</strong> Distanz macht sich u.a. an den sprachlichen Fähigkeiten fest. Die Arbeiten desSoziologen Basil Bernstein (1972) lenkten den Blick auf die unterschiedliche Struktur<strong>der</strong> Sprache in verschiedenen Schichten. Bernstein unterschied den restringierten undden elaborierten Code. Der restringierte Code wird hauptsächlich von traditionellen Arbeiterngesprochen, <strong>der</strong> elaborierte von Angehörigen <strong>der</strong> Mittelschicht. Auf Seiten <strong>der</strong>Ärzteschaft darf <strong>der</strong> elaborierte Sprachcode vorausgesetzt werden. Ohne hier auf dieBedeutung für die Sozialisation und Weichenstellungen durch Sprache für die Vermittlungvon Werten, Normen und Fähigkeiten eingehen zu können, sollen einige für unserThema relevante Erkenntnisse präsentiert werden.16
Hier einige Untersuchungsergebnisse zum Zusammenhang von Schichtzugehörigkeitund Sprachbarrieren aufgrund unterschiedlicher Sprachcodes:Soziokulturelle Sprachcodes:Restringierter Code: kurze, oftverblose Sätze; Dominieren desPräsens; seltene Verwendung vomKonjunktiv; keine scharfe Trennungvon persönlichen und unpersönlichenPronominaElaborierter Code: komplexere,vollständigere Sätze; Verwendungaller Zeitformen; Unterscheidungzwischen persönlichen und unpersönlichenPronomina; häufigerGebrauch von Konjunktiv und Adverbien;Verbalisierung von Handlungsabsichten(Siegrist 1995)vorzunehmen. Aufklärungsdefizitedagegengehen einhermit höherem physiologischen Stress, einer deutlichschlechteren Befindlichkeit und mehr Angst, einem höherenSchmerzmittelkonsum und mehr Komplikationen beiaufwendigen und schmerzhaften Diagnoseverfahren sowiein <strong>der</strong> postoperativen Phase. Auch die Complianceerweist sich als abhängig vom Grad <strong>der</strong> Informiertheit desPatienten (vgl. Siegrist 1995:247f.).Mit sinken<strong>der</strong> Sozialschicht und damit stärkererVerbreitung des restringierten Codes n<strong>im</strong>mt dieFähigkeit ab, eigene Absichten und Informationsbedürfnissebe<strong>im</strong> Arzt verständlich zu machen.Die Konsultationsdauer und die Quantität <strong>der</strong> vomArzt unaufgefor<strong>der</strong>t gegebenen Informationen sinkenebenso wie die Quantität <strong>der</strong> vom Patientengeäußerten Fragen und Erwartungen, dagegensteigt die durchschnittliche Wartezeit und Erwartungsenttäuschungseitens <strong>der</strong> Patienten. Dadurchentsteht u.a. ein Aufklärungsdefizit, dessen Folgenmessbar und schwerwiegend sind: Informationenseitens des Arztes bieten die Möglichkeit, die kritischeSituation, die eine Krankheit darstellt, zu bearbeitenund eine Selbstregulation <strong>der</strong> EmotionenCompliance:Bereitschaft zum Befolgen<strong>der</strong> ärztlichen Ratschläge/Verschreibungen, die diemedikamentöse Therapieund Lebensstilän<strong>der</strong>ungenbetreffen17
Abschließend soll eine Graphik einige Aspekte <strong>der</strong> Arzt-Patienten-Interaktion schematischzusammenfassen:Abb. 1.7: Modell Arzt-Patienten-Interaktion(Ahrens/Hasenbring in: Wilker u.a. 1994:250)Personen-VariablenProzess-VariablenErgebnis-VariablenArzt PatientAlterGeschlechtsozialeSchichtberuflicheSozialisationhealthbeliefsErwartungan Arzt undPatientErwartungan Arzt undPatientsoziale IntegrationallgemeineKenntnismedizinischesFachwissenaktiv/passiv/dominant/unterwürfigVerhaltensstile:Verhaltensstile:Führungsstil/ VerschreibungsstilSymptomeBeschwerdenKonsultationInstrumentariumVerstehenund Behalten<strong>der</strong>InformationBesorgtheitZufriedenheitComplianceGesundheit/Krankheit<strong>Soziale</strong> Belastungen <strong>im</strong> <strong>Kranken</strong>hausDie Institution <strong>Kranken</strong>haus hat zwei historische Wurzeln: Zum einen steht sie in <strong>der</strong>Tradition des christlichen Hospitals, das <strong>im</strong> Mittelalter entstand und verschiede Funktionenerfüllte. Das christliche Hospital war eine durch Spenden getragene, kommunalekaritative Einrichtung, die Witwen und Waisen, Pilgern und den Ärmsten <strong>der</strong> Gemeindeeine Unterkunft bot. Kranke wurde in aller Regel Zuhause o<strong>der</strong> ambulant behandelt, sodass das Hospital eher einem „Arbeitshaus“, als einem <strong>Kranken</strong>haus glich. Gebliebenist aus dieser Tradition aber das Verständnis des <strong>Kranken</strong>hauses als einer gemeinnützigen,karitativen Organisation.18
SystematischesAnstaltshandeln:♦ Definition eines kollektiven,verbindlichen Tagesablaufs;♦ Standardisierung von Verfahrensweisen;♦ Typisierung von Personen;♦ relative Unpersönlichkeitvon Beziehungsformen,fehlende Int<strong>im</strong>itätDie zweite Traditionslinie führt zurück zum Militärlazarett,das die erste Organisation war, die unseremheutigen <strong>Kranken</strong>haus nahe kommt. Entwickelthat sich das Militärlazarett aus <strong>der</strong> Notwendigkeit,große Mengen an Verwundeten in kurzenZeiträumen zu versorgen und die Militärärzte,Feldscher genannt, waren eine früh spezialisierteArztgruppe. Aus dieser Tradition stammen dashierarchische Gefüge mit Ober- und Unterarzt und<strong>der</strong> erwartete Gehorsam <strong>der</strong> Patienten ebenso wiedie Merkmale des Anstaltshandelns. Die sozialeAsymmetrie zwischen Patienten und Personal isthier bereits angelegt.(Siegrist 1995:246)Das <strong>Kranken</strong>haus als Organisation hat mehrereZiele, die teilweise in Wi<strong>der</strong>spruch zu einan<strong>der</strong>stehen. Als Gemeinwohlorganisation hilft das <strong>Kranken</strong>haus ohne Ansehen <strong>der</strong> Personund Kosten, als Dienstleistungsorganisation erbringt es Leistungen auf einem Markt, alsArbeitgeber ist es für die ökonomische Sicherheit seiner Angestellten verantwortlich undals Geschäftsbetrieb rücken die Bilanzen des Wirtschaftens in den Vor<strong>der</strong>grund. Aufgrunddieser Zielkonflikte werden Phänomene <strong>der</strong> kognitiven Dissonanz bei Mitarbeiter-Innen in <strong>Kranken</strong>häusern begünstigt. Die verschiedenen, oft als berechtigt anerkanntenZiele, lassen sich nicht miteinan<strong>der</strong> vereinbaren. Unwohlsein und ein schlechtes Gewissenführen zum Bemühen, die wahrgenommene Diskrepanz zu verringern. Dies geschiehthäufig mit Hilfe von Abwehrmechanismen. Ein Abwehrmechanismus ist die Rationalisierung,d.h. es werden <strong>im</strong> Nachhinein „vernünftige“ Begründungen für best<strong>im</strong>mteVerhaltensweisen gefunden. Ein an<strong>der</strong>er Abwehrmechanismus ist die Projektion, welchedie Verantwortung für die Zielkonflikte an die Außenwelt verweist.Die Organisationszwänge bleiben auch für die Patienten nicht folgenlos. Der BegriffHospitalismus wurde von dem Sozialpsychologen René Spitz in Untersuchungen überdie Folgen einer He<strong>im</strong>unterbringung von Säuglingen und Kleinkin<strong>der</strong>n geprägt. Mangelndesoziale Beziehungen, wenig emotionale Zuwendung und eine reizarme Umgebungführen nach Spitz zu deutlichen psychischen Störungen <strong>der</strong> betroffenen Kin<strong>der</strong>.Ähnliche Phänomene werden auch bei Langzeitpatienten in <strong>der</strong> Psychiatrie beobachtet.In verän<strong>der</strong>ter Form lassen sich diese Gedanken auch auf Erwachsene in <strong>Kranken</strong>häusernanwenden. Aufgrund <strong>der</strong> Organisationszwänge des <strong>Kranken</strong>hauses wie begrenzteRückzugschancen, ständige Störbarkeit, Wartezeiten, kurzfristige Verän<strong>der</strong>ungen geplanterBehandlungen, Unterbrechungen laufen<strong>der</strong> Behandlungen, fehlende freie Wahldes Arztes, sind die Einflusschancen des Patienten gering. Dies trägt zur Entstehungvon drei Begleiterscheinungen <strong>der</strong> Hospitalisierung bei: <strong>der</strong> relativen psycho-sozialenEntwurzelung, <strong>der</strong> relativen Entpersönlichung und <strong>der</strong> relativen Infantilisierung.Psycho-soziale Entwurzelung bezeichnet den Verlust <strong>der</strong> sozialen Bezüge wie <strong>der</strong>Wohnung, <strong>der</strong> Familie, <strong>der</strong> gewohnten Aktivitäten, aber auch <strong>der</strong> bisherigen sozialenStellung des Patienten. Die relative Entpersönlichung hebt ab auf die Autonomie-Einschränkung und die Umdefinierung <strong>der</strong> sozialen Identität des Patienten, die durchdie verlangte Unterwerfung unter die Organisationszwänge erfolgt. Die relative Infantilisierungschließlich bezeichnet die krankheits- und organisationsbedingte Regression in19
Krankheit kann, wie bereits oben gesagt, auch zuRückzug führen: Regression (regredi, lat.= zurückgehen)bezeichnet einen Rückschritt in frühere (kindliche)Verhaltensweisen, <strong>der</strong> in Kliniken geför<strong>der</strong>t wird durch:♦ Institutionelle <strong>Faktoren</strong> (alle wesentlichenEntscheidungen zum Tagesablauf sind den Patientenabgenommen)♦ Situative <strong>Faktoren</strong> (<strong>der</strong> Patient verbringt denganzen Tag <strong>im</strong> Bett und wird gepflegt) und♦ Individuelle <strong>Faktoren</strong> (z.B. sekundärer Krankheitsgewinn).eine kindliche Hilflosigkeit undPassivität, die durch den hohenGrad <strong>der</strong> Versorgung (bishin zum Gewaschenwerden)verstärkt wird (vgl. Rohde1975:197ff.). Das Phänomendes Hospitalismus hat sehrstarke psychische Komponenten,ausgelöst wird es allerdingsdurch (verän<strong>der</strong>bare)soziale Umstände.Es gibt eine Reihe weitererBelastungen des Patientendurch den <strong>Kranken</strong>hausaufenthalt. Diese zu kennen, ist vor allem wichtig, um den Patientenbesser verstehen zu können und den negativen Auswirkungen <strong>der</strong> Hospitalisierungentgegen zu wirken.Abb. 1.8: Belastungsfaktoren des <strong>Kranken</strong>hauses, auf die <strong>der</strong> Patient reagiert(Wilker u.a. 1994:221)ausschließlicheVerobjektivierungAnamnese und Erstuntersuchung<strong>im</strong>Mehrbettz<strong>im</strong>merIsolierungfehlendeInformationUnterordnungversus KritikräumlicheEngeDer Patientreagiert aufdie Hospitalisationsoziale Distanz undfremde SprachediagnostischtherapeutischeEingriffeniedrige Patientenpositionin Klinik-Hierarchienur krankheitszentrierte,entpersonalisierteBehandlungunverstandene VisiteMiterleben vonKrankheit und Tod20
1.4 Phase 4: Nach dem <strong>Kranken</strong>hausaufenthaltEin <strong>Kranken</strong>hausaufenthalt ist in einem gewissen Sinne ein „Höhepunkt“ innerhalb einer<strong>Kranken</strong>-<strong>Karriere</strong>. Er ist entwe<strong>der</strong> ein länger <strong>im</strong> Voraus terminiertes Ereignis o<strong>der</strong> einunerwartetes und plötzliches Geschehen, von beidem wird in <strong>der</strong> Regel eine Heilungo<strong>der</strong> zumindest spürbare Besserung erwartet. In vielen Fällen ist die Heilung nach einem<strong>Kranken</strong>hausaufenthalt aber noch nicht vollständig, in an<strong>der</strong>en Fällen wird sie niemehr erreicht werden können. Bei <strong>der</strong> zweiten Fallgruppe handelt es sich um den Vorgang<strong>der</strong> Rehabilitation und um Leben mit einer chronischen Krankheit o<strong>der</strong> einerBehin<strong>der</strong>ung. Allgemein wird Rehabilitation als „Wie<strong>der</strong>einglie<strong>der</strong>ung eines <strong>Kranken</strong>o<strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>ten in das berufliche und gesellschaftliche Leben“ (Lang/ Faller 1998:263)verstanden. Von Alleinstehenden abgesehen, ist Rehabilitation stets Familien-Rehabilitation und betrifft alle Lebensbereiche. Die folgenden Ausführungen befassensich mit den sozialen Einflüssen auf die Rehabilitation und den Umgang mit chronischerKrankheit.Abb. 1.9: Zur Definition von Behin<strong>der</strong>ung(Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 1994:25)Behin<strong>der</strong>ung (Disablement)Ursachen: Krankheiten o<strong>der</strong> angeborenes Leideno<strong>der</strong> äußere Schädigung (Verletzung)1Schaden(Impairment)2Individuelle/funktionelleEinschränkungen/ Fähigkeitsstörung(Disability)3<strong>Soziale</strong>Beeinträchtigung(Handicap)PersönlicheFolgenFamiliäreFolgenGesellschaftlicheFolgenEinschränkung <strong>der</strong> - Pflegebedarf - Fürsorgeanspruch- Unabhängigkeit - gestörte soziale - Produktivitätsverlust- Beweglichkeit Beziehungen - gestörte soziale Ein-- Freizeitaktivitäten - wirtschaftliche Be- glie<strong>der</strong>ung usw.- sozialen Integration lastungen usw.- wirtschaftlichen und beruflichenMöglichkeiten usw.21
Das Thema Rehabilitation und Leben mit einer chronischen Krankheit behandelt dieBewältigung von Krankheit. Eine Krankheit zu bewältigen heißt nicht zwangsläufig,dass man gesundet. Eine erfolgreiche Bewältigung von Krankheit liegt vor, wenn esgelingt, das gewohnte (o<strong>der</strong> gewünschte) Leben in möglichst vielen Bereichen wie<strong>der</strong>aufzunehmen o<strong>der</strong> aber einen neuen Lebensentwurf zu gestalten, <strong>der</strong> auf die verän<strong>der</strong>teAusgangslage Rücksicht n<strong>im</strong>mt.Abb. 1.10: Bedingungsfaktoren des Bewältigungsstils „Akzeptieren von Einschränkungenund Suche nach einer neuen Lebensperspektive(Kruse 1987b:364)Die Beziehung zumsozialen UmfeldErlebte "Integration" in Familie,Freundeskreis und Nachbarschaft:"Neubelebung" <strong>der</strong> Beziehungen.Die Gestaltung <strong>der</strong>UmweltNotwendigkeit- einer guten medizinischen Versorgung- einer finanziellen Sicherung, diees ermöglicht, sich noch Dingeleisten und Wünsche erfüllen zukönnen- eines Wohnumfeldes, das denindividuellen Bedürfnissen entspricht,Unabhängigkeit för<strong>der</strong>tund anregend wirktMöglichkeit- Aufgaben wahrzunehmen undVerantwortung zu übernehmen,soziale Kontakte zu findenLebensstilBiographische Verankerung<strong>der</strong> Bemühungen um "innere"/"äußere"Verän<strong>der</strong>ung;Bereitschaft zur Verän<strong>der</strong>ungund "Flexibilität".Akzeptieren <strong>der</strong> Grenzen und Suche nachneuen Möglichkeiten, die das Leben bietet.ZukunftsperspektiveSuche nach "tragfähiger"Zukunft – "abwartende"Einstellunggegenüber <strong>der</strong> Zukunft;"Offenheit aufZukunft hin".Deutung <strong>der</strong>eigenen LageÜberzeugung- "geschätzt" und "geachtet" zusein- gebraucht zu werden, "Kompetenzzu besitzen"- noch Aufgaben wahrnehmen zukönnen und Selbstverantwortungzu besitzen; - die Situationverän<strong>der</strong>n zu könnenThematische StrukturFähigkeit- zu einer "Neubewertung" zugelangen, "Kompromisse" zuschließen, Belastungen zukompensieren und zu transzendieren".Finden von neuenBezügen zu Mensch und Welt;Genüge finden <strong>im</strong> Wechsel vonArbeit und Ruhe- sich freuen können an den kleinenDingen, die <strong>der</strong> Alltag bietet.Bemühen um Aufrechterhaltungund Erweiterung des Interessenhorizontes22
Um eine Krankheit aktiv bewältigen zu können, muss zunächst einmal die Überzeugungbe<strong>im</strong> <strong>Kranken</strong> vorhanden sein, dass er seine Gesundheit überhaupt beeinflussen kann.Welche gesundheitliche Kontrollüberzeugung vorliegt, lässt sich mit dem sozialpsychologischenHealth Locus of Control (HLC) Modell messen. Im HLC-Modell wird ermittelt,wo <strong>der</strong> Betroffene den „Ort <strong>der</strong> Kontrolle“ einer Krankheit sieht. Dafür ergeben sichmindestens zwei Möglichkeiten: Eine externe Kontrollüberzeugung schreibt die Kontrolleüber den Fortgang, die Bewältigung <strong>der</strong> Krankheit an<strong>der</strong>en o<strong>der</strong> dem Schicksal bzw.Zufall zu. Die interne Kontrollüberzeugung sieht die Kontrollmöglichkeiten bei sichselbst, in <strong>der</strong> eigenen Person 5 . Angenommen wird, dass eine interne Kontrollüberzeugung,also die Überzeugung, dass die Gesundheit vom eigenen Handeln beeinflussbarist, eine wesentliche Bedingung für einen erfolgreichen Umgang mit Krankheit ist.Bei den gesundheitlichen Kontrollüberzeugungen lässt sich eine schichtspezifischeVerbreitung feststellen: Die meisten Untersuchungen konnten einen Zusammenhang<strong>der</strong> externen Kontrollüberzeugung und <strong>der</strong> Sozialschicht feststellen: Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> unterenSchicht vertreten häufiger eine externe Kontrollüberzeugung. Der Umkehrschluss,dass Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> oberen Schichten öfter eine interne Kontrollüberzeugung haben, istbislang nur schwach belegt worden, scheint aber plausibel. Glie<strong>der</strong>t man die Elemente,aus denen <strong>der</strong> Schichtindex gewonnen wird (Berufsstatus, Einkommen, Bildung) nach<strong>der</strong> Stärke ihrer Wirkung auf die Kontrollüberzeugung, dann ergibt sich die ReihenfolgeBeruf, Bildung, Einkommen (vgl. Janßen 2001:191).5 Das HLC-Modell wurde <strong>im</strong> <strong>Laufe</strong> seiner Nutzung weiterentwickelt, wobei beide D<strong>im</strong>ensionen weiteraufgeteilt wurden: Die externe D<strong>im</strong>ension in Autoritäten und Schicksal, die interne in Krankheitsprävention,Krankheitsbewältigung, Self-mastery und self-blame. Diese Unterteilungen erweisen sich allerdingsals nicht durchgehend trennscharf und beeinflussen sich gegenseitig. (vgl. Janßen 2001:185f.)23
2 "Biopsychosoziale"/ "Sozio-psycho-somatische"Gesamt-Diagnose und Sozialanamnese <strong>im</strong> Überblick(Alf Trojan und TutorInnenkreis)Die "Anamnese“ (Vorgeschichte des <strong>Kranken</strong>; von dem griechischen Wort für "sich erinnern")ist einerseits zwar nur eine von vielen Situationen, in denen <strong>der</strong> Arzt mit demPatienten redet. Es gibt jedoch mindestens drei Gründe, warum die Erst-Anamnese (<strong>im</strong><strong>Kranken</strong>haus: das "Aufnahmegespräch") die wichtigste Gesprächssituation überhauptdarstellt:♦ Weil hierbei (jedenfalls <strong>im</strong> Idealfall) ein Grundvertrauen zwischen Arzt und Patientals Basis für alle weiteren Gespräche geschaffen wird,♦ weil es (zumindest theoretisch) in den meisten Arzt-Patient-Begegnungen das umfassendsteund gründlichste Gespräch sein wird und vor allem♦ weil es überragende diagnostische und therapeutische Bedeutung hat.Von verschiedenen Autoren gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass in 50% bis 90%aller Fälle, insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Allgemeinmedizin und <strong>der</strong> Inneren Medizin, die Anamneseallein zur richtigen Diagnose ausreicht (von Troschke 1979, Gross 1969 u. 1971).Neben <strong>der</strong> Diagnose möglicher Belastungsfaktoren und Krankheitsursachen hat dieAnamnese auch zur Beurteilung <strong>der</strong> persönlichen Situation des Patienten große Bedeutung.Der Arzt erfährt etwas über:♦ Die Lebensgewohnheiten des Patienten, als wesentliche Bedingungen für Erfolgo<strong>der</strong> Misserfolg nachsorgen<strong>der</strong> und rehabilitativer Bemühungen,♦ die Chancen, nach einem <strong>Kranken</strong>hausaufenthalt zu Hause zurecht zu kommen,♦ das Ausmaß an "sozialen Ressourcen", die ihm für die bessere Bewältigung einerKrankheit zur Verfügung stehen.Was ein Patient <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Anamnese präsentiert, wird durch einige Best<strong>im</strong>mungsfaktorenbeeinflusst, die <strong>der</strong> Arzt kennen sollte, damit er ein anamnestischesGespräch richtig einordnen und bewerten kann (vgl. Gross 1969):♦ Die Vorstellung des <strong>Kranken</strong> über sein Leiden (Laienätiologie)♦ seine Wünsche und Befürchtungen♦ seine Ausdrucksmöglichkeiten♦ sein Vertrauen zum Arzt♦ seine Reaktionen auf dessen Verhalten.Das Ideal einer Anamnese ist eine "bio-psychosoziale Gesamtanamnese". In <strong>der</strong>Praxis kommt dies eher selten vor. Die soziale Situation des Patienten wird meist nurrud<strong>im</strong>entär mit einigen Grob-Indikatoren erfasst, die sowohl aus biologischen wie auch(meist aber weniger) aus Gründen einer psychosozialen Diagnose und Therapie erfragtwerden. "Alter" und "Krankheiten <strong>der</strong> Eltern" sind Beispiele dafür, dass <strong>der</strong> MedizinerMerkmale erfragt, um pr<strong>im</strong>är etwas über den erwartbaren körperlichen Zustand (Alter)und über mögliche erbliche Belastungen („Familien-Anamnese“ verkürzt auf „Krankheiten“<strong>der</strong> Eltern) zu erfahren, obwohl beide Merkmale natürlich auch soziale Informationenenthalten.24
In einer Sozialanamnese werden diese <strong>Faktoren</strong> als Einstiegsmöglichkeiten in eineumfassende und systematische Erhebung <strong>der</strong> Lebensgeschichte, <strong>der</strong> Lebensbedingungenund <strong>der</strong> <strong>Kranken</strong>geschichte erfragt, um daraus ggf. Rückschlüsse ziehen zu könnenfür notwendige problemadäquate psychische o<strong>der</strong> soziale Therapieansätze. Diesemweiten Verständnis des Begriffes steht eine häufig engere Auslegung in <strong>der</strong> Praxisentgegen: Neben den erwähnten <strong>Faktoren</strong> wird bestenfalls noch <strong>der</strong> Beruf erfragt.Wir verstehen den Ausdruck "Sozialanamnese“ als den zweiten großen Bereich neben<strong>der</strong> biomedizinischen Anamnese in einer Gesamt-Anamnese (vgl. Abb. 2.1).Abb. 2.1: Bio-psychosoziale (Gesamt-) AnamneseBiomedizinische Anamnese(psycho-)soziale AnamneseMedikamenten-AnamneseKrankheits-AnamneseEltern-Anamnesebiographische undPersönlichkeits-Anamnese<strong>Kranken</strong>-AnamneseberuflicheAnamneseFamilien-AnamnesePsychodynamischeAnamneseSexual-AnamneseDabei ist allerdings zu beachten, dass fachspezifische an<strong>der</strong>e Anamneseformen in <strong>der</strong>Praxis und in Lehrbüchern genannt werden, die jeweils nur auf einzelne Komponenten<strong>der</strong> Sozialanamnese fokussieren. Die wichtigsten Elemente und Erscheinungsformen<strong>im</strong> Zusammenhang <strong>der</strong> Sozialanamnese sollen <strong>im</strong> Folgenden kurz kommentiert werden.Aktuelle Anamnese:Momentane Beschwerden (zeitliches Auftreten, Qualität, Intensität, Lokalisation undAusstrahlung, Begleitsymptome, intensivierende, lin<strong>der</strong>nde <strong>Faktoren</strong>, Umstände desAuftretens u.a.m.).Eltern-Anamnese:Wird in <strong>der</strong> Praxis vor allem für das Erheben von Krankheiten bei den Eltern eines Patientenbenutzt, um Hinweise auf erbliche Belastungen zu bekommen.25
Familien-Anamnese:Eigentlich ein weiterer Begriff, <strong>der</strong> oft aber ebenso wie "Eltern-Anamnese" benutzt wird;<strong>im</strong> weiteren Sinne die Erhebung <strong>der</strong> familiären Lebensform (ob mit Eltern und eigenerFamilie, sozusagen "in Großfamilie" o<strong>der</strong> – als an<strong>der</strong>es Extrem – völlig allein gelebtwird.) Weitere mögliche Fragen richten sich auf die psychosoziale Situation <strong>der</strong> Eltern,soziale und familiäre Belastungsfaktoren, Erziehungsstil <strong>der</strong> Eltern, u.a.m.Biografische Anamnese (auch "Eigen"-Anamnese genannt)Dabei steht <strong>im</strong> Vor<strong>der</strong>grund zunächst einmal die "äußere Lebensgeschichte", d.h. diewichtigsten Daten von <strong>der</strong> Geburt bis zur Gegenwart, z.B. wo aufgewachsen, Kin<strong>der</strong>gartenund Schulbesuch, Abschlüsse, berufliche Ausbildung und Laufbahn, Familienstand,Kin<strong>der</strong>, Partnerschaft, Wohnsituation, Finanzen u.a.Psychodynamische Anamnese:Hierbei geht es vor allem um die "innere Lebensgeschichte" und dabei wie<strong>der</strong>um umdie Geschichte <strong>der</strong> Beziehungen zwischen dem Patienten und seinen nächsten Angehörigen,insbeson<strong>der</strong>e den Eltern, dem Partner und den Kin<strong>der</strong>n. Diese Form <strong>der</strong> A-namnese spielt eine beson<strong>der</strong>s große Rolle in Fächern, die psychotherapeutische undpsychiatrische Maßnahmen zur Verfügung haben, also Psychosomatik, Psychiatrie undbei den psychotherapeutisch-psychosomatisch orientierten Vertretern einzelner Fachdisziplinen(insbeson<strong>der</strong>e Innere, Haut, Gynäkologie, Allgemeinmedizin u.a.m.).Sexualanamnese:Spielt natürlich eine beson<strong>der</strong>s große Rolle, wenn Personen wegen sexueller Problemeeine Praxis aufsuchen, sollte jedoch auch bei zahlreichen an<strong>der</strong>en psychosomatischenFunktionsstörungen <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Frage nach Partnerschaften erhoben werden.Suchtanamnese:Bei den vielfältigen stofflichen und nicht-stofflichen Abhängigkeiten, denen ÄrztInnenbegegnen, ist die Suchtanamnese wichtige Grundlage für Diagnose- und Therapiechancen.Berufsanamnese:Spielt beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> Arbeits- und Umweltmedizin eine große Rolle. Neben den psychomentalenBelastungen (Handlungsspielräume, Eintönigkeit, Arbeitsplatz-Kl<strong>im</strong>a, Führungsverhalten<strong>im</strong> Betrieb, Arbeitsplatz-Zufriedenheit), wird auch nach physischen (z.B.Heben und Tragen) und chemischen Noxen (Umweltgifte am Arbeitsplatz) gefragt.Persönlichkeitsanamnese:Spielt beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> Psychiatrie und Psychotherapie eine große Rolle. Neben spontanenpersönlichkeitsrelevanten Schil<strong>der</strong>ungen <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> biografischen Anamnesewerden best<strong>im</strong>mte Aspekte (z.T. mit Fragebögen) zur Persönlichkeit erhoben: Umgangmit Wünschen/ Bedürfnissen, Umgang mit Gefühlen, Beziehungen zu an<strong>der</strong>en,Wertorientierungen, Beziehungen zu Ordnung und Moral, Wesenszüge <strong>im</strong> partnerschaftlich/familiären Verhalten, Wesenszüge <strong>im</strong> schulischen/beruflichen Verhalten, auffälligeZüge <strong>der</strong> Persönlichkeit, die in Extremform psychischen Störungen entsprechen.26
Fremdanamnese:Bei Bewusstlosen/ Bewusstseinsgetrübten, Notfallpatienten, Kleinkin<strong>der</strong>n, Debilen/Dementen, Unfallpatienten, müssen zur Krankheits- und <strong>Kranken</strong>geschichte Angehörige,Rettungssanitäter, Unfallzeugen, Polizisten und bei Unfällen (je nach Ort) auch Mit-Patienten o<strong>der</strong> Arbeitskollegen befragt werden.Krankheitsanamnese:Dabei wird eingeschränkt die Geschichte <strong>der</strong> Krankheit erhoben, was in best<strong>im</strong>mtensehr klaren Fällen auch ausreichend sein mag. Die vollständige biopsychosoziale A-namnese umfasst jedoch die gesamte Geschichte des <strong>Kranken</strong> (also nicht nur seinerKrankheit). Zur Krankheitsanamnese gehört auch die "Medikamenten-Anamnese", diebeson<strong>der</strong>s bei chronisch <strong>Kranken</strong> und alten Menschen sehr wichtig ist.Für das Erheben einer biopsychosozialen Gesamtanamnese, also einschließlichSozialanamnese o<strong>der</strong> einzelner spezifischer sozialer o<strong>der</strong> psychologischer Komponenten<strong>der</strong> Sozialanamnese, gibt es einige handfeste Gründe:Für die ambulante Medizin ist vielfach nachgewiesen, dass sich ein hoher Prozentsatz(je nach Praxis zwischen ein Drittel und zwei Drittel) aller Patienten, mit funktionellen/psychosomatischen/vegetativenBeschwerden an den Arzt wendet. Hinter diesenBeschwerden stecken oft psychosoziale Probleme.Untersuchungen in Allgemeinpraxen zeigen, dass ca. ein Drittel <strong>der</strong> Patienten unterKrankheiten leidet, die <strong>der</strong> sog. "kleinen Psychiatrie" zugerechnet werden: verschiedeneSüchte und Abhängigkeiten, Depressionen, Ängste, Zwangshandlungen und Persönlichkeitsstörungen.Depressionen gehören zu den häufigen Problemen. Ebenso wie Ängste, werden siedem Arzt häufig als somatische bzw. psychosomatische Störungen präsentiert. Die vielenchronischen Störungen, die <strong>der</strong> Arzt kontinuierlich betreuen muss, haben häufigpsychosoziale Begleitprobleme. Sowohl für die Prävention wie auch für die Rehabilitationspielen Risikofaktoren bzw. eine gesundheitsgerechte Lebensweise eine große Rolle.Auch <strong>im</strong> stationären Bereich zeigen Untersuchungen, dass bei 30% bis 60% <strong>der</strong> Erkrankungenpsychosoziale <strong>Faktoren</strong>, sei es bei <strong>der</strong> Entstehung o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Bewältigungchronischer Krankheiten, eine Rolle spielen.Indikationen für eine ausführliche Sozialanamnese sind insbeson<strong>der</strong>e:(nach Blohmke, 1979:34)♦ Erhebung von Informationen als Entscheidungsgrundlagen für Gutachten, z. B. zurEinstufung bei Pflegebedarf durch den MDK♦ „unklare“ Befunde (Beschwerden ohne diagnostischen Befund, wan<strong>der</strong>nde o<strong>der</strong> therapieresistenteSymptome, ungewöhnliche Symptomkonstellationen, chronischeVerläufe usw.)♦ so genannte Umwelt- o<strong>der</strong> Verhaltenskrankheiten♦ psychosomatische Krankheiten♦ Patienten mit offenkundigen psychosozialen Problemen (Bewohner von Obdachlosenunterkünften,Migranten, Abhängige usw.)27
Das entscheidende Kriterium für o<strong>der</strong> gegen die Erhebung einer umfassenden Sozialanamnesesollte die Verwendbarkeit <strong>der</strong> Informationen, d.h. die Wahrscheinlichkeit therapeutischerKonsequenzen sein.Ob eine Sozialanamnese erhoben werden kann, hängt auch davon ab, wie <strong>der</strong> Arzt dietherapeutischen Konsequenzen bzw. die Bereitschaft des Patienten dazu einschätzt.Neben <strong>der</strong> „Unklarheit“ von Befunden gibt es einige weitere Hinweise auf die soziopsychosomatischeGenese von Symptomen (vgl. Luban-Plozza 1998), die zu einer ausführlicherenpsychosozialen Anamnese führen sollten:♦ Das Fehlen organpathologischer Befunde und / o<strong>der</strong> objektivierbarer Funktionsstörungen;auffällige Diskrepanzen zwischen Befund und Beschwerden♦ die Vielfalt <strong>der</strong> Symptome und <strong>der</strong>en Heterogenität, die sich organmedizinisch nichtzu einer nosologischen 6 Einheit zusammenfügen lassen♦ rascher Wechsel <strong>der</strong> führenden Symptome♦ unscharf-nebulöse Beschwerdeschil<strong>der</strong>ungen♦ überdramatisierte Symptombeschreibungen, auffällig emotionale Schil<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>Beschwerden♦ aufweisbarer zeitlicher Zusammenhang zwischen Symptombeginn und signifikantenLebensereignissen, bzw. kritischen Situationen in <strong>der</strong> Biographie.Ablauf <strong>der</strong> AnamneseNatürlich sollte jedes rigide Schema <strong>im</strong> Erstgespräch mit den Patienten vermieden werden.Trotzdem ist folgende Reihenfolge – vorgeschlagen von dem erfahrenen KlinikerGross (1971) – sicher hilfreich:♦ Spontane Darstellung <strong>der</strong> Beschwerden durch den <strong>Kranken</strong>♦ ergänzende Fragen zu den Beschwerden, weiterführende Fragen, Fragen nach <strong>der</strong>vermuteten Ursache♦ Standardfragen nach wichtigen Körperfunktionen und nach Lebensgewohnheiten.♦ Fragen nach früheren Erkrankungen, Operationen usw.♦ Familienanamnese♦ Fragen nach <strong>der</strong> familiären, beruflichen usw. Situation.Für die Kooperation bei Sozialanamnesen sind insbeson<strong>der</strong>e wichtig:♦ DolmetscherInnen: wenn es sich um nicht-deutschsprachige MigrantInnen handelt.♦ Pflegepersonal: sofern eine Pflege-Dokumentation regelhaft zum Stationsbetriebgehört, sind darin auch sozialanamnestische Angaben enthalten.♦ SozialarbeiterInnen/ Sozialdienst <strong>im</strong> <strong>Kranken</strong>haus: werden insbeson<strong>der</strong>e beischwierigen Versorgungs-Problemen des Übergangs aus dem stationären Bereichnach Hause hinzugezogen, kennen aufgrund ihrer Profession auch generell das Instrument<strong>der</strong> „Sozialanamnese“.6 Nosologie = Krankheitslehre, die systematische Einordnung und Beschreibung von Krankheiten undKrankheitsformen (Teilgebiet <strong>der</strong> Pathologie)28
♦ Geriatrie: erhebt <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> <strong>im</strong>mer mehr zum Standard gehörenden geriatrischen„Assessments“ viele sozialanamnestische Daten (vgl. Teil 3 des Skripts).♦ Sozialversicherungsmediziner/ Medizinischer Dienst <strong>der</strong> <strong>Kranken</strong>kassen(MDK): Spezialisten für Sozialanamnesen, unter beson<strong>der</strong>en rechtlichen Aspekten(Gutachten), z.B. bei Begutachtung von Erwerbsunfähigkeit, für Schwerbehin<strong>der</strong>ten-Ausweis, von Pflegestufen u.a.m.Erst ein ganzheitlicher "sozio-psycho-somatischer" Ansatz, <strong>der</strong> soziale Risiko- undSchutzfaktoren berücksichtigt, ermöglicht eine wirklich patientenorientierte Medizin zubetreiben. Eine biomedizinisch eingeengte „krankheitsorientierte“ Medizin (o<strong>der</strong> gar eine„kostenorientierte“!) greifen zu kurz, um die psychosozialen D<strong>im</strong>ensionen vonKrankheiten richtig erkennen und behandeln zu können.Literaturangaben:Beyer, K. M. u.a.: Lehrbuch <strong>der</strong> Sexualmedizin. Urban & Fischer, München 2000Gross, R.: Die Anamnese aus <strong>der</strong> Sicht des Klinikers. In: Heite (Hg.): Anamnese. Methoden <strong>der</strong> Erfassungund Auswertung anamnestischer Daten. Schattauer, Stuttgart 1971Gross, R.: Medizinische Diagnostik. Grundlagen und Praxis. Springer, Berlin 1969 (insbes. S. 25-55)Luban-Plozza, B. u.a.: Der Arzt als Arznei. Das therapeutische Bündnis mit dem Patienten. DeutscherÄrzteverlag, Köln 1998Möller, H.-J., Lauks, G., Deister, H.: Psychiatrie und Psychotherapie. 2. Auflage. Thieme, Stuttgart 2001Odenbach, E.: Die diagnostische Bedeutung <strong>der</strong> Fremdanamnese. Monatskurse für die ärztliche Fortbildung.28 (1978) Nr. 3, S. 100-103Söllner, WQ., Wesiack, W., Wurm, B. (Hg.): Sozio-Psychosomatik. Gesellschaftliche Entwicklungen undpsychosomatische Medizin. Springer, Berlin 1989Troschke, J. v.: Sozialanamnese. In: Blohmke, M. u.a. (Hg.): Ökologischer Kurs: Teil Sozialmedizin. Enke,Stuttgart 197929
3 Klinische Sichtweisen psychosozialer <strong>Faktoren</strong>Die folgenden Seiten bieten Sichtweisen zu sozialen <strong>Faktoren</strong> und <strong>der</strong> Erhebung einer"Sozialanamnese" wie wir sie in medizinischen Lehrbüchern vorgefunden haben. Essind einige (wenige) Beispiele dafür, in welcher Weise unsere Themen <strong>im</strong> klinischenStudium wie<strong>der</strong> auftauchen.3.1 Sichtweise <strong>der</strong> Inneren MedizinQuelle: Classen, M., Diehl, V., Kochsiek, J.: „Innere Medizin“ – Lehrbuch. Urban & Schwarzenberg1998 (1. Auflage: 1991)Psychosomatische Grundlagen in <strong>der</strong> Inneren Medizin:“Ein Mensch erkrankt niemals nur in <strong>der</strong> biologischen D<strong>im</strong>ension. Vielmehr kann <strong>der</strong>menschliche Körper korrekt nur als innigst verwoben mit den seelischen, sozialen undgeistigen Aspekten <strong>der</strong> gesamten Person beschrieben werden. In <strong>der</strong> Sprache <strong>der</strong> Systemtheorieist <strong>der</strong> Körper ein komplexes Subsystem des Systems “Person“.(Classen u.a.: 1998: S. 14)Entsprechend den verschiedenen soziogenetischen Modellen von Gesundheit undKrankheita) soziologische Stresstheorienb) sozialisationstheoretische Ansätze undc) gesundheitssoziologische Ansätzelassen sich soziale <strong>Faktoren</strong> auch bei Classen, Diehl und Kochsiek identifizieren. AlsStressquellen werden bei Classen u.a. zum Beispiel genannt:a) Soziologische StresstheorienexternLeistungsanfor<strong>der</strong>ungenArbeitsplatzLärmEhescheidunginternKonflikte(z.B. Autonomie vs. Abhängigkeit)inakzeptable Triebregungenb) Sozialisationstheoretischer Ansatz♦ Ich-Struktur und –Funktionen♦ Stabiles Selbstbild und Selbstvertrauen♦ Vertrauensfähigkeit♦ erlernte Hilflosigkeit und Verantwortungsdelegation.c) Gesundheitssoziologischer Ansatz♦ Triebregulation♦ geringe Frustrationstoleranz♦ Quantität und Flexibilität von Stress-Bewältigungsstrategien (sind je nach Bildungsgrad,Einkommen und beruflicher Position verschieden).30
Den hohen oben angeführten Anspruch <strong>der</strong> Verwobenheit <strong>der</strong> seelischen mit den sozialenund geistigen Aspekten <strong>der</strong> gesamten Person relativieren die Autoren selbst, indemsie sagen, dass <strong>der</strong> Terminus “Psychosomatik“ nicht die Kluft überbrücken konnte, diezwischen den verschiedenen Wissenschaften und klinischen Disziplinen seit Aufwerfendes Leib-Seele-Problems besteht. <strong>Soziale</strong> Prozesse würden höchstens indirekt über diePsyche einbezogen. Weiterhin sagen sie, dass vielmehr jede Medizin gemeinhin psychosomatischsein sollte. Entsprechend wird als Ziel psychosomatischer Bemühungendie mehrd<strong>im</strong>ensionale Untersuchung genannt, um daran personale Zusammenhängezu rekonstruieren. Diese Zusammenhänge können infolge ihrer Entwicklung und dannKrankheit in “somatische“, “psychische“ und “soziale“ Anteile zerfallen sein, wozu nichtselten medizinische Interventionen und Institutionen aufgrund ihrer Vereinseitigungenbeigetragen haben.Kommentar: Die Betrachtung sozialer Aspekte bei <strong>der</strong> Anamnese scheint in diesemLehrbuch nur marginal zu sein. Der For<strong>der</strong>ung nach einer ganzheitlichen Betrachtungdes Systems “Person“ kommen die Autoren nicht in dem Maße nach, wie es ihre einleitendenWorte vermuten lassen.Abb. 3.1: Der Volksmund weiß, wie die Organe sprechen!31
3.2 Sichtweise <strong>der</strong> Psychosomatischen MedizinQuelle: Uexküll v. T. et al. (Hg.): „Psychosomatische Medizin“. Urban & Schwarzenberg 1990,4. Auflage (6. Auflage / 2003)“Die tief greifenden Verän<strong>der</strong>ungen von Morbidität und Mortalität während des zu Endegehenden Jahrhun<strong>der</strong>ts, mit dem drastischen Rückgang <strong>der</strong> Infektionskrankheiten einerseitsund <strong>der</strong> beschleunigten Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> menschlichen Umgebung an<strong>der</strong>erseits,haben die sozialen Gesundheitsdeterminanten gegenüber physisch-somatischenin den Vor<strong>der</strong>grund treten lassen. Auch individuelle Gesundheits- und Krankheitszuständelassen sich häufig nur <strong>im</strong> Zusammenhang mit soziokulturellen, u.a. biographischen,ethnischen und ökonomischen Umständen verstehen.“(Uexküll v.1990:45)Die Situation von Individuen mit sog. funktionellen Syndromen (keine, ihr Krankseinverursachenden, organischen Verän<strong>der</strong>ungen feststellbar) erweist sich nach Uexküll alsstark abhängig von den soziokulturellen Umständen, unter denen sie auftreten, insbeson<strong>der</strong>evom Vorhandensein o<strong>der</strong> vom Fehlen einer, für das betroffene Individuum“tragfähigen“ sozialen Umgebung, vor allem <strong>im</strong> Bereich <strong>der</strong> Familie und des Arbeitsortes.Ein zweiter Aspekt <strong>der</strong> Betrachtung sozialer Determination von Gesundheit undKrankheit ist die Fokussierung auf die sozialen Umstände <strong>der</strong> Gesundheitsversorgung.Uexküll spricht in diesem Zusammenhang von den Phänomenen <strong>der</strong> “Somatisierung“sowie – seltener – <strong>der</strong> “Psychologisierung“. Gemeint ist die Tatsache, dass das heutigebiotechnische Versorgungssystem - selbst bei <strong>der</strong> Ausprägung von funktionellen Syndromenund <strong>der</strong> Auswirkung auf sie - eine wesentliche Rolle spielt. Das heißt, das betroffeneIndividuum präsentiert sein Kranksein in <strong>der</strong> “Sprache“ des ihm zur Verfügungstehenden Versorgungssystems. In unserer Kultur überwiegend <strong>der</strong>jenigen <strong>der</strong> somatischorientierten biotechnischen Medizin sowie neuerdings zunehmend <strong>der</strong> Psychotherapie.Die <strong>im</strong> Lehrbuch dargestellte Anamneseerhebung wendet sich in erster Linie an Nichtpsychiater,obwohl grundsätzliche Aspekte <strong>der</strong> Technik nach Meinung des Autors auchfür das psychiatrische Interview gelten. Das psychoanalytische Interview bevorzugt “offene“Fragen (breiter Spielraum für Patient und Möglichkeit für den Interviewer, psychischeVorgänge <strong>im</strong> Patienten zu erkennen).Uexküll unterteilt das von ihm vorgeschlagene Interviewschema in zehn Schritte. Imachten Schritt erfragt <strong>der</strong> Arzt die sozialen Lebensumstände des Patienten, nachdem invorhergehenden Schritten bereits frühere Krankheiten, die Gesundheit seiner Angehörigenund seine persönliche Entwicklung geschil<strong>der</strong>t wurden.Im Folgenden sollen nach drei verschiedenen soziogenetischen Modellen von Gesundheitund Krankheit soziale Aspekte exemplarisch aufgeführt werden.32
a) Soziologische Stresstheorien♦ Ungelöste pathologische Trauerreaktionen (z.B. bei funktionellen Syndromen <strong>im</strong>gastrointestinalen Bereich)♦ Scheidung o<strong>der</strong> Trennung♦ lebensgeschichtlich wichtige Umstellungen (wie Pubertät, Heirat, Geburt von Kin<strong>der</strong>n,Kl<strong>im</strong>akterium und Alter)♦ funktionelle Oberbauchbeschwerden werden gehäuft bei Gastarbeitern mit Erstmanifestation3-6 Monate nach <strong>der</strong> Umsiedlung beschrieben♦ soziale Schicht bzw. sozialökonomischer Status (aus Beschäftigung, Schulbildung,Einkommen und Mietkosten ermittelt) hat den größten Einfluss auf die Ausbildungeiner Adipositaserkrankung (Adipositas ist bei Frauen mit niedrigem Status sechsmalhäufiger als bei Frauen mit hohem Staus)♦ Arbeitslosigkeit als Auslöser emotionaler Spannungszustände und physiologischerReaktionen♦ Schichtarbeit (Nachtarbeit kann psychische und soziale Folgen, sowie psychosomatischeStörungen nach sich ziehen).b) Sozialisationstheoretischer Ansatz♦ Frostige und spannungsgeladene Beziehungen <strong>im</strong> Elternhaus (Anorexia nervosa)♦ unpersönliche soziale Beziehungen (Migräne)♦ gehemmte Sexualität♦ eine überprotektive Haltung <strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong> (Anorexia nervosa)♦ eine ausgeprägte Rigidität <strong>der</strong> Familienorganisation (Anorexia nervosa)♦ Abwehr gegen die Übernahme weiblicher Rollenattribute (Anorexia nervosa).c) Gesundheitssoziologischer Ansatz♦ Unfähigkeit, Konflikte zu lösen (Patienten mit Hyperventilationssyndrom lösen ihrenKonflikt nicht, sie “atmen ihn ab“, bzw. “seufzen ihn aus“)♦ mit Panik konditionierte Reaktionen auf best<strong>im</strong>mte Situationen wie Menschenansammlungen,Lifte o<strong>der</strong> Autofahren (be<strong>im</strong> Hyperventilationssyndrom)♦ Umgang mit Ängsten (z.B. Kastrationsangst kann für die größere Verbreitung vasovagalerSynkopen bei Männern ursächlich sein)♦ geringe Frustrationstoleranz (Migräne)♦ Feindseligkeit, Abhängigkeit, Depressivität und eine Häufung psychosozialer Konflikte(Spannungskopfschmerz).Kommentar: Es ließen sich zwar noch eine Vielzahl an<strong>der</strong>er sozialer <strong>Faktoren</strong> aufzählen,die bei verschiedensten Krankheitsbil<strong>der</strong>n eine Rolle spielen. Die hier genanntenAspekte zeigen unseres Erachtens jedoch, dass Uexküll dem Anspruch <strong>der</strong> Aufwertungsozialer Gesundheitsdeterminanten gegenüber physisch-somatischen weitgehend gerechtwird.33
3.3 Sichtweise <strong>der</strong> Klinischen GeriatrieQuelle: Nikolaus, T. (Hg.) 2000: Klinische Geriatrie, Kap. 53 (nur ein Beispiel von vielen in diesemBuch)Gastroenterologische Erkrankungen„Eine genaue psychosoziale Anamnese des älteren Patienten mit gastrointestinalenBeschwerden ist sehr wichtig. Psychosoziale Stressoren können den älteren Patientenerheblich beeinträchtigen und letztendlich bis hin zur Depression führen. In einigen Fällensind die geschil<strong>der</strong>ten gastrointestinalen Beschwerden die Folge einer Somatisierungdieser Probleme. Relevante psychosoziale Probleme sind begründet z.B. <strong>im</strong> Verlustdes Ehepartners o<strong>der</strong> von Freunden, dem Verlust <strong>der</strong> Unabhängigkeit, finanziellerUnsicherheit, abnehmen<strong>der</strong> Gesundheit und Vitalität o<strong>der</strong> schwindenden intellektuellenFähigkeiten.Bei <strong>der</strong> Auswahl und Planung einer Behandlung von Patienten mit gastrointestinalenErkrankungen sollten deshalb eine koexistierende Erkrankung sowie auch die Auswirkungen,die eine gastrointestinale Erkrankung auf die Lebensqualität des Patienten hat,in Betracht gezogen werden. Das Therapieziel muss in Übereinst<strong>im</strong>mung mit den Aspektendes psychosozialen Patientenumfeldes und den Grundzügen einer sinnvollen<strong>Kranken</strong>versorgung sein. Zum Beispiel profitiert ein Patient mit einer terminalen Erkrankungo<strong>der</strong> einer an<strong>der</strong>en schwerwiegenden Grun<strong>der</strong>krankung von einer begrenztenDiagnostik und einer Therapie, die sich in Richtung einer Verbesserung <strong>der</strong> Lebensqualitätorientiert, mehr als von einer Vielzahl invasiver Diagnostiken, die dann auch nurselten eine behandelbare Erkrankung enthüllen.“3.4 Sichtweise <strong>der</strong> Allgemein-MedizinQuelle: Helmich, P. (Hg.): Allgemeinmedizin: Grundlagen hausärztlichen Handelns. Urban &Schwarzenberg, München 1993Anamnese„Anamnese ist die subjektive Schil<strong>der</strong>ung des Patienten über die Vorgeschichte seinerErkrankung.Ungefähr 70-80 % aller Diagnosen <strong>der</strong> Allgemeinpraxis können durch die Anamnesegeklärt werden. Zu den beson<strong>der</strong>en Voraussetzungen <strong>der</strong> Anamneseerhebung in <strong>der</strong>Allgemeinpraxis gehören: Langzeitkenntnis <strong>der</strong> Persönlichkeit des Patienten, meistlangjährige Kenntnis <strong>der</strong> gesamten Patientenlaufbahn und <strong>der</strong> persönlichen und sozialenLebenswelt des Patienten. Angesprochen werden die geklagten Störungen <strong>im</strong> medizinischen(auch langzeitigen), psychologischen und sozialen Kontext. Typisch allgemeinärztlichist die symptombezogene, gezielte Anamnese, die für die meisten Arzt-Patienten-Kontakte voll ausreicht. Einzuschätzen sind ferner Gesundheitsverhalten,Belastbarkeit, Erholungsfähigkeit und Compliance des Patienten. Ziele <strong>der</strong> Anamnesebestehen in: Diagnoseklärung <strong>im</strong> Sinne einer personenbezogenen Problembeschreibung,Angstmin<strong>der</strong>ung, Vertrauensbildung, Motivation und (Übergang zur Beratung)Information. Beson<strong>der</strong>e Bedeutung haben auch: Gewinnung anamnestischer Datendurch Bezugspersonen des Patienten, Arbeitsplatzanamnese und Gewinnung regionalerUmweltschädigungsdaten.“34
3.5 Sichtweise <strong>der</strong> Integrierten MedizinQuelle: Uexküll v. T. u.a. 2002: Integrierte MedizinDie integrierte Medizin will ganzheitlich denken und handeln, d.h. Störungen werden jenach Lage des Falles auf allen 3 Ebenen, <strong>der</strong> körperlichen, <strong>der</strong> psychischen und <strong>der</strong>sozialen, therapiert.Der folgende Überblick aus dem Buch zeigt dies. Er stellt gleichzeitig eine Art Checklistedar, an welche Ansätze für die Hilfe <strong>der</strong> Arzt denken muss:Therapeutisches Repertoire(die wichtigstenTherapie-Elemente <strong>der</strong> Burg-Klinik Stadtlengsfeld)Schwerpunkt medizinische VersorgungFachärztliche Therapieführung (Innere Medizin, Neurologie, Psychiatrie, Chirurgie, Gynäkologie,Pädiatrie, Kardiologie, Onkologie, Allgemeinmedizin) mit Spezialverfahren, z.B. Chemotherapie,Sauerstofftherapie, Phototherapie u.a.Spezialisierte <strong>Kranken</strong>pflege (Grundversorgung, psychosomatische Bezugspflege, Spezialpflegewie z.B. Stomaversorgung)Physiotherapie, einschließlich <strong>Kranken</strong>gymnastik mit umfassendem MethodenspektrumSport- und Bewegungstherapie mit zahlreichen Spezialisierungen für Wirbelsäulensyndrome,Arthrosekranke, Übergewichtige, Senioren, etc.Diätberatung und LehrkücheSchwerpunkte Psychotherapiepsychosomatische Grundversorgung (stützende Psychotherapie, Beratung, Gesundheitstraining)psychoanalytische Fokaltherapie, einschließlich diagnostischer Methoden und Supervisionpsychoanalytische Gruppentherapie, einschließlich Supervision und TeamarbeitVerhaltenstherapie als Einzel- und Gruppenbehandlung, z.B. Bewerbertraining, kognitivesTraining, suchtspezifische Gruppen, Selbstsicherheitstraining, jeweils einschließlich Teamarbeitund Supervisionthemenzentrierte Gruppentherapie (Krankheitsverarbeitung, Gesundheitstraining): Programmgruppenfür Jugendliche, Senioren, Psychose-Patienten, Depressive, Krebskranke, Tinnituskranke,Kopfschmerz-Patienten, etc.Entspannungstherapie (z.B. Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation, KonzentrativeEntspannung, Eutonie, Atemtherapie, Qigong)Kreative Therapie (Ergotherapie, Gestaltungstherapie, Musiktherapie, Tanztherapie)Schwerpunkt <strong>Soziale</strong> TherapieSozialberatung (Rechts-, Berufs-, Familien- und Versicherungsfragen; Renten- und Schwerbehin<strong>der</strong>tenrecht,etc.)soziale Therapie (Einzel- und Gruppenarbeit an häufigen sozialen Problemen wie Arbeitslosigkeit,sozialer Isolierung, Gesundheitstraining)berufliche Rehabilitation (Wie<strong>der</strong>einglie<strong>der</strong>ung, Umschulung, Berufsför<strong>der</strong>ung, Berufsfindung,etc.)Berufsbelastungserprobung in internen und externen Übungsarbeitsplätzenkognitives Training am PC35
Eine “<strong>Kranken</strong>geschichte“ aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> “Integrierten Medizin“ erfor<strong>der</strong>t umfassendeAnamnesen <strong>im</strong> Sinne einer bio-psycho-sozialen Gesamtdiagnose.Der folgende kurze Überblick zu „reflektierten Kasuistiken“ zeigt die beson<strong>der</strong>e Sichtweise<strong>der</strong> Integrierten Medizin und gibt Einblick in das zugrunde liegende Theoriemodell.Die Systematik ähnelt einer Einteilung, wie sie aufbauend auf den Lehren MichaelBalints entstand: Krankheits-zentrierte Diagnose, Patienten-zentrierte („Gesamt“-) Diagnose(d.h. erweitert um die psychosoziale <strong>Kranken</strong>geschichte) und „Beziehungs-Diagnose“ („Interrelations-Diagnose“). (M.B. Clyne in: „6 Minuten pro Patient“ Balint und Balint:Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1997:206-130)Der hier wie<strong>der</strong>gegebene kurze Auszug ist als Anreiz zum Selbststudium zu verstehen!Glie<strong>der</strong>ung Reflektierter KasuistikenQuelle: T. v. Uexküll u.a. Integrierte Medizin, 2002Als didaktisches Modell für Reflektierte Kasuistiken hat es sich bewährt, die <strong>Kranken</strong>geschichteeines Patienten als eine Geschichte darzustellen, die aus drei verschiedenen, aber einan<strong>der</strong>ergänzenden Kapiteln besteht:1. Die Geschichte einer Krankheit als Geschichte eines "offenen Systems": Hier werdenSymptome eines Patienten nach dem biotechnischen Modell <strong>der</strong> Medizin verstanden, also alsWirkung einer <strong>im</strong> Körper verborgenen Ursache, die es aufzufinden und zu beseitigen gilt (Modelldes Organismus als triviale Maschine bzw. als offenes System).2. Die Geschichte eines kranken Menschen als Geschichte eines "geschlossenen Systems":Hier werden Symptome eines Patienten verstanden als Zeichen für eine Passungsstörungauf o<strong>der</strong> zwischen den somatischen, psychischen und sozialen System-Ebenen, die es zuverstehen gilt.3. Die Geschichte einer Arzt-Patienten-Beziehung als Geschichte <strong>der</strong> Kommunikationzwischen zwei "geschlossenen Systemen": Welche Aufgaben muss <strong>der</strong> Arzt übernehmen,um zur Entwicklung einer neuen salutogenen Passung beizutragen? Entscheidend für den Therapieerfolgist dabei, inwieweit es Patient und Arzt gelingt, eine gemeinsame Wirklichkeit aufzubauen,einen bipersonalen Kode zu entwickeln und sich dadurch auf einen Behandlungsauftragzu einigen, <strong>der</strong> z.B. einen Eingriff in den Körper des Patienten o<strong>der</strong> – um das gesamte Spektrummedizinischer Interventionen anzudeuten – eine psychotherapeutische Behandlung o<strong>der</strong>mehrere dieser Interventionen zum Inhalt haben kann. Reflektiert wird die Beziehung zwischenArzt und Patient <strong>im</strong> Hinblick auf ein gemeinsames lernendes Modell, mithilfe dessen es gelingtbzw. misslingt, pathologische Passungsstörungen zu überwinden. Entscheidungskriterien, welcherInterpretant in welcher Situation einer Arzt-Patienten-Beziehung hilfreich ist, ergeben sichaus <strong>der</strong> Frage, wodurch Integration <strong>im</strong> Sinne von Autonomie- und Selbstorganisation auf <strong>der</strong>jeweiligen Subsystem- und Organismus-Ebene am ehesten geför<strong>der</strong>t werden kann. Dabei muss<strong>der</strong> Behandlungsauftrag zwischen Patient und Arzt unter dem Aspekt <strong>der</strong> Möglichkeiten und <strong>der</strong>Kosten stets neu ausgehandelt und formuliert werden. Die angemessene Reflexion dieses Auftrags– nämlich <strong>der</strong> Aufträge des Patienten einerseits und <strong>der</strong> Reaktion des Patient-Umweltsystems auf unsere Intervention an<strong>der</strong>erseits – unterscheidet integriertes Handeln vonpseudowissenschaftlicher Beliebigkeit. Für eine Integrierte Medizin ist die Orientierung an denBedürfnissen und Werten des Patienten wesentlich. Der Patient wird so zum aktiven Mitgestalterdes Diagnostik- und Therapieprozesses. Die jeweilige Dynamik therapeutischer Beziehungenverdichtet sich meistens in sehr intensiven kurzen Momenten, in denen Passungsstörungenzwischen Therapeut und Patient gemeinsam aktiv hergestellt, gemeinsam erfahren undevtl. gemeinsam überwunden werden können. Daher ist die Beschreibung solcher Mikroszenenin Reflektierten Kasuistiken von zentraler Bedeutung.36
4 Frage- und Dokumentationsbögen zur AnamneseDie folgenden Seiten bieten Beispiele für die Thematisierung <strong>der</strong> Erhebung einer Sozialanamneseund sozialer <strong>Faktoren</strong> von Erkrankungen in verschiedenen Bereichen:♦ Psychosomatische Klinik (Lübeck)♦ Pflege-Dokumentation♦ Geriatrie/ Gerontologie (Freiburg)4.1 Psychosomatische Klinik (Lübeck)Quelle: Prof. H. Feiereis, Medizinische Universität LübeckGlie<strong>der</strong>ung einer bio-psycho-sozialen Anamnese:♦ Gegenwärtige Beschwerden und Anamnese♦ Bisher festgestellte Befunde♦ Bisher erfolgte Therapie: medikamentös, physikalisch, psychotherapeutisch u.a.♦ Frühere Krankheiten, früher festgestellte Befunde♦ Objektivierung durch Beiziehung früherer Unterlagen♦ Berufliche Entwicklung und gegenwärtiger sozialer Status♦ Familienanamnese♦ Beziehungen zu den Mitmenschen in Familie, Beruf, Freizeit♦ Erkennbare aktuelle o<strong>der</strong> frühere Konflikte♦ Verlust- o<strong>der</strong> Trennungserlebnisse♦ Auslösende Ereignisse in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Beginn <strong>der</strong>Krankheit♦ Subjektives Erleben <strong>der</strong> Krankheit♦ Eigene Vorstellungen des Patienten über Entstehung und Art seiner Krankheit♦ Persönlichkeitsstruktur des Patienten♦ Fragen des Patienten♦ Gedanken über ergänzende diagnostische Maßnahmen und Differentialdiagnose♦ Empfindungen in <strong>der</strong> Gegenübertragung des Arztes♦ Notwendige Initialtherapie37
4.2 Pflegedokumentation (UKE)38
4.3 Geriatrie/ Gerontologie (Freiburg)Quelle: ZGGF, Zentrum für Geriatrie und Gerontologie: Das Freiburger Assessment NetzwerkEs wird zunächst <strong>der</strong> Fall geschil<strong>der</strong>t und diagnostiziert; auf den folgenden Seiten folgtdas Assessment <strong>im</strong> Original.Kasuistik: Frau K.Frau K., eine 75jährige Patientin, erleidet am 14.10.98 einen apoplektischen Insult mitbrachiofacialer Hemiparese rechts (Pat. ist Rechtshän<strong>der</strong>in) und globaler Aphasie. AnVordiagnosen sind eine arterielle Hypertonie, eine absolute Arrhythmie bei Vorhoffl<strong>im</strong>mern,eine Hypakusis (Schwerhörigkeit) beidseits und eine Adipositas bekannt.Bei sofortiger stationärer Aufnahme zeigt sich <strong>im</strong> Schädel-CT keine Blutung, aber eineleichte Schwellung <strong>der</strong> linken Hemisphäre und verstrichene Sulci. Keine Demarkierungeines umschriebenen Infarktareals. Im Kontroll-CT vom 16.10.98 stellt sich ein scharfumschriebenes Infarktareal, dem Stromgebiet <strong>der</strong> A. cerebri media links entsprechend,dar.Letzte Medikation bei stationärer Aufnahme: Captopril 25mg 1-1-0Am 19.10.98 Anfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Station zur Festlegung des Proce<strong>der</strong>e für die frühe geriatrischeRehabilitation.DiagnosenSchaden (Impairment)ICD-10:(ICD=International Classification of Diseases)Linkshemisphärischer Insult mit brachiofacialer Hemisparese re. und Aphasie (I63.4)Arterielle Hypertonie (I10)KHK (=koronare Herzkrankheit) mit absoluter Arrhythmie bei Vorhoffl<strong>im</strong>mern (I25.9)Adipositas (E66)Hypakusis bds. (H91.9)ICIDH:(ICIDH= International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)Fähigkeitsstörungen / Einschränkungen (Disabilities):Im Sprechen (F20-22); <strong>im</strong> Hören (F23-34), in <strong>der</strong> Kommunikation (F28-29),in <strong>der</strong> persönlichen Hygiene (F33-34), <strong>im</strong> Ankleiden (F35-36), in <strong>der</strong> sonstigen Ernährungund sonstigen Selbstversorgung (F37-39),in <strong>der</strong> Fortbewegung (F40-45) sowie einschränkende Fähigkeitsstörungen (F46-49),in <strong>der</strong> körperlichen Beweglichkeit (F50-57) undin <strong>der</strong> Geschicklichkeit (F60-66)Beeinträchtigungen (Handicaps):<strong>der</strong> physischen Unabhängigkeit (B2.2), <strong>der</strong> Mobilität (B3.2), <strong>der</strong> Beschäftigung (B4.5)und <strong>der</strong> sozialen Integration (B5.4)40
Beurteilung (Ziele, Maßnahmen)Ziele und Maßnahmen (nach Erstbeurteilung):Ziele:- Frau K. ihrem Wunsch gemäß die Rückkehr in die eigene Wohnung ermöglichen mit Hilfevon ambulanten Unterstützungssystemen- Verbesserung <strong>der</strong> finanziellen SituationMaßnahmen:• Erstantrag auf Einstufung nach <strong>der</strong> Pflegeversicherung• Zur Verbesserung <strong>der</strong> finanziellen Situation Antrag auf Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung undRezeptgebührenbefreiung• Information und Beratung <strong>der</strong> Tochter über Vorsorgevollmachten und rechtliche Betreuung• Für die häusliche Versorgung:- Pflegedienst/MSD- Hausnotruf- Essen auf Rä<strong>der</strong>n unter Berücksichtigung <strong>der</strong> vegetarischen Gewohnheiten- Wohnraumberatung für räumliche AnpassungsmaßnahmenErgebnis (nach Zweitbeurteilung):Frau K. konnte mit Hilfe von ambulanten Unterstützungssystemen wie<strong>der</strong> in ihre Wohnung zurückkehren. Eswerden folgende Hilfsdienste von ihr in Anspruch genommen:- Ein ambulanter Pflegedienst leistet die Grund- und Behandlungspflege morgens.- Essen auf Rä<strong>der</strong>n erhält sie von Mo. – Fr. An den Wochenenden kocht ihre Tochter.- Wegen Aspirationsgefahr wird sie während <strong>der</strong> Mahlzeiten (3x tgl.) von Mo. – Fr. von einemZivildienstleistenden des MSD betreut.- Ein Hausnotrufgerät wurde installiert, vor allem, um Frau K. die Sicherheit zu geben, <strong>im</strong>Notfall jemanden zu erreichen.- Eine Wohnraumberatung hat stattgefunden, die Stolperfallen wurden beseitigt, <strong>im</strong> Badwurden Haltegriffe angebracht.An den Wochenenden kümmert sich die Tochter um Frau K. und erledigt Einkäufe. Die Putzhilfe kommtweiterhin 1 x pro Woche.Auch konnte die finanzielle Situation gebessert werden: Frau K. erhält jetzt Wohngeld Antrag auf Rezeptgebührenbefreiung wurde genehmigt Frau K. wurde von den Rundfunkgebühren befreit und erhält Vergünstigungen <strong>im</strong> Telefondienst(Sozialtarif)Der Erstantrag auf Einstufung bei <strong>der</strong> Pflegekasse wurde gestellt, eine Einstufung ist noch nicht erfolgt.Wegen des relativ hohen Unterstützungsbedarfs von Frau K. besteht die Gefahr, dass je nach Einstufung,ein nicht gedeckter Betrag an Kosten für Pflege und Betreuung entsteht. Deshalb wurde vorsorglich einAntrag auf Hilfe zur Pflege nach §§ 68 ff. BSHG gestellt.___________________________________UnterschriftAnzahl <strong>der</strong> KontakteUnterscheidung inInsgesamt mit Patientin Angehörigen Sonstige telefon. Kont. persönl. Kont.44
5 Sozialtherapeutische Handlungsmöglichkeiten<strong>im</strong> Überblick(Alf Trojan und TutorInnenkreis)Für die Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> sozialtherapeutischen Handlungsmöglichkeiten kann man sichan den Sequenzen des Krankheits- und Behandlungsverlaufs orientieren, wie sie häufig(aber natürlich nicht regelhaft!) ablaufen:♦ krankheitsunspezifische Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,♦ medizinische und nicht-medizinische Prävention,♦ Kuration,♦ Rehabilitation,♦ Pflege.Die möglichen Ansätze psychosozialer Interventionen lassen sich meist mehreren <strong>der</strong>Sequenzen zuordnen o<strong>der</strong> gelten oft sogar für alle <strong>der</strong> genannten Abschnitte eines langen,chronischen Verlaufs.5.1 Vorbeugen ist besser als Heilen: Gesundheitsför<strong>der</strong>ungund PräventionPr<strong>im</strong>ärprävention:Verhin<strong>der</strong>ung des Neuauftretens von Erkrankungen durch Ausschaltung von Krankheitsursachen/ Risikofaktoren vor dem Auftreten einer manifesten Schädigung. Dabeikann man noch nach den zwei wichtigsten Handlungsebenen unterscheiden:Verhalten:Verhältnisse:Unterstützung (Beratung, Motivation, praktische Anleitung) <strong>der</strong>Versicherten bei <strong>der</strong> Vermeidung bzw. völligen Aufgabe gesundheitsschädigen<strong>der</strong>Verhaltensweisen undÄn<strong>der</strong>ung von Strukturen und Abläufen innerhalb <strong>der</strong> materiellenund sozialen Umwelt (Organisationen, Betriebe, Schulen, Stadtteileusw.) mit dem Ziel <strong>der</strong> vorbeugenden Ausschaltung von Gesundheitsgefahren.Die pr<strong>im</strong>äre Prävention kann man auch definieren als Versuch, die Auftretenshäufigkeitenvon Krankheiten (Inzidenz) zu senken. Als wichtigste Maßnahmentypen lassen sichunterscheiden:♦ Medizinische Maßnahmen (Impfungen),♦ pädagogische Maßnahmen (Ernährungsberatung, Raucherberatung, Sexualberatung,u.a.),♦ hygienische Maßnahmen (Reinheitsüberwachung von Luft, Wasser, Erde; <strong>Kranken</strong>haushygiene,etc.),♦ politische Maßnahmen (z.B. Verbote, Anreize durch Steuern; Gesetze; Gestaltung<strong>der</strong> Arbeits-, Wohn-, Umwelt-, Lebensbedingungen)45
Pr<strong>im</strong>ärpräventive Handlungsstrategien:Strukturelle Prävention bzw. Verhältnisprävention mit den beiden Unterfunktionen:♦ Gesetzliche Maßnahmen (partielles Rauchverbot, Versteuerung von Genussmitteln,Verbot des Alkoholverkaufs an Autobahnraststätten, Arbeitsschutzverordnungenetc.).♦ Organisatorische Maßnahmen (z.B. Än<strong>der</strong>ung des Kantinenessen in Betrieben, Einführungvon Betriebssport, Stressbewältigungsprogramme, präventive Aktionen vonz.B. Bürgerinitiativen o<strong>der</strong> Selbsthilfevereinigungen).Gruppen- und/ o<strong>der</strong> individuenzentrierte Verhaltensprävention:♦ Gesundheitserziehung (Eltern, Kin<strong>der</strong>garten, Schule)♦ Gesundheitsaufklärung (Medien, Erwachsenenbildung)♦ Gesundheitsberatung (verschiedene Berufsgruppen, u.a. Ärzte).Sekundärprävention:Sekundärprävention geht von vorhandenen Risikofaktoren o<strong>der</strong> einer noch symptomlosenSchädigung aus und versucht, dem Eintreten <strong>der</strong> manifesten Erkrankung mit gezieltenMaßnahmen vorzubeugen. Hierzu gehören alle Vorsorgeuntersuchungen undScreening-Programme. Die Maßnahmen können von einer gruppenbezogenen Betrachtungausgehen (z.B. dem Risikofaktor Bewegungsmangel bei Busfahrern) o<strong>der</strong> von einerindividuellen Betrachtung (die Suche nach Patienten mit überhöhtem Blutdruck).Tertiärprävention:Tertiärprävention wird häufig mit Rehabilitation gleichgesetzt. Das präventive Elementbesteht darin, dass bei chronisch <strong>Kranken</strong> einer Verschl<strong>im</strong>merung bzw. einem Fortschreiten<strong>der</strong> Krankheit vorgebeugt werden soll und durch gezielte Maßnahmen negativeKrankheitsfolgen auf <strong>der</strong> sozialen, psychischen und physischen Ebene <strong>der</strong> Krankheitverhin<strong>der</strong>t werden sollen.Tertiärprävention bezieht sich also darauf, Chronifizierung, Progredienz, Rückfälle,neue Krankheitsschübe und unnötiges Leiden zu verhin<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> zu verringern.Gesundheitsför<strong>der</strong>ung:Stärkung von (relativ krankheitsunspezifischen) Ressourcen (individuellen, sozialenund institutionellen) für die Gesun<strong>der</strong>haltung und Gesundheitsverbesserung. SoweitGesundheitsför<strong>der</strong>ung sich an Gesunde richtet, handelt es sich um pr<strong>im</strong>äre Prävention.An<strong>der</strong>erseits kann Gesundheitsför<strong>der</strong>ung auch bei chronisch kranken Menschen eineRolle spielen, insbeson<strong>der</strong>e als Vermeidung von Rückfällen, Vermeidung von Folgeerkrankungeno<strong>der</strong> Beeinträchtigungen, Verbesserung einzelner D<strong>im</strong>ensionen von Gesundheit(insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> psychischen und sozialen D<strong>im</strong>ension) und an<strong>der</strong>es mehr.Insofern handelt es sich bei Gesundheitsför<strong>der</strong>ung um die Stärkung von Wi<strong>der</strong>standsressourcengegen Krankheiten und Krankheitsfolgen, d.h. um einen Ansatz, <strong>der</strong> in allenSequenzen <strong>der</strong> <strong>Kranken</strong>-<strong>Karriere</strong> eine Rolle spielen kann und sollte.46
Die Rolle des einzelnen Arztes in diesem Bereich bezieht sich vor allem auf seine Funktionals "Gesundheitsberater". Dabei geht es einerseits um die Vermittlung von gesundheitsrelevantenInformationen. Hauptziele sind, persönliche Ressourcen zustärken bzw. "protektive <strong>Faktoren</strong>" besser zur Geltung zu bringen und Risikofaktoren zuverringern. Diese Präventionsmaßnahmen gehen in <strong>der</strong> Regel von Annahmen aus, dievon empirisch untersuchten "Modellen" zu Erklärung gesundheitsrelevanten Verhaltensabgeleitet worden sind (vgl. zu solchen Modellen die entsprechenden Lehrbücher, z.B. Siegrist1995:167 ff.).Während bei <strong>der</strong> Verhaltensprävention fast alle Ärzte gefor<strong>der</strong>t sind, gibt es spezifischeärztliche Gruppen, die für die Verhältnisprävention eine beson<strong>der</strong>e Rolle spielen.Dies sind insbeson<strong>der</strong>e Arbeits-, Umwelt- und Sozial-Mediziner. Diese Ärzte sind häufigin Betrieben o<strong>der</strong> Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitswesens beschäftigt.Für die Gesundheitsför<strong>der</strong>ung ist <strong>der</strong> so genannte "Setting-Ansatz" von beson<strong>der</strong>erBedeutung. Das Setting (ursprüngliche Wortbedeutung: Schaubühne) bezeichnet diejenigensozialen Systeme bzw. Lebensbereiche, in denen Menschen einen sehr großenTeil ihrer Zeit verbringen (insbeson<strong>der</strong>e Arbeitsplatz z. B. <strong>Kranken</strong>haus, Schule, Gemeinwesen<strong>im</strong> Sinne von Lebensumfeld). In diesen Bereichen wirken sowohl das Verhaltenwie auch Verhältnisse auf die Gesundheit ein. Entsprechend richten sich Gesundheitsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmensowohl auf diese beiden Ebenen wie auch auf allePersonengruppen, die in so einem Setting zu tun haben, also z.B. in <strong>der</strong> Schule nichtnur auf Schülerinnen und Schüler, son<strong>der</strong>n auch auf Lehrerinnen und Lehrer.47
5.2 Hilfe zur SelbsthilfeHilfe zur Selbsthilfe ist ein altes Prinzip in den helfenden Berufen ganz allgemein. Esgeht davon aus, dass Menschen niemals nur krank, schwach, gebrechlich, unfähig usw.sind, son<strong>der</strong>n auch stets gesunde Anteile und Kompetenzen haben, an denen man anknüpfenkann. Ein weiterer Ausgangspunkt ist, dass Hilfen gar nicht ohne das aktiveZutun <strong>der</strong> Patienten zur Wirkung gebracht werden könne (Das beginnt mit <strong>der</strong> Einnahmevon Medikamenten und wird in beson<strong>der</strong>em Maße erfor<strong>der</strong>lich, wenn es darumgeht, gesundheitsschädigendes Verhalten zu beenden.). Ansätze in diesem Zusammenhangsind:EmpowermentEmpowerment zielt auf die För<strong>der</strong>ung und Erweiterung <strong>der</strong> Selbstgestaltungskräfte <strong>der</strong>Menschen ab. Die Empowerment-Perspektive erweitert den Blick auf die Ressourceneines Menschen und lenkt die Aufmerksamkeit auf den sozialen Kontext, die sozialstrukturellenGegebenheiten und die „Gemeinschaft“, also auf das Zusammenspiel vonpersonalen und sozialen Selbsthilfemöglichkeiten. Normalerweise werden dabei dreiHandlungsebenen miteinan<strong>der</strong> verknüpft: die individuelle Ebene, die Gruppen-Ebeneund die strukturelle Handlungsebene. Ein Schlüsselbegriff für professionelles Empowermentist das soziale Netzwerk und die daraus resultierende Möglichkeit von Netzwerkför<strong>der</strong>ung.PatientInnen-Autonomie stärkenDer Grundgedanke ist ähnlich wie bei Selbsthilfe und Empowerment. Der Fokus ist an<strong>der</strong>s:Während es bei <strong>der</strong> Selbsthilfe überwiegend um Aktivitäten jenseits des Gesundheitssystemsgeht, meint das Schlagwort "Patienten-Autonomie" die Stärkung <strong>der</strong> Rolle<strong>der</strong> PatientInnen <strong>im</strong> Gesundheitssystem. Grundlegend hierfür sind leicht zugängliche,qualitätsgeprüfte Informationen für PatientInnen. Abb. 3.3 zeigt Kriterien, die PatientInnenhelfen, schlechte Informationen (z.B. <strong>im</strong> Internet o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Medien) zu erkennen.Abb.5.1:Discern-Kriterien zur Beurteilung <strong>der</strong> Qualität von Gesundheitsinformation(vgl. Diercks u.a. 2001:144)Gesundheitsinformationen sollen:1. Klare Ziele haben2. Ihre Ziele erreichen3. Für den Nutzer relevant sein4. Ihre Informationsquellen klar benennen5. Den Zeitpunkt, an dem die zugrunde gelegten Informationen / Studien veröffentlicht wurden, benennen6. Ausgewogen und unbeeinflusst sein7. Zusätzliche Informationsquellen anführen8. Auf Bereiche von Unsicherheit hinweisen9. Die Wirkung eines Behandlungsverfahrens beschreiben10. Den Nutzen eines Behandlungsverfahrens beschreiben11. Die Risiken eines Behandlungsverfahrens beschreiben12. Die Folgen einer Nicht-Behandlung beschreiben13. Auswirkungen von Handlungsverfahren auf die Lebensqualität beschreiben14. Verdeutlichen, dass mehr als ein mögliches Behandlungsverfahren existieren könnte15. Eine partnerschaftliche Entscheidungsfindung m. d. Arzt (shared-decision-making) unterstützen48
Ein weiteres wichtiges Konzept ist das "shared-decision-making" von ÄrztInnen undPatientInnen. Der/die "mündige" Patient/in, könnte man auch sagen, ist dafür Voraussetzungund Ziel, - <strong>im</strong> Gegensatz zu paternalistisch bevormundeten PatientInnen.Abb. 3.4 stellt die Aufgaben <strong>der</strong> ExpertInnen (=ÄrztInnen) und NutzerInnen(=PatientInnen) in zwei Modellen <strong>der</strong> Entscheidungsfindung über therapeutische Prozessedar.Abb. 5.2: Modelle <strong>der</strong> Entscheidungsfindung(vgl. Ballard-Reisch 1990 in: Diercks u.a. 2001:90)PhaseAufgaben <strong>der</strong>ExpertInnenI. Diagnostik Informationen sammelnInformationen interpretierenII. BehandlungsalternativenIII. Entscheidungüber das Verfahren/die BehandlungAlternativen bedenkenErfolgskriterien für eine BehandlungaufstellenAlternativen abwägenAlternativen auswählenZust<strong>im</strong>mung einholenBehandlung durchführenErfolg evaluierenAufgaben <strong>der</strong>NutzerInnen(Paternalismus)Informationen gebenZust<strong>im</strong>mung gebenBehandlung durchführen(lassen)Aufgaben <strong>der</strong>NutzerInnen(shared-decision)Informationen gebenPräferenzen nennenFragen stellenErfolgskriterien für eine BehandlungaufstellenZusätzliche Informationsquellenhinzu ziehenAlternativen auswählenZust<strong>im</strong>mung gebenBehandlung durchführen(lassen)Erfolg evaluieren (Outcome,Zufriedenheit, Lebensqualität)"Patienteninformationen als Qualitätsverbesserung":Quelle: Klemperer 1996:22-27"Wollen die Ärzte in Anwendung eines patientenzentrierten Qualitätsbegriffs die Entscheidung<strong>im</strong> Dialog mit dem Patienten finden, müssen sie best<strong>im</strong>mte Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln,in erster Linie <strong>im</strong> kommunikativen Bereich. Das Training dieser Fertigkeiten ist bis jetztin den Lehrplänen <strong>der</strong> medizinischen Fakultäten nicht ausreichend verankert.Der Patient steht daher vor <strong>der</strong> schwierigen Aufgabe, diesen Dialog einzufor<strong>der</strong>n und dem Arztseine Erwartungen und Fragen mitzuteilen.Dazu muss <strong>der</strong> Patient lernen, die Fragen, die für ihn die Qualität einer Maßnahme ausmachen,an den Arzt zu stellen:♦ Welchen Nutzen verspricht die Maßnahme?♦ Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Nutzen erlange (ausgedrückt in einerZahl)?♦ Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Nachteil erleide (ausgedrückt in einerZahl)?♦ Will ich – nachdem mir die Antworten vorliegen – überhaupt den Nutzen erlangen und willich die damit verbundenen Risiken in Kauf nehmen o<strong>der</strong> verzichte ich auf die Maßnahmeund nehme die damit evtl. verbundenen Risiken in Kauf?49
Vermittlung an SelbsthilfegruppenFür fast alle Krankheiten und viele psycho-soziale Probleme gibt es Selbsthilfegruppen.Für die entsprechenden Arbeitsschwerpunkte sollten ÄrztInnen mit den lokalen Selbsthilfegruppenzusammen arbeiten. Sie können sich aber auch an die nächste Selbsthilfe-Kontakt- und Informationsstelle (KISS) wenden.Abb.5.3:Aufgaben einer SelbsthilfekontaktstelleNetzwerkför<strong>der</strong>ungDamit sind alle Ansätze gemeint, die <strong>der</strong> Stärkung persönlicher Netzwerke (Bezugspersonenund Bezugsgruppen) dienen. Je größer, je kompetenter, je engagierter, je qualifizierterdas soziale Netzwerk eines Patienten ist, desto mehr Hilfe und Unterstützungkann er aus diesem Netzwerk erfahren. Im weiteren Sinn ist damit auch die Unterstützungvon kleinen sozialen Netzen <strong>im</strong> Gemeinwesen, also z.B. von Selbsthilfegruppen,Bürger-Inititativen, Laienhelfergruppen etc., gemeint.50
PatientInnenschulungenGrundlegendes Ziel ist es hierbei, den Patienten zu lehren, mit einer chronischen Erkrankungleben, statt sich in Depressionen, Selbstmitleid und Wunschdenken zu flüchten.In vielen Fällen stehen aber auch ganz praktische Vermittlungsaufgaben <strong>im</strong> Zentrumeiner Patientenschulung (z.B. Umgang mit <strong>der</strong> eigenen Kontrolle <strong>der</strong> Krankheit unddie richtige Ernährung bei Diabetikern). Patientenschulungen sind Aufklärungen überUrsachen und Auslösefaktoren, Ausräumung von Risikofaktoren und Aufbau gesundheitsför<strong>der</strong>licherVerhaltensweisen und Lebensstile (Verringerung von Nikotin- und Alkoholgenuss,Verbesserung <strong>der</strong> Ernährung und <strong>der</strong> körperlichen Bewegung, Stressbewältigungstrainings,Angstreduktion (z.B. durch Entspannungstechniken), frühzeitigesErkennen drohen<strong>der</strong> Krankheitsverschl<strong>im</strong>merungen o<strong>der</strong> –schübe und Erlernen deskompetenten Umgangs mit <strong>der</strong> eigenen Krankheit). Teilweise können solche Patientenschulungenin einzelnen, spezialisierten Praxen durchgeführt werden (z.B. bei Diabetes)..LiteraturempfehlungBroschüre: Patientenkompetenz„Wertvolle, praxisnahe Informationenzur Steigerung von Patienten-Autonomie und –Kompetenz <strong>im</strong>ärztlichen Alltag!“Herausgeberanschrift:Weleda AGMöhlerstr. 3D-73525 Schwäbisch GmündTel: 07171-919-555Fax: 07171-919-226www.weleda.deEmail: med-wiss@weleda.deDie Broschüre kann unter <strong>der</strong> angegebenenAdresse kostenlos bestelltwerden!51
5.3 Integrierte Medizin und PsychotherapieEng miteinan<strong>der</strong> verknüpft sind alle Versuche, den Dualismus Körper vs. Seele in <strong>der</strong>Medizin aufzuheben. Folgerichtig spielt <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> "Psycho-Somatik" eine große Rolledabei. Manchmal wird <strong>der</strong> Begriff auch erweitert zur "Sozio-Psycho-Somatik" o<strong>der</strong> zur"bio-psycho-sozialen"-Medizin. Stärker als <strong>im</strong> Studium gibt es systematische Angebote<strong>der</strong> ärztlichen Fort- und Weiterbildung durch die Ärztekammern, insbeson<strong>der</strong>e:♦ Curriculum „psychosomatische Grundversorgung“♦ Im Curriculum sind v.a. enthalten die Basisdiagnostik <strong>der</strong> wichtigsten psychischenund psychosomatischen Störungsbil<strong>der</strong>, die Basistherapie, meist als erweitertesGespräch mit dem Patienten verstanden, sowie die Kooperation mit verschiedenenan<strong>der</strong>en Berufsgruppen und Spezialisten. (vgl. Literaturhinweise am Ende dieses Textes)♦ Curriculum „psychosomatische Grundkompetenz“♦ Dies ist <strong>der</strong> Ausdruck für gleichsinnige Kenntnisse in verschiedenen Facharztweiterbildungen.Ein Curriculum dafür wurde vom Deutschen Kollegium für PsychosomatischeMedizin (DKPM) entwickelt und enthält 10 Std. allgemeine psychosomatischeTherapie, 30 Std. praktische Übungen zur Gesprächsführung sowie 10 Std. spezifischespsychosomatisches Wissen <strong>der</strong> einzelnen Facharztdisziplinen. Wie auch beidem Curriculum für die psychosomatische Grundversorgung wird mit diesem Baustein<strong>der</strong> Facharztweiterbildung die Berechtigung erworben, best<strong>im</strong>mte Ziffern fürGespräche mit Patienten abrechnen zu können (EBM-Ziffern 850 und 851). Allerdingsist die systematische Berücksichtigung dieses Curriculums in den Facharztausbildungennoch nicht so weit integriert wie wünschbar.♦ (Deutsches Ärzteblatt, Nr. 55, 09.11.2001, Jg. 98. Siehe auch Text über psychosomatischeGrundkompetenz von K. Fritzsche, 2002 <strong>im</strong> Anschluss an diesen Text.)Integrierte MedizinIntegrierte Medizin ist die Überschrift für einen Ansatz, <strong>der</strong> den Patienten nicht in einen"kranken Körper ohne Seele und eine beschädigte Seele ohne Körper“ spaltet, son<strong>der</strong>nden ganzen Menschen in den Mittelpunkt des diagnostischen und therapeutischen Interaktionsprozessesstellt und wird daher oft auch als "patientenzentrierte Medizin" ü-berschrieben. Dieses Konzept ist von einer Gruppe um den Nestor <strong>der</strong> deutschsprachigenPsychosomatik Thure von Uexküll entstanden (vgl. Uexküll, Geigges, Plassmann, Hg.:Integrierte Medizin. Modell und klinische Praxis, Schattauer, Stuttgart, 2002).PsychotherapieNatürlich spielt die Psychotherapie bei <strong>der</strong> Behandlung von psychisch und/o<strong>der</strong> sozialverursachten Problemen eine Rolle. Über die verschiedenen Ansätze und Formen gibtes auch geson<strong>der</strong>te Lehrveranstaltungen in <strong>der</strong> Klinik durch die Fächer Psychosomatikund Psychiatrie. Die Möglichkeiten und Grenzen <strong>der</strong> Psychotherapie zu kennen, gehörtzum unabdingbar wichtigen Wissensschatz eines Arztes. An<strong>der</strong>erseits sind psychischeHilfen in vielen Fällen auch <strong>im</strong> Vorfeld professioneller Psychotherapie möglich. Einedem Einzelfall angemessene, verständnisvolle Gesprächsführung kann bei vielen Menschenäußerst hilfreich sein. Die Grenzen zwischen psychischer Unterstützung, psychosozialerBeratung und "kleiner Psychotherapie" sind in <strong>der</strong> Praxis fließend.52
5.4 <strong>Soziale</strong> TherapieAls soziale Therapie können alle Ansätze bezeichnet werden, die auf eine Verbesserung<strong>der</strong> sozialen Situation eines Patienten gerichtet sind. Der Arzt kann häufig durchAtteste und Begutachtungen dazu beitragen, dass Patienten in den Genuss best<strong>im</strong>mtersozialer Leistungen kommen (z.B. <strong>der</strong> beruflichen und sozialen Rehabilitation, Verbesserungendurch Anerkennung des Schwerbehin<strong>der</strong>tenstatus u.a.m.).Hierzu gehören auch die bewussten Bemühungen des Arztes, sozialen Ausschluss,Statusverlust, Abwärtsmobilität, soziale Isolation und Stigmatisierung zu verringerno<strong>der</strong> zu vermeiden. Beson<strong>der</strong>s wichtig sind aber alle Versuche des Arztes, densozialen Rückhalt bzw. die soziale Unterstützung <strong>im</strong> sozialen Umfeld (in den "sozialenNetzwerken") zu stärken.„<strong>Soziale</strong> Unterstützung“ meint insbeson<strong>der</strong>e♦ emotionalen Rückhalt (Wertschätzung <strong>der</strong> Person, Zuneigung, Vertrauen, Interesse,Zuwendung),♦ Rückhalt durch Anerkennung (Bestätigung, Feedback, positive soziale Vergleiche),♦ Rückhalt durch Information (Tipps, Hinweise, Ratschläge),♦ instrumenteller Rückhalt (z.B. Einkaufshilfen, Unterstützung be<strong>im</strong> Gang zu Behörden,be<strong>im</strong> Ausfüllen von Anträgen, etc.).Am Beispiel psychisch Kranker lässt sich beson<strong>der</strong>s gut zeigen, wie komplex dasNetz <strong>der</strong> Laien und professionellen Institutionen ist, mit denen ÄrztInnen in <strong>der</strong> Sozialtherapiezusammen arbeiten müssen.Abb. 5.4: Das Netz psychiatrischer Rehabilitation (Hoffmann u.a.1994:58 in: Waller 2002)WohnachsePr<strong>im</strong>äres soziales NetzArbeitsachseeigene WohnungWohngemeinschaftPensionWohnhe<strong>im</strong>Notwohnungbei ElternPartnerFreundeam ArbeitsplatzNachbarnFamilieArbeitsstelle in <strong>der</strong> WirtschaftBeschützende ArbeitsplätzeReha-TrainingszentrenGeschützte WerkstattTagesstätteLANGZEITBETREUERTEAMRehabilitationsteamRun<strong>der</strong> TischPatientenclubGemeinschaftszentrenVereineKlinikTagesklinikKriseninterventionsstationHausarzt, PsychotherapeutVormundSozialdiensteInvalidenversicherungArbeitsamtFreizeitan<strong>der</strong>e med. Dienste53Behörden
SozialberatungSozialberatung richtet sich vor allem auf die Erhaltung und Wie<strong>der</strong>gewinnung <strong>der</strong> sozialenKompetenzen und sozialen Integration von hilfsbedürftigen Patienten. Sie wird vonverschiedenen Berufsgruppen und Institutionen (insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Rehabilitation)gewährt. Auch die Ärzte spielen natürlich dabei eine Rolle. Sie müssen zumindest in<strong>der</strong> Lage sein, die relevanten Probleme <strong>im</strong> familiären, häuslichen, finanziellen, beruflichen,schulischen, umwelt- o<strong>der</strong> persönlichen Bereichen (wie <strong>der</strong> geistigen und körperlichenEntwicklung) und Selbsthilfekompetenzen zu erkennen und auf die entsprechendenPersonen o<strong>der</strong> Institutionen zu verweisen. Hilfreich dabei ist ein Modell von v.Troschke (1979), das <strong>im</strong> Zusammenhang eines Konzeptes für die Sozialanamnese unddie Konsequenzen daraus entwickelt wurde. Aus <strong>der</strong> folgenden Übersicht gehen diewichtigsten Kooperationspartner eines Arztes hervor.Abb. 5.5: Modell <strong>der</strong> Kooperationspartner eines Arztes(nach v. Troschke 1979)BERATUNGSSTELLENSOZIAL-BERATUNGSozialamt, SozialhilfeSozialstationen, AltenpflegePsychosoz. B.Ehe-, Fam. B.Lebens B.Sexual B.Schwangersch. B.Drogen B.Erziehungs B.Telefonseelsorge51FREI PRAKTIZIERENDE ...PsychotherapeutenPsychosom. ÄrztePsychiaterPsychagogenLogopädenVerhaltenstherapeutenTel.KURAUFENTHALTE82PSYCHOSOMATISCHE U.PSYCHIATRISCHE KLINIK:KKBfALVA6A R Z T3LVABfAArbeitsamtUMSCHULUNG704ärztliche Gesprächeund <strong>der</strong>en Supervisionz.B. durch sog.BalintgruppenSELBSTHILFEGRUPPENAnonyme AlkoholikerAnonyme NeurotikerSeniorengruppen54
Soziotherapie„Soziotherapie“ ist ein Ausdruck, <strong>der</strong> <strong>im</strong> Sozialgesetzbuch V, § 37a vorkommt. DerAusdruck wird hier in <strong>der</strong> gesetzlichen Regelung sehr eng auf Versicherte bezogen, diewegen schwerer psychischer Krankheit nicht in <strong>der</strong> Lage sind, ärztliche o<strong>der</strong> ärztlichverordnete Leistungen selbständig in Anspruch zu nehmen. Diese haben Anspruch aufSoziotherapie, wenn dadurch <strong>Kranken</strong>hausbehandlung vermieden o<strong>der</strong> verkürzt wirdo<strong>der</strong>, wenn diese geboten aber nicht durchführbar ist. Die Soziotherapie umfasst dabeidie <strong>im</strong> Einzelnen erfor<strong>der</strong>liche Koordinierung <strong>der</strong> verordneten Leistungen sowie Anleitungund Motivation zu <strong>der</strong>en Inanspruchnahme. (vgl. ausführlicher Sielaff 2002)Das Charakteristische an weitergehenden "sozialtherapeutischen Aktionen" ist,dass sie in vielen Fällen über Interaktionen mit den <strong>Kranken</strong> hinaus reichen, d.h. Beeinflussungsozialer Verhältnisse erfor<strong>der</strong>n. Für grundlegende strukturelle Verän<strong>der</strong>ungenund Verbesserungen sind politische und gesetzgeberische Maßnahmen häufig nötig.Dies hat schon den berühmten Zellularpathologen und engagierten SozialmedizinerRudolf Virchow zu <strong>der</strong> Erkenntnis geführt: "Politik ist nichts an<strong>der</strong>es als Medizin <strong>im</strong>Großen!". (vgl. Bauriedel 1989)Weil Ärzte häufig in ihrer Praxis die negativen Auswirkungen von unzulänglichen sozialenund politischen Verhältnissen erfahren, sind viele von ihnen in <strong>der</strong> Vergangenheit<strong>im</strong>mer wie<strong>der</strong> engagierte Befürworter für soziale und politische Verän<strong>der</strong>ungen geworden.Auch heute gehört unseres Erachtens die Rolle des Arztes als Anwalt für gesundheitsför<strong>der</strong>licheLebensverhältnisse und Lebensweisen zu einem ganzheitlichenVerständnis <strong>der</strong> Arztrolle. Praktisch kann man dies aber auch als Bürger in verschiedenenInitiativen und Gruppen tun. In Hamburg (aber auch in vielen an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>nund Städten) gibt es auch Verbände von professionellen Institutionen und Personen,die sich diesem Ziel verpflichtet fühlen. Eine davon ist die Hamburgische Arbeitsgemeinschaftfür Gesundheitsför<strong>der</strong>ung (HAG e.V.).55
5.5 Bevölkerungsmedizin/ Public Health/ Bekämpfung sozialerUngleichheitBevölkerungsmedizin und Public Health zielen vor allem darauf ab, dass Maßnahmenentwickelt und durchgeführt werden, die sich nicht unmittelbar an das Individuumrichten, son<strong>der</strong>n auf die Bevölkerung, die Öffentlichkeit allgemein. Die Ursprünge liegenin <strong>der</strong> frühen "Sozialmedizin" und "Sozialhygiene" des vergangenen und vorvergangenenJahrhun<strong>der</strong>ts. Die ursprünglich ausschließlich pathogene Sichtweise wurde inzwischendurch eine salutogenetische Perspektive, d.h. die Frage nach den <strong>Faktoren</strong>, dieGesundheit för<strong>der</strong>n können, ergänzt. Eine aktuelle umfassende Definition lautet:Public Health ...... umfasst alle analytischen und organisatorischen Anstrengungen, die sich mit <strong>der</strong> Erkennungvon Gesundheitsproblemen, ihrer Beseitigung o<strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>ung befassen.Public Health bezieht sich auf Populationen und organisierte Systeme <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,<strong>der</strong> Krankheitsverhütung (Prävention), <strong>der</strong> Krankheitsbekämpfung, <strong>der</strong> Rehabilitationund <strong>der</strong> Pflege. Die gewählten Mittel sollen dabei angemessen, wirksam undökonomisch vertretbar sein. Public Health hat sich dem Ziel verpflichtet, die Gesundheitsverbesserungdurch Bedarfs-, Bedürfnis-, Ressourcen- und sozial adäquate Anstrengungen<strong>im</strong> jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Kontext zu erreichen.(Schwartz u.a. 1998:2-3)Da das Medizinstudium die hierfür notwendigen Kenntnisse nur in allgemeinen Grundzügenbehandelt, gibt es inzwischen in Deutschland 7 Orte, an denen man als Arzt (zusammenmit Graduierten aus an<strong>der</strong>en Studiengängen) ein Postgraduierten-Studium inPublic Health absolvieren kann.Bekämpfung sozialer Ungleichheit...... <strong>im</strong> Gesundheitsbereich gehört zu den Aufgaben von Public Health. In <strong>der</strong> internationalenDiskussion haben sich vier Typen von Ansatzmöglichkeiten herauskristallisiert:♦ Verbesserung von Ausbildung, Beschäftigungs- und Einkommensraten <strong>der</strong> ärmstenBevölkerungsgruppen. Dieses ist <strong>der</strong> fundamentalste und natürlich auch schwierigsteAnsatz. Er entspricht ziemlich genau dem, was Rudolf Virchow vor über 150 Jahrenangesichts <strong>der</strong> Typhusepidemie in Schlesien als "Medizin" empfahl: "Bildungund Wohlstand".♦ Verringerung <strong>der</strong> Effekte von Krankheit auf soziale Abwärtsmobilität, d.h. den Abstiegin eine niedrigere soziale Schicht durch Verarmung aufgrund von Krankheiten.Dieses Problem könnte sich durch Privatisierungstendenzen in <strong>der</strong> "solidarischen"<strong>Kranken</strong>versicherung in Zukunft sehr viel verschärfter als heutzutage darstellen.♦ Verringern, dass benachteiligte Gruppen beson<strong>der</strong>s stark und häufig gesundheitsschädlichenBelastungen ausgesetzt sind. Dies bezieht sich natürlich insbeson<strong>der</strong>eauf physische Umwelt- und Verkehrsbelastungen sowie soziale Benachteiligungenv.a. ökonomischer Art.♦ Angebot spezifischer Gesundheitsdienste für niedrige sozio-ökonomische Gruppen.Dieser Ansatz ist <strong>der</strong> relativ einfachste. Er richtet sich darauf, die Zugangsbarrierenzum Gesundheitssystem, z.B. für Obdachlose, Drogenabhängige und an<strong>der</strong>e stigmatisierteGruppen herabzusetzen.56
♦ Das Dilemma all dieser Ansätze ist, dass viele potentiell vermeidbare soziale Determinantengesundheitlicher Störungen gesellschaftlich als akzeptabel gelten unddaher keinen politischen Handlungsdruck erzeugen. Als akzeptabel gelten: gesundheitsschädigendesVerhalten "aus freiem Willen" (teilweise aber unter dem Drucksozialer Verhältnisse), gesundheitliche Vorteile für Gruppen, die gesundheitsför<strong>der</strong>ndesVerhalten bevorzugt praktizieren (also für die Mittelschichten), gesundheitsschädigendesVerhalten durch sozio-ökonomisch eingeschränkte Wahlmöglichkeiten<strong>der</strong> Lebensweise, Exposition gegenüber erhöhten gesundheitlichen Gefahrenin <strong>der</strong> physischen und sozialen Umwelt, sowie höhere Zugangsschwellen zurgesundheitlichen Versorgung.Eine "kompensatorische" Politik, d.h. eine Politik, die soziale Ungleichheit durch Umverteilungvon Ressourcen kompensiert, stellt sich heute unter den Bedingungen <strong>im</strong>mer„ärmerer“ öffentlicher Haushalte als äußerst schwierig dar.Unser sicher an vielen Stellen noch sehr allgemein gehaltener Überblick ist an dieserStelle zu Ende. Insbeson<strong>der</strong>e in den Public Health-Fächern (s. Abb. 3.8) werden Siespäter <strong>im</strong> Studium spezielles Wissen zu den angesprochenen Themen erwerben.Abb. 5.6: Public Health Aspekte <strong>im</strong> Medizinstudium(nach Schwartz u.a. 2003)Public HealthArbeitsmedizinToxizität vonArbeitsstoffenBerufskrankheitenArbeitsplatzbelastungenund -schutzEpidemiologieGesundheitsökonomiemedizinische VersorgungSozialmedizinPräventionRehabilitationsoziale SicherungHygieneUmwelthygieneSozialhygieneöffentlichesGesundheitswesenMedizinstudium57
Literaturangaben:Arbeitsgemeinschaft <strong>der</strong> Spitzenverbände <strong>der</strong> <strong>Kranken</strong>kassen: Weiterentwicklung <strong>der</strong> Prävention undGesundheitsför<strong>der</strong>ung in Deutschland. Vorstellungen <strong>der</strong> Spitzenverbände <strong>der</strong> <strong>Kranken</strong>kassenvom 22.05.2002. ManuskriptBauriedl, T.: Soziopsychosomatik: Die Erweiterung <strong>der</strong> Psychosomatik um ihre politische D<strong>im</strong>ension. In:Söllner, W., Wesiack, W., Wurm, B. (Hg.): Sozio-Psycho-Somatik. Gesellschaftliche Entwicklungenund psychosomatische Medizin. Springer Verlag, Heidelberg 1989Brähler, E., Decker, O., Strauss, B., von Troschke, J. (Hg.): Skriptum zur Medizinischen Psychologie undMedizinischen Soziologie. Neuer Gegenstandskatalog. Psychosozialverlag, Gießen 2002Bundesärztekammer: Curriculum psychosomatische Grundversorgung. Basisdiagnostik und Basisversorgungbei Patienten mit psychischen und psychosomatischen Störungen einschließlich Aspekten<strong>der</strong> Qualitätssicherung. Deutscher Ärzteverlag. Texte und Materialien, Bd. 15, 2001Dierks, M. L. u.a.: Patientensouveränität. Der autonome Patient <strong>im</strong> Mittelpunkt. Akademie für Technikfolgenabschätzungin Baden-Württemberg. Bd. Nr. 195, 2001Grünberg, H.-W. v.: Das psychotherapeutische Gespräch in <strong>der</strong> Sprechstunde des Hausarztes. Abgrenzunggegen die Psychotherapie durch den Spezialisten. Deutsches Ärzteblatt Nr. 10,08.05.1985 (Jg. 82), S. 666-670Klemperer, D.: Qualität in <strong>der</strong> Medizin. Der patientenzentrierte Qualitätsbegriff und seine Implikationen.Dr. med. Mabuse, Jan./Febr. 1996, S. 22-27Lenz, A., Stark, A. W. (Hg.): Empowerment. Neue Perspektiven für psychosoziale Praxis und Organisation.Verlag Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie, Tübingen 2002Lerch, M., Dierks, M. L.: Tabelle 2: DISCERN-Kriterien zu Beurteilung <strong>der</strong> Qualität von GesundheitsformationenIn: Dierks, M. L. u.a.: Patientensouveränität. Der autonome Patient <strong>im</strong> Mittelpunkt.Ortmann, K., Kleve, H.: Sozialmedizin in <strong>der</strong> Sozialarbeit – ein Schlüssel für die Weiterentwicklung gesundheitsbezogenerSozialarbeit. Das Gesundheitswesen 62, 2002), Manuskript <strong>im</strong> AndruckSchiffner, K.: Möglichkeiten psychosozialen Handelns in <strong>der</strong> ärztlichen Praxis. Deutsches Ärzteblatt Nr.10, 09.03.1978, S. 579-562Schlaff, M.: Soziotherapie. Neue ambulante Behandlungsform und neues Arbeitsfeld für soziale Arbeit.Standpunkt sozial, Nr. 2, 2002, S. 26-29Schwartz, F. W. u.a.: Das Public Health Buch. Urban & Schwarzenberg, München. 1. Auflage 1998, 2.Auflage 2003Trojan, A., Legewie, H.: Nachhaltige Gesundheit und Entwicklung. Leitbil<strong>der</strong>, Politik und Praxis <strong>der</strong> Gestaltunggesundheitsför<strong>der</strong>licher Umwelt- und Lebensbedingungen. VAS, Frankfurt 2001Troschke, J. v.: Gesundheitsberatung durch den Kassenarzt. <strong>Kranken</strong>versicherung. Mai 1979, S. 110-115.Uexküll, T. v., Geigges, W., Plassmann, R. (Hg.): Integrierte Medizin. Modell und klinische Praxis. Schattauer,Stuttgart 2002-06-11Waller, H.: Sozialmedizin: Grundlagen und Praxis. Kohlhammer, Köln 2002 (5. Auflage)Anlage:Fritzsche, K.: Psychosomatische Grundkompetenz. Gute Weiterbildung, zufriedene Ärzte.Deutsches Ärzteblatt 99 (2002), Nr. 14, A907-8 (siehe folgende zwei Seiten)58