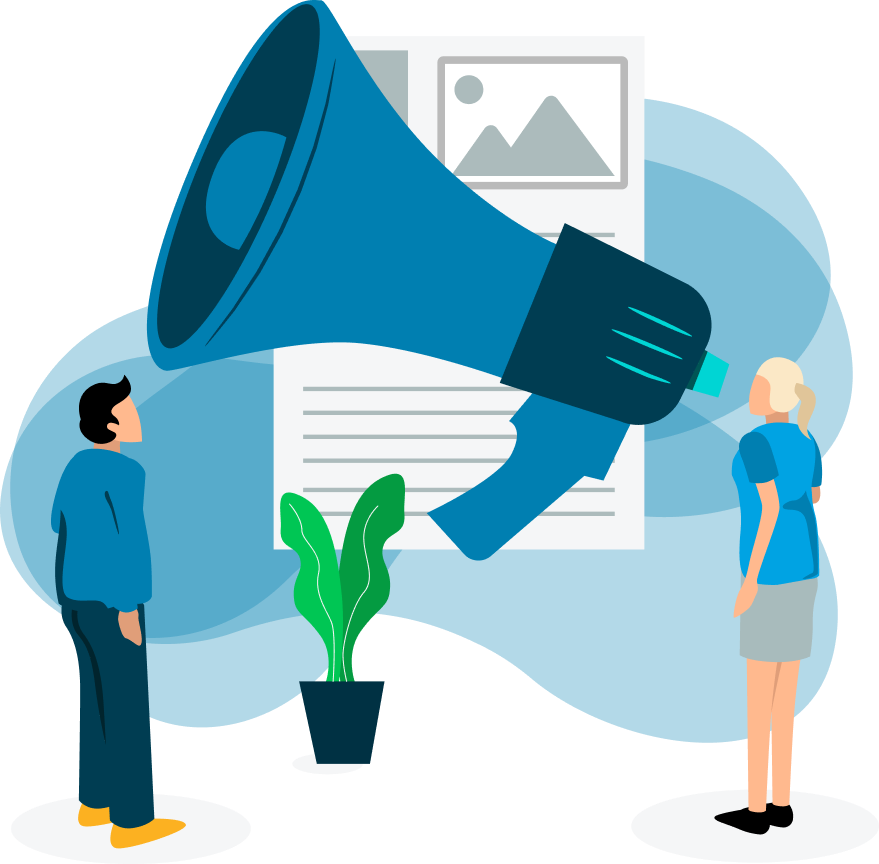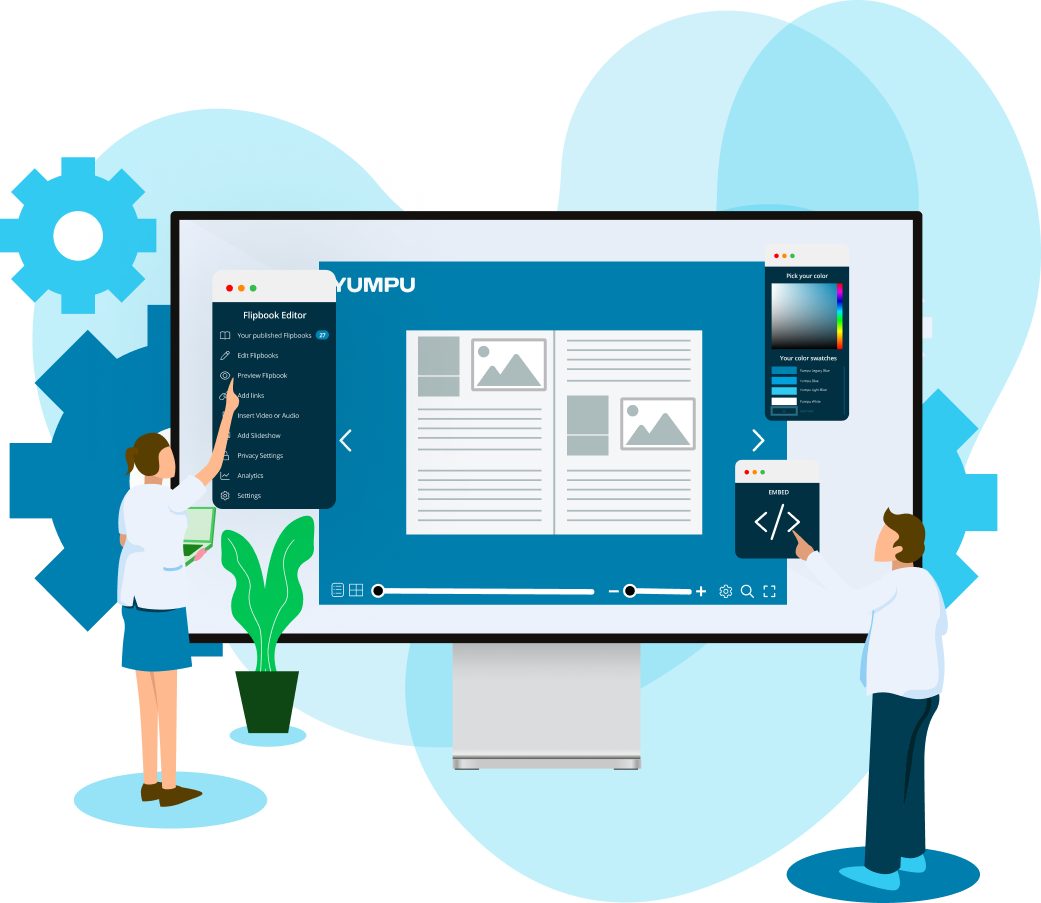Männer · Frauen · Medizin - Universitätsmedizin Göttingen
Männer · Frauen · Medizin - Universitätsmedizin Göttingen
Männer · Frauen · Medizin - Universitätsmedizin Göttingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zeitschrift des <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüros<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
Georg-August-Universität<br />
Georgia<br />
Schwerpunkt:<br />
<strong>Männer</strong> <strong>·</strong> <strong>Frauen</strong> <strong>·</strong> <strong>Medizin</strong><br />
Georgia Nr. 9<br />
Sommer 2008
Inhalt<br />
Grußwort 0-3<br />
Inken Köhler<br />
Grußworte –<br />
15 Jahre <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> 4-6<br />
Prof. Dr. Cornelius Frömmel<br />
PD Dr. Günther Bergmann<br />
Dipl.-Kffr. Barbara Schulte<br />
Da waren’s nur noch zwei…<br />
Abschied von Ulla Heilmeier 0-7<br />
Inken Köhler und Silke Groß<br />
Schmerzen – gibt es ein „starkes“ und<br />
ein „schwaches“ Geschlecht? 8-9<br />
Anne Willweber-Strumpf<br />
Michael Strumpf<br />
Martin der Millimetermann 10-13<br />
Carmen Franz<br />
Artenschutz für bedrohte <strong>Männer</strong> 14-15<br />
Erich Kasten<br />
Wunder (-Mittel), Märkte und<br />
moralische Risiken 16-18<br />
Carmel Shalev<br />
Impressum<br />
Die Zeitschrift Georgia wird vom <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> herausgegeben.<br />
Redaktion: Inken Köhler <strong>·</strong> Carmen Franz<br />
Redaktionsassistenz: Silke Groß <strong>·</strong> Ulla Heilmeier<br />
Layout: KAT <strong>·</strong> Aufl age: 2.200 <strong>·</strong> Erscheinungstermin: Sommer 2008<br />
Die eingereichten Beiträge geben nicht in jeder Hinsicht die Meinung der Redaktion wieder.<br />
Die Redaktion behält sich vor, gelieferte Beiträge redaktionell zu bearbeiten.<br />
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 0551 / 39-9785 oder<br />
per E-Mail: frauenbuero@med.uni-goettingen.de.<br />
Meine Leidenschaft für Gender Studies<br />
und Biomedizin. Wie alles begann 19-21<br />
Ineke Klinge<br />
Intersexualität bei Kindern und<br />
Jugendlichen. Ethische Aspekte eines<br />
medizinischen Dilemmas 22-25<br />
Claudia Wiesemann<br />
Susanne Ude-Koeller<br />
Anna-Karina Jakovljevic<br />
Eindrücke vom Karrieretraining des<br />
<strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüros 26-27<br />
Sabine Wöhlke<br />
Nachrichten 28-31<br />
Einerseits – Andrerseits<br />
Echte Kerle:<br />
Ein bisschen von Schiller –<br />
aber auch von Alice 32-33<br />
Carmen Franz
Foto: Birke Kleinschmidt<br />
3<br />
Liebe Leserinnen<br />
und Leser!<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Ich freue mich sehr, Ihnen<br />
hiermit die neue Ausgabe der<br />
Georgia, der Zeitschrift des<br />
<strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüros<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong>, präsentieren<br />
zu dürfen.<br />
Das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro wird 2008<br />
15 Jahre alt. Und pünktlich zu unserem Geburtstag erhielt<br />
die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> auch eine große<br />
Auszeichnung in Sachen Gleichstellung: Das Total E-<br />
Quality Prädikat, das Unternehmen und Hochschulen für<br />
ihre Erfolge in der Förderung der Chancengleichheit erhalten.<br />
Darauf sind wir sehr stolz! Die Auszeichnung mit<br />
dem Total E-Quality Prädikat bedeutet, dass das Thema<br />
Chancengleichheit bei uns immer präsent ist. Eine Auseinandersetzung<br />
mit diesem Thema – auch in Form von<br />
engagierten und kontroversen Diskussionen – bedeutet<br />
häufi g auch eine Wegbereitung für neue Ideen und ihre<br />
schrittweise Umsetzung. So hat die <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> z.B. beschlossen, ihre gesamten hausinternen<br />
Forschungsförderungsmittel zu gleichen Teilen an <strong>Männer</strong><br />
und <strong>Frauen</strong> auszuschütten. Diese Regelung ist ein Novum<br />
in der deutschen universitären Kliniklandschaft und<br />
wurde von der Jury als besonders innovativ bewertet. In<br />
Ergänzung zum bereits etablierten Heidenreich von Siebold-Programm<br />
wurde ein Anreizsystem zur Förderung<br />
der Habilitation von Wissenschaftlerinnen initiiert. Jenes<br />
belohnt Abteilungen, in denen sich eine Frau habilitiert<br />
hat, für ihre erfolgreiche akademische Personalentwicklung<br />
mit einer Stelle für eine weitere Nachwuchswissenschaftlerin.<br />
Diese und andere Gleichstellung fördernde<br />
Maßnahmen sind im Gleichstellungsplan der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> verankert, der im April dieses Jahres<br />
im Fakultätsrat verabschiedet wurde.<br />
Die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten setzt in 2008<br />
und 2009 einen Fokus auf die Gender <strong>Medizin</strong>, die sich<br />
mit geschlechtsspezifi schen Aspekten in Prävention,<br />
Diagnose, Therapie und Rehabilitation beschäftigt und<br />
die Bedeutung des Geschlechts für Gesundheit und<br />
Krankheit in den Blickwinkel rückt. Dementsprechend<br />
haben wir auch den Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe<br />
der Georgia „<strong>Männer</strong> <strong>·</strong> <strong>Frauen</strong> <strong>·</strong> <strong>Medizin</strong>“ gewählt.<br />
Auftakt<br />
Sie fi nden in der Georgia gleich zwei Vorstellungen<br />
von Gastprofessorinnen der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
– Carmel Shalev und Ineke Klinge –, die über das<br />
Maria-Goeppert-Mayer-Programm für internationale<br />
<strong>Frauen</strong>- und Genderforschung vom Niedersächsischen<br />
Ministerium für Wissenschaft und Kultur fi nanziert werden.<br />
Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Artikeln,<br />
die die <strong>Medizin</strong> aus einem geschlechtssensiblen<br />
Blickwinkel beleuchten.<br />
Haben Sie sich schon mal mit der Frage beschäftigt, ob<br />
<strong>Männer</strong> und <strong>Frauen</strong> Schmerzen gleichermaßen empfi nden<br />
und ob es, wie so oft behauptet, ein „starkes“ und ein<br />
„schwaches“ Geschlecht gibt? Anne Willweber-Strumpf<br />
und Michael Strumpf geben Ihnen interessante Antworten<br />
auf diese Frage. Und auch Carmen Franz präsentiert<br />
Ihnen mit „Martin dem Millimetermann“ eine fesselnde<br />
Geschichte dazu.<br />
Haben Sie schon mal davon gehört, dass das Geschlecht<br />
eines Menschen bei der Geburt nicht immer eindeutig<br />
ist? Wie gehen Ärztinnen und Ärzte, wie gehen Angehörige<br />
damit um? Claudia Wiesemann, Susanne Ude-<br />
Koeller und Anna-Karina Jakovljevic weihen Sie in ethische<br />
Überlegungen rund um das Thema Intersexualität<br />
ein.<br />
Haben Sie – als Leser – manchmal das Gefühl, dass die<br />
<strong>Männer</strong> bei der Gleichstellung zu kurz kommen? Hier<br />
wird Ihnen geholfen, denn Erich Kasten fordert in seinem<br />
Beitrag augenzwinkernd einen „Artenschutz für bedrohte<br />
<strong>Männer</strong>“.<br />
Viele neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Lesen<br />
wünscht Ihnen<br />
Inken Köhler<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong>
Foto: Pö<br />
Grusswort<br />
15 Jahre <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
Die <strong>Medizin</strong> wird weiblich,<br />
las man vor wenigen Tagen<br />
in einer Zeitschrift.<br />
Was könnte damit gemeint<br />
sein?<br />
Das Wort „<strong>Medizin</strong>“?<br />
Das ist schon immer weiblich.<br />
Die vielen Studentinnen und<br />
jungen Ärztinnen?<br />
Es sind mehr als die Hälfte<br />
geworden, aller Studierenden<br />
bzw. Absolvierenden.<br />
(Noch stärker beobachtet man einen solchen Sachverhalt<br />
in der Zahnmedizin.)<br />
Aber in der weiteren Karriere: Oberärztinnen, Habilitandinnen,<br />
Professorinnen, da wird der Anteil der <strong>Frauen</strong><br />
deutlich kleiner als 50 %, trotz aller Anstrengungen über<br />
die letzten Jahre. Auch wenn die <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> beim Vergleich mit anderen medizinischen<br />
Fakultäten in punkto Gleichstellung sehr gut abschneidet,<br />
diesen Verlust auf der Karriereleiter hat sie nicht vermindern<br />
können.<br />
Fehlen uns die rechten Ideen?<br />
Haben wir des Übels Wurzel noch nicht erkannt?<br />
Sind die <strong>Männer</strong> schuld? Sind die <strong>Frauen</strong> schuld?<br />
Ist die Biologie schuldig zu sprechen?<br />
Hat die Evaluation etwas falsch gemacht oder gilt der<br />
Brecht’sche Spruch „Der Mensch wäre lieber gut, als<br />
roh, doch die Verhältnisse sind nicht so?“<br />
Das heißt, wir sollten die gesellschaftlichen Verhältnisse<br />
anklagen und dann feststellen, dass wir das nicht ändern<br />
können?<br />
Allen ist bewusst, dass es eine Patentlösung nicht gibt.<br />
Deswegen aber den Kopf in den Sand zu stecken und<br />
nichts verändern zu wollen, ist mit Sicherheit falsch. Eine<br />
ähnliche Einschätzung ergäbe sich bei einem Ansatz, der<br />
alles nur auf ein <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro abwälzen<br />
möchte. Löst sich das Problem, wenn wir die Gleichstellungsbeauftragte<br />
in Gleichstellungsmanagerin oder<br />
Gender- Mainstreaming-Verantwortliche umbenennen?<br />
– Wohl kaum.<br />
4<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Prof. Dr. Cornelius Frömmel<br />
Vorstandsressort 1: Forschung und Lehre<br />
Was es braucht, ist die Politik der kleinen Schritte, gleichzeitig<br />
eine große Vision. Es beginnt bei der verstärkten<br />
Implementierung von Themen: Geschlechterverhältnisse<br />
und Rollen in den Lehrinhalten sowie die Vermeidung<br />
eines hidden curriculums, mit nur männlichen Vertretern<br />
bei bestimmten Lehrveranstaltungen und Diskussionen.<br />
Und es bedarf des scharfsinnigen Nachdenkens, welche<br />
gesellschaftlichen Verhältnisse es sind, die <strong>Frauen</strong> davon<br />
abhalten, entsprechende Positionen in Wissenschaft<br />
und <strong>Medizin</strong> einzunehmen, wie es die männlichen Kollegen<br />
mit Selbstverständlichkeit tun (können). Sind es<br />
nicht schon die oft unglücklich gewählten Anfangszeiten<br />
von Sitzungen oder Dauer von Sitzungen, die verantwortungsbewusst<br />
handelnde <strong>Frauen</strong> davon abhalten<br />
teilzunehmen? (Ich gebe zu, dass solche Einladungen zu<br />
später Stunde auch vom Vorstand kommen. Die Gründe<br />
mögen vielfältig sein, aber refl ektieren sie nicht auch alte<br />
Denkweisen, die es abzulösen gilt?)<br />
Die Aufgabe bleibt die gleiche. Lokale Ursachen für das<br />
Abbrechen oder Verlangsamen der Karriere von <strong>Frauen</strong><br />
– seien sie lokal oder gesellschaftlich bedingt – müssen<br />
erkannt und geändert werden. Und dies bleibt eine<br />
Gesamtaufgabe, wo jedem seine spezielle Funktion zukommt<br />
und das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro ideenreich,<br />
konsequent und nachhaltig mitwirken soll.<br />
Viel Erfolg!
Foto: Pö<br />
Der 15. Geburtstag des <strong>Frauen</strong>-<br />
und Gleichstellungsbüros<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> ist ein willkommener<br />
Anlass, um auf eine hervorragende<br />
Entwicklung und<br />
nachhaltige Verankerung ihrer<br />
Gleichstellungsziele hinzuweisen.<br />
Hierfür stehen unter anderem<br />
der Erfolg der nunmehr<br />
dritten Auszeichnung mit<br />
dem Total E-Quality Prädikat in 2008 und die speziellen<br />
Förderungsmaßnahmen für <strong>Frauen</strong> am Beispiel des<br />
Mentoring-Programms und des Engagements des <strong>Frauen</strong>netzwerks<br />
für Führung und Forschung in der <strong>Medizin</strong><br />
e.V. (medf3).<br />
Bei dem qualitativen und quantitativen Vergleich der<br />
<strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsaufgaben an den verschiedenen<br />
Universitätsstandorten zeigen sich noch erhebliche<br />
Unterschiede, welche auch die gesellschaftliche<br />
Entwicklung repräsentieren: Vieles hat sich hervorragend<br />
entwickelt – einiges scheint noch um Jahrzehnte zurück<br />
zu sein. Die Anforderungen und Einstellungen im Hinblick<br />
auf die Gleichstellungspolitik haben sich in den<br />
letzten Jahren entscheidend gewandelt: Sie sind in vielen<br />
Teilbereichen zur Selbstverständlichkeit geworden – in<br />
anderen noch nicht. So ist die Entwicklung für <strong>Frauen</strong><br />
hin zu Führungspositionen und zu gleichen Chancen auf<br />
dem wissenschaftlichen Qualifi kationsweg immer noch<br />
nicht ausreichend. Hier besteht ein Entwicklungspotential,<br />
welches sowohl durch fi nanzielle und strukturelle<br />
Förderungen, aber auch durch eine kulturelle „Umstellung<br />
der Einstellung“ gespeist werden muss. Nur wenn<br />
diese kulturelle Umstellung, orientiert an gesellschaftlich<br />
akzeptierten Zielen, erfolgt und von den Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern sowie insbesondere den Führungskräften<br />
mit getragen wird, wird es eine lang anhaltende<br />
Veränderung geben.<br />
Grusswort<br />
15 Jahre <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
PD Dr. Günther Bergmann<br />
Vorstandsressort 2: Krankenversorgung<br />
Es sind Ziele, die den individuellen Respekt vor dem Anderen<br />
– sei es wegen Geschlecht, Rasse, Herkunft o.a.<br />
Gründen – einfordern. Für diese Ziele sagen wir unsere<br />
Unterstützung für die Tätigkeit des <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüros<br />
auch in der Zukunft nachhaltig zu. Auf<br />
dem Weg von der Besonderheit zur Selbstverständlichkeit<br />
sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Das noch<br />
nicht Erreichte weiter zu fördern und das Selbstverständliche<br />
immer wieder refl ektierend zu erhalten, sollte das<br />
gemeinsame Ziel sein.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 5
Foto: Pö<br />
Grusswort<br />
15 Jahre <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
Das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> feiert seinen<br />
15. „Geburtstag“. Herzlichen<br />
Glückwunsch dazu! Im normalen<br />
Leben steckt man in der<br />
Pubertät, ist auf dem Weg von<br />
der Kindheit zum Erwachsensein.<br />
Eine schwierige Phase in<br />
der Entwicklung. Das <strong>Frauen</strong>-<br />
und Gleichstellungsbüro hat<br />
seine ‚Pubertät’ längst hinter<br />
sich, ist eine selbstverständliche<br />
Einrichtung in der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
geworden. Selbstverständliches birgt die Gefahr in sich,<br />
zur Gewohnheit zu werden.<br />
Vier <strong>Frauen</strong> haben in den zurückliegenden 15 Jahren das<br />
Kind „<strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro“ an die Hand<br />
genommen und groß gezogen – mit all den Schwierigkeiten,<br />
den Alltagskämpfen und den Erfolgen. <strong>Frauen</strong><br />
machen etwa 70 Prozent Anteil an der Zahl der Beschäftigten<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> aus. Allein deshalb<br />
ist die Sache der Gleichstellungspolitik in allen Bereichen<br />
– in Forschung, in Lehre, in Krankenversorgung<br />
und im administrativen Bereich – ein notwendiger und<br />
unersetzlicher Bestandteil der Unternehmenskultur. Sie<br />
zeigt damit auch gleichzeitig, dass der Einsatz für das<br />
Thema „Chancengleichheit“ weiterhin notwendig ist. Es<br />
scheint eher so, dass auf dem Weg zur Chancengleichheit<br />
die Gesamtorganisation noch erwachsen werden<br />
muss: <strong>Frauen</strong> in Führungspositionen, die Akzeptanz in<br />
einem immer noch mehrheitlich männlich besetzten<br />
Umfeld, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in zunehmend<br />
an Leistung orientierten Betriebsabläufen. Hier<br />
liegen meines Erachtens Aufgabenfelder, die mit fl exiblen<br />
Arbeitszeitmodellen und gezielter Förderung in der<br />
Personalentwicklung zu unterstützen sind.<br />
Dass „die“ <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> jetzt bereits<br />
zum dritten Mal hintereinander das Total E-Quality Prädikat<br />
erworben hat, ist eine bemerkenswerte Leistung der<br />
Gesamtkultur der UMG, die alles andere als selbstverständlich<br />
ist. Das Total E-Quality Prädikat zu erhalten,<br />
6<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Dipl.-Kffr. Barbara Schulte<br />
Vorstandsressort 3: Wirtschaftsführung und Administration<br />
ist keine „Eintagsfl iege“, ist kein Tageserfolg, sondern<br />
würdigt auch die bislang erfolgte nachhaltige und langfristige<br />
Arbeit sowie die strukturelle Leistung der UMG<br />
auf vielfältigen Ebenen. Das Prädikat spiegelt gleichzeitig<br />
das hartnäckige, dauerhafte und aufmerksame Ringen<br />
der <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbeauftragten in den<br />
letzten 15 Jahren um Chancengleichheit in der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> wider. Sie haben Maßnahmen angemahnt,<br />
erfolgreich auf den Weg gebracht oder Organisationsentscheidungen<br />
kritisch begleitet und gefördert.<br />
Dazu zählen insbesondere das erfolgreiche Mentoring-<br />
Projekt mit seiner gezielten Förderung von wissenschaftlichen<br />
Nachwuchsforscherinnen, die Einführung von<br />
<strong>Frauen</strong>förderprogrammen im Wissenschaftsbereich, die<br />
Einrichtung der Kinderbetreuung und die Zusammenarbeit<br />
mit der Tagespfl egebörse. Für diese Leistung ist ihnen<br />
ausdrücklich Dank zu sagen.<br />
Das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro in der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> muss sich dabei – wie alle anderen<br />
Einrichtungen der UMG auch – den aktuellen wirtschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen stellen. Das <strong>Frauen</strong>- und<br />
Gleichstellungsbüro hat es damit nicht einfacher. Es genießt<br />
keine privilegierte Stellung. Es muss sich begründen,<br />
muss seine Handlungsfelder verteidigen oder neu<br />
erobern. Es muss kreativ sein und darf sich nicht ausruhen<br />
auf Erreichtem.<br />
Vielleicht hat das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro aber<br />
hier den klaren Vorteil, von Anfang an – seit eben 15 Jahren<br />
– auf dieser Klaviatur erfolgreich und geübt spielen<br />
zu können. Es hat immer wieder mit schwierigen Strukturen<br />
ringen müssen und aktiv neue Regeln entwickeln<br />
können.<br />
Wie bei dem Übergang von der Pubertät zum Erwachsenwerden<br />
auch wird der Weg ja nicht einfacher. Man<br />
kann ihn aber gefestigter, erfahrener und verantwortungsbewusster<br />
gehen.<br />
Auf diesem Weg sichere ich dem <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
gerne ein faires, offenes, partnerschaftliches<br />
und lösungsorientiertes Miteinander und Gegenüber bei<br />
der Diskussion gleichstellungspolitischer Fragen zu.
Fotos: Birke Kleinschmidt<br />
Das Team vom <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro (ab Frühjahr 2008)<br />
v.l.n.r. Inken Köhler und Silke Groß<br />
Wir sind traurig. Traurig, weil wir eine super Mitarbeiterin<br />
und eine prima Kollegin verlieren. Mitte April 2008<br />
musste uns Ulla Heilmeier als Koordinatorin unseres<br />
Mentoring-Programms nach langjähriger und erfolgreicher<br />
Arbeit verlassen. Seit August 2002 ist Ulla Heilmeier<br />
im <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro tätig gewesen – die<br />
letzten rund zweieinhalb Jahre hat sie mit uns verbracht,<br />
die wir erst später hinzu gekommen sind. Aus uns dreien<br />
ist in dieser Zeit ein tolles Team geworden – wir haben<br />
gemeinsam Ideen ausgebrütet, Strategien entwickelt<br />
und Hindernisse genommen. Für ein gemeinsames Ziel<br />
– eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik an der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> – brachten wir unsere unterschiedlichen<br />
Kompetenzen, Stärken und Charaktere ein.<br />
Das hat hervorragend funktioniert und wir fühlten uns<br />
wohl dabei. Wir wünschten uns, es ginge weiter. Aber<br />
es fehlen die Gelder zur weiteren Finanzierung von Ulla<br />
Heilmeiers Stelle – von den benötigten Sachmitteln ganz<br />
zu schweigen.<br />
Ulla Heilmeier hat das Mentoring-Programm der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> konzipiert, aufgebaut und durchgeführt.<br />
Vier Jahre lang wurde ihre Arbeit aus Mitteln des<br />
Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und<br />
Kultur gefördert und gleichzeitig mit hausinternen Mitteln<br />
unterstützt. Nach Auslaufen der externen Förderung<br />
übernahmen die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> und der<br />
Internationale Studiengang Molecular Biology die Finanzierung.<br />
Es war eine Übergangsphase, in der das Programm<br />
nicht mit Sachmitteln ausgestattet war und in der<br />
es den Mentorinnen, Mentoren und Mentees nicht das<br />
bewährte Rahmenprogramm bieten konnte. Die Übergangsphase<br />
diente in erster Linie der Suche nach alternativen<br />
Finanzierungsmöglichkeiten, dem Aufbau weiterer<br />
Kooperationen und dem Anstoßen neuer Mentoring-Tandems,<br />
die gewissermaßen auf Abruf in der Warteschleife<br />
hingen. Genau genommen hing das ganze Projekt gefühlsmäßig<br />
über Monate in einer Warteschleife, weil<br />
nicht sicher war, ob, wie und in welchem Umfang es<br />
weiter gehen wird. Um eine lange Geschichte kurz zu<br />
erzählen: Wir haben keine Finanzierungsmöglichkeiten<br />
gefunden – und das ist äußerst bedauerlich, denn das<br />
Mentoring-Programm ist ein regionales und überregionales<br />
Aushängeschild für uns. Im Rahmen des Wettbewerbs<br />
um den Titel einer „exzellenten Universität“ hat man uns<br />
mehrfach zitiert und als gutes Beispiel angeführt, andere<br />
Die Mitarbeiterinnen<br />
Da waren´s nur noch zwei...<br />
Abschied von Ulla Heilmeier<br />
Inken Köhler <strong>·</strong> Silke Groß<br />
<strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüros fragen unsere Kompetenz<br />
für Mentoring ab und schlussendlich wurden wir in<br />
2007 zur erfolgreichsten aller deutschen Universitätskliniken<br />
und <strong>Medizin</strong>ischen Fakultäten in Sachen Gleichstellung<br />
gekürt – und das nicht zuletzt aufgrund unseres<br />
Mentoring-Programms.<br />
Mit dem Wegfall des Mentoring-Programms, das haben<br />
viele Unterstützerinnen und Unterstützer im Haus erkannt,<br />
verlöre die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong>, was sie<br />
lange Jahre stärkte: Ein Karriereinstrument für exzellente<br />
Wissenschaftlerinnen mit Zukunftspotential. Wir fi nden<br />
nicht, dass darauf verzichtet werden kann. Wir sind der<br />
Meinung, dass eine exzellente Universität nicht ohne gezielte<br />
Förderung ihrer hochkarätigen Wissenschaftlerinnen<br />
auskommt. Aber Geld dafür herbei zaubern können<br />
wir auch nicht. Und das Budget des <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüros<br />
reicht bei weitem nicht aus, um daraus<br />
eine Stelle zur Aufrechterhaltung des Mentoring-Programms<br />
zu fi nanzieren. In letzter Minute jedoch keimte<br />
Hoffnung auf: Es wird ein Konzept zur Integration des<br />
Mentoring-Programms in die Personalentwicklung erarbeitet<br />
– das Angebot kann somit erhalten bleiben, aber<br />
Ulla Heilmeier als Koordinatorin ist trotzdem nicht mehr<br />
da. Wir werden Ulla Heilmeier sehr vermissen – ihren<br />
Humor, ihre Kollegialität, ihre Ideen, ihre Tatkraft, ihre<br />
Schlagfertigkeit, ihre Kompetenz, ihre Erfahrung und ihren<br />
Einsatz. Jetzt sind wir nur noch zwei – das haben<br />
wir lange befürchtet, aber die Hoffnung, es doch noch<br />
abwenden zu können, starb zuletzt.<br />
Das Team vom <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
(bis Frühjahr 2008) - noch mit Ulla Heilmeier!<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 7
Schwerpunkt<br />
Schmerzen – gibt es ein „starkes“ und<br />
ein „schwaches“ Geschlecht?<br />
Beim kleinsten Wehwehchen liegt er schon wehleidig<br />
in der Ecke! <strong>Männer</strong> würden nie eine Entbindung aushalten!<br />
Ein Indianer kennt keinen Schmerz! <strong>Frauen</strong> sind<br />
Heulsusen! Stimmen diese zum Teil widersprüchlichen<br />
Klischees? Wer hält bei Schmerzen mehr aus: <strong>Männer</strong><br />
oder <strong>Frauen</strong>?<br />
Die Schmerzforschung hat in den letzten Jahren Erkenntnisse<br />
gewonnen, die eindeutig zeigen: In der Häufi gkeit,<br />
Wahrnehmung und Verarbeitung von Schmerzen<br />
gibt es Geschlechtsunterschiede. <strong>Männer</strong> leiden seltener<br />
unter chronischen Schmerzerkrankungen wie z.B.<br />
Kopfschmerzen, Fibromyalgie, Rheumaschmerzen, Gesichtsschmerzen.<br />
Gleichzeitig werden bei <strong>Frauen</strong> die<br />
Schmerzäußerungen weniger ernst genommen und<br />
<strong>Frauen</strong> nach internationalen epidemiologischen Daten<br />
schmerztherapeutisch schlechter versorgt als <strong>Männer</strong>.<br />
<strong>Männer</strong> haben in experimentellen Untersuchungen<br />
eine höhere Schmerz- und Toleranzschwelle als <strong>Frauen</strong>,<br />
d.h. <strong>Männer</strong> empfi nden einen Reiz später als schmerzhaft<br />
und halten einen Schmerzreiz länger aus als <strong>Frauen</strong>.<br />
An dieser unterschiedlichen Schmerzwahrnehmung sind<br />
Sexualhormone – Östrogene bei <strong>Frauen</strong>, Testosteron bei<br />
<strong>Männer</strong>n – beteiligt. Östrogen steigert die Aufmerksamkeit<br />
und die Aktivität des Nervensystems und verstärkt<br />
die Weiterleitung schmerzhafter Impulse aus der Peripherie<br />
ins Zentralnervensystem. Testosteron wirkt hingegen<br />
dämpfend. Aus Tierexperimenten gibt es Hinweise auf<br />
genetische Unterschiede: es wurden Proteine gefunden,<br />
die in das Schmerzgeschehen bei <strong>Männer</strong>n und <strong>Frauen</strong><br />
möglicherweise unterschiedlich eingreifen und <strong>Frauen</strong><br />
schmerzempfi ndlicher machen als <strong>Männer</strong>. Und man<br />
weiß auch: <strong>Frauen</strong> reagieren schlechter auf bestimmte<br />
schmerzstillende Medikamente als <strong>Männer</strong> und es zeigen<br />
sich zum Teil unterschiedliche Nebenwirkungsprofi<br />
le.<br />
Neben biologischen Faktoren spielen aber auch psychologische,<br />
soziale und kulturelle Faktoren eine wichtige<br />
Rolle bei der Schmerzwahrnehmung und Schmerzverarbeitung.<br />
Das Zusammenspiel all dieser Faktoren führt<br />
zur Schmerzempfi ndung, die nicht in der Peripherie, also<br />
dort, wo der Schmerz gespürt wird, sondern im Gehirn<br />
8<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Anne Willweber-Strumpf <strong>·</strong> Michael Strumpf<br />
entsteht. Auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen<br />
den Geschlechtern: Schmerzreize führen bei <strong>Frauen</strong><br />
zu einer stärkeren Aktivierung der emotionsbezogenen<br />
Hirnareale und bei <strong>Männer</strong>n zu einer stärkeren Aktivierung<br />
der kognitionsbezogenen Hirnareale. Das Interessante<br />
ist: die Aktivierungsmuster sind nicht durchgängig<br />
geschlechtsabhängig und damit biologisch zu erklären,<br />
sondern hängen auch von anderen Faktoren ab, wie dem<br />
derzeitigen Gefühlszustand, den Bewältigungsstrategien<br />
und der Reaktion wichtiger Bezugspersonen.<br />
In unserer Gesellschaft, wie auch in den meisten anderen<br />
Kulturen, dürfen Mädchen und <strong>Frauen</strong> Schmerzen und<br />
Emotionen zeigen, Jungen und <strong>Männer</strong> aber eher nicht.<br />
Wichtig für den Umgang mit Schmerzen sind kindliche Erfahrung<br />
mit Schmerz und der Bewältigung von Schmerz,<br />
die sich bis ins Erwachsenenalter auswirken und Spuren<br />
hinterlassen können. Hier spielen Faktoren wie Kontrollierbarkeit<br />
und Vorhersagbarkeit von Schmerzen und<br />
insbesondere die elterliche Reaktion auf Schmerzen bei<br />
Kindern eine große Rolle. Mädchen und Jungen werden<br />
im Umgang mit Schmerz anders behandelt. Diese Unterschiede<br />
in der Sozialisierung spiegeln sich in unserer<br />
langjährigen klinischen Erfahrung mit Schmerzpatienten<br />
und Schmerzpatientinnen wider. <strong>Männer</strong> und <strong>Frauen</strong><br />
kommunizieren verschieden über Schmerz. <strong>Frauen</strong> fokussieren<br />
stärker auf ihr soziales Umfeld und schildern<br />
ihr Verhalten. Sie beschreiben ihre Schmerzen detaillierter<br />
und sprechen mehr darüber, auch mit Freundinnen<br />
und Freunden, mit anderen Patientinnen und Patienten<br />
oder in Selbsthilfegruppen. Sie haben oft bessere Bewältigungsstrategien,<br />
lenken sich ab und suchen konkrete<br />
Hilfe. <strong>Frauen</strong> reagieren zudem aufmerksamer und zuwendender<br />
auf Schmerzen bei ihren Partnern und anderen<br />
Menschen. <strong>Männer</strong> hingegen beschreiben Symptome,<br />
forschen nach deren körperlichen Ursachen und<br />
haben oft bereits ihre eigene somatische Diagnose. Sie<br />
versuchen, Schmerzen eher zu ignorieren, wenden daher<br />
auch später sinnvolle Bewältigungsstrategien an und erkennen<br />
schlechter die psychosozialen Komponenten der<br />
Schmerzerkrankung. Und gerade <strong>Männer</strong> scheinen sich<br />
einem Schmerztherapeuten gegenüber anders zu verhalten<br />
als gegenüber einer Schmerztherapeutin – zumin-
dest am Anfang der Patient-Therapeut-Beziehung. Von<br />
„Mann zu Mann“ sind sie offener, sprechen auch eher<br />
über die psychosozialen Auswirkungen von Schmerzen<br />
und zeigen ihr Leiden. Von „Mann zu Frau“ scheint es<br />
so, dass <strong>Männer</strong> durch „Härte“ und „Haltung“ beeindrucken<br />
wollen. <strong>Frauen</strong> sind durch das Geschlecht anderer<br />
weniger zu beeindrucken.<br />
Diese beobachteten Unterschiede zwischen Schmerzpatientinnen<br />
und Schmerzpatienten scheinen sich aber<br />
in der Selbstwahrnehmung der Patientinnen und Patienten<br />
mit chronischen Schmerzen nicht zu bestätigen.<br />
Dies zeigt eine vergleichende Untersuchung an Patienten<br />
mit chronischen Schmerzen und schmerzfreien<br />
Kontrollpersonen. Schmerzpatienten zeigen eine stärker<br />
ausgeprägte feminine Geschlechtsrollenorientierung.<br />
Sie stimmen in starkem Maße femininen Rollennormen<br />
zu und beschreiben sich eher mit femininen Eigenschaften<br />
(z. B. passiv, klagend). Die Kontrollpersonen hingegen<br />
stimmen in stärkerem Maße traditionell maskulinen<br />
Rollennormen zu und beschreiben sich eher mit<br />
maskulinen Eigenschaften (z. B. überheblich, aggressiv).<br />
Die Unterschiede zwischen Schmerzpatienten und Kon-<br />
Foto: privat<br />
Dipl.-Psych. Anne Willweber-Strumpf<br />
ist psychologische Psychotherapeutin mit der<br />
Zusatzqualifi kation „Spezielle Schmerzpsychotherapie“.<br />
Sie ist seit mehr als 20 Jahren in der<br />
Schmerztherapie tätig und Vizepräsidentin des<br />
Berufsverbandes der Schmerztherapeuten in<br />
Deutschland (BVSD).<br />
Schwerpunkt<br />
trollgruppe waren weitgehend unabhängig vom biologischen<br />
Geschlecht. Ob eine feminine Rollenorientierung<br />
zu chronischen Schmerzen prädestiniert oder ob chronische<br />
Schmerzen die maskuline zu einer eher femininen<br />
Rollenorientierung verändern, ist aus den Daten nicht<br />
abzuleiten.<br />
Es gibt in Bezug auf Schmerzen nicht das „starke“ oder<br />
das „schwache“ Geschlecht, es gibt Unterschiede, die<br />
manchmal Vorteile und manchmal Nachteile haben.<br />
Möglicherweise müssen diese Unterschiede in der therapeutischen<br />
Herangehensweise deutlich stärker berücksichtigt<br />
werden. Hier ist weitere Forschung erforderlich.<br />
Nicht umsonst hat die Internationale Schmerzgesellschaft<br />
(International Association for the Study of Pain,<br />
IASP) das „Global Year against Pain 2008“ unter das<br />
Thema „real women, real pain“ gestellt. Ziel ist es, weltweit<br />
sowohl die Öffentlichkeit, die Versorgungseinrichtungen<br />
als auch die Wissenschaft darauf aufmerksam zu<br />
machen, dass Schmerz bei <strong>Frauen</strong> ein häufi geres und<br />
manchmal eben auch ein anderes Problem ist als bei<br />
<strong>Männer</strong>n und besonderer Beachtung bedarf.<br />
Foto: privat<br />
Prof. Dr. med. Michael Strumpf<br />
ist Arzt für Anästhesiologie mit der Zusatzbezeichnung<br />
„Spezielle Schmerztherapie“. Er war Chefarzt<br />
der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin<br />
und Schmerztherapie, Rotes Kreuz Krankenhaus<br />
Bremen und ist seit mehr als 20 Jahren in der<br />
Schmerztherapie tätig. Neben verschiedenen Positionen<br />
ist er designierter Präsident der Deutschen<br />
Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS).<br />
Seit dem 1. Juli 2008 ist er Professor für klinische<br />
und experimentelle Schmerztherapie an der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong>.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 9
Foto: Inken Köhler<br />
Schwerpunkt<br />
Martin der Millimetermann<br />
Es gibt Menschen, in denen<br />
ein langer Winter höchstes<br />
Entzücken auslöst. Ich gehöre<br />
nicht dazu, mir wird bei<br />
30° auch ohne Schatten so<br />
richtig wohl. Beim wärmenden<br />
Frühlingssonnenstrahl<br />
erhebt sich mein Herz. Dieses<br />
Jahr allerdings fand das<br />
Frühlingserwachen ein jähes<br />
und schmerzhaftes Ende. Ich<br />
bückte mich, um den ersten<br />
Balkonkasten mit den Fuchsien<br />
auf die Halterung im Balkon zu heben, als mir ein<br />
schneidend scharfer Schmerz in den Rücken schoss. Er<br />
nahm mir den Atem, ich kam weder vor noch zurück,<br />
bei jeder Bewegung dolchte er wieder zu. Ich schrie,<br />
stöhnte, jammerte, fauchte meinen mir zu Hilfe geeilten<br />
Mann an, als er mir aus der immer noch gebückten Haltung<br />
herauszukommen behilfl ich sein wollte. Ich wusste<br />
genau was los war, was da so mächtig weh tat – erst<br />
einschießend, spitz und scharf, dann dumpf, ziehend<br />
– das war der berühmte Hexenschuss. Ein Hexenschuss,<br />
aus dem heitersten Himmel kommend, ist so gemein, so<br />
scheußlich, dass ich dieses Erlebnis nur meinem ärgsten<br />
Feind wünsche. Dank meiner Sonnenscheinnatur,<br />
meines Hausarztes und der pharmazeutischen Industrie<br />
hielt dieser grauenhafte, hilfl ose Zustand nicht lange an.<br />
Ich kenne von Berufs wegen viele Schmerzgeschichten.<br />
Zum Beispiel die Geschichte von Martin, dem Millimetermann.<br />
Mir scheint, nichts ist so sehr mit Männlichkeit verbunden,<br />
wie der Kampf gegen den Schmerz. Schon früh<br />
lernen kleine <strong>Männer</strong>, dass ein Junge nicht weint. Martin<br />
war so ein Junge. Er hatte, seit er denken konnte,<br />
immer wieder Kopfschmerzen, oder besser gesagt, die<br />
Schmerzen hatten ihn. Der Versuch, seine Eltern von der<br />
Ernsthaftigkeit seiner Beschwerden zu überzeugen, war<br />
gescheitert. Wahrscheinlich brachten sie, bei einem ansonsten<br />
gesunden Jungen, die Kopfschmerzen eher mit<br />
Faulheit und Schule schwänzen in Verbindung. Lapidar<br />
hieß es immer „Stell dich nicht so an, reiß dich zusammen,<br />
du bist doch kein Mädchen!“ Das war offenbar das<br />
Schlimmste, was sich sein Vater vorstellen konnte, aber<br />
auch seine Mutter protestierte nicht. Beide vertraten nur<br />
das allgemeine Erziehungsprinzip, dass „Jammern“ zu<br />
ignorieren ist. Erst als Martin in der Ausbildung war und<br />
10<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Carmen Franz<br />
über eigenes Geld verfügte, kaufte er sich heimlich und<br />
mit sehr schlechtem Gewissen Schmerzmittel, nahm sie<br />
aber nur, „wenn ich es gar nicht mehr ausgehalten hab“,<br />
wie er schnell beteuerte.<br />
Für Martin waren die Beschwerden nicht nur ein Problem<br />
seines Körpers. Er war auch zutiefst beschämt.<br />
Nicht nur in seinen Augen waren Kopfschmerzen eigentlich<br />
doch ein „<strong>Frauen</strong>leiden“. Nur „hysterische Weiber“<br />
hatten nach allgemeiner Auffassung bei jeder Gelegenheit<br />
„ihre Migräne“ und er wollte auf gar keinen Fall mit<br />
ihnen in einen Topf geschmissen werden. So quälte er<br />
sich durch die Jahre.<br />
Aber nicht nur Kopfschmerzen, sondern auch die Mittel<br />
dagegen waren in seinen Augen, streng genommen, doch<br />
nur etwas für Memmen ... Weicheier ... etc. – oder?<br />
„Lerne leiden, ohne zu klagen” war nicht nur das Credo<br />
seiner Eltern, sondern ganzer Nationen. Für überbordende<br />
Tapferkeit, den Dienst am Vaterland und den<br />
Heldentod bekam man Orden vom Kaiser, König oder<br />
Präsidenten.<br />
Als Martin und ich uns kennenlernten, kannte er viele<br />
Apotheken in der Stadt und im Umland, er wechselte<br />
von einer zur anderen, damit niemand seinen sich steigernden<br />
Tablettenkonsum bemerkte. Aus Angst, nicht<br />
mehr mit voller Kraft arbeiten zu können, nahm er in<br />
den letzten Monaten sogar Tabletten, wenn sich der<br />
Schmerz nur von ferne zeigte. Aber seine Hoffnung, mit<br />
ihrer Hilfe den Schmerz loszuwerden, zerschlug sich<br />
mit jedem geleerten Tablettenröhrchen. Eigentlich wurde<br />
alles nur schlimmer. Er hatte manchmal das Gefühl,<br />
als befände sich sein Kopf in einem Schraubstock. Die<br />
Kopfschmerzhäufi gkeit stieg langsam aber stetig, bis ein<br />
dumpfer Schmerz sein Leben täglich beherrschte. Seine<br />
Konzentrationsfähigkeit war dahin, er war gereizt, eigentlich<br />
ständig übermüdet, ohne Schlaf zu fi nden. Er<br />
bangte um seine Arbeitsfähigkeit. Aber „krank machen“<br />
war für ihn unvorstellbar! Zu Hause wurde er immer<br />
schweigsamer. Seine Frau wusste von seinen Beschwerden<br />
und weil sie ihn sehr liebte, meldete sie ihn in der<br />
Schmerzambulanz an. Und weil er sie nicht verlieren<br />
wollte, ging er auch hin.<br />
Nach einer gründlichen Untersuchung vermuteten wir,<br />
dass Martin unter einem chronischen Spannungskopfschmerz<br />
gelitten hatte. „Hatte“ insofern, als erst nach<br />
einem Entzug genaueres zu sagen war. Bei Martin be-
stand aber noch ein anderes Problem. Seine geschilderten<br />
Beschwerden waren wahrscheinlich auf einen „medikamenteninduzierten“<br />
Kopfschmerz zurückzuführen.<br />
Martin wollte zunächst einmal überhaupt nicht glauben,<br />
was er hörte. Man sah ihm sein Entsetzen förmlich<br />
an: Sahen wir in ihm einen Junkie, der dringend einen<br />
Entzug brauchte!? Fassungslos fragte er noch mal nach.<br />
„Entzug? Medikamenteninduziert?“ Wir übersetzten das<br />
Wortungetüm. Es bedeutet, dass seine Medikamente,<br />
die er gegen die Kopfschmerzen konsumiert hatte, selbst<br />
wieder Auslöser für Kopfschmerzen waren. Was beim<br />
Apotheker den Umsatz hob, steigerte bei Martin den<br />
Schmerz.<br />
Er hatte, ohne es zu ahnen, den Teufel mit dem Belzebub<br />
austreiben wollen.<br />
Wir konnten seine Empörung, seine Abwehr aber auch<br />
seine Beschämung verstehen. Wir wussten auch, dass<br />
er die Tabletten doch nicht zum Spaß geschluckt hatte.<br />
Fast die Hälfte aller Menschen mit Kopfschmerzen ist<br />
von Medikamenten abhängig, insofern war Martin nur<br />
einer von vielen. Natürlich hatte ihn niemand auf die<br />
Gefahren aufmerksam gemacht, er hatte allerdings auch<br />
niemanden gefragt. Sein Widerwille, Hilfe zu suchen,<br />
hatte auch dazu beigetragen, dass Tabletten sein Leben<br />
kontrollierten.<br />
Nach einer Bedenkzeit willigte Martin in unseren Behandlungsplan<br />
ein.<br />
Ich hatte den Eindruck, dass Martin sich weniger vor<br />
langen Nadeln und Skalpellen gefürchtet hätte, als vor<br />
den Gesprächen mit mir, dabei halte ich mich für einen<br />
ausgesprochen netten Menschen. Aber natürlich ging es<br />
nicht um meine Nettigkeit. Über sich selbst zu reden,<br />
etwas vom Gemüte preiszugeben, ist für einige <strong>Männer</strong><br />
schlimmer als die Begegnung mit dem Teufel. Und manche<br />
Menschen glauben ja, Psychologen hätten einen<br />
Röntgenblick und es gäbe nichts zu verheimlichen!!<br />
Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass, vor allen anderen<br />
Faktoren, eine unzureichende Stressverarbeitung an<br />
„Spannungskopfschmerzen“ beteiligt ist.<br />
Unter der Voraussetzung, dass sich meine Stressvermutung<br />
auch bei Martin als richtig erweisen sollte, musste<br />
er ganz allgemein einen Weg fi nden, sich in belastenden<br />
Situationen nicht noch mehr aufzuschaukeln. Das sagt<br />
sich so einfach dahin, aber lassen Sie mal locker, wenn<br />
Sie locker lassen sollen. Ich wollte versuchen, Martin<br />
durch ein Entspannungstraining zu unterstützen. Aber<br />
welches? So wie ich Martin einschätzte, war meditative<br />
Einkehr, die Hände im Schoß und beruhigend „Om“<br />
murmeln, für ihn nicht geeignet. Er war als Ingenieur<br />
sicher eher für eine Entspannungstechnik zu erwärmen,<br />
an der er herumwerkeln konnte.<br />
Bald war klar, dass er ein Verspannungskünstler war.<br />
Hinzu kam, dass er es offensichtlich mir und sich recht<br />
machen wollte, wie ein braver Junge. Wir mussten sehr<br />
lachen, als ich ihm seine Anstrengungen vormachte.<br />
Schwerpunkt<br />
Schnell bekamen wir so einen Einstieg in seine bevorzugte<br />
Art, mit vielen Situationen im Leben umzugehen.<br />
Wir sprachen über Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz, ausgeprägtes<br />
Verantwortungsbewusstsein, sein Bemühen,<br />
es anderen recht zu machen. Seine penibel-perfekte Art<br />
brachte ihm bei seinen Kollegen den Spitznamen „Millimetermann“<br />
ein. Nachdem wir vertrauter geworden waren,<br />
platzte er beim Gespräch über seine ausbleibenden<br />
Erfolge bei den Entspannungsübungen plötzlich heraus:<br />
„Ich kann mich nicht entspannen, weil ich nicht weiß,<br />
was ich dann tue!“ „Was vermuten Sie denn?“ Ich bekam<br />
keine Antwort. Zum besseren Verständnis wollte ich etwas<br />
über seine Lebens-Lerngeschichte erfahren.<br />
Der familiäre Umgang mit Schmerz prägt, wie wir von<br />
Martin lernen konnten, unser Verhalten als Erwachsene.<br />
Aus der persönlichen Lerngeschichte lassen sich aber<br />
auch andere Verhaltenweisen ableiten oder erklären.<br />
Sicher ist jedes Leben einzigartig, aber es ist nicht unerheblich,<br />
wo und in welchen Umständen jemand aufwächst.<br />
Und ob er ein Mann oder eine Frau ist. Martin<br />
war 55 Jahre alt, seit 36 Jahren verheiratet. Sie kannten<br />
sich seit der Schule, und als sie 18 Jahre alt wurde, heirateten<br />
sie. Beide waren in der Ausbildung und konnten<br />
sich eine eigene Wohnung nicht leisten. Sie wohnten die<br />
ersten neun Jahre ihrer Ehe bei seinen Schwiegereltern.<br />
Nicht selten herrschte Kampfstimmung. Wenn er abends<br />
nach Hause kam, musste er schlichten. Er hasste Streit.<br />
„Ich geh auch heute jedem aus dem Weg.“ Sein Vater<br />
stritt nicht, er befahl, seine Mutter hatte sich in die innere<br />
Emigration gerettet, war auch für ihn nicht erreichbar.<br />
Sie konnte ihn so auch nicht gegen den häufi g brutalen<br />
Mann in Schutz nehmen. Zuweilen hatte er Mordphantasien.<br />
Er schluckte seine Wut hinunter, passte sich an, weil<br />
er glaubte, sie schützen zu müssen. Wir fanden heraus,<br />
dass er schon damals mit dem Kopf reagierte. Er konnte<br />
sich nicht emotional äußern, sondern dachte sich seinen<br />
Teil und bekam Kopfschmerzen. Wie ich fand, keine<br />
gute Kombination. Geschwister hatte er nicht. In seiner<br />
Ehe fanden sich beide in ihrem Harmoniebedürfnis. Es<br />
wurde deutlich, dass sie sehr aufeinander bezogen waren,<br />
eine Jugendliebe, die auch das Altern aushielt. Sie<br />
hatten keine Kinder. „Neun Jahre Schwiegereltern haben<br />
uns gereicht, wir wollten auch mal alleine sein. Dann<br />
kam für uns beide auch noch der Beruf dazwischen.“<br />
In letzter Zeit hatte es zwischen beiden vermehrt gekracht.<br />
„Ordnung ist das halbe Leben“. Das war für Martin<br />
nicht irgendein Spruch aus frühen Tagen, er hatte ihn<br />
so verinnerlicht, dass er beim Gang durch die Wohnung<br />
im Vorbeigehen mit dem Finger imaginären Staub von<br />
den Möbeln wischte, ohne es zu bemerken. Mit seiner<br />
Frau gab es deswegen Auseinandersetzungen, Sie konnte<br />
nicht glauben, dass darin kein Vorwurf lag. In einem<br />
Gespräch zu dritt bestätigte sie, dass sein „Ordnungsfi mmel“<br />
sie aus der Fassung brachte. Als sie kürzlich in die<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 11
Foto: Inken Köhler<br />
Schwerpunkt<br />
Küche kam, habe er auf einem Stuhl gestanden und sei<br />
über die Oberkante des Küchenschranks gefahren. Dabei<br />
hätte sie erst Tage zuvor gründlich sauber gemacht.<br />
Am liebsten hätte sie dem Stuhl einen Schubs gegeben.<br />
Er habe aber bei ihrer Schimpfkanonade so bekümmert<br />
drein geschaut, dass sie seinen Unschuldsbeteuerungen<br />
geglaubt hätte.<br />
Für seinen Arbeitgeber war seine Leistungsbereitschaft<br />
– gepaart mit Zuverlässigkeit – sicher ein Segen. Er war<br />
Leiter einer großen Betriebswerkstatt, die vom Auswechseln<br />
der Glühbirnen bis hin zur Notfallreparatur von<br />
kostbaren Maschinen verantwortlich war. Sein täglicher<br />
Kontrollgang durch den Betrieb war so regelmäßig wie<br />
eine Präzisionsuhr und damit beruhigend. Der Millimetermann<br />
sah alles. Sein Hang zu Perfektion sei schon in<br />
der Teenagerzeit ausgeprägt gewesen. „Lieber einmal zu<br />
viel als zu wenig überprüfen, dann konnte ich relativ sicher<br />
sein, keinen Ärger mit dem Vater zu bekommen.“<br />
Leider ist eine Verhaltensweise nicht einfach nur gut<br />
oder schlecht. Auf Sauberkeit im Betrieb zu achten ist<br />
eine Sache, der Ehefrau hinterher zu wischen eine andere.<br />
Es muss notwendigerweise zu Konfl ikten kommen,<br />
12<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
wenn das Verhalten nicht mehr den Situationen angepasst<br />
werden kann.<br />
Ich hatte das Gefühl, dass Martin Konfl ikte zwar sehen<br />
konnte, aber kaum die Möglichkeit hatte, eine für sich<br />
zufriedenstellende Lösung zu fi nden.<br />
Das war offenbar nicht nur zu Hause so. Schon vor unserem<br />
ersten Kontakt war in seinem Betrieb eine nicht<br />
mehr zu ignorierende Konfl iktlawine auf ihn zu gerollt.<br />
Im Gespräch über seine Arbeit berichtete er, dass die<br />
Geschäftsleitung gewechselt hatte. Mit ihr kamen neue<br />
Ideen. Eine davon war, einen Teil der Aufgaben der<br />
Werkstatt „outzusourcen“, was auf Deutsch heißt, zu<br />
verlagern. Martin vermutete, dass für den verbleibenden<br />
Rest an Arbeitsaufkommen ein relativ hoch bezahlter<br />
Mitarbeiter wie er eine ökonomische Fehlinvestition sein<br />
könnte. Noch gab es nur indirekte Zeichen, es war häufi -<br />
ger vorgekommen, dass die Arbeit der Werkstatt kritisiert<br />
wurde und damit stand er in der Schusslinie. Ein Organisationsentwickler<br />
hatte sich an seine Fersen geheftet. „Ich<br />
soll wohl ausgemustert werden.“ Ich hörte das Grollen in<br />
seiner Stimme, obwohl er die Worte durch die Lippen<br />
presste. Kein weiterer Kommentar. Er stand auf und lief<br />
in meinem Zimmer umher, ein für ihn völlig „ungezogenes“<br />
Verhalten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es würde<br />
gleich knallen. „Wieso träume ich ständig von meiner<br />
Mutter? Wir hatten gar kein enges Verhältnis, trotzdem<br />
vermisse ich sie plötzlich. Warum erinnere ich mich jetzt<br />
nach 40 Jahren an ihre Hüte?“ Mir blieb die Spucke weg!<br />
Auf die Mutter wäre ich nun auch nicht gekommen, obwohl<br />
Psychologen so gern mit Geschichten von Vater,<br />
Mutter, Kind in Verbindung gebracht werden. „Suchen<br />
Sie nach dem Bindeglied!“ Lange Pause. „Wir sind uns<br />
ähnlich.“ „Wenn Sie jetzt mit ihr sprechen könnten, was<br />
würde sie sagen?“<br />
„Wehr dich mal!“ Genau das war‘s. Es lag auf der Hand,<br />
dass er in dieser berufl ichen Situation nicht wie üblich<br />
stillhalten konnte, er musste in die Offensive. Aber wusste<br />
– wollte er das auch? „Was wollen Sie tun?“ „Man<br />
ist auf seine Richtung gepolt, ich möchte auf niemanden<br />
böse sein, ihn hassen.“ Wie bitte? So eine Gefühlsverbindung<br />
ließ mich staunen. Riten und Regeln hielten Martin<br />
fest im Griff. Das war der springende Punkt. Im Berufsleben<br />
war er offenbar ein Meister der Improvisation. Flexibel<br />
konnte er auf ungewöhnliche Anforderungen einer<br />
Situation reagieren. Bei Gefühlsreaktionen folgte er einer<br />
eigenen DIN-Norm. Diese konnte zum Beispiel nicht<br />
unterscheiden zwischen dem doch relativ harmlosen<br />
„auf jemanden böse sein“ und seiner furiosen Steigerung<br />
„jemanden hassen“. In Konfl iktsituationen verharrte er<br />
durch diese Undifferenziertheit wie das Kaninchen vor<br />
der Schlange und überließ so die Entscheidungen dem<br />
jeweiligen Konfl iktpartner.
Da er selber nicht klipp und klar eine Entscheidung herbeiführen<br />
konnte, machte ihn in der augenblicklichen<br />
Situation die „In-der-Schwebe-halten-Taktik“ der Geschäftsleitung<br />
im wahrsten Sinne des Wortes krank. Die<br />
Rate der Kopfschmerzenattacken stieg.<br />
Es gelang Martin, den Versuchungen aus den Tablettenröhrchen<br />
zu widerstehen. Es war aber auch klar, dass er<br />
auch weiter in Stresssituationen stereotyp mit Anspannung<br />
der Nackenmuskulatur reagieren würde, wenn er<br />
nichts veränderte. Sein eingeschränktes Verhaltensrepertoire<br />
hinderte ihn, angemessen zu reagieren. Er war ein<br />
notorischer Bedenkenträger, „ja aber“ war seine Lieblingswortkombination.<br />
Unabhängig von der notwendigen ärztlichen Betreuung<br />
nach dem Entzug konnte ich Martin für ein Stressbewältigungstraining<br />
gewinnen. Zu diesem Training ist Mut erforderlich.<br />
Nur genaues schonungsloses Hinsehen kann<br />
eine Veränderung bringen. Schwerstarbeit ist zu leisten,<br />
wenn Ist- und Soll-Zustand zu weit auseinander liegen.<br />
Scheitern ist möglich. Zuweilen muss auch akzeptiert<br />
werden, dass Situationen nicht zu verändern sind, dann<br />
muss aber auch hierzu eine Einstellung gefunden werden,<br />
die in Frieden leben lässt.<br />
Auf Martin bezogen konnte das unter anderem heißen:<br />
– Analyse der Arbeitsplatzsituation,<br />
– alte Verhaltensmuster hinterfragen,<br />
– auf Gefühle zu achten, sie zu differenzieren<br />
und nicht zuletzt, sie auch klar zu äußern,<br />
– streiten lernen.<br />
Aber das wäre nur mein gedanklicher Fahrplan, Martin<br />
könnte das natürlich ganz anders sehen. Er war der Boss,<br />
er gab Inhalt und Tempo vor, ich bot nur das Analyseverfahren.<br />
Schmerz ist nicht Schicksal, und das, glaube ich, liegt am<br />
Vergessen. Kaum einer hätte Kriegsfolgen, Hungersnöte<br />
und Naturkatastrophen bewältigt, hätte unser Gedächtnis<br />
nicht den Hang zum Positiven. Mutlosigkeit und Verzweifl<br />
ung hätten uns sonst wie die Lemminge ins Meer<br />
getrieben. Auch die Schmerzempfi ndung hat in dieser<br />
Schwerpunkt<br />
Hinsicht ihre Besonderheiten. Keine vernünftige Frau<br />
würde je ein zweites Kind bekommen, wenn sie den<br />
Geburtsschmerz vom ersten Kind nicht vergessen hätte.<br />
Martins Eltern versuchten den Schmerz in den Vergessensspeicher<br />
zu transportieren, indem sie ihn mit Heldentum<br />
und Männlichkeit in Verbindung brachten und<br />
ihm so einen positiven Touch verpassten. Für die meisten<br />
Menschen war Schmerz ohnehin nichts Besonderes,<br />
ein täglicher Begleiter, der vor allem durch schwere körperliche<br />
Arbeit eng in ihr Leben eingebunden war. Vom<br />
schmerzenden Rücken durch die Arbeit auf dem Feld,<br />
in der Fabrik oder von aufgequollenen gichtigen Fingern<br />
der Waschfrauen wurde kein Aufhebens gemacht. „Im<br />
Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen.“<br />
Diese Drohung war tägliche Realität. Schmerz war ein<br />
zentrales Thema der christlichen Religion. Er war Strafe<br />
oder Prüfung Gottes.“„Wer seine Kinder liebt, der<br />
züchtigt sie“, lautete die Handanweisung für prügelnde<br />
Ehemänner oder Väter. Bezahlten <strong>Frauen</strong> nicht zu Recht<br />
mit dem Geburtsschmerz den Preis für das paradiesische<br />
Apfelessen? Märtyrer ertrugen freudig Schmerzen in der<br />
Nachfolge Jesu und bis heute werden sie deswegen verehrt.<br />
Griechische Feuerläufer, Fakire und indonesische<br />
Trancetänzer halten diese Tradition lebendig.<br />
Im normalen Lebensalltag geht unsere Schmerztoleranz<br />
gegen Null. Wir bestehen darauf, ein schmerzfreies Leben<br />
zu haben. Sofort! Leider ist dagegen nicht immer ein<br />
Kraut gewachsen und der Schmerz ist chronisch taub gegenüber<br />
Verwünschungen, er hat seinen hilfl osen Wirt<br />
fest im Griff. Auch wenn Sie jetzt denken, die Psychologen<br />
haben häufi g nicht alle Tassen im Schrank, ich sag<br />
es trotzdem: Das ist die Stunde der Psychologie, ohne<br />
deren Unterstützung wird er sich nämlich nicht vertreiben<br />
lassen. Diese bittere Pille mögen viele <strong>Männer</strong> nicht<br />
schlucken. <strong>Frauen</strong> sind viel eher bereit, Psychologisches<br />
zu denken. Martin musste als „typischer Mann“ Zweifel<br />
und Widerstände überwinden; aber als wir uns nach harter<br />
Arbeit und heftigen sokratisch angehauchten Disputen<br />
verabschiedeten, wusste er: ohne Psychologie hätte<br />
er seinen Arbeitsplatz und vielleicht auch seine Frau verloren.<br />
Er sollte nicht er letzte ungläubige Thomas sein,<br />
der eines Besseren belehrt wurde.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 13
Schwerpunkt<br />
Artenschutz für bedrohte <strong>Männer</strong><br />
Die vorklinischen <strong>Medizin</strong>studierenden, die ich unterrichte,<br />
verstehen per defi nitionem unglaublich viel von<br />
Biochemie, dafür aber extrem wenig von menschlichem<br />
Geschlechtsverhalten. Bei zwischenmenschlicher<br />
Kontaktaufnahme, die über das übliche „Hallo, bist du<br />
auch durch die Klausur gefallen?“ hinausgeht, beginnen<br />
sie refl ektorisch den Zitronensäurezyklus aufzusagen.<br />
In meiner Vorlesung über Sexualität beginne ich daher<br />
weit unter der Basis der Kenntnisse, die in unserer Kultur<br />
ansonsten schon pseudozivilisierte Fünfjährige besitzen.<br />
Ich beginne bei den Blümchen und den Bienchen. Streng<br />
genommen lasse ich die Insekten erstmal weg, um niemanden<br />
zu verwirren. Besagte Blümchen haben einen<br />
ernstzunehmenden Vorteil: Sie sind zweigeschlechtlich.<br />
Jede Pfl anze besitzt sowohl männliche als auch weibliche<br />
Fortpfl anzungsorgane. Und zwar gleichzeitig!<br />
Warum Gott, die Natur oder das Schicksal bei allen beweglichen<br />
Wesen den Irrweg gegangen ist, sie nur mit<br />
jeweils einem Geschlecht auszustatten, lässt sich vermutlich<br />
nur mit Geiz erklären. Oder, was wahrscheinlicher<br />
ist, vermutlich waren gerade die Fördergelder<br />
ausgegangen. Überlegen Sie sich doch einmal, welche<br />
unermesslichen Vorteile es hätte, zweigeschlechtlich zu<br />
sein. Diesen ganzen Unsinn mit typisch männlichem<br />
und typisch weiblichem Verhalten könnte man sich ersparen.<br />
Es gäbe ein Zweigeschlecht und damit basta. Mit<br />
etwas Geschick könnte man sich sogar selbst befruchten<br />
und damit auf all die Verirrungen der Liebe verzichten.<br />
Was hätte ich in meinem Leben schaffen können, wenn<br />
ich nicht ständig durch amouröse Emotionen und die<br />
konsequent daraus folgenden Enttäuschungen abgelenkt<br />
gewesen wäre. Schlimmer noch, im Gegensatz zu den<br />
meisten anderen Säugetieren, die das ganze Melodrama<br />
der Balz nur einmal im Jahr durchmachen müssen und<br />
dann elf Monate ihre Ruhe haben, ist der Mensch ständig<br />
„rollig“, „brunftig“ oder „heiß“ und auf der Suche nach<br />
Geschlechtspartnerinnen oder -partnern. Zweifellos eine<br />
endlose Verschwendung von Zeit und Energie.<br />
1977 erschien das Buch „Die Töchter Egalias“ von G.<br />
Brantenberg. Es handelt sich um die vergleichsweise<br />
langweilige Beschreibung eines pubertierenden Jungen<br />
mit dem wohlklingenden Namen Petronius Bram und<br />
beschreibt eigentlich nur all die Probleme, die Heranwachsende<br />
in diesem Alter nun mal haben. Die Erzählung<br />
wäre eigentlich niemals gedruckt worden, das<br />
Besondere an dem Band aber ist, dass die Geschlechter-<br />
14<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Erich Kasten<br />
rollen vertauscht sind. <strong>Männer</strong> tragen Lockenwickler im<br />
Bart und gehen nach dem Essen in die Küche, um den<br />
Abwasch zu machen, während die <strong>Frauen</strong> im Wohnzimmer<br />
bleiben, um zu rauchen und über wichtige Dinge zu<br />
reden. Die Welt ist voll von dominanten, einfl ussreichen<br />
Direktorinnen und Bürgermeisterinnen, <strong>Männer</strong>n traut<br />
man solche wichtigen Ämter nicht wirklich zu. Es gibt<br />
den Begriff „Herrlein“, aber kein „Fräulein“, aus „beherrschen“<br />
wird „befrauschen“ und aus der Redewendung<br />
„man tut dies oder das“ wird „frau tut dies oder das“. Den<br />
Beruf der Seefrau zu ergreifen ist für Jungen unschicklich,<br />
ihnen könnte auf den schwankenden Schiffen leicht<br />
schlecht werden. Die Mädchen tragen keinen BH und<br />
lesen Abenteuerromane von todesmutigen Piratinnen;<br />
Jungen müssen sich einen engen und ständig drückenden<br />
„PH“ anpassen lassen, damit da unten zwischen den<br />
Beinen nichts unschicklich herumbaumelt. Beim Lesen<br />
dieses Buches wurden mir die sozialen Unterschiede<br />
klar, die in dieser Gesellschaft zwischen <strong>Männer</strong>n und<br />
<strong>Frauen</strong> existieren. Und immer wieder, wenn der jugendliche<br />
Held des Romans bei One Night Stands von <strong>Frauen</strong><br />
sexuell ausgenutzt, unterdrückt oder sogar vergewaltigt<br />
wurde, fragte ich mich, warum er das eigentlich erträgt<br />
und sich nicht endlich mal wehrt?<br />
Das Buch kam – wie gesagt – Ende der 1970er auf den<br />
Markt. Irgendetwas hat sich seitdem auf eine unheimliche<br />
Art hinterrücks verändert. Und zwar gravierend verändert.<br />
In meiner Vorlesung über Entwicklungspsychologie<br />
stelle ich, neben vielen anderen Theorien, auch die<br />
Phasen der psychosexuellen Entwicklung von Sigmund<br />
Freud vor. Die Kastrationsangst in der ödipalen Phase, so<br />
schrieb der Großmeister der Psychoanalyse, wird durch<br />
Identifi kation mit dem Oberhaupt der Familie beendet.<br />
Jahrzehntelang war klar, wer das Oberhaupt der Familie<br />
ist; dies bedurfte niemals der näheren Erörterung. Aber<br />
seit Mitte der 1990er Jahre bemerkte ich bei dieser Aussage<br />
zunehmend mehr fragende Stirnfalten in den Gesichtern<br />
meiner Studentinnen und Studenten und ertappte<br />
mich dabei, wie ich begann stotternd anzufügen: „… äh<br />
... ja ... das war damals wohl noch der Vater.“<br />
In den letzten fünfzig Jahren hat sich die Stellung der beiden<br />
Geschlechter umgedreht. Eine Frau als Sprecherin<br />
der Tagesschau wäre noch Anfang der 1960er Jahre völlig<br />
undenkbar gewesen und niemand von uns hat damals<br />
geahnt, dass auch eine weibliche Form des Wortes „Bun-
deskanzler“ existiert. Der Beruf der Polizistin war völlig<br />
unbekannt und kein Mensch hätte ernsthaft geglaubt,<br />
dass eine Kommissarin Verbrecher fangen kann. Dinge,<br />
die heute nicht nur Normalität sind – im Gegenteil, wir<br />
<strong>Männer</strong> geraten zunehmend ins Hintertreffen. Aufgrund<br />
hirnorganischer Funktionen, die uns angeboren sind und<br />
an denen wir damit weitgehend schuldlos sind, machen<br />
sich <strong>Frauen</strong> mehr und mehr über die ulkigen Ausrutscher<br />
ihrer maskulinen Artgenossen lustig. Das kleinste Übel<br />
hierbei ist, dass die menschlichen Männchen aufgrund<br />
ihres hohen Testosteronspiegels gedanklich ständig mit<br />
Sex beschäftigt sind, was ihren Arbeitsoutput drastisch<br />
mindert. Ich erinnere mich schwach, irgendwo gelesen<br />
zu haben, dass <strong>Männer</strong> im Durchschnitt alle vier<br />
Minuten von sexuell getönten Gedanken oder Phantasien<br />
belästigt werden, die sich ihnen unaufgefordert aufzwängen.<br />
Viel katastrophaler ist aber wohl die geringere<br />
sprachliche Begabung. Millionen Jahre lang war es ein<br />
selektiver biologischer Vorteil, dass <strong>Männer</strong>, wenn sie in<br />
kleinen Jagdgruppen durch den Urwald pirschten, völlig<br />
still sein konnten, um Beutetiere nicht zu verscheuchen<br />
und Raubtiere nicht auf sich aufmerksam zu machen.<br />
Jeder Wortwechsel stellte ein Risiko dar. <strong>Frauen</strong> in geschützten<br />
Höhlen hingegen konnten munter miteinander<br />
schwätzen; die Kinder waren ohnehin laut. In einer<br />
modernen Gesellschaft, in der schneller Informationsaustausch<br />
extrem wichtig geworden ist, haben <strong>Männer</strong><br />
durch die Selektion zum Schweigen hierdurch einen eklatanten<br />
Nachteil.<br />
Damit nicht genug. Die Herren der Schöpfung sollen<br />
aufgrund ihres kleineren Corpus callosum auch weniger<br />
fähig zu Multitasking sein. Die Medien machen<br />
sich schon über uns lustig. In der TV-Sendung „Typisch<br />
Mann, typisch Frau“ sollten Versuchspersonen beider<br />
Geschlechter eine Abfolge von Büroarbeiten in einem<br />
befristeten Zeitraum ableisten. Hierzu gehörten Kaffee<br />
kochen, kopieren, die kopierten Blätter falten und kuvertieren,<br />
einen Telefonanruf annehmen und weitere<br />
Aufgaben. Die <strong>Frauen</strong> setzten den Kaffee auf, während<br />
dieser durchlief, kopierten sie, während der Kopierer lief,<br />
falteten und kuvertierten sie bereits die fertigen Blätter<br />
und nahmen dabei gleichzeitig noch den Telefonanruf<br />
an, indem sie den Hörer zwischen Ohr und Schulter einklemmten.<br />
Der typische Mann legte das Papierblatt in<br />
den Kopierer, stellte sich breitbeinig davor und wartete<br />
mit verschränkten Armen, bis die Kopien fertig waren.<br />
Erst nachdem die letzte Kopie fertig war, widmete er sich<br />
der Kaffeemaschine usw.<br />
Logische Konsequenzen möchte ich aus diesen Beispielen<br />
besser nicht ziehen, zu sehr fühle ich mich meinem<br />
Geschlecht verbunden. Vielleicht reicht es, wenn ich (als<br />
Mann!) die <strong>Frauen</strong> einfach um ein bisschen Verständnis<br />
Schwerpunkt<br />
„<strong>Männer</strong> unter Artenschutz stellen“ fordert Professor Kasten.<br />
Foto: privat<br />
bitte. Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass <strong>Männer</strong><br />
eine aussterbende Spezies sind, die unter Artenschutz<br />
gestellt werden sollte. Als ich anfi ng, angehende <strong>Medizin</strong>erinnen<br />
und <strong>Medizin</strong>er zu unterrichten, waren 70%<br />
männlich und 30% weiblich. Inzwischen sind nur noch<br />
20% männlich, aber 80% weiblich. Als ich selbst Psychologie<br />
studierte, war der Geschlechterverhältnis mit<br />
50:50 ziemlich ausgewogen. Während meiner Gastprofessur<br />
an der Humboldt-Uni in Berlin stellte ich mit Erstaunen<br />
fest, dass inzwischen 95% (!) der Studierenden<br />
weiblich waren. Was machen die Herren, die ja offenbar<br />
nicht mehr studieren und damit auch weniger Chancen<br />
haben, Direktorin oder Bundeskanzlerin zu werden? Ich<br />
weiß es nicht, möglicherweise arbeiten die meisten von<br />
ihnen nun in der rauchfreien Eckkneipe als männliches<br />
Barmädchen.<br />
Kontakt<br />
Prof. Dr. Erich Kasten<br />
Institut für <strong>Medizin</strong>ische Psychologie<br />
Universität zu Lübeck<br />
Ratzeburger Allee 160<br />
23538 Lübeck<br />
E-Mail: EriKasten@aol.com<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 15
Foto: privat<br />
Schwerpunkt<br />
Dr. Carmel Shalev<br />
Gastprofessorin in der Abteilung Ehtik und Geschichte der <strong>Medizin</strong><br />
Die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> hat eine Gastprofessorin.<br />
Dr. Carmel Shalev aus Israel ist im Sommersemester<br />
2008 in der Abteilung Ethik und Geschichte<br />
der <strong>Medizin</strong> tätig und engagiert sich in Forschung und<br />
Lehre. Ihr Aufenthalt wird aus Mitteln des Maria-Goeppert-Mayer-Programms<br />
für internationale <strong>Frauen</strong>- und<br />
Genderforschung des Niedersächsischen Ministeriums<br />
für Wissenschaft und Kultur fi nanziert.<br />
Dr. Carmel Shalev studierte Rechtwissenschaften an<br />
der hebräischen Universität in Jerusalem und an der<br />
Universität Yale. Ihre Studien schloss sie mit dem Master<br />
of Law (LL.M) und der Promotion ab. Sie arbeitet<br />
in der Abteilung für <strong>Medizin</strong>recht und Ethik am Sheba<br />
Klinikum in Israel und ist Mitglied in verschiedenen<br />
Gremien, z.B. der Ethikkommission des nationalen<br />
Stellen Sie sich die Welt einmal<br />
ohne die Anti-Baby Pille,<br />
ohne Ultraschall, Retortenbabys,<br />
Organtransplantationen,<br />
Kernspintomographie, chirurgische<br />
Eingriffe am offenen<br />
Herzen und Intensivstationen<br />
vor. Diese großartigen medizinischen<br />
und technischen<br />
Errungenschaften haben einen<br />
vertrauten Anteil an unserem<br />
Leben und auch daran,<br />
wie wir sterben. Dies nehmen<br />
wir als selbstverständlich an; doch vor rund 50 Jahren<br />
waren sie praktisch nicht existent. Und schon wieder erklärt<br />
uns die Wissenschaft, dass ein neuer Durchbruch<br />
in der <strong>Medizin</strong> bevorsteht: die genetischen Revolution.<br />
Einige sagen voraus, dass dadurch das Zeitalter der personalisierten<br />
<strong>Medizin</strong> anbrechen wird: Ein Zeitalter der<br />
maßgeschneiderten Verabreichung von Medikamenten<br />
16<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Transplantationszentrums in Israel. Sie hat zahlreiche<br />
Veröffentlichungen zu den Themen Pränataldiagnose,<br />
Leihmutterschaft und Sterbehilfe vorzuweisen.<br />
Dr. Carmel Shalev bietet verschiedene Lehrveranstaltungen<br />
an, unter anderem zur Entwicklung der modernen<br />
Bioethik, zur Ethik der Reproduktionstechnologien<br />
(gemeinsam mit Prof. Dr. Sike Schicktanz) und zu<br />
<strong>Frauen</strong>rechten und Gerechtigkeit im Internationalen<br />
Kontext (u.a. in Kooperation mit Prof. Dr. Gunnar Duttge<br />
von der Juristischen Fakultät).<br />
In der Zeitschrift GEORGIA stellt sie sich mit einem<br />
Artikel zum Thema „Wunder (-Mittel), Märkte und<br />
moralische Risiken“ vor.<br />
Wunder (-Mittel), Märkte und moralische Risiken<br />
Carmel Shalev<br />
und Ersatzteil-Organen, abgestimmt auf unser einzigartiges<br />
genetisches Make-Up. So könnten Alter und schwere<br />
Krankheiten auf eine wirksame Art und Weise überwunden<br />
werden. Andere befürchten eher, dass der Wert des<br />
Genetischen überhöht werden könnte und sehen den<br />
Anbruch der post-menschlichen Zukunft, die zugleich<br />
das Ende der Menschheit, wie wir sie heute kennen, sein<br />
wird.<br />
Aber die Tatsache, dass wir etwas tun können, bedeutet<br />
nicht, dass wir dies auch tun sollten. Die moderne <strong>Medizin</strong><br />
lässt Wunder geschehen, aber diese haben auch<br />
ihren Preis – einen Preis, der ständig steigt und unbezahlbar<br />
sein kann. Einige Kosten sind mit Geld zu begleichen,<br />
andere stellen moralische Risiken dar. Biomedizinische<br />
Technologien werden von einer profi torientierten Industrie<br />
angetrieben, die sich von der Konsumorientierung<br />
eines freien Marktes leiten lässt, und diese mit dem Wert<br />
der individuellen Freiheit rechtfertigt. Dies kann aber<br />
gleichzeitig zu Lasten anderer wesentlicher Werte – wie
der Würde des Menschen und der sozialen Gerechtigkeit<br />
– führen. Über diese und vergleichbare Themen geht es<br />
in der Bioethik.<br />
Das in den Diskurs über Bioethik eingebrachte Wertesystem<br />
kann jedoch von Kultur zu Kultur unterschiedlich<br />
sein und daher durch unsere persönlichen Weltanschauungen<br />
variieren. Viele der behandelten Themen werfen<br />
Dilemmata auf, für die es offensichtlich keine objektiv<br />
richtige Lösung gibt. Alles was wir tun können, ist uns gegenseitig<br />
aufgeschlossen zuzuhören und die Argumente<br />
der bzw. des anderen zu refl ektieren. Aber auch danach<br />
wissen wir vielleicht noch immer nicht, was wir tun sollen.<br />
Anlässlich des Entstehens einer neuen Technologie<br />
wollen Politik und Gesetzgebung beraten werden. Aber<br />
auch dort, wo Politik und Rechtsprechung den Einsatz<br />
einer bestimmten Technologie ermöglichen, sollten wir<br />
auf der Ebene unserer persönlichen Entscheidungen diskutieren.<br />
Auch wenn der Einsatz einer bestimmten Technologie<br />
erlaubt ist, bedeutet das nicht notwendigerweise,<br />
dass wir ihren Einsatz aus moralisch verantwortlicher<br />
Sicht auch empfehlen können.<br />
In einer multikulturellen Welt liegt dem Bioethik-Diskurs<br />
ein System mannigfaltiger Werte zugrunde. Das ist so in<br />
Israel der Fall, wo die Debatten durch unterschiedliche<br />
und sich zum Teil widersprechender Werte geprägt sind.<br />
Zunächst ist die Kultur Israels in einem hohen Maße allen<br />
Arten neuer Technologien gegenüber positiv aufgeschlossen<br />
und hat allgemein ein großes Vertrauen in den<br />
wissenschaftlichen Fortschritt. Insbesondere genießen<br />
<strong>Medizin</strong> und Gesundheitsfürsorge hohen Respekt. Israel<br />
ist ein Land, das sich an besonderes hoch entwickelter<br />
<strong>Medizin</strong>, medizinischer Technik und wissenschaftlicher<br />
Forschung erfreut. Es gibt dort eine öffentliche Infrastruktur<br />
der Gesundheitsfürsorge und eine staatliche Krankenkasse,<br />
die das Recht auf eine breite Palette grundlegender<br />
Leistungen garantiert. Am Ende des Lebens sind<br />
gründliche Pfl ege und Intensivmedizin die Norm. Wenn<br />
wir den Umgang mit dem Anfang des Lebens betrachten,<br />
hält Israel alle Rekorde im Bereich der Reproduktionsmedizin,<br />
gemessen an der Anzahl der Klinken für In-vitro-Befruchtung<br />
pro Kopf und der Anzahl an Behandlungen<br />
– und israelische Ärzte waren die Pioniere sowohl<br />
in der Erforschung von Unfruchtbarkeit als auch bei der<br />
Produktion von Stammzellen.<br />
Die Offenheit der israelischen Kultur gegenüber medizinischen<br />
Innovationen und den damit zusammenhängenden<br />
Technologien ist eng gekoppelt an traditionelle jüdische<br />
Werte, die in der Halakhah (orthodoxes jüdisches<br />
Recht) ihren Ausdruck fi nden. Ein wesentliches Element<br />
im halakhischen Ansatz ist, dass es die Bestimmung des<br />
Menschen in der Welt ist, die Schöpfung Gottes zu verbessern.<br />
Die stellt einen Unterschied zu der christlich-<br />
Schwerpunkt<br />
katholischen Lehre dar, die eher davon ausgeht, dass wir<br />
nicht in die Schöpfung Gottes eingreifen sollten. Ferner<br />
gibt es die Gebote zum Heilen, zur Rettung und Schonung<br />
von Leben sowie das Gebot der Fortpfl anzung<br />
(„Seid fruchtbar und mehret euch“), so dass sogar die<br />
Therapie von Unfruchtbarkeit als lebensrettende Maßnahme<br />
gedeutet werden kann. Hinzu kommt, dass der<br />
Anfang des Lebens als ein sukzessives Kontinuum gesehen<br />
wird. So wird dem Embryo in einem frühen Stadium<br />
der Schwangerschaft nur die Bewertung von „Wasser“<br />
zuteil. Bis zum Ende der Schwangerschaft wird dem<br />
Leben des Fötus weniger Wert als dem der Mutter beigemessen.<br />
Konsequenterweise kommen die dominanten<br />
Stimmen der israelischen Bioethik-Debatte zu dem<br />
Schluss, dass die Forschung am menschlichen Embryo<br />
– auch das therapeutische Klonen – im Hinblick auf den<br />
möglichen Nutzen dieser medizinischen Forschung auf<br />
jeden Fall gerechtfertigt ist.<br />
Gleichzeitig beruht aber das israelische Grundgesetz auf<br />
der Anerkennung fundamentaler Menschenrechte und<br />
den zugrunde liegenden Prinzipien, wie der Würde des<br />
Menschen, der Freiheit und der Gerechtigkeit. So können<br />
Spannungen zwischen diesen grundlegenden demokratischen<br />
Werten und der jüdischen Tradition auftreten.<br />
Bei Entscheidungen, die am Ende eines Lebens zu treffen<br />
sind, setzt sich zum Beispiel der Wert der Heiligkeit des<br />
Lebens dem demokratischen Wert der individuellen Autonomie<br />
gegenüber durch. Das bedeutet, dass – wenn<br />
einmal begonnen – die künstliche Beatmung eines Menschen<br />
nicht wieder abgebrochen werden darf, auch<br />
wenn dieser verfügt hat, nicht von einer Maschine abhängig<br />
sein zu wollen. Auf der anderen Seite gibt es viele<br />
Bereiche, in denen das jüdische Recht liberaler ist als der<br />
säkulare Humanismus. So gibt es zum Beispiel viele gute<br />
humanistische Gründe, Kauf und Verkauf von Organen<br />
zu untersagen. Das orthodoxe jüdische Recht hat aber<br />
keine prinzipiellen Einwände gegen solche Praktiken.<br />
Ich selbst kam als Studentin in den späten Siebzigern<br />
zum Thema Bioethik, die Legalisierung der Abtreibung<br />
war ein wichtiges Thema für die Gleichberechtigung der<br />
<strong>Frauen</strong>. Individuelle Freiheit, Wahlfreiheit, Privatsphäre<br />
und Autonomie waren die grundlegenden Prinzipien der<br />
liberalen Rechtswissenschaft, wie sie mir im Studium<br />
gelehrt wurden. Dies sind Werte, die ich sehr für mich<br />
selbst wertschätze, die meinen Blick auf bioethische<br />
Themen beeinfl ussten und dies auch weiterhin grundlegend<br />
tun werden.<br />
Aber in den letzten Jahren hat der Diskurs über Menschenrechte<br />
begonnen, neben den individuellen Freiheitsrechten<br />
auch andere Rechte zu betonen. Aktuelles<br />
Thema im Diskurs über Menschenrechte ist die soziale<br />
Gerechtigkeit. Soziale Rechte, die durch den Fortschritt<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 17
Schwerpunkt<br />
in der Biomedizin beeinfl usst sind, beinhalten das Recht<br />
auf Gesundheit und das Recht am Nutzen des wissenschaftlichen<br />
Fortschritts teilzuhaben. Beide Rechte werden<br />
durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte<br />
1948 garantiert. Menschenrechte sind universell, das<br />
bedeutet, dass sie das Recht jedes einzelnen Menschen<br />
sind und nicht nur das Privileg einer Gruppe, die sie sich<br />
leisten kann. Das Prinzip der Gerechtigkeit fordert nicht<br />
nur, dass begrenzte Ressourcen fair verteilt werden. Die<br />
einer Verteilung zugrunde liegenden Prinzipien sind<br />
eine Frage der gesetzten Prioritäten. Dies gilt nicht nur<br />
bezüglich des Angebots der Gesundheitsfürsorge, sondern<br />
auch in Forschung und Entwicklung.<br />
Die Berücksichtigung des Themas Gerechtigkeit veränderte<br />
meinen Blick auf die Welt. Meine Freiheit ist mir<br />
wichtig geblieben, aber die Frage nach der Gerechtigkeit<br />
bringt mich dazu, auch über die Grenzen meiner Eigeninteressen<br />
hinaus zu blicken, die Bedürfnisse meiner<br />
Mitmenschen zu bedenken und für die zu sorgen, die<br />
weniger privilegiert sind. Ein Medikamentenhersteller<br />
hat ein neues Mittel gegen eine seltene, erblich bedingte<br />
Krankheit bei Kindern auf den Markt gebracht. Dieses<br />
Mittel wird zu einem Preis vermarktet, der so hoch ist,<br />
dass eine Behandlung mehrere hunderttausend Euro im<br />
Jahr kosten würde. Wie gehen wir mit etwas so Absurden<br />
um?<br />
Vorankündigung:<br />
Vortragsreihe „Gender <strong>Medizin</strong>“ im WS 2008/2009<br />
an der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
18<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Einige sind der Meinung, dass wir daran nichts ändern<br />
könnten, als wäre der Markt ein Golem oder Frankensteins<br />
Monster, das außer Kontrolle geraten ist. Ich benenne<br />
diese Position „Markt-Fatalismus“ oder „Markt-<br />
Defätismus“. Ich glaube, wir sind mehr als Roboter, die<br />
auf die Manipulationen einer glanzvollen Werbeindustrie<br />
reagieren, die uns verkaufen will, dass Alter, Krankheiten<br />
und der Tod besiegt werden könnten. Meiner Meinung<br />
nach macht ‚mehr’ medizinische High-Technology die<br />
Welt nicht zwangsläufi g zu einem lebenswerteren Ort.<br />
Ich würde eher sagen, dass eine faire Verteilung der bereits<br />
existierenden medizinischen Mittel zur Prävention<br />
von Malaria bei Kindern viel wichtiger ist als das Versprechen<br />
einer extravaganten Zukunft.<br />
Ich möchte nicht durch eine Überzahl von Angeboten<br />
kontrolliert werden, auch nicht durch medizinische Errungenschaften.<br />
Ich möchte lernen, verantwortliche<br />
Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass wir an der<br />
Technik wachsen können und uns als moralische Wesen<br />
weiterentwickeln können. Wir können auch lernen,<br />
unsere Freiheit mit Selbstbeherrschung auszuüben. Ich<br />
möchte weise genug sein, zu einer Technologie „nein“<br />
zu sagen, die unter Umständen absurde Folgen hat. Für<br />
mich liegt die Herausforderung der Bioethik darin sicherzustellen,<br />
dass die Technik macht, was wir wollen, und<br />
dass die Technik genau das unterlässt, was wir nicht wollen,<br />
für den Nutzen der Menschheit.<br />
Aus dem Englischen von Martin Gloger<br />
Im Wintersemester 2008/2009 laden wir Sie herzlich zu einer spannenden Vortragsreihe<br />
zum Thema „Gender <strong>Medizin</strong>“ ein. Die Gender <strong>Medizin</strong> beleuchtet geschlechtsspezifi<br />
sche Aspekte in Prävention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation. Sie schärft<br />
das Bewusstsein für die Bedeutung des Geschlechts bei Gesundheit und Krankheit. Neben<br />
biologischen Unterschieden haben auch soziale Unterschiede zwischen <strong>Männer</strong>n<br />
und <strong>Frauen</strong> eine Auswirkung auf die Entstehung und Ausprägung von Erkrankungen.<br />
Genauere Informationen zur Vortragsreihe erhalten Sie über Aushänge und Flyer zu<br />
Beginn des Wintersemesters.
Foto: privat<br />
In den 70er Jahren studierte ich Biologie mit einem medizinischen<br />
Schwerpunkt und spezialisierte mich auf Immunologie.<br />
Meine Doktorarbeit schrieb ich in den 90ern<br />
ebenfalls über ein biomedizinisches Thema – <strong>Frauen</strong><br />
und Osteoporose. Bereits in den Jahren zuvor hatte ich<br />
mir neue Fähigkeiten angeeignet und Erkenntnisse gewonnen.<br />
Ich interessierte mich für die Gender-Perspektive<br />
auf Wissenschaft und Technik. Dies resultierte auch<br />
in einem anderen Blick auf die Konstruktion biomedizinischen<br />
Wissens und die aus diesem Wissen folgenden<br />
Konsequenzen. Der Kontext meiner Forschungen<br />
war die damalige Debatte über die Medikalisierung des<br />
weiblichen Körpers. Meine Dissertation war eine gendersensible<br />
Analyse von vier Ansätzen im Umgang mit<br />
Osteoporose: Forschung, Behandlung, Informationspolitik<br />
und diesbezügliche Positionierungen im Internet.<br />
Auf Basis dieser Vorarbeiten engagierte ich mich ab 2000<br />
auch auf europäischer Ebene in der Kommission für Gender<br />
Impact Assessment Studies. Hier kam ich mit der EU-<br />
Gleichstellungspolitik im Hinblick auf Forschungsfragen<br />
in Berührung. Die Kommission nahm das Verhältnis zwischen<br />
Geschlecht und Wissenschaft als dreigeteilt wahr:<br />
Forschung von <strong>Frauen</strong>, für <strong>Frauen</strong> und über <strong>Frauen</strong>. Mit<br />
Schwerpunkt<br />
Meine Leidenschaft für Gender Studies und<br />
Biomedizin. Wie alles begann.<br />
Ineke Klinge<br />
dem sechsten Rahmenprogramm ließ es sich auf die<br />
Formel GG=GD+FP bringen. Geschlechtergerechtigkeit<br />
(GG) zu fördern, bedeutet die Gender-Dimension (GD)<br />
des Forschungsgegenstandes zu berücksichtigen und die<br />
<strong>Frauen</strong>-Partizipation (FP) auf allen Ebenen des Wissenschaftsbetriebes<br />
zu fördern.<br />
In der Studie über Gender Impact Assessment (GIA) in<br />
den Lebenswissenschaften, die ich zusammen mit Mineke<br />
Bosch, einer Kollegin vom Centre for Gender and<br />
Diversity geleitet habe, setzte ich meine Priorität auf die<br />
Frage, was die Gender-Dimension für die biowissenschaftliche<br />
und medizinische Forschung ausmacht. Ich<br />
unternahm große Anstrengungen um zu vermitteln, dass<br />
eine konzeptionelle Unterscheidung zwischen dem biologischen<br />
Geschlecht (sex) und dem sozialen Geschlecht<br />
(gender) unerlässlich in diesem Forschungsfeld war. Die<br />
GIA-Studie hatte einen großen Einfl uss; ein Resultat waren<br />
neue Richtlinien für die biomedizinische Forschung<br />
im sechsten Rahmenprogramm, z.B. obligatorische Fragen<br />
an die Antragstellerinnen und Antragsteller bezüglich<br />
der Sex- und Gender- Aspekte in ihrer biomedizinischen<br />
Forschung und konkrete Pläne zur Umsetzung von<br />
Gender-Fragen.<br />
Nach der GIA-Studie erschien mir ein weiteres EU-Projekt<br />
als logische Konsequenz. Die Richtlinien aus dem<br />
sechsten Rahmenprogramm waren ein von oben nach<br />
unten gerichteter Prozess, offen blieb jedoch die Frage,<br />
was die Bedürfnisse der Wissenschafts-Community waren.<br />
Es schien nötig, der Relevanz von Sex- und Gender-<br />
Aspekten noch mehr Aufmerksamkeit zu widmen und<br />
Instrumente zu entwickeln, wie diese Fragestellungen in<br />
den Forschungsprozess integriert werden könnten. Einer<br />
der bedeutendsten Erfolge dieses Projektes, das wir GenderBasic<br />
nannten, war eine Sonderausgabe der Zeitschrift<br />
Gender Medicine mit mir als Gast-Herausgeberin, die<br />
vier Artikel zu konzeptionellen und methodologischen<br />
Fragen der allgemeinen, translationalen, klinischen und<br />
Public Health-Forschung beinhaltete und weitere sechs<br />
Artikel zu ausgewählten medizinischen Disziplinen oder<br />
Krankheitsbildern, nämlich Angsterkrankungen, Asthma,<br />
metabolisches Syndrom, Nutrigenomik, Osteoporose<br />
und Arbeitsmedizin.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 19
Schwerpunkt<br />
Mein wissenschaftliches Hauptinteresse ist es, die Gender-Kompetenz,<br />
die ich bereits in anderen Bereichen<br />
gesammelt habe, in die biomedizinische Forschung zu<br />
integrieren. Der Körper war immer mein Lieblingsthema<br />
und wird es auch immer bleiben, schon im Fach Immunologie.<br />
In den anderen Aktionsfeldern meiner wissenschaftlichen<br />
Laufbahn lernte ich, dass der Körper zwar<br />
oft als ein interessantes Forschungsfeld wahrgenommen<br />
wird, selten jedoch als Materie, d.h. das Material des<br />
Körpers, kurz gesagt: Fleisch und Blut. Wir führten eine<br />
ganze Reihe von Debatten über die Unterscheidung<br />
zwischen Sex und Gender (ja/nein, nützlich/überholt),<br />
über konstruktivistische Perspektiven auf den Körper und<br />
über relativistische Ansätze. Trotz vieler schöner Analysen<br />
und Erzählungen vermisste ich weiterhin ernsthafte<br />
Bestrebungen, einen Einblick in den Körper zu bekommen,<br />
etwas über die biologischen Prozesse innerhalb<br />
des <strong>Frauen</strong>körpers und des <strong>Männer</strong>körpers und über die<br />
Unterschiede zu lernen. Ich habe versucht, diesen Themenkomplex<br />
in meiner Dissertation zu berühren, doch<br />
fehlte mir zu jener Zeit noch das richtige Handwerkszeug<br />
dazu. Viele Autorinnen teilen jedoch mein Unbehagen<br />
über die Vernachlässigung des Körperinneren in<br />
der Geschlechterforschung: Ellen Kuhlmann und Birgit<br />
Babitsch, Lynda Birke und Anne Fausto Sterling. Lynda<br />
Birke traute sich dies provokant auszudrücken: „Feministische<br />
Theorie geht nur so tief wie die Haut.“<br />
Das GenderBasic-Projekt lieferte neue Modelle, warf<br />
neue Forschungsfragen auf und entwickelte Instrumente<br />
für eine Umgestaltung herkömmlicher Forschungsmethoden.<br />
Beachtenswert war, dass in einigen Bereichen<br />
bereits eine Arbeitsweise „von unten nach oben“ anzutreffen<br />
war, obwohl auf Geschlechterdifferenzen begrenzt<br />
und ohne einen Bezug zur EU-Forschungspolitik.<br />
Die Erforschung körperlicher Geschlechterdifferenzen<br />
(sex) war ein relativ junges Terrain, die daraus entstandenen<br />
Publikationen Pionierleistungen. GenderBasic plädiert<br />
dafür, ebenso im Bereich von Gender-Differenzen<br />
zu verfahren.<br />
Zusammenfassend würde ich sagen, in GenderBasic lagen<br />
die Schwerpunkte auf den Unterschieden zwischen<br />
den Geschlechtern, auf Gender-Effekten (in der individuellen<br />
Gesundheitsvorsorge, in der klinischen Praxis und<br />
in der Diagnose) sowie in den Wechselwirkungen zwischen<br />
Sex und Gender und anderen Dimensionen von<br />
Differenz. Die große Herausforderung, die vor uns liegt,<br />
ist der Versuch einer umfassenden Übertragung dieser<br />
Erkenntnisse auf die Biomedizin.<br />
20<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Erinnern wir uns an die EU-Gleichstellungspolitik und<br />
die Formel GG=GD+FP. Wird eine größere Beteiligung<br />
von <strong>Frauen</strong> in der Wissenschaft propagiert, wirft das oft<br />
die Frage auf, ob <strong>Frauen</strong> Wissenschaft auf eine andere<br />
Art und Weise betreiben. Londa Schiebinger hat über<br />
diese Frage gearbeitet und eine fruchtbare Perspektive<br />
vorgeschlagen: Wesentlich sind demnach nicht die wissenschaftstheoretischen<br />
Fragen, sondern die erreichten<br />
Wissensbestände, die Ergebnisse. Wessen Bedürfnisse<br />
werden befriedigt. Wem nützt es? Was gilt als gesicherte<br />
Erkenntnis? Das ist ihr Konzept einer nachhaltigen Wissenschaft.<br />
Wenn <strong>Frauen</strong> und <strong>Männer</strong> gleichberechtigt in der Wissenschaft<br />
zusammen arbeiten, wird das Ergebnis eine<br />
größere Bandbreite, ein vielfältigeres Wissen sein. Divergierende<br />
und neue Schwerpunkte können so in der<br />
Wissenschaft gesetzt, unterschiedliche Erfahrungswelten<br />
berücksichtigt und Forschungslücken gefüllt werden.<br />
Wie genau diese Mechanismen funktionieren, ist noch<br />
unbekannt. Wir können aber davon ausgehen, dass Wissenschaft,<br />
die die Bedürfnisse von <strong>Männer</strong>n und <strong>Frauen</strong><br />
adäquat berücksichtigt (und zwar auch durch die Berücksichtigung<br />
von Sex und Gender), von hoher Qualität<br />
sein wird. Eingebaut werden nicht nur die Bedürfnisse<br />
von <strong>Frauen</strong>, sondern auch die bislang vernachlässigten<br />
Aspekte männlicher Gesundheit.<br />
Dieses Wechselspiel zwischen Gender Mainstreaming,<br />
einer verstärkten Teilhabe von <strong>Frauen</strong> am Wissenschaftsprozess<br />
und wissenschaftlicher Exzellenz ist verblüffend!<br />
Ich glaube an eine gegenseitige Verstärkung von biomedizinischen<br />
Sex- und Gender-Fragen auf der einen Seite<br />
und von Karriereförderung für <strong>Frauen</strong> und vermehrte<br />
Übernahme von Führungspositionen durch <strong>Frauen</strong> auf<br />
der anderen Seite. Eine gute Wissenschaftspolitik fordert<br />
folglich zeitgleich die Integration von Sex- und Gender-<br />
Aspekten in die Forschung und die verstärkte Positionierung<br />
von <strong>Frauen</strong> in der Wissenschaft.<br />
Aus dem Englischen von Martin Gloger
Dr. Ineke Klinge<br />
Gastprofessorin an der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
Dr. Ineke Klinge ist Gastprofessorin an der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> im Wintersemester 2008/2009.<br />
Ihre Professur wird aus Mitteln des Maria-Goeppert-<br />
Mayer-Programms für internationale <strong>Frauen</strong>- und<br />
Genderforschung vom Niedersächsischen Ministerium<br />
für Wissenschaft und Kultur fi nanziert.<br />
Dr. Ineke Klinge studierte Biologie und ist auf Immunologie<br />
spezialisiert. Sie war Forschungsstipendiatin des<br />
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) auf dem Gebiet der<br />
Tumor-Immunologie am Dutch Cancer Institute. Ihr<br />
zweiter Forschungsschwerpunkt sind Gender Studies.<br />
Während Ihrer Lehrtätigkeit an der Universität Utrecht<br />
(1988-1997) entwickelte und leitete sie das interdisziplinäre<br />
Forschungsprogramm Health and Gender: The medicalization<br />
of the female body with a focus on aging.<br />
Ihre Doktorarbeit Gender and Bones: The Production<br />
of Osteoporosis 1941-1996 wurde 1998 veröffentlicht.<br />
Derzeit arbeitet sie an der Universität Maastricht als<br />
Professorin für Gender Studies im Gesundheitswesen.<br />
Seit 2004 ist sie auch Mitglied des Centre for Gender<br />
& Diversity. Ineke Klinge engagiert sich am European<br />
Institute of Women’s Health (EIWH) und ist Mitglied<br />
der Dutch Foundation for Women and Health Research<br />
(DFWHR). Ferner ist sie Mitglied im Ethik Review Panel<br />
des siebenten EU-Forschungsrahmenprogramms.<br />
Schwerpunkt<br />
Dr. Ineke Klinge hat langjährige Erfahrungen in der Leitung<br />
von EU-Projekten. Bereits 1992 leitete Sie ein EU-<br />
Projekt über den weiblichen Blick auf das Humangenomprojekt<br />
und nahm 1993 an dem ersten Workshop<br />
der Europäischen Kommission zum Thema Women in<br />
Science and Technology Research teil. 2001 führte sie<br />
eine der sieben Gender Impact Assessment Studies des<br />
fünften EU-Forschungsrahmenprogramms durch (Klinge<br />
& Bosch, 2001). Der Fokus ihres Interesses liegt auf<br />
der Integration der Gender-Dimension in Forschungsprojekte<br />
in den Lebenswissenschaften. Sie leitet das<br />
Programm für Gender and Diversity in Health and<br />
Health Care Research an der School for Public Health<br />
and Primary Care (Caphri).<br />
Von 2005-2007 koordinierte sie das erfolgreiche GenderBasic<br />
Programm im sechsten Forschungsrahmenprogramm<br />
der EU. Das Projekt stellte Handwerkszeug<br />
zur Integration von Geschlechteraspekten in die biomedizinische<br />
Forschung bereit. Ineke Klinge war<br />
Gastherausgeberin der Zeitschrift Gender Medicine<br />
(Vol. 4, Supplement B, December 2007) unter dem<br />
Titel Bringing Gender Expertise to Biomedical and<br />
Health Related Research. Ihre Publikationen beleuchten<br />
die Themen Osteoporose, den weiblichen Körper,<br />
Medikalisierung, die Menopause und die Erforschung<br />
des Einfl usses von Gender-Aspekten auf die Lebenswissenschaften<br />
und die Gesundheitsforschung.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 21
Schwerpunkt<br />
Intersexualität bei Kindern und Jugendlichen<br />
Ethische Aspekte eines medizinischen Dilemmas<br />
22<br />
Claudia Wiesemann <strong>·</strong> Susanne Ude-Koeller <strong>·</strong> Anna-Karina Jakovljevic<br />
Abt. Ethik und Geschichte der <strong>Medizin</strong>, <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 1000 Kinder<br />
geboren, deren Geschlecht nicht auf Anhieb eindeutig<br />
zu bestimmen ist. Äußere Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsorgane<br />
oder Geschlechtschromosen sind in<br />
diesen Fällen nicht kongruent. Man bezeichnet diesen<br />
Sachverhalt mit dem Begriff Intersexualität bzw. – im<br />
Englischen – „Differences of Sex Development (DSD)“.<br />
Zu Grunde liegen vielfältige, oft noch nicht in jeder<br />
Hinsicht geklärte Ursachen. Wenn keine Begleiterkrankungen<br />
vorliegen, ist es strittig, welcher Krankheitswert<br />
einem uneindeutigen Geschlecht beigemessen werden<br />
soll.<br />
Im therapeutischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen<br />
mit einer besonderen Geschlechtsentwicklung ergeben<br />
sich für alle Beteiligten komplexe Fragestellungen.<br />
Eine ethisch bedeutsame Schwierigkeit liegt in der Tatsache<br />
begründet, dass es sich bei den oft vorgenommenen<br />
chirurgischen Eingriffen zur Vereinheitlichung des<br />
Geschlechts um Verfahren handelt, die zur Gesundheitserhaltung<br />
des Kindes nicht immer zwingend notwendig<br />
sind. Diese korrektive, geschlechtsanpassende Behandlung<br />
geschieht vielmehr im (vermeintlichen) Interesse<br />
des Kindes und künftigen Erwachsenen. Dieses Vorgehen<br />
ist in letzter Zeit kritisiert worden.<br />
Intersexualität und „DSD“<br />
Bei Neugeborenen, bei denen zunächst keine eindeutige<br />
Geschlechtszuordnung möglich ist, wird dem Säugling<br />
– idealerweise nach umfangreicher Diagnostik und Abwägen<br />
unterschiedlichster Optionen – ein Geschlecht<br />
zugewiesen („sex assignment“) und ggf. auch die Geschlechtsorgane<br />
chirurgisch vereindeutigt. Die Unsicherheit<br />
über das Geschlecht des Kindes, aber auch das<br />
Gewicht der damit verbundenen, meist irreversiblen<br />
Entscheidungen wird von den betroffenen Eltern in der<br />
Regel als ausgesprochen problematisch erlebt.<br />
Die medizinische Behandlung von Kindern mit DSD ist<br />
in den letzten Jahren sowohl von Selbsthilfegruppen als<br />
auch von Kliniker/innen und Ethiker/innen kontrovers<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
diskutiert worden. Ehemalige Behandelte fordern eine<br />
systematische Evaluation von durchgeführten chirurgischen<br />
Genitalkorrekturen und ihren gesundheitlichen<br />
und psychosozialen Konsequenzen für die Betroffenen.<br />
In der Vergangenheit erfolgten die bei Neugeborenen<br />
durchgeführten Korrekturen oftmals ohne ausreichende<br />
Aufklärung der Eltern über die Komplexität des Sachverhalts<br />
und ohne eine stellvertretende Einwilligung der<br />
Eltern. Auch die betroffenen Kinder und Jugendlichen<br />
wurden in der Regel nicht oder nur unzureichend über<br />
Ursache und Zweck der medizinischen Verfahren und<br />
die daraus resultierenden Folgebehandlungen aufgeklärt.<br />
Die wissenschaftliche Evidenz für die gewählten Verfahren<br />
war nicht selten unzureichend.<br />
Eine solche Vorgehensweise ist zu Recht aus mehreren<br />
Gründen kritisiert worden. Sie basiert auf einer inzwischen<br />
überkommenen Vorstellung von der Notwendigkeit<br />
einer in jeder – also auch körperlicher – Hinsicht<br />
eindeutigen Geschlechtsrolle. 1 In der Nutzen-Risiko-Abwägung<br />
wurde den gesellschaftlichen Erwartungen vor<br />
den individuellen psychischen und körperlichen Bedürfnissen<br />
Vorrang gegeben; die möglichen Folgen der chirurgischen<br />
Interventionen auf die Beziehung zum eigenen<br />
Körper wurden dabei oftmals ignoriert. Die körperliche<br />
Integrität blieb dabei als eigener Wert unberücksichtigt,<br />
Aspekte einer möglichen Traumatisierung der betroffenen<br />
Kinder wurden vernachlässigt.<br />
In vielen westlichen Gesellschaften werden mittlerweile<br />
Ambivalenzen in der Geschlechterrolle eher toleriert.<br />
Eine Reihe von Wissenschaftler/innen und Kliniker/innen<br />
hat sich deshalb des Themas in empirischen Forschungsprojekten<br />
angenommen. Durch ihre empirischen Forschungen<br />
zu Geschlechtsentwicklung und Lebensqualität<br />
von Personen mit Intersexualität sowie durch Berichte<br />
und Veröffentlichungen von Betroffenen ist inzwischen<br />
mehr über die Situation von Menschen mit DSD bekannt.<br />
Dennoch steht die <strong>Medizin</strong> ohne Zweifel noch am Anfang<br />
einer kritischen Evaluierung ihres Umgangs mit unterschiedlichen<br />
Formen der Geschlechtsentwicklung.<br />
1 In der Diskussion über die Ausbildung der Geschlechtsidentität lassen sich im Wesentlichen zwei unterschiedliche Konzepte ausmachen. Die<br />
erste setzt voraus, dass die Entwicklung von Geschlechtsidentität einen Entwicklungsprozess darstellt, der durch psychosoziale Faktoren geprägt<br />
wird. Demgegenüber setzt die zweite Konzeption voraus, dass primär genetische und hormonelle Einfl üsse die Geschlechtsidentität entscheidend<br />
mitbestimmen.
Einige amerikanische Bioethiker/innen plädieren deshalb<br />
für eine kritische Überprüfung und Evaluierung der<br />
Behandlungsergebnisse sowie für ein Unterlassen geschlechtskorrigierender<br />
Maßnahmen ohne medizinische<br />
Indikation, bis die betroffenen Kinder einwilligungsfähig<br />
sind und ausreichende evidenzbasierte Daten über den<br />
Erfolg der Therapien vorliegen. 2 Diese Vorgehensweise<br />
soll die Autonomie des bzw. der zukünftigen Erwachsenen<br />
respektieren und den Betroffenen eine Medikalisierung<br />
der Kindheit mit den entsprechenden psychosozialen<br />
Folgen ersparen.<br />
Aktuelle Therapieempfehlungen<br />
Ein völliger Aufschub medizinischer Interventionen<br />
bis zur Pubertät konnte sich bislang jedoch noch nicht<br />
durchsetzen. Heute raten Expert/innen zwar von übereilten<br />
Entscheidungen ab und fordern eine umfassende<br />
Beratung der Eltern. Dennoch fi rmiert das unklare Geschlecht<br />
auch ohne aktuelle Gesundheitsgefährdung in<br />
der Regel noch als medizinischer und psychosozialer<br />
Notfall. In Fachkreisen gilt die Empfehlung, auf jegliche<br />
Therapie zu verzichten und die Entscheidung über die<br />
Geschlechterrolle den älteren Kindern und Jugendlichen<br />
selbst zu überlassen, als unrealistisch. In jedem Fall<br />
wird dem Kind ein ggf. vorläufi ges soziales Geschlecht<br />
zugewiesen. Aber auch weitergehende medizinische Interventionen<br />
werden gefordert, damit verhindert werde,<br />
dass das Kind durch die Reaktionen der Umwelt und die<br />
ambivalenten Gefühle der Eltern Schaden nehme. Demgegenüber<br />
ist anzumerken, dass solche sozialen Faktoren<br />
unter Umständen einem gesellschaftlichen Wandel<br />
unterliegen können und es letztlich vor Behandlungsbeginn<br />
unklar ist, welche Auswirkungen eine Therapieentscheidung<br />
für das Kind haben kann.<br />
Als weiterer Grund für eine möglichst frühzeitige Intervention<br />
im Säuglingsalter werden medizinische Gesichtspunkte<br />
angeführt. Da gute evidenzbasierte Standards<br />
noch nicht vorliegen, scheint diese Rechtfertigung<br />
chirurgischer Maßnahmen problematisch. Follow-up-<br />
Studien, die die psychosozialen Folgen der Geschlechtskorrekturen<br />
untersuchen, wurden gerade erst begonnen.<br />
Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung<br />
und Forschung fi nanzierten „Netzwerkes Intersexualität“<br />
wurde 2005 eine groß angelegte klinische Evaluationsstudie<br />
gestartet, die sich neben dem medizinischen Outcome<br />
vor allem auch mit Aspekten der gesundheitsbezo-<br />
Schwerpunkt<br />
genen Lebensqualität beschäftigt. 3 Des Weiteren ist eine<br />
unter der Leitung von Hertha Richter-Appelt stehende<br />
Hamburger Studie damit befasst, die Lebensgeschichten<br />
von Personen mit unterschiedlichen Formen von Intersexualität<br />
zu rekonstruieren.<br />
Informed consent und Aspekte der kindlichen<br />
Autonomie<br />
Grundsätzlich spielen familiäre Interessen in der klinischen<br />
Entscheidungsfi ndung eine wesentliche Rolle. Dies<br />
gilt in besonderem Maße für die Kinder- und Jugendmedizin.<br />
Ärztliches Handeln muss sich – soll es langfristig<br />
zum Wohle des Patientinnen und Patienten gereichen<br />
– auch an diesen und ihren besonderen Lebensbezügen<br />
orientieren. Dazu gehört auch, Patient/innen als Menschen<br />
in Beziehungen wahrzunehmen und zu respektieren.<br />
Für die Kinder- und Jugendmedizin heißt das, das<br />
Kind und seine Familie in den Mittelpunkt zu stellen und<br />
die Beziehung zwischen dem Kind und seinen Eltern zu<br />
berücksichtigen. Expert/innen gehen hinsichtlich der Diagnosestellung<br />
Intersexualität von einer starken Verunsicherung<br />
und partiellen Überforderung der Eltern aus, die<br />
professionelle Hilfe benötigen, um über das zukünftige<br />
Geschlecht ihres Kindes und eventuell notwendige Genitalkorrekturen<br />
zu entscheiden. Wie kann in solchen<br />
Situationen eine echte Partizipation von Eltern und Kind<br />
an therapeutischen Entscheidungen erreicht werden?<br />
Wie soll eine individuelle Entscheidung aussehen, wenn<br />
gleichzeitig die Indikationsstellung, die Therapieverfahren<br />
und der Zeitpunkt der medizinischen Intervention<br />
kontrovers debattiert werden? Welche Interessen und<br />
welche Gründe sind zu präferieren? 4<br />
Aus medizinethischer Sicht sprechen gute Gründe für<br />
eine familienorientierte Entscheidungsfi ndung. Diese<br />
würde der Tatsache Rechnung tragen, dass das Kind als<br />
eigenständige Person gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse<br />
hat, zu deren Durchsetzung es in hohem Maße<br />
auf die Liebe und den Respekt seiner Familie angewiesen<br />
ist. Der Einbezug des komplexen und fragilen Beziehungsgefüges<br />
Familie scheint gerade bei Kindern mit<br />
Intersexualität von großer Bedeutung zu sein. Entscheidungsfi<br />
ndungen von so hoher Tragweite, wie sie bei der<br />
Geschlechtszuweisung intersexueller Kinder anstehen,<br />
sind ohne Einbezug familiärer Denkstile, Wertmaßstäbe<br />
und Lebensmuster schwer denkbar.<br />
2 Kipnis, K., Diamond, M. (1998): Pediatric Ethics and the Surgical Assignment of Sex. In: J Clin Ethics 9: 398-410.<br />
3 Richter Appelt, H. (2004): Intersexualität und <strong>Medizin</strong>: Erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts. In: Z Sex Forsch 17: 239-257.<br />
4 Ude-Koeller, S., Müller, L., Wiesemann, C. (2006): Junge oder Mädchen? Elternwunsch, Geschlechtswahl und geschlechtskorrigierende<br />
Operationen bei Kindern mit Störungen der Geschlechtsentwicklung. In: Ethik Med. 18, 63-70.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 23
Schwerpunkt<br />
Kindern und Jugendlichen wird heute in vielen Bereichen<br />
der Gesellschaft mehr Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit<br />
zugebilligt als früher. Das Prinzip des<br />
„Informed Consent“, nach dem jede ärztliche diagnostische<br />
und therapeutische Maßnahme der Zustimmung<br />
des einwilligungsfähigen und aufgeklärten Patient/innen<br />
bedarf, gilt im Grundsatz auch innerhalb der Kinder- und<br />
Jugendmedizin. Üblicherweise nehmen die Eltern dieses<br />
Recht stellvertretend für ihre Kinder wahr. In den letzten<br />
Jahren hat sich aber ein wachsendes Bewusstsein<br />
für die Mitbestimmungs- und Partizipationsrechte von<br />
Kindern entwickelt. 5 In der <strong>Medizin</strong> setzt sich seit einiger<br />
Zeit die Auffassung durch, dass auch jüngere Kinder<br />
an medizinischen Entscheidungsprozessen beteiligt sein<br />
sollen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass auch kleinere<br />
Kinder in der Lage sein können, eine altersentsprechende<br />
Aufklärung zu verstehen. Die <strong>Medizin</strong>rechtlerin<br />
Sonja Rothärmel, die sich mit der Geltung der Patientinnen-<br />
und Patientenrechte für Minderjährige beschäftigt,<br />
weist auf die Benachteiligung minderjähriger Kinder im<br />
Bereich des Informed-Consent-Konzeptes hin und plädiert<br />
für den Ausbau eigenständiger, vom Kriterium der<br />
Einwilligungsfähigkeit unabhängiger Informations- und<br />
Partizipationsrechte für jüngere Kinder. 6 Allerdings lässt<br />
die Einwilligungsfähigkeit der Minderjährigen das Sorgerecht<br />
der Eltern unberührt. In der klinischen Praxis kann<br />
es im Falle von Therapieverweigerung oder widersprechender<br />
Einwilligungserklärungen der Eltern und Kinder<br />
zu Interessens- und Entscheidungskollisionen kommen.<br />
Ethische Aspekte bei Therapieentscheidungen<br />
im Umgang mit DSD<br />
Angesichts der noch ungeklärten Frage nach den handlungsleitenden<br />
Wertvorstellungen der medizinischen<br />
Intervention bei intersexuellen Kindern zum einen und<br />
des sich wandelnden gesellschaftlichen Wertgefüges<br />
hinsichtlich Geschlechterambivalenzen zum anderen<br />
ist aus medizinethischer Sicht dafür zu plädieren, Kinder<br />
und Jugendliche verstärkt über die Diagnose und Behandlungsoptionen<br />
aufzuklären und in die anstehenden<br />
Entscheidungsprozesse möglichst umfassend mit einzubeziehen.<br />
24<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Im Jahre 2004 wurde im Rahmen des Netzwerkes Intersexualität<br />
die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „<strong>Medizin</strong>ethik<br />
und Intersexualität“ etabliert, die mittlerweile<br />
ethische Empfehlungen zum therapeutischen Umgang<br />
mit Besonderheiten der Geschlechtsentwicklung (DSD)/<br />
Intersexualität bei Kindern und Jugendlichen verabschiedet<br />
hat. 7 Die Arbeitsgruppe wurde von der Göttinger<br />
<strong>Medizin</strong>ethikerin Claudia Wiesemann geleitet und<br />
setzte sich aus Mitgliedern von Selbsthilfegruppen von<br />
Personen mit DSD/ Intersexualität bzw. deren Eltern, aus<br />
Expert/innen der Kinderheilkunde und Jugendmedizin,<br />
Chirurgie, Urologie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie<br />
Endokrinologie, aus weiteren <strong>Medizin</strong>ethikerinnen,<br />
einem Psychologen und Psychotherapeuten, einer <strong>Medizin</strong>juristin<br />
sowie einer <strong>Medizin</strong>soziologin zusammen.<br />
Die Berücksichtigung des Kindeswohls umfasst die körperliche<br />
Integrität und Lebensqualität, insbesondere im<br />
Bereich der Fortpfl anzungsfähigkeit und des sexuellen<br />
Erlebens, sowie die freie Entwicklung der Persönlichkeit.<br />
Das Partizipations- und Selbstbestimmungsrecht umfasst<br />
das Recht des Kindes auf eine angemessene Beteiligung<br />
an medizinischen Entscheidungen und das Recht des/<br />
der zukünftigen Erwachsenen auf umfassende Information<br />
über alle durchgeführten Eingriffe sowie eine entsprechende<br />
Informations- und Dokumentationspfl icht<br />
auf Seiten des therapeutischen Teams.<br />
5 Die von Deutschland 1992 unterzeichnete UN-Kinderrechtskonvention kodifi ziert in §12 das Recht von Kindern aller Altersstufen auf Berücksichtigung<br />
ihres Willens und auf freie Meinungsäußerung in allen das Kind betreffenden Angelegenheiten. Dies gilt auch für medizinische Maßnahmen.<br />
Übereinkommen über die Rechte des Kindes, von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet am 6. März 1992 (Bekanntmachung<br />
vom 10. Juli 1992 - BGBl. II S. 990).<br />
6 Rothärmel, S. (2004): Einwilligung, Veto, Mitbestimmung. Die Geltung der Patientenrechte für Minderjährige. Nomos, Baden-Baden; Rothärmel,<br />
S., Wolfslast, G., Fegert, J. (1999): Informed Consent, ein kinderfeindliches Konzept? Von der Benachteiligung minderjähriger Patienten<br />
durch das Informed Consent- Konzept am Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In: <strong>Medizin</strong>recht 17: 293-298. Vgl. auch Rothärmel, S.<br />
(2006): Rechtsfragen der medizinischen Intervention bei Intersexualität. In: <strong>Medizin</strong>recht 24, 274-284.<br />
7 http://www.netzwerk-is.uk-sh.de/forumIS/index.php<br />
Für den Umgang mit Kindern mit Besonderheiten<br />
der Geschlechtsentwicklung hat<br />
die Arbeitsgruppe die folgenden ethischen<br />
Prinzipien identifi ziert:<br />
1. Die Berücksichtigung des Wohls des<br />
Kindes und des/ der zukünftigen Erwachsenen.<br />
2. Das Recht von Menschen mit DSD auf<br />
Selbstbestimmung bzw. auf Partizipation.<br />
3. Die Achtung der Familie und<br />
der Eltern-Kind-Beziehung.
Foto: privat<br />
Die Achtung der Familie und der Eltern-Kind-Beziehung<br />
impliziert das Recht und die Pfl icht der Eltern, stellvertretend<br />
für ihr Kind Entscheidungen zu treffen sowie<br />
fachkundige Unterstützung durch das therapeutische<br />
Team in allen Konfl iktsituationen in Anspruch nehmen<br />
zu können. Die Familie und ihr besonderes Ethos muss<br />
in die ethische Analyse des Umgangs mit DSD einbezogen<br />
werden. Dies leitet sich zum einen aus der hohen<br />
kulturellen Wertschätzung her, die die Familie in unserer<br />
Gesellschaft genießt, dies entspricht aber auch dem<br />
besten Interesse des Kindes und damit einem wichtigen<br />
Aspekt des Kindeswohls. Angesichts der Tragweite der<br />
Behandlungsentscheidungen ist bei nicht einwilligungsfähigen<br />
Kindern die stellvertretende Entscheidung der<br />
Schwerpunkt<br />
Eltern besonders sorgfältig zu prüfen. Zugleich muss bedacht<br />
werden, dass die Interessen des/ der zukünftigen<br />
Erwachsenen – obgleich wichtiger Maßstab klinischer<br />
Entscheidungen – nicht zwangsläufi g deckungsgleich<br />
mit den Interessen des Kindes sind. Für das Kind, zumal<br />
für das Kleinkind, ist die liebe- und vertrauensvolle<br />
Beziehung zu seinen Eltern von besonderer Bedeutung.<br />
Auch die Sorge für die Eltern und für eine gute Eltern-<br />
Kind-Beziehung gehört damit zum Handlungsauftrag aller<br />
Mitglieder des therapeutischen Teams. Sie sollte zum<br />
Ziel haben, die Eltern zu einem verantwortungsvollen,<br />
liebevollen und gelassenen Umgang mit ihrem Kind zu<br />
befähigen.<br />
Weiterführende Internet-Links:<br />
<strong>·</strong> Netzwerk Intersexualität: http://www.netzwerk-is.uk-sh.de<br />
<strong>·</strong> Netzwerk Intersexuelle Menschen: http://www.intersexuelle-menschen.net<br />
<strong>·</strong> Selbsthilfegruppe XY-<strong>Frauen</strong>: http://www.xy-frauen.de<br />
<strong>·</strong> Intersex Society of North America: http://www.isna.org<br />
Prof. Dr. Claudia Wiesemann<br />
Dr. Susanne Ude-Koeller<br />
Anna Jakovljevic M. A.<br />
(v.r.n.l.)<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 25
Nachrichten<br />
Eindrücke vom Karrieretraining<br />
des <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüros<br />
Vom 29.02. bis 01.03.2008 bot das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro in Kooperation mit der Freiburger Ärzte<br />
Consulting ein Karrieretraining für <strong>Frauen</strong> mit Führungsaufgaben an. Das ursprünglich für Ärztinnen konzipierte<br />
Angebot wurde erweitert, um auch nicht im ärztlichen Bereich tätigen weiblichen Führungskräften – und solchen,<br />
die es werden wollen – die Teilnahme zu ermöglichen. Denn generell sind im Gesundheitswesen deutlich<br />
weniger Führungspositionen mit <strong>Frauen</strong> als mit <strong>Männer</strong>n besetzt. Um möglichen Kritiken entgegenzuwirken:<br />
„Für Ärztinnen“, so der Geschäftsführer der Freiburger Ärzte Consulting Thomas Dannecker, „muss nicht automatisch<br />
gegen Ärzte sein. Wohl nicht wenigen, meist jüngeren Ärzten ist eine kompetent und ausgeglichen<br />
führende Chefärztin sehr willkommen.“<br />
Ich hatte die Gelegenheit, am Karrieretraining für <strong>Frauen</strong><br />
mit Führungsaufgaben, das vom <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> organisiert<br />
wurde, teilzunehmen. Ziel der Veranstaltung war die<br />
Weiterentwicklung des individuellen Führungspotenzials<br />
der Teilnehmerinnen. Inhaltliche Schwerpunkte waren<br />
Führen und Leiten, Teambildung, Konfl iktmanagement,<br />
Selbstmanagement und Karriereplanung.<br />
Die beiden Kursleiterinnen, Prof. Dr. Gabriele Kaczmarczyk<br />
und Dr. Ulrike Ley, habe ich als sehr kompetente<br />
Dozentinnen kennen gelernt. Das Seminar hat davon<br />
profi tiert, dass sie über große Erfahrung in unterschiedlichen<br />
Führungspositionen verfügen. Dadurch wurden die<br />
Themen nicht nur theoretisch besprochen, sondern auch<br />
durch praktische, lebensnahe und somit gut nachvollziehbare<br />
Beispiele ergänzt.<br />
Wie sind Karrieren planbar und was sind die individuellen<br />
Karriereziele? Wir gelangten zu der Erkenntnis, dass<br />
für eine von Erfolg gekrönte Karriereplanung die Entwicklung<br />
von Visionen und eine intensive Beschäftigung mit<br />
möglichen Strategien zu ihrer Erreichung essentiell sind.<br />
Ergänzt wurde die Beschäftigung mit eigenen Visionen<br />
und Karrierewegen durch Rollenspiele zu Bewerbungssituationen<br />
und zur Selbstpräsentation, die uns anhand<br />
von Videoaufzeichnungen eine Analyse von Körpersprache,<br />
Stimme und Kleidung ermöglichten.<br />
26<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Sabine Wöhlke<br />
Auch war der Workshop für mich eine gute Gelegenheit,<br />
mich mit anderen <strong>Frauen</strong> zu vernetzen. Die Erfahrung,<br />
dass andere <strong>Frauen</strong> bei der Auseinandersetzung mit diesen<br />
Strategien vor ähnlichen Hürden stehen – etwa der<br />
Vereinbarkeit von Beruf und Familie –, hat dazu geführt,<br />
die eigene Situation aus einem anderen Blickwinkel und<br />
vor einem größeren gleichstellungspolitischen Hintergrund<br />
zu betrachten. Durch die zunehmenden Anforderungen<br />
und die Ausdehnung von Arbeitszeiten in die<br />
Abendstunden und Wochenenden ist es immer schwieriger,<br />
ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen<br />
Lebensbereichen, den unterschiedlichen Rollen und den<br />
damit verbundenen Wünschen zu fi nden. Ist eine Karriere<br />
überhaupt mit Familie und sozialem Netzwerk vereinbar?<br />
Ausgehend von der persönlichen Situation haben<br />
wir die Spannungsfelder des jeweiligen Arbeits- und<br />
Lebensalltags betrachtet, Stressfaktoren beleuchtet und<br />
mögliche Lösungsstrategien dafür entwickelt. Wichtig<br />
hierbei scheint eine höhere Flexibilität im Privatleben.<br />
Es ist allerdings auch notwenig, für den privaten Bereich<br />
genügend Zeit einzuplanen und diesen nicht immer der<br />
Karriere unterzuordnen. Die Balance zwischen diesen<br />
beiden Bereichen jedoch muss jede Frau für sich selbst<br />
herausfi nden und individuell umsetzen.<br />
Für mich hat das Seminar eine Bereichung darstellt. Ich<br />
habe für mich sehr gut meine Stärken erkennen können,<br />
aber auch meine Schwächen, an denen ich jetzt gezielt<br />
arbeiten kann.
Die Referentinnen<br />
Foto: privat<br />
Prof. Dr. med. Gabriele Kaczmarczyk<br />
Habilitation 1979 am Lehrstuhl für Anästhesiologie<br />
der Charité und Leitung der Arbeitsgruppe für „Experimentelle<br />
Anästhesiologie“ von 1996 bis 2004.<br />
Sie war langjährige <strong>Frauen</strong>beauftragte der Charité<br />
und Mitglied des Fakultätsrats.<br />
Prof. Kaczmarczyk leitet den Studiengang „Health<br />
and Society: International Gender Studies Berlin“<br />
und ist Mitglied im Deutschen Ärztinnenbund.<br />
Das von ihr mit herausgegebene Buch „Karriereplanung<br />
für Ärztinnen“ ist im Springer Verlag<br />
erschienen.<br />
Foto: privat<br />
Dr. phil. Ulrike Ley<br />
Nachrichten<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für<br />
Politikwissenschaft und Lehrbeauftragte an der<br />
Universität Marburg (1988-1994); Promotion über<br />
Biografi en von <strong>Frauen</strong> in Führungspositionen<br />
(1997); Abteilungsleiterin im Sozialwesen und in<br />
der Personalentwicklung (1995-2002); <strong>Frauen</strong>beauftragte<br />
(1998-2000) im Betrieb für Beschäftigungsförderung,<br />
Leipzig.<br />
Ihr Buch „Karrierestrategien für freche <strong>Frauen</strong>“ ist<br />
im Wirtschaftverlag Redline erschienen.<br />
Sie war Führungskraft in der Wirtschaft und arbeitet<br />
als Coach und systemische Beraterin in eigener<br />
Praxis.<br />
Haben auch Sie Interesse an einem Karrieretraining teilzunehmen?<br />
Dann melden Sie sich im <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
bei Frau Groß unter der Telefonnummer: 0551 / 39-9785<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 27
Foto: S. Muigg-Lange<br />
Nachrichten<br />
Das Leben ist kein Arztroman –<br />
wir in der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> wissen das, obwohl<br />
wir Arztromane in unserem Kiosk verkaufen und<br />
die Leserinnen und Leser damit in eine rosarote Klinik-<br />
Kitschwelt entführen. Das wirklich wahre Leben in einem<br />
Krankenhaus sieht ganz anders aus. Es kann ganz<br />
schön stressig sein. Viele von uns befi nden sich in einem<br />
regelrechten Dauerlauf. Aber die Arbeit ist spannend und<br />
abwechslungsreich, obwohl sie hektisch ist und auch belastend<br />
sein kann. Wie es ist, in einem großen Krankenhaus<br />
zu arbeiten, das vermittelte der vom <strong>Frauen</strong>- und<br />
Gleichstellungsbüro organisierte Girls’ Day in der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> am 26.04.2007. Unser Dank<br />
gilt den zahlreichen Abteilungen, die bereit waren, den<br />
Schülerinnen und Schülern einen Einblick in das wirklich<br />
wahre Leben zu ermöglichen – jenseits von einem<br />
rosaroten Arztroman.<br />
28<br />
Girls’ Day 2007 an der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
Silke Groß (Assistentin) und Inken Köhler (Gleichstellungsbeauftragte)<br />
mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Foto rechts:S. Muigg-Lange<br />
„In voller Montur“<br />
Foto links: S. Muigg-Lange<br />
Im GMP-Labor<br />
(Abt. Transfusionsmedizin)<br />
Foto: S. Muigg-Lange<br />
Im GMP-Labor beim Ausschleussen (Abt. Transfusionsmedizin)<br />
Jahrestagung der Kommission Klinika 2007<br />
Vom 21. bis 23. Juni 2007 tagte die Kommission Klinika der Bundeskonferenz der <strong>Frauen</strong>-<br />
und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (BuKoF). Treffpunkt war in diesem Jahr die<br />
<strong>Medizin</strong>ische Hochschule Hannover (MHH). Zentrale Themen der Tagung waren die Familienfreundlichkeit<br />
an Universitätskliniken, die Gender-<strong>Medizin</strong>, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz<br />
(AGG) und die Präsentation erster Ergebnisse aus einer bundesweiten<br />
Umfrage zu Chancengleichheit an <strong>Medizin</strong>ischen Fakultäten und Universitätsklinika, bei<br />
der die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> den ersten Platz belegt hat.
Vom 17. bis 18. September 2007 fand in Bad Boll die<br />
Jahrestagung der Bundeskonferenz der <strong>Frauen</strong>beauftragten<br />
und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen<br />
(BuKoF) statt. Die Tagung stand unter dem Thema „Geschlechtergleichstellung,<br />
Anti-Diskriminierung, Diversity“.<br />
Es wurden die vielfältigen Berührungspunkte der<br />
Gleichstellungspolitik zu Antidiskriminierungs- und Management-Diversity-Ansätzen<br />
beleuchtet. Durch ein besseres<br />
Verständnis der unterschiedlichen Konzepte und<br />
durch mehr Klarheit über die praktischen Erfahrungen in<br />
ihrer Umsetzung ergab sich auch die Frage ihrer mög-<br />
Jahrestagung der BuKoF 2007<br />
Nachrichten<br />
lichen Übertragung an die Hochschulen. Ein wichtiger<br />
Bezugspunkt in der Diskussion waren die Auseinandersetzung<br />
mit dem Thema sexualisierte Diskriminierung<br />
und Gewalt an Hochschulen und das Zusammenwirken<br />
mehrerer Diskriminierungsformen. Auf der Jahresversammlung<br />
der BuKoF fanden Wahlen zum Vorstand statt<br />
– dieser besteht aus: Dr. Edit Kirsch-Auwärter (Georg-August-Universität<br />
<strong>Göttingen</strong>), Dr. Marianne Kriszio (Humboldt-Universität<br />
zu Berlin), Katrin Molge (FH Lübeck),<br />
Heidemarie Wüst (Technische FH Berlin) und Dr. Ute<br />
Zimmermann (Universität Dortmund).<br />
„Ohne Glanz und Glamour“<br />
Ausstellung zu Prostitution und <strong>Frauen</strong>handel<br />
„Ohne Glanz und Glamour –<br />
Prostitution und <strong>Frauen</strong>handel im Zeitalter der Globalisierung“<br />
lautet der Titel einer Ausstellung von<br />
Terre des Femmes, die in der Zeit vom 19. November<br />
bis 3. Dezember 2007 im Foyer des Universitätsklinikums<br />
zu sehen war. Die Ausstellung „Ohne Glanz<br />
und Glamour“ ist die zweite in der von der Gleichstellungsbeauftragten<br />
angestoßenen Reihe zum Thema<br />
„Gewalt gegen <strong>Frauen</strong>“. Die Gleichstellungsbeauftragte<br />
und der Vorstand der <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> setzen damit ein Zeichen gegen Gewalt an<br />
<strong>Frauen</strong>. Gerade in einer Klinik werden wir tagtäglich<br />
mit dem Thema Gewalt konfrontiert. Gewalt ist die<br />
häufi gste Ursache für Verletzungen bei <strong>Frauen</strong>. Rund<br />
ein Viertel aller <strong>Frauen</strong> in Deutschland hat bereits<br />
körperliche oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft<br />
erlebt. Dies belegen Statistiken der Menschenrechtsorganisation<br />
Terre des Femmes e.V.<br />
Poster der Ausstellung:<br />
„Ohne Glanz und Glamour“<br />
Ausstellung im Klinikum (Westhalle)<br />
Vom 19.11. bis 03.12.2007 ist<br />
in der Westhalle des Klinikums die Ausstellung<br />
„Ohne Glanz und Glamour –<br />
Prostitution und <strong>Frauen</strong>handel im Zeitalter der Globalisierung“<br />
zu besichtigen.<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Die Ausstellung wird Ihnen präsentiert vom<br />
<strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro der<br />
<strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong>.<br />
Ausstellung im Klinikum (Westhalle)<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 29
Nachrichten<br />
Internationaler Gedenktag „Nein zu Gewalt an <strong>Frauen</strong>“<br />
Die diesjährige Jahrestagung der Landeskonferenz<br />
Niedersächsischer Hochschulfrauenbeauftragter (LNHF)<br />
fand am 5. und 6. März an der Technischen Universität<br />
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig statt. Unter<br />
der Überschrift „Möglichkeiten und Grenzen von<br />
Steuerungsinstrumenten für die Gleichstellungspolitik“<br />
wurden das Gender-Controlling, Lust und Frust bei der<br />
Erstellung und Umsetzung von Gleichstellungsplänen<br />
sowie die Bedeutung von Gender-Sensibilisierung und<br />
Gender-Trainings diskutiert. Besonderen Raum nahm<br />
Karrieretraining<br />
30<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Ebenfalls im November 2007 beteiligte sich die <strong>Universitätsmedizin</strong><br />
<strong>Göttingen</strong> auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten<br />
erneut am Internationalen Gedenktag „Nein<br />
zu Gewalt am <strong>Frauen</strong>“. Dieser Tag wird jährlich am 25.<br />
November begangen. Die Menschenrechtsorganisation<br />
Terre des Femmes hat anlässlich des Gedenktags die Fahnenaktion<br />
„Nein zu Gewalt an <strong>Frauen</strong>“ ins Leben gerufen,<br />
an der sich die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> regelmäßig<br />
beteiligt. Achten Sie auf die Fahne, die im November an der<br />
Auffahrt zum Westeingang weht.<br />
Foto: Pö<br />
Beim Hissen der Fahne<br />
Girls’ Day 2008 an der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
Auch in 2008 hat das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
wieder die Federführung bei der Organisation des Girls’<br />
Day übernommen und zahlreiche Mädchen und Jungen<br />
zu einem Schnuppertag in die unterschiedlichsten<br />
Arbeitsbereiche unserer Klinik vermittelt. Zusätzlich zu<br />
dieser Aufgabe hat das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
in 2008 auch selbst die Betreuung einer Gruppe von<br />
Jahrestagung der LNHF 2008<br />
die landesweite Dialoginitiative „Gleichstellung und<br />
Qualitätsmanagement“ der LNHF in Zusammenarbeit mit<br />
der Landeshochschulkonferenz und dem Ministerium für<br />
Wissenschaft und Kultur Niedersachsen ein. Darüber<br />
hinaus fanden Vorstandswahlen statt – der neue<br />
Vorstand, der für eine Periode von zwei Jahren amtiert,<br />
besteht aus Brigitte Doetsch (Technische Universität<br />
Braunschweig), Brigitte Just (Fachhochschule<br />
Hannover) und Dr. Edit Kirsch-Auwärter (Universität<br />
<strong>Göttingen</strong>).<br />
Für <strong>Frauen</strong> mit Führungsaufgaben und für <strong>Frauen</strong>, die Führungsaufgaben<br />
übernehmen wollen, bot das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro am 29.02. und<br />
01.03.2008 ein Karrieretraining an. Ursprünglich von der Freiburger Ärzte<br />
Consulting speziell für Ärztinnen entwickelt, wurde das Seminar von den<br />
Referentinnen Prof. Dr. Gabriele Kaczmarczyk und Dr. Ulrike Ley auch für nicht im ärztlichen Bereich tätige <strong>Frauen</strong><br />
geöffnet. Lesen Sie dazu auch den Bericht von Sabine Wöhlke (auf Seite 26-27) in dieser Ausgabe.<br />
Neugierigen übernommen, die nicht nur eine bestimmte<br />
Abteilung, sondern gleich das ganze Haus kennen lernen<br />
wollten. So wurde eine große Führung organisiert, die<br />
durch das UBFT-Gebäude (inklusive Hubschrauber-Landeplatz<br />
und Hubschrauber-Besichtigung), die Wäscherei<br />
und die Wissenschaftlichen Werkstätten führte.
Augezeichnet<br />
Internationaler <strong>Frauen</strong>tag 2008<br />
Nachrichten<br />
Anlässlich des Internationalen <strong>Frauen</strong>tages am 8. März präsentierte das <strong>Frauen</strong>- und<br />
Gleichstellungsbüro seine Arbeit in diesem Jahr in Kooperation mit dem Personalrat.<br />
Dazu hatten wir in der Westhalle mehrere Tische und Stellwände mit Informationsmaterialien<br />
aufgebaut. Die dargestellten und diskutierten Themen reichten<br />
von Karrieretipps für <strong>Frauen</strong> über Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Frage<br />
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bis zu Konfl ikten am Arbeitsplatz. Ein besonderes<br />
Bonbon in diesem Jahr: Das <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro spendierte<br />
<strong>Frauen</strong> eine kostenlose Nackenmassage. Der Internationale <strong>Frauen</strong>tag machte damit<br />
aber auch darauf aufmerksam, dass Zeitdruck, Personalabbau und Konfl ikte<br />
am Arbeitsplatz eine enorme Stressbelastung bedeuten, die zu Verspannungen,<br />
Kopfschmerzen und Schlafstörungen führen können.<br />
Foto: Silke Groß<br />
Zum Internationlem <strong>Frauen</strong>tag eine kostenlose Massage<br />
Die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> belegt unter allen deutschen <strong>Medizin</strong>ischen Fakultäten und Universitätsklinika<br />
den ersten Platz bei der Verwirklichung von Chancengleichheit. Dies ergab eine Befragung im<br />
Auftrag der Kommission Klinika der Bundeskonferenz der <strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen,<br />
an der sich 29 <strong>Medizin</strong>ische Fakultäten und Universitätsklinika beteiligten. Besonders gut schneidet<br />
die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> bei der Förderung von Wissenschaftlerinnen, dem Anteil von <strong>Frauen</strong> in<br />
der Forschung und bei der Kinderbetreuung ab. Solche Auszeichnungen sind immer ein Grund zur Freude.<br />
Aber sie bedeuten natürlich nicht, dass alles perfekt ist und wir die Hände in den Schoß legen können. Denn<br />
mit unseren 163 von 242 Punkten haben wir als beste Einrichtung trotzdem erst 67 Prozent der Gesamtpunktzahl<br />
erreicht. Wir werden also weiter an der Umsetzung des Gleichstellungsauftrags arbeiten und sind auch<br />
weiterhin dankbar für Hinweise darauf, wo der Schuh drückt. Der Weg nach oben ist offen.<br />
Total E-Quality Prädikat<br />
Foto: Total E-Quality<br />
Deutschland e.V.<br />
„Bei der Preisverleihung<br />
am 28.05.2008 in Berlin.“<br />
Die <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> wurde am 28. Mai 2008 in Berlin erneut mit dem Total E-Quality<br />
Prädikat ausgezeichnet. Sie ist damit zum dritten Mal Prädikatsträgerin. Die Auszeichnung gilt<br />
immer für drei Jahre. Die Jury konnte sich davon überzeugen, dass signifi kante Verbesserungen<br />
in den Aktionsfeldern erreicht und gleichstellungspolitische Maßnahmen erweitert und verstetigt<br />
werden konnten. Besonders herausragende Leistungen wurden in den Bereichen Karriere- und<br />
Personalentwicklung und Planungs- und Steuerungsinstrumente in der Organisationsentwicklung<br />
erreicht. Besonders hervorgehoben werden in der Beurteilung das Mentoring-Programm,<br />
das Heidenreich von Siebold-Programm zur gezielten Förderung von Habilitandinnen sowie die<br />
Integration von Gleichstellungsaspekten in monetäre und strukturelle Steuerungsinstrumente, Zielvereinbarungen<br />
und Entwicklungspläne. Als besonders innovativ wird das Konzept der fakultätsinternen Forschungsförderung bewertet,<br />
das vorsieht, dass der zur Verfügung stehende Etat zu mindestens 50 Prozent an <strong>Frauen</strong> ausgeschüttet wird.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 31
Foto: Inken Köhler<br />
Zur guter Letzt<br />
Einerseits – Andrerseits<br />
Echte Kerle: Ein bisschen von Schiller –<br />
aber auch von Alice<br />
32<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Mal ehrlich, liebe Mitfrau,<br />
möchten Sie ein Mann sein?<br />
Und Sie, lieber Mitmann, sind<br />
Sie froh, ein Mann zu sein?<br />
Also ehrlich, ich wollte bislang<br />
niemals ein Mann sein.<br />
Warum sollte ich das so einfach<br />
strukturierte Leben einer<br />
Frau gegen ein Getriebensein<br />
von Konkurrenz, Kampf und<br />
Testosteron eintauschen?<br />
Ich lernte das Gruseln vor<br />
diesem Lebensentwurf im<br />
Deutschunterricht bei Schiller:<br />
Den schlechten Mann muss man verachten,<br />
Der nie bedacht, was er vollbringt.<br />
Das ist’s ja, was den Menschen zieret,<br />
Und dazu ward ihm der Verstand,<br />
Dass er im innern Herzen spüret,<br />
Was er erschafft mit seiner Hand.<br />
…<br />
Er stürmt ins Leben wild hinaus,<br />
Durchmisst die Welt am Wanderstabe …<br />
(wahlweise C-Klasse oder Porsche)<br />
Für mich war klar: Frühe Heirat – keine alte Jungfer werden.<br />
Gezielte Blicke auf Erfolg versprechenden Partner, Libido<br />
ankurbeln und siehe da:<br />
Wie ein Gebild aus Himmelshöhn,<br />
Mit züchtigen, verschämten Wangen<br />
Sieht er die Jungfrau vor sich stehn.<br />
Da fasst ein namenloses Sehnen<br />
Des Jünglings Herz, er irrt allein …<br />
Errötend folgt er ihren Spuren …<br />
Am Ende: „Häusle baue und net nach de Mädle schaue“<br />
hieß es für ihn. Für mich war der Auftrag unmissverständlich:<br />
Den Haushalt in Ordnung halten, Hab und<br />
Gut mehren, Kinder gut erziehen, keine Experimente.<br />
Bei Schiller klingt das so:<br />
Und drinnen waltet<br />
Die züchtige Hausfrau,<br />
Die Mutter der Kinder,<br />
Und herrschet weise<br />
Im häuslichen Kreise,<br />
Und lehret die Mädchen<br />
Und wehret den Knaben,<br />
Und reget ohn Ende<br />
Die fl eißigen Hände,<br />
Und mehrt den Gewinn<br />
Mit ordnendem Sinn.<br />
Carmen Franz<br />
Aber auch Dichter sind zuweilen Realisten und<br />
warnten:<br />
Drum prüfe, wer sich ewig bindet,<br />
Ob sich das Herz zum Herzen fi ndet!<br />
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.<br />
…<br />
Mit dem Gürtel, mit dem Schleier<br />
Reißt der schöne Wahn entzwei.<br />
Die Leidenschaft fl ieht! …<br />
Affären kommen, das dürfen wir heute aussprechen.<br />
Chefs richten dazu Sonderkonten ein. Bis<br />
zum Genuss dieser Gratifi kation, mussten meine<br />
gleichaltrigen Kameraden schon im Kindergarten<br />
fürs Leben lernen:<br />
Der Mann muss hinaus<br />
Ins feindliche Leben,<br />
Muss wirken und streben<br />
Und pfl anzen und schaffen,<br />
Erlisten, erraffen,<br />
Muss wetten und wagen<br />
Das Glück zu erjagen…<br />
Ein Junge weint nicht, ein Indianer kennt keinen<br />
Schmerz, wehr dich, beiß die Zähne zusammen.<br />
Nicht nur Sprüche, bittere Realität. Mach Mami<br />
keine Schande. Dem Papi nacheifern, besser noch<br />
ihn übertrumpfen und ihm die Trophäen zu Füßen<br />
legen. Im Western, dem <strong>Männer</strong>epos schlechthin,<br />
haucht der sterbende Held in der Regel einen letzten<br />
Satz: „Sag Daddy, ich habe es geschafft.“<br />
Arme kleine Jungs.
Doch mit des Geschickes Mächten<br />
Ist kein ewger Bund zu fl echten,<br />
Und das Unglück schreitet schnell …<br />
Ihr Leidensweg ist nicht zu Ende. Ein ganzer Kerl reicht<br />
nicht mehr, die Melange ist gefragt. Ein bisschen Softimix<br />
zum Macho. Kaffeelatte zum Schmusen mit Empathie.<br />
Bocuse am heimischen Herd kocht Breichen fürs Baby,<br />
der andere Molekulares für erfolgreiche Freunde der Gattin.<br />
Die hat sich in der Zwischenzeit vom trautem Heim<br />
entfernt und sich in ein anderes Zeitalter begeben. Sicher<br />
hat sie auch hier noch mit mumifi zierten <strong>Männer</strong>hirnen<br />
zu tun, aber selbst in der <strong>Männer</strong>bastion <strong>Medizin</strong> werden<br />
schon <strong>Frauen</strong> toleriert, die wissen wo’s lang geht.<br />
Mädchen haben eben schon lange die besseren Zensuren.<br />
Und sollte Intelligenz statt Muskelstärke gefragt sein,<br />
dann kann Mann sie nicht mehr übergehen. Schiller sah<br />
das mit Schrecken:<br />
Freiheit und Gleichheit! hört man schallen,<br />
Der ruhige Bürger greift zur Wehr,<br />
Die Straßen füllen sich, die Hallen,<br />
Und Würgerbanden ziehn umher,<br />
Da werden Weiber zu Hyänen<br />
Und treiben mit Entsetzen Scherz,<br />
Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen,<br />
Zerreißen sie des Feindes Herz …<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
Zur guter Letzt<br />
Ja, so kann es kommen. Auch mich ergriff der Achtundsechzigersturm,<br />
zerfl eischen war mir zu ekelig,<br />
an die Gurgel wäre ich allerdings so manchem gerne<br />
gegangen. Aber nicht alle <strong>Frauen</strong> fl etschen die Zähne<br />
und neben den aufgeplusterten Heldensöhnen gibt<br />
es auch zu Herzen gehende Verlierergeschichten.<br />
Kennen Sie die Ballade von ALICE? Da wohnt einer<br />
24 Jahre lang neben einer Frau, traut sich nicht, sie<br />
anzusprechen und als sie endlich auszieht, stellt er<br />
nur bedauernd fest:<br />
I don’t know why she’s leaving,<br />
or where she’s gonna go,<br />
I guess she’s got her reasons<br />
but I just don’t wanna know,<br />
‘Cause for twenty-four years I’ve been living<br />
next door to Alice.<br />
Twenty-four years, just waitin’ for a chance,<br />
To tell her how I’m feeling,<br />
maybe get a second glance,<br />
Now I’ve gotta get used to not living<br />
next door to Alice.<br />
Einerseits denke ich, Alice kann froh sein, dass nichts<br />
aus ihnen geworden ist, der hätte wahrscheinlich<br />
auch anderes nicht zu Potte gebracht. Andrerseits<br />
denke ich, jeder kleine Junge verdient eine zweite<br />
Chance!<br />
Textauszüge aus:<br />
„Das Lied von der Glocke“ von Friedrich Schiller<br />
„Living next door to Alice” von Smokie<br />
wir freuen uns weiterhin über Rückmeldungen, Anregungen, Wünsche<br />
und Kritik und natürlich auch LeserInnen-Briefe!<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008 33
34<br />
Aktionen der Gleichstellungsbeauftragten<br />
Wer sucht,<br />
soll auch<br />
finden.<br />
Einsatz<br />
für Kinderbetreuung<br />
Girls‘<br />
Day<br />
Mit freundlicher Unterstützung vieler Abteilungen<br />
organisiert das Gleichstellungsbüro jedes Jahr den<br />
Girls‘ Day. Hierzu sind auch Jungen willkommen.<br />
Die Gleichstellungsbeauftragte<br />
gibt seit 1999 eine eigene<br />
Zeitschrift heraus – Georgia.<br />
Sie erscheint einmal pro Jahr.<br />
Vernetzung<br />
Kinderbetreuung<br />
Die Gleichstellungsbeauftragte setzt sich für<br />
eine umfassende Kinderbetreuung ein (auch<br />
für die ganz Kleinen) – unabhängig davon, ob<br />
die Eltern z.B. in der Wissenschaft, der Pflege<br />
oder in der Verwaltung tätig sind. Sowohl<br />
Mütter als auch Väter sollen in der Lage sein,<br />
Beruf/ Ausbildung und Familienverantwortung<br />
unter einen Hut zu bringen.<br />
Vernetzung mit anderen Gleichstellungsbeauftragten<br />
an Universitätskliniken findet in der Kommission<br />
Klinika der Bundeskonferenz der <strong>Frauen</strong>- und<br />
Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen statt.<br />
Georgia Nr. 9 – Sommer 2008<br />
Chancengleichheit<br />
Georgia<br />
Ziel der Gleichstellungspolitik ist<br />
es unter anderem, <strong>Frauen</strong> die<br />
gleichen Karrierechancen zu<br />
ermöglichen wie <strong>Männer</strong>n und<br />
ihren Anteil an den Habilitationen<br />
und Professuren zu erhöhen. Hier<br />
setzt das Mentoring-Programm<br />
des Gleichstellungsbüros an. Es<br />
vermittelt eine individuelle Betreuung<br />
und bietet ein attraktives<br />
Schulungsprogramm.<br />
? !!<br />
Beratung<br />
… z.B. bei Problemen am Arbeitsplatz,<br />
bei Karrierefragen, in Fällen sexueller<br />
Belästigung, …<br />
Inken Köhler – Gleichstellungsbeauftragte<br />
<strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong> – Georg-August-Universität<br />
Tel.: 0551/ 39-9785 Email: frauenbuero@med.uni-goettingen.de<br />
Nein zu<br />
Gewalt<br />
Jede vierte Frau in Deutschland wird in<br />
ihrem Leben Opfer von körperlicher<br />
oder sexueller Gewalt im häuslichen<br />
Kontext. Laut Aussage der Menschenrechtsorganisation<br />
Terre des Femmes<br />
e.V. ist häusliche Gewalt „die häufigste<br />
Ursache für Verletzungen bei <strong>Frauen</strong>,<br />
häufiger als Verkehrsunfälle, Überfälle<br />
und Vergewaltigungen zusammen<br />
genommen.“ Mit Ausstellungen zum<br />
Thema „Gewalt gegen <strong>Frauen</strong>“ und mit der jährlichen<br />
Beteiligung an der bundesweiten Fahnenaktion „Nein<br />
zu Gewalt an <strong>Frauen</strong>“ machen wir darauf aufmerksam.<br />
Ein Blick zurück auf 2007<br />
Posteraktion der Gleichstellungsbeauftagten
Ja, ich möchte mein persönliches Exemplar der jeweils<br />
neuesten Ausgabe der Georgia zugeschickt bekommen!<br />
Meine Adresse lautet:<br />
Vorname/Name: __________________________________________________________<br />
Abteilung: _________________________________________________________________<br />
Straße: _________________________________________________________________<br />
PLZ/Ort: _______________________________________________________________<br />
Senden Sie uns diese Seite ausgefüllt zu, und wir nehmen Sie in unseren<br />
Verteiler auf.<br />
Unsere Adresse lautet:<br />
An das<br />
<strong>Frauen</strong>- und Gleichstellungsbüro<br />
der <strong>Universitätsmedizin</strong> <strong>Göttingen</strong><br />
Georg-August-Universität<br />
TL 183<br />
Robert-Koch-Straße 40<br />
37075 <strong>Göttingen</strong><br />
Inhalt
<strong>Frauen</strong>- und<br />
Gleichstellungsbüro