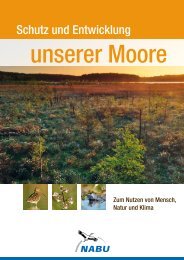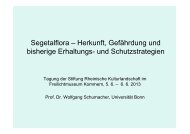Agrarwelt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Agrarwelt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Agrarwelt - Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Agrarwelt</strong><br />
20 I Titelthema<br />
dlz agrarmagazin ◾ Januar 2012<br />
Nützen<br />
und schützen<br />
Zahlen & Ziele<br />
für Biologische Vielfalt<br />
Wichtige Kennzahlen zur Nationalen<br />
Strategie für Biologische Vielfalt:<br />
• < 30 ha pro Tag für Siedlung, Verkehr;<br />
• 25 % unzerschnittene, verkehrsarme<br />
Räume, Erhalt auf heutigem Niveau;<br />
• 20 % ökologischer Landbau;<br />
• 19 % landwirtschaftliche Flächen mit<br />
hohem Naturwert;<br />
• 10 % funktionierende Biotop-Verbünde;<br />
• 5 % Wald-Entwicklung und<br />
• 2 % natürliche Wildnis;<br />
•<br />
100 % Grünland-Nutzung auf Niedermoor-Böden.<br />
Quelle: BfN
Foto: landpixel<br />
Flächenverbrauch Sieben Prozent ökologische Vorrangflächen<br />
auszuweisen, wie die EU das vorschlägt, würde die Stilllegung<br />
quasi wieder einführen. Dabei ist der ungebremste Flächenfraß<br />
durch Energiewende, Siedlung und Verkehr längst ein<br />
Topthema. Überdies werden vorgeschriebene Ausgleichs und<br />
Ersatzflächen für den Naturschutz zunehmend problematisch.<br />
Wie passt das alles zusammen? Wir nennen Lösungsansätze.<br />
Gut 90 ha fruchtbaren Bodens täglich<br />
zu versiegeln, 120 Fußballfelder, das<br />
können wir uns schon lange nicht<br />
mehr leisten. Zumal der künftige Flächenbedarf<br />
allein für die Energiewende noch<br />
gigantischer sein wird. Gut 4.000 km neuer<br />
Stromleitungen vor allem von Nord- nach<br />
Süddeutschland sind nach Schätzungen<br />
der Deutschen Energie-Agentur bis 2020<br />
nötig. Allein in Ostdeutschland rechnen<br />
Fachleute mit rund 1.600 km Trassenbau.<br />
Daraus leitet sich für die nächsten zehn<br />
Jahre ein Kompensationsbedarf von rund<br />
23.000 ha ab.<br />
Beim ungebremsten Flächenfraß ist<br />
komplettes Umdenken nötig. Doch bis in<br />
die Politik scheint das noch wenig vorgedrungen<br />
zu sein. So ist der EU-Vorschlag<br />
vollkommen kontraproduktiv, künftig sieben<br />
Prozent ökologische Vorrangflächen<br />
vorhalten zu müssen. Das würde weitere<br />
rund 600.000 ha Nutzfläche in Deutschland<br />
aus dem Verkehr ziehen. Zum Vergleich:<br />
Seit 1992 wurden durch Überbauung über<br />
800.000 ha der Nahrungsmittelerzeugung<br />
entzogen. Das entspricht der landwirtschaftlichen<br />
Fläche von Rheinland-Pfalz<br />
und dem Saarland zusammen.<br />
Dabei erklären Agrarpolitiker durch alle<br />
politischen Reihen den Schutz landwirtschaftlicher<br />
Flächen, aber auch den Arten-<br />
Entsiegeln statt Asphaltieren: Bebauen oder<br />
Beschneiden durch Ausgleichsmaßnahmen<br />
verschwendet oft fruchtbaren Boden.<br />
und Naturschutz zu Topthemen. Wie das<br />
unter einen Hut zu bringen ist, sagt kaum<br />
jemand. Konkrete Entscheidungen zum<br />
Ausgleich für den mit der Energiewende<br />
dringend gewordenen Ausbau der Stromnetze<br />
hat die Bundesregierung immerhin<br />
für dieses Jahr angekündigt. Wie sie konkret<br />
aussehen sollen, ist noch offen.<br />
Anrechenbare Fläche ausweiten<br />
Vom Greening-Vorschlag der EU rücken<br />
selbst die deutschen Agrarminister ab. Sie<br />
wollen die anrechenbaren Flächen dafür<br />
ausweiten und Agrarumweltmaßnahmen,<br />
Vertragsnaturschutz- und Bioflächen<br />
mitzählen. Anerkennen wollen sie auch<br />
Landschaftselemente, Büsche, Hecken oder<br />
Gewässerränder, also Flächen mit Schutzanforderungen<br />
nach EU-Wasserrahmenrichtlinie<br />
oder EU-Naturschutzrecht.<br />
Vor allem Ausgleichs- und Ersatzflächen<br />
für den Naturschutz stehen im Fokus<br />
des Flächenraubs. Die müssen bei Bautätigkeiten<br />
selbst von Bioags- oder Windkraftanlagen<br />
immer noch neu ausgewiesen<br />
werden. „Wer versteht noch“, fragt sich<br />
mancher Energiewirt, „dass für Windräder<br />
auf hoher See bei uns an Land noch Ausgleichsflächen<br />
verbraucht werden“?<br />
Die Herausforderungen von Ernährung<br />
und Energiewende fordern hier Gegensteuern:<br />
Der Flächenverbrauch ist drastisch<br />
zu vermindern. Dazu sind detaillierte<br />
Vorschläge gemacht. Im Mittelpunkt einer<br />
Titelthema I 21<br />
Schneller Überblick<br />
• Die Herausforderungen bei der Versorgung<br />
mit Lebensmitteln und Energie bei<br />
zugleich abnehmenden Nutzflächen sind<br />
groß. Der Flächenfraß ist zu stoppen.<br />
• Nicht extensive, sondern hocheffiziente<br />
Agrarproduktion dient dem Umwelt-, Klimaund<br />
Gewässerschutz. Intensive, nachhaltige<br />
Landwirtschaft braucht Agrarforschung.<br />
• Für Flächen- und Naturschutz sind intelligentere<br />
Lösungen bei Ausgleichs- und<br />
Ersatzmaßnahmen gefragt. Beispiele sind<br />
besser vergütete Agrarumweltmaßnahmen,<br />
Flächenpools oder Ökokonten, schließlich<br />
Ersatzgeld und viel mehr Entsiegelung.<br />
• Das Prinzip der Flächenefffizienz gehört<br />
gestärkt: Gefordert sind in die Produktion<br />
integrierte Möglichkeiten. Gezielter Naturschutz<br />
in Kooperation mit Land- und Forstwirten<br />
muss Vorrang haben vor flächigen<br />
Ausweisungen von mehr Schutzgebieten.<br />
Gesetzesinitiative könnte ein eigenes Artikelgesetz<br />
stehen zum Schutz landwirtschaftlicher<br />
Flächen. Darüber soll sogar<br />
der Petitionsausschuß des Bundestages<br />
befinden: 15.000 Unterschriften kamen bis<br />
Redaktionsschluss in einer Unterschriftenaktion<br />
des Bauernverbandes in wenigen Tagen<br />
zusammen. In Bundesgesetzen fehlt es<br />
bisher meist an solchen Schutzklauseln.<br />
Auf Äcker statt Asphalt setzen<br />
Bauprojekte und Naturschutz fressen in<br />
Deutschland Tag für Tag die Fläche, auf der<br />
rund 700 t Weizen wachsen. Ein Vielfaches<br />
der Fläche für neue Straßen und Gewerbegebiete<br />
verbraucht der zum Ausgleich<br />
vorgeschriebene Naturschutz.<br />
„Erfahrungsgemäß wird mehr Landwirtschaftsfläche<br />
durch naturschutzfachlichen<br />
Ausgleich entzogen als für den eigentlichen<br />
Um Biotope zu vernetzen, sind Randstreifen<br />
eine sinnvolle Möglichkeit. Nötig dafür ist<br />
jedoch ein angemessener Ausgleich.<br />
www.dlz-agrarmagazin.de<br />
Foto: agrar-press
<strong>Agrarwelt</strong><br />
22 I Titelthema<br />
Mehrheit<br />
gegen Zubau<br />
Die Mehrheit der Deutschen will landwirtschaftliche<br />
Flächen vor Zubau schützen.<br />
Das geht aus einer repräsentativen<br />
Studie des Instituts ‚Produkt und Markt‘ in<br />
Osnabrück hervor, das gut 1.000 Bürger, im<br />
Auftrag vom Bauernverband, befragt hat.<br />
• 67 Prozent der Bevölkerung sind für gesetzlichen<br />
Schutz von Äckern und Grünland<br />
vor Bebauung.<br />
• 84 Prozent sind dafür, alte Industrieanlagen<br />
und innerstädtische Lagen zu<br />
sanieren.<br />
• 3/4 der Bevölkerung möchte die Innenentwicklung<br />
der Städte und Dörfer voranbringen<br />
und ist gegen Bauten auf der<br />
„grünen Wiese“.<br />
Straßenkörper“, sagt etwa Hans-Joachim<br />
Kraus Geschäftsführer der Heide Agrar<br />
GmbH in Colbitz, Sachsen-Anhalt, die<br />
2.100 ha bewirtschaftet, davon 300 ha<br />
Eigentum. Er erläutert das Problem am<br />
Beispiel der Nordverlängerung der A14.<br />
Davon ist er mit gut 100 ha betroffen. Seiner<br />
Ansicht nach mag die Autobahn eine<br />
sinnvolle Investition sein. „Für Pächter<br />
Für die Energiewende werden in den kommenden<br />
Jahren mehr als 4.000 km Leitungstrassen<br />
gebaut: Das kostet Hektar.<br />
dlz agrarmagazin ◾ Januar 2012<br />
Foto: landpixel<br />
erhöhen sich aber erst mal die Pacht- und<br />
Kaufpreise“.<br />
Zudem ist der Landwirt von Ersatzmaßnahmen<br />
für die Erweiterung der benachbarten<br />
Kalihalde betroffen. Der Ausgleich<br />
ließe sich schaffen, indem „vorrangig vernachlässigte<br />
Biotope, Landschaftselemente<br />
sowie versiegelte Industriebrachen wieder<br />
in wertvollen Zustand versetzt würden“,<br />
fordert der Rinder- und Sauenhalter.<br />
Schließlich gibt es viele sinnvolle Projekte,<br />
von denen die <strong>Kulturlandschaft</strong> wirklich<br />
profitiert: Aufwerten der Kiefernwälder<br />
zu wertvollen Mischwäldern im Fall<br />
der A14. Oder die regelmäßige Pflege von<br />
vielen Kilometern Feldhecken allerorten.<br />
Oder die Landschaftspflege mit Weidetieren<br />
„für einen Gewinn an Artenvielfalt“.<br />
Diese und viele weitere Ideen lassen sich<br />
mit mehr Mut vor allem der zuständigen<br />
Bauplaner und Behörden in die Tat umsetzen.<br />
Hans-Joachim Kraus: „Denn was<br />
bringt es, wenn Bäume und Sträucher auf<br />
einen Acker gepflanzt werden und das neue<br />
Biotop mangels Pflege verkommt?“<br />
Allzu oft greifen die für Ausgleich zuständigen<br />
Behörden noch auf den Weg<br />
des geringsten Widerstands zurück. Sie<br />
wandeln lieber Äcker in Wald oder Biotope<br />
um. Der Gesetzgeber hat diesen Missstand<br />
zwar erkannt und 2009 das Bundesnaturschutzgesetz<br />
novelliert. Seitdem sieht die<br />
Eingriffsregelung vor, dass zum Ausgleich<br />
das Entsiegeln bebauter Flächen sowie die<br />
Biotoppflege durch Landwirte Vorrang haben.<br />
Das soll vermeiden, dass Landwirtschaftsflächen<br />
aus der Nutzung fallen. Aber<br />
bis in die Praxis vieler Ämter vor Ort ist<br />
das bisher kaum vorgedrungen.<br />
Der Grundsatz der Flächenschonung<br />
ist bei der Ausgleichs- und Eingriffsregelung<br />
also auch über das Bundesnaturschutzgesetz<br />
zu stärken. Nötig scheint eine<br />
Hecken sind ein Paradies für viele<br />
geschützte Arten. Pflanzung und Pflege<br />
erfordern jedoch Aufwand.<br />
Entwicklung von Naturschutz- und Ackerflächen<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
Fläche (1.000 ha)<br />
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2010<br />
Foto: agrar-press<br />
gesetzliche Pflicht, den Ausgleich für Bautätigkeiten<br />
über Entsiegelung vorzunehmen<br />
oder jedenfalls „flächenneutral“.<br />
Ausgleichsregeln überprüfen<br />
„Warum sollte ein Ausgleich nicht auch in<br />
Euro und Cent möglich sein“, fragt jeder<br />
Bauherr, der Naturschutz im Bewußtsein<br />
hat. Schließlich hat die Regierungskoalition<br />
die Gleichstellung von Ersatzgeld mit<br />
Kompensationsmaßnahmen nach Angaben<br />
des Bauernverbands bereits zugesagt, aber<br />
noch nicht umgesetzt. Dabei darf das Geld<br />
nicht zur Haushaltssanierung zweckentfremdet<br />
werden „oder gar zum Flächenkauf<br />
“, ärgern sich viele Bewirtschafter<br />
in der Nachbarschaft. Deren Pachtpreise<br />
steigen dann nämlich mangels weiterer<br />
Flächen meist an.<br />
Ein Vorschlag in diese Richtung ist auch,<br />
einen Entsiegelungsfonds einzurichten,<br />
der Brachen revitalisiert, gespeist über Ersatzgeld.<br />
Der könnte zudem – ähnlich den<br />
Flächenpools – Ausgleichsmaßnahmen<br />
bündeln. Auch der Ersatz für geschützte<br />
Arten und Biotope nach der Fauna-Flora-<br />
Habitat (FFH)-Richtlinie muss dem Prinzip<br />
1990 1995 1999 2000 2005 2009<br />
Dauergrünland<br />
Ackerland<br />
Landwirtschaftlich genutzte Fläche<br />
Nationalparke<br />
Biosphärenreservate<br />
Naturschutzgebiete<br />
Naturparke<br />
Naturwaldreservate<br />
Feuchtgebiete<br />
2012
der Flächenschonung unterliegen. Dabei ist<br />
das „Feld“ nicht einer Seite zu überlassen:<br />
Für Natur- und Flächenschutz mit Augenmaß<br />
ist ein ‚Fachbeitrag Landwirtschaft’<br />
ebenso gleichrangig nötig wie der übliche<br />
‚Fachbeitrag Naturschutz’.<br />
Schließlich gehören Agrarumweltmaßnahmen<br />
stärker auf den Prüfstand.<br />
Der Schwerpunkt muss auf nachhaltiger<br />
Bewirtschaftung liegen. Die muss hochproduktiv<br />
sein und effektiv, aber nachteilige<br />
Umweltwirkungen vermeiden.<br />
Flächenneutrale Möglichkeiten, etwa<br />
Pflege oder Aufwerten vorhandener Biotope,<br />
kommen meist viel zu kurz. Oft werden<br />
die „Ersatzflächen für teures Geld angelegt,<br />
nach wenigen Jahren aber kümmert<br />
sich niemand mehr“, wissen Betroffene zu<br />
berichten. Deutlich besser sind da Projekte<br />
mit Landwirten oder produktionsintegrierte<br />
Möglichkeiten.<br />
Flächenpools fördern<br />
Angesehen bei den Bauern sind <strong>Stiftung</strong>en,<br />
die Flächenpools und Ökokonten bieten.<br />
Beim Ausbau der Energienetze ist eigentlich<br />
„kein Wettlauf um Ausgleichs- und<br />
Ersatzmaßnahmen nötig“, meint Dr. Manfred<br />
Klein, Leiter des Agrar- und Waldbereichs<br />
im Bundesamt für Naturschutz.<br />
„Und auch keine Flächenkonkurrenz, weil<br />
Flächenagenturen bevorratete Angebote<br />
für die Kompensation bereits vorhalten.“<br />
Bundesweit gibt es nach seiner Auskunft<br />
rund 600 Anbieter von Ökokonten.<br />
Natürlich müssen die Naturschutzbehörden<br />
vor Ort diese Pools auch fachlich<br />
anerkennen. Letztlich entscheidet die Qualität<br />
der Planungsleistungen. Oft geschieht<br />
die durch beauftragte, in der Region nicht<br />
immer erfahrene Planungsbüros. Sicher ist:<br />
Die Fachleute vor Ort sind die Landwirte,<br />
die „ihre Natur“ am besten kennen.<br />
Schutzgebiete in Deutschland<br />
Gebietstyp Schutz<br />
(Wirkung)<br />
Anzahl<br />
Fläche*<br />
(in Prozent)<br />
Nationalparke • 14 0,54<br />
Naturschutzgebiete • 8491 3,6<br />
FFH-Gebiete • 4621 9,3<br />
EU-Vogelschutzgebiete • 738 11,2<br />
Biosphärenreservate • 16 3,5<br />
Landschaftsschutzgebiete • 7409 28,5<br />
Naturparke • 102 26,8<br />
*bezogen auf die terrestrische Fläche Deutschlands; mit vielfältigen<br />
Überlagerungen, Aufsummierung daher unzulässig;<br />
• = streng geschützt, • = mittel, • = relativ leicht geschützt;<br />
FFH = Fauna-Flora-Habitat; Quelle: BfN; detaillierter Karten-<br />
Service zum Schutzniveau Ihrer Flächen im Internet<br />
http://www.bfn.de/0308_gebietsschutz.html<br />
2012<br />
Pools, <strong>Stiftung</strong>en,<br />
Agenturen, Vereine und Verbände helfen weiter<br />
EEG-Anlagen ausnehmen<br />
Letzlich ist zur Flächenschonung auch<br />
wichtig, dass die Bewertungssysteme zur<br />
Bemessung von Eingriffen samt Kompensationsbedarf<br />
bundesweit vereinheitlicht<br />
werden. Nur so lässt sich etwa Entsiegelung<br />
priorisieren. Das Revitalisieren von Flächen<br />
muss dringend aufgewertet werden.<br />
Denkbar ist ein Bonus-/Malus-System, das<br />
Zu- oder Abschläge für Flächenschonung<br />
von Ausgleichsmaßnahmen vergibt.<br />
Titelthema I 23<br />
Name Adresse Telefon / Fax Internet / Mail Verzeichnis<br />
Deutsche <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>Kulturlandschaft</strong><br />
Bundesverband der<br />
Flächenagenturen<br />
(bfad)<br />
Bayerische<br />
Kulturlandstiftung<br />
Flächenagentur<br />
BadenWürttemberg<br />
<strong>Stiftung</strong> Kulturlandpflege<br />
Niedersachsen<br />
<strong>Stiftung</strong> Westfälische<br />
<strong>Kulturlandschaft</strong><br />
<strong>Stiftung</strong> <strong>Rheinische</strong><br />
<strong>Kulturlandschaft</strong><br />
<strong>Stiftung</strong> <strong>Kulturlandschaft</strong><br />
RheinlandPfalz<br />
Hessische Landgesellschaft,<br />
Ökoagentur<br />
<strong>Stiftung</strong> Naturschutz<br />
SchleswigHolstein<br />
<strong>Stiftung</strong> Umwelt und<br />
Naturschutz MecklenburgVorpommern<br />
Flächenagentur<br />
Brandenburg<br />
Landgesellschaft<br />
SachsenAnhalt<br />
Sächsische<br />
Ökoflächen-Agentur<br />
Thüringer<br />
Landgesellschaft<br />
Netzwerk Ländlicher<br />
Raum (DVS/BLE) 2)<br />
Deutscher Verband<br />
für Landschaftspflege<br />
Bundesverband der<br />
gemeinnützigen Landgesellschaften<br />
(BLG)<br />
Claire-Waldoff-Str. 7<br />
10117 Berlin<br />
Neustädtischer<br />
Markt 22,14775<br />
Brandenburg/Havel<br />
Barer Str. 14<br />
80333 München<br />
Gerhard-Koch-Str. 2<br />
73760 Ostfildern<br />
Warmbüchenstr. 3<br />
30159 Hannover<br />
Schorlemerstr. 11<br />
48143 Münster<br />
Rochusstraße 18,<br />
53123 Bonn<br />
Burgenlandstr. 7<br />
55543 Bad<br />
Kreuznach<br />
Nordenstr. 44<br />
64546 Mörfelden<br />
Eschenbrook 4<br />
24113 Molfsee<br />
Zum Bahnhof 20<br />
19503 Schwerin<br />
Zeppelinstr. 136<br />
14471 Potsdam<br />
Große Diesdorfer<br />
Str. 56/57<br />
39110 Magdeburg<br />
Schützestr. 1<br />
01662 Meißen<br />
Weimarische Str. 29b<br />
99099 Erfurt<br />
Deichmanns Aue 29<br />
53179 Bonn<br />
Feuchtwanger Str. 39<br />
91522 Ansbach<br />
Märkisches Ufer 34,<br />
10179 Berlin<br />
030- 31904 -580<br />
Fax -584<br />
03381- 21102 -22<br />
Fax- 24<br />
089- 5906829 -32<br />
Fax -33<br />
0711-32732 -113<br />
Fax -127<br />
0511-367044173<br />
Fax 32 46 27<br />
0251-4175 -147<br />
Fax -175<br />
0228-9090721 -0,<br />
Fax -9<br />
0671-793 -1213<br />
06131- 2398-127<br />
06105-4099-12,<br />
Fax -30<br />
0431-21090 -70<br />
Fax -99<br />
0385-76099 -95<br />
Fax -96<br />
0331- 581823 -12<br />
Fax -11<br />
0391- 7361 -710<br />
Fax -888<br />
03521- 4690 -0<br />
Fax -13<br />
0361-4413 -110<br />
Fax -299<br />
0228- 6845 -3722,<br />
Fax -3361<br />
0981-4653 -3540<br />
Fax -3550<br />
030-2345-8789,<br />
Fax -8820<br />
www.landschafft.info<br />
stiftung@landschafft.info<br />
www.verband-flaechenagenturen.de<br />
info@verband-flaechenagenturen.de<br />
www.bayerischekulturlandstiftung.de<br />
info@bayerischekulturlandstiftung.de<br />
www.flaechenagentur-bw.de<br />
kontakt@flaechenagentur.de<br />
www.stiftungkulturlandpflege.de<br />
info@stiftungkulturlandpflege.de<br />
info@stiftung-westfaelische-<br />
kulturlandschaft.de<br />
stiftung@rheinische-kulturlandschaft.de<br />
www.kula-rlp.de<br />
dieter.feldner@kula-rlp.de<br />
thomas.raetz@kula-rlp.de<br />
www.oekoagentur-hessen.de<br />
info@hlg.org<br />
deinert@ausgleichsagentur.de<br />
www.stiftungsland.de<br />
www.stun-mv.de<br />
info@stun-mv.de<br />
info@flaechenagentur.de<br />
www.flaechenagentur.de<br />
schoster.e@lgsa.de<br />
www.lgsa.de<br />
oekoflaechen@lsl-net.de<br />
www.sls-sachsen.de<br />
i.pueschel@thlg.de<br />
www.thlg.de<br />
www.netzwerk-laendlicher-raum.de<br />
dvs@ble.de www.ble.de<br />
www.landschaftpflegeverband.de<br />
info@lpv.de www.eu-natur.de<br />
www.blg-berlin.de,<br />
blg-berlin@t-online.de<br />
Auswahl; 1) Verzeichnis/Kataster für Ausgleichs-/Kompensationsflächen • = vorhanden; Quelle: bfad; 2) Deutsche<br />
Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE); Stand 2012<br />
für Flächen 1)<br />
Genauso nötig sind bundeseinheitliche<br />
Vorgaben zur Kompensation von Anlagen<br />
für erneuerbare Energien, also Windräder,<br />
Photovoltaik-, Biogasanlagen und deren Leitungstrassen.<br />
Der Bau neuer Anlagen sollte<br />
nach der Energiewende möglichst keine<br />
flächenfressenden Ausgleichsmaßnahmen<br />
mehr auslösen, meinen viele Fachleute. Das<br />
würde bedeuten: Der Ausgleich für Eingriffe<br />
ins Landschaftsbild könnte entfallen oder<br />
als Ersatz in Geld gezahlt werden. kb<br />
www.dlz-agrarmagazin.de<br />
–<br />
–<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
–<br />
–<br />
•<br />
2012
<strong>Agrarwelt</strong><br />
24 I Titelthema<br />
dlz agrarmagazin ◾ Januar 2012<br />
„Ökonomische Anreize sind der Hebel“<br />
Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), Bonn,<br />
zum Thema Flächenverbrauch und zu den Ansprüchen des Naturschutzes an die Landwirte.<br />
Frau Professor Jessel, der Druck auf<br />
die Fläche steigt. Äcker und Grünland<br />
werden für Siedlung und Verkehr in<br />
Anspruch genommen, für Energie und<br />
Naturschutz. Jetzt sollen im Zuge der<br />
EUAgrarreform sieben Prozent der<br />
Ackerfläche als ökologische Vorrangfläche<br />
ausgewiesen werden. Überzieht<br />
der Naturschutz hier nicht seine<br />
Ansprüche an die Landwirte?<br />
Prof. Dr. Beate Jessel: Keinesfalls. Es ist richtig,<br />
die Ansprüche an die Fläche nehmen zu.<br />
Genau deshalb müssen wir versuchen, verschiedene<br />
Anforderungen besser miteinander<br />
zu verbinden. Wir dürfen Naturschutz nicht nur<br />
in Schutzgebieten betreiben, sondern brauchen<br />
wirksame Mindeststandards, die letztlich auch<br />
in der Fläche eine naturverträgliche und damit<br />
dauerhaft nachhaltige Nutzung sicherstellen.<br />
Die Direktzahlungen künftig mit Naturschutzanforderungen<br />
zu koppeln, ist dabei der richtige<br />
Weg. Über die Ausgestaltung und die Details<br />
ökologischer Vorrangflächen muss noch intensiv<br />
diskutiert werden. Ich möchte aber<br />
deutlich betonen, dass sie nicht unbedingt<br />
Flächenstilllegung bedeuten müssen. Vielmehr<br />
werden sie auch Flächen einschließen, die mit<br />
ökologischen Vorgaben weiter bewirtschaftet<br />
werden können.<br />
Die in der einen oder anderen Form unter<br />
Natur oder Landschaftsschutz stehende<br />
Fläche hat sich seit 1990 in etwa verdoppelt,<br />
während die landwirtschaftlich<br />
genutzte Fläche schrumpfte. Wie lange<br />
soll das so weitergehen?<br />
Jessel: Diese zwei unabhängig verlaufende<br />
nProzesse gegenüberzustellen halte ich für unsinnig.<br />
Die landwirtschaftliche Fläche schrumpft<br />
ja nicht durch Unterschutzstellungen. Vielmehr<br />
beträgt allein die täglich neu durch Siedlung<br />
und Verkehr beanspruchte Fläche in Deutschland<br />
etwa 90 ha. Hier müssen wir ansetzen:<br />
Ich würde mir wünschen, dass sich Landwirtschaft<br />
und Naturschutz auf dieser Basis sehr<br />
viel stärker gemeinsam gegen die Überbauung<br />
wertvoller Flächen durch Siedlungs-, Verkehrs-<br />
oder Infrastrukturprojekte einsetzen.<br />
In einem Positionspapier empfiehlt das<br />
BfN ein bundesweites Systems von handelbaren<br />
Flächenkontingenten. Hat das<br />
Modell Chancen auf Verwirklichung?<br />
Jessel: Ökonomische Anreize sind der wesentliche<br />
Hebel, um zu einer Reduzierung der<br />
Flächeninanspruchnahme zu gelangen. Handelbare<br />
Flächenkontingente sind dabei ein<br />
Instrument, mit dem die Politik einfach und klar<br />
die nachhaltige Flächennutzung steuern kann. Zur<br />
Umsetzung bedarf es aber neuer Strukturen auf<br />
unterschiedlichen Ebenen. Hierzu laufen zurzeit<br />
verschiedene Forschungsvorhaben. Wenn jetzt<br />
nicht bald konkrete Entscheidungen folgen, ist das<br />
Ziel einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahme<br />
auf 30 ha in 2020 nicht zu erreichen.<br />
Ausgleichsleistungen sind auch immer eine<br />
Frage der Bewertung. Nach der EUBiodiversitätsstrategie<br />
müssen die Mitgliedstaaten<br />
den Wert ihrer Ökosysteme bis 2014 erfassen.<br />
Wie hoch ist die Ökosystemleistung<br />
eines Rübenackers oder einer Weide in Euro<br />
und Cent?<br />
Jessel: Ökosystemleistungen sind, allgemein definiert,<br />
die Leistungen von Ökosystemen für den<br />
Menschen. Ein Rübenacker liefert uns Rüben,<br />
bei entsprechendem konventionellem Einsatz von<br />
Arbeit, Maschinenstunden, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.<br />
Viel mehr gibt der Rübenacker aber<br />
meist nicht her...<br />
Wir kommen allein mit<br />
hoheitlichen Maßgaben<br />
nicht zum Ziel, sondern<br />
sind auf Kooperationen<br />
mit Landwirten angewiesen,<br />
um den Erhalt<br />
der biologischen Vielfalt<br />
zu erreichen.“<br />
...was die meisten Landwirte komplett anders<br />
sehen dürften.<br />
Jessel: Nun, bei einer Weide oder allgemein bei<br />
Grünland sieht es anders aus. Neben dem Erlös<br />
aus Milch- oder Fleischproduktion hat die Weide<br />
einen bestimmten, vom Standort abhängigen Kohlenstoffgehalt<br />
im Oberboden. Durch Umwandlung<br />
in Acker würde davon schnell ein beträchtlicher<br />
Teil verloren gehen oder in Form von CO 2 in die<br />
Atmosphäre entweichen, wobei man pro Tonne<br />
CO 2 mit zusätzlichen volkswirtschaftlichen Langfristschäden<br />
im Wert von 70 Euro rechnen kann.<br />
Grünland reduziert im Vergleich zur üblichen Ackernutzung<br />
außerdem die Nährstoffbelastung von<br />
Gewässern im Umfang von 30 kg bis 70 kg N pro<br />
ha und Jahr. Multipliziert mit günstigen alternativen<br />
Vermeidungskosten ergibt das weitere 40 bis 120<br />
Euro pro ha und Jahr.<br />
Interview<br />
Und wie bewerten Sie die Artenschutz<br />
und Erholungsfunktion?<br />
Jessel: Eine Studie in NRW ermittelte Größenordnungen<br />
von 15 € bis 30 € Zahlungsbereitschaft<br />
pro Haushalt und Jahr, um diese<br />
Funktionen von Grünland zu sichern. Eine von<br />
uns durchgeführte Pilotstudie zeigte, dass der<br />
Erhalt von ökologisch wertvollem Grünland<br />
aufgrund der dadurch erbrachten Leistungen<br />
für Klimaschutz, Grundwasserqualität und Naturschutz<br />
als Grundlage der Artenschutz- und<br />
Erholungsfunktion einen Wert von zusammen<br />
etwa 900 Euro bis knapp 2.700 Euro pro ha<br />
und Jahr erbringt. Solche Zahlen sind auch im<br />
Naturschutz zunehmend wichtig.<br />
Sollte diese Bewertung der Maßstab zur<br />
Entschädigung von Nutzungsauflagen sein<br />
oder der durch die Auflagen entgangene<br />
wirtschaftliche Nutzen?<br />
Jessel: Pauschallösungen halte ich hier nicht<br />
für zielführend. Nicht jede Auflage zieht eine<br />
Entschädigung nach sich. Es ist nötig, den<br />
jeweiligen Kontext zu berücksichtigen. Bei freiwilligem<br />
Vertragsnaturschutz oder auch manchen<br />
Agrarumweltmaßnahmen haben wir uns<br />
stets für den vollen Ausgleich des entgangenen<br />
wirtschaftlichen Nutzens sowie eine zusätzliche<br />
Anreizkomponente ausgesprochen. Leider ist<br />
dies in den EU-Vorschlägen nicht aufgenommen<br />
worden.<br />
Wo funktioniert die Zusammenarbeit zwischen<br />
Naturschutz und Landwirtschaft<br />
gut, wo gibt es Spannungen?<br />
Jessel: Vertragsnaturschutz und Agrarumweltmaßnahmen<br />
sind gute Ansätze,<br />
um ökologische Leistungen der Landwirte zu<br />
honorieren. Diese Ansätze sind jedoch inhaltlich<br />
und finanziell noch weiter ausbaufähig.<br />
Konflikte gibt es beispielsweise bei der Ausweitung<br />
von Monokulturen wie Mais, dessen Anbau<br />
zwischen 2005 und 2010 von 70.000 ha auf<br />
über 600.000 ha angewachsen ist. Konfliktpotenzial<br />
bietet auch der Grünlanderhalt: Dass<br />
sich trotz Cross Compliance der Grünlandanteil<br />
an der landwirtschaftlich genutzten Fläche seit<br />
2003 um etwa vier Prozent, in einigen Bundesländern<br />
um deutlich mehr als fünf Prozent<br />
reduziert hat, macht uns große Sorgen. Hier<br />
sind die Legislativvorschläge der EU leider<br />
noch nicht ausreichend, um den Rückgang<br />
an biologischer Vielfalt in der Agrarlandschaft<br />
aufzuhalten.<br />
Frau Prof. Jessel, vielen Dank für Ihre<br />
Antworten. leh
Jörg Claus, Sülzetal<br />
Ausbruch aus<br />
dem Hamsterrad<br />
Artenschutz 270 ha neu ausgewiesene Gewerbefläche haben<br />
die Landwirte in Sülzetal bei Magdeburg fast zur Verzweifelung<br />
getrieben. Denn neben der ohnehin benötigten Ausgleichsfläche<br />
fand man bei der Kartierung 30 Löcher von Feldhamstern.<br />
Wir haben nichts gegen Hamster und<br />
auch nichts gegen die Entwicklung<br />
von Gewerbegebieten“, stellt Jörg Claus<br />
als aller erstes klar. Vor vier Jahren war<br />
die Welt im Sülzetaler Ortsteil Osterweddingen<br />
für ihn und seine Berufskollegen<br />
noch in Ordnung. „Bis dahin waren 200 ha<br />
als Gewerbegebiet ausgewiesen“, berichtet<br />
er. „Das fanden wir auch okay, denn dadurch<br />
wurden Arbeitsplätze geschaffen.“<br />
Zusammen mit seinem GbR-Partner Hans-<br />
Heinrich Meine trat er bereitwillig Flächen<br />
gegen eine entsprechende Entschädigung<br />
ab (siehe Kasten „Meine & Claus GbR“).<br />
Im Jahr 2008 entschied die Gemeinde<br />
Sülzetal dann, weitere 270 ha als Gewerbegebiet<br />
auszuweisen. Damit fingen<br />
die Probleme an: Denn man fand bei der<br />
Kartierung der Fläche 30 Löcher von Feldhamstern.<br />
„Das war es aber nicht alleine.<br />
Die Gestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen<br />
war ebenso problematisch wie<br />
die kleinen Nager“, sagt Jörg Claus.<br />
160 ha Ausgleichsfläche<br />
Er weiß, wovon er spricht. Der Landwirt<br />
ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Um-<br />
Für die hamstergerechte Bewirtschaftung müssen 20 Prozent des<br />
Getreides in Streifen stehen bleiben…<br />
weltausschusses des Bauernverbands und<br />
sitzt außerdem im Naturschutzbeirat der<br />
Stadt Magdeburg. So erfuhr er bereits frühzeitig<br />
von den Vorhaben und konnte sich<br />
einbringen.<br />
„Für Teile des alten 200 ha Gewerbegebiets<br />
waren noch Ausgleichsmaßnahmen<br />
offen. Hinzu kamen die Maßnahmen für<br />
das neue 270 ha umfassende Gebiet. Insgesamt<br />
sollten 100 ha Wald am Stadtrand<br />
Magdeburgs angepflanzt werden. Dazu<br />
kamen noch 60 ha Sukzessionsfläche“, erinnert<br />
sich der Landwirt. „In Summe sollten<br />
also 160 ha bester Ackerboden verloren<br />
gehen. Das ging nicht. Und das sahen sogar<br />
die Umweltverbände so.“<br />
Unter Leitung der Landgesellschaft<br />
Sachsen-Anhalt, die als Mittler zwischen<br />
Behörden, Planungsbüros und Landwirten<br />
fungiert, suchte und fand man Alternativen.<br />
So wurde beispielsweise ein Teilstück des<br />
Flusses Aller renaturiert und man verband<br />
zwei Biotope mittels einer Hecke miteinander.<br />
Zusätzlich ist schon länger entlang des<br />
Flusses Sülze ein Landschaftsschutzgebiet<br />
ausgewiesen, wo Maßnahmen umgesetzt<br />
werden sollen. „Aufgrund des Einsatzes der<br />
Titelthema I 25<br />
Jörg Claus hat zusammen mit seinem GbR-<br />
Partner vier Jahre lang 20 ha hamstergerecht<br />
bewirtschaftet.<br />
Landgesellschaft kann man glücklicherweise<br />
auf einem Teil der betroffenen Flächen<br />
mit einer Flurbereinigung begleitend tätig<br />
sein, so dass dem Land Sachsen-Anhalt<br />
zwar etwas Eigentum verloren geht, aber<br />
nicht den Landwirten“, erklärt der gebürtige<br />
Niedersachse.<br />
Im Gegensatz zu den Aktivitäten auf<br />
dem Land, wird in der Stadt Magdeburg<br />
aufgrund des Anstoßes des Naturschutzbeirats<br />
in unterschiedlichen Gremien bisher<br />
über den Abriss und die Entsiegelung von<br />
Flächen, wie Industrieruinen, im Stadtgebiet<br />
nur diskutiert. „Wobei auf Taten noch<br />
zu warten ist“, betont Jörg Claus.<br />
30 Hamsterlöcher<br />
All diese Maßnahmen brachten und bringen<br />
den Landwirten in Sülzetal eine Menge<br />
Erleichterungen – bis zu dem Zeitpunkt als<br />
man bei der Kartierung des neuen, 270 ha<br />
großen Gewerbegebiets über die Hamsterlöcher<br />
stolperte. „30 Löcher fand man“, berichtet<br />
der Landwirt. „Das entspricht zwei<br />
…außerdem darf der Boden erst ab dem 01. Oktober bearbeitet<br />
werden.<br />
www.dlz-agrarmagazin.de<br />
Foto: Diersing-Espenhorst<br />
Fotos: Meine, Claus
<strong>Agrarwelt</strong><br />
26 I Titelthema<br />
Meine & Claus GbR<br />
Zusammen mit seinem Partner Hans-Heinrich<br />
Meine betreibt Jörg Claus die Meine & Claus<br />
GbR mit drei Standorten. Der Hauptsitz der im Jahr<br />
1991 gegründeten GbR befindet sich in Osterweddingen<br />
nahe Magdeburg. Hier werden 800<br />
ha Ackerfläche bewirtschaftet. Der zweite Standort<br />
ist das Gut Röderhof bei Halberstadt mit etwa<br />
420 ha Nutzfläche und 70 ha Wald. Der dritte<br />
Standort mit insgesamt etwa 960 ha Ackerland<br />
liegt in Mackendorf zwischen Wolfsburg und<br />
Helmstedt. Hier wirtschaftet ein Verbund aus<br />
bis drei Feldhamstern.“ Und die unterliegen<br />
dem europäischen Artenschutz. Das hatte<br />
zur Folge, dass ein Flächenausgleich von<br />
1:1 stattfand. „Das heißt, wir hätten 270<br />
ha hamstergerecht bewirtschaften müssen,<br />
wenn die Gesamtfläche bebaut worden wäre.<br />
Bis dato waren allerdings nur 70 ha so zu<br />
beackern“, sagt Jörg Claus, den diese Maßnahme<br />
mit 20 ha betraf. Hamstergerechte<br />
Bewirtschaftung bedeutete für ihn und seine<br />
betroffenen Berufskollegen:<br />
• eine vorgegebene Fruchtfolge mit maximal<br />
einmal Raps in fünf Jahren,<br />
Willi Liesenberg, Kerpen<br />
dlz agrarmagazin ◾ Januar 2012<br />
drei Betrieben: Dem ursprünglichen Betrieb von<br />
Hans-Heinrich Meine, dem elterlichen Betrieb<br />
von Jörg Claus sowie einem Nachbarbetrieb.<br />
Es wird neben dem Ackerbau eine 1,7 MW<br />
Biogasanlage zur Gasdirekteinspeisung mit<br />
drei weiteren Partnern betrieben.<br />
Auf den Flächen werden Zuckerrüben, Raps,<br />
Mais und Getreide angebaut. Neben den beiden<br />
Betriebsleitern sind zehn Festangestellte<br />
sowie zur Ernte zusätzliche Saisonarbeitskräfte<br />
beschäftigt. de<br />
• 20 Prozent des Getreides musste bis zum<br />
30. September in Streifen stehen bleiben,<br />
• Bodenbearbeitung erst ab dem 1. Oktober,<br />
• Glyphosat-Einsatz war untersagt und<br />
• jegliche Art der Mäusebekämpfung war<br />
verboten.<br />
Dafür erhielten die Landwirte 700 € Entschädigung<br />
pro Hektar und Jahr. „Und jede<br />
Menge Ärger mit den Verpächtern, die uns<br />
fragten, was wir mit ihrem Acker machten“,<br />
fügt Jörg Claus hinzu. Hier sei noch<br />
angemerkt, dass auf den so bewirtschafteten<br />
Zusammen mit der <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>Kulturlandschaft</strong>sstiftung Wie Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen<br />
mit der <strong>Stiftung</strong> <strong>Rheinische</strong> <strong>Kulturlandschaft</strong> sinnvoll<br />
umgesetzt werden, zeigt das Beispiel von Willi Liesenberg aus<br />
dem Rheinland.<br />
Flächen kaum Hamster lebten – jedenfalls<br />
nicht vor der Umsiedlung! „Ja“, bestätigt<br />
Jörg Claus, „man siedelte die Hamster auf<br />
die entsprechend bewirtschafteten Flächen<br />
um. Es gab in den ersten Jahren zudem ein<br />
Monitoring, als dann das Umweltbüro<br />
wechselte, fand dies nicht mehr statt.“ Das<br />
ist neben dem Einsatz aller Beteiligten ein<br />
Grund, warum diese Art der Bewirtschaftung<br />
im vergangenen Jahr endete.<br />
Ab diesem Jahr wird auf den 1:1 Ausgleich<br />
verzichtet. Darauf konnte man sich<br />
in den entsprechenden Verwaltungsausschüssen<br />
nach intensiven Diskussionen<br />
einigen. Dafür werden für jeden Hektar<br />
versiegelte Fläche nun 0,15 ha Hamsterausgleichsfläche<br />
geschaffen. „Das sind dann<br />
Streifen, die nicht mehr landwirtschaftlich<br />
genutzt werden“, erklärt der Landwirt.<br />
„Hier werden verschiedene Getreidearten<br />
gesät, die den Hamstern zugute kommen.“<br />
Bei 270 ha Gewerbefläche sind das dann<br />
nur noch 40,5 ha.<br />
„Es lohnt sich also sich einzumischen“,<br />
ist Jörg Claus überzeugt. „Ich rate meinen<br />
Berufskollegen deshalb, sich so früh wie<br />
möglich einzubringen, wenn sie erfahren,<br />
dass Ackerfläche anderweitig genutzt werden<br />
soll.“ de<br />
Willi Liesenberg bewirtschaftet<br />
einen mittelgroßen Ackerbaubetrieb<br />
in Kerpen-Türnich. In<br />
der dicht besiedelten Region ist der Flächenbedarf<br />
durch den Braunkohle-Tagebau,<br />
aber auch für Gewerbe-, Wohn- und<br />
Verkehrszwecke sehr groß. Mit seinem<br />
Betrieb liegt der Rheinländer teilweise in<br />
einem „Suchfenster“ der Stadt Kerpen: Vor<br />
allem in den ehemaligen Erftauen sollen<br />
weniger produktive Agrarflächen für Ausgleichsmaßnahmen<br />
herangezogen werden.<br />
„Dem Flächendruck können wir uns nicht<br />
entziehen. Wenn Ausgleichsmaßnahmen<br />
unvermeidlich sind, ist die Umsetzung mit<br />
der <strong>Stiftung</strong> <strong>Rheinische</strong> <strong>Kulturlandschaft</strong><br />
nach meiner Erfahrung ein guter Weg“,<br />
berichtet Willi Liesenberg.<br />
Ackerbauer Willi Liesenberg (links)<br />
und Jan Dirk Schierloh von der<br />
<strong>Kulturlandschaft</strong>sstiftung: „Gerechte<br />
Entschädigung für Ausgleichs- und<br />
Ersatzmaßnahmen“.
Foto: <strong>Stiftung</strong> <strong>Rheinische</strong> <strong>Kulturlandschaft</strong><br />
Fairer Ausgleich<br />
Die <strong>Stiftung</strong> <strong>Rheinische</strong> <strong>Kulturlandschaft</strong><br />
gewährt für Ausgleichsflächen eine Entschädigung,<br />
die sich am durchschnittlichen<br />
Deckungsbeitrag einer ortsüblichen Fruchtfolge<br />
orientiert. In der Köln-Aachener-Bucht,<br />
wo Weizen-Weizen-Zuckerrübe üblich sind,<br />
veranschlagt die <strong>Stiftung</strong> den Deckungsbeitrag<br />
auf 900 bis 1.300 Euro. Die Summe<br />
wird um einen finanziellen Anreiz aufgestockt,<br />
damit die Teilnahme attraktiv ist.<br />
Die EU-Flächenprämie kann der Landwirt<br />
nach wie vor beantragen. Mittel für Agrarumweltmaßnahmen,<br />
zum Beispiel für Vertragsnaturschutz,<br />
werden für diese Fläche<br />
aber nicht gewährt.<br />
Anders ist der Fall, wenn die <strong>Stiftung</strong><br />
Eigentümer der Fläche ist. Dann wird sie<br />
pachtzinsfrei zur Verfügung gestellt. Die Pflegeauflagen<br />
werden nach KTBL-Richtsätzen<br />
vergütet. Für Grünlandpflege beträgt die<br />
Vergütung zum Beispiel 2 bis 4 ct/m2 . Der<br />
Bewirtschafter darf das Schnittgut nutzen<br />
und die Flächenprämie beantragen. leh<br />
Er hat eine Ackerfläche von fast sieben<br />
Hektar an der Erft mit zertifiziertem Regio-<br />
Saatgut als artenreiches Dauergrünland<br />
eingesät. Zusätzlich wurden entlang den<br />
Rändern 15 Meter breite Blühstreifen angelegt<br />
sowie Bäume und Gehölze gepflanzt.<br />
Die Fläche darf weder gedüngt noch mit<br />
Pflanzenschutz behandelt werden. Zwei<br />
Schnitte im Jahr sind erlaubt. Der Betrieb<br />
darf den Aufwuchs nutzen.<br />
Für den Ertragsausfall im Vergleich<br />
zur Ackernutzung und den Pflegeaufwand<br />
erhält er von der <strong>Stiftung</strong> eine auf<br />
15 Jahre vertraglich geregelte Entschädigung.<br />
Die <strong>Stiftung</strong> ihrerseits füllt mit<br />
der Fläche ein Ökopunktekonto, das für<br />
Ausgleichspflichtige bei Bedarf zur Ver-<br />
fügung steht. Willi Liesenberg: „Der<br />
Arbeitsweise von Flächenpools im Überblick<br />
Genehmigungs/<br />
Fachbehörde<br />
Fischreiher finden sich vor allem an Bachläufen oder Auen. Längst nicht überall sind sie willkommen.<br />
Der Fischräuber Kormoran soll in NRW künftig nicht mehr bejagt werden dürfen.<br />
stimmt zu<br />
Kompensationsvertrag<br />
• Umfang<br />
• Maßnahme<br />
• Bewertung<br />
• Laufzeit<br />
• Kapital<br />
dokumentiert<br />
Vorhabenträger<br />
Planungsbüro<br />
Titelthema I 27<br />
Landwirt<br />
Quelle: Muchow, <strong>Stiftung</strong> <strong>Rheinische</strong> <strong>Kulturlandschaft</strong> 2012<br />
Flächenbedarf ist ganz klar zu hoch und<br />
muss dringend verringert werden. Dazu<br />
werden auch gesetzliche Änderungen notwendig<br />
sein. Ausgleichsmaßnahmen finden<br />
in der Landwirtschaft nur Akzeptanz,<br />
wenn dadurch kein Einkommensverlust<br />
entsteht“.<br />
Darum ist die Kooperation mit der <strong>Stiftung</strong><br />
in jedem Fall die beste Lösung, weil<br />
hier der Wille zur Zusammenarbeit mit der<br />
Landwirtschaft und Fachwissen vorhanden<br />
sind und eine Entschädigung gezahlt wird“.<br />
Für eine weitere Ausgleichsmaßnahme hat<br />
er daher in Absprache mit Projektleiter Jan<br />
Dirk Schierloh von der <strong>Stiftung</strong> <strong>Rheinische</strong><br />
<strong>Kulturlandschaft</strong> auch in diesem Jahr wieder<br />
zahlreiche Lerchenfenster in seinen<br />
Weizenschlägen angelegt. leh<br />
Flächenmanagement<br />
• Jährliche Kontrolle<br />
• Berichterstattung<br />
• Pflegemanagement<br />
• Vertragsverlängerung<br />
betreut und honoriert<br />
Eigentümervertrag zur<br />
Flächenbereitstellung<br />
• Maßnahme<br />
• Sicherung<br />
• Laufzeit<br />
• Entschädigung<br />
Bewirtschaftervertrag zur<br />
Herstellung und Pflege<br />
• Maßnahme<br />
• Auflagen<br />
• Laufzeit<br />
• Vergütung<br />
Wenn der<br />
Amtsschimmel wiehert<br />
Die Arbeit der Kulturlandstiftung genießt<br />
im Rheinland einen guten Ruf unter<br />
den Land- und Forstwirten und wird insgesamt<br />
positiv aufgenommen. Ein Beispiel<br />
dafür, wie überzogene Auflagen vom grünen<br />
Tisch den Erfolg von Naturschutzmaßnahmen<br />
massiv gefährden, liefert jedoch das<br />
anfangs erfolgreich initiierte Projekt ‚Feldlerchenfenster‘.<br />
Fenster für Lerchen: Für die Anlage in Getreide<br />
zahlt die <strong>Stiftung</strong> 10 Euro pro Fenster<br />
von mindestens 20 m². Voriges Jahr<br />
wurden landesweit rund 10.000 solcher<br />
Bruthilfen für die Feldlerche eingerichtet. Das<br />
Programm wurde von den Landwirten also<br />
gut angenommen.<br />
Auf Druck des Landes NRW mit seinem<br />
grünen Landwirtschaftsminister wurden die<br />
Auflagen dieses Jahr jedoch verschärft. Die<br />
Fenster dürfen jetzt nicht mehr in Wintergerste<br />
freigehalten werden. Zudem müssen<br />
sie mindestens 150 m von geschlossenen<br />
Ortschaften und Baumbeständen sowie 50<br />
m von Straßen, Strauchhecken und Greifvogelansitzen<br />
entfernt sein.<br />
Folge: Die Beteiligung ging auf ein Drittel<br />
des Vorjahres zurück! Die Mindestabstände<br />
können wegen der Flächenstruktur häufig<br />
schlicht nicht eingehalten werden.<br />
In anderen Bundesländern, wo ähnliche<br />
Projekte angeboten werden, wurden die<br />
Auflagen nicht erschwert. leh<br />
www.dlz-agrarmagazin.de
<strong>Agrarwelt</strong><br />
Foto: Unkel<br />
28 I Titelthema<br />
Gerhard Risser, Stetten<br />
Partner der Natur<br />
Naturschutz Wie sich vorbildlicher Artenschutz in die eigenen<br />
betrieblichen Abläufe ganz praktisch integrieren lässt, zeigt das<br />
Beispiel von Gerhard Risser aus der Pfalz.<br />
Naturschutz liegt ihm „von Natur<br />
aus“ am Herzen, sagt Gerhard<br />
Risser, der mit seiner Frau Christa<br />
einen 75 ha Ackerbaubetrieb in Stetten<br />
bewirtschaftet. In der Nordpfalz herrscht<br />
recht hohe Ertragssicherheit und ein<br />
vergleichsweise breites Anbauspektrum.<br />
Künftig wird sich der Naturschutz „bei<br />
uns in dieses System integrieren“, sagt der<br />
kommunikative Pfälzer.<br />
Bedingt durch Sonderkulturen wie<br />
Spargel und Kartoffeln liegt das Pachtpreisniveau<br />
in seiner Region bei 500 €/ha,<br />
Tendenz steigend. Die Betriebsflächen<br />
befinden sich teilweise in einem Natura<br />
2000-Gebiet vorrangig mit Vogelschutz.<br />
Gerhard Risser nimmt teil am Projekt<br />
‚Partnerbetrieb Naturschutz‘.<br />
Motiviert<br />
für den Naturschutz<br />
Auf die Frage, was ihn motiviert, aktiv<br />
dabei mitzumachen, antwortet Risser<br />
spontan: „Handfeste Vorteile auch für<br />
den eigenen Betrieb, jedenfalls bei gut<br />
abgestimmter Zusammenarbeit zwischen<br />
Landwirten und Naturschützern“. Im Mittelpunkt<br />
steht für den öffentlich bestellten<br />
Sachverständigen dabei „die angemessene<br />
Vergütung“ von Naturschutzleistungen.<br />
Ackerbauer Gerhard Risser diskutiert Agrarumweltmaßnahmen mit<br />
Ludwig Simon, Artenschutzreferent am Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft<br />
und Gewerbeaufsicht, Brigitte Leicht aus der Agrarberatung<br />
sowie zwei Praktikantinnen (v.l.n.r.).<br />
dlz agrarmagazin ◾ Januar 2012<br />
Zudem zählt der „Dialog auf Augenhöhe“,<br />
sagt Risser, nicht nur beim Festlegen der<br />
Maßnahmen, sondern auch bei der Wahl<br />
der Flächen und bei der Analyse der Ergebnisse.<br />
„Dabei wird nichts von Behörden<br />
vordiktiert“.<br />
Die Teilnahme am rheinland-pfälzischen<br />
Agrarumweltprogramm PAULa ist<br />
für den Betriebsleiter momentan „überhaupt<br />
kein Thema“. Der Grund: „Unzureichende<br />
finanzielle Anreize und zu hoher<br />
Verwaltungsaufwand“. Risser wünscht sich<br />
stattdessen „flexible Laufzeiten“ und Förderpämien,<br />
die dem Ertragspotential seines<br />
Standorts angepasst sind.<br />
Intensive Ackerbauregionen, wie das<br />
Gebiet um Stetten, „nehmen trotz guter<br />
Ansätze die bei PAULa in Betracht kommenden<br />
Programmteile derzeit nicht an“,<br />
weiß auch Jörg Weickel. Der Abteilungsleiter<br />
Landwirtschaft im Dienstleistungszentrum<br />
Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück<br />
in Bad Kreuznach<br />
gibt zu: „Dazu reicht einfach die Prämienausstattung<br />
im Moment nicht“.<br />
Auf dem Betrieb Risser werden im<br />
Rahmen des ‚Partnerbetriebs Naturschutz‘<br />
Erhebungen durchgeführt, um den betriebsindividuellen<br />
Prämienbedarf für<br />
ausgewählte Programmteile zu ermitteln.<br />
Foto: Unkel<br />
Gerhard Risser, Beraterin Brigitte Leicht.<br />
Weickel: „Die Ergebnisse dienen als eine<br />
Diskussionsgrundlage für die Programmfortschreibung<br />
von PAULa ab 2014“.<br />
Naturschutz in Arbeit einbauen<br />
Unabdingbar ist, erklärt Gerhard Risser,<br />
dass „die Naturschützer die wirtschaftlichen<br />
Interessen der Landwirte anerkennen“. Zudem<br />
muss „die Kommunikation auf beiden<br />
Seiten verbessert werden“. In Stetten bestehen<br />
inzwischen gute Voraussetzungen, lohnenden<br />
Naturschutz umzusetzen. Risser:<br />
„Auch die hiesigen Jagdpächter haben ihre<br />
Bereitschaft signalisiert, sich an der Anlage<br />
und Umsetzung von Projekten finanziell<br />
zu beteiligen“. Natürlich musste der Praktiker<br />
dabei auch „Lehrgeld“ zahlen, vor<br />
allem mit den vorherigen Pächtern. „Die<br />
hatten wenig Verständnis für betriebswirtschaftliche<br />
Belange“ aufgebracht. Das ist<br />
inzwischen anders. Auf seinen Flächen<br />
Ackerrand- und auch unbearbeitete Grünstreifen im Feld bieten echten<br />
Schutz für viele Arten. Dazu zählt, dass die Schlaggrenze nicht<br />
immer näher an den Wegesrand rückt: „4,50 m breite Wege müssen<br />
auch 4,50 m breit bleiben“.<br />
Foto: Leicht
Betriebsspiegel Risser<br />
Betriebsleiter: Landwirtschaftsmeister Gerhard,<br />
56, und Dipl.-Landwirtin Christa Risser;<br />
ein Sohn, promoviert, bei Südzucker, und zwei<br />
Töchter außerhalb der Landwirtschaft tätig;<br />
Arbeitskraft: 0,5 AK; in Agil e.V. Vermarktung<br />
15.000 bis 20.000 t Getreide jährlich; Mitbegründer<br />
Kraichgau-Korn; Disponent 65 Mitarbeiter<br />
bei Zuckerrübenlogistik Donnersberg;<br />
öffentlich bestellter Sachverständiger Rheinland-Pfalz,<br />
Baden-Württemberg, Hessen;<br />
Betrieb: 75 ha Ackerbau, rund 0,7 ha Weinberge;<br />
circa 0,5 ha Hof-, Streuobstfläche;<br />
Standort: Gemarkung Stetten, Pfalz, 280 m<br />
über NN; Durschnittstemperatur 1980 bis 2010<br />
über 9° C bei etwa 500 mm Niederschlag;<br />
Verkehrslage: Hof-Feldentfernung 1 km; 15<br />
Teilstücke von 1 ha bis 9 ha;<br />
Boden: 50 bis 90 Punkte; pfluglos;<br />
Anbau: Zuckerrüben und Winterweizen je 25<br />
integriert Risser den Naturschutz in die<br />
Arbeitsabläufe. Er sät auf Randstreifen<br />
und Kleinflächen ein- und mehrjährige<br />
Blühmischungen. Auf Flächen „mit floristischem<br />
Potential“ legt er in Wintergetreide<br />
ungedüngte und ungespritzte Streifen an,<br />
um Ackerwildkräuter zu fördern. Andernorts<br />
sät er eigene Blühmischungen ein, „die<br />
faunistischen Zielen dienen“. Neben Hase,<br />
Fasan und Rebhuhn soll etwa auch der<br />
Feldhamster gefördert werden.<br />
Um Weihen zu unterstützen, pflegt und<br />
mulcht der Landwirtschaftsmeister Graswege<br />
in der Gemarkung. Er sorgt dafür,<br />
dass „4,50 m breite Wege auch 4,50 m breit<br />
bleiben und nicht immer weiter umgepflügt<br />
werden“. Bodenbrüter fördert er mit Strohmulch<br />
in Zuckerrüben. „Mit Förderung<br />
des örtlichen Jagdpächters werden weitere<br />
Berufskollegen mit ins Boot geholt“.<br />
Für 6 bis 10 m breite Blühstreifen,<br />
bei den Jägern „Hennenwiesen“ genannt<br />
wegen der unzähligen Fasanenhennen,<br />
hat Risser inzwischen „gestaffelte Vergütungen“<br />
vereinbart: Ausgehend von 1.350<br />
Euro/ha bei 100 Bodenpunkten geht<br />
es weiter in 150 Euro-Schritten je nach<br />
Bodengüte, also 1.050 Euro bei 80 Punkten,<br />
600 Euro bei 50 und 300 Euro/ha bei<br />
30 Bodenpunkten plus Prämien. „Mit mindestens<br />
2,5 ha davon auf 500 ha“ lassen sich<br />
in der Gemarkung sinnvolle Vernetzungsstrukturen<br />
etablieren.<br />
Zusammenarbeit in Augenhöhe<br />
Durch das Verschneiden der Flächengeometrien<br />
des Betriebs auf der einen mit vorliegenden<br />
Fachplanungen auf der anderen<br />
Seite, von Naturschutzdaten über Bodenkarten<br />
bis zum Erosionskataster, werden<br />
Prozent; Sommer- und Winterbraugerste je 20<br />
Prozent, Winterroggen 10 Prozent;<br />
Ertragsniveau: (1980 bis 2010) Rüben 400<br />
bis 850 dt/ha, Weizen 58 bis 110 dt, Roggen<br />
54 bis 110 dt, Sommergerste 52 bis 82, Winterbraugerste<br />
56 bis 86 dt/ha;<br />
Maschinen: zum Teil mit Partner; Schlepper:<br />
John Deere 6920, Case CS 86; 6 t-,10<br />
t-, 14 t-, 18 t-Hänger; Bodenbearbeitung: 3<br />
m-Horsch Terrano FX, 4-m-Horsch-Kurzscheibenegge,<br />
6-m-Köckerling Federzinkengrubber,<br />
6,30-m-Cambridge-Walze; Saat: 5,60-m-<br />
Rau-Saatbettkombination mit Kverneland<br />
Kreiselegge, Güttler-Frontpacker, Accord-Drille;<br />
Pflege: 21-m-Rauch-Axis- Wiegestreuer;<br />
21-m-Rau-Spritze Flowmate Control und<br />
12-m-Jacobi-Feldspritze für Zuckerrüben;<br />
Getreidelager für 300 t; ohne Mähdrescher,<br />
Rübenroder und Rübensägerät.<br />
die Naturschutzpotentiale des Betriebs und<br />
der Flächen abgebildet. Naturschutz- und<br />
Landwirtschaftsberater erstellen dann gemeinsam<br />
für den Betrieb eine Potentialanalyse<br />
für den Naturschutz.<br />
„Die wird auch gemeinsam diskutiert“,<br />
erläutert der Nordpfälzer. Wichtig dabei:<br />
„Die Entscheidung über zu treffende Maß-<br />
So läuft der ‚Partnerbetrieb<br />
Naturschutz‘<br />
Der ‚Partnerbetrieb Naturschutz‘ ist in<br />
Rheinland-Pfalz ein gemeinsames<br />
Instrument von Naturschutz- und staatlicher<br />
Landwirtschaftsberatung. In Wein-,<br />
Obstbau und Landwirtschaft arbeiten die<br />
verschiedenen Seiten zusammen. Kernbestandteil<br />
des ‚Partnerbetriebs‘ ist die<br />
Potentialanalyse des Betriebs auf Basis<br />
von vorliegenden Geo- und Fachdaten. Die<br />
werden von Naturschutz- und staatlicher<br />
Landwirtschaftsberatung geliefert.<br />
Analysen und Beratungen sind für alle<br />
interessierten Landwirte kostenlos verfügbar.<br />
Die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen<br />
ist in jedem Fall freiwillig. Sie liegt<br />
allein in der Entscheidung des Landwirts.<br />
Flankierend ist das Fach ‚Naturschutz‘ Pflicht<br />
im Fachschulunterricht Landwirtschaft am<br />
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum<br />
(DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück.<br />
In der DLR-Abteilung Landwirtschaft ist<br />
auch die landesweit zuständige Koordinationsstelle<br />
angesiedelt. Zur Zeit nehmen<br />
78 Betriebe aller Produktions- und Anbaurichtungen<br />
im Rahmen eines ersten<br />
Antragsverfahrens daran teil.<br />
Foto: Mattern<br />
Titelthema I 29<br />
Rübenbauer Gerhard Risser arbeit seit Jahren<br />
pfluglos. „Für Bodenbrüter ist vor allem<br />
der Strohmulch in Zuckerrüben förderlich.“<br />
nahmen liegt allein bei mir“. Zuvor hat Risser<br />
mit den Beratern die naturschutzfachlichen,<br />
ackerbaulichen und ökonomischen<br />
Aspekte umfassend diskutiert.<br />
„Je nach Problemlage“, weiß der<br />
Landwirt, stehen beide Beratungs-<br />
stränge „einzeln oder gemeinsam“ für<br />
weitere Gespräche und Termine zur Verfügung.<br />
Wichtig ist Gerhard Risser auch<br />
dabei „der offene und vertrauensvolle Dialog<br />
auf Augenhöhe“. Die Entscheidung<br />
für einzelne Naturschutz-Maßnahmen<br />
bleibt freiwillig. Risser: „Sie liegt allein in<br />
meiner Verantwortung“. So sieht er die<br />
eigene Region in Sachen Naturschutz „auf<br />
gutem Weg“.<br />
„Allerdings fehlt es zur Zeit noch an<br />
auf das Gebiet abgestimmten Natur-<br />
schutz-Strategien“, räumt Jörg Weickel<br />
ein. „Zusammen mit Landwirten können<br />
diese Konzepte aber entwickelt und<br />
umgesetzt werden“, ist er sicher. Dabei<br />
muss das Augenmerk auch weiter auf<br />
der Freiwilligkeit liegen, auf dem Dialog<br />
und dem wirtschaftlichen Arbeiten der<br />
Betriebe“. Da ist Jörg Weickelt mit Gerhard<br />
Risser einig: „Der ‚Partnerbetrieb<br />
Naturschutz‘ ist das richtige Instrument,<br />
um Naturschutz in die landwirtschaftliche<br />
Praxis zu tragen“. kb<br />
www.dlz-agrarmagazin.de