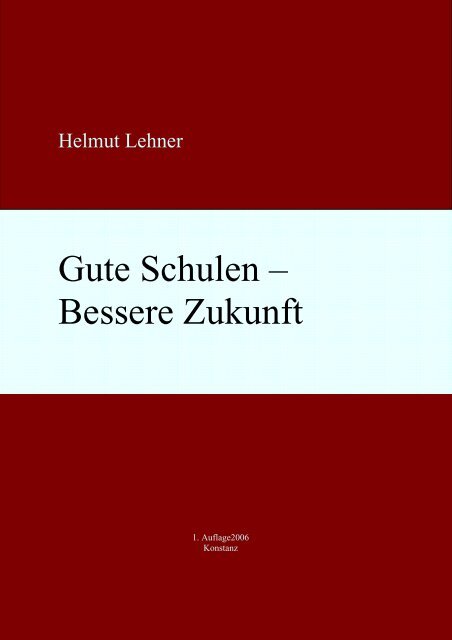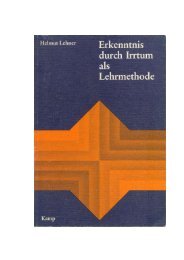PDF-Dokument downloaden - Auswirkungen auf die Institution
PDF-Dokument downloaden - Auswirkungen auf die Institution
PDF-Dokument downloaden - Auswirkungen auf die Institution
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT© Helmut Lehner 2006Alle Rechte vorbehalten2
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTInhaltTeil I ...................................................................................................................................6Die Notwendigkeit einer Neuen Schule..............................................................................61. Die Probleme der Alten Schule..................................................................................6Die Forderungen der Lehrpläne .................................................................................6Die Vorgaben der Schulbürokratie.............................................................................8Was tatsächlich erreicht wird ...................................................................................112. Warum es so wenige gute Schulen gibt....................................................................15Der mangelnde Glauben an uns selbst fördert staatliche Eingriffe ..........................15Die übliche Auffassung von Erziehung schwächt <strong>die</strong> Kinder und Jugendlichen.....18Die vorherrschende Didaktik behindert das Denken................................................213. Die Alte Schule <strong>auf</strong>geben – aber wie? .....................................................................25„Richtig“ und „Falsch“ in der Erziehung unterscheiden..........................................25Veränderungspotenziale erkennen ...........................................................................28Die staatliche Einmischung zurückdrängen .............................................................29Die Überschätzung unseres objektiven und <strong>die</strong> Vernachlässigung unseressubjektiven Wissens <strong>auf</strong>geben..................................................................................324. Erziehungswissenschaft in der Sackgasse................................................................37Forschungsschwerpunkte .........................................................................................37Perspektiven .............................................................................................................41Teil II................................................................................................................................43Das neue Modell: Ein Überblick......................................................................................435. Der Schüler...............................................................................................................43Anmerkungen zur Psychologie des Schülers ...........................................................43Der Schüler in der Unterrichtssituation....................................................................45<strong>Auswirkungen</strong> von Erwartungs- und Handlungsmustern ........................................486. Didaktisch bedeutsame Merkmale des Unterrichts ..................................................51Freiheit und Ordnung vs. Führung ...........................................................................51Problemorientierung vs. Ergebnisorientierung.........................................................52Kooperation vs. Wettbewerb....................................................................................537. Schulische Rahmenbedingungen – ihr Einfluss <strong>auf</strong> Lehrer und Unterricht.............54Ziele und <strong>die</strong> dadurch bedingte Lehr-/Lernorganisation..........................................54Die Organisation zur Sicherung von Leistung .........................................................56Schulleitung..............................................................................................................568. Unterrichtsumgebung und Lehrer-Schüler-Interaktion ............................................579. Schulpolitische Bedingungen...................................................................................58Zentrale Lenkung vs. Autonomie.............................................................................58Isolierung vs. Öffentlichkeit.....................................................................................603
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT10. Gesellschaftliche Bedingungen und Einflüsse....................................................... 61Die Macht anonymer Erwartungen.......................................................................... 62Entwicklung durch klar bestimmte Erwartungen .................................................... 64Teil III.............................................................................................................................. 66Beiträge zur Psychologie des Schülers............................................................................ 6611. Entwicklung von innen oder von außen?............................................................... 66Die These des anfänglich „leeren“ Geistes.............................................................. 67Einwände gegen <strong>die</strong> Theorie des „leeren“ Geistes.................................................. 68Die These des bereits entwickelten Verstandes....................................................... 70Handlung und Produkt: Ich und Persönlichkeit....................................................... 77Die triadische Struktur der menschlichen Intelligenz.............................................. 8012. Lernen.................................................................................................................... 82Kognitive Stile......................................................................................................... 83Entstehung des rezipierend-reproduzierenden Lernstils.......................................... 86Beispiele für rezipierend-reproduzierendes Lernen................................................. 90Der Einfluß der Schule <strong>auf</strong> den rezipierend-reproduzierenden Lernstil.................. 92Selbständiges Forschen und Entdecken bei Kindern............................................... 94Kognitive Operationen beim forschend-entdeckenden Lernen ............................... 97Die Beseitigung von Lernstörungen durch forschend-entdeckende Operationen . 10713. Motivation ........................................................................................................... 109Objektivistische Theorien...................................................................................... 110Subjektivistische Theorien..................................................................................... 112Das Bedürfnis nach Sicherheit............................................................................... 114Das Bedürfnis nach Selbständigkeit ...................................................................... 114Das Bedürfnis nach Kompetenz ............................................................................ 115Diskussion objektivistischer und subjektivistischer Auffassungen....................... 116Intrinsische und extrinsische Motivation............................................................... 119Fremd- und Selbstbestimmung.............................................................................. 120Formen extrinsischer und intrinsischer Motivation............................................... 120Kontrollierende Maßnahmen zerstören <strong>die</strong> Lernfreude......................................... 12414. Gefühl und Temperament.................................................................................... 127Schulisch bedeutsame Temperamente................................................................... 128Der Einfluss des Temperaments bei extrinsischer Motivierung............................ 130Der Einfluss des Temperaments bei intrinsischer Motivierung ............................ 136Körperliche Entspannung als Mittel zur emotionalen Integration......................... 13915. Einstellungen und Werte ..................................................................................... 140Die <strong>Auswirkungen</strong> kontrollierender Maßnahmen ................................................. 140Der Mechanismus der Abwehr .............................................................................. 142Befunde und Erfahrungsberichte zu den Folgen der Abwehr ............................... 144Individuelle Differenzen und Unterschiede........................................................... 146Entwicklung von Wertvorstellungen durch Selbstregulation................................ 14716. Pläne und Interessen ............................................................................................ 14817. Selbstwerteinschätzungen.................................................................................... 150Erhaltung des Selbstwerts als (Grund-)Bedürfnis ................................................. 151Das handlungs- und das lageorientierte Selbst ...................................................... 1534
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTeil IV ............................................................................................................................156Beiträge zur Unterrichtspsychologie..............................................................................15618. Didaktische Merkmale aus der Sicht von außen ..................................................157Erziehung als Lenkung...........................................................................................157Stoff- bzw. Ergebnisorientierung ...........................................................................165Auslese / Wettbewerb.............................................................................................17019. Didaktische Merkmale aus der Sicht von innen...................................................181Freiheit und Ordnung .............................................................................................182Problemorientierung...............................................................................................191Kooperation............................................................................................................208Teil V..............................................................................................................................214Diskussion schulischer Rahmenbedingungen ................................................................21420. Die Ziele: Gesellschaftliche Erwartungen vs. Entfaltung der Persönlichkeit 215Die so genannten Leistungsanforderungen ............................................................215Folgen für das Selbstbild von Lehrern ...................................................................216Folgen für das Selbstbild der Schüler.....................................................................21921. Organisation des Unterricht: Mechanisierung vs. Individualisierung..................222Planerfüllung ..........................................................................................................222Die Förderung der Pläne von Schülern ..................................................................22622. Organisation zu Sicherung von Leistung: Selektion von Individuen vs. Selektionvon Maßnahmen .........................................................................................................229Leistungsvergleiche führen zu Wettbewerb...........................................................230Homogene Leistungsgruppen führen nicht zu besseren Leistungen......................233Problematik der Leistungsauslese ..........................................................................236Koppelung von Unterricht und Berechtigungswesen: Schule als Ausleseagentur.238Trennung von Unterricht und Berechtigungswesen...............................................24123. Schulpolitische Rahmenbedingungen ..................................................................243Abhängigkeit vs. Autonomie..................................................................................243Geschlossenheit vs. Offenheit ................................................................................246Teil VI ............................................................................................................................249Ausblick..........................................................................................................................24924. Wege zu besseren Schulen ...................................................................................249Schulentwicklung als evolutionären Prozess verstehen lernen ..............................250Durch geeignete Rahmenbedingungen <strong>die</strong> Entwicklung der Schulen fördern.......252Erziehung als Hilfe zur individuellen Entwicklung <strong>auf</strong>fassen ...............................257Literaturverzeichnis........................................................................................................2605
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTeil IDie Notwendigkeit einer Neuen Schule1. Die Probleme der Alten SchuleEigentlich soll <strong>die</strong> Schule <strong>die</strong> Fähigkeiten der jungen Menschen entwickeln und sie <strong>auf</strong>das Leben als selbstverantwortliche Bürger in einer freien Gesellschaft vorbereiten. DieMädchen und Jungen sollen <strong>die</strong> kulturellen, politischen, wirtschaftlichen, technischenund andere Aspekte des sozialen Lebens verstehen lernen. Sie sollen zunehmend daranteilnehmen und sich dadurch in das gesellschaftliche Leben einfügen und sich dort behaupten.Wird der Erwerb von Kenntnissen über sich und <strong>die</strong> Welt zu einem selbstverständlichenTeil ihres Daseins, dann wollen sie auch lebenslang bewusst lernen. So könnensie ein reiches und erfülltes Leben führen und ihren Beitrag zum Wohl der Allgemeinheitleisten.Das ist in etwa das Bild der allgemeinen Ziele in den feierlich formulierten Einleitungenzu den Lehrplänen. Schaut man sich <strong>die</strong> Pläne jedoch im Einzelnen an, ist so gut wienichts mehr von <strong>die</strong>sen wunderbaren Zielen zu erkennen. Woran liegt es?Die Forderungen der LehrpläneDas Problem der Lehrplanautoren ist, dass sie im Detail bestimmen müssen, durch welcheInhalte Kinder und Jugendliche <strong>auf</strong> das zukünftige Leben vorbereitet werden sollen.Da sind eindeutige Antworten dann nicht mehr so einfach zu geben. Was ist wichtig zuwissen? Wie viel Mathematik, Physik, Geschichte, welche Sprachen, wie viel Grammatikist nötig? Sind Musik und Kunst erforderlich? Sind Faust und Wallenstein zentral fürunsere Kultur? Wie wichtig ist der Parzival? Was lässt sich aus der Beschäftigung mit6
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBrecht, Grass oder Böll gewinnen? Sollen <strong>die</strong> Kreuzzüge heute noch behandelt werden?Welches Wissen brauchen Mädchen und Jungen über Wirtschaft, Recht, Naturschutz,Gesundheit, Ernährung und Sexualität? Welche grundlegenden Werte wie Gerechtigkeit,Wahrhaftigkeit, Toleranz müssen vermittelt werden? Welches Verständnis von Demokratieoder Minderheitenschutz ist unerlässlich? Wie soll <strong>die</strong> Schule mit Religionslehrenumgehen? Man meint, <strong>die</strong> Experten müssten es doch wissen. Aber auch <strong>die</strong> Expertensind sich nicht einig, und ihre Empfehlungen sind selten unabhängig von allgemeinengesellschaftlichen Strömungen. So gehen Experten in Deutschland von uniformen Lehrplänenfür alle Schüler einer Schulform aus, wobei <strong>die</strong> Differenzierung in Schulformenfür unabdingbar gehalten wird. In Schweden dagegen fordern Experten <strong>die</strong> Individualisierungder Lerninhalte nach Fähigkeiten und Interessen der Schüler, wobei dort eineeinheitliche Schulform für alle als selbstverständlich gilt.Heute fordern Experten eine Vorbereitung <strong>auf</strong> <strong>die</strong> „digitale Weltgesellschaft“. NebenInformationstechnologie müssten Inhalte wie Wirtschaft oder Recht den Unterricht stärkerbestimmen. Vor allem aber bräuchten <strong>die</strong> Schüler heute weniger Faktenwissen, sondernWissen, das sie in unterschiedlichen Bereichen anwenden können. Sie sollen sichdarin üben, mit ihren Kenntnissen von heute zukünftige Probleme zu lösen. Darüberhinaus wird <strong>die</strong> Stärkung der Bereitschaft zu lebenslangem Lernen, zu mehr Kreativitätund Innovation, zu Teamfähigkeit und Verantwortlichkeit gefordert 1 Alle <strong>die</strong>se Änderungsvorschlägeresultieren aus einer Unzufriedenheit mit der Schule und ihren Leistungen.212Vgl. beispielsweise <strong>die</strong> Delphi-Befragung 1996/1998: Potentiale und Dimensionen der Wissensgesellschaft– <strong>Auswirkungen</strong> <strong>auf</strong> Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen. Abschlußbericht zum „Bildungs-Delphi“.Bundesministerium für Bildung und Forschung. München 1998.Siehe z.B. <strong>die</strong> aktuelle Timss- sowie <strong>die</strong> Pisa-Stu<strong>die</strong> (Jürgen Baumert u.a. (Hrsg.): TIMSS – Mathematisch-naturwissenschaftlicherUnterricht im internationalen Vergleich. Opladen: Leske & Budrich1997; Jürgen Baumert u.a. (Hrsg.): PISA 2000 – Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülernim internationalen Vergleich. Opladen: Leske & Budrich 2001), deren Ergebnisse ja keineswegs überraschen,da frühere Untersuchungen der Schülerleistungen, auch wenn sie längst nicht in <strong>die</strong>sem Umfangdurchgeführt worden sind, stets ähnlich schlechte Ergebnisse erbracht haben (zur Schuleffektivitätsforschungvgl. z.B. Kurt Aurin (Hg.): Schulvergleich in der Diskussion. Stutgart: Klett-Cotta 1990;Harvey A. Averch, Stephen J. Carroll, Theodore S. Donaldson, Herbert J. Kiesling, John Pincus: HowEffective is Schooling? A Critical review of Research. Englewood Cliffs, New Jersey: EducationalTechnology Publications 1974). Vermutlich werden <strong>die</strong> mangelnden Leistungen der Schule (gemessenam Können der Schüler) kritisiert, seit es Schulen gibt. So verurteilte bereits Confucius das reineAuswendiglernen, das vertane Arbeit sei (Theodore Hsi-en Chen, History of Education. In: EncycolpaediaBritannica 1978, Macropaedia Vol. 6, 320), und Seneca klagte vor zweitausend Jahren in seinenberühmten Briefen „Non vitae, sed scolae discimus“ (nicht fürs Leben, für <strong>die</strong> Schule bloß lerntman). Im L<strong>auf</strong>e der Jahrhunderte wurde der Satz jedoch umgedreht zu dem geflügelten Wort: „Nonscolae, sed vitae discimus“, mit dem man zumeist <strong>die</strong> Pforten der Gymnasien zierte.7
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAber wird es helfen, <strong>die</strong> Lehrpläne zu ändern? Die Lehrpläne forderten auch schon früher<strong>die</strong> Förderung selbständigen Denkens im Unterricht, <strong>die</strong> Kenntnis und den Umgangmit den Arbeitsmethoden verschiedener Disziplinen und <strong>die</strong> Anwendung des Schulwissensim täglichen Leben. Sie forderten auch <strong>die</strong> Erziehung zu Verantwortung, zu Einfühlungsvermögen,moralischem Handeln und viele andere Dinge, <strong>die</strong> durchaus wünschenswertund wertvoll sind. Die meisten der allgemeinen Ziele, <strong>die</strong> heute genannt werden,sind keineswegs so neu, auch wenn Einzelnes sich verändert oder erweitert hat undteils andere Schwerpunkte gesetzt werden.So gesehen sind also nicht <strong>die</strong> Lehrpläne das Problem, sondern das, was der Unterrichtaus ihnen macht. Jedenfalls kommen Pisa- und Timss-Stu<strong>die</strong> zu dem Schluss, dass <strong>die</strong>Ergebnisse letztlich vom Unterricht abhängen. Die Frage ist jedoch, welche Ziele für denUnterricht maßgebend sind. Stehen wirklich Ziele im Vordergrund wie Kreativität, mathematischesVerständnis, Freude an musikalischem und künstlerischem Gestalten, Verantwortlichkeitund all <strong>die</strong> anderen hochwillkommenen Dinge? Sieht man sich <strong>die</strong> Lehrplänegenauer an, gewinnt man unweigerlich den Eindruck, dass allein <strong>die</strong> speziellenInhalte, <strong>die</strong> im Einzelnen festlegen, was zu unterrichten ist, <strong>die</strong> Lehrbücher und denschulischen Alltag prägen. Da ist dann keine Rede mehr von physikalischem Verständnis,sondern da geht es um Bewegung, um Newtonsche Gesetze, um Arbeit, Leistung,Impuls, Rotation, Schwingung, Stoß usw. Auch wenn zwischen Zielen und Inhalten Zusammenhängebestehen, fragt man sich doch, ob Lehrplankommissionen wirklich wissenkönnen, was jeder einzelne Schüler letztlich lernen muss, um so etwas wie physikalischesoder mathematisches Verständnis zu gewinnen.Ungeachtet solcher Bedenken bestimmen <strong>die</strong> Schulbürokratien jedoch nicht nur <strong>die</strong> Inhaltedes Unterrichts, sondern auch, unter welchen Bedingungen <strong>die</strong>se in <strong>die</strong> Köpfe derSchüler zu bringen sind. Will man wissen, warum der durchschnittliche Unterricht ist,wie er ist, darf man <strong>die</strong>se Regelungen nicht außer Acht lassen.Die Vorgaben der SchulbürokratieDie Kultusverwaltungen scheinen keineswegs nur vage Vorstellungen vom Unterricht zuhaben, sondern genau zu wissen, was <strong>die</strong> Schulen zu tun haben. Das entspricht ihrer Positionin dem hierarchischen Verhältnis von Staat und Schule. Per Vorschrift oder Erlassbestimmen Bürokratien den Schulalltag. Fast alles ist geregelt: <strong>die</strong> Altersgruppierung,<strong>die</strong> Anzahl der Schüler pro Klasse, <strong>die</strong> Zahl der Stunden pro Fach und Woche, <strong>die</strong> Artund Anzahl der Klassenarbeiten in jedem Fach, mündliche und schriftliche Notenge-8
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbung, <strong>die</strong> Einrichtung von Arbeitsgruppen, <strong>die</strong> ständige Aufsichtspflicht, Art und Weiseder Ahndung von Disziplinverstößen usw. Die Kultusverwaltungen entscheiden, welcheLehrbücher, Arbeitshefte oder Me<strong>die</strong>npakete für den Unterricht geeignet sind. NurSchulbücher, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Zensur erfolgreich durchl<strong>auf</strong>en haben, dürfen verwendet werden.Sie stellen <strong>die</strong> Lehrer ein und ernennen <strong>die</strong> Schulleiter. Da den Ministerien klar ist, welcheBedeutung der Unterrichtsgestaltung zukommt, ist anzunehmen, dass Lehrplanreformenin Zukunft auch genauere Vorschriften für den Unterricht beinhalten werden.Änderungen der Schule können so per Erlass verfügt werden. Die weisungsgebundenenSchulleiter und Lehrer haben auszuführen, was ihnen <strong>auf</strong>getragen wird. 3Offenbar ist <strong>die</strong> Schulbürokratie überzeugt, über alles erforderliche Wissen zu verfügen,um <strong>die</strong>se Entscheidungen treffen oder zumindest vorformen zu können. Würde manLehrer <strong>auf</strong> Lebenszeit verbeamten, ohne sicher zu sein, <strong>die</strong> besten Kräfte gefunden zuhaben? Würde man Inhalte, Alter und Zahl der Schüler pro Klasse, <strong>die</strong> Zahl der Stundenpro Fach und Woche vorschreiben können, ohne sich über <strong>die</strong> genauen <strong>Auswirkungen</strong>im Klaren zu sein? Würde man Lehrbücher zensieren ohne <strong>die</strong> Sicherheit, <strong>die</strong> am bestengeeigneten herausgefunden zu haben? Aber ist der Schulbürokratie wirklich klar, welcheWirkungen von einem durch ihre Vorschriften bedingten üblichen Stundenplan-Tagesabl<strong>auf</strong> in der Untersekunda ausgehen? Er könnte beispielsweise so aussehen: 1.Stunde: Deutsch, (Blechtrommel); 2. Stunde: Französisch (Candide); 3. Stunde: Politik(Pressefreiheit); 4. Stunde: Englisch (Aktionsarten); 5. Stunde: Mathematik (Tangensfunktionen);6. Stunde: Physik (Dopplersches Gesetz). Welchen Spielraum lässt <strong>die</strong>seZusammenhanglosigkeit für <strong>die</strong> Orientierung an grundlegenden Zielen?Hinzu kommt, dass Vorschriften und Weisungen nur in seltenen Fällen <strong>auf</strong> direktemWege zu den angestrebten Zielen führen. Die Bildungsplaner haben ja nicht mit Schachfigurenzu tun, <strong>die</strong> sie nach Belieben hin- und herschieben können. Die beteiligtenSchulleiter, Lehrer, Kinder und Eltern, aber auch Schulräte haben ihre eigenen Vorstellungenund Auffassungen. Sie sehen zwar <strong>die</strong> äußeren Bedingungen und Anforderungen,aber solange <strong>die</strong>se nicht mit ihren inneren Antrieben und Prinzipien übereinstimmen,nutzen sie <strong>die</strong>se für eigene Ziele. 4 Nicht selten wird eine verbliebene Verantwortung <strong>auf</strong>34Vgl. Peter Vogel: Die bürokratische Schule. Unterricht als Verwaltungshandeln und der pädagogischeAuftrag der Schule. Kastellaun: Henn 1977Vgl. hierzu im Hinblick <strong>auf</strong> politisches Planen und Handeln auch Adam Smith: Theorie der ethischenGefühle (1926, Bd. 2, S.396 bzw. 2. Kap. Abschnitt 2, vorletzter Absatz): Der unbedachte Politikergehe dar<strong>auf</strong> aus, „seinen Plan vollständig und in allen seinen Teilen einzuführen, ohne Rücksicht <strong>auf</strong><strong>die</strong> wichtigen Interessen oder <strong>auf</strong> <strong>die</strong> starken Vorurteile, <strong>die</strong> ihm entgegenstehen mögen. Er scheintsich einzubilden, dass er <strong>die</strong> verschiedenen Glieder einer Gesellschaft mit ebensolcher Leichtigkeitanordnen kann als <strong>die</strong> Hand <strong>die</strong> verschiedenen Figuren <strong>auf</strong> dem Schachbrett anordnet. Er bedenkt9
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT<strong>die</strong> Schulbehörden abgewälzt, indem für unvorhergesehene Fälle weitere Vorschriftengefordert werden. Die Vorschriften können aber auch benutzt werden, um sich gegenpädagogische Anforderungen engagierter Schüler, Eltern oder Kollegen zu immunisieren.Auf der anderen Seite gibt es sicher auch Fälle, in denen Lehrer besondere Projektegegen engherzige Regelungen durchsetzen und dabei von den Schulbehörden unterstütztwerden.Im allgemeinen aber ist in der Schule wie in anderen hierarchisch strukturierten <strong>Institution</strong>ender Glaube stark, dass Ordnung nur von außen oder „von oben“ als bewusste Setzungherbeigeführt und erhalten werden kann, dass ohne eine solche Macht Menschenkaum vernünftig handeln könnten. Das hat zur Folge, dass im Wesentlichen nur das ander Spitze der Hierarchie vorhandene Wissen genutzt wird, wobei <strong>die</strong> Ausführenden denvorgegebenen Rahmen für den jeweiligen Einzelfall zu ergänzen haben. Die Einengungdes Handelns durch <strong>die</strong> Bildungsbürokratie soll vor allem der Willkür Grenzen setzen.Man könnte sich damit beruhigen, dass ja nur das Handeln beschränkt wird, <strong>die</strong> Möglichkeitdes freien Denkens aber erhalten bleibt. Jedoch braucht auch das Denken, dasder Entwicklung der Schule <strong>die</strong>nen soll, <strong>die</strong> Herausforderung durch selbst gewählte Zieleund Handlungsmöglichkeiten. Die Menschen müssen neue Techniken erproben können,um sich den besonderen Tatsachen, Interessen und Umständen anzupassen, <strong>die</strong> fürihr Leben und ihre Tätigkeiten in ihrem jeweiligen Umfeld von Bedeutung sind. Ansonstenwird das bloße Denken leicht unfruchtbar. Es ist kaum verwunderlich, dass <strong>die</strong> interessantestenund vielversprechendsten Anregungen für <strong>die</strong> Schulen auch heute noch vorallem aus der Zeit der Reformpädagogik stammen, <strong>die</strong> so nur wirken konnte, weil für sieauch <strong>die</strong> Freiheit des Handelns bestand. Andere heute wesentliche Einflüsse <strong>auf</strong> das erziehungswissenschaftlicheDenken kommen aus dem Vergleich unterschiedlichen Handelnsin den Schulsystemen verschiedener Nationen.Aus solchen unterschiedlichen schulischen Bedingungen erfahren wir, wodurch guterUnterricht gefördert wird, wie Schulleitung, Lehrer, Schüler und Eltern dazu angeregtwerden können, Schule und Unterricht zu verbessern oder wie <strong>die</strong> Entwicklung einer10nicht, dass <strong>die</strong> Figuren <strong>auf</strong> dem Schachbrett kein anderes Bewegungsprinzip besitzen als jenes, welches<strong>die</strong> Hand ihnen <strong>auf</strong>erlegt, dass aber <strong>auf</strong> dem großen Schachbrett der Gesellschaft jede einzelneFigur ein eigenes Bewegungsprinzip besitzt, das durchaus von demjenigen verschieden ist, welchesder Gesetzgeber nach seinem Gutdünken ihr <strong>auf</strong>erlegen möchte. Wenn <strong>die</strong>se beiden Prinzipien zusammenfallenund in der gleichen Richtung wirken, dann wird das Spiel der menschlichen Gesellschaftleicht und harmonisch vonstatten gehen und wahrscheinlich glücklich und erfolgreich sein.Wenn sie einander entgegengesetzt oder auch nur voneinander abweichend sind, dann wird das Spielsehr schlecht vorwärts gehen und <strong>die</strong> Gesellschaft muss sich dann in höchster Unordnung und Verwirrungbefinden.“ Siehe ferner zum gleichen Problem Friedrich A. von Hayek, Law, Legislation and Liberty.Bd.1: Rules and Order. London and Henley: Routledge & Kegan: 1973, Kap 2, S. 35 ff.
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTSchulkultur begünstig wird, <strong>die</strong> verantwortliches Handeln, Einfühlungsvermögen, künstlerischesGestalten, wirtschaftliches Denken und Handeln fördert. Offenbar brauchenwir unterschiedliche Schulen, in denen <strong>die</strong> Beteiligten frei handeln können, um mehrüber Verbesserungsmöglichkeiten zu erfahren.Der Glaube machtvoller Schulbürokratien, das Wesentliche zu wissen und besser zuwissen als <strong>die</strong>, <strong>die</strong> an ihre Weisungen gebunden sind, erschwert <strong>die</strong> Gewinnung neuerund weiterführender Kenntnisse, beschneidet <strong>die</strong> pädagogische Phantasie, <strong>die</strong> Spontaneitätund das Engagement von Schülern und Lehrern. Die bürokratisch geplante und gesteuerteSchule ist nichts anderes als eine Art Planwirtschaft im Bereich der Bildung. 5 Eswäre ein Wunder, wenn <strong>die</strong> Ergebnisse nicht ebenso fatal wie in Planwirtschaften wären.Was tatsächlich erreicht wirdSeit jeher kommen Untersuchungen von Schulleistungen zu meist enttäuschenden Ergebnissen.Am besten waren <strong>die</strong> Lernerfolge früher in der Grundschule. Das könnte sichmit dem wachsenden Anteil von Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache geänderthaben. Denn offenbar können viele von ihnen in der Grundschule, so wie sie heute ist,nicht angemessen gefördert werden. Nach der Grundschulzeit jedoch gehen Lehrzieleund Lernleistungen immer weiter auseinander. In Physik beispielsweise verlassen <strong>die</strong>Schüler „in ihrer übergroßen Mehrheit“ trotz der umfassenden fachlichen Unterweisung<strong>die</strong> Schule „schlicht als physikalische Analphabeten“. „Keines der gesteckten Ziele wirdauch nur annähernd erreicht. Statt eines fun<strong>die</strong>rten physikalischen Fachwissens findensich allenfalls einige Buch- und Versatzstücke des gelehrten Wissens, einzelne Formelnund Satztrümmer...“ 656Der Soziologe HELMUT SCHELSKY vergleicht den staatlichen Bildungsplan mit der Herrschaft dertotalen Klassenherrschaft durch eine Einpartei (Die Arbeit tun <strong>die</strong> anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaftder Intellektuellen. Opladen: Westdeutscher Verlag 1975, S. 317)GEORG NOLTE-FISCHER: Bildung zum Laien. Zur Soziologie des schulischen Fachunterrichts. Weinheim:Deutscher Stu<strong>die</strong>n Verlag 1989, 288 f. Andere Untersuchungen erbrachten stets ähnliche Ergebnisse;z.B. Walter Schultze: Die Leistungen im naturwissenschaftlichen Unterricht in der Bundesrepublikim internationalen Vergleich. Frankfurt a. M.: Deutsches Institut für Internationale PädagogischeForschung 1974; MARTIN WAGENSCHEIN: Was bleibt unseren Abiturienten vom Physikunterricht?In: Zeitschrift für Pädagogik 6,1960, 29-43; RUDOLF LEHMBERG/ HORST LOCHHAAS/ HERBERTPAGNIA: Vergleichende Physik-Tests mit Schülern und Stu<strong>die</strong>nanfängern. In: Der mathematische undnaturwissenschaftliche Unterricht, 28,1975, 385-390. Lediglich PETER HÄUSSLER stellt fest, dassSchüler mit viel Physikunterricht auch als Erwachsene noch mehr wissen als Schüler mit wenig Physikunterricht(ders: Die Wirkung schulischer und außerschulischer Faktoren <strong>auf</strong> den Stand naturwissenschaftlicherBildung in der Bevölkerung am Beispiel der Physik. In: KURT RIQUARTS, WERNERDIERKS, REINDERS DUIT, GÜNTER EULEFELD, HENNING HAFT, HEINRICH STORK: Naturwissenschaftli-11
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTIn den übrigen Fächern sieht es nicht besser aus 7 . So hält sich in der Gruppe der 15- bis24-jährigen ein Drittel nach einem Unterricht von sechs Jahren oder mehr nicht für fähig,an einer englischsprachigen Unterhaltung teilzunehmen 8 . Auch im Fach Geschichtezeigen <strong>die</strong> „Schüler lediglich ein sehr begrenztes Verstehen des Unterrichtsgebiets. Sieverfügen über fragmentarisches Faktenwissen über vereinzelte Ereignisse..., aber sieverstehen <strong>die</strong> ... Zusammenhänge nicht. ... Vier Wochen nach der Klassenarbeit habenSchüler ... Schwierigkeiten, sich an <strong>die</strong> Fakten zu erinnern, <strong>die</strong> sie gelernt hatten. Nacheinem Jahr ist das Gedächtnisbild sehr verschwommen.“ 9 Literaturstudenten versagendarin, den Inhalt von Gedichten zu entziffern. Vielen fällt es schon sehr schwer, <strong>die</strong> einfacheBedeutung der Sätze zu erkennen, und kaum einer ist in der Lage <strong>die</strong> poetischeAussage zu verstehen. 10In anderen Ländern sind <strong>die</strong> Ergebnisse zwar besser oder schlechter, aber das bedeutetnicht, dass sie irgendwo hervorragend wären 11 . Wie es scheint, ist der durchschnittlicheSchulunterricht kaum irgendwo <strong>auf</strong> der Welt besonders erfolgreich. Und im Grunde genommenweiß das auch jeder ohne Untersuchungen. Wer hat schon gute Sprachkenntnisseoder herausragendes Wissen in Physik und Mathematik, in Musik oder Kunst vorallem in der Schule erworben? Fast immer war bereits vorher ein Interesse vorhanden,und das meiste hat derjenige in seiner Freizeit gelernt. Was ist uns geblieben, wenn wir<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Dinge zurückblicken, <strong>die</strong> man gezwungenermaßen lernen musste? Wer kannnoch etwas anfangen mit den Urstromtälern, mit den Differentialgleichungen, der Berechnungder Fallgeschwindigkeit oder Literaturtheorien? Hauptsache war doch, <strong>die</strong>Prüfungen zu bestehen.7891011che Bildung in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1: Bedingungen und Einflußgrößen naturwissenschaftlich-technischerBildung Kiel: Institut für <strong>die</strong> Pädagogik der Naturwissenschaften an der UniversitätKiel 1990, 59-76Vgl. zusammenfassende Darstellung bei HOWARD GARDNER: The unschooled Mind. How ChildrenThink and How Schools Schould Teach. New York: Basic Books, 1991; deutsch: Der ungeschulteKopf. Wie Kinder denken. Stuttgart: Klett-Cotta 1993, Kap. 8 und 9.DIE ZEIT Nr. 38, 2001, S. 75.Gunilla Svingby: Der Zusammenhang zwischen Schüler<strong>auf</strong>fassungen über bestimmte Begriffe undSchulerfahrungen. In: Tilman Grammes/ Kurt Wicke (Hg.): Die Gesellschaft aus der Schülerperspektive.Schwedische Beiträge zu einer didaktischen Phänomenographie. Hamburg: Krämer 1991, 69-89;hier S. 86 ff. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten in früheren Untersuchungen Egon Becker, SebastianHerkommer und Joachim Bergmann: Erziehung zur Anpassung. Politische Bildung in den Schulen.Eine soziologische Untersuchung. Schwalbach: Wochenschau Verlag 1968 sowie Manfred Teschner:Politik und Gesellschaft im Unterricht. Eine soziologische Analyse der politischen Bildung an hessischenGymnasien. Frankfurt a. M. 1968Vgl. <strong>die</strong> Vielzahl von Stu<strong>die</strong>n, <strong>die</strong> Gardner (1993) Der ungeschulte Kopf, in den Kap. 8 und 9 anführt.Siehe TIMSS- und PISA-Stu<strong>die</strong>12
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTHaben alle <strong>die</strong>se nicht erworbenen und offensichtlich nicht erfolgreich vermittelten Unterrichtsinhaltedas spätere berufliche und gesellschaftliche Leben des einzelnen beeinträchtigt?Ist daraus ein beruflicher oder gesellschaftlicher Schaden entstanden, sofern<strong>die</strong> Zeugnisse insgesamt annehmbar waren? Offenkundig kommt den im Lehrplan vorgesehenenEinsichten und Erkenntnissen doch nicht <strong>die</strong> zumeist angenommene Bedeutungzu. Was <strong>die</strong> Lehrpläne fordern, kann – ausgenommen <strong>die</strong> Kulturtechniken – alsokaum so entscheidend sein, wie behauptet wird. Niemand kann mit Sicherheit wissen,wor<strong>auf</strong> es letztlich ankommt. Heute fordern <strong>die</strong> Experten Problemlösefähigkeit, Teamfähigkeit,Kreativität, Zielstrebigkeit, Eigeninitiative und andere so genannte Schlüsselqualifikationen.Auch <strong>die</strong>se Fähigkeiten können nur in der Auseinandersetzung mit Gegenständenerworben werden. Warum kann das nicht an Gegenständen geschehen, <strong>die</strong>dem einzelnen wichtig sind? In <strong>die</strong>sem Fall könnte Lernen eine Quelle lebenslanger Befriedigungund Freude werden. Und <strong>die</strong>se Freude am Lernen ist schließlich <strong>die</strong> Voraussetzungfür das so viel beschworene lebenslange Lernen.Mit ihrem Unterricht sollte <strong>die</strong> Schule dem einzelnen helfen, einen Platz in der Welt zufinden, sich in seine soziale Umgebung einzubinden sowie Aufgaben und Verantwortungzu übernehmen. Schüler der neunten Klasse scheinen nur sehr wenig Sinn und Nutzenin schulischer Bildung entdecken zu können. Sie erfahren <strong>die</strong> Schule als lebensfernund öde und erhoffen kaum noch, dass es später im Beruf besser werden könnte. 12 Einesolche frühe Resignation wird <strong>die</strong> Bereitschaft zu sozialem Engagement und lebenslangemLernen wohl kaum begünstigen.Tatsächlich bringt der durchschnittliche Unterricht nicht selten negative Einstellungenhervor. Beispielsweise führt der Physikunterricht eher dazu, dass <strong>die</strong> Mehrheit der Schülersich mit dem Gedankengut der Physik nur unter Zwang beschäftigt und kaum Vertrauenin <strong>die</strong> eigene Fähigkeit zum naturwissenschaftlichen Denken entwickelt. Physikgilt als Fach für Spezialisten und naturwissenschaftlich Begabte. 13 Das erzwungene undbewertete Lesen und Besprechen der Werke der großen Dichter scheint <strong>die</strong> Freude anguter Literatur eher zu vergällen. 14 Der Geschichtsunterricht ruft bei gar nicht so weni-12Vgl. Gudrun-Anne Eckerle/ Bernhard Kraak: Selbst- und Weltbilder von Schülern und Lehrern. Rekonstruktionaus einer Befragung an hessischen Gesamtschulen. Göttingen: Hogrefe 1993, S. 13913 vgl. Nolte-Fischer a.a.O. 1989, S. 248-263; Gernot Born/ Manfred Euler: Physik in der Schule. In: Bildder Wissenschaft, 15, 1978,74-8114Vgl. R.W. Beach: Attitude Towards Literature. In: Arieh Lewy (Ed.): The Inernational Encyclopaediaof Curriculum. Oxford: Pergamon 1991; 653-657.13
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTgen Schülern eher Überdruss hervor als Interesse für <strong>die</strong> Vergangenheit. 15 Zudem hatsich <strong>die</strong> Hoffnung der Nachkriegszeit in Deutschland, dass Geschichtsunterricht <strong>auf</strong>klärendund abschreckend <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Übernahme nationalsozialistischen Gedankenguts wirke,nicht bestätigen lassen. 16 Auch <strong>die</strong> Programme der Friedenserziehung, der multikulturellenErziehung, staatsbürgerlichen Erziehung, Sozialerziehung, Drogenerziehung, Sexualerziehung,Umwelterziehung zeitigen selten <strong>die</strong> erwarteten Ergebnisse. Manchmalfördern Moralerziehungsprogramme geradezu das unerwünschte Verhalten. 17 So verwundertes nicht, wenn der Harvard-Pädagoge Howard Gardner <strong>die</strong> Auffassung vertritt,der Besuch der meisten Schulen drohe „heutzutage, <strong>die</strong> Kinder zu verderben.“ Aus denErfahrungen, <strong>die</strong> sie in durchschnittlichen Schulen gewinnen, könnten sie keinen Grunddafür erkennen, warum sie sie überhaupt besuchen sollen. 18Es gibt jedoch nicht nur „durchschnittliche“ und „schlechte“, sondern auch einige „guteSchulen“, worunter wir zunächst Schulen verstehen wollen, <strong>die</strong> jedes einzelne Kind,jeden einzelnen Jugendlichen optimal zu fördern suchen. Viele „gute Schulen“ knüpfenan reformpädagogische Traditionen an, andere sind ganz einfach Schulen, in denen engagierteSchulleiter und Lehrer pädagogische Ideale pflegen und sich um deren Realisierungbemühen. 19 Warum finden wir solche Schulen nur relativ selten? Warum geht vonihnen so wenig Wirkung <strong>auf</strong> durchschnittliche Schulen aus?1516171819Vgl. Ernst Anrich: Leben ohne Geschichtsbewusstsein? Eine Anklage gegen den heutigen Geschichtsunterricht.Tübingen: Grabert 1988; Hans Müller: Zur Effektivität des Geschichtsunterrichts.Schülerverhalten und allgemeiner Lernerfolg durch Gruppenunterricht. Stuttgart: Klett 1972.Vgl. Brigitte Reich/ Wolfgang Stammwitz: Antifaschistische Erziehung in der Bundesrepublik? Vonden Schwierigkeiten einer pädagogischen „Bewältigung“ des Nationalsozialismus. In: Hanns-Fred Rathenow/Norbert H. Weber (Hrsg.): Erziehung nach Auschwitz. Pfaffenweiler: Centaurus 1989, 98-108.Im Überblick Siegfried Uhl: Die Mittel der Moralerziehung und ihre Wirksamkeit. Bad Heilbrunn:Klinkhardt 1996. Als Ergebnis der Analyse einer Vielzahl von Stu<strong>die</strong>n kommt Uhl zu dem Ergebnis:„Ob ein Schüler am Moralunterricht teilgenommen hat oder nicht, ändert an seinen Wertüberzeugungenund am Verhalten in aller Regel wenig oder nichts.“ (S. 56).Gardner a.a.O., 1993, S. 251Vgl. insbesondere <strong>die</strong> im Forum Bildung beschriebenen Schulen (URL: www.forum-bildung.de)14
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT2. Warum es so wenige gute Schulen gibtGute Schulen sind offenbar das Ergebnis besonderen Engagements, außerordentlicherBemühungen und ungewöhnlicher pädagogischer Ideen. Eben das scheint in den Standardschulenweitgehend zu fehlen. Standardschulen entstehen, wenn Schule nicht mehrist als <strong>die</strong> pflichtgemäße Ausführung bürokratischer Vorgaben. Besonders erfolgreicheSchulen beweisen aber, dass es möglich ist, über bloßes Ausführen hinauszugehen, eigeneVorstellungen zu entwickeln und durchzusetzen. Warum ist das aber so selten? Warumgeben wir dem Staat und der Bürokratie <strong>die</strong> Macht, den Unterricht im Übermaß zubestimmen?Der mangelnde Glauben an uns selbst fördert staatliche EingriffeImmer wenn ich Studenten einen Film mit Kindern vorführe, <strong>die</strong> mit großem Enthusiasmusund Engagement selbständig arbeiten und anspruchsvolle Aufgaben lösen, ist<strong>die</strong> Reaktion eine Art misstrauischer Begeisterung. 20 Kann das wirklich sein? Ja, sie wärengerne in eine solche Schule gegangen. Ihre eigenen Kinder würden sie trotzdemnicht dorthin schicken, aus Angst, sie könnten später der „harten Wirklichkeit des Lebens“nicht gewachsen sein. Als wäre <strong>die</strong> heutige Schule <strong>die</strong> beste Vorbereitung <strong>auf</strong> einfreies, eigenständiges Leben, als würde sie Eigenaktivität, Unternehmungslust und <strong>die</strong>Kraft eines freien Geistes fördern. Wer nicht an sich selbst glaubt, ist unsicher undängstlich <strong>auf</strong> seine Interessen begrenzt. Er wird von seinen Wünschen und Ängsten bestimmtund es gelingt ihm kaum darüber hinaus zu gehen. Wer dagegen den Glauben ansich selber hat, kann eher in sich ruhen, mit sich und der Welt im Einklang sein. Er istsich seiner sicherer und nicht voller Spannungen, sein Blick kann frei nach außen gehen,unverstellt von Impulsen, <strong>die</strong> nur das eigene Ich zu schützen oder ihm Vorteile zu verschaffensuchen. Deshalb sieht er auch <strong>die</strong> Probleme und Nöte der andern, fühlt mit ihnenund sucht in seinem Handeln dem Besten Aller zu <strong>die</strong>nen. 21Ein Volk, in dem viele nicht nur an sich selbst, sondern überhaupt an den Möglichkeitendes Einzelnen zweifeln, wird dem Staat bereitwillig ein Übermaß an Macht zugestehen.Denn nur der Staat kann den schwachen Einzelnen schützen und ein Höchstmaß an2021Es handelt sich dabei um den Film „Lob des Fehlers“ von Reinhard Kahl.Vgl. auch Carl R. Rogers: Philosophie der Persönlichkeit. In: ders.: Entwicklung der Persönlichkeit.Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten. Stuttgart: Klett-Cotta 1983. 163-195.15
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTGleichheit gewährleisten. Zugleich aber soll er in gerechter Weise Leistung, Stärke undIntelligenz belohnen und jeden Einzelnen in seinen individuellen Stärken fördern. Diesewiderstreitenden Ziele in Einklang zu bringen und eine effektive Schule zu ihrer Erreichungzu schaffen, betrachten wir als Aufgabe des Staates. Wenn er das nicht leistenkann, lasten wir es der Unfähigkeit seiner Verwaltungen oder den einseitigen Interessender Politiker an. Es scheint uns gar nicht in den Sinn zu kommen, dass nur Einzelne,indem sie über <strong>die</strong> staatlichen Anordnungen hinausgehen, erst <strong>die</strong> von uns gewünschtenaußergewöhnlichen Leistungen hervorbringen können.Mit dem ständigen Ruf nach dem Staat, der <strong>die</strong> Lehrer besser ausbilden und auswählen,<strong>die</strong> Schulen besser ausstatten, lebensnähere Lehrpläne erstellen soll und tausend weiterenForderungen stärken wir <strong>die</strong> gegenwärtigen schulischen Strukturen. Die vielen Forderungennach Eingriffen „von oben“ nähren <strong>die</strong> Schulbürokratie. Beispielsweise wirdimmer wieder der Ruf nach strenger Leistungsbewertung laut. Aber wozu soll sie gutsein? Tatsächlich hilft sie weder guten noch schlechten Schülern. Gute Schüler werdenalleine dadurch keinen Deut besser. Nicht selten konzentrieren sie sich nur umso mehr<strong>auf</strong> ihre Noten als <strong>auf</strong> ein wirkliches Verständnis der Unterrichtsinhalte. Sie werden besondereAnstrengungen sogar eher meiden, weil sie das für <strong>die</strong> Note nicht nötig haben.Die Forderung, schlechten Schülern immer wieder zu sagen, dass sie schwach sind unddaher kaum etwas Vernünftiges aus ihnen werden kann, ist nichts anderes als eine unbedachteGrausamkeit.Die Einstufung einer ganzen Bevölkerung in einer Rangliste mit dem Musterschüler <strong>auf</strong>der obersten Stufe und dem Versager <strong>auf</strong> der untersten soll dazu <strong>die</strong>nen, den jungenMenschen <strong>die</strong> ihrer Leistungsfähigkeit entsprechenden Lebenschancen zuzuweisen. A-ber offensichtlich ist das ein höchst fragwürdiges und <strong>die</strong> Schule unnötig belastendesUnterfangen. Der Soziologe Helmut Schelsky hat bereits in den 50iger Jahren gefordert,<strong>die</strong> Schule von <strong>die</strong>ser Aufgabe zu befreien. 22 Nach wie vor gilt aber gerade <strong>die</strong> Bewertungund Beurteilung der jungen Menschen als zentrale Aufgabe der Schule. Die Zeugnissesind das wichtigste, was wir von der Schule mitnehmen. Kaum jemand denkt daran,was in den Kindern und Jugendlichen vor sich geht, <strong>die</strong> nach Kriterien beurteilt werden,<strong>die</strong> ihnen nicht gerecht werden. Weil wir weder an uns noch an unsere Kinder glauben,überlassen wir es dem Staat, ja fordern es geradezu, dass er alle bewertet und ver-22Helmut Schelsky: Soziologische Bemerkungen zur Rolle der Schule in unserer Gesellschaftsverfassung:Eine Denkschrift. In: ders: Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschaft. Würzburg:Werkbund 1957, 9-50, hier S. 21.16
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTsucht, jedem <strong>die</strong> Chancen zuzuweisen, <strong>die</strong> seinen Fähigkeiten entsprechen und so in <strong>die</strong>Sorge für das zukünftige Wohl unserer Kinder übernimmt.Dessen ungeachtet lässt sich aber auch, und zwar weltweit, ein Trend hin zu mehrSelbstverantwortung beobachten. So mehrt sich <strong>die</strong> Zahl der Bürger, <strong>die</strong> ihre Kinder inalternative Schulen schicken, <strong>die</strong> eine sinnvollere Organisation des Unterrichts fordern,für mehr Rechte der Schulen, Schüler und der Eltern eintreten. Die Schweden habensogar erreicht, dass <strong>die</strong> Schulbürokratie abgeschafft und <strong>die</strong> Gestaltung der Schule weitgehendin <strong>die</strong> Hände der Lehrer, Schüler und Eltern gelegt wurde. 23 Man erkennt, dass<strong>die</strong> verantwortlichen Politiker gar nicht all das Wissen besitzen können, das erforderlichwäre, um <strong>die</strong> Schule von oben her zu reformieren. Denn <strong>die</strong> Beamten können nicht über<strong>die</strong> Kenntnis all der besonderen Tatsachen verfügen, <strong>die</strong> für bestimmte Schulen und derenSchüler zu gewissen Zeitpunkten von Bedeutung sind. Staatliche Instanzen könnendaher <strong>die</strong> Verschiedenheit der Bedingungen nicht beachten. Sie wollen das auch garnicht, weil es ihren Prinzipien der Einheitlichkeit und mechanischen Durchführbarkeitwiderspricht.Der Staat kann jedoch einen Rahmen bereitstellen, in dem <strong>die</strong> Schulen zusammen mitSchülern und Eltern jene Bedingungen erzeugen und ständig neu erschaffen müssen,unter denen <strong>die</strong> jungen Menschen ihre individuellen Fähigkeiten am besten entfaltenkönnen. Aber nur wer an sich glaubt, wird bereit sein, auch an <strong>die</strong> Schüler, Lehrer undEltern zu glauben und ihrem Engagement, ihrem Streben nach Wissen und Verbesserungihres Handelns vertrauen können.Da also weder der Staat noch irgend eine andere Organisation über das erforderlicheWissen verfügen kann, das zur Lenkung des Werdens der jungen Generation erforderlichwäre, wird eine zentrale Steuerung der Schulen immer zu Durchschnittsschulen führen,deren Leistung weit unter denen guter Schulen liegt. Aber auch wenn wir wissen, warum<strong>die</strong> meisten unserer Schulen bloß Durchschnitt sind, bleibt <strong>die</strong> Frage unbeantwortet, warum<strong>die</strong> Leistungen <strong>die</strong>ser Schulen so gering sind.23Vgl. den Artikel von Reinhard Kahl: Die Bürokratie geschlachtet. In: Die Zeit, vom 09.01.2002(URL: www.zeit.de/2001/50/Hochschule/2001/50-pisa-schweden.html)17
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDie übliche Auffassung von Erziehung schwächt <strong>die</strong> Kinder und JugendlichenErziehung wird in aller Regel verstanden als <strong>die</strong> Formung der Persönlichkeit jungerMenschen durch ihre Eltern und Lehrer. Lernen ist dann der Prozess, durch den <strong>die</strong> lehrendeDarbietung in das Wissen des Schülers übergeht. Fortgesetzte Anforderungen anDisziplin, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit sollen sich irgendwie und irgendwannin moralischem Verhalten niederschlagen. Solche Auffassungen drücken <strong>die</strong>Überzeugung aus, der Mensch sei weitgehend das Produkt erzieherischer Einwirkung.Wenn Kinder zappelig oder aggressiv sind, sind <strong>die</strong> Eltern schuld, wer sonst. Für all <strong>die</strong>unerreichten Ziele lassen sich viele Gründe finden: mangelnde Erziehung zu Leistungsbereitschaft,Verwöhnung, zuviel Fernsehen, ungenügender Druck und letztlich natürlichein ungünstiges Erbgut. Das meiste, das mit Kindern und Jugendlichen schief läuft, lässtsich <strong>auf</strong> falsche Erziehung zurückführen. Nicht wenige Psychologen scheinen zu glauben,man wüsste zumindest das Wesentliche über <strong>die</strong> Natur und <strong>die</strong> Entwicklung desKindes und seines Denkens. Die Erziehungswissenschaft meint uns sagen zu können,was Eltern und Lehrer tun müssen, um in den von Natur und Vererbung gesetzten Grenzenanständige, kluge Kinder und Jugendliche hervorzubringen. Das ist <strong>die</strong> wissenschaftlicheStandardmeinung. Aber <strong>die</strong>se Auffassung ist unhaltbar und stellt eine durchnichts zu rechtfertigende Überschätzung unseres Wissens und unserer Möglichkeitendar. Denn Erziehung kann weder <strong>die</strong> Persönlichkeit noch <strong>die</strong> Kenntnisse und <strong>die</strong> Fertigkeiteneines Menschen nach unseren Wünschen konstruieren.Diese Überschätzung der Erziehung bewirkt eher, dass Eltern an sich zweifeln und bereitsind, <strong>die</strong> Erziehung ihrer Kinder in <strong>die</strong> Hände eines anscheinend allwissenden Staates zugeben. Würden <strong>die</strong> Eltern ihrer eigenen Erfahrung und ihren Kindern trauen, kämen sieder Wahrheit vermutlich näher. Denn immer mehr Untersuchungen belegen <strong>die</strong> Annahme,dass Eltern und Schule im Gegensatz zur wissenschaftlichen Standardmeinung nurwenig Einfluss <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder haben. 24 Immer deutlicherwird, dass <strong>die</strong> jungen Menschen ihren Weg letztlich selber finden. Sie beeinflussenund provozieren durch ihr Wesen ihre Eltern und Lehrer und somit letztlich ihre Erziehung.Jedes sucht eine ihm entsprechende Umwelt oder gestaltet sie nach seinen Neigungen.Ein innerer Kompass – sind es <strong>die</strong> Gene? – scheint sie zu leiten. Manche Kindertreibt es zur Beschäftigung mit technischen Dingen, andere fühlen sich am wohlsten bei24Einen Überblick über <strong>die</strong> Literatur findet man bei David C. Rowe: Genetik und Sozialisation. DieGrenzen der Erziehung. Weinheim: Psychologie Verlags Union 1997; Judith R.Harris: The NurtureAssumption. Why Children Turn Out the Way they do. New York: Free Press 199818
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTsportlicher Betätigung oder gehen in ihrer Clique <strong>auf</strong>, und <strong>die</strong> nächsten drängt es, möglichstviel durch Lesen über <strong>die</strong> Welt zu erfahren. Psychologie und Erziehungswissenschaftlernen erst allmählich, was <strong>auf</strong>merksame Eltern immer wussten: dass Kinder vonAnfang an eigene Persönlichkeiten mit eigenem Willen sind und man aus ihnen nichtmachen kann, was man will.Das Problem ist jedoch, dass <strong>die</strong> Erziehungsbehörden und Lehrplankommissionen mehran ihre großen Pläne, ihre erzieherischen Wunschbilder denken, an <strong>die</strong> künftigen Aufgabender Industrie, <strong>die</strong> sie gar nicht kennen, an <strong>die</strong> Anforderungen, <strong>die</strong> an zukünftigeBürger zu stellen sind und was nicht alles. Dass <strong>die</strong> Schüler aber Menschen mit eigenenRechten und eigener Persönlichkeit sind und nicht bloß Rädchen für Wirtschaft und Gesellschaft,wird dabei leicht übersehen.„Ehrfurcht vor der menschlichen Persönlichkeit“ – meinte Bertrand Russell – „ist derWeisheit Anfang in jeder sozialen Frage, vor allem in der Erziehung.“ 25 Aber so wie <strong>die</strong>staatliche Standardschule organisiert ist, bietet sie kaum Freiräume, <strong>die</strong> persönlichenInteressen der Schüler zu berücksichtigen, geschweige denn sie in den Mittelpunkt zustellen. Natürlich sollen <strong>die</strong> Lehrer für den Lehrstoff Interesse wecken. Aber wie sollman 30 Schüler in einer Stunde gleichzeitig für <strong>die</strong> punischen Kriege interessieren, inder nächsten für <strong>die</strong> Braunsche Röhre, hinterher für Kreisfunktionen und schließlich fürRainer Maria Rilkes Stundenbuch? Der eine interessiert sich vielleicht für mathematische,der andere eher für historische Fragen, aber alle für alles? Wenn in der zur Verfügungstehenden Stunde das herauskommen soll, was <strong>die</strong> Lehrpläne fordern, bleibt demLehrer nicht viel anderes übrig als den Gang der Dinge möglichst genau zu bestimmen.Für eigene Gedanken und Wünsche der Schüler bleibt da kaum Zeit. Die Erwartung bestimmterLösungen – <strong>die</strong> Schüler erraten sie in der Regel – und das Denken in vorgegebenenBahnen erstickt <strong>die</strong> Liebe zu geistigen Entdeckungen. Freies Erkunden des Gegenstandesund allmähliches Reifen und Ausarbeiten von Ideen, und damit auch der Persönlichkeit,lässt <strong>die</strong>se Art von Schule kaum zu.Die natürliche Unternehmungslust, <strong>die</strong> sich bei Kindern durch alle <strong>die</strong> Gegenstände anregenlässt, <strong>die</strong> ihrer eigenen Entdeckung Möglichkeiten bieten, wird durch <strong>die</strong> schulischeOrganisation allmählich abgestumpft. Deshalb ist sie im späteren Leben selten, wosie dann dringend gebraucht würde. Der Zwang, im Unterricht immer nur das zu tun,was Lehr- und Stundenplan und ausführende Lehrer gerade zulassen, engt <strong>die</strong> Gedanken25Bertrand Russel: Erziehung ohne Dogma. Pädagogische Schriften. München: Nymphenburger 1974,S. 240.19
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTunnötig ein. Statt mit großen Hoffnungen und Visionen sind <strong>die</strong> Schüler mit kleinlichenÄngsten um Noten beschäftigt oder mit kalkulierenden Überlegungen, welche Anstrengunglohnt. Dagegen würde <strong>die</strong> freie Beschäftigung mit Dingen des eigenen Interessesund freies Denken einen Sinn für Wirklichkeit erzeugen, weil <strong>die</strong>se Gegenstände Ausschnitte<strong>die</strong>ser Wirklichkeit sind und <strong>die</strong> Richtigkeit der gewonnenen Vorstellungenauch nur an der Realität selbst zu prüfen ist. Im üblichen Unterricht dagegen ist dasLehrbuchwissen der Gegenstand und geprüft wird, ob <strong>die</strong> Kenntnisse des Schülers mitLehrsätzen übereinstimmen. Wenn sie dann später im Beruf mit wirklichen Dingen zutun bekommen, reagieren sie nicht selten hilflos.Die derzeitige Ausrichtung der Schule <strong>auf</strong> eine Zukunft, <strong>die</strong> eigentlich keiner kennt, undder dadurch bedingte Vorbereitungscharakter des Unterrichts trennen <strong>die</strong> Kinder undJugendlichen von den Dingen und Fragen, <strong>die</strong> ihnen wichtig sind. Sie lernen vieles, dasihnen später einmal helfen soll, irgendwelche Tätigkeiten auszuüben oder Probleme zulösen. Aber das meiste ist aus ihrer Sicht nutzloses und langweiliges Zeug. 26 Die Lehrplankommissionenüberschätzen sich, denn niemand kann <strong>die</strong> in der Zukunft <strong>auf</strong>tretendenProbleme heute kennen. Deshalb kann auch niemand wirklich wissen, welche besonderenKenntnisse in Zukunft gebraucht werden. Es ist viel klüger, Kinder und Jugendlichean Dingen arbeiten zu lassen, <strong>die</strong> sie interessieren. Denn dadurch entwickelnsie eine Liebe zur Erkenntnis, so dass sie immer <strong>auf</strong>s Neue das Richtige herausfindenund Schwierigkeiten bewältigen wollen. Kann es eine bessere Vorbereitung <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Zukunftgeben? 27Die Einheitlichkeit, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Schule mit all ihren kleinen Vorübungen dem Geist der jungenMenschen <strong>auf</strong>zudrängen sucht, vernichtet dagegen jeden weitgreifenden Ehrgeiz.Der Mechanismus der Standardschule, der alle über den gleichen Kamm schert, wird derVielfalt der Begabungen nicht gerecht. Eine Gesellschaft lebt aber gerade von der reichenVerschiedenartigkeit menschlicher Begabungen. Die Gleichförmigkeit der schulischenBildung behindert <strong>die</strong> Ausbildung und möglichst optimale Nutzung ihrer verborgenenKräfte. Diese sinnlose Vergeudung wird noch gesteigert, weil <strong>die</strong> gleich ausgebildetenjungen Menschen, <strong>die</strong> ihre Interessen und Begabungen nicht kennen, sich später<strong>auf</strong> <strong>die</strong> gleichen Berufe stürzen. 28 Würde <strong>die</strong> Schule <strong>die</strong> Entfaltung der Einzelnen mit262728Vgl. <strong>die</strong> Befragung von Schülern der 9. Klasse an hessischen Gesamtschulen (Eckerle/Kraak a.a.O.1993, S. 139)Vgl. auch John Dewey/ Oscar Handlin / Werner Correll: Reform des Erziehungsdenkens. Eine Einführungin John Deweys Gedanken zur Schulreform. Weinheim: Beltz 1963, S.61Vgl. dazu Untersuchungsergebnisse von Schülern im Berufsvorbereitungsjahr (Spies, W. E./ Elbers,D./ Habel, W./ Heitzer, M./ Hoffmann, J./ Merkel, K.: Das Berufsvorbereitungsjahr in NW. Dortmund1982, S. 91 ff.20
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTihren manchmal großen Bestrebungen unterstützen, hätten <strong>die</strong>se eine großzügigere Vorstellungvon sich selbst. Sie würden mit ihrem speziellen Wissen eine Fülle von Nischenentdecken und selbstbewusst zu nutzen verstehen. Die Gesellschaft würde durch <strong>die</strong>Vielfalt der Kenntnisse und Leistungen bereichert und könnte so ihrerseits dem jugendlichenForscherdrang mehr Anregungen und Gelegenheiten bieten.Solange wir jedoch der Auffassung sind, Geist und Persönlichkeit junger Menschen würdenvon außen und durch unsere lehrenden oder erzieherischen Bemühungen geformt,fehlt uns jede angemessene Vorstellung von dem, was in Kindern und Jugendlichensteckt. Wir unterdrücken unwissentlich ihre Kräfte, indem wir <strong>die</strong> von fernen Ministerienvorgeschriebenen Lehrinhalte zwanghaft in <strong>die</strong> jungen Menschen hineinzupressensuchen. Dabei ist jedes Kind, jeder Jugendliche ein Forscher, ein Erfinder und Entdecker.Sie brauchen lediglich eine Umgebung, <strong>die</strong> entsprechende Anregungen bietet undihnen hilft, <strong>die</strong> verschiedensten Bereiche des Lebens zu erkunden und ihre Interessen zuentwickeln. Die Standardschule bietet <strong>die</strong>se Anregungen nicht, sondern bremst das vorhandeneStreben. Sie will den Willen der Schüler nicht brechen, aber sie stärkt ihn auchnicht. Vielmehr ermüdet sie sie, indem sie <strong>die</strong> Schultage mit einer Vielfalt kleinlicheruninteressanter Aufgaben füllt. Die Schule kümmert sich zwar um <strong>die</strong> Kinder und Jugendlichen,aber doch nicht so, dass sie sie selbst sein dürften. Die Schule zerstört <strong>die</strong>Interessen ihrer Schüler nicht, aber durch den Zwang der Stundenpläne, <strong>die</strong> vorgegebenenLerninhalte, <strong>die</strong> fortwährend erforderlichen Bewertungen und Prüfungen verfügt sieständig über <strong>die</strong> jungen Menschen. Es gibt eine Menge verwickelter Vorschriften füralles, <strong>die</strong> schwer zu durchbrechen sind. Wenn dann im Rahmen eines besonderen Projektes<strong>die</strong> Lust zu selbständigem Handeln und Denken genutzt werden soll, finden wir<strong>die</strong> Fähigkeit eigene Aufgaben zu suchen und den eigenen Interessen nachzugehen, verkümmert.So stumpft <strong>die</strong> Schule – mehr oder weniger bewusst – allmählich den Willender jungen Menschen ab, ermüdet, beugt und lenkt ihn. Das Ganze nennen wir Erziehung,Anpassung an <strong>die</strong> Realität des Lebens. 29Die vorherrschende Didaktik behindert das DenkenDie vorherrschende Didaktik ist das Kind unserer Auffassung von Erziehung. Danachkommt das Wissen von außen in noch mehr oder weniger leeren und unwissenden Köp-29Dieser schulische „Despotismus” gleicht dem, den Alexis de Tocqueville für <strong>die</strong> Zukunft der demokratischenNationen fürchtete (vgl. ders.: Über <strong>die</strong> Demokratie in Amerika. München: Deutscher TaschenbuchVerlag, Buch II, IV. Teil, 6. Kap., S. 812 ff.)21
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTfe. Damit das effektiv geschehen kann, beginnt der Unterricht mit bekannten, einfachenund konkreten Elementen. Dazu kommen dann <strong>die</strong> Regeln, wie <strong>die</strong>se Elemente zu verknüpfensind. Durch immer neue Elemente und deren Verknüpfung versucht der Lehrerdas Wissen der Schüler immer komplexer zu gestalten.Vielleicht erinnern Sie sich noch an <strong>die</strong> Anfänge im Fremdsprachenunterricht. Am Anfangder Stunde stehen meist kleine Geschichten oder Dialoge. Die sind recht einfach zuverstehen. Aber dann kommt nach jeder Lektion <strong>die</strong> Grammatik mit all ihren Ausnahmen,Sonderformen. In jeder Geschichte gibt es neue Vokabeln. Man muss sich merken,welche Substantive männlich, weiblich oder auch sächlich sind. Dann sind da <strong>die</strong> verschiedenenFormen der Verben, Stellung und Funktion bestimmter Wortarten. Es nimmtkein Ende! Alle <strong>die</strong>se Dinge müssen nun beim Sprechen und Schreiben gegenwärtigsein, weil man sonst unweigerlich Fehler macht. Der Sprachunterricht erwartet also, dass<strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong>se anscheinend einfachen Elemente der Sprache behalten und aktiv vonAnfang an korrekt anwenden. Obwohl <strong>die</strong> Lernerfolge gering sind, wird im Allgemeinenimmer noch so vorgegangen. Selbst nach jahrelangem Unterricht ist eine nicht so geringeZahl von Schülern kaum in der Lage, einen anspruchsvollen Text zu verstehen.Offenbar erzielt <strong>die</strong> Methode nicht <strong>die</strong> erwünschten Wirkungen. Die Annahme, es gehebeim Wissenserwerb vor allem um das „Lernen“ von Elementen (Vokabeln) und derenVerknüpfungsregeln (Grammatik) bewährt sich offenbar nicht. Reformpädagogen forderndaher seit langem, das Auswendiglernen abzuschaffen und stattdessen den Verstandder Schüler herauszufordern.Das ist immer noch nicht üblich. Im Sprachunterricht könnte man beispielsweise schonvon Anfang an den Austausch mit Schülern ausländischer Schulen über das Internet anregen.Die Beschäftigung mit der Sprache wird dadurch umfassender, weil <strong>die</strong> Schülerganz unterschiedliche Dinge machen können. Sie beschäftigen sich mit Gegenständen,<strong>die</strong> sie interessieren. Sie entschlüsseln Texte in fremden Sprachen, suchen Informationenim Netz, lernen mit unbekannten Menschen umzugehen. Einige Schüler werden vielleicht<strong>die</strong> Texte ihrer Lieblingssongs erkunden oder sich Filme in fremden Sprachenansehen und davon berichten. Die Vielfalt der Inhalte und des Sprachmaterials, mit demsich der einzelne dadurch auseinandersetzt, wächst mit der Freiheit zur Auswahl derInhalte und der Freiheit, sie eigenständig zu bearbeiten. Wenn Fehler nicht ständig korrigiertwerden, können <strong>die</strong> Schüler unbekümmert dr<strong>auf</strong> los reden und so wirklich Fortschrittemachen. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei weniger <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Grammatik,sondern mehr <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Sachen, <strong>die</strong> man liest oder hört, <strong>die</strong> man verstehen, über <strong>die</strong> man22
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTmehr erfahren möchte. Die Grammatik als integraler Bestandteil der Sprache wird beimHören, Sprechen, Lesen automatisch verwendet. Natürlich unterl<strong>auf</strong>en dabei vor allemanfangs eine Menge Fehler. Aber mit der Zeit entwickelt sich ein Sprachgefühl, d.h. einnicht bewusstes Regelsystem, das <strong>die</strong> intuitive Kontrolle des Sprachflusses übernimmt.Im üblichen Fremdsprachenunterricht werden Sprachen nicht hinreichend gelernt, weil<strong>die</strong> grammatischen Verknüpfungen einer Sprache gerade nicht das Einfache oder Konkretesind. Sie werden vielmehr durch <strong>die</strong> Analyse der Sprache gewonnen, einer Sprachewohlgemerkt, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Schüler noch kaum kennen. Grammatische Funktionen liegen janicht offen zutage, sondern sie müssen erst aus dem Sprachgebrauch erschlossen werden.Eine Sprache über <strong>die</strong> Grammatik zu lernen, bedeutet daher, mit dem Abstrakten,Komplizierten zu beginnen. Schüler, <strong>die</strong> nicht an Sprachanalyse interessiert sind, könnendamit nur wenig anfangen. Für sie handelt es sich um Regeln, um eine Menge sinnloserFakten, <strong>die</strong> sie auswendig lernen müssen. Nach einiger Zeit können sie <strong>die</strong>ses Wissendann nur noch verstümmelt wiedergeben und gewinnen den Eindruck, dass <strong>die</strong> ganzeArbeit sie nicht weiter bringt.Damit Lernen erfolgreich sein kann, müssen <strong>die</strong> Schüler von für sie sinnvollen, alsokomplexen Aufgaben oder Gegenständen ausgehen können. Sie sind das Natürliche, dasNaheliegende, das Einfache. Durch <strong>die</strong> Beschäftigung mit interessanten, komplexenSachverhalten, <strong>die</strong> sie am besten selber finden, erwerben <strong>die</strong> Schüler Kenntnisse über <strong>die</strong>Elemente, aus denen Texte darüber zusammengesetzt sind. Denn <strong>die</strong> Elemente und Regelnsind das Künstliche, Abstrahierte, der Anschauung fern liegende und Komplizierte.Sie werden verständlich, wenn sie als Teile eines Ganzen erkannt, wenn ihre Funktion in<strong>die</strong>sem Ganzen durch Untersuchung erschlossen wird.Nehmen wir als Beispiel den Bereich der Optik. Im normalen Physikunterricht beginntman zunächst mit einfachen optischen Erscheinungen beispielsweise anhand eines Spiegels.Nach kurzer Beschreibung solcher Phänomene stellt der Lehrer Fragen, anhandderen er <strong>die</strong> Gesetze der Reflexion an ebenen und sphärischen Flächen, Reflexionswinkel,Brechungsgesetz, Linsen, Linsenformel usw. eingeführt. Alles das sind Ergebnisse,Fakten. Dahinter aber steht eine Fülle von Überlegungen, <strong>die</strong> von den konkreten Dingenabstrahieren und deren Formulierung <strong>die</strong> frühen Forscher oft Jahre gekostet hat. EineMenge von Hypothesen mussten verworfen werden, bevor man zu <strong>die</strong>sen Gesetzen kam.Diesen Wissenskanon zerlegt man nun in kleine Häppchen und bietet sie im Unterrichtdar. Die Schüler lernen nur <strong>die</strong> Antworten, ohne eigene Fragen gestellt zu haben. IhreAufgabe sehen sie darin, sich <strong>die</strong>se Antworten einzuprägen und Prüfungen damit zu23
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbestreiten. Das Lernen wird so zu einer bewussten Anstrengung. Doch das Ergebniskann kaum mehr sein als eine oberflächliche Kenntnis von Lehrmeinungen. Das eigeneNachdenken, Suchen und Forschen wird unterdrückt. Die Schüler glauben nach einerWeile fast nicht mehr, dass sie in <strong>die</strong>sen Bereichen zu eigenen Ideen in der Lage wären.Bilden sie sich aber keine eigenen Auffassungen – weil weder ihre Lehrer noch sie selbstgenügend Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben – kann das Ergebnis nur etwas Zweitrangigessein. 30Unter günstigeren Umständen würden interessierte Mädchen und Jungen dazu angeregt,selber herauszufinden, was mit dem Licht passiert, wenn es beispielsweise durch einenSpalt in der Tür oder der Jalousie ins Zimmer fällt. Sie würden den Spalt enger oder weitermachen, vielleicht eine künstliche Lichtquelle verwenden, um <strong>die</strong> Wirkungen verschiedenerAnordnungen auszuprobieren. Sie würden sich über ihre „Theorien“ streitenund herausfinden wollen, ob und wie ihre Richtigkeit zu testen wäre. Natürlich würdensie auch <strong>die</strong> Meinung anderer einholen und Bücher konsultieren. Aber all das <strong>die</strong>nte nurdazu, um immer tiefer in das Feld optischer Erscheinungen einzudringen und sich eineigenes Bild zu machen, es immer wieder zu prüfen und zu vervollständigen. Der Gegenstandwürde also im Mittelpunkt stehen. Lernen wäre einfach eine Folge, eine natürlicheBelohnung der Auseinandersetzung mit solchen Phänomenen.Ein entsprechendes Vorgehen ist in der Schule ohne weiteres möglich. Außerdem ist derLernerfolg solcher an das „natürliche“ Lernen angelehnter Verfahren deutlich größer. Sohat Dietmar Herdt einen entsprechenden Lehrgang zur Einführung in <strong>die</strong> elementareOptik entwickelt und überprüft. Die Schüler haben mit <strong>die</strong>sem Lehrgang insgesamt beinahedoppelt so viele Fragen richtig beantworten können wie <strong>die</strong> Schüler im normalenUnterricht. Die Leistungen der schwachen Schüler verbesserten sich so sehr, dass siesogar <strong>die</strong> besten Schüler des Normalunterrichts übertrafen. 31 Offensichtlich sind solcheVerfahren äußerst wirksam. Warum werden sie aber dann in Durchschnittsschulen so gutwie nie angewandt?Zunächst fällt der Verdacht <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Lehrer. Sie seien ungenügend ausgebildet, <strong>die</strong> Prüfungenzu lasch, es werde zu wenig Psychologie und Pädagogik unterrichtet. Außerdemsei <strong>die</strong> Ausbildung zu praxisfern, zu theoretisch, zu wissenschaftlich abgehoben. Die3031Siehe John Dewey: On Education. Selected Writings. Edited and with an Introduction by Reginald D.Archambault. New York: Random House 1964, 392 f.; Helmut Lehner: Erkenntnis durch Irrtum alsLehrmethode. Bochum: Kamp 1979, 88 ff.Vgl. Dietmar Herdt: Einführung in <strong>die</strong> elementare Optik. Vergleichende Untersuchung eines neuenLehrgangs. Essen: Westarp-Wissenschaften 199024
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLehrer würden als kleine Wissenschaftler ausgebildet, statt als Lehrer, <strong>die</strong> doch nurGrundlagen zu unterrichten haben. Solche oberflächlichen und teils widersprüchlichenAnalysen verfehlen <strong>die</strong> wunden Punkte nahezu vollständig. Es ist zwar richtig, dass wirgute Lehrer brauchen, aber gute Lehrer und entsprechende Schulen bedingen sich gegenseitig.Denn bleiben <strong>die</strong> Schulen, wie sie sind, signalisieren <strong>die</strong> Zwänge der Lehrpläne,<strong>die</strong> Vorgaben zum Stundenplan, <strong>die</strong> staatliche Zensur der Lehrbücher und eine Vielzahlanderer Regelungen, dass besondere Bemühungen gar nicht erwünscht sind. Womöglichwürden sie – z.B. bei Lehrproben – sogar das Missfallen der Aufsichtsbehörden hervorrufen.Die übliche Erziehungs<strong>auf</strong>fassung und <strong>die</strong> vorherrschende Didaktik sind gewissermaßenin <strong>die</strong> staatliche Schule eingebaut. Sie stecken in den Lehrplänen, in den detailliertenInhalts- und Stundenvorgaben, in einem Vorschriftenkatalog, der zu wenigRaum für <strong>die</strong> Entwicklung von Alternativen lässt. Auch wenn <strong>die</strong> Lehrer noch besserund länger ausgebildet würden, würden sie sich in der Praxis mehr oder weniger denherrschenden Bedingungen anpassen. Das Problem ist, dass es offenbar unendlichschwer ist, <strong>die</strong> Alte Schule loszulassen.3. Die Alte Schule <strong>auf</strong>geben – aber wie?Wenn man Schule und Erziehung grundlegend verbessern möchte, braucht man Kriteriendafür, was in der Erziehung richtig und falsch oder gut und schlecht ist. Ein solchesKriterium ist aus verschiedenen Gründen allerdings schwierig zu gewinnen.„Richtig“ und „Falsch“ in der Erziehung unterscheidenZunächst hat <strong>die</strong> Wissenschaft mit <strong>die</strong>ser Aufgabe ihre eigenen Probleme. Es wird zwarversucht <strong>die</strong>se Aufgabe zu lösen, aber erstens gibt es widersprüchliche Ansichten überdas, was richtig und falsch in der Erziehung ist und zweitens gilt, dass sich wissenschaftlichprinzipiell keine Aussagen darüber machen lassen, was gut oder schlecht ist und wieman seine Kinder erziehen soll. Die Wissenschaft kann nur untersuchen, was funktioniertund was nicht, welche Folgen und Nebenwirkungen eine bestimmte Erziehung hat,aber <strong>die</strong> Entscheidung darüber, was man tun und als gut und erstrebenswert betrachtensoll, muss jeder selber treffen. Die Wissenschaft kann uns nur über mögliche Kriteriendazu informieren und uns im Rahmen des Wissbaren über <strong>die</strong> jeweils zu erwartendenKonsequenzen <strong>auf</strong>klären.25
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWenn wir wissen möchten, welche Ziele von Schule und Erziehung falsch oder richtigsind, dann lässt sich zumindest ein großer Teil dessen, was wir als falsch bewerten, relativleicht dadurch feststellen, indem wir klären, was wir nicht wollen. Da gibt es beispielsweisegroße Überstimmung darüber, dass eine Erziehung falsch ist, <strong>die</strong> nicht zurEntstehung eines Unrechtsbewusstseins führt oder <strong>die</strong> moralische Verwahrlosung oderpolitischen Extremismus u.ä. begünstigt. Unser Urteil lässt sich dadurch begründen, dass<strong>die</strong>se Dinge in jeder Gesellschaft von Schaden sind. Aber eigentlich beruht unser Urteil<strong>auf</strong> einem Gefühl oder einem gefühlsmäßigen Maßstab von Richtig und Falsch. So empfindenes <strong>die</strong> meisten von uns auch als falsch, wenn Menschen zu etwas gezwungen werden,was sie aus sich selbst heraus nicht wollen oder das ihren inneren Bestrebungenzuwiderläuft. Ebenso erscheint uns alles das als falsch, durch das Menschen unterdrückt,verletzt oder grundlegend verunsichert werden. Es wäre durchaus sinnvoll, <strong>die</strong>se Grundsätzeauch <strong>auf</strong> Erziehung und Schule anzuwenden, man tut es nur nicht. Immerhin hat<strong>die</strong> klassische Reformpädagogik gezeigt, welche positiven Folgen <strong>die</strong> Anwendung solcherGrundsätze zeitigen kann.Die große Reformpädagogin MARIA MONTESSORI (1976, .S. 11 ff) hat stets danach gefragt,wo wir Kinder und Jugendliche bewusst oder unbewusst unterdrücken. 32 „Jeder“,beobachtet sie, „unterbricht sie ohne jede Rücksichtnahme, ohne jeden Respekt.“(1976,S. 29). Sie hat versucht, sich in <strong>die</strong> Kinder und ihre Situation einzufühlen. Aus <strong>die</strong>serEinfühlung heraus empfindet sie das Stillsitzen in der Schule, das heute freilich nichtmehr mit den drastischen Mitteln der Vergangenheit eingefordert wird, als „Tortur“ undals „erbarmungslose Quälerei“ (MONTESSORI 1976, S. 58). Schulen, in denen Kinder undJugendliche den ganzen oder halben Tag „sitzen und langweilige Tatsachen und Erklärungenanhören und auswendig lernen müssen“ bezeichnet sie als „Totenhäuser für denGeist des Menschen; <strong>die</strong>se Kinder werden tote, verstümmelte Geister haben“ (MONTES-SORI 1979, S. 64). Oder sie spricht von der Schule als einem „Gefängnis … ohne Anregungen“(ebenda S. 98). Sie bedauert <strong>die</strong> Jugendlichen: „... in der Schule, zu Hause,immer geführt, immer komman<strong>die</strong>rt, immer überwacht in ihren erzwungenen Arbeiten“(ebenda S.112). Die ständige Leistungsbewertung verletze <strong>die</strong> jungen Menschen underzeuge Minderwertigkeitskomplexe. Zuerst komme „<strong>die</strong> Beleidigung“ durch Anforderungen,<strong>die</strong> dem Einzelnen nicht gerecht werden, „und dann <strong>die</strong> Angst. Dies ist <strong>die</strong> Weiseder Unterjochung“ (ebenda S. 115).32Sie hat dabei insbesondere auch <strong>die</strong> vielen leichteren „Formen von Unterdrückung, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> dem Kindlasten“, in den Blick genommen. Montessori 1976, S. 26, es ist jedoch das gesamte Kapitel <strong>die</strong>semThema gewidmet, ab S. 11 ff26
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTNach MONTESSORIS Auffassung leben Kinder „in einer Welt ihrer eigenen Interessen,und das Werk, das sie dort verrichten, muß respektiert werden Denn obwohl viele kindlicheAktivitäten Erwachsenen zwecklos scheinen mögen, benutzt sie <strong>die</strong> Schöpfung zuihren eigenen Zielen. Sie baut Geist und Charakter ebenso <strong>auf</strong> wie Knochen und Muskeln.“(ebenda S. 14). Aus <strong>die</strong>ser Einstellung heraus bittet sie uns, Kinder und Jugendlicheals werdende große Maler, Mathematiker, Schriftsteller usw. zu verstehen. Wennwir sie, wie <strong>die</strong> Schule das tut, immerzu nach den Vorgaben irgendeines Plans lenkenund hin- und herschieben, kommen sie mit Sicherheit nie zu den großen von ihnen erwartetenErgebnissen. Beim Kind sei <strong>die</strong> Folge, dass es sich selbst verliert, weil seineArbeit ja <strong>die</strong> Entfaltung seiner selbst ist. Eine Folgerung, <strong>die</strong> im Übrigen gut mit demErgebnis übereinstimmt, dass Jugendliche, <strong>die</strong> sich in ihrer Selbsteinschätzung unsichersind, <strong>die</strong> ihre Interessen nicht gut kennen und ein geringes Selbstwertgefühl <strong>auf</strong>weisen,auch bei ihrer Berufswahl eine entsprechende Unsicherheit zeigen (PRAGER/WIELAND2005, S. 7f.).Diese Erörterung negativer Kriterien kann uns den Weg zu weisen zu den positiven Kriterien,<strong>die</strong> sich ebenso wie <strong>die</strong> negativen verwenden lassen, um Formen von Erziehungund Schule zu bewerten. In der Reformpädagogik versuchte man immer vom Kind auszugehen. Wie beim Erwachsenen geht es auch beim Kind um <strong>die</strong> Befriedigung seinerBedürfnisse, <strong>die</strong> Vermeidung von Leiden, <strong>die</strong> Harmonisierung seiner Bestrebungen undHandlungen oder <strong>die</strong> Zunahme an Wissen und Verständnis. Wenn wir von <strong>die</strong>sen Kriterienausgehen, können wir auch <strong>die</strong> Vorstellungen MONTESSORIS besser nachvollziehen.Nun ist klar, dass <strong>die</strong> Wissenschaft solche oberste Kriterien für Erziehung und Schulekeinesfalls verbindlich festlegen kann. Es geht hier aber ja nur darum, <strong>die</strong> Kriterien zufinden, <strong>die</strong> mit unseren höchsten Bestrebungen übereinstimmen und von daher dann untersuchenzu können, was geschehen würde, wenn wir <strong>die</strong>se Kriterien tatsächlich unseremHandeln in Erziehung und Schule anwenden würden. Das ist ein wissenschaftlichdurchführbares Programm, ein Programm, das uns Hilfen für <strong>die</strong> Verbesserung vonSchule geben kann.Denn <strong>die</strong> Erziehungswissenschaft würde uns dann darüber zu informieren suchen, welcheKonsequenzen zu erwarten sind, wenn wir von anderen Bedingungen ausgehen alsdenen, <strong>die</strong> wir zur Genüge kennen. Wenn Wissenschaft sinnvoll beraten soll, werdenihre Beiträge dann den größten Wert haben, wenn sie das untersucht, was nicht ist oderzumindest nicht üblich ist. D.h. indem sie hypothetische Modelle von Erziehungsbedingungenkonstruiert, <strong>die</strong> man schaffen könnte, wenn einige änderbare, also in unserer27
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTMacht liegende Umstände anders gestaltet würden. Eine der wichtigsten Aufgaben derErziehungswissenschaft ist es mithin, über <strong>die</strong> Wirkungen <strong>auf</strong>zuklären, <strong>die</strong> solche Änderungennach sich ziehen würden (vgl. v. HAYEK 1973, Vol. I, S. 16 f.).Die alte Schule mit all ihren Problemen wird weiter bestehen, wenn wir nicht nachneuen Wegen suchen. Diese neuen Wege können wir aber nicht finden, solange wir keineKriterien dafür haben, was an der Schule gut und was an ihr schlecht ist.Veränderungspotenziale erkennenIn heutigen Schulen wird sehr viel über Disziplinlosigkeit und Lernunlust geklagt. DieseProbleme sind alt und hängen mit der Organisation und den Zielen der Schule zusammen,<strong>die</strong> eben in vielen Dingen den oben genannten Kriterien widersprechen.Disziplinlosigkeit entsteht nach MONTESSORI, wenn <strong>die</strong> spontanen Kräfte des Wachstumsim Kind und im Jugendlichen gehemmt werden. Wenn <strong>die</strong>se „Kräfte der psychischenPersönlichkeit“ unterdrückt werden und <strong>die</strong> Kinder nicht <strong>die</strong> Aktivität entfaltenkönnen, „welche <strong>die</strong> Natur von der menschlichen Persönlichkeit verlangt, damit sie sichgut entwickelt“, entstehen eben jene „ungeordneten seelischen Bewegungen“, <strong>die</strong> manDisziplinlosigkeit, Gewaltbereitschaft, Vandalismus, Mobbing usw. nennt. AngehendeLehrer oder Erziehende denken meist, dass <strong>die</strong>se Probleme durch Freundlichkeit odergute Behandlung abgestellt werden könnten. Aber <strong>die</strong> Erfahrung zeigt, dass das nicht derFall ist.Der „einzige Weg zum Erfolg“ liegt nach MONTESSORI darin, „<strong>die</strong>se Kinder in eine Umgebungzu bringen, welche ihre schöpferische Aktivität nicht hemmt.“ Der Versuch, ihrVerhalten zu korrigieren, führe in <strong>die</strong> Irre. Die Schwierigkeit dabei ist nämlich, dass wirim Einzelnen gar nicht wissen können, was und wie der Geist der Kinder verändert werdenmuss und kann. Wenn man ihnen aber ein normales Leben ermöglicht, in dem manihnen eine geordnete und anregende Umwelt bietet, in der sie körperlich und geistig freiagieren können, dann gesunden sie. Sie brauchen Freiheit, um sich „von der beständigenLeitung durch Erwachsene“ zu erholen. Nicht <strong>die</strong> Korrektur des Verhaltens und des Individuumsist nötig, sondern <strong>die</strong> Vorbereitung <strong>auf</strong> ein selbständig zu führendes Leben,wor<strong>auf</strong> Menschen angelegt sind (MONTESSORI, 1979 S. 99) 33 . Wenn aber selbst „Freiheit33Es gibt im Übrigen zahlreiche praktische Erfahrungen in Schulen, <strong>die</strong> zeigen, dass jede Methode, <strong>die</strong>auch nur ein Stück weit in <strong>die</strong>se Richtung des Umgangs mit undisziplinierten Kindern geht, außergewöhnlicheErfolge zu verzeichnen hat (vgl. dazu LEHNER 1991).28
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTund eine gute Umgebung“ <strong>die</strong> Kinder nicht von der Disziplinlosigkeit heilen, ist ihr inneresWachstum vermutlich schon über zu lange Zeit und von klein <strong>auf</strong> unterdrückt undverstümmelt worden. In einem solchen Fall „müssen Sie Gott bitten, Ihnen zu helfen“.Denn dann brauche es ein Wunder, und <strong>auf</strong> ein solches müsse man geduldig warten, bises eintrete (MONTESSORI S. 100).Das Arbeitsverhalten steht in engem Zusammenhang mit der Disziplin. Da Schule nachverbreiteter Auffassung der Vorbereitung <strong>auf</strong> den Beruf und damit der Sicherung desLebensunterhalts <strong>die</strong>nt, sind <strong>die</strong> Schüler gezwungen zu lernen, um bei Prüfungen möglichstgute Noten zu erhalten, weiterführende Schulen besuchen zu können, zu einemStu<strong>die</strong>nfach mit guten Berufschancen und hohen Einkommenserwartungen zugelassenzu werden usw. Dieser das gesamte Schulleben umfassende Zwang verhindert geradezujedes besondere Engagement und erschwert dadurch <strong>die</strong> Entfaltung von Interessen. DerSchüler ist wie jemand, der nur aus dem Grund arbeitet, um damit seinen Lebensunterhaltzu sichern. Da sind weder großartige Ergebnisse zu erwarten noch kann der Menschsich <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise entfalten.Arbeitsfreude entsteht durch <strong>die</strong> gleichen Bedingungen, unter denen Disziplin entsteht:Freiheit und eine anregende Umgebung, in der <strong>die</strong> Schüler sich selbst für ihre Arbeitentscheiden und ihre Ausführung bestimmen können. In <strong>die</strong>sem Prozess wenden sich <strong>die</strong>Schüler immer komplexeren Gegenständen zu, weil sie aus eigenem Antrieb danachstreben ihren Geist zu vervollkommnen. „Wenn <strong>die</strong> Arbeit aus einer inneren Quellekommt, dann … ergibt sich ein größerer Fortschritt.“ Dann gibt es keine Müdigkeit undFaulheit, „und der Mensch vervielfacht seine Energien in einer außerordentlichen Weise“(MONTESSORI 1979, S. 105 ff.).Die staatliche Einmischung zurückdrängenWenn es um Schule geht, denken <strong>die</strong> meisten, der Staat müsse etwas tun. Erziehungwird nahezu allgemein als ein Werkzeug des Staates verstanden, um den Nachwuchs <strong>auf</strong><strong>die</strong> Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft vorzubereiten. Solange aber derStaat <strong>die</strong> Erziehung dirigiert, wird eine grundlegende Reform nicht möglich sein. Dennder Staat ist ein Verwaltungsmechanismus. Er arbeitet mit Regeln und Anweisungen, <strong>die</strong>von Leuten geschaffen werden, <strong>die</strong> kein Wissen über <strong>die</strong> einzelnen Schüler mit ihrenbesonderen Fähigkeiten und Problemen haben können. Diese prinzipielle Unkenntnismacht eine staatliche Erziehung unfähig <strong>auf</strong> <strong>die</strong> individuellen Besonderheiten einzelnerSchüler einzugehen und ihnen dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Die aus29
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTprinzipieller Unkenntnis und Unfähigkeit entspringende Härte und Gefühllosigkeit wirdfälschlicherweise oft als Stärke gedeutet. Wenn es also ein Potential für eine Entwicklungder Schule gibt, dann kann es jedenfalls nicht beim Staat oder bei Schulbehörden zufinden sein.Das Ziel der staatlichen Schule ist Wissensvermittlung und Sortierung der Schüler nachLeistungsfähigkeit. Es ist viel weniger das Ziel, dem Einzelnen dabei zu helfen, seinindividuelles Potential zu entdecken und in der Gemeinschaft mit anderen zu entfalten.Auch wenn sich Lehrer ernsthaft darum bemühen, müssen sie sich doch im Wesentlichendar<strong>auf</strong> konzentrieren, den Schülern <strong>die</strong> in den Bildungsstandards gefordertenKenntnisse und Fertigkeiten beizubringen und sie im Hinblick <strong>auf</strong> ihre Geschicklichkeitdabei in Ränge sortieren. Auch wenn Lehrer dagegen ankämpfen, ist es unter <strong>die</strong>senBedingungen nicht leicht für sie, dem einzelnen Schüler gerecht zu werden.Vielen Kindern und Jugendlichen gelingt es, <strong>die</strong> Beachtung und Förderung, <strong>die</strong> sie in derSchule nicht erhalten, in der Familie und im Freundeskreis zu kompensieren. Diejenigenjedoch, <strong>die</strong> sich weder in der Schule noch im Elternhaus verstanden fühlen, können oftnur wenige angemessene Handlungsmöglichkeiten für sich entdecken. Offenbar betrifft<strong>die</strong>s fast ein Viertel der Jugend. Aber auch in einem großen Teil der restlichen Familiensind <strong>die</strong> Bedingungen keineswegs als gut zu bezeichnen; sie sind nur in vielen Fällennicht ganz so ungünstig (vgl. Stecher/Dröge 1996, S. 345) 34 .Nehmen wir <strong>die</strong> 25 % der Schüler, <strong>die</strong> in der Schule, so wie sie organisiert ist, einfachnicht oder mehr schlecht als recht mitkommen. Wer das Lesen, Schreiben und Rechnennur unzureichend lernt und nur einen verkümmerten sprachlichen Ausdruck entwickelt,hat nicht nur später wenig Chancen, sondern ist überhaupt durch seine unentwickeltengeistigen und emotionalen Kräfte in seinen alltäglichen Lebensäußerungen beeinträchtigt(HÖHN 1980). So ist es nicht verwunderlich, wenn <strong>die</strong>sen Schülern der Optimismusfehlt, wenn sie sich zur Gesellschaft und ihren <strong>Institution</strong>en apathisch oder misstrauischverhalten, wenn sie ihr und das Leben und Lernen anderer durch alle möglichen Aktionenschwer machen und der Allgemeinheit zur Last fallen oder versuchen, sich rücksichtslosdurchzusetzen, weil sie das Gefühl haben, dass niemand sich um sie küm-34Ein entsprechendes Ergebnis zeigte sich übrigens auch in der Pisa-Stu<strong>die</strong> (Baumert u.a. 2001). Danachkönnen über 26% der 15-jährigen in Deutschland nur <strong>auf</strong> einem elementaren Niveau lesen, d.h. sieweisen deutliche Schwächen bei Aufgaben <strong>auf</strong>, <strong>die</strong> das Reflektieren und Bewerten von Texten erfordern.30
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTmert. 35 Auch viele Eltern sind beunruhigt durch <strong>die</strong> <strong>die</strong> Unfähigkeit der öffentlichenSchule, den Kindern gerecht zu werden, durch ihr Unvermögen, Interesse und Engagementzu wecken, zum Lernen und zur Bewältigung von Schwierigkeiten mit sich undanderen anzuregen.Wenn es uns um mehr als nur um <strong>die</strong> so oft als Ziel der Erziehung beschworene „Reproduktionder Gesellschaft“ geht, also den bloßen Erhalt des Gegebenen, dann dürfen wir<strong>die</strong> Kinder nicht länger in schulische Schemata pressen und den Maßstäben einer Autoritätunterwerfen, <strong>die</strong> nichts vom Einzelnen weiß, sondern müssen das im einzelnen Kindund Jugendlichen liegende Potential fördern. Das ist auch <strong>die</strong> ursprüngliche Bedeutungdes Wortes Erziehung. Denn Erziehung meint nicht ziehen oder formen, so wie manKnetmasse zieht und formt, sondern etwas herausziehen, etwas Verborgenes, Inneres,Latentes ans Licht bringen. Die Möglichkeiten des Einzelnen können wir nicht sehenoder messen. Es ist das, was nur der Einzelne selber leisten und unter dazu geeignetenUmständen hervorbringen kann und was seine besondere Aufgabe ist. Denn wozu sonstkönnten wir geboren sein, als dazu, unsere Möglichkeiten in der für uns und andere bestenund förderlichsten Weise zu entfalten und unsere Welt mitzugestalten?Jeder Einzelne kann etwas beitragen, etwas, das nur er kann. Eben das macht seinenWert auch für <strong>die</strong> Gesellschaft aus. Dieser Wert des Einzelnen wird schwerlich verwirklichtwerden können, wenn unser Hauptziel darin besteht, ihn den Anforderungen derGesellschaft anzupassen. Wenn wir <strong>die</strong> Schule zu einer Rennbahn machen, <strong>auf</strong> der esvor allem dar<strong>auf</strong> ankommt, sich durchzusetzen und Erfolg zu haben, koste es was eswolle, müssen wir <strong>die</strong> Folgen tragen. Denn wenn es keinen Raum für individuelle Entfaltunggibt, werden viele unter den Zwängen verkümmern, sich ins Private zurückziehenund statt Engagement nur eine laue Mitarbeit und mittelmäßige, statt guter Leistungenerbringen.Leistungen sind wichtig, aber sie entstehen dadurch, dass wir uns um den Einzelnen ansich und in der Gruppe kümmern und ihn in seinen individuellen und sozialen Möglichkeitenfördern. Das bedeutet, dass wir ihm zu Selbsterkenntnis verhelfen, dass er seineFähigkeiten und schöpferischen Kräfte entdeckt, dass er Impulse, Ängste, Antriebe ausseinem Inneren erkennt, mit ihnen umgehen lernt und sich als Teil eines kosmischen undsozialen Ganzen erfährt, in das einzufügen er lernt, wenn man ihn unterstützt, seineneigenen Weg zu finden.35Zur Jugendproblematik in der Bundesrepublik Deutschland vgl. z.B. Hurrelmann, Heitmeyer, Pfeiffer,Eckert, Zinnecker 1998: Zukunftsinvestition Jugend, sowie Silbereisen, Vaskovics, Zinnecker 1996:Jungsein in Deutschland.31
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDie alte Schule tut alles das nicht, und sie schadet damit nicht nur den Kindern und Jugendlichen,sondern der auch der Gesellschaft, was aber schon aus reinem Selbstschutznicht wahrgenommen wird. Indem wir uns weigern zu sehen, was <strong>die</strong> Schule jungenMenschen antut, können wir bedenkenlos weitermachen, wir brauchen nichts zu ändern.Die Überschätzung unseres objektiven und <strong>die</strong> Vernachlässigung unseressubjektiven Wissens <strong>auf</strong>gebenDie Schulbürokratie hat ganz bestimmte Vorstellungen vom Unterricht. Sie weiß genau,was <strong>die</strong> Schulen tun müssen. Das entspricht ihrer Position in dem hierarchischen Verhältnisvon Staat und Schule. Per Vorschrift oder Erlass bestimmen Bürokratien denSchulalltag. Fast alles ist geregelt: <strong>die</strong> Altersgruppierung, <strong>die</strong> Anzahl der Schüler proKlasse, <strong>die</strong> Zahl der Stunden pro Fach und Woche, <strong>die</strong> Art und Anzahl der Klassenarbeitenin jedem Fach, mündliche und schriftliche Notengebung, <strong>die</strong> Einrichtung von Arbeitsgruppen,<strong>die</strong> ständige Aufsichtspflicht, Art und Weise der Ahndung von Disziplinverstößenusw. Die Kultusverwaltungen entscheiden, welche Lehrbücher, Arbeitshefteoder Me<strong>die</strong>npakete für den Unterricht geeignet sind. Nur Schulbücher, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Zensurerfolgreich durchl<strong>auf</strong>en haben, dürfen verwendet werden. Sie stellen <strong>die</strong> Lehrer ein undernennen <strong>die</strong> Schulleiter. Änderungen können so per Erlass verfügt werden. Die weisungsgebundenenSchulleiter und Lehrer haben auszuführen, was ihnen <strong>auf</strong>getragenwird (VOGEL 1977).Inzwischen haben Grund- und Hauptschulen zwar sehr viel mehr Freiheit, aber <strong>die</strong> altenGewohnheiten und Erwartungen sitzen tief bei allen Beteiligten. Weder Lehrer nochEltern und Schüler können sich Schule anders vorstellen als sie im Moment eben ist.Es ist leicht zu verstehen, dass in einem Plan-Schulsystem Skepsis gegenüber einer Reformpädagogika la MONTESSORI besteht. Es passt einfach nicht ins Schema <strong>die</strong>ses Denkens,wenn jeder Schüler nach seinem eigenen Plan arbeitet statt im Gleichschritt belehrtzu werden. Es passt auch nicht in das gesamt-planerische Denken, wenn <strong>die</strong> Schülernicht nach einem einheitlichen Maßstab bewertet und entsprechend ihrer Noten sortiertwerden – denn in Montessorischulen gibt es in der Regel keine Noten und auch keinenVergleich der Schüler. Da wird sofort unterstellt, Leistungen würden hier wohl nicht soernst genommen. Man vermutet sofort sozialromantische Spinnereien, denn ohne einefrühe Gewöhnung an Leistungserbringung und Leistungskontrolle befürchten nicht nurBildungspolitiker und Lehrer, sondern auch viele Eltern, <strong>die</strong> Kinder könnten sich dann32
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTspäter nicht durchsetzen und würden untergehen. Da wir nun einmal in einer Leistungsgesellschaftlebten, müssten wir uns ihr auch so früh wie möglich an sie anpassen.Das mag einleuchtend klingen. Schaut man sich Montessori- und andere Reformschulenaber genauer an, ist man überrascht, dass <strong>die</strong> Leistungen dort nicht etwa geringer, sondernmeist sogar deutlich höher ausfallen. Und vor allem gewinnen <strong>die</strong> Schüler eher Einsichtin <strong>die</strong> Zusammenhänge, d.h. sie verstehen mehr. Dennoch bleibt <strong>die</strong> Furcht, <strong>die</strong>Kinder könnten ohne harte Anforderungen zu weich werden und später versagen. Manverwechselt Härte mit Stärke und übersieht dabei, dass Härte <strong>die</strong> Kinder und Jugendlichenja darin hemmt, ihre Anlagen zur Entfaltung zu bringen. Solange aber unsere Vorstellungenund Erwartungen hinsichtlich dessen, was Schule letztlich für <strong>die</strong> Schülerleisten soll so dem herkömmlichen Denken über Erziehung und Schule verhaftet sind,können Reformen nicht flächendeckend erfolgen.Warum haben nun aber auch Erziehungswissenschaftler, <strong>die</strong> in der Reformpädagogikentstandenen Ideen entweder gar nicht oder nur sehr zögerlich <strong>auf</strong>gegriffen? Was ist amDenken der Reformpädagogen so anders, dass es so schwer fällt, sich dar<strong>auf</strong> einzulassen?Als erstes gehen Reformpädagogen von relativ globalen Vorstellungen von Schule undErziehung aus. Einzelne Handlungen, Maßnahmen oder Methoden werden stets im Rahmen<strong>die</strong>ses Gesamten betrachtet. Die allgemeinen Vorstellungen beruhen zu einem gutenTeil <strong>auf</strong> Annahmen, <strong>die</strong> sich rational nur begrenzt rechtfertigen lassen, wie etwa <strong>die</strong>Annahme, dass jeder Mensch von Anfang an einen „inneren Führer“ bzw. eine „innereFührung“ hat oder <strong>die</strong> Annahme, dass jeder ein nur ihm eigenes Potenzial besitzt, das er<strong>auf</strong> eine ihm eigene Weise zu entwickeln hat. Solche Annahmen sind nicht einfach intuitivgewonnen, sondern beruhen <strong>auf</strong> einem inneren Wissen, das <strong>die</strong> meisten von uns mehroder weniger teilen. Aber <strong>die</strong> Verwendung solchen „Wissens“ erscheint uns im Zusammenhangwissenschaftlicher Arbeiten suspekt, weil <strong>die</strong>ses „Wissen“ zunächst nicht rationalbegründbar erscheint (vgl. v. HAYEK, LLL, Vol 1, 1973, S. 10).MONTESSORI geht von Voraussetzungen aus, <strong>die</strong> zunächst nur durch eine Innenschau zugewinnen sind, etwa wie in folgendem Gedankengang: „Ich habe den unabweisbarenEindruck, dass mein Leben und Tun von innen her geleitet ist, einen inneren Führer hat.Das Ziel <strong>die</strong>ses inneren Führers ist <strong>auf</strong> geistiges Wachstum in der Welt und eine umfassendeVollendung hin ausgerichtet. Dieses Empfinden hatte ich bereits als Kind. Ichnehme deshalb an, dass alle Menschen von Geburt an oder auch schon vorher, über eineinnere Führung verfügen.“ Diese Auffassung, <strong>die</strong> von MONTESSORI mit Erkenntnissen33
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTder Biologie untermauert wird, wendet sie <strong>auf</strong> Kindergarten und Schule an, und zwarnach etwa folgendem Gedankengang: „Wenn <strong>die</strong> Kinder <strong>die</strong>sen inneren Führer haben,wie müssen sie sich dann in der herkömmlichen Schule fühlen, wie müssen sie <strong>die</strong>Handlungen und Einstellungen der Lehrer zu ihnen verstehen und wie wird ihre geistigeTätigkeit unter <strong>die</strong>sen Bedingungen sein?“ Montessori geht also emphatisch vor, siefühlt sich in <strong>die</strong> Umgebung und <strong>die</strong> Beteiligten ein und beurteilt <strong>die</strong> Situation in <strong>die</strong>semSinn von innen her.Auch <strong>die</strong> Frage, wie <strong>die</strong> Bedingungen der Umgebung zu ändern wären, damit das Kind,geleitet von seinem „inneren Führer“ seine Arbeit in optimaler Weise ausführen kann,geht von innen aus. Sie kann dann ausgiebig durch Beobachtung herausfinden, wie sich<strong>die</strong> veränderten Bedingungen <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Kinder, <strong>auf</strong> ihr geistiges Wachstum, ihre Disziplin,ihre Leistungen, ihre Kreativität, ihre Arbeitsfreude, ihre Bereitschaft zu Zusammenarbeitund gegenseitiger Hilfe, ihre Selbstsicherheit, ihre berufliche Karriere, ihren Familien-und Bürgersinn usw. auswirken.Diese Sicht von innen verändert insbesondere auch das Handeln im Rahmen der <strong>Institution</strong>Schule. In der traditionellen Schule versucht man <strong>die</strong> geistige Tätigkeit der Kinderund Jugendlichen Schritt für Schritt von außen her zu lenken, einerseits weil man sichdavon den größten Erfolg erhofft, andererseits weil <strong>die</strong> als Ziele bestimmten, gesellschaftlicherforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse so umfangreich sind, dass ein anderesVorgehen für den Lehrer kaum möglich ist. Bei MONTESSORI hingegen kann unddarf <strong>die</strong> Schule nur eine entsprechend anregende Umgebung schaffen, in der der Schülerselbst seine Aufgaben finden und <strong>die</strong> für ihn und seine Entfaltung notwendige Arbeit tunkann. Der Lehrer darf nur Hilfestellung bei <strong>die</strong>sem Prozess leisten. Das Handeln derBeteiligten ist zur deren Orientierung von wenigen allgemeinen Regeln begleitet. Nurfür den Lehrer gibt es auch einige Gebote wie: „Er muß zuhören und antworten, wenn erdazu eingeladen wird. Er muß das Kind, das arbeitet, respektieren, ohne es zu unterbrechen.Er muß das Kind, das Fehler macht, respektieren, ohne es zu korrigieren. Er mußdas Kind respektieren, das sich ausruht und das den anderen bei der Arbeit zusieht, ohnees zu stören, ohne es anzurufen, ohne es zur Arbeit zu zwingen.“ (MONTESSORI 1979, S.28 f.). Unter solchen Bedingungen ist das Handeln der Schüler von innen her und durch<strong>die</strong> Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand geleitet.Aus traditioneller Sicht taucht da <strong>die</strong> Frage <strong>auf</strong>, worin hier eigentlich Erziehung undLehre bestehen. Tatsächlich wird bei MONTESSORI Erziehung durch Selbsterziehung desLehrers wie auch des Kindes oder Jugendlichen ersetzt, ebenso wie Lehren durch selb-34
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTständiges Lernen des Lehrers wie des Schülers. Erziehen und Lehren, das erwünschtesVerhalten und Kenntnisse Schritt für Schritt durch bewusst geplante und gezielte Handlungendes Lehrers herbeiführt – also Handlungen, <strong>die</strong> von außen <strong>auf</strong> den Schüler einwirken–, findet man hier kaum. Solches Handeln würde, wenn es wirklich erfolgreichsein sollte, voraussetzen, dass wir alle dafür relevanten Elemente kennen würden undgezielt beeinflussen könnten. Aber es ist ein verhängnisvoller Irrtum zu glauben, wirkönnten jemals vollständiges Wissen über alle für ein solches Geschehen bedeutsamenFaktoren besitzen. Wie sollte man beispielsweise jemals alle Bedingungen kennen, <strong>die</strong>das Handeln eines Schülers in einer bestimmten Situation beeinflussen? Es gibt letztlichauch gar keine Möglichkeit <strong>die</strong> Begrenzungen unserer Kenntnis der jeweils erforderlichenFakten in einem Bereich vollständig zu überwinden.Wenn wir <strong>die</strong> prinzipielle Begrenzung unseres Wissens anerkennen, kann <strong>die</strong>se Einsicht<strong>die</strong> Arbeit des Verstandes effektiver machen, weil wir dann eher bereit sind, „<strong>die</strong> Unterstützungzu akzeptieren, <strong>die</strong> wir von Prozessen erhalten, deren wir uns nicht bewusstsind“ (v. HAYEK, Vol 1, 1973, S. 29). Dazu zählt insbesondere alles das, was wir intuitivwissen, oder überlieferte Regeln, <strong>die</strong> wir befolgen, nicht selten ohne zu wissen, warum.In <strong>die</strong>sem Sinn hat unser Handeln immer einen nicht-rationalen Charakter, denn es wäreuns gar nicht möglich unter Beachtung aller relevanten Zusammenhänge und Fakten zuhandeln, sowenig wie wir beim Sprechen <strong>die</strong> Sätze bewusst nach den grammatischenRegeln konstruieren und jedes einzelne Wort bewusst wählen können. (V. HAYEK, Vol 1,S. 32). Wenn also MONTESSORI <strong>die</strong> Aufgabe des von der Vernunft geleiteten Lehrerhandelnsso stark begrenzt, dann ist das notwendig, gerade weil unser Intellekt <strong>die</strong> Realitätin ihrer Komplexität nicht zu erfassen vermag.Dennoch versuchen Erziehungswissenschaft oder Erziehungspsychologie Regeln mitmöglichst genauen Details für das Handeln in Schule und Erziehung zu finden. Schulesoll das Handeln der Schüler möglichst so leiten und lenken, dass <strong>die</strong> Schüler am Ende<strong>die</strong> Fähigkeiten und Verhaltensdispositionen erworben haben, <strong>die</strong> als Ziel gesetzt waren.Selbst wenn es möglich wäre, <strong>die</strong>ses Wissen zu gewinnen, wäre das Handeln der Lehrernach derart detailliertem Wissen nicht in <strong>die</strong>ser Weise möglich, sowenig wie man eineFremdsprache verwenden kann, indem man im Augenblick des Sprechens und Schreibensalle Regeln und Einzelheiten bewusst anwendet. Der Versuch, <strong>die</strong> innere Führungauszuschalten und <strong>die</strong> komplexen Prozesse geistiger, emotionaler und körperlicher Entwicklungvon außen her zu lenken, kann letztlich nur Verwirrung, Verunsicherung undunzulängliche Ergebnisse erzeugen.35
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDas größte Problem ist demnach, dass es uns so schwer fällt, anscheinend bewährteDenkweisen <strong>auf</strong>zugeben. Sind wir bereit zu akzeptieren, dass wir nicht in der Lage sind,Kinder und Jugendliche nach unseren Vorstellungen zu erziehen? Sind wir bereit, <strong>die</strong>sich aus <strong>die</strong>ser Einsicht ergebenden Folgen in der Schule umzusetzen? Das bedeutet,dass wir nicht mehr nach Plan zu „bilden“ versuchen, sondern dass unsere Aufgabe darinbestehen muss, jedem einzelnen Schüler zu helfen, sein Potenzial zu entwickeln. Eswürde also große Unterschiede zwischen dem geben, was einzelne Schüler tun. Denndurch Lernzwang werden nur geringe Leistungen erzielt. In der traditionellen Schuleerzielt <strong>die</strong> Gesellschaft mit hohem Aufwand etwas Unbedeutendes und verliert das Beste,dessen <strong>die</strong> jungen Menschen fähig gewesen wären. Denn unser so genanntes Leistungsprinzip,das allen das Gleiche abfordert, fördert nicht Leistung, sondern Mittelmäßigkeit.Aber sind wir bereit, eine solche weitgehende individuelle Förderung zu akzeptieren?Sind wir bereit, Schulen eine große und wachsende Freiheit zu geben, damit siein Zusammenarbeit mit Schülern und Eltern und frei von ihnen gewählten Experten imWettbewerb untereinander bessere und für unsere Zeit angemessenere Schulen entdeckenund entwickeln?Lippenbekenntnisse reichen hier nicht aus. Denn <strong>die</strong> Folgen sind tief greifender als beioberflächlichem Hinschauen erkennbar. Schulen im Wettbewerb würde beispielsweiseheißen, <strong>die</strong> Schulwahl vollkommen frei zu stellen. Das hätte zur Folge, dass Schulen,denen es nicht gelingt, sich zu behaupten, „sterben“ würden. Das würde wiederum voraussetzen,dass der Beamtenstatus von Lehrern <strong>auf</strong>gegeben werden müsste. Sind wirbereit, <strong>die</strong> entstehenden Ungleichheiten zwischen Schulen hinzunehmen? Erst durchgewisse Ungleichheiten oder Unterschiede wäre es nämlich möglich, <strong>die</strong> Schulen zuentwickeln und zu erkennen, <strong>die</strong> wir haben wollen. „Schlechten Schulen“ müsste manHilfen anbieten, um sich zu verbessern. Aber <strong>die</strong>se Verbesserung müsste letztlich voninnen heraus bewältigt werden, wenn sie Bestand haben soll.Hinsichtlich der Wirtschaft hat sich eine solche eher evolutionistische Sicht trotz allerEinschränkungen, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Praxis gelten, nahezu allgemein durchgesetzt. Zumindestim Prinzip akzeptieren wir, dass effektive wirtschaftliche Lösungen sich im mehr oderweniger freien Spiel der Kräfte entfalten. Rein konstruktivistischen Lösungen – alsoPlanwirtschaften – wird wenig Vertrauen entgegen gebracht. Sie sind inzwischen alsVerfahren zur Gleichverteilung von Armut, d.h. mittelmäßigen bis schlechten Leistungen,allgemein disqualifiziert.36
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDas Versagen der Plan-Pädagogik ist nicht geringer als das der Planwirtschaft. Die Lehrpläneund Bildungsstandards werden so wenig erreicht wie Produktionsstandards. Undso wie <strong>die</strong> Planwirtschaft scheitern musste, weil sie über bloße Flickschusterei nie hinauskam,wird wohl auch <strong>die</strong> Plan-Pädagogik scheitern müssen. Sicher gibt es Unterschiedein den Leistungen der Schulsysteme verschiedener Nationen. Aber keines <strong>die</strong>serSysteme kann als außerordentlich leistungsfähig gelten. So ist beispielsweise das finnischeSchulsystem, das bei der Pisa-Untersuchung mit am allerbesten abgeschnitten hat,keineswegs optimal was <strong>die</strong> Förderung der leistungsfähigsten Schüler angeht. Wenn wireine ständige Verbesserung wollen, brauchen wir ein System, das von seiner Struktur heralle Beteiligten ständig zur Entwicklung um Umsetzung von Innovationen anregt. Währendkleine Reparaturen hier und da bei der alten Schule durchaus möglich sind, erfordertein tief greifender und <strong>auf</strong> Dauer angelegter Entwicklungs- und Verbesserungsprozessden Abschied von der bisherigen Plan-Bildung. Aber nicht nur <strong>die</strong> Praxis der Schule,sondern auch ihre Theorie steckt in Schwierigkeiten.4. Erziehungswissenschaft in der SackgasseDie Erziehungswissenschaft hat lange Zeit genau definierte Ziele für Schule und Unterrichtgefordert. Nur bei solchen klaren Zielen bestünde <strong>die</strong> Chance, auch zu erreichen,was man sich von Schule und Unterricht wünsche. Nun werden <strong>die</strong>se Ziele aber, wie wirgesehen haben, nur selten erreicht und auch schulische Reformen führen nur in Grenzenzu erwarteten Ergebnissen. Was also ist falsch gel<strong>auf</strong>en, wo muss man umdenken?ForschungsschwerpunkteVor nicht langer Zeit hoffte man in der Forschung noch, von einfachen Zusammenhängenausgehen zu können, deren Aufklärung gleichsam <strong>die</strong> „Rezepte“ für Unterrichtserfolgeliefern würde. So sah man etwa in der Bestimmung von Merkmalen der erfolgreichenLehrerpersönlichkeit einen Schüssel für erfolgreiches Lehren (vgl. Pause 1970).Nun ändern sich aber <strong>die</strong> Kriterien für „gute“ oder effektive Lehrer entsprechend denjeweils vorherrschenden Ansichten, so dass <strong>die</strong>se Merkmale nicht absolute sein können(vgl. Campbell 1972). Außerdem ist es schwierig, Lehrer nach gerade als ideal geltendenBildern zu formen. Man fand sogar heraus, dass <strong>die</strong> übliche „Lehrerausbildung keinerleinachhaltigen Einfluss <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Werthaltungen, Einstellungen und Verhaltensrichtlinienihrer Absolventen“ hat, „soweit <strong>die</strong>se für Schul-, Erziehungs- und Unterrichtsbelange37
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTvon Interesse sind“ (Koch/ Pfeifer 1971, S. 440; ähnlich Tausch / Tausch 1970, S. 445ff.).In der Folge konzentrierte sich <strong>die</strong> Erziehungswissenschaft <strong>auf</strong> Verhaltensweisen vonLehrern in bestimmten Situationen. Weil solche Verhaltensweisen sich trainieren lassen,werden dadurch eher Eingriffsmöglichkeiten eröffnet (vgl. Grell 1974; Gordon 1977). Inletzter Zeit ist <strong>die</strong> Forschung wieder dazu übergegangen, das Verhalten von Lehrern, <strong>die</strong>als Experten gelten, mit dem von zu Novizen zu vergleichen, um dadurch herauszufinden,was Könnerschaft ausmacht. Auf <strong>die</strong>ser Grundlage hoffen Erziehungstheoretikeru.a., <strong>die</strong> Lehrer gezielter und besser ausbilden zu können (z.B. Berliner 1992; Weinert/Helmke/ Schrader 1992). Aber auch <strong>die</strong>se Forschungsrichtung war nicht von Erfolg gekrönt.In der Wirtschaft geht man mit dem Problem des richtigen Personals viel einfacher undpragmatischer um. Erstens sucht man sich nicht unbedingt Leute mit der entsprechendenAusbildung, sondern ist bereit, Bewerber zu akzeptieren, <strong>die</strong> Interesse an den Aufgabenhaben und bereit sind, sich zu engagieren. Dann unterstützt man ihre Weiterbildung, gibtihnen bei guten Leistungen und Ideen Aufstiegschancen. Die Managementforschung hatzudem herausgefunden, dass <strong>die</strong> Firmen langfristig <strong>die</strong> besten Ergebnisse haben, <strong>die</strong> ihreMitarbeiter entsprechend ihrer jeweiligen Interessen einsetzen, wenn Vorschläge <strong>die</strong>serMitarbeiter ernst genommen, diskutiert und nach Möglichkeit umgesetzt werden (Buckingham/Coffman 1999). Hat man den absolut falschen Mitarbeiter eingestellt, entlässtman ihn oder vermittelt ihn in einen Job, für den er geeigneter ist.Sollte man sich nicht auch in der Erziehungswissenschaft <strong>die</strong> Frage stellen, durch welcheBedingungen der Schule man <strong>die</strong> Lehrer zu neuen Ideen, zu Engagement und Begeisterungan ihrer Arbeit verhelfen kann? Vermutlich würde eine solche Änderung beiden etablierten Lehrern erst mal ein Menge Missmut erzeugen. Aber im L<strong>auf</strong>e der Zeit,wenn <strong>die</strong> Arbeit allmählich mehr Freude macht, wenn <strong>die</strong> Unternehmungslust steigt undsich Erfolge zeigen, würde sich das ändern.Die Suche nach Faktoren, <strong>die</strong> den Unterricht grundlegend verbessern könnten, erstrecktsich über eine ganze Reihe von Forschungsfeldern. Neben den Lehrern werden auch <strong>die</strong>Lehrmethoden (im Überblick Weinert 1970), <strong>die</strong> Lehrme<strong>die</strong>n (Dallmann 1970), Formender sozialen Interaktion wie Gruppenunterricht oder Diskussionsmethode (Peters 1970),<strong>die</strong> Klärung der Ziele und <strong>die</strong> dar<strong>auf</strong> bauende Planung (Möller 1969) usw. untersucht.Auch da gab es nicht <strong>die</strong> erwarteten klaren und eindeutigen Ergebnisse, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Forschererwartet hatten. Vielmehr zeigte sich, dass <strong>die</strong> Wirkungen von Methoden, Me<strong>die</strong>n usw.38
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTvon zahlreichen Faktoren abhängig sind. Insbesondere sind unterschiedliche Schülermerkmalevon Bedeutung (vgl. Cronbach/ Snow 1969; Schwarzer/ Steinhagen 1975;Flammer 1975). Die große Zahl möglicher Wechselwirkungen und Faktoren ließ <strong>die</strong>Auffassung, man könne von Elementen des Ganzen ausgehen, <strong>die</strong>se Schritt für Schrittanalysieren und danach wieder zusammensetzen, um <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise zu einem Gesamtbildder Bedingungen erfolgreichen Unterrichts zu gelangen, zusehends unrealistischerwerden.Unter <strong>die</strong>sem Eindruck suchten <strong>die</strong> Erziehungswissenschaftler nach Faktoren für denUnterrichtserfolg, <strong>die</strong> ihrer Aufmerksamkeit bis dahin entgangen waren. Sie konzentriertensich <strong>auf</strong> wenige bedeutsam erscheinende und zudem manipulierbare Faktoren. Vorallem gingen sie von den Schülern aus und suchten nach den Bedingungen, <strong>die</strong> besondersden weniger erfolgreichen Schülern helfen sollten, sich zu verbessern. Denn je mehrSchüler einer Schule <strong>die</strong> angestrebten Ziele erreichen, umso effektiver ist sie. Unter <strong>die</strong>semGesichtspunkt sind beispielsweise Modelle für einen Ausgleich unterschiedlicherAusgangsvoraussetzungen von Schülern entwickelt worden. Solche unterschiedlichenVoraussetzungen entstehen durch Einflüsse des sozioökonomischen Status der Eltern,des mit dem sozialen Milieu zusammenhängenden Sprachcodes, des Anregungsgehaltsder häuslichen Umgebung, durch <strong>die</strong> kulturellen Bedingungen der jeweiligen Bezugsgruppe,den Entwicklungstand der Schüler usw. Indem Schüler mit ungünstigen Ausgangsvoraussetzungenbeispielsweise mehr Zeit für <strong>die</strong> Bearbeitung von Aufgaben erhalten,<strong>die</strong> ihnen schwer fallen, oder indem sie in ihren „schwachen“ Fächern in Leistungsgruppendifferenziert werden, <strong>die</strong> spezielle Fördermaßnahmen ermöglichen, sollensie in <strong>die</strong> Lage versetzt werden, ihre schon weiter fortgeschrittenen Mitschüler einzuholen36.Schüler mit ungünstigen Ausgangsvoraussetzungen sollen <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise ebenfallsChancen erhalten, gute Leistungen zu erzielen. Da <strong>die</strong>ser Chancenausgleich aber imWesentlichen zu Lasten der guten Schüler ging37, war <strong>die</strong> Effektivität <strong>auf</strong> eine Schülergruppebegrenzt, während andere benachteiligt wurden. Jedenfalls können durch Differenzierungin Leistungsgruppen und/oder <strong>die</strong> Förderung leistungsschwacher Schülerallein keine außergewöhnlichen Leistungssteigerungen erzielt werden38.363738Vgl. das als "Mastery Learning" bekannt gewordene Modell von BLOOM 1968 und das "PersonalizedSystem of Instruction" von KELLER 1968. Einen bekannteren Versuch in <strong>die</strong>ser Richtung stellt <strong>die</strong> integrierteGesamtschule dar.Vgl. TREIBER/WEINERT 1985; kritisch dazu BECK/BROMME 1988.Das gilt sowohl für das Mastery Learning (vgl. <strong>die</strong> Metaanalyse von KULIK/KULIK/BANGERT-DROWNS 1990) als auch für <strong>die</strong> Gesamtschule (vgl. FEND u.a 1976). Allerdings ist bei der Gesamtschulezu berücksichtigen, dass <strong>die</strong> Entscheidung über <strong>die</strong> schulische L<strong>auf</strong>bahn offen gehalten wird.39
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDa zwischen Organisationsformen – Leistungsdifferenzierung innerhalb der Schule vs.Differenzierung durch verschiedene Schulformen (innere und äußere Differenzierung) –keine größeren Leistungsunterschiede bestehen als innerhalb jeder <strong>die</strong>ser Organisationsformen,müssen andere Merkmale von größerer Bedeutung für <strong>die</strong> Effektivität sein. Umnun herauszufinden, welche Merkmale von Schule und Unterricht für hohe Leistungender Schüler verantwortlich sind, werden im Rahmen der Schuleffektivitätsforschung(vgl. z.B. Mortimore 1994, Aurin 1991) außergewöhnlich effektive Schulen mit wenigerguten verglichen. Gesucht wird nach den Bedingungen, <strong>die</strong> den Leistungsunterschiedverursacht haben. Dabei zeigt sich folgendes: Ein wesentlicher Faktor von Schuleffektivitätist, dass hohe Erwartungen an <strong>die</strong> Schüler gestellt werden, wobei <strong>die</strong> individuelleLeistungsfähigkeit berücksichtigt wird (vgl. Dorr-Bremme 1990). Ein anderer Faktor ist<strong>die</strong> Bedeutung, <strong>die</strong> schulischen Leistungen zugemessen wird, wie das z.B. bei öffentlicherAnerkennung von Leistungen zum Ausdruck kommt (vgl. Purkey/Smith 1983).Weitere Faktoren werden in gemeinsamen Bemühungen des Kollegiums um <strong>die</strong> Verbesserungdes Leistungsstandes der Schüler (vgl. Levine/Lezott 1990), in der optimalenAusnutzung der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit (vgl. Blum 1984) und in einerstarken Schulleitung gesehen, <strong>die</strong> durch Kontrolle <strong>die</strong> besten Lehrer herausfiltert undunterstützt und – sofern das möglich ist – <strong>die</strong> als ineffektiv geltenden Lehrer entlässt(vgl. Sergiovanni 1994).So bedeutsam derartige Informationen über Zusammenhänge zwischen Merkmalen vonSchulen und der Leistung von Schülern auch sind, lassen sie doch wesentliche Fragenunbeantwortet. Beispielsweise erfährt man nicht, warum <strong>die</strong>se Zusammenhänge bestehen.Man weiß nicht, ob effektive Schulen hohe Leistungserwartungen ihrer Lehrer bedingenoder ob hohe Leistungserwartungen der Lehrer zu effektiven Schulen führen.Beides wäre möglich. Außerdem sind <strong>die</strong> Leistungserwartungen der Lehrer nicht so genauuntersucht worden; sind es hohe Anforderungen oder ist es einfach das Vertrauen in<strong>die</strong> Leistungsfähigkeit ihrer Schüler, was ich eher glaube. Wenn letzteres der Fall seinsollte, dann wäre <strong>die</strong> Frage, welches Umfeld erforderlich ist, damit ein solches Vertrauenentsteht und wirksam wird. Jedenfalls sieht man schnell, dass es wenig Sinn machenwürde, derartige verstreute Fakten zu verwenden, um Bedingungen für effektive Schulenzu schaffen. Auf <strong>die</strong>se Weise wird das erwünschte Ziel mit großer Wahrscheinlichkeitverfehlt39.Die Identifizierung von Merkmalen effektiver Schulen reicht also nicht aus. Es kommthinzu, dass <strong>die</strong> Leistungen in den Schulfächern nicht <strong>die</strong> einzigen Ergebnisse darstellen,39 Vgl. auch <strong>die</strong> Kritik von MADAUS/AIRASIAN/KELLAGHAN (1980) an der Schuleffektivitätsforschung.40
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT<strong>die</strong> für <strong>die</strong> Zukunft der Kinder von Bedeutung sind. Es kommt auch an <strong>auf</strong> das Selbstvertrauender Kinder und Jugendlichen, <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Entwicklung ihrer Interessen, ihrer Kreativität,<strong>auf</strong> den Grad ihrer Aggressivität, <strong>auf</strong> ihre Orientierungsschwierigkeiten bzw. ihreVerhaltenssicherheit nach dem Wechsel zu anderen <strong>Institution</strong>en, ihre Durchsetzungskraft,Kooperations- und Problemlösefähigkeit. Auch Leistungsergebnisse nach derSchule wie <strong>die</strong> Beurteilungen durch Arbeitgeber, ihre Berufs- und Stu<strong>die</strong>nerfolge usw.sollten bei der Beurteilung der Schulqualität berücksichtigt werden.PerspektivenErforderlich wäre also eine Theorie, <strong>die</strong> erklärt, warum bestimmte schulische und unterrichtlicheBedingungen zu bestimmten Wirkungen führen. Eine solche Theorie würdeaber letztlich, wenn sie genau sein sollte, überaus komplex werden. Man müsste dann jafestzustellen suchen, welche Maßnahmen für welche Ziele und Inhalte bei welchenSchülern mit bestimmten Merkmalen Erfolg versprechend eingesetzt werden können.Weil <strong>die</strong> Wirkungen äußerer Bedingungen <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Schüler in vielfachen Abstufungenund Kombinationen geprüft werden müssen, wobei wiederum jedes Element im Hinblick<strong>auf</strong> verschiedene Ziele und externe Einflüsse zu analysieren wäre, was immer weitereDifferenzierungen zur Folge hätte, führt das zu extrem verästelten Wissensstrukturen.Hinzu kommt, dass Reize, <strong>die</strong> von außen als gleich zu beurteilen sind, für Schüler jenach inneren und äußeren Voraussetzungen und Situationsinterpretationen verschiedeneBedeutungen haben. Indem man all das erfasst, gelangt man zu zwar immer genaueren,aber auch immer begrenztere Phänomene erfassenden Theorien. Wegen der zunehmendenKomplexität ist es aussichtslos, <strong>die</strong> ständig wachsende Fülle der Einzelbefunde und-theorien jemals zu einem System integrieren zu können.4040Letztlich wird es kaum eine andere Möglichkeit geben, als das Paradigma der Erforschung von Erziehungsphänomenenvon außen (Objektivismus) zu ergänzen oder zu ersetzen durch ein Paradigma derErforschung von innen (Subjektivismus) Die Unterscheidung <strong>die</strong>ser Ansätze gewinnt in der Psychologiezunehmend an Bedeutung. So grenzen DECI/ RYAN (1991, 279 f im Anschluß an MCADAMS 1990)„I theories“ ab von „me theories“, wobei Theorien vom „I“-Typ das Individuum als Subjekt behandeln,während Theorien vom „me“-Typ das Individuum als Objekt betrachten. Zum "Objektivismus"bzw. der Sicht von außen in der Psychologie, insbesondere im Behaviorismus vgl. Groeben/Scheele1977, S. 6 ff., 34 ff.; zur Sicht von innen ebenda z.B. S. 20 ff.; ferner Groeben 1981. Zu den der Innen-bzw. Außensicht entsprechenden psychologischen Modellen des Menschen vgl. Herzog 1984,bes. S. 97 ff. u. 163 ff. In der Erziehungspsychologie sprechen Ryan/ Stiller (1991, 117) von einer Erziehung„von außen“ im Unterschied zu einer Erziehung, <strong>die</strong> von den Bedürfnissen des Schülers ausgeht.Historisch hängt der Objektivismus eng mit dem frühen Rationalismus zusammen, der nur dasals vernünftig oder rational ansieht, was sich durch Beobachtung beweisen läßt (vgl. V. HAYEK 1979;1973, Bd. 1, S. 9 ff.; LEHNER 1986, S. 9 ff.). Vor allem in Industrie, Bürokratie und Politik ist <strong>die</strong>41
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTIm Unterschied zu <strong>die</strong>sem Ansatz der heutigen Erziehungswissenschaft versuchten Reformpädagogenwie Peter Petersen oder Maria Montessori nicht durch Beobachtung vonaußen <strong>die</strong> Bedingungen effektiven Unterrichts zu bestimmen, sondern aus der Sicht voninnen, also vor allem aus der subjektiven Sicht der Schüler. In <strong>die</strong>sem Sinn ist <strong>die</strong> Reformpädagogikeine „Pädagogik vom Kinde aus“, und <strong>die</strong>se Sicht von innen ist auch <strong>die</strong>treibende Kraft <strong>die</strong>ser Pädagogik. Ihr Bild des Schülers ist nicht einfach das eines vonGesetzmäßigkeiten bestimmten Organismus, sondern das eines Menschen, der <strong>auf</strong>grundeines inneren Bauplans seine ganz legitimen eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Zielehat, <strong>die</strong> ihn dazu veranlassen, sich in seiner Umgebung <strong>die</strong> Dinge herauszusuchen, <strong>die</strong> erfür sein Wachstum und seine Entwicklung braucht. Dementsprechend konnte es für <strong>die</strong>Reformpädagogen auch nicht darum gehen, den Schüler nach bestimmten Zielen zu bildenoder zu formen. Vielmehr fragten sie sich, wie <strong>die</strong> schulische Umgebung einzurichtensei, damit sie den Bedürfnissen, Wünschen und Zielen des Kindes und Jugendlichengerecht würde und am förderlichsten für <strong>die</strong> Entfaltung seines inneren Plans zur SelbstundWelterkenntnis wie auch zur Erschaffung der eigenen Zukunft sei. Hinzu kommt,dass <strong>die</strong> Erfolge der Jenaplan- und Montessori-Pädagogik deren Theorien bestätigen.41Allerdings wünschen wir uns ein übergreifendes Erklärungsmuster oder –modell, das <strong>die</strong>Voraussetzungen, theoretischen Grundannahmen, Funktionsweisen und <strong>Auswirkungen</strong>jeder Art von Schule verständlich macht. Ein solches Erklärungsmuster oder Modellwürde sowohl <strong>die</strong> Wirkungen von reformpädagogischen Schulen wie auch <strong>die</strong> traditionellerSchulen erklären. Es würde darüber hinaus Handreichungen bieten, um <strong>die</strong> Schulezu reformieren oder zu verbessern.41"Sicht von außen" vorherrschend (vgl. z.B. WEBER 1976, S. 686 ff., sowie v. HAYEK 1973). Es ist nurkonsequent, daß in Industrie und Bürokratie, wo zunächst Menschen in rationaler Planung zur Erfüllungbestimmter Aufgaben eingesetzt wurden, <strong>die</strong>se genau definierten Funktionen zunehmend vonMaschinen übernommen werden.Zur Theorie PETERSENS im Überblick vgl. DIETRICH 1995; vgl. MONTESSORI 1977 zur Theorie ihrerMethode; zu ihrer empirschen Prüfung z.B. FISCHER 1982; WÖRNLE 1984. Berichte zur Praxis vonPETERSENs Jenaplan-Schule findest man in RETTER 1993; zur MONTESSORI-Theorie z.B. BÖHM 1991;zur schulischen Praxis z.B. HELLBRÜGGE 1984.42
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTeil IIDas neue Modell: Ein Überblick5. Der SchülerIm Mittelpunkt jeder Schule und jedes Schulsystems steht letztlich der Schüler. Die Zieleund Anforderungen der Schule beziehen sich <strong>auf</strong> ihn, der Unterricht wendet sich anihn, <strong>die</strong> Ergebnisse werden an ihm gemessen. Welches Bild man auch immer von ihmhaben mag, in jedem Fall bildet er den Kern <strong>auf</strong> den hin alles sich ausrichtet. Dennochist gerade <strong>die</strong> Art des Bildes, das wir vom Schüler haben, entscheidend für <strong>die</strong> Art, wiewir ihn behandeln. Und da gibt es zwei psychologische Theorien.Anmerkungen zur Psychologie des SchülersNach der ersten Theorie wird <strong>die</strong> Persönlichkeit erst durch <strong>die</strong> Umwelt geschaffen. Inder Schule geschieht das durch <strong>die</strong> <strong>auf</strong>grund von bewusst geplanten Maßnahmen angeregteoder auch erzwungene Auseinandersetzung des Schülers mit den darin enthaltenenAnforderungen. Nach der zweiten Theorie setzt <strong>die</strong> Entwicklung der Persönlichkeit einenKern oder ein Selbst bereits voraus, das <strong>die</strong> später entstehende Persönlichkeit sozusagenin nuce enthält. Dieses Selbst, <strong>die</strong>se Person kann nicht das Ergebnis von Erfahrungoder Lernen sein, sondern es muss von Beginn an existieren (vgl. ausführlich dazuKap. III).Es sind also zwei Aspekte zu unterscheiden: Das innere und das äußere Selbst. Das innereSelbst enthält <strong>die</strong> gesamte Potenzialität des Menschen. Jedes Individuum, jedes Kindist von Anfang an mit allen Anlagen ausgestattet, <strong>die</strong> es ihm ermöglichen, sich in seinerUmwelt zurechtzufinden, Ziele zu wählen, selbständig zu denken, zu lernen usw.Unter dem Ausdruck „äußeres Selbst“ ist <strong>die</strong> Persönlichkeit zu verstehen, also das Ichals handelnde Instanz und alles, was <strong>die</strong>ses Ich sich aneignet und wozu es wird. Dazuzählen beispielsweise alle Kenntnisse, Fertigkeiten, Überzeugungen und Gewohnheiten.Das erste, d.h. das Ich als Agens, ist <strong>die</strong> aktive Seite des (äußeren) Selbst, das zweite istdas Ergebnis des Handelns <strong>die</strong>ser aktiven Seite, d.h. das Ich als Persönlichkeit mit ihren43
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTEigenschaften oder Merkmalen. Die Person, das innere Selbst meiner Möglichkeiten,das den eigentlichen Ursprung des äußeren Selbst bildet, bleibt unsichtbar im Hintergrund,wir sehen es nicht, sind uns seiner nicht bewusst, auch oder vielleicht weil es <strong>die</strong>Matrix für <strong>die</strong> Entwicklung des Individuums darstellt.Abb.: Inneres Selbst und äußeres Selbst(Ich und Persönlichkeit)Die Entwicklung der Persönlichkeit wird gesteuert von einem ursprünglichen Bedürfnisnach Selbstentfaltung des eigenen Potenzials. Damit <strong>die</strong>ses Bedürfnis befriedigt werdenkann, müssen insbesondere zwei Bedingungen gegeben sein: Sicherheit und Selbständigkeit.Sicherheit wird erfahren, wenn das Individuum in seiner Umwelt eine Ordnungerkennen kann, <strong>die</strong> ihm subjektiv wertvolle Handlungsmöglichkeiten eröffnet, in der essich dauerhaft von anderen akzeptiert, sozial gebunden und anerkannt fühlt, der Wert deseigenen (äußeren) Selbst nicht in Frage gestellt wird. Unter <strong>die</strong>ser Bedingung gewinntdas Individuum Selbstsicherheit. Eine chaotische, undurchschaubare Umgebung dagegenwirkt bedrohlich. In <strong>die</strong>sem Fall werden <strong>die</strong> Möglichkeiten der Selbstentfaltung unddes selbständigen Handelns beeinträchtigt. In einer solchen Umgebung ist der Wert des(äußeren) Selbst ungesichert.Die Erfahrung von Sicherheit begünstigt selbständiges Handeln. Kommt dazu noch eineUmgebung, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> das Kind oder den Jugendlichen, seine Gefühle, Bedürfnisse, Wünscheund Interessen ernsthaft eingeht, ihn zu verstehen sucht und Anregungen bietet,steigert das <strong>die</strong> inneren Anstrengungen des Individuums, seine Umwelt zu erobern, seineMöglichkeiten in ihr zu erkunden und zu gestalten. Das lässt sich bereits beim Säuglingbeobachten. Indem der Einzelne <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise Kontrolle über Dinge gewinnt und sich44
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbehauptet, erweitert er seine Möglichkeiten. Abenteuer und Eroberungen durch selbständigesHandeln sind ebenso bedeutsam für <strong>die</strong> Selbstentfaltung wie Sicherheit. DasWagnis der Unsicherheit durch selbständiges Handeln setzt aber das Vertrauen in <strong>die</strong>eigenen Fähigkeiten, in den Wert des eigenen Selbst voraus.Der Schüler in der UnterrichtssituationWie geht nun der Schüler im Unterricht mit Informationen um und passt sich an jeweilsgegebene Bedingungen an? Da nicht <strong>die</strong> ganze Breite möglicher Unterrichtssituationenberücksichtigt werden kann, werden vereinfachende Typisierungen vorgenommen.Dementsprechend werden <strong>die</strong> Handlungsweisen von Schülern in der Form allgemeinerMuster zu bestimmen versucht.Unterrichtssituationen enthalten eine Fülle von Informationen, <strong>die</strong> der Schüler <strong>auf</strong>nehmenund entschlüsseln muss, um sich zurechtfinden und sein Handeln dar<strong>auf</strong> abstimmenzu können. Deutungen von Situationen und Situationselementen setzen jedoch Annahmenvoraus. Diese Annahmen sind meist unbewusst. Wir bilden ständig Erwartungenüber <strong>die</strong> Umwelt und entschlüsseln mit ihrer Hilfe <strong>die</strong> über <strong>die</strong> Sinnesorgane <strong>auf</strong>genommenenReize. Dabei werden <strong>die</strong>se Informationen <strong>auf</strong> ihren Selbstbezug geprüft. DieDinge können positiv, negativ oder neutral und unwesentlich sein, den Selbstwert bedrohenoder steigern. Entscheidend sind <strong>die</strong> einer Situation zugeschriebenen HandlungsundBewältigungsmöglichkeiten.Handlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten äußern sich in der Hoffnung, Aufgaben,Fragen, Probleme lösen oder Neues erkennen zu können, oder in der Annahme, sie nichtlösen zu können oder sie werden als uninteressant betrachtet. Furcht, Aufgaben nichtlösen zu können, entsteht in der Regel erst unter der Bedingung der Leistungsbeurteilung.Es kommt ferner dar<strong>auf</strong> an, ob der Schüler sich akzeptiert fühlt oder nicht, ob ersich eingeengt, bedroht oder ob er sich beteiligt und angesprochen fühlt usw. Es kommt<strong>auf</strong> den jeweiligen Unterricht sowie <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Kenntnisse und Fertigkeiten und andere Persönlichkeitsmerkmaleder Schüler an, welcher Art ihre Erwartungen sind. Insbesondereist es von Bedeutung, ob Schüler ein gutes oder eher ein bedrohtes Selbstwertgefühl haben.Die wichtigsten Zusammenhänge lassen sich am Beispiel von Schülern mit sehr gutenbis außergewöhnlichen Fähigkeiten verdeutlichen. Als Unterrichtssituation wird zunächstder undifferenzierte Klassen- oder Frontalunterricht mit Übungs<strong>auf</strong>gaben ge-45
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTwählt, d.h. <strong>die</strong> am häufigsten vorkommende Unterrichtsform. In <strong>die</strong>sem Fall werdenSchüler mit sehr guten bis außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Sache meist kaum eineHerausforderung sehen können. Sie werden eher gebremst, d.h. in ihren Handlungsmöglichkeiteneingeengt. Das Verhalten der Schüler kann nach folgenden und der Deutlichkeithalber überzeichneten Mustern differenziert werden:Schüler mit gutem Selbstwertgefühl, <strong>die</strong> über gute soziale Fähigkeiten verfügen, werdeneher eigene Aufgaben suchen bzw. gegebene Aufgaben <strong>auf</strong> ihre eigene Weise deuten.Sie sind handlungsorientiert und haben am ehesten das Gefühl, ausreichende Kontrolleüber Ziele und Vorgehensweisen zu besitzen. Sie wollen in erster Linie herausfinden,wie <strong>die</strong> Dinge zusammenhängen, sind also eher intrinsisch motiviert. Mit zunehmenderDauer des Schulbesuchs jedoch können sie dadurch in eine Außenseiterposition geraten.Damit verringert sich ihre Kontrolle über <strong>die</strong> Lernsituation. Denn um das Abgleiten ineine Außenseiterrolle zu vermeiden, kann es vorteilhafter sein, sich weniger interessiertzu zeigen. Die ursprünglich intrinsisch motivierten Schüler werden dann durch Reflexionen<strong>auf</strong> sich bzw. Möglichkeiten des Selbstschutzes stärker extrinsisch motiviert.Bei Schülern mit bedrohtem Selbstwertgefühl können <strong>die</strong> angepassten und passivenSchüler gemeinsam betrachtet werden. Sie werden sich vermutlich langweilen oder irgendwie<strong>die</strong> Zeit vertreiben. Die Angepassten beteiligen sich zwar, aber wie <strong>die</strong> passivenSchüler versuchen sie kaum, Einfluss zu nehmen, sondern fügen sich. Kontrolle glaubensie in dem Sinne zu besitzen, als sie das Ergebnis beeinflussen können. Je empfindlichersie gegen Bedrohungen ihres Selbstwerts sind, desto vorsichtiger handeln sie. Sie denkenstets an <strong>die</strong> Folgen für sich, vergleichen sich stärker mit andern, grübeln über <strong>die</strong>Situation usw., d.h. sie sind eher lageorientert. Ihre Motivation besteht darin, <strong>die</strong>se Lagezu verbessern bzw. zu überstehen, d.h. sie sind vor allem extrinsisch motiviert.Schüler, <strong>die</strong> gegen <strong>die</strong> Einschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten rebellieren, sind innoch höherem Maß Impulsen, Erwartungen und den Nachwirkungen früherer Erfahrungenausgesetzt. Aufgrund ihrer Angst vor Kontrollverlust neigen sie dazu, blind zu reagieren.Wenn sie dadurch ins Abseits geraten und <strong>auf</strong>grund fehlender Akzeptanz nochmehr an Sicherheit verlieren, können sie resignieren und bewusst falsche Lösungen fürAufgaben angeben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr Handeln ist in hohem Maßextrinsisch, d.h. von <strong>auf</strong>gabenfremden Zielen motiviert.46
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAbb: Handlungsmuster von Schülern unter verschiedenen BedingungenDie Fähigkeiten von Schülern mit bedrohtem Selbstwert werden häufig unterschätzt(sog. Underachiever), entweder weil sie zu inaktiv sind oder weil sie unangepasste undunbeliebte Störer sind. Das bedeutet, dass Schüler mit potentiell herausragenden Fähigkeitennicht <strong>die</strong> Leistungen erbringen, <strong>die</strong> sie erbringen könnten. Sucht man nach denUrsachen, dann fallen zunächst <strong>die</strong> mangelnde schulische Initiative und <strong>die</strong> begrenzteFähigkeit, Gefühle zu kontrollieren, ins Auge. Nun wird aber gerade durch den lehrergeleitetenFrontalunterricht eine verstärkte Ausprägung <strong>die</strong>ser Merkmale begünstigt. Weildem Lehrer eine dominante Rolle zukommt und <strong>die</strong> Schüler mit Bewertungen rechnen,müssen sie vorsichtig sein und sich in günstigem Licht darzustellen suchen. Es istschlecht, wenn einer das nicht kann. Jedenfalls wird von der Sache abgelenkt, so dasssachfremde Aspekte des Unterrichts <strong>die</strong> Aufmerksamkeit des Schülers mehr oder wenigerin Anspruch nehmen.Ändert man <strong>die</strong> Unterrichtssituation in den entscheidenden Merkmalen – wobei solcheÄnderungen nicht nur vom Lehrer, sondern auch von den schulischen und schulpolitischenRahmenbedingungen abhängen (vgl. LEHNER 1998) –, wird auch das Schülerverhaltenin anderen Mustern verl<strong>auf</strong>en. In Montessori- und anderen reformpädagogischenoder davon beeinflussten Schulen wie der Bielefelder Laborschule oder der Bodensee-Schule in Friedrichshafen sind eher Unterrichtsbedingungen anzutreffen wie sie im Folgendenbeschrieben werden. Hier können <strong>die</strong> Schüler vielfach aus einem Angebot von47
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLernmaterial nach Neigung und Interesse wählen; ihre Leistung wird nicht mit der ihrerMitschüler verglichen, es zählt nur, dass sie ihre Arbeit so gut wie möglich machen; siehaben Zeit und können Lehrer oder Mitschüler fragen, ohne nach ihren Fragen beurteiltzu werden; wichtig ist vor allem <strong>die</strong> Sache und das Bemühen um Verständnis.Unter solchen Bedingungen kann der Schüler durch eigene Aktivität einen positivenSelbstbezug herstellen sowie subjektiv bedeutsame Handlungspläne auswählen oderselbst erarbeiten und ausführen. Die Individualisierung ermöglicht es, Schülern mit unterschiedlichenFähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen gerecht zu werden. AußergewöhnlicheSchüler können vorpreschen, während schwächere sich langsam vorarbeiten.Auf <strong>die</strong>se Weise hat jeder Schüler innerhalb gewisser Grenzen <strong>die</strong> Kontrolle überZiele und Vorgehensweisen, kann entscheiden, welche Hilfsmittel er verwenden will, obund mit wem er zusammenarbeiten möchte usw. In einer solchen Situation wird vor allem<strong>die</strong> Sache interessant, d.h. <strong>die</strong> Schüler werden insgesamt eher intrinsisch motiviertsein oder sich in <strong>die</strong>ser Richtung entwickeln.<strong>Auswirkungen</strong> von Erwartungs- und HandlungsmusternDie von Unterrichtssituationen mit bestimmten Merkmalen ausgelösten Erwartungs- undHandlungsmuster wirken sich zunächst <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Art und Weise des Lernens aus. In derLiteratur werden – teils unter anderen Namen – reproduzierendes und entdeckendes Lernenunterschieden (vgl. LEHNER 2000; 2001).Beim reproduzierenden Lernen versuchen Schüler Lehrstoff in ihre Wissensstrukturenzu integrieren, und zwar weitgehend unabhängig davon, wie gut sie den Stoff verstandenhaben. Diese Lernhaltung tritt verstärkt <strong>auf</strong>, wenn der Selbstbezug schwach oder ehernegativ ist und extrinsische Motivation überwiegt, z.B. wenn der Stoff wenig Interesseweckt, aber gelernt werden muss oder wenn befürchtet wird, eine anstehende Prüfungnicht zu bestehen. Im Extremfall lernen Schüler repetitiv, d.h. sie wiederholen für siesinnlose Wortfolgen oder Formeln so lange, bis sie sie reproduzieren können. Selbstleistungsstarke Schüler werden sich bei begrenzten Handlungsmöglichkeiten nicht unbedingtintensiver mit den Gegenständen befassen als nötig, solange ihnen nur <strong>die</strong> gewünschteNote sicher ist. Als Folge entwickeln auch <strong>die</strong>se Schüler oft nur eng beschränkteund vage Handlungspläne, und <strong>die</strong> Wahrscheinlichkeit der Entstehung ausgeprägterInteressen bleibt gering.48
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBeim entdeckenden Lernen versucht der Schüler den Gegenstand durch Anwendungseines Wissens zu verstehen. Kommt er dabei zu Ergebnissen, <strong>die</strong> mit der Realität nichtübereinstimmen, muss er seine Vorstellungen ändern. Auf <strong>die</strong>se Weise kann er zunehmendadäquatere mentale Modelle von Gegenständen erwerben. Entdeckendes Lernentritt eher <strong>auf</strong>, wenn ein enger und positiver Selbstbezug zum Lerninhalt besteht, wennder Schüler Ziele und Vorgehensweisen (mit-)bestimmen kann und intrinsische Motivationüberwiegt. Unter <strong>die</strong>sen Bedingungen will der Schüler vor allem <strong>die</strong> Zusammenhängebegreifen, seine Vorstellungen verbessern, bzw. wo Alltagstheorien zwar ungenau,aber in Grenzen gültig sind, alternative exaktere Auffassungen entwickeln. Bei derAuseinandersetzung mit subjektiv bedeutsamen Gegenständen achtet man verstärkt <strong>auf</strong>Handlungsmöglichkeiten. Führen Schüler <strong>auf</strong>grund besonderer Neigung <strong>auf</strong> einem odermehreren Gebieten eine Vielzahl von Handlungsplänen aus, nimmt <strong>die</strong> Wahrscheinlichkeitder Ausprägung von Interessen zu.Extrinsische und intrinsische Motivation beeinflussen nicht nur <strong>die</strong> Art des Lernens,sondern auch das Verhalten im Unterricht. Bei überwiegender extrinischer Motivationwerden sich <strong>die</strong> Schüler im Wesentlichen soweit anstrengen, als sich <strong>die</strong>se Anstrengungfür sie lohnt. D.h., dass <strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong> Höhe ihrer Anstrengung im Hinblick <strong>auf</strong> ihreZiele kalkulieren. Außerdem werden sie, wenn es ihnen zur Erreichung ihrer Ziele vorteilhafterscheint, <strong>die</strong> im Unterricht geforderte Ordnung hinnehmen und sich daran halten.Ängstlichere Schüler passen sich stärker an oder reagieren hilflos, während andere,insbesondere bei Angst vor Kontrollverlust, sich eher reaktiv gegenüber der Einschränkungihrer Selbstentfaltungsmöglichkeiten verhalten, d.h. stören, aggressiv werden usw.Parallel dazu regeln sich über Rückkopplungsschleifen Selbstwert und Anspruchsniveau.Unter Bedingungen, <strong>die</strong> eher extrinsische Motivation begünstigen, werden bei Erfolgenund Misserfolgen <strong>die</strong> eigenen Leistungen mit denen anderer verglichen. Man will wissen,wie das eigene Selbst bei <strong>die</strong>sem Vergleich wegkommt. Erfolg und Misserfolg werdendann vor allem mit guter oder schwacher Begabung in Verbindung gebracht, mitgroßer oder geringer Kompetenz usw. Für leistungsschwächere Schüler können bei derRegelung des Selbstwerts Illusionen eine bedeutsame Rolle spielen. Illusionen schützenzunächst das Selbstwertgefühl. Da sie jedoch inadäquate Anspruchsniveausetzungenbegünstigen, tragen sie eher zur Vereitelung von Anstrengungen bei, weil <strong>die</strong> zu hochgesteckten Ziele ja ohnehin unerreichbar sind. Dadurch verschlechtert sich <strong>die</strong> Lage <strong>die</strong>serSchüler noch weiter.49
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAbb.: Rückkopplungsschleifen (*SelbstWert und AnspruchsNiveau)Unterrichtsbedingungen dagegen, <strong>die</strong> nicht den Vergleich der Schülerleistungen in denVordergrund stellen, begünstigen <strong>die</strong> Entstehung von intrinsischer Motivation. Schüler,<strong>die</strong> weniger an Bewertungen, sondern vor allem am Gegenstand interessiert sind, werdeneher zu hohen Anstrengungen bereit sein. Sie suchen aktiv von sich aus nach Ordnung,und wenn sie eine den Unterricht bereits bestimmende Ordnung als förderlich für ihreTätigkeit erleben, wird auch <strong>die</strong> Bereitschaft relativ hoch sein, <strong>die</strong>se Ordnung zu akzeptieren.Bei intrinsischer Motivation wird ferner Erfolg und Misserfolg weniger <strong>auf</strong> <strong>die</strong> eigeneBegabung, sondern stärker <strong>auf</strong> ausreichende oder nicht ausreichende Anstrengungenzurückgeführt. Auch Schüler, <strong>die</strong> lange brauchen, um eine Sache zu verstehen, könnenletztlich Erfolge erfahren und dadurch gelegentliche Misserfolge besser ertragen. Weilsie zur Aufrechterhaltung und Steigerung ihres Selbstwertgefühls keine Illusionen <strong>auf</strong>zubauenbrauchen, lernen sie, sich realistisch einzuschätzen und angemessene Anspruchsniveauszu wählen, was ihnen hilft, sich zunehmend zu verbessern.50
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWie man sieht, kann man das entwickelte „Modell des Schülers“ verwenden, um zu erwartendeWirkungen schulischer und unterrichtlicher Maßnahmen zu beurteilen. Da esin der Praxis <strong>auf</strong>grund der Komplexität der Zusammenhänge jedoch nicht möglich ist,jede Situation hinsichtlich aller Möglichkeiten im Schülermodell durchzuspielen, ist eswünschenswert, aus dem Modell jene wenigen allgemeinen Merkmale abzuleiten, <strong>die</strong> für<strong>die</strong> Wirkungen des Unterrichts entscheidend sind. Dar<strong>auf</strong> wird im Folgenden kurz eingegangen.6. Didaktisch bedeutsame Merkmale des UnterrichtsIm Folgenden werden jeweils zwei Merkmale einander gegenübergestellt, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> dereinen Seite der subjektivistischen oder der Sicht von innen und <strong>auf</strong> der andern der objektivistischenoder der Sicht von außen entsprechen. Sie bilden gleichsam <strong>die</strong> Maschen desdidaktischen Netzes, mit dem versucht wird, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Unterrichtswirkungen wesentlichenBedingungen einzufangen.Freiheit und Ordnung vs. FührungAufgrund ihres Bedürfnisses nach Selbstentfaltung streben Individuen nach Sicherheitund Selbständigkeit. Beides wird ermöglicht, wenn der Unterricht Freiheit für selbstbestimmtesHandeln gewährt und durch das Handeln der Schüler eine spontane Ordnungentsteht. Es ist aber genauso möglich, dass <strong>die</strong> Schüler eine bestimmte Ordnung vorfindenoder dass sie eine Ordnung vereinbaren. In jedem Fall sind Grenzen unabdingbar,um <strong>die</strong> Umgebung als regelhaft und zuverlässig zu erkennen und sich darin sinnvoll zuorientieren. Freiheit bedeutet ferner, dass den Schülern Vertrauen entgegengebrachtwird. Solches Vertrauen kann das Zutrauen des Schülers stärken, über Ziele und Vorgehensweisenselbst zu entscheiden, und trägt damit zur Gewinnung von Selbstvertrauenbei, das eine Voraussetzung für selbständiges Handeln ist.Da das Merkmal „Freiheit und Ordnung“ sich an den inneren Gegebenheiten des Schülersorientiert, wird es auch als subjektivistisches Unterrichtsmerkmal bezeichnet, währendMerkmale, <strong>die</strong> aus der Sicht von außen entstehen, objektivistisch genannt werden.Aus der Sicht von außen erscheint es als günstigste Vorgehensweise, wenn <strong>die</strong> Schülermit Hilfe der Führung durch den Lehrer zu den im Lehrplan festgesetzten Zielen gelangen.Dabei lässt ein Unterricht, in dem der Lehrer bestimmt, was zu tun ist, weniger Gelegenheitfür Selbständigkeit. Es handelt sich um eine Betonung des Ordnungsaspekts.51
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDie Schüler wissen zwar, womit sie zu rechnen haben, aber sie lernen kaum, eigene Orientierungen<strong>auf</strong>zubauen. Ihnen verbleibt dann nur eine gewisse Kontrolle über ihre eigeneAnstrengung und eine gewisse Beeinflussung der Ergebnisse.Der Vollständigkeit halber sei noch <strong>die</strong> Möglichkeit erwähnt, dass sowohl Freiheits- alsauch Ordnungsaspekt vernachlässigt werden. Unter solchen Umständen ist es den Schülernkaum möglich, Regelhaftigkeiten zu erkennen und Erwartungen <strong>auf</strong>zubauen. Freiheitohne klare Grenzen für selbstbestimmtes Handeln führt zu Unberechenbarkeit undlöst damit Angst vor Kontrollverlust aus. Unter derart starkem Stress sind Verhaltenssteuerungund Lernvorgänge erheblich beeinträchtigt.Freiheit und Ordnung einerseits und Führung andererseits sind keine absoluten Gegensätze.Vielmehr ist Freiheit und Ordnung mit Führung vereinbar, solange sie ein gewissesMaß nicht überschreitet.Abb.: Freiheit und Ordnung und andere „Führungs“stileProblemorientierung vs. ErgebnisorientierungProblemorientierung bedeutet, von Fragen der Schüler auszugehen, <strong>auf</strong> <strong>die</strong> sie eine Antworthaben möchten. Aus der Sicht von innen entspricht <strong>die</strong>ses Vorgehen dem Bedürfnisnach Selbstentfaltung, da Fragen den Ausgangspunkt für Erweiterungen des Wissensund Könnens des Einzelnen bilden. Problemorientierung steht in engem Zusammenhangmit Lernen durch Entdeckung. Indem der Schüler selbständig Antworten <strong>auf</strong> Fragensucht, setzt er sich sinnvoll mit den Dingen auseinander. Das ermöglicht es ihm, Plänebzw. Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und auszuführen. In <strong>die</strong>sem Rahmen übt er<strong>die</strong> Kontrolle über Ziele und Vorgehensweisen aus. Voraussetzung ist eine zumindestteilweise Individualisierung des Unterrichts.52
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAus der Sicht von außen ist vor allem der Lehrplan bestimmend. Unter <strong>die</strong>ser Voraussetzungwird unter Lernen im Wesentlichen <strong>die</strong> Aufnahme und Speicherung von Erkenntnissenverstanden. Ergebnisorientierter Unterricht richtet sich <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Übernahmevon Lehrstoff. Aus der Sicht der Schüler bedeutet das, dass Wissen etwas ist, das vonaußen kommt und mit ihren eigenen Erfahrungen nicht viel zu tun hat. Die Kontrolleüber den Inhalt und <strong>die</strong> Aufgaben liegt beim Lehrer, <strong>die</strong> Schüler haben aber <strong>die</strong> Möglichkeit,ihr Lernergebnis durch Fragen, verstärktes Üben usw. zu beeinflussen. Es ü-berwiegt reproduzierendes Lernen.Zwischen Problem- und Ergebnisorientierung gibt es Übergänge. Denn auch wenn <strong>die</strong>Schüler Antworten <strong>auf</strong> von ihnen selbst gestellte oder aus ihrem Sinnhorizont sich ergebendeFragen suchen, wird man von ihnen erwarten, dass sie Lexikonartikel oder Aufsätzeverwenden, <strong>die</strong> ergebnisorientiert gestaltet sind.Kooperation vs. WettbewerbDie Bedingung der Kooperation kommt aus der Sicht von innen vor allem dem Bedürfnisnach Sicherheit durch Möglichkeiten sozialer Bindung und Zusammenarbeit entgegen.Während Freiheit und Ordnung in erster Linie dem Bedürfnis nach Selbständigkeitdurch das Aufsuchen von herausfordernden Fragen, Aufgaben oder Problemen entspricht,kann Kooperation <strong>die</strong> dadurch entstehende Spannung durch Zusammenarbeit sogestalten helfen, dass <strong>die</strong> Aussicht <strong>auf</strong> Erfolg nicht zu niedrig wird und so das Gefühlder Kontrolle erhalten bleibt. Sofern <strong>die</strong> Zusammenarbeit durch das Bedürfnis nach Sicherheitim Umgang mit den eigenen Fragen oder Aufgaben reguliert wird, erfolgt sieaus einem inneren Antrieb. Die Regeln solcher Kooperation ergeben sich durch den gemeinsamenUmgang mit der Sache, sind intrinsisch motiviert, es braucht also keine Regelungvon außen.Das Unterrichtsmerkmal des Wettbewerbs ergibt sich aus Anforderungen, <strong>die</strong> von außenan <strong>die</strong> Schüler gestellt werden. Die Aufgabe der Unterscheidung nach Leistung schaffteine Situation, bei der unter grundverschiedenen Ausgangsvoraussetzungen <strong>die</strong> Schülerzu Leistungen angespornt werden sollen, hinsichtlich derer sie anschließend miteinanderverglichen werden. Wettbewerb drängt das Selbst (als Produkt) ins Bewusstsein, verstärktVergleichsprozesse und <strong>die</strong> Reflexion der eigenen Lage. Das Handeln der Schülerin einer solchen Situation ist extrinsisch motiviert.53
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAllerdings schließen Kooperationsbedingungen intrinsisch regulierten Wettbewerb nichtaus. Denn Wettbewerbe können dem Bedürfnis nach Selbständigkeit und Abenteuerentgegen kommen und <strong>die</strong> Schüler können aus einer erworbenen Stärke heraus lernen,sich Herausforderungen zu stellen, sich zu behaupten und mit unvermeidlichen Selbstwertbedrohungenkonstruktiv umzugehen. Allerdings handelt es sich dabei um Wettbewerbemit ähnlichen Voraussetzungen der Teilnehmer, und sie werden aus eigenem Antriebgesucht. Es handelt sich dabei um einen spielerischen Umgang mit Selbstwertbedrohungenoder Risiken. Durch besondere Anstrengung besteht <strong>die</strong> Möglichkeit, zu gewinnen.Der verborgene Sinn besteht aber mehr im „Verlieren lernen“, im Erwerb eineremotionalen Stabilität, <strong>die</strong> das Verlieren verkraftet.7. Schulische Rahmenbedingungen – ihr Einfluss <strong>auf</strong>Lehrer und UnterrichtUnter schulischen Rahmenbedingungen sind jene institutionellen Bedingungen zu verstehen,<strong>die</strong> das Handeln von Lehrern leiten. Über ihre Ziele, ihre innere Organisation,<strong>die</strong> jeweilige Form der Leistungsbeurteilung usw. kanalisiert <strong>die</strong> Schule Wahrnehmungund Denken und beeinflusst so das Lehrerhandeln.Es sind zwei Grundkonzeptionen von Schule zu unterscheiden, deren Ursprünge in denbeiden Auffassungs- oder Denkweisen zu sehen sind, <strong>die</strong> hier als Objektivismus (<strong>die</strong>Sicht von außen) und Subjektivismus (Sicht von innen) bezeichnet werden. Beide könnennur von den Gegebenheiten ausgehen, <strong>die</strong> sie aber unter verschiedenen Gesichtspunktenbetrachten und interpretieren.Ziele und <strong>die</strong> dadurch bedingte Lehr-/LernorganisationDie objektivistische Grundorientierung kommt meist in der Form von Lehrplänen oderIdealvorstellungen über den Schüler zum Ausdruck, <strong>die</strong> den Ausgangspunkt der Erziehungbilden. Es handelt sich also um eine Orientierung an Zielen, <strong>die</strong> von außen kommen.Diese Ziele sind im Wesentlichen das Programm der Schule. Die Realisierung desLehrplans kann am sichersten durch eine zielerreichende Organisation gewährleistetwerden. Bei größerer oder geringerer Freiheit kann der Lehrer das Programm in Schritteunterteilen und in einer vorgegebenen Menge von Stunden unterrichten. Es wird also <strong>die</strong>Führung durch den Lehrer erwartet. Die Aufgabe der Wissensvermittlung unterstütztferner <strong>die</strong> Ergebnisorientierung des Unterrichts. Da <strong>die</strong> Schüler der Klasse zumeist ge-54
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTmeinsam zum gleichen Ziel geführt werden sollen, überwiegt als Bezugspunkt <strong>die</strong> Gruppe.Bei subjektivistischer Grundorientierung müssen Lehrpläne und andere gesellschaftlicheAnforderungen zwar auch beachtet werden, aber statt als Richtlinien des Unterrichtswerden sie als Ziele und Handlungsmöglichkeiten des Schülers <strong>auf</strong>gefasst, <strong>die</strong> <strong>die</strong>sem inForm von Alternativen und Vorschlägen angeboten werden und ihm helfen, seine Kulturkennen zu lernen und wichtige Fertigkeiten zu erwerben. Nicht <strong>die</strong> Ziele, sondern <strong>die</strong>Schüler stehen im Vordergrund; man orientiert sich am Individuum. In <strong>die</strong>sem Fallbraucht man ein Programm, das von den inneren Bedingungen des Schülers ausgeht und<strong>die</strong> freie Entfaltung seiner Möglichkeiten in den Grenzen einer normativen Kultur anstrebt.Im Zusammenhang <strong>die</strong>ses übergeordneten Ziels ist der Lehrplan als Mittel zusehen und nicht als Zweck.Abb.: Vollständiges UnterrichtsmodellUnter <strong>die</strong>ser Voraussetzung, besteht <strong>die</strong> Aufgabe der Schule darin, mit Hilfe der imLehrplan genannten Inhalte einen Rahmen von Lernmöglichkeiten zu schaffen, innerhalbdessen Gelegenheiten für selbständiges wie auch geleitetes Lernen bestehen. In55
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT<strong>die</strong>sem Fall wird der Unterricht eher im Sinne von Freiheit und Ordnung organisiertsein, wobei dem Lehrer vor allem <strong>die</strong> Rolle des Beraters und Organisators zukommt,wobei sein Bezugspunkt eher der Einzelne ist.Die Organisation zur Sicherung von LeistungPrüfungsleistungen gelten als äußere Indikatoren für <strong>die</strong> nicht beobachtbare Leistungsfähigkeit.Wenn alle Schüler einer Klasse oder Lerngruppe den gleichen Stoff in derselbenWeise durchgenommen haben, können Unterschiede in den Leistungen nur durchsolche der Schüler entstanden sein. Je höher <strong>die</strong> Leistungen sind, desto eher wird erwartet,dass <strong>die</strong>ser Schüler auch später bessere Leistungen als andere erbringt. Das erfolgversprechendsteMittel zur Erzielung möglichst hoher Leistungen wird daher in der Selektionder leistungsfähigsten Schüler gesehen. Lässt der Selektionsdruck nach, wird inweiterführenden Schulen ein Sinken der Leistungen erwartet. In jedem Fall aber solldort, wo <strong>die</strong> Selektion von Individuen mit besseren Leistungen als Hauptmittel zur Leistungssicherunggilt, der Wettbewerb um Noten <strong>die</strong> Schüler zu größeren Leistungen anstacheln.Das Problem ist jedoch, dass <strong>die</strong> Schüler nun einmal verschieden sind und derWettbewerb für einige daher nur ungünstig ausgehen kann.Aus der Sicht von innen ist <strong>die</strong> Frage, wie man dem einzelnen Schüler helfen kann, sichim Einklang mit den eigenen inneren Bedingungen zu entwickeln und – auch wenn esnur in einem kleinen Bereich möglich sein sollte – möglichst hohe Leistungen zu erbringen.Diesem Zweck <strong>die</strong>nen insbesondere <strong>die</strong> Selektion der am besten geeigneten Maßnahmensowie <strong>die</strong> Aussonderung aller ungeeigneten Methoden, Maßnahmen und Organisationsformen.SchulleitungBei Vorherrschen der genannten objektivistischen Rahmenbedingungen (Orientierung anAnforderungen von außen usw.) wird <strong>die</strong> Aufgabe der Schulleitung eher darin gesehen,für <strong>die</strong> organisatorischen Voraussetzungen zur Erfüllung des Lehrplans und andererschulischer Aufgaben zu sorgen sowie <strong>die</strong> Qualität der Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.Allerdings ist häufig auch ein darüber hinausgehendes Engagement vorhanden.Anstöße zu Verbesserungen irgendwelcher Art werden meistens von der Schulleitungerwartet. Es wird also vor allem <strong>die</strong> Führungsfunktion der Schulleitung in einer hierarchischenStruktur betont.56
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBei Vorherrschen subjektivistischer Rahmenbedingungen, insbesondere aber einer verstärktenOrientierung am Schüler, nimmt <strong>die</strong> Komplexität der Aufgaben einer Schuleerheblich zu. Dem über den Lehrplan hinausgehenden Programm kommt eine größereBedeutung zu, wobei das Programm unter Partizipation von Lehrern, Schülern und Eltern(weiter)entwickelt oder den sich wandelnden Bedingungen ständig angepasst werdenmuss. Aber nicht nur <strong>die</strong> Erstellung oder Weiterentwicklung, auch <strong>die</strong> Verwirklichungeines solchen Programms erfordert eine verstärkte Kooperation.8. Unterrichtsumgebung und Lehrer-Schüler-InteraktionBesteht das Hauptziel der Schule in der lehrplangemäßen Wissensvermittlung, dannwird in der Regel der Lehrer den geforderten Stoff bzw. <strong>die</strong> geforderten Fertigkeiteneiner Klasse oder Gruppe von Schülern beizubringen suchen. Die mit weitem Abstandam häufigsten anzutreffende Unterrichtsform ist dann der Frontalunterricht. Die jeweiligenZiele sind für alle Schüler bestimmend, und meist erhalten <strong>die</strong> Schüler auch <strong>die</strong>selbenAufgaben. Dieser methodischen Standardisierung entspricht <strong>die</strong> monozentrischeOrdnung des Unterrichts mit dem Lehrer als Lenkenden.In derartigen Unterrichtssituationen können Neigungen oder Interessen der Schüler nurbegrenzt berücksichtigt werden. Der Selbstbezug der Gegenstände bleibt für <strong>die</strong> Schülerdaher eher gering ebenso wie ihre Möglichkeiten, Kontrolle über <strong>die</strong> Unterrichtsprozesseauszuüben. Insgesamt wird daher eher extrinsische Motivation vorherrschend sein, wobeiim Rahmen einer monozentrischen Ordnung wichtige Motive <strong>die</strong> Rangunterschiedebetreffen. Auch wenn Auseinandersetzungen um den Rang eher unterschwellig stattfinden,erhöhen sie doch <strong>die</strong> Selbst<strong>auf</strong>merksamkeit und binden dadurch Verarbeitungskapazität.Mit den Rangkämpfen unter den Schülern geht in der Lehrer-Schüler-Interaktionbei durchsetzungsstarken „Führern“ deren Anerkennung einher, während „schwächere“Lehrer häufig mit Herausforderungen ihres Führungsanspruchs fertig werden müssen.Orientiert sich eine Schule an dem Ziel, <strong>die</strong> Entfaltung der individuellen Möglichkeiteneines jeden zu fördern und dafür geeignete Angebote zu machen, wird der Unterrichteine große, aber überschaubare Vielfalt von Zielen, Methoden, Materialien, Möglichkeitensozialer Beziehungen usw. <strong>auf</strong>weisen. Weil <strong>die</strong> Schüler in <strong>die</strong>sem Fall weitgehendselbständig lernen, kann ihre Aktivität im Wesentlichen nur von Regeln geleitet sein, <strong>die</strong>sie im Rahmen der allgemeinen Ordnung selber in der Tätigkeit als bedeutsam entde-57
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTcken. Anweisungen des Lehrers können damit im Idealfall <strong>auf</strong> ein Minimum beschränktsein und es entsteht eine polyzentrische Ordnung.In einer Umgebung mit polyzentrischer Ordnung übernimmt der Lehrer vorwiegend <strong>die</strong>Rolle eines Beraters und Organisators. Sein Bezugspunkt ist eher der Einzelne als <strong>die</strong>Gruppe. Wenn Wahlmöglichkeiten bestehen, und wenn <strong>die</strong> Arbeit des Schülers an seinemGegenstand im Mittelpunkt steht, überwiegt <strong>die</strong> intrinsische Motivation. D.h., dasssowohl <strong>die</strong> Interaktionen zwischen Schülern als auch <strong>die</strong> Schüler-Lehrer-Interaktion inhöherem Maß sachlich geprägt sein werden.9. Schulpolitische BedingungenDie Organisation der Schule und damit <strong>die</strong> Arbeit der Schulleitung wie auch des Lehrerswerden aber nicht nur von den schulischen, sondern auch und vielleicht in noch höheremGrad von den schulpolitischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Das heißt nicht, dass<strong>die</strong> Schulen nur im Rahmen der gegebenen schulpolitischen Bedingungen handeln könnten.Denn auch wenn Schulen sicher nicht beliebige Entscheidungen treffen dürfen,könnten sie doch ihre Spielräume erweitern. Das zeigen deutlich genug einzelne Schulenwie <strong>die</strong> Helene-Lange-Schule in Wiesbaden. Aber es erfordert neben Ideen alternativerSchulgestaltung für unsere Verhältnisse außergewöhnlichen Mut und vor allem Engagement.Das kann man nicht erwarten und noch weniger kann man so etwas einfordern.Deshalb kommt es dar<strong>auf</strong> an, dass wir <strong>die</strong> schulpolitischen Bedingungen und ihre Wirkungenkennen und mögliche Alternativen dazu entwerfen.Zentrale Lenkung vs. AutonomieObjektivistisches Denken zeichnet sich <strong>auf</strong> schulpolitischer Ebene durch <strong>die</strong> Überzeugungaus, das Schulsystem als Ganzes zielbewusst lenken und fortentwickeln zu könnenoder zu müssen. Die Konsequenz ist eine zentrale Verwaltung, <strong>die</strong> alle wesentlichenEntscheidungen trifft. Dadurch wird <strong>die</strong> Zahl der Versuche stark eingeengt, <strong>auf</strong> verschiedeneAuffassungen gegründete Arten von Schule und Unterricht und entsprechendeMethoden zu realisieren und schrittweise zu verbessern.Wenn Lehrer sich nach vorliegenden Befunden für <strong>die</strong> Entwicklung der Organisationihrer Schule „nicht zuständig“ fühlen und für Zusammenarbeit mit Kollegen kaum Anlasssehen, dürfte das nicht zuletzt an <strong>die</strong>sem Mangel an Gestaltungsmöglichkeiten lie-58
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTgen. Es ist wohl kein Wunder, wenn sie sich stattdessen lieber <strong>auf</strong> den eigenen Unterrichtkonzentrieren, der ihnen mehr Handlungsmacht bietet (ECKERLE / KRAAK 1993,148 ff.). Zentrale Lenkung lässt nur eine begrenzte Nutzung der Kompetenzen von Lehrernzu und dämpft ihre Bereitschaft, sich zu engagieren.Wird der einzelnen Schule dagegen Autonomie gewährt, können Lehrer und Schüler,Eltern und hinzugezogene Berater ihre Auffassungen, Erfahrungen und Kenntnisse zurGestaltung von Schule und Unterricht einbringen.Abb.: Schulpolitische Rahmenbedingungen und ihre FolgenAutonomie bedeutet <strong>die</strong> freie Erfüllung von Aufgaben in einem Rahmen von Grundpflichten,der Spielräume für selbst zu verantwortendes Gestalten schafft. Durch eineRechenschaftspflicht gegenüber Schulträger, Schülern, Eltern lässt sich willkürlichesbzw. nicht zu begründendes Handeln einschränken. Wenn z.B. ein Grundkanon an Lehrinhaltenund Zielen vorgegeben ist, kann <strong>die</strong> Schule selbst über <strong>die</strong> programmatischen59
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTSchwerpunkte des Unterrichts, <strong>die</strong> Lehrmethoden, <strong>die</strong> Schulorganisation, <strong>die</strong> Verwendungder finanziellen Mittel und vieles andere selbständig entscheiden.Ob man <strong>die</strong> Grenzen weiter oder enger zieht, hängt vor allem davon ab, welche Unterschiedezwischen Schulen man tolerieren möchte. Denn größere Spielräume werdenauch größere Unterschiede zur Folge haben. Je nach sozialem Umfeld könnte es danndeutlich besser und schlechter ausgestattete Schulen geben. Denn Freiräume könnenverschieden genutzt und auch ausgenutzt werden. Es ist deshalb auch nicht zu erwarten,dass alle autonomen Schulen eine verstärkte Orientierung am Individuum favorisieren.Ein anderes Problem ist der Übergang von abhängigen Schulen in <strong>die</strong> Autonomie, dervon den Betroffenen nicht immer positiv <strong>auf</strong>genommen werden muss. Denn neue Spielräumeund Anforderungen können wegen der nicht abzuschätzenden Folgen Angst undAblehnung hervorrufen. Gestufte Übergänge unter Begleitung von Beratern können hierzur Entlastung beitragen 42 .Isolierung vs. ÖffentlichkeitAutonomie kann ebenso wie ein zentral gelenktes Schulsystem zu Einseitigkeiten führen.Solange Schulen oder ein Schulsystem ganz oder partiell gegen öffentliche Kritikabgeschirmt sind, entstehen kaum Anreize zur Korrektur. Abschirmung vor öffentlicherKritik entsteht vor allem durch ideologische oder weltanschauliche Isolierung. So könnensich <strong>auf</strong>grund gemeinsamer religiöser oder anderer Anschauungen der Lehrer- undElternschaft schulische Inseln bilden, <strong>die</strong> sich „einigeln“ und gegen Kritik immunisieren.So beklagt etwa SKIERA (1982, 107) einen gewissen Isolationismus an autonomen niederländischenSchulen.Die Abschirmung vor öffentlicher Kritik kann sich auch <strong>auf</strong> ein einzelnes Prinzip oderMerkmal beziehen. Ein Beispiel dafür ist das Leistungsprinzip (vgl. FEND u.a. 1976, 173ff.), das im Selbstverständnis der Schule und breiter gesellschaftlicher Schichten vonzentraler Bedeutung ist. Durch eine einseitige Auffassung von Leistung wird das Missverständnisbegünstigt, alternative Formen des Unterrichts müssten notwendig zu einerVernachlässigung des Leistungsaspekts ten<strong>die</strong>ren. Sofern Leistung nämlich mit lehrplanmäßigemUnterricht und nachfolgendem sozialem Leistungsvergleich gleichgesetztwird, müssen nicht wettbewerbsorientierte Formen der Forderung und Förderung von42Zu Problemen und Möglichkeiten der Autonomie vgl. DASCHNER / ROLFF/ STRYK 1995.60
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLeistungen, der Leistungserbringung und Leistungsbeurteilung als nonkonform hinsichtlichdes einseitig gedeuteten Leistungsprinzips erscheinen.Isolation und ideologische Abschirmung ließen sich begrenzen, wenn Schulen beispielsweisedazu verpflichtet wären, sich in einem gewissen Ausmaß und zum Zweckdes Vergleichs der Untersuchung zu öffnen und in gewissen Abständen Berichte über ihrProgramm und ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit vorzulegen. Bei vergleichenden Untersuchungenist zu beachten, dass für eine umfassende Beurteilung der Leistungen vonSchulen eine Vielzahl von Vergleichskriterien einbezogen und <strong>die</strong> Ziele der jeweiligenSchule berücksichtigt werden sollten 43 . Neben den Schülerleistungen können <strong>die</strong> Wirkungender jeweiligen Schule <strong>auf</strong> das Selbstwertgefühl oder Selbstbild ihrer Schüleruntersucht werden, <strong>auf</strong> den Grad ihrer Aggressivität, <strong>auf</strong> ihre Orientierungsschwierigkeitenbzw. ihre Verhaltenssicherheit nach dem Wechsel zu anderen <strong>Institution</strong>en, ihre Kreativität,Durchsetzungskraft, Teamgeist und Problemlösefähigkeit, ihre Beurteilungendurch Arbeitgeber, ihren Berufs- und Stu<strong>die</strong>nerfolg, ihre emotionale Stabilität und Gesundheitusw.Während Autonomie ein schulpolitisches Mittel ist, um <strong>die</strong> Kräfte und das Wissen voneinzelnen und Gruppen auszuschöpfen, ist Öffentlichkeit ein Mittel, um Informationenüber unterschiedliche schulische Problemlösungen und deren Folgen für Diskussionenund Beurteilungen aller an schulischer Bildung Interessierter bereitzustellen. In den dadurchin Gang gesetzten Prozessen könnten jene Kenntnisse und Verfahren entdeckt underprobt werden, <strong>die</strong> man zur Verbesserung von Schulen braucht.10. Gesellschaftliche Bedingungen und EinflüsseDie Auffassung, <strong>die</strong> Schule sei so, wie <strong>die</strong> Politiker sie haben wollen, trifft so einfachsicher nicht zu. Denn <strong>die</strong> Politiker richten sich ihrerseits nach dem, was aus ihrer Sichtals gesellschaftlich erwünscht und erforderlich gilt. Dabei werden in der Regel <strong>die</strong> Meinungenbeachtet, <strong>die</strong> von so genannten Meinungsführern, also beispielsweise von denVorsitzenden einflussreicher Verbände, geäußert werden. Es wird so getan, als würden<strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise <strong>die</strong> Meinungen oder Erwartungen einer großen Zahl von Menschen oderGruppen berücksichtigt. Tatsächlich aber sind es völlig anonyme Gruppen; niemandkennt <strong>die</strong> Menschen, <strong>die</strong> angeblich <strong>die</strong>se Erwartungen an <strong>die</strong> Schulen haben.43Zur Problematik der Untersuchung von Schuleffektivität vgl. Madaus/ Airasian/ Kellaghan1980.61
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDie Macht anonymer ErwartungenIn gewisser Weise unterliegen wir alle der Massensuggestion, Schulen hätten so zu sein,wie sie eben sind, mit Lehrplänen oder Bildungsstandards, <strong>die</strong> vorschreiben, was <strong>die</strong>Kinder und Jugendlichen lernen und können sollen. Wir lassen uns suggerieren, es seinotwendig so, dass Schulen im Dreiviertel-Stunden-Takt Teile lehrplanmäßig festgelegteInhalte vermitteln, dass Schüler im Hinblick dar<strong>auf</strong>, wie gut sie den vermittelten Stoffwiedergeben oder <strong>auf</strong> Prüfungs<strong>auf</strong>gaben anwenden können, beurteilt und nach einerSkala von Eins bis Sechs in Ränge sortiert werden. Wir sind so hypnotisiert davon, dassuns davon abweichende Auffassungen sinnlos, unrealistisch und gegen alle Vernunftgerichtet vorkommen. Unbedacht und unbewusst treffen wir damit ständig Entscheidungendarüber, wie über Schulen zu denken ist, wie Schulen richtig sind, was Schulen tunsollen. Unbedacht und unbewusst stimmen wir dem Geschehen in Schulen zu und bestätigendas, was geschieht als sinnvolle und richtige Handlungsweisen.Desgleichen sind <strong>die</strong> meisten Lehrer und <strong>die</strong> Schulleitungen von dem Glauben durchdrungen,es gäbe für sie gar keine andere Wahl als <strong>die</strong> Lehrpläne bzw. <strong>die</strong> Bildungsstandardsmöglichst buchstabengetreu zu befolgen, <strong>die</strong> Stundenpläne in Fetzen von 45 Minutenzu gestalten, Bewertungen der Schüler nach der Notenskala vorzunehmen, und überhauptentsprechend aller bürokratischen Vorgaben zu handeln. Diese Vorgaben umfassenetwa <strong>die</strong> Bedingungen des Vorrückens von Klassenstufe zu Klassenstufe, das Überspringenvon Klassen und <strong>die</strong> Bedingungen der Schulentlassung. Die Schulen halten sichin aller Regel an <strong>die</strong> amtlich vorgeschriebenen Klassenfrequenzen ohne nach persönlichenund situativen Gegebenheiten zu fragen und sie nehmen <strong>die</strong> ständige Aufsichtspflichtdes Lehrers und <strong>die</strong> ständige Lenkung des Schülerverhaltens willig hin – vermutlichwird Schülern auch heute noch nur einmal in der Unterrichtsstunde für wenige Minutengestattet, eigenständig und ohne Lehrereingriffe zu arbeiten (vgl. Fürstenau 1969).Die bürokratisch-organisatorischen Rahmenbedingungen der Schule und vor allem derGlaube der Lehrer und Schulleitungen, <strong>die</strong>se Bedingungen dürften nicht umgangen werden,üben jedenfalls einen enormen prägenden Einfluss aus und bilden den „heimlichenLehrplan“ der Schule (Zinnecker 1975).Aufgrund <strong>die</strong>ses heimlichen Lehrplans – oder besser, <strong>die</strong>ser Erwartungen – übernehmen<strong>die</strong> Schüler nun ihrerseits <strong>die</strong>se Erwartungen. Sie lernen, wann es ihnen erlaubt ist zusprechen, zu wem sie sprechen dürfen, wann sie <strong>auf</strong>stehen oder sich setzen dürfen, dasssie lernen müssen, was der Lehrer als geltendes Wissen darstellt, dass sie Prüfungenmachen und bestehen müssen und dabei möglichst zeigen sollten, dass sie besser sind als62
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTund Eltern häufig Widerstände gegen <strong>die</strong>sen scheinbar unvermeidlichen L<strong>auf</strong> der Dinge.Denn unser Gefühl sagt uns durchaus, dass es nicht richtig und auch nicht gut sein kann,wenn Kinder und Jugendliche in der Schule unnötig leiden, wenn sie – wie es nahezuunweigerlich geschieht –, in ihrem Selbstwert verletzt werden, wenn <strong>die</strong> Schule <strong>die</strong> ursprünglicheLernlust fast ausnahmslos tötet und <strong>die</strong> Kinder und Jugendlichen letztlichsich selbst verlieren. Die Frage drängt sich <strong>auf</strong>, ob es wirklich keine Möglichkeit gibt,<strong>die</strong>se Situation zu ändern.Entwicklung durch klar bestimmte ErwartungenDa es Schulen gibt – insbesondere solche in nicht-staatlicher Trägerschaft –, in denen<strong>die</strong> Lernfreude der Schüler nicht nur erhalten, sondern noch gestärkt wird, in denen Leistungsbewertungennicht zur Tagesordnung zählen und Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsamSchule und Unterricht und Schulleben gestalten, können <strong>die</strong> oben beschriebenenanonymen gesellschaftlichen Erwartungen und <strong>die</strong> von ihnen ausgelösten Zirkeljedenfalls nicht allmächtig sein. Der Unterschied: hier wirken nicht anonyme Erwartungen,sondern <strong>die</strong> Beteiligten wissen genau was sie erwarten und wollen. Gegen <strong>die</strong>Macht anonymer Erwartungen erstreiten sie neue und bessere Formen von Schule.Einzelne Lehrer haben es geschafft, ihre Klassen in ganz normalen staatlichen Schulen –wenn auch mit Unterstützung <strong>auf</strong>geschlossener Schulleiter – <strong>auf</strong> eine Weise lernen undarbeiten zu lassen, dass <strong>die</strong> Kinder nicht einen einzigen Schultag fehlen wollten, sich <strong>auf</strong>jeden Tag freuten. Sie haben Kindern Verantwortung übertragen und Freiheiten ermöglicht,wie vielleicht <strong>die</strong> meisten Erwachsenen sie nicht haben (neuere Beispiele dafür:Peschel 2003; Czisch 2004). Und <strong>die</strong> Kinder konnten damit umgehen. Trotz eher ungünstigerEingangsvoraussetzungen waren beispielsweise <strong>die</strong> Leistungen der Kinder inFalko Peschels Klasse überdurchschnittlich gut. Selbst Kinder, <strong>die</strong> als Fälle für <strong>die</strong> Schulefür Erziehungshilfe oder Lernbehinderten-Einrichtungen galten, schnitten wider Erwartengut ab. Selbstbestimmt und interessenorientiert zu lernen, hat <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Kinder offenbareine gesundende „normalisierende“ Wirkung. Auch den Übergang <strong>auf</strong> weiterführendeSchulen schafften <strong>die</strong> Kinder problemlos (vgl. Peschel 2003, Teil II).Tatsächlich gibt es nahezu in allen Ecken Deutschlands Schulen, <strong>die</strong> sich den anonymenErwartungen nicht anpassen und gegen den Strom schwimmen. Darunter sind auch staatlicheSchulen wie <strong>die</strong> Helene-Lange-Schule in Wiesbaden (Riegel 2004; ein lebensnahesBild solcher Schulen geben Reinhard Kahls <strong>Dokument</strong>arfilme, z.B. Kahl 2004).64
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTEltern, <strong>die</strong> solchen Schulen, ihren Lehrern und Schulleitern den Rücken stärken oder <strong>die</strong>von sich aus <strong>die</strong> Schulen in <strong>die</strong> Reform drängen, tragen zu neuen Verhältnissen in denSchulen bei. Denn offenbar lassen sich <strong>die</strong> so festgefügten Regelungen der Ministeriendoch <strong>auf</strong>weichen, wenn selbstbewusste Eltern, Lehrer und Schüler nicht <strong>auf</strong>geben, sichnicht ins Bockshorn jagen lassen und <strong>auf</strong> besseren Schulen beharren und für eine bessereund lebenswertere Zukunft der Schule kämpfen.65
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTeil IIIBeiträge zur Psychologie des Schülers11. Entwicklung von innen oder von außen?Entscheidend für unser Bild des Menschen ist, ob man ihn eher als passives Wesen betrachtet,als Empfänger von Wissen und als Imitator von Fertigkeiten. In <strong>die</strong>sem Fallmüsse <strong>die</strong> Entwicklung im Wesentlichen durch Reize von außen her gesteuert sein. Nachder anderen Auffassung ist das Individuum von Anfang an ein aktives Wesen, das einumfassendes Potenzial in sich trägt und bestrebt ist, es durch Interaktion mit seiner Umgebungzu entfalten.Derartige Vorstellungen von der Entwicklung des Menschen sind von grundlegenderBedeutung auch für Erziehung und Schule. Denn wenn der Schüler als passives Wesengilt, das erst durch allmähliche Entwicklung zu einer handelnden und denkenden Personwird, <strong>die</strong> erst mit der Zeit ihr Verhalten selber leiten kann, dann erscheint es nahe liegend,dass <strong>die</strong> Schule den Einzelnen entsprechend seiner Anpassungsfähigkeit im Hinblick<strong>auf</strong> gesellschaftliche Anforderungen und kulturelle Ideale zu formen sucht. Das ist<strong>die</strong> vorherrschende Auffassung, <strong>die</strong> unser Schulen und vielfach auch <strong>die</strong> Erziehung imElternhaus prägt.Dem steht <strong>die</strong> von der heutigen Entwicklungspsychologie vertretene Auffassung gegenüber,dass das Individuum von vornherein in der Lage ist, selbständig zu agieren undseine Anlagen im Rahmen seiner jeweiligen Umwelt zu entfalten. Erziehung kann in<strong>die</strong>sem Fall <strong>auf</strong>gefasst werden als Hilfe und Anregung bei der Entwicklung der individuellenMöglichkeiten. Eine inhaltliche Bestimmung <strong>die</strong>ser Möglichkeiten und ihrerEinschränkungen ergeben sich durch <strong>die</strong> jeweilige normative Kultur mit ihren Angebotenund Grenzen. Sehen wir uns <strong>die</strong>se beiden Theorien etwas genauer an.66
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDie These des anfänglich „leeren“ GeistesWie beginnt <strong>die</strong> Entwicklung? Ist es nicht so, dass wir anfangs erst einmal alles lernenmüssen? Wenn ein Kind <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Welt kommt, dann sehen wir in ihm einen Menschenmit einem funktionierenden Organismus. Aber geistig und von seinen Einstellungen undGewohnheiten her ist es in unserer Vorstellung noch leer. Sein Selbst ist sozusagen erstim Entstehen. Das Kind muss zwar eine ausgeprägte Lernfähigkeit besitzen, aber esscheint kaum ausgeprägte Möglichkeiten zu haben, um seine Sinneswahrnehmungen zudeuten und etwas damit anzufangen. Wie könnte es denn den Tisch im Wohnzimmer,<strong>die</strong> Stühle und Sessel und den Fernseher schon in unserem Sinn verstehen?Wir nehmen nun freilich nicht an, der Verstand sei vollkommen leer. Vielmehr gehenwir von angeborenen Dispositionen und Reflexen aus, sie sich allmählich differenzieren.Aufgrund der bahnbrechenden Arbeiten PIAGETs verbreitete sich <strong>die</strong> Überzeugung, dasNeugeborene sei ein rein sensomotorischer Organismus. Danach kann das Kind durchsensorische und motorische Erfahrungen jene Schemata erwerben, mit deren Hilfe esseine Handlungen allmählich zu koordinieren, <strong>die</strong> Gegenstände seiner Umwelt zu unterscheidenund zu klassifizieren vermag. Beim Umgehen mit Gegenständen nimmt es <strong>die</strong>durch seine Operationen hervorgerufenen Veränderungen wahr, und indem es sich <strong>die</strong>seOperationen und ihre Folgen zunehmend auch geistig vorzustellen versucht, entwickeltsich das Denken, das anfangs im werdenden Individuum noch nicht zu existieren schien.So fühlt es, dass <strong>die</strong> Beine des Tisches und der Stühle kantig sind, es erfährt, dass derTisch höher ist als <strong>die</strong> Stühle. Wenn es Spielklötze mit Händen, Mund und Augen erforscht,erkennt es ihre Form. Das Runde fühlt sich anders an als das Eckige, das Weicheanders als das Harte usw. Indem das Kind zunehmend <strong>die</strong> handelnd an konkreten Dingenvorgenommenen Operationen auch in der Vorstellung, d.h. gedanklich als interne Repräsentationvollziehen kann, bildet sich das Denken heraus (z.B. PIAGET 1971; AEBLI1975). Es unterscheidet dann gedanklich das Runde vom Eckigen, das Weiche vom Harten,selbst wenn es noch nicht über <strong>die</strong> Sprache verfügt. Daraus folgt, dass das Kind nureine fragmentarische Vorstellung der Dinge haben kann. Seine Auffassungen von derWirklichkeit müssen danach unangemessen sein, da sie aus beschränkten sinnlichen undmotorischen Erfahrungen erwachsen.Diese Theorie ist dadurch charakterisiert, dass sich <strong>die</strong> „psychischen Funktionen von derPeripherie nach innen entfalten: Wahrnehmung und Handeln entwickeln sich <strong>auf</strong> derGrundlage sensorischer und motorischer Erfahrung, und Denken entwickelt sich <strong>auf</strong> derBasis von Wahrnehmung und Handeln“ (SPELKE u.a. 1992, 605, meine Übers.). Danach67
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTgehen Wahrnehmung und Denken also vom Konkreten oder Besonderen aus. Diese Dingevergleicht das Kind; es stellt Ähnlichkeiten fest und <strong>auf</strong>grund <strong>die</strong>ser Ähnlichkeitenkonstruiert es zunehmend abstraktere Schemata oder Regeln, <strong>die</strong> ihm <strong>die</strong> Bildung vonKlassen, dadurch ein immer umfassenderes und letztlich auch immer adäquateres Verständnisder Welt ermöglichen.Die Annahme der Entwicklung des Wissens und Denkens vom Konkreten und von derPeripherie her steht in der Tradition des Sensualismus und Empirismus. Weil in unserembewussten Erleben <strong>die</strong> konkreten Einzelheiten einen bedeutenden Platz einnehmen, erscheintes uns nahe liegend, dass wir erst durch Aufnahme von Informationen über <strong>die</strong>Sinnesorgane etwas über <strong>die</strong> Welt erfahren können. Wir stellen uns vor, dass das Individuummithilfe seiner außergewöhnlichen Lernfähigkeit <strong>auf</strong> der Grundlage einiger Reflexeoder primitiver Schemata <strong>die</strong>ses Werk beginnt. Der Verstand ist danach also zunächstmehr oder weniger leer. Beinahe alles, was wir wissen und können, lernen wir durchErfahrungen, <strong>die</strong> wir durch <strong>die</strong> Sinne <strong>auf</strong>nehmen.Diese Auffassung spielt in pädagogischen Theorien eine zentrale Rolle. Aber <strong>die</strong> Annahme,dass von der Erfahrung konkreter Elemente allmählich abstrahiert und dadurchdas Denken in allgemeinen Begriffen möglich werde, ist in logischer Hinsicht problematisch.Einwände gegen <strong>die</strong> Theorie des „leeren“ GeistesEine der Schwierigkeiten ist, wie konkrete Objekte bei wiederholten Darbietungen als<strong>die</strong>selben erkannt werden können, wobei das Erkennen von Ähnlichkeiten zwischenverschiedenen Objekten einen Spezialfall <strong>die</strong>ser Frage darstellt. Die Wiedererkennungeines Objekts ist nur <strong>auf</strong> den ersten Blick eine einfache Sache. Denn je nach Entfernung,Lage, Lichteinwirkung usw. treffen immer andere Bilder <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Netzhäute <strong>auf</strong>. Angenommen,es wird bei der ersten Darbietung ein geistiges Schema des Kubus <strong>auf</strong>gebaut,dann dürfte <strong>die</strong>ses Schema nur im Ausnahmefall genau mit den weiteren Darbietungenirgendwelcher Würfel und anderer Kuben übereinstimmen. Es müssen also ständig Anpassungenvorgenommen werden, <strong>die</strong> ihrerseits jedoch allgemeine Gesichtspunkte wieGröße, Farbe, Form, Lage usw. voraussetzen.Damit stellt sich <strong>die</strong> Frage, wie zwei gleiche oder gleichartige Objekte als Elemente einerKlasse erfasst werden können. Dinge ähneln sich unter bestimmten Gesichtspunkten,nicht aber „an sich“. Sie können hinsichtlich ihrer Farbe, Form und anderen Merkmalen68
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTgleich sein, sich aber in anderen unterscheiden. Bedenkt man <strong>die</strong> Vielfalt von Bildern,<strong>die</strong> beispielsweise durch Drehen, Kippen, Spiegeln eines Gegenstandes hervorgerufenwerden, wird <strong>die</strong> Komplexität der Wiedererkennung deutlich. Offenbar müssen abstrakteGesichtspunkte, <strong>die</strong> zur Bestimmung von Ähnlichkeiten zwischen den Bildern erforderlichsind, schon vorausgesetzt werden (vgl. POPPER 1973, S. 77 ff.; !971, S. 374 ff.; VHAYEK 1952). Wenn wir solche Ähnlichkeiten mühelos erkennen, so deshalb, weil in <strong>die</strong>Sinnesorgane „antizipierende Theorien genetisch eingebaut“ sind (POPPER 1973, S. 86;kursiv im Original). Die Annahme solcher antizipierender, also abstrakter Theorien unddamit des „Primats des Abstrakten“ klingt paradox, da danach etwas Konkretes vorausgesetztwird, von dem erst zu abstrahieren ist. Möglicherweise hat <strong>die</strong>se sprachlicheSchranke <strong>die</strong> Entstehung der Auffassung behindert, dass <strong>die</strong> Erfahrung des Konkretennicht das Primäre sein kann (v. Hayek 1970, 300 ff).Grundsätzlich jedoch muss man sich fragen, wie ein „leerer“ Geist überhaupt eine Persönlichkeiterzeugen soll. Auch wenn <strong>die</strong>ser einige anfängliche Operationen ausführenkann, bleibt doch das Grundproblem, wie aus einem einfach strukturierten Geist komplexesDenken entsteht, wie ein Mensch ohne Persönlichkeit eine solche entwickelnkann usw. Diese Frage ist vor allem durch <strong>die</strong> Debatte zwischen Piaget und Chomsky<strong>auf</strong>geworfen worden (vgl. Piatelli-Palmarini 1980). In Analogie zum Computer würdesie lauten, wie aus einem einfachen Programm, das nur wenige Aufgaben bewältigenkann, sich ein neues komplexeres Programm entwickelt, das erheblich schwierigere Fragenbearbeitet. Offenbar kann der Computer das nicht ohne einen Programmierer. Dasselbegilt auch für lernende Computerprogramme, denn auch <strong>die</strong>se verarbeiten Informationennur im Rahmen einer vorgegebenen Struktur. Zwar können sie innerhalb von UnterprogrammenAnpassungen vornehmen, aber es ist es ihnen unmöglich, das <strong>die</strong>se Anpassungensteuernde Programm so umzugestalten, dass nicht nur immer komplexere,sondern auch völlig neuartige Aufgaben nicht nur damit zu bewältigen, sondern auchdamit zu finden oder aus eigener Macht zu erzeugen sind.Um <strong>die</strong>ses Paradox <strong>auf</strong>zulösen, muss man davon ausgehen, dass der Geist bereits mitabstrakten Regeln und implizitem Wissen ausgestattet ist, dass er also bereits über einSelbst verfügt. Solange man von der Annahme ausgeht, Lernen könne nur als fortschreitendeErkenntnis von konkreten Einzeldingen hin zu Abstraktionen verstanden werden,entsteht eine paradoxe Situation, weil immer etwas zustande kommen soll, für das <strong>die</strong>Voraussetzungen fehlen (Pascual-Leone 1980, Bereiter 1985). Aber <strong>die</strong>ses Paradox bestehtnur, solange man beim Lernen <strong>die</strong> Erkenntnis der konkreten Dinge als das Primäre69
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbetrachtet. Das Paradox entsteht nicht, wenn man davon ausgeht, dass das Lernen mitabstrakten Regeln beginnt (bzw. mit einem impliziten Wissen höherer Stufe).Unter der Voraussetzung einer entsprechenden Annahme ist es Chomsky gelungen, <strong>die</strong>Sprachentwicklung mit Hilfe der generativen Grammatik zu erklären. Es handelt sichdabei um ein System abstrakter Regeln, das sämtlichen Sprachen gemeinsam ist, also umeine Universalgrammatik. Wenn Kinder von vornherein über ein solches universalesRegelsystem verfügen, kann man verstehen, warum es ihnen gelingt, jede sie umgebendeSprache zu lernen. Denn das System ermöglicht es ihnen, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> jeweilige Sprachecharakteristischen Muster ihrer Umwelt zu erkennen, <strong>die</strong> sie dann in individueller Weisezur Formulierung ihrer Wünsche, Antworten oder Erkenntnisse anwenden. Auf <strong>die</strong>seWeise gelingt es ihnen, mit einer begrenzten Zahl von Wörtern, <strong>die</strong> sie lernen, eine imPrinzip unendliche Menge von Sätzen zu konstruieren (Chomsky 1977). Untersuchungenmit Kindern und Kleinkindern lassen es als wahrscheinlich erscheinen, dass ähnlicheRegelsysteme auch für das selbständige Entdecken mathematischer, physikalischer, psychischerund anderer Zusammenhänge bestehen (vgl. z.B. Spelke u.a. 1992; Wynn 1992;Leslie 1987, Tooby/Cosmides 1992, S. 91).Die These des bereits entwickelten VerstandesUm <strong>die</strong> ungeordnete Masse von Empfindungen, <strong>die</strong> von Sinneswahrnehmungen ausgehen,ordnen zu können, muss der Verstand von vornherein über Regeln, Gesichtspunkteusw. verfügen 44 . Dazu muss das Individuum z.B. beim Anblick von Dingen in der Lagesein, sich eine Vorstellung davon <strong>auf</strong>zubauen und mit <strong>die</strong>ser Vorstellung in seinem Geistumzugehen, d.h. zu denken. Diese Auffassung ist in der Tradition des erkenntnistheoretischenIdealismus (DESCARTES, KANT u.a.) verankert, nach dem alle Erkenntnis aus unsselber stammen muss.Wenn Kinder einen Verstand haben, müssen sie in der Lage sein, <strong>die</strong> Umwelt von vornhereingeordnet wahrzunehmen. Wenn wir annehmen, dass ihr Verstand ihre Wahrnehmungin dem Sinne bestimmt, als er Erscheinungen nach abstrakten Regeln beurteilt undentsprechende Erwartungen formt, um zu erfahren, ob sie bestätigt oder enttäuscht werden,so ist das bereits eine Form des Denkens. Denken ermöglicht es, Ereignisse vorherzusehen,weil der zugrunde liegende Zusammenhang <strong>die</strong> Anwendung bestimmter Regelnzulässt.44Zum Wandel der Auffassungen in der Entwicklungspsycholoigie vgl. im Überblick MANDLER 1988.70
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDie Frage ist ob man Denken nur als bewussten oder auch als unbewussten Prozess versteht.Die Anwendung nicht oder nur vage bewusster Regeln könnte vom Denken unterschiedenwerden, indem man es als „instinktives Handeln“ bezeichnet. Meist bezeichnenwir solche geistigen Vorgänge als „gefühlshaft“. Auch wenn man von etwas nur einevage Idee hat, sagt man, man habe es im Gefühl. Tatsächlich ist uns wohl das meiste, dasin unserem Verstand vor sich geht, nicht bewusst. So kann es sein, dass uns beim Sprechenoder Schreiben über ein Problem plötzlich <strong>die</strong> Lösung einfällt, <strong>die</strong> uns kurz davornoch vollkommen unbekannt war. Es ist also nicht unangebracht, Denken als Prozess zuverstehen, der sich unter verschiedenen Abstufungen von Bewusstheit vollzieht.Unbewusste, d.h. automatisch <strong>auf</strong>l<strong>auf</strong>ende Prozesse des Denkens finden wir vor allem inkomplexen Fertigkeiten wie Klavierspielen oder Radfahren, <strong>die</strong> zwar von Regeln geleitetsind, <strong>die</strong> man aber doch nicht ins Bewusstsein treten. Solche Fertigkeiten sind gewöhnlichzwar gelernt, aber <strong>die</strong> Regeln, <strong>die</strong> dabei berücksichtigt werden, werden kaumbewusst erworben. Nehmen wir als Beispiel das Billiardspiel. Auch wenn <strong>die</strong> dabei beachtetenRegeln in präzisen Formeln beschrieben werden könnten, wird es doch kaumjemanden geben, der sich ihrer bewusst wäre. Dieses Wissen würde beim Erlernen derTechniken vermutlich auch nicht viel nützen oder sogar stören. Dennoch handelt derSpieler so, als ob er <strong>die</strong> Regeln kennen würde. Selbst wenn er <strong>die</strong> Regeln formulierenkann, ist es meist eher eine Art „gefühlsmäßiges“ Wissen.Das wohl erstaunlichste Phänomen im Bereich des Könnens ist, dass Kinder <strong>die</strong> Spracheihrer Umgebung so bemerkenswert leicht und korrekt sprechen. Obwohl <strong>die</strong> zugrundeliegenden Regeln von enormer Komplexität sind, scheint der Verstand des Kindes spielerischdamit umgehen zu können. Da es aber kein bewusstes Umgehen ist, hat man <strong>die</strong>von Normen geleitete Sprachverwendung, <strong>die</strong> automatisch das Falsche vom Richtigensondert, als „Sprachgefühl“ bezeichnet (KAINZ 1956, 343).Das heißt nun freilich nicht, Denken sei vollständig dem Bereich der automatisiertenFertigkeiten zuordnen. Denkprozesse geschehen sicher nicht nur unbewusst. Denn wennman sich etwas vorstellt, etwas vergleicht, Folgerungen zieht, ein Ereignis antizipiertusw. tut man das ja bewusst. Doch auch hier spielen unbewusste Prozesse eine nichtunwesentliche Rolle. Denn auch wenn wir solche Vorgänge bewusst in Gang setzen,vollziehen sie sich letztlich von selbst. Eine Vorstellung wird nicht Schritt für Schritt<strong>auf</strong>gebaut; <strong>die</strong> Anwendung logischer Regeln erfolgt weitgehend automatisiert; wennman etwas antizipiert, ist man in der Regel erst dabei, Gründe für seine Annahme zuformulieren, d.h. dass uns das Ergebnis oft vor den Details bewusst ist; usw. (vgl. POLA-71
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTNYI 1978). Zahlreiche Denker behaupten, <strong>die</strong> wichtigsten Erkenntnisse würden durchIntuition gewonnen, d.h. durch das plötzliche Auftauchen von Lösungen im Bewusstsein(vgl. BASTICK 1982, 1 ff.).Dem Denken liegt also eine Fülle von Regeln zugrunde, <strong>die</strong> wir nicht im Einzelnen angebenkönnen. Wir wissen nicht, wie wir zu Erkenntnissen gelangen, wüsste man es,könnte man Computer entsprechend programmieren. Auch wenn das Denken durch Ü-bung verbessert werden kann, bedeutet das nicht, dass es durch bewusste Vorgänge oder<strong>die</strong> Imitation solcher Vorgänge entsteht. Die Annahme, Kinder könnten komplexe Fertigkeitenwie <strong>die</strong> Sprache durch Imitation und Verstärkung lernen, hat sich als unzutreffenderwiesen (CHOMSKY 1977). Ebenso unzutreffend dürfte <strong>die</strong> Annahme sein, sie würdendas Denken nach und nach lernen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass derVerstand von Beginn an mit Regelsystemen ausgestattet ist, <strong>die</strong> ihm das Denken vonvornherein ermöglichen. Durch Lernen kann es zwar verfeinert und weiterentwickelt,aber nicht erworben werden (z.B. v. HAYEK 1970).Wenn Denken das Umgehen mit Vorstellungen bedeutet und das Denkvermögen vonAnfang an vorhanden ist, dann müssen auch Vorstellungen über <strong>die</strong> Welt von Anfangvorhanden sein. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um solche Vorstellungen oderWahrnehmungs- bzw. Deutungsbereitschaften handelt, <strong>die</strong> eine schnelle Anpassung anverschiedene Lebensumstände ermöglichen. Das ist insbesondere bei abstrakten Regelsystemender Fall, bei denen nicht spezifische Regeln bestimmte Handlungen notwendigauslösen – wie bei Reflexen – sondern Handlungsmuster durch <strong>die</strong> Anwendung von Regelnan spezifische Situationen flexibel angepasst werden (HAYEK 1970, 312). 45 .Einer der bedeutendsten Fortschritte in der Untersuchung leitender abstrakter Regeln istdurch CHOMSKYs Formulierung der der Sprachentwicklung zugrunde liegenden generativenGrammatik gelungen. Es handelt sich um ein System abstrakter grammatischerRegeln, das sämtlichen Sprachen gemeinsam ist, also um eine Universalgrammatik.Wenn man annimmt, dass Kinder über ein solches universales Regelsystem verfügen,kann man verstehen, warum es ihnen gelingt, jede sie umgebende Sprache zu lernen.Denn das System ermöglicht es ihnen, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> jeweilige Sprache charakteristischen45Allerdings darf <strong>die</strong> Angepaßtheit von Dispositionen nicht mit ihrer Wahrheit verwechselt werden.Beispielsweise nimmt man in der idealistischen Erkenntnistheorie an, daß <strong>die</strong> unmittelbar oder a priorigegebenen, geistigen Inhalte wahr oder gewiß sein müßten. Bei einer plötzlichen Änderung der Umweltkönnte sich jedoch zeigen, daß <strong>die</strong>se Dispositionen nur unter bestimmten Bedingungen zutreffen.Der „bisherige Erfolg von Theorien“ garantiert also „keineswegs ihren Erfolg in der Zukunft“ (POP-PER 1973, S. 83).72
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTMuster zu erkennen, <strong>die</strong> sie dann in individueller Weise zur Formulierung all jener Dingeanzuwenden, <strong>die</strong> für sie gerade wichtig sind. Auf <strong>die</strong>se Weise können sie aus einerbegrenzten Zahl von Wörtern, eine unendliche Fülle von Sätzen konstruieren (CHOMSKY1977).Dieses Regelsystem ermöglicht es Kindern auch, aus einer unter bestimmten Umständenprimitiven ungrammatischen Sprache ihrer Umgebung eine differenzierte und grammatischeSprache zu formen, wie das Beispiel der Entwicklung von Kreolsprachen zeigt (imÜberblick PINKER 1996, S. 37 ff.). Die Vorläufer von kreolischen sind Pidginsprachen.Diese entstehen, wenn Menschen unterschiedlicher sprachlicher Herkunft zur Erledigungvon Aufgaben miteinander kommunizieren müssen, aber „keine Gelegenheit haben,<strong>die</strong> Sprache der anderen zu lernen“ (PINKER 1996, S. 38). Die dadurch entstehendenSprachen bestehen aus weitgehend willkürlichen Wortzusammenstellungen und weisennur Ansätze grammatischer Strukturierung <strong>auf</strong>. Interessant ist nun, dass <strong>die</strong> Kinder <strong>die</strong>serLeute, auch wenn sie nur Pidgin hören, eine Sprache von weit höherer grammatischerKomplexität entwickeln, <strong>die</strong> so genannten Kreolsprachen.Diesen Vorgang konnte man an der Entwicklung des hawaiianischen Kreol untersuchen,das Anfang <strong>die</strong>ses Jahrhunderts entstanden ist. Wegen eines akuten Arbeitskräftemangels<strong>auf</strong>grund einer plötzlichen Hochkonjunktur der Zuckerrohrplantagen wurden Arbeiteraus verschiedenen asiatischen und südamerikanischen Ländern angeworben. Die unter<strong>die</strong>sen Arbeitern sich entwickelnde Pidginsprache schienen <strong>die</strong> Leute, <strong>die</strong> BICKER-TON in den siebziger Jahren untersuchte, beibehalten zu haben. Die Kinder jedoch, <strong>die</strong> in<strong>die</strong>ser Umgebung <strong>auf</strong>wuchsen, entwickelten eine grammatisch korrekte Kreolsprache,<strong>die</strong> zwar Elemente der Sprache ihrer Umgebung <strong>auf</strong>greift, ihr aber eine Struktur zugrundelegt, <strong>die</strong> vorher nicht oder zumindest nur in Ansätzen existierte (BICKERTON 1980).Eine ganz ähnliche Entwicklung vollzog sich im Fall eines gehörlosen Jungen, der ineiner isoliert bei seinen ebenfalls gehörlosen Eltern <strong>auf</strong>wuchs. Die Eltern lernten <strong>die</strong>Gebärdensprache erst in späterem Alter und beherrschten sie nur im Sinne von Pidgin-Sprechern. Obwohl ihr Sohn nur mit <strong>die</strong>ser Sprache konfrontiert war, konnte er <strong>die</strong> Gebärdenspracheweitaus korrekter anwenden als seine Eltern (SINGELTON/ NEWPORT1993; zit. n. PINKER 1996, 44 ff.).Ein analoges Beispiel berichtet OERTER (1992, 188). Er hatte bei einem Lehrer mit rechtbegrenzten musikalischen Fähigkeiten hospitiert und dabei beobachtet, wie <strong>die</strong>ser einneues Lied in einer sehr unmusikalischen Weise einführte. Die Kinder hörten nur <strong>die</strong>sesunschöne Beispiel, beherrschten das Lied am Ende der Stunde aber viel besser, während73
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbeim Lehrer keinerlei Fortschritt zu verzeichnen war. „Offensichtlich waren es <strong>die</strong> Kinder,von denen der größte Beitrag beim Erlernen kam, obwohl sie das Lied ohne <strong>die</strong>schlechte Darstellung des Lehrers nicht gelernt hätten“(meine Übers.).Kinder lernen also nicht einfach das, was man ihnen zeigt oder was sie in ihrer Umweltwahrnehmen, sondern können Informationen im Sinne übergeordneter Regeln interpretierenund verbessern. Sie sind also in der Lage, zu gegebenen Handlungsmöglichkeitenneue und komplexere zu erfinden und <strong>die</strong> besseren auszuwählen und ihrem Tun zugrundezu legen.Denkvermögen im Sinne des Umgangs mit Vorstellungsbereitschaften werden neuerdingsan immer jüngeren Kindern festgestellt. So konnten SPELKE u.a. (1992) zeigen,dass bereits Kleinkinder im Alter von 2½ bis 4 Monaten <strong>die</strong> Fähigkeit zu korrektenSchlussfolgerungen angenommen werden kann. Für ihre Untersuchungen verwendetensie <strong>die</strong> so genannte „looking-time procedure“. Bei <strong>die</strong>sem in der Entwicklungspsychologiegebräuchlichen Verfahren wird <strong>die</strong> Zeit gemessen, in der Kinder sich Gegenständenund deren Veränderungen <strong>auf</strong>merksam zuwenden. Ist ein Gegenstand erst einmal vertraut,schaut das Baby weg; tritt jedoch eine Veränderung ein, wird seine Aufmerksamkeitwieder geweckt. Im Experiment wird das Kind zunächst mit der verwendeten Prozedurvertraut gemacht. Nach der Gewöhnung untersucht man, wie sich bestimmte Veränderungengegenüber der gewohnten Situation <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Aufmerksamkeitsspanne derKinder auswirken.In einem der Experimente hielt man einen gelben Ball durch ein Loch in einer Wand undließ ihn hinter einen Schirm fallen. Danach wurde der Schirm gesenkt und <strong>die</strong> Kindersahen den Ball. In der Gewöhnungsphase hatte er immer <strong>auf</strong> dem Boden gelegen. Jetztlag er einmal <strong>auf</strong> einer kleinen Bank, <strong>die</strong> an der Wand stand und dann darunter. Wenn er<strong>auf</strong> der Bank lag, schauten <strong>die</strong> Kinder nur geringfügig länger hin. Lag er jedoch unterder Bank, wurde ihr Blick deutlich länger festgehalten, denn eigentlich konnte er dortnicht sein, es sei denn, er wäre durch <strong>die</strong> Bank hindurch oder in einem Bogen gefallen.Die Kinder der Kontrollgruppe, bei denen bereits in der Gewöhnungsphase der Ballentweder durch ein oberes oder unteres Loch in der Wand positioniert wurde, zeigtendenn auch keinerlei Bevorzugung. Man kann also annehmen, dass <strong>die</strong> Babys davon ausgingen,dass der Ball sich nur <strong>auf</strong> einem geraden Weg bewegen und als fester Gegenstandnicht durch eine ebenfalls feste Oberfläche hindurch fallen konnte (SPELKE u.a.1992, 610 ff.).74
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTIn einem anderen Experiment <strong>die</strong>ser Reihe gab es drei Bälle, einen kleinen, einen mittlerenund einen großen. Die Bank hatte in ihrer Mitte eine Lücke, <strong>die</strong> aber für den großenBall zu klein war. Wie im ersten Experiment spielte sich alles hinter einem Schirm ab,so dass <strong>die</strong> Kinder, wenn sie nach dem Absenken des Schirms sinnvoll und nicht zufällig<strong>auf</strong> das Ergebnis reagierten, sich eine Vorstellung gebildet haben mussten. In <strong>die</strong>semFall kam es dar<strong>auf</strong> an, <strong>die</strong> Größe des Balls in Beziehung zur Größe der Lücke zu bringen.Die Aufmerksamkeit der Kinder war nur dann deutlich höher, wenn der große Ball,der nicht durch <strong>die</strong> Lücke passte, unter der Bank lag. Wenn nun <strong>die</strong> erwartungswidrigeLage des Balles <strong>die</strong> höhere Aufmerksamkeit verursacht hat, dann setzt das voraus, dass<strong>die</strong> Kinder davon ausgingen, dass feste Objekt weder andere Objekte durchdringen nochvon einer geraden Bewegung plötzlich in eine bogenförmige Bewegung übergehen, sondernstetig fallen. Außerdem mussten sie annehmen, dass Objekte ihre Größe und Formnicht ändern (ebenda, 613 ff).Weniger eindeutig fielen <strong>die</strong> Ergebnisse aus, wenn zum Verständnis der Lage eines Objekts<strong>die</strong> Berücksichtigung von Gravitation und Trägheit erforderlich waren. In der Gewöhnungsphaserollte ein Ball über eine geschlossene Bank und lag, wenn der Schirmgesenkt wurde, am anderen Ende. Im Experiment wies <strong>die</strong> Bank eine große Lücke <strong>auf</strong>.Die Aufmerksamkeit der Kinder wurde aber nicht geweckt, wenn der Ball trotzdem amanderen Ende lag. Auch beim Fallen des Balls erregte es keine Neugier, wenn der Ballohne Unterlage in der Luft stehen blieb (ebenda, 621 ff.). Andererseits scheinen 3½ Monatealte Kinder Gravitationseffekte zu erwarten, wenn sichtbare Objekte ihre Unterlageverlieren (ebenda, 626). Außerdem sind 2 und 4 Monate alte Kinder bereits in der Lage,sich bewegende Objekte mit den Augen zu verfolgen und nach ihnen zu greifen, wobeisie den Verl<strong>auf</strong> der Bewegung in Übereinstimmung mit Effekten der Trägheit extrapolieren.Außerdem richten sie sich in ihrer Haltung und der Stellung von Gliedern nachBedingungen der Gravitation (HOFSTEN 1980; PRECHTL 1989). Unsicherheit oder Inkonsistenzin den Reaktionen <strong>auf</strong> Gravitations- und Trägheitseffekte sind aber nicht nur beiKindern, sondern auch noch bei Erwachsenen häufig anzutreffen (vgl. SPELKE u.a. 1992,607 u. 626). Auch <strong>die</strong> entsprechenden Gesetze sind ja erst spät entdeckt worden.Mit Hilfe der looking-time procedure wurde u.a. auch untersucht, ob es Kleinkinder gelingt,ihre Erwartungen bei abnehmender oder zunehmender Anzahl von Gegenständenanpassen. So hat WYNN (1992) in einem Experiment mit Kindern im Alter von fünf Monatengezeigt, dass <strong>die</strong>se durchaus in der Lage sind, Vergleichsoperationen mit kleinenMengen von Gegenständen korrekt auszuführen. WYNN platzierte eine Mickeymaussichtbar in einem Kasten, vor den dann ein Schirm geklappt wurde. Anschließend sahen75
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT<strong>die</strong> Kinder eine Hand, <strong>die</strong> von der Seite eine weitere Mickeymaus hinter den Schirmstellte und sich leer zurückzog. Wenn nach dem Absenken des Schirms erwartungswidrigeine oder drei Mickeymäuse vorhanden waren, starrten <strong>die</strong> Kinder deutlich länger hinals beim richtigen Ergebnis.Bei der Subtraktion wurden sichtbar zwei Mäuse <strong>auf</strong>gestellt. Anschließend sahen <strong>die</strong>Kinder wie seitwärts eine leere Hand hinter den Schirm griff und mit einer der beidenMäuse verschwand. Fanden sich nach Absenken des Schirms dann aber drei oder zweiMäuse statt einer, konnten <strong>die</strong> Kinder ihren Blick lange nicht lösen.Andere <strong>die</strong> Anpassung an spezifische Umgebungen ermöglichende Programme könntenauch im Hinblick <strong>auf</strong> Sitten, Gebräuche und Normen bestehen. Die Vielfalt kulturellerFormen wäre so gesehen nur Ausdruck einer „einzigen menschlichen Metakultur“, derengrundlegende Regelsysteme jedem Individuum gegeben sind. Sie ermöglichen erst dasErkennen und <strong>die</strong> Anpassung an spezifische Muster sozialen Verhaltens (TOOBY/ COS-MIDES 1992, 91; vgl. ferner S. 63 ff. u. 88 ff.).Beispielweise entwickeln Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren eine Art intuitiverPsychologie. Mit Hilfe der <strong>die</strong>ser Psychologie zugrunde liegenden Regeln versuchen siedas Verhalten anderer zu verstehen. Dabei spielt u.a. <strong>die</strong> Zuschreibung von Wünschenund Überzeugungen eine zentrale Rolle. Jemand tut bestimmte Dinge (schenkt etwas,lächelt, schaut böse usw.), weil er einen bestimmten Wunsch hat und davon ausgeht,dass sein Wunsch durch <strong>die</strong>se Handlungen erfüllt wird. Diese intuitive Psychologiekonnte bei Kindern in ganz verschiedenen Kulturen nachgewiesen werden, wobei imAlter zwischen drei und fünf kulturspezifische Formen erworben werden (z.B. LESLIE1987).Darüber hinaus scheinen wir mit Präferenzregeln für bestimmte Bereiche ausgestattet.So könnte beispielsweise <strong>die</strong> Bevorzugung bestimmter Landschaften durch ein universalesProgramm geleitet sein (KAPLAN 1992).Insgesamt bestätigen zahlreiche Experimente <strong>die</strong>ser Art <strong>die</strong> Annahme, dass wir von Anfangan über Regeln verfügen, <strong>die</strong> bereits Kleinkindern ermöglichen, sich Vorgänge vorzustellenund auch <strong>die</strong> durch solche Vorgänge verdeckt bewirkten Änderungen vorherzusehen.Das Vorhandensein solcher abstrakter Regeln ist eine notwendige Voraussetzung,um sich umgebungsadäquat verhalten und Wissen über <strong>die</strong> Welt erwerben zu können.Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich zeigen würde, dass solche abstrakten Regelnallen Bereichen menschlichen Verhaltens zugrunde lägen. Weil <strong>die</strong>se Regeln uns76
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTnicht bewusst sind, kann man zunächst <strong>die</strong> dadurch geleiteten Bewertungen und Handlungennicht begründen. Es ist aber zumindest nicht unwahrscheinlich, dass Kinder „gefühlsmäßig“bereits sehr früh beispielsweise zwischen Recht und Unrecht unterscheidenkönnen, so wie sie „gefühlsmäßig“ mechanische Vorgänge beherrschen, Mengen vergleichenusw. Auch wenn das Wort „Fühlen“ einen Zusammenhang mit Emotionenvermuten lässt, dürften <strong>die</strong> zugrunde liegenden Regeln doch eher kognitiver als emotionalerNatur sein (vgl. v. HAYEK 1970, 310).Die abstrakten Regeln, <strong>die</strong> Handeln, Denken und Erkenntnisse ermöglichen, gehörenzum Ich als Selt. Durch sie ist der einzelne ein Wissender, Denkender usw. Im Unterschieddazu werden erworbene Kenntnisse, Fertigkeiten, Einstellungen usw. dem Selbstals Persönlichkeit oder Produkt zugerechnet. Man spricht ja auch von seinem Wissen,seinen Fertigkeiten, seinen Gefühlen usw. So hat auch JAMES (1890; 1950, S. 400 ff.)zwischen dem „I“ und dem „me“ unterschieden, wobei unter „I“ das Selbst als Subjektund unter „me“ das Selbst als Objekt zu verstehen ist.Handlung und Produkt: Ich und PersönlichkeitDie Annahme, dass das Individuum von Anfang an eigene Bestrebungen hat und selbstbestimmtdenken und handeln kann, setzt eine Unterscheidung des Selbst in einen handelndenTeil, das Ich, und das Ergebnis <strong>die</strong>ses Handelns, <strong>die</strong> Persönlichkeit, voraus. DieBezeichnungen sind in der Literatur verschieden und nicht so wichtig.Gehen wir von dem aus, was <strong>die</strong> Kinder schon von Anfang an „können“. Dabei mussman festhalten, dass ihr Können nicht identisch ist mit dem, was sie wissen. Die Entwicklungspsychologie,<strong>die</strong> sich mit der Entwicklung des Wissens der Kinder beschäftigthat und weniger mit ihrem Können, konzentrierte sich bei ihren Untersuchungen langeZeit <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Abhängigkeit des Wissenserwerbs von bestimmten Vorbedingungen, vondenen angenommen wurde, dass sie sich im Zuge von Reifungs- und Lernvorgängenentwickeln. Neuerdings wird zunehmend <strong>auf</strong> angeborenes Können, Denken und Wissenhingewiesen (im Überblick MANDLER 1988). Solche Befunde bestätigen Theoretiker wieCHOMSKY oder von HAYEK, <strong>die</strong> seit langem das Bestehen einer Art geistiger Überstrukturangenommen haben, <strong>die</strong> in universellen Regelsystemen besteht und <strong>die</strong> den Erwerbder Sprache, den Umgang mit Zahlen, <strong>die</strong> Orientierung in Zeit und Raum, <strong>die</strong> Unterscheidungvon Recht und Unrecht usw. ermöglichen Auch allgemeine kognitive Fähigkeitenwie das Einnehmen eines Gesichtspunkts, das Vergleichen von Gegenständen, <strong>die</strong>77
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBildung von Klassen, <strong>die</strong> Fähigkeit zu Urteilen, zum Schlussfolgern, zur Imaginationusw. scheint <strong>auf</strong> solchen universellen Regeln zu beruhen.Nun sind angeborene Regeln und Ideen aber nicht alles, denn natürlich werden <strong>die</strong> meistenFertigkeiten und das meiste Wissen nach und nach erworben. Und wir verbessernunser Wissen und unsere Regeln, indem wir fehlerhafte Dinge durch besseres Handelnund Wissen oder undifferenzierte Vorstellungen durch differenziertere ersetzen. DieEntwicklung von Fähigkeiten und Wissen folgt allgemeinen Richtlinien wie der, dassFortschritte vom Bekannten zum Unbekannten erfolgen. Sie ist also nicht völlig beliebig.So müssen Kinder, <strong>die</strong> beim Hinzufügen und Wegnehmen von Objekten korrekteErwartungen über das Ergebnis bilden, zur Gewinnung arithmetischen Wissens erst <strong>die</strong>Zahlnamen kennen, <strong>die</strong> Mächtigkeit von Mengen unterscheiden, Rechenregeln erkennenusw. Erst dann spricht man von „Wissen“ im üblichen Sinn.Um <strong>die</strong> Vorgänge besser zu überblicken, systematisieren wir nun das Ganze. Da ist alsoerstens <strong>die</strong> geistige Überstruktur – das innere Selbst – mit universalen, abstrakten Regelsystemenund dem darin implizierten Wissen. Da ist zweitens das Ich, das sich in gewissemMaß seines Denkens, Wollens, Fühlens und Handelns bewusst ist. Zum Teil setzt es<strong>die</strong>se Prozesse in Gang, zum Teil findet es sie in sich vor, identifiziert sich mit ihnen undmacht sie so zu einem Teil von sich. Da ist drittens das Produkt des Wollens, Fühlens,Denkens und Handelns, also Zuneigungen, Abneigungen, Erinnerungen, Fähigkeitenund Wissen, aber auch Neurosen, Traumen usw. Das Wahrnehmen, Fühlen, Denken undWollen, Handeln wird vermutlich nur zum kleinsten Teil vom bewussten Ich bestimmt.Der weitaus größere Teil wird einerseits von der geistigen Überstruktur bestimmt undandererseits von den erworbenen Strukturen, <strong>die</strong> das Ego teils auch bewusst verwendet.Allerdings umfassen <strong>die</strong> erworbenen Strukturen, also <strong>die</strong> Persönlichkeit aber neben denDingen, denen sich das Ego bewusst ist, auch Unter- und Unbewusstes, d.h. aus demBewusstsein verdrängte Inhalte. Diese regieren das Verhalten, Denken, Fühlen usw.durch Blockaden, Neurosen und andere Automatismen zumeist in nicht unerheblichemMaß. Andere Beeinträchtigungen des Erwerbs von Wissen, des Fühlens, Wahrnehmensusw. können erfolgen durch physische (neurologische) oder auch genetische Schädigungen,<strong>die</strong> sich <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Verarbeitung und bewusste Erfahrung wie auch <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Produkteder geistigen Verarbeitung ungünstig auswirken können.Aufgrund der geistigen Überstruktur können wir immer mehr als wir wissen, und vieles,das wir erfolgreich vollbringen können „beruht <strong>auf</strong> Voraussetzungen, <strong>die</strong> außerhalb desBereiches liegen, in dem wir Feststellungen machen, über den wir reflektieren können“78
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT(von HAYEK 1967, 61). Insbesondere bei kreativen Prozessen wird das Denken und Handelnstärker von der Überstruktur her bestimmt. Da <strong>die</strong> leitenden Regelsysteme der Ü-berstruktur aber nicht bewusst sein können, muss man sich solange <strong>auf</strong> sein „Gefühl“ für<strong>die</strong> richtigen und falschen Handlungen verlassen, bis eine brauchbare Lösung gefundenist. Dieses Gefühl ist sozusagen der bewusste Anteil <strong>die</strong>ser Prozesse, den das Ich zu erfassenin der Lage ist.Abb. 9: Interne Prozesse beim Wahrnehmen, Denken, HandelnWenn es uns gelingt, einige Bereiche der das Denken leitenden Regeln zu erschließen,setzt das wiederum Regeln einer höheren Ordnung voraus, <strong>die</strong> ihrerseits nicht kommunizierbarsind (ebenda, S. 62). 46 „Alles, worüber wir reden können und wahrscheinlichalles, über das wir bewusst nachdenken können, setzt <strong>die</strong> Existenz eines Rahmens voraus,der <strong>die</strong> Bedeutungen festlegt, d.h. ein System von Regeln, das unser Denken bestimmt,aber das wir nicht feststellen und von dem wir uns auch kein Bild formen können.In anderen können wir es nur wachrufen, insofern sie es bereits besitzen“ 47 .Diese abstrakten Regeln des inneren Selbst legen also <strong>die</strong> Bedingungen fest, in denensich unser Denken bewegt. Dieser Rahmen ermöglicht es uns durch den Umgang mitGegenständen und Personen, immer dichtere Netze von Ordnungsrelationen zu knüpfen.4647v. HAYEK (1970, 309; 1967, 60 ff.) vertritt <strong>die</strong> Auffassung, <strong>die</strong>se handlungsbestimmenden Regelsystemeseien als überbewußt zu bezeichnen, weil es Regeln sind, <strong>die</strong> uns deshalb nicht bewußt sind, weilsie sich <strong>auf</strong> einer zu hohen Ebene abspielen und nicht <strong>auf</strong> einer zu niedrigen (wie Reflexe).v. HAYEK 1967, 61 (meine Übersetzung). Eine ähnliche Auffassung vertritt, bezogen <strong>auf</strong> entwicklungspsychologischeFragen der Begriffsbildung, KEIL 1989.79
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDer Unterschied zwischen dem Kleinkind und dem Erwachsenen ist, dass <strong>die</strong>se Netzebei ersterem noch sehr lose geknüpft sind. Im Wesentlichen haben sich im L<strong>auf</strong>e derEvolution drei Arten von Netzen entwickelt, <strong>die</strong> im Bildungsprozess zu beachten sind.Es ist von ganz entscheidender Bedeutung für das Leben des Einzelnen, ob es ihm – mitHilfe seiner Umgebung – gelingt, <strong>die</strong>se in ihm von Anfang an vorhandenen Intelligenzenharmonisch <strong>auf</strong>einander abzustimmen.Die triadische Struktur der menschlichen IntelligenzDie Entwicklung des Selbst erfolgt <strong>auf</strong> drei Ebenen, entsprechend der triadischen Strukturunseres Gehirns. Die Grundlage bildet das Althirn. Es enthält das Potenzial für unseresinnlich-physische Intelligenz, physisch, weil es dazu angelegt ist, mit den konkretenDingen zu arbeiten und sich durch <strong>die</strong>sen Umgang zu entfalten. Deshalb sind zunächst<strong>die</strong> wichtigsten Werkzeuge zur Eroberung der Umgebung ja auch der sinnliche Verstandund der Körper. Dem entspricht, dass <strong>die</strong> Umgebung für den Säugling und das Kleinkindvor allem <strong>die</strong> physischen Gegebenheiten der Umwelt umfasst. So kommt es nicht vonungefähr, wenn MONTESSORI ihr Material für Kleinkinder und den Kindergarten vorallem Sinnesmaterial darstellt, wobei dann in der Grundschule noch <strong>die</strong> Kulturfertigkeitendes Lesens, Schreibens und Rechnens hinzukommen, aber ebenfalls weitgehend mitkonkretem, physischem Lernmaterial erarbeitet werden. Indem das Kind sich mit Formen,Farben, Oberflächen usw. beschäftigt, lernt es <strong>die</strong> genaue Unterscheidung vonFormen, von Farbschattierungen, der Rauhigkeit bzw. Glattheit von Oberflächen, esschult seine Gewichtsempfindungen, den Geschmacks- und Geruchssinn. Es übt somitden disziplinierten Gebrauch seiner Sinne, was eine deutlich fördernde Wirkung <strong>auf</strong> <strong>die</strong>Verstandesentwicklung hat, denn der Verstand kann nur dann gut arbeiten, wenn seinMaterial korrekt ist. Ein Großteil des Verstandesmaterials sind ja zunächst Sinneseindrücke.Die Ausbildung desjenigen Teils unseres Geistes, der an das Physische gebundenist und damit arbeitet, stellt somit <strong>die</strong> Grundlage der Bildung dar.Diese Arbeit wird am ehesten dann gut und wirklich erfolgreich sein können, wenn sievom eigenen Interesse geleitet ist. Ein Interesse ist ein Ausfluss des Bedürfnisses nachSelbstentfaltung. An einem Gegenstand Interesse zu gewinnen, setzt eine Bewertungvoraus. Dieser Bewertungsprozess erfolgt in der Regel unbewusst. Eine negative Bewertungäußert sich in Abneigung, eine positive in Bevorzugung oder Vorliebe. Es ist eineder Aufgaben der emotionalen Intelligenz, <strong>die</strong> Dinge auszusuchen, <strong>die</strong> für unsere Selbstentfaltungvon Bedeutung sind. Die emotionale Intelligenz arbeitet mit Bildern, mit Vor-80
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTstellungen von Dingen, mit Gefühlen, mit Sinn. Ihr Bestreben ist <strong>die</strong> Selbstausweitung,<strong>die</strong> Erfüllung von Bedürfnissen und Wünschen, sie sucht das Abenteuer und <strong>die</strong> Erregung.Ihre Antriebe konstituieren einen wesentlichen Teil des Willens, ihre Vorliebenund Abneigungen differenzieren sich in den ästhetischen Sinn. Diese Intelligenz ist ü-beraus kreativ. Wird <strong>die</strong>ser gestalterischen Kraft keine Möglichkeit des Ausdrucks geboten,können ihre ungeordneten Impulse zerstörerische oder despotische Charakterstrukturenerzeugen. Werden Kinder und Jugendliche aber in der richtigen Weise zu ihrereigenen Selbstvervollkommnung ermutigt, dann kann <strong>die</strong> emotionale Intelligenz aucheinen Charakter hervorbringen, der für <strong>die</strong> höchsten Ideale kämpft.Abb. 2: Triadisches Gehirn und triadische Intelligenz (nach PEARCE 1992)Die emotionale Intelligenz entwickelt sich z.B. durch <strong>die</strong> Aktion und das Erleben in derAktion. Dazu eignen sich in der Schule Rollenspiele, Theater und alle anderen Künste,der Umgang mit Sprache, Literatur, <strong>die</strong> Beziehung und der Austausch mit Anderen. DieWaldorfschule mit ihrem alle Bereiche umfassenden Programm des Geschichten-Erzählens und des künstlerischen Gestaltens gibt der Bildung der emotionalen Intelligenzgroßen Raum. Um beispielsweise ein Verständnis der griechischen Kultur zu bekommen,wird in manchen Waldorfschulen der ganze Klassenraum mit Säulen, Skulpturenund den entsprechenden Farben gestaltet; der Lehrer erzählt griechische Sagen, <strong>die</strong>Schüler spielen <strong>die</strong> Tragö<strong>die</strong>n.Ein großes Problem der emotionalen Bildung ist <strong>die</strong> Induzierung von Angst. Angst vorschlechten Noten, Angst vor der Zukunft und all <strong>die</strong> anderen Ängste behindern <strong>die</strong> Entfaltungder feineren psychischen, sozialen und ästhetischen Empfindungen, verkrampft<strong>die</strong> Vorstellungskraft, erzeugt Verunsicherung, Auflehnung, bringt Selbstzerstörungstendenzenund Konflikte hervor. Werden solche Ängste nicht durch eine unsinnige Benotungs-und Strafkultur noch vervielfältigt, dann besteht eine weit größere Bereitschaft81
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTund auch Fähigkeit, nach und nach zu sehen, was in einem selbst vor sich geht und warum.Kinder können, wenn Schuld und Strafe keine Rolle spielen, durchaus verstehen,wie sich in der Beziehung zu anderen Kindern oder Erwachsenen Handlungen und Gefühleergeben. Sie können <strong>die</strong> Folgen <strong>die</strong>ser Handlungen und Gefühle erkennen und akzeptieren.Nach und nach stellt sich eine Selbstbewusstheit ohne Schuld und Wertungein und dadurch wird es zunehmend möglich, das Fühlen und Handeln zu verändern.Bei <strong>die</strong>ser Aufgabe hilft mit wachsendem Alter der reine Verstand, <strong>die</strong> reine Intelligenz.Die reine Intelligenz entfaltet sich erstens durch das selbständige Bemühen um Erkenntnisund zweitens durch den Austausch der eigenen Ergebnisse mit anderen. Die ständigenVersuche, herauszufinden, welche Ursachen oder Zusammenhänge einer Erscheinungzugrunde liegen, führen allmählich zur Entdeckung einer abstrakten, geistigenWelt hinter den Gegenständen. Schon beim Zählen geht es nicht einfach um konkreteDinge, sondern um Mächtigkeiten von Mengen. Woraus <strong>die</strong> Mächtigkeit „3“ besteht istvöllig belanglos. Es kann sich um drei Staubkörner oder auch nur drei Ideen oder auchum drei Himmelskörper handeln. Das Merkmal der grundlegenden Abstraktheit unsererIdeen kommt allmählich zu Bewusstsein. Der Austausch der Ergebnisse des eigenenDenkens mit anderen zeigt <strong>auf</strong>, wie Erkenntnis durch Vorlieben oder persönliche Interessenverfälscht wird. Zunehmend wird den Schülern dadurch klar, wie sehr <strong>die</strong> Zieleder Erkenntnis vom physischen und emotionalen Leben abgehoben sind und von allenerkenntnisfremden Einflüssen frei gehalten werden müssen. Dazu ist zunächst vor allem<strong>die</strong> Fähigkeit der unvoreingenommenen Beobachtung wichtig. Eine große Hilfe dafür istes, wenn <strong>die</strong> physische Intelligenz daran gewöhnt wurde, <strong>die</strong> Dinge genau zu sehen undvoneinander zu unterscheiden. Dann kann der Schüler allmählich lernen, auch seine Gefühle,Interessen, Vorlieben, Abneigungen usw. in den Zusammenhängen, in denen sie<strong>auf</strong>treten, sachlich zu untersuchen und besser damit umzugehen.12. LernenWir haben gesehen, dass schon Säuglinge in der Lage sind, Informationen denkend zuverarbeiten. Da sie zumindest zum Teil bereits über adäquate Schemata verfügen, könnensie sich den verborgenen Verl<strong>auf</strong> von Ereignissen vorstellen, können auch richtigeFolgerungen ziehen und das, was ihnen schließlich als Ergebnis präsentiert wird, mitihrer Vorstellung vergleichen und dabei eventuelle Unstimmigkeiten erkennen. Nun findetman aber gerade in der Schule oft, dass Schüler versuchen, sich Dinge einfach nureinzuprägen ohne über den Lerngegenstand nachzudenken. Was ist das passiert? Warum82
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTfunktioniert <strong>die</strong> ursprüngliche Befähigung zum Denken nicht mehr? Doch nehmen wires zunächst als gegeben hin, dass Menschen beim Lernen verschiedene Vorgehensweisenoder kognitive Stile haben. Die Frage, woher das kommt, werden wir später zu beantwortensuchen.Kognitive StileUnterscheidungen von Lernstilen sind von einer Reihe von Theoretikern vorgenommenworden (im Überblick SCHÜMER 1993, 3 ff.). So beschreibt SIMONS (1992, 256 f.) unterBezug <strong>auf</strong> VERMUNT (1987) drei Vorstellungen von Lernen: reproduktives Lernen, Lernen,das vor allem <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Anwendung angeeigneter Information gerichtet ist und konstruktivesLernen. Während reproduktives Lernen vor allem in der passiven Aufnahmevon Wissensstoff besteht, wird bei den beiden anderen Lernstilen davon ausgegangen,dass das Individuum selbst Annahmen konstruiert und prüft. Reproduzierendes Lernenhat sich als deutlich weniger effektiv erwiesen als <strong>die</strong> konstruktiveren Formen. MARTON/ BOOTH (1996) unterscheiden zwischen Oberflächen- (surface) und Tiefenlernen (deeplearning). Da beim Oberflächenlernen mehr Wert <strong>auf</strong> unwesentliche Einzelheiten statt<strong>auf</strong> <strong>die</strong> zentralen Prinzipien gelegt wird, ist es auch weniger effektiv als Tiefenlernen.FEUERSTEIN (1983, 143) bezieht den Lernstil <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Selbstwahrnehmung des Individuumsals „passiven Rezipienten und Reproduzenten von Information“ im Gegensatzzur Selbstwahrnehmung als „aktiven Erzeuger von neuer Information“.Nach den im vorangegangenen Kapitel berichteten Untersuchungen, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> einen aktivenUmgang mit Informationen von den ersten Wochen an hinweisen, wäre zu erwarten,dass kognitive Stile nur unterschiedliche Formen des denkenden Umgangs beschreiben,dass beispielsweise manche schneller angemessene Deutungsmuster finden und sie effektiveranwenden oder bei Schlussfolgerungen Unterschiede in der Genauigkeit bestehenusw. Bei den genannten kognitiven Stilen bestehen <strong>die</strong> Hauptunterschiede aber darin,dass im einen Fall ein denkender Umgang und im anderen eine passive, also weniger<strong>auf</strong> Denkvorgängen beruhende Aufnahme von Informationen beschrieben wird. Währendalso Untersuchungen zur frühen kognitiven Entwicklung den denkenden Umgangmit Information als quasi natürliche Vorgehensweise darstellen, scheint das in einemspäteren Stadium nicht mehr der Fall. Wie entstehen solche Unterschiede? Es gibt zweiMöglichkeiten. Entweder werden sie durch <strong>die</strong> Umgebung hervorgerufen oder es gibtgenetische Bedingungen, <strong>die</strong> der Entwicklung von Anlagen Grenzen <strong>auf</strong>erlegen.83
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDie These der genetischen Begrenzung ist beispielsweise von JENSEN (1973) vertretenworden, der davon ausging, dass geringe kognitive Leistungen im Wesentlichen genetischbedingt seien. Nach Jensen gibt es zwei Stufen der Intelligenz. Stufe I ermöglichtnur einfache kognitive Akte assoziativer und reproduktiver Art, während Stufe II komplexeOperationen des Problemlösens, Schlussfolgerns, Abstrahierens usw. umfasst. AufStufe I sind Denkprozesse danach nur in sehr eingeschränkter, rudimentärer Form anzutreffen.Dabei ist zu bedenken, dass es nicht um zu erwartende Unterschiede in der intellektuellenLeistungsfähigkeit geht, sondern um Unterschiede in den kognitiven Grundfunktionen,<strong>die</strong> Voraussetzungen des Denkens und damit des intelligenten Verhaltenssind. Weil JENSEN <strong>die</strong>se Unterschiede als genetisch bedingt betrachtete, sah er für Individuender Stufe I keine Möglichkeit <strong>die</strong> erblich gesetzten Grenzen zu überschreiten.Man müsse sich mit <strong>die</strong>ser Lage abfinden und den Schülern, um sie nicht unnötig zuüberfordern, entsprechend beschränkte Bildungsangebote bereitstellen.Nun kann es aber sein, dass das, was nach JENSEN <strong>die</strong> Intelligenz der Stufe I bzw. StufeII ausmacht, durch Erziehungseinflüsse verursacht wird und nicht genetisch bedingt ist.Legt man <strong>die</strong>se Annahme zugrunde, dann muss man nach den Bedingungen suchen, <strong>die</strong><strong>auf</strong> der einen Seite eine Beeinträchtigung und <strong>auf</strong> der andern eine Förderung der kognitivenFunktionen zur Folge haben.Dieser Frage ist insbesondere FEUERSTEIN, im Zusammenhang mit der Untersuchung derUrsachen von Lernschwierigkeiten einer großen Zahl israelischer Immigrantenkindernachgegangen, <strong>die</strong> hinsichtlich ihrer sozialen und intellektuellen Entwicklung zwischendrei und sechs Jahren unterhalb der Altersnorm lagen. Nach FEUERSTEINS Theorie sindbei der Entstehung solcher Störungen direkte und indirekte Determinanten zu unterscheiden.Die direkte Determinante besteht in einem Mangel adäquater Lernerfahrungen48 . Als indirekte Determinanten gelten z.B. Vererbung, organische Schäden, der Anregungsgehaltder Umwelt, sozioökonomischer Status und Bildungsstand der Eltern,emotionale Ausgeglichenheit von Eltern und/oder Kind, kulturelle Differenzen usw.Diese können, wenn sie ungünstig oder defizitär sind, das Entstehen eines Mangels an48Feuerstein (1983, 13 ff) versteht unter dem, was ich hier als Mangel an adäquaten Lernerfahrungenbezeichne als „Mangel an vermittelten Lernerfahrungen“, eine Formulierung, <strong>die</strong> ich bewusst vermeide.Der Kern seiner Theorie besteht in der Annahme, dass Lernbeeinträchtigungen dann nicht eintreten,wenn Kinder und Schüler durch Vermittlung dazu angeregt werden, jene kognitiven Operationenauszuführen, <strong>die</strong> im vorliegenden Modell dem forschend-entdeckenden Lernen zuzuordnen sind. Mitder Betonung des Vermittlungsaspekts bringt sich Feuerstein jedoch in Schwierigkeiten, wenn er zumindestin einem Beispiel zwischen lernfördernden und lernbehindernden Instruktionen unterscheidet.Worum es wirklich geht, sind aber <strong>die</strong> beim Kind durch Lerngelegenheiten angeregten bzw. behindertenkognitiven Operationen.84
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTadäquaten Lernerfahrungen mit bedingen, müssen es aber nicht (FEUERSTEIN 1983, 15ff.). So kann ein niedriger Bildungsstand der Eltern dazu beitragen, dass sie ihrem Kindkeine adäquaten Lernerfahrungen vermitteln. Oder genetische Defekte oder emotionaleUnausgeglichenheit des Kindes können dessen Rezeptivität einschränken und <strong>die</strong> Umweltschließlich zu der Überzeugung bringen, dass <strong>auf</strong>grund der Mängel des Kindes alleAnstrengungen zum Misserfolg verurteilt seien.Eine andere bedeutsame indirekte oder mittelbare Ursache sind kulturelle Differenzen.Wenn Familien aus Ländern, in denen teilweise ganz andere Normen gelten, hierherkommen, kann ihr Leben durch grundlegende Veränderungen aus dem Tritt geraten.Manche Familien können derart verunsichert werden, dass sie davon ausgehen, sie könntenihren Kindern nichts weiter vermitteln als das, was augenblicklich wichtig erscheint.Hinzu kommt vielleicht, dass <strong>die</strong> Eltern sich ihrer eigenen, als unterlegen bewertetenKultur schämen und deshalb eine Reihe zusätzlicher Tabus entstehen. Die Eltern werdendann meist versuchen, das Kind ängstlich <strong>auf</strong> ein bestimmtes und als wichtig angesehenesVerhaltensrepertoire festzulegen – statt es in einer forschend-entdeckenden Weisemit der eigenen Kultur vertraut werden zu lassen.Bei anderen Familien wiederum kann <strong>die</strong> Angst vorherrschen, <strong>die</strong> Verankerung in dereigenen Kultur zu verlieren, so dass sie bei ihren Kinder in einer dogmatischen Weise<strong>die</strong> Rezeption und Reproduktion bestimmter äußerer Formen erzwingen. Die Folgensind gleich ungünstig. In jedem Fall entstehen <strong>die</strong> Schwierigkeiten einfach durch einenMangel an adäquaten, also mit der geistigen Überstruktur übereinstimmenden, also forschend-entdeckendenLernerfahrungen. Denn von <strong>die</strong>ser Überstruktur sind wir alle vonvornherein <strong>auf</strong> denken, untersuchen, selbständiges Suchen und Forschen angelegt.Es ist daher zu vermuten, dass <strong>die</strong> meisten lernbeeinträchtigten Kinder ihre kognitiveLeistungsfähigkeit durch adäquate Lernerfahrungen erheblich steigern können, d.h. dass<strong>die</strong> niedrige kognitive Leistungsfähigkeit <strong>die</strong>ser Kinder nicht angeboren und unveränderlichist. So stellte STOTT (1972, 68 f.) bei der Untersuchung langsam lernender Kindererstaunt fest, dass er nicht in der Lage schien, ein Kind zu finden, das „einfach dumm“war. In jedem, der von ihm untersuchten Fälle stieß er <strong>auf</strong> eine „Mixtur von Nachteilen,ungünstigem Temperament, emotionalen Belastungen <strong>auf</strong>grund von familiären Ängsten,sozialen Benachteiligungen, unregelmäßigem Schulbesuch, lang dauernder Krankheit,von denen jeder schon für sich gereicht hätte, um das Schulversagen zu erklären“. Umsicher zu gehen, bat STOTT <strong>die</strong> Lehrer von vier Schulen, ihm jene Kinder zu nennen, beidenen sie einfach einen Mangel an Intelligenz vermuteten und nicht andere Faktoren zu85
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTniedrigen Leistungen geführt hätten. Obwohl sie zunächst glaubten, eine Menge solcherSchüler benennen zu können, fanden sie nur wenige. Trotz einer sorgfältigen Prüfung<strong>die</strong>ser Kinder gelang es STOTT nicht in einem einzigen Fall, <strong>die</strong> schlechten Leistungen<strong>auf</strong> letztlich unbeeinflussbare Defekte zurückzuführen.Den für <strong>die</strong> kognitive Entwicklung adäquaten bzw. inadäquaten Bedingungen wird inden folgenden Kapiteln zum rezeptiv-reproduktiven sowie zum forschend-entdeckendenLernstil nachgegangen. Der rezeptiv-reproduktive Lernstil ist nach FEUERSTEIN typischfür retar<strong>die</strong>rte lernbehinderte Schüler. Es ist daher zu vermuten, dass ein Mangel an adäquatenLernerfahrungen zunächst <strong>die</strong> Entstehung eines rezipierend-reproduzierendenLernstils begünstigt, wobei dann durch dessen fortgesetzte Anwendung nach und nachernsthafte Lernstörungen und Retar<strong>die</strong>rungen <strong>auf</strong>treten.Entstehung des rezipierend-reproduzierenden LernstilsDer Ausgangspunkt für <strong>die</strong> Entstehung des rezipierend-reproduzierenden Lernstils liegtin der Einstellung der Eltern und Lehrer, nämlich in der Einstellung, Erziehung bestehein der Formung von Verhalten, von Auffassungen und Kenntnissen nach als richtig erachtetenVorstellungen der Erwachsenenwelt. Jemanden nach festen Vorstellungen formenzu wollen bedeutet, dass <strong>die</strong> Neigungen und Interessen des Kindes als nicht sowichtig gelten und übergangen werden können. Bei einer solchen Erziehung geht es vorallem um <strong>die</strong> Ergebnisse. Das Kind soll sich „richtig“ verhalten, es soll alles das beherrschen,was von Kindern in einem bestimmten Alter erwartet wird. Ein Erzieher, der sich<strong>auf</strong> Ergebnisse konzentriert, wird beispielsweise den Umgang mit einem Spielzeug inder richtigen Weise vorexerzieren und dann dar<strong>auf</strong> achten, dass das Kind das erwünschteVerhalten zeigt. Dementsprechend wird er entweder mit Lob oder Missfallen reagieren.Das Ziel des Erziehers ist <strong>die</strong> Vermittlung einer bestimmten Handlungsweise.Versuchen wir nun einmal <strong>die</strong> Sicht des Kindes einzunehmen. Es sieht wie der Erziehereinen Gegenstand behandelt. Wenn es jetzt selber versucht, mit dem Gegenstand umzugehen,was es ja nur <strong>auf</strong> seine Weise tun kann, erzeugt das Missfallen. Das Kind fragtsich nun, was <strong>die</strong>ses Missfallen ausgelöst hat und was der Erzieher erwartet. Nach einerWeile wird ihm vielleicht klar, dass <strong>die</strong>se ganz bestimmte Handlung mit dem Gegenstand,<strong>die</strong> der Erzieher immer wieder mit dem Gegenstand ausführt, von ihm erwartetwird. Da ihm aber der Zusammenhang der Handlung mit dem Gegenstand noch klar ist,erscheint ihm <strong>die</strong> Handlung ohne jeden Sinn. Führt es nun <strong>die</strong> Handlung aus, dann vorallem, um den Erzieher nicht zu enttäuschen bzw. nicht seinen enttäuschenden Reaktio-86
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTnen ausgesetzt zu sein. Solches Lernen von subjektiv sinnlosen Handlungen, Lehrsätzen(z.B. „ein Punkt ist, was keine Ausdehnung hat“) usw. erzeugt den rezeptivreproduzierendenLernstil.Das bedeutet nun allerdings nicht, dass der Umgang mit Gegenständen grundsätzlich<strong>die</strong>se Wirkung haben müsste. Wenn nämlich ein solcher handelnder Umgang immer nurdann vorgemacht wird, wenn das Kind eine gewisse Aufmerksamkeit dafür <strong>auf</strong>bringtund ohne vom Kind das Nachmachen zu fordern, wird es ihm irgendwann gelingen, ausder Abfolge der Handlungen anhand des Gegenstandes das Ziel zu erschließen. Die gemeinsameFreude darüber bedeutet dann eine Bestätigung. In <strong>die</strong>sem Fall ist das Ziel desErziehers nicht einfach ein Handlungsergebnis, sondern das Verstehen eines sachlichenZusammenhangs, nämlich des Zusammenhangs, dass es einerseits einen bestimmtenZweck gibt und andererseits bestimmte Handlungen, <strong>die</strong> seiner Erreichung <strong>die</strong>nen. Daserfordert eine gedankliche Unterscheidung <strong>die</strong>ser abstrakten Elemente und ihrer Beziehung.Dadurch kommt eine das Einzelereignis überschreitende Bedeutung zustande(Transzendenz), dass nämlich viele Dinge im Rahmen der jeweiligen Kultur zu einemoder auch mehreren Zwecken verwendet werden.Wenden wir uns nun wieder den Wirkungen einer vordringlich an festen Vorstellungen,Normen oder Ergebnissen orientierten Erziehung zu. Meines Wissens liegen nur relativwenige Untersuchungen zu <strong>die</strong>sen Wirkungen vor. In einer Untersuchung wurde festgestellt,dass Kinder, <strong>die</strong> von ihren Müttern für <strong>die</strong> richtige Betonung von Wörtern belohntund für schlechte Betonung durch Missfallensäußerungen bestraft wurden, deutlich geringereFortschritte zeigten als Kinder, deren Mütter sich kaum um <strong>die</strong> Aussprachekümmerten (NELSON/CARSKADDON/ BONVILLIAN 1973). Daraus folgt nicht, dass <strong>die</strong>beste Aussprache dadurch zu erzielen wären, indem man sich nicht um <strong>die</strong> Korrektheitoder Falschheit der Handlungen von Kindern kümmert, sondern lediglich, dass <strong>die</strong>s besserist, als <strong>die</strong> Fixierung <strong>auf</strong> bestimmte Ergebnisse. Man kann sich leicht vorstellen, dassKinder im zwanglosen Spiel mit ähnlichen Wörtern wie Maus, Haus, Laus usw. sehrschnell <strong>die</strong> Bedeutung einer deutlichen Aussprache erkennen können. Im Übrigen ist dasErkennen der Unterschiede von erheblicher Bedeutung für das Lesen und Schreiben. Soließen sich <strong>auf</strong>grund des Ausmaßes, in dem Vier- und Fünfjährige einzelne Laute unterscheiden,ihre Fortschritte im Lesen und Schreiben vier Jahre später vorhersagen (BRAD-LEY/BRYANT 1983).Die Konzentration <strong>auf</strong> Ergebnisse wird vor allem dann anzutreffen sein, wenn <strong>die</strong> Erzieher<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Einhaltung von Verhaltensnormen fixiert sind und weniger das Kind sehen,87
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTum dessen Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Das Kind erfährt dadurch immerwieder, dass es in derartigen Interaktionen mit Erwachsenen vor allem dar<strong>auf</strong> ankommt,gewünschte Reaktionen zu zeigen, eine Aufgabe willig auszuführen usw., weil es dadurchweiterem Druck entgehen kann. Bei einer solchen Orientierung an Verhaltensnormenstehen meist Instruktionen und deren Einhaltung im Vordergrund.FEUERSTEIN (1983, 21) vergleicht an einem Beispiel <strong>die</strong> Wirkung unterschiedlicher Formenvon Instruktionen. Während es im einen nur um <strong>die</strong> Ausführung einer gefordertenTätigkeit geht, wird sie im anderen Fall sachlich begründet und überschreitet damit <strong>die</strong>bloße Forderung (Transendenz).„Geh zum K<strong>auf</strong>mann und hol drei Flaschen Milch.“„Geh bitte zum K<strong>auf</strong>mann und hol uns drei Flaschen Milch, damit wir genügend fürmorgen haben, wenn <strong>die</strong> Läden geschlossen sind.“Im zweiten Fall wird das Kind in <strong>die</strong> Überlegungen, <strong>die</strong> hinter der Forderung stecken,miteinbezogen. „Wenn <strong>die</strong> Instruktion“ - vorausgesetzt, das Kind ist <strong>auf</strong>merksam undinteressiert - „noch mit dem Gedanken verbunden wird, dass <strong>die</strong> größere Menge anMilch immer vor dem Wochenende, wenn <strong>die</strong> Läden geschlossen sind, zu besorgen ist,... werden dadurch gedankliche Antizipationen über gegebene Bedingungen in einermehr oder wenig fernen Zukunft angeregt (Transzendenz), <strong>die</strong> einen Verhaltensplaneinschließen, der mit Zielen verknüpft ist, <strong>die</strong> das Verhalten leiten (Intentionalität). DerEffekt <strong>die</strong>ser Instruktion ist also nicht <strong>auf</strong> den spezifischen Inhalt beschränkt, sondernerzeugt vielmehr eine Orientierung ...“ (FEUERSTEIN 1983, 21, meine Übers.).Es scheint so einfach zu sein, forschend-entdeckendes Lernen anzuregen, und doch wirdes im Elternhaus wie in der Schule so häufig unterlassen. Warum kommt es Erziehernund Lehrern im Umgang mit Kindern und Jugendlichen so oft nur <strong>auf</strong> Ergebnisse an,d.h. <strong>auf</strong> ein bestimmtes erwünschtes Verhalten, <strong>auf</strong> in einer bestimmten Weise formulierteKenntnisse usw. Offensichtlich deshalb, weil es uns schwer fällt, Kinder und Jugendlicheals eigenständige Personen zu akzeptieren. So seltsam es scheint, es ist unerhörtschwierig für uns, andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Tatsächlich ist das eineder am schwersten zu erwerbenden Haltungen im Leben, auch wenn sie für den professionellenErzieher unerlässlich scheint.Wenn wir von Kindern vor allem <strong>die</strong> von uns gewünschten Ergebnisse erwarten, fürchteninsbesondere empfindsamere Kinder abgelehnt zu werden, wenn sie eine falscheAntwort geben. Der Druck lässt meist nach, wenn sie <strong>die</strong> Lösung nicht finden. So entdeckensie vielleicht, dass es eine nicht unangenehme Art zu leben ist, wenn sie sich dumm88
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTstellen und Antworten einfach wiederholen, weil man sich dann mehr um ihr Wohlbefindenkümmert, auch wenn ihre Denkfähigkeiten dann unentwickelt bleiben. Ähnlich istes, wenn Kinder in normorientierten Anforderungssituationen <strong>die</strong> Fertigkeit entwickeln,den Erwachsenen <strong>die</strong> Antworten zu entlocken, indem sie zögernd einen Anfang machenund dann abbrechen. Wenn sie kein ermutigendes Zeichen erhalten, greifen sie <strong>auf</strong> gutGlück zu einer anderen Lösung, bis es klappt. Auf <strong>die</strong>se Weise suchen sie den Erzieherzufrieden zu stellen (STOTT 1972, 20 ff.).Immer, wenn das Kind versucht, den Erzieher zufrieden zu stellen, unangenehmemDruck oder Missfallen auszuweichen, stehen nicht <strong>die</strong> sachlichen Zusammenhänge imMittelpunkt seiner Aufmerksamkeit, wie es der Erzieher vielleicht beabsichtigt, sondernganz andere Dinge. Die Sache bzw. <strong>die</strong> richtige Antwort wird zu einem Mittel, um einerunangenehmen Situation zu entkommen, um endlich Ruhe zu haben, um den Erwachsenenzufrieden zu stellen. Die Sache selbst kann dann schon deshalb nicht an sich interessantwerden, weil für das Kind ja gar kein solches sachliches Problem besteht. Das wäredann der Fall, wenn <strong>die</strong> Interaktion von den Problemen des Kindes ausgehen würde oderwenn es vom Erwachsenen in den Problemzusammenhang einbezogen würde. Dannkönnte man gemeinsam über <strong>die</strong> Sache nachdenken, Schritte zur Lösung ausprobierenusw. Wer dagegen Antworten lernt ohne Fragen gestellt zu haben, dem fehlt der Sinn,der Zusammenhang. Das Kind wird also versuchen, das gewünschte zu rezipieren undbei Bedarf zu reproduzieren.Nicht alle Kinder versuchen, sich einem an Normen ausgerichteten Erzieherhandeln <strong>auf</strong><strong>die</strong> eine oder andere Weise anzupassen. Es gibt auch solche, <strong>die</strong> <strong>auf</strong>sässig werden undsich gegen <strong>die</strong> Einengung ihrer Selbstentfaltungsmöglichkeiten wehren. Aber auch in<strong>die</strong>sem Fall versäumen es <strong>die</strong> Kinder, sich mit Sachverhalten auseinander zu setzen.Stattdessen geraten sie bei Lernsituationen leicht in einen emotionalen Aufruhr, der ihreEmpfänglichkeit für das Verständnis von Sachzusammenhängen beeinträchtigt. Weil sie<strong>die</strong> Erfahrung machen, dass <strong>die</strong> Reaktionen, <strong>die</strong> man von ihnen fordert, als solche sinnlossind und nur auswendig gelernt werden können, neigen auch <strong>die</strong>se Kinder zu derfatalen Ansicht, Lernen bedeute, Wissen zu Rezipieren und wieder zu Reproduzieren.Eine Auffassung, <strong>die</strong> sich auch in der Schule letztlich nur nachteilig auswirken kann.Ernste Lernstörungen und Retar<strong>die</strong>rungen treten in der Regel in den ersten Schuljahrenzutage. Es sind meist Schüler <strong>die</strong> in einer Sache versagen und denen niemand kompetenthilft, ihre Fehler zu entdecken. Meist haben sie an einer entscheidenden Stelle etwasWichtiges nicht verstanden und glauben nun, <strong>die</strong>sen Mangel an Verständnis nur durch89
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTintensiviertes (Auswendig-)Lernen wettmachen zu können. Dadurch wird der Fehleraber nicht korrigiert. Vielmehr wird Lernen, wo das Verständnis fehlt, ineffektiv. DieKinder merken das und zweifeln an ihrem Verstand. Auf <strong>die</strong>se Weise können unscheinbareSchwierigkeiten, wenn sie nicht gelöst werden, verheerende Entwicklungen zurFolge haben.Beispiele für rezipierend-reproduzierendes LernenGustav war „Sitzenbleiber“. Er musste <strong>die</strong> erste Klasse wiederholen. Der Lehrerin fiel<strong>auf</strong>, dass er „bei den ersten Wörtern des Leselehrgangs immer eine tieftraurigere Miene“machte, „obwohl er alle Wörter behielt“. Sie ging nun nicht darüber hinweg, sondernfragte ihn nach dem Grund, wor<strong>auf</strong> der Schüler ihr erklärte, dass Lesenlernen anfangszwar leicht sei, aber dann würden es immer mehr Wörter. „’Zum Schluß sind es Tausendoder eine Million, und denn kann man sie nicht mehr behalten und denn bleibt man sitzen!’“Die Lehrerin setzte ihm auseinander, er müsse etwas falsch verstanden haben unddass man sich bloß 26 Buchstaben merken müsse. Gustav wollte dar<strong>auf</strong>hin jeden Tagdrei Buchstaben lernen. Es dauerte drei Wochen, bis er lesen konnte. Zum Zeitpunkt desBerichts der Lehrerin war er ein Schüler mit vielen Ideen, der „wunderbar lesen“ konnteund „fast alle Diktate fehlerlos“ schrieb (BERT/GUHLKE 1977, S. 51).Es hätte aber auch anders ausgehen können, wenn <strong>die</strong> Lehrerin <strong>die</strong> Traurigkeit von Gustavnicht als Indikator für Schwierigkeiten gedeutet hätte. Ist bei einem „Sitzenbleiber“nicht zu erwarten, dass er beim Lesenlernen versagt? Die Lehrerin hätte davon ausgehenkönnen, dass er nicht „intelligent“ genug und/oder „lerngestört“ sei. Gustav hätte sichselbst zunehmend als unfähig betrachtet, sein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen wärenimmer weiter gesunken und hätten <strong>die</strong> Verschlechterung seiner Leistungen in anderenFächern zusätzlich begünstigt. In <strong>die</strong>sem Fall wäre er wahrscheinlich wieder „sitzengeblieben“ und am Ende vielleicht in der Sonderschule gelandet.Zu der „Störung“ des Lesenlernens kam es vermutlich, weil Gustav von der Annahmeausging, Lernen bestehe im Einprägen von Wissen, das bei Bedarf aus dem Gedächtnishervorzuholen und anzuwenden sei. Mit der Beseitigung <strong>die</strong>ser inadäquaten rezeptivreproduzierendenLernweise konnte <strong>die</strong> kognitive Leistungsfähigkeit von Gustav wiederhergestellt werden.Die Schull<strong>auf</strong>bahn von Jan bis zu einem umzugsbedingten Wechsel von einem mathematisch<strong>auf</strong> ein sprachlich orientiertes Gymnasium problemlos verl<strong>auf</strong>en: Im neuen90
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTsprachlich orientierten Gymnasium scheiterte Jan im ersten Jahr an „miserablen Zensurenin Latein und Englisch“. Der Druck des Vaters und <strong>die</strong> Misserfolgserwartungen derLehrer belasten den sensiblen Schüler enorm. Druck hat in der Regel Angst und eineerhöhte Selbst<strong>auf</strong>merksamkeit zur Folge, d.h. man verschwendet eine Menge Gedankendaran, was man falsch gemacht hat, ob man nicht genügend begabt ist usw. Dadurchwird <strong>die</strong> Verarbeitungskapazität eingeschränkt. Man reagiert nicht mehr flexibel, sondernstarr. So war es auch bei Jan; er arbeitete noch viel mehr als sonst, wiederholt eineKlasse und scheitert wieder. Der Weg zum Abitur ist damit verbaut. Außerdem ist Janunsicher geworden und hat angefangen zu stottern. Als „Notlösung“ bietet sich <strong>die</strong> Hiberniaschulean, eine Waldorfschule, an der in hohem Maß künstlerische und handwerklicheFähigkeiten gefördert werden und in der auch Berufsausbildungen möglich sind. 49 .Allein <strong>die</strong> Tatsache, dass <strong>die</strong> Lehrer dort nicht weiterhin schlechte Leistungen von Janerwarten, ist für ihn ungeheuer erleichternd. Außerdem entdeckt er im künstlerischhandwerklichenBereich herausfordernde Möglichkeiten, <strong>die</strong> seine Arbeitsfreude wecken.Das Stottern verschwindet und beim Abitur schließt er mit der „besten Englischprüfungseiner Klasse“ ab. (GESSLER 1985, S. 197, 198).Auch in <strong>die</strong>sem Fall ist anzunehmen, dass der Schüler zunächst versucht hat, <strong>die</strong> Fülledes Lernstoffes durch rezipierend-reproduzierendes Lernen zu bewältigen. Denn wer imsystematisch <strong>auf</strong>gebauten Lateinunterricht einige wichtige Zusammenhänge nicht versteht,und das durch Auswendiglernen auszugleichen sucht, muss mit zunehmenden undschließlich kaum noch zu bewältigenden Schwierigkeiten rechnen. Beim Fortschreitendes Unterrichts wird der Aufwand für <strong>die</strong> mechanische Aneignung immer größer undkann letztlich nicht mehr bewältigt werden. Denn statt einer beschränkten Zahl übergeordneterRegeln, mit deren Hilfe Texte zu entschlüsseln sind, muss der Schüler eineschier unendliche Fülle von Einzelheiten behalten. Doch reicht das nicht aus. Dennselbst wenn <strong>die</strong>se Einzelheiten zur Anwendung ständig und allesamt verfügbar wären,könnte er doch nur mit den entscheidenden Regeln herausfinden, welche relevant undwelche zu vernachlässigen sind. Für den reproduktiv Lernenden werden <strong>die</strong> Gegenstände<strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise immer undurchschaubarer. Sie werden daher auch als wenig sinnvollerlebt, so dass der Schüler schließlich resigniert.Rezeptiv-reproduktiv lernenden Schülern fällt es grundsätzlich sehr schwer ihre Kenntnisseund Fertigkeiten zu nutzen. So berichtet FEUERSTEIN (1983, 285) von Schülern, <strong>die</strong>zwar wissen, wie alt sie sind, <strong>die</strong> Jahreszahl des l<strong>auf</strong>enden Jahres kennen, subtrahierenund ad<strong>die</strong>ren können, aber <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Frage, in welchem Jahr sie geboren wurden, nicht in49Zur Hiberniaschule vgl. ausführlich RIST/SCHNEIDER 1980.91
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTder Lage sind, <strong>die</strong> richtige Antwort zu geben. Stattdessen sagen sie etwa: „Ich habe meineGeburtsurkunde nicht gesehen, aber mein Vater weiß es“. In einem anderen Fall fragteFEUERSTEIN ein Mädchen, wie lange sie zur Schule unterwegs sei. Sie sagte, sie wissees nicht. Durch Befragen fand FEUERSTEIN heraus, dass sie wusste, wann der Bus abfuhr,wann er ankam, wie viel Minuten eine Stunde hat und dass sie in der Lage war, <strong>die</strong> erforderlicheSubtraktion auszuführen. Diese Schüler glauben nur das zu wissen, was sierezipierend gelernt haben. Etwas selber herauszufinden, kommt ihnen kaum in den Sinn.Dieses Verhalten ist auch bei Erwachsenen anzutreffen, <strong>die</strong> an rezeptiv-reproduktivesLernen gewöhnt sind. So erinnere ich mich an folgende Geschichte in einem Supermarkt.Eine ältere Dame hatte ein Rezeptbuch ausgegraben, in dem <strong>die</strong> Mengen noch inDezilitern angegeben waren. Sie wollte nun wissen, wie viel Zentiliter (cl) ein Deziliter(dl) habe. Niemand konnte es sagen. Schließlich stand eine Reihe von Leuten zusammenund suchten Wissensbruchstücke hervor. Wie viel Deziliter hat denn ein Liter? Einigemeinten es müssten wohl 100 oder 10 sein, einige meinten, es wären vielleicht nur 5.Dann fing man an zu raten, wie viele Milliliter ein Liter wohl habe. Allerdings kameneinige hier dann doch zum richtigen Ergebnis. Es müssten wohl 1000 sein, so wie einMeter ja 1000 mm habe. Aber Deziliter, das wusste keiner mehr. „Es ist zu lange her,dass ich das gelernt habe.“ Schließlich gab man achselzuckend <strong>auf</strong>. Die Dame solle dochmal in der Apotheke nebenan fragen.Der Einfluß der Schule <strong>auf</strong> den rezipierend-reproduzierenden LernstilZumeist wird es als Aufgabe der Schule betrachtet, Inhalte zu vermitteln, d.h. <strong>die</strong> Ergebnisseeiner Ansammlung von Erkenntnissen. Daher verwundert es nicht, wenn Lehrerhäufig schon zufrieden sind, wenn ein Schüler <strong>die</strong>se Ergebnisse <strong>auf</strong>nehmen und richtigwiedergeben kann. Rezipierendes Lernen ist daher sehr verbreitet. Tatsächlich gilt Lernenim Alltagsverständnis als Aufnehmen, Speichern, Wiedergeben und Anwenden vonWissen bzw. Ergebnissen. Selbst im Rahmen einiger Lerntheorien wird <strong>die</strong> Auffassungvertreten, <strong>auf</strong> der untersten Stufe stünden der Erwerb von einfachen Reaktionen <strong>auf</strong> Signale,<strong>die</strong> dann zu immer komplexeren Bedeutungsmustern kombiniert, von anderenMustern unterschieden und dann zu Regeln verknüpft würden. Erst <strong>auf</strong> der höchstenStufe seien Individuen in der Lage, selbständig Probleme zu lösen und Zusammenhängezu entdecken (vgl. z.B. GAGNÉ 1973).Dieses allgemeine Verständnis von Lernen als einem Rezeptions- und Reproduktionsvorgangdürfte nicht selten dazu führen, dass Kinder <strong>die</strong>sen Lernstil bereits zuhause er-92
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTwerben. Sie werden dann mit einiger Wahrscheinlichkeit auch in der Schule fortfahren,<strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise zu lernen. Diese Bereitschaft wird noch verstärkt durch den in der Schuleverbreiteten Verbalismus, d.h. <strong>die</strong> übliche Praxis, fast alles durch Sprache zu vermitteln.So stellen MARTON / BOOTH (1996) fest, dass <strong>die</strong> oberflächlich lernenden Schülervor allem dar<strong>auf</strong> bedacht sind, sich Texte anzueignen. Sie führen das <strong>auf</strong> eine falschemonistische Ontologie der Schülers zurück, in der der Text als identisch mit der Wirklichkeitbetrachtet wird. Diese Auffassung kommt aber zustande durch <strong>die</strong> Art des Lehrensund Prüfens. Wenn Lehrtexte <strong>die</strong> Grundlage und den Maßstab von Prüfungen darstellen,wird es insbesondere Schülern, <strong>die</strong> bereits in ihrer frühen Kindheit entsprechendeErfahrungen gemacht haben, nahe liegend erscheinen, den Text selber als das zu Lernendezu betrachten 50 .Praktisches Experimentieren, Basteln von Figuren, geometrischen Körpern, handwerkliches,gärtnerisches Tun usw. wird meist nur zur Veranschaulichung oder als Ergänzungfür intellektuell weniger begabte Schüler berücksichtigt. Doch es ist vor allem das Umgehenmit Gegenständen, das <strong>die</strong> Aufmerksamkeit <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Sache selber lenkt. Darausergeben sich fast von selbst Fragen danach, wie und warum etwas funktioniert. In einemsolchen zielgeleiteten Erkunden werden kognitive Operationen des Vergleichens, derBildung von Klassen, der Schlussfolgerung, der Prüfung von Hypothesen usw. geübt.Wenn aber der schrittweise Prozess, der erst in einsichtiger Weise vom bestehendenWissen des Schülers zu einem gewünschten Ergebnis führen kann, nicht nachvollzogenoder gefunden wird, erscheint das Ergebnis als etwas, das man nicht oder nur vage undteilweise verstehen kann. Nur durch <strong>die</strong>ses Entdecken oder Nachvollziehen der einzelnenSchritte, können <strong>die</strong> Schüler jene kognitiven Grundfunktionen trainieren, <strong>die</strong> erstden Aufbau mentaler Modelle ermöglichen. Wenn sie aber nicht lernen, <strong>auf</strong>merksamDinge und Vorgänge zu beobachten, z.B. indem sie Zeichnungen von einem Gegenstandanfertigen, <strong>die</strong> sie immer weiter perfektionieren können, <strong>die</strong> sie mit Zeichnungen vonähnlichen Gegenständen vergleichen, wenn sie nicht versuchen, Dinge nach solchenselbst erkannten Merkmalen zu klassifizieren, wenn sie nicht selber Erscheinungen entdecken,<strong>die</strong> sie durch <strong>die</strong> Annahme verborgener Zusammenhänge zu erklären suchenusw., werden sie kaum lernen, wie man selber eine Ordnung in einem Wust von Faktenschaffen kann. Werden sie nicht zu solchen geistigen Prozessen angeregt, verlernen sieletztlich das Lernen.50Zur Bedeutung der Unterscheidung von Wirklichkeit, Theorien über <strong>die</strong> Wirklichkeit vgl. LEHNER1994, 40.93
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAls beispielsweise BAIRD (1986) Schüler der 9. und 11. Klasse fragte, ob sie sich wünschenwürden, effektiver lernen zu können, sagten fast alle ja. Aber <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Frage, wassie dazu tun könnten, meinten <strong>die</strong> meisten, sie müssten sich besser konzentrieren undhärter arbeiten. Da <strong>die</strong> Aufgabe der Lehrer vor allem darin besteht, den Schülern Inhaltezu präsentieren, <strong>die</strong> <strong>die</strong>se rezipieren und verstehen sollen, und da ja auch LerntheorienLernen erst <strong>auf</strong> den obersten Stufen als Problemlösen durch selbständiges Handeln <strong>auf</strong>fassen,ist nicht zu erwarten, dass Lehrer hier eine abweichende Ansicht vertreten. Daszeigte sich auch in einem zweijährigen Versuch zum selbständigen Lernen, in dem mancheLehrer größere Schwierigkeiten hatten, sich mit ihrer Rolle als Beschaffer von Materialabzufinden als <strong>die</strong> Schüler, <strong>die</strong> das Lernen zwar als mühsam, aber befriedigend erlebten.Aufgrund der Erfahrungen im Versuch nehmen BECK u.a. (1991, 758 ff) an, dass<strong>die</strong> Lehrer sich während des Übergangs als Lernberater noch nicht hinreichend kompetentfühlen und <strong>die</strong> Forderungen der nicht nur selbständiger, sondern hinsichtlich der Artder Kommunikation und Aufgaben zugleich auch anspruchsvoller werdenden Schülerzunächst fürchten.Nun darf man sich rezeptives Lernen nicht so vorstellen, als würden <strong>die</strong> Schüler denStoff einfach wie sinnlose Silben auswendig lernen. Vielmehr verstehen <strong>die</strong> Schüler Teile,bei anderen Teilen haben sie zumindest eine Ahnung, aber <strong>die</strong> größeren Zusammenhängebleiben der Mehrheit verborgen wie Untersuchungen an Schulabgängern zeigen(HÄUSSLER 1990; NOLTE-FISCHER 1989; SVINGBY 1991). Rezeptiv-reproduktives Lernendürfte im ergebnisorientierten Unterricht bei fast allen Schülern verstärkt in den Fächernanzutreffen sein, für <strong>die</strong> sie nur wenig Interesse <strong>auf</strong>bringen. Auch wenn nicht immerernste Lernstörungen entstehen, können doch Möglichkeiten der Schüler verschüttetwerden.Selbständiges Forschen und Entdecken bei KindernWährend rezeptiv-reproduktives Lernen in der Abhängigkeit von äußeren Quellen desWissens wurzelt, beruht forschend-entdeckendes Lernen <strong>auf</strong> dem selbständig denkendenUmgang mit Information. Es bedeutet immer, von einer Frage oder einem Problem auszugehen.Ein Problem entsteht dann, wenn ein Geschehen oder eine Information einerbestehenden Erwartung widerspricht. Erwartungen wiederum bedeuten, dass bereits eineVorstellung oder eine intuitive Theorie der Dinge, mit denen es das Individuum zu tunhat, vorhanden ist. Nach dem Alltagsverständnis ist es jedoch so, dass <strong>die</strong>se Grundlagenerst geschaffen werden müssen. Auch in der Lerntheorie ging man lange davon aus, zu-94
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTerst seien Wissenselemente zu erwerben, <strong>die</strong> als Ausgangspunkt für <strong>die</strong> Bildung vonBegriffen <strong>die</strong>nen, <strong>die</strong> wiederum zu Regeln kombiniert werden können usw.Bei der Untersuchung von Begriffsbildungsprozessen gingen Entwicklungspsychologenlange davon aus, dass <strong>die</strong> Kinder mit der Sammlung von Informationen z.B. über dasAussehen von Dingen beginnen, <strong>die</strong> sie dann vergleichen, nach Ähnlichkeit ordnen usw.bis sie schließlich zu jenen Merkmalskombinationen gelangen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Begriffe ausmachen.Inzwischen sieht <strong>die</strong> Forschung das aber anders. Es wird angenommen, dass <strong>die</strong>Kinder von allgemeinen Vorstellungen oder intuitiven Theorien ausgehen, innerhalbderer <strong>die</strong> Dinge eine bestimmte Bedeutung haben, <strong>die</strong> sie im Zuge der Anpassung an <strong>die</strong>Realität differenzieren. Danach müssen sie also bereits über „Theorien“ oder Begriffeverfügen, <strong>die</strong> es ihnen ermöglichen, Ereignisse und Dinge ihrer Umgebung sinnvoll zudeuten. Einzeldinge sind für sich bedeutungslos, erst innerhalb übergreifender Vorstellungenerhalten sie eine Bedeutung. Deshalb kann ein Roboter nichts mit Erscheinungenanfangen, für <strong>die</strong> ihm keine Wahrnehmungskriterien einprogrammiert worden sind.Um <strong>die</strong> Annahme zu prüfen, ob Kinder im Umgang mit Tierarten von intuitiven Theorienausgehen, führte KEIL (1989) Untersuchungen mit Geschichten von Verwandlungendurch. Es ging um Lebewesen und künstliche Gegenstände. Beispielweise erzählte KEILKindern im Vorschul- und Kindergartenalter von einem Tierarzt, der einem krankenTigerbaby eine Tablette gibt. Aber <strong>die</strong> Tablette hat unerwartete Nebenwirkungen. Dennals es dem Tigerbaby wieder besser ging und es größer wurde, verlor es <strong>die</strong> Streifen undum den Hals es wuchs ihm eine Mähne. „Jetzt wo es ausgewachsen ist, sieht es so aus(der Versuchsleiter zeigt dem Kind ein Bild). Ist es ein Tiger oder ein Löwe?“ (S. 222).Daneben gab es auch Verwandlungen durch bloße Veränderung des Aussehens (Überstreichenvon Streifen, ankleben von Mähnen usw.).Jüngere Kinder rechtfertigen den Wandel von einer zur anderen Tierart damit, dass <strong>die</strong>Spritze, Pille oder <strong>die</strong> Vitamine den Endzustand des Tieres verändert hätten, obgleichsie, wenn <strong>die</strong> Verwandlung nur das Äußere betraf, verneinten, dass das Aussehen dasWesen eines Tieres ändern könne. Ältere Kinder beharren dar<strong>auf</strong>, dass eine Tierart nichtgeändert werden könne und geben dafür verschiedene Gründe an. Für einige ist es entscheidend,als was ein Tier geboren wurde, andere behaupten kategorisch, ein Tier könnenicht in ein anderes verwandelt werden oder meinen, dass sich nur sein Äußeres veränderthabe (S.223 ff).In jedem Fall gehen <strong>die</strong> Kinder von allgemeinen Annahmen aus, innerhalb derer sie <strong>die</strong>geschilderten Verwandlungen, d.h. <strong>die</strong> Art, zu der ein Tier gehört, interpretieren. Aber95
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTjüngere Kinder sind im Gegensatz zu älteren eher geneigt, innere Verwandlungen durchSpritzen usw. für möglich zu halten. Ein Kind ging vom Verhalten aus. Wenn eineBlaumeise nach einer Vitaminspritze wie ein Gelbfink singt, dann müsse <strong>die</strong>ser Vogelauch <strong>die</strong> innere Natur eines Finken besitzen, denn sonst würde er doch wie eine Blaumeisesingen.Ganz sicher waren <strong>die</strong> Kinder bei Verwandlungen künstlicher Gegenstände. Ein <strong>auf</strong>ziehbarerSpielzeugvogel, dem Ärzte eine kleine Maschine einbauen, damit er singen kann,dem sie in einer Schönheitsoperation richtige Federn ankleben und einen schönerenSchnabel machen, dem sie den Aufziehschlüssel entfernen und eine weitere Maschineeinbauen, damit er mit den Flügeln schlagen, umherfliegen und pfeifen kann, ist für <strong>die</strong>Kinder nach wie vor kein richtiger Vogel. Ferner waren sie auch in der Lage, Bilder mitLebewesen und Artefakten korrekt zu sortieren, auch wenn es sich dabei um unvertrauteGegenstände und Lebewesen handelte (z.B. ein Ionisiergerät mit dänischem Design undeine unbekannte Kaktusart), denen artuntypische Phantasienamen gegeben wurden.Untersuchungen <strong>die</strong>ser Art zeigen, dass „Vorschul- und sogar Kindergartenkinder systematischeVorstellungen davon haben, wodurch charakteristische Merkmale von Tierenentstehen können und wodurch nicht“. Sie verstehen, „dass typische äußere Kennzeichenallein nicht ausreichen, um <strong>die</strong> Zugehörigkeit zu einer bestimmten Tierart festzustellen;man muss auch berücksichtigen, wie <strong>die</strong>se Merkmale entstanden sind. ... <strong>die</strong>se Kinderbetten ihre Begriffe ein in einen Zusammenhang systematisch verknüpfter Vorstellungenund interpretieren Begriffsmerkmale in <strong>die</strong>sem Rahmen...“ 51Wenn nun Kinder in verschiedenen Bereichen über zwar naive oder intuitive, für dasAlltagsverständnis jedoch hinreichende Theorien oder Vorstellungen verfügen, ist damit<strong>die</strong> entscheidende Voraussetzung für forschend-entdeckendes Lernen erfüllt. Einschränkendist allerdings hinzuzufügen, dass das nur zutrifft, wenn solche „Kerntheorien“ bzw.abstrakte Regelsysteme für alle Bereiche vorhanden sind, was neuerdings insbesondereim Rahmen der evolutionären Psychologie nachzuweisen versucht wird (z.B. TOO-BY/COSMIDES 1992). Danach verfügen Kinder über eine intuitive Mechanik, Vorstellungenvon Zahl, Zeit und Raum, eine intuitive Psychologie, Gerechtigkeitssinn, einen Sinnfür Verwandtschaft usw. Man kann sie sich als Regelsysteme oder Programme für <strong>die</strong>51KEIL 1989, 246, meine Übers. Diese Auffassung scheint in der Entwicklungspsychologie inzwischenweithin akzeptiert (z.B. CAREY 1985;WELLMAN 1990;GELMAN/MARKMAN 1987) .96
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTEntwicklung von Fertigkeiten und Theorien vorstellen, ähnlich der Transformationsgrammatikfür den Bereich Sprache (vgl. Chomsky 1977; FODOR 1983) 52 .Kognitive Operationen beim forschend-entdeckenden LernenNach allgemeiner Auffassung wird schulisches Lernen immer zu einem mehr oder wenigergroßen Teil in der Rezeption und Reproduktion von Wissen bestehen müssen.Damit ist aber offensichtlich nur gemeint, dass <strong>die</strong> Schüler nicht alles selber entdeckenkönnen. Forschend-entdeckendes Lernen kann aber beispielsweise auch im Nachvollzugvon Forschungs- und Entdeckungsprozessen bestehen. Es kommt nicht so sehr dar<strong>auf</strong>an, alles vollständig selbst zu entdecken. Entscheidend ist, dass <strong>die</strong> Lernenden <strong>die</strong> Sache,um <strong>die</strong> es geht, verstehen, statt Aussagen darüber in ihrem Gedächtnis zu speichern.Verstehen bedeutet, Informationen im Rahmen der eigenen Vorstellung eines Gegenstandsanzuwenden, zu untersuchen oder zu erproben. Das Behalten der Lerngegenständeist eher Nebenprodukt als Ziel. Es sind also vor allem <strong>die</strong> kognitiven Operationen wichtig,<strong>die</strong> Kinder und Schüler anwenden und durch deren Übung sie ihre mentalen Anlagenentwickeln 53 .Der Gebrauch der SinneDer Gebrauch der Sinne wird durch Aufgaben im Zusammenhang mit konkreten Gegenständengefördert. Der Umgang mit Dingen hat den Vorzug, dass <strong>die</strong> Lernenden dadurchüber eine Kontrolle für Behauptungen von Unterschieden, Gemeinsamkeiten oder Folgenvon bestimmten Operationen verfügen. Außerdem wird dadurch das Interesse an derSache selber geweckt, wodurch <strong>die</strong> Neigung zur Rezeption umgangen wird. Vor allemaber kann durch <strong>die</strong> sinnenhafte Kontrolle der Drang der Schüler nach Perfektion, nach5253Gegen <strong>die</strong> Auffassung des umfassend von der Gesellschaft geprägten Individuums hat der PhilosophBERGSON ( 1 1932; 1980, 97) eingewandt: „Aber damit <strong>die</strong> Gesellschaft existiere, muss zunächst das Individuumein Gesamt von eingeborenen Anlagen mitbringen; <strong>die</strong> Gesellschaft erklärt sich also nichtvon selbst; folglich muss man unterhalb der sozialen Errungenschaften nachgraben, und so gelangtman zum Leben, von dem <strong>die</strong> menschlichen Gesellschaften, wie ja das ganze Menschengeschlecht,nur Manifestationen sind.“Die Einengung <strong>auf</strong> rezeptiv-reproduktives Lernen wirkt sich ja deshalb so behindernd <strong>auf</strong> <strong>die</strong> kognitivenFunktionen aus, weil nur wenige Operationen gebraucht und geübt werden. Im Grunde ist aberauch rezeptives Lernen ein forschend-entdeckender Vorgang. Denn etwas Behalten zu wollen erfordertja, daß der Lernende Strategien entwickelt, um sich <strong>die</strong> Dinge einzuprägen. Dazu zählen etwa derBau von Eselsbrücken, Rhythmisierungen, <strong>die</strong> Einbindung in Ordnungs oder Bedeutungszusammenhänge,<strong>die</strong> allerdings der Sache selbst nicht entsprechen müssen usw. Das bedeutet immer noch einegewisse Übung von Denkprozessen (LEHNER 1979, 69 f.). Beim reinen repetitiven Lernen, bei derdumpfen Wiederholung des Stoffes, werden <strong>die</strong> kognitiven Operationen noch weiter reduziert. DieBeeinträchtigungen für weiteres Lernen sind bei repetitivem Vorgehen daher besonders groß.97
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbesserer Darstellung, effektiveren Mitteln usw. unterstützt und gefördert werden, weilman ja immer wieder fragen kann, ob das auch genau ist. Das erfordert allerdings, dass<strong>die</strong> Schüler sich eingehend mit den Gegenständen befassen können.Wie genau Schüler beispielsweise <strong>die</strong> Bedeutungsschattierungen von Wörtern unterscheidenkönnen und bestrebt sind, das treffende Wort zu finden, einen Vorgang glaubhaftdarzustellen, den Rhythmus ihrer Sätze der jeweiligen Stimmung anzupassen usw.,zeigte sich als HEIDE BAMBACH (1989) ihre Schüler über Jahre hin ermunterte Geschichtenzu schreiben. Denn durch <strong>die</strong> genaue Erkundung einer Sache, wird auch <strong>die</strong> Wahrnehmungverfeinert, d.h. <strong>die</strong> Schüler entwickeln immer feinere Sinne. Aufgrund ihrergenaueren Wahrnehmung stellen sie dann selbst immer höhere Anforderungen auch an<strong>die</strong> Genauigkeit.Vergleichen und KontrastierenOperationen des Vergleichens erstrecken sich bei kleinen Kindern <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Unterscheidungeinzelner Sinnesqualitäten, d.h. man unterscheidet Dinge nach ihrer Farbe, ihrerForm, nach ihrer Oberfläche, ob sie rauh oder glatt, weich oder hart ist, nach ihrem Geruch,der Art der Bewegung, des Geschmacks, der Unterschiede im Klang oder Lautusw. Schüler können Gegenstände im Hinblick <strong>auf</strong> eine Vielzahl von Gesichtpunktenunterscheiden und lange Listen anlegen, in denen sie Gemeinsamkeiten und Unterschiedez.B. von Pflanzen, Tieren usw. festhalten. Dadurch werden <strong>die</strong> Schüler an genauesBeobachten gewöhnt.Bildung von KlassenDas Kontrastieren und Vergleichen führt automatisch zur Bildung von Klassen. So sindmanche Pflanzen essbar, während andere ungenießbar sind, manche sind giftig, andereungiftig usw. Auf <strong>die</strong>se Weise wird zugleich das Urteilsvermögen ausgebildet, weil derSchüler bei jedem Schritt entscheiden muss, welche Einschätzung der Farbe, Form desGeruchs, Geschmacks, Klangs usw. richtig und welche falsch ist.Analogien bildenBeim Vergleichen und Kontrastieren sind zudem Analogien zu erkennen. Denn bestimmteZusammenhänge, Lösungsweisen usw. sind bei verschiedenen Gegenständenvon gleicher Struktur. Dadurch lernen <strong>die</strong> Schüler, vom Gleichen zum Gleichen zu argumentieren.Analogien ermöglichen es ihnen, das Neue oder Unbekannte <strong>auf</strong> Vertrauteszurückzuführen. Denn wenn sie erkennen, „das ist ja wie bei ...“, erfahren sie, dass98
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTsie neue Gegenstände oft durch Suche nach analogen Zusammenhängen verstehen können(vgl. NORMAN / RUMELHART 1980).Bei der Leselern-Methode JÜRGEN REICHEN (2002) üben <strong>die</strong> Kinder eine ganze Reihesolcher Operationen. Die Kinder lernen zuerst Schreiben und danach Lesen, wie ja auchin der Entstehungsgeschichte <strong>die</strong> Entwicklung der Schrift dem Lesen stets einen Schrittvoraus ist. Als erstes müssen <strong>die</strong> Kinder lernen, <strong>die</strong> Laute eines Wortes zu unterscheiden,dann müssen sie das Zeichen für <strong>die</strong> entsprechenden Laute in der so genannten Lautier-Tabellesuchen und zuordnen. Bei Wörtern wie „Iglu“, „immer“, „ich“ usw. brauchensie z.B. das Zeichen für den Laut „I“. Sie müssen also den Gegenstand in der Tabellesuchen, der mit dem Laut I beginnt, nämlich den Igel. Sie müssen also suchen, unterscheiden,vergleichen, Klassen bilden, urteilen usw. Das ist zwar mühsam, aber interessant,und deshalb arbeiten <strong>die</strong> Schüler mit außerordentlichem Elan. An den Lehrerwenden sie sich nur, wenn sie Fragen haben, wenn sie Bestätigung brauchen. Ansonstenerforschen und entdecken sie <strong>die</strong> Welt der Schrift mit wenigen Hilfsmitteln selbständig.Sie lernen dabei nicht nur Schreiben, sondern üben auch geistige Operationen, <strong>die</strong> ihnenauch bei der Erkundung und Aneignung anderer Sachgebiete helfen.Algorithmen finden und formulierenWenn auch ohne ausdrückliche Formulierung erzeugen <strong>die</strong> Kinder bei <strong>die</strong>ser Art desSchreibenlernens auch einen Algorithmus, d.h. eine Abfolge von Operationen, <strong>die</strong> zurErledigung einer Aufgabe zu wiederholen sind. Andere Handlungspläne erleichtern <strong>die</strong>Lösung bei mathematischen Problemen, das Schreiben von Aufsätzen usw. Die Erzeugungsolcher Handlungspläne geht in dem Sinn immer ihrer Entdeckung voraus, alsman, um sie zu formulieren, bereits über eine Vorstellung des Abl<strong>auf</strong>s verfügen muss.So berichten GROEN / RESNICK (1977), dass Kinder das Verfahren, beim Rechnen <strong>die</strong>kleinere Zahl zur größeren zu ad<strong>die</strong>ren statt umgekehrt, selber entdecken. Es sei abersehr schwierig, ihnen <strong>die</strong>ses Vorgehen direkt zu vermitteln und so den Lernprozess abzukürzen.Wenn man sich Vorgänge auch vorstellen kann, ohne <strong>die</strong> entsprechendenAufgaben gelöst zu haben, kann <strong>die</strong> Mitteilung der Strategie eher genutzt werden.Beziehungen erkennen und nutzenBei der Bildung von Algorithmen, beim Vergleichen, bei der Bildung von Klassen spielenoft auch Beziehungen wie kleiner – größer; lauter – leiser, erster – zweiter usw. eineRolle, <strong>die</strong> Anlässe für <strong>die</strong> Bildung oder das Erkennen und untersuchen von Ordnungen(zeitliche, räumliche, verwandtschaftliche, transitive, intransitive Beziehungen usw.)99
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbieten. Wenn Schüler sich immer wieder mit solchen Ordnungsbeziehungen befassen,wird ihnen das auch bei der Systematisierung größerer Gegenstandsbereiche helfen.SchlussfolgernMit dem Sammeln und Ordnen von Informationen ist auch das Training des logischenDenkens verknüpft. Dazu ist es wenig sinnvoll, <strong>die</strong> logischen Verknüpfungen und Regelnanhand von Beispielen zu vermitteln. Denn wenn ein Schüler <strong>die</strong>se Regeln nochnicht selbst entdeckt hat, wird er sie sich nur rezeptiv aneignen; er wird sie dann zwarwiedergeben, aber nicht im Alltag anwenden können. Will man letzteres erreichen,braucht man <strong>die</strong> Schüler nur zu ermuntern, eigene Schlüsse aus den von ihnen in verschiedenenGebieten gesammelten Tatsachen zu ziehen. Auf <strong>die</strong>se Weise können sieUrsache und Wirkung entdecken. Da es dabei neben erfolgreichen Lösungen stets auchzu Fehlschlägen kommt, können sie <strong>die</strong> Gründe für Erfolg und Misserfolg untersuchen:<strong>die</strong> ungenauen Ausgangstatsachen; impulsiv gezogene Schlüsse, bei denen nur ein Teilder Fakten beachtet wurde; das Beharren <strong>auf</strong> einer Vorannahme, statt auch andere Möglichkeitenzu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen; das unkritische Akzeptiereneiner Folgerung, bevor man versucht hat, sie durch weitere Fakten zu stützen usw.NachvollzugDarstellungen begünstigen forschend-entdeckendes Lernen dann, wenn sie ein Phänomenverständlich beschreiben oder einen Vorgang nachvollziehbar vormachen. Wichtigist aber auch, dass neue oder auch eine Spur von Ungewissheit erzeugende Elementevorkommen. Während Verständlichkeit <strong>die</strong> Voraussetzung schafft, dass <strong>die</strong> für das Begreifendes Zusammenhangs erforderlichen Regelkombinationen der geistigen Struktursowie <strong>die</strong> für den Sachzusammenhang erforderlichen Schemata evoziert werden, fördernneue und Ungewissheit erzeugende Informationen <strong>die</strong> Neugier und regen zu Fragen unddamit zum Nachdenken an 54 .Wenn unter Bezug <strong>auf</strong> Alltagserfahrungen und im Zusammenhang mit bekannten Operationenallgemeine Zusammenhänge eines Phänomens beschrieben werden, können Schülerauch Vorstellungen von relativ abstrakten Erscheinungen wie der Gravitation <strong>auf</strong>bauenund differenzieren. Tatsächlich berücksichtigen ja bereits Kleinkinder, wenn sie nachbewegten Gegenständen greifen, Gravitationseffekte. Es ist also anzunehmen, dass <strong>die</strong>für das Verständnis von Gravitationsphänomenen grundlegenden Voraussetzungenschon von Anfang an gegeben sind.54Vgl. Dazu BERLYNE/FROMMER 1966; BERLYNE 1974; zur Verständlichkeit GROEBEN 1972; LAN-GER/SCHULZ v. THUN/ TAUSCH 1974.100
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTIn seinen Briefen an eine deutsche Prinzessin hat der Mathematiker EULER (1773) invorbildlicher Weise verständliche und Neugier erweckende Darstellungen geschaffen.Unter anderem versuchte er der Prinzessin auch NEWTONs Gravitationstheorie nahezubringen(S. 179 f.):„Dieser große Philosoph und Mathematiker lag einst in einem Garten unter einemApfelbaume, als ein Apfel, der ihm <strong>auf</strong> den Kopf fiel, bey ihm eine MengeBetrachtungn veranlaßte. Das wußte er sehr wohl, daß <strong>die</strong> Schwere <strong>die</strong> Ursachesey, warum der Apfel gefallen war, nachdem ihn der Wind oder eine andere Ursachevon seinem Aste abgerissen hatte. Diese Vorstellung war sehr natürlich, undjeder ehrliche Bauer hätte sie vielleicht ebenso gut haben können; aber der englicheWeltweise gieng weiter. Der Baum, sagte er, muß sehr hoch gewesen seyn;und das brachte ihn <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Frage: Würde wohl der Apfel gefallen seyn, wenn derBaum noch weit höher gewesen wäre? Daran konnte er unmöglich zweifeln.Wie aber wenn der Baum so hoch gewesen wäre, daß er bis an den Mond gereichthätte? Hier wurde er verlegen zu entscheiden, ob der Apfel noch gefallen seynwürde oder nicht. Wenn er alsdann noch fiele (welches ihm noch sehr wahrscheinlichzu seyn schein, weil man in der Höhe des Baums sich keine gewisse bestimmteGrenze denken kann, wo der Apfel <strong>auf</strong>hören sollte zu fallen); wenn das also geschähe,so müßte der Apfel doch noch einige Schwere haben, <strong>die</strong> ihn gegen <strong>die</strong>Erde triebe. Also müßte auch der Mond, der sich mit dem Apfel an einerley Ortebefände, mit eben der Gewalt, wie der Apfel gegen <strong>die</strong> Erde getrieben weden, daihm aber doch der Mond nicht <strong>auf</strong> den Kopf fiel, so sah er ein, daß davon <strong>die</strong> Bewegungdes Mondes <strong>die</strong> Ursache seyn könne, so wie eine Bombe über uns wegfliegen kann, ohne gerade herunter zu fallen.“Durch <strong>die</strong> Art der Darstellung wird der Schüler dazu gebracht, sich mit dem unter demApfelbaum liegenden Forscher zu identifizieren. Er wird so schrittweise mit dem stetsein wenig veränderten Ziel seiner Überlegungen vertraut. Außerdem weckt <strong>die</strong> Bildhaftigkeitdes Textes Vorstellungen, d.h. er führt zur Identifikation in dem Sinn, als beimSchüler Regelsysteme <strong>auf</strong>gerufen werden, <strong>die</strong> denen gleichen, <strong>die</strong> den Autor bei derFormulierung geleitet haben, so dass <strong>die</strong> wiedergegebenen Überlegungen verständlichwerden. Die ungewöhnliche Vorstellung eines Baums, der bis zum Mond wächst, regt zueigenen gedanklichen Experimenten an. Der Leser oder Zuhörer vollzieht <strong>die</strong> Ereignissenicht nur nach, sondern er variiert sie auch, indem er sie mit eigenen Erfahrungen verknüpftund in <strong>die</strong>sem Sinn selbständig <strong>die</strong> zugrunde liegenden Zusammenhänge durcheigene Überlegungen erschließt und nicht einfach nur rezeptiv übernimmt. All das erreichtEULER, indem er bei seiner Darstellungen von Alltagserfahrungen ausgeht, Erlebnisseund anschauliche Bilder verwendet und trockene Ergebnisse in <strong>die</strong> von einer Personerlebte Ungewissheit und Neugier in Fragen, in <strong>die</strong> Suche nach Lösungen einschließlichIrrtümern und Verbesserungsversuchen zurückverwandelt.Eine bloße Darstellung der Ergebnisse hingegen würde nicht dem Denken der Schülerentsprechen, es würden nicht Vorstellungen alltäglicher fallender, in Wurf- oder Ge-101
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTschoßbahnen sich bewegender Gegenstände, mit den <strong>die</strong>sen Vorstellungen zugrundeliegenden geistigen Regelsystemen evoziert, <strong>die</strong> erst das Verständnis der Gravitationermöglichen. Deshalb kann <strong>die</strong> Darstellung bloßer Ergebnisse oder Lehrsätze einen mitden beschriebenen Phänomenen unvertrauten Schüler nicht zu eigenem Denken anregen,d.h. zu Variationen beschriebener Vorgänge. Das variierende gedankliche „Durchspielen“,das nicht einmal mit Absicht erfolgen muss, macht eben das „Forschen“ und „Entdecken“aus. Fehlt es, ist der Lerneffekt gering. Dasselbe trifft <strong>auf</strong> Aufgaben zu, bei denenes um darum geht, Verhaltens- oder Handlungsweisen durch Beobachtung und Imitationvon Modellen oder Vorbildern zu lernen.ImitationDas Lernen von Modellen oder Vorbildern beginnt sozusagen am ersten Tag. So konnteMELTZOFF (1988) zeigen, wie bereits Neugeborene versuchen, bestimmte Bewegungendes Mundes und der Zunge der Mutter zu beobachten und nachzumachen. Im Unterrichtwird das Nachahmen eines modellhaften Verhaltens etwa beim Turnen, Malen, Musizieren,aber auch im Fremdsprachenunterricht methodisch genutzt.Beim Schüler kann das Nachmachen forschend-entdeckendes Lernen fördern, wenn ihm<strong>die</strong> Freiheit gegeben wird, dabei zu variieren, d.h. Möglichkeiten zu erproben, um herauszufinden,welche Art des Bewegungsabl<strong>auf</strong>s, der Aussprache, der Satzstellung ineiner Fremdsprache, des Spielens einer Passage <strong>auf</strong> einem Instrument usw. ihm am ehestenerlaubt, eine gegebene Schwierigkeit zu lösen, einen bestimmten Klang zu erzeugenusw. Die Lösung, <strong>die</strong> entdeckt werden muss, besteht im Finden derjenigen Kombinationvon Regeln, bei der es zu einer Übereinstimmung und flüssigen Ausführung der Schemata,<strong>die</strong> durch <strong>die</strong> Wahrnehmung evoziert wurden und jener, <strong>die</strong> durch das Selbermachenaktiviert werden, kommt. Ein Sportler, der z.B. eine neue Technik des Stabhochsprungserprobt, wird vielleicht nach langer Zeit der Übung plötzlich das Gefühl haben,dass er nun erst wirklich versteht, „wie es geht“.Wird jedoch <strong>die</strong> selbstbestimmte variierende Erprobung verhindert, was zumeist durchZerlegung in kleine Teilschritte mit nachfolgenden Kontrollen geschieht, richtet sich dasBestreben des Schülers <strong>auf</strong> das bloße Beherrschen einer bestimmten Bewegungsfolge,wie <strong>die</strong> Aussprache eines bestimmten Worts, <strong>die</strong> Wiedergabe einer bestimmten musikalischenPassage usw. Es geht also vor allem um das Behalten und Zusammenfügen vonElementen. Man spricht auch von mechanischem Lernen, weil <strong>die</strong> Rezeption und Reproduktionvon äußerlichen Handlungsmustern zugrunde liegende kognitive Regelsystemenur sehr eingeschränkt aktiviert und reorganisiert. Während beim rezeptiven Ler-102
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTnen <strong>die</strong> Ergebnisse <strong>auf</strong> jeweils bestimmte gelernte Dinge beschränkt bleiben, entwickeltsich beim forschenden Lernen ein „Gespür“, d.h. ein nicht formulierbares Regelwissen,das auch <strong>auf</strong> andere Aufgaben angewandt werden kann. In <strong>die</strong>sem Sinn transzen<strong>die</strong>rtforschend-entdeckendes Lernen stets <strong>die</strong> besonderen Ergebnisse, <strong>die</strong> das Beherrscheneiner bestimmten Aufgabe bedeutet.So zeigte sich in einer Untersuchung, in der Schüler eine Regel aus einem von ihnenbeobachteten Vorgang erschließen sollten, dass <strong>die</strong> Gruppen, <strong>die</strong> mehr Möglichkeitenhatten, zumindest in ihren Überlegungen Fehler zu machen, besser abschnitten als jene,bei denen <strong>die</strong> Beobachtung von geleitetem Handeln begleitet wurde, das Fehler ausschloss.Die reine Beobachtungsgruppe war hinsichtlich Wissen und Transfer mehr alsdoppelt so erfolgreich. Bei den Beobachtungsgruppen schnitten <strong>die</strong>jenigen besser ab beiTransfer<strong>auf</strong>gaben, denen weniger strukturierte Darstellungen dargeboten wurden (ZIM-MERMAN/ DIALESSI 1973). Auch autistische und geistig behinderte Kinder lernten Fertigkeitenwie das Ausziehen von Schuhen und Strümpfen, Dreiradfahren und Ordnenvon Gegenständen durch bloße Beobachtung besser als bei zusätzlichem geleiteten Übenmit Lob für richtige Einzelhandlungen (BIEDERMAN/ DAVE/ RYDER/ FRANCHI 1994).Während <strong>die</strong> Vermittlung von bestimmten Verhaltensergebnissen zur schrittweisen Aneignungund späteren Kombination kleiner Verhaltenseinheiten führt, <strong>die</strong> bei Aufforderungoder gleichen Aufgaben wieder reproduziert werden können, begünstigt <strong>die</strong> reineBeobachtung häufig <strong>die</strong> Evozierung abstrakter interner Regelsysteme. Solche Regelsystemekönnen allerdings nicht beliebig konstruiert werden, vielmehr sind es Regeln, mitdenen das Individuum bereits ausgestattet ist, <strong>die</strong> aber dann in der bewussten Handlungoder im Denken „schnell und in einer ganzheitlichen Weise angeeignet werden“ (ZIM-MERMAN/ROSENTHAL 1974, 39, meine Übers.).EinfühlungAufgaben, sich in <strong>die</strong> Handlungen von Personen einzufühlen, stellen sich oder könnengestellt werden, wenn Schüler sich beispielsweise mit Personen, in historischen Zusammenhängen,Filmen usw. auseinandersetzen. „Warum haben er oder sie <strong>die</strong>se Entscheidunggetroffen? Warum haben sie nicht anders gehandelt? Welche Wahlen wären unter<strong>die</strong>sen Umständen möglich gewesen? Welche Interessen waren bestimmend?“ ÄhnlicheMöglichkeiten der Einfühlung ergeben sich beim Rollen- und Simulationsspiel, bei derBeschäftigung mit literarischen Personen usw. Eine andere Form der Einfühlung bestehtdarin, eine Sache von mehreren Standpunkten aus zu sehen, wie Personen sie durch verschiedenartigenSituationsbezug erleben.103
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWie Nachvollzug und Imitation besteht auch Einfühlung darin, Ereignisse oder Handlungenals von Regeln bestimmtes bedeutungshaltiges Geschehen wahrzunehmen (v.HAYEK 1967, 59). Der Schüler muss also jene Regelkombinationen bei sich selbst rekonstruieren,von denen Personen in ihren Interaktionen geleitet waren. Wie das Verstehenvon Sprache setzt auch das Verstehen von Personen voraus, dass wir alle im Prinzipmit den gleichen grundlegenden Regelsystemen ausgestattet sind, <strong>die</strong> unser Denken,Fühlen und Handeln leiten. So sind etwa beim Rollenspiel Regeln erforderlich, <strong>die</strong> <strong>die</strong>Bildung so abstrakter Klassen wie <strong>die</strong> Rollen der Mutter, des Vaters, des Kindes usw.erlauben. Außerdem muss bereits eine Art intuitiver „Theorie“ der Organisation des sozialenLebens vorhanden sein, in deren Rahmen verschiedene Rollen erst sinnvoll sind.Da bei jedem Individuum aber <strong>auf</strong>grund unterschiedlicher innerer und äußerer Bedingungenjeweils andere Kombinationen entstehen, erfordert Einfühlung eine situationsgebundeneRekombination <strong>die</strong>ser Regeln, also ein Suchen oder Forschen nach den Kombinationen,<strong>die</strong> es gestatten, <strong>die</strong> Rolle, <strong>die</strong> Vorstellungen, Wünsche, Interessen und Gefühlevon Personen in bestimmten Situationen zu erkennen.Da beim Vorgang der Einfühlung nicht nur große Mengen, sondern auch sehr verschiedenartigeInformationen gleichzeitig verarbeitet werden können, sind dabei leichter Einblickein komplexe Zusammenhänge zu gewinnen als bei den meisten anderen kognitivenOperationen. Daher wird Einfühlung auch als grundlegend für Intuition und Einsichtbetrachtet (BASTICK 1982). Insbesondere <strong>die</strong> Beschäftigung mit Kunst, Musik usw. fördernsolche ganzheitlichen kognitiven Vorgänge. Auch eine anregende schulische Umgebungist dazu geeignet; beispielsweise wird in Waldorfschulen <strong>die</strong> Beschäftigung mitder Geschichte Griechenlands häufig verknüpft mit einer entsprechenden Gestaltung derKlassenräume, mit dem Einleben in <strong>die</strong> griechische Sagenwelt und Mythologie etc.Einfühlung <strong>auf</strong> der Ebene sozialer Beziehungen ist geeignet, <strong>die</strong> Selbstbeobachtung zuverbessern. Beurteilung von anderen, selbst von Tieren, erfolgt über eine Art „erkennendesGefühl“, was nur ein anderer Ausdruck für „interne Regelsysteme“ ist. Durch Bewusstmachungdessen, was <strong>auf</strong>grund der Evozierung solcher inneren Regelsysteme gefühlshafterkannt wird, steigern wir unser bewusstes Wissen von Erscheinungen, ob sienun außerhalb von uns oder in uns. Beispiele dafür sind etwa das Erkennen von Rangordnungen,Arroganz, Gleichstellung, Unterordnung usw. Die Bewusstmachung solchenErkennens kann nicht nur bei der Beurteilung von anderen, sondern auch in der Einschätzungdes eigenen Verhaltens von Nutzen sein. Das gilt auch für das Erkennen vonGefühlen. Wir kommen in ein Zimmer und spüren, dass eine Spannung zwischen denMenschen dort in „in der Luft liegt“. Wir erkennen <strong>die</strong> gedrückte oder gehobene Stim-104
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTmung und drücken sie auch selber durch Signale aus, <strong>die</strong> von anderen ebenfalls über denWeg der Einfühlung erfasst werden.Es verwundert daher nicht, wenn gesteigertes Einfühlungsvermögen eine größere Sensitivitätfür soziale Probleme mit sich bringt, prosoziales Handeln begünstigt und in engemZusammenhang mit der Handlungskompetenz im sozialen Bereich steht (zusammenfassendhierzu UHL 1996, 117 ff.; 133 ff.). Es fördert darüber hinaus aber auch <strong>die</strong>schnellere Gewinnung von Einsicht in Sachzusammenhänge (BASTICK 1982, 276 ff, 279ff.). Das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass <strong>die</strong> Rekombination von Regeln dasDenken insgesamt flexibler macht. Das gilt in ähnlicher Weise für <strong>die</strong> Imagination.ImaginationWährend Einfühlung vor allem <strong>auf</strong> Personen bezogen ist, umfasst Imagination auch <strong>die</strong>Vorstellung von Gegenständen und sachlichen Vorgängen. Als Einstein sich als Jugendlicherversuchte vorzustellen, wie es wäre <strong>auf</strong> einem Lichtstrahl zu reiten, war das einesolche sachgebundene Imagination, <strong>die</strong> aus seinem Hineinversetzen in physikalischeZusammenhänge entstand. Imagination ist der Umgang mit gedanklichen Repräsentationenvon Dingen, Ideen usw. Es bedeutet im Grunde das gedankliche Erforschen vonZusammenhängen, Handlungsmöglichkeiten und den Umgang mit Vorstellungen.So berichten beispielsweise Erfinder und Ingenieure, sie könnten sich in ihrer Vorstellungso sehr in ein Gerät oder auch seine einzelnen Teile hineinversetzen, dass sie Druckund Zug und andere Vorgänge gewissermaßen körperlich empfinden (GORDON 1961).Durch ihre Vorstellungskraft gewinnen sie leichter ein Gesamtbild, das sie anschließenddurch analytisches Denken in seinen Einzelheiten zu formulieren suchen. In Anlehnungan <strong>die</strong>ses Vorgehen von besonders kreativen Wissenschaftlern und Technikern empfehlenauch Methoden zur Förderung der Kreativität <strong>die</strong> Imagination; man soll sich sozusagenin <strong>die</strong> Mitte seines Problems versetzen; Augen; Ohren und Arme sollen ein Teil davonsein (GORDON 1961, 21).Übungen zur körperlichen Darstellung des Verhaltens von Menschen, Dingen, Tieren,Fabelwesen usw. erfordern, dass <strong>die</strong> Schüler versuchen, sich in eine Sache hineinzuversetzen,in „Fühlung“ mit ihr zu kommen. WAGENSCHEIN (1970, Bd. 1, 338) beschrieb<strong>die</strong>sen Vorgang beispielsweise für „das ‘Pendel’ im Physikunterricht“. Man solle einlanges schweres Pendel <strong>auf</strong>hängen und unten einen schweren Felsbrocken, den mandann schwingen lässt. Der Lehrer sagt nichts, fragt nichts, <strong>die</strong> Schüler kommen vonselbst, um das Geschehen zu beobachten. Man sieht, wie sie mit dem Kopf oder dem105
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTganzen Körper leicht mitschwingen, wie der Wendepunkt erwartet wird. Es werden vielleichtAssoziationen an das Erlebnis einer Schaukel wach, der Rhythmus von Tag undNacht, Sommer und Winter usw. Das kann fünf Minuten oder länger dauern - oder „kosten“,wenn man an den verbleibenden Rest der Stunde denkt. Aber Wagenschein kommtes dar<strong>auf</strong> an, dass das Gesetz sozusagen im Gefühl geweckt wird, oder in der Spracheder hier vorgelegten Theorie, dass jene Regeln aktiviert werden und den Denkprozessmitbestimmen sollen, <strong>die</strong> bereits das Kleinkind in Übereinstimmung mit der Gravitationnach einem bewegten Gegenstand greifen lassen.In der Mathematik versucht er das gleiche Ziel durch verbales alltagssprachliches Umkreisendes Themas zu erreichen, ohne <strong>die</strong> eigentliche Frage direkt anzusprechen oder in<strong>die</strong> Fachterminologie zu verfallen. Wenn <strong>die</strong> Schüler dann anfangen, sich Gedanken zumachen und sich noch unbeholfen und tastend zu äußern, „muß der Lehrer sofortschweigen“ und <strong>die</strong> Schüler „in das Feld des Forschens“ entlassen (WAGENSCHEIN 1970,Bd. 1, 340).Imaginationen spielen ferner eine bedeutsame Rolle bei der Aufrechterhaltung desSelbstwertgefühls, wenn Individuen z.B. Illusionen erzeugen, um mit Misserfolgen besserumgehen zu können. Diese Möglichkeit kann auch gezielt verwendet werden, umSchüler mit einem ungünstigen Selbstbild dazu anzuregen, ihre Selbstwahrnehmung zuändern, Überzeugungen, dass sie z.B. unbegabt wären und nicht lernen könnten, durchpositive Vorstellungen von Handlungsmöglichkeiten zu ersetzen. Dieses Vorgehen hatsich als sehr effektiv erwiesen, weil <strong>die</strong> Schüler sich dadurch offenbar als eher eigenständigund selbstverantwortlich erfahren (SCHMECK 1988).Imaginationen können im Unterricht aber auch eingesetzt werden, um Schüler dazu anzuleitensich eine Vorstellung von einer Sache, einem Vorgang, einem Ereignis zu machen.Dabei können insbesondere anschauliche Darstellungen helfen. Imaginationenkönnen so das Verständnis in den verschiedensten Bereichen fördern. Beim Rechnenkann <strong>die</strong> Vorstellung der Gestalten von Zahlmengen wie dem Fünfer, dem Dreier, demVierer usw. das Operieren mit Zahlen sicherer machen und das mathematische Denkenfördern (KARASCHEWSKI 1969). Das Schreiben einer Erzählung kann durch <strong>die</strong> Imaginationvon Situationen und Personen mit bestimmten Charaktermerkmalen, Redeweisenusw. unterstützt werden. Beim Üben eines Musikstücks kann <strong>die</strong> Vorstellung des ge-106
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTwünschten Klangbildes im Zusammenhang mit den Bewegungen beim Spiel des Instrumentshelfen 55 .Die Beseitigung von Lernstörungen durch forschend-entdeckende OperationenLernstörungen entstehen nach FEUERSTEIN (1983) durch inadäquate Lerngelegenheiten,d.h. insbesondere durch Lernanforderungen, <strong>die</strong> rezeptiv-reproduktives Lernen fordern.Stellt man in ihrer Entwicklung zurückgebliebenen Kindern oder Jugendlichen Aufgaben,<strong>die</strong> <strong>die</strong> Anwendung forschend-entdeckender Operationen von ihnen fordern, dannwerden damit <strong>die</strong> Ursachen für <strong>die</strong> Retar<strong>die</strong>rung, nämlich <strong>die</strong> inadäquaten Lernanforderungenbeseitigt.Die Schüler brauchen anfangs viel Hilfe und Ermutigung. Sie müssen langsam lernen,erst dann zu handeln, wenn sie eine Annahme formuliert haben. Sie sollten angehaltenwerden solche Annahmen zu prüfen: haben sie sich bewährt? Warum nicht? Warumtreffen sie zu? Der für schwache Schüler oft typischen Impulsivität ist durch Begleitungzu begegnen, damit sie nicht zu viele Fehler machen, <strong>die</strong> sie entmutigen könnten. Wennsie aber Fehler machen, sind <strong>die</strong> Ursachen der Fehler zu suchen, indem man den Gedankengangdes Schülers ernst nimmt und zurückverfolgt.Auch wenn schwere Lernstörungen im frühen Kindesalter entstanden sind, können siedurch adäquate Lernbedingungen verändert und Retar<strong>die</strong>rungen nicht selten deutlichverringert werden. Häufiger als gemeinhin angenommen, können selbst schlimmste Fälleeine günstige Wendung nehmen (vgl. CLARKE/CLARKE 1976). Auch wenn <strong>die</strong> Umstellung<strong>auf</strong> Lernbedingungen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Übung forschend entdeckender Operationen fordern,erst spät erfolgt, können noch erstaunliche Korrekturen erzielt werden, wie FEUERSTEIN(1983, S. 10) am Beispiel des 15-jährigen M., zahlreichen anderen Fällen sowie anhandquantitativer Untersuchungen demonstriert:M. war zur Verwahrung ins Heim überwiesen worden. In den vorliegenden Berichtenwurde sein „IQ zwischen 35 und 45 angegeben. M.s Wortschatz bestand aus 40-50 Wörternund er zeigte ernste Beeinträchtigungen der raum-zeitlichen Orientierung, der Fähigkeitzur Nachahmung, der Gedächtnisleistungen und des Sozialverhaltens.“ Unter den55Ähnlich ist es im Sport. Anstatt von Imagination wird hier meist von „mentalem Training“ gesprochen,das insbesondere im Spitzensport Anwendung findet.107
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTdenkbar ungünstigsten Verhältnissen <strong>auf</strong>gewachsen, zu früh und mit zu geringem Gewichtgeboren, „litt M. von Geburt an einem Gehirnschaden“.FEUERSTEIN wendete das vom ihm entwickelte Learning Potential Assessment Devicean, einen Test, der im Unterschied zu Intelligenztests nicht <strong>die</strong> Leistung festzustellensucht, <strong>die</strong> bei einem gegebenen Maß an Fähigkeiten erbracht wird, sondern das Lernpotential<strong>auf</strong>decken soll (vgl. FEUERSTEIN 1979). Dieser Test zeigte bei M, „entgegen allenErwartungen ... eine erstaunlich hohe Lernkapazität“.Nach 11 Jahren intensiver Betreuung, in denen M. mittels entsprechender Aufgaben O-perationen des forschend-entdeckenden Lernens wie Vergleichen, Hypothesen bildendesund schlussfolgerndes Denken, Analogien bilden usw. erwarb, ist er zu einem selbständigenjungen Mann geworden, mit sehr guten sprachlichen Fertigkeiten, „einem Sinn fürHumor, sozialen Fertigkeiten und beruflichen Ambitionen. Er ist verantwortlich für denBetrieb eines großen Hallenschwimmbads und hat Französisch und etwas Deutsch gelernt.Trotz M.s belasteter Erbanlagen, organischem Schaden“ und extremer frühkindlicherDeprivation konnte er sich noch zu dem relativ späten Zeitpunkt, an dem man ihn inlebenslängliche Heimverwahrung geben wollte, in einer adäquaten Lernumwelt mit angemessenenLernhilfen zu einem anpassungsfähigen intelligenten Menschen entwickeln,der sein Leben selbstverantwortlich gestalten konnte.FEUERSTEIN berichtet etliche Fälle von Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren,<strong>die</strong> in hohem Maß impulsiv, manchmal auch aggressiv und unvorhersehbar reagierten,<strong>die</strong> <strong>die</strong> Sprachbeherrschung von 6- oder 8-jährigen sowie extrem eingeschränkteRechenfähigkeiten zeigten. Mit Hilfe eines Programms (Feuerstein Instrumental Enrichment,FIE), das dar<strong>auf</strong> ausgerichtet ist, Operationen des forschend-entdeckendenLernens zu üben und in verschiedenen Situationen anzuwenden, wurden erstaunlicheErfolge erzielt. Relativ viele <strong>die</strong>ser Kinder wurden später selbst „Lehrer und Schulleiterund haben eine sehr viel optimistischere Haltung hinsichtlich der Möglichkeiten“ desLernens angenommen (FEUERSTEIN 1983, 65).Es wurden auch mehrere Langzeituntersuchungen der Wirkungen des FIE durchgeführt.In einer <strong>die</strong>ser Untersuchungen wurden zwei Formen der Förderung miteinander verglichen(ebenda, S. 325 ff.). Die eine Gruppe erhielt eine allgemeine Förderung (GeneralEnrichment, GE), <strong>die</strong> dar<strong>auf</strong> ausgerichtet war, durch zusätzliche Hilfen, <strong>die</strong> Lücken imWissen und Können der Schüler zu schließen. Die andere Gruppe erhielt neben demsonstigen Unterricht das FIE, d.h. es wurden gezielt forschend-entdeckende Operationengeübt und angewandt.108
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDer größere Teil der am Programm beteiligten Kinder war schwer geschädigt. Die meistender Heranwachsenden im Alter von 12 bis 15 kamen aus Nordafrika. In ihren sozialenund intellektuellen Fertigkeiten lag <strong>die</strong> Entwicklung zwischen drei und sechs Jahrenunterhalb der Altersnorm. Viele hatten einen IQ zwischen 50 und 70 und sogar niedriger.Die Mehrzahl konnte entweder gar nicht oder nur begrenzt lesen und schreiben. Nurein Viertel beherrschte drei der vier Grundrechenarten. Im Handeln überwog eine ungezügelteImpulsivität und es bestand <strong>die</strong> Tendenz, stereotype und unangepasste Verhaltensweisenzu wiederholen.Nach zwei Jahren schnitten <strong>die</strong> Schüler, <strong>die</strong> das FIE erhalten hatten im Primary MentalAbilities sowie verschiedenen anderen Tests deutlich besser ab, als <strong>die</strong> Gruppe mit demProgramm der allgemeinen Förderung (GE). Ein größerer Teil der Gruppen wurde, als<strong>die</strong> Schüler zwei bis drei Jahre nach Abschluss des Programms zum Militär eingezogenwurden, noch einmal hinsichtlich verschiedener Testleistungen verglichen. Jetzt schnitten<strong>die</strong> FIE-Probanden noch weit besser ab als <strong>die</strong> GE-Schüler. Die Kluft zwischen denGruppen hatte sich erweitert. D.h., dass <strong>die</strong> Übung in forschend-entdeckenden Operationennach Beendigung der Schule weit größere Transferleistungen ermöglichte, als einvorwiegend <strong>auf</strong> lehrplangemäße Kenntnisse und Fertigkeiten ausgerichtetes schulischesProgramm.Für <strong>die</strong> Bedeutung der Verfügbarkeit forschend-entdeckender Operationen spricht auch,dass Jugendliche aus Kulturen, <strong>die</strong> eine Kluft von Jahrhunderten von unserer modernentechnologischen Gesellschaft trennt, sich schnell und leicht anpassen können, wenn siezu uns kommen. Vermutlich haben sie als Kinder durch Beteiligung, Beobachtung undgezielte Belehrung ihre Kultur <strong>auf</strong> forschend-entdeckende Weise erkundet und dabeiausreichende Übung in jenen kognitiven Operationen gewonnen, <strong>die</strong> auch unter gewandeltenUmständen angewandt werden können und ihnen <strong>die</strong> Anpassung ermöglichen(vgl. FEUERSTEIN 1983, 24 f.).13. MotivationWarum sind im Unterricht manche Schüler <strong>auf</strong>merksam und warum lassen andere sichablenken? Wovon hängt das Verhalten der Schüler ab, wie kann man es beeinflussen? Jenach Standpunkt werden <strong>die</strong>se Fragen verschieden beantwortet. Während objektivistischeTheorien das Individuum von außen betrachten, ohne <strong>auf</strong> seine Einstellungen und109
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTErwartungen Bezug zu nehmen, gehen subjektivistische Theorien von eben <strong>die</strong>sen individuellenEinstellungen und Erwartungen aus.Objektivistische TheorienObjektivistische Theoretiker suchen nach Gesetzmäßigkeiten zwischen äußeren Bedingungenund Verhalten von Individuen. Aus <strong>die</strong>ser Sicht erscheint das Individuum als einWesen, das durch äußere Reize oder andere lenkende Maßnahmen eine Richtung fürseinen Aktivitätsdrang erhält. Wenn es in der Lage ist, sich in gewünschter Weise zuverhalten, so deshalb, weil es gelernt hat, <strong>auf</strong> bestimmte Reize oder Reizkombinationenin bestimmter Weise zu reagieren. Liegen also bestimmte Umgebungsbedingungen vor,wird der Einzelne nach seinen vorangegangenen Lernerfahrungen handeln.Abb.: Objektivistische Theorie der VerhaltensregulationNach <strong>die</strong>ser Auffassung muss das Individuum zunächst von seiner Umwelt gelenkt werden,damit es später weiß, was es unter bestimmten Umständen tun soll, tun muss oderkann. Der Ausgangspunkt ist ein Wesen, das anfangs nur mit Reflexen und Bedürfnissen,aber großer Lernfähigkeit ausgestattet ist. Um zu einem Mitglied der Gesellschaftzu werden, muss es durch Erziehung entsprechend der jeweiligen sozialen Erfordernissegeformt werden. Denn wäre es sich selbst überlassen, würde es nur tun, was ihm geradeSpaß macht, also ohne jeden Bezug zu gesellschaftlichen Normen. Dass <strong>die</strong>se Normen inverschiedenen Gesellschaften stark variieren, scheinen sie reine Produkte der Gesellschaftenzu sein. Wenn sie aber reine gesellschaftliche Produkte darstellen, dann müssensie auch erst gelernt werden. Erst in letzter Zeit mehren sich Untersuchungen, <strong>die</strong> bei allden kulturellen Differenzen doch <strong>auf</strong> grundlegende Universalien verweisen (BARKOW/COSMIDES/ TOOBY 1992; BROWN 1991).Nach der objektivistischen Theorie kann das Verhalten des Individuums reguliert werden,weil es bestimmte Zustände anstrebt bzw. zu vermeiden trachtet. Deshalb kann esdurch <strong>die</strong> Versprechung oder Vorenthaltung gewünschter Dinge positiv oder negativ110
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTverstärkt werden. Alles, was das Individuum tut, tut es nach <strong>die</strong>ser Auffassung, um einenfür es angenehmen Zustand herbeizuführen bzw. unangenehme Zustände zu vermeiden.D.h. der Mensch ist vollkommen oder nahezu vollkommen von außen, also von seinerUmwelt determiniert.Diese Auffassung ist tief im Alltagsbewusstsein verwurzelt. Seit Menschengedenkengelten Lob und Tadel bzw. Belohnung und Bestrafung als grundlegende Erziehungsmittel(vgl. Uhl 1996, 201 ff.). Wie mit einer Zange wird damit Macht über das Verhaltendes Individuums ausgeübt. Die eine Seite weckt Hoffnungen, <strong>die</strong> andere droht mit Verlustund Unannehmlichkeiten. Wenn das Individuum lange genug solchen Situationenausgesetzt war, ist es nach <strong>die</strong>ser Auffassung bereit, von sich aus zu tun, was man vonihm erwartet. Zentrale Elemente <strong>die</strong>ser Auffassung sind in Assoziationstheorien anzutreffen(z.B. Thorndike 1935; Skinner 1953). Verhalten wird danach durch positive undnegative Verstärkung reguliert. Sie ist der Mechanismus, durch den das Verhalten inbeliebige Richtungen gelenkt werden kann.Tatsächlich ist Verstärkung eines der wirksamsten Mittel zur kurzfristigen Beeinflussungder Handlungstendenzen von Individuen – was tut man nicht alles, um eine Belohnungzu erhalten oder ihrer nicht verlustig zu gehen und natürlich auch um Strafen zuvermeiden. Aber langfristig richten <strong>die</strong>se Steuerungsversuche eine Menge schaden an,weil sie das Engagement, <strong>die</strong> Kreativität zerstören und den Erwerb von grundlegendenWerten stören (vgl. KOHN 1993). Wenn der Mensch vollständig durch Lob und Tadel zulenken wäre, würde das auch bedeuten, dass Argumente, Überlegungen, Beweise, <strong>die</strong>Bedeutung von Aussagen usw. keine oder lediglich insofern eine verhaltensleitendeWirkung hätten, als sie mit Verstärkern verknüpft wären oder selbst Verstärker darstellenwürden. Wenn Ziele aber nicht durch vernünftige Diskussion, <strong>die</strong> Suche nach Wahrheitnicht durch Überlegung, <strong>die</strong> Formulierung von Annahmen und deren Prüfung zustandekäme, sondern durch Verstärkungen, würde es wenig Sinn machen, überhauptvon Vernunft zu sprechen.Diese Probleme entstehen durch den Versuch, alle Bedingungen „objektiv“ zu bestimmen,d.h. unabhängig von subjektiven Einstellungen der Individuen. Das führt dazu,dass äußerlich zwar gleich erscheinende, aber subjektiv ganz verschiedene Dinge in <strong>die</strong>selbeKlasse eingeordnet werden. So spielt es aus der Sicht der Verstärkungstheorie keineRolle, ob <strong>die</strong> Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Verhaltensweise dadurch erhöhtwird, ob jemand durch Überlegung zu einer richtigen Lösung gelangt oder durchRaten. Entscheidend ist nur, dass <strong>die</strong> Äußerung entsprechender Worte durch lobende111
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBemerkungen verstärkt wird und dar<strong>auf</strong>hin häufiger bei bestimmten Reizkonfigurationengezeigt wird. Es wird ferner übersehen, dass das, was <strong>die</strong> Verstärkungstheorie als„objektive“ Reizkonfiguration zu definieren sucht, aus subjektiver Sicht vollkommenVerschiedenes bedeuten kann. Während <strong>die</strong> Aufgabe beim einen Vorstellungen evoziert,mit deren Elementen er sinnvolle Operationen durchführen kann, betrachtet sie der andereein Bild mit unklaren Zeichen oder Wörtern; nur <strong>auf</strong>grund eines bestimmten Merkmalsdarin erinnert er sich, letztes Mal für eine bestimmte Antwort gelobt worden zusein, wor<strong>auf</strong> er <strong>die</strong> entsprechende Wortfolge wiederholt.Der Versuch solche Zusammenhänge von außen zu stu<strong>die</strong>ren, kann nicht zu zufriedenstellenden Lösungen führen. Vielmehr müssen <strong>die</strong> subjektiven Einstellungen, Erwartungen,Deutungen usw. berücksichtigt werden.Subjektivistische TheorienTheorien <strong>die</strong>ses Typs gehen bei der Erforschung der Regelhaftigkeiten des Verhaltensnicht von einer als objektiv gegeben betrachteten Situation aus, sondern versuchen solcheSituationen ausgehend von den Vorgängen im Innern der Individuen zu rekonstruieren.Bei <strong>die</strong>sem Vorgehen bilden also „subjektive Daten“, also innere Prozesse oder aberAnnahmen über innere Vorgänge wie Denken, Fühlen oder Wollen den Ausgangspunktder Untersuchung und nicht oder nicht nur <strong>die</strong> objektiv beobachtbaren Erscheinungenoder Dinge. Wenn also beispielsweise Säuglinge eine kleine Veränderung eines bekanntenEreignisses deutlich länger betrachten, ist nicht etwa das objektive Datum der Zeitdauerder Aufmerksamkeitszuwendung das Entscheidende, sondern <strong>die</strong> subjektiven Erwartungenin Bezug <strong>auf</strong> das beobachtete Ereignis, <strong>die</strong> dann zur längeren Zuwendungführen, wenn sie nicht zutreffen, abweichen oder eine andere Deutung des Ereignisseserforderlich ist.Erwartungen <strong>die</strong>nen der Erkundung und der Konstruktion von Handlungen oder Handlungsmöglichkeiten.Es ist anzunehmen, dass <strong>die</strong> Erwartungsbildung über verschiedeneEbenen erfolgt, wobei zunächst vermutlich allgemeine Kriterien entstehen, <strong>die</strong> wiederum<strong>die</strong> <strong>auf</strong> Details bezogenen spezifischeren Erwartungen eingrenzen. So wird ein Schüler,der im Sprachunterricht das Gefühl hat, Zusammenhänge zu verstehen, zunächst derDarstellung des Lehrers <strong>auf</strong>merksam folgen, weil er annimmt, seine bestehenden Kenntnisseerweitern zu können. Auch wenn <strong>die</strong> Ausführungen dann zunächst eher verwirrendfür den Schüler sind, wird er <strong>auf</strong>grund <strong>die</strong>ser Erwartung dazu neigen, nach solchen Elementensuchen, <strong>die</strong> an seine Kenntnisse anknüpfen, ihnen vielleicht auch widersprechen;112
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTer wird Fragen dazu stellen oder sich eigene Überlegungen machen, vielleicht auch Behauptungenan Beispielen erproben usw. Ein Schüler dagegen, der an dem Fach keinInteresse, also eher <strong>die</strong> Erwartung von etwas wenig Bedeutungsvollem hat, wird kaum<strong>auf</strong> besondere Einsichten hoffen und daher auch kaum nach Möglichkeiten zur Erweiterungseiner Kenntnisse suchen.In jedem Fall beeinflusst <strong>die</strong> positive oder negative Einschätzung der Möglichkeiten zurVerwirklichung des eigenen Selbst <strong>die</strong> Richtung der Aktivitäten des Individuums. Vermutlichwird <strong>die</strong> Richtung des Verhaltens zunächst durch jene Kompetenzen bestimmt,<strong>die</strong> der Einzelne besitzt und deren Entwicklung deshalb unmittelbar einen Zuwachs anKompetenz verspricht. Der Prozess der Verwirklichung von Kompetenzen stellt eineaktive Anpassung an <strong>die</strong> Gegebenheiten der jeweiligen Umwelt dar. Sie erfolgt also auseigenem Antrieb. Allerdings wird das Individuum seine Umwelt eher dann selbstbestimmterkunden wollen, wenn es sich sicher fühlt. In einer bedrohlich empfundenenSituation wird es sich vor allem der Quelle der Bedrohung zuwenden. Das Individuumsteht also in aktiver Interaktion mit seiner Umgebung.Abb.: Subjektivistische Theorie der VerhaltensregulationBei der Erwartungsbildung stehen der Schutz des Selbst vor Bedrohungen und <strong>die</strong> Entfaltungder eigenen Möglichkeiten im Mittelpunkt, weil das Individuum durch eingrundlegendes Bedürfnis nach Selbstentfaltung geleitet wird, d.h. nach Entfaltung seinerVorstellungen bzw. seiner Dispositionen zur Bildung von Vorstellungen hinsichtlichseiner materiellen, sozialen und idellen Umwelt sowie seiner Handlungsmöglichkeiten inihr; letztes schließt <strong>die</strong> Abwendung von Bedrohungen ein (vgl. MCCOMBS/ WHISLER1989). Durch Interaktion mit seiner Umgebung verändert das Individuum seine Erwartungenund versucht seine Bedürfnisse und Ziele im Rahmen der jeweiligen Bedingun-113
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTgen zu realisieren. Das Bedürfnis nach Selbstentfaltung lässt sich in <strong>die</strong> Bedürfnissenach Sicherheit, Selbständigkeit und Kompetenz 56 differenzieren.Das Bedürfnis nach SicherheitDas Bedürfnis nach Sicherheit besteht zunächst in dem Bestreben der Zugehörigkeitoder sozialen Bindung, dem Wunsch akzeptiert zu sein. Es umfasst nicht nur denWunsch, dass andere sich um einen kümmern, sondern auch den Wunsch für andere zusorgen. Insgesamt ist es also das Bestreben, in befriedigender Weise in <strong>die</strong> soziale Umgebungmit ihren Zielen, Aufgaben und Interaktionen eingebunden zu sein.Mit zunehmender Reflexion <strong>auf</strong> sich selbst und der daraus resultierenden Vorstellungeneines aktuellen, eines werdenden und idealen Selbsts rückt das Bestreben nach Erhaltdes Selbstwerts in den Mittelpunkt. Erhaltung des Selbstwerts bedeutet <strong>die</strong> Aufrechterhaltungder Selbsteinschätzungen der Person. Das sind <strong>die</strong> Bewertungen der verschiedenenAspekte des äußeren Selbst. Dazu gehört das Aussehen, das Wissen, <strong>die</strong> Interessen,<strong>die</strong> Kompetenzen usw. Die Gesamtheit der Selbsteinschätzungen wird als Selbstwertgefühlbezeichnet. Da es vom Individuum ständig überprüft wird, unterliegt es Schwankungen.Bedrohungen oder Herabsetzungen des Selbstwerts werden als unangenehm undbedrohend, Bestätigungen oder Erhöhungen dagegen als angenehm und Sicherheit gebendempfunden. Es besteht ein grundlegendes Bedürfnis, das Selbstwertgefühl <strong>auf</strong>rechtzuerhaltenund gegen Bedrohungen zu verteidigen (FREY/BENNING 1983).Das Bedürfnis nach SelbständigkeitDas Bedürfnis nach Selbständigkeit ist nach DECI / RYAN (1985, 38) eine „angeboreneNeigung zur Selbstbestimmung, <strong>die</strong> den Organismus dazu bringt“, sich für ihn bedeutsamenDingen zuzuwenden. Das ermögliche ihm <strong>die</strong> Entwicklung von Fähigkeiten und<strong>die</strong> flexible Anpassung an <strong>die</strong> Umwelt. Das Bedürfnis nach Selbständigkeit ist eine ursprünglicheintrinsische Motivation, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Internalisierung von Zielen und Verhaltensanforderungenfördert, so dass <strong>die</strong>se aus eigenem Antrieb und nicht etwa durch Druckerfüllt werden. Selbständigkeit kann allerdings durch kontrollierende Maßnahmen wie56Die Idee angeborener psychischer Bedürfnisse geht <strong>auf</strong> MURRAY (1938) zurück und wurde seitherimmer wieder <strong>auf</strong>gegriffen. Da <strong>die</strong>se Annahme durch zahlreiche Untersuchungen eher gestützt als widerlegtwird, scheint sie zunehmend <strong>auf</strong> breiter Basis akzeptiert zu werden (im Überblick DECI/ RYAN1985).114
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTStrafen, Belohnungen, Druck oder auch durch eine Unsicherheit erzeugende Umgebungunterminiert werden. Denn <strong>die</strong> Erfüllung des Bedürfnisses nach Selbständigkeit setztSicherheit voraus.So betrachten Kleinkinder <strong>die</strong> Mutter als sicheren Stützpunkt, von aus sie <strong>die</strong> Umwelterkunden (vgl. AINSWORTH 1967; AINSWORTH/ BLEHAR/ WATERS/ WALL 1978). DasBedürfnis nach Selbständigkeit löst eine Vielfalt von Aktivitäten aus. Schon das Kleinkindwill seinen Bereich erkunden, will alles, was ihm in <strong>die</strong> Hände fällt, „begreifen“und damit umgehen, um es einzuordnen, sein Weltbild dadurch zu erweitern und zu differenzieren(HANSEN 1965; PIAGET 1976). Das Bedürfnis nach Selbständigkeit ist <strong>auf</strong><strong>die</strong> Ausweitung des Selbst gerichtet. Es schließt <strong>die</strong> Suche nach Abenteuer, nach Eroberungneuer unbekannter Dinge sowie nach Wettstreit ein; wobei Wettstreit immer <strong>die</strong>Möglichkeit des Gelingens wie auch des Misslingens bedeutet, d.h. dass für jeden Teilnehmereine Chance des Gewinnens wie auch des Verlierens besteht – im Unterschiedzum schulischen Wettbewerb um Noten, der <strong>auf</strong> ungleichen Voraussetzungen beruht, sodass <strong>die</strong> Leistungsschwachen notwendig immer Verlierer sind.Das Bedürfnis nach KompetenzDas Bedürfnis nach Kompetenz besteht in dem Streben, <strong>die</strong> Mittel zu beherrschen, durch<strong>die</strong> <strong>die</strong> Verwirklichung angestrebter Ziele ermöglicht wird (WHITE 1959). Es bestehteine Wechselbeziehung zwischen den Bedürfnissen nach Kompetenz und Selbständigkeit.Kompetenz fördert das Bestreben nach Selbständigkeit und Selbständigkeit erfordertKompetenz. Individuen ten<strong>die</strong>ren daher dazu, solche Aktivitäten zu suchen, „für <strong>die</strong>sie gewisse angeborene Fähigkeiten besitzen.“ Je kompetenter jemand ist oder je größersein Potential für ein Gebiet ist, desto stärker <strong>die</strong> Bevorzugung (DECI 1992, 51).Eine soziale Umgebung <strong>die</strong> dem Individuum <strong>die</strong> Erfüllung seiner Bedürfnisse nach Sicherheit,Selbständigkeit und Kompetenz ermöglicht, wird bessere kognitive Leistungen,größere soziale Harmonie sowie eine stärkere emotionale Ausgeglichenheit fördern alseine Umgebung, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Erfüllung <strong>die</strong>ser Bedürfnisse behindert. Es kann also <strong>die</strong> körperliche,kognitive, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern durch Berücksichtigung<strong>die</strong>ser Bedürfnisse unterstützt und gefördert werden. Das ist der Fall, wenn <strong>die</strong>Umgebung sensibel <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Bedürfnisse des Kindes eingeht, indem sie ihm Sicherheitdurch Anerkennung sowie Anteilnahme an seinen Wünschen, Plänen usw. gibt; indemsie ihm Spielräume für selbständiges Handeln einräumt, <strong>die</strong> durch von beiden Seitenakzeptierte, einfache klare Regeln strukturiert sind. Allerdings dürfen <strong>die</strong>se Regeln keine115
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTRechtfertigung zu ihrer Durchsetzung darstellen, sondern sie <strong>die</strong>nen lediglich als Orientierungspunkte,mit deren Hilfe Eltern oder Erzieher versuchen, sich ergebende Problemeoder Differenzen im Umgang miteinander zu verstehen, zu deuten und vielleichtanders geartete gemeinsame Regeln mit dem Kind oder den Kindern zu finden. Eineförderliche Umgebung wird Fehler im Umgang mit sozialen und anderen Regeln immerals Möglichkeit zur Entwicklung von Kompetenzen verstehen, wobei vor allem Verständnisund Ermutigung wichtig sind.Diskussion objektivistischer und subjektivistischer AuffassungenWenn beim Kleinkind <strong>die</strong> Regulation des Verhaltens von außen erfolgen müsste, dannmüsste sich beispielsweise das Weinen von Kindern durch äußere Maßnahmen in beliebigerWeise beeinflussen lassen. Angenommen das Kind weint, obwohl es keinen Hungerhaben kann, <strong>die</strong> Windel trocken ist, keinerlei Anzeichen von Krankheit festzustellensind usw. Wenn es dann jedes Mal <strong>auf</strong>genommen wird, wenn es zu weinen anfängt, wirdes <strong>auf</strong>grund der Nähe der zwei Ereignisse im Sinne der Kontiguitätstheorie Weinen mitZuwendung assoziieren. Das gleiche Ergebnis ist nach der Theorie des operanten Konditionierenszu erwarten, wobei allerdings <strong>die</strong> Bedingung hinzukommt, dass das Aufnehmeneine Bekräftigung für das Kind sein muss. Das Weinen und seine belohnende Folgewerden dann miteinander verknüpft. Das Baby wird also immer weinen, wenn es <strong>die</strong> alsbelohnend erfahrene Zuwendung möchte, und damit seine Eltern tyrannisieren. DasWeinen wird dann zu einer Verhaltenstendenz, einer Art von Eigenwillen, den das Kind,solange es das Aufnehmen als belohnend empfindet, durchzusetzen sucht. Wenn esschließlich immer häufiger weint, kann es zu einem „Machtkampf“ zwischen Kind undEltern kommen.Aber entwickelt sich das Kind tatsächlich zu einem kleinen Tyrannen, wenn man sichihm immer zuwendet und es <strong>auf</strong>nimmt, sobald es weint? Wird es das Weinen einsetzen,um seine Eltern zu manipulieren? Diese Annahme hat sich nicht bestätigt. Vielmehrschrieen Kinder, <strong>die</strong> in den ersten drei Lebensmonaten immer umsorgt wurden, wenn sieweinten, in den folgenden Monaten bedeutend weniger, während <strong>die</strong>jenigen, derenSchreien nicht beachtet wurde, sich eher noch steigerten. Außerdem gehorchten <strong>die</strong> häufiggetrösteten Kinder im Alter von neun bis zwölf Monaten in über 80 Prozent der Fälle,während Kinder, deren Weinen nicht beachtet wurde, in weniger als 50 Prozent derFälle gehorchten (AINSWORTH / BELL 1972)116
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTNach der subjektivistischen Auffassung war <strong>die</strong>ses Ergebnis zu erwarten. Denn danachist das Weinen unter den gegebenen Umständen (kein Hunger, trocken, gesund) Ausdruckder Bedürfnisse nach Zuwendung oder Sicherheit und Selbstentfaltung. Zunächstsucht das Kind Sicherheit durch <strong>die</strong> Gegenwart der Mutter. Zudem kann es auch denAustausch wünschen oder es möchte durch das Aufnehmen seine Umgebung erkundenkönnen. Es gibt natürlich auch Babys, <strong>die</strong> nicht <strong>auf</strong>genommen werden wollen. Sie weinennach dem Aufnehmen dann sogar noch mehr. Sie möchten aber Kontakt und Austauschdurch Stimme, Gesten usw. (KORNER 1971). Sowohl das Ignorieren wie auchEingehen <strong>auf</strong> <strong>die</strong> individuellen Wünsche des Kindes bedeutet eine Form der Interaktion.Dabei wird das Kind – wenn auch zunächst nicht bewusst – <strong>auf</strong>grund interner Regelnz.B. Annahmen über seine Umwelt und seine Verhaltensmöglichkeiten in ihr bilden, <strong>die</strong>sein weiteres Handeln bestimmen. Erfährt es kein oder kein konsistentes Eingehen <strong>auf</strong>sein Weinen, wird es wahrscheinlich zu der Annahme kommen, dass <strong>die</strong> Umwelt unzuverlässigist und es um <strong>die</strong> Erfüllung seiner Bedürfnisse und Wünsche kämpfen muss.Erfährt es dagegen eine Art der Zuwendung, <strong>die</strong> spürt, was es möchte, erlebt es seineUmwelt als Sicherheit gewährend. Unter <strong>die</strong>ser Voraussetzung kann es sein Bedürfnisnach selbständiger Erkundung stillen, wodurch sich wiederum seine Kompetenzenschneller entwickeln.Tatsächlich hat sich <strong>die</strong> Sensibilität der Mutter gegenüber den Signalen des Kindes alskritischer Faktor für dessen Entwicklung erwiesen. Da <strong>die</strong> Kinder von Geburt an so verschiedensind, verschieden reagieren, verschiedenes möchten bzw. brauchen, können <strong>die</strong>jeweiligen Erfordernisse des Kindes nur individuell beurteilt und befriedigt werden. DieKinder sensitiver Mütter sind weit früher fähig in effektiver Weise mit anderen zu kommunizierenals Kinder von weniger sensitiven Müttern. Am Ende des ersten Jahres habensie deutlich größere Fortschritte in Fertigkeiten gemacht, <strong>die</strong> für ihre weitere intellektuelleund soziale Entwicklung von Bedeutung sind (AINSWORTH / BELL / STAYTON1974).Sensitives Eingehen bedeutet, dass durch Berücksichtigung interner Prozesse der Verhaltensregelungdas Bedürfnis nach Selbstentfaltung, also nach Sicherheit, Selbständigkeitund den Erwerb von Kompetenzen unterstützt wird. Das bedeutet nicht, dass alleAktivität vom Kind ausgehen muss. Vielmehr sind <strong>die</strong> Anregung, <strong>die</strong> Bereitstellung vonSpielsachen, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> geistige und körperliche Entwicklung besonders geeignet sind,<strong>die</strong> Einbeziehung in gemeinsame Aktivitäten, <strong>die</strong> sich in spielerischer Form auch gezielt<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Förderung sprachlicher, künstlerischer und sonstiger Fertigkeiten beziehen kön-117
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTnen, sowie das Bemühen um gemeinsame und gemeinsam beachtete soziale Regeln vongroßer Bedeutung.Die Berücksichtigung der individuellen Persönlichkeit des Kindes bedeutet vor allem,dass man nicht versucht, es nach einem Schema, nach äußeren Zielen und Normen odereinem Idealbild zu erziehen, sondern es in Übereinstimmung mit seinen inneren Gegebenheiten,seinen Interessen oder Neigungen zu fördern sucht. Kinder, <strong>die</strong> selbstbestimmtGegenstände oder Spiele wählen und sich mit ihnen beschäftigen können, entwickelnsich günstiger als wenn sie mit Gegenständen spielen müssen, <strong>die</strong> sie nicht interessieren.Schon Drei- bis Vierjährige finden bei Gegenständen ihres Interesses mehr Möglichkeitenzu spielen, sie spielen länger, wiederholen häufiger bestimmte Handlungsfolgenvariieren das Spiel stärker, sind weniger ablenkbar, emotional stärker engagiert undeher bereit auch andere mit einzubeziehen als beim Spiel mit Gegenständen, <strong>die</strong> sie nichtinteressieren. Außerdem verarbeiten sie beim Spiel mit sie interessierenden Gegenständenmehr Informationen für den späteren Gebrauch und entwickeln Handlungspläne fürzukünftige Aktivitäten (RENNINGER 1992).Offenbar hängt es auch stärker vom Interesse der Kinder ab und weniger von ihrem Alter,in welchem Maß sie in der Lage sind, Informationen zu strukturieren und planvoll zuhandeln. So weist RENNINGER (1992, 373) dar<strong>auf</strong> hin, dass Kinder, <strong>die</strong> sich nach PIA-GET/ INHELDER (1969) <strong>auf</strong> der präoperationalen Entwicklungsstufe befinden – wonachsie nicht in der Lage sein sollen, zwei Dimensionen gleichzeitig zu berücksichtigen –„zumindest im Hinblick <strong>auf</strong> Objekte ihres Interesses“ durchaus auch mehrere Vorgängegleichzeitig beachten können. Die freie Verfolgung von Interessen ist so gesehen auchvon großer Bedeutung für <strong>die</strong> Entwicklung forschend-entdeckenden Lernens. Wenn <strong>die</strong>Kinder in RENNINGERS Experimenten über einige Wochen, <strong>die</strong> Möglichkeit dazu hatten,waren sie alle gleichermaßen in der Lage, sich selbst komplexe Herausforderungen zusetzen und in ihren Anstrengungen bis zur Lösung durchzuhalten (RENNINGER 1992,375).Interne Prozesse der Verhaltensregulation hinsichtlich der Bedürfnisse nach Sicherheit,Selbständigkeit und Kompetenz stehen demnach in einer Interaktion mit externen Bedingungen.Je nachdem, ob <strong>die</strong>se Bedingungen <strong>die</strong> Erfüllung <strong>die</strong>ser Bedürfnisse ermöglichenoder nicht, wird das Individuum eher intrinsisch oder extrinsisch motiviert sein,und es werden sich entsprechende Motivstrukturen entwickeln.118
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTIntrinsische und extrinsische MotivationNeugier, Interesse, das Bestreben, etwas verstehen oder beherrschen zu wollen sindkennzeichnend für das Phänomen der intrinsischen Motivation. Es bedeutet, etwas vonsich aus, d.h. selbstbestimmt zu wollen und zu tun. Aus Interesse an der Sache oder ausSpaß an einer Tätigkeit will man zu immer vollkommenerer Beherrschung oder einembesseren Verständnis eines Gegenstands gelangen. Kinder, <strong>die</strong> herausfinden wollen,woran es liegt, dass manche Dinge <strong>auf</strong> dem Wasser schwimmen und andere untergehen,und <strong>die</strong> dabei eine Reihe von Annahmen <strong>auf</strong>stellen, <strong>die</strong> sie dann prüfen, oder Kinder, <strong>die</strong>sich zu einem Spiel zusammengefunden haben, sind intrinsisch motiviert. Sie handelnaus eigenem Antrieb und es geht ihnen um <strong>die</strong> Erforschung einer Ursache bzw. um dasSpielen des Spiels.Bei extrinsischer Motivation dagegen kommen <strong>die</strong> Ziele von außen. Das Individuumfühlt sich mehr oder weniger gezwungen, etwas zu lernen, um unangenehme Konsequenzenwie schlechte Noten oder Strafpredigten zu vermeiden oder um gute Noten,Bezahlung oder andere belohnende Folgen zu bekommen. Man arbeitet also nicht umder Sache selber willen, sondern wegen der Konsequenzen, <strong>die</strong> man erstrebt oder vermeidenmöchte und <strong>die</strong> <strong>die</strong> ein bestimmtes Verhalten nach sich zieht. Extrinsische Motivationist also stets instrumentell (DECI / RYAN 1985).Nach RYAN/ CONNELL (1989) können vorgegebene Ziele aber auch verinnerlicht werden.Die entscheidende Bedingung ist, dass <strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong> Möglichkeit zur Selbstbestimmungerhalten. Die Verinnerlichung kann in unterschiedlichem Grad erfolgen. Sieunterscheiden vier Kategorien: external (der Schüler befürchtet sonst Schwierigkeiten);Introjektion (der Schüler hätte sonst ein schlechtes Gewissen usw.); Identifikation (derSchüler betrachtet <strong>die</strong> Aufgabe als wichtig, um … usw.); intrinsisch (der Schüler arbeitet,weil es Spaß macht) 57 . Das Kontinuum reicht von Fremdbestimmung bis zu Selbstbestimmung.Aber auch wenn sich der Schüler mit einem Ziel identifiziert gilt er nach<strong>die</strong>ser Auffassung als extrinsisch motiviert. DECI/ RYAN (1991, 257) gehen nämlich davonaus, dass der Schüler sich einer Aufgabe <strong>auf</strong>grund anderer persönlicher Ziele zuwendet,so dass sie nur Mittel zu einem anderen Zweck sei, jedenfalls sei es ist nicht dasInteresse am Gegenstand das ihn antreibe. Aus <strong>die</strong>sem Grund sehen sie auch kein Kontinuumvon extrinsischer zu intrinsischer Motivation, sondern nur von Fremd- zu Selbstbestimmung.57Deci/ Ryan 1985 postulieren als weitere Kategorie Integration. Damit befassen wir uns später noch.119
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTFremd- und SelbstbestimmungDas Kontinuum von Fremd- zu Selbstbestimmung ist besonders da von Interesse, woWege zur Veränderung von Schule oder Erziehung gesucht werden. Tatsächlich ist es janicht völlig unproblematisch, an Fremdbestimmung gewöhnte Schüler in eine Selbständigkeiterfordernde Umgebung zu bringen. Es dauert eine Weile bis <strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong> Sicherheitgewinnen, <strong>die</strong> sie für eigene Entscheidungen brauchen. Viele vermuten in einerplötzlich geforderten Selbständigkeit nicht mehr als einen Trick, Sachen aus eigenemAntrieb lernen zu sollen, für <strong>die</strong> sie sich eigentlich gar nicht interessieren. Das trifft jaauch überall da zu, wo <strong>die</strong> Schüler nicht wirklich selbst über <strong>die</strong> Gegenstände entscheidendürfen, mit denen sie sich befassen wollen.Als Beispiel dafür kann eine Gesamtschule mit Dalton-Plan-Phasen <strong>die</strong>nen, <strong>die</strong> vonPOPP (1995, 254 ff.) beschrieben wird. In <strong>die</strong>sen Phasen sollen <strong>die</strong> Schüler in etlichenFächern Aufgaben in einer bestimmten Zeit selbständig bewältigen. Die Aufgaben werdenmeist den Schulbüchern entnommen, entsprechen somit dem gewohnten schulischenSchema. Die Schüler genießen <strong>die</strong> Selbständigkeit, erachten eine gute schulische Ausbildungals wichtig, sind aber mehr an den Noten als am Lehrstoff interessiert. Sie fühlensich dann zwar selbständiger, sind aber deswegen nicht mehr an den Aufgaben interessiert,wie in lehrergesteuerten Arbeitsphasen.Wichtig ist also wie ernst einem Erzieher oder einer Schule es mit der Selbständigkeitwirklich ist, mit welchem Verständnis und welchen Hilfen sie sich um <strong>die</strong> selbständigarbeitenden Schüler bemühen. D.h. <strong>die</strong> Schule muss auch versuchen, <strong>die</strong> Bedürfnissenach Sicherheit zu befriedigen. Zur Befriedigung des Bedürfnisses nach Kompetenzkann <strong>die</strong> Art der Aufgaben von Bedeutung sein. Förderlich sind Aufgaben, bei denen <strong>die</strong>Schüler von Alltagserfahrungen ausgehen können, weil es dann leicht ist, eigene Vorstellungeneinzubringen oder zu verwenden. Dadurch können <strong>die</strong> Schüler über solcheAufgaben auch gut mit anderen diskutieren und sich letztlich zu Eigen machen. Wenneine Aufgabe so beschaffen ist, dass der Schüler selber etwas herausfinden kann und soerfährt, dass er <strong>die</strong> Sache versteht, wird sein Bedürfnis nach Kompetenz am ehesten befriedigt.Formen extrinsischer und intrinsischer MotivationIn der üblichen Schule, aber auch <strong>auf</strong> dem Weg von der Fremd- zur Selbstbestimmung,lassen folgende Formen extrinsischer bzw. intrinsischer Motivation beobachten:120
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT1. Extrinsisch: Der Schüler arbeitet, um Druck zu entgehen oder eine Belohnung zuerhalten; beispielsweise wenn lernt, weil er unter Aufsicht steht, weil er <strong>die</strong> enttäuschteMiene seiner Eltern bei der nächsten Klausur fürchtet, oder wenn er lernt,um ein neues Fahrrad zu bekommen bzw. befürchtet, es könnte ihm sonst versagtwerden.2. Ego-Orientierung bedeutet, dass der Schüler vor allem danach strebt, sich gegenüberanderen zu behaupten und sich durchzusetzen. Er betrachtet schulische Aufgabenund Wettbewerb als Mittel und Herausforderung für seine Selbstbehauptung58 .3. Aufgaben-Orientierung bedeutet, dass dem Schüler vor allem <strong>die</strong> Beherrschungund das Verstehen des Gegenstands wichtig ist. Wenn er Zeit und Energie <strong>auf</strong> eineSache verwenden muss, will er <strong>die</strong> Zusammenhänge auch begreifen bzw. eine Fertigkeitgut ausführen können.4. Intrinsisch: Der Schüler ist aus sich heraus an dem Gegenstand interessiert undwill mehr darüber herausfinden. Er braucht keinerlei Lenkung von außen, sondernarbeitet völlig aus eigenem Antrieb.Die Sta<strong>die</strong>n von (1) bis (4) sind einerseits durch eine Zunahme an Selbstbestimmungbzw. Verringerung von Fremdbestimmung gekennzeichnet. Im Hinblick <strong>auf</strong> den üblichenschulischen Unterricht ist zu bedenken, dass nie alle Schüler an allen Gegenständengleich stark interessiert sein können. Deshalb ist auch zu erwarten, dass Schüler selbstunter günstigen Bedingungen selten bzw. nur bei individuell bedeutsamen Gegenständenintrinsisch motiviert sein werden. Unter günstigen Bedingungen dürfte am ehesten„Aufgaben-Orientierung“ anzutreffen sein, <strong>die</strong> als Form intrinsischer Motivation verstandenwerden kann. Im Folgenden beschreibe ich <strong>die</strong>se vier Formen der Motivationdetaillierter:ad (1): Extrinsische Motivation entsteht, wenn der Schüler sich von außen gesteuertfühlt. Auch wenn er aus einem inneren Antrieb <strong>auf</strong> <strong>die</strong> äußeren Maßnahmen reagiert,spürte er doch, dass er einer Situation ausgeliefert ist, wobei <strong>die</strong> Einhaltung der damitverbundenen Anforderungen durch Kontrolle, Lob, Tadel usw. zu sichern versucht wird.Indirekt wird damit signalisiert, dass dem Schüler <strong>die</strong> Kompetenz fehlt und er deshalbauch (noch) nicht selbständig sein kann. Ängstliche und gehemmte Schüler – sie sindbesonders empfänglich für Zeichen der Bedrohung ihres Selbst (GRAY/ OWEN/ DAVIS/TSALTAS 1983) – werden dazu neigen, <strong>die</strong> Bedingungen und <strong>die</strong> damit verknüpfte Einschätzungzu akzeptieren. Sie fügen sich, um so das Bedürfnis nach Sicherheit zu befriedigen,um Anerkennung, Lob oder Belohnung zu erhalten bzw. um weitere Bedrohungen58SHERIF/ CANTRIL (1947)verstanden unter „ego involvement“ als Inhalte und Bestrebungen des Egos,<strong>die</strong> ihm als Beurteilungskriterien <strong>die</strong>nen. Der Ausdruck „ego-oriented“ wird von NICHOLLS (1984) fürdas Bestreben von Individuen, sich im Vergleich zu anderen als fähig zu erweisen, oder gute Beurteilungenzu erhalten, während „task-oriented“ das Bestreben nach Beherrschung, Kompetenz und Verstehenbedeutet.121
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTder Sicherheit durch Tadel oder Strafe, Entzug von Vergünstigungen usw. zu vermeiden.Die Aufgabe selbst hat nur wenig Bedeutung für sie, denn es kommt vor allem <strong>auf</strong> <strong>die</strong>Konsequenzen für ihr Selbst an. Unter solchen kontrollierenden Bedingungen sehen <strong>die</strong>seSchüler kaum eine Wahl, wenn sie Selbstbedrohungen vermeiden wollen, als <strong>die</strong> Bedürfnissenach Selbständigkeit und Kompetenz zu opfern. Sie passen sich entweder ü-bermäßig an oder fügen sich mehr oder weniger passiv. Aufgrund <strong>die</strong>ser Bedingungensind sie eher an kurzfristigen Zielen orientiert. Weil es im Zusammenhang <strong>die</strong>ser Zielenicht unbedingt erforderlich ist, Sachzusammenhänge im Einzelnen zu verstehen, werdensie zu rezeptiv-reproduktivem Lernen neigen und sich den Aufgabe nur solange zuwendenals nötig.Impulsive Schüler dagegen werden unter kontrollierenden Bedingungen versuchen, <strong>die</strong>erwarteten Bestätigungen zu bekommen, denn sie sind besonders empfänglich für Signalevon Belohnungen (GRAY/ OWEN/ DAVIS/ TSALTAS 1983). Nicht selten werden sie jedoch<strong>auf</strong>grund ihrer Impulsivität gegen Regeln verstoßen und / oder unüberlegte Lösungenproduzieren. Wenn sie öfter Misserfolge erleben und getadelt werden, werden dadurchihre Bedürfnisse nach Sicherheit, Selbständigkeit und Kompetenz bedroht. Bei alsstrafend empfundenen Bedingungen entsteht Angst vor Kontrollverlust. Nicht seltenneigen sie dann zu <strong>auf</strong>sässigem, rebellischem oder auch aggressivem und bösartigemVerhalten (STOTT 1972, 58 ff.; GRAY/ OWEN/ DAVIS/ TSALTAS 1983).ad (2): Ego-Orientierung entsteht ebenfalls unter kontrollierenden Bedingungen. Schülermit <strong>die</strong>ser Motivation befürchten schlechte Noten und sozialen Abstieg im Sinne einesVerlusts an Anerkennung. Sie wollen aber nicht <strong>auf</strong>geben und kämpfen lieber. Sie sagensich, dass <strong>die</strong> Welt nun einmal so ist und versuchen das Beste daraus zu machen. Als„Realisten“ haben sie ihre anfänglich intrinsische Motivation der Grundschulzeit verloren,doch <strong>die</strong> schulischen Anforderungen mit Leistungskontrollen und Wettbewerb bietenihnen genügend Herausforderungen für den Erhalt und <strong>die</strong> Steigerung des Selbstwerts.Ego-Orientierung kann für solche Schüler bedeuten, dass sie besser oder genau sogut wie Andere sein wollen, dass sie gute Leistungen wollen, um später bessere Chancenzu haben, dass sie einen bestimmten Notendurchschnitt anstreben, um das von ihnengewünschte Fach stu<strong>die</strong>ren zu können. Sie verfolgen also eher langfristige Ziele undhandeln selbstbestimmt. Obwohl sie kein besonderes Interesse an den Aufgaben haben,ist ihnen das Verständnis der Zusammenhänge nicht ganz gleichgültig. Allerdings ist esihnen wichtiger, ein positives Selbstbild zu haben und einen guten Eindruck bei anderenzu hinterlassen. Ihre Selbst<strong>auf</strong>merksamkeit wird also relativ ausgeprägt sein, was auchdarin zum Ausdruck kommt, dass sie <strong>die</strong> Anstrengungen, <strong>die</strong> notwendig sind, um ihr122
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTZiel zu erreichen, berechnen. Bei Ego-Orientierung werden <strong>die</strong> Leistungen daher zwarden Erfordernissen entsprechen, aber auch kaum darüber hinausgehen.ad (3): Aufgaben-Orientierung entsteht unter Bedingungen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Befriedigung derBedürfnisse nach Sicherheit, Selbständigkeit und Kompetenz ermöglichen. Das setzt dasFehlen von Druck und anderen kontrollierenden Maßnahmen voraus. Aufgaben-Orientierung als schwächere Form intrinsischer Motivation wird am ehesten bei an sichintrinsisch motivierten Schülern bei jenen schulischen Aufgaben anzutreffen sein, wennsie Aufgaben bearbeiten müssen, <strong>die</strong> nicht unmittelbar „Spaß machen“, sondern ebenverpflichtend sind.Wenn der Schüler sich als selbständig denkendes und handelndes Individuum akzeptiertfühlt, und selbst entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt er innerhalb eines vorgegebenenRahmens seine Aufgaben wie und mit wem bearbeitet, kann er auch Selbstbewusstseinund Selbstsicherheit entwickeln. Wenn er versucht, seine Arbeit so gut als möglichzu verrichten, kann er nicht nur Befriedigung in seiner Arbeit finden, sondern sich auchals nützlicher, geschätzter und wertvoller Teil einer sozialen Gruppe sehen, in der er eineAufgabe hat.Selbständiges Handeln kann letztlich auch das Bedürfnis nach Sicherheit befrieden.Denn wenn der Schüler nach seinen Vorstellungen mit den Dingen umgeht, sie ordnet,zusammenfügt, zerlegt usw., fühlt er sich als „Quelle“ (origin) von Erkenntnissen (DE-CHARMS 1968). Er kann etwas bewirken, <strong>die</strong> Umwelt in einem gewissen Grad nach eigenenWünschen beeinflussen und gestalten. Er erfährt aber auch Widerstände. Dingeund andere Menschen lassen sich nicht nach Belieben manipulieren. Es gibt Gesetzmäßigkeitenund Regeln, <strong>die</strong> beachtet werden müssen, wenn man Gegenstände handhabenund Menschen erfolgreich beeinflussen will. Die Widerstände und Grenzen, <strong>die</strong> <strong>die</strong>Umwelt dem eigenen Drang nach Gestaltung oder Beeinflussung entgegensetzt, stellenjedoch Regeln dar, <strong>die</strong> verdeutlichen, dass es mehr oder weniger verlässliche Bedingungengibt, <strong>die</strong> den Umgang mit Menschen und Dingen erleichtern. Es gibt etwas, an dasman sich halten kann. Die Wahlmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten werdendadurch zwar begrenzter, aber auch überschaubarer.Auch das Bedürfnis nach Kompetenz lässt sich durch selbständiges Handeln befriedigen.Allerdings müssen <strong>die</strong> Schüler Anforderungen, <strong>die</strong> seinen Fähigkeiten angemessen sind,selbständig wählen können. So sind Schülern bei Fertigkeiten wie Tennis, Schach usw.am liebsten solche Partner, <strong>die</strong> ein wenig besser sind und so eine optimale Herausforderungbieten, bei der der Schüler sich steigern kann und doch gewisse Gewinnchancen123
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFThat. Andere Anreize sehen sie in der Neuigkeit von Aufgaben oder Gegenständen (BER-LYNE 1974; HUNT 1965). Wichtiger und grundlegender ist es jedoch, dass <strong>die</strong> Schülernicht Ergebnisse lernen, sondern sich ausgehend von ihrer Sicht der Dinge in Problemeverwickeln können, <strong>die</strong> forschend-entdeckendes Lernen anregen. In solchen Fällen stehen<strong>die</strong> Aufgaben nicht für sich, sondern sind in den Zusammenhang umfassendererFragen und Zusammenhänge eingebettet.Beim forschend-entdeckenden Lernen erfahren <strong>die</strong> Schüler, dass sie durch eigene AnstrengungErkenntnisse gewinnen können, dass sie Kompetenzen besitzen. Die Konzentration<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Sache wird durch das Fehlen von Druck und <strong>auf</strong> Schülerseite durch dasFehlen unnötiger Vergleiche mit den Fähigkeiten der anderen, <strong>die</strong> nur von der Sacheablenken und Verarbeitungskapazität verbrauchen, gefördert. Wie <strong>die</strong> Untersuchungenvon FEUERSTEIN (1983) zeigen, verringert sich <strong>die</strong> Bedeutung der Einflüsse von Temperament,Familienhintergrund usw. bei forschend-entdeckendem Lernen. Ängstliche undgehemmte Schüler gewinnen durch <strong>die</strong> Abwesenheit von Druck, den sie als Bedrohunginterpretieren, und <strong>die</strong> Erfahrung von Kompetenz mehr Selbstvertrauen. Impulsive Schülerlernen unter Bedingungen, bei denen nicht Lob oder Belohnung für richtige Reaktionen,sondern ausschließlich der Erwerb von Kompetenzen zählt, dass sie ihr Können nursteigern können, wenn sie erst Nachdenken und durch Zurückhaltung spontaner HandlungenFehler vermeiden.ad (4): Intrinsische Motivation als unmittelbares und anhaltendes Interesse an einer Sachemit der Bereitschaft sich intensiv damit auseinanderzusetzen und keine Anstrengungenzu scheuen ist nur individuell als bedeutsam empfunden Gegenständen anzutreffen.Ein solches Interesse kann <strong>die</strong> Grundlage für <strong>die</strong> Entwicklung von Talenten bilden. Fastjeder kann – wenn auch in einem kleinen Bereich – besondere Leistungen erbringen.Voraussetzung ist, dass der Schüler den Bereich, der seinen Kompetenzen am ehestenentspricht, auch findet. Das kann unterstützt werden durch ein Angebot an Wahlmöglichkeitenim Rahmen einer Unterrichtsorganisation, <strong>die</strong> es erlaubt, <strong>die</strong> Wünsche, Neigungen,Bedürfnisse, Interessen und Vorschläge von Schülern <strong>auf</strong>zugreifen und umzusetzen.Kontrollierende Maßnahmen zerstören <strong>die</strong> LernfreudeWenn Kinder in <strong>die</strong> Schule kommen, sind sie in der Regel an den Sachen interessiert, siewollen unbedingt lernen und freuen sich <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Herausforderungen, <strong>die</strong> sie in der Schuleerwarten. Diese ursprüngliche Lernfreude löst sich in der Regel schon nach kurzer124
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTZeit <strong>auf</strong>. Spätestens mit dem Ende der Grundschule sind <strong>die</strong> letzen Reste intrinsischerMotivation bei den Kindern verflogen. Dabei ist <strong>die</strong>se Lernfreude <strong>die</strong> grundlegende Voraussetzungfür <strong>die</strong> Entfaltung ihrer Möglichkeiten. Denn nur wenn <strong>die</strong> Schüler aus Interessean der Sache lernen, werden sie bereit sein, sich den Gegenständen solange zuzuwenden,bis sie <strong>die</strong> erforderlichen Kompetenzen erworben haben. Zudem ist ihre Aufmerksamkeitnur bei intrinsischer Motivation ganz <strong>auf</strong> den Gegenstand gerichtet undnicht durch sachfremde Bedingungen abgelenkt.Die Frage ist, wie es der Schule gelingt, <strong>die</strong> ursprüngliche Lernfreude der Kinder so ausnahmsloszu zerstören. Das Problem ist, dass <strong>die</strong> Schule – wie auch <strong>die</strong> Arbeitswelt –vor allem <strong>auf</strong> kontrollierende Maßnahmen setzt. Es sind aber <strong>die</strong>se kontrollierendenMaßnahmen, <strong>die</strong> der Lernfreude den Garaus machen.So zeigten Untersuchungen, dass intrinsische Motivation durch kontrollierende Maßnahmeneingeschränkt oder unterminiert wird. Häufige Maßnahmen <strong>die</strong>ser Art bestehenin Versprechungen. Bei irgendwelchen Leistungen werden bestimmte Wünsche erfüllt,das Taschengeld mit einem Bonus bedacht usw. Untersuchungen zeigen, dass Belohnungoder Bezahlung (DECI 1971) und Preise (LEPPER/ GREENE/ NISBETT 1973; HARA-CKIEWICZ 1979) für <strong>die</strong> Beteiligung an einer interessanten Aktivität dazu führte, dass <strong>die</strong>Probanden nach Erhalt der Belohnung weit weniger bereit waren, weiterzumachen alsProbanden, <strong>die</strong> nichts erhielten. Auch Untersuchungen der Wirkungen allgemein üblicherMethoden extrinsischer Motivierung durch positive und negative Sanktionen, erbrachtenähnliche Ergebnisse. Diese Mittel wirken zwar, aber sie erfüllen ihren Zwecknur innerhalb des zeitlichen und örtlichen Rahmens, in dem <strong>die</strong>se Sanktionen ausgeübtwerden. Selbst bei an sich interessanten Aufgaben verringern sie <strong>die</strong> intrinsische Motivationund auch „<strong>die</strong> Internalisierung der Regulation bei uninteressanten Aufgaben“ (DECI/ VALLERAND / PELLETTIER / RYAN 1991, 335). Aber auch Maßnahmen wie Wettbewerb(VALLEREAND / GAUVIN / HALLIWELL 1986) vorgegebene Ziele (MOSSHOLDER 1980)und Zeitlimits (AMABILE/ DEJONG/ LEPPER 1976), schränken <strong>die</strong> intrinische Motivationein.Kontrolle im Sinne von Überwachung im Zusammenhang mit Sanktionen begünstigt <strong>die</strong>Entstehung von Stress. Bei Wettbewerb um Noten fürchten viele Schüler sich gegenüberanderen zu verschlechtern, bei Zeitlimits, nicht rechtzeitig fertig zu sein usw. UnterStress steigt zwar <strong>die</strong> Fähigkeit zu körperlichen und geistigen Routineleistungen, aberder Umgang mit Vorstellungen wird ungünstig beeinflusst, denn Angst beeinträchtigtdas Denken. Sie stellt eine Bedrohung des Bedürfnisses nach Sicherheit dar. In <strong>die</strong>sem125
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTFall muss sich das Interesse an der Aufgabe notwendig verringern. Statt sich für eineAufgabe zu interessieren kommt es dar<strong>auf</strong> an, etwas zu tun, um wieder Sicherheit zugewinnen. So ist es nicht verwunderlich, wenn Kinder, <strong>die</strong> <strong>die</strong> notwendige emotionaleSicherheit nicht erhalten, <strong>die</strong> intrinsische Motivation verlieren (ANDERSON/ MANOOGI-AN/REZNICK 1976).Schüler reagieren bei Ankündigung von Kontrollen oft mit einer Beschränkung <strong>auf</strong> Routinelösungenoder Auswendiglernen. Dadurch wird <strong>die</strong> Aufmerksamkeit wie bei Fluchtoder Angriff <strong>auf</strong> eine eingespielte Handlung konzentriert. Weiß der Schüler aber, dassihm das nichts nützt, kommt es zur Teilung der Aufmerksamkeit. Seine Aufmerksamkeitist dann nicht nur <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Aufgabe, sondern auch <strong>auf</strong> <strong>die</strong> eigene Lage und <strong>auf</strong> <strong>die</strong> zu erwartendenFolgen gerichtet. Ist nämlich der Erhalt des Selbstwerts bedroht oder bestehen<strong>auf</strong>grund häufiger Selbstwertbedrohungen entsprechende Erwartungen, <strong>die</strong> Wahrnehmungund Verhalten mitbestimmen, nimmt <strong>die</strong> Selbst<strong>auf</strong>merksamkeit zu (WICKLUND1975). Die Individuen neigen dazu, Anforderungen, Reaktionen usw. <strong>auf</strong> sich zu beziehenund in negativer Weise als Bedrohung ihres Selbst zu betrachten. Dadurch wird <strong>die</strong>Verarbeitungskapazität, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Bearbeitung der Aufgabe zur Verfügung steht, durchnutzlose Überlegungen gestört und eingeschränkt.MCGRAW (1978), der frühere Forschungsergebnisse zu den Folgen intrinsischer undextrinsischer Motivation im Umgang mit Lern<strong>auf</strong>gaben zusammengefasst hat, kommt zudem Ergebnis, dass Aufgaben, deren Lösung durch Anwendung einfacher Schemataoder mechanisches Lernen erreichbar ist, extrinsische Motivierung zu besseren Ergebnissenführen kann. Bei Denk<strong>auf</strong>gaben dagegen hat extrinsische Motivierung äußerstungünstige Folgen (vgl. RYAN/ STILLER 1991;DECI/ RYAN 1987; RYAN/ POWELSON1991).Dieses Ergebnis wird unterstützt durch eine Untersuchung von AMABILE (1983). Siestellte fest, dass extrinsische Motivierung <strong>die</strong> Kreativität der Versuchspersonen deutlichbeeinträchtigte, während sie durch intrinsische Motivierung gefördert wurde. In einerUntersuchung von GROLNICK/RYAN (1987) zeigten sich bei extrinsischer MotivationBeeinträchtigungen des Verständnisses von Zusammenhängen. Sie verglichen das Textverständnisund Behalten von üblichen Lesetexten bei Schülern der fünften Klasse, <strong>die</strong>sie drei Bedingungen unterwarfen. Der ersten Gruppe wurde der Text einfach zum Lesengegeben. Die Schüler mussten annehmen, dass sie nicht getestet würden. Der zweitenGruppe wurde mitgeteilt, dass <strong>die</strong> Forscher wissen möchten, was sie aus dem Text lernen,das Ergebnis würde aber nicht benotet. Die dritte Gruppe erfuhr, dass sie im An-126
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTschluss getestet und Noten dafür erhalten würden, also <strong>die</strong> schulische Standardprozedur.Das Ergebnis war, dass <strong>die</strong> zweite und dritte Gruppe deutlich bessere Ergebnisse bei derWiedergabe von Einzelheiten zeigten. Nach einer Woche jedoch war <strong>die</strong> Vergessenratehöher als bei der ersten Gruppe. Besonders hoch war sie bei der dritten Gruppe, der mitgeteiltworden war, sie würden benotet werden. Die Zusammenhänge wurden am bestenvon der ersten Gruppe verstanden. Die dritte Gruppe, deren Ergebnisse bewertet wurden,war hier am schlechtesten.Mittel extrinsischer Motivierung sind also nicht geeignet, eine Zunahme an intrinsischerMotivation zu bewirken, im Gegenteil. Außerdem ist damit zu rechnen, dass Mittel zurintrinisischen Motivierung (z.B. Gruppenarbeit oder Selbstbestimmung bei der Wahlund Bearbeitung von Aufgaben) bei gleichzeitig angewandten Mitteln zur extrinsischenMotivierung in der zu erwartenden Wirkung erheblich beeinträchtigt werden. So wähltenSchüler, <strong>die</strong> für richtige Lösungen belohnt wurden, leichtere Aufgaben (PITTMAN/ EME-RY/ BOGGIANO 1982; SHAPIRO 1976) und ten<strong>die</strong>rten dazu, nur ein Minimum an Anstrengungfür <strong>die</strong> Aufgabe einzusetzen (KRUGLANSKI/STEIN/RITER 1977). Bei Anwendungvon Mitteln zur intrinsischen Motivierung wählten sie hingegen schwierigere (SHAPIRO1976) und ihren individuellen Fähigkeiten entsprechende, also weder zu schwierige nochzu leichte Aufgaben (DANNER/LONSKY 1981). Wenn also im Zusammenhang schulischerReformen einer <strong>auf</strong> extrinsischer Motivierung beruhenden Struktur einige Elementezu intrinsischer Motivierung hinzugefügt werden, dürften kaum nachhaltige Steigerungenhinsichtlich Lernbereitschaft und Lernerfolgen zu erzielen sein.14. Gefühl und TemperamentWenn <strong>die</strong> Umwelt dem Streben des Individuums nach Sicherheit, Selbständigkeit undKompetenz entgegenkommt, wird es dem inneren Selbst eher gelingen, <strong>die</strong> im sozialenKontext erfahrenen Anforderungen, Wertvorstellungen und Informationen mit den eigenenWünschen, Interessen und Auffassungen koordinieren. Das Individuum wird sichdaher in seiner Umwelt eher subjektiv sinnvolle Handlungsmöglichkeiten erkennen könnenund sich selbstbestimmt darin verhalten (DECI/ RYAN 1991).Wenn der soziale Kontext das Streben nach Sicherheit, Selbständigkeit und Kompetenzbehindert, wird dadurch auch <strong>die</strong> Entwicklung der Persönlichkeit beeinträchtigt. Zwarwerden auch dann Informationen <strong>auf</strong>genommen, Regeln und Wert<strong>auf</strong>fassungen gebildet,aber da sie nicht mit dem individuellen Empfinden und Wollen integriert sind, fühlt sich127
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTdas Individuum in seinem Handeln eher gedrängt als frei und selbstbestimmt, es erlebteher Spannungen, wird eher von Gefühlen beherrscht, deren Macht es nicht kontrollierenkann, <strong>die</strong> Kenntnis von Werten und das Handeln stehen kaum in einem Zusammenhangmiteinander usw. (DECI/RYAN 1991, 276 ff.).Gefühle sind im vorliegenden Modell zunächst als Reaktionen des inneren Selbst <strong>auf</strong>Reize und Informationen zu verstehen. Gefühle, <strong>die</strong> im Umgang mit der Umwelt immerwieder <strong>auf</strong>treten, formen <strong>die</strong> Persönlichkeit. Das sich kann z.B. körperlich in bestimmtenGesichtszügen (resigniert, verbittert, fröhlich usw.) und/ oder in einer bestimmten Haltung(gedrückt, verschlossen, <strong>auf</strong>recht und offen usw.) niederschlagen. In <strong>die</strong>sem Sinnsind Gefühle als Aspekte des äußeren Selbst zu betrachten.Schulisch bedeutsame TemperamenteTemperamente sind angeborene Verhaltensmuster, <strong>die</strong> das Fühlen, Denken und Handelneines Individuums in geradezu mechanischer Weise bestimmen. So sind ängstlicheSchüler sensitiver gegenüber Bestrafungen bzw. gegenüber dem Entzug von Gratifikationenals wenig ängstliche. Sie zeigen unter Bedingungen, <strong>die</strong> ihnen hinsichtlich ihresSelbstwerts bedrohlich erscheinen, eine höhere Anpassungsbereitschaft. Bei Prüfungenmit unzulänglichen Vorbereitungsmöglichkeiten kann Ängstlichkeit <strong>die</strong> Leistungen beeinträchtigen(SCHWARZER 1987, 100 ff.). Angst im Zusammenhang mit Misserfolgenkann aber auch zu Kontrollverlust bzw. Hilflosigkeit zur Folge haben (ebenda, S. 200ff.). Ängstlichkeit ist also eine schulisch sehr bedeutsame Temperamentseigenschaft.Eine andere wesentliche Eigenschaft ist <strong>die</strong> Impulsivität. Impulsive Schüler handelnohne zu denken oder zu planen; sie raten, machen viele Fehler, werden getadelt und erfahrendadurch Enttäuschungen. Außerdem stören sie mit ihren spontanen Aktivitätenim Unterricht und fallen negativ <strong>auf</strong>. Aber nicht nur in hohem Maß impulsive Schüler,sondern auch Schüler, denen <strong>die</strong> Impulsivität weitgehend fehlt, <strong>die</strong> eher passiv und reserviertoder scheu sind, können in der herkömmlichen Schule leicht untergehen, weilsie kaum wahrgenommen werden.Diese Temperamentseigenschaften können insbesondere bei Kindern aus benachteiligtensozialen Milieus eine Kumulierung negativer Effekte begünstigen, weil solche Schülerohnehin eher ein schwaches Selbstwertgefühl haben und auch ihre Bereitschaft zumWettbewerb im intellektuellen Bereich geringer ist, weil sie ferner stärker irritierbar,weniger an <strong>die</strong> geltenden Normen angepasst sind und <strong>die</strong> Bedeutung von Prüfungen oft128
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTnicht angemessen einschätzen können (vgl. DEUTSCH/ FISHMAN/ KOGAN/ NORTH/ WHI-TEMAN 1964).Es sind also folgende Gruppen von Schülern zu unterscheiden:• Ängstliche Schüler;• Ungezwungene Schüler. Sie müssen nicht frei von Ängsten sein, können aber gut mitihnen umgehen, so dass sie in ihren Leistungen dadurch nicht oder kaum beeinträchtigtwerden;• Impulsive Schüler;• Gehemmte Schüler, d.h. Schüler, <strong>die</strong> zurückgezogen sind, <strong>die</strong> sich nicht <strong>auf</strong>drängenund ihnen unangenehme Situationen eher passiv ertragen als sich zu wehren.Diese Einteilung ist auch in anderen Konzeptionen zu finden und weist Beziehungen zuälteren Temperamentslehren wie der von Hippokrates <strong>auf</strong>.Abb.: Klassifikationen von Temperamenten (nach SCHALLING/ EDMAN/ ÅSBERG (1983,125).129
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTEs ist umstritten, inwieweit Temperamente angeboren oder erworben sind. Auch wennheute eine Neigung besteht, den Faktor der Anlage höher zu bewerten, gilt es als sicher,dass Umwelt und Erziehung gegebene Temperamentseigenschaften verstärken oder mildernkönnen (FULKER 1981; EYSENCK 1983; KAGAN/ SNIDMAN/ ARCUS 1993, 20 F.; DA-VIDSON 1993).Ob Angst und Impulsivität verstärkt werden, hängt also auch von Unterrichtsbedingungenab. Insbesondere kommt es dar<strong>auf</strong> an, ob <strong>die</strong> psychischen Bedürfnisse nach Sicherheit,Selbständigkeit und Kompetenz erfüllt oder nicht erfüllt werden. Während Maßnahmenzur intrinsischen Motivierung <strong>die</strong>se Bedürfnisse zu berücksichtigen suchen,werden sie bei Maßnahmen zur extrinsischen Motivierung kaum beachtet.Der Einfluss des Temperaments bei extrinsischer MotivierungBei extrinsischer Motivierung, d.h. unter Bedingungen, <strong>die</strong> das Lernen des Schülers vonaußen durch Lenkung, Lob, Tadel usw. zu bestimmen oder kontrollieren versuchen, werdenEinflüsse von Temperamentseigenschaften in äußerst ungünstiger Weise verstärkt.Das gilt vor allem für• ängstliche Schüler.Sie sind besonders sensibel gegenüber Bestrafungen, Tadel oder Entzug von Anerkennung,d.h. sie reagieren sehr stark <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Möglichkeit negativer Sanktionen bei extrinsischerMotivierung (GRAY/ OWEN/ DAVIS/ TSALTAS 1983). Es kommt nicht einmal dar<strong>auf</strong>an, ob sie selbst bestraft werden, entscheidend ist, dass es Bestrafungen gibt, wen immersie treffen. Wenn in der Schule und anderen <strong>Institution</strong>en Lob und Tadel, Belohnungund Bestrafung <strong>die</strong> zentralen Mittel sind, kann Ängstlichkeit erheblich verstärkt werden.Ängstliche Kinder und Jugendliche neigen in solchen Situationen dazu, Bedrohungenihres Selbstwerts zu wittern und sich entsprechend zu verhalten. Da Angst und Schwäche<strong>auf</strong> der Seite der Lehrer und auch bei anderen Schülern Überlegenheit und Machtbegünstigt, erhalten sich <strong>die</strong>se Interaktionsmuster <strong>auf</strong> Dauer (CAPSI/ BEM/ ELDER 1989)Schulangst ist überaus häufig. Die Schüler leiden unter Kritik und Zurückweisung; siefürchten sich vor anderen Schülern und vor Gewalt. Kinder der vierten bis sechstenKlasse fürchten sich beispielsweise, bei Spielen als letzte für ein Team ausgewählt zuwerden. Die Furcht, nicht versetzt zu werden, zählt zu den größten Ängsten (YOUNGS1985). Laut einer im Saarland durchgeführten repräsentativen Befragung befürchteten 46% der Schüler, unter Umständen nicht versetzt zu werden, obwohl das nur in 5 % der130
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTFälle vorkam; 46 % gaben an, in der Schule manchmal so <strong>auf</strong>geregt zu sein, dass ihnen<strong>die</strong> Hände zittern; 51 % haben Angst, eine falsche Antwort zu geben. Wenn nun unterden üblichen schulischen Bedingungen bei so vielen Schülern Ängste erzeugt werden, istanzunehmen, dass in hohem Maße ängstliche Schüler noch weit mehr als andere leiden.So gaben 20 % an, ihnen sei manchmal schlecht vor der Schule, 12 % nehmen <strong>auf</strong> Anratendes Arztes Beruhigungsmittel und 2 % Schlaftabletten am Abend vor den Klassenarbeiten(STRITTMATTER 1977).Ängstliche Schüler werden also bei potentiellen Bedrohungen in ihrem Bedürfnis nachSicherheit noch stärker beeinträchtigt als weniger ängstliche Schüler. Wenn versuchtwird, <strong>die</strong> Schüler durch Prüfungen, unerwartete Fragen und schwierige Aufgaben, durchLeistungsdruck <strong>auf</strong>grund hoher Anforderungen, durch negative Reaktionen <strong>auf</strong> Misserfolge,durch unerwartete Kontrollen usw. zu Mitarbeit und Anstrengungen anzuspornen,werden sie ganz besonders vorsichtig sein, um ihren bedrohten Selbstwert nicht zu gefährden.Ihre Möglichkeiten dazu hängen allerdings von ihrer Fähigkeit ab, sich schnellden gegebenen Bedingungen anzupassen. Dadurch ergeben sich weitere Unterschiedezwischen leistungsfähigen, mittelmäßigen und leistungsschwachen ängstlichen Schülern.Leistungsfähige ängstliche Schüler neigen dazu sich anzupassen und zu versuchen, immer<strong>die</strong> richtigen Antworten zu geben. Mit ihren Leistungen sind sie nie zufrieden, siemöchten perfekt sein und alles noch besser machen. Sie trauen sich daher nicht, neueund unsichere Wege zu gehen, sondern suchen nach Gewohntem, sind also Wagnissenund Neuem gegenüber abgeneigt. Bei einer Änderung der Unterrichtsbedingungen, <strong>die</strong>ihnen mehr Freiheit geben, werden sie verunsichert. Sie wünschen, dass der Lehrer denUnterricht strukturiert und warten <strong>auf</strong> seine Anweisungen, weil sie nur so wissen, wassie tun sollen. Sie opfern das Bestreben nach Selbständigkeit zugunsten der Sicherheit,<strong>die</strong> sie durch Anpassung und durch ihre Kompetenz in der Lösung vorgegebener Aufgabenfinden, wodurch sie nicht selten zu Lieblingsschülern ihrer Lehrer werden (LANDAU1990, 70).Mittelmäßige ängstliche Schüler finden dagegen weniger Befriedigung in der Anerkennungihrer Kompetenz. Auch sie ten<strong>die</strong>ren dazu, sich anzupassen und richten sich nachdem, was der Lehrer hören möchte. Aber da sie <strong>die</strong> Zusammenhänge weniger gut verstehen,ist ihre Neigung zur Rezeption ohne klares Verständnis bei ihnen größer. Sofernsie Sicherheit in der Perfektion suchen, bauen sie mehr <strong>auf</strong> bloßes Auswendiglernen.Aufgrund ihrer Ängstlichkeit und eingeschränkten Kompetenz neigen sie in Anforderungssituationendazu, sich unnötig mit <strong>auf</strong>gabenfremden Überlegungen z.B. zu den131
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTFolgen eines möglichen Versagens beschäftigen, so dass sie in Prüfungen unter ihremLeistungsniveau abschneiden (DEFFENBACHER 1980).Leistungsschwache ängstliche Schüler haben weniger Möglichkeiten, Sicherheit durchAnpassung und Kompetenz zu finden, auch wenn sie es versuchen. Sie entwickeln dahermeist ein niedriges Selbstwertgefühl und fühlen sich als Versager. Wenn dann ihre Erfolgszuversichtgeschwunden ist, strengen sie sich auch nicht mehr an und verschlechternsich dadurch noch mehr (JOPT 1978).Ängstlichkeit wird zusätzlich verstärkt durch Eltern, <strong>die</strong> mit Tadel, Bestrafung, Verbotenund Einschränkungen <strong>auf</strong> Misserfolge der Kinder reagieren. Wenn <strong>die</strong> Kinder sich dannin Leistungssituationen <strong>die</strong> Reaktionen ihrer Eltern vorstellen, verstärkt das <strong>die</strong> Angstvor Misserfolg noch mehr. Ähnlich wirkt sich unberechenbares Elternverhalten aus;wenn sie einmal <strong>die</strong> schlechten Noten freundlich hinnehmen und ein anderes Mal wütendreagieren, wird <strong>die</strong> unerwartete Bestrafung dann umso stärker empfunden (HELM-KE/ VÄTH-SZUSDZIARA 1980). Aber auch Verwöhnung und Unterforderung ängstlicherKinder tragen dazu bei, dass <strong>die</strong>se ihre Fähigkeiten nicht entfalten können; daraus wiederumresultiert ein geringes Selbstvertrauen, wodurch <strong>die</strong> Ängstlichkeit in unbekanntenSituationen oder bei neuen Anforderungen verstärkt wird.Ähnlich wie ängstliche reagieren oft• gehemmte, zurückgezogene Schüler.Sie sind besonders empfindsam und „verwundbar im Angesicht von Fremdheit undSchwierigkeiten“ (STOTT 1972, 71). Aufgrund von Situationen, in denen sie oder andereimmer wieder vor Aufgaben gestellt werden, <strong>die</strong> ihnen fremd und/oder zu schwierigerscheinen, neigen sie zu der Erwartung, dass jede Aufgabe, vor <strong>die</strong> sie gestellt werden,zu schwierig für sie sei. Um nicht gedrängelt und gefordert zu werden, geben sie sichunfähig (STOTT 1972, 37) oder bauen eine Mauer aus Gleichgültigkeit und Desinteresse<strong>auf</strong>, hinter <strong>die</strong> sie sich zurückziehen. Werden sie von Kameraden zurückgewiesen, beurteilensie sich und ihre Fähigkeiten negativ; aus <strong>die</strong>sem Grund sind auch meist sozialzurückgezogen und haben nur wenig Freunde (RUBIN 1993). Aus der Sicht des Lehrerssind das oft <strong>die</strong> trägen unintelligenten Kinder, <strong>die</strong> nur ein Minimum an Lehrstoff bewältigenkönnen (STOTT 1972, 37; 73). Zurückgezogenheit wird begünstigt durch subjektiveUnsicherheit, <strong>die</strong> bei <strong>die</strong>sen Kindern insbesondere <strong>die</strong> wiederholte Erfahrung von Inkompetenz,sowie durch Zurückweisung und negative Fremdeinschätzung <strong>auf</strong>rechterhaltenwird. Aber nicht nur Überforderung, sondern auch Verwöhnung und Unterforderung132
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTführen dazu, dass <strong>die</strong>se Kinder ihre Fähigkeiten nicht entwickeln können und verstärkenso <strong>die</strong> Neigung, sich zurückzuziehen.Im Klassenunterricht mit seinen vorgegebenen Aufgaben und dem Wettstreit um Noten,der <strong>die</strong> soziale Rangordnung betont, geraten solche Schüler leicht ins Abseits. Eine Untersuchungsozial zurückgezogener Kinder einer normalen Schülerpopulation ergab einehohe Stabilität <strong>die</strong>ser Temperamentseigenschaft von der frühen bis zur späten Kindheit,begleitet von einem Gefühl der Unsicherheit und Abhängigkeit sowie negativen Selbsteinschätzungen(RUBIN 1993).Da <strong>die</strong>se Kinder sich unterschätzen und nicht aus sich herausgehen, können sie ihre Fähigkeitenweder nutzen noch entfalten. Es können überaus leistungsfähige Kinder daruntersein, d.h. typische „Underachiever“ (LANDAU 1990, 70 f.). Grundsätzlich werden sieaber alle in ihren Möglichkeiten eher unterschätzt. Da sie geduldige individuelle Ermutigung,Bestätigung und soziale Akzeptanz brauchen, können sie bei den im normalenschulischen Unterricht üblichen kontrollierenden Methoden nicht gefördert werden.Vielmehr festigen <strong>die</strong>se kontrollierenden Methoden <strong>die</strong> bestehenden ungünstigen Interaktions-und Reaktionsmuster. Es gelingt solchen Schülern daher nur schwer, ihre Gehemmtheitdurch Selbstvertrauen und Zuversicht auszugleichen, wodurch sich ihreHemmung in eine durchaus vorteilhafte Vorsicht mit abwägendem Denken verwandelnkönnte.Aus der Sicht des Lehrers sind am schwierigsten• impulsive Schüler.Sie neigen zu überstürztem Handeln ohne zu überlegen, ohne <strong>die</strong> mit ihrem Handelnverknüpften Risiken abzuschätzen oder zu planen (z.B. BARRATT/ PATTON 1983, 89).Meist sind sie von einem unermüdlichen Aktivitätsdrang erfüllt, der sich in unvorhersehbaremVerhalten äußert, mit dem auch der geduldigste Erzieher im Kindergarten nurschwer zurechtkommt. Denn wenn sie durch dem Raum rasen, dabei andere Kinder anrempelnund lachend oder schreiend alles durcheinander bringen, strapaziert <strong>die</strong>ses Verhaltendas Einfühlungsvermögen und Verständnis vieler Erzieher und Eltern. Wenn einKind <strong>die</strong> Sachen, <strong>die</strong> der Erzieher ihm gibt, um es zu beschäftigen, durch den Raumwirft, fällt es Erziehern oft schwer, <strong>die</strong>ses Verhalten ruhig und forschend zu beobachten,um herauszufinden, was das Kind so antreibt und was ihm wohl fehlt. In der Schulekriecht <strong>die</strong>ses Kind unter den Bänken durch, erschrickt andere, nimmt ihnen <strong>die</strong> Schreibsachenfort, schmeißt mit ihren Ra<strong>die</strong>rgummis, steht plötzlich hinter dem Lehrer, wenn<strong>die</strong>ser sich zur Tafel wendet, läuft trotz aller Ermahnungen immer wieder durch den133
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTRaum usw. Eltern und Lehrer, <strong>die</strong> alles versuchen, das Kind zu disziplinieren, scheinennur Fehlschläge zu erleben und geraten selbst in einen Zustand der Hilflosigkeit (STOTT1972, 59), drohen, strafen immer härter, geben schließlich alle Erziehungsversuche <strong>auf</strong>.Impulsivität wird begünstigt und <strong>auf</strong>rechterhalten durch <strong>die</strong> Anwendung von Erziehungsmittelnwie Lob oder Belohnung für erwünschtes Verhalten oder richtige Antworten.Die Möglichkeit von Bestrafungen oder des Erregens von Missfallen scheinen impulsiveSchüler kaum wahrzunehmen, aber wenn sie getadelt oder bestraft werden, reagierensie meist aggressiver als andere Kinder und fühlen sich ungerecht behandelt; dasbedeutet auch, dass sie kaum aus Bestrafungen lernen (GRAY/ OWEN/ DAVIS/ TSALTAS1983).Problematisch ist vor allem, wenn Eltern und Lehrer glauben, ein solches Kind sei nurdurch eine „Dressur“, d.h. <strong>die</strong> Einübung bestimmter Verhaltensmuster zu erziehen. Dennwenn im Wesentlichen <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Einhaltung bestimmter Ergebnisse geachtet wird, hat daseine ständige Kontrolle zur Folge. Die Schwierigkeit des impulsiven Kindes ist, dasssein kognitiver Stil unangemessen ist. Es nimmt Informationen <strong>auf</strong> und verknüpft sieunmittelbar mit Handlungen. Es ist also gerade der Mangel an Lern<strong>auf</strong>gaben, <strong>die</strong> <strong>die</strong>Einsicht in den Zusammenhang von Zielen, möglichen Mitteln zu ihrer Erreichung undPlänen zu ihrem Einsatz fördern, durch <strong>die</strong> <strong>die</strong>ser Stil <strong>auf</strong>rechterhalten wird. Dressurbaut <strong>auf</strong> <strong>die</strong> ständige Kontrolle erwünschten Verhaltens. Wenn es für das Kind aber nurdar<strong>auf</strong> ankommt, <strong>auf</strong> irgendwelche Reize Reaktionen zu zeigen, <strong>die</strong> den Erzieher zufriedenstellen, wor<strong>auf</strong> dann Belohnungen zu erwarten sind, fördert das gerade einen rezipierend-reproduzierendenLernstil. Auf <strong>die</strong>se Weise kann das Kind seine Impulse nichtin den Griff bekommen. Denn um sie zu beherrschen, muss es zu einer Verzögerungzwischen Informations<strong>auf</strong>nahme und Handeln kommen. Genau das geschieht, wenn <strong>auf</strong>grundvon letztlich einsehbaren, verstehbaren Zusammenhängen zunehmend selbstständigesHandeln möglich wird (vgl. FEUERSTEIN 1983, 265 ff.).Impulsive Kinder strahlen nicht selten eine Unbekümmertheit aus, was ihnen einen ungewöhnlichenCharme verleiht. Eltern und Erzieher sind daher oft bereit, „ihnen Dingezu erlauben, <strong>die</strong> sie weniger bezaubernden Kindern“ nicht durchgehen lassen würden(STOTT 1972, 48). Dadurch werden <strong>die</strong>se Kinder in der Erwartung bestärkt, es sei ihrRecht, Aufmerksamkeit und Bewunderung zu erhalten. Da sie aus Ermahnungen undStrafen kaum lernen, sehen Eltern oft über das Fehlverhalten hinweg und rechtfertigensich damit, dass <strong>die</strong> Kinder lernen müssten, sich durchzusetzen. Zur Impulsivität geselltsich dann nicht selten das Bestreben zu dominieren und ein Ärgernis zu sein. Daraus134
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTkönnen <strong>die</strong>se Kinder zumindest <strong>die</strong> Befriedigung von Kompetenz im Sinne der Beherrschungihrer Umwelt ziehen (STOTT 1972, 48; 53 f.).Aber auch wenn <strong>die</strong> Eltern gegen das Fehlverhalten anzugehen suchen, können durchImpulsivität begünstigte Verhaltensmuster <strong>auf</strong>rechterhalten werden. Angenommen, dasKind reagiert bei unerfüllten Wünschen mit Wutanfällen. Wenn es der Mutter nun nichtgelingt, <strong>die</strong>se Gefühlsausbrüche als das zu akzeptieren, was sie sind (nämlich Zornausbrüche<strong>auf</strong>grund unerfüllter Wünsche, also Gefühle, wie auch Erwachsene sie haben undfür <strong>die</strong> man durchaus Verständnis zeigen kann), sondern sich dagegen stellt, indem sieärgerlich reagiert, wird das Kind noch aggressiver, bis <strong>die</strong> Mutter schließlich nachgibtund seine Wünsche erfüllt. Da sie aus Bestrafungen kaum lernen, erleben sich Eltern undErzieher nicht selten als hilflos. Hilflosigkeit ist aber auch für den Erziehers eine Bedrohungseines Selbstwerts, <strong>die</strong> Aggression oder Ablehnung zur Folge haben kann (STOTT1972, 39). Auch in solchen Fällen wird das Verhalten des Kindes bestärkt und der Erwerbalternativer Muster behindert (CASPI/ BEM/ ELDER 1989).Unter schulischen Bedingungen ist impulsives Handeln ungeeignet zur Lösung komplexerkognitiver Aufgaben. Hochgradig impulsive Kinder geben daher leicht <strong>auf</strong> und versuchen,sich vor Lern<strong>auf</strong>gaben zu drücken, indem sie z.B. den Clown spielen und dadurch<strong>die</strong> Anerkennung ihrer Mitschüler zu erhalten suchen. Andere legen sich mit denLehrern an und versuchen so, sich für <strong>die</strong> Einschränkung der Möglichkeiten ihrerSelbstentfaltung zu rächen (STOTT 1972, 36). Wieder andere entwickeln sich zu unkooperativen,aggressiven, bösartigen und/ oder herrschsüchtigen Schülern, <strong>die</strong> meist keineFreunde haben (STOTT 1972, 58 ff., LANDAU 1990, 71). Das ist insbesondere bei bedingterAnerkennung der Fall – d.h. wenn Anerkennung und Zuwendung nur bei guten Leistungenund konformem Verhalten gewährt werden, während sie bei anderem Verhalten<strong>auf</strong> Ablehnung stoßen. Auf <strong>die</strong>se Weise (wie bei Liebesentzug) wird nämlich das grundlegendeBedürfnis nach Sicherheit nur unter bestimmten Bedingungen befriedigt. ImpulsiveKinder befürchten dann ständig den Verlust von Sicherheit. Sie werden zutiefstmisstrauisch. Sobald ihnen eine Verhaltensweise anderer in irgendeiner Weise Ablehnunganzudeuten scheint, können sie sich verraten fühlen, wegen <strong>die</strong>ser vermeintlichenUngerechtigkeit bzw. wegen <strong>die</strong>ser vermeintlichen Verletzung oder Beschneidung ihrerSelbstentfaltungsmöglichkeiten in Rage geraten und mit heftigen Aggressionen reagieren.Um sich gegen solche Eingriffe abzusichern, versuchen sie ihre Umwelt soweit alsmöglich zu beherrschen. Den entsprechenden Interaktionsstil bezeichnen CASPI/ BEM/ELDER (1989) als „gegen <strong>die</strong> Welt angehen“.135
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBegünstigt durch das Temperament und über Jahre weitgehend ähnlicher schulischerund häuslicher Umstände wird <strong>die</strong>ser Interaktionsstil ein Teil der Persönlichkeit. DieIndividuen neigen dazu, von ihrer Umwelt Einschränkungen zu erwarten, so dass sie vonvornherein misstrauisch sind und sehr schnell aggressiv reagieren. Auf <strong>die</strong>se Weise kannein solcher Interaktionsstil ein Handicap für das ganze Leben werden. Jedenfalls ließensich anhand in Längsschnittstu<strong>die</strong>n angefangen bei 8-10jährigen bis zum Alter von 30-40 Jahren solche Interaktionsstile verfolgen (CASPI// BEM/ ELDER 1989).Weniger problematisch sind Bedingungen extrinsischer Motivierung für Schüler• Schüler mit geringer Ängstlichkeit bzw. Schüler mit ungezwungenem Temperament.Auch <strong>die</strong>se Schüler sind manchmal ängstlich, gehemmt oder übersprudelnd und impulsiv,aber im Großen und Ganzen gelingt es ihnen, mit ihren Ängsten zu leben, ihre Impulseim Zaum zu halten und ihre Hemmungen zu überwinden. Es gelingt ihnen, sich angegebene Bedingungen anzupassen. Aber auch wenn sie weniger leiden, werden <strong>auf</strong>grundder extrinsichen Motivation auch ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht hinreichendausgeschöpft und entwickelt.Der Einfluss des Temperaments bei intrinsischer MotivierungIntrinsische Motivierung besteht in der Schaffung von Bedingungen, <strong>die</strong> dem Schüler<strong>die</strong> Befriedigung seiner Bedürfnisse nach Sicherheit, Selbständigkeit und Kompetenzgewähren. Sicherheit entsteht, wenn sich der Einzelne anerkannt und akzeptiert fühlt,wenn er in seinem Selbstwert bestätigt wird, also wenn er sich z.B. bei schwierigen Aufgabenan Andere wenden kann und Hilfe erhält, so dass er sich verbessern kann. Selbständigkeitwird unterstützt, indem dem Schüler Wahlmöglichkeiten hinsichtlich derZiele, der Zeitdauer der Beschäftigung mit einer Aufgabe, der Lösungswege, der Zusammenarbeitmit Anderen usw. eröffnet werden. Die Entwicklung von Kompetenz wirdvor allem durch Unterrichtsformen oder Lehrmaterialien gefördert, <strong>die</strong> forschendentdeckendesLernen ermöglichen.Fühlen sich nun ängstliche Schüler im Unterricht akzeptiert und sicher, dann lernen siemit ihrer Temperamentseigenschaft umzugehen. Solche Bedingungen bestehen dann,wenn <strong>die</strong> Schüler selbst Aufgaben wählen können, <strong>die</strong> sie bearbeiten möchten und wennsie anschließend nicht darüber geprüft werden. Dann können <strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong> Arbeit eheraus Interesse an der Sache tun. Steht <strong>die</strong> Sache im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit,dann wird <strong>die</strong> Verarbeitungskapazität der Schüler ausschließlich und intensiv <strong>auf</strong> <strong>die</strong>136
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAufgabe gerichtet. Bei selbständig gewählten Aufgaben und individualisierter Betreuungkönnen auch leistungsschwache ängstliche Schüler Kompetenzen erwerben. Dadurchverbessern sich ihre Selbsteinschätzungen und ihr Selbstvertrauen, auch mit anderenSituationen fertig werden zu können.Die subjektiven Einschätzungen der eigenen Kompetenz und des damit verknüpftenSelbstwerts sind von größerer Bedeutung für das Werden der Persönlichkeit des Einzelnenals <strong>die</strong> schulischen Aufgaben selbst (ECCLES 1983). Sie sind auch entscheidend dafür,ob der Einzelne sich gut oder schlecht, belastet oder unbelastet fühlt (HARTER 1986).Sich gut und unbelastet zu fühlen bedeutet, dass Ängste durch Gefühle des Vertrauens in<strong>die</strong> Unterstützung durch <strong>die</strong> Umgebung, aber auch durch Selbstvertrauen und Hoffnung<strong>auf</strong> Erfolg begrenzt werden. Ängstlichen Schülern gelingt es bei Maßnahmen zur intrinsischenMotivierung eher, ihr Gefühlsleben so zu integrieren, dass Ängste durch entgegengesetzte Emotionen begrenzt werden. Sie lernen mit Gefühlen umzugehen, statt vonihnen beherrscht zu werden.Das gilt in analoger Weise auch für gehemmte, zurückgezogene Schüler. Denn auch siekönnen unter Bedingungen, <strong>die</strong> ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, eher Selbstvertrauen,Kompetenz und vor allem Vertrauen in <strong>die</strong> eigenen Fähigkeiten erwerben.Wenn sie durch Beschäftigung mit Gegenständen ihres Interesses selbständiger gewordensind und Erfolge erfahren haben, werden sie sich eher als fähig betrachten, auchschwierigere Aufgaben zu lösen und bereit sein, sich ihnen zu stellen.Desgleichen können, wenn <strong>die</strong> Sache im Mittelpunkt steht, auch impulsive Kinder erkennen,dass Nachdenken eine interne Belohnung durch den Erfolg richtiger Lösungenund den Erwerb von Kompetenz ermöglicht. Wenn Bestrafungen ebenso wie Belohnungenausbleiben, wenn sie z.B. Lösungen raten, wenn einfach <strong>die</strong> Fehler einer Antwortsachlich untersucht werden und wie sie sich vermeiden lassen, können sie nach und nachlernen, ihre Impulse in einem komplexeren Gefüge von Erwartungen zu interpretierenund sie dadurch zunehmend besser beherrschen.Wenn rezeptiv-reproduktives Lernen durch einen forschend-entdeckenden Lernstil ersetztwird, müssen <strong>die</strong> Schüler notgedrungen zwischen dem Problem, alternativen Lösungswegenund dem Ergebnis unterscheiden. Auf <strong>die</strong>se Weise wird im Bewusstsein desSchülers eine Distanz zwischen der angebotenen Information und der Antwort erzeugt.Diese Distanz, <strong>die</strong> er durch Nachdenken zu überbrücken versuchen muss, trägt dazu bei,sein kognitives Tempo zu verringern (vgl. FEUERSTEIN 1983, 265 ff.). In dem durch dasErkennen von Zusammenhängen entstehenden Netz von Erwartungen verlieren Impulse137
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTan Kraft, so dass der Schüler ihnen weniger ausgeliefert ist. Außerdem kann er das Bedürfnisnach Selbstentfaltung <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise weitaus wirkungsvoller befriedigen, dennforschend-entdeckendes Lernen steigert seine Kompetenz und damit sein Selbstvertrauen.Eine ganz ähnliche Wirkung ist von Maßnahmen zur Förderung der Selbständigkeit zuerwarten. Denn selbständiges Arbeiten bedeutet vor allem, dass der Schüler planenmuss; Planung erfordert <strong>die</strong> Unterscheidung des Ziels und der Strategie zur Erreichungdes Ziels. Der Schüler muss sich Schritte überlegen, das Ziel in Teilziele gliedern, einebestimmte Abfolge festlegen, sich Gedanken über <strong>die</strong> Bedeutung seines Zieles und <strong>die</strong>Effektivität alternativer Strategien machen usw. Auf <strong>die</strong>se Weise erzwingt das Handelngewissermaßen eine Verzögerung zwischen Informations<strong>auf</strong>nahme und Handlungsergebnis(FEUERSTEIN 1983, 265 ff.).Um Schülern auch unter ungünstigen schulischen Bedingungen für den Umgang mitBelastungen und den daraus resultierenden Gefühlen zu helfen, sind als Hilfsmittel u.a.entsprechende Materialien entwickelt worden. So haben DEWOLFE/ SAUNDERS (1995)ein Programm geschaffen, bei dem acht Wochen lang jeweils eine Stunde pro Wocheeine Einheit erarbeitet wird. Dabei geht es neben einer kurzen Einführung in Entspannungstechnikenvor allem um das Erkennen der Ursachen von Stress durch negative Gedanken,ungünstige Verhaltensweisen, Alkohol und Drogen. Das Hauptaugenmerk wird<strong>auf</strong> den Umgang mit Stress gelegt: Wie man negative Gedanken durch positive ersetzenkann; durch welche Verhaltensweisen man ereicht, dass Andere einem zuhören; wie man„gute Gefühle“ genießt und dass es in Ordnung ist, „schlechte“ Gefühle zu haben; wieman Anerkennung erreichen und mit Frustrationen und Ängsten umgehen kann. DasProgramm konzentriert sich also <strong>auf</strong> das Erkennen von Problemen und Möglichkeitendes aktiven Umgangs damit. Die Erprobung des Programms in drei Schulklassen städtischerund ländlicher Schulen ergaben signifikante Verbesserungen in den Selbst- undLehrereinschätzungen hinsichtlich der Fähigkeit im Umgang mit Stress. Darüber hinauszeigten sich übereinstimmende Steigerungen des allgemeinen Selbstwerts, der sozialenKompetenz, sowie der Akzeptanz des eigenen Aussehens und des Verhaltens. Eine Analysevon Einzelfällen zeigte, dass <strong>die</strong>jenigen, <strong>die</strong> Hilfe brauchten, auch am meisten profitierten.138
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTKörperliche Entspannung als Mittel zur emotionalen IntegrationZwischen Gefühl und Körper besteht eine enge Beziehung. Dar<strong>auf</strong> hat beispielsweiseJames (1890; 1950, Bd. 2, 451 f.) hingewiesen. Er legt dem Leser nahe, einmal zu versuchen,von einem Gefühl das Empfinden für <strong>die</strong> Körpersymptome zu eliminieren. Wasbleibt, sei nur ein kalter neutraler Zustand intellektueller Wahrnehmung. Furcht ohneHerzklopfen, flache Atmung, zitternde Lippen und weiche Knie oder verkrampfte Eingeweidekönne er sich nicht vorstellen. Man könne sich auch nicht einen Zustand derWut ausmalen, ohne dabei an ein rotes Gesicht, an Aufwallungen, bebende Nasenflügelusw. zu denken. Aufgrund der engen Beziehung von Körper und Gefühl ist es nahe liegend,dass körperliche Übungen wie Spiel und Sport oder Anspannung und EntspannungGefühlszustände beeinflussen, und dass <strong>die</strong> Beobachtung der durch solche Handlungenbewusst hervorgerufenen Empfindungen einen Zugang zur eigenen Gefühlswelt darstellt.Insbesondere unter Druck können Gefühle <strong>auf</strong>treten, <strong>die</strong> in einer disharmonischen Beziehungzu der jeweiligen Tätigkeit stehen, ihre Erledigung also nicht fördern, sonderneher behindern. Das ist etwa der Fall, wenn Misserfolgsängste oder das Streben nachAnerkennung im Vordergrund stehen, also vor allem bei extrinsischer Motivation. Nichtintegrierte Gefühle verstärken <strong>die</strong> Selbst<strong>auf</strong>merksamkeit. Dabei werden vor allem <strong>die</strong>nicht bewussten Verarbeitungsprozesse abgelenkt oder abgezogen, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> der Grundlagenicht bewusster Regelsysteme Ideen erzeugen, <strong>die</strong> im Bewusstsein <strong>auf</strong>scheinen undso das Lernen oft am schnellsten und weitesten voranbringen.In solchen Situationen kann körperliche Entspannung <strong>die</strong> ungünstigen Gefühle beruhigenoder schwächen und <strong>die</strong> von ihnen ausgehenden negativen Einflüsse <strong>auf</strong> Denkenund Verhalten verringern. In <strong>die</strong>sem Sinn hat bereits MONTESSORI (1909; 1977, 195)Stilleübungen durchgeführt. Es ging ihr nicht bloß darum, eine unruhig gewordene Klassezur Ruhe zurückzuführen, sondern den Einzelnen <strong>auf</strong> ein „höheres Niveau“ zu heben,das ihm ermöglicht von seinem eigentlichen Selbst her zu agieren, also unbeeinflusstdurch oberflächlichere Impulse und andere Erregungen. Demnach fördert also körperlicheEntspannung <strong>die</strong> Integration der geistigen Instanzen. Eine der Folgen sollte auch ineiner Zunahme der Leistung zu erkennen sein. Eine gewisse Bestätigung dafür kann manin folgendem Feldexperiment zur Wirkung des Autogenen Trainings sehen.Mit Schülern der fünften bis siebten Klasse Hauptschule wurden vier Wochen lang kurzvor Schluss des Deutschunterrichts drei Grundübungen des autogenen Trainings (allgemeineRuhetönung, Schwere und Wärme-Suggestion sowie das Zurücknehmen der Ent-139
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTspannung) durchgeführt. Den Lehrern waren <strong>die</strong>se Techniken zuvor in einem Gruppenkursvermittelt worden. Zur Prüfung der Effekte <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Leistung wurden <strong>die</strong> Grundübungendes Autogenen Trainings unmittelbar nach einem regulären Diktat vier Minutenlang durchgeführt. Danach wurde den Schülern fünf Minuten Zeit zur Selbstkorrekturgegeben, wobei sie einen andersfarbigen Stift verwenden mussten. Die von denselbenLehrern unterrichteten Schüler der Kontrollgruppe erhielten eine Erholungspause vonvier Minuten und hatten danach ebenfalls vier Minuten Zeit zur Selbstkorrektur. Bei denSchülern der Experimentalgruppe hatten signifikant weniger Fehler, <strong>die</strong> Zahl der richtigenSelbstkorrekturen war bedeutend höher und <strong>die</strong> Zahl der falschen Selbstkorrekturenwar erheblich geringer als bei den Schülern der Kontrollgruppe. Letztere machten in derKorrekturphase mehr neue Fehler als sie beseitigten (KRAMPEN 1992).15. Einstellungen und WerteHinsichtlich der Werte und der Moral lassen sich zwei Auffassungen unterscheiden.Nach der einen stellen Werte gesellschaftlich konstruierte oder religiös gegebene Regelndar. Der Einzelne hat sie im Wesentlichen zu übernehmen und zu befolgen. Diese Auffassungist eng mit kontrollierenden Regelungsmaßnahmen verknüpft.Die andere Auffassung des Erwerbs von Werthaltungen ist komplexer. Danach sindWerte bereits von Anfang an im Individuum vorhanden. Durch Auseinandersetzung mitden Wertstrukturen seiner Umgebung, sowie ethischen Problemen und Ideen differenziertund integriert der Einzelne aber seine ursprünglichen moralischen Erwartungen.Erziehung kann den Einzelnen daher auch nur unterstützen in seiner „Suche nach demRichtigen und Falschen“ (MACKIE 1981), sie kann Werte oder Moral aber nicht „vermitteln“.Die <strong>Auswirkungen</strong> kontrollierender MaßnahmenDer Anwendung kontrollierender Maßnahmen liegt <strong>die</strong> Überzeugung zugrunde, dass derMensch erst <strong>auf</strong>grund von Erziehung Moral<strong>auf</strong>fassungen und entsprechende Verhaltensweisenerwirbt. Der Mensch und insbesondere das Kind werden als von wilden Impulsengesteuerte Wesen angesehen, <strong>die</strong> durch Erziehung an <strong>die</strong> gesellschaftlichen Werteanzupassen sind. Ist ein Mensch oder Kind „einsichtig“ und beachtet <strong>die</strong> gefordertenRegeln, bedarf es keiner weiteren Maßnahmen. Ist das aber nicht der Fall, sind zusätzlicheEingriffe erforderlich. Bei kontrollierenden Regelungsversuchen sind dabei insbe-140
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTsondere <strong>die</strong> Vermittlung von Wissen, Übung sowie Lob und Tadel bzw. Belohnung undStrafe <strong>die</strong> wesentlichen Mittel. Das schließt sowohl Strenge als auch Behütung undÜberbehütung ein, <strong>die</strong> Anstrengungen abnimmt oder erleichtert, also vor allem <strong>auf</strong> Belohnungberuht.Bei kontrollierender Regelung sind <strong>die</strong> äußeren Prinzipien, denen das Verhalten derSchüler folgen soll, das Primäre. Der Schüler soll sie übernehmen und sich an sie halten.Die Prinzipien sind allgemein und gelten für alle in gleicher Weise, unabhängig von denspeziellen Bedingungen und Bedürfnissen des Einzelnen. Wenn beispielsweise <strong>die</strong> Regelgilt, alle Schüler sollen ihre Schulsachen stets geordnet und vollständig in den Unterrichtmitbringen, kann man keine Ausnahme für denjenigen machen, dessen Geschwister amAbend sein Malzeug aus dem Ranzen genommen haben. Er hätte eben am Morgen nocheinmal alles nachsehen sollen. Jetzt bekommt er einen Strich für Vergesslichkeit, damiter lernt, in Zukunft Ordnung zu halten. Außerdem muss er es vielleicht über sich ergehenlassen, wenn der Lehrer fragt, wer dem „Bummelanten“ Buntstifte leihen kann(BERT/GUHLKE 1977, 15 ff.).In <strong>die</strong>sem Beispiel legt <strong>die</strong> Norm fest, dass <strong>die</strong> Kinder <strong>auf</strong> Ordnung bedacht zu sein haben,ohne dabei <strong>die</strong> speziellen Umstände zu berücksichtigen. Diese Auffassung, dassNormen immer von außen her kommen und den Schülern <strong>auf</strong>zuerlegen sind, ist nahezuallgemein anerkannt. Viele können sich daher auch kaum eine Alternative wie <strong>die</strong> folgendevorstellen. Das Problem, dass im Unterricht bestimmte Arbeitsmaterialien unabdingbarsind, aber von den Schülern nicht immer mitgebracht werden, könnte nämlichauch als gemeinsam zu lösende Aufgabe betrachtet werden. Auf <strong>die</strong>se Weise sind Lehrerund Schüler an einer Berliner Grundschule dar<strong>auf</strong> gekommen, dass in der Schule solcheDinge, <strong>die</strong> immer wieder fehlen, in der Klasse bereitgestellt werden, wobei <strong>die</strong> Schülersich verpflichteten, mit den Sachen ordentlich umzugehen. Eine Lösung, <strong>die</strong> sich bewährthat (BERT/GUHLKE 1977, 15 ff.).Wenn Erziehungsnormen als statisch <strong>auf</strong>gefasst werden, bedeutet das, dass <strong>die</strong> Elternund Lehrer das Kind oder den Jugendlichen nach vorgefassten Vorstellungen oder Idealenzu bilden versuchen und danach beurteilen. Bei einer derartigen Erzieher-Kind- undLehrer-Schüler-Beziehung wird <strong>die</strong> Entstehung einer positiven sozialen Bindung durchAnerkennung und Akzeptierung erschwert. Vor allem wenn <strong>die</strong> Erzieher überzeugt sind,Normabweichungen seien durch starke Einengungen, durch genauere Kontrollen, durchHoffung <strong>auf</strong> Belohnung und Furcht vor Strafe „weg zu erziehen“, wird das Bedürfnisnach Anerkennung und Akzeptanz bzw. nach Sicherheit in hohem Maß beeinträchtigt.141
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTMan hofft, dass <strong>die</strong> Kinder, um dem zu entgehen, dann eben „brav“ sind (vgl. IZARD1981, 413 ff.).In der Schule wird durch <strong>die</strong> Aufgabe, nach dem Lehrplan, ohne Berücksichtigung derAuffassungen der Schüler, zu unterrichten und Leistungen nach einer sozialen Bezugsnormzu beurteilen, der Lehrer in eine Rolle als Kontrolleur und Regelnder gedrängt.Sein Bezugspunkt sind vorgegebene Normen. Der Einzelne wird nur dort wichtig, wo er<strong>auf</strong>fällt, was vor allem dann der Fall ist, wenn er gegen <strong>die</strong> Normen verstößt, denn unterdem Gesichtspunkt der Norm werden besonders <strong>die</strong> unerwünschten Abweichungen bemerkt.Das führt zu einer potentiell bedrohlichen Situation für <strong>die</strong> Schüler, da jeder jederzeitunangenehm <strong>auf</strong>fallen kann. Außerdem muss der Lehrer <strong>auf</strong>grund des Primatsder Normen <strong>die</strong> Selbstständigkeit der Schüler stark einschränken. Da Erziehung danachim Wesentlichen als <strong>die</strong> Verinnerlichung gegebener Normen zu verstehen ist, wird derLehrer seine Schüler nur im Fall eingetretener Erziehungserfolge als kompetent betrachtenkönnen.Der Primat der Erziehungsnormen führt also dazu, dass <strong>die</strong> Bedürfnisse nach Sicherheitdurch soziale Bindung und Anerkennung, sowie auch <strong>die</strong>jenigen nach Selbständigkeitund Kompetenz nur eingeschränkt befriedigt werden. Bedenkt man <strong>die</strong>se Beschränkungder Selbstentfaltung und <strong>die</strong> damit verknüpfte Bedrohung des Selbstwerts, dann wundertes nicht, wenn Lehrer „in den Urteilen der Schüler geradezu ‘abgewiesen’“ werden undangeben, <strong>die</strong> Lehrer seien „für sie unwichtig“ (ECKERLE/ KRAAK 1993, 137). Dieses Ergebnistrifft nur <strong>auf</strong> Schüler höherer Klassenstufen zu, d.h. <strong>auf</strong> desillusionierte Schüler.Diese Schüler geben außerdem an, dass sie, um den Lehrer nicht ungünstig zu stimmen,sich scheinbar kooperativ und freundlich zeigen (ECKERLE/ KRAAK 1993, 79 ff. u. 138).D.h., um sich vor der potentiellen Bedrohung des Selbst durch kontrollierende Maßnahmenzu schützen, bauen <strong>die</strong> Schüler sich einen Schutzschild aus schematisch vorgeschütztenUrteilen, Wert<strong>auf</strong>fassungen und moralischen Ansichten. Sie gehen Auseinandersetzungenaus dem Weg, weil sie nicht mehr an <strong>die</strong> Möglichkeit sachlich begründeterund gerecht empfundenen Lösungen glauben. Zu oft haben sie erfahren, wie „<strong>die</strong> Schulordnung“,„<strong>die</strong> Leistungsnorm“, „der Lehrplan“, „der Zeitdruck“ usw. <strong>die</strong> ernsthafteSuche nach echten Lösungen und ihrer Verwirklichung unmöglich gemacht haben.Der Mechanismus der AbwehrUm ihr Selbst vor Bedrohungen durch Kontrollen zu schützen, lernen <strong>die</strong> Schüler alsoihre Spontaneität zu begrenzen, ihre Gefühle zu verbergen, sich berechnend zu verhalten142
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTund eher dem verstandesmäßigen Kalkül als ihrem Fühlen zu vertrauen. Sie sind nichtbestrebt herauszufinden, was das (moralisch) Richtige ist und es zu tun, sondern wollenwissen, was in der gegebenen Situation einerseits den besten Schutz und andererseitsden größten Nutzen verspricht. Ihr Handeln ist also extrinsisch motiviert. Es geht nichtum <strong>die</strong> Sache und das was richtig ist, sondern um das, was am ehesten der Erhaltung desSelbstwerts bzw. der Selbstbehauptung <strong>die</strong>nlich ist.Das bedeutet aber auch, dass sie <strong>die</strong> Ansichten, Maßstäbe, Wert<strong>auf</strong>fassungen usw., <strong>die</strong>sie nach außen vertreten, um akzeptiert zu werden und Konflikten zu entgehen, sich nuroberflächlich aneignen. Sie sind also nur schwach in <strong>die</strong> eigene Vorstellungs- und Gefühlsweltintegriert. Wenn in anderen Zusammenhängen <strong>die</strong>se Maßstäbe und Werte derSelbstbehauptung nicht <strong>die</strong>nlich erscheinen und <strong>die</strong> Angst vor Strafe gering ist odernicht existiert, werden sie durch andere Maßstäbe und Werte ersetzt. Es kommt zu dembekannten Phänomen, dass <strong>die</strong> Menschen durchaus viel über wünschenswerte Arbeitshaltungen,erwünschtes soziales Verhalten usw. wissen und auch entsprechend argumentierenkönnen; wenn es lohnend erscheint, halten sie sich daran, aber in ihrem sonstigenDenken, Fühlen und Handeln bleiben sie davon nahezu unbeeinflusst (vgl. dazu UHL1996, z.B. 72 ff. u. 94 ff.).Daraus folgt jedoch nicht, dass Wert<strong>auf</strong>fassungen, <strong>die</strong> bloß Fassade sind, für das Verhaltengenerell unwesentlich wären. Die jeweiligen moralischen und sonstigen Maßstäbe,<strong>die</strong> entsprechend der Umstände durch andere Maßstäbe ersetzt werden können, haben ansich keine besondere Bedeutung. Wichtig an ihnen ist nur ihre Schutzfunktion, <strong>die</strong> <strong>die</strong>daraus errichtete Fassade erfüllt. Ihr Zweck besteht zunächst ja darin, Zurückweisungenund Herabsetzungen abzuwehren, <strong>die</strong> den Kern der Person, d.h. ihre Empfindungen,Gefühle und Spontaneität bedrohen 59 . Alles das abzuweisen, was dem Einzelnen in derjeweiligen Situation mit ihren Normen und Maßstäben bedrohlich erscheint, hat notwendigzur Folge, dass auch eigene Regungen, Gefühle und spontane Reaktionen blockiertund auch nicht in den Verarbeitungsprozess einbezogen werden (vgl. ROGERS 1983,187).Nun sind <strong>die</strong>se verdrängten Regungen, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> nicht bewussten Verarbeitungsstufen entstehen,allerdings nicht bedeutungslos, auch wenn sie <strong>auf</strong> Ebenen entstehen, <strong>die</strong> für dasBewusstsein unzugänglich sind. Um zu verstehen, warum <strong>die</strong> Verdrängung <strong>die</strong>ser Regungenschädlich ist, müssen wir zunächst <strong>die</strong> Funktion <strong>die</strong>ser Regungen selbst erken-59Diesem Mechanismus entspricht in der psychoanalytischen Theorie <strong>die</strong> Verdrängung (im Überblickdazu HIERDEIS/ WALTER 1993.143
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTnen. Solche Regungen sind oft gefühlshaft oder vage wie z.B. Eindrücke über Unstimmigkeitenund Stimmigkeiten, wenn man noch nicht weiß, warum etwas falsch oderrichtig ist, Ideen, <strong>die</strong> eher Ahnungen gleichen als klaren Vorstellungen. Regungen <strong>die</strong>serArt beruhen <strong>auf</strong> den primären Regelsystemen und ihre Beachtung bei der bewusst gesteuertenInformationsverarbeitung führt zur Erkenntnis von Problemen und begünstigtdadurch forschend-entdeckendes Lernen. Können solche inneren Regungen nun aber<strong>auf</strong>grund der beschriebenen Abwehr nicht in <strong>die</strong> Verarbeitung von Information einbezogenwerden, dann bestimmen vor allem oberflächliche Schemata <strong>die</strong> Wahrnehmung unddas Denken. Weil <strong>die</strong>sen Schemata aber <strong>die</strong> Tiefenintegration fehlt, verliert sich <strong>die</strong> Personin ihren oberflächlichen Regungen. Sie ist daher leicht manipulierbar, abhängig,unsicher und/oder herrisch und nicht bei sich. Die in einer Situation aktivierten und <strong>die</strong>Aufmerksamkeit beherrschenden Auffassungen werden jeweils als Selbst betrachtet. Umden damit verknüpften Selbstwert, <strong>die</strong> Einschätzungen durch andere oder das Selbst, dasman sein möchte, <strong>auf</strong>rechtzuerhalten oder zu steigern, werden jeweils <strong>die</strong> Handlungenausgewählt, <strong>die</strong> am vorteilhaftesten erscheinen.Befunde und Erfahrungsberichte zu den Folgen der AbwehrDiesen Wechsel zwischen verschiedenen Aspekten des Selbst verdeutlich eine Stu<strong>die</strong>von KOESTNER/ BERNIERI/ ZUCKERMAN (1991). In <strong>die</strong>ser Untersuchung wurden selbständige(d.h. intrinsisch motivierte) von kontrollorientierten (d.h. extrinsisch motivierten)College-Studenten unterschieden. Die Probanden wurden dann zu einem Untersuchungsraumgebeten, wo sie einen Test absolvierten, in dem sie ihre Gewissenhaftigkeiteinschätzten. Beim Verlassen des Raums erhielten <strong>die</strong> Studenten einen Fragebogen mitder Bitte, ihn ausgefüllt im Büro abzugeben. Die Autoren korrelierten dann <strong>die</strong> Selbsteinschätzungjedes Studenten hinsichtlich seiner Gewissenhaftigkeit mit seinem Rückgabeverhalten.Bei der Gruppe der intrinsisch motivierten Studenten ergaben sich signifikanthöhere Korrelationen als bei den extrinsisch motivierten Studenten. Extrinsischmotivierte Studenten zeigen ein deutlich geringeres Maß der Integration von verschiedenenAspekten des Selbst.Der durch <strong>die</strong> Abwehr von Gefühlen, spontanen Reaktionen usw. bewirkte Schutz desSelbst und das Bestreben, den eigenen Vorteil zu sichern, beeinträchtigt auch <strong>die</strong> Fähigkeit,Möglichkeiten zur Erfüllung des Bedürfnisses nach Selbstentfaltung zu erkennen.Da <strong>auf</strong>grund der Abwehr <strong>die</strong> primären Regelsysteme sich bei der Verarbeitung von In-144
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTformation <strong>auf</strong> nicht integrierte Schemata stützen können, werden bedeutsame persönlicheWerte nicht erkannt, d.h. sie fallen der Abwehr zum Opfer.In <strong>die</strong>sem Sinn lässt sich <strong>die</strong> zweite Stu<strong>die</strong> KOESTNER/ BERNIERI/ ZUCKERMAN (1991)interpretieren, in der sie <strong>die</strong> Beziehung zwischen dem Verhalten von Studenten bei freierWahl und ihren Interessen untersuchten. Bei der Gruppe der intrinsisch motivierten Studentenkorrelierten Interessen und Verhalten (0.6) während bei der Gruppe der extrinsischmotivierten Studenten keine Beziehung zwischen freier Wahl und ihren Interessenbestand.Die Beeinträchtigung der Fähigkeit, Möglichkeiten zur Erfüllung des Bedürfnisses nachSelbstentfaltung zu erkennen und zu ergreifen, wird besonders deutlich bei Individuen,<strong>die</strong> <strong>auf</strong>grund langer Überbehütung dazu neigen, solche Wahlen treffen, <strong>die</strong> ihnen möglichstalle Anstrengungen und schwierigen Entscheidungen abnehmen.Im Grunde verhalten wir uns aber alle in etwa <strong>die</strong>ser Weise, weil wir alle irgendwelchenallgemeinen Wertvorstellungen übernommen haben, <strong>die</strong> nur dem Schutz unseres Selbstvor der Umwelt <strong>die</strong>nen. Wir wollen nicht wegen unserer Meinung oder unserer EmpfindungenKritik ausgesetzt sein und uns als Teil der Gemeinschaft betrachten können.Diese Wertvorstellungen sind gleichsam „heiße Eisen“, <strong>die</strong> der Einzelne nicht prüft. AlleInformationen, <strong>die</strong> <strong>die</strong>se Wert<strong>auf</strong>fassungen in Frage stellen und <strong>die</strong> den Schutzschildentweder von außen oder von innen her beschädigen könnten, werden abgewehrt wieauch das folgende Beispiel zeigt.Nach meiner Erfahrung ist für jenen Teil der Schüler und Studenten, <strong>die</strong> <strong>die</strong> schulischeLeistungsideologie 60 als einen Teil ihrer Weltsicht akzeptiert haben, ein Verzicht <strong>auf</strong>Leistungsdruck und Wettbewerb entweder nicht vorstellbar oder sie halten eine Schule,<strong>die</strong> ohne <strong>die</strong>se Mittel auszukommen sucht, für zum Scheitern verurteilt. Dabei ist es unwesentlich,ob <strong>die</strong> Schüler und Studenten selbst erfolgreich oder erfolglos waren. Selbstnach dem Betrachten eines Films über eine Montessori-Schule, <strong>die</strong> ohne <strong>die</strong>se Mitteleine ideale Mitarbeit und Disziplin sowie sehr gute Leistungen erzielt, halten sie <strong>die</strong>sesModell für einen ausgesprochen dubiosen Sonderfall, der nicht zum Normalfall werdenkönne. Insbesondere könne eine solche Schule nur in der Grundstufe und mit solchenKindern funktionieren, <strong>die</strong> schon vom Kindergarten her daran gewöhnt seien. Außerdemsei zu erwarten, dass <strong>die</strong>se Schüler, weil sie lebensfern erzogen würden, auch nur ungenügend<strong>auf</strong> das Leben vorbereitet seien. Später müssten sie nahezu zwangsläufig versa-60Zur Leistungsideologie siehe FEND/ KNÖRZER/ NAGL/ SPECHT/ VÄTH-SZUSDZIARA 1976,173 ff.145
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTgen. Gegenteilige Befunde werden in der Regel mit großer Skepsis zur Kenntnis genommen,und bei nächster Gelegenheit werden <strong>die</strong>selben Einwände wiederholt.Beim Anblick der mit Lust und Eifer arbeitenden Kinder empfinden sie offenbar keineFreude. Die von außen an sie herangetragene Information wird also nur bis zur Fassademit ihren Schematismen vorgelassen und danach beurteilt. Das ist zunächst <strong>die</strong> Abwehrnach außen, gegen das, was mit den eigenen Auffassungen nicht vereinbar ist. Dann istda aber auch eine Abwehr nach innen, weil <strong>die</strong> spontane Einfühlung in <strong>die</strong> beobachteteSituation nicht zugelassen wird. Das bedeutet eine Abwehr von Erfahrungen, <strong>die</strong> ausdem Miterleben der Empfindungen der Kinder folgen würden, aus dem Erkennen undErfühlen ihrer Möglichkeiten, ihres Selbstvertrauens und ihrer ernsthaften Suche nachErkenntnis. Indem <strong>die</strong> eigene schematische Sicht von Erziehung als realitätsnah und <strong>die</strong>Montessori-Erziehung als lebensfern bezeichnet wird, geht man einer intensiven, <strong>die</strong>ganze Person einbeziehende Auseinandersetzung aus dem Wege.Individuelle Differenzen und UnterschiedeNun werden <strong>die</strong> <strong>Auswirkungen</strong> bei verschiedenen Individuen sicher unterschiedlich sein.Entscheidend ist vor allem, wie <strong>die</strong> Einschränkung des Bedürfnisses nach Selbstentfaltungvom Einzelnen gedeutet wird. Ängstliche Kinder oder Schüler, <strong>die</strong> <strong>auf</strong>grund einerVielzahl von Misserfolgserlebnissen und sozialen Zurückweisungen ein schwachesSelbstwertgefühl entwickelt haben, werden vermutlich eher zur Übernahme von sozialenRegeln und Wertmaßstäben sowie deren Einhaltung neigen, weil sie dadurch eine gewisseSicherheit und soziale Akzeptanz erreichen können. Ferner ist zu erwarten, dass impulsiveIndividuen, <strong>die</strong> eher <strong>auf</strong> Belohnungen reagieren, ihre Wertmaßstäbe stärker alsandere der jeweiligen Situation anpassen.Pädagogisch bedeutsamer sind aber eher jene Unterschiede, <strong>die</strong> <strong>auf</strong>grund des erfahrenenAusmaßes an Sicherheit bzw. sozialer Bindung zu erwarten sind. So werden Schüler, <strong>die</strong>ein subjektiv ausreichendes Maß an Zuwendung, Selbständigkeit und Kompetenz erfahrenhaben, im Rahmen der sich in ihrer Umwelt bietenden Möglichkeiten versuchen, ihrLeben selbst zu bestimmen und ihren eigenen Weg zu gehen. Indem sie eigene Vorstellungenvertreten und einbringen, tragen sie konstruktiv zur Gestaltung ihrer materiellenund sozialen Umwelt bei.Kinder und Jugendliche, <strong>die</strong> <strong>auf</strong>grund eines ängstlichen Temperaments besonders verletzlichsind und deren grundlegende Bedürfnisse nach Sicherheit, Anerkennung und146
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLiebe enttäuscht wurden, entwickeln in ungünstigen Fällen eine negative soziale Bindung.Weil sie <strong>die</strong> Enttäuschung ihrer Hoffnungen und Wünsche nicht mehr ertragenkönnen, wollen sie nicht mehr hoffen, und dazu müssen sie versuchen ihre Bedürfnissenach Sicherheit, Anerkennung und Liebe abzutöten und durch Hass und Ablehnung zuersetzen. Sie suchen nach Wegen, um <strong>die</strong> Anderen für ihre Illoyalität, für ihr Nicht-zuihnen-haltenzu bestrafen. Sie tun absichtlich Dinge, <strong>die</strong> <strong>die</strong> anderen ärgerlich machensollen; z.B. stehlen sie, gehen nicht zur Schule oder kommen nicht nach Hause. Sie suchenablehnende Reaktionen; gewissermaßen eine stabile, gleich bleibende Zurückweisung.Eine solche negative soziale Bindung erscheint ihnen erträglicher als <strong>die</strong> Angst, inihrem Grundbedürfnis nach Sicherheit enttäuscht zu werden (vgl. STOTT 1972, 59 f.).Besonders strenge wie auch besonders stark behütende und für <strong>die</strong> Bedürfnisse des Kindeswenig sensible Eltern können außerdem <strong>die</strong> Entstehung von Gewaltbereitschaft begünstigen.Da in solchen Familien bestimmte Normen oder elterliche Vorstellungen eineüberragende Bedeutung einnehmen, denen <strong>die</strong> Bedürfnisse des Kindes und seine Gefühlegeopfert werden, werden Konflikte in der Regel durch Macht entschieden, auch wenn<strong>die</strong>se Macht unter dem Mantel der Fürsorge <strong>auf</strong>tritt. Unter solchen Umständen wird demKind kaum etwas erlaubt, es werden ihm kaum Rechte eingeräumt und man wird untereinanderund auch zum Kind kein enges emotionales und verständnisvolles Verhältnisentwickeln. Eine Möglichkeit der Selbstentfaltung besteht dann darin, selbst mächtig zusein oder zu werden und <strong>die</strong> eigenen Vorstellungen gegen den Widerstand anderer mitGewalt durchzusetzen.MANTELL (1978) hat in einer berühmt gewordenen Stu<strong>die</strong> <strong>die</strong> Lebensläufe von 25Kriegsfreiwilligen – Angehörigen der Spezialeinheit „Green Berets“ – untersucht. Erfand im Wesentlichen <strong>die</strong> oben genannten familiären Umstände als Bedingungen für <strong>die</strong>Entstehung einer gewalttätigen Grundhaltung. Im Unterschied dazu ergab <strong>die</strong> Untersuchungder Lebensläufe von 25 Kriegs<strong>die</strong>nstverweigerern nahezu <strong>die</strong> entgegen gesetztenfamiliären Bedingungen, also eine Atmosphäre, in der das sensible Eingehen <strong>auf</strong> denanderen <strong>die</strong> Regel war. Der Zusammenhang von früher Zurückweisung und Gewaltbereitschaftwird auch durch andere Untersuchungen bestätigt (im Überblick BUTOLLO/MEYER-PLATH/ WINKER 1978, 3093).Entwicklung von Wertvorstellungen durch SelbstregulationSelbstregulation bedeutet, dass das Kind eigene Vorstellungen von dem hat, was richtigund falsch ist und <strong>die</strong>se durch den Austausch mit seiner Umgebung differenziert und147
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTanpasst. Danach baut das Individuum in der Auseinandersetzung mit einer von moralischenRegeln bestimmten Umwelt sein eigenes Wert- und Normensystem <strong>auf</strong>, das seinemSinn für Gerechtigkeit entspricht und ihm zugleich <strong>die</strong> Erfüllung seiner Bedürfnissenach positiver sozialer Bindung, Selbständigkeit und (sozialer) Kompetenz ermöglicht.Es handelt sich hier also um eine intrinsisch motivierte Entfaltung von Werten und Moral.Wenn Schüler im Unterricht grundsätzlich selbstbestimmt tätig sein können, wenn also<strong>die</strong> Wahl der Inhalte, der Art und Weise der Bearbeitung sowie der Maßstäbe und Idealevom Einzelnen (mit-)bestimmt werden, kann sich jeder Schüler eher so akzeptiert fühlen,wie er ist. Unter solchen Bedingungen besteht auch weniger Anlass, das eigene Fühlen,Denken und Handeln nach äußeren Kriterien auszurichten. Der Einzelne kann vondem ausgehen, was ihm bedeutsam erscheint und daher werden sich auch seine Einstellungenund Wert<strong>auf</strong>fassungen insgesamt stärker in Einklang mit seinem eigenen Denkenund Handeln entwickeln, d.h. inneres und äußeres Selbst werden in höherem Maß integriert(vgl. DECI/ RYAN 1991).Das bedeutet, dass das Individuum <strong>auf</strong>grund der seinem Handeln zugrunde liegendeninneren Regelsysteme selbst eine Ordnung in den von der Umwelt angebotenen Dingen,Vorstellungen, Werten usw. erzeugt, so wie es <strong>auf</strong>grund der seinen Geist bestimmendenuniversalen Grammatik aus dem von der Umgebung angebotenen sprachlichen Materialseine eigenen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten findet und entwickelt. So wie lenkendeEinflüsse durch Lob und Tadel und <strong>die</strong> dadurch entstehende extrinsische Motivationden Spracherwerb behindern, zeitigen entsprechende Steuerungsversuche und <strong>die</strong>dadurch entstehende extrinsische Motivation auch im Bereich der Werthaltungen eherunerwünschte Ergebnisse, während <strong>die</strong> Unterstützung der Selbstregulation <strong>die</strong> Fähigkeitzur verantwortlichen Führung des eigenen Lebens stärkt.16. Pläne und InteressenKinder verfügen schon von vornherein über differenzierte Dispositionen nicht nur fürden Erwerb von Wissen, sondern für Wissen selbst. Aber sie sind auch von vornherein inihren Dispositionen sehr verschieden, und <strong>die</strong>se Verschiedenheit verstärkt sich nochdurch <strong>die</strong> Unterschiede in den Temperamenten, durch <strong>die</strong> Umgebungen, in denen <strong>die</strong>Kinder <strong>auf</strong>wachsen usw. Das bedeutet, dass auch <strong>die</strong> Interessen der Kinder von vornhereinsehr verschieden sind. Interesse ist zu verstehen als das Bestreben des Selbst, seine148
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTimmer schon bestehenden Kompetenzen zu erweitern, um Herausforderungen immerbesser gewachsen zu sein.Subjektiv äußert sich das Interesse als Affekt, der eine Beziehung zwischen dem Selbstund seinen Handlungsmöglichkeiten in einer jeweils gegebenen Umgebung herstellt(vgl. auch CECI 1992). Zugleich wird der Zugang zu Assoziationen, möglichen Zusammenhängen,Anwendungen und Beispielen erleichtert sowie eine für das Lernen günstigeErregung <strong>auf</strong>gebaut. Solche Interessen anzeigende Affekte sind das Ergebnis derVerarbeitung von Information in vernetzten Regelsystemen.Aufgrund der Kenntnis von Gegenständen und ihrer Einstellung zu ihnen entwickelnSchüler Pläne zum Umgang mit <strong>die</strong>sen Gegenständen. Unter einem Plan ist dabei einemehr oder weniger klare Vorstellung von Zielen, Handlungen oder Handlungsfolgen zuverstehen, <strong>die</strong> zu einem gewünschten Ergebnis führen 61 . Danach lassen sich auch Tagträume,in denen jemand sich vorstellt, er würde <strong>die</strong>s und jenes tun und sehr erfolgreichdabei sein, als eine Form von Plänen verstehen. Tagträume können so etwas wie derKeim sein, aus dem langfristig verfolgte Pläne entstehen. So wie Watts von einer Kraftmaschineträumte, aber erst nach langer Zeit den Plan für <strong>die</strong> Dampfmaschine fand. DerAusgangspunkt von technischen Entwicklungen, von Büchern usw. stellt meist nur einevage Idee dar, <strong>die</strong> man kaum als ausgereiften Plan bezeichnen würde. Aber im Verl<strong>auf</strong>der weiteren Arbeit daran tritt der Plan, das innere Gerüst der Idee, zunehmend klarerhervor.Aus der interessegeleiteten Beschäftigung mit einer Sache können also komplexe Pläneentstehen. Durch <strong>die</strong> Beschäftigung mit einem Gegenstand erwirbt man sich erst dasWissen über konkrete Handlungsmöglichkeiten, d.h. über einfache Pläne, das für <strong>die</strong>Erstellung komplexer Pläne, d.h. komplexer Handlungsmöglichkeiten gebraucht wird.Solche komplexen Pläne sind bedeutsam für <strong>die</strong> Arbeits- oder Lernmotivation. Dennwenn wir einen Plan entwickeln und verfolgen können, wissen wir, was wir als nächstesvorhaben und tun möchten.Erfolgt nun <strong>die</strong> Beschäftigung mit einem Unterrichtsgegenstand unter Bedingungen, <strong>die</strong>keine eigenen Handlungsmöglichkeiten, also keine eigenen Pläne erkennen lassen, wird<strong>die</strong> Einstellung, <strong>die</strong> das Individuum zu dem fraglichen Gegenstand gewinnt, eher negativsein. Solche Bedingungen liegen beispielsweise vor, wenn <strong>die</strong> Auseinandersetzung mitdem Gegenstand nur wenige Bezüge zur Erfahrung des Schülers <strong>auf</strong>weist. Auch der61Diese Bedeutung von "Plan" entspricht nicht der Definition von MILLER/ GALANTER/PRIBRAM 1973,lehnt sich aber daran an.149
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTschnelle Wechsel der Unterrichtsgegenstände, wie ihn <strong>die</strong> überfrachteten Lehrpläne undder dar<strong>auf</strong> <strong>auf</strong>gebaute Stundenplan erfordern, lässt kaum das allmähliche Begreifen einesGegenstandes und <strong>die</strong> Abtastung <strong>auf</strong> seine Möglichkeiten hin zu. Unter solchen Bedingungengeht der behandelte Sachverhalt nicht aus dem bestehenden Wissen hervor.Er ist dann nicht in <strong>die</strong> kognitive Struktur des Schülers eingebunden, sondern wird wieein Fremdkörper empfunden – auch oder gerade weil er nur zu einer vom Schulsystemgeforderten Prüfung gebraucht wird. Er hat in <strong>die</strong>sem Fall keine wirkliche Bedeutungund ist im Extremfall subjektiv sinnlos. Solange Individuen Dinge sinnlos erscheinen,befassen sie sich auch nicht gern damit.Wenn aber durch Erfahrungsbezüge deutlich wird, was man anhand eines Unterrichtsgegenstandsauch für sich gewinnen kann, wenn man sieht, dass <strong>die</strong> eigenen Fähigkeiten,das eigene Wissen dadurch erweitert werden, d.h. wenn Pläne erkennbar werden, wieman das eigene Wissen, <strong>die</strong> ja einen Teil des eigenen Selbst darstellen, erweitern undstabilisieren kann, dann wird auch <strong>die</strong> Einstellung eines Individuums zu einem Gegenstandpositiv sein. Wenn das Individuum <strong>auf</strong>grund der Ausführung einiger Pläne innerhalbeines Bereiches immer mehr Handlungsmöglichkeiten für sich erkennt wird auchsein Interesse daran gestärkt. Zu einer solchen Stärkung von Interessen kann man beitragen,indem man das Individuum zur Ausführung seiner subjektiven Pläne ermutigt.Durch <strong>die</strong> Ausarbeitung seiner Pläne erfährt sich das Individuum als kompetent, wassein Interesse noch weiter stärkt. Auf <strong>die</strong>se Weise wird der Drang, <strong>die</strong> in seiner kognitivenStruktur entstandenen Pläne in <strong>die</strong>sem Bereich auszuführen. Je mehr der Einzelne<strong>die</strong>ser Pläne tatsächlich ausführt, umso mehr neue Fragen und Pläne wird er erkennen,was wiederum sein Interesse steigert.17. SelbstwerteinschätzungenJeder Mensch trägt ein Bild von sich selbst in sich, das oft als "Selbstgefühl" bezeichnetwird (vgl. BISCHOF-KÖHLER 1985, S. 20). Das Selbstgefühl entsteht und ändert sich inder Auseinandersetzung mit den Umständen, unter denen man lebt. Bei extrinsisch motiviertenIndividuen sind insbesondere <strong>die</strong> Urteile und Erwartungen Anderer von Bedeutungfür <strong>die</strong> Einschätzung des eigenen Selbstwerts, während <strong>die</strong>se Urteile Anderer beiintrinsisch motivierten Individuen weit weniger ins Gewicht Bedeutung haben. DasSelbstbild hängt von den jeweiligen äußeren und inneren Bedingungen für ein Individuumab.150
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTEine gewisse Stabilität des Selbstgefühls wird durch <strong>die</strong> Überzeugungen eines Individuumsbegründet, über einen unverwechselbaren eigenen Körper, ein bestimmtes Wissen,Können und über eigene langfristige Pläne zu verfügen. Der Wert seines Selbst bestimmtdas Individuum <strong>auf</strong>grund einer Auswahl der Urteile, <strong>die</strong> es selbst und/oder andereüber Komponenten seines Selbst treffen.Da das Selbst als abgrenzbares Phänomen erlebt wird, gewinnt es für das Individuumeinen "einmaligen Wert, den es zu erhalten und zu erhöhen gilt. Die Steigerung und Intensivierungdes Selbstgefühls wird damit ein motivationales Ziel" (BISCHOF-KÖHLER1985, S. 20). Die Interaktion mit der Umwelt erfolgt unter dem Ziel des Erhalts, der Erweiterungund Bestätigung des Selbst (vgl. KELLY 1968).Erhaltung des Selbstwerts als (Grund-)BedürfnisDer Ausdruck "Erhaltung des Selbst" ist ein abkürzender Sprachgebrauch. Er bedeutet<strong>die</strong> Aufrechterhaltung der Selbsteinschätzungen der Person. Das sind <strong>die</strong> Bewertungeneinzelner Komponenten des Selbst. Die Gesamtheit der Selbsteinschätzungen wird alsSelbstwertgefühl bezeichnet. Bedrohungen oder Herabsetzungen des Selbstwerts werdenals unangenehm, Bestätigungen oder Erhöhungen dagegen als angenehm empfunden. Esbesteht ein grundlegendes Motiv, das Selbstwertgefühl <strong>auf</strong>rechtzuerhalten und gegenBedrohungen zu verteidigen (vgl. FREY/BENNING 1983).Bedrohungen wie auch <strong>die</strong> Bestätigungen des Selbstwerts hängen <strong>auf</strong>s Engste mit derErfüllung bzw. Nicht-Erfüllung der Grundbedürfnisse zusammen. Im Wesentlichen sindes zwei Gruppen von Bedürfnissen, deren Befriedigung <strong>die</strong> Bestätigung bzw. Erhaltungdes Selbstwerts ermöglichen bzw. deren Vorenthaltung den Selbstwert bedrohen:(1) das Bedürfnis nach Zugehörigkeit bzw. sozialer Bindung;(2) das Bedürfnis nach Selbständigkeit und das damit verknüpfte Bedürfnis nach Kompetenz;Das gleichzeitige Streben nach Selbständigkeit und nach Zugehörigkeit erzeugt immerein Spannungsfeld, in dem das Individuum sich in der Regel Bedrohungen ausgesetztsieht. So kann das Streben nach Zugehörigkeit zu Vereinnahmung und Abhängigkeitführen. Andererseits kann das Streben nach Unabhängigkeit mit dem Verlust von sozialerBindung und Sicherheit verknüpft sein. Der gesamte Lebensl<strong>auf</strong> kann als Auseinandersetzungzwischen dem Eigenstreben des Individuums und seiner sozialen Anpassung151
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFToder Bindung verstanden werden, und in <strong>die</strong>ser Auseinandersetzung bestimmt und entfaltetdas Individuum seinen Kern, d.h. sein Selbst (vgl. ERIKSON 1965).Nun wird Selbständigkeit häufig eher als Fähigkeit verstanden, nach eigenen Vorstellungenzu handeln und Entscheidungen zu treffen. DECI und RYAN dagegen behaupten,Selbständigkeit sei "mehr als eine Fähigkeit; sie ist auch ein Bedürfnis" und verweisendazu <strong>auf</strong> eine Reihe von Forschungsbefunden. Danach bestehe eine "angeborene Neigungzur Selbstbestimmung, <strong>die</strong> den Organismus dazu bringt", sich für ihn bedeutsamenReizen zuzuwenden (vgl. DECI/RYAN 1985, S. 38). Dies erst führe zur Entwicklung vonFähigkeiten und zur flexiblen Anpassung an <strong>die</strong> Umwelt. Selbständigkeit als Grundbedürfniskann biologisch aus purer Notwendigkeit entstanden sein. Denn um zu überleben,muss jeder Organismus mit seiner Umwelt zurechtkommen und sich <strong>auf</strong> sie einstellen.Wenn lebende Systeme zwar energetisch offen, funktional aber geschlossen sind,bleibt ihnen nur <strong>die</strong> Möglichkeit der Selbstorganisation (vgl. RYAN/ POWELSON 1991).Das Bedürfnis nach Selbständigkeit löst eine Vielfalt von Aktivitäten aus. Schon dasKleinkind will seinen Bereich erkunden, will alles, was ihm in <strong>die</strong> Hände fällt, "begreifen"und damit umgehen, um es in sein Weltbild einzuordnen bzw. sein Weltbild dadurchzu erweitern und zu differenzieren (vgl. z.B. HANSEN 1965; PIAGET 1976). Indemdas Individuum nach seinen Vorstellungen mit den Dingen umgeht, sie ordnet, zusammenfügt,zerlegt usw., fühlt es sich als Verursacher vieler für es wichtiger Ereignisse. Eserfährt, dass es etwas bewirken kann, dass es <strong>die</strong> Umwelt in einem gewissen Grad nacheigenen Wünschen zu beeinflussen und zu gestalten vermag.Es erfährt aber auch Widerstände. Dinge und andere Menschen lassen sich nicht nachBelieben manipulieren. Es gibt Gesetzmäßigkeiten und Regeln, <strong>die</strong> zu beachten sind,wenn man Gegenstände handhaben und Menschen erfolgreich beeinflussen will. DieseWiderstände und Grenzen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Umwelt dem eigenen Drang nach Gestaltung oderBeeinflussung entgegensetzt, fordern das Individuum zum Lernen heraus. In der Auseinandersetzungmit Widerständen erkennen wir Naturgesetze sowie soziale Zusammenhängeund Regeln aller Art. Sie verdeutlichen, dass es mehr oder weniger verlässlicheBedingungen gibt, <strong>die</strong> den Umgang mit Menschen und Dingen erleichtern. Es gibt etwas,an das man sich halten kann. Die Wahlmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeitenwerden dadurch zwar begrenzter, aber auch überschaubarer. Die Überschaubarkeit vonHandlungsmöglichkeiten und <strong>die</strong> Vorhersagbarkeit der Folgen von Handlungen vermittelndem Kind Sicherheit in seiner subjektiv größer werdenden Welt.152
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDie Berücksichtigung der Bedürfnisse nach Sicherheit oder Zugehörigkeit und Unabhängigkeitist großer Bedeutung für <strong>die</strong> Erziehung. Das Interesse der Lehrer für <strong>die</strong> ihnenanvertrauten Schüler wird von <strong>die</strong>sen nämlich nur dann als positiv erfahren, wenn<strong>die</strong> Erzieher einerseits <strong>die</strong> Selbständigkeit der Schüler unterstützen und ihnen andererseitsauch Sicherheit durch Schutz, Ermutigung, Trost und eine grundlegende Akzeptanzgewähren. Wenn <strong>die</strong> schulische Umwelt <strong>die</strong> Schüler darin unterstützt, ihren Selbstwertzu erhalten und zu steigern, bedeutet <strong>die</strong> soziale Anpassung an <strong>die</strong>se vorteilhaften Umständeauch für <strong>die</strong> Schüler einen Vorteil. Ihre Lernbereitschaft und Lernerfolge werdendadurch positiv beeinflusst (vgl. RYAN / LYNCH 1989; MILLS / ALPERT / DUNHAM 1988;DECI / SCHWARTZ / SHEINMAN / RYAN 1981; RYAN / GROLNICK 1986; GROLNICK / RYAN1989).Das handlungs- und das lageorientierte SelbstFortgesetzte Kompetenz- bzw. Inkompetenzerfahrungen beeinflussen <strong>die</strong> Selbstwerteinschätzungenvon Individuen sowie auch <strong>die</strong> allgemeine Haltung, <strong>die</strong> sie gegenüber ihrerUmwelt bzw. den Situationen, in <strong>die</strong> sie geraten, einnehmen.Schüler, deren Bedürfnisse nach Sicherheit und Selbständigkeit erfüllt werden und <strong>die</strong>sich als kompetent erfahren, zeigen zumeist eine Haltung, <strong>die</strong> als „Handlungsorientierung“bezeichnet wird. Bei induzierten Phantasieszenen neigen sie dazu, <strong>die</strong> Geschichtenso fortzusetzen, dass sie selbst erfolgreich daraus hervorgehen. Sie nehmen stets an, einenWeg finden zu können, wie ein Problem zu lösen ist, und sie halten sich im Fall vonSchwierigkeiten nicht lange mit Gedanken über ihre vielleicht ungünstige Lage <strong>auf</strong>, sondernsuchen nach Möglichkeiten, wie sie aus den Schwierigkeiten wieder herauskommenkönnen (vgl. KUHL 1984). Handlungsorientierung ist mit dem Gefühl verknüpft,sein Schicksal selbst verändern zu können, der "Meister" seiner selbst zu sein (vgl. DE-CHARMS 1979). Das fördert <strong>die</strong> Selbständigkeit und Sicherheit <strong>die</strong>ser Individuen unddamit auch eine positive Selbstwerteinschätzung. Im Grunde ist Handlungsorientierungals ein Aspekt intrinsischer Motivation zu verstehen.Dagegen konstruieren Schüler, deren Bedürfnisse nach Sicherheit und Selbständigkeitnicht erfüllt werden und <strong>die</strong> sich häufig als erfolglos oder inkompetent erfahren, <strong>die</strong> weiteher Geschichten, in denen alles schief geht (vgl. BANDURA 1990). Unter solchen Bedingungenfühlen sich Schüler zu ihren Aufgaben eher gezwungen, als dass sie sich auseigenem Antrieb damit beschäftigen. Schüler, <strong>die</strong> durch derartige Bedingungen geprägtwurden, neigen in Anforderungssituationen in hohem Maße dazu, sich mehr mit ihrer153
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLage als mit ihren Handlungsmöglichkeiten zu beschäftigen. Ihre Informationsverarbeitungskapazitätist sozusagen mit Gedanken über ihre Lage, ihr Pech belastet. Für <strong>die</strong>Lösung der jeweiligen Probleme bedeutet das eine nicht unerhebliche Behinderung, weilsozusagen nur ein Teil der Verarbeitungskapazität zur Verfügung steht und <strong>die</strong> Problembearbeitungbei jedem positiven oder negativen Teilergebnis durch Lagereflexionengestört wird (vgl. KUHL 1984). Es ist nicht verwunderlich, wenn Menschen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> vonSelbstzweifeln geplagt werden, in ihren Fähigkeiten zum synthetischen wie analytischenDenken beeinträchtigt sind. Es wird einfach zuviel Kapazität für <strong>auf</strong>gabenfremde Überlegungenverbraucht. Infolgedessen lösen sie gestellte Aufgaben deutlich schlechter (vgl.RODIN 1990).Lagereflexionen bedeuten, dass das Individuum sich immer wieder fragt, wie es in <strong>die</strong>aus seiner Sicht unlösbare Situation geraten konnte, dass es inkompetent sei, welcheschlimmen Folgen das Ganze für es haben könnte, dass es den Umständen ausgeliefertund eine "Marionette" sei (DECHARMS 1979). Wenn es nun gelänge, solche lageorientiertenVorstellungen durch Imaginationen zu ersetzen oder zu verdrängen, in denen <strong>die</strong>Individuen sich als handelnd und erfolgreich vorstellen, dann sollten sie auch in nachfolgendenkonkreten Anforderungssituationen weniger in lageorientierten Phantasienversinken, sondern sich konzentrierter den jeweiligen Aufgaben zuwenden. Eine Annahme,<strong>die</strong> in mehreren Untersuchungen bestätigt werden konnte (vgl. CORBIN 1972;KAZDIN 1978; FELTZ / LANDERS 1983; BANDURA 1986).Die Erfahrung von Erfolg bzw. Kompetenz stärkt aber nicht nur <strong>die</strong> Konzentration. Weilsolche Individuen das Gefühl oder den Eindruck haben, Kontrolle über Ereignisse unddas eigene Verhalten zu besitzen, können auch ihre Bedürfnisse nach Selbständigkeitund Sicherheit befriedigt werden; sie sind dann ausdauernder bei der Verfolgung ihrerZiele (vgl. TAYLOR/ LOCKE/ LEE/ GIST 1984; im Überblick RODIN 1990). Dagegen begünstigenMisserfolge und Zweifel an der eigenen Kompetenz eher Unsicherheit, einGefühl der Abhängigkeit sowie <strong>die</strong> Tendenz <strong>auf</strong>zugeben (vgl. WEINBERG / GOULD /JACKSON 1979; JACOBS/ PRENTICE-DUNN / ROGERS 1984; CERVONE/ PEAKE 1986).Für den "Meister" (DECHARMS 1979) tragen gelegentliche Misserfolge eher zum Gefühlder Meisterschaft in einer Welt voller Schwierigkeiten bei. Welt- und Selbstbild brauchendavon nicht negativ beeinflusst zu werden. Denn wenn Misserfolge dazu Anlassgeben, <strong>die</strong> angewandten Strategien zu verbessern, ein Problem zu zerlegen, realistischeTeilziele zu setzen usw., dann beweist sich ein handlungsorientiertes Individuum gerade154
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTdadurch, dass es <strong>auf</strong>grund seiner Kompetenz in der Lage ist, am Ende auch mit schwierigstenSituationen fertig werden zu können (vgl. KUHL 1989; SCHUNK 1984).Handlungsorientierung – als Folge oder Aspekt intrinsischer Motivation – wird im Idealfallauch als eine Art mühelosen Funktionierens der eigenen Kräfte erlebt. Dieses Phänomenbezeichnet CZIKSZENTMIHALYI (1990) auch als "Flow". MONTESSORI (1977, S.173) nannte es "Polarisation der Aufmerksamkeit". Im Flow erlebt sich das Individuumin einer Position, in der es <strong>die</strong> Kontrolle über einen Teil der Umwelt in den eigenenHänden hat. Gedanken neben <strong>die</strong>ser Tätigkeit, Hoffnungen oder Sorgen und Ängste habenhier keinen Platz. In <strong>die</strong>sem Zustand absoluter Konzentration verändert sich auchdas Zeitgefühl. Allerdings entsteht Flow nur, wenn kein Erfolgsdruck besteht.155
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTeil IVBeiträge zur UnterrichtspsychologieSchulen sind häufig so organisiert, dass <strong>die</strong> von ihnen geschaffenen Bedingungen vorallem rezipierend-reproduzierendes Lernen sowie extrinsische Motivation fördern.Schaut man sich solche Schulen näher an, hat zumeist man das Gefühl, <strong>die</strong>se Orte längstzu kennen. Sie haben nichts Einladendes, man findet kein Plätzchen, an dem man sichgern niederlassen, in Büchern oder Arbeitsmaterialien stöbern und sich gern mit Schülernunterhalten würde. Kahle Flure, keine Kunstwerke der Kinder und Jugendlichen,Bilder von Klassenfahrten oder Projekten. Man spürt, dass es keine Freude macht, denTag hier zu verbringen.In der Alltagssprache würde man solche Orte als "schlechte Schulen" bezeichnen. Dassind Schulen, <strong>die</strong> unsere Kinder nicht ver<strong>die</strong>nen. Man fragt sich, warum <strong>die</strong> Kinder undJugendlichen in Schulen gehen müssen, <strong>die</strong> noch immer genauso funktionieren wie <strong>die</strong>Schulen, in <strong>die</strong> wir selber gegangen sind, in denen <strong>die</strong> Freude erstirbt, das Lernen zurLast wird, <strong>die</strong> Angst vor den Klausuren und Noten den Tag verderben."Schlechte Schulen", das sind Schulen, in denen der Lehrer dominiert, in denen der Lehrerfür alles verantwortlich ist. Die Schüler haben zu lernen, aber man traut ihnen nichtzu, dass sie Eigenaktivität entwickeln und Projekte aus eigener Entscheidung herausangehen. Der „gute“ Lehrer in schlechten Schulen legt großen Wert <strong>auf</strong> Leistung undMitarbeit. Er kennt seine Schüler, er lobt sie, wann immer es möglich ist, er führt regelmäßigeTests durch und weiß immer, was mit jedem seiner Schüler los ist. Aber sehenwir uns <strong>die</strong> Merkmale solcher Schulen genauer an.156
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT18. Didaktische Merkmale aus der Sicht von außen„Schlechte“ Schulen sind Schulen, <strong>die</strong> nach Verwaltungskriterien geschaffen wurden,Schulen, <strong>die</strong> nach Verwaltungsvorschriften handeln, nach Lehrplan, Stundenplan undDisziplinarordnung. Es sind Schulen, <strong>die</strong> aus der Sicht von außen konstruiert wordensind. Erziehung besteht danach in der Formung der Schüler nach vorgegebenen Zielen.Solche Schulen glauben an den Lehrplan oder Bildungsstandards – wie immer auch <strong>die</strong>Sammlung ihrer von übergeordneten Verwaltungsorganen vorgegebenen Ziele heißenmag.Erziehung als LenkungOberflächlich betrachtet ist <strong>die</strong> Lenkung des Schülerverhaltens eine einfache und erfolgreicheMethode, um <strong>die</strong> Ziele des Unterrichts und der Erziehung zu verwirklichen. ImWesentlichen besteht sie Anweisungen und den Maßnahmen, <strong>die</strong> zur Einhaltung derAnweisungen erforderlich sind, also Lob und Tadel sowie Belohung und Bestrafung. Jeenger und bestimmter <strong>die</strong>se Anweisungen sind, desto offensichtlicher ist es, wenn Schülerdavon abweichen. Allerdings können Schüler sich entscheiden, innerlich abwesendzu sein oder sich nur in minimaler Weise zu beteiligen beziehungsweise den Forderungendes Lehrers nur soweit zu genügen als nötig ist, um Strafe oder Tadel zu vermeidenoder Belohnungen zu erhalten.Schulen und Lehrer, <strong>die</strong> großen Wert <strong>auf</strong> Erfolg und Leistung legen, betrachten <strong>die</strong> Lenkungdes Handelns ihrer Schüler als ihr wichtigstes Mittel. Das gleiche gilt für <strong>die</strong> Bildungs-Ministerien.Tatsächlich sieht es für den jeweiligen Moment so aus, als ließensich mit Hilfe der Lenkung alle gewünschten Ziele erreichen. Schließlich tun Schülervieles, um ein Lob zu erhalten oder um eine unangenehme Strafe oder schlechte Notenzu vermeiden. Langfristig jedoch ist Lenkung ein absoluter Fehlschlag. Denn sobald derLehrer nicht mehr da ist, hören <strong>die</strong> Schüler <strong>auf</strong> zu arbeiten, sich anzustrengen, sich zubenehmen usw. Außerdem tun sie grundsätzlich nur das, was sie müssen. Ihre Leistungenliegen daher immer weit unterhalb dessen, zu dem sie wirklich in der Lage wären.Deshalb sind Schulen, in denen Lenkung eine prominente Rolle spielt, fast immerschlechte, zumindest aber keine guten Schulen. Die Leistungen ihrer Schüler erreichennicht das Spitzenniveau und ihre Lehrer sind nicht, oder nur in seltenen Ausnahmen, inhohem Maß engagiert. Zu den langfristig durchwegs negativen Wirkungen von Lohn157
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTund Strafe, Lob und Tadel liegt eine Fülle von Befunden vor (zusammenfassend dazuALFIE KOHN 1999).Die Zerstörung von InteressenUnter den langfristigen Folgen schulischer Lenkung ist insbesondere <strong>die</strong> Zerstörung derInteressen der Schüler zu nennen. Denn <strong>die</strong> Pläne und Interessen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Schüler beifreiem Handeln entwickeln würden, werden durch <strong>die</strong> Einschränkungen eines lenkendenUnterrichts unterdrückt. Die Einengung der Pläne der Schüler hat bei einem großen Teilder Schüler <strong>die</strong> Konsequenz, dass sie kein besonderes Interesse an der Sache entwickeln,da es für sie ja nicht möglich ist, den Gegenstand in einer subjektiv bedeutsamen Weisezu betrachten und zu untersuchen. Man braucht Freiräume, um schulische Aufgabenoder Unterrichtsstoffe mit dem eigenen Wissen und Plänen zu verknüpfen, deren Verwirklichungeinen persönlichen Wert für <strong>die</strong> Schüler hat.Wenn so viele junge Menschen kaum lesen, wenn viele nach der Schule und oft auchnach dem Studium nicht wissen, was sie denn beruflich tun könnten, ist das ein deutlichesZeichen für <strong>die</strong> Zerstörung der Interessen und für das Fehlen von eigenen Plänen.Die Interessen von Schülern werden in vielen Schulen nicht unterstützt und gefördert,wie <strong>die</strong>se Schulen überhaupt wenig Bezug zum Leben ihrer Schüler haben. Folgerichtigvertritt Ingo Richter, Direktor des Deutschen Jugendinstituts, <strong>die</strong> Auffassung, es sei„hochmütig, zwischen 10 000 und 20 000 Stunden des Lebens von jungen Menschen füreinen Unterricht mit der Behauptung in Anspruch zu nehmen, er bereite <strong>auf</strong> das Leben inGesellschaft und Beruf vor, während er in Wirklichkeit nur lehrt, den Anforderungen desBildungswesens zu entsprechen.“ (RICHTER 1999, S. 88) 62Wenn <strong>die</strong> "Wünsche der Schüler, wie und was sie lernen wollen" sich nicht mit demUnterrichtsangebot decken, dann erleben <strong>die</strong> Schüler das, was sie im Unterricht tun alsnicht sehr sinnvoll, als nicht besonders nützlich und auch wenig interessant (ECKERLE /KRAAK 1993, S. 139). Sie erleben ihre eingegrenzten Handlungsmöglichkeiten und dasie nichts dagegen ausrichten können, finden sie sich damit ab. Nach Jahren fremdbestimmtenschulischen Lernens können sie sich vermutlich kaum noch vorstellen wie sieden Unterricht selber mitgestalten könnten. Das geht soweit, dass sie Mitbestimmungsmöglichkeitenin Schule und Unterricht abschätzig bewerten und beurteilen (ECKERLE /62 INGO RICHTER: Die sieben Todsünden der Bildungspolitik. München, Wien 1999, C. Hanser Verlag, S.88.158
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTKRAAK 1993, S. 140, 77). Denn wenn <strong>die</strong> Schüler durch den ergebnisorientierten Unterrichterst einmal eine reproduktive Lernhaltung angenommen haben, dann fällt es ihnenschwer, eigene Pläne und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Wenn aber eigenePläne nicht entwickelt und ausgeführt werden können, wird das Denken träge undstumpf, statt tätig und energisch. Man lässt sich lieber treiben und schiebt anderen <strong>die</strong>Verantwortung zu für das, was geschieht und zu geschehen hat.Die Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten wirkt sich insgesamt lähmend aus.Denn obwohl <strong>die</strong> Schüler überzeugt sind, dass gute Schulbildung und gute Noten für ihrweiteres Leben große Bedeutung haben, sie ihre schulische Leistung gern verbessernund nützliche Dinge lernen würden (vgl. ECKERLE / KRAAK 1993, S. 37), beschränkensie sich <strong>auf</strong> das Notwendige und verschieben das Handeln <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Zukunft. Dennochsind sie überzeugt, eigentlich mehr leisten zu können, wenn sie nur wollten (vgl. ECKER-LE / KRAAK 1993, S. 139). Das trägt zur Erhaltung des Selbstwerts bei und kann zumanderen eine an <strong>die</strong> Schule gerichtete Schuldzuweisung sein, <strong>die</strong> sie zwingt, aus ihrerSicht mehr oder weniger Sinnloses zu lernen.Schwache Schüler werden noch weiter geschwächtEin am Gängelband geführter Schüler, dem nicht <strong>die</strong> Möglichkeit gegeben wird, innerhalbeines <strong>auf</strong> seine Fähigkeiten abgestimmten Rahmens eigene Pläne und Interessen zuentwickeln und zu verfolgen, verkümmert dadurch allmählich in seiner Fähigkeit, sichselbst Ziele zu setzen, sie aus eigenem Antrieb zu verwirklichen, das Ergebnis kritischzu prüfen und zu verbessern. Wenn sich ein Schüler in den ihm eigenen Möglichkeitenund Fähigkeiten, <strong>die</strong> ja nicht unbedingt mit dem Lehrplan und dem, was ein steuernderUnterricht daraus macht, konform gehen, nicht entwickeln darf, kann er sich auch alsPerson nicht geschätzt fühlen. Insbesondere ein schwächerer Schüler wird, wenn er sichnicht zur Wehr setzen kann und <strong>die</strong> Situation andauert, ein niedriges Selbstwertgefühlentwickeln. Ein niedriges Selbstwertgefühl wirkt sich ungünstig <strong>auf</strong> das weitere Lernenund Leben <strong>die</strong>ses Schülers aus. Nach und nach wird er das fehlende Vertrauen seinerErzieher in seine Fähigkeiten sogar rechtfertigen. 63Letztlich führen fortgesetzte Erfahrungen von Inkompetenz und Selbstabwertung zueinem kaum revi<strong>die</strong>rbaren Misserfolgszirkel sowie zu Abneigung gegenüber der Schule63 Vgl. ELFIEDE HÖHN, Der schlechte Schüler. Sozialpsychologische Untersuchungen über das Bild dasSchulversagers, München 1972;159
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTund ihren Unterrichtsgegenständen. Der Schüler fühlt sich weniger als Verursacher oder"Meister" seines Verhaltens, sondern eher als Marionette der Umstände (Vgl. DE-CHARMS 1968). Er verfängt sich zunehmend in einem Netz von Gedanken über seineWertlosigkeit, Hilflosigkeit, <strong>die</strong> Unausweichlichkeit der eigenen Lage. Da er den Eindruckhat, keinen Einfluss <strong>auf</strong> seine Situation nehmen zu können, entwickelt eine Haltung,<strong>die</strong> man als Lageorientierung (KUHL 1984) oder auch als Hilflosigkeit bzw. erlernteHilflosigkeit (SELIGMAN 1975) bezeichnet. Das Nachdenken über <strong>die</strong> eigene Lage und<strong>die</strong> Unausweichlichkeit der Situation, in der man sich befindet oder zu befinden glaubt,bindet <strong>die</strong> Verarbeitungskapazität der Person. Sie unternimmt nichts, um ihre Lage zuändern, einerseits weil sie <strong>die</strong>se als feststehend akzeptiert und andererseits, weil sie ihreKraft <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Imagination der vermeintlichen Unausweichlichkeit ihrer Lage konzentriert.In ihrer Angst vor erwarteten Misserfolgen neigen solche Schüler dazu, <strong>die</strong> Bedeutungder ihnen gestellten Aufgaben, aber auch ihre eigenen Fähigkeiten und <strong>die</strong> Wichtigkeitihrer Pläne abzuwerten. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn Lernbehinderung auchals "eine Folge verhinderter Eigenaktivität" verstanden wird (KLEIN 1992, S. 220 ff). Dieunterdrückte kreative Energie kann sich aber auch in Ausbrüchen von Destruktion, Vandalismus,politischem Extremismus usw. Luft machen (FROMM, S. 37).Die Entwicklung von Interessen in unterschiedlichen Schulsystemen mit ihren förderndenwie auch hemmenden Einflüssen und den Folgen für das spätere Leben der Absolventenist bisher kaum untersucht worden. Das ist durchaus bezeichnend für eine Erziehungswissenschaft,<strong>die</strong> sich offenbar in hohem Maß der herrschenden Bildungspolitikund deren Fragen verpflichtet fühlt statt den Fragen und Problemen der Schüler.Schüler lehnen <strong>die</strong> Schule abDie Haltung, dass man selber eigentlich nichts tun kann, geht über den Unterricht hinausund betrifft <strong>die</strong> Schule. Hier trifft <strong>die</strong> Haltung der Schüler <strong>auf</strong> <strong>die</strong> entsprechende Haltungder Lehrer, <strong>die</strong> in <strong>die</strong>ser Hinsicht ja selbst nicht an Handlungsmöglichkeiten glauben.Außerdem "erfordern Bemühungen der Schüler von denen, <strong>die</strong> sie unterstützen wollen,auch Durchhaltevermögen gegenüber anderen Interessen". Denn wegen zahlreicher Bestimmungenist es nicht nur kompliziert, sondern auch lähmend langwierig bei Schülervorschlägenz.B. "zur Schulorganisation oder zur Ausgestaltung ihrer Schule" zu Ergebnissenzu gelangen (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 142).160
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAllerdings üben sich <strong>die</strong> Schüler nicht in offenem Widerstand gegen schulische Fremdbestimmung.Sie haben erkannt, dass sie letztlich <strong>die</strong> Verlierer wären. Deshalb passenihr Verhalten "den Notwendigkeiten an" (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 139). Freilich verweigernsie sich den Lehrern, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Lenkung an ihnen vollziehen. Ganz bewusst vermeidensie es, <strong>die</strong> "Anerkennung von Lehrern" zu suchen. Sie entziehen sich dem Einflussihrer Lehrer, weisen sie zurück und signalisieren ihnen: 'So wichtig seid ihr für unsnicht. Wir müssen uns halt zwangsweise mit euch abgeben, aber das ist auch alles.' (vgl.ECKERLE / KRAAK 1993, S. 78 u. 137). Diese Haltung ist durchaus zwiespältig. Denneinerseits möchten <strong>die</strong> Schüler etwas Sinnvolles tun, selbstbestimmt arbeiten und lernen,aber andererseits haben sie das Gefühl, "es lohnt sich nicht." Deshalb lehnen sie "<strong>die</strong>seSchule" ab und fügen sich, "weil es ja nun so sein muß ... Schule selbst ist nicht wichtig;sie erhält ihre Bedeutsamkeit mittelbar, als notwendige Voraussetzung" (ECKERLE /KRAAK 1993, S. 85).Der Schaden für <strong>die</strong> GesellschaftDie Einengung des Denkens und der Entwicklungsmöglichkeiten der jungen Menschenschadet der Gesellschaft, weil ja ein vorhandenes Potential an Kreativität und Talentennicht gefördert wird, so dass zahllose potentielle Leistungen nicht erbracht werden undder Gesellschaft auch nicht zugute kommen können. Die Gesellschaft ist dar<strong>auf</strong> angewiesen,dass ihre Mitglieder sich voll und ganz für ihre Aufgaben einsetzen, gute unternehmerische,soziale und kulturelle Leistungen erbringen. Es kommt dar<strong>auf</strong> an, dass siedas alltägliche Leben und Zusammenleben in einer für alle förderlichen Weise gestaltenund bewältigen. Wenn man Kindern und Jugendlichen keine wirkliche Verantwortungfür ihr Denken und Handeln lässt, wenn man ihnen keine weittragenden Entscheidungenzutraut, wenn man sie nicht in jeder Hinsicht beteiligt, sondern ständig über sie verfügtund bestimmt und <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise das Werden der mündigen Bürger behindert und verletzt,fügt man der Gesellschaft, auch wenn es unwissentlich geschieht, schwer zu heilendeWunden zu, an denen alle zu leiden haben.Natürlich sind Lehrer, Eltern und überhaupt <strong>die</strong> Erwachsenen in der Regel überzeugt,mehr zu wissen und <strong>die</strong> Dinge besser beurteilen zu können als <strong>die</strong> Jugend, aber letztlichist es doch immer <strong>die</strong> Jugend, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Entdeckungen und Neuentwicklungen hervorbringt.Nicht <strong>die</strong> Lehrer, nicht <strong>die</strong> Väter und Mütter, sondern <strong>die</strong> Schüler, <strong>die</strong> Söhne undTöchter erschaffen das Neue. Wenn man also durch Steuerungsmaßnahmen <strong>die</strong> Schüler161
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTin das Prokrustesbett vorgeschriebener Lernvollzüge zwingt, erschwert man dadurchnicht nur <strong>die</strong> Entfaltung der individuellen Talente, sondern auch <strong>die</strong> Wandlung und Erneuerungder bestehenden Ordnungen <strong>auf</strong> allen Gebieten. Die Kraft zur Wandlung undErneuerung ist es letztlich, <strong>die</strong> einer Gesellschaft unter sich ständig ändernden Bedingungendas Überleben – und im Idealfall das „gute Leben“ – ermöglicht.Am „Führerprinzip“ bzw. wie ich es nenne, am „Prinzip der Lenkung“ kritisiert der PhilosophKARL POPPER (1970, Bd. 1, S. 187 f.) vor allem, dass es <strong>die</strong> Entwicklung vonintellektueller Vortrefflichkeit und Initiative behindere. Denn das „Geheimnis der intellektuellenVortrefflichkeit“ sei „eine kritische Einstellung und intellektuelle Unabhängigkeit.“Genau daran aber müssten alle „autoritären Methoden scheitern“. Denn der„Vertreter autoritärer Prinzipien wird im allgemeinen <strong>die</strong> Gehorsamen, <strong>die</strong> Gläubigen zuseinen Nachfolgern machen, Menschen also, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> seine Ideen eingehen.“ Dadurchwähle er „notwendigerweise mittelmäßige Geister“. Niemals könne <strong>die</strong> leitende undlenkende Autorität zugeben, dass <strong>die</strong>jenigen, <strong>die</strong> anders denken, <strong>die</strong> eigene Ideen vertreten,<strong>die</strong> andere Maßstäbe anlegen oder sich einer anderen Moral verpflichtet fühlen,„von größtem Werte sein könnten“. Diejenigen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> lenkenden Funktionen ausüben,werden zwar überzeugt sein, dass sie “zur Entdeckung von Selbständigkeit und Initiativefähig seien. Aber unter Initiative verstehen sie nur das schnelle Erfassen ihrer Absichten.Daß hier ein Unterschied vorliegt, werden sie nie begreifen.“Wir überschätzen unser WissenEinem hohen Ausmaß an Steuerung liegt nicht nur <strong>die</strong> Auffassung zugrunde, man wissebegründet, was für <strong>die</strong> Schüler gut ist. Genauso wichtig ist <strong>die</strong> damit oft stillschweigendverknüpfte Ansicht, man könne das Lernen von Schülern tatsächlich so lenken, dass mithoher Wahrscheinlichkeit auch ein optimales Ergebnis zustande kommt. Werden <strong>die</strong>Ziele nicht erreicht, wird <strong>die</strong> Schuld weniger in der Methode als vielmehr in der Widerspenstigkeitund Unwilligkeit der Schüler gesehen.Diese Steuerungstheorie überschätzt jedoch unser Wissen über Erziehung. In Wirklichkeitwerden <strong>die</strong> gesetzten Erziehungs- oder Unterrichtsziele eher selten in der geplantenForm, wenn überhaupt, erreicht. Die meisten Untersuchungen belegen, dass umfangreicheSteuerungsmaßnahmen weniger effektiv sind als einfach bloß helfende Hinweise beiSchwierigkeiten, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Schüler dann selbständig zu lösen versuchen (vgl. den Literaturüberblickbei FLAMMER 1975, S. 360 ff.).162
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir jenes Wissen, das wir bräuchten, umeffektiv steuern zu können, überhaupt gewinnen können. Denn alles theoretische Wissen,das wir über Erziehung haben können, besteht in Erklärungen mittels allgemeinerZusammenhänge, <strong>die</strong> uns in der Regel nur sehr wenig oder nichts über den Einzelfallund seine je besonderen Gegebenheiten oder Bedingungen sagen. Die Erklärungen derErziehungswissenschaft sind also nie vollständig, weil sie prinzipiell nicht sämtlicheBedingungsfaktoren erfassen.Es ist aber nicht nur so, dass wir nicht alle Bedingungsfaktoren von Erziehung kennenkönnen. Darüber hinaus sind selbst <strong>die</strong> dem Erzieher bekannten Faktoren nur begrenztbeeinflussbar. Didaktische Steuerungsmaßnahmen können insofern auch nur bedeuten,dass der vorhandenen Realität Regelungen hinzugefügt werden. Das bedeutet, dass <strong>die</strong>seRegelungen <strong>die</strong> Wirklichkeit nur im Ausnahmefall im beabsichtigten Sinn beeinflussen.In den meisten Fällen passen sich <strong>die</strong> Kinder und Jugendlichen einer ergriffenen Erziehungsmaßnahmean und beziehen sie in individueller Weise in ihr Leben ein. Auf <strong>die</strong>seWeise führen <strong>die</strong> Maßnahmen dann allerdings zu anderen Ergebnissen als den erwarteten.Warum wir so hartnäckig Erziehung als Lenkung feshaltenDie Frage ist, warum wir dann so hartnäckig an <strong>die</strong> positiven Wirkungen der Steuerungglauben. Wenn wir als Lehrer oder Eltern Kinder und Jugendliche zu leiten oder zu lenkensuchen, sehen wir den Schüler als eine in jeder Hinsicht klar von uns selbst abgetrenntePerson. Die physischen Grenzen eines Individuums unterscheiden uns ja eindeutigvon dem Anderen. Und doch ist <strong>die</strong>se rein physische Abgrenzung im Hinblick <strong>auf</strong> <strong>die</strong>Psyche eine Illusion. Denn in unseren Gedanken und Gefühlen sind wir sehr eng mitandern Menschen verbunden. Es fällt uns nur sehr schwer, das im alltäglichen Umgangzu sehen und zu akzeptieren.Nur weil wir glauben, von anderen Individuen, d.h. hier also von Kindern und Jugendlichen,getrennt zu sein, sind wir nicht davon abzubringen, trotz Lügen und Unehrlichkeitbei uns selbst, Kinder und Schüler für das gleiche Verhalten zu tadeln oder zu bestrafen.Wir sind sogar überzeugt, ihre Persönlichkeit durch solche Handlungen in einer Weiseformen oder dauerhaft beeinflussen zu können, wie uns das bei uns selbst nicht gelungenist oder wie wir das bei uns selbst nicht einmal versucht haben.163
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTObwohl wir bei Anderen sehr leicht Stimmungen ohne Worte spüren, glauben wir, dassdas, was andere nicht sehen können, für sie auch nicht erkennbar ist. Aber kann das, waswir als Erzieher oder Lehrer sind, wirklich bedeutungslos für das „Erziehen“ sein? Wennwir selbst Gefühlen wie Zorn, Eifersucht oder Wut ausgesetzt sind und es <strong>auf</strong>gegebenhaben <strong>die</strong>se Reaktionen in uns zu beherrschen, können wir ernsthaft von den uns anvertrautenKindern und Jugendlichen erwarten, dass sie ihr Fühlen <strong>auf</strong> unser Missfallen hinabstellen? Wie sollen Schüler freiwillige Anstrengungen und Lernfreude <strong>auf</strong>bringen,wenn wir selbst Weiterbildung nur <strong>auf</strong> uns nehmen, wenn wir dazu gezwungen sind?Was geht in uns vor, wenn wir vollmundig <strong>die</strong> schärfere Bewertung von Leistungen fordernund selber Prüfungen aus dem Weg gehen?Warum tun wir so als hätte <strong>die</strong> innere Welt, in der wir Erwachsenen leben, nichts mit derinneren Welt von Kindern und Jugendlichen und ihren Reaktionen <strong>auf</strong> uns zu tun? Sowohlunsere naiven als auch unsere wissenschaftlichen Theorien über psychische Vorgängewie Lernen, Denken, Wollen oder Fühlen wenden wir vor allem <strong>auf</strong> andere an,<strong>auf</strong> Kinder oder <strong>auf</strong> Menschen mit „Problemen“. Es ist <strong>die</strong>se Wendung des Blicks nachaußen durch <strong>die</strong> wir uns <strong>die</strong> Illusion erhalten, wir könnten <strong>die</strong> Persönlichkeit der anderennach unseren Zielen formen. Denn der Blick nach außen vermittelt uns <strong>die</strong> Illusion völligenAbgetrenntseins.Würden wir nach innen schauen, müssten wir erkennen, dass uns an Kindern und Jugendlichenirgendwelches Verhalten nur deshalb stört, weil wir unsere eigenen Wünscheund Vorstellungen gestört oder durchkreuzt sehen. Das heißt nun nicht, dass wir unsereWünsche <strong>auf</strong>geben müssen, nur erkennen sollten wir sie. Wenn dann mein Sohn meinePapiere, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> dem Schreibtisch liegen, zerreißen oder meine neue Digitalkamera in <strong>die</strong>gefüllte Badewanne werfen möchte, verstehe ich unmittelbar, dass das mit meinen Wünschenkolli<strong>die</strong>rt. Deshalb bin ich dann innerlich nicht gezwungen mit meinem Sohn zuschimpfen, sondern ich kann ihm in aller Ruhe <strong>die</strong> Sachen abnehmen und ihm deutlichmachen, dass ich nicht will, was er möchte. Ich verstehe auch, dass er meine Wünschenicht erkennen kann und dass ich versuchen muss, ihm eine Alternative zu bieten. Deshalbkann ich leicht und fließend dazu übergehen, mit ihm Bilder zu betrachten, zu „lesen“,zu fotografieren usw. Ich erkenne, dass ich mein Kind nicht nach meinen Vorstellungenlenken und „erziehen“ kann. Vielmehr geht es darum, eine gute Beziehung <strong>auf</strong>zubauen,ihn zu verstehen, <strong>auf</strong> ihn einzugehen und ihn mit mir und meinen Wünschen164
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTvertraut zu machen. Für den Lehrer ist es im Prinzip das Gleiche. Aber solange seinBlick nur nach außen gewendet ist, kann er das nicht erkennen.Stoff- bzw. ErgebnisorientierungWenn der zu lernende Unterrichtsstoff in der Schule das Primäre ist und nicht <strong>die</strong> Schülermit ihren Bedürfnissen und Interessen, sind solche Schulen „stofforientiert“ oder „ergebnisorientiert“zu bezeichnen. Im Unterricht stehen wissenschaftliche Ergebnisse imMittelpunkt und nicht der Umgang mit wirklichen Dingen und den sich daraus ergebendenFragen und Problemen. Es werden Antworten unterrichtet und gelernt statt Phänomenezu untersuchen, dabei Fragen zu stellen und nach Lösungen zu forschen.Wenn <strong>die</strong> Interessen und Bedürfnisse der Mädchen und Jungen in <strong>die</strong>ser Weise dem„Stoff“ untergeordnet werden, wenn bürokratisch erlassene Lehrpläne oder Bildungsstandardswichtiger sind als der Einzelne, rückt <strong>die</strong> Auseinandersetzung mit dem, was<strong>die</strong> jungen Menschen wirklich beschäftigt, notwendig in den Hintergrund. Das worum esdann in einer solchen Schule geht, sind Dinge, <strong>die</strong> für viele, wenn nicht <strong>die</strong> meistenSchüler, ohne Bedeutung sind. Damit sinkt in <strong>die</strong>sen Schulen <strong>die</strong> Bereitschaft der jungenMenschen, sich zu engagieren. Ihre Leistungen und damit <strong>die</strong> Leistungen <strong>die</strong>ser Schulensind also schlechter als <strong>die</strong> von Schulen, <strong>die</strong> in höherem Grad <strong>auf</strong> den Einzelnen einzugehensuchen.Von wissenschaftlichen Ergebnissen auszugehen, erscheint unterrichtsmethodisch alslogisches Vorgehen. Denn dazu müssen wissenschaftliche Sätze oder Theorien lediglichin eine Form gebracht werden, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Vermittlung an <strong>die</strong> Schüler möglichst einfach undökonomisch macht. Den Stoff, angefangen von seinen jeweiligen Elementen bis hin zuden komplexen Zusammenhängen, in der Form seines logischen Aufbaus zu unterrichten,gilt nach wie vor als <strong>die</strong> effektivste Methode der Wissensvermittlung, auch wenn <strong>die</strong>schulischen Ergebnisse sehr zu wünschen übrig lassen.Beispiel für ergebnisorientierten UnterrichtEine gute Einführung in <strong>die</strong> Geometrie beginnt damit, dass der Lehrer <strong>die</strong> Schüler fragt,welche Figuren man denn mit Zirkel und Lineal zeichnen kann. Es werden Kreise, DreieckeVierecke, Vielecke usw. genannt. Dabei werden sozusagen nebenbei das gleichseitigeDreieck, das Parallelogramm, das Quadrat usw. eingeführt. Der Lehrer zeichnet165
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTvielleicht einige Figuren an <strong>die</strong> Tafel oder lässt auch <strong>die</strong> Schüler selbst solche Figurenmalen.Er erklärt dann, dass Geometrie <strong>die</strong> Disziplin ist, <strong>die</strong> sich mit Figuren beschäftigt undihre Eigenschaften feststellt. Danach fragt er, welche Bausteine oder Elemente in derGeometrie benutzt werden. Einige Schüler werden sagen "Figuren". Das leuchtet auchallen ein."Auch, ja", antwortet der Lehrer vermutlich. "Aber woraus sind <strong>die</strong>se Figurengemacht? Es sind ganz allgemeine, grundlegende Dinge..."Jetzt beginnen <strong>die</strong> Schüler zu raten, bis sie <strong>auf</strong> vielleicht <strong>auf</strong> "Linien und Flächen" kommen.Enttäuscht müssen sie hören, dass Punkte, Geraden und Ebenen <strong>die</strong> Grundelementeder Geometrie sein sollen. Danach werden in rascher Folge Grundsätze und Definitioneneingeführt, <strong>die</strong> jeweils an Beispielen verdeutlicht werden.Zu <strong>die</strong>sem Zeitpunkt gibt es für <strong>die</strong> Schüler aber gar keine Erfahrungsgrundlage, <strong>die</strong> zurFestlegung der Grundelemente sowie der Grundsätze und Definitionen drängen würde.Erst wenn sie eine Vielfalt von Figuren konstruiert, ausgeschnitten, gefaltet, verglichenund so <strong>auf</strong> Eigenschaften und Gemeinsamkeiten untersucht hätten, würde eine solcheSystematisierung ihrer Erfahrungen einen Sinn für sie ergeben.D.h. <strong>die</strong> Fragen, <strong>die</strong> aus Schülersicht sinnvoll wären, werden ausgeblendet: Welche Figurenkönnt ihr zeichnen? Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen <strong>die</strong>sen Figuren? Was geschieht,wenn man Dreiecke an jeder Ecke so faltet, dass <strong>die</strong> Seiten genau übereinanderliegen? Und wenn sie den gemeinsamen Schnittpunkt der Winkelhalbierenden gefundenhaben: Ist es bei allen Dreiecken so, wirklich bei allen? Sind eure Zeichnungen und Ausschnitteauch genau, absolut präzise? Wie könnt ihr das prüfen?Aber eben <strong>die</strong>se kritische Analyse wird unterschlagen. Dem "Schüler wird das Resultatder Analyse vorgesetzt, und er darf zusehen, wie der Lehrer, der weiß, wo es hingeht, eszusammensetzt" (FREUDENTHAL 1974, Bd. 1, S. 100). Die Frage, wie man zu denGrundsätzen, Definitionen Sätzen und Beweisen gelangt, bleibt ein Geheimnis für ihn.Da er keinen Sinn darin erkennen kann, ist es <strong>die</strong> einzige Möglichkeit für ihn, zumindestdas, was abgefragt wird, auswendig, d.h. als Folge von Wörtern bzw. Operationen zuspeichern und für <strong>die</strong> Reproduktion bereitzuhalten. Am Beispiel der Behandlung derEuklidischen Axiome im Geometrieunterricht lässt sich, auch weil fast jeder noch einigeErinnerung daran hat, sehr schön verdeutlichen, wie <strong>die</strong> Schüler einfach auswendig ler-166
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTnen, weil ohne eigenes Probieren und damit ohne eigene Erfahrung keine Umgestaltungder bestehenden Vorstellungen möglich ist. Auswendig lernen bedeutet dabei, dass einerelativ sinnarme Folge von Wörtern und/ oder Operationen so gespeichert wird, dass siereproduzierbar ist.Die Ergebnisorientierung wird auch als "didaktische Inversion" bezeichnet, weil man beider Vermittlung eines Gegenstandes nicht bei seinen problemgeschichtlichen Anfängenansetzt, sondern am Ende des Erkenntnisprozesses. Dadurch wird auch der spannungsgeladeneProzess des Suchens, Ausprobierens, des Irrens und der erneuten Suche undschließlich des Erfolgs ausgeblendet. Wenn aber nicht von der Erfahrungsgrundlage derSchüler und den sich daraus ergebenden Problemen ausgegangen wird, verbindet sichweder das Gelernte mit <strong>die</strong>ser Erfahrungsgrundlage und ihren Umformungen, noch wirdein ausgeprägtes Problemlösungswissen erworben, das auch für <strong>die</strong> Lösung neuer Aufgabenverwendet werden kann.Weil aber nicht nur in der Mathematik und den Naturwissenschaften, sondern auch inallen anderen Fächern, <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se sinnarme Weise gelernt wird, bleiben bei vielen Schülernschon nach kurzem nur Versatzstücke, Formeln und Satztrümmer im Gedächtnis.Von einem tieferen Verständnis der Phänomene kann oftmals kaum <strong>die</strong> Rede sein (NOL-TE-FISCHER 1989, S. 220 ff.). 64 Solcherart sind <strong>die</strong> Lernergebnisse bei fast allen Unterrichtsgegenständen,ob es sich nun um Grammatik, Notenschrift oder das Wissen umden Aufbau einer Fuge handelt. Immer wenn Schüler mit fertigem Wissen konfrontiertwerden, das sie nur verstehen könnten, wenn sie wenigstens einen Teil der Schritte, einschließlichder Irrtümer, <strong>die</strong> erst zur Schaffung <strong>die</strong>ses „Wissens“ geführt haben, nachvollzogenbzw. selber gegangen wären. 65Das Alltagsverständnis von Lernen bedingt <strong>die</strong> ErgebnisorientierungIm Alltagsverständnis bedeutet Lernen einfach <strong>die</strong> Aufnahme von Wissensinhalten indas Gedächtnis. Im Rahmen <strong>die</strong>ser Alltagstheorie des Lernens wird Wissen als Werkzeugbetrachtet. Wie Werkzeuge in einem Schrank hält man das Wissen im Gedächtnis6465Vgl. ausführlich <strong>die</strong> Zusammenstellung der Befunde zur Wirksamkeit des naturwissenschaftlichenUnterrichts NOLTE-FISCHER 1989, S. 220 ff.Zum naturwissenschaftlichen Unterricht vgl. <strong>die</strong> Zusammenfassung der Ergebnisse bei NOLTE-FISCHER 1989, S. 220 ff., ferner WAGENSCHEIN 1970, S. 385-399. Zum Geschichtsunterricht vgl. BE-CKER/ HERKOMMER/ BERGMANN 1968; TESCHNER 1968.167
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbereit, um es später bei Gelegenheit wieder hervorzuholen und alle möglichen Aufgabendamit zu lösen oder Dinge zu bauen (LEHNER 1979, S. 85 ff.).Die Alltagstheorie des Lernens hat unsere Bildungsinstitutionen durchdrungen undgleichsam imprägniert. Die Schule hat das Wissen zu vermitteln, das in Lehrplänen oderBildungsstandards festlegt ist. Dieses Wissen wird für den Unterricht systematisch in<strong>auf</strong>einander bezogene Einheiten mit ihren jeweiligen Grundbegriffen oder Grundelementenund Regeln zerlegt und <strong>auf</strong>bereitet. Bei der Vermittlung versucht man in der Regeldurch einfache Beispiele einen allgemeinen Eindruck des zu Lernenden zu erzeugen.Dadurch sollen auch <strong>die</strong> relevanten Wissensbereiche der Schüler aktiviert werden. In<strong>auf</strong>einander bezogenen Schritten wird dann der Stoff mit Erläuterungen dargeboten undzum besseren Behalten durch <strong>die</strong> Ausführung einer Reihe von Übungs<strong>auf</strong>gaben gespeichertund auch <strong>auf</strong> neue Aufgaben angewandt. 66 Die grundlegenden Probleme und Fragen,<strong>die</strong> zu bestimmten Erkenntnissen geführt haben, spielen dabei kaum eine Rolle.Denn im ergebnisorientierten Unterricht geht es nicht um <strong>die</strong> Hintergründe, um das"Warum", sondern um <strong>die</strong> schnelle und effektive Vermittlung der Ergebnisse kanonisierterwissenschaftlicher Ergebnisse. Die Aufgabe der Schüler ist es, den Stoff zu behaltenund in der Prüfung zu reproduzieren.Geringe Leistungen durch ErgebnisorientierungAls wichtigste Folgen des ergebnisorientierten Unterrichts sind das häufig unzureichendeVerständnis der Lerngegenstände, das deswegen schnelle Vergessen und <strong>die</strong> Beschränkungdes Erwerbs von Problemlösefähigkeiten zu nennen. Klagen über bloßeWissensanhäufung in den Köpfen und das mangelnde Verständnis der Schüler werdeninsbesondere von Naturwissenschaftlern häufiger vorgebracht. So meinte schon MACH(1923, S. 344 f.): "Ich kenne nichts Schrecklicheres als <strong>die</strong> armen Menschen, <strong>die</strong> zuvielgelernt haben. Statt des gesunden kräftigen Urteils, welches sich vielleicht eingestellthätte, wenn sie nichts gelernt hätten, schleichen ihre Gedanken ängstlich und hypnotischeinigen Worten, Sätzen und Formeln nach, immer <strong>auf</strong> denselben Wegen. Was sie besitzen,ist ein Spinnengewebe von Gedanken, zu schwach, um sich dar<strong>auf</strong> zu stützen, aberkompliziert genug, um zu verwirren ... Ich wäre zufrieden, wenn jeder ... einige wenigemathematische oder naturwissenschaftliche Entdeckungen sozusagen miterlebt und inihre weiteren Konsequenzen verfolgt hätte."66Eine didaktisch geschickte Strategie bieten auch GRELL/ GRELL 1979, S. 103 ff.168
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTEine weitere Folge ergebnisorientierten Unterrichts ist <strong>die</strong> Entstehung großer Leistungsdifferenzen.Vor allem <strong>die</strong> in einem Fach leistungsschwächeren Schüler verfügen nurüber begrenzte Möglichkeiten, den dargebotenen Unterrichtsstoff im Rahmen der eigenenWissensstrukturen zu interpretieren. Weil sie nur wenig verstehen, erleben sie Inkompetenzgefühle.Die erfahrene Inkompetenz kann zu Unmut führen. Bei Häufung derInkompetenzerlebnisse geraten <strong>die</strong>se Schüler letztlich in einen Misserfolgszirkel. Diesich dadurch <strong>auf</strong>stauende Frustration macht Disziplinprobleme wahrscheinlich. Aufgrundder erlebten Selbstwertbedrohung verhalten sich Schüler nicht mehr erwartungskonform.Sie können beispielsweise versuchen, <strong>die</strong> nötigen Erklärungen von Mitschülernzu erhalten, sie können aber auch aggressiv reagieren, am Ende sogar resignierenund <strong>die</strong> Beteiligung am Unterricht weitgehend einstellen.Aber auch leistungsfähige Schüler werden in ihren Möglichkeiten beschränkt. Weil sie<strong>die</strong> Zusammenhänge an der Oberfläche schnell verstehen und <strong>die</strong>ses Verständnis für <strong>die</strong>Prüfungen ausreicht, stellen sie weitergehende Fragen dann auch kaum. Nur wem esgelingt durch zusätzliche Anregungen, seien es Gespräche mit Eltern, Filme oder populärwissenschaftlicheBücher, <strong>die</strong> Gegenstände selbst zu untersuchen und sie dadurchimmer wieder mit den eigenen Vorstellungen zu vergleichen und letztere dadurch anzupassenund zu korrigieren, wird trotz ergebnisorientierten Unterrichts ein differenziertesund tief schürfendes Wissen gewinnen. Diese Schüler können dann Pläne oder Handlungsmöglichkeitenfür sich erkennen und Interessen entwickeln. Mit wachsender Einsichtin <strong>die</strong> Zusammenhänge bringen sie immer mehr Arbeit für <strong>die</strong> Gegenstände ihresInteresses <strong>auf</strong>.Das breite Mittelfeld der Schüler wird vermutlich nur lernen, <strong>auf</strong> mehr oder wenigerclevere Weise befriedigende Leistungen im vorgegebenen Rahmen zu erbringen. Dafürsprechen <strong>die</strong> zahlreichen Befunde, nach denen das Verständnis naturwissenschaftlicherPhänomene bei der Mehrheit der Schüler von mechanisch angewandtem und häufigfalsch reproduziertem Formelwissen geprägt ist (vgl. dazu FISCHER-NOLTE 1989).Das falsche Ideal der FehlervermeidungWenn nach der ergebnisorientierten Auffassung jede Abweichung vom Standard odereiner bestimmten Lehrmeinung als Fehler zu interpretieren ist, bedeutet das für denSchüler, dass er den Stoff solange nicht richtig beherrscht, als er <strong>auf</strong> Fragen dazu keinevollkommen oder wenigstens nahezu vollkommen fehlerfreien Antworten geben kann.169
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAußerdem lässt sich feststellen, in welchem Grade etwas perfekt gelernt worden ist. Derfeststehende Lehrstoff gilt demnach als sicherer und im Grunde undiskutierbarer Maßstab,und es entsteht eine Art Ideal der Fehlerfreiheit bzw. der Fehlervermeidung.Um bei Schülern eine möglichst gute Beherrschung des Wissens zu gewährleisten, wirdes als sinnvoll betrachtet, den Stand ihrer Wissensaneignung zu kontrollieren, weil mandann gegebenenfalls gezielt eingreifen und rechtzeitig Korrekturen vornehmen kann.Daraus folgt, dass <strong>die</strong> Möglichkeiten von Schülern, selbständig Entdeckungen zu machenals wenig sinnvoll betrachtet werden, weil sie dann sehr viele unnötige Fehler machenwürden. Im Sinne des Ideals der Fehlervermeidung erscheint es vielmehr bedeutsam,bei Abweichungen vom Standard sofort zu korrigieren. Das ist für viele Schülermit starken Frustrationen verbunden. Nicht wenige verlieren <strong>die</strong> Lust an den Bereichen,in denen sie „Fehler“ machen und geben <strong>auf</strong>, statt im freien Umgang mit den Dingenihre Talente zu entdecken und zu entfalten.Allerdings kann <strong>die</strong> Ergebnisorientierung auch eine Art pervertierter Befriedigung gewähren.Hat man erst einmal <strong>die</strong> der Ergebnisorientierung zugrunde liegenden Überzeugungenangenommen, dann bietet sie ein fest gefügtes Weltbild, an das man sich haltenkann. Als Lehrer und Vorgesetzter gewinnt man zudem eine gewisse Macht, <strong>die</strong> in derKontrolle oder Überwachung der „Unwissenden“ besteht.Auslese / WettbewerbDie <strong>Institution</strong>alisierung der Leistungsauslese ist besonders problematisch, weil dadurch<strong>die</strong> Aufgaben der Schule schwerpunktmäßig <strong>auf</strong> das Lehren und Zensieren festgelegtwerden. Die Aufgabe des Leistungsvergleichs erfordert eine Organisation, <strong>die</strong> das Lernenim Gleichschritt und damit <strong>die</strong> Lenkung des Unterrichts durch den Lehrer, <strong>die</strong> Orientierungan den Vorgaben des Lehrplans oder den Erfordernissen der Bildungsstandardsbedingen. Weitere Folgen sind regelmäßige Klausuren, Notenkonferenzen, Zeugnissemit ihren Konsequenzen für Versetzungen usw. Das allgemeine Bild von Schuleund Unterricht ist – und zwar überall <strong>auf</strong> der Welt – entscheidend durch <strong>die</strong>se Faktorengeprägt. Die Bewertung der Ergebnisse des Lernens soll nach allgemeiner Auffassung zuhohen Leistungen stimulieren und der Auswahl der Besten <strong>die</strong>nen, was aber nicht wirklichfunktioniert – wie weiter unten noch ausgeführt werden wird. Tatsächlich ist derGrundsatz des Leistungsvergleichs ein Kennzeichen von Schulen, <strong>die</strong> gerade keine überragendenLeistungen erbringen.170
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLeistungsvergleiche suggerieren Lehrern, Schülern, Eltern und der Öffentlichkeit zumeist,Wettbewerb sei das geeignetste Mittel zum Erfolg. Wettbewerbsgesellschaftenseien schließlich am erfolgreichsten. Das ist aber ganz offensichtlich eine kurzschlüssigeAuffassung. Denn <strong>die</strong> Auswahl von jungen Menschen in der Schule ist nicht vergleichbarmit der Auswahl der besten Mitarbeiter beispielsweise für ein Unternehmen. Währendich im Unternehmen wirklich nur <strong>die</strong> „Besten“ behalte, verbleiben beim Auswahlprozessin der Schule <strong>die</strong> Erfolglosen weiterhin sowohl in der Schule. Auch wenn <strong>die</strong>Schule den schlechtesten Schülern jedes Jahr bestätigt, dass sie unfähig sind, ist es unmöglich<strong>die</strong>se jungen Menschen aus der Gesellschaft auszuscheiden. Der Wettbewerbkann allerdings ein Mittel sein, um im Hinblick <strong>auf</strong> bestimmte Kriterien erfolgreichereSchulsysteme von weniger erfolgreichen zu unterscheiden, wie das derzeit beispielsweisedurch <strong>die</strong> internationalen Untersuchungen von Schulen und Schülerleistungen durch<strong>die</strong> OECD geschieht. Und dabei zeigt sich, dass jene Systeme erfolgreicher sind, <strong>die</strong>dem Prinzip der Leistungsauslese weniger Bedeutung beimessen.Allerdings sind <strong>die</strong> Unterschiede zwischen den Schulen verschiedener Nationen bei weitemnicht so groß, wie es in den Me<strong>die</strong>n den Anschein hat. Das liegt vor allem daran,dass <strong>die</strong> Schulsysteme aller Länder sich immer noch stark ähneln. Trotz aller äußerlichenUnterschiede ähneln sich <strong>die</strong> Schulsysteme fast aller Nationen. Fast überall sind <strong>die</strong>Kriterien der Unterrichtslenkung durch den Lehrer, <strong>die</strong> Orientierung an Lehrplänen oderBildungsstandards und ständige Leistungsvergleiche der Schüler untereinander anzutreffen.Erst allmählich und in wenigen Staaten beginnt ein Prozess des Umdenkens.Nach wie vor sind <strong>die</strong> Schulsysteme der meisten Nationen nach dem Muster des zu seinerZeit so erfolgreichen staatlichen Schulsystems, das WILHELM V. HUMBOLDT (1957,S. 21 ff.) in Preußen <strong>auf</strong>gebaut hat, organisiert. Dabei hatte sich Humboldt zunächst entschiedengegen ein öffentliches Schulwesen gewandt, weil es „<strong>die</strong> Mannigfaltigkeit derAusbildung hindert“ und weil es unnütz sei, da es einer freien Nation „an guter Privaterziehungnicht fehlen wird“. Öffentliche Erziehung schien Humboldt daher „ganz außerhalbder Schranken zu liegen, in welchen der Staat seine Wirksamkeit halten muss.“ 67Aber <strong>auf</strong>grund der Schwierigkeiten Preußens während der Napoleonischen Kriege undder Erfordernisse der Landesverteidigung hat er <strong>die</strong>sen Standpunkt dann zugunsten einesstarken, organisierten Staates mit einem hoheitlich gelenkten Schulwesen, <strong>auf</strong>gegeben.67WILHELM VON HUMBOLDT: Ideen zu einem Versuch, <strong>die</strong> Grenzen der Wirksamkeit des Staates zubestimmen. In: Wilhelm von Humboldt. Auswahl und Einleitung von Heinrich Weinstock, Frankfurt:Fischer TB 1957, S.21 ff.171
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLeistungswettbewerb schädigt <strong>die</strong> PsycheDie schulische Leistungsbewertung erfolgt anhand der Leistungen bei gleichen Aufgaben.Dabei wird der Einzelne in der Regel im Vergleich zur Klassennorm (in manchenLändern auch zur Jahrgangsnorm) bewertet. Die Aufgaben sollen dabei einen Schwierigkeitsgrad<strong>auf</strong>weisen, bei dem nur sehr wenige Schüler fehlerfreie Leistungen erzielenund auch nur sehr wenige Schüler versagen. Das Ergebnis soll also einer statistischenNormalverteilung nahe kommen, d.h. es gibt immer eine Menge mittelmäßiger Leistungen,einen kleinen Teil guter und sehr guter sowie einen weiteren kleinen Teil schlechterund sehr schlechter Leistungen.Da es bei gruppennormbezogener Leistungsmessung immer nur um <strong>die</strong> Position einesSchülers innerhalb <strong>die</strong>ser Verteilung gehen kann, bedeutet der Wettbewerb um Noten fürviele Schüler einen hohen Leistungsdruck, bei dem der Einzelne in Konkurrenz zu seinenMitschülern steht. Wem es gelingt, einen besseren Platz einzunehmen, verdrängtdamit notwendig einen anderen. Erfolg "ist immer nur <strong>auf</strong> Kosten anderer zu erreichen,... man kann immer nur gewinnen, wenn andere verlieren" (FEND U.A. 1976, S. 186).Man kann nun – wie man es ja auch oft hört – argumentieren, dass <strong>die</strong>s doch <strong>die</strong> idealeVorbereitung <strong>auf</strong> das Leben in der Konkurrenzgesellschaft sei. Die Schüler würden darangewöhnt, dass sie Leistungen zu erbringen hätten, andernfalls würden sie sich garnicht anstrengen. Wenn das zuträfe, dann müssten Schüler von Montessori- oder Jena-Plan-Schulen, in denen keine Noten vergeben werden, leistungsscheu oder zumindestweniger gut an das Leben in der Konkurrenzgesellschaft angepasst sein. Das ist abernicht der Fall. Abgänger <strong>die</strong>ser Schulen sind offenbar nicht weniger lebenstüchtig alsSchüler, <strong>die</strong> schon früh Leistungs- und Konkurrenzdruck in der Schule erlebt haben68 .Darüber hinaus haben Leistungsbewertungen und –vergleiche aber noch eine Reiheanderer, überaus ungünstiger Nebenwirkungen.Die Traumatisierung schwacher SchülerEine Wirkung des schulischen Leistungswettbewerbs ist, dass das Selbstwertgefühl derschlechteren Schüler sinkt. Diese Schüler bemerken bald, dass <strong>auf</strong>grund des Systems amEnde doch immer <strong>die</strong> gleiche Verteilung in gute und schlechte Schüler herauskommenmuss. Sind sie in den ersten Schuljahren noch überzeugt, dass gute Leistungen durchAnstrengung zu erzielen sind, gehen sie spätestens ab der fünften Klasse davon aus, dass68Vgl. hierzu <strong>die</strong> grundlegenden Erörterungen von LEWIN 1931.172
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTeher externe und interne Faktoren, <strong>die</strong> von ihnen nicht beeinflusst werden können, wieGlück, Begabung oder Intelligenz, dafür verantwortlich sind (vgl. RIES 1991).Dieses Wissen beeinflusst das Selbstwertgefühl der Schüler negativ (vgl. COVINGTON1984; HARTER 1987). Es zerstört - wie BLOOM (1968, S. 1) ausführt - "systematisch dasIch und das Selbstkonzept einer relativ großen Gruppe von Schülern, ... <strong>die</strong> <strong>die</strong> Schuleunter Bedingungen besuchen, <strong>die</strong> für sie enttäuschend und demütigend sind. Die Kosteneines solchen Systems sind sehr hoch; sie liegen in einer Verminderung der Bereitschaftfür späteres Lernen" und in der Beeinträchtigung oder Gefährdung der psychischen Gesundheit(vgl. BLOOM 1976, S. 157 ff. ähnlich BERRY 1990; NICHOLLS 1990; HOLLER/HURRELMANN 1991).Die Erfolglosigkeit der "schlechten" Schüler erzeugt und stärkt Unterlegenheitsgefühleund führt zu Angst vor Misserfolg. Um weitere Misserfolgserlebnisse zu vermeiden,strengen manche der Schüler sich zunehmend weniger an. Denn würden sie sich anstrengenohne am Ende erfolgreich zu sein, dann müssten sie ihrer Ansicht nach ja eingestehen,dass ihr Misserfolg durch mangelnde Fähigkeiten verursacht wäre. Misserfolgeohne Anstrengung sind weit weniger bedrohlich für ihr Selbstwertgefühl, denn immerhinhätten sie sich ja anstrengen können. In der Folge jedoch sinken <strong>die</strong> Leistungensolcher Schüler zunehmend, sie geraten in einen Misserfolgsstrudel, und das führt zusteigender Unzufriedenheit (vgl. AMES 1981, 1984; SCHUCH 1982).Die Lage des "Schulversagers" ist nahezu aussichtslos. Niemand erwartet mehr, dass erzu etwas fähig ist. Er wird von anderen abgewertet, und er wertet sich selber ab. Er verliert<strong>die</strong> Lust am Lernen und an der Mitarbeit (vgl. HÖHN 1980). Wenn der schulischeLeistungsvergleich zu einer subjektiv starken sozialen Abwertung leistungsschwächererSchüler führt und wenn <strong>die</strong>se Schüler in einem Elternhaus leben, das ihnen keinen Ausgleichund keine Hilfe bietet, sondern <strong>die</strong> Abwertung eher noch verstärkt, werden <strong>die</strong>seSchüler nicht selten in eine Randgruppenposition gedrängt (vgl. MILLER 1956; RICK1961).Hilflosigkeit und LageorientierungHoher Leistungs- und Konkurrenzdruck stellt immer eine Bedrohung des Selbstwertsdar. Schließlich kann jeder einmal verlieren. Und nicht wenige verlieren notgedrungen.Diese Schüler haben das Gefühl, durch eigene Anstrengung nichts bewirken zu könnenund von den Umständen bestimmt zu werden. Im Unterricht sind sie daher kaum motiviert.So werden sie leicht zu Problemfällen und verlieren ihre Handlungsorientierung173
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFToder eine bereits bestehende Lageorientierung wird noch weiter verstärkt. Sie werdenaber nicht nur hilflos gegenüber der konkreten schulischen Situation, <strong>die</strong> sie nicht zuändern vermögen, sondern <strong>die</strong>se erlernte Hilflosigkeit weitet sich aus <strong>auf</strong> andere Situationen(vgl. SELIGMAN 1975). In gewisser Weise kann man sogar sagen, dass das schulischeLeistungssystem viele Schüler lebensuntüchtig macht.Denn wenn Schüler in Wettbewerbssituationen versagen, fragen sie weniger, wie sie esanders machen könnten, sondern eher, ob sie unfähig sind oder warum immer sie solchesPech haben. Sie fühlen sich unwohl, geben leicht <strong>auf</strong> oder reagieren passiv und mit Ü-berlegungen zu ihrer Lage, statt sich mit Handlungsmöglichkeiten zu befassen (vgl. EL-LIOT / DWECK 1988; NICHOLLS 1983, S. 216).Diese Einstellung wird noch dadurch verstärkt, weil Schüler unter Wettbewerbsbedingungenungern um Hilfe fragen. Denn um Hilfe fragen bedeutet, dass sie nicht wirklichgut sind. Wenn Lehrer oder Mitschüler ihnen helfen, hat <strong>die</strong>s den gleichen Effekt; sieempfinden sich dann in höherem Maß als weniger fähig, weil offensichtlich wird, dasssie <strong>auf</strong> Hilfe angewiesen sind. Täuschung erscheint dagegen als ein akzeptableres Mittel(vgl. NICHOLLS 1983). Letztlich glauben solche Schüler dann nicht mehr daran, dass sieselbst etwas an ihrer Lage ändern können. Sie verstricken sich in Gedanken über ihrimmerwährendes Pech, ihr Unglück und alle eigenen Handlungsmöglichkeiten zerrinnen(vgl. KUHL 1984).Förderung negativer CharaktereigenschaftenDie Einstufung der Schüler in verschiedene Intelligenz- oder Fähigkeitsgrade regt inhohem Maße zu Vergleichen hinsichtlich der eigenen sozialen Lage an: "Ich bin besserals der und der", "ich bin schlechter als ...", "ich bin so gut wie ..." usw. Die Schüler sehen<strong>auf</strong> sich selbst, sie sind oder werden in hohem Maße Ego-orientiert. Bei Ego-Orientierung wird Wissen insbesondere von den guten Schülern als Mittel betrachtet, mitdem man sich als klug darstellen, Macht ausüben oder vermeiden kann, dass man alsdumm gelten könnte. Die Aufmerksamkeit ist mehr <strong>auf</strong> das eigene Ich als <strong>auf</strong> den Lerngegenstandgerichtet (vgl. NICHOLLS 1983).Dabei wird Erfolg dann <strong>auf</strong> gute Befähigung oder Begabung und Misserfolg <strong>auf</strong> Dummheitoder mangelnde Begabung zurückgeführt. Also kommt es dar<strong>auf</strong> an, zu zeigen, dassman besser ist, dass man andere übertrifft und sie mit seiner Begabung "schlagen" kann(vgl. NICHOLLS 1990, S. 38).174
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAndere Nebenwirkungen bestehen darin, dass jeder vor allem den eigenen Vorteil imAuge hat und <strong>die</strong> Bereitschaft zur Kooperation abnimmt. Es entstehen Neid <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Leistungender Besseren und Abschätzigkeit gegenüber schwächeren Schülern.Ego-Orientierung statt Sach-OrientierungWeil schulische Wettbewerbssituationen Belohnungen und Bedrohungen in komplexerVernetzung implizieren, werden <strong>die</strong> Empfindungen und Überlegungen der Schüler <strong>auf</strong>Vor- und Nachteile ihrer Handlungen gelenkt. Nicht so sehr <strong>die</strong> Gegenstände des Lernens,sondern vor allem das Ego des Schülers steht im Mittelpunkt. Aus der Sicht desego-orientierten Schülers ist Schule eine <strong>Institution</strong>, "in der ich im Vergleich mit anderenbeurteilt werde". Im Unterricht, vor dem Lehrer, den Mitschülern geht es darum,"dass ich eine gute Figur mache, dass ich nicht als unfähig erscheine" usw. Indem WettbewerbssituationenSelbstbewertungen induzieren, stärken sie <strong>die</strong> Ego-Orientierung(vgl. NICHOLLS 1983, S. 215, AMES / FELKNER 1979.).Bei Schülern, für <strong>die</strong> Wettbewerbssituationen Bedrohungen darstellen, haben ego-orientierteSchutzmechanismen zur Erhaltung des Selbstwertgefühls langfristig negative Effekte.An <strong>die</strong> Stelle des Sachinteresses treten Ich-Orientierung und Anstrengungs-Vermeidungs-Orientierung. Auch wenn den Schülern klar ist, welche große Bedeutung<strong>die</strong> Noten für ihr weiteres Leben haben, möchten sie <strong>die</strong> Schule mit wenig möglichstwenig Aufwand hinter sich bringen, weil sie das, was sie dort lernen müssen, einfachnicht interessiert. Tatsächlich würden sie gern nützliche Dinge lernen und ihre Leistungenverbessern (vgl. ECKERLE/ KRAAK 1993, S. 37), aber unter den gegebenen schulischenBedingungen schaffen sie das einfach nicht und verschieben daher alles <strong>auf</strong> <strong>die</strong>Zukunft. Dennoch sind sie überzeugt, eigentlich mehr leisten zu können, wenn sie nurwollten (vgl. ECKERLE/ KRAAK 1993, S. 139). Sie wollen also durchaus lernen, aber derKonkurrenzkampf raubt den meisten <strong>die</strong> Kraft und das Interesse.Charakterbildung bei leistungsfähigen SchülernEs ist nun aber nicht so, dass nur <strong>die</strong> schwachen Schüler unter Wettbewerbsbedingungenleiden. Die „guten“ Schüler werden ebenfalls beeinträchtigt, wenn auch weniger in ihrenLeistungen. Zwar behalten sie <strong>auf</strong>grund ihrer Erfolgserlebnisse <strong>die</strong> handlungsorientierteGrundhaltung, aber da auch sie unter Wettbewerbsbedingungen immer scheitern können,immer auch einmal als Verlierer dastehen können, meiden sie jedes Risiko, suchen sieden Erfolg, d.h. <strong>die</strong> Belohnung an sich, unabhängig vom Gegenstand oder ihrem Interesse.Dabei verlieren sie sich selbst, ihre Interessen und ureigensten Ziele. Es geht ihnen175
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTmehr als alles andere darum, besser als andere zu sein und Anerkennung für Leistungenzu erhalten. Die Arbeit an der Sache verliert ihren intrinsischen Wert. Dafür gewinnenäußere Werte wie Erfolg und damit verknüpfte Konsequenzen wie Anerkennung undGratifikationen immer mehr an Bedeutung (vgl. Nicholls 1983).Solche Dispositionen tragen nicht nur in der Schule, sondern auch später im Berufslebenzur Entstehung von Konflikten bei und erschweren <strong>die</strong> ernsthafte Diskussion von Sachfragen.Vor allem muss es doch bedenklich sein, wenn Menschen ihre größte Befriedigungin Erfolgen finden und den Inhalt oder Zusammenhang, in dem <strong>die</strong>se Erfolge gewonnenwerden, nicht weiter wichtig erscheinen. Wer sich selbst verliert und nur nochdar<strong>auf</strong> aus ist, Aufgaben effizient auszuführen und dabei im Wesentlichen von der Hoffnung<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Verbesserung seiner Position geleitet wird, wird sich am Ende für ziemlichbeliebige Zwecke einspannen lassen.So gewinnen Schüler unter den üblichen schulischen Bedingungen des Leistungswettbewerbsein Weltbild, in dem andere als potentielle Konkurrenten betrachtet werden, mitdenen Kooperation nicht gesucht wird. Man kann Freunde in der Schule haben, aberman kann nicht einfach füreinander da sein und sich helfen. Die Frage nach Zusammenarbeitmit anderen Schülern stößt <strong>auf</strong> eine reservierte Haltung, ebenso wie <strong>die</strong> Frage, obman Anerkennung von ihnen erwarte. "Die Frage nach der Zusammenarbeit scheint soerlebt zu werden, als ob in <strong>die</strong> persönlichen Beziehungen der Schüler gleichsam verunreinigendschulische Beimischungen eingetragen würden." Zusammenarbeit ist für <strong>die</strong>Schüler "kein Wert, der sich aus schulischen Situationen ergibt" (ECKERLE/ KRAAK1993, S. 136). Man ist zusammen mit Freunden und man arbeitet auch mit ihnen. SolcheFreundschaftsbeziehungen entstehen durchaus in der Schule, aber das hat nichts mit geforderterKooperation zu tun. Kooperation ist für <strong>die</strong> Schüler nur <strong>auf</strong> einer freundschaftlichenGrundlage möglich. Schulische Kooperation dagegen ist für sie ein Widerspruchin sich selbst, denn in der Schule geht es um Wettbewerb, nicht um Zusammenarbeit.Nur Freunde tragen zur Erhaltung des Selbstwerts bei, von ihnen hat man nichts zu befürchten.Man versucht jedes Risiko einer Abwertung des Selbst zu begegnen. Deshalbkann auch nur <strong>die</strong> Anerkennung von Freunden zählen und nicht <strong>die</strong> irgendwelcher Mitschüler(vgl. ECKERLE/ KRAAK 1993, S. 137).Wettbewerb, das bedeutet für <strong>die</strong> Schüler, dass sie ihren Weg in einer im Grunde feindlichenWelt gehen müssen, dass sie sich behaupten und durchsetzen müssen. Nicht nur<strong>die</strong> Schule ist so organisiert, sondern alle gesellschaftlichen <strong>Institution</strong>en. Der Rückzug176
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTins Private <strong>auf</strong> eher als gesichert betrachtete Positionen liegt da nahe. Im begrenztenBereich der Familie und Freunde glaubt man sich am sichersten. Situationen in <strong>die</strong>senBereichen glaubt man am ehesten so bewältigen zu können, dass <strong>die</strong> Erhaltung desSelbstwerts gesichert ist. "Freunde haben" und "ein gutes Zusammenleben in der Familie"stellen für <strong>die</strong> Schüler denn auch <strong>die</strong> höchsten Werte dar (vgl. ECKERLE/KRAAK1993, S. 69). So gesehen, kann es kaum verwundern, wenn <strong>die</strong> Schüler "Menschlichkeitin unserer Gesellschaft" nur in geringem Maß für gegeben halten und sie nicht mehrglauben, dass <strong>die</strong> Zukunft eine Besserung bringt (vgl. ECKERLE/KRAAK 1993, S. 71 f.)Lehrer-Schüler-InteraktionDie Lehrer- Schüler-Beziehung wird durch gegenseitige Erwartungen geformt und verändert.Dabei prägen <strong>die</strong> institutionellen Rahmenbedingungen, <strong>die</strong> eher Verwaltungs- alspädagogische Gesichtspunkte betonen, <strong>die</strong>se Erwartungen in hohem Maße mit. Spätestensab der Mittelstufe scheinen Schüler staatlicher Regelschulen <strong>die</strong> Vermittlung fertigerWissensinhalte zu bevorzugen. Lehrer, <strong>die</strong> dazu "<strong>auf</strong>fordern 'darüber nachzudenken'oder etwas 'selbst herauszufinden'" gelten als unbeliebt. Die Lehrer ihrerseits "zeigen einAusweichen des Pädagogen <strong>auf</strong> das Feld des Fachwissenschaftlers, dem allein durchWissensüberlegenheit auch <strong>die</strong> Entscheidungsmacht über Unterrichtsinhalt und -formzuwachsen muß" (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 142).Weil große Anstrengungen unter Wettbewerbsbedingungen eher als Hinweis <strong>auf</strong> ehergeringe Fähigkeit gewertet werden, erzeugt es eher Unzufriedenheit bei Schülern, wennLehrer fordern, dass sie hart arbeiten sollen, um etwas zu können oder zu verstehen (vgl.AMES 1978; 1981; AMES / AMES 1978; AMES / AMES / FELKNER 1977). Letztlich kommtes dann doch nur dar<strong>auf</strong> an, ein irgendwie ein akzeptables Ergebnis vorzuweisen. Schüler,<strong>die</strong> irgendwann angefangen haben, sich <strong>auf</strong> auswendig gelernte Antworten zu verlassen,werden dadurch am Ende immer unfähiger, Zusammenhänge zu verstehen, und ihreLeistungen verschlechtern sich rapide (vgl. NOLEN 1988). Wenn der Lehrer dar<strong>auf</strong>hinnur geringer Leistungen von <strong>die</strong>sen Schülern erwartet, wird er sie mit einfachen Aufgabenund eindeutigen Lösungs-Schemata konfrontieren, <strong>die</strong> <strong>die</strong>se Schüler noch stärker zureproduktivem Lernen verleiten. Außerdem tragen genaue Anweisungen, wie Aufgabenzu lösen sind, zu unselbständigem Lernen bei. Die Schüler verlassen sich dann stärker<strong>auf</strong> den Lehrer als selbst Strategien zu entwickeln und zu erproben (vgl. CORNO/ ROHR-KEMPER 1985)177
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWettbewerb um Noten als DisziplinierungsmittelDer Leistungswettbewerb <strong>die</strong>nt der Selektion und damit der Zuteilung von Lebenschancen(SCHELSKY 1957). Diese Funktion erkennen <strong>die</strong> Schüler bereits früh, schon weil <strong>die</strong>Eltern in aller Regel großen Wert <strong>auf</strong> gute Noten legen. „Wenn du schlechte Noten hast,wird auch im Leben nichts aus dir“, heißt es dann. Wegen <strong>die</strong>ses Drucks erscheinen Notenals probates Mittel der Disziplinierung. Man kann den Schüler damit sozusagen "in<strong>die</strong> Zange nehmen". Der eine Hebel besteht in der Hoffnung <strong>auf</strong> gute Noten, der anderein der Furcht vor schlechten Noten bzw. in der Versagung guter Noten.Wenn der Wettbewerb um Noten, d.h. einerseits <strong>die</strong> Furcht vor schlechten und andererseits<strong>die</strong> Hoffnung <strong>auf</strong> gute Noten, der Disziplinierung der Schüler <strong>die</strong>nt, dann tangieren<strong>die</strong> dadurch ausgelösten Erwartungen den Selbstwert der Schülers ganz zentral. Undzwar nicht nur innerhalb der Unterrichtssituation, sondern auch für <strong>die</strong> Beziehung zu denEltern und für <strong>die</strong> Zukunft des Schülers. Kommen weitere erschwerende Faktoren wieein stark kontrollierender, <strong>die</strong> Schülerinteressen vernachlässigender oder chaotischerUnterricht und weitgehende Ergebnisorientierung hinzu, wird das Klima der Klasse,wenn nicht der ganzen Schule äußert negativ beeinflusst (vgl. JERUSALEM/SCHWARZER1991, S. 121 ff.). Als Folge des negativen Klassenklimas fühlen sich weder Schüler nochLehrer in der Schule wirklich wohl (vgl. VIERLINGER1990, S. 53 f.). Die Lernbereitschaftund Disziplin eines großen Teils der Schüler entwickelt sich dadurch eher ungünstig,und statt konstruktiver Mitarbeit kann sich eine destruktive Haltung ausbreiten.Schüler können sich durch Störungen des Unterrichts für ihr verletztes Selbstwertgefühlam Lehrer zu "rächen" suchen. Um aber unangenehme Konsequenzen zu umgehen, lasseninsbesondere schwache Schüler ihren Unmut nicht selten gerade an den Lehrern aus,<strong>die</strong> ihnen wohl gesonnen sind. Oder sie suchen sich heimlich durch Zerstörung von Gegenständen(Vandalismus) in und außerhalb der Schule Genugtuung zu verschaffen,oder indem sie Gruppen beitreten, <strong>die</strong> genauso verpönt sind sich ebenfalls abgelehnt undausgeschlossen fühlen. Manche werden auch in Drogen ausweichen, <strong>die</strong> ein stressfreies,nicht selbstwertbedrohtes Rückzugsgebiet zu bieten scheinen. So wird ein Teil der Schüler,<strong>die</strong> ja durchaus etwas hätte leisten können und leisten wollen, an den Rand der Gesellschaftgedrängt.Es ist aber durchaus möglich, solche Konsequenzen zu vermeiden, indem man <strong>die</strong> Schüler<strong>auf</strong> den Gebieten fördert, für <strong>die</strong> sie ein gewisses Interesse <strong>auf</strong>bringen. In <strong>die</strong>sem Fallstünden <strong>die</strong> Schüler kaum in Konkurrenz zueinander, und sie könnten kooperieren, umsich gegenseitig fit zu machen für das Leben, um Nischen zu finden und für Wettkämpfe178
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTgut gerüstet zu sein. Auch wenn es natürlich immer Leistungsunterschiede gibt, ist esdoch etwas anderes, ob man frühzeitig im Hinblick <strong>auf</strong> einen schmalen Ausschnitt vonFähigkeiten Auslese betreibt, oder ob man individuelle Fähigkeitsprofile und Interessenanerkennt und fördert. Die dabei zu erreichenden Leistungen übertreffen jene, <strong>die</strong> unterAuslesebedingungen entstehen, bei weitem.Wie <strong>die</strong> Schüler sich selber helfenDas übergeordnete Ziel jeden Schülers ist der Erhalt seines Selbstwerts. Das ist einerseitsdurch Zugehörigkeit zur Gruppe und andererseits durch Selbständigkeit möglich.Von daher ist es verständlich, wenn <strong>die</strong> Schüler im Interesse der Zugehörigkeit zu ihrerGruppe versuchen, jeden der nicht ohnehin schon außerhalb der Gruppe steht, das Gesichtwahren zu lassen. Das bedeutet keineswegs, dass innerhalb der Klasse enge oderfreundschaftliche Beziehungen bestehen müssten. Aber wenn <strong>die</strong> Schüler im Wesentlichenam eigenen Durchkommen interessiert sind, und dazu gehört ein erträglichesSelbstwertgefühl, ist es einfacher, wenn man offene Gegnerschaft bzw. offenen Wettbewerbvermeidet. Denn das würde für <strong>die</strong> meisten Nachteile mit sich bringen. Gute Schülerwürden sich womöglich einer breiten Front von Schwächeren gegenübersehen, <strong>die</strong>mit unfairen Mitteln versuchen könnten, sie unter Druck zu setzen. Schlechte Schülerdagegen würden offen <strong>auf</strong> ihr Versagen <strong>auf</strong>merksam gemacht und abgewertet.Um das Klima nicht noch weiter zu verschlechtern, ist es für gute Schüler vorteilhafter,sich so darzustellen, als wäre es ihnen nicht besonders wichtig, dass sie besser sind. Auf<strong>die</strong>se Weise können sie ihre Beliebtheit bei anderen sogar noch steigern. SchlechtereSchüler haben es schwerer. Sie können ihre Schwächen überspielen, indem sie sagen, sieseinen "völlig unvorbereitet" gewesen, oder indem sie sich so schwierige Aufgaben wählen,dass ohnehin nicht zu erwarten ist, dass sie sie lösen. Sie können auch vorgeben, fürihre Zukunftspläne keine besseren Noten zu brauchen, d.h. sie können ihren Selbstwerterhalten, indem sie sich als besonders unabhängig und selbständig geben. Sie könnenaber auch andere, von ihnen selbst nicht beeinflussbare Faktoren wie Pech oder Unbeliebtheitbeim Lehrers anführen und sich möglichst cool geben (vgl. ECKERLE / KRAAK1993, S. 79 ff.).Perverse PolitikEin wettbewerbsorientiertes, gegliedertes und abgestufte Berechtigungen vergebendesSchulsystem hat SCHELSKY (1957, S. 18 ff.) als "Zuteilungsapparatur von Lebenschancen"beschrieben. Als Kriterium <strong>die</strong>nt der Leistungsvergleich bei vorgegebenen179
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAufgaben. In <strong>die</strong> oberste Leistungsgruppe sollen nur <strong>die</strong> besten Schüler <strong>auf</strong>genommenwerden. Sie bilden <strong>die</strong> künftige Elite. Die Vertreter einer elitären Bildungstheorie fordernalso den Ausschluss aller jener von höherer Bildung, <strong>die</strong> bestimmte Standards nichterfüllen.Die Prüfung <strong>die</strong>ser elitären Bildungstheorie zeigt, dass <strong>die</strong> Forderung, <strong>die</strong> schulisch besteAusbildung nur jenen zu geben, deren Fähigkeit auch erwiesen ist, nicht so einfacherfüllt werden kann. Als erstes ist schon unklar, <strong>auf</strong> welche Fähigkeiten es überhauptankommt. Gute Schulnoten sind nicht unbedingt wichtig für späteren beruflichen Erfolg.Beispielsweise kann Mediziner nur der werden, der einen besonders guten Notendurchschnitterreicht und den Eingangstest besteht. Philosophie kann man dagegen auch miteinem nur ausreichenden Notendurchschnitt stu<strong>die</strong>ren. Das belegt, dass ein guter Notendurchschnittin erster Linie den Zugang zu finanziell attraktiven Berufen erleichtert. Obaber <strong>die</strong> Fähigsten für <strong>die</strong> jeweilige Disziplin ausgewählt wurden, ist mehr als fraglich.Untersuchungen zeigen vielmehr, "dass nur ein geringer Zusammenhang zwischen denErgebnissen der Reifeprüfung und den Vorexamen in verschiedenen naturwissenschaftlichenDisziplinen" und bei Medizinern besteht (WEINGARDT 1971, S. 253). Tatsächlichsind nämlich Mediziner mit relativ schlechten Schulnoten im Beruf ebenso tüchtigwie <strong>die</strong>jenigen mit sehr guten Noten (vgl. WILLIE 1982). Jedenfalls ist der Zusammenhangvon Zensuren und späterem Berufserfolg im allgemeinen nur "sehr mäßig" (HOYT1965), ebenso wie der Zusammenhang zwischen IQ und Berufserfolg (vgl. zusammenfassendHOWE 1990, S. 200).Ein weiteres Problem ist <strong>die</strong> mangelnde Objektivität von Noten und Zeugnissen (vgl.INGENKAMP 1971a). Notenunterschiede zwischen Schülern können nicht ausschließlichdurch unterschiedliche kognitive Leistungen erklärt werden. Anstrengung und Benehmender Schüler, Vorurteile des Lehrers und <strong>die</strong> von <strong>die</strong>sen Faktoren beeinflussteInteraktion des Lehrers mit den Schülern scheinen ebenfalls eine bedeutsame Rolle zuspielen (vgl. z.B. FARKAS/SHEEHAN/GROBE 1990). Außerdem <strong>die</strong>nen Noten nichtnur der objektiven Leistungsmessung, sondern können von den Lehrern auch als Erziehungsmittelverwendet werden. Diese verschiedenen Aufgaben, <strong>die</strong> mangelnde Objektivitätund der geringe prognostische Wert von Zensuren stellen sie als Auswahlkriteriumin Frage. Zensuren für Schulleistung haben eine Vorhersagegültigkeit von etwa r = .30.Wenn nun unter 1000 Bewerbern 200 Geeignete <strong>auf</strong>grund ihrer Noten ausgewählt werden,dann sieht das Ergebnis rechnerisch folgendermaßen aus: Unter den 200 Zugelassenensind 66 Geeignete und 134 nicht Geeignete. Man hat "aber 134 Geeignete und 666nicht Geeignete abgewiesen" (INGENKAMP 1971b, S. 222).180
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTHohe schulische Leistungsanforderungen wirken außerdem sozial selektiv. Je weiterman <strong>die</strong> Leiter der Bildung emporsteigt, umso weniger wird man sich in der Gesellschaftvon Kindern aus der Unterschicht, von Minoritäten, Ausländern usw. befinden (vgl.WILLIE 1987, S. 17). Der Politologe WILLIE ist der Auffassung, dass es "unter demBanner der Aufrechterhaltung strenger Maßstäbe" darum gehe, <strong>die</strong> Früchte langer Erziehungden Kindern jener zu sichern, <strong>die</strong> <strong>die</strong> gesellschaftlich höheren Positionen bekleiden(vgl. ebenda).Wenn das eigentliche Ziel der Bildung leistungshomogener Gruppen in der Schule darinbestanden haben sollte, <strong>die</strong> besten, tüchtigsten oder leistungsfähigsten Mitglieder derheranwachsenden Generationen zu identifizieren, dann ist <strong>die</strong>ses Ziel klar verfehlt worden.Nur in einem gewissen Sinn werden <strong>die</strong> Leistungsfähigsten gefunden. Denn dasSystem wird <strong>die</strong>jenigen herausfiltern, <strong>die</strong> oder deren Eltern wissen, wie man <strong>die</strong>sesSchulspiel gewinnt - also <strong>die</strong> Cleveren. Ein Anteil weniger cleverer Schüler wird, auchwenn sie im Prinzip sehr gute Schulleistungen erbringen könnten, ausgesondert werden(vgl. PAQUETTE 1991).Der zentrale Schwachpunkt der Selektion nach Schulleistung, <strong>die</strong> ja <strong>die</strong> Konzentration<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Förderung der Besten ermöglichen soll, ist also, dass <strong>die</strong> Besten <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weisezu einem wesentlichen Teil gar nicht erkannt werden. Ferner werden viele Schüler, <strong>die</strong>zu hohen Leistungen in der Lage sind, von der Förderung ausgeschlossen und entmutigt.Die Untersuchung der L<strong>auf</strong>bahnen außergewöhnlich erfolgreicher Wissenschaftler,Künstler und Wirtschaftsführer zeigt, dass <strong>die</strong> Schule oft eher eine negative Rolle gespielthat. Entscheidend war in fast allen Fällen <strong>die</strong> frühe Weckung und Aufrechterhaltungeines starken Interesses für einen Gegenstandsbereich und <strong>die</strong> Aufrechterhaltungder Freude am Lernen in <strong>die</strong>sem Bereich. Häufig waren es <strong>die</strong> Eltern, <strong>die</strong> den Kindernam meisten geholfen habe, seltener ein Lehrer (vgl. zusammenfassend OCHSE 1990, S.83 ff.). Man sollte denken, dass jedes Kind Ermutigung und Hilfe ver<strong>die</strong>nt, um das Besteaus dem machen zu können, was es hat. Im Übrigen kann niemand wissen, welche Schülerspäter sozial als besonders bedeutsam bewertete Leistungen erbringen werden.19. Didaktische Merkmale aus der Sicht von innen„Gute“ Schulen sind Schulen, in denen Lehrer und Schüler gemeinsam an Gegenständenihres Interesses arbeiten und so das erschaffen, was im üblichen Sprachgebrauch Unterrichtgenannt wird. Die Vorstellung, dass Schüler nach Plan geformt oder gebildet wer-181
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTden könnten, ist <strong>die</strong>sen Schulen fremd. Es geht vielmehr immer darum, was auch derSchüler will. Erziehung wird <strong>auf</strong>gefasst als etwas, das nur von innen her erfolgen kann,etwas, das nur jeder Einzelne für sich selber tun kann und an dem er ein Leben lang arbeitet.Jeder kann sich nur selbst erziehen. Und <strong>die</strong> Schule ist ein Ort für <strong>die</strong> gemeinsameBemühung um solche Selbst-Bildung, ein Ort, an dem jeder <strong>die</strong> Unterstützung, Hilfeund Ermutigung findet, <strong>die</strong> er gerade braucht. Das ist <strong>die</strong> entscheidende Rechtfertigungsolcher Schulen.Freiheit und OrdnungFreiheit und Ordnung bedeutet, dass sowohl der Einzelne wie auch <strong>die</strong> Gruppe innerhalbgewisser Grenzen eigene Ziele setzen und Wege zu ihrer Erreichung suchen kann. Inmanchen Schulen oder Klassen wie der von FALKO PESCHEL (2002) oder der SUDBURYVALLEY SCHOOL werden <strong>die</strong>se Grenzen in einem geregelten demokratischen Prozessfestgelegt und verändert. Voraussetzung allerdings ist eine Grundsatzentscheidung indem Sinn, dass <strong>die</strong> Mädchen und Jungen selbst über ihr Tun bestimmen, ihre eigeneUmgebung erzeugen können sollen und dass <strong>die</strong> Schule mit ihren Lehrern und all ihrenEinrichtungen für <strong>die</strong> Schüler da sein soll.Von der Grundsatzentscheidung her sind sehr unterschiedliche Formen von Freiheit vorstellbar.Ähnliches gilt für <strong>die</strong> Ausformungen <strong>die</strong>ser Grundsatzentscheidungen im alltäglichenSchulleben. In jedem Fall wird es gewisse Regeln geben, wie auch immer sie eingeführtwerden, <strong>die</strong> sowohl für Lehrer und Schüler bindend sein müssen. Die Anerkennungund Beachtung <strong>die</strong>ser Regeln oder Bedingungen eröffnet einen gemeinsamenRahmen, der Handlungsmöglichkeiten absteckt, <strong>die</strong> Willkür einzelner Schüler und Lehrersowie von Gruppen begrenzt und somit eine gewisse Sicherheit und Stabilität gewährleistet.Der Zwang, der damit verbunden sein mag, ist weit geringer als der Zwang,der von Steuerungsmaßnahmen ausgeht, <strong>die</strong> zudem völlig willkürlich sein können unddas Handeln der Schüler im Detail bestimmen.Die Freiheit einer Gruppe von Schülern kann – ebenso wie <strong>die</strong> Freiheit der Gesellschaft– nicht darin bestehen, dass jeder tun kann, was er möchte. Denn dann könnten einigeversuchen, <strong>die</strong> Freiheit anderer zugunsten ihres eigenen Handlungsspielraums einzuengen.Die Freiheit der Individuen einer Lerngruppe kann daher nur gewährleistet werden,wenn alle sich an gemeinsame Regeln halten. In der Schule können solche – nicht ganzso weiten – Regeln beispielsweise fordern: "Respektieren des bereitgestellten Unter-182
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTrichtsmaterials; Respektieren der Arbeit und der Persönlichkeit der anderen; jede Arbeitso gut wie möglich zu machen und zu bestimmten Zeiten anwesend zu sein."Man kann, wie in MONTESSORI-Schulen, gebundene Arbeitsphasen, in denen Materialund Aufgaben vorgegeben werden, und Freiarbeitsphasen festlegen, in denen <strong>die</strong> Schüler<strong>die</strong> Ziele und <strong>die</strong> Erarbeitungsweisen selbst wählen. Wie sie vorgehen, was sie zuerst,was sie als zweites tun wollen, ob sie mit einem oder mehreren Partnern, gemeinsamoder allein den Gegenstand bearbeiten möchten wie auch <strong>die</strong> Bewertung ihrer Ergebnissekönnen sie selbst bestimmen. In manchen Schulen wie der SUDBURY VALLEY SCHOOLkönnen <strong>die</strong> Schüler auch bestimmen, ob sie irgend einer geregelten Lerntätigkeit nachgehenwollen oder ob sie beispielsweise das ganze Schuljahr über einfach nur spielenoder mit Kameraden im Freien herumstreifen wollen – übrigens durchaus mit insgesamtrespektablen Leistungen der Schüler. Andere legen etwas einengender fest, dass das, was<strong>die</strong> Schüler zu bestimmten Zeiten tun, etwas mit Mathematik, mit Musik etc. zu tun habenmuss; oder noch weiter einengend, dass sie etwa im Musikunterricht Material zubestimmten Themenkreisen bearbeiten, oder sie mit einem Partner arbeiten sollen.Je mehr Einengungen allerdings vorgenommen werden, umso mehr verringern sich <strong>die</strong>Wahlmöglichkeiten der Schüler. Eine gewisse Einengung mag in manchen Fällen fürLehrer wie Schüler hilfreich sein, um sich an <strong>die</strong> Freiheit zu gewöhnen. Außerdem kanneine überschaubare Anzahl von Alternativen in einem Bereich <strong>die</strong> Wahl der Schüler erleichtern.Eine zu starke Einengung jedoch wie <strong>die</strong> Wahl zwischen zwei gleichermaßenals unattraktiv empfundenen Alternativen, stellt wohl eher einen unzulänglich verschleiertenZwang dar.Vorteile von Selbstbestimmung der SchülerDer besondere Vorzug des Unterrichtsprinzips der Freiheit liegt darin, dass dadurch <strong>die</strong>Zahl der Dinge, <strong>die</strong> der Einzelne aus eigenem Antrieb versucht, vergrößert wird. Dennbei Handlungsfreiheit wird der Einzelne, selbst wenn er mit vorgegebenen Unterrichtsmaterialienarbeitet, viel eher Risiken eingehen und seine Kraft <strong>auf</strong> Gegenstände undFragen verlegen, wie er es im gebundenen Unterricht nie hätte versuchen können. Auf<strong>die</strong>se Weise kann er sein individuelles Wissen in Richtungen weiterentwickeln, <strong>die</strong> ihmspäter vielleicht einzigartige Möglichkeiten der Nutzung bieten.Nehmen wir als Beispiel das Thema Bakterien im Biologieunterricht. Bei gutem und inverschiedene Richtungen differenziertem Material werden einige Schüler sich mit Bakterienals Krankheitserregern, andere werden sich vielleicht mit gentechnischen Verfah-183
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTren ihrer Veränderung, wieder andere mit der Verwendung von Bakterien in der Abfallverwertung,in der Gewässerreinigung usw. befassen.Im Zusammenhang mit ihren außerhalb der Schule und in anderen Fächern erworbenenKenntnissen und Interessen können sich letztlich Kombinationen ergeben, <strong>die</strong> das Erkennenbestimmter Problemsituationen in einem Bereich begünstigen. Das kann demjeweiligen Individuum <strong>die</strong> besten Voraussetzungen zur Lösung einer Reihe von Problemenverschaffen. Auf <strong>die</strong>se Weise wird der einzelne sozusagen in <strong>die</strong> Lage versetzt,seinen originären Beitrag zur Lösung kommender Aufgaben zu leisten, während einweitgehend gelenkter Wissenserwerb lediglich zu einer Art Standardwissen geführt hätte,das vielleicht zu nicht viel nütze gewesen wäre.Es ist also auch gesellschaftlich nicht so unwesentlich, dass individuell differenzierteKenntnisse und Fähigkeiten und nicht ein kollektiver, standardisierter Wissenskanonangestrebt werden. Nur nach den individuellen Interessen differenzierte Kenntnisse undFähigkeiten haben auch eine Vielfalt von Fortentwicklungen in unterschiedlichste Richtungenzur Folge, was für <strong>die</strong> Gesellschaft von höchstem ideellem Wert ist, aber auchvon wirtschaftlicher Bedeutung sein kann (vgl. dazu v. HAYEK 1972, S.11 ff.). Selbst derAuf- und Abstieg von Nationen oder Wirtschaftsblöcken könnte weitgehend davon abhängen,ob in ihren <strong>Institution</strong>en, also auch der Schule, Bedingungen bestehen, <strong>die</strong> <strong>die</strong>Individuen zur Entdeckung und Realisierung von Neuem ermutigen (vgl. v. HAYEK1972, S. 49 ff.).Die kurzfristigen, unmittelbaren Wirkungen, denen in der Regel größere Bedeutung zugemessenwird, bestehen in einer besseren Disziplin, einer besseren Mitarbeit und inhöheren Leistungen. Freilich gilt das nur dann, wenn auch <strong>die</strong> beiden anderen Unterrichtsbedingungender Problemorientierung und der Kooperation wenigstens in einemMindestmaß erfüllt sind.Wege zur FreiheitSowohl unter einigen Praktikern wie Theoretikern der Pädagogik hört man nicht selten<strong>die</strong> Auffassung, dass in der Schule Ordnung nur dann möglich sei, wenn <strong>die</strong> Lehrer Anweisungen– sprich: Befehle – geben und <strong>die</strong> Schüler gehorchen. Die Pädagogik ist sozusagengespalten in Anhänger der Freiheit und Anhänger der "Ordnung", wobei hier"Ordnung" eigentlich "Zwang" bedeutet. Vertreter der letzteren Richtung können sich inder Regel nicht vorstellen, dass eine ganze Klasse von Schülern in der Lage sein soll, ihrTun ohne ständige und als wirkungsvoll gedachte steuernde Eingriffe eines Erziehers zu184
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTkoordinieren oder überhaupt einer im Rahmen der Schule als sinnvoll bewerteten Tätigkeitnachzugehen.Auch wenn praktische Versuche und <strong>die</strong> seit Jahrzehnten bestehenden Montessori- oder<strong>die</strong> vor allem in Holland zahlreichen Jena-Plan-Schulen zeigen, dass eine freiheitlicheOrdnung hohe Leistungen bei nahezu verschwindend geringen Disziplinproblemen ermöglicht,werden <strong>die</strong>se Ergebnisse schlicht und einfach nicht zur Kenntnis genommen;bestenfalls gelten solche Schulen als Ausnahmeerscheinungen, <strong>die</strong> nur funktionierenkönnten, weil bereits im Kindergarten begonnen werde, <strong>die</strong> Kinder entsprechend zu beeinflussenund weil <strong>die</strong> Kinder aus bevorzugten Elternhäusern kämen. Beide Bedingungentreffen zwar manchmal zu, aber Montessori- und Jena-Plan-Schulen funktionieren inder Praxis offenbar genauso unter ganz anderen Voraussetzungen. Nicht selten entstandensie ja nur, weil man keinen anderen Ausweg mehr aus unlösbaren Disziplinproblemenmit Kindern aus sozial schwierigen Gegenden finden konnte.Allerdings ist eine Umstellung des Unterrichts nicht von heute <strong>auf</strong> morgen zu bewerkstelligen,besonders wenn der Unterricht vorher in einem hohen Maß <strong>auf</strong> Lenkung beruhte.In der Übergangsphase kann es durchaus zu Irritationen bei den Schülern kommen.Man darf nicht erwarten, dass sie sich unmittelbar <strong>auf</strong> neue Bedingungen einstellen.Man sollte <strong>die</strong> Freiheit und <strong>die</strong> damit verknüpften Anforderungen an <strong>die</strong> Selbststeuerungalso allmählich steigern.Tatsächlich sind bei Unterrichtsversuchen mit selbständigem Lernen sind Misserfolgenicht selten. Einen häufigen Grund dafür beschreibt DECHARMS (1984) an einem Beispiel:Nach einer Schulung über selbständiges Lernen hatte sich ein Lehrer "entschieden,seine neuen Siebtklässler als selbständige Lerner zu behandeln. Als er seine Klasse zumersten Mal traf, bat er sie, <strong>die</strong> Tische in einem Kreis <strong>auf</strong>zustellen. Die Klasse beganndann darüber zu diskutieren, was sie in <strong>die</strong>sem Schuljahr tun wollte. Sein Plan war es,<strong>die</strong> Klasse alles durch Mehrheitsbeschlüsse bestimmen zu lassen". Dieser Lehrer berichtetespäter, dass es "ein Fehlschlag sei, Schüler als selbständige Lerner zu behandeln".Es sei ausgeschlossen, so etwas über längere Zeit <strong>auf</strong>rechtzuerhalten, da es in Chaosmünde. DECHARMS Kommentar: "Offensichtlich war <strong>die</strong>ser Lehrer von einem Übermaßan Lenkung zu einem allzu geringen Maß an Lenkung übergegangen" (S. 287, meineÜbersetzung). Auch sollte man bedenken, dass <strong>die</strong> Mitbestimmung bei der Festlegungvon Inhalten, <strong>die</strong> dann durch Mehrheitsvoten festgelegt werden, eigentlich nur für <strong>die</strong>erfolgreichen Meinungsführer einen Zugewinn an Selbständigkeit bedeutet (DECHARMS1984, S. 288).185
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDas seinem Projekt untersuchte DECHARMS über 3 Jahre hinweg <strong>die</strong> <strong>Auswirkungen</strong> derBedingung wachsender Freiheit mit dem traditionellen Unterricht. Der ideale selbständigeSchüler wird als "Meister" bezeichnet. Er besitzt <strong>die</strong> "Fähigkeit, im Kontext persönlicherSinn- und Zielsetzung vorwärts zu streben ... Der Meister setzt sich seine Zieleselbst und bestimmt, welche Maßnahmen er ergreifen muß, um <strong>die</strong>se Ziele zu erreichen."(DECHARMS 1979, S. 195).Die Untersuchung wurde mit allen Schulen eines Bezirks in einem sozialen Problemgebiet– es waren 11 Schulen, 32 Klassen, 1200 Schüler und 32 Lehrer – durchgeführt. Die16 Lehrer der nach einem Zufallsverfahren gebildeten Versuchsgruppe wurden gezielt<strong>auf</strong> ihre Aufgabe vorbereitet. Die Schulleistungen der Versuchsklassen im standardisiertenLeistungstest (Iowa Test of Basic Skills) steigerten sich hochsignifikant und dauerhaftgegenüber der Kontrollgruppe. Außerdem blieben <strong>die</strong> Schüler der Versuchsgruppesignifikant seltener dem Unterricht fern als <strong>die</strong> der Vergleichsgruppe (vgl. de DECHARMS1979, S. 138 ff.). Nach vier Jahren wiesen Schüler der Versuchsgruppe immer noch höhereMeister-Werte <strong>auf</strong>, und ein signifikant höherer Prozentsatz der trainierten gegenüberden untrainierten Schülern machte <strong>die</strong> Abschlussprüfung. Schüler mit höherenMeister-Werten waren mit größerer Wahrscheinlichkeit unter den Schülern mit bestandenerAbschlussprüfung zu finden als Schüler mit niedrigen Meister-Werten (vgl. DE-CHARMS 1984, S. 292 f.).Grundsätzlich besteht der größte Vorteil der Freiheit darin, dass der einzelne Schüler ineinem gewissen Maß sein eigenes Wissen in einer mehr oder weniger von ihm zu bestimmendenWeise verwenden und seine persönlichen Interessen einbringen kann. Dasträgt zu einer positiveren Einstellung zum Lerngegenstand und <strong>auf</strong> Dauer auch zur Schulebei.Indem der Schüler sein bestehendes Wissen erweitert, entwickelt er Pläne, <strong>die</strong> sein Handelnleiten und antreiben. Durch <strong>die</strong>se selbstbestimmte Tätigkeit, bei der er sich vonMitschülern helfen lassen und ihnen auch seinerseits helfen kann, erfährt er zumindest<strong>auf</strong> bestimmten Gebieten Anerkennung. Man weiß, jeder kann einige Dinge und leistetdarin wertvolle Beiträge. Dadurch fühlt er sich der Gruppe zugehörig. Das gibt Selbstsicherheit.Zusammen mit der durch selbständiges Handeln erfahrenen Kompetenz hebtoder erhält das den Selbstwert der Person.Weil <strong>die</strong> Schüler in einem gewissen Ausmaß ihre eigenen Pläne entwickeln können,verbessert sich ihre Mitarbeit. Durch ihre eigene Arbeit differenzieren sie ihr Wissen, so186
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTdass sie auch in Tests bessere Leistungen zeigen, als wenn sie unter einem Übermaß anLenkung nur das erledigen, was sie unbedingt müssen.Zur Theorie der SelbstbestimmungNach Auffassung von Reformpädagogen wie Montessori sind Selbstbestimmung und <strong>die</strong>sie ermöglichende Freiheit notwendige Voraussetzungen des Lernens. Wenn das zutrifft,dann wirkt jede Pädagogik oder Erziehung, <strong>die</strong> <strong>die</strong>se Voraussetzung nicht beachtet, beeinträchtigendund schädigend. Tatsächlich kann man Kindern und Erwachsenen wederWissen noch Wertgrundsätze irgendwie eingeben oder einflößen. Man kann also nichtslehren. Der Lehrer kann nur eine für das Lernen und <strong>die</strong> Entwicklung der Schüler günstigeoder ungünstige Umgebung schaffen, indem er Lernmittel bereitstellt, indem er selberein erstrebenswertes Vorbild abgibt usw."Der Lehrer kann nicht für den Schüler lernen noch für ihn denken. Er kann nur Ideen sosinnvoll wie möglich darbieten. Die eigentliche Arbeit, neue Ideen in einen persönlichenBezugsrahmen zu gliedern, kann nur vom Lernenden selbst geleistet werden. Darausfolgt, daß Ideen, <strong>die</strong> Schülern gewaltsam eingegeben oder von ihnen passiv und unkritischakzeptiert werden, unmöglich im wahren Sinn des Wortes sinnvoll sein können."AUSUBEL (1974, Bd. II, S. 405). Daraus folgt, dass man in der Erziehung nur Angebotemachen kann. Man kann nicht einmal direkt helfen, sondern nur indirekt, weil es dar<strong>auf</strong>ankommt, was ein Individuum aus der ihm angebotenen "Hilfe" zu machen versteht.Das ist vielleicht besser zu verstehen, wenn wir bedenken, dass unsere Theorien, Grundsätzeusw., <strong>die</strong> wir den Schülern nahe zu bringen suchen, nicht <strong>die</strong> Realität an sich darstellenkönnen, sondern bloß Mittel sind, um <strong>die</strong> Realität zu verstehen, sich in ihr zurechtzufindenund mit ihr umzugehen.Das gilt auch soziale Regeln; auch sie sind nichts weiter als Mittel, um sich in der sozialenUmgebung zurechtzufinden. Diese Regeln entsprechen aber der Wirklichkeit nicht injedem Fall, zumindest nicht voll. Die sozialen Beziehungen sind meist weit komplexerist als vereinfachende Regeln oft glauben machen. Die genauen Ge- und Verbote derRegeln, denen wir in unserem Verhalten folgen, dürften uns nur selten ausdrücklich bekanntsein. Wir folgen ihnen in unserem Handeln, aber sie sind uns nur zum Teil bewusst.Das hartnäckige Bestehen nun, <strong>die</strong> bewusst vorgegebenen Regeln im Denken undVerhalten genauestens zu berücksichtigen, führt daher eher zu einem unangemessenenVerständnis sozialer Vorgänge und zu einem ebenfalls unangemessenen Verhalten.187
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTHandlungs- und Lernstrategien durch selbstbestimmtes TunSelbstbestimmung über einen langen Zeitraum ist eine wesentliche Bedingung für <strong>die</strong>Entstehung von Handlungsorientierung. Handlungsorientierung liegt vor, wenn eine Person<strong>auf</strong> große Schwierigkeiten nicht mit Verzweiflung oder Selbstmitleid reagiert, sondernunverdrossen seine verfügbaren Handlungsmöglichkeiten untersucht und anwendet(vgl. KUHL 1984; neuerdings wird statt von Handlungsorientierung auch von Resilienzgesprochen).Im Unterschied dazu würde eine lageorientierte Person in einer entsprechenden Situationüber sich selbst nachdenken. Sie würde sich überlegen, wo überall ihre Fähigkeiten unzulänglichsind, um das Problem zu lösen, anstatt geeignete Maßnahmen zu planen undauszuprobieren (vgl. KUHL 1984).Um Handlungsorientierung gewinnen oder stabilisieren zu können, braucht ein MenschKompetenzerlebnisse. Indem er sich selbst als kompetent erfährt wächst das Vertrauenin seine Fähigkeit, Problemsituationen auch in Zukunft lösen zu können. Die Fähigkeitder Problemlösung wiederum wird unterstützt durch den Erwerb von Strategien des Lernens.Wenn <strong>die</strong> Schüler im Unterricht über <strong>die</strong> Ziele, Inhalte und Ergebnisse ihres Lernensselbst bestimmen können, dann werden sie auch über ihr eigenes Tun nachdenken.Die Auswahl einer Aufgabe, eines Problems steht am Anfang, und durch geeignetes Unterrichtsmaterialkann man dem einzelnen Schüler Hilfen bereitstellen, sich selbst angemessene,d.h. erreichbare Ziele zu setzen. Das Setzen realistischer Ziele ist eine Problemlösetätigkeit.Dazu gehört auch das Zerlegen von Globalzielen in Teilziele, so dassder Schüler relativ schnell feststellen kann, was er erreicht hat, was er kann und nochnicht kann, wo er Hilfe braucht usw.Die Möglichkeit in gewissem Maß eigene Wahlen treffen zu können und <strong>die</strong> eigenenKenntnisse und Fähigkeiten <strong>auf</strong> eine Weise zu verbessern und zu erweitern, <strong>die</strong> manselbst als wertvoll betrachtet, ermöglicht dem Schüler eine Art organischen, d.h. subjektivals sinnvoll erlebten Zugewinn von Kompetenz. Die erlebte Kompetenz schafft <strong>die</strong>Voraussetzung für erfolgreiches weiteres Lernen und motiviert dazu (vgl. WHITE 1959).Für <strong>die</strong> Lösung von Aufgaben bieten bereichs- oder fachspezifische Lösungsstrategienden größten Nutzen. Ihr Erwerb wird vor allem <strong>die</strong> Zusammenarbeit von Schülern inLernpartnerschaften gefördert. Sie werden von Schülern äußerst positiv eingeschätzt(BECK u.a. 1991). Die Partner besprechen ihre Lernerfahrungen, offene Probleme undFragen und entscheiden darüber, welche Erkenntnisse, welche inhaltlichen oder strategi-188
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTschen Schwierigkeiten sie besser in einem größeren Kreis oder mit dem Lehrer erörtern.Die Schüler entwickeln dabei selbst Lernstrategien, <strong>die</strong> sie auch effektiv einzusetzenverstehen (vgl. BECK u.a. 1991).Zu den Lernstrategien zählt auch <strong>die</strong> selbständige Bewertung der eigenen Leistung. Da<strong>die</strong> Selbstbewertung häufig <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Erkenntnis von Mängeln hinausläuft, trägt <strong>die</strong> eigenständigeBewertung in höherem Maß zur Verbesserung späterer Leistungen bei alsFremdbewertung, <strong>die</strong> weniger leicht zu akzeptieren ist. Das gilt insbesondere dann,wenn <strong>die</strong> Fremdbewertung unmittelbar in Benotungen mündet.Vertrauen statt. ÜberwachungSchülern innerhalb eines vorgegebenen Ordnungsrahmens Freiheit zuzugestehen, bedeutetVertrauen in sie zu haben. Solches Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungendes Erziehers, wenn er Freiheit und Selbstbestimmung im Unterricht verwirklichenwill. Wie Untersuchungen zeigen, können sich Erwartungen <strong>auf</strong> das Verhalten der davonBetroffenen im Sinne sich selbst erfüllender Prophezeiungen auswirken (vgl. ROSEN-THAL/ JACOBSEN 1974) 69 . Das macht auch verständlich warum jemand, der Schülernvertraut, sich durch <strong>die</strong> Praxis ebenso bestätigt sieht wie derjenige, der der Auffassungist, man könne den Schülern nur misstrauen.Einem Schüler zu vertrauen bedeutet, daran zu glauben, dass er, wie schwierig er auchsein und welche Fähigkeiten er auch besitzen mag, doch ein nach Erkenntnis und Ordnungstrebendes Wesen ist. Jeder Mensch gilt danach in seinem innersten Kern als gesundund als entwicklungsfähig. Das braucht uns nicht blind für psychische und sozialeProbleme des Einzelnen machen. Und <strong>die</strong>se Probleme können überaus ernsthaft sein undsind vielleicht innerhalb der Schule nicht korrigierbar.69Vgl. ROSENTHAL/JACOBSEN 1974. Literarisch wurde das Thema von Bernhard Shaw in "Pygmalionbehandelt. Seine Eliza bringt den Sachverhalt <strong>auf</strong> den Punkt: "Sehen Sie, wenn man davon absieht,was ein jeder sich leicht aneignet, sich anziehen, richtige Aussprache und so weiter, dann besteht derUnterschied zwischen einer Dame und einem Blumenmädchen wahrhaftig nicht in ihrem Benehmen,sondern darin, wie man sich gegen sie benimmt. Für Professor Higgins werde ich immer ein Blumenmädchensein, weil er mich immer wie ein Blumenmädchen behandelt und behandeln wird. Aber ichweiß, daß ich für Sie wie eine Dame sein kann, weil Sie mich immer wie eine Dame behandeln undbehandeln werden."Wie ernst <strong>die</strong>se Möglichkeit zu nehmen ist, geht auch daraus hervor, daß man in der medinzinischenForschung (wo man mit kleinen Versuchsgruppen arbeitet, bei denen sich in der Regel ein persönlicherKontakt von Versuchsleiter und Versuchspersonen herausbildet) im wesentlichen nur noch Doppel-Blind-Versucheals hinreichend frei von solchen Erwartungs-Übertragungen betrachtet.189
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDass auch in sehr schwierigen Fällen Akzeptanz und Vertrauen <strong>auf</strong>rechtzuerhalten sind,mag nicht realistisch klingen. In jedem Fall muss zugegeben werden, dass es sehrschwierig sein kann. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist eine innere Distanz – nichtzum schwierigen Schüler – sondern zu den eigenen Gefühlen und Impulsen. Denn wennZorn, Ärger, Enttäuschung usw. das Bewusstsein mit Beschlag belegen, dann ist es unmöglich,noch Vertrauen zu haben und den Schüler zu akzeptieren. Dann beginnt manden Schüler aus seinen Gefühlen heraus zu strafen, abzuwerten usw. Den eigenen Gefühlenausgeliefert, versucht man den Schüler zu kontrollieren. Wenn man <strong>die</strong> Strafennicht steigert, sondern gleich mit den schärfsten Strafen beginnt und bei nachfolgendemWohlverhalten Lob und Belohnung einsetzt, können damit sogar „gute Erfolge“ in demSinn erreicht werden, dass der Schüler sich in der Gegenwart des Lehrers „benimmt“.Allerdings verschwindet <strong>die</strong> Wirkung mit dem kontrollierenden Lehrer.Der von seinen Gefühlen gesteuerte Lehrer kann nun freilich kaum als „Erzieher“ bezeichnetwerden, vielmehr ist er ein Sklave seiner Gefühle. Das ist seine Schwäche. Undder Schüler weiß das. Er kann <strong>die</strong>se Schwäche des Lehrers ausnutzen, indem er den Lehrerimmer wieder zur „Weißglut“ treibt. Auf <strong>die</strong>se Weise hat der Schüler Macht über denLehrer. Dieses „Spiel“ wird solange weitergehen als keine grundlegende Änderung derSituation eintritt. Eine solche Änderung würde im Idealfall in einer Veränderung derHaltung des Lehrers bestehen. Eine solche grundlegende Änderung kann er erreichen,wenn es ihm gelingt, Distanz zu seinen Gefühlen zu gewinnen. Wenn er ihnen nichtmehr ausgeliefert ist, wenn es ihm gelingt, sich selbst mit seinen Gefühlen zu akzeptieren,werden sie ihre Macht über ihn verlieren. Dann kann er auch den Schüler mit allseinen Problemen und Schwierigkeiten akzeptieren und dar<strong>auf</strong> vertrauen, dass <strong>die</strong>serSchüler letztlich eine Lösung seiner Probleme finden wird.Nur wenn der Lehrer selber frei ist von eigenen negativen Gefühlen, kann er mit denSchülern, sofern sie dazu bereit sind, ehrlich und offen über ihre Schwierigkeiten sprechen.Die Schüler werden sich dann mit der Zeit selber besser verstehen und ihr Verhaltennach und nach in den Griff bekommen. Die Klärung solcher Probleme steigert also<strong>die</strong> Fähigkeit der Schüler im zwischenmenschlichen Umgang und wirkt damit indirektselbstwerterhöhend. Auch der Lehrer lernt aus solchen Konfliktlösungen, sie steigernauch sein Selbstwertgefühl und stärken damit sein Zutrauen in den erfolgreichen Umgangmit weiteren Konflikten. 7070Wer versuchen will, mit negativen Gefühlen besser klar zu kommen oder sich davon zu befreien,findet eine einfache und wirksame Hilfe in den Emotional Freedom Techniques. Sie sind leicht zu ler-190
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTProblemorientierungKinder sehen überall Fragen und sie stellen ständig Fragen, weil ihnen irgendetwas unklar,komisch oder nicht stimmig erscheint. In der Wissenschaft bezeichnet man solcheUnklarheiten oder Unstimmigkeiten als Probleme. Von Problemen oder Fragen geht alleForschung, <strong>die</strong> es wert ist, so bezeichnet zu werden, aus. Problemorientierung bedeutetalso, dass man sich im Unterricht an den Problemen oder Fragen der Kinder und Jugendlichenorientiert, dass man im Unterricht Antworten <strong>auf</strong> Fragen der Schüler sucht, dassman herauszufinden sucht, welche Fragen oder Probleme <strong>die</strong> Mädchen und Jungen haben,wenn sie an einer Sache arbeiten.Problemorientierung unterscheidet sich durch <strong>die</strong> Konzentration <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Fragen und Interessender Schüler von der Stoff- oder Ergebnisorientierung. Letztere geht vom Lehrplanaus, erstere vom Schüler. Problemorientierung kann also nicht gut nach Lehrplan funktionieren,sondern erfordert, dass man sich im Unterricht von den Fragen und Interessender Schüler leiten lässt. Durch entsprechendes Material, wenn es von den Schülern akzeptiertwird, kann durchaus eine gewisse Kanalisierung der Schülerinteressen erfolgen.Wenn das erfolgreich sein soll, muss <strong>die</strong> Kanalisierung allerdings sehr flexibel sein unddem Einzelnen immer wieder <strong>die</strong> Freiheit der Abweichung anbieten. Eine stark lehrplanorientierteSchulorganisation wird dagegen kaum Problemorientierung zulassen.Auch der Lehrer muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wenn er Problemorientierungals Unterrichtsprinzip realisieren möchte. Als Lehrer sollte ich immer <strong>auf</strong>s Neueherausfinden wollen, wie <strong>die</strong> Dinge wirklich sind, denn dann bin ich auch offen für neueIdeen und kann mich für <strong>die</strong> Vorstellungen meiner Schüler interessieren. Wenn ich dazuden Schüler als gleichwertigen Gesprächspartner akzeptiere, kann ich wirklich mit ihmfachsimpeln, mich ernsthaft über einen Gegenstand mit ihm austauschen. Denn derSchüler wird dem Lehrer seine Gedanken nur mitteilen, wenn er fühlt, dass er ernst genommenwird und dass der Lehrer sich für das, was er denkt und sagt, auch interessiert.Problemorientierung fördert das Forschen und Lernen der Kinder und Jugendlichen,denn nur wer nach Antworten <strong>auf</strong> Fragen sucht, lernt wirklich. Er kann das, was er erfährtsinnvoll verknüpfen und anwenden. Er ist an den Dingen interessiert, nicht an Notenoder dem, was andere über ihn denken oder von ihm halten. Er wendet seine gesamtegeistige Kapazität der Untersuchung des Gegenstandes zu, ohne Furcht vor Fehlern oderBewertungen durch andere. Wer das herausfindet und lernt, was er wissen will, wird <strong>die</strong>nen und können von jedem selbst angewendet werden. EFT wurde entwickelt von Gary Craig. SeinHandbuch ist als kostenloser Download verfügbar unter: www.emofree.com191
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTbesten Leistungen erbringen, zu denen er fähig ist, gerade weil er dabei nicht an Leistung,Noten oder Belohnung denkt.Bedingungen für Problemorientierung im UnterrichtProblemorientierung setzt grundsätzlich voraus <strong>die</strong> Akzeptanz der Eigenständigkeit deseinzelnen Schülers voraus. Wenn Problemorientierung bedeutet, dass man als Lehrer <strong>auf</strong><strong>die</strong> Fragen des Einzelnen einzugehen versucht, muss man ihn als jemanden sehen, derProbleme erkennt und nach Lösungen sucht. Das setzt aber voraus, dass dem Schülereine große Freiheit zu irren, zu fragen, mit anderen Schülern zusammen Überlegungenanzustellen, <strong>die</strong>se Überlegungen durch selbst entwickelte Experimente auszuprobieren,wobei es wiederum zu Fehlschlägen kommen kann. Problemorientierung kann also nichteinfach ein Lückenfüller im normalen Unterricht sein, sondern setzt einen Rahmen fürfreies Denken und Handeln voraus. Es ist auch wichtig, dass <strong>die</strong> Schüler sich untereinanderhelfen können, weil <strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong> Herausforderung durch schwierige Fragendann annehmen können, wenn gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit durch Zusammenarbeitbesteht. Außerdem darf keine Bedrohung durch Benotung im Hintergrundstehen. Vielmehr sprechen <strong>die</strong> von den Schülern gelösten Aufgaben für sich selbst.Solche Bedingungen sind ihrerseits nur dann möglich, wenn der Lehrer bereit ist, seinementalen und gefühlshaften Mechanismen oder Impulse in sich selber zu erkennen.Denn <strong>die</strong> Bewertungen von Schülern oder ihrer Verhaltensweisen, <strong>die</strong> Versuche <strong>die</strong>sesVerhalten zu regulieren, zu belohnen oder bestrafen entstehen beim Lehrer aus Gefühlenund Impulsen heraus. Unreflektierte Ängste und verletzter Stolz spielen dabei eine zentraleRolle. Diese Mechanismen und <strong>die</strong> sie begleitenden Gefühle muss der Lehrer sichbewusst machen. Denn sie zwingen ihn zu einem entsprechenden Handeln und lassenihm keine Freiheit der Entscheidung. Nur wenn er <strong>die</strong>se Impulse und Gefühle und <strong>die</strong>davon ausgelösten zwingenden Reaktionstendenzen in sich erkennt und akzeptiert, kanner Distanz zu ihnen gewinnen und sich allmählich von ihnen befreien. Hat er das zumindestzu einem Teil geschafft, wird er frei genug sein, <strong>die</strong> Bedürfnisse der Schüler zu sehenund zu erkennen, dass <strong>die</strong> Kinder nicht mutwillig stören, sondern dass sie einfachnicht anders können, auch <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Gefahr von Strafen hin. Dann gibt es eine Chance,dass er ihre Bedürfnisse akzeptieren und sie ermutigen kann, <strong>die</strong> daraus resultierenden192
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTProbleme zu erkennen und konstruktiv nach Lösungen zu suchen. Denn <strong>die</strong> Lösungenkönnen nur von den Schülern selber kommen. 71Sofern solche Rahmenbedingungen bestehen, kann Problemorientierung in verschiedenerForm realisiert werden: vom Lehrervortrag bis hin zur freien Arbeit an selbst gewähltenoder selbst gestellten Fragen und Aufgaben.Problemorientierter LehrervortragEin Vortrag z. B. geht dann von einem bestimmten Problem und allgemein akzeptiertenLösungsvorschlägen dazu aus. Nach und nach versucht man, <strong>die</strong>se Vorschläge als falschzu erweisen und durch möglichst bessere zu ersetzen. Oder man geht von einem nochunklaren Problem aus und versucht, es allmählich immer genauer zu fassen, man entwickeltLösungsvorschläge, <strong>die</strong> der Kritik immer besser standhalten. FREUDENTHAL beschreibtanschaulich, wie ein solcher Vortrag vorbereitet wird und welche <strong>Auswirkungen</strong>er <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Zuhörer hat. Er stellt sich zunächst vor, wie der Vortragende sich vorbereitethat:„Da sagte er, in seinem Arbeitszimmer ‚liebe Zuhörer’, und er sah vor sich, <strong>die</strong> er imGeiste <strong>auf</strong>gerufen hatte. Er redete sie an, und sie neigten ihr Ohr; er fixierte einen, undder antwortete, es kam ein Zuruf aus dem Saal der Einbildung, und er diskutierte mitdem Interpellanten, man stimmte ihm zu oder griff ihn an, und er wehrte sich. Das allesschrieb er <strong>auf</strong> oder memorisierte er, sogar Irrtümer, <strong>die</strong> er rechtzeitig korrigiert hatte,setzte er an <strong>die</strong> rechte Stelle, und auch den richtigen Augenblick für einen Witz hatte erangekreuzt. Schließlich hielt er <strong>die</strong> Rede ... Und dann gingen <strong>die</strong> Hörer nach Hause undsagten ,er hat mir aus dem Herzen gesprochen’, oder ,er hat mich Punkt für Punkt widerlegt’,als ob er gewußt hätte, was ich sagen wollte’ oder ,nun weiß ich, warum ich andererMeinung bin als er’.“ (FREUDENTHAL 1974, Bd. 1, S. 98)Eine problemorientierte Darbietung ist also eine Art Dialog, da sie <strong>die</strong> Gedanken in ihrerEntwicklung zeigt, sie sozusagen dramatisiert. Der Gegenstand wird so dargestellt, als71Wer versuchen will, mit solchen Gefühlen und Reaktionstendenzen besser klar zu kommen oder sichdavon zu befreien, findet eine einfache und wirksame Hilfe in den Emotional Freedom Techniques.Sie sind leicht zu lernen und können von jedem selbst angewendet werden. EFT wurde entwickelt vonGary Craig. Sein Handbuch ist als kostenloser Download verfügbar unter www.emofree.com193
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTwürde er erst während des Sprechens erkannt. Der Schüler sieht <strong>die</strong> Problemstellungenund -lösungen in ihrer Entstehung 72 .Man kann sicher viele Beispiele für derartige Darbietungen, vom Niveau des Kindergartensbis zum Universitätsniveau finden. Das folgende Beispiel ist eine Stelle aus einemFernunterrichtsbrief des Mathematikers LEONHARD EULER an eine deutsche Prinzessin,in dem er über NEWTONS Gravitationstheorie schreibt (1773, Bd. 1, S. 179-180):„Dieser große Philosoph und Mathematiker lag einst in einem Garten unter einemApfelbaume, als ein Apfel, der ihm <strong>auf</strong> den Kopf fiel, bey ihm eine Menge vonBetrachtungen veranlaßte. Das wußte er sehr wohl, daß <strong>die</strong> Schwere <strong>die</strong> Ursachesey, warum der Apfel gefallen war, nachdem ihn der Wind oder eine andere Ursachevon seinem Aste abgerissen hatte. Diese Vorstellung war sehr natürlich, undjeder ehrliche Bauer hätte sie vielleicht eben so gut haben können; aber der englischeWeltweise gieng weiter. Der Baum, sagte er, muß sehr hoch gewesen seyn;und das brachte ihn <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Frage: Würde wohl der Apfel gefallen seyn, wenn derBaum noch weit höher gewesen wäre? Daran konnte er unmöglich zweifeln.Wie aber wenn der Baum so hoch gewesen wäre, daß er bis an den Mond gereichthätte? Hier wurde er verlegen zu entscheiden, ob der Apfel noch gefallen seynwürde oder nicht. Wenn er alsdann noch fiele (welches ihm noch sehr wahrscheinlichzu seyn schien, weil man in der Höhe des Baums sich keine gewisse bestimmteGrenze denken kann, wo der Apfel <strong>auf</strong>hören sollte zu fallen); wenn das also geschähe,so müßte der Apfel doch noch einige Schwere haben, <strong>die</strong> ihn gegen <strong>die</strong>Erde triebe. Also müßte auch der Mond, der sich mit dem Apfel an einerley Ortebefände, mit eben der Gewalt, wie der Apfel, gegen <strong>die</strong> Erde getrieben werden. Daihm aber doch der Mond nicht <strong>auf</strong> den Kopf fiel; so sah er ein, daß davon <strong>die</strong> Bewegungdes Mondes <strong>die</strong> Ursache seyn könne, so wie eine Bombe über uns wegfliegen kann; ohne gerade herunter zu fallen.“Bei einer derartigen, in problemorientierter Weise <strong>auf</strong>gebauten Darbietung können <strong>die</strong>Schüler <strong>die</strong> Gedanken NEWTONS nachvollziehen. Sie entdecken so NEWTONS Theoriewieder, durch <strong>die</strong> ihnen bisher Unerklärtes und Unzusammenhängendes plötzlich erklärbarwird und einen Zusammenhang erhält. Sie lernen etwas Neues in verständlicherWeise kennen und dadurch werden sie motiviert, selbständig weiter nachzudenken.Problemorientierter Mathematik-LehrgangEin Lehrgang ist dann problemorientiert, wenn er Fragen bei den Schülern hervorruft,zumindest aber sie <strong>die</strong> Fragen, <strong>die</strong> im Lehrgang <strong>auf</strong>tauchen, lebendig nachvollziehen72Nach <strong>die</strong>ser Regel schrieb auch LEIBNIZ: „Ich nahm mir vor, so zu schreiben, dass der Leser jederzeitden inneren Grund des Gelesenen sehen könne, ja möglichst sogar so, dass <strong>die</strong> Quelle der Entdeckungdeutlich werde, ja sogar <strong>auf</strong> solche Weise, dass der Leser alles so verstehe, als ob er es selbsterfunden hätte." (LEIBNIZ, Mathematische Schriften, hrsg. von GERHARDT, Bd. VII, S. 9; hier zit.nach POLYA 1967, S. 152)194
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTlässt. Sie Fragen oder Probleme müssen dann durch <strong>die</strong> Anregung veränderter Sichtweisenso drängend werden, dass <strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong> Lösungen dazu finden wollen. Der Lehrgangsollte <strong>die</strong> Schüler aber zudem ermutigen, eigene Lösungen zu den von ihnen gestelltenFragen zu suchen.Verdeutlichen wir uns das am Beispiel des Dreiecks (vgl. den Geometrielehrgang vonWITTENBERG 1963). Ein Dreieck ist zunächst nichts weiter als ein mit drei Strichen <strong>auf</strong>ein Blatt Papier gemalter Gegenstand, <strong>die</strong> an den drei Ecken aneinander stoßen. Möglicherweiseist es für einen Schüler ein Dreieck nur dann, wenn <strong>die</strong> Striche in etwa gleichlang sind und alle Ecken sich ähneln. Wenn <strong>die</strong> Schüler nun <strong>auf</strong>gefordert werden, möglichstverschiedene Dreiecke zu zeichnen und auszuschneiden, erhält das Wort Dreieckeine immer umfassendere Bedeutung für sie.Diese Bedeutung wird gesteigert, wenn <strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong> ausgeschnittenen Dreiecke nachgemeinsamen Merkmalen untersuchen. Sie finden dann beispielsweise, dass es solchemit gleich langen Seiten gibt. Sie gelten möglicherweise als besonders schön. Lässt man<strong>die</strong> Schüler der Frage nachgehen, warum das so ist, entdecken sie wiederum eine Mengeinteressanter Eigenschaften. Zum Beispiel kann man gleichseitige Dreiecke so falten,dass <strong>die</strong> Hälften sich genau decken. Die Ecke an der man das Dreieck faltet wird dabeigenau halbiert. Ist das nur bei gleichseitigen Dreiecken so?Wenn man gleich große gleichseitige Dreiecke mit einer Spitze um einen Punkt herumlegt und <strong>die</strong> Seiten aneinander stoßen, dann entsteht immer <strong>die</strong>selbe Figur, nämlich einregelmäßiges Sechseck. Was geschieht, wenn man dasselbe mit anderen Dreiecken versucht?Durch Zeichnen, Ausschneiden, Falten, Neben- und Übereinanderlegen, Kombinierenund Vergleichen verschieden gestalteter Dreiecke wird <strong>die</strong> Bedeutung des Namens"Dreieck" immer reicher, immer umfassender, d.h. <strong>die</strong> Schüler wissen immer mehrüber <strong>die</strong>sen Sachverhalt. 73Indem <strong>die</strong> Schüler mit dem Gegenstand umgehen, ihn mit den Operationen handhaben,<strong>die</strong> ihnen zur Verfügung stehen, entdecken sie eine Menge Dinge, <strong>die</strong> ihnen als solchenicht unbekannt sind. Sie wissen in etwa was "gleich große Ecken" sind, was "Halbieren"meint, was "Gleichmäßigkeit" ist, dass man eine Figur nach der Zahl ihrer Eckenbenennen kann, dass man aus einzelnen Gegenständen neue Gegenstände zusammenfügenkann usw. Neu aber ist <strong>die</strong> Kombination all <strong>die</strong>ser Wissenselemente.73Vgl. ausführlich hierzu den Geometrielehrgang von WITTENBERG 1963.195
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAußerdem dürften <strong>die</strong> vorhandenen Wissenselemente oder Annahmen über Gegenständenicht selten mehr oder weniger fehlerhaft oder ungenau sein, was durch Vergleich mitder Realität und <strong>die</strong> Diskussion gemeinsamer Erfahrungen festgestellt werden kann.Diese Annahmen werden dann durch angemessenere und den Prüfungen besser standhaltendeAuffassungen ersetzt. So baut der Schüler nach und nach eine immer differenziertereWissensstruktur über geometrische Gegenstände <strong>auf</strong>.Tatsächlich können wir gar nicht anders, als einem Gegenstand mit den Annahmen zubegegnen, über <strong>die</strong> wir bereits verfügen. Sie sind sozusagen das Netz, mit dessen Hilfewir <strong>die</strong> Wirklichkeit einzufangen und zu verstehen versuchen. Wir haben zunächst nichtsanderes als eben <strong>die</strong> schon vorhandenen Wissenselemente, und nur aus ihnen können wirunsere Annahmen für neue Gegenstände formen, mit denen wir sie dann zu erfassenversuchen.Lernen bedeutet danach also den Aufbau von kognitiven Schemata, <strong>die</strong> der Wirklichkeitimmer besser angemessen sind. Ausgangspunkt sind <strong>die</strong> jeweils vorhandenen, mehr oderweniger bereichsspezifischen Alltagsschemata der Lernenden, d. h. <strong>die</strong> Wissenselemente,aus denen sie ihre Annahmen formen. Diese vorhandenen Wissensschemata könnennach und nach immer besser an <strong>die</strong> realen Phänomene angepasst werden. Denn wenn <strong>die</strong>Anwendung <strong>die</strong>ser Schemata nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt, z.B. weil Versucheden durch ein Schema bedingten Erwartungen widersprechen, dann können <strong>die</strong>Schemata verändert, angepasst oder neu strukturiert werden. Auf <strong>die</strong>se Weise werden<strong>die</strong> verfeinerten Schemata in der Erfahrungswelt der Lernenden verankert.So erwirbt der Schüler nicht nur ein differenziertes Können und Wissen. Er erwirbt auchStrategien zum Erwerb von Können und Wissen. Er lernt, wie er <strong>die</strong> Merkmale von Gegenständenerforschen kann. Er lernt das Lernen, wie man oft sagt. Und was vielleichtnoch wichtiger ist – auch wenn es damit zusammenhängt –, er lernt, dass er fähig ist,sich selbst Wissen über <strong>die</strong> Welt und den Umgang mit ihr anzueignen. Er lernt, dass er<strong>die</strong> Angemessenheit <strong>die</strong>ses Wissens an den Gegenständen selbst prüfen kann, und dass<strong>die</strong>se Prüfung nicht in der persönlichen Macht von irgendjemandem liegt. Der Schülerkann sich selbst als kompetent erleben. Und <strong>die</strong>ses Kompetenzerlebnis motiviert ihn zuweiterem Lernen (vgl. WHITE 1959).Problemorientierter Physik-LehrgangDIETMAR HERDT (1990) hat einen problemorientierten Lehrgang zur Einführung in <strong>die</strong>elementare Optik entwickelt und überprüft. Die Schüler den Versuchsklassen haben mit196
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT<strong>die</strong>sem Lehrgang insgesamt beinahe doppelt so viele Fragen richtig beantworten könnenwie <strong>die</strong> Schüler im normalen Unterricht. Die Leistungen der schwachen Schüler verbessertensich so sehr, dass sie sogar <strong>die</strong> besten Schüler des Normalunterrichts übertrafen. 74Offensichtlich regen problemorientierte Lehrgänge das Lernen an und fördern es.Im normalen Physikunterricht beginnt man zunächst mit einfachen optischen Erscheinungenbeispielsweise anhand eines Spiegels. Nach kurzer Beschreibung solcher Phänomenestellt der Lehrer Fragen, anhand deren er <strong>die</strong> Gesetze der Reflexion an ebenenund sphärischen Flächen, Reflexionswinkel, Brechungsgesetz, Linsen, Linsenformelusw. einführt. Alles das sind Ergebnisse, Fakten. Dahinter aber steht eine Fülle von Ü-berlegungen, <strong>die</strong> von den konkreten Dingen abstrahieren und deren Formulierung <strong>die</strong>frühen Forscher oft Jahre gekostet hat. Eine Menge von Hypothesen mussten verworfenwerden, bevor man zu <strong>die</strong>sen Gesetzen kam. Diesen Wissenskanon zerlegt man nun inkleine Häppchen und bietet sie im Unterricht dar. Die Schüler lernen <strong>die</strong> Antworten,ohne eigene Fragen gestellt zu haben. Ihre Aufgabe sehen sie darin, sich <strong>die</strong>se Antworteneinzuprägen und Prüfungen damit zu bestreiten. Das Lernen wird so zu einer bewusstenAnstrengung. Doch das Ergebnis kann kaum mehr sein als eine oberflächlicheKenntnis von Lehrmeinungen. Das eigene Nachdenken, Suchen und Forschen wird unterdrückt.Die Schüler glauben nach einer Weile fast nicht mehr, dass sie in <strong>die</strong>sen Bereichenzu eigenen Ideen in der Lage wären. Bilden sie sich aber keine eigenen Auffassungen– weil weder ihre Lehrer noch sie selbst genügend Vertrauen in ihre Fähigkeitenhaben – kann das Ergebnis nur etwas Zweitrangiges sein. 75Im problemorientierten Lehrgang von DIETMAR HERDT nun werden Mädchen und Jungendazu angeregt, selber herauszufinden, was mit dem Licht passiert, wenn es beispielsweisedurch einen Spalt in der Tür oder der Jalousie ins Zimmer fällt. Sie machenden Spalt enger oder weiter, verwenden eine künstliche Lichtquelle, um <strong>die</strong> Wirkungenverschiedener Anordnungen auszuprobieren. Sie streiten sich über ihre „Theorien“ undwollen herausfinden, ob und wie ihre Richtigkeit zu testen ist. Natürlich holen sie auch<strong>die</strong> Meinung anderer ein und konsultieren Bücher. Aber all das <strong>die</strong>nt nur dazu, um immertiefer in das Feld optischer Erscheinungen einzudringen und sich ein eigenes Bild zumachen, es immer wieder zu prüfen und zu vervollständigen. Der Gegenstand steht also7475Vgl. DIETMAR HERDT: Einführung in <strong>die</strong> elementare Optik. Vergleichende Untersuchung eines neuenLehrgangs. Essen: Westarp-Wissenschaften 1990Siehe JOHN DEWEY: On Education. Selected Writings. Edited and with an Introduction by Reginald D.Archambault. New York: Random House 1964, 392 f.; HELMUT LEHNER: Erkenntnis durch Irrtum alsLehrmethode. Bochum: Kamp 1979, 88 ff.197
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTim Mittelpunkt. Lernen ist einfach eine Folge, eine natürliche Belohnung der Auseinandersetzungmit den Phänomenen der Optik.Bei HERDT wird anfangs das Alltagswissen der Schüler über optische Zusammenhängeverwendet, um optische Erscheinungen zu deuten. Diese Deutungen werden dann gründlich<strong>auf</strong> ihre Richtigkeit hin befragt und untersucht. Die Ergebnisse der Schüler werdendann von <strong>die</strong>sen – mit Hilfestellung des Lehrers – an anderen, aber einfachen und denSchülern vertrauten Alltagsphänomenen untersucht und <strong>die</strong> Schüler übertragen sie zunehmendauch <strong>auf</strong> komplexere optische Erscheinungen. Erst zum Schluss des Lehrgangskleiden sie ihre Erkenntnisse zusammen mit dem Lehrer in Formeln und werteten sierechnerisch aus.An den Ergebnissen <strong>die</strong>ses problemorientierten Lehrgangs besonders interessant ist, dass<strong>die</strong> gemessene Intelligenz der Versuchspersonen erheblich geringere Bedeutung für denLehrerfolg hatte als <strong>die</strong> Lehrmethode. So ist das schlechteste Lernergebnis, in der unterstenIntelligenzklasse in der Versuchsgruppe (22,8 von 40 möglichen Punkten) erheblichbesser als das beste Lernergebnis der obersten Intelligenzklasse der Vergleichsgruppe(13,7) (vgl. HERDT 1990, S. 410 f.).Problemorientierte LernmaterialienMaterialien zum selbständigen Arbeiten sollten grundsätzlich so beschaffen sein, dasssie den Schülern als Mittel verwendet werden können, um einen Gegenstand zu erforschenund sich eigene Vorstellungen der ihm zugrunde liegenden Zusammenhänge zubilden und <strong>die</strong>se Vorstellungen selbständig <strong>auf</strong> ihre Richtigkeit hin zu prüfen.Diese Voraussetzungen sind in nahezu idealer Weise beim mathematischen MONTESSO-RI-Material erfüllt, wobei ich hier nur das so genannte Goldene Perlenmaterial herausgreife.Dieses Material besteht, wie der Name sagt, aus goldfarbenenen Plastik- oderGlasperlen. Die Zahlenmengen sind in Einer, Zehner, Hunderter und Tausender. DieZehner sind zu einem Stab verbunden, zehn Zehnerstäbchen bilden in der Form einesflachen Quadrats einen Hunderter und zehn Hunderter einen Tausenderkubus. Implizitstecken also im Material <strong>die</strong> natürlichen Zahlen, das Zehnersystem und <strong>die</strong> geometrischeGrundformen des Punkts (Einer), der Linie (Zehner), des Quadrats (Hunderter) und desKubus (Tausender).Dieses Material ist, innerhalb der Grenzen der natürlichen Zahlen, ein wunderbares Mittelzum Umgang mit der Welt der Zahlen und für <strong>die</strong> Entdeckung der Gesetze <strong>die</strong>ser198
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWelt. Nach der schrittweisen Einführung des Materials und der Zahlen, beginnen <strong>die</strong>Kinder schon sehr früh mit großen Zahlen umzugehen. Zunächst beginnen <strong>die</strong> Kindermit dem Zählen der Perlen, sie tauschen zehn Einer gegen einen Zehnerstab, zehn Zehnerstäbegegen einen Hunderter usw. und schaffen so aus einem H<strong>auf</strong>en von Einern einezählbare, gut zu überschauende Ordnung.Fordert man <strong>die</strong> Kinder <strong>auf</strong>, von einem Hunderter eine Perle wegzulegen, dann kommensie bald <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Idee, ihn in zehn Zehner und dann einen Zehner in zehn Einer zu tauschen.Sie probieren das dann natürlich auch bald mit dem Tausender. Das richtigeRechnen beginnt mit der Verwendung der Kartensätze, <strong>die</strong> zu jeder Perlenmenge gehören.Auf den Karten sind <strong>die</strong> zugehörigen Zahlen <strong>auf</strong>gedruckt: <strong>die</strong> Einer grün, Zehnerblau, Hunderter rot, Tausender wiederum grün. Die Karten 9000-300-20-6 liegen zunächstuntereinander:9000300206Schieben <strong>die</strong> Kinder <strong>die</strong> Karten übereinander entsteht <strong>die</strong> Zahl 9326. Die Kinder legendazu <strong>die</strong> entsprechenden Perlenmengen. Jetzt können sie im Rahmen der natürlichenZahlen beliebig ad<strong>die</strong>ren, subtrahieren, verteilen (divi<strong>die</strong>ren) und multiplizieren (xmaligesAd<strong>die</strong>ren gleicher Summanden). Die Kinder rechnen also bereits im erstenSchuljahr mit großen Zahlen.Wenn <strong>die</strong> Kinder sich dann selber beliebige Aufgaben stellen, stoßen sie an <strong>die</strong> Grenzendes Raums der natürlichen Zahlen. Beispielsweise, wenn beim Verteilen das Ergebnisnicht „<strong>auf</strong>geht“ oder wenn beim Subtrahieren mehr Perlen weggenommen werden müsstenals eigentlich da sind. Das sind interessante Fragen, <strong>die</strong> zu einer Erweiterung desZahlenraums führen und eine auch eine Erweiterung der Mittel zur Erkundung <strong>die</strong>serneuen Zahlenräume und der in ihnen geltenden Gesetzmäßigkeiten erfordern.Ein weiteres Beispiel für problemorientierte Lernmaterialien ist <strong>die</strong> Lautier- oder Buchstabentabellevon JÜRGEN REICHEN (2001). Das ist eine Tabelle, <strong>auf</strong> der <strong>die</strong> wichtigstenim Deutschen vorkommenden Laute als Grapheme in Druckschrift <strong>auf</strong>gedruckt sind.Diese Tabelle gibt den Schülern <strong>die</strong> Möglichkeit, Laut-Buchstaben-Zuordnungen vorzunehmen,also <strong>die</strong> Laute eines Wortes in schriftlichen Zeichen auszudrücken, d.h. Wörterzu schreiben. Dieses Mittel ist nicht perfekt, weil <strong>die</strong> Umsetzung schon <strong>auf</strong>grund unterschiedlicherAussprache nicht immer so eindeutig ist. Dennoch lösen <strong>die</strong> Kinder dasProblem der Verschriftlichung ihrer Erzählungen in kürzester Zeit, wenn auch anfangs199
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTmit zahlreichen Abweichungen von der Norm. Das Lesen erfolgt dann nach wenigenWochen ganz spontan.Manche Lehrer lassen <strong>die</strong> Kinder auch selber ihre eigenen Buchstabentabellen erstellen,indem sie Bilder von Gegenständen malen <strong>die</strong> mit dem entsprechenden Buchstaben beginnen(beispielsweise können sie zu dem Buchstaben B einen Baum malen).Andere Mittel wie der Morgenkreis regen das problemorientierte Handeln in sozialenSituationen an. Wie bei allen anderen genannten „Mitteln“ hängt <strong>die</strong> Wirkung im Wesentlichendavon ab, ob Bedingungen der Selbständigkeit der Schüler (Freiheit und Ordnung)sowie der Kooperation (im Unterschied zum Wettbewerb) ab. FALKO PESCHELbeschreibt eine solche Situation in seiner Klasse:„Morgens bin ich gegen halb acht in meiner Klasse. Unser Raum ist nicht geradetypisch eingerichtet, denn <strong>die</strong> Schülertische stehen bei uns alle ringsum an derWand entlang. Bei Verzicht <strong>auf</strong> ‚Frontalunterricht’ müssen <strong>die</strong> Tische ja auchnicht zur Tafel zeigen und <strong>die</strong> Klasse erhält so eine schöne, große Freifläche in derMitte. Kurz nach mir trudeln <strong>die</strong> ersten Kinder ein, arbeiten ein wenig oder sprechenmiteinander. ... Irgendwann nach dem eigentlichen Stundenbeginn gegenzehn nach acht ruft der ‚Kreisleiter’ <strong>die</strong> Kinder dann mit der unüberhörbaren Mitteilung‚Kreis’ in unsere <strong>auf</strong> einem Podest fest installierte Sitzecke aus selbst gezimmertenHolzbänken. Wenn ich mich lieber mit den Hospitanten weiterunterhaltenoder ein Kind lieber an seiner Arbeit weiter machen möchte, fragt man denKreisleiter, der einem dann <strong>die</strong> entsprechende Erlaubnis gibt – oder auch nicht.Die Kinder haben beschlossen, dass alle zwei Tage jemand neues Kreischef wird.Alle zwei Tage, damit eine gewisse Kontinuität entsteht, aber auch jeder in überschaubarerZeit dran kommen kann. Entsprechend wählt der bisherige Chef dannein anderes Kind aus, das nun den Kreis leiten will. Der neue Kreischef hat dann<strong>die</strong> Gesprächsleitung inne und nimmt Kinder oder Lehrer dran, achtet <strong>auf</strong> Zwischenfragen,bricht evtl. abschweifende Gespräche nach Rücksprache mit derKlasse ab usw. Kinder und Lehrer haben dabei <strong>die</strong> Gelegenheit, Sachen zu erzählen,Termine abzustimmen, nachzufragen, Probleme zu klären, andere zur Verantwortungzu ziehen, Regeln abzustimmen, Arbeitsergebnisse vorzustellen, Gruppenzu organisieren, Ausflüge zu planen usw. Wenn niemand mehr etwas zu sagen hat,oder wenn der Kreisleiter merkt, dass es unruhig wird, beendet er den Kreis.Heute ist B. ‚Kreischef’, er hat <strong>die</strong> Gesprächsleitung inne. Zuerst fragt er, ob jemandetwas Wichtiges zu sagen hat. Ich zeige schon mal mit <strong>auf</strong>, denn ich mussnoch etwas … fragen. … Einfach reden will ich nicht. Wenn ich davon ausgehe,dass <strong>die</strong> Kinder sich an <strong>die</strong> Regeln halten sollten, dann muss ich das ja wohl auch(was mir zugegebenermaßen oft sehr schwer fällt.) Oh, heute komme ich sogarschon als Dritter dran. Dann kann ich meine Sachen ja noch schnell abklären, bevorB. jedes Kind danach fragt, was es heute tun will. In <strong>die</strong>ser Zeit können wir eigentlichschon aus dem Kreis gehen – wenn B. es erlaubt …“ (FALKO PESCHEL2002, Bd. 1. S. 128 ff.)200
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWer nun denkt, dass es dazu besonders guter und sozial angepasster Schüler bedürfe, irrtgewaltig. PESCHEL erzählt: B., der gerade den Kreis leitet, war im Kindergarten hyperaktiv,aggressiv und unsozial <strong>auf</strong>gefallen. Er konnte sich an keine Regeln halten, erst allmählichfiel <strong>auf</strong>, dass wohl „hochbegabt“ war.Noch viel schwieriger war K. Er war vorher bereits in der Sonderschule und <strong>die</strong> Lehrerindort meinte, dass man bei ihm an Lernen noch gar nicht denken könne.G. galt weder als kindergarten- noch als schulkindergartenfähig. Nach einem Aufenthaltin der Psychiatrie und einem gescheiterten Schulversuch sollte er in <strong>die</strong> Erziehungshilfeeingewiesen werden. Während einer „Wartezeit“ kam er in PESCHELS Klasse und bliebdann da, wo er nie ein Problem war, weil er nie zu irgendwas gezwungen wurde, vorallem nicht zum Lernen.Noch etliche andere Kinder waren problematisch, aber im offenen Unterricht von PE-SCHEL viel weniger als im normalen Unterricht. Sie lösten <strong>die</strong> Probleme ihres Zusammenlebensin der Klasse gemeinsam und selbständig; sie lernten alles das, was ihneninteressant erschien, was also Fragen anregte, was ein subjektives Problem für sie darstellte.Freies problemorientiertes ArbeitenFreies problemorientiertes Arbeiten bedeutet, dass der Unterricht sich ganz <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Fragenjedes einzelnen Schülers einstellt. Das mag für viele Lehrer schwer vorstellbar sein,aber es ist möglich und es verbessert langfristig <strong>die</strong> Leistungen der Schüler, weil sie jaimmer ihre persönliche Könnens- und Fähigkeitsgrenzen erweitern (vgl. PESCHEL 2002,S. 121 ff.). Es gibt also keine feste Unterrichtsstruktur, weil ja jeder Schüler selbst seineeigenen Inhalte, Interessen, Fragen, Erarbeitungsabläufe, Aufgaben, Zusammenarbeitmit anderen, Einzelarbeit, Übungen, Ergebnisdarstellungen usw. findet. Aufgrund ihresInteresses setzen sich <strong>die</strong> Schüler mit anderen auseinander, befragen beispielsweise Geschwister,Freunde, Verwandte, aber auch den Lehrer, suchen nach Anregungen in Büchern,Zeitschriften oder vorliegenden Arbeitsheften in der Klasse. Durch <strong>die</strong>se steteAuseinandersetzung wird das Lernen ständig vorangetrieben. Solche selbständige Arbeitder Schüler erfordert ein entsprechendes Engagement, das <strong>die</strong> Schüler aber <strong>auf</strong>bringen,„wenn daneben nicht ein bequemerer, verlässlicher Lehrgang angeboten wird“ (PESCHEL2002, S. 121).201
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAusgangspunkt solcher selbständiger Arbeit kann der „Kreis“ (siehe oben) sein, in demNeuigkeiten erzählt, Arbeitsvorhaben oder Sachen vom Vortag vorgestellt und Fragengeklärt werden. In der „Regel gibt es dann schnell eine Runde, in der jedes Kind derGruppe mitteilt, was es heute tun möchte und dann aus dem Kreis geht“ (PESCHEL 2002,S. 123).Vom Lehrer fordert <strong>die</strong>ses freie problemorientierte Arbeiten eine völlig andere Rolle. Erbraucht nun nicht mehr in <strong>die</strong> verschiedenen Dinge einzuführen, sondern unterstützt ehereinzelne Schüler, sofern sie das möchten, lässt sich von ihnen erklären, wie sie warumvorgehen usw. Vor allem aber muss er versuchen, den Überblick zu behalten. Um selberSicherheit zu gewinnen, muss er <strong>die</strong> Lehrpläne oder Bildungsstandards seiner und dernächsten Klassenstufen im Kopf haben, nach Möglichkeit auch <strong>die</strong> anderer Schulformen.Auf <strong>die</strong>se Weise kann er dann <strong>die</strong> von den Schülern erarbeiteten Inhalte und Ergebnisseverorten und sich ein Bild ihrer Leistungen machen. Wenn alle Stufen und alle Inhaltegleichzeitig vertreten sind, muss der Lehrer sich auch mit der Vielfalt der Inhalte vertrautmachen. So ist er selber ständig am Lernen und Erkunden. Er muss sich mit denForschungsmethoden in den verschiedenen Bereichen befassen und in der Klasse dafürsorgen, dass entsprechende Werkzeuge, Bücher und sonstige Utensilien bereitstehen(PESCHEL 2002, S. 122).Genetisches Lehren als Hilfe für den LehrerUm vor allem den Lehrern den Zugang zur Problemorientierung zu erleichtern, hat WA-GENSCHEIN (z.B. 1970, S. 68 ff.) das "Genetische Lehren" vorgeschlagen. Das methodischePrinzip des genetischen Lehrens besteht darin, <strong>die</strong> Ergebnisse der Wissenschaft, derTechnik, der Musik, Kunst usw. wieder in Fragen oder Probleme <strong>auf</strong>zulösen oder zurückzuverwandeln.Die Probleme, <strong>die</strong> einmal zur ursprünglichen Entdeckung von Lösungengeführt haben, seien auch <strong>die</strong> Fragen, <strong>die</strong> ganz einfach am Anfang der Beschäftigungmit einem Gegenstand stehen. Der Lehrer muss sich dazu mit der Geschichte seinesFaches oder Gegenstandes befassen. Er kann dann <strong>die</strong> der Entstehung einer bestimmtenLösung vorausgegangenen Probleme nachvollziehen und dadurch auch besser<strong>die</strong> Fragen seiner Schüler verstehen und ihnen entsprechende Anregungen geben, weiterführendeFragen stellen usw.Den Ausgangspunkt im problemorientierten Unterricht sollte allerdings nach Möglichkeitimmer der Schüler mit seinen Interessen und Fragen sein. Denn nur der Schülerselbst kann <strong>die</strong> subjektive Bedeutung von Lerngegenständen konstruieren bzw. rekonstruieren.Das wird am ehesten möglich sein, wenn man ihm Spielräume gibt, "<strong>die</strong> Frei-202
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTheit, einen eigenen Zugang aus seiner Perspektive zu finden" (PRENZEL 1990, S. 181).Wenn im Unterricht in <strong>die</strong>ser Weise gearbeitet wird, sind <strong>die</strong> Schüler bereit, selbst verpflichtendeLehrstoffe in ihre subjektiven Bedeutungsstrukturen einzubinden, sofernman ihnen nur unterschiedliche Zugänge und Erarbeitungsweisen erlaubt.Eine Interesse erweckende Frage hat immer eine affektive Komponente. Denn wennetwas subjektive Bedeutung gewinnt, wenn es als wichtig für einen selbst betrachtetwird, führt das zu einer emotionalen Erregung oder Spannung. Eröffnet der Umgang miteinem Gegenstand Wissens- und Fähigkeitserweiterungen oder neue Handlungsmöglichkeiten,wird <strong>die</strong> ausgelöste emotionale Erregung als positiv und förderlich erlebt. DerLehrer kann sie freilich ins Negative kehren, wenn er keine Geduld hat und <strong>die</strong> Schülerzu Ergebnissen drängt oder wenn er bestimmte Formulierungen von ihnen will.Dagegen kann <strong>die</strong> Bedeutung, <strong>die</strong> allein durch den Hinweis <strong>auf</strong> Noten oder Zeugnisse"oder eine ferne Zukunft" entsteht, Schüler kaum zu einer intensiven, selbständigen, auseigenem Antrieb gespeisten Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen bringen; "imGegenteil, sie verhindert sie geradezu" (PRENZEL 1990, S. 181; ähnlich GROLNICK / RY-AN 1987).Die problemorientierte Auffassung von FehlernAus problemorientierter Sicht kann unser Wissen nichts anderes als eine freie Konstruktionvon Vermutungen oder Theorien sein. Bei wirklichkeitsbezogenen Theorien kannman durch den Vergleich mit der Realität lediglich feststellen, ob sie falsch sind. Aberauch, wenn sie sich in allen Tests bewähren, kann man kann niemals sicher sein, ob sieauch fehlerfrei oder wahr sind. Sie gelten vielmehr als vorläufige Problemlösungen, <strong>die</strong>durch bessere ersetzt werden können.Bei Regelsystemen, wie sie etwa dem Gebrauch von Sprachen zugrunde liegen, handeltes sich um Konventionen, <strong>die</strong> in einem langen Prozess geschaffen wurden, und von denenman annehmen kann, dass sie nicht vollkommen sind. Deshalb werden sie auch z.T<strong>auf</strong>grund von Schwierigkeiten, sie einzuhalten, z.T. weil abweichende Regeln in derPraxis sich <strong>auf</strong>grund größerer Einfachheit durchgesetzt haben, stets gewissen Veränderungenausgesetzt sein. Auch <strong>die</strong> bestehenden Konventionen werden danach als vorläufigeLösungen für Probleme betrachtet, für <strong>die</strong> immer weiter nach besseren Lösungengesucht wird.203
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWenn Schüler Fehler im Umgang mit unserem vorläufigen Wissen und mit unseren unvollkommenenKonventionen machen, dann sind beispielsweise Abweichungen vomStandard der Rechtschreibung als Versuche des Schülers <strong>auf</strong>fassen, <strong>die</strong> konventionellenRegeln nachzuvollziehen und zu verstehen. Das bedeutet, dass im problemorientiertenUnterricht Fehler als Anlässe für <strong>die</strong> Entdeckung von Zusammenhängen zu betrachtensind, <strong>die</strong> bisher womöglich unberücksichtigt geblieben sind. Dabei ist es sinnvoll, wenn<strong>die</strong> Schüler selber oder gegenseitig ihre Lösungen prüfen. Tatsächlich sind Mitschüler invielen Fällen <strong>die</strong> effektiveren Helfer (vgl. CLOWARD 1967; BECK u.a. 1991). Entscheidendist, dass <strong>die</strong> Schüler als denkende und nach effektivem Wissen und Handeln strebendeIndividuen behandelt werden.Problemorientierung in der Entwicklung der KinderProblemorientierung ist <strong>die</strong> natürliche Haltung des Menschen von klein <strong>auf</strong>. Aber <strong>die</strong>Schule geht oft nicht dar<strong>auf</strong> ein, sondern traktiert <strong>die</strong> Kinder mit dem Lehrplan. Auchviele Eltern wissen nicht so recht, wie sie <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Haltung ihrer Kinder eingehen sollen.Sehen wir uns dazu folgende Dialoge (vgl. FEUERSTEIN 1980) an:Bitte geh in den Laden an der Ecke und k<strong>auf</strong> drei Flaschen Milch.Warum so viel?Weil wir soviel brauchen!Bitte geh in den Laden an der Ecke und k<strong>auf</strong> drei Flaschen Milch.Warum soviel?Morgen ist Sonntag; da sind <strong>die</strong> Geschäfte zu.Dem Kind kommt <strong>die</strong> Bitte, drei Flaschen Milch <strong>auf</strong> einmal zu k<strong>auf</strong>en, offenbar etwasseltsam vor. Im ersten Beispiel muss es sich mit einer Erklärung abfinden, <strong>die</strong> nicht überdas hinausgeht, was es schon vorher wusste, denn es wäre nicht gebeten worden, sovielMilch zu k<strong>auf</strong>en, wenn sie <strong>die</strong> Milch nicht brauchten, aber warum, wozu, weshalb?Wenn ein Kind immer solche Antworten erhält, mag es schließlich zu der Auffassunggelangen, dass <strong>die</strong> Welt einfach nicht verständlich ist. Nach Feuersteins Untersuchungenleiden solche Kinder unter einer "reduced modifiability", einer verringerten Fähigkeit,sich zu ändern, d.h. zu lernen (vgl. FEUERSTEIN / HOFFMAN / JENSEN / RAND 1985).Solche Kinder mögen vieles wissen, soziale Gewohnheiten beherrschen usw., aber eshandelt sich für sie dabei um feststehende Gegebenheiten. Diese Kinder lernen nurschwer dazu und gewöhnen sich kaum an neue Situationen und neue Regeln. Sie bauenein sozusagen endgültiges Weltbild <strong>auf</strong>. Sie lernen reproduktiv bestimmte Ergebnisse.Da sie <strong>auf</strong>hören, nach Antworten <strong>auf</strong> ihre Fragen zu suchen, verringert sich ihre Fähig-204
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTkeit zu lernen. Wenn <strong>die</strong> Kinder genügend andere soziale Kontakte haben, kann <strong>die</strong>sereproduktive Lernhaltung <strong>auf</strong> das Elternhaus begrenzt bleiben. Alles, was von den Elternkommt oder mit Belehrung zu tun hat, wird von ihnen als reproduktiv zu lernende Gegebenheit<strong>auf</strong>gefasst. Außerhalb des Elternhauses, <strong>auf</strong> der Straße unter Gleichaltrigen könnensie in vieler Hinsicht geschickt und schlau sein und eine schnelle Auffassungsgabebesitzen (vgl. FEUERSTEIN / HOFFMAN / JENSEN / RAND 1985). 76Dialoge, <strong>die</strong> dem zweiten Beispiel entsprechen, regen das Kind dazu an, Hintergründezu erforschen, Bedingungen und dar<strong>auf</strong> abgestimmte Planungen zur Erreichung bestimmterZiele zu untersuchen. Das Kind lernt mit Argumenten umzugehen, es lerntForderungen und Hinweise <strong>auf</strong> zugrunde liegende Zusammenhänge zu prüfen. Es lernt<strong>die</strong> unausgesprochenen, konnotativen Beziehungen zu erahnen oder mitzudenken, <strong>die</strong>dem Wortlaut einer Äußerung nicht unmittelbar anzusehen sind. Insbesondere auch imHinblick <strong>auf</strong> das Lernen sozialer Regeln sind solche Fähigkeiten von grundlegender Bedeutung.Denn soziale Regeln sind im Unterschied zu Befehlen nicht <strong>auf</strong> eine ganz bestimmteHandlung bezogen, sondern stecken einen Raum von Möglichkeiten ab, d.h. siemüssen interpretiert und verstanden werden.Feuerstein konnte zeigen, dass Kinder, deren Lerngeschichte von überwiegend ergebnisorientiertenErziehungsbedingungen geprägt war, durch <strong>die</strong> Bewältigung von interessantenProblem<strong>auf</strong>gaben sich nach einer gewissen Zeit ganz normal entwickelt haben.Die Beseitigung von Lernstörungen durch ProblemorientierungLernstörungen entstehen nach FEUERSTEIN (1983) durch inadäquate Lerngelegenheiten,d.h. insbesondere durch ergebnisorientierte Lernanforderungen, <strong>die</strong> rezeptivreproduktivesLernen fordern. Stellt man in ihrer Entwicklung retar<strong>die</strong>rten Kindern oderJugendlichen aber vor Probleme, d.h. Aufgaben, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Anwendung forschendentdeckenderOperationen von ihnen fordern, dann werden damit <strong>die</strong> Ursachen für <strong>die</strong>Retar<strong>die</strong>rung, <strong>die</strong> offenbar in ergebnisorientierten Lernanforderungen liegen, beseitigt.Freilich dürfen in der Anfangsphase nicht zu hohe Anforderungen an das selbständigeErforschen und Entdecken gestellt werden. Die Schüler brauchen anfangs noch Hilfeund Ermutigung. Sie müssen sich daran gewöhnen, nicht impulsiv, sondern überlegt zu76Wie <strong>die</strong> Erfahrung zeigt, halten Schüler sich im lehrergelenkten Unterricht oft auch dann an <strong>die</strong> Anweisungendes Lehrers, wenn <strong>die</strong>se offensichtlich unsinnig sind. Sollen sie dagegen in eigener Verantwortungumfangreiche Aufgaben mit Hilfe von Arbeitsblättern erledigen, <strong>die</strong> Anleitungen undHinweise geben, dann gleichen sie Unstimmigkeiten oder unpraktikable Anweisungen usw. selbständigaus.205
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFThandeln, indem sie eine Annahme formulieren und <strong>die</strong>se prüfen: hat sie sich bewährt?Warum trifft sie zu? Warum nicht? Der typischen Impulsivität ist durch eine entsprechendeBegleitung zu begegnen. Wenn sie Fehler machen, sind <strong>die</strong> Ursachen der Fehlerzu suchen, indem man den Gedankengang des Schülers ernst nimmt und zurückverfolgt.Auch wenn schwere Lernstörungen im frühen Kindesalter entstanden sind, können siedurch adäquate Lernbedingungen oft noch verändert und Retar<strong>die</strong>rungen nicht seltendeutlich verringert werden. Häufiger als gemeinhin angenommen, können selbstschlimmste Fälle eine günstige Wendung nehmen (vgl. CLARKE/CLARKE 1976). Auchwenn <strong>die</strong> Umstellung <strong>auf</strong> problemorientierte Lernbedingungen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Übung forschendentdeckender Operationen fordern, erst spät erfolgt, können noch erstaunliche Korrekturenerzielt werden, wie FEUERSTEIN (1983, S. 10) an Beispielen wie dem des 15-jährigenM. darstellt:M. war zur Verwahrung ins Heim überwiesen worden. In den vorliegenden Berichtenwurde sein „IQ zwischen 35 und 45 angegeben. M.s Wortschatz bestand aus 40-50 Wörternund er zeigte ernste Beeinträchtigungen der raum-zeitlichen Orientierung, der Fähigkeitzur Nachahmung, der Gedächtnisleistungen und des Sozialverhaltens.“ Unter dendenkbar ungünstigsten Verhältnissen <strong>auf</strong>gewachsen, zu früh und mit zu geringem Gewichtgeboren, „litt M. von Geburt an einem Gehirnschaden“.Feuerstein wendete das vom ihm entwickelte Learning Potential Assessment Device an,einen Test, der im Unterschied zu Intelligenztests nicht <strong>die</strong> Leistung festzustellen sucht,<strong>die</strong> bei einem gegebenen Maß an Fähigkeiten erbracht wird, sondern das Lernpotential<strong>auf</strong>decken soll (vgl. FEUERSTEIN 1979). Dieser Test zeigte, „entgegen allen Erwartungen... eine erstaunlich hohe Lernkapazität“.Nach 11 Jahren intensiver Betreuung, in denen M. mittels problemorientierter AufgabenOperationen des forschend-entdeckenden Lernens wie Vergleichen, antizipatorischesund schlussfolgerndes Denken, Analogien bilden usw. erwarb, ist er zu einem selbständigenjungen Mann geworden, sprachlich gewandt und mit „einem Sinn für Humor, sozialenFertigkeiten und beruflichen Ambitionen. Er ist verantwortlich für den Betriebeines großen Hallenschwimmbads und hat Französisch und etwas Deutsch gelernt. TrotzM.s belasteter Erbanlagen, organischem Schaden“ und extremer frühkindlicher Deprivationkonnte er sich noch zu dem relativ späten Zeitpunkt, an dem man ihn in lebenslänglicheHeimverwahrung geben wollte, in einer adäquaten Lernumwelt mit problemorientiertenLernhilfen zu einem anpassungsfähigen intelligenten Menschen entwickeln, dersein Leben selbstverantwortlich gestalten kann.206
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTFEUERSTEIN berichtet etliche Fälle von Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren,<strong>die</strong> in hohem Maß impulsiv, manchmal auch aggressiv und unvorhersehbar reagierten,<strong>die</strong> <strong>die</strong> Sprachbeherrschung von 6- bis 8-jährigen sowie extrem eingeschränkte Rechenfähigkeitenzeigten. Mit Hilfe eines Programms (Feuerstein Instrumental Enrichment,FIE), das dar<strong>auf</strong> ausgerichtet ist, an problemorientierten Aufgaben Operationendes forschend-entdeckenden Lernens zu üben und in verschiedenen Situationen anzuwenden,wurden erstaunliche Erfolge erzielt. Relativ viele <strong>die</strong>ser Kinder wurden späterselbst „Lehrer und Schulleiter und haben eine sehr viel optimistischere Haltung hinsichtlichder Möglichkeiten“ des Lernens angenommen (FEUERSTEIN 1983, 65).Es wurden auch mehrere Langzeituntersuchungen der Wirkungen des FIE durchgeführt.In einer <strong>die</strong>ser Untersuchungen wurden zwei Formen der Förderung miteinander verglichen(ebenda, S. 325 ff.). Die eine Gruppe erhielt eine allgemeine Förderung (GeneralEnrichment, GE), <strong>die</strong> dar<strong>auf</strong> ausgerichtet war, durch zusätzliche Hilfen, <strong>die</strong> Lücken imWissen und Können der Schüler zu schließen. Die andere Gruppe erhielt neben demsonstigen Unterricht das FIE, d.h. es wurden an problemorientierten Aufgaben gezieltforschend-entdeckende Operationen geübt und angewandt.Der größere Teil der am Programm beteiligten Kinder war schwer geschädigt. Die meistender Heranwachsenden im Alter von 12 bis 15 kamen aus Nordafrika. In ihren sozialenund intellektuellen Fertigkeiten lag <strong>die</strong> Entwicklung zwischen drei und sechs Jahrenunterhalb der Altersnorm. Viele hatten einen IQ zwischen 50 und 70 und sogar niedriger.Die Mehrzahl konnte entweder gar nicht oder nur begrenzt lesen und schreiben. Nurein Viertel beherrschte drei der vier Grundrechenarten. Im Handeln überwog eine ungezügelteImpulsivität und es bestand <strong>die</strong> Tendenz, sterotype und unangepasste Verhaltensweisenzu wiederholen.Nach zwei Jahren schnitten <strong>die</strong> Schüler, <strong>die</strong> das FIE erhalten hatten im Primary MentalAbilities sowie verschiedenen anderen Tests deutlich besser ab, als <strong>die</strong> Gruppe mit demProgramm der allgemeinen Förderung (GE), das eher ergebnisorientierte Aufgaben verwendete.Ein größerer Teil der Gruppen wurde, als <strong>die</strong> Schüler zwei bis drei Jahre nachAbschluss des Programms zum Militär eingezogen wurden, noch einmal hinsichtlichverschiedener Testleistungen verglichen werden. Jetzt schnitten <strong>die</strong> FIE-Probanden nochweit besser ab als <strong>die</strong> GE-Schüler. Die Kluft zwischen den Gruppen hatte sich erweitert.D.h., dass <strong>die</strong> Übung in forschend-entdeckenden Operationen anhand von problemorientiertenAufgaben nach Beendigung der Schule weit größere Transferleistungen ermög-207
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTlichte, als ein vorwiegend <strong>auf</strong> lehrplangemäße Kenntnisse und Fertigkeiten ausgerichtetesergebnisorientiertes schulisches Programm.Für <strong>die</strong> Verfügbarkeit forschend-entdeckender Operationen, wie problemorientierte Aufgabensie erfordern, spricht auch, dass Jugendliche aus Kulturen, <strong>die</strong> eine Kluft vonJahrhunderten von unserer modernen technologischen Gesellschaft trennt, sich schnellund leicht anpassen können, wenn sie zu uns kommen. Vermutlich haben sie als Kinderdurch Teilnahme an den in ihrer Umgebung anfallenden Fragen und Problemen ihreKultur <strong>auf</strong> forschend-entdeckende Weise erkundet. Die dabei angewandten forschendentdeckendenOperationen ermöglichen ihnen nun <strong>die</strong> Anpassung an <strong>die</strong> völlig anderenUmstände einer fremden Kultur (vgl. FEUERSTEIN 1983, 24 f.).KooperationKooperation ist zu verstehen als Zusammenarbeit, als gegenseitige Hilfe unter den Schülernsowie als Zusammenarbeit und Hilfe zwischen Lehrer und Einzelschüler oder Lehrerund Schülergruppe. Kooperation bedeutet zudem ein gegenseitiges Verstehen undAkzeptieren mit allen Stärken und Schwächen. Vor allem bedeutet es, dass der Lehrerlernen muss, seine Schüler so zu akzeptieren wie sie sind.Eine freie Kooperation ist nicht gut möglich, wenn der Lehrer über den Schülern stehtund ihre Leistungen bewertet und vergleicht. Unter Bedingungen der Kooperation sollteLeistungsbewertung, wenn es vorgeschrieben ist oder wenn <strong>die</strong> Schüler das wollen, eingemeinsamer Prozess sein. D.h. <strong>die</strong> Kinder schätzen ihre Leistung selbst ein, fragen anderenach ihren Einschätzungen und finden so zu einer angemessenen Leistungsbewertung,der in der Regel auch der Lehrer zustimmen kann.Es gibt verschiedene Bedingungen durch <strong>die</strong> Kooperation gefördert werden kann. So istes z.B. notwendig, dass <strong>die</strong> Schüler nicht im Gleichschritt lernen, sondern sich im Unterricht,geleitet durch ihre Interessen und entsprechende Aufgaben, mit verschiedenen Gegenständenbefassen. In <strong>die</strong>sem Fall haben Schüler mit ähnlichen Interessen Gelegenheitsich zusammen zu tun. Wenn andere Schüler später ähnliche Fragen bearbeiten, könnensie sich an <strong>die</strong> Kameraden wenden, <strong>die</strong> sich schon mit solchen Aufgaben befasst haben.Grundsätzlich fördert Verschiedenheit <strong>die</strong> Kooperation. Solche Verschiedenheiten bestehen<strong>auf</strong>grund der verschiedenen Gegenstände, <strong>die</strong> im Unterricht bearbeitet werden,den unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten der Schüler und, wie in Jena-Plan-208
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTSchulen üblich, durch altersgemischte Schüler-Gruppen, wobei <strong>die</strong> Älteren oder Fortgeschrittenerenals Helfer der anderen fungieren. Wenn solche Unterschiede bestehen undakzeptiert werden, haben <strong>die</strong> Schüler einander auch vieles zu bieten. Gerade <strong>die</strong> Verschiedenheitträgt zu einer komplexen Struktur von Schülergruppen bei. In einem solchenZusammenhang hat <strong>die</strong> Leistung des einzelnen den Sinn, einen Beitrag für dasGanze zu erbringen. Und von der Leistung des Einzelnen hat jeder Beteiligte einen Gewinn.Folgen von KooperationUntersuchungen zeigen, dass nicht nur gute, sondern auch durchschnittliche und selbstunterdurchschnittliche Schüler für Mitschüler, sogar wenn <strong>die</strong>se komplexe Lernschwierigkeitenund Defizite haben, nicht selten weit überlegenere Lehrer sind als selbst fachlichausgebildete Spezialisten (vgl. CLOWARD 1967). Vermutlich verstehen Schüler <strong>die</strong>Probleme ihre Kameraden besser als der Lehrer, dessen kognitive Struktur von der seinerSchüler so verschieden ist, dass er deren Denkwege nicht so einfach nachvollziehenund ohne weiteres verstehen kann. Die Erklärungen des Lehrers sind daher oft zu weitvon der Denkweise der Schüler entfernt.Ferner gewinnen Schüler, <strong>die</strong> anderen helfen, selber durch <strong>die</strong>se Tätigkeit. Indem sieanderen helfen, verstehen sie auch ihre eigenen Schwierigkeiten besser, weil sie ja <strong>auf</strong>einer Metaebene über das Lernen und <strong>die</strong> dabei angewandten Strategien nachdenken.Die Strategien, <strong>die</strong> sie für oder mit anderen entwickeln, können sie auch selber anwenden.Das scheint nicht nur für leistungsstärkere, sondern auch für leistungsschwächereSchüler zu gelten, <strong>die</strong>, wenn sie selbst Nachhilfe bekommen, <strong>auf</strong>grund erniedrigenderErfahrungen in der Schule eher rebellisch reagieren und kaum etwas hinzulernen. Wenn<strong>die</strong>se Schüler aber selbst noch schwächeren helfen und dabei sozusagen gemeinsam erfolgreichsind, dann scheint der Lerngewinn beim helfenden eher noch höher auszufallenals beim betreuten Schüler (vgl. CLOWARD 1967).Unter Kooperationsbedingungen können alle Schüler eine berechtigte Hoffnung <strong>auf</strong> Erfolghaben. Die Hoffnung <strong>auf</strong> Erfolg wird unter Kooperationsbedingungen jedenfallssehr viel seltener enttäuscht wird als unter der Bedingung des Wettbewerbs (vgl. SLAVIN1983). Die Aussicht, Leistungen erbringen zu können, <strong>die</strong> auch von anderen erkannt undanerkannt werden, fördert <strong>die</strong> Bereitschaft zur Mitarbeit, schon weil <strong>die</strong>s eine Möglichkeitdarstellt, den eigenen Selbstwert <strong>auf</strong>rechtzuerhalten. Die Schüler können beim kooperativenArbeiten weit mehr selbstwertstabilisierende Erfahrungen machen als im lehrergeleitetenFrontalunterricht.209
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWeil zudem bei gegenseitiger Hilfe <strong>die</strong> Aufmerksamkeit in erster Linie <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Aufgabegerichtet wird und nicht <strong>auf</strong> <strong>die</strong> eigenen Fähigkeiten, sind <strong>die</strong> Schüler unter <strong>die</strong>ser Bedingungnicht Ich-orientiert, sondern Aufgaben-orientiert. Bei Aufgaben-Orientierungerfahren <strong>die</strong> Lernenden zudem, dass der Erfolg nicht ausschließlich von den Fähigkeitendes Einzelnen, sondern auch von seiner Anstrengung, seinem Interesse, seinen Versuchen,<strong>die</strong> Zusammenhänge zu erkennen und von der Zusammenarbeit mit anderen, <strong>die</strong>etwas dazu beitragen können, abhängt (NICHOLLS 1990, S. 38).Wenn leistungsschwächere Schüler sehen, dass sie bei der gemeinsamen Arbeit auchselber nachvollziehbare und einsehbare, sachlich richtige Lösungen finden können,stärkt das ihre Handlungsorientierung. Sie gewinnen <strong>die</strong> <strong>die</strong> Einstellung, dass sie durcheigenes Tun fähiger werden, dass sie ihr Wissen erweitern und ihre Situation ändernkönnen. Sie brauchen weniger Verarbeitungskapazität für lageorientierte Reflexionen,und es gelingt ihnen, das Gefühl abzubauen, unfähig zu sein und nur herumgestoßen zuwerden.Außerdem führen sowohl Erfahrungen, anderen helfen zu können wie auch Erfahrungen,im Notfall nicht allein gelassen zu werden, zu positiven Gefühlserlebnissen, was sichletztlich in einem angenehmeren Klassenklima bemerkbar macht. Dadurch wird <strong>die</strong> sozialeBindung bzw. das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gruppe gestärkt. Schon kurzfristigträgt <strong>die</strong>s zu einer Besserung der Disziplin in der Klasse bei. Denn wenn <strong>die</strong> Schüler <strong>die</strong>Erfahrung machen, dass <strong>die</strong> bestehende Unterrichtsordnung ihnen hilft, erscheint es ihnenauch sinnvoll, <strong>die</strong>se Ordnung zu stützen (vgl. LAZAROWITZ/ SCHACHAR 1990).In einer Reihe von Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass leistungsschwacheSchüler in leistungsheterogen Lerngruppen eher Durchschnittsniveau erreichen alswenn sie alleine lernen (vgl. HOFSTÄTTER 1967, S. 85; SHARAN 1990; SLAVIN 1983;DIETRICH 1991). Insbesondere bei Unsicherheiten vermitteln Lerngruppen oder Lernpartnerschaftendem Einzelnen <strong>die</strong> für sie wichtige Sicherheit (vgl. BECK u.a. 1991). Siesind dann nicht <strong>auf</strong> sich allein gestellt, können Probleme mit anderen besprechen, eigeneLernstrategien finden und ausprobieren, Hilfsmittel verwenden und auch außerhalb ihrerLerngruppe um Rat fragen. Nach und nach trauen sich dann auch schlechtere Schülerimmer mehr zu und werden aus der Sicherheit heraus zusehends selbständiger.Nach den vorliegenden Ergebnissen sind <strong>die</strong> Leistungen beim kooperativen Lernen zumindestgenauso hoch wie beim lehrergeleiteten und -kontrollierten Unterricht (SLAVIN1983, S. 31 ff.). Vermutlich würde das Ergebnis im Vergleich mit Unterricht unter forciertenWettbewerbsbedingungen noch günstiger zugunsten des kooperativen Lernens210
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTausfallen. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass bei Kooperation neben kognitivenja auch wichtige soziale Fähigkeiten erworben werden.Die Leistungssteigerungen bei kooperativem Lernen dürften neben der Verminderungvon Stress, von lageorientierten Reflexionen und vermehrten Möglichkeiten der Selbstwertbestätigungdurch <strong>die</strong> Förderung des Denkens und der Problemlösefähigkeit unterKooperationsbedingungen zu erklären sein. Da <strong>die</strong> Schüler bei Zusammenarbeit mitMitschülern eher bereit sind ihre Ansichten zu äußern und zu diskutieren, versuchen sieaktiv, ihre bestehenden kognitiven Schemata anzuwenden und bei erkannter Unzulänglichkeitumzuformen. Diese Umformung erwächst sozusagen aus dem jeweils individuellenWissen durch Konstruktion von Lösungshypothesen. Auf <strong>die</strong>se Weise differenzierensie ihr bestehendes Wissen und passen es an <strong>die</strong> Wirklichkeit an.Indem sich <strong>die</strong> Schüler beim kooperativen Lernen mit Argumenten und Gegenargumentenauseinandersetzen, betrachten sie einen Sachverhalt von verschiedenen Seiten. Sielernen daher nicht nur <strong>die</strong> zur Lösung führenden Wege kennen, sondern auch Irrwege,<strong>die</strong> aber zur Erkenntnis der Sachlage bedeutsam sind, weil man dadurch erst <strong>die</strong> Gründefür <strong>die</strong> Richtigkeit eines bestimmten Lösungsweges erkennt. Zudem zwingen geradeIrrwege dazu, das Wissen über einen Gegenstand zu durchforsten, zu prüfen und zu ordnen.Auf <strong>die</strong>se Weise werden bestehende Schemata tief greifend umgeformt. 77 Die Problemlösefähigkeitkann beim kooperativen Lernen gefördert werden, indem man <strong>die</strong>Schüler dazu anregt, über ihr Vorgehen nachzudenken. Dadurch verbessern sie ihre Lösungsstrategienund lernen, <strong>auf</strong> einer Metaebene zu argumentieren(vgl. BECK u.a. 1991).Durch den beim kooperativen Lernen in höherem Maß selbstbestimmten Lernprozess"verbeißen" sich <strong>die</strong> Schüler auch eher in <strong>die</strong> Probleme und schrauben mit zunehmendemVerständnis ihre Anforderungen selber immer höher, d.h. sie sind intrinsisch motiviert(vgl. WELLS / CHANG / MAHER 1990; SLAVIN 1983, S. 53 ff.).Kooperation und das Problem der NotenGrundsätzlich begünstigen Noten <strong>die</strong> Entstehung von extrinsischer Motivation. DieSchüler fangen an, wegen der Noten zu lernen und nicht weil <strong>die</strong> Sachen selber sie inte-77"Auch ist das Suchen und Irren gut", meinte Goethe zu Eckermann, "denn durch Suchen und Irrenlernt man. Und zwar lernt man nicht bloß <strong>die</strong> Sache, sondern den ganzen Umfang. Was wüßte ich vonder Pflanze und der Farbe, wenn man meine Theorie mir fertig überliefert und ich beides auswendiggelernt hätte! Aber daß ich eben alles selber suchen und finden und auch gelegentlich irren mußte, dadurchkann ich sagen, daß ich von beiden Dingen etwas weiß, und zwar mehr als <strong>auf</strong> dem Papieresteht." (ECKERMANN 1976, S.590 f.)211
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTressieren. Gute Noten machen <strong>die</strong> Schüler überheblich, schlechte machen sie mutlos.Aus pädagogischer Sicht machen Noten schlicht und einfach keinen Sinn. Benotungensind ungenau und ungerecht. Es ist einfach absurd <strong>die</strong> Leistungsfähigkeit der gesamtenBevölkerung <strong>auf</strong> einer Notenskala einzustufen. Wenn man <strong>die</strong>se Zerstörung des Sachinteressesvermeiden möchte, muss man Leistungsvergleiche grundsätzlich <strong>auf</strong>geben. Dader einzelne Lehrer eine solche Entscheidung im Rahmen der mir bekannten Schulsystemeaber nicht treffen darf, stellt sich <strong>die</strong> Frage nach verbleibenden Handlungsmöglichkeiten.Wenn ein Lehrer sich des Problems der Leistungsbewertung bewusst ist, wird er damitanfangen, Noten nicht mehr so ernst zu nehmen. Es kommt ihm nicht dar<strong>auf</strong> an, <strong>die</strong>Kinder und Jugendlichen zu bewerten, sondern er will ihnen helfen, das was sie können,so gut wie möglich zu tun. Er will ihnen helfen, in ihren Fähigkeiten zu wachsen, Zusammenhängezu erkennen, stark zu sein und ihr Leben mit Mut und Freude führen.Wenn er aus solchen Motiven heraus in seiner Klasse Kooperationsbedingungen einführt,werden dadurch nebenbei auch <strong>die</strong> Leistungen steigen. Wenn aber der Leistungsstandardin einer Klasse insgesamt steigt, wird man es durchaus rechtfertigen können,wenn der Notendurchschnitt besser ausfällt, als er nach der Normalverteilung sein dürfte.Denn es ist klar, dass der Lehrer aus Gründen der Aufrechterhaltung der Normalverteilungden Notenspiegel nicht gleich halten kann. Das würde seinen pädagogischen Zielenwidersprechen, würde ihn insgesamt unglaubhaft machen und hätte selbstverständlichauch zerstörerische Folgen für <strong>die</strong> Leistungsbereitschaft und Lernfreude seinerSchüler. Es bleibt also nur der Weg, dass der Lehrer das Problem mit seinen Schülern inaller Offenheit bespricht und gemeinsam mit Ihnen nach einer tragfähigen Lösung sucht.Lösungsansätze sind beispielsweise in einer Kombination aus der Selbstbewertung derSchüler, kriterienbezogener Leistungsbewertung (HELLER 1974, S. 137 ff.) und direkterLeistungsvorlage (VIERLINGER 1999; 1990 S. 56 ff.) zu sehen.Bei der kriterienbezogene Leistungsmessung wird, im Unterschied zur gruppennormbezogenenLeistungsbewertung, nicht gemessen, welcher Rangplatz einem Schüler zukommt,sondern in welchem Ausmaß er eine Sache beherrscht.Beim Konzept der „Direkten Leistungsvorlage“ werden nicht <strong>die</strong> Noten, sondern <strong>die</strong>Leistungen selbst, also "direkt" vorgelegt. Das sagt weit mehr als eine bloße Ziffer.Wenn Schüler beispielsweise Jahresarbeiten zu sie interessierenden Themen schreiben,können <strong>die</strong>se als Leistungen in einer Mappe zusammengefasst und zur direkten Vorlageverwendet werden. Je nach Fach können das auch Zeichnungen, Gemälde, Werkstücke,212
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTon- oder Video<strong>auf</strong>nahmen usw. sein, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Schüler anfertigen. Bei solchen selbst gewähltenArbeiten sind <strong>die</strong> Schüler ja hoch motiviert und geben ihr Bestes. Solche Arbeitenkönnen <strong>die</strong> Schüler bei Bewerbungen vorlegen. Sie vermitteln dem Beurteiler in derRegel einen weit genaueren Einblick in <strong>die</strong> Fähigkeiten und Leistungen eines Bewerbersals <strong>die</strong> undifferenzierten Ziffernnoten (vgl. VIERLINGER 1990, S. 58 ff.; 1999).Für den Schüler bedeutet <strong>die</strong> "Direkte Leistungsvorlage", dass er mit der Hilfe der Schule– und hier wiederum insbesondere durch <strong>die</strong> Kooperation mit anderen – seine besonderenInteressen und damit auch bestimmte individuelle Fähigkeiten entwickeln kann.Eben weil <strong>die</strong> Leistung <strong>auf</strong> einem oder mehreren Interessengebieten des Schülers erbrachtund anderen Interessierten vorgestellt wird, kann dadurch eine realistische Selbsteinschätzungdes Schülers gefördert werden. Möglicherweise wird dadurch dann auchder Ehrgeiz angestachelt, <strong>die</strong> eigene Leistung, wenn der Schüler erkennt, dass sie unterdem eigenen Anspruchsniveau zurückbleibt, zu steigern. Zudem kann der Schüler darineinen Ausgleich für vielleicht nicht so zufrieden stellende Noten sehen.213
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTeil VDiskussion schulischer RahmenbedingungenDie wesentlichen Rahmenbedingungen der Schule sind ihre Ziele, <strong>die</strong> Organisation, mitder man <strong>die</strong>se Aufgaben zu erreichen versucht und <strong>die</strong> abhängige oder autonome Stellungder Einrichtung. Diese Rahmenbedingungen entsprechen bestimmten Grundmustern.Im konkreten Fall können sie natürlich recht unterschiedliche Formen haben, dennochlassen sie sich dem einen oder dem anderen der zu beschreibenden Grundtypenzuordnen.Die Rahmenbedingungen bestimmen zum Teil das Lehrerverhalten sowie <strong>die</strong> Unterrichtsumgebung.Insbesondere begünstigen sie <strong>die</strong> Anwendung von Maßnahmen, <strong>die</strong>entweder vom einzelnen Schüler mit seinen Bedürfnissen und Interessen ausgehen odervon gesellschaftlichen Erwartungen, wie sie in den bürokratischen Vorgaben Schulverwaltungzum Ausdruck kommen. Über <strong>die</strong>se Wirkungskette tragen entsprechende Rahmenbedingungenzumindest mittelbar zur Entstehung und Aufrechterhaltung zentralerProbleme der Schule wie geringe Lernmotivation, Disziplinschwierigkeiten, unzureichendeLeistungen usw. bei. Eine Änderung der Rahmenbedingungen kann daher amehesten <strong>die</strong> Probleme der Schule lösen helfen.Wesentlich dazu ist eine differenzierte Zieldiskussion, <strong>die</strong> bisher kaum geführt wordenist. D.h. ob <strong>die</strong> Auswahl von Eliten bereits im frühen Schulalter beginnen muss, indemSchüler regelmäßig Leistungsprüfungen unterworfen werden, oder ob man <strong>die</strong> Leistungsprüfungenfür einen Zeitpunkt <strong>auf</strong>hebt, wo <strong>die</strong> Schüler gut vorbereitet worden sind,und sich dem Wettbewerb besser gerüstet stellen können. Kinder, <strong>die</strong> erst einmal Selbstsicherheiterwerben können bevor sie Wettbewerben ausgesetzt werden, scheinen bessermit <strong>die</strong>sen umgehen zu können.214
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT20. Die Ziele: Gesellschaftliche Erwartungen vs.Entfaltung der PersönlichkeitDie Schule soll Grundwissen und Grundfertigkeiten vermitteln, <strong>die</strong> Schüler für das Berufslebenund <strong>die</strong> Rolle des Staatsbürgers sowie <strong>auf</strong> ein selbstverantwortliches Lebenvorbereiten (vgl. DREEBEN 1968). Das ist <strong>auf</strong> verschiedene Weise möglich und hängtganz wesentlich von unserem Menschenbild ab.Betrachtet man das Individuum im Wesentlichen als Teil und Produkt der Gesellschaft,wird man es für gerechtfertigt halten, <strong>die</strong> Schüler weitgehend den jeweils als wünschenswertgeltenden gesellschaftlichen Anforderungen zu unterwerfen und sie <strong>die</strong>sen Zielenentsprechend zu formen.Sind wir dagegen der Auffassung, dass der Einzelne bereits alles in sich trägt, was ihn zueinem vollkommenen menschlichen und gesellschaftlichen Wesen machen kann, dannkommt es in Elternhaus und Schule vor allem dar<strong>auf</strong> an, Bedingungen zu schaffen, unterdenen Kinder und Jugendliche ihr Potenzial in bestmöglicher Weise entfalten können.Erst dadurch erhält das Individuum <strong>die</strong> Möglichkeit, einen originären Beitrag zum Ganzenzu leisten.Bei <strong>die</strong>sen Menschenbildern handelt es sich um wertbestimmte Grundsätze. Im Folgendengeht es darum, Einflüsse <strong>die</strong>ser Menschenbilder <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Gestaltung schulischerRahmenbedingungen darzustellen und zu untersuchen, wie sie sich <strong>auf</strong> den Unterrichtund letztlich <strong>die</strong> Schüler auswirken können.Die so genannten LeistungsanforderungenGesellschaftliche Anforderungen betreffen <strong>die</strong> Reproduktion kultureller Systeme undden Erwerb grundlegender Qualifikationen, <strong>die</strong> Reproduktion der Sozialstruktur bzw.<strong>die</strong> Verteilung sozialer Positionen sowie <strong>die</strong> Reproduktion "von solchen Normen, Wertenund Interpretationsmustern ..., <strong>die</strong> zur Sicherung ... (von) Herrschaftsverhältnissen<strong>die</strong>nen" (FEND u.a. 1976; S. 8). Dies soll erreicht werden indem <strong>die</strong> Schule alles das tut,was von den Lehrplänen oder Bildungsstandards gefordert wird. D.h., <strong>die</strong> Schule sollbestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und <strong>die</strong> Schüler je nach Leistungsniveaumit entsprechenden Qualifikationsnachweisen versehen. Es überwiegt der gesellschaftlicheAnspruch, <strong>die</strong> Kinder und Jugendlichen im Hinblick <strong>auf</strong> soziale Erfordernisseauszubilden und zu formen.215
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDas ist in der Regel verbunden mit der Aufgabe, <strong>auf</strong> das Leben in der bestehenden Sozialstrukturvorzubereiten (vgl. FEND u.a. 1976, S. 7 ff.). In jeder Gesellschaft gibt es verschiedeneSchichten, wobei der Aufstieg bzw. <strong>die</strong> Zugehörigkeit zu höheren Schichtenstets mit besonderen Gratifikationen verknüpft ist. Familien der oberen Schichten wollendaher ihre Position behalten oder verbessern, während <strong>die</strong> unteren eher nach oben streben.Das bei uns weithin anerkannte Kriterium für <strong>die</strong> Verteilung sozialer Positionenwird in der Leistung oder Leistungsfähigkeit des Einzelnen gesehen.Vom Aspekt <strong>die</strong>ser gesellschaftlichen Anforderungen ist das Schwergewicht der Schule<strong>auf</strong> einen Prozess der Leistungsforderung und Leistungserbringung mit anschließenderLeistungsprüfung zu legen. Die Verteilung sozialer Positionen sollte dann abhängig seinvom gesellschaftlichen Wert der erworbenen Qualifikationen. Unter <strong>die</strong>sem Aspekt hatSCHELSKY (1957, S. 18 ff.) <strong>die</strong> Schule als "Zuteilungsapparatur von Lebenschancen"verstanden.Die Betonung gesellschaftlicher Anforderungen führt im Unterricht – wie WALLER(1932, 1965, S. 195 f.) es formuliert hat – zu einem Verhältnis "institutionalisierter Dominanzund Unterwerfung." Der dadurch entstehende Konflikt zwischen Lehrer undSchüler,"kann in seiner Stärke zwar gemildert werden, aber selbst wenn er weitgehend imVerborgenen schwelt, ist er dennoch stets vorhanden. Der Lehrer steht für <strong>die</strong>Gruppe der Erwachsenen, <strong>die</strong> immer der Feind des spontanen Lebens der Gruppeder Kinder ist. Der Lehrer steht für den formalen Lehrplan, zu dessen Erfüllung erden Schülern Aufgaben <strong>auf</strong>erlegt; <strong>die</strong> Schüler sind mehr am Leben ihrer eigenenWelt interessiert als an den langweiligen Bruchstücken des Erwachsenenlebens,<strong>die</strong> <strong>die</strong> Lehrer anzubieten haben... Schüler sind das Material, in dem <strong>die</strong> Lehrer ihreErgebnisse erzielen sollen. Schüler sind auch menschliche Wesen, <strong>die</strong> sichselbst in ihrer eigenen spontanen Weise verwirklichen möchten und ihre eigenenResultate <strong>auf</strong> eigenen Wegen anstreben. Jede <strong>die</strong>ser feindlichen Parteien steht deranderen im Weg; insoweit <strong>die</strong> Ziele einer von ihnen realisiert werden, erfolgt es<strong>auf</strong> Kosten der anderen... (Aber) der Ausgang des Kampfes ist vorherbestimmt"(Übers. H.L.).Folgen für das Selbstbild von LehrernWie das Zitat von WALLER verdeutlicht, führen gesellschaftliche Leistungsanforderungenim Unterricht zu einem hohen Ausmaß an Fremdbestimmung. Nun kann das Lehrer-Schüler-Verhältnis heute sicher nicht mehr angemessen mit den Worten "Dominanz und216
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTUnterwerfung" beschrieben werden. Der Lehrer hätte wohl auch kaum <strong>die</strong> erforderlichenDruckmittel dazu. Letztlich jedoch fordert der Lehrplan von ihm, abweichende Bedürfnisseund Interessen der Schüler zu übergehen.Die Fülle der in jedem Fach zu vermittelnden Lehrinhalte trägt ferner dazu bei, dass <strong>die</strong>Lehrer ihren Unterricht im Wesentlichen ergebnisorientiert gestalten werden. D.h. sieneigen dazu, Auffassungen, Theorien, Methoden usw. als fertige Produkte darzubieten,<strong>die</strong> <strong>die</strong> Schüler in ihr Gedächtnis <strong>auf</strong>zunehmen und / oder anzuwenden haben.Mit der regelmäßigen Durchführung geforderter Leistungsprüfungen und Benotungenwird der Lehrer schließlich ein Klima des Wettbewerbs erzeugen. Auch wenn er durchHilfsangebote, gute Vorbereitung und andere Angst reduzierende Mittel <strong>die</strong> <strong>Auswirkungen</strong>des Wettbewerbs ein wenig mildert, sind sie doch nicht zu beseitigen. Werden Prüfungenund Noten benutzt, um Druck auszuüben, verschärft das noch das Wettbewerbsklima.Einige Folgen <strong>die</strong>ser Unterrichtsbedingungen <strong>auf</strong> das Selbstbild von Lehrern und Schülernlassen sich anhand der Ergebnisse einer Befragung an hessischen Gesamtschulen<strong>auf</strong>zeigen (vgl. ECKERLE / KRAAK 1993). Diese Art von Gesamtschulen spiegelt im Wesentlichendas übliche dreigliedrige Schulsystem, denn kooperative Gesamtschulen sindeigentlich nur leicht modifizierte dreigliedrige Schulen. Nach der Grundschule kommen<strong>die</strong> Schüler zunächst in eine 2-jährige Orientierungsstufe, so dass <strong>die</strong> Auslese erst zumEnde des 6. Schuljahres erfolgt. Die Schüler sind im Unterricht getrennt, haben aber inden Pausen Gelegenheit, Kontakt zueinander <strong>auf</strong>zunehmen und sich auszutauschen. DieBefragungen wurden an je zwei großstädtischen, mittelstädtischen und drei kleinstädtisch-ländlichenSchulen durchgeführt. "Die Charakterisierungen von Lehrern benachbarterSchulen" reichten von chaotisch über ordentlich bis hin zu elitär (ECKERLE /KRAAK 1993, S. 6) Die Autoren vermuten, "daß <strong>die</strong> befragten Schüler weder spezifischhessische Stellungnahmen abgegeben haben noch ausgesprochen gesamtschultypische,daß sie also weitgehend repräsentativ für ihre Altersklasse im deutschsprachigen Raumgeantwortet haben. Grund für <strong>die</strong>se Vermutung ist <strong>die</strong> eindrucksvolle Gleichförmigkeitder Antworten sowie <strong>die</strong> Übereinstimmung einiger Ergebnisse mit anderen Erhebungenbei Jugendlichen" (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 9).Zunächst zu den Lehrern:Die Aufgabe, Schülern vorgeschriebene Inhalte zu vermitteln und im Anschluss daran zuprüfen und zu bewerten, in welchem Grad sie behalten wurden und angewendet werdenkönnen, engt <strong>die</strong> Handlungsmöglichkeiten von Lehrern entschieden ein. Dieser Rahmen217
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTlässt ihnen lediglich <strong>die</strong> methodische Freiheit, <strong>auf</strong> eine von ihnen bestimmte Weise z.B.<strong>die</strong> Integralrechnung oder <strong>die</strong> Kreuzzüge zu behandeln. Aber <strong>die</strong>se Freiheit kann alsbeträchtlich erscheinen, da kaum eine Kontrolle gegeben ist. Wenn <strong>die</strong> Lehrer Zusammenarbeitmit Kollegen nicht sehr <strong>auf</strong>geschlossen gegenüberstehen, hängt das vermutlichauch damit zusammen, dass sie dadurch eine Einschränkung <strong>die</strong>ser Freiheit befürchten.Diese „Freiheit“ ermöglicht ihnen, selbstbestimmt an Aufgaben zu arbeiten, "<strong>die</strong> siesinnvoll und interessant finden können", und sie scheinen darin auch <strong>die</strong> zentrale Möglichkeitberuflicher Erfüllung zu erblicken (vgl. ECKERLE / KRAAK 1993, S. 92). Doch<strong>die</strong>se Erfüllung ist offenbar nur schwer zu erreichen. Einerseits sind <strong>die</strong> Lehrer überzeugt,dass der Lernerfolg der Schüler von ihnen "sehr gut beeinflußbar" ist, andererseitsaber tritt er "nicht im gewünschten Maß ein", und was noch schlimmer ist, sie erwarten,dass er "in Zukunft weiter nachlassen" wird. Es verwundert also nicht, wenn im Schnitt<strong>die</strong> Zufriedenheit unter Lehrern gering ist. (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 149).Wer sich nicht in außergewöhnlicher Weise engagiert, muss lernen, mit unzulänglichemErfolg und spärlicher Anerkennung zu leben. Wenn man einerseits möchte, dass Schüler"viel lernen" und ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis besteht, andererseits aber betont,dass Anerkennung von Schülern und persönliche Kontakte zu ihnen keine besondereBedeutung für einen haben (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 92), will man damit erwartetenMisserfolgsrückmeldungen aus dem Wege gehen. Unter Rahmenbedingungen, <strong>die</strong> inhohem Maß "Fremdbestimmung", "Ergebnisorientierung" und "Wettbewerb" begünstigen,muss es ungeheuer schwierig sein, Unterricht zu machen, <strong>die</strong> Schüler schätzen undals profitabel bezeichnen. Es würde ja bedeuten, dass man <strong>die</strong> den gegebenen Umständenentgegen gesetzten Bedingungen von "Freiheit und Ordnung", "Problemorientierung"und "Kooperation" durchsetzen müsste.Auch unter den gegebenen widrigen Umständen stellt <strong>die</strong> Überzeugung, den Unterrichtserfolgbewirken zu können, eine notwendige Voraussetzung der Aufrechterhaltungdes beruflichen Selbstwertgefühls von Lehrern dar. Wenn man sich <strong>die</strong>ses Erfolgs abernicht sicher sein kann, muss man sich potentiell bedroht fühlen, zumindest ist man leichtverletzbar. Das könnte ein weiterer Grund dafür sein, dass Lehrer <strong>die</strong> Zusammenarbeitmit Kollegen nur schwach bewerten, dass ihnen persönliche Beziehungen zu Kollegennur "wenig erstrebenswert" erscheinen (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 92) und dass sie "dasZiel, Anerkennung von ihren Kollegen zu erhalten", brüsk zurückweisen (ECKERLE /KRAAK 1993, S. 148). Enge kollegiale Kontakte nämlich könnten in selbstwertbedro-218
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFThender Weise verdeutlichen, dass man selbst gesetzten Ansprüchen nicht in erwünschterWeise genügen kann (ähnlich ECKERLE / KRAAK 1993, S. 149).Die Arbeitsbedingungen werden von den Lehrern "pauschal als in Gegenwart und Zukunftunzureichend, aber auch nur wenig beeinflußbar bezeichnet" (ECKERLE / KRAAK1993, S. 147). Die Lehrer schätzen also ihre Möglichkeiten, <strong>die</strong> Entwicklung der <strong>Institution</strong>Schule mitzugestalten, als sehr gering ein. Deswegen konzentrieren sie sich <strong>auf</strong> denUnterricht, der ihnen wenigstens methodische Freiheit und entsprechende Handlungsmöglichkeitengewährt und igeln sich dort ein. Deswegen haben sie auch nur wenig mitder <strong>Institution</strong> Schule im Sinn. "Sie sehen sich nicht als Mitglieder einer Organisation,<strong>auf</strong> deren Funktionieren sie Einfluß nehmen möchten" (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 92).Die Schulreform liegt außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs.Folgen für das Selbstbild der SchülerDie Haltung der Lehrer, sich den gegebenen Umständen zu fügen und das zu tun, wassubjektiv am lohnendsten erscheint, spiegelt sich auch im Verhalten der von ECKERLE/KRAAK befragten Schüler der 9. Jahrgangsstufe.Die Fremdbestimmung wirkt sich erwartungsgemäß dergestalt aus, dass <strong>die</strong> "Wünscheder Schüler, wie und was sie lernen wollen" sich nicht mit dem Unterrichtsangebot decken,das ja keine wirklich freie Wahl nach den eigenen Interessen zulässt. Was sie lernenund im Unterricht tun, scheinen sie als nicht sehr sinnvoll zu erleben, es erscheintihnen nicht besonders nützlich und auch nur wenig interessant ( ECKERLE/ KRAAK 1993,S. 139).Sie erleben ihre eingegrenzten Handlungsmöglichkeiten und finden sich damit ab. NachJahren fremdbestimmten Lernens können sie sich oft kaum noch vorstellen, wie sieselbst den Unterricht mitgestalten könnten. Das geht soweit, dass sie Mitbestimmungsmöglichkeitenin Schule und Unterricht abschätzig bewerten und beurteilen (ECKERLE/KRAAK 1993, S. 140, 77).Im Rahmen unseres Modells sind solche negativen Erfahrungen mit selbständigem Lernensogar als wahrscheinlich anzunehmen. Wenn <strong>die</strong> Schüler nämlich <strong>auf</strong>grund desdurch <strong>die</strong> Rahmenbedingungen begünstigten ergebnisorientierten Unterrichts eine reproduktiveLernhaltung angenommen haben, dann muss es ihnen schwer fallen, eigene Pläneund Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Wenn aber eigene Pläne nicht entwi-219
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTckelt und ausgeführt werden können, wird das Denken träge und stumpf, statt tätig undenergisch. Man lässt sich lieber treiben und schiebt anderen <strong>die</strong> Verantwortung zu fürdas, was geschieht und zu geschehen hat.Die Haltung, dass man selber eigentlich nichts tun kann, überträgt sich vom Unterricht<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Schule insgesamt. Hier trifft <strong>die</strong> Haltung der Schüler <strong>auf</strong> <strong>die</strong> entsprechende Haltungder Lehrer, <strong>die</strong> in <strong>die</strong>ser Hinsicht ja selbst nicht an Handlungsmöglichkeiten glauben.Außerdem "erfordern Bemühungen der Schüler von denen, <strong>die</strong> sie unterstützen wollen,auch Durchhaltevermögen gegenüber anderen Interessen". Denn wegen zahlreicherBestimmungen ist es nicht nur kompliziert, sondern auch lähmend langwierig bei Schülervorschlägenz.B. "zur Schulorganisation oder zur Ausgestaltung ihrer Schule" zu Ergebnissenzu gelangen (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 142).Die Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten wirkt sich <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Leistungsfähigkeitder Schüler insgesamt lähmend aus. Denn obwohl <strong>die</strong> Schüler überzeugt sind, dass guteSchulbildung und gute Noten für ihr weiteres Leben große Bedeutung haben, dass siegern ihre schulische Leistung gern verbessern und nützliche Dinge lernen würden (ECK-ERLE/ KRAAK 1993, vgl. S. 37), beschränken sie sich zunächst <strong>auf</strong> das Notwendige undverschieben das Handeln <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Zukunft. Aber sie sind überzeugt, eigentlich mehr leistenzu können, wenn sie nur wollten (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 139). Diese Auffassungist nützlich für <strong>die</strong> Erhaltung des Selbstwerts und stellt zum anderen eine an <strong>die</strong> Schulegerichtete Schuldzuweisung dar, weil <strong>die</strong> Schüler gezwungen werden, aus ihrer Sichtmehr oder weniger Sinnloses zu lernen.Doch üben sich <strong>die</strong> Schüler nicht in offenem Widerstand gegen schulische Fremdbestimmung– vermutlich gehen sie davon aus, dass sie letztlich immer Verlierer wären –,sondern passen ihr Verhalten "den Notwendigkeiten an" (ECKERLE / KRAAK 1993, S.139). Eine gewisse Verweigerung allerdings lässt sich darin sehen, dass sie "Anerkennungvon Lehrern" bewusst nicht suchen. Dadurch entziehen sie sich dem Einfluss ihrerLehrer, weisen sie sozusagen zurück, signalisieren ihnen, so wichtig seid ihr für unsnicht, und unser Selbstwert hängt von euch bestimmt nicht ab' (ECKERLE / KRAAK 1993,S. 78, 137).Diese Haltung ist durchaus zwiespältig. Denn einerseits möchten <strong>die</strong> Schüler Sinnvollestun, arbeiten und etwas lernen, aber andererseits haben sie das Gefühl, "es lohnt sichnicht." Deshalb lehnen sie "<strong>die</strong>se Schule" ab und fügen sich, "weil es ja nun so sein muß... Schule selbst ist nicht wichtig; sie erhält ihre Bedeutsamkeit mittelbar, als notwendigeVoraussetzung" (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 85). Unter den Bedingungen von Fremd-220
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTsteuerung, Ergebnisorientierung fällt es den Schülern naturgemäß schwer, sinnvolle, d.h.für sie selbst bedeutsame Probleme zu erkennen an denen sie gern arbeiten und sich bewährenwürden.Eine weitere Folge gesellschaftlicher Leistungserwartungen ist, dass mit den gefordertenregelmäßigen Leistungsprüfungen ein Klima des Wettbewerbs erzeugt wird. Das mussnicht bedeuten, dass sozusagen jeder jederzeit andere auszustechen oder zu übertrumpfenversucht. Aber wenn beispielsweise schon durch den lehrergesteuerten und ergebnisorientiertenUnterricht, das Interesse an den Gegenständen sehr gering ist, wird Wettbewerbdazu beitragen, dass es durch den Zwang eine annehmbare Note zu erzielen ganzin den Hintergrund tritt. An <strong>die</strong> Stelle des Sachinteresses treten Ich-Orientierung undAnstrengungs-Vermeidungs-Orientierung. D.h. <strong>die</strong> Schüler möchten eher, dass man siefür der Situation gewachsen hält, dass sie den Eindruck machen, vollkommen "cool" zusein und / oder dass sie das, was von ihnen erwartet wird, mit wenig Aufwand hinter sichbringen.Die Schüler wissen, Erfolg "ist immer nur <strong>auf</strong> Kosten anderer zu erreichen, ... man kannimmer nur gewinnen, wenn andere verlieren" (FEND u.a. 1976, S. 186). Ihr Weltbild entsprichtbereits <strong>die</strong>ser Einsicht in das Gesetz des Wettbewerbs, bei dem andere als potentielleKonkurrenten betrachtet werden müssen, mit denen man also auch nicht kooperierendarf. Man kann Freunde haben, aber man kann nicht mit jedem gut Freund sein. DieFrage nach Zusammenarbeit mit anderen Schülern stößt <strong>auf</strong> eine reservierte Haltung,ebenso wie <strong>die</strong> Frage, ob man Anerkennung von ihnen erwarte. "Die Frage nach der Zusammenarbeitscheint so erlebt zu werden, als ob in <strong>die</strong> persönlichen Beziehungen derSchüler gleichsam verunreinigend schulische Beimischungen eingetragen würden." Zusammenarbeitist für <strong>die</strong> Schüler "kein Wert, der sich aus schulischen Situationen ergibt"(ECKERLE / KRAAK 1993, S. 136). Man ist zusammen mit Freunden und man arbeitetauch mit ihnen. Solche Freundschaftsbeziehungen entstehen durchaus in der Schule,aber das hat nichts mit geforderter Kooperation zu tun. Die Freunde tragen zur Erhaltungdes Selbstwerts bei, von ihnen hat man nichts zu befürchten. Man versucht jedes Risikoeiner Abwertung des Selbst zu begegnen. Deshalb zählt auch nur <strong>die</strong> Anerkennung dereigenen Freunde und nicht <strong>die</strong> der Mitschüler im allgemeinen (ECKERLE / KRAAK 1993,S. 137).Wettbewerb bedeutet für <strong>die</strong> Schüler, dass sie ihren Weg in einer im Grunde feindlichenWelt gehen müssen, dass sie sich behaupten und durchsetzen müssen. Nicht nur <strong>die</strong>Schule ist so organisiert, sondern alle gesellschaftlichen <strong>Institution</strong>en. Der Rückzug ins221
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTPrivate <strong>auf</strong> „gesicherte“ Positionen liegt nahe. Im begrenzten Bereich der Familie undFreunde glaubt man <strong>die</strong>se Sicherheit am ehesten zu finden. "Freunde haben" und "eingutes Zusammenleben in der Familie" sind denn auch <strong>die</strong> von den Schülern am höchstenbewerteten Lebensbereiche (ECKERLE / KRAAK 1993, S. 69). So gesehen, kann es kaumverwundern, wenn <strong>die</strong> Schüler "Menschlichkeit in unserer Gesellschaft" nur in geringemMaß für gegeben halten und auch nicht glauben, dass <strong>die</strong> Zukunft eine Besserung bringt(ECKERLE/ KRAAK 1993, S. 71 f.)21. Organisation des Unterricht: Mechanisierung vs.IndividualisierungSchule als <strong>Institution</strong> muss verwaltet bzw. organisiert werden. Die Organisation ist einwesentliches Mittel zur Erreichung der jeweiligen schulischen Ziele, wie auch immer<strong>die</strong>se beschaffen sein mögen. Sie kann <strong>die</strong>sen Zweck mehr oder weniger gut erfüllen undneben den erwünschten Wirkungen auch zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.PlanerfüllungWenn gesellschaftliche Leistungsanforderungen <strong>die</strong> Schule bestimmen, liegt es nahe,ihre Erfüllung durch eine mehr oder weniger detaillierte Planung von zu erwerbendenKenntnisse und Fertigkeiten, der dafür <strong>auf</strong>zuwendenden Zeit usw. herbeizuführen. DerLehrplan ist sozusagen <strong>die</strong> zentrale Instanz, <strong>die</strong> alle Aktivitäten leitet und alle Schüler<strong>die</strong>ser Einrichtung den gleichen Anforderungen unterwirft.Detaillierte Lehrplanvorschriften sind also blind gegenüber individuellen Unterschieden,sie führen dazu, dass <strong>die</strong> Inhalte immer weiter vermehrt werden, dass als Unterrichtsformder Frontalunterricht überwiegt, <strong>die</strong> Fachgrenzen betont werden und <strong>die</strong> Stundenpläneentsprechend der Vielfalt der Anforderungen zerfasern. Die Aufgaben des Lehrersbeschränken sich im Sekundarbereich im Wesentlichen <strong>auf</strong> das "Stundengeben" und <strong>die</strong>Wahrung der dazu erforderlichen Disziplin.Gleichbehandlung der SchülerLehrpläne enthalten in der Regel nur sehr begrenzte Wahlmöglichkeiten. Die verbindlichenLehrinhalte im Sekundarbereich sind derart umfassend, dass außerdem nur wenigZeit für ihre Abarbeitung verbleibt. Es kann also nur sehr begrenzt <strong>auf</strong> individuelle Inte-222
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTressen oder Neigungen von Schülern eingegangen werden. Ausnahmen bilden Projektwochen,Klassen- oder Stu<strong>die</strong>nfahrten usw. Ansonsten werden <strong>die</strong> Schüler auch an Entscheidungen,<strong>die</strong> Disziplin- oder Verhaltensregeln, <strong>die</strong> Organisation des Unterrichts usw.betreffen, zumeist im Interesse zügiger Durchführung nicht beteiligt.Das bedeutet ein hohes Maß an Fremdbestimmung. Solche Bedingungen werden vonSchülern als selbstwertbedrohend erfahren. Die Folgen bestehen u.a. in mangelnder Mitarbeit,Verringerung der Lernmotivation und Steigerung der Konfliktbereitschaft. DieseFolgen werden nur insofern gemildert, als <strong>die</strong> Fremdbestimmung zumeist in berechenbarenBedingungen besteht. Die Schüler wissen, was <strong>auf</strong> sie zukommt. Das gibt eine gewisseSicherheit, auch weil dadurch Möglichkeiten für selbstbestimmte Formen der Nutzungoder Ausnutzung der schulischen Regelungen eröffnet werden.Der Gleichbehandlung der Schüler entspricht ihre Gruppierung in Altersklassen, <strong>die</strong> imWesentlichen von Verwaltungsgesichtspunkten bestimmt ist. Bedürfnisse, Neigungenund Entwicklung der Schüler werden dabei kaum beachtet. Die Jahrgangsklasse setztvoraus, dass alle Schüler gleich schnell vorankommen. Wer im Gleichschritt nicht mitkommt,bleibt entweder sitzen oder wird mitgeschleift, was sehr ungünstige <strong>Auswirkungen</strong><strong>auf</strong> das Selbstwertgefühl und <strong>die</strong> weitere Entwicklung der Persönlichkeit der betroffenenSchüler hat (vgl. HÖHN 1972; PETILLON 1978).Eine andere Form der Einteilung der Schüler besteht in der Gruppierung nach Leistung.So werden beispielsweise in manchen Gesamtschulen <strong>die</strong> „wenig begabten“ Schüler inLeistungsfächern in gesonderten Gruppen zusammengefasst und mit leichten Aufgabengefördert. Trotz der guten Absicht werden <strong>die</strong>se Schüler dadurch aber eher stigmatisiert.Die Maßnahme verdeutlicht den Schülern, dass man im Grunde nur geringe Erwartungenan sie hat. Zudem werden dabei jedoch <strong>die</strong> Gefühle der Schüler ignoriert. So gabenacht- bis dreizehnjährige Schüler unterer Leistungsgruppen Beschreibungen wie <strong>die</strong> folgenden:"Schüler in der Untergruppe zählen nicht.""Ich bin in der höchsten Gruppe ... Schüler in den anderen Gruppen sind Unterentwickelte.""Sie sind einfach nicht gut genug.""Ich fühle mich wie jemand, der nicht sehr gut ist. Es bringt mich vom Lernen ab.Bald verwendest du deine Zeit dafür, Arbeit zu vermeiden.""Wenn man in der Untergruppe ist, fühlt man sich, als ob man aus dem Weg geräumtworden wäre. Es ist eine Art Bestrafung, weil man zu dumm ist, um <strong>die</strong> Arbeiten zumachen. Die merkst, <strong>die</strong> anderen können es; warum kannst du es nicht ... irgendwasmuß falsch sein."223
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTManche Schüler sagen, sie selbst seien nicht betroffen, aber andere: "Es kümmert einige;sie fühlen sich ziemlich blöd. Es hält sie vom Lernen ab, aber mir macht esnichts aus" (MASON 1974).Lerninhalte und breite AllgemeinbildungIst das Lehren in der Schule von Lehrplänen geleitet, führen veränderte Bedingungen zuneuen Anforderungen und Zusatzstoffen. KOZDON (199.., S. 64 ff.) spricht von einer"springflutartigen Vermehrung schulischer Additiva" wie Me<strong>die</strong>n- und Zukunftskunde,Technik- und Wirtschaftsunterricht, Informationstechnische Grundbildung, Friedens-,Interkulturelle und Umwelterziehung, Erziehung zu mehr Verständnis für ältere undbehinderte Menschen, ferner Verkehrs-, Sexual- und Gesundheitserziehung, Drogenprävention,Aufklärung über Okkultismus und Organspenden, Verbrechensvorbeugung undvieles andere mehr.Jeder Schüler soll eine breite Allgemeinbildung erwerben. Er soll nicht nur in größtmöglichemUmfang mit seiner Kultur vertraut werden, sondern auch instand gesetzt werden,zahlreiche Schwierigkeiten des Lebens mit Hilfe des in der Schule Gelernten bewältigenzu können. Doch inwieweit <strong>die</strong> Schule darin erfolgreich ist, ist sehr umstritten.FrontalunterrichtBei der Fülle der Stoffe, <strong>die</strong> jeder Schüler lernen soll, kann von Freiheit der Methodekaum noch <strong>die</strong> Rede sein. Denn um allen Schülern möglichst gleiche Informationen undLernbedingungen zu geben, scheint nur der Frontalunterricht geeignet, der ja auch innahezu allen Fächern <strong>die</strong> bei weitem überwiegende Unterrichtsmethode ist.Frontalunterricht bedeutet Fremdbestimmung der Schüler. Es verbleiben nur begrenzteMöglichkeiten für eigene Entscheidungen und selbstständiges Lernen. Frontalunterrichtist in der Regel ergebnisorientiert, d.h. der Schüler erhält Antworten, <strong>die</strong> ihn nicht interessieren,weil er noch gar keine Fragen gestellt hat. Weil Antworten <strong>auf</strong> nicht gestellteFragen kaum subjektive Bedeutung haben, sind solche Stoffe uninteressant und wenigsinnvoll. In solchen Fällen ist reproduktives Lernen, bei dem man <strong>die</strong> Inhalte kurzfristigspeichert, ohne sich intensiver mit der Sache auseinandersetzen zu müssen, das einfachste,um <strong>die</strong> nächste Prüfung zu bestehen. Die Fülle der Stoffe, im Frontalunterricht dargeboten,führt somit vielfach zu oberflächlichem Wissen und zur Verschüttung des Sachinteresses.224
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBetonung der FachgrenzenFachgrenzen sind nichts Natürliches; denn sie ergeben sich nicht aus der Sache. Die Unterscheidungvon Fächern gründet vielmehr in historischen Entwicklungen, zum Teil hatsie auch administrative Ursachen, da Lehrende für bestimmte Fächer oder Teilgebieteeines Faches angestellt werden. Vom Gesichtspunkt der Gewinnung von Wissen über<strong>die</strong> Wirklichkeit sind solche Unterscheidungen aber nicht von Bedeutung. Denn Wissenschaftlerbefassen sich nicht mit einem Fach, sondern mit ungelösten Fragen oder Problemen,auch wenn sie <strong>die</strong>se gewohnheitsmäßig einem Fach zuordnen. Überschreiten ihreTheorien bestehende Fachgrenzen, entstehen oft neue Fächer (vgl. POPPER 1972, S.67).Detaillierte Lehrpläne sind zumeist streng fächerbezogen. Inzwischen sind verstreuteHinweise <strong>auf</strong> Verknüpfungen mit anderen Bereichen üblich. Sie sollen helfen, <strong>die</strong> fachlicheBeengung wenigstens stellenweise zu durchbrechen.In der Schule hat <strong>die</strong> Betonung der Fachgrenzen verschiedene Folgen. Zunächst verführtsie zu ergebnisorientiertem Unterricht. Denn ein Fach zu lehren bedeutet, es in seineElemente wie Definitionen, Sätze, Regeln usw. zu zerlegen und <strong>die</strong>se dann schrittweisedarzubieten. Auf <strong>die</strong>se Weise führt der Lehrer <strong>die</strong> Schüler durch sein Fach wie durch einMuseum. Man "besichtigt" <strong>die</strong> Teile, man verwendet einzelne Elemente für Aufgaben,aber man geht kaum von Fragen oder erlebten Schwierigkeiten aus, <strong>die</strong> zur Suche nachLösungen anregen, und wobei man Entdeckungen machen, geeignete Mittel finden undsinnvoll anwenden lernen kann. Ein solches forschendes Vorgehen ist aber nicht gutmöglich, weil <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Schüler interessanten Probleme oft weder mit den Fachgrenzen,noch mit der Systematik des Faches zusammenfallen. Ihre Fragen gründen eher in praktischenoder Alltagserfahrungen und würden eine stärker exemplarische Auseinandersetzungmit bestimmten Bereichen des Faches erfordern, wobei <strong>die</strong> erforderlichen Grundlagenim Zusammenhang – also nicht systematisch – anzueignen wären.Die Beschäftigung mit Fächern anstelle von Problemen hat auch Konsequenzen für <strong>die</strong>Berufwahl. Weil <strong>die</strong> Interessen der Schüler vielfach mit den Fachgrenzen zusammenfallen,bleiben ihre beruflichen Vorstellungen oft vage und unklar. Denn Unterrichtsfächerund Berufe haben in der Regel nur begrenzt etwas miteinander zu tun.Zerfaserung der StundenpläneWenn es darum geht, Stundendeputate zur Erfüllung des Lehrplans zu verteilen, werdenEntscheidungen zumeist nach den rein mechanischen Kriterien von Verwaltungen getroffen.Da kann dann Französisch an einem Tag in der ersten und letzten Stunde <strong>auf</strong>225
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTdem Plan stehen, und wenn <strong>die</strong> Schüler sich nach 45 Minuten eingearbeitet haben, klingeltes. All das stärkt <strong>die</strong> Tendenz zu fremdbestimmtem, ergebnisorientiertem Unterrichten.Wozu soll man das Interesse der Schüler wecken, wenn man den Prozess nach wenigenMinuten wieder abbrechen muss, um <strong>die</strong> Ergebnisse zu sichern? Mit dem Stoffdurchzukommen wird wichtiger als andere Ziele.Stundengeben und Disziplinieren als Aufgaben des LehrersUnter solchen Bedingungen wird <strong>die</strong> Aufgabe des Lehrers im Wesentlichen <strong>auf</strong> Stundengebenreduziert. Der Lehrer steht vorne, gibt <strong>die</strong> Ziele an, erklärt, verteilt Aufgaben,leitet Unterrichtsgespräche, erarbeitet im fragend-entwickelnden Verfahren den Stoffusw. Für <strong>die</strong> Schüler ist der Tag damit ausgefüllt stillzusitzen und <strong>auf</strong>zupassen. Das istnicht leicht. Frontalunterricht zeichnet sich durch ein hohes Maß an Fremdbestimmungaus und ist dadurch eine er störanfälligsten Unterrichtsformen. Weil fast alle Aktivitätenvom Lehrer ausgehen und wieder zu ihm zurückl<strong>auf</strong>en, bedeutet jede abweichendeHandlung der Schüler einen Verstoß. Einen nicht geringen Teil des Unterrichts ist derLehrer damit beschäftigt, solche Schüler zur Ordnung zu rufen und zu disziplinieren.Die Förderung der Pläne von SchülernBesteht <strong>die</strong> Aufgabe der Schule darin, <strong>die</strong> Schüler zur Entwicklung und Ausführung vonPlänen anzuregen, dürfen <strong>die</strong> Vorgaben eines Lehrplans nur sehr allgemein sein, d.h. siemüssen Freiheit für eigene Entscheidungen der Schüler bieten. Es ist ferner eine Organisationerforderlich, <strong>die</strong> dem Lehrer eine Gestaltung entsprechender Unterrichtssituationenermöglicht und auch von ihm fordert.Für Schülerinteressen offenes und allgemeines MinimalcurriculumDie erste Bedingung ist ein für Schülerinteressen offenes und allgemeines Minimalcurriculum.Die Teilbedingung "für Schülerinteressen offen" bedeutet, dass <strong>die</strong> Schüler ihreErfahrungen hinreichend einbringen können bzw. ihre Erfahrungsbasis vordringlich berücksichtigtwird. Wie schon KERSCHENSTEINER (1914, S. 114) festgestellt hat, sind <strong>die</strong>"natürlichen Schülerinteressen" zunächst praktisch. Mit dem Ausdruck "praktisch" meinteer manuelle Arbeit. Hier wird <strong>die</strong>ser Ausdruck in dem weiteren Sinn von "erfahrungsbezogen"verstanden. So sind das Schreiben einer Geschichte, das Zeichnen geometrischerFiguren oder das Erfinden eines Liedes ebenfalls praktische bzw. erfahrungsbezogene,wenn auch nicht so sehr manuelle Arbeiten.226
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDas Ausgehen von Erfahrungen ist eine zentrale Voraussetzung für entdeckendes Lernen.Denn wenn Erfahrungen untersucht werden, können <strong>die</strong> Schüler Unstimmigkeiten,Unvollständigkeiten usw. erkennen, und <strong>die</strong>se Erkenntnis regt dazu an, Pläne zur Verbesserungzu machen und auszuführen. In <strong>die</strong>sem Sinn ermöglichen für Schülerinteressenoffene Lehrpläne problemorientiertes Unterrichten.Die zweite Teilbedingung fordert ein "allgemeines Minimalcurriculum". Wenn nämlicherreicht werden soll, dass <strong>die</strong> Schüler Pläne entwickeln und verwirklichen und dadurchTechniken geistigen Arbeitens einüben, grundlegende vernetzte Kenntnisse erwerbenund zu selbständig handelnden Persönlichkeiten werden, dann müssen sie sich <strong>auf</strong> <strong>die</strong>intensive eigene Arbeit an einem beschränkten Stoffgebiet konzentrieren können. Mandarf dann nicht enzyklopädische Kenntnisse von den Schülern verlangen. Vielmehrmuss man den Lehrstoff <strong>auf</strong> ein Minimalcurriculum begrenzen.Um den unterschiedlichen und sich ändernden Schülerinteressen gerecht werden zu können,sollte <strong>die</strong>ses Minimalcurriculum außerdem allgemein gehalten sein. Denn je genauer<strong>die</strong> Angaben sind, desto weniger Möglichkeiten werden offen gelassen, einen Gegenstandzu erkunden und zu verstehen. 78Produktive Beschränkung statt Allgemeinbildung 79Minimalcurricula können und sollen nicht zu jener Art von Allgemeinbildung führen,<strong>die</strong> den heutigen Abiturienten auszeichnen soll. Der "Ruf nach Wissensmassen", spotteteKERSCHENSTEINER, (1914, S. V f.) sei "ein Kennzeichen für <strong>die</strong> Oberflächlichkeit vielerunserer Gebildeten... In den Lehrplänen unserer Schulen spiegelt sich deutlich <strong>die</strong>se O-berflächlichkeit ab, eben weil jeder Vertreter einer Wissenschaft erklärt, dass von dem,was er selbst lehrt, der Schüler unbedingt einiges wissen müsse..."Statt um breites und damit notgedrungen oberflächliches Wissen, soll <strong>die</strong> produktiveBeschränkung Vertiefung ermöglichen und herausfordern. Der Einzelne muss nicht vonallem etwas wissen, sondern <strong>die</strong> Arbeit der Wissensgewinnung soll durch entdeckendesLernen, durch Selbstbestimmung innerhalb eines Rahmens von Freiheit und Ordnung,durch Kooperation, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Diskussion und Reflexion fördert, den ganzen Menschenerfassen, damit er sein Denkvermögen, seine Einstellungen, Motive, Interessen, Wert<strong>auf</strong>fassungenentfalten kann.7879Vgl. zur Frage der Lernzielformulierung auch <strong>die</strong> kritischen Ausführungen bei MACDONALD-ROSS1973; POPHAM 1987; LEHNER 1979, S. 127 ff.; SCHÜMER 1993, S. 18 ff.Der Titel bezieht sich <strong>auf</strong> V. CUBEs Schrift: "Allgemeinbildung oder produktive Einseitigkeit".227
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWechsel von individuellen und gemeinsamen AktivitätenDurch <strong>die</strong> Individualisierung Lernwege versucht <strong>die</strong> Schule dem Bedürfnis der Schülernach Selbständigkeit gerecht zu werden. Um auch das Bedürfnis nach Sicherheit durchZugehörigkeitsgefühle zu größeren Lerngruppen zu befriedigen, können in einem Teilder Unterrichtszeit gebundene bzw. lehrergeleitete Pflichtkurse sowie frei wählbareLehrgänge durchgeführt werden. Demselben Zweck <strong>die</strong>nen Feiern, Theater<strong>auf</strong>führungen,Konzerte, Versammlungen in Großgremien, um Entscheidungen bei den Fragen zudiskutieren und zu treffen, <strong>die</strong> jeweils <strong>die</strong> ganze Gruppe oder <strong>die</strong> Schule betreffen.Auch <strong>die</strong> Darstellung eigener Arbeiten vor der Großgruppe oder <strong>die</strong> Durchführung vonÜbungen unter Leitung wechselnder Schüler bzw. Schülergruppen kann ein geeignetesMittel sein, um Gefühle der Sicherheit durch soziale Bindung zu fördern. Hinzu kommt,dass schülergeleitete Übungen für Mitschüler in der Regel besonders effektiv sind, d.h.<strong>die</strong> Mitschüler lernen in <strong>die</strong>sen Übungen erheblich mehr und besser als durch lehrergeleiteteÜbungen.Der Austausch mit der Gruppe kann auch <strong>die</strong> Planungsfähigkeit fördern helfen. So könnenMontagmorgenkreise wie in Jenaplan-Schulen genutzt werden, um ihre Pläne für <strong>die</strong>Woche vorzustellen und zu diskutieren. Da Einwände von Mitschülern nicht selten ernstergenommen werden als Vorschläge des Lehrers, können sie in effektiverer Weise dazubeitragen Irrtümer zu korrigieren und Fehler zu beseitigen.Wenn derart individualisiert, kooperativ und durchaus leistungsbestrebt, aber ohne Leistungsdruck,gearbeitet wird, kann <strong>die</strong> Lerngruppe Schüler unterschiedlichen Alters, sehrheterogener Leistungsstufen sowie Behinderte und Nichtbehinderte umfassen. Unterselbstwerterhaltenden Unterrichtsbedingungen ermöglicht das vielfältige soziale Erfahrungenund fördert den verständnisvollen Umgang miteinander, und zwar ohne kognitiveLeistungseinbußen. Das konnte für <strong>die</strong> Grundschule in der Integrierten Erziehung derMontessori-Schulen des Kinderzentrums München nachgewiesen werden (vgl.HELLBRÜGGE 1986, S. 312 ff.).Stundenblöcke durch FächergruppenUm <strong>die</strong> Zerstückelung des Stundenplans und damit <strong>die</strong> häufigen Unterbrechungen derArbeit der Schüler durch Fachwechsel zu vermeiden, bietet sich <strong>die</strong> Zusammenfassungverwandter Fächer an. Das würde <strong>die</strong> Möglichkeit eröffnen, <strong>die</strong> Arbeit in den Fächergruppenin größeren Blöcken zu organisieren. Die Lehrer könnten gemeinsame fächergruppenspezifischeArbeitsräume einrichten, <strong>die</strong> grundlegenden Lernmaterialien erstel-228
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTlen oder ank<strong>auf</strong>en usw. Das Material kann fachspezifische und dar<strong>auf</strong> bezogene fächerübergreifendeEinheiten umfassen, in denen komplexere Themen aus unterschiedlichenPerspektiven erarbeitet werden können.Nach einem Vorschlag von MAYER (1992, S. 50) könnten <strong>die</strong> Fächer in folgende fünfBereiche gruppiert werden:• Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich. Er würde - teilweise erst inder Sekundarstufe II - <strong>die</strong> Fächer Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Technikumfassen.• Sprachlich-literarischer Bereich. Er würde aus Fächern Deutsch, Englisch, Französischusw. bestehen.• Gesellschaftlich-politischer Bereich, mit den Fächern - wiederum z.T. erst in der SekundarstufeII - Geographie, Geschichte, Politik / Sozialwissenschaften usw.• Musisch-künstlerischer Bereich (Kunst / Gestaltung, Musik, Sport, Tanz, Gymnastik).• Philosophisch-religiös-weltanschaulicher Bereich ( aus den Fächern Ethik / Philosophie,Religion).22. Organisation zu Sicherung von Leistung: Selektionvon Individuen vs. Selektion von MaßnahmenAus gesellschaftlicher Sicht geht es um <strong>die</strong> Unterscheidung der Schüler hinsichtlich ihrerLeistungsfähigkeit bei vorgegebenen Aufgaben. Diese Unterscheidung soll vor allemzu Leistungen stimulieren und <strong>die</strong> Auswahl von Leistungseliten ermöglichen. Die Aufgabedes Leistungsvergleichs erfordert eine Organisation, <strong>die</strong> regelmäßige Klausuren,Notenkonferenzen, Zeugnisse mit ihren Konsequenzen für Versetzungen usw. vorschreibt.Das allgemeine Bild von Schule und Unterricht ist entscheidend dadurch geprägtworden.Steht das Ziel der Entfaltung des Individuums im Vordergrund, dann sollte es nicht besonderswichtig sein, wie gut ein Schüler eine Aufgabe im Vergleich zu anderen beherrscht.Vielmehr kommt es in erster Linie dar<strong>auf</strong> an, wie gut er <strong>die</strong> Sache verstandenhat und wie er sich weiter verbessern kann. Schüler und Lehrer können sich so stärker<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Sache konzentrieren und das Lernen wird weniger durch soziale Vergleiche gestört.Die Hauptfrage lautet nicht "Wer kann es besser?", sondern "Ist es richtig?" und"Wie kann man es noch besser machen?"229
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLeistungsvergleiche führen zu WettbewerbLeistungsvergleiche setzen voraus, dass <strong>die</strong> Schüler einer Klasse das Gleiche gelernthaben. Nur so lässt sich anhand der gleichen angeeigneten Kenntnisse und Fertigkeitenfeststellen, wer mehr und wer weniger leistet. Jeder soll <strong>die</strong> „gleiche Chance“ haben,sich mit dem jeweiligen Gebiet vertraut zu machen bevor der Vergleich vorgenommenwird. Das ist <strong>die</strong> häufigste Begründung für den Gleichschritt im Unterricht. Um <strong>die</strong>senGleichschritt <strong>auf</strong> Dauer <strong>auf</strong>rechterhalten zu können, werden <strong>die</strong> Schüler nach Leistungsortiert: in <strong>die</strong> Schnellen, <strong>die</strong> Mittelmäßigen und <strong>die</strong> Langsamen.Eine ähnliche Sortierung gibt es in Gesamtschulen, in denen versucht wird, <strong>die</strong> Ungleichheitenzwischen den Schülern, <strong>die</strong> durch ungünstige häusliche Umwelt, geringereVorkenntnisse, sprachliche Schwierigkeiten usw. entstehen, zu verringern. Auch hier istdas wichtigste Mittel <strong>die</strong> Aufteilung der Schüler in Leistungsgruppen, <strong>die</strong> dann getrenntunterrichtet werden. Allerdings beschränkt man <strong>die</strong>se Gruppierung in Gesamtschulen <strong>auf</strong>Leistungsfächer, in den anderen Fächern bleiben <strong>die</strong> Schüler zusammen.Im Rahmen gruppennormbezogener Leistungsbewertung erhält Differenzierung also <strong>die</strong>Aufgabe, langsame Lerner zu fördern und schnelle Lerner durch Erweiterungen oderZusätze zu beschäftigen. Der unterrichtliche Gleichschritt wird somit zwar abgemildert,aber nicht <strong>auf</strong>gehoben, denn letztlich geht es darum, möglichst alle Schüler im Hinblick<strong>auf</strong> den Unterrichtsstoff zu gleicher Zeit an den gleichen Punkt zu bringen und dann ihreLeistungen zu vergleichen (vgl. v. CUBE 1972, S.105 ff.).Wie bereits beschrieben, tragen solche Bedingungen zur Entstehung einer Reihe vonProblemen bei. Insbesondere ist es schwieriger, <strong>die</strong> Schüler für den Unterrichtsstoff zuinteressieren, d.h. sie zu aktiver Mitarbeit durch Entwicklung, Diskussion und Ausführungeigener Pläne anzuregen. Außerdem fördern Leistungsvergleiche <strong>die</strong> Entstehungvon Wettbewerb.Wettbewerb bedeutet nicht, dass <strong>die</strong> Schüler das Gefühl haben, ständig gegeneinanderantreten und kämpfen zu müssen, auch wenn sie sich bewusst sind, dass sie nach ihrerLeistungsfähigkeit sortiert werden. Wer erfolgreich ist, sieht <strong>die</strong> Ursache dafür stärker inseinen guten Fähigkeiten als in seinen Anstrengungen, denn sich besonders anstrengenzu müssen würde bedeuten, nicht wirklich fähig zu sein. Aber auch, wer sich bedrohtfühlt, schreibt <strong>die</strong>s seinen – allerdings unzulänglichen – Fähigkeiten zu.230
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTUm nun das Verhalten der Schüler in der Klasse zu beurteilen, muss man beachten, dassein übergeordnetes Ziel des Individuums im Erhalt des Selbstwerts besteht. Das ist gegeben,wenn der Schüler sich sicher oder geborgen fühlt und wenn er selbständig undaus eigener Kompetenz handeln kann. Es ist also zu erwarten, dass <strong>die</strong> Schüler im Interessedes Gefühls der eigenen Sicherheit versuchen werden, jeden der nicht ohnehinschon außerhalb der Gruppe steht, das Gesicht wahren zu lassen. Das bedeutet nicht,dass innerhalb der Klasse enge oder freundschaftliche Beziehungen bestehen müssten.Denn Wettbewerb dürfte eher das Zurückziehen von der Klasse begünstigen. Man mussschließlich sehen, wie man durchkommt, und dabei helfen einem nur gute Freunde.Trotzdem will man es sich nicht unnötig erschweren; daher ist man bestrebt, offeneGegnerschaft bzw. offenen Wettbewerb zu vermeiden. Denn das würde für <strong>die</strong> meistenNachteile mit sich bringen. Gute Schüler würden sich womöglich einer breiten Front vonSchwächeren gegenübersehen, <strong>die</strong> mit unfairen Mitteln versuchen könnten, sie unterDruck zu setzen. Schlechte Schüler dagegen würden offen <strong>auf</strong> ihr Versagen <strong>auf</strong>merksamgemacht und so noch mehr abgewertet.Um das Klima einer gewissen Sicherheit nicht zu gefährden, ist es für gute Schüler vorteilhafter,sich so darzustellen, als wäre es ihnen nicht besonders wichtig, dass sie bessersind – auch wenn sie im Geheimen stolz dar<strong>auf</strong> sind, besser als andere zu sein, andere zuschlagen usw. Indem sie ihre eigentlichen Gefühle geheim halten und so tun, als sei ihnenLeistung nicht so wichtig, können sie ihre Beliebtheit bei anderen sogar noch steigern.Schlechtere Schüler haben es schwerer. Sie können ihre Schwächen überspielen, indemsie sagen, sie seinen "völlig unvorbereitet" gewesen, oder indem sie sich so schwierigeAufgaben wählen, dass man ohnehin nicht erwarten kann, dass sie sie lösen. Sie könnenauch vorschützen, dass sie für ihre Zukunftspläne keine besseren Noten brauchen, d.h.sie können ihren Selbstwert erhalten, indem sie sich als besonders unabhängig und selbständiggeben. Sie können aber auch andere, von ihnen selbst nicht beeinflussbare Faktorenwie Pech, größere Sorgen usw. anführen und sich cool geben, möglichst auch vorsich selber – was Schüler auch offensichtlich tun. 80Weil schulische Wettbewerbssituationen Belohnungen und Bedrohungen in komplexerVernetzung implizieren, werden <strong>die</strong> Empfindungen und Überlegungen der Schüler <strong>auf</strong>Vor- und Nachteile ihrer Handlungen gelenkt. Nicht so sehr <strong>die</strong> Aufgaben, sondern vor80vgl. das von ECKERLE / KRAAK (1993, S. 79 ff.) geführte Klassengespräch sowie <strong>die</strong> Interpretation derAutoren.231
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTallem das Ego des Schülers steht im Mittelpunkt. Aus der Sicht des ego-orientiertenSchülers ist Schule eine <strong>Institution</strong>, "in der ich im Vergleich mit anderen beurteilt werde".Im Unterricht, vor dem Lehrer, den Mitschülern geht es darum, "dass ich eine guteFigur mache, dass ich nicht als unfähig erscheine" usw. Indem WettbewerbssituationenSelbstbewertungen induzieren, stärken sie <strong>die</strong> Ego-Orientierung (vgl. NICHOLLS 1983,215; AMES/ FELKNER 1979.).Insbesondere bei Schülern, <strong>die</strong> Wettbewerbssituationen als Bedrohungen sehen, könnenego-orientierte Schutzmechanismen zur Erhaltung des Selbstwertgefühls langfristig negativeEffekte haben. Denn wenn Schüler in Wettbewerbssituationen versagen, fragensie weniger, wie sie es anders machen könnten, sondern eher ob sie unfähig sind oderwarum immer sie solches Pech haben. Sie fühlen sich unwohl, geben schneller <strong>auf</strong> oderreagieren eher passiv und mit Überlegungen zu ihrer Lage, statt sich mit Handlungsmöglichkeitenzu befassen (vgl. ELLIOT/ DWECK 1988; NICHOLLS 1983, S. 216).Weil große Anstrengungen unter Wettbewerbsbedingungen eher als Hinweis <strong>auf</strong> ehergeringe Fähigkeit gewertet werden, erzeugt es eher Unzufriedenheit bei Schülern, wennsie hart arbeiten müssen, um etwas zu können oder zu verstehen (vgl. AMES 1978; 1981;AMES /AMES 1978; AMES/ AMES /FELKNER 1977). Gerade leistungsschwache Schülerneigen unter dem Eindruck, dass es weniger <strong>auf</strong> das Verstehen ankomme, sondern mehrdar<strong>auf</strong>, irgendwie ein akzeptables Ergebnis vorzuweisen, sich nicht mehr intensiv mitinhaltlichen Fragen auseinander zu setzen. Weil es ihnen leichter erscheint, sich nur reproduktivErgebnisse anzueignen, werden sie dadurch am Ende immer unfähiger, Zusammenhängezu verstehen, und ihre Leistungen verschlechtern sich rapide (vgl. NOLEN1988).Dieses Problem wird ferner dadurch verstärkt, dass Schüler unter Wettbewerbsbedingungenungern um Hilfe fragen, weil auch das bedeutet, dass sie eigentlich nicht besondersgut sind. Wenn Lehrer oder Mitschüler ihnen helfen, hat <strong>die</strong>s den gleichen Effekt;sie empfinden sich dann in höherem Maß als weniger fähig, weil offensichtlich wird,dass sie <strong>auf</strong> Hilfe angewiesen sind. Täuschung erscheint dagegen als ein akzeptableresMittel (vgl. NICHOLLS 1983). In Verbindung mit Misserfolgserlebnissen verstärkt Ego-Orientierung also <strong>die</strong> Lageorientierung und <strong>die</strong> Selbst<strong>auf</strong>merksamkeit. D.h. das Individuumglaubt nicht mehr daran, dass es selbst etwas an seiner Lage ändern kann, es verstricktsich immer mehr in Gedanken über sein ständiges Pech, dass nur ihm so was passierenkann usw. (vgl. KUHL 1984).232
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAber auch leistungsfähige Schüler werden unter Wettbewerbsbedingungen beeinträchtigt.Zwar gelingt es ihnen <strong>auf</strong>grund von Erfolgserlebnissen ihre Handlungsorientierungzu behalten, aber Zweck und Ziel ihres Handelns ist stärker <strong>auf</strong> das Ziel bezogen, besserals andere zu sein, "andere zu schlagen" und Anerkennung für Leistungen zu erhalten.Die Arbeit an der Sache ist für sie weniger in sich selbst lohnend und wertvoll, es istmehr das damit verknüpfte „Aus-dem-Feld-Schlagen“ anderer und <strong>die</strong> erzielte Anerkennung,<strong>die</strong> ihnen wichtig werden (vgl. NICHOLLS 1983). Das gilt, auch wenn sie <strong>die</strong>sesStreben vor anderen nicht zeigen, um so den offenen Kampf zu vermeiden. Wie <strong>die</strong> leistungsschwachenSchüler sind auch sie gefangen in den um das Ego kreisenden Gedanken.Dieses Gefangensein im Ego erschwert ernsthafte Diskussion von Sachproblemen.Unter Zugrundelegung ethischer Kriterien erscheint es ferner bedenklich, wenn Individuendazu neigen, ihre größte Befriedigung in Leistungen zu finden, wobei sie den Inhaltihrer Leistungen und den Zusammenhang, in dem sie erbracht werden, nicht ernsthaftreflektieren. Wer gelernt hat, Aufgaben effizient auszuführen ohne viel nachzufragenund in hohem Maß von der Hoffnung <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Verbesserung seiner Position und/ oderAnerkennung geleitet wird, wird sich womöglich auch für mehr oder weniger beliebigeZwecke "einspannen" lassen.Homogene Leistungsgruppen führen nicht zu besseren LeistungenDie Bildung von Schülergruppen mit hohen, mittleren und niedrigen Leistungen wirdmeist damit begründet, dass <strong>die</strong> großen Leistungsunterschiede eine solche Trennungerfordern, um <strong>die</strong> Schüler angemessen unterrichten zu können. Die Effektivität des Unterrichtsbzw. <strong>die</strong> leistungsgerechte Förderung der Schüler ist eines der Argumente, mitdem <strong>die</strong> Auslese begründet wird (vgl. SLAVIN 1990, S. 473 f.).Argumente gegen homogene Leistungsgruppen betonen, dass leistungsschwache Schülerdadurch diskriminiert und stigmatisiert würden. Die Gruppierung entspreche weitgehendder sozialen Herkunft der Schüler. Kinder aus der Unterschicht, von Minderheitsgruppenoder Ausländern würden in leistungsschwächere Klassen abgedrängt. Ihr Selbstwertgefühlsinke durch <strong>die</strong> niedrigere Gruppierung stark ab und Aufstiegsmöglichkeiten würdenihnen verwehrt (vgl. ROSENBAUM 1980, S. 371 ff.).Das Argument, homogene Leistungsgruppierung fördere <strong>die</strong> Effektivität des Unterrichtsist kaum <strong>auf</strong>rechtzuerhalten, da bei heterogener Gruppierung <strong>die</strong> Leistungen nicht niedrigersind. Insgesamt sind <strong>die</strong> Ergebnisse der Untersuchungen hierzu zwar uneinheitlich,233
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTaber in den meisten Überblicksartikeln und Metaanalysen wird der Schluss gezogen,dass homogene Leistungsgruppierung gegenüber heterogener Gruppierung selbst inLangzeituntersuchungen nur geringe oder keine Effekte hinsichtlich der Leistung derSchüler erbringt (BORG 1965; FINDLEY / BRYAN 1971; ESPOSITO 1973; GOOD / MARS-HALL 1984; KULIK / KULIK 1982, 1987; SLAVIN 1990).Das scheint im Wesentlichen sowohl für lernstarke wie für lernschwache Schüler zugelten. Beispielsweise erzielen lernbehinderte Schüler in Regelschulen keine schlechterenErgebnisse als in Sonderschulen. "Es kann keine Untersuchung gefunden werden,welche <strong>die</strong> Überlegenheit der Sonderschule gegenüber der Regelschule für <strong>die</strong> Förderungder Schulleistungen von schwachen Schülern empirisch nachgewiesen hätte"(HAEBERLIN 1991, S. 180). Vorteile durch <strong>die</strong> Sonderschulplazierung ergäben sich erstbei einem IQ unter 75 (MADDEN / SLAVIN 1983).Die Effektivität des Unterrichts scheint weniger von der Gruppierungsform und stärkervon der didaktischen Gestaltung des Unterrichts abhängig zu sein. So führten SLAVIN/KARWEIT (1985) folgende experimentelle Vergleichsuntersuchung im Mathematikunterrichtin der vierten bis sechsten Jahrgangsstufe durch. Die heterogenen Klassen wurdenmittels einer individualisierenden und innerhalb der Klassen differenzierenden Methodeunterrichtet. Die homogenen Klassen wurden mittels einer schüleraktivierenden, häufigesFeedback vermittelnden Methode unterwiesen. Unter <strong>die</strong>sen Bedingungen hatte <strong>die</strong>Art der Fähigkeitsgruppierung keinen messbaren Einfluss <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Leistungen der Schüler.Die Frage ist allerdings, ob <strong>die</strong> Anwendung der individualisierenden Methode, wennman sie in homogenen Gruppen anwendete, dort nicht zu einem noch höheren Leistungsgewinnals in den heterogenen Klassen führen würde. Denn <strong>die</strong> Effektivität derInstruktion hängt weitgehend davon ab, in welchem Ausmaß <strong>auf</strong> <strong>die</strong> individuellen Lernproblemeeinzelner Schüler eingegangen wird (vgl. HELMKE / SCHRADER 1987).Das Lehrerverhalten und mithin <strong>die</strong> Differenziertheit der angewandten Methoden hängenu.a. von den Wertvorstellungen ab, <strong>die</strong> in einer Schule vertreten werden (vgl. GA-MORAN 1989, S. 132). Wo vor allem Leistung geschätzt wird und <strong>die</strong> leistungsstarkenSchüler besonders gefördert werden, scheinen sich vor allem Lehrer guter Klassen besondersum Leistungsverbesserungen und um <strong>die</strong> Anwendung entsprechender Methodenvielfaltzu bemühen (vgl. ROSENBAUM 1976; OAKES 1985). Lehrer leistungsschwacherKlassen würden dagegen demotiviert, weil ihre Klassen ja ohnehin keine besonde-234
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTren Leistungen erbringen könnten (vgl. EVERTSON 1982; OAKES 1982; HARGREAVES1967; ROSENBAUM 1976).Schulen, <strong>die</strong> sich am Wert der Gleichheit orientieren, scheinen <strong>die</strong> Lehrer eher zur Unterstützungleistungsschwacher Schüler zu ermutigen. Entsprechend werden Leistungssteigerungenverstärkt in den schwächeren und mittleren Leistungsgruppen erzielt (vgl.VALLI 1986, zit. nach GAMORAN 1989). Für den Lernerfolg allein scheinen also geeigneteLehrerverhaltensweisen und Unterrichtstechniken von größerer Bedeutung als homogeneoder heterogene Leistungsgruppen.Hinsichtlich der <strong>Auswirkungen</strong> der Fähigkeitsgruppierung <strong>auf</strong> das Selbstwertgefühl sind<strong>die</strong> Befunde schwieriger zu interpretieren. Das Selbstwertgefühl ist ja vor allem das Resultatder in einem bestimmten Kontext erfahrenen Erfolgs- bzw. Misserfolgsgeschichteeines Individuums. Wettbewerbsbedingungen begünstigen bei leistungsschwachen Schülenniedrige und bei leistungsstarken Schülern hohe Selbstwerteinschätzungen. HomogeneGruppierung schränkt <strong>die</strong> Leistungsbreite ein. Bei Wettbewerb haben Schüler inleistungsschwachen homogenen Gruppen daher eher ein besseres Selbstwertgefühl als instark heterogenen Gruppen. So verfügen Gymnasiasten im fünften Schuljahr zwar überein deutlich gestärktes und <strong>die</strong> Hauptschüler ein geschwächtes Selbstwertgefühl, aber<strong>auf</strong>grund der Orientierung an der eigenen Gruppe gleichen sich Gymnasiasten undHauptschüler im L<strong>auf</strong>e von drei Jahren stark an (vgl. JERUSALEM / SCHWARZER 1983).So ist zunächst auch "das Begabungskonzept von leistungsschwachen Schülern in Sonderklassenfür Lernbehinderte etwa gleich hoch ... wie dasjenige von begabten Schülernin Regelklassen" (HAEBERLIN 1991, S. 178; vgl. auch HAEBERLIN u.a. 1990; BATTLE /BLOWERS 1982; KRAMPEN / ZINSSER 1981; KRUG / PETERS 1977; RHEINBERG / ENSTRUP1977). Allerdings scheint es relativ "gut gesichert zu sein, dass das höhere Begabungskonzeptvon Sonderschülern in den oberen Klassen wieder zu sinken beginnt" (HAEBER-LIN 1991, S. 178), nämlich dann, wenn sie ihre Berufschancen im Vergleich mit der gesamtenAltergruppe einzuschätzen beginnen. Die Illusion des relativ guten Selbstwertgefühls,das <strong>die</strong> homogene Gruppenbildung Schülern der unteren Leistungsgruppen unterWettbewerbsbedingungen zu bieten scheint, scheint also nicht sehr tief zu gehen.Wurde Wettbewerb durch Kooperation ersetzt, dann ließ sich auch innerhalb heterogenerGruppen eine gute Selbstwerteinschätzung für alle Schüler erzielen (vgl. LAZARO-WITZ/ KARSENTY 1990). Dasselbe gilt für schulleistungsschwache Sonderschüler in Regelschulklassen(vgl. AFFLECK U.A. 1988; WANG / BIRCH 1984)235
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTProblematik der LeistungsausleseAuslese erzeugt BürokratieVon Leistungen hängt <strong>die</strong> Möglichkeit des Erwerbs besserer Bildungschancen und damitauch besserer Berufschancen ab. Leistung ist heute das im Wesentlichen von allen anerkannteKriterium für <strong>die</strong> Auswahl von Eliten, d.h. jener Leute, "<strong>die</strong> politisch und wirtschaftlichentscheidende Funktionen innehaben" (LÜTHJE 1995, S. 180).Um eine Auslese mit derart weit reichenden Folgen rechtfertigen zu können, bedarf esentsprechender Regelungen, Regelungen, <strong>die</strong> vorspiegeln, es gehe alles mit rechten Dingenzu. Dazu ist in den Leistungsfächern in der Regel eine Mindestzahl von Teilprüfungenvorgeschrieben. Sie sind nach einer als hinreichend betrachteten Behandlung deszugrunde gelegten Lehrstoffes durchzuführen. Die Klausuren werden bewertet, und ausdem Durchschnitt der Noten und einer gewichteten Berücksichtigung mündlicher Leistungenwird <strong>die</strong> Zeugnisnote errechnet.Bewertungen sind nicht gerechtWas <strong>die</strong> Leistungsbewertung selbst angeht, so soll <strong>die</strong>se möglichst objektiv gestaltetwerden. Tatsächlich ist sie das aber nicht (vgl. INGENKAMP 1977; 1981). Die geringeObjektivität von Noten ist teils dar<strong>auf</strong> zurückzuführen, dass <strong>die</strong> Zensurengebung mangelsVergleichsnormen nicht an der entsprechenden Altergruppe, sondern an den Leistungender jeweiligen Lerngruppe orientiert ist.Bei den in der Schule üblichen Beuteilungsverfahren spielen ferner Faktoren wie Anstrengungund Benehmen der Schüler, wie und ob sie dem Lehrer Anerkennung zeigen,wie höflich oder unhöflich sie sich gegenüber anderen verhalten oder ihre körperlicheAttraktivität eine nicht unwesentliche Rolle (vgl. z.B. FARKAS / SHEEHAN / GROBE1990). Außerdem <strong>die</strong>nt <strong>die</strong> Notengebung nicht immer nur der Leistungsmessung, sondernwird auch als Erziehungsmittel verwendet. Hinzu kommt, dass Prüfungen nichtoder nicht nur <strong>die</strong> Qualität der vergangenen Lernarbeit erfassen, sondern auch <strong>die</strong> künftigenzu erwartenden Leistungen voraussagen soll (vgl. z.B. AEBLI 1976, S. 336).Insbesondere <strong>die</strong>se Voraussage, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Grundlage für weit reichende Entscheidungenüber Berufs- und Bildungschancen des einzelnen bildet, ist nach wie vor höchst umstritten.Die Aufgabe objektiver Leistungsbewertung ist also nicht nur äußert komplex und236
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTschwierig, sie wird auch kaum jemals in objektiver Weise durchzuführen sein (vgl. IN-GENKAMP 1987, S. 73 f.).Auslese erzeugt LooserErstens trägt <strong>die</strong> Einteilung in "gute" und "schlechte" Schüler dazu bei, dass Schüler inden "schlechten" Gruppen sich selber als weniger fähig betrachten. Die Schüler trauensich dann von vornherein weniger zu und sie strengen sich auch nicht mehr an. Wer sichselber für dumm hält, bemüht sich nicht besonders, nach ungeeigneten Ansätzen, Lernstrategienoder Fehlerquellen zu forschen, auch wenn deren Beseitigung erheblich zurVerbesserung der Leistungen beitragen könnte, sondern versucht eher, sich Arbeit zuersparen, indem er rät, von anderen abschaut, schwierige Aufgaben auslässt usw. (vglMEECE / BLUMENFELD / HOYLE 1988).Zweitens betrachten <strong>die</strong> Lehrer – und in der Regel auch <strong>die</strong> Eltern – <strong>die</strong>se Schüler alsweniger fähig und erwarten keine besonderen Leistungen von ihnen. Sie neigen dazu,ihre Schüler mit einfachen Aufgaben und eindeutigen Lösungs-Schemata zu konfrontieren,<strong>die</strong> <strong>die</strong> Schüler eher noch stärker zu reproduktivem Lernen verleiten. Starke Vereinfachungennehmen Aufgaben den Reiz der Schwierigkeit, der Herausforderung; sie verlierendadurch an Anziehungskraft für <strong>die</strong> Schüler (vgl. STODOLSKY 1988) Außerdemtragen genaue Anweisungen, wie Aufgaben zu lösen sind eher zu unselbständigem Lernender Schüler bei. Sie verlassen sich dann stärker <strong>auf</strong> den Lehrer als selbst Strategienzu entwickeln und zu erproben (vgl. CORNO/ ROHRKEMPER 1985).Drittens sollen leistungsschwächere Schüler in der Regel nur minimale Lernziele erreichen.Der Unterricht wird also kaum individualisiert, sondern zumeist wird versucht, <strong>die</strong>ganze Lerngruppe Schritt für Schritt der niedrigen Lehrzielnorm anzunähern.Wenn man möchte, dass möglichst viele Schüler Leistungsfreude entwickeln und hoheLeistungen erbringen, muss man es als problematisch betrachten, wenn <strong>auf</strong>grund vergleichenderLeistungsbewertung Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, durch<strong>die</strong> so viele junge Menschen benachteiligt werden. Vor allem Schüler, <strong>die</strong> im Vergleichzu anderen schlecht abschneiden, <strong>die</strong> häufiger Misserfolge als Erfolge erleben, entwickelnein schwaches Selbstwertgefühl, werden eher ängstlich, unsicher und von äußerenBedingungen abhängig (vgl. FUCHS 1979; SCHIEFELE 1974, S. 271 FF.; KÜHN 1983; NI-CHOLLS 1983).237
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWenn man <strong>die</strong>ses Problem lösen will, wird man unter anderem fragen müssen, wie Leistungsbeurteilungso gestaltet werden kann, dass das Leistungspotential von Schülerndadurch nicht beeinträchtigt, sondern eher gefördert wird.Koppelung von Unterricht und Berechtigungswesen: Schule als AusleseagenturWenn der Unterricht Aufgaben des Berechtigungswesens übernimmt, geschieht dasdurch gruppennormbezogene Leistungsvergleiche. Die schulische Auslese hat einenprägenden Einfluss. In unserer Wahrnehmung hat Schule neben ihrem Bildungs<strong>auf</strong>tragvor allem <strong>die</strong> Funktion der Auslese der Leistungsfähigsten. Das Problem ist jedoch, dass<strong>die</strong> Auslesefunktion für <strong>die</strong> Erfüllung des Bildungs<strong>auf</strong>trag in höchstem Grad störend ist.Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, beeinträchtigt der durch <strong>die</strong> Leistungsauslesebedingte Wettbewerb das Interesse an der Sache und fördert <strong>die</strong> Entstehung vonEgo-Orientierung und eher geringe Anstrengungsbereitschaft. Schüler, <strong>die</strong> unter <strong>die</strong>senUmstände dennoch sachorientiert bleiben, schwimmen sozusagen gegen den Strom. Sindsie erfolgreich, dann vielleicht trotz und nicht wegen der Schule und der ihnen dort bestätigtenoder auch nicht bestätigten Leistungsfähigkeit.Untersuchungen der L<strong>auf</strong>bahnen außergewöhnlich erfolgreicher Wissenschaftler, Künstlerund Wirtschaftsführer zeigen, dass <strong>die</strong> Schule oft eine eher negative Rolle gespielthat. Entscheidend war vor allem <strong>die</strong> frühe Weckung und Aufrechterhaltung eines starkenInteresses für einen Gegenstandsbereich und <strong>die</strong> Aufrechterhaltung der Freude am Lernenin <strong>die</strong>sem Bereich. In den meisten Fällen waren es <strong>die</strong> Eltern, <strong>die</strong> den Kindern <strong>die</strong>entscheidenden Anstöße und weiterführenden Hilfen gegeben haben und nur selten <strong>die</strong>Schule oder ein Lehrer (vgl. OCHSE 1990, S. 83 ff.).Insbesondere aber beeinträchtigen l<strong>auf</strong>ende Leistungsvergleiche das Selbstwertgefühlschwacher Schüler, sie fördern eher lageorientierte Reflexionen bei <strong>die</strong>sen Schülern, waszu emotionalen Belastungen und verringerter Verarbeitungskapazität führt und dadurcheher zur Verschlechterung der Leistungen beiträgt. Durch mehrfache Misserfolge kannder Schüler dann in einen Misserfolgszirkel geraten, aus dem er unter Wettbewerbsbedingungenoft nicht mehr herauskommt.Da vergleichende Leistungsprüfungen erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten prüfenund nicht den Weg, <strong>auf</strong> dem <strong>die</strong>se erworben wurden und auch nicht <strong>die</strong> Höhe des Poten-238
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTtials, das den Erwerb solcher Kenntnisse und Fertigkeiten erst ermöglicht, wird dahernicht untersucht, wodurch es zu schlechten Leistungen gekommen ist und ob ein Schülerim Prinzip bessere Leistungen erbringen könnte. Auch eine gute Leistung kann ja <strong>auf</strong>Zufall beruhen. Nehmen wir nun an, eine schlechte Leistung beruht <strong>auf</strong> einer grundlegendenfalschen Annahme, <strong>die</strong> aus dem bloßen Prüfungsergebnis nicht zu erschließenist. Wenn <strong>die</strong>se Annahme nicht korrigiert wird, kann das zu fatalen <strong>Auswirkungen</strong> führen,wie folgendes Beispiel verdeutlicht.Gustav ist Schüler der ersten Klasse, ein "Sitzenbleiber". Der Lehrerin fällt <strong>auf</strong>, dass ernicht gerne liest. Auf ihre Fragen hin erklärt er ihr, dass es anfangs ja leicht aussehe,man müsse sich auch nur wenige Wörter merken, aber jede Woche würden es mehr."Zum Schluss sind des Tausend oder eine Million." Die könne man nicht alle behaltenund dann bleibe man sitzen. Die Lehrerin erklärt ihm, dass er in der anderen Klasse etwasfalsch verstanden haben müsse. Es sei lediglich erforderlich 26 Buchstaben zu behalten,weil alle Wörter aus <strong>die</strong>sen Buchstaben zusammengesetzt seien. Nachdem Gustavdas überprüft hatte, ging er zusammen mit der Lehrerin an <strong>die</strong> Arbeit. "Drei Wochenspäter konnte Gustav lesen." 81 Hätte auch Gustavs zweite Lehrerin ausschließlich <strong>auf</strong> <strong>die</strong>bloße Leseleistung geachtet statt <strong>die</strong> Hintergründe dafür zu erkunden, hätte Gustav gutund gerne in der Sonderschule landen können. Die Vermengung der Aufgaben des Unterrichtsund des Berechtigungswesens beeinträchtigt den Unterricht also in hohem Maß.Weiter ist zu fragen, ob <strong>die</strong> vergleichenden Leistungsbewertungen im Unterricht überhauptzu dem gewünschten Ergebnis führen. Denn <strong>die</strong> Frage, ob Leistungsbewertungtatsächlich <strong>die</strong> Auslese der Leistungsfähigsten ermöglicht ist durch ihr bloßes Bestehenja keineswegs geklärt. Hierzu zeigen in den frühen 70er Jahren durchgeführte Untersuchungen,deren wesentliche Voraussetzungen und Folgerungen auch heute zutreffen,dass <strong>die</strong> mit den üblichen Methoden schulischer Leistungsmessung gewonnenen Ergebnisseweder hinlänglich objektiv noch von hinlänglichem prognostischem Wert sind(vgl. INGENKAMP 1977a).Die Vorhersagegültigkeit von Grundschulzeugnissen für Leistungen im Gymnasiumbeispielsweise liegt kaum über r = .30. Wenn also unter 1000 Bewerbern 200 Geeignete<strong>auf</strong>grund ihrer Noten ausgewählt werden, dann sieht das Ergebnis rechnerisch folgen-81BERT / GUHLKE 1977, S. 51. Eine Fülle weiterer Beispiele, <strong>die</strong> u.a. <strong>auf</strong> ein Versagen der Schule <strong>auf</strong>grundihrer Orientierung an bloßen Ergebnissen hinweisen, berichtet FEUERSTEIN 1983, der einen Testzur Erfassung des Lernpotentials entwickelt hat. Mithilfe <strong>die</strong>ses Tests vermochte er bei zahlreichenKindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schwersten Lerndefiziten und -behinderungenPotentiale zu erkennen, <strong>die</strong> anschließend auch entwickelt werden konnten.239
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTdermaßen aus: Unter den 200 Zugelassenen sind 66 Geeignete und 134 nicht Geeignete.Man hat "aber 134 Geeignete und 666 nicht Geeignete abgewiesen" (INGENKAMP 1977b,S. 222). Wobei zu beachten ist, das Geeignetheit hier lediglich bedeutet: „für <strong>die</strong> üblichenAnforderungen des Gymnasiums geeignet“.Es ist sicher nicht zu erwarten, dass <strong>die</strong> Zuweisung von Stu<strong>die</strong>nplätzen <strong>auf</strong>grund vonAbiturzeugnissen einen höheren Prognosewert hat. Denn Stu<strong>die</strong>nplätze werden "nacheiner unsinnigen Notenarithmetik von einer Zentralstelle vergeben", <strong>die</strong> <strong>die</strong> Gültigkeitder getroffenen Entscheidungen nicht überprüft, und <strong>die</strong> Übergangsauslese wird immernoch nach den Methoden gestaltet, "<strong>die</strong> schon in den sechziger Jahren überholt und unzureichendwaren" (INGENKAMP 1987, S. 40). Es ist also nicht überraschend, wenn nurein geringer Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der Reifeprüfung und den Vorexamenin verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen und bei Medizinern besteht(TROST 1975; WEINGARDT 1977, S. 253). Tatsächlich scheinen Mediziner mitschlechten Schulnoten im Beruf ebenso tüchtig zu sein wie solche mit guten Noten (vgl.WILLIE 1982). Jedenfalls ist der Zusammenhang zwischen Zensuren und späterem Berufserfolgim allgemeinen nur "sehr mäßig" (HOYT 1965).Insoweit das Ziel der Leistungsauslese darin bestanden hat, <strong>die</strong> besten, tüchtigsten oderleistungsfähigsten Mitglieder der heranwachsenden Generationen zu identifizieren, ist<strong>die</strong>ses Ziel durch <strong>die</strong> Koppelung von Unterricht und Berechtigungswesen ganz sichernicht zu erreichen. Nur in einem gewissen Sinn werden <strong>die</strong> Leistungsfähigsten gefunden.Denn das System wird vermutlich <strong>die</strong>jenigen begünstigen, <strong>die</strong> oder deren Eltern wissen,wie man das "Schulspiel" gewinnt (PAQUETTE 1991). Viele Schüler, <strong>die</strong> im Prinzip zuguten Leistungen in der Lage wären, aber nicht clever genug sind, <strong>die</strong> also nicht verstehen,dass es vor allem dar<strong>auf</strong> ankommt, sich <strong>auf</strong> sprachlich ausgewogen vorgebrachteDarstellungen, Einwände, Argumente etc. zu konzentrieren, sich gezielt <strong>auf</strong> Tests vorzubereiten,einen guten Eindruck im Umgang mit dem Lehrer zu hinterlassen, in prekärenSituationen dem Lehrer ein positives, angenehmes Bild von sich zu bieten und ähnliches,werden durch negative Etikettierungen frühzeitig entmutigt und verlieren im schulischenWettbewerb (vgl. PAQUETTE 1991).Die Auslese durch l<strong>auf</strong>ende Leistungsvergleiche, Halbjahres- und Jahreszeugnisse wirdvon allen Beteiligten zwar akzeptiert und bestimmt das Denken und Handeln von Lehrern,Schülern und Eltern im schulischen Alltag, aber das in der Schule vermittelte Wissenund Können und <strong>die</strong> darüber erteilten Übergangs- und Abschlusszertifikate geben240
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTkeine hinreichend gültigen Urteilsgrundlagen dafür, welche Schüler <strong>auf</strong> weiterführendenSchulen, im Studium und später im Beruf erfolgreich sein werden.Trennung von Unterricht und BerechtigungswesenDie Entkoppelung von Unterricht und Aufgaben des Berechtigungswesens ermöglichtSchulen und Lehrern Freiräume für <strong>die</strong> Gestaltung des Unterrichts, den man dann janicht <strong>auf</strong> <strong>die</strong> nächste Prüfung ausrichten muss. Eine Lösung bestünde in der Errichtungexterner Prüfungsbehörden. Die Erstellung zuverlässiger und valider Tests ist ja eineAufgabe, <strong>die</strong> Kenntnisse und auch Mittel erfordert, über <strong>die</strong> Schulen wohl kaum verfügen.Außerdem werden <strong>die</strong> Lehrer in der Regel nicht für <strong>die</strong>se Aufgabe ausgebildet.Eine andere und kostengünstige Lösung wird von einigen Privatschulen praktiziert. Siegehen einfach so vor, dass sie erst dann, wenn der Zeitpunkt für einen Übergang <strong>auf</strong> eineandere Schulform oder der Erwerb eines Abschlusses ansteht, gezielt dar<strong>auf</strong> vorbereitenund <strong>die</strong> entsprechenden Prüfungen durchführen. Wer beispielsweise das Abitur an einerWaldorfschule machen möchte, kann sich, nachdem bis dahin ohne Notendruck gearbeitetwurde, im letzten Schuljahr gezielt <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Prüfung vorbereiten. Die Entkoppelungvon Prüfungen zur Vergabe von Berechtigungen und Unterricht ermöglicht es der Waldorfschule,sich <strong>auf</strong> ihren pädagogischen Auftrag zu konzentrieren, "junge Menschen ...in ihrem eigenen Wesen und Können so zu wecken und zu steigern, daß sie in sich undaus sich selber <strong>die</strong> Mittel und Wege finden können, ihr Leben zu meistern" (LINDEN-BERG 1975, S. 23).Auf <strong>die</strong>se Weise können zwar viele Nachteile vermieden werden, <strong>die</strong> ein in den Unterrichtintegrierter jahrelanger Prozess des Leistungsvergleichs und der Zuordnung vonLeistungsrängen erzeugt, aber das Problem der geringen Objektivität und der fehlendenprognostischen Kraft solcher Prüfungsergebnisse wird hierdurch nicht gelöst.Was <strong>die</strong> begrenzte Bedeutung von Schulzeugnissen für Stu<strong>die</strong>n- und Berufserfolg angeht,ist zu fragen, ob <strong>die</strong> üblichen schulischen Lerninhalte und Lernweisen überhauptbedeutsame Bezüge zu Studium und Beruf <strong>auf</strong>weisen. Wenn aber <strong>auf</strong>grund der Entkoppelungvon Unterricht und Berechtigungswesen Schulen Freiräume zur Gestaltung eigenerBildungsprogramme haben, ließen sich auch Beziehungen zwischen Unterricht, Unterrichtserfolgsowie Stu<strong>die</strong>n und Berufserfolg differenzierter untersuchen. Dann dürftesich zeigen, dass Bildungsprogramme, <strong>die</strong> sich stärker an der Entwicklung des Individuumsorientieren als an gesellschaftlichen Anforderungen und den Schülern Wahl- und241
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLerngelegenheiten einräumen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Entstehung und Ausprägung von Interessen begünstigen,eher Fähigkeiten fördern, <strong>die</strong> auch Stu<strong>die</strong>n- und berufsrelevant sind.Außerdem könnte eine derartige Interessendifferenzierung zur konkreteren Klärung beruflicherWünsche und Vorstellungen beitragen, so dass das Stu<strong>die</strong>n- und Berufswahlverhaltenvermutlich einen geringeren Grad an Unsicherheit <strong>auf</strong>weisen würde. 82 Indem<strong>die</strong> Schüler z.B. selbständig Arbeiten (Texte, Modelle, Filme, Tonmaterial usw.) anfertigen,lernen sie einen Aufgabenbereich und seine Techniken genauer kennen. SolcheDirekten Leistungsvorlagen können außerdem bei Bewerbungen eingereicht werden(VIERLINGER 1990). Gymnasiasten können sich <strong>auf</strong> <strong>die</strong>se Weise nicht nur mit einemFragenbereich, sondern auch mit den Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens vertrautmachen. Wenn Schüler sich immer nur mit eng umgrenzten Aufgaben befassen, fällt esihnen schwer, einen Sinn oder Zusammenhang in der Abfolge <strong>die</strong>ser Aufgaben zu erkennen,<strong>die</strong> nirgendwohin zu führen scheinen und sie an der Oberfläche der Sache zurücklassen.Für den Fall, dass Leistungen in Interessenschwerpunkten relativ gute Prognosen fürStu<strong>die</strong>n und Berufserfolge abgeben, könnte <strong>die</strong>s zur Differenzierung des Berechtigungswesensbeitragen, indem in <strong>die</strong> Abschlusszeugnisse derartige Leistungen <strong>auf</strong>genommenwerden.Es ist aber im Grunde kaum möglich, ein für allemal jene Ziele, Maßnahmen Organisationsformenusw. zu bestimmen, durch <strong>die</strong> eine Schule den größten Nutzen für den weiterenWerdegang ihrer Schüler und für <strong>die</strong> Allgemeinheit bietet. Außerdem ändern sichunsere Werte und Ziele, an denen wir den Erfolg messen, so dass sich auch unsere Anforderungenan <strong>die</strong> Schule ändern. Da wir wohl kaum im einzelnen wissen können, welcheschulischen Ziele, Organisationsformen und Methoden sich in Zukunft unter verändertenBedingungen bewähren werden, dürfte es unter dem Gesichtspunkt der Anpassungan <strong>die</strong>se Bedingungen günstiger sein, wenn Schulen eigene Programme entwickelnund durchführen als wenn sie den Weisungen monopolartiger Behörden unterstehen.82Zu den Problemen der Ausbildungs- und Berufswahlentscheidungen vgl. LANGE/ BÜSCHGES 1975;PEISERT 1981.242
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT23. Schulpolitische RahmenbedingungenSchulen oder Schulsysteme werden – wie andere gesellschaftliche <strong>Institution</strong>en auch –gegen den Wettbewerb mit alternativen Einrichtungen und Konzepten abgeschirmt, indemman grundlegende Prinzipien wie letzte Axiome, d.h. nicht mehr diskutierbareStandpunkte behandelt bzw. akzeptiert.Ein solcher Standpunkt ist das sogenannte Leistungsprinzip. Seine Abschrimungsfunktionzeigt sich, wenn beispielsweise in einer Auseinandersetzung über Waldorfschulen,Montessori-Schulen und staatliche Regelschulen <strong>die</strong> Diskussion mit dem Hinweis beendetwird, es handle sich dabei um grundverschiedene, nicht vergleichbare Systeme; inder Staatsschule stehe das Leistungsprinzip im Mittelpunkt, bei den anderen nicht. Tatsächlichwerden aber in allen Schulen Leistungen erbracht. Man könnte sie also durchaushinsichtlich der Lernergebnisse und anderer Wirkungen vergleichen. Das Problemist, dass im Rahmen leistungsideologischer Auffassungen "Leistung" nahezu als identischmit lehrplanmäßigem Unterricht und nachfolgender vergleichender Leistungsmessungbetrachtet wird.Die <strong>Auswirkungen</strong> einer solchen Haltung können verstärkt werden, wenn <strong>auf</strong>grund vonVorgaben vorgeordneter Behörden den davon abhängigen Schulen der Spielraum fürVersuche zur eigenen Gestaltung unverhältnismäßig erschwert und eingeengt wird.Wettbewerb setzt dagegen eine größere Autonomie der Schulen voraus, so dass sie <strong>auf</strong>verschiedene Ziele, Grundsätze, Programme und Methoden gründende Wege versuchenkönnen.Die aus Autonomie erwachsende Vielfalt allein gibt allerdings keine Gewähr dafür, dassbesser bewährte Prinzipien auch von anderen Schulen übernommen werden. Wettbewerbentsteht, wenn erstens ideologisch abgestützte Untersuchungsschranken fallen und wennzweitens Schulen einschließlich der vorgeordneten Behörden sich Prüfungen und Untersuchungensowie der öffentlichen Verbreitung und Diskussion <strong>die</strong>ser Informationennicht verschließen können.Abhängigkeit vs. AutonomieAbhängigkeit oder Autonomie ist in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einenhinsichtlich des eigenen Programms, also der Ziele, der Gestaltung der organisatorischenStruktur und der räumlich-materiellen Umgebung, und zum anderen hinsichtlich der243
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTMittel, <strong>die</strong> ja gebraucht werden, um das eigene Konzept im Rahmen bestehender Möglichkeitenzu realisieren, zu verbessern oder den sich wandelnden Ansprüchen, Vorstellungenund Bedingungen anzupassen.Abhängige Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass ihnen <strong>die</strong> Ziele, <strong>die</strong> Organisationund vielfältige Handlungsregeln vorgegeben sind. Verbleibende Spielräume könnenzwar genutzt und erweitert werden, was aber <strong>die</strong> Überwindung von Hindernissen unddamit einen erheblichen Aufwand an Energie erfordern würde. Konformität und <strong>die</strong> Einfügungin bestehende Routinen ist weit weniger <strong>auf</strong>wendig und daher meist der bequemereWeg. da er außerdem das Risiko mindert, für bestimmte Ergebnisse haftbar gemachtzu werden, ist er auch relativ risikolos. 83Autonome Schulen dagegen verfügen über relativ große Handlungsspielräume, <strong>die</strong> siezur Erfüllung ihrer Aufgaben selber gestalten können. Beispielsweise kann ihnen einGrundkanon an Lerninhalten und -zielen vorgegeben sein, wobei sie Schwerpunkte undLehrmethoden in eigener Verantwortung bestimmen. Autonomie bedeutet also nicht,dass eine Schule tun und lassen kann, was sie möchte, sondern es können ihr Grundpflichten<strong>auf</strong>erlegt und ihre Einhaltung kann kontrolliert werden. Autonomie muss auchnicht notwendig zu einem eigenständigen Programm führen, aber zumindest besteht <strong>die</strong>Möglichkeit dazu.Zur Autonomie von Schulen gehören eigene Finanzmittel. Ohne zusätzliche Kostenkönnten Spielräume geschaffen werden, wenn beispielsweise der Etat für <strong>die</strong> l<strong>auf</strong>endenKosten den Schulen zur eigenen Verwaltung überlassen wird. Bei selbst ausgeführtenReparaturen, eingesparten Heizkosten usw. entstünden dann Überschüsse, <strong>die</strong> frei genutztwerden könnten.Ferner ist <strong>die</strong> Möglichkeit, <strong>die</strong> (Um-)Gestaltung der Räume, der Möbel und Lehrmittelselbst bestimmen zu können, wichtig für <strong>die</strong> Verwirklichung eines eigenen Programms.Besonderer Bedeutung hat <strong>die</strong> Leitung der Schule. Eine partizipative Leitung wird nahezuimmer eine Vielzahl von Ideen hervorbringen und etliche davon zu realisieren versuchen.Die Beteiligung der verschiedenen Gruppen an der Leitung erhöht zumindest längerfristig<strong>die</strong> Motivation, <strong>die</strong> Innovationsbereitschaft und <strong>die</strong> Zufriedenheit der Beteiligten.Eine hierarchisch-bürokratische Leitung wird sehr häufig eher <strong>die</strong> gegenteiligenEffekte <strong>auf</strong>weisen (vgl. BOSSERT / DWYER / ROWAN / LEE 1982; BLASE 1988). Es könnte83Vgl. zu Anpassungsbereitschaft allgemein z.B. BERKOWITZ 1980, S. 304 ff.244
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTdaher <strong>die</strong> innovative Qualität und Effektivität einer Schule schon ganz erheblich steigern,wenn <strong>die</strong> nähere Bestimmung der Leitungsfunktionen in ihren Händen liegen würde.Schulen könnten dann diskutieren und für eine bestimmte Dauer festlegen, ob sieeine Leitung unter Partizipation von Lehrern, Schülern und möglicherweise auch Elternmöchten oder ob sie lieber eine hierarchisch-bürokratische Leitung wünschen, ob <strong>die</strong>Leitung vom Kollegium, Schülern und Eltern gewählt oder von der Schulverwaltungbestimmt werden soll, ob <strong>die</strong> Leitung <strong>auf</strong> Dauer oder zeitlich begrenzt sein soll usw.Um umfassend gestalten zu können, braucht <strong>die</strong> einzelne Schule außerdem das Recht,ihr Personal selbst einzustellen. Für <strong>die</strong> Verwirklichung des Programms kann z.B. <strong>die</strong>Einstellung eines Computerfachmanns entscheidend sein. Nur <strong>die</strong> Schule selbst kannwissen, wer für ihr bestimmtes Programm geeignet erscheint und am besten ins Kollegiumpasst.Wenn eine über lange Zeit abhängige Schule in <strong>die</strong> Autonomie entlassen werden soll,muss das von den betroffenen Lehrern und Schülern nicht notwendig positiv <strong>auf</strong>genommenwerden. Spielräume können wegen der im Einzelnen nicht abzuschätzenden FolgenAngst und Ablehnung erzeugen. Wo also ein solcher Übergang vollzogen wird, wird esden Schulen helfen, wenn mittels Beratern <strong>die</strong> für <strong>die</strong> einzelne Schule sinnvolle Nutzungder eröffneten Spielräume geklärt und <strong>die</strong> Erstellung und Ausgestaltung eines eigenenProgramms wenigstens teilweise begleitet wird. Im Folgenden werden zur Verdeutlichungeinige mögliche Programmpunkte genannt.So könnten schulische Programme zunächst ethische Grundsätze enthalten. Z.B.:- keine Mittel anzuwenden oder ihre Anwendung einzustellen, sofern zu erwarten ist,dass sie zu Beeinträchtigungen des Selbstwerts und der Fähigkeiten des Einzelnenführen oder beitragen.- Jeder (Schüler und Lehrer) soll Fehler machen dürfen, aber Ziel ist es, aus Fehlernzu lernen und dadurch besser zu werden.- Toleranz zu praktizieren. Auch wenn ein Schüler oder Lehrer selbst nicht tolerantist, intolerante Handlungen <strong>die</strong>ser Personen zwar nicht zuzulassen, aber denjenigendeshalb als Person nicht auszugrenzen, sondern zu versuchen, <strong>die</strong>se Person so zuakzeptieren wie sie ist.Pädagogische Ziele (unter Berücksichtigung von Elternwünschen) könnten sein:- Lehrplan und Organisation an den Grundbedürfnissen von Schülern zu orientierenund <strong>die</strong> freie Leistungsentfaltung des Einzelnen zu fördern.- Demokratisches Verhalten in einer demokratischen Schulorganisation, <strong>die</strong> auch <strong>die</strong>Schüler beteiligt, zu üben.- Selbständigkeit und Schülerinteressen zu fördern.245
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT- Entsprechend den eigenen Möglichkeiten (Personal, räumliche Bedingungen usw.)behinderte Schüler zu integrieren.- Handwerkliche, künstlerische u.a. Sonderprogramme anzubieten.Die Organisation kann umfassen:- Räume von Lerngruppen für selbständiges und individualisiertes Arbeiten gestalten.- Vorbereitete Lernmaterialien einsetzen und ständig neue Materialien entwickeln.- Zusammenarbeit mit Industrie, Handwerk oder öffentlicher Verwaltung bei einzelnenProjekten <strong>auf</strong>bauen. Wenn Schulen solche Kontakte knüpfen, können erstaunlicheErgebnisse zustande kommen. So haben Schüler des Oberhausener Elsa-Brandström-Gymnasiums, dessen Gebäude durch eine dreispurige Straße getrenntsind, "detaillierte Pläne ausgearbeitet". Sie wurden dabei vom Stadtplanungsamtunterstützt, wo sie sich mit Bauordnungen und Vorschriften vertraut machen konnten."Eine hilfsbereite Angestellte der Behörde kam immer wieder in den Unterricht."Mitarbeiter des Amtes bezeichneten <strong>die</strong> erarbeiten Pläne als "professionell"."Jetzt wollen <strong>die</strong> Schüler eine Bürgerinitiative gründen, um Eltern und Nachbarn zumobilisieren" (DER SPIEGEL 35/ 1994, S. 40 f.).- Zur Förderung besonderer Interessen von Schülern zeitweilig externe Betreuer engagieren.- Altersgemischte Gruppen bilden.- Ganztägige Betreuung anbieten.- Enge Zusammenarbeit mit Eltern.- Mitbestimmung von Eltern und Schülern (in dazu geregelten Formen).- Individuelle Leistungserfassung- neben staatlichen Abschlüssen auch schuleigene Zeugnisse über besondere Fertigkeitenund Persönlichkeitsmerkmale von Schülern ausgeben.Das Programm einer Schule kann zum einen der Klärung der Ziele, zum anderen ihrerDiskussion sowie der Kontrolle ihrer Erreichung <strong>die</strong>nen. Außerdem können ausformulierteProgramme auch zu einem höheres Maß an Transparenz oder Offenheit beitragen.Geschlossenheit vs. OffenheitGeschlossenheit liegt vor, wenn es einer <strong>Institution</strong> gelingt, Kritik an zentralen Maßnahmenoder Maßnahmekomplexen immer wieder durch Hinweise <strong>auf</strong> Grundsätze zuentkräften, <strong>die</strong> weithin als selbstverständlich <strong>auf</strong>gefasst und akzeptiert werden. Es gehtalso nicht notwendig um <strong>die</strong> Immunisierung ganzer Systeme, sondern vielmehr um wesentlicheBestandteile.Die Geschlossenheit oder Abschirmung vor öffentlicher Kritik kann sich auch <strong>auf</strong> eineinzelnes Prinzip oder Merkmal beziehen. Ein Beispiel dafür ist das Leistungsprinzip246
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT(vgl. FEND u.a. 1976, 173 ff.), das im Selbstverständnis der Schule und breiter gesellschaftlicherSchichten von zentraler Bedeutung ist. Durch eine einseitige Auffassungvon Leistung wird das Missverständnis begünstigt, alternative Formen des Unterrichtsmüssten notwendig zu einer Vernachlässigung des Leistungsaspekts ten<strong>die</strong>ren. SofernLeistung nämlich mit lehrplanmäßigem Unterricht und nachfolgendem sozialem Leistungsvergleichgleichgesetzt wird, müssen nicht wettbewerbsorientierte Formen der Forderungund Förderung von Leistungen, der Leistungserbringung und Leistungsbeurteilungals nonkonform hinsichtlich des einseitig gedeuteten Leistungsprinzips erscheinen.Geschlossenheit ist kein Merkmal das mit dem Status einer Schule – sei sie nun privat,staatlich oder kirchlich – zusammenhängt. Auch autonome Schulen können sich einigelnund sich gegenüber Kritik taub stellen. So beklagt SKIERA (1982, S. 107) den Isolationismusvieler der autonomen niederländischen Schulen.Offenheit setzt zum einen den Zugang für Eltern und Untersucher voraus, zum anderenvergleichende Untersuchung und <strong>die</strong> Veröffentlichung der Ergebnisse. Dabei ist zu beachten,dass ein umfassender Eindruck der Leistungen einer Schule sich nur gewinnenlässt, wenn Untersuchungen eine Vielfalt von Vergleichskriterien einbeziehen, <strong>die</strong> auch<strong>die</strong> Ziele der jeweiligen Schulen berücksichtigen. 84 Dazu kann z.B. gehören, <strong>auf</strong> welcheArt und mit welchen Konsequenzen für das Selbstwertgefühl, für Zufriedenheit, Leistung,Berufschancen usw. (benachteiligte) Schüler gefördert wurden; welchen Zusammenhangzwischen den verschiedenen schulischen Maßnahmen und an Aggressivität,Orientierungslosigkeit bzw. Verhaltenssicherheit, Durchsetzungskraft, KooperationsundProblemlösungsfähigkeit usw. besteht. Auch <strong>die</strong> Beurteilung durch Arbeitgeber, derErfolg im Studium und andere langfristige <strong>Auswirkungen</strong> können von Bedeutung für <strong>die</strong>Beurteilung sein.Offenheit in <strong>die</strong>sem Sinn ist also gleichbedeutend mit der Bereitschaft zu offenem Wettbewerb.Dieser Wettbewerb vollzieht sich nicht nur über <strong>die</strong> Ergebnisse wissenschaftlicherUntersuchungen, sondern hängt in hohem Maß auch von der Selbstdarstellung derSchule in der Öffentlichkeit und von der Elternarbeit ab. Wenn beispielsweise Schulenmit Betrieben zusammenarbeiten, könnten Schüler im Rahmen von Unterrichtsprojektenbeispielsweise lokale Marktanalysen oder Werbekampagnen durchführen oder zumindestbegleiten. Betriebe können Schüler-Wettbewerbe in bestimmten Bereichen ausschreibenund so öffentliche Foren für Schulen und <strong>die</strong> von ihnen geförderten Talenteschaffen.84Zur Problematik der Untersuchung von Schuleffektivität vgl. Madaus / Airasian / Kellaghan 1980.247
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTOffenheit führt damit nicht nur zu Wettbewerb, sondern hat auch didaktische Konsequenzen,weil <strong>die</strong> Öffnung zur Umgebung neben Auseinandersetzungen auch Kontakteeröffnet und <strong>die</strong> Kooperation mit anderen <strong>Institution</strong>en fördert. Schließlich erwirbt eineSchule damit Wettbewerbsvorteile. Der Wettbewerb muss im Übrigen nicht oder zumindestnicht in erster Linie der Verdrängung unterlegener Schulen <strong>die</strong>nen. Der Hauptzweckist vielmehr <strong>die</strong> Ausführung oder Erprobung unterschiedlicher Versuche und <strong>die</strong> Möglichkeitvoneinander zu lernen.248
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTeil VIAusblick24. Wege zu besseren SchulenWenn ich über Wege zu besseren Schulen nachdenke, bin ich mir durchaus bewusst,dass niemand <strong>die</strong>se Wege im Detail zu kennen und zu beschreiben vermag. Wir könnenlediglich <strong>die</strong> allgemeinen Bedingungen erkunden, <strong>die</strong> langfristig zu „schlechten“ oder„guten“ Schulen führen. Verfolgt man jedoch Diskussionsrunden, drängt sich zumeistder Eindruck <strong>auf</strong>, als wüssten <strong>die</strong> beteiligten Bildungspolitiker und Erziehungswissenschaftlerbis ins Einzelne, was getan werden muss, um Schulen grundlegend und dauerhaftzu verbessern. Offenbar sind <strong>die</strong> Reformer allzu sehr davon überzeugt, komplexeProzesse steuern zu können, obwohl weder Behörden noch wissenschaftliche Disziplinenjemals über <strong>die</strong> Kenntnis aller erforderlichen speziellen Tatsachen verfügen können.Tatsächlich haben bisherige Reformen ja auch kaum nennenswerte Verbesserungen erbracht.85 Doch der Irrglaube, Behörden und beratende Wissenschaftler würden wissen,wie Schulen reformiert werden müssen, wird in der Regel in den in der Öffentlichkeitzum Ausdruck gebrachten Meinungen vertreten. Gerade solche Einstellungen undDenkmuster bestätigen und stärken <strong>die</strong> derzeitige Gestalt und Funktion der Schule. DieFrage ist also, wie und unter welchen Bedingungen sich <strong>die</strong>ses Vertrauen in Planungsbürokratienwandeln und ein Druck in Richtung freierer Entwicklungsprozesse entstehenkann.85Tatsächlich hat es in den vergangenen Jahrzehnten ja eine ganze Reihe von Schulleistungsuntersuchungenin verschiedenen Fächern gegeben, <strong>die</strong> zwar manchmal zu Änderungen, aber nie zu grundlegendenVerbesserungen geführt haben (mit Ausnahme der skandinavischen Länder). Dazu kommt,dass <strong>die</strong>se Änderungen eigentlich immer politisch motiviert waren, und fast nie wegen der Kinder o-der Jugendlichen vorgenommen worden sind, was schon Robert Dottrens (The Primary School Curriculum.Unesco 1962, 145 ff.) beklagt hat.249
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTSchulentwicklung als evolutionären Prozess verstehen lernenDas Auseinanderdriften zwischen den Zielen der Schulen und ihren Ergebnissen ist geeignetResignation, Schuldzuweisungen und ähnlich unproduktive Verhaltensweisen zuprovozieren. Schulentwicklung dürfte aber überall dort schleppend in Gang kommenund lange dauern, wo <strong>die</strong> Betroffenen sich selbst mit ihren Wünschen und Ängsten imBlick haben. Denn sind <strong>die</strong> Menschen daran gewöhnt, von den Regierungen vor allemden Schutz ihrer Privilegien zu erwarten, werden sie Einschränkungen immer nur beianderen akzeptieren. Solche Privilegien sind in Deutschland beispielsweise der Beamtenstatus(der Lehrer), <strong>die</strong> Vorteile bestimmter Lehrergruppen oder auch <strong>die</strong> Vorzüge,<strong>die</strong> eine bestimmte Schulform in den Augen mancher Eltern besitzen mag. In <strong>die</strong>semZusammenhang sind auch <strong>die</strong> Forderungen nach Hebung der Leistungsstandards zu sehen.Denn <strong>die</strong>s bedeutet <strong>die</strong> Auslese der Kinder sozial benachteiligter Gruppen. Ihneneine gute Schulbildung vorzuenthalten führt jedoch nur zu einer Verschiebung des Problems,weil <strong>die</strong>se jungen Menschen ja weiterhin Mitglieder der Gesellschaft sind.Da Behörden Forderungen der verschiedenen Interessengruppen nicht angemessen berücksichtigenkönnen, unterbleiben <strong>die</strong> erforderlichen grundlegenden Änderungen. Ausder Sicht der <strong>auf</strong> ihre Wünsche und Ängste eingeengten Interessengruppen erscheint dasimmer noch als das Vorteilhafteste. Eine breite Unterstützung für eine grundlegendeReform setzt eine Änderung <strong>die</strong>ser Haltungen voraus.Ein solcher Bewusstseinswechsel muss seinen Ausdruck zunächst im Handeln der Bürgerfinden. In Deutschland scheint es hier am ehesten im Bereich der Grundschule einegewisse Bewegung zu geben. Grundschulen sind seit jeher Gesamtschulen, <strong>die</strong> von allenals schulreif beurteilten Kindern unabhängig von Leistungseinstufungen besucht werden.Hier ist in den Präferenzen der Eltern und Lehrer ein wachsender Trend hin zu reformpädagogischenSchul- und Unterrichtsformen zu beobachten. Das ist leicht zu verstehen.Denn um mit den sehr großen Unterschieden zwischen den Schülern in kultureller, sozialerund kognitiver Hinsicht umgehen zu können, sind <strong>die</strong> Konzepte der traditionellenStaatsschule ungeeignet. Inzwischen werden land<strong>auf</strong> landab – häufig mit Zustimmungoder Förderung der Behörden – Montessori- und andere an reformpädagogischen Vorstellungenorientierte Schulen gegründet, <strong>die</strong> eine weit stärkere Individualisierung ermöglichen.Die Eltern verstehen durchaus, dass sie Vorteile für ihre Kinder nur erhaltenkönnen, wenn alle Kinder in den Genuss erweiterter, besserer Bildungsmöglichkeitengelangen.250
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDarüber hinaus wurden in den letzten Jahren durch private Initiativen wie <strong>die</strong> Bertelmann-Stiftungeine Vielzahl schulischer Projekte, Versuche der Qualitätsverbesserungund vieles andere angeregt. Eine wachsende Zahl von Lehrern, Schülern, Eltern undinteressierten Bürgern werden in solche Prozesse einbezogen. Darüber hinaus wurdendurch einige Me<strong>die</strong>n Diskussionen angeregt. Es ist verständlich, dass dabei insbesondereVeröffentlichungen eine wichtige Rolle spielen, <strong>die</strong> von herrschenden Lehrmeinungenabweichen. Internationale Organisationen und Forschungsinstitute fördern <strong>die</strong>se Prozessedurch <strong>die</strong> nationalen und internationalen Schulvergleichsuntersuchungen. Zudem ist<strong>die</strong> Konkurrenz durch Privatschulen geeignet das Denken in Alternativen zu fördern.Derartige Initiativen werden das Schulwesen zwar nicht grundlegend verändern, aber siesind geeignet, <strong>die</strong> Bereitschaft zur Aufnahme neuer Ideen zu steigern. Es ist anzunehmen,dass immer wieder bürokratisch-kosmetische Reformen für eine Weile das Feldbeherrschen. Letztlich kann <strong>die</strong>s aber nicht von Dauer sein. Denn von den Regierungenverordnete Reformen werden <strong>die</strong> wachsenden schulischen Probleme nicht nachhaltiglösen können. Weil bürokratische Planung und Steuerung der individuellen Initiative zuwenig Freiräume bietet, können sich kaum nennenswerte alternative Schulformen, Methoden,Lehrinhalte, Prüfungsformen und Abschlüsse entwickeln. Solche Alternativensind jedoch notwendig, weil durch sie erprobt und gezeigt werden kann, welche Mittelnachweislich bessere Lösungen erlauben.Schon <strong>die</strong> gegenwärtigen minimal-alternativen Schulversuche haben auch das wissenschaftlicheDenken über Schule und Erziehung stimuliert. Häufig ist Wissenschaft nämlichnur ein Prozess der Ausarbeitung, Auswahl und Prüfung von bereits gebildeten I-deen. Entfällt <strong>die</strong> Anregung durch eine breite Palette alternativen Handelns, konzentrierensich auch Wissenschaftler einseitig <strong>auf</strong> das, was ist. 86 Dabei sollte ihre Aufgabe dochgerade sein, hypothetische Modelle von prinzipiell möglichen Alternativen zu entwickelnund zu prüfen. Auf <strong>die</strong>se Weise können wir nämlich erfahren, was Schulen leistenkönnten, wenn der Staat einen anderen Rahmen für ihr Handeln schaffen würde.Nun nehmen aber in einer Zeit der Globalisierung auch in Schule und Bildungsforschung<strong>die</strong> Vergleichsmöglichkeiten zu. Nationen, <strong>die</strong> ihre Schulen von den Fesseln der86Tatsächlich konzentrieren sich Forschung und Literatur einseitig <strong>auf</strong> <strong>die</strong> allgemeine „Staatspädagogik“.Es gibt auch nur relativ wenig Vergleiche zwischen den staatlichen und den wenigen alternativenSchulen – angeblich weil Alternativschulen mit staatlichen nicht vergleichbar seien (vgl. dazuauch Anm. 31).251
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBürokratie befreien, könnten gegenüber anderen Nationen Vorteile gewinnen. Es könntenbereits nach relativ wenigen Jahren <strong>Auswirkungen</strong> <strong>auf</strong> Wirtschaft, Gesundheit, gesellschaftlicheHarmonie und andere Faktoren erkennbar sein. Solche zumindest teilweisedurch Schulsysteme bewirkten Unterschiede zwischen Nationen werden unweigerlichauch <strong>die</strong> Schulentwicklung in anderen Ländern vorantreiben. Auch wenn einzelne Interessengruppensich <strong>die</strong>sem Prozess hartnäckig verweigern, werden sie dem Druck <strong>auf</strong>Dauer nicht standhalten können.Durch geeignete Rahmenbedingungen <strong>die</strong> Entwicklung der SchulenfördernWas geschehen muss, ist nichts weniger als der Übergang von einer Planungsbürokratiehin zu einer freien Entwicklung der Schulen. Die Frage für muss also letztlich sein, wieman <strong>die</strong> Betroffenen in den einzelnen Schulen dazu bringen kann, selbst <strong>die</strong> Anpassungenan <strong>die</strong> Erfordernisse einer sich ständig verändernden Welt zu vollziehen.Gelegenheit zu eigenständigem Denken und Handeln kann geschaffen werden durcheine mehr oder weniger weitreichende Lockerung aller bürokratischen Vorgaben vonden Lehrplänen bis hin zu den Abschlüssen. Die Schulen würden nicht zum Wandel gezwungen.Anfangs könnten herkömmliche Bildungsinstitutionen noch samt ihrer Bürokratiebestehen bleiben. Aber durch <strong>die</strong> Lockerung der derzeitigen Vorgaben würde eineSuche nach Alternativen in Gang gesetzt. Man würde beginnen, sich an Schulen zu orientieren,<strong>die</strong> in Vergleichsstu<strong>die</strong>n besser abschneiden. Die Bürokratien müssten wohloder übel versuchen, den Schulen bei ihrer Entwicklungsarbeit eine Hilfe zu sein. Diebisherigen Vorschriften würden für eine gewisse Zeit zwar noch einen gewissen Haltgeben, aber nach und nach von schuleigenen, dem jeweiligen Bedarf entsprechendenRegelungen ersetzt werden. Insbesondere freie Schulen und Schulen mit mutigen Leitern,Lehrern und Eltern hätten <strong>die</strong> Möglichkeit ihre Vorstellungen einer besseren Schulezu erproben. Sie würden sozusagen <strong>die</strong> Speerspitze der Entwicklung bilden. In ihremeigenen Veränderungsprozess könnten Schulen <strong>die</strong> Beratung von Lehrern weiter fortgeschrittenerEinrichtungen auch aus anderen Ländern in Anspruch nehmen.Die Entwicklung der Schulen wird also im wesentlichen von innen heraus erfolgen müssen,auch wenn grundlegende Anstöße zunächst von außen kommen. So würden Lehrer,Schüler und Eltern <strong>auf</strong>grund des Bestehens weiter fortgeschrittener Schulen dazu ange-252
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTregt, ihre eigenen Auffassungen zu prüfen und womöglich allmählich zu verändern. DieseBewegung würde eine ständig wachsende Vielfalt von Versuchen hervorbringen. Eswären individuelle Konzepte, <strong>die</strong> erneuert, verbessert und weiter entwickelt werden,indem Einzelne und Schulen versuchen, <strong>die</strong> besten Lösungen für sich zu finden und weiterzu entwickeln. Andere Schulen könnten Elemente oder Kombinationen von Elementen<strong>auf</strong>greifen und sie im Hinblick <strong>auf</strong> <strong>die</strong> für sie wesentlichen Umstände weiter entwickeln.Das ist ein quasi organischer Prozess und nicht durch den konstruierenden undvon oben her planenden Staat bewirkt.Hier stehen wir vor dem Problem der Kontrolle. Kaum eine Regierung wird bereit sein,<strong>die</strong> Verbindlichkeit all <strong>die</strong>ser Regelungen <strong>auf</strong>zuheben, ohne eine Möglichkeit der Kontrolleund Eindämmung von Willkür zu haben. In Deutschland ist <strong>die</strong> Aufsicht sogargrundgesetzlich vorgeschrieben. Es wäre jedoch problematisch, <strong>die</strong>se Kontrolle den altenBürokratien zu überlassen. Um ihre Macht zu erhalten, müssten sie <strong>die</strong> alten Strukturenverteidigen. Es gibt jedoch andere Lösungen. In Schweden beispielsweise sind <strong>die</strong>Schulen zwar selbständig, also unabhängig von Weisungen, müssen aber ihrer Kommunejährlich Bericht erstatten. So spüren <strong>die</strong> Bürger viel direkter <strong>die</strong> Verpflichtung, sichum <strong>die</strong> Jugend zu kümmern. Die alte Schulbürokratie haben <strong>die</strong> Schweden <strong>auf</strong>gelöst,aber <strong>die</strong> Regierung gibt Bildungsstandards vor und legt <strong>die</strong> Fächer sowie <strong>die</strong> Anzahl derStunden pro Fach, bezogen <strong>auf</strong> <strong>die</strong> gesamte Schulzeit, fest. Wenn solche Bildungsstandardssehr allgemein gehalten sind, geben sie den Schulen viel Freiraum für selbständigesGestalten und Handeln. 87 Die Überprüfung solcher Standards sollte weniger derKontrolle als vielmehr der Hilfe und Anregung für Verbesserungen <strong>die</strong>nen. Vor allemsollten sich <strong>die</strong> Überprüfungen sich nicht <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Schulleistungen konzentrieren, sondernauch andere Merkmale beachten. So könnte man erfahren, wie sich unterschiedlicheBedingungen auswirken beispielsweise <strong>auf</strong> Selbstwertgefühl, Aggressivität, Verhaltenssicherheit,Kreativität, Durchsetzungskraft, Teamgeist, Berufs- und Stu<strong>die</strong>nerfolg, Beurteilungendurch schulfremde Personen und Einrichtungen usw. 88Zur Finanzierung der Schulen hat sich ein Gutscheinsystem bewährt, bei dem <strong>die</strong> Schülerdas Geld sozusagen in ihre Schule mitbringen, <strong>die</strong> davon alle Ausgaben von den Leh-8788Allgemein hierzu Helmut Lehner: Einführung in <strong>die</strong> empirisch-analytische Erziehungswissenschaft.Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1994, S.126 ff.Vgl. Helmut Lehner: Lassen sich Alternativ- und Regelschulen vergleichen? In: Ztschr. F. Soz. d. Erz.u. Sozialisation, 18, 1998, 53-65.253
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTrergehältern bis zur Gebäudereinigung bestreitet. 89 Das Modell wird mit Anpassungenan <strong>die</strong> jeweiligen Umstände beispielsweise in den Niederlanden, in Schweden und teilsin den USA genutzt. Auf <strong>die</strong>se Weise können <strong>die</strong> Kosten der allgemeinen Schulbildungvom Staat bestritten werden, ohne dass <strong>die</strong> Schulen notwendig staatlich sein müssen.Wenn <strong>die</strong> Schüler ihre Gutscheine einer frei gewählten Schule übergeben könnten, hättedas zudem den Vorteil, dass zunehmend <strong>die</strong> Schulen entstehen könnten, <strong>die</strong> Kindern undJugendlichen in ihren eigenen wie in den Augen ihrer Eltern zur bestmöglichen Bildungverhelfen. Bei freier Schulwahl würden Schüler und Eltern grundsätzlich dazu angeregt,sich Gedanken über <strong>die</strong> Schule, ihre Methoden, ihre zu erwartenden Wirkungen undvieles andere zu machen. Sie würden vermehrt Berichte über Schulen lesen. So würde<strong>die</strong>se Form der Finanzierung auch <strong>die</strong> öffentliche Diskussion von Schulfragen erheblichanregen.Bei eigenständig agierenden Schulen würden Unterschiede bald offensichtlich werden.Gerade durch <strong>die</strong>se Unterschiede würde <strong>die</strong> eigene Schule für alle Betroffenen erst sorichtig interessant. Selbstständige Schulen werden allein aus dem Interesse an ihrerSelbsterhaltung damit beginnen, ihren Schülern und deren Eltern echte Mitbestimmungeinzuräumen, Ziele und Schwierigkeiten mit ihnen zu teilen und gemeinsam mit ihnennach Lösungen zu suchen. So wird eine echte Zusammenarbeit möglich, und <strong>die</strong> Schulenkönnen zunehmend eine Funktion als kulturelle Zentren ausüben und sich für anderegesellschaftliche Bereiche öffnen, mit der lokalen Wirtschaft gemeinsame Projekte planen,sich mit Aufgaben und Problemen ihrer Kommunen in sozialen, technischen, kulturellenBereichen beschäftigen, intensiven internetgestützten Austausch mit Partnerschulenin anderen Ländern und Erdteilen pflegen. Das würde nicht nur das Schulleben bereichern,sondern auch das Leben der Kommunen und eine frühe soziale Einbindung derKinder und Jugendlichen fördern.Die Selbständigkeit der einzelnen Schulen also ist entscheidend. Das bedeutet, dass <strong>die</strong>Schulen für alles verantwortlich sind: für <strong>die</strong> Einstellung, Vertragsgestaltung und Bezahlungder Lehrer. Sie könnten sich beispielsweise für den Fremdsprachenunterricht verstärktausländische Lehrer holen und so ihrer Schule auch einen internationalen Charaktergeben. Sie könnten <strong>die</strong> Arbeitszeit und Aufgaben ihrer Lehrer bestimmen (wobei89Das Modell stammt ursprünglich von Milton Friedman: The Role of Government in Education, in:Robert A. Solo (Ed.): Economics and the Public Interest. New Brunswick: NJ Rutgers UniverstiyPress 1955254
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTÜbergangsregelungen für <strong>die</strong> noch beamteten Lehrer erforderlich sind). Sie können, zumindestinnerhalb eines gewissen Rahmens, den Lehrplan gestalten, <strong>die</strong> Aufteilung derStunden über das Schuljahr vornehmen und <strong>die</strong> ganze Einrichtung in eigener Verantwortungführen sowie <strong>die</strong> Schüler und Eltern an <strong>die</strong>ser Aufgabe beteiligen. Sie können ganztägigeBetreuung einführen, mit nahegelegenen Kindergärten oder weiterführendenSchulen, mit Universitäten, Firmen und Museen kooperieren. Die Vielfalt der Anregungen,<strong>die</strong> solche Schulen <strong>auf</strong>greifen würden und <strong>die</strong> wiederum von ihnen ausgehen würden,wäre viel größer als heute.Langfristig wären auch Rückwirkungen <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Hochschulen und insbesondere <strong>die</strong> Lehrerausbildungzu erwarten. Denn Staatsprüfungen für <strong>die</strong> Lehrer könnten entfallen. DieSchulen würden Lehrer nach eigenen Kriterien einstellen, was letztlich zu Veränderungenbei den Stu<strong>die</strong>ngängen führen würde. Denn <strong>die</strong> Schulen könnten Bewerber vorziehen,<strong>die</strong> <strong>die</strong> herkömmliche Ausbildung nicht durchl<strong>auf</strong>en oder berufliche Erfahrungen inganz anderen Bereichen gesammelt haben. Sie könnten von sich aus anregen, dass angehendeLehrer erst ein Praktikum an der Schule absolvieren und sich danach bei reduziertemGehalt der Lösung oder theoretischen Durchdringung von Problemen widmen, <strong>die</strong>sich aus den von ihnen gewonnenen schulischen oder erzieherischen Erfahrungen ergeben.Diese angehenden Lehrer würden sich dann Hochschulen und Stu<strong>die</strong>ngänge aussuchen,<strong>die</strong> dazu sinnvolle individuelle Hilfen anbieten können. 90Bei Wegfall der Lehrpläne würden Schulen <strong>die</strong> Kinder und Jugendlichen verstärkt entsprechendderen individuellen Neigungen oder Talenten fördern. Die üblichen Formender Leistungsprüfung wären unter <strong>die</strong>sen Umständen sinnlos. Weitaus vorteilhafter wärendirekte Leistungsvorlagen, denn Leistung spricht für sich selbst. Das würde auchdem normalen Leben mehr entsprechen. Denn wer einen guten Handwerker sucht,schaut sich am besten dessen Produkte an statt seine Zeugnisse. Man entscheidet sich fürein Stammlokal, weil man beim ersten Besuch zufrieden war und nicht weil das Zeugnisdes Kochs oder der Be<strong>die</strong>nung irgendwelchen formalen Ansprüchen genügt. Desgleichensind <strong>die</strong> Leistungen der Schüler, <strong>die</strong> sie mit umfassenden eigenen Arbeiten dokumentieren,aussagekräftiger als bloße Ziffernzensuren. RUPERT VIERLINGER hat <strong>die</strong>se90Dabei könnten <strong>Institution</strong>en wie <strong>die</strong> School of Independent Study eine besondere Attraktivität gewinnen(Eunice Hinds: The School for independent study and international links. Ziff Papiere 69, Hagen:FernUniversität 1987; Helmut Lehner: Autonomous Learning in Distance Education: Methodologyand Results / Autonomes Lernen und Fernlehre: Methoden und Wirkungen. In: Börje Holmberg /Gerhard E. Ortner (Hrsg.): Research into Distance Education / Fernlehre und Fernlehrforschung.Frankfurt 1991 (Lang), S. 160-176.255
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTForm der Leistungsbeurteilung ausgiebig untersucht und gezeigt, dass sie nicht nur beiPersonalchefs Zustimmung findet, sondern darüber hinaus auch <strong>die</strong> Schüler selbst ermutigt,sich mehr als üblich anzustrengen, Schwächen zu überwinden und <strong>die</strong> ihnen möglichenHöchstleistungen zu erbringen. 91Die Befreiung von der Einhaltung der Lehrpläne hätte somit zur Folge, dass <strong>die</strong> Abschlüssezunehmend individueller würden. Fachliche und fächerübergreifende Leistungenkönnten durch konkrete Projekte samt Bewertung belegt werden. Darüber hinauskönnten Leistungen einbezogen werden, <strong>die</strong> bei schulischen Abschlüssen heute eherwenig Beachtung finden, aber im beruflichen Alltag von großer Bedeutung sind. Beispielsweisekann ein Schüler oder eine Schülerin bei einem Tüftlerwettbewerb mitgemachtund einen funktionierenden Apparat entwickelt haben; oder ein Schüler war erfolgreichim Schülerparlament tätig, hat eine Schülerzeitung herausgegeben, eine Reihevon interessanten Arbeiten geschrieben, interessante Musik komponiert; ein anderer istvon seinen Kameraden als Leiter umfangreicher Projekte gewählt worden. Die Gesamtheitsolcher Leistungen ist sicher aussagekräftiger als ein herkömmlicher Schulabschlussund würde auch im Leben eher weiterhelfen. Für <strong>die</strong> Schulen würde es dann immerwichtiger, <strong>die</strong> Stärken der Kinder und Jugendlichen in ihren Lebensbezügen zu fördern,ihren Forscher- und Entdeckerdrang zu unterstützen und zu erhalten.Eine weitere Folge wäre der Wegfall der ministeriellen Zensur der Schulbücher. DieVerlage würden ebenso wie <strong>die</strong> Schulen nach Wegen suchen, <strong>die</strong> Schüler bei der Vorbereitung<strong>auf</strong> <strong>die</strong> Zukunft zu unterstützen. Da <strong>die</strong>ses allgemeine Ziel viele Möglichkeitenoffen lässt, würde eine intensive Suche einsetzen. Die Verlage würden sich mit geeignetenBüchern zu übertreffen suchen. Es entstünde eine wirkliche Vielfalt. Statt nur in Detailszu unterscheidenden Büchern stünde eine Fülle von Alternativen zur Auswahl.Doch würden Anregungen nicht nur von Büchern ausgehen, sondern auch von den unterschiedlichenArbeiten der Schüler oder Schülergruppen, von Erfinderklassen mit ihrenteils patentierten Erzeugnissen, von Schülerunternehmen, -theatern oder Kunstgruppen.Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. 929192Rupert Vierlinger: Leistung spricht für sich selbst. „Direkte Leistungsvorlage“ (Portfolios) statt Ziffernzensurenund Notenfetischismus. Heinsberg: Dieck Verlag 1999Alles das existiert bereits an einzelnen Schulen. So gibt es am Maristengymnasium in der MarktgemeindeFürstenzell bei Passau eine Erfinderklasse, <strong>die</strong> der Oberstu<strong>die</strong>nrat Hubert Fenzl gegen den erbittertenWiderstand der Schulbürokratie durchgesetzt und <strong>die</strong> inzwischen eine stattliche Reihe vonPatenten vorzuweisen hat.256
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTEine Gefahr könnte in einer zu starken Orientierung an Erwartungen der Wirtschaft odereiner anderen Gruppe bestehen. Immer wenn das Wissen einer bestimmten Gruppe derartüberschätzt wird, bedeutet das, dass unsere grundlegende Unwissenheit außer Achtgelassen wird. Dadurch wird <strong>die</strong> Realisierung von Zielen behindert, deren Wert für <strong>die</strong>Zukunft heute nicht zu erkennen ist. Doch jedes Hindernis, das gegen <strong>die</strong> Verfolgungungewohnter oder aus heutiger Sicht wenig sinnvoll erscheinender Ziele <strong>auf</strong>gerichtetwird, kann zukünftig bedeutsamen Interessen schaden. Die Freiheit in der Verfolgungder verschiedensten Ziele – soweit <strong>die</strong>s nicht offensichtlich schädlich ist oder im Widerspruchzu unseren Gesetzen steht – ist so wesentlich, weil <strong>die</strong> Chance, <strong>die</strong> Zukunft erfolgreicherzu bewältigen, größer ist, wenn wir der heranwachsenden Generation Raumfür <strong>die</strong> Beschäftigung mit dem Unvorhersehbaren oder dem Unvoraussagbaren lassen. 93Erziehung als Hilfe zur individuellen Entwicklung <strong>auf</strong>fassenTraditionell wird unter Erziehung <strong>die</strong> Formung von Menschen nach erwünschten Zielenverstanden. Die Educanden sollen Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen oder Werthaltungenerwerben, <strong>die</strong> in einer Gesellschaft als wertvoll gelten. Durch entsprechende Maßnahmensollen <strong>die</strong> Lehrer <strong>die</strong> Verwirklichung <strong>die</strong>ser Ziele bei den Schülern herbeiführen.Erziehung ist also in der Regel ein Prozess, der das Denken und Verhalten der Kinderund Jugendlichen von außen her bestimmt.Die Entwicklung von Alternativen zur herkömmlichen Schule wird <strong>die</strong>ser Erziehung vonaußen eine „Erziehung von innen“ entgegensetzen. Bildung und Erziehung werden verstandenals Hilfe für den Einzelnen, seine individuellen Kräfte zu entfalten. 94 Es ist janicht zu übersehen, dass Kinder aktive Wesen sind, Wesen mit einem eigenen Willen,eigenen Vorstellungen, einem eigenen Charakter, einem eigenen Geist. Über all das verfügensie nicht erst nach einer gewissen Entwicklung, sondern von Anfang an. Schon derSäugling ist ein Forscher und Entdecker, ein geborener Kommunikator und Beobachter,aber auch ein regelrechtes Willensbündel. Alternative Formen von Erziehung und Bildungstreben danach, <strong>die</strong>se inneren Kräfte zu nutzen, sich ihnen anzupassen und Erziehungals Hilfe im Prozess <strong>die</strong>ser Entwicklung von innen heraus zu sein.9394Vgl. Friedrich A. v. Hayek: Die Verfassung der Freiheit. Tübingen: Mohr 1971, 49 ff.Dieses Ideal wurde von Wilhelm von Humboldt formuliert: Ideen zu einem Versuch, <strong>die</strong> Grenzen derWirksamkeit des Staats zu bestimmen. In: Wilhelm von Humboldt. Auswahl und Einleitung vonHeinrich Weinstock. Frankfurt: Fischer TB, 1957, 21-55.257
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDenn es scheint gewissermaßen das Gesetz im Einzelnen, das ihn leitet, ihn dazu drängt,seine Umwelt zu erobern, ihn zwingt, <strong>die</strong> ihn umgebende Sprache zu lernen, Mengenverschiedener Mächtigkeit zu unterscheiden, <strong>die</strong> grundlegende Verschiedenheit von Lebewesenund Dingen zu erkennen und vieles mehr. Diese Kraft im Lebewesen ist stark.Sie bewegt kleine Kinder, sich <strong>die</strong> Lautbildung und <strong>die</strong> Sprache ihrer Umwelt zu erobern.Sie haben dabei wohl kaum das Gefühl, sie würden Sprechen lernen, sondern derSpracherwerb ist eher etwas, das mit ihnen geschieht. Sie setzen sich mit ihrer Umgebungauseinander, und <strong>die</strong> Folge davon ist, dass sie lernen. Aber <strong>die</strong>ses Lernen ist keinEinfüllen von Wissen und Können in einen mehr oder weniger leeren Geist, sondern derGeist ist – selbst beim Säugling – bereits voller Wissen und Fähigkeiten, wie <strong>die</strong> neuereEntwicklungspsychologie zeigt. 95Lernen bedeutet demnach <strong>die</strong> Entwicklung oder Auswicklung von Potenzialen, <strong>die</strong> imIndividuum bereits vorhanden sind. Wir werden immer mehr erfahren und <strong>die</strong> Überzeugunggewinnen, dass Kinder und Jugendliche nicht nur von sich aus <strong>die</strong> Welt entdeckenund erobern wollen, sondern, sofern ihnen <strong>die</strong> Möglichkeit dazu eingeräumt wird, schonfrüh aus sich heraus ihre besonderen Stärken entwickeln. Montessori war der Überzeugung,dass Kinder in einer Welt ihrer eigenen Interessen leben, und dass wir das Werk,das sie dort verrichten, respektieren müssen. Lehrer und Eltern sollen sich nur „ruhig inBereitschaft ... halten und dafür ... sorgen, dass <strong>die</strong> Kinder frei sind, sich in ihrer eigenenWeise zu entwickeln.“ 96Diese Sichtweise trägt ihrerseits zu einer Verbesserung der Schulen bei. Denn wenn derUnterricht von den Schülern ausgeht, ihre Wünsche und Interessen <strong>auf</strong>greift, werdensich <strong>die</strong> Schüler verstanden fühlen. Eine Schule, <strong>die</strong> Kinder als Forscher und Erfinderbetrachtet, wird versuchen, sie durch Werkbänke, Laboratorien, Bibliotheken usw. zustimulieren. Die Vielfalt der Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten fördert <strong>die</strong> Entstehungeiner Fülle von Ideen und Kräften, Vorhaben und Erfindungen, <strong>die</strong> das Lebenund Arbeiten in einer solchen Schule spannend und <strong>auf</strong>regend machen. Wesentlich fürden Einzelnen ist <strong>die</strong> Möglichkeit, nach dem zu streben, was für ihn <strong>die</strong> größte Bedeutunghat. Nie leisten wir mehr, als wenn uns eine Sache interessiert. Da aber <strong>die</strong> für uns9596Vgl. z.B.: Doris Bischof-Köhler: Kinder <strong>auf</strong> Zeitreise. Theory of Mind, Zeitverständnis und Handlungsorganisation.Göttingen: Huber 2000; Alison Gopnik, Andrew N Meltzoff, Patricia K. Kuhl.:The Scientist in the Crib: Minds, Brains, and How Cildren Learn. W.Morrow & Company 1999Maria Montessori: Spannungsfeld Kind-Gesellschaft- Welt. Auf dem Wege zu einer „KosmischenErziehung“. Freiburg: Herder 1979, 14 u 13258
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTinteressanten und wichtigen Dinge in der Regel komplex sind, schließt <strong>die</strong> Beschäftigungdamit viele Fähigkeiten ein, <strong>die</strong> der einzelne dabei verbessern oder entfalten kann.Dazu gehören auch Kontakte zu anderen, Wissen, wo etwas zu finden ist, wen man fragenkann, der Umgang mit Menschen, mit Werkzeugen, mit Computerprogrammen, mitdem Internet. Solche interessengeleitete Aktivität bedeutet einen Zustand der Munterkeitund Freude. Die Schüler dürften unter solchen Bedingungen eher gern in <strong>die</strong> Schule gehenund nicht fehlen wollen, um nichts zu versäumen.Die Förderung der Vielfalt individueller Fähigkeiten und Interessen erbringt aber auchfür <strong>die</strong> Gesellschaft einen weit größeren Nutzen als <strong>die</strong> herkömmliche Art der schulischenErziehung nach Lehrplan. Denn <strong>die</strong> Lösung zukünftiger wirtschaftlicher, kultureller,sozialer, ökologischer und anderer Probleme hängt von uns noch unbekanntem besonderenWissen und einer Vielzahl von Fähigkeiten ab, <strong>die</strong> wir im Einzelnen nicht kennenkönnen. Deshalb sind individuelles Wissen und individuelle Fähigkeiten für <strong>die</strong>Entwicklungen in allen Bereichen so wichtig.97 Die Verschiedenheit der Individuen undihrer Fähigkeiten sind der größte Segen einer Nation. Dieses Potential an unterschiedlichenFähigkeiten aus Unverständnis einem Streben nach (Chancen-)Gleichheit oder aberder Auswahl der Leistungsstärksten im Hinblick <strong>auf</strong> einen amtlichen Lehrplan zu opfern,bedeutet eine Verschleuderung von Hoffnungen, Kräften und Möglichkeiten.Wir können nicht wissen, welche Ideen, Vorhaben oder Kombinationen von Fähigkeitenund Wissen für <strong>die</strong> Zukunft der Gesellschaft wie auch des Einzelnen am bedeutsamstensein werden. Deshalb sollten wir den Einzelnen mit seinen besonderen Interessen, Fähigkeiten,Vorstellungen, Zielen und Kontakten fördern, weil er dadurch Beiträge leistenkann, <strong>die</strong> <strong>auf</strong> andere Weise kaum entstehen würden. Wenn wir <strong>die</strong> Schüler in ihrer Individualitätfördern, werden sie letztlich ihre höchstmöglichen Leistungen erbringen undals Erwachsene der Gesellschaft in mehrfacher Weise zurückgeben, was <strong>die</strong>se ihnen hatzukommen lassen.97Vgl. Friedrich A. v. Hayek: Die Verfassung der Freiheit, Tübingen: Mohr 1971, 54259
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLiteraturverzeichnisACHAM, K.: Philosophie der Sozialwissenschaften. Freiburg/München: Alber 1983AEBLI, H.: Über <strong>die</strong> geistige Entwicklung der Kindes. Stuttgart: Klett 4 1975AFFLECK, J.Q./MADGE, S./ADAMS, A./LOWENBRAUN, S.: Integrated Classroom VersusResource Model: Academic Viability and Effectiveness. In: Exceptional Children, 54(1988), S. 339-348.AINSWORTH, M.D.S./ BELL, S.M./ STAYTON, D.J.: Infant-mother attachment and socialdevelopment: socialisation as a product of reciprocal responsiveness to signals. In.Richards, M.P. M. (Hg.): The integration of a Child into a social world. London;Cambridge University Press 1974.AINSWORTH, M.D.S./ BELL, S.M.: Infant crying and maternal responsivness. Child development,43 (1972) 1171-1199.AINSWORTH, M.D.S./BLEHAR, M.S./WATERS, E./WALL, S.: Patterns of Attachement.Hillsdale, NJ 1978 (Erlbaum).AINSWORTH, M.D.S.: Infancy in Uganda. Infant care and the growth of love. Balimore:John Hopkins Press 1967.AINSWORTH, M.E./BATTEN, E.J.: The Effects of Environmental Factors on SecondaryEducational Attainment in Manchester: A Plowden Follow-Up. London 1974 (Macmillan).ALBERT, R.: Cognitive Development and Parental Loss Among the Gifted, the ExceptionallyGifted and the Creative. In: Psychological Reports, 19 (1971) S. 19-26.AMABILE, T.M./ DEJONG, W. / LEPPER, M.R.: Effects of externally imposed deadlines onsubsequent intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 34(1976) 92-98.AMABILE, T.M.: Effects of External Evaluations on Artistic Creativity. In: Journal ofPersonality and Social Psychology, 37 (1979), S. 221-233.AMABILE, T.M.: The social psychology of creativity. New York: Springer 1983.AMES, C. / FELKNER, D.W.: An Examination of Childrens Attributions and Achievement-relatedEvaluations in Competitive, Cooperative, and Individualistic RewardStructures. In: Journal of Educational Psychology 71, 1979, 413-420.AMES, C./ AMES, R. FELKNER, D. W.: Effects of competitive reward structure and valenceof outcome on children's achievement attributions. In: Journal of EducationalPsychology, 1977, 69, 1-8.260
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTAMES, C./ AMES, R.: Thrill of victory and agony of defeat: Children's self and interpersonalevaluations in competitive and non-competitive learning environments. In:Journal of research and Development ind Education 1978, 12(1), 79-81.AMES, C.: Achievement Attributions and Self-Instruction Under Competitive and IndividualisticGoal Strutures. In: Journal of Educational Psychology, 76 (1984), 478-487.AMES, C.: Children's achievement attributions and self-reinforcement: Effects of selfconceptand competitive reward structure. In: Journal of Eductional Psychology1978, 70, 345-355.AMES, C.: Competitive versus Cooperation Reward Structures: The Influence of Individualand Group Performance Factors on Achievement Attributions and Affect.American Eduacitonal Research Journal, 18 (1981), S. 273-287.ANDERSON, R./MANOOGIAN, S.T./REZNICK, J.S.: The Undermining and Enhancing ofIntrinsic Motivation in Preschool Children. In: Journal of Personality and Social Psychology,34 (1976), 915-922.ANDERSON, RICHARD W./FAUST, GERALD W.: Educational Psychology. The Science ofInstruction and learning. New York, Toronto: Dodd, Mead &Co 1975AURIN, KURT: Gute Schulen - wor<strong>auf</strong> beruht ihre Wirksamkeit? Bad Heilbrunn: Klinkhardt21991.AURIN, KURT: Gute Schulen - wor<strong>auf</strong> beruht ihre Wirksamkeit? Bad Heilbrunn 1990(Klinkhardt).BACH, H./KNÖBEL, R./ARENZ-MORCH, A./ROSNER, A.: Verhaltens<strong>auf</strong>fälligkeiten in derSchule. Statistik, Hintergründe, Folgerungen. Mainz. (v. Hase & Koehler) 1984 (=Kultusministerium Rheinland-Pfalz: Schulversuche und Bildungsforschung. Berichteund Materialien).BAIRD, J.R.: Improving Learning Through Enhanced Metakognition: A ClassroomStudy. European Journal of Science Education. 8 (1986) 263-282.BALL, STEPHEN J.: The Micro-Politics of the School. Towards a theory of school organization.London, New York: Methuen 1987.BALL, W./ TRONICK, F. Infant Responses to Impending Collision: Optical and Real. InScience, 171 (1971), S. 818-820.BAMBACH, H.: Erfundene Geschichten erzählen es richtig. Lesen und Leben in der Schule.Konstanz: Faude 1989.BAMBACH, H.: Ermutigungen. Nicht Zensuren. Lengwil am Bodensee: Libelle Verlag1994.261
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBANDURA, A.: Reflections on Nonability Determinants of Competence. In: J. Kolligian,Jr./R.J. Sternberg (Eds.): Competence Considered: Perceptions of Competence andIncompetence Across the Lifespan. New Haven, CT 1990 (Yale University Press),315-362.BANDURA, A.: Self-Efficacy Mechanisms in Physiological Activation and Health PromotingBehavior. In: J. Madden IV/S. Matthyse/J. Barchas (Eds.): Adaptation,Learning and Affect. New York 1986 (Raven Press).BARRATT, E.S./ PATTON J.H.: IMPULSIVITY: COGNITIVE, BEHAVIORAL, AND PSYCHO-PHYSIOLOGICAL CORELATES. IN: Zuckerman, M. (Hg.): Biological bases of sensationseeking, impulsivity, and anxiety. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates1983, 77-116.BASTIAN, J. (Hg.):Pädagogische Schulentwicklung, Schulprogramm und Evaluation.Hamburg: Bergmann&Helbig 1998.BASTICK, T. Intuiton. How we Think and Act. Chicester: Wiley 1982.BASTIK, T.: INTUITION. How we think and act. Chichester, New York: Wiley 1982.BATTLE, S./BLOWERS T.: A Longitudial Comparative Study of the Self-Esteem of Studentsin Regular and Special Education Classes. In: Journal of Learning Disabilities,15 (1982), S. 100-102.BAUMERT, JÜRGEN UA. (HRSG.): Pisa 2000. Basiskompetenzen vo Schülerinnen undSchülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske und Budrich 2001.BECK, E./GULDIMANN, T./ZUTAVERN, M.: Eigenständig lernende Schülerinnen undSchüler. Bericht über ein empirisches Forschungsprojekt. In: Zeitschrift für Pädagogik,37 (1991), 735-768.BECK, E.: Chancenausgleich: Ideologie und Empirie. Eine Antwort <strong>auf</strong> Weinert. In: Zeitschriftfür Pädagogische Psychologie, 2 (1988b), Heft 3, S. 173-178.BECK, M./BROMME, R./HEYMANN, H. W./MANNHAUPT, G./SKOWRONEK, H./TREUMANN,K.: Gefangen im Datenlabyrinth. Kritische Sichtung eines Forschungsberichts zumschulischen Chancenausgleich. In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 2(1988a), Heft 2, S. 91-111.BECKER, W./MADSEN, C./ARNOLD, C./THOMAS, D.: The Contingent Use ofTeacher Attention and Praise in Reducing Classroom Behavior Problems. In: TheJournal of Special Education, 1 (1967), S. 287-307.BERGIUS, RUDOLF: Analyse der "Begabung": Die Bedingungen des intelligentenVerhaltens. In: ROTH, HEINRICH (Hg.): Begabung und Lernen. Ergebnisse undFolgerungen neuer Forschungen. Stuttgart 1969 (Klett), S. 229-268 (= DeutscherBildungsrat: Gutachten und Stu<strong>die</strong>n der Bildungskommission Bd. 4).262
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBERGSON, H.: Die beiden Quellen der Moral und der Religion. Olten: Walter, 1980.BERKOWITZ, LEONARD: A Survey of Social Psychology. New York / Chicago usw.: Holt,Rinehart & Winston 1980.BERLINER; DAVID, C.: The Nature of Expertise in Teaching. In: Effective and ResponsibleTeaching. The New Synthesis. San Francisco: Jossey-Bass 1992, S. 227-248BERLYNE, D.: Konflikt, Erregung, Neugier. Zur Psychologie der kognitiven Motivation.Stuttgart 1974 (Klett).BERLYNE, D.E./FROMMER, F.D.: Some determinants of the incidence and content ofchildren’s questions. Child Development, 37 (1966) 177-189.BERNSTEIN, B.: Education Cannot Compensate for Society. New Society, 387 (1970),S. 344-347.BERRY, COLIN: On the Origins of Exceptional Intellectual and Cultural Achievement.In: HOWE, MICHAEL (ed.): Encouraging the Development of Exceptional Skillsand Talents. Leicester 1990 (The British Psychological Society), S. 49-70.BERT, E.-M./GUHLKE, J.: Nun differenziert mal schön. Von der Überzeugung und denErfahrungen, daß Differenzierung im Grundschulalltag doch möglich ist. Frankfurta.M. 1977 (Diesterweg).BICKERTON, D.: Roots of Language. Ann Arbor, Mich.: Karoma 1981.BIEDERMAN, G.B./DAVEY, V.A./RYDER, C./FRANCHI, D.: The Negative Effects of PositiveReinforcement in Teaching Children with Developmental Delay. ExceptionalChildren, 60 (1994) 458-465.BIERHOFF, HANS W.: Psychologie hilfreichen Verhaltens. -Stuttgart / Berlin / Köln:Kohlhammer 1990.BISCHOF-KÖHLER, D.: Zur Phylogenese menschlicher Motivation. In: ECKENS-BERGER, L./LANTERMANN, E.-D. (Hg.): Emotion und Reflexivität. München,Wien, Baltimore 1985 (Urban & Schwarzenberg), S. 3-47.BLAE, JOSEPH: The Teachers' Political Orientation vis-a-vis the Principal: The Micropoliticsof the School. In: J. Hannaway/ R. Crowson (Hg.): The Politics of ReformingSchool Administration. New York: Falmer 1988, S. 113-126.BLASE, JOSEPH J.: Some Negative Effects of Principals' Controloriented and ProtectivePolitical Behavior. In: Amercan Educational Research Journal, 27 (1990), (4), 727-753.BLOOM, B.: Generalizations About Talent Development. In: Ders. (ed.): DevelopingTalent in Young People. New York 1985b, S. 507-549.263
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTBLOOM, B.: Learning for Mastery. In: Evaluation Comment, Vol. 1 (1968), No. 2, S. 1-11.BLOOM, B.: The Nature of the Study and Why It Was Done. In: Ders. (ed.): DevelopingTalent in Young People. New York 1985a (Ballantine Books), S. 3-18BLOOM, BENJAMIN: Characteristics and School Learning. New York u.a. 1976(McGraw-Hill).BLOOM, BENJAMIN: Learning for Mastery. In: Evaluation Comment, 1 (2), (1968), S.1-11.BLUM,R.: Onward to Excellence: Making Scholls More Effective. P0rtland/ Oregon1984.BÖHM, W.: Maria Montessori. Hintergrund und Prinzipien ihres pädagogischen Denkens.Basd Heilbrunn: Klinkhardt 2 1991.BORG, W.: Ability Grouping in the Public Schools. In: The Journal of ExperimentalEducation, 34 (1965), S. 1-97.BOSSERT, S.T. / DWYER, D.C. / ROWAN, B. / LEE, G. V.: The Instructional ManagementRole of the Principal. In: Educational Administration Quaterly, 18 (3), 1982, 34-64.BRADLEY, L./BRYANT, P.E.: Categorizing Sounds and Learning to Read in Preschoolers.Journal of Educational Psychology, 68 (1983), 680-688.BRAUNMÜHL, EKKEHARD VON: Antipädagogik. Stu<strong>die</strong>n zur Abschaffung der Erziehung.Weinheim, Basel: Beltz 1975.BREZINKA, W.: Tüchtigkeit. Analyse und Bewertung eines Erziehungsziels. München,Basel 1987 (Reinhardt).BROWN, R.: HUMAN UNIVERSALS. NEW YORK: MCGRAW -HILL 1991BRUNER, JEROME S.: Stu<strong>die</strong>n zur kognitiven Entwicklung. Stuttgart1971 KlettBUCKINGHAM, MARCUS/COFFMAN, COURT: First, Break all the Rules. What the World’sGreatest Managers Do Differently. New York, NY: Simon & Schuster 1999BÜCKMANN, N./HOLMBERG, B./LEHNER, H./WEINGARTZ, M.: Steuerung undSelbständigkeit im Fernstudium. Bericht zum ZiFF-Projekt 1-2.29: Fernstu<strong>die</strong>nsystemeim internationalen Vergleich. Arbeitsfeld Lehren und Lernen. Hagen 1985(FernUniversität).CAMPBELL, V.N.: Self-Direction and Programmed Instruction for Five DifferentTypes of Learning Objectives. In: Psychology in the Schools, 4 (1964), 348-359.CAMPBELL, W.J.: The Teacher's View of Teaching Behavior. In: Flanders/ Nuthall (Hg.):The Classroom Behavior of Teachers. Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft18 (1972), S. 540-546.264
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTCANDY, P.C.: Self-Direction for Lifelong Learning. A Comprehensive Guide to Theoryand Practice. San Francisco/Oxford 1991 (Jossey-Bass).CAREY, S.: Conceptual Change in Childhood. Cambridge, MA: Bradford/MIT-Press1985.CARROLL, JOHN: The Measurement of Intelligence. In: STERNBERG, ROBERT(ed.). Handbook of Human Intelligence. New York/Cambridge 1982 (CambridgeUniversity Press), S. 29-120.CASPI, A./ BEM, D.J./ ELDER, G.H.J.: Continuities and consequences of interactionalstyles across the life course. Journal of Personality 57 (1989) 375-406.CECI, S.J.: On Intelligence ... More or Less: A Bio-Ecological Theory of IntellectualDevelopment. Englewood Cliffs 1990 (Prentice-Hall).CECI, STEPHEN/LIKER, JEFFREY: A Day at the Races: A Study of IQ, Expertise,and Cognitive Complexity. In: Journal of Experimental Psychology, 115 (1986), S.255-266.CERVONE, D./PEAKE, P.K.: Anchoring, Efficacy, and Action: The Influence ofJudgmental Heuristics on Self-Efficiency Judgments and Behavior. In: Journal ofPersonality and Social Psychology. 50 (1986), 492-501.CHASE, WILLIAM/ERICSSON, ANDERS, K.: Skilled Memory. In: ANDERSON,JOHN (ed.): Cognitive Skills and their Acquisition. Hillsdale 1981 (Lawrence Erlbaum),S. 141-189.CHAUNCEY, HENRY/DOBBIN, JOHN: Der Test im modernen Bildungswesen. Stuttgart1968 (Klett).CHOMSKY, N.: Reflexionen über <strong>die</strong> Sprache. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977CLARKE, A.M./ CLARKE, A. D. B.: Early Eyperience: Myth and Evidence. London: OpenBooks; New York: Free Press 1976.COLE, JONATHAN R./COLE, STEPHEN: Social Stratification in Science. Chicago1973 (Chicago University).COMBS, A.W./AVILA, D.L./PURKEY, W.W.: Die helfenden Berufe. Stuttgart; Klett 1975.CONNELL, J.P./RYAN, R.M.: A Development Theory of Motivation in the Classroom.In: Teacher Education Quality. 11 (1984), S. 64-77.COOPER, P./UPTON, G.: An Ecosystemic Approach to Classroom Behaviour Problems.In: WHELDELL, K. (Hg.): Discipline in Schools. London, New York 1992(Routledge), S. 66-81.CORBIN, C.: Mental Practice. In: W. Morgan (Ed.): Ergogenetic Aids and MuscularPerformance. New York 1972 (Academic Press), 93-118.265
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTCORNO, L / ROHRKEMPER, M.: The intrinsic motivation to learn in classrooms. In:C.Ames / R. Ames (Hg.): Research on Motivation in Education. The classroom Milieu.New York: Academic Press 1985, Bd. 2, S. 53-84.COTTLE, T.J.: What Tracking Did to Ollie Taylor. In: Social Policy, 5 (1974), S. 21-24.COVINGTON, M.V.: The Motive for Self-Worth. In: AMES/AMES: Research on Motivationin Education. Vol. 1: Student Motivation. Orlando, San Diego 1984 (AcademicPress), S. 77-113.COVINGTON, M.V.: The Motive for Self-Worth. In: R.E. AMES/C. AMES: Researchon Motivation in Education. Vol. 1: Student Motivation. Orlando/San Diego 1984(Academic Press), S. 77-113.CRONBACH, L.J./SNOW, R.: Individual differences in learning ability as a function ofinstructional variables. Final Report. Stanford: Stanford Univ. 1969.CROPLEY, ARTHUR J.: Unterricht ohne Schablone, Wege zur Kreativität. München21991 (Ehrenwirth).CSIKSZENTMIHALYI, MIHALY: Flow. The Psychology of Optimal Experience. New York:Harper Perennial 1991CUBE, FELIX VON: Allgemeinbildung oder produktive Einseitigkeit? Der Weg zur Bildungim Geiste Kerschensteiners. Stuttgart: Klett 1960.CZISCH, FEE: Kinder können mehr. Anders lernen in der Grundschule. München:Kunstmann 2004.DAMASIO, A.R.: Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. München/Leipzig: List 1994.DANIELS, L.B.: Behavior Strata and Learning. In: Educational Theory, (1970), S. 377-386.DANNER, F.W./ LONSKY, E.: A cognitive-developmental approach to the effects of rewardson intrinsic motivation. Child Development, 32 (1981) 1043-1052.DAVIDSON, R.J.: Childhood temperament and cerebral asymmetry: A neurobiologicalsubstrate of behavioral inhibition. In: Rubin, K.H./ Aspendorpf, J.B. (Hg.): Socialwithdrawal, inhibition, and shyness in childhood. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum1993, 31-48.DECHARMS, R.: Motivation Enhancement in Educational Settings. In: R.E. Ames/C.Ames (Hg.): Research on Motivation. Vol. 1: Student Motivation. Orlando/SanDiego u.a. 1984 (Academic Press), 275-310.DECHARMS, R.: Motivation in der Klasse - unter Mitarbeit von Dennis J. Shea, Karl W.Jackson, Franziska Plimpton, Sharon Koenigs, Agusto Blasi. München 1979 (mvg).266
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTDeCHARMS, R.: Personal Causation. New York 1968 (Academic Press).DECI, E.L. /RYAN, R.M.: A Motivational Approach to Self: Integration in Personality.In: Nebraska Symposium on Motivation 1990: Vol. 38. Perspectives on Motivation.Lincoln, London 1991 (University of Nebraska Press), S. 237-288.DECI, E.L. /VALLERAND, R./PELLETIER, L./RYAN R.M.: Motivation and Education:The Self-Determination Perspective. In: Educational Psychologist, 26 (1991), S.325-346.DECI, E.L./ SPIEGEL, N.H./RYAN, R.M./KOESTNER, R./KAUFFMAN, M.: Effectsof Performance Standards on Teaching Styles: Behavior of Controlling Teachers. In:Journal of Educational Psychology, 74 (1982), 852-859.DECI, E.L./RYAN, R.M.: Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior.New York 1985 (Plenum).DECI, E.L./SCHWARTZ, A.J./SHEINMAN, L./RYAN, R.M.: An Instrument to AssessAdults' Orientations Toward Control versus Autonomy with Children: Reflections onIntrinsic Motivation and Preceived Competence. In: Journal of Educational Psychology,73 (1981) 642-650.DECI, E.L.: Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal ofPersonality and Social Psychology, 18 (1971) 105-115.DECI, E.L.: TheRelation of interest to the motivation of behavior: a self-determinationtheory perspective. In: Renninger, K.A./ Hidi, S./ Krapp, A.: (Hg.) The role of interestin learning and development. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass.:1992, 43-70.DEFFENBACHER, J.L.: Worry and emotionality in test anxiety. In: Sarason, J.G.: (Hg.):Test anxiety. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum 1980, 111-128.DER SPIEGEL: Schulen - Nützliche Praxis. 3/1983, S. 66-69.DER SPIEGEL: Talentförderung. Profis nur mit Abitur. 24/1995, S. 188 - 192.DER SPIEGEL: Vorwärts in <strong>die</strong> Vergangenheit. 23/1995, S. 72-82.DEUTSCH, J.A./ FISHMAN, A./ KOGAN, L. NORTH, R./ WHITEMAN, M.: Guidelines for testingminority group children. Journal of Social Issues, 20 (1964) 127-145.DEUTSCHER BILDUNGSRAT: Einrichtung von Schulversuchen mit Gesamtschulen. BadGodesberg, 21971DEWOLFE,A.S./ SAUNDERS, A.M.: Stress reduction in sixth-grade studens. The Journalof Experimental Education, 63 (1995) 315-329.DIETRICH, THEO: Die Pädagogik Peter Petersens. Der Jena-Plan: Beispiel einer humanenSchule. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1991.267
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTdiVESTA, F.J.: Applications of Cognitive Psychology to Education. In: M.C. Wittrock/F.Farley (Hg.): The Future of Educational Psychology. Hillsdale, N.J. 1989(Erlbaum), 37-73.DÖRNER, DIETRICH/KREUZIG, HEINZ/REITHER, FRANZ/STÄUDEL, THEA(Hg.): Lohhausen. Vom Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität.Bern/Stuttgart/Wien 1983 (Huber).DORR-BREMME, D. Culture, Practice and Chance: School Effectiveness Reconsideres. In:Levine, D./ Lezotte, L. (Hg.): Unusually Effective Scools: A Review of Research andPractice, Madison/ Wisconsin 1990.DREEBEN, R.: On What is Learned in School. Menlo Park, Cal: Addison.Wesley 1968.DREESMANN, HELMUT: Zur Psychologie der Lernumwelt. In: WEIDENMANN, B/KRAPP,A./HOFER, M./HUBER, G.L/MANDL, H. (Hg): Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch.Weinheim21993, S. 447-491.DREWS, E.M.: Student Abilities, Grouping Patterns and Classroom Interaction. Washington,D.C.: Cooperative Research Program, Office of Education, DHEW 1963.(ERIC Document Reproduction Service No. ED 002 679).DUBIN, R./TAVEGGIA, T.A.: The Teaching-Learning Paradox: A Comparative Analysisof College Teaching Methods. Eugene, Oreg. 1968 (Center for the AdvancedStudy of Educational Administration, University of Oregon).DÜKER, HEINRICH: Untersuchungen über <strong>die</strong> Ausbildung des Wollens.Bern/Stuttgart/Wien 1975 (Huber).DURKIN, D.: Children Who Read Early. New York: Teachers College Press, ColumbiaUniverstiy 1966ECCLES, J.: Expectancies, values, and academic behaviors. In: Spence, J.T. (Hg.):Achievement and achievement motives: Psychological approaches. San Francisco:Freeman 1983, 75-146.ECKENSBERGER, L./LANTERMANN, E.-D. (Hg.): Emotion und Reflexivität. München,Wien, Baltimore 1985 (Urban & Schwarzenberg).ELKIND, D.: Wenn Eltern zu viel fordern. Die Rettung der Kindheit vor leistungsorientierterFrüherziehung. Hamburg 1989 (Hoffmann u. Campe).ELLIOT, E. / DWECK, C. : Goals: An approach to motivation and achievement. In: Journalof Personality and Social Psychology, 54, 1988, 5-12.ENGLANDER, M.E.: Strategies for Classroom Discipline. New York 1986 (Praeger).ENGLANDER, MERYL E.: Strategies for Classroom Discipline. New York 1986(Praeger).268
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTERICSSON, ANDERS K./TESCH-RÖMER, CLEMENS/KRAMPE, RALF: The Roleof Practice and Motivation in the Acquisition of Expert-Level Performance in RealLife: An Empirical Evaluation of a Theoretical Framework. In: HOWE, MICHAEL(ed.): Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talents. Leicester1990 (The British Psychological Society), S. 109-130.ERIKSON, E.H.: Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart 1965 (Klett-Cotta).ERISMANN, TH.: Allgemeine Psychologie. Bd. 3: Experimentelle Psychologie und ihreGrundlagen/ Erster Teil, Berlin: De Gruyter 21962.ESPOSITO, D.: Homogenous and Heterogenous Ability Grouping: Principal Findingsand Implications for Evaluating and Designing more Effective Educational Environments.In: Review of Educational Research, 43 (1973), S. 163-179.EULER, L. Briefe an eine deutsche prinzessin über verschiedne Gegenstände aus der Physikund Philosophie. (Aus dem Französischen übersetzt), 3 Bde., Leipzig 1773.EVERTSON: Differences in Instructional Activities in Higher- and Lower-AchievingJunior High English and Math Classes. In: Elementary School Journal, 82 (1982), S.329-350.EYSENCK, H.J.: A biometrical-geneitical analysis of impunlsive and sensation seekingBehavior. In: Zuckerman, M. (Hg.): Biological bases of sensation seeking, impulsivity,and anxiety. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 1983, 1-27.FARKAS, G./SHEEHAN, D./GROBE, R.: Coursework Mastery and School Success:Gender, Ethnicity, and Poverty Groups within an Urban School District. In: AmericanEducational Research Journal, Vol. 27 (1990), S. 807-827.FELTZ, D.L./LANDERS, D.M.: Effects of Mental Practice on Motor Skill Learning andPerformance: A Meta-Analysis. In: Journal of Sport Psychology, 5 (1983), 25-57.FEND, H.: Schule und Persönlichkeit: Eine Bilanz der Konstanzer Forschungen zur"Sozialisation in Bildungsinstitutionen". In: PEKRUN, R./FEND, H. (Hg.): Schuleund Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resümee der Längsschnittforschung. Stuttgart1991 (Enke), S. 9-32.FEND, HELMUT / KNÖRZER, WOLFGANG / NAGL, WILLIBALD / SECHT, WERNER / VÄTH-SZUSDZIARA, ROSWITH: Sozialisationseffekte der Schule. Soziologie der Schule II.Weinheim, Basel: Beltz 1976.FEUERSTEIN, REUVEN / HOFFMAN, MILDRED B. / JENSEN, MOGENS R. / RAND, YAACOV:Instrumental Enrichment, an Intervention Program for Structural Cognitive Modifiability:Theory and Practice. In: SEGAL, JUDITH W. / CHIPMAN, SUSAN F.: Thinkingand Learning Skills. Vol. I: Relating Instruction to Research, Hillsdale N.J./ London:Lawrence Erlaum 1985, S. 43-82.269
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTFEUERSTEIN, REUVEN: Instrumental Enrichment. An Intervention Program for CognittiveModifiability. In collaboration with Ya'acov Rand, Mildred B. Hoffman and RonaldMiller. Baltimore: University Park 31983.FEUERSTEIN, REUVEN: The Dynamic Assessment of Retarded Performers: The LearningPotential Assessment Device. Theory, Instruments, and Techniques. Baltimore: UniversityPress 1979.FINDLEY, W.G./BRYAN, M.: Ability Grouping: 1970 Status, Impact, and Alternatives.Athens: Center for Educational Improvement, University of Georgia. (ERIC DocumentReproduction Service No ED 060595) 1971.FLAMMER, A.: Individuelle Unterschiede im Lernen. Weinheim/Basel 1975 (Beltz).FODOR, J.A.: The Modularity of Mind. Cambridge, Mass: MIT 1983.FREEMAN, JOAN: The Intellectually Gifted Adolescent. In: HOWE, MICHAEL (ed.):Encouraging the Development of Exceptional Skills and Talents. Leicester 1990(The British Psychological Society), S. 89-108.FREY, D./BENNING, E.: Das Selbstwertgefühl. In: MANDL, H./HUBER, G.: (Hg.):Emotion und Kognition. München, Wien, Baltimore 1983 (Urban & Schwarzenberg),S. 148-182.FRY, J.P.: Interactive Relationship Between Inquisitiveness and Student-Control of Instruction.In: Journal of Educational Psychology, 63 (1972), 459-465.FUCHS, RAINER: Zur Anwendung der Denk- und Motivationspsychologie <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Unterrichtsgestaltung.Theoriefun<strong>die</strong>rte Entwicklung und Erprobung. In: ders. (Hg.):Denk- und motivationspsychologische Grundlagen des Unterrichtens. Entwicklungund Erprobung von Unterrichtsmodellen. Düsseldorf 1979 (Schwann), S. 7-58.FULKER, D.W.: The genetics and environmental architecture of psychotism, extraversionand neuroticism. In Eysenck, H.J. (Hg.): A model for personalitiy. New York:Springer 1981.FÜRSTENAU, PETER (HG.): Zur Theorie der Schule. Weinheim: Beltz 1969GAEDIKE, ANNE-KATRIN: Determinanten der Schulleistung. In: Kurt Heller (Hg.): Leistungsbeurteilungin der Schule. Heidelberg (Quelle & Meyer) 1974, S. 46-93.GAGNÉ, R.M.: Die Bedingungen des menschlichen Lernens. Hannover: Schroedel 3 1973GAMORAN, A./BERENDS, M.: The Effects of Stratification in Secondary Schools:Synthesis of Survey and Ethnographic Research. In: Review of Educational Research,57 (1987), S. 415-435.GAMORAN, A./MARE, R.D.: Secondary School Tracking and Educational Inequality:Compensation, Reinforcement, or Neutrality? In: American Journal of Sociology, 94(1989), S. 1146-1183.270
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTGAMORAN, A.: Measuring Curriculum Differentiation. In: American Journal of Education,79 (1989), S. 129-143.GARDNER, HOWARD: The unschooled Mind. How Children Think and How SchoolsSchould Teach. New York: Basic Books, 1991; deutsch: Der ungeschulte Kopf. WieKinder denken. Stuttgart: Klett-Cotta 1993GELMAN, S.A./ MARKMAN, E.: Young Children’s Inductions from Natural Kinds. TheRole of Categories and Appearances. Child Development 58 (1987), 1532-1541.GESSLER, LUZIUS: Vom Nutzen der Zweibeinigkeit - Lernbiographische Gespräche mitehemaligen Hiberniaschülern. In: Friedrich Edding / Cornelia Mattern / Peter schneider(Hg.): Praktisches Lernen in der Hibernia-Pädagogik. Eine Rudolf-Steiner-Schule entwickelt eine neue Allgemeinbildung. Stuttgart: Klett-Cotta 1985, S. S. 188- 199.GIFFORD, R.: Environmental psychology. Principles and practice. Boston: Allyn & Bacon1987GLENN, C.L. JR.: THE MYTH OF THE COMMON SCHOOL. AMHURST 1988 (UNIVERSITY OFMASSACHUSETTS PRESS).GOOD, T./MARSHALL, S.: Do Students Learn More in Heterogenous or HomogenousGroups? In: P. PETERSON/L.C. WILKINSON/M. HALLINAN (Eds.): The SocialContext of Instruction:: Group Organization and Group Processes. New York 1984(Academic Press), S. 15-38.GRAY, J.A./ OWEN, S./ DAVIS, N./ TSALTAS, E.: Psychological and physiological relationsbetween anxiety and impulsivity. In: Zuckerman, M. (Hg.): Biological bases of sensationseeking, impulsivity, and anxiety. Hillsdale, New Jersey: Lawrence ErlbaumAssociates 1983, 181-217.GROEBEN, N. / SCHEELE, B.: Argumente für eine Psychologie des reflexiven Subjekts.Paradigmawechsel vom behavioralen zum epistemologischen Menschenbild. Darmstadt:Steinkopff 1977.GROEBEN, N.: Die Handlungsperspektive als Theorierahmen für Forschung im pädagogischenFeld. In: Hofer, M (Hg.): Informationsverarbeitung und Entscheidungsverhaltenvon Lehrern. Münschen, Wien, Baltimore: U&S 1981, S. 17-48.GROEBEN, N.: Die Verständlichkeit von Unterrichtstexten. Dimensionen und Kriterienrezeptiver Lernsta<strong>die</strong>n. Münster 1972.GROEN, G.J./RESNICK, J.B.: Can Preschool Children Invent Addition Algorithms? Journalof Educational Psychology, 69 (1977, 645-652.GROLNICK, W.S./RYAN, R.M.: Autonomy in Children's Learning: An Experimentaland Individual Difference Investigation. In: Journal of Personality and Social Psychology,52 (1987), 890-898.271
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTGROLNICK, W.S.: Parent Styles Associated with Children's Self-Regulation and Competencein School. In: Journal of Educational Psychology, 81 (1989), 143-154.GRUBER, H.E./WEITMAN, M.: The Growth of Self-Reliance. In: School and Society,91 (1963), 222-223.GÜNTER KRAMPEN; Effekte der Grundübungen des autogenen Trainings im schulischenAnwendungskontext. In: Psychol. in Erziehung und Unterrricht. 39 (1992), 33 - 41.GÜNTHER, H.:Kompetenzvermittlung durch Erziehung - Kritische Befunde zum "offenenLernen". In: J. Mittelstraß (Hg.): Wohin geht <strong>die</strong> Sprache? Wirklichkeit - Kommunikation- Kompetenz. Essen 1989 (Hanns Martin Schleyer-Stiftung, AkademieVerlag), 318-325.HAEBERLIN, U.: Die Integration von leistungsschwachen Schülern. Ein Überblick überempirische Forschungsergebnisse zu Wirkungen von Regelklassen, Integrationsklassenund Sonderklassen <strong>auf</strong> "Lernbehinderte". In: Zeitschrift für Pädagogik, 37. Jg.(1991), S. 167-189.HAEBERLIN, U/BLESS, G./MOSER, U./KLAGHOFER, R.: Die Integration von Lernbehinderten.Bern 1991.HAIM H.: Schol bureaucratic structure, locus of control and alienation among primaryscholteachers. In. Research in Education, 44 (1990), S. 55-66.HALLBERG, P.-F.: Er zerstört mein "schönes Rollenspiel". In: ULICH, K. (Hg.): Wenn<strong>die</strong> Schüler stören. München, Wien, Baltimore 1980 (Urban & Schwarzenberg), S.19-26.HAMMOND, M./COLLINS, R.: Self-Directed Learning. Critical Practice. London/NewYork 1991 (Kogan Page/Nichols).HANS PETILLON, SOZIALE BEZIEHUNGEN IN SCHULKLASSEN, WEINHEIM 1980HANSEN, W.: Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes. München 1965 (Kösel).HARACKIEWICZ, J. M.: The effects of reward contingency and performance feedback onintrinsic motivation. . Journal of Personality and Social Psychology, 37 (1979) 1352-1363.HARGREAVES, D./HESTER, S./MELLOR, F.: Abweichendes Verhalten im Unterricht.Weinheim, Basel 1981 (Beltz).HARGREAVES, D.H.: Social Relations in a Secondary School. London 1967(Routledge & Kegan).HARRIS, F./WOLF, M./BAER, D.: Effects of Adult Social Reinforcement on ChildBehavior. In: Young Children, 20 (1964), S. 8-17.272
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTHARRIS, JUDITH RICH: The Nurture Assumption. Why Children Turn Out the Way theydo. New York: Free Press 1998HARTER, S.: Processes underlying the construction, maintenance and enhancement of theself-concept in children. In Suis, J./ Greenwald, A. (Hg.): Psychological perspectiveson the self. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 1986, Bd. 3, 127-181.HARTER, S.: The Determinants and Mediational Role of Global Self-Worth in Children.In: EISENBERG, N. (Ed.): Contemporary Topics in Developmental Psychology.New York, Chichester u.a. 1987 (John Wiley & Sons), S. 219-242.HÄUSSLER, P.: Die Wirkung schulischer und außerschulischer Faktoren <strong>auf</strong> den Standnaturwissenschaflicher Bildung inder Bevölkerung am Beispiel der Physik. In: Riquarts,K./Dierks, W. Duit, R./Eulefeld, G.Haft, H./Stork, H.: NaturwissenschaftlicheBildung in der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 1: Bedingungen und Einflußgrößennaturwissenschaftlich-technischer Bildung. Kiel: IPN 1990, 59-76.HAYEK, F. A. von: Die Verfassung der Freiheit. Tübingen 1971 (Mohr).HAYEK, F.A. V.: Der Primat des Abstrakten. In: Koestler, A./Smythies, J.R. (Hg.): DieRevolutionierung der Wissenschaften vom Leben. Ein internationales Symposion.Wien: Molden 1970, 300-313HAYEK, F.A.: Law, Legislation and Liberty. A new statement of teh liberal principles ofjustice and political economy. London and Henley: Routledge & Kegan Paul. 1973-79. ( Bd.1:Rules and Order, 1973: Bd. 2: The Mirage of Social Justice 1976; Bd. 3:The Political Order of a Free People 1979)HAYEK, F.A.: Mißbrauch und Verfall der Vernunft. Ein Fragment. Verlag WolfgangNeugebauer: Salzburg 1979HAYEK, F.A.V.: Rules, Perception and Intelligibiltiy. In. Ders.: Stu<strong>die</strong>s in Philosophy,Politics ans Economics. London, Henley: Routledge & Keegan 1967, 43-65.HAYEK, F.A.V.: The Sensory Order London/Chicago 1952HEATHERS, G.: Grouping. In: R.L. EBEL (Ed.): Encyclopedia of Educational Research(4th ed.). New York 1969 (Macmillan), S. 559-570.HECKHAUSEN, H: Leistung und Chancengleichheit. Göttingen: Hogrefe 1974.HEIM, ALICE: Professional Issues Arising from Psychological Evidence Presented inCourt: A Reply. In: Bulletin of The British Psychological Society, 35 (1982), S. 332-333.HEINZE, TH.: Schülertaktiken. München, Wien, Baltimore: Urban & Schwarzenberg1980.HELLBRÜGGE,THEODOR: Integrierte Erziehung durch Montessori-Heilpädagogik. In:HERMANN RÖHRS (Hg.): Die Schulen der Reformpädagogik heute. Handbuch re-273
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTformpädagogischer Schulideen und Schulwirklichkeit. Düsseldorf: Schwann 1986, S.305-322.HELMKE, A./ VÄTH-SZUSDZIARA, R.: Familienklima, Leistungsangst und Selbstakzeptierungbei Jugendlichen. In: Lukesch, H./ Perrez, M./ Schneewind, K.A. (Hg.): FamiliäreSozialisation und Intervention. Bern: Huber 1980, 199-219.HENTIG, HARTMUT V.: Cuernavaca oder Alternativen zur Schule? Stuttgart: Klett 1971HERBART, J. F.: Pädagogisches Gutachten über Schulklassen und deren Umwandlung(1818). In: ders.: Pädagogisch-didaktische Schriften. Bd. 3. Hrsg. von ASMUS, W.Düsseldorf 1965 (Küpper), S. 89-128.HERDT, D.: Einführung in <strong>die</strong> elementare Optik. Vergleichende Untersuchung einesneuen Lehrgangs. Essen 1990 (Westarp-Wissenschaften).HERDT, DIETMAR: Einführung in <strong>die</strong> elementare Optik. Vergleichende Untersuchungeines neuen Lehrgangs. Essen 1990 (Westarp-Wissenschaften).HERRMANN, THEO: Psychologie als Problem: Herausforderungen der psychologischenWissenschaft. Stuttgart: Klett-Cotta 1979.HERTZ-LAZAROWITZ, R./SHACHAR, H.: Teachers' Verbal Behavior in Cooperativeand Whole-Class Instructions. In: SHARAN, S. (Hg.): Cooperative Learning. Theoryand Research. New York 1990 (Praeger), S. 77-94.HERZOG, W.: Modell und Theorie in der Psychologie. Göttiongen, Toronto, Zürich 1984.HIDI, SUZANNE: Interest and its Contribution as a Mental Resource for Learning. In:Review of Educational Research, 60 (1990), S. 549-571.HIDI, SUZANNE: Interest and its Contribution as a Mental Resource for Learning. In:Review of Educational Research, 60 (1990), S. 549-571.HIERDEIS, HELMWART/ HUG, THEO: Pädagogische Alltagstheorien und erziehungswissenschaftlicheTheorien. Ein Stu<strong>die</strong>nbuch zur Einführung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt1992.HIGGINS, R.L./SNYDER, S.R./BERGLAS, S. (Hg.): Self-Handicapping. The Paradoxthat isn't. New York/London 1990 (Plenum).HIRST, WILLIAM/NEISSER, ULRIC/SPELKE, ELIZABETH: Kann man zwei Dingegleichzeitig tun? In: Psychologie heute. 7 (3), (1980), S. 37-43.HOFER, M.: Schülergruppierungen im Urteil und Verhalten des Lehrers. In: ders. (Hg.):Informationsverarbeitung und Entscheidungsverhalten von Lehrern. München, Wien,Baltimore 1981 (Urban & Schwarzenberg), 192-221.HOFER, MANFRED: Sozialpsychologie erzieherischen Handelns. Göttingen: Hogrefe1986.274
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTHOFER, MANFRED: Zu den Wirkungen von Lob und Tadel. In Bildung und Erziehung, 38(1985) S. 415-427.HOFMANN, ULRIKE / PRÜMMER, CHRISTINE VON / WEIDNER, DIETER / VIER, BERNHARD:Forschungsbericht über Bildungslebensläufe ehemaliger Waldorfschüler. Eine Untersuchungder Geburtsjahrgänge 1946 und 1947. Stuttgart 1981.HOFSTEN, C.V.: Predictive reaching for moving objects by human infants. Journal ofExperimental child Psychology 1980, 30, 369-382.HÖHN, E.: Der schlechte Schüler. Sozialpsychologische Untersuchungen über das Bilddas Schulversagers. München 1980 (Piper) (= überarbeitete Neuausgabe).HOLLER, B./HURRELMANN, K.: Die psychosozialen Kosten hoher Bildungserwartungen:Eine Vier-Jahres-Stu<strong>die</strong> über das Bildungsverhalten im Jugendalter. In:PEKRUN, R./FEND, H.: Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resümee derLangsschnittforschung. Stuttgart 1991 (Enke), S. 254-271.HOLLER, BIRGIT/HURRELMANN, KLAUS: Die psychischen Kosten hoher Bildungserwartungen:Eine Vier-Jahres-Stu<strong>die</strong> über das Bildungsverhalten im Jugendalter.In: PEKRUN, R./FEND, H.: Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resumeeder Längsschnittforschung. Stuttgart 1991 (Enke), S. 254-271.HOOGH, H.: The Individual Model for Fostering Giftedness. In: CROPLEY,A./URBAN, K. u.a. (eds.): Giftedness: A. Continuing Worldwide Challenge. NewYork 1986 (Trillium), S. 391-396.HOPF, D./ KRAPPMANN, L. / SCHEERER, H.: Aktuelle Probleme der Grundschule. In:Max-Planck-Institut für Bildungsforschung / Projektgruppe. Bildungsbericht (Hg.):Bildung in der Bundesrepublik Deutschland. Daten und Analysen - Bd. 2. Stuttgart1980, S. 1113-1176.HOUGHTON, S./MERRETT, F./WHELDALL, K.: The Attitudes of British SecondarySchool Pupils to Praise, Rewards, Punishments and Reprimands: A Further Study.In: New Zealand Journal of Educational Stu<strong>die</strong>s, 23 (1988), S. 203-214.HOUGHTON, S/WHELDALL, K./JUKES, R./SHARPE, A.: The Effects of LimitedPrivate Reprimands and Increased Private Praise on Classroom Behaviour in fourBritish Secondary School Classes. In: British Journal of Educational Psychology, 60(1990), S. 255-265.HOWE, MICHAEL J.A.: Separate Skills or General Intelligence: The Autonomy ofHuman Abilities. In: British Journal of Educational Psychology. 59 (1989), S. 351-360.HOWE, MICHAEL J.A: Introduction. In: ders. (ed.): Encouraging the Development ofExceptional Skills and Talents. Leicester 1990b (The British Psychological Society).275
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTHOWE, MICHAEL J.A: The Origins of Exepional Abilities. Oxford/Cambridge, Mass.1990a (Blackwell).HOWE, MICHAEL, J.A.: The Origins of Exeptional Abilities. Oxford/Cambridge, Mass.1990 (Blackwell).HOYT, D.P.: The Relationship Between College Grades and Adult Achievement. AReview of the Literature. ACT Research Reports, 1965, No. 7. American CollegeTesting Program. Iowa City, Iowa.HUMBOLDT, W. von: Ideen zu einem Versuch, <strong>die</strong> Grenzen der Wirksamkeit desStaats zu bestimmen. In: WILHELM HUMBOLDT: Auswahl und Einleitung vonHEINRICH WEINSTOCK. Frankfurt 1957 (Fischer Taschenbuch), S. 21-55.HUNT, J.MC.V.:INTRINSIC Motivation and its Role in psychological development. In: D.Levine (Hg.): Nebraska Symposium on Motivation (Vol 13). Lincoln: UniversityNebraksa Press 1965, 189-282.HURRELMANN, K./ HEITMEYER, W./ PFEIFFER, CH./ ECKERT, R, ZINNECKER, J.: ZukunftsinvestitionJugend. 1998. URL: http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/40030/HURRELMANN, K.: Lebensphase Jugend. Eine Einführung in <strong>die</strong> sozialwissenschaftlicheJugendforschung. Weinheim, München: Juventa 5 1997HUTTENLOCHER, J.: Effects of Manipulation of Attributes on Efficiency of ConceptFormation. In: Psychological Reports, 10 (1962), 503-509.ILLICH, IVAN: DESCHOOLING SOCIETY. NEW YORK: HARPER&ROW 1970INGENKAMP, K. (Hg.): Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Texte und Untersuchungsberichte.Weinheim/Basel 71977 (Beltz), S. 59-68.INGENKAMP, K. (Hg.): Wer und Wirkung von Beurteilungsverfahren, Weinheim: Beltz1981.INGENKAMP, K.: Überblick über <strong>die</strong> prognostische Bewährung der Grundschulgutachtenund -zensuren. In: ders. (Hg.): Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Texteund Untersuchungsberichte. Weinheim/Basel 1971 (Beltz), S. 219-228.INGENKAMP, K: Zeugnisse und Zeugnisreform in der Grundschule aus der Sicht empirischerPädagogik. In: R. Olechowski / E. Persy (Hg.): Fördernde Leistungsbeurteilung.Wien / München: Volk und Welt 1987, S. 38-79.IRAN-NEJAD, A.: Active and Dynamic Self-Regulation of Learning Processes. In: Reviewof Educational Research, 60 (1990), 573-602.IZARD, C.E.: Die Emotionen des Menschen. Weinheim 1981 (Beltz).JACKSON, PHILIP W.: Life In Classrooms. New York: Holt, Rinehart & Winston 1968276
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTJACOBS, B./PRENTICE-DUNN, S./ROGERS, R.W.: Understanding Persistence: AnInterface of Control Theory and Self-Efficacy Theory. In: Basic and Applied SocialPsychology, 5 (1984), 333-343.JAMES, W.: The Principles of Psychology. 2 Bde. New York: Dover 1950 ( 1 1890).JENCKS, C.: Chancengleichheit. Reinbek 1973 (Rowohlt).JENSEN, A.R.: Educability and Group Differences. London: Methuen 1973.JERUSALEM, M./SCHWARZER, R.: Entwicklung des Selbstkonzepts in verschiedenenLernumwelten. In: PEKRUN, R./FEND, H. (Hg.): Schule und Persönlichkeitsentwicklung.Ein Resümee der Längsschnittforschung. Stuttgart 1991 (Enke), S. 115-128.JONAS, F.: Sozialphilosophie der industriellen Arbeitswelt. Stuttgart 1974.JONES, ILSE: Möglichkeiten und Grenzen der Montessori-Pädagogik. Das Jugenderziehungskonzeptder Maria Montessori in der Sekundarstufe I. Frankfurt/ Bern/ NewYork/ Paris: Lang 1987.JOPT, U.-J.: Warum manche Schüler „faul“ sind: Die attributionstheoretische Vernünftigkeitdes schulischen Anstrengungsverzichts. Zeitschrift für Entwicklungspsychologieund Pädagogische Psychologie, 10 (1978) 315-327.JUNG, W.: Über <strong>die</strong> Schwierigkeiten, Physik zu lernen. In: physika didactica 4/1982,S.135 ff.KAGAN, J./ SNIDMAN, N./ ARCUS, D.: On temperamental categories of inhibited and uninhibitedchildren. In: Rubin, K.H./ Aspendorpf, J.B. (Hg.): Social withdrawal, inhibition,and shyness in childhood. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 1993, 19-28.KAGAN, JEROME: Temperamental Contributions to Social Behavior. In: AmericanPsychologist, 44 (1989), S. 668-674.KAHL, REINHARD: Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutschland Schulen gelingen. Archivder Zukunft 2004 (www.archiv-der-zukunft.de; www.reinhardkahl.de)KAINZ, F.: Psychologie der Sprache, Bd. 4, Stuttgart 1956.KANT, I.: Kritik der reinen Vernunft (1787). In: Kants gesammelte Schriften, Hrsg. vonder Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften Bd. 3, Berlin 1911KAPLAN, S.: Environmental preference in a knowledge-seeking, knowledge-using organism.In: Cosmides, L./ Tooby, J. (Hg.): The Adapted Mind. Evolutionary Psychologyand the Generation of Culture. New York/Oxford: Oxford Press 1992, 581-598.KARASCHEWSKI, H.: Wesen und Weg des ganzheitlichen Rechenunterrichts. Stuttgart:Klett 1969277
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTKAZDIN, A.E.: Covert Modeling - Therapeutic Application of Imagined Rehearsal. In:J.L. Singer/K.S. Pope (Eds.): The Power of Human Imagination: New Methods inPsychotherapy. Emotions, Personality, and Psychotherapy. New York 1978 (Plenum),225-278.KEGAN, R.: Die Entwicklungsstufen des Selbst. Fortschritte und Krisen im menschlichenLeben. München 1986.KEGAN, R.: Die Entwicklungsstufen des Selbst. Fortschritte und Krisen im menschlichenLeben. München 1986 (Kindt).KEIL, F.C.: Concepts, Kinds, and Cognitive Development. Cambridge, Mass: MIT 1989.KELLER, F.S.: Good-bye, Teacher ... . In: Journal of Applied Behavioral Analysis, 1(1968), S. 79-89KELLY, G.A.: Der Motivationsbegriff als irreführendes Konstrukt. In: THOMAE H.(Hg.): Die Motivation menschlichen Handelns. Köln 1968 (Kiepenheuer & Witsch),S. 498-509.KELLY, G.A.: Der Motivationsbegriff als irreführendes Konstrukt. In: H. Thomae(Hg.): Die Motivation menschlichen Handelns. Köln 1968 (Kiepenheuer & Witsch),498-509.KERSCHENSTEINER, GEORG: Wesen und Wert des naturwissenschaftlichen Unterrichts,1914KLAUS HURRELMANN, Unterrichtsorganisation und schulische Sozialisation, Weinheim1971;KLINGER, BERND: Geeignet oder nicht geeignet. Dürfen Kinder ihre Schull<strong>auf</strong>bahn selbstbestimmen? Erfahrungen eines Lehrers mit dem Ehrgeiz der Eltern. In. Die Zeit, 18,1995, .S. 85.KLINK, J. G.:Hauptschule und Realschule. In: Lenzen, D. Hg.): Enzyklopä<strong>die</strong> Erziehungswissenschaft,Bd. 8: Erziehung im Iugendalter. Stuttgart 1983, S. 198-210.KLUWE, R.: Kontrolle eigenen Denkens und Unterricht. In: B. Treiber/F.E. Weinert(Hg.): Lehr-Lern-Forschung. Ein Überblick in Einzeldarstellungen. München/Wien/Baltimore1982 (Urban & Schwarzenberg), 113-133.KOCH, J.-J./PFEIFER, H. Sozialpsychologische Aspekte einer Reform der zweiten Phaseder Lehrerbildung. In: Die Deutsche Schule 63 (1971) S. 435-449.KORNER, A.F.: Individual Differences at Birth: Implications for Early Experience andLater Development. In: American Journal of Orthopsychiatry, 41 (1971), No. 4, S.608-619.278
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTKORNER, ANNELIESE F.: Individual Differences at Birth: Implications for Early Experienceand Later Development. In: American Journal of Orthopsychiatry. 41(1971), S. 608-619.KOZDON, BALDUR : Schule in der Entscheidung. Über den Un-Ernst der überbuchtenSchule. München: PimS 1994.KRAMPEN, G./ZINSSER, A.: Effekte der Sonderschulzuweisung <strong>auf</strong> das Selbstkonzeptund Attribuierungsverhalten von Schülern. In: Zeitschrift für Empirische Pädagogik,5 (1981), S. 125-135.KRAMPEN, G.: Effekte der Grundübungen des autogenen Trainings im schulischen Anwendungskontext.Psychologie in Erziehung und Unterricht, 39 (1992) 33-41.KREUTZ, H.: Aufälliges Verhalten bei Jugendlichen. In: Lenzen, D. Hg.): Enzyklopä<strong>die</strong>Erziehungswissenschaft, Bd. 8: Erziehung im Jugendalter. Stuttgart 1983, S. 135-149.KRUG, S./PETERS, J.: Persönlichkeitsänderung nach Sonderschulzuweisung. In: Zeitschriftfür Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 3 (1977), S.181-184.KRUG, S.: Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion. Motivations- und attributionstheoretischeAnalysen zum Erwartungseffekt. Unveröffentl. Dissertation, Bochum1985.KRUGLANSKI, A.W./ STEIN, C./ RITER, A.: Contingencies of exogenous reward and taskperformance: On the „minimax“ strategy in instrumental behavior. Journal of AppliedSocial Psychology, 7 (1977) 141-148.KUHL, J.: Tatsächliche und phänomenale Hilflosigkeit: Vermittlung von Leistungsdefizitennach massiver Mißerfolgsinduktion. In: WEINERT F.E./KLUWE, R. (Hg.):Metakognition, Motivation und Lernen. Stuttgart 1984 (Kohlhammer), S. 192-209.KUHN, D./HO, V.: Self-Directed Activity and Cognitive Development. In: Journal ofApplied Developmental Psychology, 1 (1980), 119-133.KUHN, DEANNA/HO, VIKTORIA: Self-Directed Activity and Cognitive Development.In: Journal of Applied Development Psychology. 1 (1980), S. 119-133.KÜHN, ROLF: Bedingungen für Schulerfolg. Zusammenhänge zwischen Schülermerkmalen,häuslicher Umwelt und Schulnoten. Göttingen / Toronto/Zürich 1983.KULIK, C. /BANGERT-DROWNS, R.: Effectiveness of Mastery Learning Programs: AMeta-Analysis. In: Review of Educational Research, 60 (1990), S. 265-299.KULIK, C.: Effects of Ability Grouping on Student Achievement. In: Equity and Excellence,23 (1987), S. 22-30.279
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTKULIK, C.-L./KULIK, J.: Effects of Ability Grouping on Secondary School Students: AMeta-Analysis of Evaluation Findings. In: American Educational Research Journal,19 (1982), S. 415-428.LANDAU, E.: MUT ZUR BEGABUNG. MÜNCHEN: ERNST REINHARDT 1991LANGE, ELMAR / BÜSCHGES, GÜNTER (HG.): Aspekte der Berufswahl in der modernenGesellschaft. Frankfurt: Aspekte 1975.LANGER, I./SCHULZ V. THUN, F./TAUSCH, R.: Verständlichkeit - in Schule, Verwaltung,Politik und Wissenschaft. München/Basel: Reinhardt 1974.LANGER, J.: Disequilibrium as a Source of Developemant. In: P. Mussen/ J. Langer / M.Covington: Trends and issues in developemental psychology. New York: Holt,Rinehart & Winston 1969, S. 22-37.LAZAROWITZ, R./KARSENTY, G.: Cooperative Learning and Students' AcademicAchievement, Process Skills, Learning Environment, and Self-Esteem in Tenth-Grade Biology Classrooms. In: SHARAN, S. (Ed.): Cooperative Learning. Theoryand Research. New York u.a. 1990 (Praeger), S. 123-149.LEHNER, H.: Erkenntnis durch Irrtum als Lehrmethode. Bochum 1979 (Kamp).LEHNER, HELMUT: Autonomous Learning in Distance Education: Methodology and Results/AutonomesLernen und Fernlehre: Methoden und Wirkungen. In: B. Holmberg/G.ORTNER (Hg.): Research into Distance Education/Fernlehre und Fernlehrforschung.Frankfurt 1991 (Lang), 160-161/162-176.LEHNER, HELMUT: Das Zusammenspiel von Individuum und <strong>Institution</strong>. In: StephanDietrich (Hrsg.): Selbstgesteuertes Lernen in der Weiterbildungspraxis. Ergebnisseund Erfahrungen aus dem Projekt SeGeL. Bielefeld, W.Bertelsmann Verlag 2001, S.214-229.LEHNER, HELMUT: Der Umgang mit Disziplinkonfliken im Unterricht. Konstanz:www.helmut-lehner.de 1991 (kostenloser Download)LEHNER, HELMUT: Die Entwicklung und Förderung von Talenten in der Schule. 1991unter http//www.helmut-lehner.de. als Download verfügbar.LEHNER, HELMUT: Erfolg und Misserfolg von Fernunterricht im „Wissenszeitalter“ /Success and Failure of Distance Education in the „Age of Knowledge“; Zentales Institutfür Fernstu<strong>die</strong>nforschung. Herausgegeben von Helmut Fritsch. FernUniversität– Gesamthochschule – Hagen, August 2000LEHNER, HELMUT: Konfektionierung und Individualisierung im Fernstudium. In: H.Lehner/M. Weingartz: Bericht zum ZiFF-Projekt 2.23. ZiFF-Papiere 58. Hagen 1985(Fernuniversität), 1-54.280
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTLEHNER, HELMUT: Konstruktivismus und Fernstudium. Hagen (FernUniversität: ZentralesInstitut für Fernstu<strong>die</strong>nforschung) 1986LEHNER, HELMUT: Lassen sich Alternativ- und Regelschulen vergleichen? Ein Modellder <strong>Auswirkungen</strong> von Erziehungstheorien <strong>auf</strong> Schule und Unterricht. In: Zeitschriftfür Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 18, 1998, S. 53-65.LENNING, JAMES S.: Character Education: Lessons from the Past, Models for the Future.Camden, Maine 1993 (The Intitut for Global Ethics)LEPPER, M.R./ GREENE, D./ NISBETT, R.E.: Undermining children’s intrinsic interest withextrinsic rewards: A test of the „overjustification“ hypothesis. Journal of Personalityand Social Psychology, 28 (1973) 129-137.LESLIE, A.M.: Pretence and representation: The origins of „theory of mind.“ PsychologicalReview, 94 (1987) 412-426.LEVINE, D./ LEZOTTE, L. (HG.): Unusually Effective Schools: A Review of Research andPractice, Madison/ Wisconsin 1990LEWONTIN, RICHARD: Human Diversity. New York 1982 (Scientific AmericanBooks).LINDENBERG, CHRISTOPH: Waldorfschulen: Angstfrei lernen, selbstbewußt handeln. Praxiseine verkannten Schulmodells. Reinbek: rororo 1975LISSMANN, U.: Die Wirkung von Bewertungsverfahren <strong>auf</strong> Lernende. In: Ingenkamp, K.(Hg.): Wert und Wirkung von Beurteilungsverfahren. Untersuchungen zu den Gütekriterienund der Wirkung diagnostischer Instrumente in der Schule. Weinheim / Basel1981, S. 233-289.LITT, THEODOR: FÜHREN ODER WACHSENLASSEN. STUTTGART: KLETT 131967LUCHINS, A.: Mechanisierung beim Problemlösen. Die Wirkung der Einstellung. In.Graumann, C. F. (Hg.): Denken. Köln: Kiepenheuer &Witsch 1971, S. 171 - 190.LÜTHJE, JÜRGEN: Elite statt Bildung? Spiegel Essay. In: Der Spiegel 27/1995, 180-181.M. MÄNDL: ERZIEHUNG DURCH UNTERRICHT. BAD HEILBRUNN 1963, KLINKHARDTMACDONALD-ROSS, M: Behavioural Objectives - A Critical Review. Instructional Science,2, 1973, 1-52.MADAUS, GEORGE F./ AIRASIAN, PETER W./ KELLAGHAN, THOMAS: School Effectiveness.A Reassurement of the Evidence. NewYork u.a.:McGraw Hill 1980.MADDEN, N.A./SLAVIN, R.E.: Mainstreaming Students with Mild Handicaps: Academicand Social Outcomes. In: Review of Educational Research, 53 (1983), S. 519-569.281
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTMADSEN, Ch./BECKER, W./THOMAS, D.: Rules, Praise, and Ignoring: Elements ofElementary Classroom Control. In: Journal of Applied Behavior Analysis, 1 (1968),S. 139-150.MADSEN, Ch./MADSEN, C.K.: Teaching Discipline: A Positive Approach for EducationalDevelopment. Boston 1974 (Allyn and Bacon).MANDL, H./HUBER, G. (Hg.): Emotion und Kognition. München, Wien, Baltimore1983 (Urban & Schwarzenberg).MANDLER, J.M.: How to build a baby: On the development of an accessible representationalsystem. Cognitive Development, 3 (1988) 113-136.MARCHTHALER PLAN, Erziehungs- und Bildungsplan für <strong>die</strong> Freien Grund- und Hauptschulenin der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Hrsg. vom Bischöflichen Schulamt derDiözese Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg 1990.MARTON, F./ BOOTH, S.: The Learner’s Experience of Learning. In: Olson, D.R. / Torrance,N.: The Handbook of Education and Human Development. New Models ofLearning, Teaching and Schooling. Cambridge(Mass.)/ Oxford: Blackwell 1996MASON, G.A.: Ability Grouping. An Ethnographic Study of a Structural Feature ofSchools. In: Australian and New Zealand Journal of Sociology, 10 (1974), S. 53-56.MAYER, WERNER G.: Freie Arbeit in der Primarstufe und in der Sekundarstufe bis zumAbitur. Denkanstöße zur inneren Reform der Schule; ein Denkanstoß aus Nordrhein-Westfalen. Heinsberg: Diek 1992.MCADAMS, D.P.: The Person. An Introduction to Personality Psychology. New York:Harcourt Brace Jovanovich 1990McCLELLAND, D.C.: Macht als Motiv. Entwicklungswandel und Ausdrucksformen.Stuttgart 1978 (Klett-Cotta).McCLELLAND, DAVID C.: How MOtives, Skills, and Values Determine What PeopleDo. In: American Psychologist, 40 (1985, S. 812-825.McCOMBS, B.: Self-Regulated Learning and Academic Achievement: A PhenomenologicalView. In: B.J. ZIMMERMAN/D.H. SCHUNK (Hg.): Self-RegulatedLearning and Academic Achievement. Theory, and Practice. New York/Berlin 1989(Springer), 51-82.McCOMBS, B.L.: Process and Skills Underlying Continuing Intrinsic Motivation toLearn. In: Educational Psychologist, 19 (1984), 199-218.McCOMBS, BARBARA/WHISLER, JO SUE: The Role of Affecitve Variables inAutonomous Learning. In: Educational Psychologist. 24 (1989), S. 277-306.282
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTMcGRAW, K.O.: The Detrimental Effects of Reward on Performance: A Literature Reviewand a Prediction Model. In: M.R. Lepper/D. Greene (Hg.): The Hidden Costs ofReward. Hillsdale N.J. 1978 (Erlbaum), 33-60.McKEACHIE, W.J.: The Improvement of Instruction. In: Review of Education Research,30 (1960), 351-360.MEAD, GEORGE HERBERT: Geist Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus.Frankfurt 3 1978MEDAWAR, P.B.: The Uniqueness of the Individual. London 1957 (Dover).MEECE, J. / BLUMENFELD, P. C. / HOYLE, R.: Student's goal orientations and cognitiveengagement in classroom activities. In: Journal of Educational Psychology, 80, 1988,514-523.MELTZOFF, A.N.: The Human Infant as homo Imitans. In: Zentall, T.R./ Galef, B.G. Jr.(Hg.): Social Learning. Psychological and Biological Perspectives. Hillsdale, NJ:Erlbaum, 319-341.MERTON, ROBERT K.: The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations.Ed. by NORMAN W. STORER. Chicago/London 1973 (Chicago University).MILAK, J.J.: A Comparison of Two Approaches of Teaching Brass Instruments to ElementarySchool Children. Unpublished doctoral dissertation. Washington University,St. Louis, MO, 1980.MILL, JOHN STUART: Die Freiheit. Darmstadt 1973 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft).MILLER, GEORG A./ GALANTER, EUGENE/PRIBRAM, KARL H.(Strategien des Handelns.Pläne und Strukturen des Verhaltens. Stuttgart 1973, Klett)MILLER, R.V.: Social Status and Socioemphatic Differences Among Mentally Superior,Mentally Typical and Mentally Retarded Children. In: Exceptional Children, 23(1956), S. 114-119.MILLS, R.C./ ALPERT, G./DUNHAM, R.: Working with High-Risk Youths in Preventionand Early Intervention Programs: Toward a Comprehensive Wellness Model. In:Adolescence, 23 (1988), 643-660.MILLS, R.C.: A New Understanding of Self: The Role of Affect, State of Mind, Self-Understanding, and Intrinsic Motivation. In: Journal of Experimental Education, 60(1991), 67-81.MOLNAR, A./LINDQUIST, B.: Verhaltensprobleme in der Schule. Lösungsstrategienfür <strong>die</strong> Praxis. Broadstairs (UK) 1990 (borgmann).MONTESSORI, M.: Die Entdeckung des Kindes. Freiburg 1969 (Herder).283
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTMONTESSORI, MARIA: Die Entdeckung des Kindes. Herausgegeben und eingeleitet vonPaul Oswald und Günther Schulz-Benesch, Freiburg1969MONTESSORI, MARIA: Schule des Kindes. Montessori-Erziehung in der Grundschule.Herausgegeben und eingeleitet von Paul Oswald und Günther Schulz-Benesch, Freiburg1976MONTESSORI, MARIA: Spannungsfeld Kind – Gesellschaft – Welt. Auf dem Wege zueiner „kosmischen Erziehung“. Aus nachgelassenen Texten herausgegeben GüntherSchulz-Benesch, Freiburg1979MONTESSORI-SCHULEN der Aktion Sonnenschein e.V. im Kinderzentrum München. Pensenbuch.München 1984.MOSSHOLDER, K.W.: Effects of externally mediated goal setting on intrinsic motivation:A laboratory experiment. Journal of Applied Psychology, 65 (1980) 202-210.NASH, R: Lehrererwartung und Schülerleistung. Ravensburg: Maier 1978.NEBER, H.: Selbstgesteuertes Lernen. In: B. Treiber/F.E. Weinert (Hg.): Lehr-Lern-Forschung. Ein Überblick in Einzeldarstellungen. München/Wien/Baltimore 1982(Urban & Schwarzenberg), 89-112.NELSON, K./CARSKADDON,G./BONVILLIAN, J.D.: Syntax Acquisiton: Impact of ExperimentalVariaton in Adult Verbal Interacton with the Child. Child Development, 44,(1973) 497-504.NEWMAN, J.H.: Discourses on the Scope and the Nature of University Education. Dublin1852 (Duffy).NICHOLLS, J.: Conceptions of Ability and Achievement Motivation: A Theory and itsImplications for Education. In: PARIS, S./OLSON, G./STEVENSON, H (Eds.):Learning and Motivation in the Classroom. Hillsdale 1983 (Erlbaum), S. 211-237.NICHOLLS, J.: What is Ability and Why are we Mindful of it? A Developmental Perspective.In: STERNBERG, R./KOLLIGIAN, J.: (Hgs.): Competence Considered.New Haven, London 1990 (Yale University), S. 11-40.NICHOLLS, J.G.: Achievement motivation: Conception of ability, subjective experience,task choice, and performance. Psychological Review, 91 (1984) 328-346.NICHOLLS, JOHN: In: STERNBERG, ROBERT J./KOLLIGIAN, JOHN (eds.): CompetenceConsidered. New Haven 1990, S. (Yale University).Nohl, Herman: Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. Frankfurt:Schulte-Bulmke 6 1963.NOLEN, , S. B.: Reasons for studying. Motivational Orientations and study stategies. In:Cognition and Instruction. 5, 1988, 269-287.284
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTNOLTE-FISCHER, G.: Bildung zum Laien. Zur Soziologie des schulischen Fachunterrichts.Weinheim 1989 (Deutscher Stu<strong>die</strong>n Verlag).NORMAN, D.A./RUMELHART, D.E.: Analogical Processes in Learning: Center for HumanInformation Processing. Report Nr. 97. San Diegeo, Ca.: Universitiy of California1980.Oakes- Keeping Track: How Schools Structure Inequality. New Haven 1985 (Yale UniversityPress).OAKES, J.: The Reproduction of Inequity: The Content of Secondary School Teaching.In: Urban Review, 14 (1982), S. 107-120.OCHSE, R.: Before the Gates of Excellence. The Determinants of Creative Genius.Cambridge, New York u.a. 1990 (Cambridge University Press).OERTER, ROLF.: The Zone of Proximal Development for Learning and Teaching. In:Oser, Fritz, K/ dick, Andreas/Patry, Jean-Luc (Hg.): Effective and ResponsibleTeaching. The New Synthesis. San Francisco: Jossey-Bass 1992, S.187-202.OFFE, C.: Leistungsprinzip und industrielle Arbeit. Mechanismen der Statusverteilung inArbeitsorganisationen der industriellen "Leistungsgesellschaft". Frankfurt: EVA1970.O'LEARY, K.D./BECKER, W.: Behavior Modification of an Adjustment Class: A TokenReinforcement Program. In: Exceptional Children, 33 (1966/67), S. 637-642.PAQUETTE, J.: Social Purpose and Schooling: Alternatives, Agendas and Issues. London/NewYork/Philadelphia 1991 (The Falmer Press).PARIS, S.G./BYRNES, J.P.: The Constructivist Approach to Self-Regulation and Learningin the Classroom. In: B.J. Zimmerman/D.H. Schunk (Hg.): Self-Regulated Learningand Academic Achievement. Theory, Research, and Practice. New York 1989(Springer), 169-200.PARKHURST, HELEN: Education on the Dalton Plan. London 41924.PATTERSON, G.R.: Accelerating Stimuli for two Classes of Coercive Behaviors. In:Journal of Abnormal Child Psychology, 5 (1977), S. 335-350.PEARCE, JOSEPH CHILTON: From Magical Child to Magical Teen, A Guide to AdolescentDevelopment. South Paris, MA: Park Street Press 1992.PEISERT, HANSGERT (HG.): Abiturienten und Ausbildungswahl. Weinheim, Basel: Beltz1981PERKINSON, H.J.: Learning from our Mistakes. A Reinterpretation of Twentieth-Century Educational Theory. Westport, CT/London 1984 (Greenwood).285
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTPERSELL, C.H.: Education and Inequality: A Theoretical and Empirical Synthesis. NewYork 1977 (Free Press).PESCHEL, FALKO: Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtesKonzept zur Diskussion, Teil I und II. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren,2002.PESCHEL, FALKO: Offener Unterricht. Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtesKonzept in der Evaluation, Teil I und II. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren,2003.PETERSEN, P.: Führungslehre des Unterrichts. Braunschweig 71963.PETERSEN, PETER: DER URSPRUNG DER PÄDAGOGIK. BRAUNSCHWEIG 21964PETERSEN, PETER: Die Neueuropäische Erziehungsbewegung. Weimar 1926.PETILLON , HANS: Der unbeliebte Schüler. Braunschweig: Westermann 1978PETILLON, HANS: Soziale Erfahrungen in der Schulanfangszeit. In: Reinhard Pekrun /Helmut Fend (Hg.): Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resümee derLängsschnittforschung. Stuttgart: Enke 1991, S. 183-200.PHILLIPS, DEBORAH/ZIMMERMAN, MARC: In: STERNBERG, R.J./KOLLIGIAN,JOHN (eds.): Cometence Considered. New Haven: Yale University Press 1990.PIAGET, J./ INHELDER, B.: The psychology of the child. New York: Basic Books 1969.PIAGET, J.: Die Äquilibration der kognitiven Strukturen. Stuttgart 1976 (Klett-Cotta).PIAGET, J.: PSYCHOLOGIE DER INTELLIGENZ. OLTEN 1971PIAGET, JEAN: Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde, Stuttgart 1969 Klett;PICHT, GEORG: Die deutsche Bildungskatastrophe. Analyse und <strong>Dokument</strong>ation. Olten/Freiburgi.Br. 1964 (Walter).PINKER, S.: Der Sprachinstinkt. Wie der Geist <strong>die</strong> Sprache bildet. München: Kindler1996.PITTMAN, T.S./ EMERY, J./ BOGGIANO, A.K.: Intrinsic and extrinsic motivational orientations:Reward.induced changes in preference for complexitiy. Journal of Personalityand Social Psychology, 42 (1982) 789-797.POLANYI, M.: Personal Knwledge. Towards a Post-Critical Philosphophy. London,Henley: Routledge & Keegan 1978.POPHAM W. J.: Two-Plus Decades of Educational objectives. International Journal ofEducational Research 11, 1987, 31- 41.Popper, K.R./ ECCLES, J.C.: Das Ich und sein Gehirn. München/Zürich 1982 (Piper).286
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTPOPPER, K.R.: Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Hamburg 1973(Hoffmann u. Campe).PORTELE, G.: Lernen und Motivation. Ansätze zu einer Theorie intrinsisch motiviertenLernens. Weinheim 1975 (Beltz).PRAGER, JENS U./WIELAND, CLEMENS: Jugend und Beruf. Repräsentativumfrage zurSelbstwahrnehmung der Jugend in Deutschland. Bertelsmann Stiftung Gütersloh, Juli2005, www.ironkids.dePRECHTL, H.F.R.: The Development of postural control in infancy. In: Euler, C.v./Forssberg, T/ Lagercrantz (Hg.): Neurobiology of early infant behavior. London:Macmillan 1989, 59-68.PRENZEL, MANFRED./HEILAND, ALFRED.: Motivationale Prozesse beim autodidaktischenLernen. In: Unterrichtswissenschaft, 18. Jg. (1990), S. 219-234.PRENZEL, MANFRED: Die Wirkungsweise von Interesse. Ein pädagogischpsychologischesErklärungsmodell. Opladen 1988 (Westdeutscher Verlag).PRENZEL, MANFRED: Lernen innerhalb und außerhalb der Schule - zwischen Instruktionund Konstruktion. In: P. Strittmatter (Hg.): Zur Lernforschung: Befunde - Analysen -Perspektiven. Weinheim 1990 (Deutscher Stu<strong>die</strong>n Verlag), 169-183.PURKEY, S./SMITH, M.: Effective Schools: A Review. In: Elementary School Journal 83(1983), 4, S. 427-452.RADFORD, JOHN: Child Prodigies and Exceptional Early Achievers. New York/Londonu.a. 1990a (Harvester Wheatsheaf).RADFORD, JOHN: The Problem of the Prodigy. In: HOWE, M. (ed.): Encouraging theDevelopment of Exeptional Skills and Talents. Leister 1990b (The British PsychologicalSociety), S. 32-48.REICHEN, JÜRGEN: Hannah hat Kino im Kopf. Die Reichen-Methode „Lesen durchSchreiben“ und ihre Hindergründe für Lehrerinnnen, Stu<strong>die</strong>rende und Eltern. Hamburg:Heinevetter 2001RENNINGER, ANN K./WOZNIAK, ROBERT H.: Effect of Interest on Attentional Shift, Recognition,and Recall in Young Children. In: Developmental Psychology. Vol. 21 (4),(1985), S. 624-632.RENNINGER, K.A.: Individual interest and development: implications for theory andpractice. In: Renninger, K.A./ Hidi, S./ Krapp, A.: (Hg.) The role of interest in learningand development. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass.: 1992, 361-395.287
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTRENZULLI, J.S./SMITH, L.H./REIS, S.M.: Curriculum Compacting: An EssentialStrategy for Working with Gifted Students. In: The Elementary School Journal, 82(1982), 185-194.RENZULLI, J.S.: The Three-Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model forCreative Productivity. In: STERNBERG, ROBERT/DAVIDSON, JANET (eds.):Conceptions of Giftedness. Cambridge 1986 (Cambridge University Press), S. 53-92.RENZULLI, JOSEPH: Guiding the Gifted in the Pursuit of Real Problems: The TransformedRole of the Teacher. In: Journal of Creative Behavior. 17 (1983), S. 49-59.REYNOLDS, D./MURGATROYD, S.: The Sociology of Schooling and the Absent Pupil:The School as a Factor in the Generation of Truancy. In: CARROLL, H.C.M.(Hg.): Absenteeism in South Wales: Stu<strong>die</strong>s of Pupils, Their Homes and Their SecondarySchools. Swansea (University of Swansea, Faculty of Education) 1977.RHEINBERG, F. / DUSCHA, R. / MICHELS, U.: Zielsetzungund Kausalattribution in Abhängigkeitvom Leistungsvergleich. Zeitschrift für Enwicklungspsychologie und PädagogischePsychologie 12, 1980. 177-189.RHEINBERG, F. / LÜHRMANN, J.V. / WAGNER, H.: Bezugsnorm-Orientierung von Schülernder 5. - 13. Klasse bei der Leistungsbeurteilung. Zeitschrift für Entwicklungspsychologieund Pädagogische Psychologie, 9, 1977, 90-93.RHEINBERG, F./ENSTRUP, B.: Selbstkonzept der Begabung bei Normal- und Sonderschülerngleicher Intelligenz: Ein Bezugsgruppeneffekt. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologieund Pädagogische Psychologie, 9 (1977), S. 171-180.RICK, G.: Die soziale Stellung entwicklungsgehemmter Kinder in Volklsschulklassenund ihre soziale Stellung nach der Überweisung in <strong>die</strong> Hilfsschule. In: Zeitschrift fürHeilpädagogik, 12 (1961), S. 557-564 u. S. 609-621.RIDLEY, D.S.: Reflective Self-Awareness: A Basic Motivational Process. In: Journal ofExperimental Education, 60 (1991), 31-48.RIEGEL, ENJA: Schule kann gelingen! Wie unsere Kinder wirklich fürs Leben lernen.Frankfurt a. M.: Fischer 2004RIES, G.: Die Entwicklung von kausalen Erklärungsmustern für Schulleistungen. In:SCHMIDT-DENTER, U./MANZ, W. (Hg.): Entwicklung und Erziehung im ökopsychologischenKontext. München 1991 (Reinhardt), S. 56-67.RIES, GERHILD: Die Entwicklung von kausalen Erklärungsmustern für Schulleistungen.In: SCHMIDT-DENTER/MANZ, WOLFGANG (Hg.): Entwicklung und Erziehungim öko-psychologischen Kontext. München 1991 (Reinhardt), S. 56-67.RIST, G./SCHNEIDER, P.: Die Hibernia-Schule. Von der Lehrwerkstatt zur Gesamtschule:eine Waldrorfschule integrierte berufliches und allgemeines Lernen. Reinbek:Rowohlt 1980288
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTRODIN, J.: Control by any Other Name: Definitions, Concepts, and Process. In: J.Rodin/C. Schooler/K.W. Schaie (Eds.): Self-Directedness: Cause and EffectsThroughout the Life Course. Hillsdale NJ 1990 (Erlbaum), 1-17.ROGERS, C.R.: Lernen in Freiheit. Zur Bildungsreform in Schule und Universität.München 1974 (Kösel).ROGOFF, B.: Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. NewYork/Oxford: Oxford University Press 1990.RÖHRS, HERMANN (HG.): Die Reformpädagogik des Auslands. Stuttgart 1983RÖHRS, HERMANN: Die progressive Erziehungsbewegung. Ursprung und Verl<strong>auf</strong> derReformpädagogik in den USA. Hannover 1977RÖHRS, HERMANN: Die Reformpädagogik. Ursprung und Verl<strong>auf</strong> in Europa. Hannover1983ROKEACH, MILTON: The Open and Closed Mind. Investigations into the Nature of BeliefSystems and Personality Systems. New York: Basic Books 1960.Rosenbaum- Social Implications of Educational Grouping. In: Review of Research inEducation, 8 (1989), S. 361-401.ROSENBAUM, J.: Making Inequality. The Hidden Curriculum of High School Tracking.New York/London u.a. 1976 (Wiley).ROSENBAUM, S./DARKENWALD, G.G.: Effects of Adult Learner Participation inCourse Planning on Achievement and Satisfaction. In: Adult Education Quarterly, 33(1983), 147-153.ROSENBERG, SONJA: Schulische Leistungsschwäche: <strong>Institution</strong>elle Konstituierungund individueller Umgang. Zürich 1989 (ADAG Administration & Druck), (= Diss.Zürich).ROTH, H.: Pädagogische Anthropologie. 2 Bde. Hannover 1966, 1970.ROTH, HEINRICH (Hg.): Begabung und Lernen. Ergebnisse und Folgerungen neuerForschungen. Stuttgart 1969 (Klett) (= Deutscher Bildungsrat: Gutachten und Stu<strong>die</strong>nder Bildungskommission Bd. 4).ROWE, DAVID C.: Genetik und Sozialisation. Die Grenzen der Erziehung. Weinheim:Psychologie Verlags Union 1997RUBIN, K.H.: The Waterloo Longitudinal Project: Correlates and consequences of socialwithdrawal from childhood to adolescence. In: Rubin, K.H./ Aspendorpf, J.B. (Hg.):Social withdrawal, inhibition, and shyness in childhood. Hillsdale, NJ: LawrenceErlbaum 1993, 291-314.289
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTRUTTER, M./MAUGHAN, B./MORTIMORE, P./OUSTON, J.: Fünfzehntausend Stunden.Schulen und ihre Wirkung <strong>auf</strong> Kinder. Weinheim, Basel 1980 (Beltz).RUTTER, M./MAUGHAN, B./MORTIMORE, P./OUSTON, J.: Fünfzehntausend Stunden.Schulen und ihre Wirkung <strong>auf</strong> <strong>die</strong> Kinder. Weinheim/Basel 1980 (Beltz).RYAN, R./GROLNICK, W.S.: Origins and Pawns in the Classroom: Self-Report andProjective Assessments of Individual Differences in Children's Perceptions. In: Journalof Personality and Social Psychology, 50 (1986), 550-558.RYAN, R./LYNCH, J.: Emotional Autonomy versus Detachment: Revisting the Vicissitudesof Adolescence and Young Adulthood. In: Child Development, 60 (1989), 340-356.RYAN, R./POWELSON, C.L.: Autonomy and Relatedness as Fundamental to Motivationand Education. In: Journal of Experimental Education, 60 (1991), 49-66.RYAN, R.M./CONNELL, J.P.: Perceived Locus of Causality and Internalization: ExaminingReasons for Acting in two Domains. In: Journal of Personality and Social Psychology,57 (1989), 749-761.RYAN, R.M./STILLER, J.: The social contexts of internalization: Parent and teacher influenceson autonomy, motivation, and learning. In: Maehr, M.L./ Pintrich, P.R.: Advancesin Motivation and Achievement. JAI Press ?, S. 115-149.SALDERN, MATTHIAS von: Selbstwertgefühl des Schülers und soziale Anerkennungdurch Mitschüler. In: Empirische Pädagogik. 4 (1990), S. 229-239.SCARR, S./ MCCARTNEY, K.: How people make their own environments: a theory ofgenotype environment effects. Child Development 54 (1983), 424-435.SCHALLING, D./ EDMAN, G./ ÅSBERG, M.: Impulsive cognitive style and inability to tolerateboredom: Psychobiological stu<strong>die</strong>s of temperamental vulnerability. In: Zuckerman,M. (Hg.): Biological bases of sensation seeking, impulsivity, and anxiety.Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 1983, 123-145..SCHEIBE, W.: Die Reformpädagogische Bewegung 1900-1932. Weinheim/ Berlin / Basel1971SCHELSKY, H. Auf der Suche nach Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze. Düsseldorf,Köln 1965.SCHELSKY, H.: Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschaft. Würzburg1957 (Werkbund).SCHIEFELE, H.: Lernmotivation und Motivlernen. Grundzüge einer erziehungswissenschaftlichenMotivationslehre. München 1974 (Ehrenwirth).SCHITTKO, KLAUS: Differenzierung in Schule und Unterricht. Ziele, Konzepte, Beispiele.Münschen: Ehrenwirth 1984.290
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTSCHMALT, H.D.: Das LM-Gitter. Göttingen 1976.SCHMECK, R.R.: Individual differences and Learning Strategies. In: Weinstein,C.E./Goetz, E./Alexander, P. A. (Hg.): Learning and Study Strategies: Issues in Assessment,Instruction, and Evaluation. New York: Academic 1988, 171-191.SCHNEIDER, K.: Motivation unter Erfolgsrisiko. Göttingen: Hogrefe 1973.SCHORB, B.: Leistung und Sozialisation. Einführung in <strong>die</strong> Theorien der Leistungsmotivation.München 1976.SCHUCH, A.: Erlernte Hilflosigkeit – ausschließlich ein Problem unangemessenerKognitionen? Weinheim 1982 (Beltz).SCHULZ-BENESCH, GÜNTER (Hg): Montessori. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft1970SCHÜMER, RUDOLF: Some Psychological Aspects of Distance Education. Hagen (Fernuniverstiät,ZIFF) 1993.SCHUNK, D.H.: Social Cognitive Theory and Self-Regulated Learning. In: B.J. Zimmerman/D.H.Schunk (Hg.): Self-Regulated Learning and Academic Achievement.Theory, Research, and Practice. New York/Berlin 1989 (Springer), 83-110.SCHWARZER, R./JERUSALEM, M.: Selbstkonzeptentwicklung in schulischen Bezugsgruppen.In: Zeitschrift für Personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie,2 (1983), S. 79-87.SCHWARZER, RALF/STEINHAGEN, KLAUS (HG.): Adaptiver Unterricht. Zur Wechselwirkungvon Schülermerkmalen und Unterrichtsmethoden.München: Kösel 1975.SCHWARZER, RALF: Streß, Angst und Hilflosigkeit. Die Bedeutung von Kognitionen undEmotionen bei der Regulation von Belastungssituationen. Stuttgart, Berlin, Köln:Kohlhammer 2 1987SCMECK, R.R.: Individual Differences and Learning Strategies. In: Weinstein, C.E./Goetz, E. T./ Alexander, P.A. (Hg.): Learning and Study Strategies: Issues in Assessment,Instruction, and Evaluation. New York, Academic 1988, 171-191.SEIBEL,H.D.: Gesellschaft im Leistungskonflikt. Düsseldorf: Bertelsmann 1973.SELIGMAN, M.E.P.: Helplessness: On Depression, Development, and Death. San Francisco1975 (Freeman).SERGIOVANNI, T. J.: Moral leadership. Getting to the Heart of School Improvement. SanFrancisco: Jossey-Bass 1992.SHAPIRO, Z.: Expectancy determinants of instrinically motivated behavior. Journal ofPersonality and Social Psychology, 34 (1976) 1235-1244.291
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTSHARAN, S. (Ed.): Cooperative Learning. Theory and Research. New York u.a. 1990(Praeger).SHERIF, M./CANTRIL, H.: The psychology of ego involvements, social attitudes and identifcations.New York: Wiley 1947.SILBEREISEN, R.K./VASKOVICS, L.A./ZINNECKER, J. (HRSG.): Jungsein in Deutschland.Jugendliche und junge Erwachsene 1991 und 1996. Opladen: Leske & Budrich 1996.SILBEREISEN, RAINER: Adolesence in context: the interplay of familiy, school, peers, andwork in adjustment. Berlin, Heidelberg: Springer 1994SIMONS, P.R.J.: Lernen, selbständig zu lernen - ein Rahmenmodell. In: H. Mandl/H.F.FRIEDRICH (Hg.): Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention. Göttingen,Toronto, Zürich 1992 (Hogrefe), 251-264.SINGLETON, J./NEWPORT, E.: When Learners Surpass Their Models: The Acquisition ofSign Language from Impoverished Input. Unveröffentl. Ms. Dep. of Pych. Universityof Rochester 1993. Zit. nach Pinker 1996.SKIERA, EHRENHARD: Die Jena-Plan-Bewegung in den Niederlanden. Beispiel einer pädagogischfun<strong>die</strong>rten Schulreform. Weinheim, Basel: Beltz 1982.SKINNER, B.F.: Science and human behavior. New York: Macmillan 1953.SLAVIN, R./KARWEIT, N.: Effects of Whole Class, Ability Grouped, and IndividualizedInstruction on Mathematics Achievement. In: American Educational ResearchJournal, 22 (1985), S. 351-367.SLAVIN, R.: Achievement Effects of Ability Grouping in Secondary Schools: A Best-Evidence Synthesis. In: Review of Educational Research, 60 (1990), S. 471-499.SLAVIN, R.: Cooperative Learning. New York, London 1983 (Longman).SLAVIN, R.: Cooperative Learning. New York/London 1983 (Longman).SLOANE, KATHRYN D.: Home Influences on Talent Development. In: BLOOM,BENJAMIN S. (ed.): Developing Talent in Young People. New York 1985 (BallantineBooks), S. 439-476.SOBIERAJ, ANKE: Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher (Tagungsbericht).In: Pädagogik und Schulalltag. 46 (1991, S. 618-619.SORENSEN, A./HALLINAN, M.: Effects of Ability Grouping in Growth in AcademicAchievement. In: American Educational Research Journal, 23 (1986), S. 519-542.SOSNIAK, LAUREN A.: A Long-Term Commitment to Learning. In: BLOOM, BEN-JAMIN S. (ed.): Developing Talent in Young People. New York 1985b (BallantineBooks), S. 477-506.292
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTSOSNIAK, LAUREN A.: Phases of Learning. In: BLOOM, BENJAMIN S. (ed.): DevelopingTalent in Young People. New York 1985a (Ballantine Books), S. 409-430.SOSNIAK, LAUREN A.: The Nature of Change in Successful Learning. In: TeachersCollege Record. 88 (4), (1987), S. 519-535.SOSNIAK, LAUREN A.: The Tortoise, the Hare, and the Development of Talent. In:HOWE, MICHAEL (ed.): Encouraging the Development of Exceptional Skills andTalents. Leicester 1990 (The British Psychological Society), S. 149-164.SPECK, O.: Chaos und Autonomie in der Erziehung. Erziehungsschwierigkeiten untermoralischem Aspekt. München 1991 (Reinhardt).SPELKE, E.S./ BREINLINGER, K./ MACOMBER, J./ JACOBSON, K.: Origins of Knowledge.Psychological Review 99 (1992), 605-632.SPIELBERGER, Ch./DeNIKE, L.D.: Descriptive Behaviorism Versus Cognitive Theoryin Verbal Operant Conditioning. In: Psychological Review, 73 (1966), S. 306-326.SPIES, W. E./ ELBERS, D./ HABEL, W./ HEITZER, M./ HOFFMANN, J./ MERKEL, K.: DasBerufsvorbereitungsjahr in NW. DORTMUND 1982.STAATS, A. W.: Child Learning, Intelligence, and Personality. Principles of a BehavioralInteraction Approach. New York/Evanston/London 1971 (Harper & Row).STAATS, ARTHUR W.: Child Learning, Intelligence, and Personality. Principles of aBehavioral Interaction Approach. New York/Evanston/London 1971 (Harper &Row).STANLEY, JULIAN C./BENBOW, CAMILLA P.: Intellectually Talented Students:The Key is Curricular Flexibility. In: PARIS, SCOTT G./OLSON, GARYM./STEVENSON, HAROLD W. (eds.): Learning and Motivation in the Classroom.Hillsdale, New Jersey/London 1983 (Lawrence Earlbaum), S. 259-281.STECHER, L./DRÖGE: Bildungskapital und Bildungsvererbung in der Familie. In: R.K.Silbereisen/ L.A. Vaskovic/ J. Zinnecker (Hrsg.): Jungsein in Deutschland. Jugendlicheund junge Erwachsene 1991 und 1996. Opladen: Leske & Budrich 1996.STERN, ELSBETH: Die spontane Strategieentdeckung in der Arithmetik. In: Heinz Mandl/ Helmut F. Friedrich (Hg.): Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention.Göttingen/ Toronto/ Zürich 1992, S.101-123.STIPPEL, F.: Die Zerstörung der Person. Donauwörth 1957.STODOLSKY, S.: The subject matters. Chicago: University of Chikago Press 1988.STONE, J./CHURCH, J.: Kindheit und Jugend. Einführung in <strong>die</strong> Entwicklungspsychologie.Bd. 1, Stuttgart 1978 (dtv/Thieme).293
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTSTOTT, D.H.: The Parent as Teacher. A Guide for Parents of Children with Learning Difficulties.Toronto: New Press 1972STRITTMATTER, P.: Schüler-Enquete: „Streß in der Schule“. Bericht einer Voruntersuchung.Saarbrücken: Ministerium für Kultur, Bildung und Sport des Saarlandes 1977.SVINGBY, GUNILLA.: Der Zusammenhang zwischen Schüler<strong>auf</strong>fassungen über bestimmteBegriffe und Schulerfahrungen. In: Grammes, T./ Wicke, K. (Hg.): Die Gesellschaftaus der Schülerperspektive. Schwedische Beitäge zu einer didaktischen Phänomenographie.Hamburg: Krämer 1991, 69-89.TAUSCH, R. /TAUSCH, A.-M.: Erziehungspsychologie. Psychologische Prozesse in Erziehungund Unterrichtung. Göttingen: Hogrefe 5 1970.TAYLOR, M.S./LOCKE, E.A./LEE, C./GIST, M.E.: Type A Behavior and Faculty ResearchProductivity: What are the Mechanisms? In: Organizational Behavior andHuman Performance, 34 (1984), 402-418.TERMAN, LEWIS/ODEN, MELITA: The Gifted Group at Mid-Life. Thirty-five Years'Follow-up of the Superior Child. (Genetic Stu<strong>die</strong>s of Genius, Vol. V, ed. by LEWISTERMAN). Stanford/London 21960 (Stanford University Press/Oxford UniversityPress).THOMAS, D./BECKER, W./ARMSTRONG, M.: Production and Elimination of DisruptiveClassroom Behavior by Systematically Varying Teacher's Behavior. In: Journalof Applied Behavior Analysis, 1 (1968), S. 35-45.THONHAUSER, JOSEF: Zur Interdependenz von Entwicklungsbedingungen und Leistungsbeurteilung.In: (Olechowski, Richard / Persy, Elisabeth (Hg.): Fördernde Leistungsbeurteilung.Ein Sympoion. Wien/ München: Volk & Welt 1987, S. 125-148.THORNDIKE, E.L.: The psychology of wants, interests, and attitudes. New York: D. Appleton-Century1935TOOBY, J./COSMIDES, L.: The Psychological Foundations of Culture. In: Barkow, J.H./Cosmides, L./ Tooby, J. (Hg.): The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and theGeneration of Culture. New York/Oxford: Oxford Press 1992, 19-136.TREIBER, B./WEINERT, F. E.: Gute Schulleistungen für alle? Psychologische Stu<strong>die</strong>nzu einer pädagogischen Hoffnung. Münster 1985 (Aschendorff).TROST, G.: Möglichkeiten und Nutzen der Aufbereitung von Reifezeugniszensuren für<strong>die</strong> Verbesserung der Stu<strong>die</strong>nerfolgsprognose. Der Bundesminister für Bildung undWissenschaft, Schriftenreihe Bildungsplanung 12, Bonn 1975, S. 9-12.TRUDEWIND, C. / KOHNE, W.: Bezugsnorm-Orientierung der Lehrer und Motiventwicklung.Zusammenhänge mit Schulleistung, Intelligenz und Merkmalen der häuslichenUmwelt in der Grundschulzeit. In: RHEINBERG, F. (Hg.): Jahrbuch für EmpirischeErziehungswissenschaft 1982. Düsseldorf 1982, 115-142.294
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTTUNSTALL, OLIVE/GUDJONSSON, GISLI/EYSENCK, HANS/HAWARD, LIO-NEL: Professional Issues Arising from Psychological Evidence Presented in Court.In: Bulletin of the British Psychological Society. 35 (1982), S. 329-331.UHL, S.: Die Mittel der Moralerziehung und ihre Wirksamkeit. Bad Heilbrunn: Klinkhardt1996UKENA, SILJA: PLANUNGSZIEL ZUKUNFT. IN: DIE ZEIT NR. 31, 1995, S. 26VALLERAND, R.J./ GAUVIN, L.I./ HALLIWELL, W.R.: Negative effects of competition onchildren’s intinsic motivation. Journal of Social Psychology, 126 (1986) 649-657.VALLI, L.: "Tracking: Can It Benefit Low Achieving Students?" Paper presented at theannual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco,April 1986. Zit. nach GAMORAN, A. 1989.VERMUNT, J.D.H. M./VAN RIJSWIJK, F.A.W.M.: Analysis and Development of Student’sSkill in Self-regulated Learning. Higher Education, 17 (1988). 647-682.VIERLINGER, R.: Lernen für <strong>die</strong> Zukunft - oder: Die Reform ist tot - es lebe <strong>die</strong> Reform!In: Erziehung und Unterricht, 140, 2 (1990), S. 50-67.VIERLINGER, RUPERT: Leistung spricht für sich selbst. „Direkte Leistungsvorlage“ (Portfolios)statt Ziffernzensuren und Notenfetischismus.Heinsberg: Dieck 1999.VORRATH, H./BRENDTIO, L.: Positive Peer Culture, Chicago 21985 (Aldine Press).WAGENSCHEIN, M.: Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken. 2 Bde. Stuttgart:Klett 2 1970.WAGENSCHEIN, M.: Was bleibt: (Verfolgt am Beispiel der Physik). In: H. Flügge(Hg.): Pathologie des Unterrichts. Bad Heilbrunn 1971 (Klinkhardt), 74-92.WAGENSCHEIN, MARTIN: VERSTEHEN LEHREN. WEINHEIM; BELTZ 1975WALDMANN, M./WEINERT, F.: Intelligenz und Denken. Perspektiven der Hochbegabungsforschung.Göttingen u.a. 1990 (Hogrefe).WALLER, W.: The Sociology of teaching. New York: Russell Russell (11932) 1961.WANG, M.C. BIRCH, J.W.: Comparison of a Full-Time Mainstreaming Program and aResource Room Approach. In: Exceptional Children, 51 (1984), S. 33-44.WEBER, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Tübingen:Mohr 51976.WEBSTER, PETER R. / KATHY SCHLENDRICH: Discrimination if Pitsch Direction by PreschoolChildren with verbal and nonverbal tasks. In: journal of Research in MusikEducation.. 30 (1982) S. 151-161.WEHRMANN, ELISABETH: Fremdsein in Deutschland. Ganz gewöhnliche Schüler dreheneinen ganz ungewöhnlichen Film. In: DIE ZEIT, 27, 1995.295
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWEINBERG, R.S./GOULD, D./JACKSON, A.: Expectations and Performance: An EmpiricalTest of Bandura's Self-Efficacy Theory. In: Journal of Sport Psychology, 1(1979), 320-331.WEINERT, F.E./SCHRADER, F.-W./HELMKE, A.: Unterrichtsexpertise - ein Konzeptzur Verringerung der Kluft zwischen zwei theoretischen Paradigmen. In: ALISCH,L.-M./BAUMERT, J./BECK, K. (Hg.): Professionswissen und Professionalisierung.Braunschweig 1990 (= Braunschweiger Stu<strong>die</strong>n zur Erziehungs- und Sozialarbeitswissenschaft),S. 173-206.WEINERT, F.E.: Kann nicht sein, was nicht sein darf? Kritische Anmerkungen zu eineranmerkungsreichen Kritik. In: Zeitschrift für Psychologie, 2 (1988), Heft 2, S. 113-117.WEINERT, FRANZ E./ HELMKE, ANDREAS/ SCHRADER, FRIEDRICH-W.: Research on theModel Teacher and the Teaching Model. In: Effective and Responsible Teaching.The New Synthesis. San Francisco: Jossey-Bass 1992, S. 249-260.WEINERT, FRANZ E./WALDMANN, MICHAEL R.: How do the Gifted Think? IntellectualAbilities and Cognitive Processes. In: CROPLEY A.J./URBAN,K.K./WAGNER, H./WIECZERKOWSKI, W. (eds.): Giftedness: a ContinuingWorldwide Challenge. New York 1986 (Trillium), S. 49-64.WEINGARDT, E.: Die Verteilung der Noten von Sexta bis Oberprima. In: INGEN-KAMP, K. (Hg.): Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Texte und Untersuchungsberichte.Weinheim/Basel 1971 (Beltz), S. 205-215.WEISZ, J.R./ROTHBAUM, F.M./BLACKBURN, T.C.: Standing Out and Standing In:The Psychology of Control in America and Japan. In: American Psychologist, 39(1984), 955-969.WELLMAN, H.M.: The Child’s Theory of Mind: Cambridge, MA: Bradford/MIT-Press1990.WELLS, G./CHANG, G.L.M./MAHER, A.: Creating Classroom Communities of LiterateThinkers. In: SHARAN, S. (Hg.): Cooperative Learning. Theory and Research.New York 1990 (Praeger), S. 95-121.WHELDALL, K./HOUGHTON, S./MERRETT, F.: Natural Rates of Teacher Approvaland Disapproval in British Secondary School Classrooms. In. British Journal of EducationalPsychology, 59 (1989), S. 38-48.WHELDALL, K.: Managing Troublesome Classroom Behaviour in Regular Schools: APositive Teaching Perspective. In: International Journal of Disability, Developmentand Education, 38 (1991), S. 99-116.WHITE, J.: Education and the Good Life. Beyond the National Curriculum. London1990 (Kogan Page).296
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFTWHITE, R.W.: Motivation. Reconsidered: The Concept of Competence. In: PsychologicalReview, 66 (1959), 297-333.WILLIAMS, R.J.: Free and Unequal. The Biological Basis of Individual Liberty. Austin1953 (University of Texas Press).WILLIE, CHARLES VERT: Effective Education. A Minority Policy Perspective. NewYork/Westport, Conn. 1987 (Greenwood Press).WILLIE, CHARLES VERT: The Recruitment and Retention of Minority Health Professionals.In: Alabama Journal of Medical Sciences, 19 (1982), S. 303-308.WILLIS, P.: Spaß am Widerstand. Frankfurt/M. 1982.WINTER, S.: Teacher Approval and Disapproval in Hongkong Secondary School Classrooms.In: British Journal of Educational Psychology, 60 (1990), S. 88-92.WITTMANN, J.: Theorie und Praxis eines ganzheitlichen Unterrichts. Dortmund 4 1967(Crüwell).WÖRNLE, R. CH.: <strong>Auswirkungen</strong> der gemeinsamen Unterrichtung behinderter und nichtbehinderterKinder nach den pädagogischen Prinzipien von Maria Montessori <strong>auf</strong>Konzentrationsverhalten, Schulangst, Schulleistungen und soziale Integration.Uneröffentl. Diss., Universität München 1984.WYNN, K.: Addition an Subtraction by Human Infants. Nature, 358 (1992), 749-750.YOUNGS, B.B.: STRESS IN SCHILDREN. NEW YORK: ARBOR HOUSE 1985ZIMMERMAN, B.J./ DIALESSI, F.: Modeling Influences on Childrens’s Creative Behavior.Journal of Educational Psychology, 65 (1973) 127-134.ZIMMERMAN, B.J./ROSENTHAL, T.L.: Observational Learning of Rule-Governed Behaviorby Children. Pychological Bulletin, 81 (1974) 29-42.ZIMMERMAN, B.J.: Models of Self-Regulated Learning and Academic Achievement.In: B.J. Zimmerman/D.H. Schunk (Hg.): Self-Regulated Learning and AcademicAchievement. Theory, Research, and Practice. New York/Berlin 1989 (Springer), 1-25.ZIMMERMANN, B.J./SCHUNK, D.H. (Hg.): Self-Regulated Learning and AcademicAchievement. Theory, Research, and Practice. New York/Berlin 1989 (Springer).ZINNECKER, JÜRGEN: Der heimliche Lehrplan, Weinheim: Beltz 1975ZUCKERMAN, HARRIET: Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States. NewYork 1977 (Free Press).297
HELMUT LEHNER:GUTE SCHULEN – BESSERE ZUKUNFT298