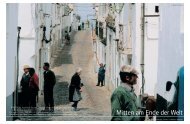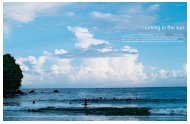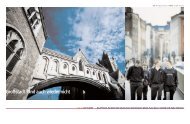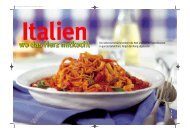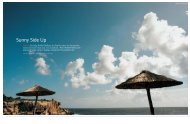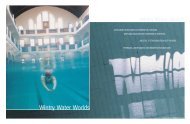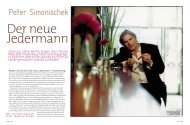Benchmark - D+R-Verlag
Benchmark - D+R-Verlag
Benchmark - D+R-Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Heinz und Roland Velich<br />
Heinz und Roland Velich gelten in Sachen<br />
Chardonnay als eine „<strong>Benchmark</strong>“, also als<br />
Prüfmaßstab. Ihr „Tiglat“ macht auch in inter-<br />
nationalen Proben eine hervorragende Figur.<br />
<strong>Benchmark</strong><br />
Chardonnay<br />
Interview: Michael Prónay Fotos: Nikolaus Similache<br />
Ein Weingut im Burgenland – und kein Rotwein. Wie gibt’s so was?<br />
Wir haben uns eben auf Weißwein und Süßwein spezialisiert,<br />
was mit unserer Lage zusammenhängt. Hier, in diesem kleinen<br />
Bereich, der Apetlon, Illmitz und den südlichen Teil von<br />
Podersdorf umfasst, ist der Botrytisdruck durch die vielen<br />
Lacken ganz einfach wesentlich stärker als etwa in Gols am<br />
Abhang der Parndorfer Platte, Frauenkirchen oder in Rust.<br />
Das ist der eigentliche Seewinkel. Der Hallebühl in Frauenkirchen<br />
beispielsweise liegt 30 oder 40 m höher. Die tiefste<br />
Gemeinde Österreichs ist Illmitz, der tiefste Punkt überhaupt<br />
in einer Apetloner Senke.<br />
Andererseits wachsen hier ja doch auch anständige Rote, wenn ich<br />
an Sepp und Niki Moser denke oder auch an Alois Kracher.<br />
Stimmt schon, aber historisch gewachsen sind wir als kleines<br />
Weiß- und Süßweingut. Dazu kommt, dass wir in diesem<br />
Bereich Weine keltern, die national – und damit natürlich<br />
auch international – absolut konkurrenzfähig sind. Diese Möglichkeit<br />
sehen wir persönlich, für unseren Betrieb gesprochen,<br />
beim Rotwein noch nicht. Das deckt sich übrigens mit den internationalen<br />
Berichten über unser Land: Da wird Weiß und Süß<br />
voll anerkannt, der Rote aber mit einer gewissen Skepsis<br />
beäugt. Was aber nicht heißt, dass sich das nicht in zehn oder<br />
15 Jahren ändern könnte. Wenn die Prognose stimmt, dass die<br />
Durchschnittstemperatur in unserer Region in den nächsten<br />
20 Jahren um 1 °C steigen wird, dann wird der Rotwein sogar<br />
ganz sicher ein Thema. Aber vorderhand ist’s noch nicht so<br />
weit. Aber auch der Großvater hat schon nur Weißwein ausgesetzt,<br />
und auch bei den Alten war nur Weißwein gefragt.<br />
Das ist der Punkt, eine eindringliche Warnung auszusprechen.<br />
Rotwein boomt national wie international, was zum Beispiel<br />
dazu führt, dass sogar Jean-Louis Chave im nördlichen Rhônetal<br />
seine großartigen Weißen schwer verkaufen kann. Wer<br />
einen roten Hermitage von ihm will, muss die weiße Variante<br />
dazunehmen. Koppelkäufe sind nicht das Größte, aber das ist
Heinz und Roland Velich<br />
Über den Rotwein-Boom: „Das Beispiel eines Nachbarns, der in einer<br />
Super-Botrytislage ausgerechnet St. Laurent – die fäulnisempfindlichste<br />
Sorte überhaupt – gesetzt hat, gibt sehr zu denken.“<br />
72<br />
die Situation. Man ist also versucht,als verantwortungsbewusster<br />
Kämmerer oder Funktionär, den Bauern einzuimpfen,<br />
Rotwein auszusetzen. Und dabei kommt’s natürlich zu Misstönen,<br />
dass nämlich Rotwein ausgesetzt wird, ohne zu bedenken,<br />
wo und wie, und so kommt’s, dass heute Rotweine in<br />
Böden und Kleinklimata ausgesetzt werden, die für Rotweine<br />
überhaupt nicht geeignet sind. Das Beispiel eines Nachbarn,<br />
der in eine Super-Botrytislage ausgerechnet St. Laurent – die<br />
fäulnisempfindlichste Sorte überhaupt – gesetzt hat, gibt da<br />
sehr zu denken.<br />
Das Ganze ist ja auch in Verbindung mit der Pionierarbeit<br />
der Rotweinwinzer im Burgenland zu sehen. Deren Arbeit<br />
hat ja den Ruf des Burgenlands als Rotweinland mitbegründet<br />
– und wenn jetzt mir nichts, dir nichts überall Rotwein hingesetzt<br />
wird, dann schadet das auch dem Ruf. Und dazu<br />
kommt als weiterer Punkt, dass im Zuge des Booms der<br />
Weißwein in Lagen gerodet wird, die an sich dafür ausgezeichnet<br />
geeignet sind, selbst, wenn das Potenzial noch gar<br />
nicht wirklich ausgelotet ist, weil halt zufällig die falsche<br />
Rebsorte draufsteht. Selbst für den Grünen<br />
Veltliner gibt’s sicher Enklaven,<br />
wo der wirklich gut werden kann.<br />
Natürlich nicht im Seewinkel, sondern<br />
im nördlichen Burgenland, da verschwindet<br />
der Weißwein in einem<br />
atemberaubenden Tempo. Allein im<br />
letzten Jahr sind im Bezirk Neusiedl,<br />
also dem Weinbaugebiet Neusiedlersee,<br />
800 Hektar Rotwein dazugekommen.<br />
500 Hektar Weißwein sind dafür<br />
gerodet worden, zum Großteil ohnehin<br />
Sorten, um die’s nicht schad’ ist, wie Veltliner, Riesling oder<br />
Goldburger, zumindest hier im Seewinkel. Hingegen ist es<br />
uns durchaus ein Anliegen, dass die Weißweinkultur im<br />
Burgenland weitergepflegt wird und nicht verloren geht.<br />
Ich erinnere an Tibor Szemes, der mir in einem Interview gesagt<br />
hat: Er versteht nicht, wieso sich das Burgenland die Weißweinkompetenz<br />
ohne Gegenwehr hat wegnehmen lassen.<br />
Da muss man natürlich sagen, dass das Burgenland Niederösterreich,<br />
der Steiermark – und freilich auch Wien –<br />
gegenübersteht, die samt und sonders klassische Weißweinregionen<br />
sind, mit großen Weinen auch im internationalen<br />
Vergleich. Da ist das Burgenland immer ein wenig abseits<br />
gestanden, auch weil die Struktur der Weine anders ist (sieht<br />
man von den winzigen Weißweininseln im südlichen Burgenland<br />
ab, die schon steirische Anmutung zeigen). Aber Ende<br />
der 80er Jahre, als plötzlich die leichten, frischen, jungen<br />
Weißen in Mode kamen, hatte das Burgenland dem nichts<br />
entgegenzusetzen. Und im Bereich der fülligen und<br />
kräftigen Weißen ist unsere doch etwas andere Stilistik<br />
und Struktur nicht ganz so rezipiert worden,<br />
wie wir uns das gewünscht hätten. Vielleicht sind<br />
wir auch selber schuld, wer weiß.<br />
Die Velichs sind Spezialisten für barriqueausgebauten<br />
Chardonnay. Umgekehrt hört man viel vom „unoaked“ Chardonnay,<br />
also solchem ohne Holz?<br />
Vielleicht fehlt dem reinen Edelstahl-Chardonnay eine Facette,<br />
aber das ist nicht der Punkt: Viel wichtiger ist die Frage des<br />
„Wie?“ beim Holzfassausbau. Die Gegenströmung gegen<br />
eichenüberladene Chardonnays war hauptsächlich gegen<br />
solche gerichtet, die nicht nach dem Stand der Technik ausgebaut<br />
worden sind. Und dazu gehört einfach die Vergärung<br />
im Fass selbst, das Lager auf der Hefe, die Batonnage, also<br />
das Aufrühren. All das fehlt den Stahltankchardonnays. Dazu<br />
kommt eine rasche Vergärung mit Reinzuchthefe, ein reduktiver<br />
Ausbau, um möglichst früh auf die Flasche zu kommen<br />
– zu all dem braucht man in Wahrheit keinen Chardonnay.<br />
Andererseits verkauft sich eine Flasche, auf der Chardonnay<br />
draufsteht, leichter, als wenn etwa Welschriesling draufstünde.<br />
Freilich, aber da kann auch Sauvignon stehen, und er verkauft<br />
sich leichter. Aber damit der Chardonnay sein volles Potenzial<br />
„Der Wein muss im Holz vergären. Wenn man fertigen Wein<br />
im Barrique lagert, schmeckt er, wie’s in der Tischlerei riecht.“<br />
ausspielt, dazu braucht er die richtige Unterstützung von<br />
Hefe und Holz – zumindest sind wir für unsere Region davon<br />
überzeugt.<br />
Gibt’s eine Trendänderung bei den besten holzausgebauten<br />
Weißen, weg von der Wucht, hin zur Eleganz?<br />
Was wir tun – übrigens nicht nur beim Chardonnay, sondern<br />
beispielsweise auch beim Welschriesling –, ist, dass wir sehr<br />
reifes Traubenmaterial anstreben, das im Holz vinifiziert<br />
wird, das möglicherweise auch zwei Jahre auf der Feinhefe<br />
im Holz liegt. Grad beim Welschriesling sind wir dabei, das<br />
auszuloten, übrigens ausschließlich mit gebrauchten Fässern.<br />
Bekanntlich hat die Welschrieslingskala zwei starke Enden<br />
– die leichte, frische Variante und die edelsüße –, aber in der<br />
Mitte hapert’s. Normal Ausgebaute mit 13 % will keiner. Wir<br />
glauben, dass da einiges drin ist. Aber insgesamt stimmt das<br />
auf jeden Fall: Wir haben beim heurigen 2002er „Tiglat“ (dem<br />
Top-Chardonnay des Hauses) nur mehr 40 % neue Fässer verwendet.<br />
Wir waren aber nie Eichenfanatiker – die Frucht<br />
muss in jedem Fall erhalten bleiben.<br />
Hängen Intensität und Dauer des Holztons nicht auch davon ab,<br />
ob man im Barrique vergärt?<br />
Und ob. Wenn man den fertigen Wein darin lagert, schmeckt<br />
er, wie’s in der Tischlerei riecht, und das ändert sich auch nimmer.<br />
Wenn aber der Wein im Holz vergärt, ergibt<br />
sich durch die CO 2 -Entwicklung eine völlig andere<br />
Interaktion mit dem Holz, da werden Polyphenole<br />
polymerisiert, ähnlich wie beim Rotwein, wenn<br />
auch natürlich mit anderen aromatischen Komponenten,<br />
weil ja der Weiße deutlich weniger<br />
Gerbstoff mitbringt. Und die Hefe spielt natürlich<br />
auch mit. Früher hat man filtrierte Weine ins<br />
Barrique getan, das kann ja nichts werden. 1990<br />
haben wir das einzige Mal damit experimentiert<br />
– eine Charge im Holz vergoren, die andere nachher<br />
eingefüllt –, und dann nie mehr wieder, denn<br />
das Ergebnis war völlig eindeutig. Beim Ausbau des fertigen<br />
Weins im Holz stehen Wein und Holz nebeneinander, und<br />
zwar auf immer. Und mit längerer Lagerung wird der nur<br />
trauriger. Bei holzvergorenen Weinen ist vom vordergründigen<br />
Holz nichts mehr zu spüren, das ist zu einer Einheit<br />
verwachsen. Ganz ähnlich übrigens wie bei großen weißen<br />
Burgundern, wo nach fünf, sechs Jahren der Wein im Vordergrund<br />
steht, der Boden, auf dem er gewachsen ist. Das ist<br />
auch der Unterschied zur Aromatisierung mit Eichenchips.<br />
Da ist’s dann zur Aromatisierung mit Aromen nimmer weit.<br />
Andererseits: Wenn Länder der Neuen Welt Billigweine mit<br />
Eichenaroma um fünf oder sechs Euro in die Regale der Supermärkte<br />
stellen können, fragen sich traditionelle Winzer zu<br />
Recht: Haben wir das notwendig?<br />
Da stellt sich die Frage: Wohin wollen wir? Welchen Weg<br />
wollen wir beschreiten? Klar, für uns ist’s eher einfach, aber<br />
wenn das Weinland Burgenland so etwas wie eine Corporate<br />
Identity haben will, führt an der Frage kein Weg vorbei. Beim<br />
Rotwein hieße das: Versuche ich, Weine der neuen Welt zu<br />
kopieren? Dann wird das Scheitern kläglich sein, weil die unter<br />
anderen Voraussetzungen und mit anderen Betriebsstrukturen<br />
arbeiten. Oder ich besinne mich darauf, was ich kann, nämlich<br />
individuelle und authentische Weine zu erzeugen, die<br />
als solche auch erkennbar sind, wenn man hineinriecht: Ein<br />
knackiger Blaufränkischer im 70-, 80-Schilling-Bereich, so<br />
was hat Sinn. Den großen Ländern<br />
nachzuhüpfen hingegen, das führt<br />
uns auf den Holzweg.<br />
Ich habe eine gewisse Schwierigkeit mit<br />
dieser Argumentation. Einerseits die<br />
Betonung der Regionalität – und andererseits<br />
räumen die Velichs in extrem<br />
frankophon geprägten Blindproben<br />
wie zuletzt in Belgien mit dem Chardonnay<br />
alles ab.<br />
Das ist aber leicht zu beantworten.<br />
Chardonnay wird ja bei uns nicht<br />
angebaut, weil er Mitte der 1980er Jahre plötzlich extrem in<br />
Mode gekommen ist, sondern nachweislich seit 100 oder 150<br />
Jahren, vielleicht sogar wesentlich länger. Wenn man mit alten<br />
73
Heinz und Roland Velich<br />
Winzern in Rust spricht oder mit den Kellermeistern von<br />
Halbturn, wo’s Aufzeichnungen gibt, dann merkt man rasch:<br />
Die Sorte war immer schon da und hat sich hier bewährt,sowohl<br />
im Anbau als auch in der Qualität der Weine.<br />
Andererseits: Wir haben für die „Collection Taubenkobel“<br />
eine Sonderfüllung gemacht, bei der wir vom reinen Chardonnay<br />
weggegangen sind. Es ist also keineswegs gesagt, dass<br />
der „Tiglat“ immer ein reiner Chardonnay bleiben muss. Wir<br />
denken da sehr intensiv darüber nach. Linie und Charakter<br />
sollen natürlich erhalten bleiben. Es glauben uns zwar nur wenige,aber<br />
wir versuchen doch,so gut es geht,das Terroir in Szene<br />
zu setzen, den Boden, den’s hier gibt, bei den Weinen herauszuarbeiten.<br />
Wenn man zwei- oder dreijährigen<br />
„Tiglat“ trinkt, sind da schon Nuancen<br />
drinnen, die man woanders nicht findet.<br />
Das mag teilweise auf die Vinifizierung<br />
zurückzuführen sein, aber sicher auch auf<br />
Boden und Klima. Wir wollen bewusst<br />
burgenländische Chardonnays machen,<br />
seewinklerische Chardonnays von mir aus<br />
– die Rebsorte ist ja nur ein Parameter unter<br />
mehreren und sicher nicht der wichtigste.<br />
Wir wären mit dem „Tiglat“-Weingarten,<br />
den unser Vater 1961 mit „Weißburgunder-<br />
Morillon“ ausgesetzt hat, auch zufrieden gewesen, wenn’s ein<br />
Pinot Blanc gewesen wäre. Es war halt Chardonnay – mehr<br />
oder weniger zufällig.<br />
Was die Sache mit Belgien betrifft, das kam so: Unser Händler<br />
in Brügge hat vor etwas über einem Jahr gemeinsam mit<br />
einem bekannten Journalisten, eine Verkostungsserie – blind<br />
– zum Thema Chardonnay aus aller Welt organisiert. Am ersten<br />
Tag kamen die Sommeliers der großen Häuser, am zweiten<br />
Tag die Weinfreaks, die sind wie bei uns, die kennen alles<br />
und wissen alles. Jeder sollte einen Top-Chardonnay mitbringen,<br />
wir haben ’97 „Tiglat“, „Darscho“ und OT Reserve<br />
mitgehabt. Da war alles dabei, was Rang und Namen hat, Les<br />
Perrières von Coche-Dury, Comte Lafon und derlei. Am ersten<br />
Tag hat nach der Auszählung „Tiglat“ gewonnen, und „Darscho“<br />
war Dritter oder Vierter. Wobei es nicht um Punkte ging,<br />
sondern um Fragen wie: Welcher Wein hat das meiste Terroir,<br />
welcher schmeckt am besten, an sich ein gutes System. Am<br />
zweiten Tag waren dann „Tiglat“ und Reserve vorn, „Darscho“<br />
war Dritter oder Vierter. Und dieses Votum war so eindeutig,<br />
dass sich die Leute schon gefragt haben: Wie gibt’s das? Und<br />
noch dazu, weil die Skepsis gegenüber unseren Weinen a priori<br />
ganz enorm war. Aber die Leute sind nicht angestanden, ihre<br />
Meinung völlig zu revidieren. Und das hilft natürlich, international<br />
ernst genommen zu werden.<br />
In Sachen Malolaktik: Wird der biologische Säureabbau immer zu<br />
100 % angestrebt?<br />
Das kommt sehr drauf an. Grundsätzlich stehen wir dazu, und<br />
wenn ein Wein länger reifen können soll, dann auf jeden Fall.<br />
Andererseits gibt’s natürlich extreme Jahre wie 1992, wo’s<br />
besser ist, den biologischen Säureabbau wegzulassen – der<br />
erfolgt ja in solchen Jahren ohnehin zum Großteil bereits am<br />
Stock, solche Jahrgänge haben a priori einen sehr geringen<br />
Apfelsäureanteil. Aber in Jahrgängen wie 2002, wo die Säure<br />
schon sehr präsent ist, ist der Säureabbau das Um und Auf.<br />
Außerdem darf man nicht vergessen: Wir machen Weine im<br />
ursprünglichen Sinn, nämlich als Essensbegleiter. Und da<br />
fördert der Säureabbau die Bekömmlichkeit ungemein. Nach<br />
meinem Gefühl passen junge Weine mit forscher Säure nicht<br />
unbedingt zu jedem Gericht. Sie sind deutlich weniger universell<br />
einsetzbar als Weine mit biologischem Säureabbau, noch<br />
dazu, wenn sie vielleicht zwei oder drei Jahre alt sind. Das gilt<br />
übrigens genauso für große Veltliner und Rieslinge aus der<br />
Wachau: Wenn die vier oder fünf Jahre alt sind, passen sie<br />
zum Essen wesentlich besser als in ihrer Jugend.<br />
Im Übrigen: Wir bieten solche Weine a priori<br />
einmal an. Wir waren nie in der Situation wie<br />
viele andere, die alle Farben, Sorten und Qualitätsstufen<br />
im Programm hatten – und haben<br />
mussten. Wir waren in der glücklichen Lage<br />
eines kleinen Weinbaubetriebs mit drei, vier<br />
Rebsorten und nicht mehr. Die Leute, die das,<br />
was wir machen, haben wollen, die kaufen das.<br />
Was aber nicht bedeutet, dass wir deshalb<br />
eine enge Sicht der Dinge haben. Wir trinken<br />
wesentlich mehr Weine als nur die<br />
eigenen: Wachau, Südsteiermark, Elsass,<br />
Italien, Frankreich – Weiße, aber auch Rote.<br />
Wenn wir heute Lust auf einen fünf- oder<br />
zehnjährigen Clos Ste Hune von Trimbach<br />
haben, dann gehen wir in den Keller und<br />
holen eine Flasche. Das macht Freude, und so gehören Weine<br />
auch eingesetzt: zu bestimmten Gerichten, zu bestimmten<br />
Anlässen.<br />
Ich deute das als Plädoyer für den gereiften Wein. Damit sieht’s<br />
aber in der Gastronomie nicht so toll aus?<br />
Aber es fängt langsam an und greift immer mehr um sich.<br />
Klar, der Druck seitens der Gäste ist enorm – es hängt aber<br />
auch damit zusammen, dass viele Gäste reifere Weine noch<br />
nicht verstanden haben. Da muss sich die Gastronomie –<br />
und sie tut’s ja ohnehin immer mehr – ihrer Dolmetschfunktion<br />
gegenüber dem Gast bewusst werden und ihm<br />
reifere Weine richtiggehend erklären. Ein schönes Beispiel<br />
„Winzer und Gastronomen leben in einer Symbiose. Wer<br />
sonst als die Topgastronomie soll denn die Schaufensterfunktion<br />
ausüben und gereifte Weine anbieten?“<br />
der jüngeren Zeit ist Klaus Piber, der seit kurzem<br />
bewusst auch reifere Weine in den glasweisen<br />
Ausschank einbezieht. Ich erinnere mich an<br />
einen Bründlmayer’schen Lamm 1995 im<br />
„Indochine“ – der reife Veltliner war schlicht<br />
und einfach perfekt.<br />
Ich erinnere mich an eine heftige Diskussion,<br />
die ich an der Bar vom Seehotel in Rust mit Karl<br />
Seiser („Meinl am Graben“) und Walter Eselböck („Taubenkobel“)<br />
vom Zaun gebrochen habe: Ihr habt zu wenig reife<br />
Weine. Ihr beide (bzw. Christian Petz) macht große Küche,<br />
aber es gibt zu wenig passende Weine dazu. Es wär’doch viel<br />
schöner, wenn diese grandiosen österreichischen Gerichte<br />
mehr passende Begleiter hätten. Der Widerstand war beträchtlich<br />
und die Argumentation verständlich: einerseits die Kostenfrage<br />
und andererseits das Unverständnis des Publikums.<br />
Die trinken zu Hause die gereiften Flaschen und wollen dort<br />
was Neues probieren. Und noch ein Argument: Österreichische<br />
Weiße haben Weltgeltung, das spricht sich immer mehr<br />
herum. Wer sonst als die Topgastronomie soll denn die Schaufensterfunktion<br />
ausüben, wenn jemand beispielsweise eine<br />
93er Schütt von Knoll trinken will? Das Resultat nach eineinhalb<br />
Jahren: Bei „Meinl am Graben“ gibt’s plötzlich eine<br />
Altweinkarte, und auch bei Eselböcks mehren sich die Empfehlungen<br />
reiferer Jahrgänge.<br />
Was ich damit auch sagen möchte: Winzer und Gastronomen<br />
leben in einer Symbiose, bei der Erfahrungsaustausch absolut<br />
notwendig ist. Gemeinsam muss man bewerkstelligen,<br />
dass der Gast zu einem tollen Abend kommt. Wenn ich beispielsweise<br />
an die Auberge de l’Ill denke, an die Haeberlins<br />
in Illhaeusern – dort arbeitet der Sommelier Serge Dubs mit<br />
einer Weinkarte, da stehen alle Granaten, von Zind-Humbrecht<br />
bis Clos Ste Hune, mit zehn bis 15 Jahrgängen bis weit in<br />
die 70er Jahre zurück drauf. (Im Übrigen haben wir Wein<br />
dorthin geliefert, wir sind die einzigen Österreicher auf der<br />
Karte.) Wenn ich dran denke, wer hat das bei uns? Gut, ich<br />
akzeptiere die Gegenbeispiele, Josef Knoll, Klaus Wagner, der<br />
„Eckel“ und der „Döllerer“ fallen mir ein – aber es könnten<br />
(und sollten) mehr sein. Beim Süßwein allerdings schaut’s<br />
mit Vertikalen ganz schlecht aus, was eigentlich unverständlich<br />
ist, weil jeder weiß, dass sich Süßwein hält.<br />
Das ist der Punkt, wo man eine kulturell-kulinarisch-gastronomische<br />
Diskussion lostreten müsste.<br />
Das Bewusstsein in der Richtung Edelsüßwein ist<br />
leider extrem schwach ausgeprägt. Wenn ich Kunden<br />
und Gäste aus Italien oder Frankreich anschaue,<br />
wie sehr die Süßwein schätzen und als phantastisches<br />
Produkt ehren (und verehren), da sind wir<br />
in Österreich in der Situation, dass auf diesem<br />
Sektor viel zu wenig passiert ist und nach wie vor<br />
passiert. Das liegt natürlich an dem Umstand, dass<br />
wir als vergleichsweise kleines Land nicht nur<br />
große Qualitäten,sondern auch Quantitäten dieser Spezialitäten<br />
keltern können. Das macht das Ganze ein wenig inflationär,<br />
und jeder sieht den Süßwein halt als Süßwein – und nicht als<br />
Weltklassespezialität, die er international ist. Wenn man an<br />
74 75
Heinz und Roland Velich<br />
76<br />
Sauternes denkt, und dass es eine besondere Ehre ist, einen<br />
Climens, Rieussec oder Yquem zu trinken, dieses Verständnis<br />
fehlt völlig. Es hängt natürlich auch mit unseren kulinarisch-önologischen<br />
Konsumgewohnheiten zusammen, und<br />
da will ich uns Winzer gar nicht ausnehmen, wir sollten da<br />
ruhig anfangen, vor der eigenen Türe zu kehren. Wir essen<br />
also Vorspeise, Suppe, Fisch, Hauptgang und so weiter, man<br />
trinkt Wein dazu – und wenn es eigentlich aus sein sollte, ist<br />
der Punkt gekommen, wo man gern noch eine Flasche Wein<br />
trinkt. Auf die Idee, zum Dessert eine Flasche Süßwein zu bestellen<br />
und dann aufzustehen und zu sagen: Wunderbar, das<br />
war’s, maxmimal noch Kaffee – das tut keiner. Da bleibt man<br />
eher in der Runde sitzen und trinkt noch eine Flasche oder<br />
zwei – zum Wohle unserer Wirten, aber zu Lasten unserer<br />
Edelsüßen. Dieses Selbstverständnis des Essens und Trinkens,<br />
wie’s die romanischen Länder kennen, das haben wir in dieser<br />
Form nicht. Wenn ich an das Selbstbedienungsrestaurant<br />
am Pariser Flughafen denke, wo sich ein alter Herr zu seiner<br />
Gänseleber, seiner Hauptspeise und dem Dessert völlig natürlich<br />
eine Flasche Wein nimmt – das gäb’s bei uns nicht.<br />
Historisch gesehen: Hatte der Edelsüßwein früher einen höheren<br />
Stellenwert?<br />
Freilich. Die Weine waren teuer und geschätzt. Wir merken’s<br />
ja selbst,wenn die Leute zu uns kommen. Jeder sagt: „Süßwein?<br />
Nein, danke!“ Aber jeder probiert ihn und kauft ihn auch; eben<br />
weil die Leute ein gänzlich anderes Vorstellungsbild von<br />
Süßwein haben. Nicht zuletzt,weil Süßwein bei uns leider auch<br />
als Massenprodukt gesehen wird. Da gefällt mir René Gabriel,<br />
der die heftige Empfehlung abgibt, immer eine kleine Flasche<br />
Süßwein im Eiskasten zu haben – und sie dann zum Dessert,<br />
zur Kaffeejause oder einfach zur blauen Stunde herauszunehmen.<br />
Übrigens ist Süßwein konzentriert genug, Kaffee<br />
auszuhalten.<br />
Mit ein Hindernis ist auch die Bezeichnung „Süßwein“. Zu<br />
„süß“ fällt einem höchstens „klebrig“ ein. Aber es ist schwierig,<br />
da ein neues Wort zu finden oder zu erfinden. Uns würde natürlich<br />
„Ausbruch“ vorschweben, aber da wollen wir den Winzern<br />
vom anderen Seeufer nicht in die Quere kommen. Die<br />
machen das mit „Ausbruch“ und „Essenz“ sehr gut, was außerdem<br />
ja auf den ungarischen Konnex hindeutet, der ja jahrhundertealt<br />
ist. Wir haben’s dem Robert Wenzel vorgeschlagen,<br />
der geantwortet hat: „Wissen Sie, das hätten wir so gern<br />
für uns allein“ – was auch verständlich ist. Also müssen wir<br />
vorderhand mit Beerenauslese und Trockenbeerenauslese<br />
leben. Vielleicht kann man’s zu einer gewissen „Marke“ entwickeln,<br />
ähnlich wie’s beim „Tiglat“ irgendwie auch gelungen<br />
ist. Und vielleicht können wir auch von der bisherigen Nomenklatur<br />
der Süßepyramide weg-<br />
kommen, wer weiß, so was wie<br />
die Goldkapsel in Deutschland.<br />
Unsere Beerenauslese, die’s<br />
inzwischen auch in einer nicht<br />
ganz unbeträchtlichen Menge<br />
gibt, müssen wir als solche<br />
bezeichnen, obwohl sie in Summe in der Rückrechnung eine<br />
TBA wäre; und zwar deshalb, weil ein paar Chargen mit 28,<br />
29 °KMW dabei sind und 30 °KMW das Minimum für die TBA<br />
sind. Es sind auch Chargen mit 35 und 36 ° dabei, wobei der<br />
Durchschnitt immer bei 30 bis 32 °KMW liegt, zumindest<br />
streben wir das an. Vinifikatorisches Ziel ist eine trinkfreundliche<br />
Balance zwischen Alkohol (12,5 bis 13 %) und<br />
Zuckerrest (100 bis 140 g/l), und dazugehört auch der Ausbau<br />
im Holz, eineinhalb bis zwei Jahre. Ein wenig schwebt uns<br />
die Eleganz der Süßweine von der Loire,aus der Chenintraube,<br />
und deren eminente Trinkfähigkeit vor. Das ist das Ziel – und<br />
nicht die größte Konzentration und die üppigste Opulenz um<br />
jeden Preis. Trinkcharme und ein Preis,der für die Gastronomie<br />
den glasweisen Ausschank kalkulierbar macht, sind die Parameter,<br />
um die’s uns geht, denn wenn man zu zweit Essen geht,<br />
bestellt man sich keine Flasche.<br />
Tatsache ist, dass uns die Welt um die Qualität und Quantität<br />
unserer Süßweine beneidet, dass wir aber beträchtliche Mühe<br />
haben, diese Weine zu vermarkten. Nicht nur die Erzeugung,<br />
sondern auch die Vermarktung ist kosten- und zeitintensiv,<br />
die Konkurrenz schläft auch nicht,und es ist anstrengend,weil<br />
er in seiner Gesamtheit im Inland nicht absetzbar ist.<br />
Worauf wir noch Wert legen: Weder wird ein Weingarten auf<br />
höheren Ertrag für Süßwein angeschnitten, noch bringen wir<br />
Kali- oder Stickstoffdünger aus (das erhöht die Botrytisanfälligkeit),<br />
noch arbeiten wir mit Sprinkleranlagen, um in<br />
trockenen Herbsten die Entwicklung<br />
zu beschleunigen. Und wir<br />
haben auch nicht den Druck, unbedingt<br />
jedes Jahr Süßwein zu<br />
machen. Wir wollen einfach nichts<br />
erzwingen. Wenn das Jahr, wie<br />
2000, sehr trocken ist, lassen wir<br />
lieber die Trockenbeerenauslese<br />
aus, damit die Qualität der Beerenauslese<br />
gleichmäßig hoch bleiben<br />
kann.<br />
„Auf die Idee, zum Dessert eine Flasche<br />
Süßwein zu bestellen und dann aufzustehen<br />
und zu sagen ,danke das war’s‘<br />
kommt bei uns niemand.“