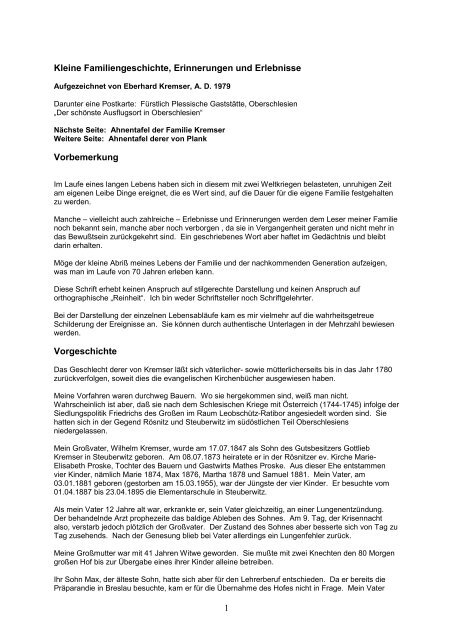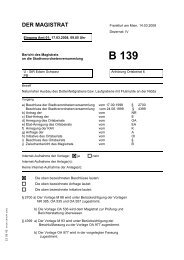Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Obergärtner in einer Firma der Gartengestaltung in Magdeburg. Von dort aus wurde im November1907 die Verlobung mit Fräulein Martha Fritsch gefeiert.Die Verlobungsanzeigen lauten:„Meine Verlobung mit Fräulein Martha Fritsch, Tochter des Kaufmanns Herrn Otto Fritsch und seinerGemahlin Emilie, geb. Zimmer, beehre ich mich anzuzeigen. Magdeburg-Neustadt, im November1907, Samuel Kremser.Die Verlobung meiner Tochter Martha mit dem Obergärtner Herrn Samuel Kremser in Magdeburg-Neustadt beehren wir uns ergebenst anzuzeigen. Gross-Wartenberg, im November 1907 (Bez.Breslau), Otto Fritsch und Frau, Emilie geb. Zimmer.“Am 1. November 1908 erhielt mein Vater in Weimar/Thüringen eine Stellung als Leiter derGartenbauschule für Frauen. Das war die Stellung, die ihm die Gründung einer Familie ermöglichte.Am 1. März 1909 starb mein Großvater Otto Fritsch. Der Weg zur Verehelichung war nun frei. MeineEltern fanden in Weimar in der Amalienstraße eine schöne 2-Zimmerwohnung, die sie sich gemütlicheinrichteten.Am 17.08.1909 fand die Trauung in Groß-Wartenberg statt, wo auch meine Steuberwitzer Großmutterzugegen war. Sie wurde wegen ihrer ländlichen Kleidung (oberschlesische Tracht) und wegen derlangen Zöpfe, die teilweise in Oberschlesien getragen wurden, belächelt. Das muß sie sehr gekränkthaben. Da die Geschwister meiner Mutter leider nicht so feinfühlend waren und wohl Spott mit ihrtrieben, hat sie dieses Gebaren ihr lebenlang nicht vergessen. Ob meine Mutter während ihrerBrautzeit in Steuberwitz war, ist mir nicht bekannt. Ich hatte immer den Eindruck, daß Vater seinebäuerliche Herkunft der Groß-Wartenberger Sippschaft wohlweislich verborgen hielt.Mutter löste sich also schweren Herzens von der elterlichen Geborgenheit und vertauschte sie nun mitder Einsamkeit der neuen Umgebung. Dies ist ihr sehr schwer gefallen, zumal sie den „Umtrieb“ beider großen Familie und den Umgang mit der Kundschaft abrupt verlassen hatte. An Markttagennämlich kamen zahlreiche Bauern aus dem benachbarten Polnisch-Rußland (Bralin – Kepno) um sichhier preiswerte Textilien zu holen. Die Grenze war in unmittelbarer Nähe. An solchen Tagen war imLaden viel zu tun, und die Kinder mußten mithelfen zu bedienen. Das fehlte nun der Mutter.Kinder- und Schulzeit: <strong>1910</strong> - 1926Auf der ersten Seite steht eine handschriftliche Ankündigung des Samuel Kremser: „Die amDonnerstag dem 4. August nachmittags 7 Uhr erfolgte Entbindung Marthas von einem kräftigen,gesunden Jungen, teilen wir Euch hocherfreut mit. Mutter und Kind befinden sich wohl. Weimar,04.08.<strong>1910</strong>, M. + S. Kremser.“II. Kinderzeit und JugendjahreAn einem Donnerstag, dem 4. August <strong>1910</strong>, erblickte ich das Licht der Welt. Mit den Namen meinerGroßväter wurde ich mit den Vornamen Otto, Wilhelm und dem Rufnamen Eberhard getauft. Vonmeiner Taufpatin, der Freiin von Loen, 1. Vorsitzende der Gartenbauschule, bekam ich alsTaufgeschenk ein silbernes Kinder-Eßbesteck.Von meinen Kinderjahren weiß ich heute nichts mehr. Ganz fern kann ich mich an Weimar nurerinnern, daß mir meine Mutter Brote eingepackt vom 2. Stock mir in den Hof warf, wo ich spielte.Warum Vater die einstmals so gute Stellung aufgegeben hat, um im Bureau für Gartenarchitekturweiter zu arbeiten, ist mir unbekannt. Später aber übersiedelte die Familie nach Trittau-Hamfelde (?)bei Hamburg, wo mein Vater bei Albert Ballin, Generaldirektor der Hapag Amerika-Linie, auf seinemGut als Obergärtner tätig war. Dort verbrachten wir die ersten Kriegsjahre 1914 und 1915. Dort hatuns Oma aus Groß-Wartenberg und ihr Sohn Emmo während eines Fronturlaubes besucht. Emmo istEnde 1915 leider in Kurland gefallen.Am 12. Juli 1915 hat mein Vater seine berufliche Tätigkeit unterbrechen müssen, weil er zumHeeresdienst eingezogen wurde. Da er des Lungenfehlers wegen nicht fronttauglich war, hatte er3
lediglich Munitionszüge an die Front zu begleiten. Während seiner Militärzeit hatten wir eine kleineWohnung in Hamburg-Altona bezogen.Noch während Vaters Zeit bei Ballin, hatte sich Vater auf eine Annonce einer Fachzeitschrift beimFürsten von Pleß um eine lukrativere Stellung beworben Die Stelle bei Ballin muß ihm nicht so rechtzugesagt haben. Außerdem hatte Mutter dem Vater dauernd in den Ohren gelegen, wieder in die alteHeimat nach Schlesien zurückzukehren.Vater wurde zum Glück aus einer Vielzahl von Bewerbern zur Besetzung der Obergärtnerstelleauserkoren und eingestellt. Vom Militärdienst wurde er vorerst mit der Maßgabe befreit, daß er nur fürden Zweck des Dienstantritts bei der Fürstlich Pless’schen Bergwerksdirektion Kattowitz,Oberschlesien, beschäftigt bleibt. Es heißt in seinem Militärpaß weiter: „Legt Kremser seine Arbeitnieder, oder wird er von der obengenannten Firma entlassen, hat er sich sofort bei demBezirkskommando Rybnik zu melden, damit er seinem Truppenteile wieder zurückgeführt werdenkann.“Am 6. Dezember 1916 hat Vater seine Stellung in Emanuelssegen bei Kattowitz als Obergärtnerangetreten.(Hinweis: Das war vermutlich ein geschickter Schachzug. Wie der Reichskanzler Bernhard vonBülow in seinen Denkwürdigkeiten schildert, waren sowohl Ballin als auch der Fürst von Pleß Freundedes Kaisers.)Zuvor ist jedoch ein entscheidendes Ereignis eingetreten, das meine Mutter zutiefst getroffen hat.1916 grassierte in Schlesien die Influenza (Grippe), der meine Großmutter (Fritsch) am 16. Januar1916 und einige Wochen später Mutters älteste Schwester Helene zum Opfer fielen.Wir fuhren daher nach Groß-Wartenberg zur Beerdigung und verbrachten dort einige Monate um denNachlaß zu ordnen. Außerdem hatte Mutter sich vorübergehend um die vier Kinder der erst kürzlichverstorbenen Schwester zu kümmern. Die Kinder waren noch klein – etwa in meinem Alter –, dieversorgt werden mußten. Das war für mein Mutter eine große Aufgabe. Onkel Adolf Wobst war durchden Tod seiner Frau Helene untröstlich, so daß auch er Beistand haben mußte.Was aus Großmutters Möbeln später geschah, – während unseres Aufenthaltes in Groß-Wartenbergwohnten wir in ihrer Wohnung -, weiß ich heute nicht mehr. Jedenfalls weiß ich soviel, daß dasGeschäft mit dem Haus verkauft wurde, weil der älteste Sohn Emmo gefallen war, und er zurÜbernahme nicht mehr da war. Onkel Emil, ebenfalls Kaufmann, heiratete seine Braut in Greiz inThüringen, wo er seine neue Heimat fand. Onkel Erwin war Konditor, auch er kam dafür nicht inFrage.(Hinweis: Den Onkel Erwin besuchten wir einmal in Kronberg, wo ich Micky-Maus-Heftchen las. MeinVater hatte ein gespaltenes Verhältnis zu den Fritschens, die als ziemlich egoistisch galten. Dazukam, daß meine Mutter für ihre Schwiegermutter Martha nicht standesgemäß war!)Onkel Adolf Wobst hatte eine Tonwaren-Fabrik. Als kleiner Bub sah ich den „Töpfern“ gern zu, wieaus einem Klumpen Ton eine Kanne entstand. (Hinweis: Drei blaue Vasen von dieser Töpfereistehen in Zöbingen im Wohnzimmer.)Ich erinnere mich noch genau, wie wir Anfang Dezember 1916 von Hamburg nach Kattowitzübersiedelten. Emanuelssegen war eine Bergwerkskolonie, die vom Fürsten von Pleß gegründetwurde. Im Ort (eine selbständige Gemeinde) waren ein Kaufhaus, ein Gasthaus, eine Fleischerei undBäckerei vorhanden. Die Bewohner hatte alle durchweg mit dem Bergbau zu tun. Im Kreis Pleß gabes die beste Kohle, meist Anthrazit, die aus einer Sohle von 1100 m Tiefe gefördert wurde. Der KreisPleß hatte 10 Fördergruben mit entsprechend 10 Bergwerkkolonien. Sie waren reichlich mitGrünanlagen ausgestattet, die für die Erholung der dort tätigen Bergleute gedacht waren. Der Fürstwar ein sozial denkender Mensch, der viel auf das Wohl seiner Leute bedacht war. Deswegen legteer großen Wert auf die Erhaltung und auf den weiteren Ausbau der Grünflächen innerhalb derKolonien. (Hinweis: Der Fürst von Bülow sprach aber von dem asiatischen Luxus des Fürsten vonPleß.)Mein Vater hatte also die Aufgabe, eine zentrale Gartenverwaltung in Emanuelssegen aufzubauen.Sie hatte den Zweck alle 10 Bergwerkskolonien mit Pflanzen und Bäumen zu versorgen. Zur4
Überfwachung der Grünanlagen stand Vater eine Kutsche mit Gespann zur Verfügung. Ich bin alsKind oft mit ihm gefahren, wenn Vater Inspektion machte. In Emanuelssegen entstand eine großeAnzuchtsgärtnerei und eine Baumschule.Und nun zu unserem Umzug.Vater hatte uns mit einer Kalesche vom Bahnhof abgeholt. Der Bahnhof war vom Dorf etwa 20Gehminuten entfernt. Für mich war die Gegend neu und fremd. Die Geschäftigkeit im Kohlenrevier,die oberschlesischen Kumpel mit ihrer harten Aussprache, hatten mich beeindruckt.Von Kattowitz nach Emanuelssegen waren es 11 Bahnkilometer, zu Fuß allerdings durch den Waldnur 6 km.Wir wurden bis zur Fertigstellung der Beamtenhäuser vorerst in einer Arztvilla, nahe Vaters Büro,einquartiert. Die Villa war leer, weil damals die Arztstelle nicht besetzt war. Wir fühlten uns wie im 7.Himmel. Meine Eltern ließen sogleich die in Weimar eingestellten Möbel kommen. Hier hatten wirgenug Platz um uns gemütlich einzurichten. Hier hatten wir uns schnell eingewöhnt. Es dauerte auchnicht lange und es besuchten uns Onkel Erwin, Tante Elly und Onkel Max, der damals Rektor inKattowitz war. (Hinweis: Der Onkel Max soll ein ausgezeichenter Rechner gewesen sein, der zweivierstellige Zahlen im Kopf auswendig multiplizieren konnte!)Es ging uns in Emanuelssegen nicht schlecht. Wir hatten Brennmaterial frei, soviel Kohle und Holzwie wir wollten. Zur Aufbesserung unserer Nahrungsmittel erhielten wir 2 Morgen Feld (vermutlich4000 qm) und einen großen Garten. Das Feld wurde von der Grubenverwaltung kostenlos bearbeitet.Wir brauchten nur das Saatgut zu bezahlen.Wir feierten zum ersten Male Weihnachten in unserer alten Heimat. Es war ein Weihnachtsfest, dasich als Bub bewußt „mitbekommen“ habe. Am Sylvester wurde das „Neue Jahr“ eingeschossen, einBrauch, den wir nicht kannten. Zuerst glaubten wir der Russe sei in Oberschlesien eingefallen undKattowitz nahe. Wir flüchteten deswegen in den Keller. Am nächsten Tag erfuhren wir, was sich da inder Sylvesternacht abgespielt hatte.(Hinweis Bild: Auf der Weihnachtsfeier der Familie Kremser von 1919 mit dem guten „Hausgeist“Amalie dürfte mein Vater in seinem Märchenbuch von Helene Stöckl gelesen haben, unter anderemdie von mir immer zelebrierte Geschichte „Die Glocke von Innisfare“.)Ostern kam und „Klein-Eberhard“ wurde in der Emanuelssegener Volksschule eingeschult. Die Lehrerwaren bereits seit langem eingezogen, nur 2 Lehrerinnen, nämlich Fräulein Chlorius und FräuleinKrause, unterrichteten etwa 100 Mädchen und Buben. Schule wurde unregelmäßig abgehalten.Wegen der schlechten Ernährungslage waren Kinder und Lehrerinnen sehr anfällig. Ich erinneremich, daß zu jener Zeit eine Mitschülerin, Ilse Henschelmann, die neben mir auf der Schulbank saß,innerhalb kürzester Zeit an Genickstarre (Hinweis: Meningitis cerebrospinalis epidemica,hervorgerufen durch einen Influenzabazillus) starb. Ihr Tod hatte mich so getroffen, daß ich ihr langeZeit nachtrauerte.(Hinweis: Auf dem Klassenbild vom ersten Schultag 1918 meines Vaters ist auch die IlseHenschelmann abgebildet.)Da es in Ems (Emanuelssegen) so schlecht mit der Schule stand, haben sich 5 oder 6Beamtenfamilien zusammengetan und ihre Kinder in Privatunterricht zu Frl. Chlorius geschickt.Darunter war auch ich. Sie hat uns so getrimmt, daß wir Ostern 1918 in die Oktava derOberrealschule in Kattowitz aufgenommen werden konnten.Im Laufe des Jahres 1917 wurde die schon erwähnte Beamtensiedlung fertiggestellt. Sie befand sichmitten in der Kolonie an einem Weier. Wir bekamen eine schöne 4-Zimmerwohnung zugewiesen. Zudieser Wohnung gehörte ein kleiner Stall für die Kleintierhaltung, außerdem ein etwa 500 qmNutzgarten und einen Acker, den ich bereits erwähnt habe. Als „Teilselbstversorger“ konnten wir nunHühner, ein paar Gänse, Hasen und 1 Schwein halten. Später hatten die Eltern statt der Stallhasensich Puten angeschafft. (Hinweis: Solche Selbstversorgereinrichtungen gab es bis in die 80iger Jahrenoch - vor dem Umbau - in der Eisenbahnersiedlung Nied.)5
Mutter hatte nun allerhand zu tun. Auch ich bekam mein tägliches Pensum zugeteilt. Als erstesmußte ich jeden Morgen 1 l Milch auf der Grube holen, die etwa 2 km von uns entfernt war. Viehfüttern und im Garten mithelfen war meine Aufgabe. Außer der oben erwähnten „Selbstversorgung“kam von Großmutter hier und da ein Korb, der mit einem Sackleinen zugenäht war. Das war für michimmer ein Festtag. Manchmal schickte sie uns Rauchwaren (Fleisch und Wurst), manchmal auchObst. Ein großes Fest war es auch, wenn bei uns das Schwein geschlachtet wurde. Mutter teilte dasFleisch so ein, daß der Vorrat ein ganzes Jahr vorhalten mußte. Zum „Schlachtfest“ kam regelmäßigOnkel Max aus Kattowitz um sich etwas abzuholen.Hier fällt mir eine Begebenheit ein.Mutter hatte nach dem Schweinschlachten alles schön im Keller verstaut. Eines Tages, als Mutterwieder nach dem Pökelfleisch sehen hatte, wurde sie gewahr, daß die meisten zum Räuchernvorgesehenen Fleischteile fehlten. Außerdem fehlten auch auf einer Stange aufgereihte Würste. DerVerdacht richtete sich sofort auf unser Dienstmädchen, Lena Kischka, die damals 18 Jahre alt war.Sie wurde von unserem Dorfpolizisten verhört und gab nach langem Zögern den Diebstahl zu. Siewar dazu offensichtlich von ihren Eltern angestiftet worden. Was mit dem Mädchen später passiert ist,weiß ich heute nicht mehr. Jedenfalls weiß ich heute noch soviel, daß Kischka ein Polenfreund warund daß er damals schon Vater gegenüber Rache geschworen hatte, was dann später auch zutraf.Die Arbeit für meinen Vater wurde immer umfangreicher. Neben den Verwaltungsarbeiten undtechnischen Anforderungen hatte er ja noch die gärtnerischen Anlagen in den Arbeiter- undBeamtenkolonien der Gruben Boarschächte (?), Fürstengrube, Piastschächte, Bradegrube,Prinzengrube, Heinrichsglückgrube und Trautscholdsegengrube neben der Emanuelssegengrube zuüberwachen und zu betreuen. Um ihn deshalb zu entlasten, hatte der Fürst von Pleß noch einenObergärtner (Vater wurde zum Gartenverwalter ernannt) eingestellt. Mikulla, so hieß der Mann, solltedie Anzucht von Gehölzen und Blumen übernehmen.Robert Mikulla war ein sympathischer Mann, auch ein Oberschlesier, der auch schon einen Teil der„Welt“ gesehen hatte. Er verkehrte oft bei uns zu Hause, da er Junggeselle war und sonst keineBekannte hatte, hatte er sich mit uns angefreundet.Von ihm bekam ich die ersten Anleitungen in Bezug auf Botanik und Pflanzenumgang. Ihm habe iches wohl auch zum Teil zu verdanken, daß in mir die Liebe zur Natur erwachte, die mich ein ganzesLeben nicht mehr losließ. In den Gewächshäusern durfte ich daher meine Studien betreiben. ImFrühjahr 1918 heiratetet er die Tochter unseres Schneiders Neumann. Nach der Heirat waren seinehäuslichen Besuche bei uns seltener geworden. Jahre später sollte sich die gegenseitige Sympathieins Gegenteil umkehren. Doch dazu später.Eines Tages, - ich erinnere mich noch als ob es gestern gewesen wäre -, es war der 4. Februar 1918morgens 7 Uhr in der Frühe, als der „Storch“ die Familie Kremser aufsuchte und ihr die Erika – EmilieDorothea – brachte. Ich mußte damals in die Mansarde – wo das Dienstmädchen schlief – umziehen,damit ich den Vorgang des Storchbesuchs nicht mitbekomme. Am Nachmittag durfte ich mir dasSchwesterchen betrachten. Es hatte ganz schwarze Haare und blaue Augen und man sagte damals,daß es ein schönes Kind sei. Ich fand das eigentlich nicht so.Ostern 1919 kam ich, wie schon gesagt, in die Oberrealschule zu Kattowitz. Es war für mich ein ganzneuer Lebensabschnitt. Ganz stolz war ich, als mir Mutter eine Schülermütze, grün mit silbernerKordel, kaufte. Mutter hatte ja mit ihrem Sohn so allerhand vor. In Weimar hatte sie oft studentischeVeranstaltungen und festliche Umzüge von Burschenschaften, die im festlichen Gewand und Wichsdaher marschierten in Erinnerung. Diese Erinnerungen hatten sich in ihrem Geiste so eingeprägt, daßsie sich einbildete, ihr Sohn müßte später einmal ebenso als Korpsstudent vor ihr stehen.Ich war damals knapp 9 Jahre alt. Da die Emser Schüler mit der Bahn nach Kattowitz fahren mußten(der Zug kam von Bielitz-Pleß) mußte ich täglich um 6 Uhr aufstehen, weil der Weg zum Bahnhof 20Minuten beanspruchte und der Zug um 7.20 Uhr abfuhr. Manchmal mußte ich mich sputen den Zugzu erreichen. Der nächste kam erst nach 8 Uhr in Kattowitz an. Das war für die Schule zu spät. Ichwar nicht allein, der zur Schule nach Kattowitz fuhr. Viele Freunde traf ich unterwegs, oder sie holtenmich zu Hause ab. Auf dem Bahnhof und im Zuge wurde allerhand Unsinn getrieben – wie das beiBuben halt so ist. Wir freuten uns riesig, wenn der Zug Verspätung hatte, und wir vielleicht die ersteStunde schwänzen konnten. Das kam hin und wieder mal vor. Vor allem in den Wintermonaten.6
Wir hatten 20 Minuten nach Kattowitz zu fahren. Meine Jugendfreunde waren Herbert und AlexanderMöser, ihr Vater war bei der Forstverwaltung des Fürsten von Pleß, Heinz Zazarek, der Vater hatte dieEmser Fleischerei, und Paul Pollok, dessen Vater Lok-Führer bei der Grubenverwaltung war. Wir 5Jungen waren immer zusammen und unzertrennlich. Alle 5 fuhren nach Kattowitz zur Schule, Herbertund Paul waren in meiner Klasse. Nach der Schule spielten wir bis in die Abendstunden im Wald oderauf den Feldern und Wiesen.Meine Eltern waren zu uns sehr streng. Ich mußte pünktlich um ½ 7 Uhr abends zu Hause sein zumAbendbrot. Wehe, wenn ich zu spät kam. Mit Bangen machte ich mich dann auf den Heimweg, ander Entreetür angelangt, drückte ich zaghaft auf die Klingel. Meistens gab es dann Hiebe undobendrein noch „Stubenarrest“, was für mich das schlimmste war. Wenn nämlich dann am nächstenNachmittag meine Freunde vor unserem Fenster auftauchten und sich mit Pfiffen bemerkbar machten:Mutter war dann unerbittlich. Mein Bitten und Betteln half nichts; ich mußte im Zimmer bleiben. Dashat damals meiner „Kinderseele“ sehr geschadet. Mutter machte sich zu allem Überfluß drauf unddran, mir im Rechnen und Diktat „Nachhilfeunterricht“ zu geben. Das tat weh; ein Glücksgefühl war’swenn ich dann nach Stunden davor befreit wurde. Dieser „Nachhilfeunterricht“ hat mir mehrgeschadet als genutzt.Überhaupt wurde ich zu Hause streng erzogen. Widerpart gab es nicht. Trotzdem habe ich an zuHause sehr gehangen; denn meine Mutter verstand es uns allen eine gewisse Nestwärme zu geben.Bei uns zu Hause wurde sehr gespart. Egal ob die Zeiten gut oder schlecht waren. Im Überflußhatten wir nie etwas. Ich entsinne mich, daß es bei uns am Sonntag Fleisch gab. Am Dienstag undDonnerstag gab es meistens Aufgewärmtes vom Sonntag. Montags und Samstags hatten wirmeistens Eintopf. Mittwochs Eierspeisen oder sonstige Mehlspeisen. Den Speisefahrplan kannten wirschon auswendig. Abends gab es Brot zugeteilt. Wenn es Wurst gab, war es ein Feiertag. DerSonnabendabend war was außergewöhnliches. Da hatte Mutter ein Pfund Krakauer eingekauft undabends warm auf den Tisch gestellt. Schon Tage vorher freute ich mich auf den Sonnabend.Im übrigen sind wir, Erika und ich, von den Eltern keinesfalls verwöhnt worden. An Geburtstagen oderWeihnachten gab es für uns Kinder lediglich Kleinigkeiten, die nicht „ins Geld liefen!“ Ich erinneremich, es waren Gesellschaftsspiele oder Sachen zum Ausschneiden, bunte Papierstreifen zumFlechten und Süßigkeiten. Wie gerne hätte ich als Bub’ mal eine Dampfmaschine oder eineEisenbahn (damals gab es nur solche mit Uhrwerk) als Geschenk bekommen. Wie oft stand ich inKattowitz vor dem Schaufenster der Kinderspielläden und träumte davon, daß sich der Traum erfüllte.Meine liebe Schwester Erika wurde immer größer. Meine Aufgabe war es nun Kindermädchen zuspielen. Nachmittags habe ich sie immer mit einem Kinderwagen mit großen Rädern ausfahrenmüssen. Natürlich war ich davon nicht gerade begeistert. Einmal habe ich mit dem Kinderwagenwider einmal „Puffbahn“ gespielt. Als es im „Volldampf“ in eine Kurve ging, kam der Wagen aus demGleichgewicht und meine nichts ahnende Schwester flog in hohem Bogen aus dem Wagen und lagauf der Straße. Das Malheur habe ich trotz größter Anstrengungen vor meinen Eltern nicht verbergenkönnen. Für diese Untat hat es auch etwas abgesetzt. Seitdem war ich vorsichtiger. Trotzdempassierte wenig später wieder ein Malheur mit meiner Schwester. Als ich wieder einmal für meineSchwertfische im großen Einmachglas Wasserflöhe brauchte, ging ich mit Erika zum naheliegendemTeich. Die meisten Wasserflöhe gab es am Wehr, eine Schleuse, die das Wasser zumtiefergelegenen 2. Weier abhielt. Hier fummelte ich mit dem Netz herum und schüttete das „Fanggut“in ein Glas. Während dieser Tätigkeit beugte sich Erika über die Brüstung und plumpste prompt instiefe Wasser. Vor Schreck und Todesverachtung sprang ich nach, erwischte sie und hielt sie am Kleidfest und mich am Schleusengestänge. Ein zufällig vorübergehender Arbeiter zog uns heraus. Wasfür ein Glück. Erika wäre um ein Haar umgekommen. An dieser Stelle möchte ich es mir versagen zuschildern, was danach zu Hause „los“ war.Emanuelssegen war damals für die Kattowitzer Bevölkerung wegen der sehr schönen landschaftlichenLage ein gern besuchter Ausflugsort. Da seinerzeit Autos noch eine Seltenheit waren, kamen dieAusflügler entweder mit der Bahn oder zu Fuß durch den Wald. Unmittelbar hiner dem Dorf begannder Mischwald. Von dort ging es langsam bergan bis man nach einer Wanderung von ca. ½ Stundeauf die sogenannte Erdmannshöhe kam. Von dort hatte man bei schönem Wetter eine wunderschöneAussicht auf die Beskiden und dahinter auf die Karpathen. Im Sommer kamen auch viele Ausflüglerum Pilze zu sammeln oder Blaubeeren und Preiselbeeren zu pflücken.7
Nach dem Spaziergang ging es ins Emser Gasthaus. Im ausgedehnten Gastgarten um eineKolonnade haben sich die Ausflügler nach der Wanderung gütlich getan. Wir waren auch öfters dort,weil dort immer etwas los war. Ich durfte mir sogar eine Flasche Limonade bestellen.(Hinweis: Das Gasthaus ist auf dem Titelblatt abgebildet.)Bei solchen Ausflügen bekamen wir ebenfalls öfters aus Kattowitz Besuch. Der damaligeGartendirektor Sallmann kam mit seiner Familie öfters gern zu uns um mit Vater fachzusimpeln.Familie Sallmann hatten 2 Buben in meinem Alter: Hans und Joachim. Wir spielten in derbenachbarten Baumschule „Räuber und Gendarm“ oder Versteck. Damals konnte ich freilich nochnicht ahnen, daß der ältere der beiden (Hans) später mal mein Chef in Frankfurt werden sollte.Erinnerlich ist mir jedenfalls, daß meine Eltern Sallmanns nicht gern mochten. Der alte Sallmann warsehr von sich eingenommen und geschwätzig. Deshalb wurde eine Freundschaft nicht gepflegt undwir sahen sie nicht gerne bei uns.(Hinweis: Mein Vater hat immer gesagt, daß der Frankfurter Gartenbaudirektor Sallmann ihn in seinerKarriere nicht unterstützt hat. Erst ein halbes Jahr vor der Pensionierung wurde mein Vater in denhöheren Dienst befördert, also etwas Baurat A13 oder BAT IIa. Nach meinem Kenntnisstand kanntemein Vater von der Kattowitzer Realschule auch den Direktor des Frankfurter Zoos Berhard Grzimek.)Im März 1918 war Waffenstillstand zwischen Deutschland und Rußland geschlossen worden. Es gingdeshalb im gesamten Industriegebiet Oberschlesiens ein Aufatmen los. Der Druck, die Russenkönnten das Kohlenrevier einnehmen, löste sich schlagartig.Inzwischen bezogen wir unsere 3. Wohnung in der Kattowitzer Straße. Mein Vater hatte dieseWohnung angestrebt, weil das Haus unmittelbar an dem Baumschulgelände angrenzte. Hier hattenwir die schönste Wohnung und von hier aus gehen auch meine schönsten Kindheitserinnerungen. Zudieser Wohnung gehörten auch selbstverständlich Stallungen, Hofraum und ein schönerGemüsegarten, der neben der Baumschule und dem Gewächshaus lag. Dort hatte Vater auch einenkleinen Wohngarten für uns einrichten lassen, wo wir im Sommer öfters Kaffeeklatsch abgehaltenhaben. Tante Elly kam öfters auch aus Kattowitz oder Onkel Max, wo ich öfters eine Tafel Schokolademitgebracht bekam.Hier fällt mir noch ein Erlebnis ein. Nämlich als unser guter Geist Amalie bei ihren Eltern zu Hausewar, fiel es meiner Mutter plötzlich ein, mal eine Gans zu braten. Nur mit dem Schlachten verstand siesich nicht. Das arme Vieh wurde von der Mutter eingefangen und nachdem sie das Schlachtmesseram Kopf angesetzt hatte und mit dem Schneiden begann, entwich das Tier blutend vor Todesangstaus Mutters Klauen. Voller Mitleid haben wir sie dann lange behalten, bis sie dann später doch nochin der Bratpfanne landete.Außer den Gänsen hatten wir auch ein Putenpaar. Der Puter war ein mächtiges Tier, der es immerauf die Erika abgesehen hatte. Wenn Erika in die Nähe des Puters kam, war er nicht zu bändigen.Sie, die Erika, traute sich nicht mehr ins Gehege.In unserem Haus wohnte im Parterre der Bürgermeister Jonas, im 1. Stock wir und über uns dieFamilie Mende mit 10 Kindern. Vater Mende war Hilfssteiger. Die Mendes hatten keinen guten Ruf.Meine Mutter sah darauf, daß ich mich von den Kindern, die meisten in meinem Alter, fern halte.Manchmal aber habe ich mich doch mit ihnen verdrückt. Das durfte ich allerdings nur heimlich tun.In den großen Ferien mußte ich mit Mutter entweder auf die „Pilzsuche“ oder in die „Preiselbeeren“gehen. Vom frühen Morgen bis zur Mittagsstunde waren wir im Wald und pflückten feste Beeren bisuns der Rücken weh tat. Stolz waren wir, wenn wir mit 2 Milchkannen gefüllt mit Blaubeeren heimkamen. Ein Teil wurde gleich eingemacht, der andere sofort als Kompott gedünstet. Dann gab esMutters vielgerühmte Hefeklößel, die Vater gar nicht mochte.Unmittelbar hinter dem Garten befand sich ein großer Hundezwinger. Wir hatten einen Diensthund(Jagdhund), ein Mords-Vieh. Der Kerl war so scharf, daß sich nur Vater und ich als Bub in denZwinger hineintraute. Mutter fürchtete sich sehr vor ihm. Nachts ließ ich ihn aus dem Zwinger, wo erim Baumschulgelände freien Auslauf hatte. Als Treff altersschwach wurde, bekamen wir einenanderen Hund, und zwar einen schottischen Schäferhund. Mit dem hatte es Erika gut.8
Nun zu dieser Zeit erinnere ich mich, als die Kirschenernte heranstand, kam ich auf den Gedanken miteinem meiner Freunde verbotenerweise selbst welche zu ernten. Da stand dicht neben demGewächshaus ein mächtiger Kirschbaum mit dunkelroten Früchten. Um zu den Kirschen zu gelangen,stieg ich auf das Gewächshausdach in der guten Hoffnung, daß die starken Drahtglasscheiben meinGewicht aushalten werden. Zunächst ging alles gut. Als aber das Körbchen halb voll war, muß icheinen Fehltritt getan haben. Eine Scheibe gab nach, rutschte aus der Sprosse und ich landete imGewächshaus auf einer Anzuchtstellage. Ich bin da zu Tode erschrocken. Aus Angst verwischte ichschnell die Spuren. Mein Freund und ich machten uns schleunigst aus dem Staube. Als der Gehilfeam nächsten Morgen die Bescherung entdeckte, meldete er den „Einbruch“ sofort der Gärtnerei. Manwar höchst erstaunt, daß Treff gegen die Einbrecher nichts unternommen hatte. Daß der Sohn desChefs die Hand im Spiel gehabt hätte, darauf ist man freilich nicht gekommen. Später habe ich dasVater gebeichtet, als alles längst vergessen war.Im November 1918 war der Krieg beendet, das Kaiserreich durch die Republik abgelöst. Für unsDeutsche begann damals eine schlimme Zeit. Zunächst tat sich in Emanuelssegen nichts. Aberinsgeheim gärte es schon. Es gab im Industriegebiet Oberschlesiens zahlreiche Kräfte, die dieAbtrennung des Kohlenreviers vom Deutschen Reich im Untergrund betrieben. Zuerst ging das ganzlangsam vor sich. Es sollte noch einige wenige Jahre dauern, ehe die Loslösung vom Reich reifwurde.Von der Schule in Kattowitz besuchte ich oft Tante Elly, die Hauswirtschafterin bei Bergrat Brunnerwar und in der Schillerstraße 9 wohnte. Bergrat Brunner war Witwer; er hatte 3 Kinder, die jüngsteTochter Eva war in meinem Alter. Eva war ein hübsches Mädel, deren Nähe ich immer suchte. Sieging aufs Lyceum. Sie kam auch oft mit Elly mit nach Ems, wenn sie uns besuchte.Einmal muß mich wohl der „Teufel geritten“ haben, nämlich ich ließ kurzerhand einen 20-Mark-Schein,der auf der Kommode lag, „mitgehen“! (Im Hause Brunner) Da ich ja nie einen Pfennig Geld in derTasche hatte, fühlte ich mich nun reich. Ich konnte mir nun endlich die geliebten Kokosflocken kaufen,die ich so gerne hatte. Der Diebstahl bekam mir aber nicht. Elly war darob außer sich. Sie fuhr nachEms und erzählte Mutter von der Tat „ihres Früchtchens“. Ich darf mir hier ersparen zu schildern, wasdarauf an mir geschah. Jdenfalls hatte ich lange danach zu „lecken“, und oft wünschte ich mir die Tatungeschehen zu machen. Man hat mir das dann auch lange genug vorgehalten.Mein Onkel Max wohnte von Tante Elly nur ein „Steinwurf“ weit weg, nämlich in der Nikoleistraße 7. Indem Hause wohnte ein Stock tiefer die spätere Ehefrau von Bernhard Grzimek.Meine Tante Meta (Ehefrau des Onkel Max) war hochgradig Rheuma-krank. Ich sehe sie heute nochwie sie 10 oder 15mal um den großen Wohnzimmertisch herumgehumpelt ist. Ihre Hände warenderart verkrümmt, daß sie kaum eine Tasse halten konnte. Kremsers hatten 2 Kinder, - MädchenRuth und Ilse. Sie waren einige Jahre älter als ich. Sie haben mich bei verschiedenen Besuchenkaum zur Kenntnis genommen. Sie waren zu hochnäsig und zu sehr eingebildet, da sie schon dieBänke der oberen Klassen des Lyceums drückten. Deshalb ging ich sehr selten zu ihnen, eigentlichnur dann, wenn ich mußte, zu besonderen Anlässen. Tante Meta verstarb am 7.12.1923 mit 45Jahren an ihren Leiden.Einmal fielen in unserer Klasse 2 Unterrichtsstunden wegen Krankheit unseres Lehrers aus. WirBuben, die wir schon um ½ 8 Uhr im Klassenzimmer waren, hatten nichts anderes zu tun als Unsinnzu treiben. So balgten wir uns halt herum und Klein-Eberhard machte hier auch keine Ausnahme. Beieiner solchen Balgerei rutschte ich mit meinem linken Arm unter den schwarzen Klassenschrank undeiner setzte sich auf mich. Um den Jungen loszuschütteln muß ich mit dem Arm den schwerenSchrank angehoben haben. In diesem Augenblick splitterte die Gelenkkugel des linken Ellbogens.Der Schmerz war fürchterlich. Ich wurde sofort nach Hause gebracht und in das FürstlicheKnappschafts-Lazarett eingeliefert.Bei einer Röntgenaufnahme hat man festgestellt, daß ein sehr komplizierter Bruch des Kugelgelenksvorliegt, der äußerst schwierig zu behandeln sei. Man sprach sogar davon, daß ein steifer Armzurückbleibden könnte. Ich kam sogleich in den OP-Saal in Narkose. Als ich aufwachte, hatte icheinen mordsgroßen Gipsverband in einer Schiene. Ich habe ein halbes Jahr damit zugebracht.Schlimmer aber war dann die folgende Bewegungs-Therapie. Wenn mich der Wärter in der „Fuchtel“hatte, schrie ich so fürchterlich, daß das ganze Lazarett zusammenlief. Später mußte mich ständigmeine Mutter ins Lazarett hinbringen, weil ich sonst den Weg einfach nicht fand.9
Das Jahr 1919 brachte uns Kummer und Leid. Das oberschlesische Volk wurde von einigen Verräternaufgehetzt sich an Polen anzulehnen. Der Slogan hieß: „Stimmt für Polen, das ist das Land in demMilch und Honig fließt.“ Einer der Haupträdelsführer war Woiczeck Korfanty, ein ehemaliger Minister(gemeint ist vermutlich „Abgeordneter“) des Reichstags (1903 – 1918). Er organisierte dieInsurgentenaufstände. Der erste Aufstand war im August 1919. Zur Abwehr derInsurgentenaufstände wurde ein deutsches Freiwilligen-Corps gebildet, an dem auch Vater teilnahm.Während der Aufstände wurden die Frauen und Kinder deutscher Familien zusammengezogen undnach Kattowitz zur Hauptverwaltung der Fürstlich Plessischen Grubenverwaltung verbracht. Dort sindwir in großen Sälen, die extra zu diesem Zweck hergerichtet waren, untergebracht worden. Wir warendreimal dort. Meist dauerte es immer 3 – 4 Wochen, ehe wir wieder zurück in unsere Wohnungenkonnten (1919, 1920 und 1921).In dieser Zeit als Vater in seinem Büro war, sah er von seinem Fenster aus eine Kolonne von Männernauf die Gärtnerei zukommen. Allen voran Kischka mit den rotweisen Fahnen. Mikulla, seinMitarbeiter, riet meinem Vater dringend sich schleunigst in Sicherheit zu bringen. Mikulla tat dies auchfür seine Person. Vater jedoch, sich wohl keiner Schuld bewußt gewesen, verharrte auf seinem Platz.Die Horde drang ins Büro und Kischka rief haßerfüllt: „Hier habt ihr das ‚deutsche Schwein’“! Sieschleppten Vater in den naheliegenden Wald und hieben (ihn) dort mit Knüppeln auf ihn ein bis erbewußtlos war. Wir ahnten von diesem Vorgang nichts. Als er aber abends nicht nach Hause kam,wurde uns bewußt, daß hier etwas passiert sein mußte. Wir machten uns auf um nach ihm zuforschen. Von Mikulla hörten wir, daß die Insurgenten in der Gärtnerei waren. Aber näheres konnteer uns nicht sagen. Erst später, am übernächsten Morgen, bekamen wir vom Emser Lazarett dieNachricht, daß Vater dort eingeliefert war. Nach seiner Genesung haben wir ihn wieder freudigempfangen. Leider blieb infolge der Mißhandlung ein Dauerschaden, nämlich die Zertrümmerung desTrommelfells im rechten Ohr (zurück).Man begann nun auch die Kinder der deutschen Familien zu traktieren. Die verhetzten Jungen derPolacken trachteten, wo sie nur konnten, uns Schaden zuzufügen. Deswegen schlossen wirDeutsche uns nun ganz fest zusammen. In unserer Gemeinschaft wagten sie nicht uns anzugreifen.Aber wehe, wenn wir mal alleine waren, dann gab es „Zunder“.So gingen beide Insurgentenaufstände 1919 und 1920 für uns glimpflich zuende. Der Völkerbundhatte danach beschlossen, Oberschlesien zu besetzen und für Ordnung zu sorgen. Es kamen 18000Franzosen, 3000 Italiener und 600 Engländer nach Kattowitz, das als Hauptquartier ausersehen war.Leider hat der französische General Le Ronde, unter dessen Oberbefehl die Besatzung stand,einseitig gehandelt. Wenn was war, waren immer die Deutschen schuld. Korfanty ging bei le Rondeständig ein und aus. Wir konnten uns nun ausmalen, wie wohl der vom Völkerbund angeordneteVolksentscheid aussehen wird (Plebiszit).Die Abstimmung fand am Palmsonntag 1921 statt. Bei der Auszählung der Stimmen wurdefestgestellt, daß der polnische Teil der oberschlesischen Bevölkerung eine große Niederlage erlittenhatte. Es stimmten nämlich 60% der Bevölkerung für den Verbleib Oberschlesiens beim DeutschenReich, 40% indessen nur für Polen. Durch die Wahl war es sonnenklar, daß ganz Oberschlesien beimDeutschen Reich verbleiben mußte.Die Gegner Deutschlands waren vom Ausgang der Wahl betroffen. Sie sannen nach, wie man dieWahl zugunsten Polens auslegen könnte. Le Ronde kam auf den Gedanken dem Völkerbund dieAbtrennung Oberschlesiens – eben nur die 40% - vorzuschlagen. Das war also Ostoberschlesien, derwertvollste Teil des Industriegebietes. So kam es dann auch. Die Grenze wurde also Ratibor –Gleiwitz – Beuthen und Tarnowitz gezogen.Nach dem Versailler Vetrag durften die Deutschen, die nicht für Polen optierten, bis Ende 1926 imabgetrennten Teil O/S bleiben und bis dahin auch ihren Arbeitsplatz behalten. Vater optierte nicht fürPolen, aber unser Freund Mikulla wendete nun seinen Kittel und war seitdem ein guter Polegeworden.Der Fürst von Pleß mußte sein „Imperium“ zugunsten seines Sohnes, der Pole werden mußte,abtreten. Die veränderte politische Landschaft veränderte auch unser Dasein.Das öffentliche Leben wurde also schnellstens polonisiert. So war es auch mit den Schulen. Kinderreichsdeutscher Eltern durften die Schulen nicht mehr besuchen. So mußte ich auch dieOberrealschule in Kattowitz verlassen. Meine Eltern schulten mich also in einer Oberrealschule in10
Bunzlau in Niederschlesien ein. Dieser Schule war ein Waisenhaus, das früher eine Kadettenanstaltwar, angeschlossen. Dort wurde ich untergebracht. Meine Eltern kannten die Schule schon vonBreslau her. Bunzlau liegt am kleinen Nebenfluß der Oder, Bober geheißen. Es ist ein kleinesProvinzstädtchen von etwa 20000 Einwohnern, bekannt durch Bunzlauer Tonwaren. Ich war alsorund 350 km von zu Hause fort.Der Schulbesuch in Bunzlau war aus polnischer Sicht illegal. Die in Ostoberschlesien lebendenDeutschen durften aufgrund eines Ausweises sich nur in der oberschlesischen Provinz bewegen. DieDeutschen jedoch kümmerten sich um diesen Passus um einen Dreck. Für mich sollte jedoch dieseBestimmung einmal zum Verhängnis werden. Doch davon später.Im Waisenhaus wurde ein spartanisch einfaches Leben geführt. Das Haus war so eingeteilt, daß dieSchüler verschiedener Altersgruppen in sogenannte Familien aufgestellt wurden. Es waren jeweils 50Schüler, die von einem Lehrer der Anstalt beaufsichtigt wurden. Ich gehörte zur Familie „Richthofen“.Die Schule selbst war von der Anstalt getrennt.Das Leben und das Tagewerk war militärisch ausgerichtet. Punkt 6 Uhr läutete die Glocke zumAufstehen. Im gemeinsamen Waschraum mußten wir uns unter Aufsicht mit entblößtem Oberkörperwaschen. Um 7 Uhr läutete die Glocke abermals zum Antreten. Gemeinsam wurden wir in denSpeisesaal geführt, wo an langen Tischen jeder seinen Platz hatte. Es gab für jeden einen TellerMehlsuppe, 2 Stück Brote mit einem Stück Margarine. Damit mußten wir bis zum Mittagessenauskommen. Um 8:00 Uhr begann der Unterricht. Obwohl ich nicht zu den Besten, aber auch nichtzu den Schlechtesten gehörte, war ich gerne in der Schule. Nachmittags machten wir im großenGemeinschaftsraum unter Aufsicht von Abiturienten unsere Schulaufgaben. Ab und zu kam auchunser Lehrer, ein Studienrat, aus seinem, neben dem Raum befindlichen Zimmer, (Wilder hieß er) undsah nach dem Rechten. Er war meiner Meinung nach ein gerechter Mann.Ab 5 Uhr konnten wir in den Hof und durften dort uns austoben. Oder aber konnten wir oben bleibenund unseren Neigungen nachgehen. Wenn das Heimweh über mich kam, habe ich Briefe an meineEltern geschrieben.Abends um 7 Uhr mußten wir wieder zum Abendbrot antreten. Das Abendbrot bestand wieder auseinem Teller Mehlsuppe und 2 Brote mit einem Stück Margarine. Damals war ja eine schelchte Zeit;es gab an Lebensmittln nicht viel.Nach dem Essen durften wir noch einige Zeit draußen bleiben. Um 9 Uhr aber mußten wir, nachdemwir uns im Waschraum wieder unter Aufsicht gereinigt hatten, ins Bett. In einem großen Schlafsaalbefanden sich ein Unmenge Betten, wo wir die Nacht verbrachten. Ein Lehrer schlief wöchentlichabwechselnd ebenfalls im Schlafsaal, so daß kein Unsinn getrieben werden konnte. Hier im Bett habeich oft an daheim gedacht. Voll Wehmut habe ich da Tränen vergossen.Sonntags machten wir uns auf zum gemeinsamen Kirchgang. Das war schon gang und gäbe. Obsommers oder winters, egal, in „Dreierkolonne“ marschierten wir in die Stadt.Neben dem Schulgeld hatten die Eltern auch eine bestimmte Summe Taschengeld zu überweisen.Das Taschengeld erhielt der „Familien-Vater“ Wilder, der den Kontostand in einem Oktavheft eintrug.Wenn wir etwas brauchten, mußten wir ihn um Geld bitten. Manchmal kaufte ich mir in einer nahegelegenen Bäckerei ein Stück Mohnkuchen. Das wußte Wilder schon; er hatte nichts dagegen.Fortsetzung der Erinnerungen auf seine Seite 38:Ein Vorfall erscheint mir wert hier festgehalten zu werden. Jeden Monat machten die Klassen derSchule einen Ausflug um die Natur und die nähere Umgebung kennenzulernen. So machten wireinmal im schönen Monat Mai einen Radausflug zur Gröditzburg, die etwa 20 km von Bunzlau entferntauf einem etwa 100 m hohen Bergkegel mitten in einer Ebene stand. Natürlich war ich „Radfahrer“,obwohl ich auf dem Rade nicht ganz sicher war. Ich wollte unbedingt an diesem Ausfluge mitteilnehmen. Anfangs ging ja alles gut, bis wir auf der abschüssigen Chaussee an einer Kurve voreiner Ortschaft ankamen, und ich vor lauter Schreck die Rücktrittsbremse vergaß zu betätigen, dennvor mir tauchte plötzlich ein Fuhrwerksgespann auf. Ich raste also darauf zu und kam mit dem Radezwischen Deichsel und Halfter der Pferde und flog dabei in hohem Bogen auf den Rücken eines derPferde. Mir und dem Gespann war gottlob nichts passiert, aber für mich war der „Film“ gelaufenundder Ausflug zu Ende. Ich bekam das Fahrrad abgenommen und mußte per Bahn nach Bunzlau11
zurück. Mein Klassenlehrer meinte: „Du bist theoretisch tot, du hast mal ein Riesenglück gehabt.“Bestraft bin ich gottlob nicht worden; man wertete das als ein unglückliches Geschick. Seitdem durfteich in Bunzlau nie mehr auf ein Fahrrad steigen.Das Heimweh verließ mich in der ganzen Bunzlauer Zeit nicht. Das Weihnachtsfest und dieWeihnachtsferien des jahres 1923 standen vor der Tür. Schon Wochen vorher schrieb ich meinenEltern, wie ich mich auf die Ferien und auf das Wiedersehen mit ihnen freue. (Hier ein kurzerKommentar des Transkriptors: Die fürchterliche Inflation war im Oktober 1923 zu Ende gegangen.Mein Vater erwähnt das mit keinem Wort. Wie konnte man damals einkaufen usw.?) Ich bat sieinständig mich nicht zu vergessen und das Fahrgeld zu überweisen. Im Geiste malte ich mir schonaus, wie Mutter dabei war die Weihnachtsbäckerei vorzubereiten. Den Pfefferkuchenteig hatte sieschon Ende November gemacht, damit er vor Weihnachten durchgezogen und die Plätzchen mürbewaren. Den ganzen Advent roch es zu Hause nach Weihnachten. Die letzten Nächte vor der Abfahrtnach Hause konnte ich schon nicht mehr gescheit schlafen.Ich packte also rechtzeitig meinen Koffer. Und als der Reisetag kam, verabschiedete ich michfreudestrahlend von meinem „Familienlehrer“ und marschierte rechtzeitig zum Bahnhof um ja nichtden D-Zug nach Kattowitz zu verpassen. Die Fahrkarten hatte ich bereits einen Tag vorher besorgt.Nach 5 Stunden Fahrt kam ich an der Grenzstation in Gleiwitz an. Auf dem Bahnsteig befand sicheine lange über den Bahnsteig überspannende Baracke. Da mußten alle diejenigen durch, die nachKattowitz weiter wollten.Der deutsche Zöllner wollte nichts von mir, er ließ mich ohne Kontrolle durch. Der polnische dagegendurchwühlte meinen Koffer und fand eine niederschlesische Bunzlauer Tageszeitung, in der meineSchuhe eingewickelt waren. Das war das Signal für den Polacken, daß ich nicht aus Deutsch-Oberschlesien kam, sondern verbotenerweise mich in Niederschlesien aufgehalten hatte. Ich wurdeeingehend verhört und da sie auch mein Zeugnis fanden, konnte ich meinen verbotenenAufenthaltsort nicht mehr leugnen. Man ließ mich nicht durch und der Zug fuhr ohne mich nachKattowitz weiter.Wie mir zumute war, ist hier eigentlich nicht zu beschreiben. Ich muß wie ein „Schloßhund“ geheulthaben. Jedenfalls bemerkte das ein deutscher Zollbeamter, der mich tröstete und mir gottlobweiterhalf. Ich sagte ihm die Telefonnummer vom Vaters Büro. Er rief dort an und ließ ausrichten,daß ich in Gleiwitz festsäße und im Wartesaal III. Klasse auf ihn wartete. Gegen abend kam meinVater auch; es waren von Kattowitz nach Gleiwitz nur wenige Kilometer. Er bedankte sich beimeinem Helfer mit einem Glas Bier und einem Korn. Da wir in Gleiwitz nicht mehr über die Grenzekonnten, fuhren wir mit der Straßenbahn von Beuthen nach Kattowitz. Dort konnte ich ungehindertüber die Grenze. Freudestrahlend kam ich nach Emanuelssegen, das seit der polonisierung „Murcki“hieß und nahm Mutter und Erika in die Arme.Ich habe in der Heimat wieder schöne Tage verlebt und alles was hinter mir lag, war vergessen.Wegen des Vorfalles an der Grenze konnte ich leider nicht mehr in die Schule nach Bunzlauzurückkehren. Nach Darlegung der Situation meldete Vater mich dort ab. Vater wußte, daß im KreisLeobschütz in Oberschlesien im Kreisstädtchen Katscher ebenfalls eine Oberrealschule mit einemdazugehörigen Schülerheim für auswärtige, vornehmlich Schüler aus dem abgetretenen Gebiet,aufnahm. Nach den Weihnachtsferien fuhren Vater und ich zusammen hin. Ich wurde dort auchgleich im Januar 1924 aufgenommen, und zwar in die Untertertia (U III). (Hinweis: In meinemSchuljahrgang gab es ab der 5 Klasse die folgenden Klassen: Sexta, Quinta, Quarta, Untertertia,Obertertia, Untersekunda, Obersekunda, Unterprima, Oberprima.) In Katscher fühlte ich michpudelwohl. Wie seither war ich kein Musterschüler, meine Leistungen bewegten sich so etwa in „derMitte“. Nur mit meinem Religionslehrer war ich ständig im Streit. Er verlangte zuviel von uns. Er warnoch ein junger Vikar, und er wollte wohl durch seine Strenge und seine Leistungsanforderungen„oben“ angesehen sein. Ich selbst war der Ansicht, daß religiöse Sprüche und Kapitel für das spätereLeben nicht so wichtig seien. 4 oder 5 Schüler hatten bei ihm auch Konfirmandenunterricht. Es fielihm bald auf, daß der Kremser nicht ganz bei der Sache war und oft das zu lernende nicht aufsagenkonnte. Wahrscheinlich ist, daß wir beide gleich von Anfang an eine Antipathie gegenseitig hatten.Ich mochte einfach diesen Kerl nicht. Er prophezeite mir, wenn ich bei der Vorstellung derKonfirmanden in der Kirche, wo die Eltern zugegen waren, meine Sache nicht flüssig aufsagen könne,müßte ich vor dem Altar knieen.12
Der Tag der Vorstellung kam. Der Kremser konnte also doch nicht die Sprüche „flüssig“ aufsagen.Wahrscheinlich trieb mich die Angst und die verhaltene Wut in die Defensive. Aber zum Erstaunendes Vikars kam ich nicht zum Altar vor um mich niederzuknieen. Nach der Kirche mußte ich in dieSakristei. Dort verabfolgte mir Klingler, so hieß der brave Gottesmann, mir einige schallendeOhrfeigen mit der Bemerkung mich nicht konfirmieren zu wollen. Mein Vater hat jedoch dafür gesorgt,daß ich trotzdem konfirmiert worden bin.Die Sache kam an die große „Glocke“. Dabei fand man auch noch andere Dinge heraus, die nichtganz sauber waren, und Klingler wurde eines Tages versetzt.Die Konfirmation haben wir bei meiner Großmutter in Steuberwitz gefeiert, die es als eine große Ehreempfand. Bei meiner Großmutter war ich oft in den großen Ferien. Ich war gern bei ihr. Sie hat michals den einzigen Namensträger sehr gern gehabt und hat mich, wo sie nur konnte, verwöhnt. Ich kannmich nicht erinnern, daß sie mir ein böses Wort gegeben hat. Oft war ich bei Gottsmanns drüben undspielte mit meinen Cousinen, die im gleichen Alter waren. Gegenüber der Wirtschaft befand sich eineBäckerei. Dort war ich auch anzutreffen. Ich durfte dort sogar die aus dem Ofen gehobenen Brote miteinem Handbesen mit Wasser bestreichen, damit sie glänzten.Ostern 1926 kam ich mit der O III-Reife aus der Schule und kehrte nach Emanuelssegen wiederzurück. Nun kam die Berufswahl. Ich wollte den Gärtnerberuf ergreifen und später eineentsprechende Fachschule besuchen. Mir schwebte Vaters Tätigkeit vor. Er hatte gerade zu jenerZeit die Planung des neu zu schaffenden Friedhofs in Ems auf dem Zeichentisch. Ich sah ihm bei derArbeit zu. Später bekam er für die schöpferische Leistung vom Fürsten die Silbermedaille.Aber Mutter war anderer Ansicht und Vater blies ebenfalls in ihr „Horn“. Wir hatten einen Bekannten,Quintek mit Namen, er war Oberingenieur und technischer Leiter der Elvator-Werke in Kattowitz-Boguschütz. Mit ihm müssen die Eltern schon vorher gesprochen und vereinbart haben, daß ihr Sohnals Praktikant 2 volle Jahre dort arbeiten sollte. Mir paßte das ganz und gar nicht, aber es half nichts,ich mußte hin. Das Werk stellte Loren für den Untertagebau her und weiteren Bedarf für dieFörderanlagen. Ich kam zunächst ¼ Jahr in die Werkzeugdreherei und später in die Kesselschmiede.Je länger ich dort arbeitete, umso mehr wurde mir klar, daß ich an diesem Beruf keinen Spaß habenwürde. Mit Grauen betrat ich jeden Tag das Fabrikgelände. Ich sprach darüber auch mit meinenEltern; aber sie beharrten auf dem Entschluß und forderten mich auf die Zähne zusammenzubeißen.Eines Tages ritt mich wieder einmal der Teufel. Unweit der Fabrik „Elevator“ war ein großerStauweiher mit einer wunderschönen Badeanstalt geschaffen worden. Die Sommerzeit war geradezugeschaffen, sich in der Badeanstalt „zu erholen“. Ich schwänzte daher die Arbeit und ging baden.Erst wollte ich das nur einmal tun; aber aus einmal wurde zweimal und schließlich waren es zweiWochen geworden. Mutter packte mir brav jeden Morgen die Brotportionen für den ganzen Tag.Meine Abwesenheit fiel schließlich auch dem Quintek auf. Da keine Entschuldigung bzw. Krankmeldungvorlag, rief er kurzerhand meinen Vater an. Vater muß wohl „aus allen Wolken“ gefallen sein, alser hörte, daß sein Sohn seit zwei Wochen nicht mehr in der Fabrik war. Als ich abends nach Hausekam, hat man mich entsprechend „empfangen“. Beide Elternteile nahmen mich ins „Gebet“! Es halfaber nichts. Ich habe ihnen in die Hand hinein versprechen müssen, daß ich künftig meinen Pflichtennachkomme werde. Das habe ich dann auch getan.Aber bald kam das Schicksal mir zu Hilfe. Vaters Mitarbeiter Mikulla ist inzwischen „Super-Pole“geworden. Er strebte hinter Vaters Rücken Vaters Entlassung an um dann selbst seine Stelleeinzunehmen. Der Intrigen waren viele. Schließlich klappte das auch; Vater mußte alsReichsdeutscher den Arbeitsplatz räumen. Wir wurden zu allem Unglück auch aus Polenausgewiesen. (Hinweis: Für meinen Vater ist typisch, daß er die Einzelheiten der Intrigen nichtausführlich erläutert. - Als mein Vater im 2. Weltkrieg in Oberschlesien war, schrieb ihm sein Vater, ersolle das undeutsche Verhalten des Mikulla anzeigen, was er nicht tat. Als er wieder im Gartenamtder Stadt Frankfurt tätig war, sagte ihm sein Schulkollege Sallmann, der später Direktor desGartenamts wurde: „Schönen Gruß Herr Kremser vom Herrn Mikulla.“ Mein Vater sagte nun zu mir,daß seine Großzügigkeit sich da bezahlt gemacht hätte, da der Mikulla ihm ansonsten geschadethätte.) Im September 1926 räumten wir unsere liebgewordene Heimat und ließen uns unter Mitnahmeder Möbel in Kandrzin vorübergehend nieder. Die Möbel wurden bei einem dortigen Spediteureingestellt; wir bezogen eine kleine möblierte Wohnung im Ort. Kandrzin ist ein ganz kleiner Ort inunmittelbarer Nähe der Kreisstadt Cosel an der Oder. Aber Kandrzin war Oberschlesiens größterVerschiebebahnhof. Dort kreuzten sich alle Strecken von Ost + West, von Süd und Nord. Vater13
wußte, daß die dortige Reichsbahndirektion einen Fachmann suchte, der es überrnahm, anbesonderen gefährlichen Strecken Windschutzpflanzungen anzulegen. Er bekam den Auftrag dazu.Da ich nun auch bar jeglicher Beschäftigung war, habe ich ihm tüchtig mitgeholfen. Die Arbeiten,gemeint sind hier Rigolarbeiten, hatte Vater im Akkord vergeben. Ich war sehr stolz, wenn ich amAbend die stolzen Quadratmeter aufmaß und sie dem Vater vorlegte. Ich hatte immer soviel, wie dieanderen Arbeiter auch. Davon wollte ich keinen Pfennig. Ich war schon froh, wenn ich von Mutteretwas Geld in die Finger bekam. Die Arbeitsstrecken erreichten wir mit der Bahn und die freienStrecken mit der Draisine.Eine Freude war es für mich immer, wenn ich am Sonnabend nach Cosel laufen durfte, um für VaterTabak zu holen und die Illustrierte zu kaufen. Ab und zu durfte ich von Vaters Tabak eine Zigarettedrehen. (Hinweis: Mein Großvater, mein Vater und Herbert waren nikotinsüchtig. Als ich 14 war, hatmein Vater in einer Illustrierten eine kritische Abhandlung gelesen, so daß er von einem Tag auf denanderen mit dem Rauchen aufhörte. (Mit Tabak hat er 1945 den Lokfahrer bestochen, als der Zugaus hamburg kommend langsam in Frankfurt-Süd einfuhr. Sonst wäre er wohl im Rheinlandungekommen wie der Vater von Frau Z..) Mein Großvater rauchte auch im Alter. Ich glaube, ererstickte regelrecht an einer Lungenentzündung im Kronberger Krankenhaus 1955.)Abends spielten wir bei der Petroleumlampe meistens das Würfelspiel „die lustige Sieben“.Nach Weihnachten nahm Vater die alte Verbindung zur Samenfirma „Titus Hermann“ in Liegnitz auf,wo Vater in Emanuelssegen beträchtliche Mengen Samen bezog. Sie war die größte Samenfirma undAnzuchtsgärtnerei Schlesiens.Wir bezogen nun von ihr Gemüse- und Blumensamen in sog. Kommission. Damit machten wir in derdortigen Umgebung ganz gute Geschäfte.Vater legte jedoch seine Hände nicht in den Schoß. Es war ja auch abzusehen, daß die Vertragsarbeitenbei der Reichsbahn eines Tages auslaufen werden. Er bewarb sich nun mehrmals aufAnzeigen in den Fachzeitschriften „Möllers deutsche Gärtnerzeitung“ und dem „Thalacker“. Daswaren Fachblätter von Ruf. Auch ich liieß meine Eltern nicht in Ruhe. Ich bat sie Tag für Tag, siemögen doch mal bei Titus Hermann anfragen, ob ich dort nicht als Praktikant oder als Lehrlingeintreten könnte. Mutter wollte anfänglich davon nichts wissen. Schließlich willigten die Eltern ein undmeine stolze Mutter begrub endgültig ihre Hoffnung auf ihren „Studenten“.Hier in Kandrzin hatten wir eine Familie kennengelernt, deren Mann das damals aufkommende Radioselbst gebastelt hatte. Er führten uns das Ding vor und wir staunten, daß aus dem Trichter ohneDrahtverbindung Musik vom entfernten Sender Breslau zu hören war. Gegen die heutigen Apparatewa das ein „Trum-Ding“; das den ganzen Tisch eingenommen hatte. Manchmal funktionierte derApparat nicht, das war oft ein Quietschen und Pfeifen, aber immerhin war das für uns etwas Neuesund für mich ein großartiges Erlebnis im Herbst 1926 zum erstenmal Radio gehört zu haben.Die Firma Titus Hermann, Inhaber Kemler, war bereit mich als Lehrling in seinem Betrieb einzustellen.Vor Freude darüber hüpfte ich schier an die Decke. Zwar war ich sehr betrübt, die Familie wiederverlassen zu müssen, aber mir war klar, daß das sein mußte.14
Lehr- und Wanderjahre1927 - 1939BerufsjahreAn einem kalten Maientag des 15.05.1927 machte ich mich mit zwei Koffern auf um mein beruflichesLeben in Liegnitz zu beginnen.Liegnitz liegt an der Katzbach und hatte zu jener Zeit 80000 Einwohner. Liegnitz war als Garten- undGurkenstadt in ganz Schlesien bekannt.In Liegnitz angekommen, meldete ich mich zuerst im Hauptgeschäft bei meinem neuen Chef Kamleran und stellte mich als den neuen „Gärtnerstift“ vor. Man empfing mich dort sehr freundlich. Manbrachte mich von dort in die Anzuchtgärtnerei, in der Breslauerstr. 109, wo ich mich beim dortigenBetriebsleiter Georg Emig, Obergärtner, zu melden hatte. Hier bezog ich meine neue Behausung, einan sich geräumiges Zimmer, in dem schon ein Stift, namens Georg, wohnte. Das geräumige Haus,neben den Gewächshäusern, beherbergte im 1. Stock die Familie Emig, im Parterre waren weitereZimmer, in der noch 4 Gehilfen untergebracht waren. Anschließend waren riesige Lagerhallen fürMaschinen und Samenreinigungsgeräte. Wir Stifte, insgesamt 4, waren samt und sonders in„Vollpension“ beim Emig. Als Entgelt bekamen die Stifte im 1. Jahr 2 ganze deutsche Reichsmark.(Hinweis: Für welchen Zeitraum? Vielleicht monatlich?) Mit diesem Lohn konnten wir keine großen„Sprünge“ machen. In diesem Betrieb wurden alle Blumensamen und Gemüsesamen erzeugt. Eskamen aber auch zahlreiche Neuzüchtungen heraus, die Jahr für Jahr prämiert wurden.Ich war eigentlich sehr stolz in einem so bekannten und erfolgreichen Betrieb lernen zu dürfen.Meine Lehrzeit begann eigentlich mit einer Panne. Ich war kaum 8 Tage da, da hatte ich mich mitdem 1. Gehilfen (Böhm) in den „Haaren“.Ich mußte nämlich aus Frühbeetkästen Hortensien in Blumentöpfe herausnehmen und die Töpfe, dievoller Grünspan waren, mit einem Lappen säubern. An diesem Tag war es kalt, und es regnete mitSchnee vermischt ununterbrochen. (Hinweis. Kommt mir komisch vor, daß am 23. Mai Schnee fiel!)Ich stand am Wasserbassin und wusch also die Töpfe. Ab und zu steckte ich meine klammen Händein die Hosentaschen um sie wieder etwas aufzuwärmen. Meine Kollegen in den Gewächshäusernbeneidete ich, da ich sie sah, wie sie drinnen hantierten.Böhm sah also, wie ich meine Hände „wärmte“. Er forderte mich auf, und zwar in einem herrischenTon, der mich reizte, ich solle die Hände aus der Tasche nehmen und arbeiten. Ich sei doch nichtzum Vergnügen hier! Ein Wort gab das andere – jedenfalls kam ich derartig „in Fahrt“, daß ich ihmsagte, er solle sich um seinen Kram kümmern. Daraufhin warf er mir einen nassen Lappen insGesicht. Ich nahme denselben Lappen und schleuderte ihn genau auf seine Nase. Nun war das Faßvoll. Zwar feixte der ganze Betrieb darüber, daß Böhm vom Stift eins in die „Fresse“ bekam, aber fürmich war ein für allemal „der Ofen aus“.Emig verwarnte mich mit der Maßgabe, künftige derartige Vorfälle der Betriebsleitung im Hauptgeschäftzu melden. Seitdem hatte ich es beim Emig verspielt, und er bereitete mir die Hölle. Mir warklar, daß ich nun den Mund halten mußte und daß „Lehrjahre keine Herrenjahre“ seien. Ich verhieltmich auch danach, auch wenn mir das sehr schwer fiel.Mit der Fresserei beim Emig waren wir nicht zufrieden. An allen Ecken und Enden wurde gespart;aber da wir kein Geld hatten um zuzusetzen trieb uns schon der Hunger zum „Futternapf“. Außerdemwar Frau Emig eine recht bequeme und unsaubere Frau. Das konnten wir schon an der Blech-Kaffeekanne sehen, die wahrscheinlich überhaupt nicht sauber gemacht wurde. Wenn wir Kaffeeausschenken wollten (das war ja gar kein Kaffee, sondern „Mopselbrühe“ nannten wir das Gesöff)mußten wir erst mit einem Stock die Schnauze frei machen.Wir haßten diese Frau. Sie stand stundenlang am Fenster und beobachtete uns, anstatt daß sie ihreZeit der Wohnung geopfert hätte. Emig erfuhr täglich haargenau was unten im Betrieb gespielt wurde.15
Eine Riesenfreude was es für Emig immer, wenn er uns nach 7 Uhr abends nach dem Abendessenherausjagen konnte um die Freilandkulturen zu bewässern. Das ging bis zum Dunkelwerden und dieAlte stand am Fenster und sah uns zu.Die Lehrlinge hatten täglich ein Tagebuch zu führen. Sämtliche metereologischen Daten sowie alleam Tage verrichteten Arbeiten mußte in das Tagebuch eingetragen werden. Manchmal waren wir somüde, daß wir kaum zum Eintragen fähig waren. Emig wollte „die Brillenschlange, den Kujon“ oderdie „verfluchte Wildsau“ „Kirre“ kriegen. Seine Frau half dabei feste mit. Sie wußte und fühlte wie ichüber sie dachte und hörte auch von anderen „guten Kollegen“ wie Wert (???) sie mir war. Ich ließ miraber nichts zu Schulden kommen, so daß man mir auf andere Weise „Liebenswürdigkeiten“ zuteilwerden ließ.Inzwischen bekam mein Vater eine Stellung in Völksen, Kreis Springe (bei Hannover), auf einemkleinen Gut bei einer Gräfin angeboten. Da er vorerst zur Probe angestellt wurde, reiste er alleindorthin. Mutter wollte verständlicherweise mit Erika nicht allein in Kandrzin bleiben. Sie kam zumeiner großen Freude zu mir nach Liegnitz. Sie suchte sich ein schönes, geräumiges Zimmer in derGoldbergerstraße bei einem verwitweten Rektor, der bereits pensioniert war. Sie hatte sich dort auchdie Küchenbenutzung ausbedungen. Wie ein Zufall, gegenüber wohnte Mutters einstige FreundinHelene Pawliczek, deren Mann im 1. Weltkrieg gefallen war. Sie hatte einen Sohn und eine Tochter,namens Charlotte. Eine zweite Freundin wohnte ebenfalls dort im gleichen Stockwerk.Die Töchter der beiden Tanten waren wahrhaftig keine „Schönheitsköniginnen“. Charlotte, Lottegerufen, hatte ein Gebiß, wenn die lachte meinte man ein Gaul lacht dich an, die andere Hanne hatte„Knollaugen“, hervorgerufen durch die Basedowsche Kropfkrankheit. Mit den beiden Mädchen, die inmeinem Alter waren, konnte ich keine „Staat“ machen.Im Mai 1928 wurde in Liegnitz die erste Reichsgartenschau – die Gugali – eröffnet. Das war fürMutter und Erika ein schönes Ereignis. Sie bezog eine Dauerkarte, mit der sie so oft sie konnte sich inder Ausstellung ihre Sorgen vom Leibe halten konnte. Vater verdiente nicht sehr viel. Der doppelteHaushalt verschlang auch eine Menge Geld. Mutter war also darauf angewiesen, selbst Geldhinzuzuverdienen. Sie warb damals Abonnements für die „Vobach Frauenzeitschrift“ und da das nichtsehr viel einbrachte, vertrieb sie für eine Breslauer Firma Seife, Waschpulver und Parfümeriewaren.Mutter lief oft tagelang treppauf, treppab, manchmal mit, manchmal auch ohne Erfolg. Es war für sieein bitteres Brot von Haus zu Haus Aufträge zu betteln. Später hatte sie schon etwas„Stammkundschaft“. Manchmal saß sie deprimiert am Abendtisch, wenn es mal gar nicht geklappthatte.Meine Aufgabe war, die bestellte Waren der „Kundschaft“ auszuhändigen und zu kassieren. Ich habedas nicht gern gemacht, aber was macht man da nicht alles?Während Mutters Anwesenheit in Liegnitz durfte ich ab und zu, wenn mal nicht zu wässern war, früherFeierabend machen. Nach dem Abendessen machte ich mich auf um Mutter zu besuchen. An lauenSommerabenden saßen wir auf dem Balkon, den ich mit Balkonpflanzen schön geschmückt hatte, undtauschten voller Wehmut Erinnerungen von Ems aus. Jeden 2. Sonntag hatte ich frei. Den verbrachteich samt und sonders bei der Mutter.Da der Rektor ein Fahrrad hatte, aber es wegen seines Alters nicht mehr benutzen konnte, verkaufteer es uns für ganze 5 Reichsmark. Seitdem hatte ich es sehr einfach rasch zur Mutter zu kommen.Mit diesem Rad habe ich später während meiner Freizeit die Liegnitzer Umgebung abgefahren. Ichwar per Fahrrad sogar mal in Bunzlau und habe mein ehemaliges Waisenhaus wieder in Augenscheingenommen. Bekannte indessen habe ich dort nicht mehr angetroffen.In der Gugali hatte unsere Firma Titus Hermann ebenfalls einen Wohngarten und einen Informationsstandzur Schau gestellt. Ab und an hat man mich abgestellt den Wohngarten zu säubern und vonUnkraut zu befreien. Das war für mich immer eine Abwechslung. Zur Gugali hatte ich durch denFirmenausweis immer freien Eintritt.Eines Tages bat mich Mutter inbrünstig, ich möge doch die beiden Pawliczek-Mädchen mit in dieAusstellung nehmen. Es gehöre sich, daß ich anstandshalber mit ihnen ausgehen müsse. Es paßtemir zwar nicht, aber an einem Sonnabendabend nahm ich die beiden „Grazien“ mit in denVergnügungspark der Ausstellung. Wir hatten zwar alle nur paar „Piepen“ aber wir amüsierten unsköstlich.16
Am anderen Morgen wurde ich von meinen Kollegen und von den Gehilfen gehänselt. Sie hattenmich nämlich am Vorabend mit den beiden Mädchen beobachtet. „Was hast Du für Weiberaufgegabelt?“ „Die eine hat ja ein Wechselgebiß, die andere Knallaugen!“ „Wenn Du nichts anderesauftreiben kannst, bleibst Du am besten zu Hause!“ Ich schämte mich so, daß ich mit den beiden niemehr zur Gugali ging.Ab und zu besuchte mich Mutter mit Erika in der Gärtnerei in der Breslauerstraße, um mich nachFeierabend abzuholen. Einmal kam sie gerade in dem Augenblick, als mich Emig am Kragen hatteund mich aus dem Büro hinauswarf. Wahrscheinlich war es nur wegen einer Lappalie. Dem Emigwar das ja sehr peinlich. Er entschuldigte sich damit, daß Eberhard ihn wieder geärgert hatte. Esentwickelte sich bei ihm mit den Jahren zu einer Art „Haßliebe“ mir gegenüber.Vater hatte inzwischen in Völksen von seiner Arbeitgeberin ein kleines Häuschen (möbliert) zur Mieteangeboten bekommen. Mutter zog also zu meinem Leidwesen mit Erika im Oktober 1928 zu ihm. Ichwar also wieder allein. Da Vater die dortige Stellung als Sprungbrett betrachtete, blieben unsereMöbel weiterhin in Kandrzin eingestellt.Ende Oktober 1928 bekam ich eines Tages ganz plötzlich furchtbare Leibschmerzen. Der Arztdiagnostizierte eine Blinddarmentzündung, die eine sofortige Einweisung in das LiegnitzerPiastenkrankenhaus notwendig machte. Vor der Operation hatte ich eine Heidenangst. Ich rauchtedaher eine Zigarette nach der anderen im Klo. Als ich am nächsten Morgen auf dem Operationstischlag, hatten die Ärzte ihre liebe Not mich zu narkotisieren. Die Operation gelang gut. Als ich aus derNarkose aufwachte, befand ich mich in einem großen Krankensaal, wo etwa 30 frisch operierte lagen.Alte und junge, Arbeiter und Angestellte. Alles durcheinander. Mir ging es von Tag zu Tag besser.Da die meisten Kranken im Saal keine Schwerkranken waren, wurde dort allerhand Unsinn getrieben.Uns betreuten katholische Schwestern. Ich erinnere mich daran, wie ein fast gesunder in demAugenblick, in dem eine Krankenschwester zur Abendvisite in den Saal kam, auf dem in der Mittestehenden Tisch im Nachthemd einen Handstand machte. Das Nachthemd rutschte ihm bis zumHals. Die Krankenschwester verließ fluchtartig den Saal.(Hinweis: Blinddarmentzündung war früher nicht ganz ungefährlich. Der Reichspräsident Ebert istnach meiner Erinnerung an einer verschleppten Appendizitis gestorben, vielleicht auch Scheidemann.Ich glaube, daß auch Herbert eine Blinddarmoperation hatte.)Nach 14 Tagen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Ich war darüber so traurig, daß mir dieTränen kamen. Hatte ich es dort so gut gehabt. Nun mußte ich wieder in die rauhe Wirklichkeit zumeiner „geliebten“ Familie Emig. Ich blieb noch einige Zeit in ambulanter Behandlung. Währenddieser Zeit durfte ich nur leichteste Arbeit verrichten. Man beschäftigte mich mit der Reinigung vonBlumensämereien. Abends schlich ich mich um das Krankenhaus und sah zu den Fenstern desKrankensaales hinauf. Mit Wehmut dachte ich mir: „dort oben hattest du es so gut, dort warst du sogeborgen“.Der Arzt schrieb mich 14 Tage krank, da er sah, daß mir auch die leichteste Arbeit nicht bekam. Daich aber nicht in der Gärtnerei bleiben wollte, fuhr ich zu meinen Eltern nach Völksen. Daß ich sie soschnell wiedersehen würde, hätte ich ja nicht geglaubt. Dort verlebte ich zwei schöne unbeschwerteWochen. In Hannover kaufte mir Mutter den ersten Sonntagsanzug beim Brenningmeyer. DerAbschied war wieder schwer.Der Winter kam. Es war ein furchtbar kalter Winter. Das Thermometer sank wochenlang auf minus30 Grad. Für uns kam eine schwere Zeit, nämlich die große Gewächshausanlage mußte immer aufmindestens 18 Grad plus gehalten werden. Am Tag war das ja eine Leichtigkeit, zumal dieSonneneinstrahlung mithalf. Umso schärfer und schneidender war nachts der Frost.Jeder von uns, der in der Gärtnerei untergebracht war, wurde zum Heizdienst eingeteilt. Jeder eineWoche lang. Im Heizraum standen drei große Höertsch(?)-Kessel (Hösch?), die mit Koks beladenwurden. Es waren 10 große Gewächshäuser mit Wärme zu beschicken. Am schwersten waren dieGewächshäuser, die am weitesten vom Kessel entfernt waren.In der Woche, in der ich Heizdienst hatte, passierte mir folgendes: Um 7 Uhr abends ging ich in denHeizraum entschlackte die Kessel und füllte sie bis oben hin mit Koks. Alle drei Stunden mußte dieser17
Vorgang wiederholt werden. Um die Zeit einzuhalten, stellte ich den Wecker, der mich um 3 Uhrwecken sollte . Ich überhörte den Weckruf und wachte erst 1 ½ Stunden später auf.Ich glaube, ich hätte bald einen Herzschlag bekommen. Ich rannte in den Heizraum und sah, daß inallen drei Kesseln nur noch Rotglut war. Im hintersten Gewächshaus sank die Temperatur auf 5 Gradplus ab. Ich schuftete und schuftete; es dauerte mindestens 1 ½ Stunden bis die Kessel wieder aufHochtouren liefen. Wenn der Emig es gemerkt hätte, hätte er mich sicher zerrissen. Als die Arbeitszeitum 7 Uhr begann, waren die Temperaturen in den Gewächshäusern wieder normal. Ich hatte ausdiesem Vorgang die Lehre gezogen. Ich legte mich künftig nicht mehr auf die „faule Haut“, sondernwachte die ganze Nacht.Meine Lehrzeit ging langsam zu Ende. Mit „Freund Emig“ stand ich immer noch auf Kriegsfuß. Erprophezeite mir immer wieder, daß aus mir nie etwas gescheites werden wird. Er muß innerlich eineMordswut auf mich gehabt haben, weil ich seiner Ansicht nach eine immer aufsässige Haltung ihmgegenüber gezeigt habe.Am 17. September wurde die Gehilfenprüfung vor der Landwirtschaftskammer NiederschlesienBreslau angesetzt. Wir waren insgesamt 18 Lehrlinge, die geprüft wurden. Emigs „Kujon“ Eberhardbrachte das beste Prüfungszeugnis heim. Mit der Höchstzahl von 17 erreichbaren Punkten bekam ichdie Note eins. Emig machte ein dummes Gesicht. Ich sagte ihm: „Der Eberhard wird nie etwasgescheites.!“ Ich bat ihn, er möge mir das Lehrzeugnis zum 30.09.1929 aushändigen, da ich nichtbereit bin, nur eine einzige Stunde länger bei ihm die Gastfreundschaft seiner Familie zu genießen!(Hinweis: Im Oktober 1929 war der Schwarze Freitag an der NYSE (New York Stock Exchange). Esist interessant, daß die fürcherlichen Wirtschaftskrisen, wie auch die Hyperinflation 1923, mein Vatergar nicht für erwähnenswert hält.)In der Zwischenzeit hatte mein Vater aufgrund einer Stellenanzeige in der Fachzeitschrift „MöllersDeutsche Gärtnerzeitung“ eine Stellung unter 41 Bewerbern als Obergärtner auf Schloß Friedrichshofangeboten bekommen. Bei der Vorstellung bei der Verwaltung und bei der Landgräfin von Hessenwurde man sich „handelseinig“, so daß Vater am 01.05.1929 die Stelle zunächst bei einer Probezeitvon 6 Monaten antreten konnte.Im nächsten folgenden zwei Bilder:Das erste Bild signiert „Margarete, Landgräfin von Hessen, 1940“. Darunter: jüngste SchwesterKaiser Wilhelm II., * 1876 - + 1954, (Geschenk an meinen Vater)Das zweite Bild: Landgräfliche Familie, Landgraf von Hessen mit seiner Frau,Margarete mit drei Zwilllingspaaren(Max, Moritz), (Philipp, Wolfgang), (Christoph, Richard)Da mein Vater zumeist bei Fürstlichkeiten angestellt war, wurde er bei der Besetzung der Stellebevorzugt. Vater nahm auch in den folgenden Jahren bei der Landgräfin von Hessen – die jüngsteSchwester des letzten deutschen Kaisers – eine Sonderstellung ein.Mutter und Erika siedelten gleichfalls nach Kronberg um. Sie wurden für die Probezeit in zweiZimmern, die möbliert waren, im Wirtschaftstrakt des Schlosses beherbergt.Schon im August 1929 ist meinen Eltern eine Wohnung im Marstallgebäude angetragen worden. Erwurde aufgefordert seine Möbel kommen zu lassen und sich nun hier häuslich einzurichten. Damitwurde er fest eingestellt.Gegen Ende meiner Lehrzeit bat ich Vater sich doch dafür zu verwenden, für mich vorübergehend inder Schloßgärtnerei in Schönberg eine Gehilfenstelle zu verschaffen, weil ich unter keinen Umständenlänger in Liegnitz bleiben wollte. Die Eltern schilderten in ihren Briefen, wie herrlich doch Kronberggelegen sei und wie schön es sich im Schloßpark wohnen ließe. Ich war ganz verrückt in demGedanken, nach Kronberg überzuwechseln. Ich traute aber der ganzen Sache nicht recht, denn eswaren zu jener Zeit sehr schlechte Zeiten in Deutschland. Deutschland hatte im Jahre 19298.000.000 Arbeitslose, und die politische Lage war hoffnungslos. (Hinweis: Ich glaube das war ersteinige Jahre später.)18
Die Landgräfin und ihr Adlatus Oberstleutnant Lange waren also bereit, seinen Sohn in derSchloßgärtnerei Schönberg als Gehilfen zu beschäftigen. Ich sollte dort frei Wohnung und Kost, freieWäsche und ein „fürstliches Gehalt“ von 25 Reichsmark monatlich bekommen. Als mir das Vatermitteilte, sprang ich vor Freude bis zur Zimmerdecke.Emig war platt, er glaubte der Eberhard wird noch ganz zahm werden und ihm aus der Hand fressen.Am 29. September 1929 in der Frühe nahm ich meine Koffer und ging stolz an Emig vorbei ohne ihmund seiner so gütigen Ehefrau Adieu zu sagen. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet und schonlange vor der Zeit mir meinen Abgang so vorgestellt. Ich habe von ihm nie mehr etwas gehört und ervon mir ebensowenig. Als der D-Zug mich in Richtung Westen entführte, nahm ich Abschied vonSchlesien ohne damals zu wissen, daß ich Jahre später nochmals als Soldat nach Schlesien kommensollte. Doch davon später.Abends, -es war schon dunkel, kam ich im Frankfurter Hauptbahnhof an. Es war nicht schwer, dasGleis, auf dem der Kronberger Zug stand, zu finden. Man schrieb mir, Kronberg sei Endstation. Eskonnte also jetzt nichts mehr schief gehen. In Kronberg erwartete mich die ganze Familie, samtmeiner Schwester Erika. Ein Fuhrgespann, Rollwagen von Herrn Abelshausen gelenkt, nahm meineKoffer auf.Wir machten uns aber zu Fuß auf, um den Weg über den Stadtpark zum Marstall in etwa ½ Stunde zudurchmessen. Es war sehr dunkel, von der Umgebung sah ich nichts. Aber es war in mir ein Gefühl,daß ich nun in eine neue Welt eingetreten war.Der nächste Tag kam. Es war ein wunderschöner Tag; die Sonne schien auf die herbstliche Naturund vergoldete mit ihren Strahlen die Landschaft und mein Herz. Zum ersten Mal erkannte ich dieschöne Mittelgebirgslandschaft, die, wie mir schien, dem Glatzer Bergland nicht unähnlich war.Nach dem ersten Frühstück kam der erste Kronberger Bürger, der mir begegnete. Es war derTapezierer und Sattlermeister Anto Weck, der kurz zuvor noch die Wohnung renoviert hatte. Icherzähle das hier deswegen, weil mich später seine älteste Tochter Hanna noch viel beschäftigen wird.Nach einem ausgedehnten Rundgang durch den Park hatte Vater mich der Landgräfin und demOberstleutnant Lange vorgestellt. Ich glaube, ich habe bei beiden einen günstigen Eindruckhinterlassen. Mein Herz jubelte vor Glück. Später gingen wir nach Schönberg in die Schloßgärtnerei,wo mein künftiges Betätigungsfeld war. Beim Betriebsleiter Karl Fleschner meldete ich mich an. Mirwurde das neue Arbeitsgebiet vorgestellt und dem Mann, der mein unmittelbarer Vorgesetzter seinwird. Es war der Obergehilfe Kohl.Im Gegensatz zu Liegnitz hatte ich hier den „Himmel auf Erden“. Ich arbeitete hier bewußt mit demGefühl, daß ich es im Leben nicht hätte besser haben können. Für die Unterkunft war bestensgesorgt. Ich hatte einen Zimmergenossen, Hans Budack, einem Sachsen, mit dem ich michausgezeichnet vertrug. Das Essen war einwandfrei. Fräulein Klara Stahlberg sorgte köstlich für uns.Die Portionen waren mehr als ausreichend. Wir waren bei Tisch 8 Mann. Die schmutzige Wäschewurde wöchentlich eingesammelt und in die Wäscherei, die sich in der Meierei befand, gewaschenund gebügelt. Da ich von Liegnitz aus nicht verwöhnt war, sah ich alle die Annehmlichkeiten als einGeschenk des Himmels an.Nach dem Abendbrot ging ich meistens zu meinen Eltern hinauf und verbrachte dort die gemütlichenAbende. Entweder spielte ich mit Vater Schach, oder wir hörten Radio. Vater hatte sich ein neuesGerät gekauft und war recht stolz darauf.Von meinem „Gehalt“ habe ich Mutter 20 Mark abgeben müssen, da sie mir einen neuen Anzug beiunserem Herrenschneider Knecht in Schönberg schneidern lassen wollte. Die restlichen 5 Marklangten gerade noch für Tabak und Zigarettenpapier. Für andere Dinge reichte das Geld nicht –vielleicht noch für paar Schoppen Apfelwein, der damals 15 Pfennig kostete.Ich war kaum ein Vierteljahr in der Schloßgärtnerei beschäftigt als Anfang Dezember 1929 eineWunde im Leben unserer Familie eintreten sollte. Vater hatte sich während seiner Tätigkeit einenRosen- oder Weißdornstachel in den rechten Daumen gestoßen. Zunächst fand er nichtssonderliches dabei. Aber nach einigen Tagen verschlimmerte sich die Wunde. Unsere Hausarzt, Dr.Kramer, dokterte an dem Daumen solange herum, bis Vater es vor Schmerzen nicht mehr aushalten19
konnte. Auf Veranlassung der Landgräfin mußte Vater ins Städtische Krankenhaus (Frankfurt), demdamals berühmten Chirurgen Prof. Dr. Schneider vorgestellt werden. Er mußte gleich dortbleiben. Erwurde in die Chirurgische Abteilung eingewiesen. Als wir Vater am nächsten Sonntag imKrankenhaus aufsuchten um ihm noch fehlende Wäsche und andere Sachen zu bringen, war seinrechter Arm bereits amputiert. So schnell ging das um sein Leben zu retten. Danach ging es ihmwieder wesentlich besser, und er erholte sich auch rasch wieder. Die beiden Weihnachtsfeiertageverbrachten wir bei ihm im Krankenzimmer. Vater hatte sich mit dem Verlust des rechten Armes baldabgefunden. Die Landgräfin sorgte rührend für ihn. Sie sorgte auch dafür, daß er täglich regelmäßigein kleines Fläschchen Sekt bekam, damit er sich stärken und bald wieder nach Hause zurückkehre.Das erste Weihnachtsfest sollte ich in nun in Kronberg erleben. Wahrlich es war so schön, daß ich esheute noch lebendig im Gedächtnis habe. Die Schloßverwaltung richtete eine Weihnachtsfeier imgroßen Festsaal des Schlosses aus. Landgraf von Hessen sollte die Festrede halten.Wir freuten uns schon Wochen vorher auf diese Weihnachtsfeier.Am 23. 12. 1929 hatten wir schon unsere Arbeit um 4 Uhr nachmittags beendet und uns festlichangekleidet. An langen Tischen waren in Hufeisenform die Weihnachtsgeschenke, mitNamensschildern versehen, aufgebaut. Im Kerzenlicht erstrahlte ein großer Weihnachtsbaum. DerLandgraf hielt die Weihnachtsansprache nicht ohne auf die miese wirtschaftliche Lage, in der sichdamals das Deutsche Reich befand, hinzuweisen. Es gab für jeden nur einige Kleinigkeiten, die unsjedoch riesig erfreuten. Es gab für jeden einen Teller voll Plätzchen, Schokolade, Zigaretten undZigarren und je eine Flasche Wein. In einem Kuvert lagen für Vater 40 und für mich 20 Mark alsWeihnachtsgeschenk. Außerdem bekam jede Familie als Weihnachtsbraten einen Hasen überreicht.(Hinweis vom Artikel „Staatsbankrotte“ des Prof. Dr. jur. Hans Hattenhauer zu Brüning in derZeit vom 30. März 1930 bis zum 30. Mai 1932:Was indessen die Weltwirtschaftskrise angeht, so stand das Reich schon am „Schwarzen Freitag",dem 25. Oktober 1929, am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Es behalf sich mit Kassenkrediten, umnoch Löhne und Gehälter auszahlen zu können. Brüning konnte mit vollem Recht hartnäckig auf dieVerantwortung der Siegermächte für diese Lage hinweisen und Erlass der Reparationslasten fordern.Allerdings ließ sich auch ein erhebliches Stück Mitverschulden der früheren Regierungen nichtleugnen. Das Reich hatte mit Hilfe der Inflation bis 1923 zwar seine Kriegsschulden auf Kosten derSparer liquidiert, danach aber einen neuen Schuldenberg angehäuft. Unter günstigeren Umständenhätte man diesen wohl tragen können, doch war in der Zeit der Wirtschaftskrise daraus nun ein Nagelzum Sarge der Republik geworden.Es gab die folgenden Probleme:Reparationslasten,Abnahme der Wirtschaftsproduktion,Steuerausfälle,Steigen der Arbeitslosenzahlen,Wachsen der Soziallasten,Kapitalflucht,Weltwirtschaftskrise,Bankenkrise,Überschuldung der Landwirtschaft.)Im Januar 1930 konnte Vater wieder nach Hause kommen. Er nahm seine Arbeit wieder auf, obwohlihn die Schloßverwaltung noch einige Wochen Ruhepause zusagte.Vater fand infolge der Amputation des Armes keine so große Behinderung. Das Verhältnis zurLandgräfin wurde immer inniger und bald war er ihr Vertrauter.(Hinweis: Als körperbehinderter stelle ich mir die Änderung aber doch ziemlich schwer vor, dennmeine Großvater war Rechtshänder. Offensichtlich ist unserer Familie für Staphylokokken-Infektionenprädestiniert. Außer meinem Großvater Samuel Kremser, verlor mein anderer Großvater Martin Plank1930 seine Arbeit infolge einer Handentzündung durch eine Brombeer-Dorne, und ich zog mir im20
städtischen Höchster Krankenhaus eine MRSA-Infektion zu mit Spondylodiscitis und Befall derAugen.)In dieser Zeit war es, daß Mutter auffiel, daß ich immer zu Hause war und ich mich kaum anderenMenschen anschloß. Sie drang darauf, daß ich „unter die Leute“ müßte. Über dem Schloßpark unddem Schwimmbad befand sich das Waldcafe Bürgelstollen. Jeden Mittwoch trafen sich dort Bekannteund sonstige Bürger Kronbergs um beim Apfelwein einen Plausch zu tun. Vater war auch immerdabei. Er nahm mich mittwochs immer mit. Es war um den runden Stammtisch immer lustig, wennder Haushofmeister Dose oder sein „Spezi“ Göbel Witze losließen. Oft wurden Karten gespielt. Ichwar dabei mit von der Partie.Eines Abends gesellte sich zu dieser Gesellschaft eine andere hinzu. Darunter waren auch einigeMädchen mit jungen Männern, die ich natürlich nicht kannte. Diese „Nachkömmlinge“ kamen aufeinmal auf den Gedanken nach Schallplatten musikalisch zu tanzen. Man machte die Mitte desLokals frei und Karl Eichenauer legte eine Platte nach der anderen auf. Ein „Fräulein“ wollte absolut,daß ich mit ihr tanze. Ich konnte das natürlich nicht und außerdem schämte ich mich vor denanderen. Das Mädchen wurde immer zudringlicher, bis ich also stocksteif ihr dauernd auf die Füßetrat.Jeden Mittwoch wiederholte sich die Zusammenkunft mit der gleichen „Besetzung“. In der Folgespielten wir Rommee: Kurt Bönicke (Chauffeuer von Lange), Adolf Winter (Bademeister desSchwimmbads Kronberg), Karl Eschenauer (der Sohn des Gastwirts) und meine Wenigkeit. Ab undzu kam Hanne mit Begleitung. Dann wurde auch mal getanzt.Inzwischen wurde Vater wieder krank. Das war wohl März/April 1930. Dr. Kramer behandelte Vatererneut, und zwar auf Rheuma. Als das nicht besser wurde, haben wir ihn wieder zum Prof. Dr.Schneider ins städtische Krankenhaus gebracht. Dort stellte man eine Vereiterung desKnochenmarks im linken Oberschenkelknochen fest. Er mußte wieder operiert werden. Er lag einigeWochen bis zum Hals im Gipsverband. Der Eiter floß durch eine Kanüle ab. Wieder mußten wirmittwochs und sonntags ins Krankenhaus. Um Geld zu sparen fuhr ich jedes Mal mit dem Fahrradvon Kronberg nach Sachsenhausen rund 20 km, einfache Fahrt! Hinzu ging das ja leicht, aber zurückmußte man dauernd bergan strampeln.Vater ging es dauernd sehr schlecht. Wir hatten schon mit seinem Ableben gerechnet, weil keinErfolg zu erkennen war. Er wurde von Woche zu Woche immer weniger. Als man ihm denGipsverband abnahm, brach der Oberschenkelknochen durch. Die sofortige Amputation des linkenBeines mußte vorgenommen werden.Es war schon schlimm für ihn und für uns. Als das Bein aber ab war, erholte sich Vater zusehends.Er nahm wieder zu und sah auch besser aus. Er nahm auch wieder am täglichen Geschehen teil.Seine Genesung dauerte mehrere Monate, zumal er ins Friedrichsheim verlegt wurde um dort eineBeinprothese angemessen zu bekommen. Danach erfolgten die ersten Gehversuche. Ich erinneremich, daß ich Mutter und Erika ständig beistehen mußte. Für sie war es nicht leicht die Ungewißheitzu tragen.Die wirtschaftlichen Verhältnisse im Jahr 1930 wurden immer schlechter. Es gab immer mehrArbeitslose und die Krawalle zwischen „rechts und links“ mehrten sich. Sie wurden immer heftiger undverbissener.(Hinweis: Das Ende parlamentarischer Regierung erfolgte am 27. März 1930 durch Austritt der SPDaus der Großen Koalition. Damit gab es keine Regierung mehr, und das Land wurde durch quasidiktatorischeVollmachten des Reichspräsidenten geleitet. Brüning brachte sein Sanierungsprogrammin einer umfangreichen „Ersten Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen" unter, dieder Reichspräsident gemäß Artikel 48 Abs. 2 WRV unter Gegenzeichnung des Reichskanzlers unddes Reichsinnenministers am 1. Dezember 1930 in Kraft setzte. Es folgten noch drei weitereNotverordnungen.)Die wirtschaftliche Krise ging auch bei der Schloßverwaltung nicht ohne Quereln vorüber. EinesTages ließ mich Oberstleutnant Lange kommen, Mutter war auch dabei. Er eröffnete uns, daß sichdie Verwaltung wegen der derzeitigen Lage ganz gehörig einschränken müsse. Er müsse Eberhardentlassen, da die Gärtnerei z. Zt. gar nichts mehr einbringe. Wer hätte in dieser Zeit denn noch Lustund Geld Blumen und Obst zu kaufen? Er machte einen Vorschlag: Da Vater ja für Monate ausfiel,21
und man auch noch nicht absehen würde, wann er wieder dienstfähig werden würde, könnte jaEberhard die Arbeiten im Schloßpark übernehmen. Auf diese Weise wäre die Weiterzahlung VatersGehalt gesichert. Mutter und ich waren mit diesem Vorschlag einverstanden. Was wollten wir dennsonst noch machen?Der Leidtragende war also ich. Als Taschengeld bezog ich also weiterhin monatlich 5 Reichsmark.Am 01.10.1930 wechselte ich nun meinen Arbeitsplatz und übernahm Vaters Stelle. Im Krankenhauserstatte ich ständig Bericht. Vater gab mir anschließend immer wieder neue Instruktionen.Vater erholte sich zusehends. Im Oktober kam er nach Hause. Doch konnte er lange nicht in „seinenPark“ hinunter, zumal der Winter vor der Tür stand. Er war aber weiterhin mein Berater. Ich wohntenun auch bei meinen Eltern. Aus der „gräflichen Pension“ schied ich aus. (Hinweis, wie ich denVorgang interpretiere: Mein Vater übernahm die Verpflichtungen für seinen Vater, kostete damit dieSchloßverwaltung weder das zusätzliche Zimmer, deren Kost und Wäsche, noch das Arbeitsverhätnisoder die Anwartschaft auf Pension, d. h. Betriebsrente., war aber trotzdem sehr zufrieden.Für Vergnügungen hatte ich wenig Lust. Erstens fehlte mir dafür dasGeld, zweitens mußte ichzusehen, daß ich Vater bei der „Stange“ hielt. Denn manchmal war er niedergeschlagen, weil erseinen Dienst nicht versehen konnte. Ich habe ihn stets aufmuntern müssen.Ab und zu ging ich aber doch hinauf zum Bürgelstollen und kam dabei immer wieder mit meinen„Spezies“ und mit Hanne in Berührung. Hanne wußte auch, daß es mir pekuniär ganz miserabel ging.Trotzdem machte sie sich nichts daraus. Sie selbst nagte ja auch am „Hungertuche“, da sie zu Hauseihre Familie mitversorgen mußte. Sie verdiente sich paar Groschen durch Stickereien, in der sie einewahre Meisterin war.Sie lud mich hin und wieder zu sich nach Hause ein. Ich ging gern hin, weil bei ihnen zu Hause immeretwas los war. Die vielen Geschwister, die etwa im gleichen Alter waren, bildeten ein lustigesHäufchen. Ihre Stiefmutter, Frau Weck, war eine herzensgute Frau. Bei ihnen vergaß ich oft dasLeid, das bei uns ständig zu Gast war. Hanne hatte unter anderm auch einen Bruder. Robert hieß er.Durch ihn kam ich zum Taunusclub, wo wir mit Klampfen und Mandolinen Wanderungen machten und„Konzerte“ gaben. Hanne wurde immer anhänglicher. Aber ich wollte mit meinen 20 Jahren nochkeine Verbindung eingehen, zumal ich erst meine weitere Ausbildung durchlaufen wollte. Das konntenoch Jahre dauern. Eine Verbindung hätte mein Vorhaben nur gehemmt. Vielleicht hatte sieinsgeheim doch die Hoffnung, daß aus uns ein Paar werden würde, - vielleicht?Wand an Wand unserer Wohnung wohnten Abelshausens. Bei ihnen wohnte Mariechen Burk, eineNichte der Frau Abelshausen. Da Mariechens Mutter bei ihrer Geburt gestorben war, zog ihre Tantesie auf. Sie war ein schönes Mädchen, das mir sehr gefallen hatte. Ihretwegen nahm ich Stenostunden;obwohl ich Stoltze-Schrey gelernt hatte, unterwies sie mich in der Einheitskurzschrift. Ich suchteinstinktiv ihre Nähe. Ich war anscheinend nicht ihr Typ, oder war ich zu schüchtern? Oder war esetwa, weil ich mit Hanne gesehen wurde?Fortsetzung auf der Mitte von S. 69:In der Kronberger Zeit hatte ich noch zweimal das Vergnügen mit jungen Mädchen anzubändeln.Einmal war es eine „Köchin“ aus dem Villenviertel, die ich durch Kollegen Budack, der dasKindermädel aus dem gleichen Hause poussierte, kennenlernte. Mit der machte ich baldigst „Schluß“,nachdem Vater urteilte, daß er mit einer solchen „Schönheit“ nicht mal aufs „Scheißhaus“ gehenwollte. (Kommentar: Das hätte ich vielleicht mal gedacht, aber meinen Söhnen sehr vieleuphemistischer gesagt.) Die andere „Annemarie“ hatte ich bei einer Fastnacht kennengelernt. Siewar leider aus Niederhöchstadt, deren Eltern dort eine Gärtnerei hatten. Mit ihr ging ich paarmal aus,aber das gegenseitige Interesse verlor sich bald, wohl auch deswegen, weil mir die „Millionen“ fehlten.Vater mußte nach einiger Zeit wieder nach Frankfurt ins Krankenhaus. Es war für uns schon einKreuz. Inzwischen wurde uns das Krankenhaus so vertraut, daß es bald unsere zweite Heimatgeworden ist. Die Chirurgen kannten ihn schon, besonders Oberarzt Nissen, dessen Sohn später beimir im Gartenamt als Gärtner sein Leben fristete. Der Sohn hatte einen kleinen geistigen Defekt.(Kommentar: Ich erinnere mich, daß unsere Vater erzählte: Die anderen Arbeiter haben ihn geärgertund er verteidigte sich mit dem Hinweis, sein Vater sei Oberarzt. So sind die Menschen: An denBehinderten das eigene Mütchen zu kühlen!) Hier nahmen sie Vater die rechte vereiterte Niere22
heraus. Einige Wochen später mußte man ihm auch noch den rechten Harnleiter herausoperieren. Ertat den Ausspruch: „Was wollte ihr mir denn noch herausschneiden?“Anfang 1932 war es abzusehen, daß es mit Vater wieder aufwärts ging und daß er seinen Dienstkünftig allein bewältigen würde. Er fühlte sich auch wohl und gesund und die Zigaretten schmecktenihm wieder wie früher. (Kommentar: Das übersetze ich nur aus Wahrheitsliebe! Die Zigarettenwaren bestimmt sein Tod! Ich meine sein Tod 1955 war auf Ersticken der Lunge zurückzuführen.)Für mich kam daher die Zeit darüber nachzudenken, wie es mit mir und meiner Ausbildungweitergehen solle. Die wirtschaftlichen Verhältnisse waren immer noch recht mies. Ich bewarb michalso auf zwei Stellenangebote in Vaters Fachzeitschrift. Eine Gärtnerstelle war in Berlinausgeschrieben, die andere in Freiburg im Breisgau. Die Berliner antworteten innerhalb wenigerTage. Gebrüder Niemetz suchten für ihre Großgemüsetreiberei einen „tüchtigen Gehilfen“. Ich sagtezu. Meinen Eltern war das nicht recht; sie haben mich schweren Herzens ziehen lassen. Ich war fürsie noch ein Halt, falls doch noch etwas passieren sollte.In Berlin trat ich die Stellung am 1 April 1932 an. Ich bekam dort freie Unterkunft, Pension und 50Reichmark einschließlich Familienanschluß. Mit einem der Söhne befreundete ich mich an, zumal dasmein Chef und dessen Frau in jegllicher Weise förderte. Es war ein Großbetrieb und keine kleineKlitsche. Bei der Abfahrt in Frankfurt kam überraschenderweise Hanna zur Verabschiedung mit einemgroßen Paket. Meine Abreise wollte ich eigentlich verheimlichen, aber Erika konnte anscheinend denMund nicht halten.Der Abschied war aber kurz und schmerzlos. Hier sei anzumerken, daß unser Abschied endgültigwar. Erst viele Jahre später, als wir beide längst verheiratet waren, sollte eine neue innigeFreundschaft zwischen beiden Ehepartnern entstehen.(Kommentar: Wenn ich mich recht erinnere, war Hanna einige Jahre älter als mein Vater. Sieheiratete einen Handelsvertreter für Pflanzenschutzmittel namens Willi Beckel, von dem mein Vaterspäter für die Stadt einige Mengen abnahm. Später konnte er den Ankauf aber nicht mehr fortsetzen,weil das Sortiment veraltet war. Herr Beckel war ein gut aussehender und gut gekleideter Mann. Daer oft unterwegs war, meinte meine Mutter einmal zu Hanna, ob sie die Abwesenheiten nichtbeunruhige. Da sagte Hanna: „Der kann noch nicht einmal eine einzige Geiß füttern.“ Damit spieltesie darauf an, daß er wegen Hodenhochstand Potenzprobleme hatte. Als er später Krebs hatte, legteer sich als Privatpatient ins Krankenhaus, was meinem Vater nicht gefiel, weil er weder eineKrankenkasse noch Ersparnisse hatte. Als er verstarb, mußte Hanna die Erbschaft ausschlagen unddas Krankenhaus blieb auf den Kosten sitzen sowie Kronberg auf den Beerdigungskosten. MeineEltern habe die Beckels mehrmals besucht. Als meine Mutter ansprach, daß er so schöneKristallgläser hatte, hat Herr Beckel die Gläser sofort eingepackt und meiner Mutter geschenkt. Siesind noch in Zöbingen. Ich glaube, ich war dabei. Jedenfalls war es mir schrecklich peinlich, daßmeine Mutter diese Gläser angenommen hat, und wir uns sozusagen von ärmeren Leuten etwasschenken ließen. Beckels hatten keine Kinder.)In Berlin verstand ich mich mit beiden Chefs ausgezeichnet. Ihre Zuneigung belohnte ich mit großemFleiß und Ehrlichkeit. Der Betrieb hatte 20000 qm Gewächshausflächen und ebensovieleFrühbeetkästen. Die Heizung bezogen sie als Abfallwärme von Großkraftwerken im Spreewald. DasFrühgemüse wurde Tag für Tag in die Großmarkthalle geschafft und dort versteigert. Ich hatte damitallerdings nichts zu tun.Niemetzens Sohn Hans wollte mir auch mal Berlin zeigen. An einem freien Tag machten wir uns alsoauf und fuhren ins Zentrum. Für mich war ja alles neu. Hier konnte ich den Vergleich zwischenFrankfurt und Berlin anstellen. Wir waren im „Haus Vaterland“, am Anhalter Bahnhof, Unter denLinden, Zoo, Kurfürstendamm und die Geschäftsstraße Leipziger Straße. Es gab viel zu sehen undich interessierte mich für alles. Zum Abschluß gingen wir in die „Oase Bar“ um zu erfahren, was esmit den „Lido-Nächten“ für eine Bewandtnis hatte. Gleich der Eintritt kostete eine Stange Geld undreduzierte unseren Barbestand beträchtlich. Erst drinnen wurden wir gewahr, daß wir hier„ausgenommen“ werden sollten.Wir nahmen in einer Nische Platz. Kaum hatten wir uns niedergelassen, kamen schon zwei Lido-Damen und setzten sich auf unseren Schoß. Wir bestellten einen Likör nach dem anderen. Ich fühltemich dabei nicht wohl, weil ich dauernd an mein Portemonnaie dachte. Insgeheim hoffte ich, daßHans uns schon aus der Klemme helfen würde. (Kommentar: Mein Vater hat mir diese für ihn23
unangenehme Situation einmal geschildert: Er mit geringem Einkommen und die beiden Damenbestellten auf ihrer beider Kosten Getränke!) Als es ans Bezahlen ging, reichte das Geld nicht. Eswar sehr peinlich, wir versetzten unsere Armbanduhren und konnten dann schließlich gehen. Da wirkeinen Pfennig für die U-Bahn mehr in der Tasche hatten, tippelten wir bis zum frühen Morgen nachHause. Wir hatten gerade noch soviel Zeit sich umzuziehen um pünktlich zur Arbeit zu kommen.Niemals mehr kam ich in die Versuchung, eine solche Pleite zu wiederholen. Übrigens die Uhrenhaben wir wieder in der Oase Bar eingelöst.(Kommentar: Mein Vater hat auch die politischen Turbulenzen in Berlin mitbekommen. So eineDemonstration gegen Luther (Reichskanzler) mit dem Slogan: Luther schiß in die Butter.)Nach einigen Wochen bei Niemetz erhielt ich plötzlich vom Vater ein Telegramm. Der BotanischeGarten Freiburg fragte an, ob ich noch Interessse an die Besetzung einer freien Stelle im BotanischenGarten hätte. Die Entscheidung für Freiburg fiel mir sehr, sehr schwer. Hier hatte ich mich gerade guteingelebt, und die Arbeit gefiel mir. Ich genoß dort ein großes Vertrauen. Ich schämte mich fastmeine Kündigung den Chefs vorzutragen. Sie fielen aus „allen Wolken“ als ich dann doch kündigte.(Kommentar: Wenn es um die eigene berufliche Zukunft geht, darf man nicht zimperlich sein. Alsder Assistent Hörner bei Prof. Wittmann kündigte, bot Prof. Waldemar Wittmann mir dieAssistentenstelle an. Das habe ich nicht angenommen, weil ich einerseits Prof. Gerhard Gehrig nichtenttäuschen wollte und andererseit UB, der bei Prof. Engel nur Stipendiat war, auch eine Stellebenötigte. Von solchen Sentimentalitäten darf man sich bei einer Berufsentscheidung eigentlich nichtbestimmen lassen! [Trotzdem bin ich mit meinem Lebensweg zufrieden!])Sie konnten es nicht fassen. Aber streng genommen hatte ich die Berliner Stellung nur deswegengenommen, weil ich von zu Hause fort wollte, und weil ich nichts anderes bekommen hatte. Mit derGemüsetreiberei konnte ich in Bezug auf meine Ausbildung gar nichts bezwecken.Ich verabschiedete mich von ihnen, fuhr nach Kronberg zurück, ordnete dort meine Angelegenheitenfür die neue Situation und fuhr am nächsten Tag, am 30.05.1932, nach Freiburg.Am 01.06.1932 begann ich meine neue Tätigkeit, die sich von der in Berlin wie die Nacht vom Tagunterschied. Mein neuer Kumpel Hans Lindner, ein Rektorsohn aus Königsberg, verschaffte mir einschönes, möbliertes Zimmer in der Zähringer Straße 80 bei einem Landschaftsgärtner GustavSchmalzer. Meine neue Bleibe war nur ein Steinwurf weit weg vom Botanischen Garten. ImSchänzle, eine kleinen aber saubere Gastwirtschaft, hatte ich mich für 0,60 RM (Reichsmark) täglichim Abonnement angemeldet. Das Essen war gut und reichlich. Im botanischen Garten hatte ichStundenlohn. Damals betrug der Lohn pro Stunde 0,75 RM, was mir sehr fürstlich vorkam.Ich hatte dort die Warmhausabteilung mit allen tropischen Pflanzen zu betreuen. Mein VorgesetzterMachatzke - mit dem ich heute noch in Verbindung stehe (Kommentar: Das war 1979.) – war mirauch sehr zugetan. Ich hatte es bei ihm sehr gut. Auch das Betriebsklima.Mit den anderen Kollegen war, solange ich in Freiburg war, immer ohne Tadel.Wir hatten alle 4 Wochen Sonntagsdienst. Meistens überließ ich diesen Dienst einem verheiratetenKollegen. Die Verheirateten waren ganz „scharf“ darauf, weil über dem Stundenlohn 100% Zuschlagfür die Sonntagsarbeit gezahlt worden ist.Die Freiburger Zeit war eine der schönsten Zeit, die ich bisher erlebt habe. Ich war frank und frei, ichhatte Geld und war ein freier Mann. Meine Arbeit verstand ich aus dem „effeff“.Meine Wirtsleute waren angenehme Menschen. Sie ließen mich in meinem Zimmer schalten undwalten. Sie kümmerten sich nicht um mich. Morgens um 6:30 Uhr brachte mir Frau Schmalzerlediglich den Kaffee, manchmal ein „bissel spät“, weil sie ja auch so gerne schlief und schwer aus denFedern kroch. Um meine Freizeit weiter zu nutzen trat ich in den dortigen Schlesierverein ein und binauch Mitglied im Freiburger Mandolinen- und Gitarrenverein geworden. Alle 4 Wochen spielten wir imFreiburger Studio des Südwestfunks. Wenn sonst nichts los war, gingen Lindner und ich ins CafeMuseum in der Kaiserstraße. Dort gab es täglich Streichkonzert. Hans Lindner hatte in Zähringeneine Freundin, die er auch öfters besuchte. So hatte halt jeder von uns eigene Verpflichtungen. Ichselbst fand im Schlesierverein und im Mandolinenklub keinen weiblichen Anschluß.24
Dafür aber in der Nachbarschaft. Meiner Behausung gegenüber befand sich ein Milchgeschäft, dasneben Milch auch Butter, Käse und Brot verkaufte. Dort deckte ich stets meinen täglichen Bedarf anLebensmitteln ein. Steinle, so hießen die Leute hatten eine gleichaltrige Tochter Ria. Sie hatte einAuge auf mich geworfen, was ich zuerst gar nicht merkte. Erst später, als sie morgens mit einem2rädrigen Handkarren mit Milchkannen beladen über das Straßenpflaster rumpelte um Milchauszuteilen und dabei Steinchen in mein Zimmer schmiß, dämmerte es mir. Sie war eine rothaarige,aber sonst keine unansehnliche Maid. (Hinweis: Dabei mochte gerade ich die rothaarigen!) Eswaren reiche Leute, sie hatten 4 große Häuser in Freiburg, und sie hatten nur einen Sohn und ebendiese Tochter. Ihr Bruder war mit einer Sächsin verheiratet. Er war Musiker im RundfunkorchesterLeipzig. Diese Frau, also Rias Schwägerin, wollte mich partout mit Ria verkuppeln. Aber immerwieder sah ich meine Laufbahn vor mir. Ich wollte mich nicht binden und außerdem wollte ich auchnicht das Mädchen hinziehen und vielleicht eine andere Chance vermasseln. Es war sehr schwer, Riafernzuhalten. Wer weiß, wenn ich nicht den festen Gedanken gehabt hätte nach Weihenstephan zugehen, vielleicht wäre noch etwas daraus geworden. „Die Liebe wäre vielleicht noch gekommen!“Alle Steinles hatten geglaubt der Botanische Garten wäre meine endgültige sichere Endstation.Ich war manchmal der Versuchung nahe bzw. ich bin öfters in die Verlegenheit gekommen anzubandeln.Schmalzers hatten Freundschaft mit einem gleichaltrigen Ehepaar. Sie hatten ebenfalls eineTochter, die Thea. Sie brachten sie ständig mit. Eines Tages wurde ich von Schmalzers eingeladenund Thea vorgestellt. Sie war groß und schlank und hübsch, aber ich war zu schüchtern und wiederwurde nichts daraus. Mit den Weibern hatte ich in Freiburg meine Last. Durch den Mandolinen- undGitarrenverein lernte ich während eines Konzertes, das wir in den Tonhallen Zürich veranstalteten,eine Apothekerin kennen, die ebenfalls im Züricher Mandolinenverein Banjo spielte. Unsere Vereinetauschten ständig Konzerte aus, so daß wir uns öfters sahen. Auch hier klappte es nicht, weil sie älterals ich war.Um immer etwas von der Heimat Frankfurt-Kronberg zu hören, kaufte ich mir jede Woche auf demFreiburger Bahnhof die Wochenendausgabe den „Frankfurter Generalanzeiger“. Die Zeitung las ichSamstagsabend genüßlich im Bett. U. a. fiel mir in der „Heiratsrubrik“ eine Annonce auf, wonach ein23jähriges ev. Mädchen einen jungen Mann kennen lernen möchte. Am nächsten Tag setzte ich michhin und schriebe auf diese Annonce, mehr zum Spaß, na ja wartest mal ab, was daraus werden wird.Aus diesem Spaß ist später bitterer Ernst geworden.(Hinweis: Die Annonce war von meiner damals 22jährigen Tante Erna aufgegeben worden (geb.25.12.<strong>1910</strong>). Meine Mutter (geb 20.07.1912) war erst 20 alt. Meine Tante hatte einen Stoß Briefebekommen, saß mit meiner Mutter auf einer Bank und gab ihr mehrere interessante Briefe zurweiteren Bearbeitung. Meine Mutter war es nie so recht, wenn ich anderen Menschen erzählte, daßsich meine Eltern durch eine Brieffreundschaft kennengelernt hatten. War ihr das zu künstlich perPost?)Das war genau am 29. April 1933. Nach ein paar Tagen, als ich mittags nach Hause kam, lag aufdem Tisch ein Brief an mich. Die Schrift war mir völlig unbekannt. (Hinweis: Mein Vater schrieblateinisch, meine Mutter sütterlin.) Zuerst wußte ich nicht, wer mir da geschrieben hatte; ich öffneteden Brief und da fiel mir wieder die Annonce ein. Das Fräulein Berta Plank schrieb mir also, daß sienicht abgeneigt sei, mit mir in Briefwechsel zu treten. Der Schriftsatz gefiel mir. Da ich dabei ohnehinkein Risiko einzugehen hatte, begann ich den Briefwechsel. Mit der Zeit lernten wir uns ja kennen.Ich erfuhr von ihr und ihrer Vergangenheit und sie von meiner. Es kam mir nicht darauf an, einMädchen aus Kreisen des Mittelstandes, die verarmt waren, kennenzulernen, als solche die Hab undGut hatten, wie das wohl meine Mutter wünschte. Es sollte halt ein Mädchen mit Herz sein, und daswar meiner Meinung nach Fräulein Berta Plank.Im Laufe der Zeit war ich natürlich sehr neugierig, wie wohl das Fräulein aussah. Sie hatte mir zwarein Bild übersandt, das mir gefiel und meiner Vorstellung entsprach. Aber wie sieht sie denn sonstaus?Zu Pfingsten 1933 sollte eine Zusammenkunft stattfinden. Ich nahm mir ein paar Tage Urlaub undarrangierte das so, daß Bertel am 2. Pfingstfeiertag mit dem 2 Uhr Zug nach Kronberg kommen sollte,wo ich sie abholen wollte. Am Pfingssamstag fuhr ich nach Kronberg, wo ich von den Eltern stürmischbegrüßt wurde. Sie glaubten, ich sei nur ihretwegen gekommen. Zunächst wollte ich keineVerstimmung in den Freudenbecher schütten. Ich sagte zunächst nichts von einem Fräulein Plank.25
Erst am Pfingssonntagabend rückete ich mit der Sprache raus. Mutter war sprachlos, denn sieglaubte wohl immer noch ihren Sohn ganz und für alle Zeiten besitzen zu müssen.Schließlich fand sie sich damit ab. Da ich mich auch am 2. Feiertag nicht ihnen entziehen sollte,machte sie den Vorschlag, das junge Mädchen einfach mit nach Hause zu bringen. Sie wollte, daßwir zusammen Kaffee trinken. Dem Vater war das nur recht. Er war wohl auch neugierig, ob es nichtwieder so ein Typ wäre, wie siehe zuvor, wo er mit einer solchen nicht auf einen gewissen Ortgemeinsam hätte gehen wollen.Voller Spannung holte ich Berta Plank am Bahnhof ab. Der Zug brachte mehrere hundert Ausflügleraus Frankfurt. Es war ja auch ein wunderschöner Sonnentag. Als letzter Fahrgast schritt majestätischein Fräulein mit einem rosa Seidenkleidchen und einem großen Strohhut daher. „Das muß sie dochsein“, ging es durch meinen Kopf. Lächeld kam sie auf mich zu. Wir begrüßten uns und bald war dasEis gebrochen. Unsere ersten gemeinsamen Schritte, - die fortan das ganze Leben gemeinsamwerden sollten -, lenkten wir durch den Stadtpark zum Schloßpark. Dort führte ich sie auch gleich zumRosengarten, der damals in voller Blüte stand. Offen gesagt, ich wollte ihr doch imponieren; ich hatteErfolg damit. Fräulein Plank war begeistert.(Hinweis: Meine Mutter hatte übrigens zeitlebens schlanke Beine, erst nach der Geburt von Herbertbegannen die Krampfadern, die im Alter zu dem RLS (restless leg syndrom) führten. In derVolksschule war sie die schnellste Läuferin ihrer Klasse.)Nun kam es zur ersten Begegnung mit meinen Leuten. Ich muß hier offen gestehen, daß mir das„Herz in die Hose“ rutschte, als ich die Klingel betätigte. Erika öffnete uns. Sie war die erste, die ichmeinem Mädchen vorstellte. Dann kam uns Mutter entgegen und zuletzt Vater. Als ich das Fräuleinallen vorgestellt hatte, wurden wir zu Tisch gebeten. Mutter war reserviert, Vater dagegen sehrzugänglich. Damals fühlte ich schon, daß ich es mit Bertel zu Hause sehr schwer haben würde. Ichging nun aufs Ganze. Der Tag verlief ohne „Zwischenfälle“. Auch wenn ich auf Bertel keinen„stürmischen“ Eindruck gemacht hatte, verabredeten wir uns am darauffolgenden „Wäldchestag“ zurgleichen Zeit. Mutter murrte wie immer, wenn es nicht nach ihrer Pfeife ging. Ich aber ließ mich nichtbeirren.(Hinweis von mir. 1. Mose 2, 24 besagt: „Darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassenund an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch. Schopenhauer nennt das den Willenzum Leben.)Der Nachmittag verlief ganz herrlich; es war wieder ein Sonnentag. Unser Spaziergang führte unszum Viktoriatempel und danach kehrten wir im Waldcafe „Bürgelstollen“ ein. Dort trafen wir auchmeine Eltern draußen im Gastgarten. Wir setzten uns zu ihnen und sahen dem Treiben der Badendenim benachbarten Schwimmbad zu. Auf dem Heimweg zur Bahn - ich sehe das heute noch –überwand ich meine Schüchternheit und gab meinem Fräulein einen zärtlichen Kuß, worauf wir unsdas Du anboten. Der helle Mond war unser Zeuge.Der darauffolgende Tag war mein Reisetag; denn am Donnerstagmorgen mußte ich wieder im Betriebsein. Ich flunkerte daher den Eltern vor, daß ich mit dem 13 Uhr Zug nach Freiburg zurück müßte. Ichverabschiedete mich und fuhr zum Bahnhof Frankfurt-West, wo mich Bertel abholte. Nun war es ich,der an der Reihe war, sich beschnüffeln zu lassen. Ich sehe es heute noch, als wir beide von derGroßen Seestraße in die Mühlgasse einbogen, 3 Frauenkopfe aus den Fenstern des 2. Stocksherausstreckten, um das Paar vorab zu belugen.Ich wurde also den Planks artig vorgestellt. Vater Plank stand gebügelt und gestriegelt im bestenAnzug vor mir. Er begüßte mich sehr freundlich. (Hinweis: Normalerweise soll er damals alsArbeitsloser ziemlich unrasiert ausgesehen haben, aber er wollte die drei Töchter verheiratet sehen,was nur bei meiner Mutter erfolgt ist.) Danach kamen die beiden Schwestern dran, Erna und Else,und zuletzt Bertels Freundin Wilma Augstein, die mich auch begutachten mußte. Mutter Plank war zudieser Zeit verreist bei ihrem Bruder in Traunstein.(Hinweis: Meine Großmutter Wilhelmine Plank hatte eine sehr gute Beziehung zu ihrem BruderWilhelm Gackstatter, Justizoberinspektor am Amtsgericht Traunstein. Diese innige Beziehung kommtmeiner Meinung nach auch in der Bitte meiner Urgroßmutter Margarete Gackstatter geb. Schwarzzum Vorschein, wo sie schreibt, daß sie hoffe am jüngsten Gericht sagen zu können, daß diesebeiden (ihre Kinder) nicht verloren gegangen seien. Es war noch ein Bettelbrief des Wilhelm26
Gackstatter an meinen Großvater Martin Plank wegen des Geldes für einen Mantel vorhanden,letzterer war aufgrund seines Erbteils, auch von einer Tante, für die damalige Zeit (bis zur Inflation)wohlhabend war.)Mir ist nicht bekannt, welchen Eindruck ich diesen Leute gemacht habe. Später berichtete mir Bertel,daß Schwester Erna an jenem Tage ihr gegenüber geäußert hatte: „Nun ja, der Herr Kremser ist jaein netter Mann, aber mein Typ ist er nicht.“ Dabei hatte eigentlich die Erna die Heiratsannonceaufgegeben und Bertel kam nur rein zufällig auf meine Adresse. Jedenfalls war es ein gelungenerNachmittag und Abend. Um 23 Uhr ging mein letzter Zug nach Freiburg. Der Abschied von denschönen Tagen fiel mir nicht leicht.(Hinweis: Tante Erna hatte am meisten Familiengefühl in meiner Familie, insbesondere mochte siemich sehr. Es existiert immer noch ein Kalender, der seit dem 1. November 1946, d. h. seit dem Tagmeiner Geburt, nicht mehr umgeschlagen worden ist. Vermutlich stammte der Kalender von ihr.(Wenn ich gestorben bin, könnt ihr mir den Kalender ins Grab legen.) Sie liebte vermutlich höheregeistige Gaben ohne selbst deren teilhaftig geworden zu sein. Sie hatte ein unglückliche Liebschaftmit dem 20 Jahre älteren evangelischen Hausener Pfarrer Perizonius, der mich getauft hat, und istüber diese Unglück nicht mehr hinweggekommen. Dieser evangelische Pfarrer hatte Beziehungen zumehreren Frauen parallel. Deswegen forderte die Synode von ihm, daß er eine von ihnen heiratensollte. Seine Wahl fiel auf die junge Anna Steigerwald, die nach dem Tod ihres Mannes, des Pfarrers,angeblich Selbstmord machte. Zu dieser ganzen problematischen Geschichte paßt gut, daß derLieblingsroman meiner Tante „Zwei Menschen“ von Richard Voß war, worin es um dieLiebesgeschichte eines Mönchs namens Rochus im Kloster Neustift/Brixen ging.)Meine Eltern fuhren jedes Jahr, wenn sie es sich erlauben konnten, in die „Sommerfrische“. Diesmalwollten sie mal zu mir nach Freiburg, der Hauptstadt des Schwarzwaldes. Ich besorgte alles für meineEltern: ein schönes großes Zimmer mit 3 Betten mit Küchenbenutzung. Das war Juli/August 1933während der großen Ferien (seiner Schwester Erika). Sie blieben volle 4 Wochen in Freiburg. Esgefiel ihnen recht gut. Abends, wenn ich frei hatte, war ich bei ihnen. Abends gingen wir ins CafeMuseum oder ins Cafe Kopp, wo man auch tanzen konnte. Während der Wochenende machten wirSpaziergänge in die nähere Umgebung. Trotz der Behinderung, die Vater keine großen Sprüngemachen ließ, waren wir zweimal auf dem 1300 hohen Schauinsland. Am Tage gingen wir entwederauf den sanft ansteigenden Schloßberg oder in den schönen Stadtpark in dem auch allerhand los war.Eines Abends waren wir auch im Cafe Kopp. Da es ein lauer Sommerabend war, setzten wir uns indes Gastgarten. Dort war auch ein Tanzpodium aufgebaut. Zufällig traf ich dort auch Ria Steinle, diefortwährend zu unserem Tisch herüberschaute. Ich holte sie zum Tanze. Mutter meinte sie mögesich doch an unseren Tisch setzen, was sie auch freudig tat. Wir haben dort einige schöne undfröhliche Stunden verlebt und hielten es dort solange aus, bis die Musikanten ihre Geigen einpackten.Während ihres Aufenthalts war auch wieder ein Mandolinen-Konzert beim Schwesterverein Zürich inder Tonhalle fällig. Da im Omnibus noch Platz war, nahm ich Mutter mit, die gern in derWeltgeschichte herumkutschierte. Es war auch ein Ausflug zum Vierwaldstättersee bis nach Flüelenvorgesehen. Mutter war von der Fahrt sehr begeistert. Bei dieser Gelegenheit konnte ich ihr auchmeinen „Schwarm“, jene Apothekerin, vorstellen. Mutter hat mir später oft erzählt, wie gern sie sichan die Schweizer Fahrt erinnerte. „Daß die Welt so schöne sein kann“, hätte sie erst jetzt erfahren.Im Oktober 1933 machte ich nochmals eine ganz kurze Stippvisite in Frankfurt. Es waren auch nur 2oder 3 Tage, wo wir uns sehen durften. Ich erinnere mich noch, wie Bertel und ich die Hausfrauenausstellungin der Festhalle besuchten.Am 2. Weihnachtsfeiertag aber besuchte mich Bertel in Freiburg. Ich besorgte wieder das gleicheZimmer, das die Eltern hatten. Es war nur ein Steinwurf weit weg von meinem Zimmer. Wir verlebtenin Freiburg wunderschöne Stunden. Da ich leider keine Urlaub hatte und mich außer den Festtagenihr nur nach Feierabend widmen konnte, hatte sich ihrer mein Freund Hans Lindner angenommen, derdamals krank geschrieben war. Ich war ihm sehr dankbar, daß er Bertels freie Stunden ausfüllenkonnte.An dieser Stelle muß ich von einem Vorfall erzählen, der mich beinahe um mein junges Glückgebracht hätte. Nämlich Bertel begleitete mich täglich nach dem Mittagessen in den BotanischenGarten. Auf dem Rückweg zu ihrem Zimmer folgte ihr Frau Steinle, Rias Mutter. Sie hielt Bertel an27
und fragte sie, ob der Herr Kremser etwa ihr Bräutigam sei? „Sie hätte hier nicht zu suchen, denn derHerr Kremser sei bereits ihrer Tochter Ria versprochen und seine Eltern wären bereits damiteinverstanden. Das wäre während ihrer Ferien hier in Freiburg so abgemacht worden!“Bertel war wie geschlagen –sehr verständlich; ich aber auch! Bertel wollte sich gleich wieder zurRückfahrt nach Frankfurt fertig machen, ohne sich von mir zu verabschieden. Es war nur HansLindner zu verdanken, daß sie blieb. Ich hatte es sehr schwer ihr klar zu machen, daß ich mit Riaüberhaupt nichts hatte. Warum sollte ich auch? Durfte ich nicht mit einem Mädel ein paar freundlicheWorte und Scherze machen, ohne gleich an Heirat zu denken? Bertel glaubte mir dann auch, und ichwar glücklich, daß das alte Vertrauen wieder hergestellt war. Die schöne Freiburger Zeit war nach 8Tagen leider wieder abgelaufen. Sie mußte nach Hause zurück, weil sie durch ihre Einkünfte von derSchneiderei ihre Eltern mitunterstützen mußte. Vater Plank war seit Jahren arbeitslos. Bertel war einfleißiges und pflichtbewußtes Mädchen. Berrtel verdiente damals 19 Reichsmark die Woche.(Hinweis: Meine Mutter sagte, daß sie Freiburg in demselben Status verlassen hat, wie sie ihnbetreten hatte! Sie hatte eine Schneiderlehre bei Abraham & Zechermann absolviert, einer jüdischenFirma, über die sie sich nie beschwert hat. Ihre Schwester Else hat sie dann überredet der besserenEinkünfte wegen sich selbständig zu machen. Das machte sie, hatte dann aber noch mehr Arbeit beiunsichereren Einkünften. Tante Else hat gelernt und gearbeitet bei einem jüdischenWäschehandelshaus, Gebrüder Seemann, die ca. 1938 nach Südamerika gingen. Bei der Auflösungdes Wäschegeschäfts hat meine Tante viel übernommen. Dabei fällt mir noch folgendes ein: ImZweiten Weltkrieg schickte sie ein ca. 10 kg schweres Wäschepaket mit Damasttischdecken usw.nach Walxheim, um es vor der alliierten Bombardierung zu sichern. Nach 1945 kam die Wäschezurück nach Frankfurt-Hausen „An den Postwiesen 27“. Nach ihrem Tod 1999 habe ich es ungeöffnetgefunden und wieder nach Zöbingen gebracht, wo ich es bisher noch nicht aufgemacht habe. Wirsind also tatsächlich sehr wenig bedürftig. Das meisten Güter belasten uns eigentlich. Trotzdemkönnen wir der Versuchung so schwer widerstehen, Güter zu besitzen!)Die letzten Monate brachen für mich in Freiburg an. Nach Neujahr <strong>1934</strong> hatte ich mich für einFachstudium, Fachrichtung Gartengestaltung in Weihenstephan, angemeldet. Hans Lindner, der mitmir sehr verbunden war, wollte allein nicht zurückbleiben. Er meldete sich gleichfalls an. Nacheinigen Wochen kam die Bestätigung zur Aufnahme. Schweren Herzens kündigten Hans und ich beider Verwaltung. Man war erstaunt, daß wir beide eine sichere Lebensstellung aufgaben. Es halfjedoch nichts; wir wollten beruflich weiterkommen.Ende Februar <strong>1934</strong> machten wir uns auf und fuhren gemeinsam nach Freising, 30 km nördlich vonMünchen. Dort angekommen verfielen wir beide gleich in eine Art tiefer Depression. Was die„landschaftlichen Reize“ dieser Gegend anbelangt, war es eigentlich eine Sünde diese mit der inFreiburg zu vergleichen. Weihenstephan, ein ehemaliger Klosterkomplex, stand auf einem etwa 100m hohen Hügel, der einsam aus der Ebene herausragte. Das versöhnte uns etwas, weil man von dorteine herrliche Aussicht auf das Freisinger Moos und bei klarem Wetter die gesamte Alpenkette vorsich hatte.Nach der Ankunft gingen wir erst zum Zimmernachweis des Studentenbundes „Balduria!“ Die Leuteschickten uns in die Wippenhauserstraße 87 zum Postsekretär Josef Maier, der dort einen Neubauerrichtet hatte.Im Kniestock (?) des Hauses waren 2 Mansardenzimmer frei. Für zusammen 50 RM nahmen wirbeide Zimmer, eins als Schlaf-, eins als Arbeits- und Wohnraum. Wir richteten uns gemütlich ein.Zum Frühstück gab es lediglich Kaffee, den wir in ihrer großen Wohnküche einnahmen. Für dieVerpflegung sorgten wir selbst. Zum Mittagessen haben wir uns in der Studentenkneipe imAbonnement für 50 Pfennig je Mahlzeit angemeldet. Für das Geld konnten wir keine fürstlicheMahlzeit verlangen, aber sie war gut und reichlich. Zunächst hatte ich ja noch etwas Eigenkapital, dasmich für einige Zeit „über Wasser“ hielt. Davon schaffte ich mir auch die notwendigen Lebensmittelan, was nicht billig war und ins Geld lief. Vor allem das Zeichenmaterial und die Lehrbücher warenteuer. Meine Eltern waren gütigerweise bereit mit monatlich eine Überweisung von 90 RM zugewährleisten. Oftmals war ich am Ende des Monats so abgebrannt, daß ich schon Tage vor demErsten auf den Briefträger mit Sehnsucht wartete. Mutter war leider nicht von der „Geberseite“geprägt. Es gab nicht mehr; mit 90 RM mußte ich auf alle Fälle auskommen. Das habe ich auch inder ganzen Freisinger Zeit mir vor Augen gehalten. Schulden wurden nicht gemacht. Selbst HansLindner hätte ich um Geld nciht angehen können. Lieber aß ich am Ende des Monats trockenes Brot.28
(Hinweis: Mein Vater hat sogar erzählt zum Monatsende regelrecht gehungert zu haben. Sein Lebenlang hat er nie Schulden gemacht. Solange sie das Haus in Zöbingen zurückgezahlt haben, hatmeine Mutter aus einer Bratwurst mehrere Frikadellen gefertigt! Sobald er die Schuldenzurückgezahlt hatte, war er dann auch zu seinen Söhnen ausgesprochen großzügig. So habe ich1989 seinen alten grünen Audi 100 geschenkt bekommen. In diesem Sommer habe ich zum letztenMal Martin nach Zöbingen gebracht. Er war damals auch damit einverstanden.)Am nächsten Tag pilgerten wir beide den Berg hinauf um uns der Aufnahmeprüfung zu unterziehen.Es waren etwa 85 „Neulinge“ zugegen. Wir beschnüffelten uns und schlossen gleich eine gewisseKameradschaft, die ja 4 Semester lang anhalten sollte. Vom Direktor wurden wir begrüßt und demLehrkörper vorgestellt. Die Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau war ein Anhängsel derLandwirtschaftlichen Hochschule in München. Bei der nun vorgesehenen Aufnahmeprüfung wurdesie auch auf diesem Niveau ausgerichtet. Hans Lindner und ich bestanden diese Prüfung sehr gut.Am 01.03.<strong>1934</strong> konnte nun mein neuer Lebensabschnitt beginnen.Die ersten beiden Semester waren sehr stramm. Ich stürzte mich mit Eifer auf meine neue Aufgabe.Hans und ich versäumten keine Vorlesung und nachmittags saßen wir ernsthaft über unsereKolleghefte und paukten. Wir waren schon etwas älter als die anderen und wußten auch worum esgeht. Für mein späteres Fortkommen erschien es mir auch wichtig der Studentenvereinigung„Balduria“ beizutreten. Hier hatte ich auch die Gelegenheit mit einflußreichen Leuten desBerufsstandes Fühlung zu nehmen. Während der verschiedenen Pflichtübungen und Kneipen derBalduria hielt ich mich zurück. Einmal fehlte mir das Geld dazu, und zum anderen war ich dazu nichtgeeiget. Viele meiner Kollegen waren von Hause aus reich „betucht“. Es waren viele Söhne vonGärtnereibesitzern dabei, die sich manches erlauben konnten. Hans Lindner war kein Baldure.Der National-Sozialismus hatte im Herbst alles „gleichgeschaltet!“. So mußten wir „freiwilliggezwungen“in den neugeschaffenen SA-Studentensturm eintreten. Die Balduria blieb nochunangetastet. Nun mußten wir fortan im Sturm 2/J. 5 für „unseren geliebten Führer“ Dienst tun. Vonunserem Semester gab es Leute, die sich nun in der Folge als Scharfmacher herausschälten. Daswaren für uns, die zur SA gezwungen waren, gefährliche und auch gefürchtete Leute. Verbissen tatenwir unseren „Dienst Mittwochnachmittag“ und das Wochenende waren die Zeiten, die wir in„Wehrübungen“ und „Gepäckmärsche“ unsere kostbare Zeit vertrödeln mußten.Hans Lindner hatte es fertiggebracht, sich durch ärztliches Attest freizustellen. Seitdem bestandzwischen uns ein gespanntes Verhältnis. Ich konnte es einfach nicht ertragen, daß er nun bessergestellt war als ich.(Hinweis: Vielleicht wollte mein Vater mit dieser Episode betonen, daß er keinesfalls gern den SA-Dienst machte. Als er dann später einmal herausfand, daß Hans Lindner die Briefe meiner Mutterheimlich las, kam es zwischen ihnen zu einem großen Krach.)Mit unseren Wirtsleuten kamen wir prima aus. Herr Maier, kriegsbeschädigt, hatte ein künstlichesBein, war ein gutmütiger Mensch, zu jedem Scherz aufgelegt. Frau Maier dagegen war humorlos unddazu sehr knickrig. Sie konnte um jeden Pfennig streiten. Trotzdem hatten wir sie gern, weil sie unssonst machen ließ, was wir wollten.Als wir schon im 3. Semester waren, wurde Herr Maier von der Post befördert, und er wurde ausdiesem Grunde in ein größeres Postamt in München versetzt. Das bedeutete für uns den Auszug ausunserer liebgewordenen Wohnung, weil das Haus an einen anderen Interessenten vermietet werdenmußte, der uns nicht gebrauchen konnte.Wir fanden eine neue Heimat in der Haydstr. 15 bei Frau Burgmayer, die Witwe war und mit ihrerTochter Luise, „Lu“ genannt, zusammenlebte. Lu war etwa in unserem Alter. Hier war auch derVersuchung nahe „anzubandeln“. Aber ich hatte mir schon einmal die Finger verbrannt. (Vermutlichmeint er die Ria Steinle.) Ein zweites Mal wollte ich das nicht mehr riskieren, zumal ich bereits inFrankfurt in der Mühlgasse „versprochen“ war. Lu tröstete sich dann mit einem Feldwebel Seitz, derjedoch beträchtlich jünger war als sie. Auch dort hatten wir es sehr gut. Wir gewöhnten uns dortschnell ein, zumal Frau Burgmayer eine gewisse Wärme ausstrahlte.Meine freie Zeit verbrachte ich entweder in München oder beim Baden in der Amper. Die Isar führte inden Sommermonaten zu wenig Wasser. Ich hatte mir ein Fahrrad zugelegt, mit dem ich allein durchdie Gegend streifte. Dadurch hatte ich auch die Umgebung sehr gut kennengelernt. Zu Pfingstenmachte ich mit noch einem Freund eine Fahrradtour nach Berchtesgaden.29
Es war eine herrliche Fahrt bei schönstem Wetter. Unterwegs machten wir in Traunstein halt undübernachteten bei Bertels Verwandten Gackstatter, wo wir köstlich bewirtschaftet und aufgenommenwurden. (Hinweis: Der Wilhelm Gackstatter, Justizoberinspektor am Amtsgericht Traunstein, war derBruder meiner Großmutter Wilhelmine Plank.) Ich glaube, daß wir auf dem Rückweg vonBerchtesgaden dort noch einmal übernachteten.Im Sommer <strong>1934</strong> wurde unser SA-Sturm, der zur Leibstandarte Adolf Hitler gehörte, plötzlich perLastwagen nach München verfrachtet. Kein Mensch wußte warum. Wir standen den ganzen Tag inder Leopoldstraße herum, ohne daß sich was tat. Später erfuhren wir, daß unser oberster SA-FührerRöhm gegen Hitler putschen wollte. Der Putsch mißglückte. Röhm wurde erschossen.Die großen Sommerferien, die von Ende Juli bis Ende September dauerten, verlebte ich in Kronberg.Es waren immer herrliche Tage, die ich daheim und bei der Bertel verleben durfte. Zwar bekam ichvon den Eltern Aufgaben und Pflichten zugewiesen. Aber im großen und ganzen hatte ich genug Zeitmit Bertel im Taunus herumzustolzieren. Da sie allerdings auf den Geldverdienst achten mußte, warihre Freizeit leider ganz kurz bemessen. Wir kamen nur – nach meiner Erinnerung – anMittwochnachmittagen und an den Wochenenden zusammen. Meine Mutter sah diesem Treiben mitUnbehagen zu. Am liebsten hätte sie mir die monatliche Zuweisung entzogen, aber sie wußte, daßich da nicht mitmachte.Gegen Ende der Semesterferien haben wir jeweils mehrtägige Exkusionen gemacht. Sie sollten dentheoretischen Stoff, der wir in der Vorlesung durchgenommen hatten, in der Praxis abrunden. Einmalfuhren wir im Bayernland herum und besichtigten Kirchen, Schlösser und historische Gartenanlagen.Im 3. Semester fuhren wir durch Baden-Württemberg, wir kamen von Stuttgart bis nach Frankfurt, wouns damals Gartenbaudirektor Bromme in sehenswerten öffentlichen Gartenanlagen herumführte.Damals konnte ich es nicht ahnen, daß Bromme mal mein Chef werden sollte. In Frankfurt warSemesterschluß. Ich blieb gleich in Frankfurt, die anderen fuhren wieder zurück nach Freising.Die Studienzeit in Weihenstephan ging langsam zu Ende. Bereits im Dezember begannen dieKlausurarbeiten. Im Februar 1936 kam die mündliche Prüfung. Ich hatte nichts zu befürchten;gelassen und ohne Prüfungsangst ging sie an mir vorüber.. Ich kam am Ende mit der Note „gut“durch. Mit dieser Note hatte ich mir nach dreijähriger Praxis den Zugang zur 2. Staatsprüfungerworben.Nach Abschluß der Prüfung war man Gartenbautechniker und mit der Aushändigung der Zeugnissedas Studium beendet. Der Abschied von Freising fiel mir nicht schwer. Ich verabschiedete mich vonmeinem langjährigen Freund Lindner, den ich niemals mehr wiedersehen sollte. Er kehrte in seineHeimat Königsberg zurück.Ich fuhr nach Kronberg zurück um von hier aus eine neue Stellung zu suchen. Eine Bewerbung füreine Technikerstelle in Halle/Saale kam bereits wieder zurück mit der Bemerkung, „die Stelle ist leiderschon besetzt! Ein Studienfreund des älteren Semesters hatte die Stelle wegen besserer praktischerErfahrung erhalten (Hensel). Ich bewarb mich fleißig weiter, soweit passende Stellen ausgeschriebenwaren. Mutter hatte im Sinn, mich schnellstens wieder loszuwerden, je weiter desto lieber. Ihr warenmeine innigen Kontakte zu meiner Bertel ein Dorn im Auge. Der Aufenthalt zu Hause wurde mirimmer mehr verleidet. Ich hatte zu meinen Eltern und zur schönen Umgebung keine große innereBeziehung mehr. So schön, wie ich’s mir in der Fremde ausgemalt hatte, war es zu Hause und inKronberg nicht mehr.(Hinweis: Obwohl meine Mutter eine hübsche Frau war und auch sittlich einwandfrei, war sie nicht diePartie nach der Wahl meiner Großmutter. Sie wollte etwas standesgemäß besseres haben für meinenVater und möglichst wohlhabend. Mein Großvater Plank hatte jedoch sein Erbe, 20000 Goldmark,das wären heute 7,8 kg Gold, in der Inflation verloren und hat dann eine Siedlerstelle nach demReichsheimstättengesetz erhalten. Wegen dieser unklugen Haltung meiner Großmutter kam meinVater immer mehr in den Konflikt zwischen seiner Mutter und Ehefrau. Diese eskalierte letzendlichderart, daß er von seinen Eltern enterbt wurde, und ich meine Großmutter, die 1954 starb, niepersönlich kennenlernte, weil sie ab 1946 miteinander „bös“ waren.)Eines Tages erhielt ich von meinem ehemalige Dozenten Wilzcek aus Freising (er war derInstitutsleiter für Gartengestaltung) ein Schreiben, in dem er mir mitteilte, daß er für mich eineinteressante Technikerstelle in München besorgen könnte. Es war eine große und bekannte Berliner30
Firma, die in München ein Zweigbüro unterhielt und zwar in der Nikolaistraße. Die Eltern waren„Feuer und Flamme“ für dieses Angebot. Um ihrem Drängen zu entgehen, sagte ich zu.Mutter drückte mir ganze 50 RM in die Hand mit der Bemerkung sie schleunigst zurückzuzahlen, wennich das erste Gehalt bekomme.Der Abschied von Kronberg fiel mir nicht schwer. Am 25.02.1936 trat ich die Stelle bei der FirmaFörster an. Ich hatte mir eine gemütliche Unterkunft in Schwabing in der Ain(?)müllerstraße 15besorgt. Es war mir sehr lieb, daß mir meine Wirtin, Frau Strang, die Sorge der Selbstverpflegungabnahm. Ich war bei ihr in Vollpension. Ich war mit der Verpflegung sehr zufrieden. Sie war Witweeines Memminger Bauunternehmers und zum zweiten Male mit einem Finanzbeamten verheiratet –das war eine Seele von Mensch. Mit ihm bin ich fast jeden Sonntagmorgen im benachbartenEnglischen Garten spazieren gegangen.In der Münchner Zeit, es war Pfingsten 1936, kam Bertel zu mir. Wir hatten uns lange genug geprüft.Hier haben wir uns verlobt. Frau Strang hatte für sie ein Zimmer bereitgestellt. Auch hier verlebtenwir ein paar schöne gemeinsame Tage. Viel Zeit hatte sie leider wieder nicht. Sie mußte ja für ihreFamilie sorgen. (Hinweis: Die Kinder der Arbeitslosen mußten einen Teil ihres Einkommens an ihreEltern abgeben. Da gab es dann natürlich auch wieder Konflikte, weil die Tante Else nicht oder nichtausreichend abgeben wollte.) Meine Eltern waren von dieser Verlobung ganz und gar nicht angetan.Von diesem Zeitpunkt an hatten wir uns für lange Zeit entzweit. Wir konnten es nicht begreifen,warum sie gegen die Bertel waren. Ihre Uneinsichtigkeit hat sie um viele schöne gemeinsame Tagegebracht.(Hinweis: Mein Großvater konnte sogar meine Mutter gut leiden und sagte zu seiner Frau, was hastDu denn gegen sie, sie ist doch ein schönes Mädchen!)Meine Technikertätigkeit in München sagte mir nicht zu. Ich hatte in verschiedenen Stadtteilen dieOberaufsicht von Baustellen zu führen.☺31