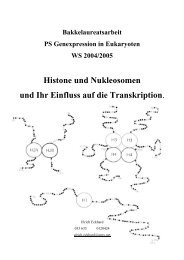N N - StV Biologie Salzburg
N N - StV Biologie Salzburg
N N - StV Biologie Salzburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
VO<br />
Populationsbiologie<br />
WS 2009/2010<br />
Haslett / Heiselmayr / Comes<br />
Version 0.1 vom 26.01.2009<br />
Version 1.0 vom 26.01.2010<br />
1/143
VO Populationsbiologie<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Vorwort.................................................................................................................................<br />
4<br />
1.1 Version 0.1.....................................................................................................................<br />
4<br />
1.2 Version 1.0.....................................................................................................................<br />
4<br />
1.3 Lizenz............................................................................................................................<br />
4<br />
2 Teil Prof. Haslett...................................................................................................................<br />
5<br />
2.1 Begriffsdefinitionen........................................................................................................<br />
5<br />
2.2 Überlebenskurven..........................................................................................................<br />
6<br />
2.3 Diagrammatische Lebenstafeln......................................................................................<br />
8<br />
2.4 Statische- und Kohortenlebenstafel...............................................................................<br />
9<br />
2.5 Populationsdynamik.....................................................................................................<br />
12<br />
2.5.1 Intrinsische Faktoren..............................................................................................<br />
13<br />
2.5.2 Abhängigkeit von Natalität und Mortalität...............................................................<br />
15<br />
2.6 Mathematische Modelle...............................................................................................<br />
16<br />
2.7 Räumliche Faktoren.....................................................................................................<br />
21<br />
2.7.1 Parasitoiden...........................................................................................................<br />
21<br />
2.7.2 Nicholson-Bailey-Modell (1935) ............................................................................. 22<br />
2.7.3 Modell von Comins (1992) .................................................................................... 25<br />
2.8 Metapopulationen........................................................................................................<br />
27<br />
2.8.1 Inseltheorie (Inselbiogeographie) ........................................................................... 27<br />
2.8.2 Levins Metapopulationsmodell (1969-70) .............................................................. 29<br />
2.8.3 Source and Sink....................................................................................................<br />
30<br />
2.8.4 Kritik am Levins Modell..........................................................................................<br />
32<br />
2.9 Angewandte Populationsbiologie.................................................................................<br />
33<br />
2.9.1 Naturschutz............................................................................................................<br />
33<br />
2.9.2 Räumliche Verteilung.............................................................................................<br />
36<br />
2.9.3 Rote Liste...............................................................................................................<br />
39<br />
2.9.4 Populationsdynamik im Zusammenhang mit Klimaveränderung............................<br />
40<br />
3 Teil Prof. Heiselmayer........................................................................................................<br />
41<br />
3.1 Populationsbiologie bei Pflanzen.................................................................................<br />
41<br />
3.2 Diasporenausbreitung..................................................................................................<br />
41<br />
3.2.1 Fruchtformen.........................................................................................................<br />
42<br />
3.2.2 Ausbreitungstypen.................................................................................................<br />
43<br />
3.2.3 Ausbreitungsstrategien..........................................................................................<br />
61<br />
3.3 Diasporenpool - Diasporenbank...................................................................................<br />
63<br />
3.3.1 Grundtypen der Diasporen.....................................................................................<br />
64<br />
3.4 Keimung und Etablierung.............................................................................................<br />
70<br />
3.4.1 Keimruhe...............................................................................................................<br />
70<br />
3.4.2 Keimstimulanz.......................................................................................................<br />
72<br />
3.4.3 Schutzstellen - Safe Sites......................................................................................<br />
74<br />
3.4.4 Etablierungswachstum...........................................................................................<br />
77<br />
3.5 Wachstum und Entwicklung.........................................................................................<br />
77<br />
3.5.1 Wachstum..............................................................................................................<br />
77<br />
3.5.2 Entwicklung............................................................................................................<br />
82<br />
3.5.3 Variation und Plastizität.........................................................................................<br />
85<br />
3.6 Klonales Wachstum.....................................................................................................<br />
86<br />
3.6.1 Morphologie...........................................................................................................<br />
86<br />
3.6.2 Typen des klonalen Wachstums............................................................................<br />
88<br />
3.6.3 Strategien..............................................................................................................<br />
96<br />
3.7 Regeneration...............................................................................................................<br />
98<br />
3.8 Bestäubung und Befruchtung.......................................................................................<br />
99<br />
3.8.1 Selbstbefruchtung (Autogamie) .............................................................................. 99<br />
3.8.2 Allogamie – Fremdbefruchtung............................................................................<br />
100<br />
3.8.3 Bestäubungsmedien............................................................................................<br />
100<br />
2 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.8.4 Reizmittel.............................................................................................................<br />
106<br />
3.8.5 Spezialisierungen.................................................................................................<br />
106<br />
3.9 Fortpflanzung.............................................................................................................<br />
112<br />
3.9.1 Ressourcenverteilung..........................................................................................<br />
113<br />
4 Teil Prof. Comes..............................................................................................................<br />
114<br />
4.1 Darwin und Evolutionstheorie.....................................................................................<br />
114<br />
4.1.1 Darwins Argumente und Schlussfolgerungen......................................................<br />
115<br />
4.1.2 Selektion..............................................................................................................<br />
116<br />
4.2 Variation.....................................................................................................................<br />
118<br />
4.2.1 Kontinuierliche/diskontinuierliche Variation..........................................................<br />
118<br />
4.2.2 Ontogenetische / entwicklungsbedingte Variation................................................<br />
120<br />
4.2.3 Modifikation/Phänotypische Plastizität.................................................................<br />
120<br />
4.2.4 Genetische Variation............................................................................................<br />
124<br />
4.3 Selbstbefruchtung......................................................................................................<br />
131<br />
4.4 Populationsgenetik.....................................................................................................<br />
133<br />
4.4.1 Genfluss...............................................................................................................<br />
133<br />
4.4.2 Genpool...............................................................................................................<br />
133<br />
4.4.3 Hardy-Weinberg-Gleichgewicht...........................................................................<br />
135<br />
4.4.4 Flaschenhalseffekt und Genetische Drift..............................................................<br />
137<br />
4.4.5 Gründereffekt.......................................................................................................<br />
138<br />
4.4.6 Hybridisierung......................................................................................................<br />
141<br />
3 / 143
VO Populationsbiologie<br />
1 Vorwort<br />
1.1 Version 0.1<br />
Dies ist meine persönliche Vorlesungsmitschrift und wird von Vorlesung zu Vorlesung<br />
erweitert. Ich übernehme keine Garantie für Richtigkeit und/oder Vollständigkeit. Falls Fehler<br />
in der Mitschrift sind, bitte an mich via eMail (hingsamer@aon.at) melden. Abbildungen und<br />
Diagramme werden später noch eingefügt.<br />
Leider ist es manchmal nicht möglich gewesen vollständig mitzuschreiben bzw. die<br />
Reihenfolge (Mitschrift zu Vorlesung) differiert etwas. Bei manchen Teilen weichen auch<br />
Definitionen von denen in der Vorlesung genannten ab. Ich habe die Stellen bestmöglich<br />
markiert.<br />
Die .pdf File kann unter http://biologie.rabbit-hole.at runtergeladen werden.<br />
Der reine Textteil ist soweit fertig gestellt. Leider wird es mit der Bebilderung noch etwas<br />
dauern und es werden sicherlich noch laufend Korrekturen durchgeführt.<br />
Diese Unterlagen unterliegen, bis auf Widerruf, der GNU-Lizenz für freie Dokumentation!<br />
Samstag, 26. Januar 2008<br />
1.2 Version 1.0<br />
Aufbauend auf dem sehr guten Skript von Peter, habe ich in dieser Version nun die Bilder<br />
eingefügt um ein möglichst komplettes Dokument zu schaffen. Weiters wurde der Inhalt<br />
komplett korrekturgelesen, ergänzt, sowie das Kapitel Mathematische Modelle entsprechend<br />
der Vorlesung WS09/10 angepasst.<br />
Ich hoffe dieses Skript ist eine gute Lernunterlage für euch.<br />
Euer Harry<br />
Harald.Berger@sbg.ac.at<br />
November 2009<br />
1.3 Lizenz<br />
Der Text, von Peter erfasst, unterliegt der GFDL 1.3. Siehe auch:<br />
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html<br />
Sämtliche Abbildungen sind den Skripten der Professoren entnommen und unterliegen<br />
keinesfalls der GFDL. Die Rechte liegen bei den entsprechenden Verlagen bzw.<br />
Herausgeber.<br />
4 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2 Teil Prof. Haslett<br />
2.1 Begriffsdefinitionen<br />
Was ist eine Population? Eine Population ist eine Gruppe von Individuen, die der gleichen<br />
taxonomischen Einheit angehören und sowohl im selben Raum als auch zum selben<br />
Zeitpunkt vorkommen (Definition nach Urbanska 1992).<br />
Organismen können unitär oder modular sein.<br />
Unitarer Organismus:<br />
• 1 Individuum (höhere Tiere); Ein Individuum ist das Produkt einer Zygote, also ein<br />
Genet. Unitare Organismen sind fest determiniert, ein Mensch hat immer 2 Beine, 2<br />
Arme und 2 Augen. Diese Eigenschaften ändern sich auch nicht im Laufe der<br />
Ontogenese<br />
• keine fest verbundenen Anhänge<br />
Modularer Organismus:<br />
• Tochtermodule, die mit Mutterorganen verbunden sind (z.B. Ausläufer bei der Garten-<br />
Erdbeere; Gras); Die Anzahl der Module ist nicht vorhersehbar und von<br />
Umwelteinflüssen abhängig. Oft ist es einfacher die einzelnen Module zu zählen, als<br />
die Individuen. Die Summe der Grashalme einer Wiese ist gleich die Zahl der<br />
Module, nicht die der Individuen.<br />
• Oft bei Pflanzen, teilweise bei Tieren wie Korallen und Quallen (ist in Wasser einfach,<br />
aufgrund der 3 Dimensionen)<br />
Individuen sind leicht unterscheidbar bzw. zählbar, im Unterschied bei modularen<br />
Organismen wie z.B. Bäumen.<br />
Die Populationsbiologie beschäftigt sich mit der Veränderung der Individuen in Raum und<br />
Zeit. Die wichtigsten Prozesse innerhalb einer Population sind:<br />
• Natalität (Fortpflanzung)<br />
• Mortalität (Tod)<br />
• Immigration<br />
• Emigration<br />
Dies führt dazu, dass diese 4 Faktoren sich auf die Populationsdichte auswirken. Das lässt<br />
sich auch in der folgenden Formel ausdrücken:<br />
N t + 1 = N t<br />
B −<br />
D +<br />
t = time, N = Anzahl Individuen, I = Imigration, B = Birth, E = Emigration, D = Death<br />
Diese Gleichung führt uns zu Überlebenskurven.<br />
+<br />
I<br />
−<br />
E<br />
5 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.2 Überlebenskurven<br />
Es gibt 3 verschiedene schematische Formen von Überlebenskurven. In der Realität<br />
wechseln sich diese aber ab und gehen ineinander über. Anders als der Name vermuten<br />
lässt geben Überlebenskurven Sterberaten wieder. In einer Überlebenskurve wird das Alter<br />
dem der Sterberate gegenüber gestellt. Die 3 grundlegenden Formen werden wie folgt<br />
eingeteilt:<br />
• Typ I: Neugeborene sterben selten und ältere Individuen sterben im hohem Alter (z.B.<br />
Menschen in Nicht-Entwicklungsländer, Elefanten)<br />
• Typ II: Die Sterberate ist konstant. Dies ist sehr selten in der Natur. Es wird davon<br />
ausgegangen, dass z.B. Samen in der Bodensamenbank diesem Typ entsprechen.<br />
• Typ III: Viele junge Individuen sterben und die Sterberate nimmt mit dem Alter ab.<br />
Abbildung 1: Aus Ökologie Von Colin R. Townsend, Michael Begon, John L. Harper<br />
Die Überlebenskurve von Insekten weicht von diesen Kurven ab. Dies ist durch die<br />
verschiedenen Teile des Lebenszyklus erklärbar. So wechseln sich Eier- Larven- und<br />
Adultstadium ab. Dies ergibt eine treppenförmige Lebenskurve.<br />
6 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Das Beispiel im Skript (Figure 4.10) zeigt eine Überlebenskurve von Wild auf der Insel<br />
Rhum, Hebriden, Schottland. Solche Informationen können in mathematische Modelle<br />
zusammengefasst werden.<br />
7 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.3 Diagrammatische Lebenstafeln<br />
8 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Als Beispiel für eine Insektenlebenstafel dient Fig. 2.3 aus dem Skript. Hier wird anhand des<br />
Jakobsbär (Sensecio jacobaea) ein Insektenlebenszyklus gezeigt:<br />
Die Eier werden an der Unterseite von Blättern angebracht. In jedem Teil des Lebenszyklus<br />
stirbt ein gewisser Prozentsatz von Individuen. Pro Jahr gibt es eine Generation, die<br />
Geburts- und Sterberate bleibt konstant. Ein weibliches Tier kann ca. 200 Eier ablegen, das<br />
Verhältnis Weibchen zu Männchen ist 1:1. Dies ergibt 100 Nachkommen pro Individuum.<br />
Aus 1000 Eiern entwickeln sich 920 Laven. Von diesen 920 Larven überleben nur 25 % bis<br />
zum Puppenstadium. Von den überlebenden 230 Puppen überstehen 20 % den Winter und<br />
können zu adulten Tieren werden. Dies ergibt 46 Adulttiere aus 1000 Eiern.<br />
Rechnerisch wie folgt dargestellt:<br />
Eggst + 1 = Eggst<br />
· 0, 92 · 0, 25·<br />
0, 2 · 100<br />
Dies erklärt sich daraus, dass jedes Adulttier 100 Eier legen kann und von der derzeitigen (t)<br />
Eiermenge nur 4,6 % zu Adulttieren werden (0, 92 · 0, 25 · 0, 2 = 0, 046) Daraus ergibt sich,<br />
dass auf jedes Ei dieser Generation 4,6 Eier in der nächsten Generation folgen.<br />
Allgemein kann man diese Formel in<br />
Nt + 1 = Nt<br />
· λ<br />
zusammenfassen. Hierbei ist λ = Wachstumskonstante und N = Individuenzahl.<br />
2.4 Statische- und Kohortenlebenstafel<br />
Der Unterschied zwischen einer statischen und einer Kohortenlebenstafel liegt darin, dass<br />
bei einer Kohortenlebenstafel alle Individuen einer Population, die zum gleichen Zeitpunkt<br />
geboren werden beobachtet werden. Das heißt, man verfolgt z.B. alle 1990 geborenen<br />
Individuen und stellt fest, wie lange sie leben. Also wie viele überleben bis 1991, wie viele bis<br />
1992 usw. Dies klappt nur bei Populationen ohne überlappende Generationen.<br />
In einer statischen Lebenstafel dagegen werden alle Individuen einer Population zu einem<br />
Stichtag betrachtet. So betrachtet man etwa das Jahr 1992 und analysiert die Altersstruktur<br />
(Wie viele Individuen sind 1 Jahr alt? Wie viele 2 Jahre? usw.). Dieser Ansatz wird meist<br />
verwendet, wenn man das Schicksal von Kohorten nicht verfolgen kann. Eine statische<br />
Lebenstafel kann sinnvoll sein, wenn die beobachteten Arten sehr langlebig sind oder sich<br />
mit anderen Kohorten vermischen. Oberflächlich gesehen mutet eine statische Lebenstafel<br />
wie eine Kohortenlebenstafel an. Sie darf allerdings nur dann äquivalent verwendet werden,<br />
wenn die Geburten- und Sterbemuster von dem Ältesten bis zum Jüngsten Individuum<br />
konstant sind! Etwas, das nur sehr selten der Fall ist. Nur bei Populationen/Arten mit<br />
überlappenden Generationen.<br />
9 / 143
10/143
VO Populationsbiologie<br />
11 / 143
Am Beispiel der Kohortenlebenstafel im Skript (Table 4.1) sollen gängige Abkürzungen<br />
erläutert werden. Die angegebenen Kürzel sind international einheitlich:<br />
Mortalität:<br />
ax<br />
Individuenzahl<br />
lx Proportion Überlebende:<br />
Ausgangsgeneration)<br />
(Individuen dieser Generation / Individuen der<br />
dx Proportion Todesfälle: (Tote dieser Generation/Individuen der vorherigen Generation)<br />
gibt an, wie viele Individuen von der vorherigen zu dieser Generation gestorben sind,<br />
ausgehend von der ausgangs Generation Individuen der Ausgangsgeneration dx =<br />
Tote von Generation x auf Generation x+1.<br />
qx Mortalitätsrate dx /lx gibt die Rate an wie viele Individuen von Generation x auf<br />
Generation x+1 sterben<br />
killing power: Abtötungsstärke des Lebenszyklus (log ax − log ax+1)<br />
kx<br />
Natalität<br />
Fx<br />
mx<br />
lxmx<br />
Anzahl der Eier bzw. Samen bei Pflanzen<br />
Eier/Samen pro überlebendes Individuum<br />
Eier/Samen pro Individuum pro Stadium<br />
Diese Daten sind sehr wichtig für Schädlingsbekämpfung und Naturschutz. Sie helfen unter<br />
anderem, den idealen Zeitpunkt zum Insektizideinsatz zu bestimmen aber auch, um einen<br />
effektiven Naturschutz zu gewährleisten.<br />
Diese Lebenstafeln sind rein deskriptiv und können nicht als Vorhersagemodelle verwendet<br />
werden.<br />
2.5 Populationsdynamik<br />
Die Modelle der ersten Vorlesung werden als taktische Modelle bezeichnet. Sie enthalten<br />
sehr viele Parameter im Gegensatz zu strategischen Modellen die einfache Modelle mit<br />
wenigen Parametern sind. Strategische Modelle reduzieren die Parameter auf wenige<br />
wichtige Werte. Diese Modelle zeigen dass Populationen einer Dynamik unterliegen.<br />
Zum Beispiel steigt eine Grippevirenpopulation während einer Epidemie an. Sie erreicht ein<br />
Plateau und nimmt danach wieder ab. Die Population ist also vor und nach der Epidemie<br />
endemisch (=nur in klar begrenzten Gebieten vorkommend). Es gibt verschiedene Gründe,<br />
warum Populationen nicht stabil sind. Diese werden in extrinsische und intrinsische Faktoren<br />
unterteilt:<br />
• Extrinsische Faktoren: Nahrung, abiotische Faktoren<br />
• Intrinische Faktoren: Sind Faktoren innerhalb einer Population<br />
Intrinsische Faktoren führen zur Dichteabhängigkeit (density intendence). Diese Faktoren<br />
regulieren die Größe der Population. D.h. Geburten- und Sterberaten sind von der<br />
Populationsdichte abhängig. Grund für die Dichteabhängigkeit ist die intraspezifische<br />
Konkurrenz.<br />
12/143
VO Populationsbiologie<br />
2.5.1 Intrinsische Faktoren<br />
Fig. 6.4 zeigt die Sterberate in Abhängigkeit der Dichte. Im dem Experiment wurde betrachtet<br />
wie viele Individuen pro m² überlebten. Es zeigte sich, dass je mehr Individuen zu Beginn<br />
vorhanden waren, umso mehr überlebten. Dies geschah aber nur bis zu einer gewissen<br />
Grenze. An dieser Grenze sorgte intraspezifische Konkurrenz für eine Selbstregulation, also<br />
blieb die Individuenzahl relativ konstant.<br />
Fig 6.5 zeigte ein ähnliches Experiment mit Sojabohnen. Hier wurden Sojabohnen in<br />
verschiedenen Dichten ausgesetzt. Es zeigte sich, dass nach 39 Tagen ein Plateau erreicht<br />
wurde, nach 61 und 93 Tagen kommt es zur Überkompensation.<br />
13 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Die beiden folgenden Experimente beziehen sich auf die Natalität, wobei das zugrunde<br />
liegende Prinzip dasselbe ist: Bei Spatzen zeigte sich: Je mehr weibliche Individuen brüten,<br />
umso geringer wird die Anzahl der Nachkommen pro Weibchen.<br />
Ein weiteres Beispiel zeigt: Je dichter der Besatz von Pflanzen ist, umso geringer wird die<br />
Anzahl der Samen pro Pflanze.<br />
14 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.5.2 Abhängigkeit von Natalität und Mortalität<br />
Die Natalität und Mortalität kann voneinander abhängig oder unabhängig sein. Im<br />
Allgemeinen gibt es aber immer einen Punkt K, an dem die Kapazitätsgrenze erreicht wird.<br />
Populationen können nicht dauerhaft über diesen Punkt anwachsen. K ist als der Wert<br />
definiert, der die maximale Populationsgröße einer Art in einem Lebensraum angibt.<br />
Die Natalität und Mortalität ist voneinander abhängig. Wird die Geburten- und die Todesrate<br />
als Funktion gx bzw. tx aufgefasst (gx = Geburtenrate tx = Todesrate x = Individuenanzahl) ist<br />
der Schnittpunkt (also gx = tx) die Kapazitätsgrenze K (oder mathematischer ausgedrückt:<br />
wenn gx = tx dann K = gx = tx)<br />
Dies wird in den folgenden 3 Szenarien gezeigt:<br />
1. Sowohl Natalität als auch Mortalität sind dichteabhängig<br />
2. Die Natalität ist dichteunabhängig und die Mortalität dichteabhängig<br />
3. Die Natalität ist dichteabhängig und die Mortalität ist dichteunabhängig<br />
In der Realität sind diese Funktionen aber nicht so scharf, sondern es gibt einen mehr oder<br />
weniger großen Bereich in dem K variieren kann.<br />
15 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.6 Mathematische Modelle<br />
Wachstumskurven für Populationen mit überlappenden Generationen lassen sich als<br />
kontinuierliche Kurve darstellen (Differentialgleichung.)<br />
Folgend eine Wachstumskurven für Populationen mit diskreten Generationen<br />
Exponentielles Wachstum, wie in den folgenden Gleichungen dargestellt, tritt nur auf wenn<br />
keine Konkurrenz herrscht.<br />
N t + 1 = N t ∗<br />
Bzw.<br />
N = N ∗<br />
t<br />
Wobei R die Reproduktionsrate ist. Dies ist jedoch eine zu einfache Abbildung. Logistisches<br />
Wachstum (sigmoidale Kurve) tritt beim Vorhandensein von intraspezifische Konkurrenz auf.<br />
0<br />
R<br />
R<br />
t<br />
16 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Die folgende Formel bezieht sich auf diskrete Generationen:<br />
N<br />
t + 1<br />
wobei R = Reproduktionsrate und a = (R−1)/K .<br />
=<br />
Nt<br />
∗ R<br />
(1 + a ∗ N<br />
Mit der Einführung einer weiten Modifikation (Variable b) kann man die Parameter der Art der<br />
Kompensation einführen:<br />
Nt<br />
∗ R<br />
(1 + a ∗ N<br />
Nt = + 1<br />
b<br />
t )<br />
b < 1 Unterkompensation<br />
b > 1 Überkompensation<br />
b = 1 perfekte Kompensation<br />
b = 0 Dichteunabhängig (=exponentiales Wachstum)<br />
a besagt, wann die Schwankungen kommen<br />
b besagt, wie stark die Schwankungen sind<br />
Die Kompensation gibt an, wie die Population beim Erreichen von K reagieren wird. Eine<br />
Unterkompensation bedeuten, dass weniger kompensiert wird, als eigentlich notwendig wäre<br />
um K zu erreichen. Bei einer Überkompensation reagiert die Population mit einer<br />
Verringerung der Individuenzahl unter die Grenze von K. Perfekte Kompensation wäre das<br />
exakte Erreichen von K und das Verbleiben auf diesem Wert. Bei der Dichteunabhängigkeit<br />
spielt der Punkt K keine Rolle bzw. ist gar nicht vorhanden.<br />
In Fig. 3.10 wird b gegen R aufgetragen. Aus dem Verhältnis ergibt sich<br />
folgendes:<br />
t<br />
)<br />
17 / 143
VO Populationsbiologie<br />
wenn R und / oder b niedrig ist � monotonic damping<br />
wenn R oder b steigt � damped oscillations<br />
wenn’s noch mehr steigt � stable limit cycles<br />
bei sehr hohen R und b � chaos<br />
Bei einem chaotischem Model sind alle Parameter bekannt, es existieren keine unbekannten<br />
Außeneinflüsse (Umwelt) Trotzdem kommt es zu chaotischen Schwankungen. Diese sind<br />
meistens aber immer noch innerhalb bestimmter Grenzen. Siehe auch Schmetterlingseffekt.<br />
Langzeitige Vorhersagen sind aber nicht möglich<br />
Diese Tabellen zeigen verschiedene Formen von Populationskurven.<br />
a) Eindeutige S Form (optimal im Labor)<br />
b) ähnlich der allgemeinen Form, aber mit Einflüssen (z.B. Fütterungen)<br />
c) z.B. Käfer im Mehl, gedämpfte Oszillation<br />
d) Kohlmeise (Parus major). Zeigt ein chaotisches System<br />
e) Vorgängergeneration für die Nachkommen verantwortlich; Oszillation kommt<br />
aufgrund Nt−1 zustande.<br />
18 / 143
VO Populationsbiologie<br />
19 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Fig. 10.1 zeigt ein Modell mit 2 oder mehr Räuber-Beute Populationen.<br />
a) zeigt Eule als Jäger und Maus als Beute. Die Beutepopulation variiert stark, die<br />
Räuberpopulation bleibt aber stabil<br />
b) zeigt Schmetterling vs. Pflanze. Die Anzahl der Insektenlarven ist abhängig von der<br />
Anzahl der Pflanzen des Vorjahres. Die Pflanzen sind nur abhängig von<br />
Umwelteinflüssen (unabhängig vom Räuber) die Larven sind aber abhängig von den<br />
Pflanzen.<br />
c) zeigt Luchs vs. Schneehuhn. Diese sind gegenseitig abhängig. Sie oszillieren<br />
phasenverschoben.<br />
20 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.7 Räumliche Faktoren<br />
In den letzten 100 Jahren waren die Modelle in der Populationsbiologie immer an der<br />
Zeitachse orientiert. Es waren geschlossene Modelle, ohne das die Immigration oder<br />
Emigration berücksichtigt wurde. Erst durch Computer und Geoinformationssysteme konnten<br />
räumliche Faktoren in die theoretischen Modelle aufgenommen werden. Die folgenden<br />
Modelle werden auch den räumlichen Bereich berücksichtigen wobei 2 Populationen<br />
betrachtet werden (Predator-Prey bzw. Parasitoiden-Host)<br />
Diese Modelle sind aber nicht nur für theoretische Überlegungen wichtig, sondern haben<br />
auch durch Klimaveränderung und dem daraus resultierenden Wanderungsverhalten einen<br />
angewandten Aspekt!<br />
2.7.1 Parasitoiden<br />
Parasiten nutzen den Wirt und leben von ihm. Im Unterschied zu Parasitoiden töten sie den<br />
Wirt meist nicht! Als Parasitoide werden in der Regel Insekten bezeichnet, die den Wirt am<br />
Ende des Parasitenbefalls töten. In den folgenden Modellen legen die Adulttiere Ihre Eier in<br />
die Wirtslarven.<br />
• Hautflügler (Hymenoptera) z.B. Schlupfwespen (Ichneumonidae)<br />
• Zweiflügler (Diptera) z.B. Raupenfliegen (Tachinidae)<br />
Ichneumonidae legten z.B. ihre Eier in die Larven des Schmetterlings. Die Wespe schlüpft<br />
aus der Wirtslarve aus und der Wirt stirbt. Eine beeindruckende Zahl ist, dass man<br />
heutzutage davon ausgeht, dass 10 % der 1.000.000 beschriebenen Insektenarten eine<br />
parasitoide Lebensweise haben.<br />
21 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.7.2 Nicholson-Bailey-Modell (1935)<br />
Dieses Modell beschreibt ein Host-Parasitoids System. Es werden folgende Parameter<br />
verwendet:<br />
Pt<br />
Anzahl der Parasitoiden zum Zeitpunkt t<br />
Ht<br />
Anzahl der Wirte (Hosts) zum Zeitpunkt t<br />
λP<br />
Wachstumsrate der Parasitenpopulation<br />
λH<br />
Wachstumsrate der Wirtspopulation (ohne Parasitismus)<br />
α = a/A Wahrscheinlichkeit, dass ein Wirt attackiert wird (Sucheffizienz)<br />
a Suchgebiet der Parasiten (area of discovery)<br />
A Größe des Areals der Wirtspopulation (bzw. des untersuchten Gebiets)<br />
Die folgende Formel kann verwendet werden, um entweder die Anzahl der Parasiten zum<br />
Zeitpunkt t+1 zu bestimmen (Pt+1) oder um die Anzahl der Wirte bei t + i (Ht+1).<br />
Für Parasiten<br />
und für Wirte<br />
P<br />
t + 1<br />
H<br />
=<br />
t + 1<br />
λ<br />
=<br />
P<br />
⋅<br />
λ<br />
H<br />
H<br />
t<br />
⋅<br />
⋅<br />
( 1<br />
H<br />
−<br />
e<br />
− α P<br />
Pt<br />
t e<br />
− α<br />
⋅<br />
Zur Erklärung der Formel:<br />
Pt+1 Anzahl der Parasiten in der Generation t + 1<br />
Ht+1 Anzahl der Wirte in Generation t + 1<br />
λP * Ht Gibt das Parasitenwachstum in Abhängigkeit zur Wirtspopulation wieder<br />
(1 − e−αPt ) Anteil infizierter Wirte<br />
e−αPt Anteil nicht infizierter Wirte<br />
Wachstumsrate der Wirtsgeneration ohne Parasitismus (etwa bei P=0)<br />
λHHt<br />
Um diese Formel verwenden zu können müssen aber einige Annahmen erfüllt sein, bzw.<br />
geht die Formel von folgenden Voraussetzungen aus:<br />
1. 0 oder ein Parasit pro Wirt<br />
2. Jeder weibliche Parasitoid durchsucht ein Gebiet a und befällt dort jeden Wirt<br />
3. Parasitoid unterscheidet nicht zwischen gesundem und bereits infiziertem Wirt<br />
4. Wachstumsrate λH und λP sind bekannt<br />
Dieses Modell alleine führt zu Oszillationen, aber es fehlt die Dichteabhängigkeit. Es gibt<br />
zwar Zyklen, diese sind aber instabil. Es könnte zwar in diese Modelle eine<br />
Dichteabhängigkeit nach dem Schema (K−Nt)/K eingebaut werden jedoch hätte dies<br />
mathematisch und biologisch keine Relevanz.<br />
t<br />
)<br />
22 / 143
VO Populationsbiologie<br />
23 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Fig. 6.1a zeigt ein echtes Experiment. Die Schwarzen Kreise zeigen die Wirte, die weißen<br />
die Parasiten. Die dünne Linie ist das Ergebnis der Nicholson-Bailey Berechnung.<br />
Es gibt aber auch innerhalb von Parasiten intraspezifische Konkurrenz, daher ist die<br />
Annahme α = a/A biologisch nicht richtig. Um der intraspezifischen Konkurrenz Rechnung zu<br />
tragen; kann dies durch einführen des Faktors m gemacht werden. Siehe hierfür Fig 6.1b.<br />
Dies zeigt, je mehr Parasiten desto weniger Befall in a.<br />
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Parasit einen Wirt findet ist auch von der räumlichen<br />
Verteilung abhängig. Daher ist die Frage, ob die Population verklumpt oder als Poisson-<br />
Verteilung 1 vorkommt. Je geklumpter die Verteilung ist, umso größer ist die Stabilität.<br />
Hierfür gibt es zwei Gründe:<br />
1. Intraspezifische Konkurrenz: Je dichter die Parasitenpopulation ist, umso weniger<br />
Wirte werden getroffen.<br />
2. Pseudointraspezifische Konkurrenz: Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wirt<br />
bereits besiedelt ist bei einer dichten Parasitoidenpopulation höher als bei einer dünn<br />
besiedelten. Es besteht also die Möglichkeit, dass ein Wirt zweimal von einem<br />
Parasitoiden getroffen wird. Dieser “Doppeltreffer” ist aber statistisch wie ein<br />
einfacher gewertet.<br />
Bei einer niedrigen Parasitoidenendichte finden die meisten Parasitoiden einen Wirt. Je<br />
höher diese Dichte wird, umso geringer ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Dies ist eine<br />
räumliche Dichteabhängigkeit bei geklumpten Situationen.<br />
1 Poisson-Verteilung gibt die Verteilung der Wahrscheinlichkeit bei Experimenten mit<br />
geringer Erfolgsquote an. Diese weicht von der Normalverteilung ab.<br />
24 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.7.3 Modell von Comins (1992)<br />
Comins et al nutzten das Nicholson-Bailey Modell für eine computergestützte Simulation der<br />
räumlichen Verteilung. Folgende Voraussetzungen müssen betrachtet werden.<br />
Wirt und Parasit sind über ein Areal verteilt.<br />
X Stellt eine Population dar. Innerhalb dieser Population gibt es Reproduktion und<br />
Parasitismus. Für dieses Modell gibt es bestimmte Regeln:<br />
1. Individuen einer Zelle können jeweils nur in eine angrenzende Zelle auswandern bzw.<br />
in ihrer Zelle bleiben.<br />
2. Ein Teil der Wirts- und Parasitoidengeneration verlässt die Zelle und ein Teil bleibt<br />
und reproduziert sich.<br />
3. Der Teil der die Zelle verlässt verteilt sich gleichmäßig (also jeweils 1/8).<br />
4. Pro Generation kann nur einmal ausgewandert werden.<br />
5. Die Raster sind diskret d.h. sie haben Grenzen an denen die emigrierenden<br />
Individuen reflektiert werden.<br />
Hier zeigt sich eines: Jede einzelne Zelle für sich ist instabil. Im Verband ist eine solche<br />
Matrix allerdings sehr stabil.<br />
Fig. 10.13 zeigt die Verteilung von Populationen in einem bestimmten Areal. Die weißen<br />
Felder sind dicht besiedelt, die dunklen frei.<br />
a) Die spiralige Form findet man, wenn Parasitoid und Wirt sehr mobil sind. („Spirals“)<br />
b) zeigt in der Mitte ein mathematisches Chaos. („Spatial chaos“ = räumliches Chaos)<br />
c) Szenario, in dem die Parasitoiden sehr mobil sind, die Wirte aber nicht. („crystalline<br />
lattices“ = Kristallgitter)<br />
Die räumliche Dimensionen ist in der Populationsbiologie genauso wichtig sind wie zeitliche.<br />
Dies gibt ganz neue Möglichkeiten, die Natur abzubilden und zu verstehen.<br />
25 / 143
26/143
2.8 Metapopulationen<br />
Als Metapopulationen bezeichnet man eine Gruppe von lokalen Populationen die sich<br />
untereinander austauschen können. Die Idee von Metapopulationen stammt aus den 1970er<br />
Jahren und wurde aber erst in den 1990er Jahren wieder aufgegriffen. Heute sieht man jede<br />
Population als Metapopulation an. Die Kernidee ist:<br />
• Es gibt Habitatflächen (Patches) die benutzt werden und<br />
• es gibt Patches die nicht benutzt werden obwohl sie potentiell verwendbar wären.<br />
2.8.1 Inseltheorie (Inselbiogeographie)<br />
Inseln sind von dem Festland räumlich getrennt, werden aber vom Festland her besiedelt.<br />
Gleichzeitig kommt es auch zu einem Aussterben: Die Theorie besagt, dass<br />
• je mehr Arten auf der Insel sind, umso geringer wird die Immigrationsrate vom<br />
Festland.<br />
• Je mehr Arten auf der Insel sind, umso mehr sterben aus.<br />
Diese beiden Raten können in ein Diagramm eingetragen werden. Der Schnittpunkt<br />
entspricht dem Gleichgewicht zwischen Aussterben und Immigration. Es gibt aber noch<br />
mehrere Faktoren:<br />
• Die Entfernung zum Festland und die Inselgröße.<br />
• Je weiter die Insel vom Festland entfernt ist, umso weniger Arten können immigrieren<br />
(absteigend Äste).<br />
• Je größer die Insel ist, umso geringer ist die Aussterbensrate (aufsteigende Äste).<br />
Abbildung 2: Aus Robert H. MacArthur, Edward O. Wilson The theory of island biogeography<br />
Diese Informationen sind wichtig für Metapopulationen, ein weiterentwickeltes Modell. Es gibt<br />
aber auch unterschiedliche Besiedlungsstrategien bei verschiedenen Arten. Unterschieden<br />
werden grob r- und K-Strategen. R-Strategen (opportunistische Populationen) können sich<br />
schnell ausbreiten, haben eine hohe Reproduktionsrate und besiedeln schnell neue Gebiete<br />
z.B. viele Insekten (Ausnahme “soziale Insekten”, Mäuse, Bakterien). K-Strategen<br />
(ausbalancierte Populationen) brauchen länger zum Besiedeln, sind langlebig und haben<br />
27/143
VO Populationsbiologie<br />
eine niedrigere Reproduktionsrate (z.B. viele Säuger wie Bären, Wale, Primaten). Dadurch<br />
befindet sich die Individuenzahl nahe an K.<br />
28 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.8.2 Levins Metapopulationsmodell (1969-70)<br />
Die Populationen befinden sich nicht auf Inseln, sondern innerhalb eines Habitates (die<br />
Bedingungen für Metapopulationen müssen erfüllt sein).<br />
Wann ist eine Population eine Metapopulation?<br />
• Es müssen Teilpopulationen aussterben und entstehen können.<br />
• Diese Teilpopulationen dürfen nicht gekoppelt sein (das Aussterben einer<br />
Teilpopulation darf keine Auswirkung auf eine andere Teilpopulation haben).<br />
• Teilpopulationen bzw. deren Flächen haben verschiedene Größen<br />
Im Gegensatz zur Inseltheorie kommen Gleichgewichte durch wechselseitige Migrationen<br />
zwischen Habitatsinseln und nicht durch einseitige Kolonisation von einem großen<br />
Ausgangsgebiet (großes Artenpool am Festland) zustande. Ein weiterer Unterschied zur<br />
Inseltheorie ist, dass nur eine Art betrachtet wird. Für solche Metapopulationen gibt es eine<br />
Gleichung zum Berechnen der benutzten Fläche in Abhängigkeit zur Zeit:<br />
dp<br />
=<br />
dt<br />
mp(1-<br />
p) - μ p<br />
p Anteil der benutzten Fläche<br />
1-p Anteil der unbenutzten Fläche (Ziele für Immigranten)<br />
μ Aussterbensrate für die einzelnen Teilpopulationen (eigentlich Flächen)<br />
m Rekolonisierungsrate von leeren Flächen<br />
dp Veränderung der benutzten Fläche<br />
dt Veränderung der Zeit<br />
Die Aussage dieser Gleichung ist also die Veränderung der Fläche in der Zeit. Also die Rate<br />
der Neukolonisierung oder des Aussterbens. Die Parameter sind die freie Fläche und die<br />
reproduzierenden Individuen. Mehr benutzte Fläche führt zur mehr Individuen, aber<br />
zwangsläufig auch zu mehr intraspezifischer Konkurrenz.<br />
m − μ > 0 bedeutet, dass die Wiederbesiedelungsrate größer ist als die Aussterbensrate.<br />
Dies bedeutet, die Wiederbesiedelung ist größer als das Aussterben. Es kommt zu einem<br />
stabilen Gleichgewicht. Hierbei werden aber nur Flächen behandelt.<br />
Es können Metapopulationen also stabil sein, obwohl einzelne Teilpopulationen stetig<br />
aussterben und neue Areale besiedelt werden. Die benutzte bzw. unbenutzte Fläche bleibt<br />
also immer gleich.<br />
Dieses Modell ist aber für die Realität zu einfach: es werden keine Qualitätsunterschiede<br />
zwischen den einzelnen Gebieten berücksichtigt (z.B. Verfügbarkeit von Beute ist nicht<br />
überall gleich).<br />
29 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.8.3 Source and Sink<br />
Fig. 10.1 zeigt das Bild einer Source-Sink Population. In der Mitte befindet sich das Source<br />
Gebiet (r > 0; r = Reproduktionsrate) es werden mehr Individuen produziert als aussterben.<br />
Innerhalb des Source Gebiets gibt es meist einen Bereich mit r = max. Also wo die höchste<br />
Reproduktionsrate ist. In der Sink Population (außen) ist r < 0. Ohne Quellgebiet könnte<br />
diese Population nicht existieren. Es entsteht ein Gleichgewicht zwischen Source und Sink.<br />
30 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.8.3.1 Austausch zwischen Populationen<br />
Fig. 6.3 zeigt verschiedene Möglichkeiten der Vernetzung zwischen Teilpopulationen. Die<br />
dunklen Punkte sind besiedelte Gebiete, die leeren Punkte Gebiete, die potentiell nutzbar<br />
wären, aber unbesiedelt sind. Die strichlierten Linien geben die Populationsgrenzen an.<br />
Pfeile geben die Richtung des Austauschs an.<br />
A Dynamische Population; ist ein Beispiel für das Levins Modell<br />
B Große Kern- und viele kleine Satelliten-Population; es besteht aus 4 verschiedenen<br />
Populationen<br />
C „patch population“ Ist eine Population mit sehr viel Interaktion. Keine Teilpopulation<br />
steht für sich allein. Sie ist als eine Population zu sehen.<br />
D „isolated populations“ Einzelne Populationen ohne Kontakt zueinander.<br />
E Kombination aus B und C. Kern-Satelliten Population, wobei der Kern aus einer<br />
Patchy population besteht<br />
31 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.8.4 Kritik am Levins Modell<br />
Das Lewins Modell weist aber einige Schwächen auf. So werden folgende Fakten nicht mit<br />
eingerechnet:<br />
• Berücksichtung unterschiedlich großer patches (source /sink Modelle)<br />
• Berücksichtung der räumlichen Struktur (Vernetzheits-/Isolationsgrad, Qualität der<br />
verbindenden Korridore)<br />
• Die Dynamik (Reproduktionsrate) der einzelnen Populationen kann nicht<br />
berücksichtigt werden (kleine Populationen sterben leichter aus als große)<br />
Da die Aussterbensrate nicht konstant ist, kann man 2 Gleichgewichte in Populationen<br />
erhalten (Fig 6.19). In dieser bimodalen Verteilung zeigen sich die zwei Maxima links und<br />
rechts.<br />
Fig 10.13 in Bezug auf Metapopulationen: Jeder einzelne Teil des Rasters ist ein Teil einer<br />
Metapopulation. Jedes Quadrat für sich allein ist instabil. Zusammen ergibt sich aber eine<br />
stabile Metapopulationen. Wie geklumpt die Raster vorliegen hat einen Einfluss auf die<br />
Heterogenität der Populationsdynamik durch Räumer-Beute-Interaktionen (in diesem Fall<br />
Parasitoiden-Wirt).<br />
32 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.9 Angewandte Populationsbiologie<br />
Angewandte Populationsbiologie ist sowohl in der Agrarwirtschaft als auch im Naturschutz<br />
relevant. Aber auch für den medizinischen Bereich:<br />
• Gibt eine Berechnungsmöglichkeit für Schädlinge.<br />
• Man kann die Verbreitung von Krankheiten modellieren. Die Populationen sind dann<br />
aber nicht die einzelnen Viren, sondern die infizierten Individuen (Parasitoid-Wirt-<br />
Modell). Dies ist z.B. bei der Modellierung von Epi- oder Pandemien wichtig.<br />
• Es können auch Populationen von exotischen Arten (Neophyten bzw. Neozooen)<br />
modelliert werden um die Auswirkung auf endemische Arten zu berechnen.<br />
• Auch die Berechnung von Ernteerfolgen ist möglich.<br />
2.9.1 Naturschutz<br />
Naturschutz betrifft das Aussterben von Arten. Von je her sind Arten ausgestorben da es ein<br />
zentraler Teil der Evolution ist. Bis jetzt sind über 99 % der Arten die jemals auf unserem<br />
Planeten gelebt haben ausgestorben. Das Problem, das heute besteht ist also nicht die<br />
Tatsache, dass Arten aussterben, sondern die Geschwindigkeit mit der sie das tun. Die<br />
jetzige Aussterbensrate ist nicht akzeptabel.<br />
Wenn der Tiger (Panthera tigris) in 10.000 Jahren ausstirbt ist das „kein“ Problem. Wenn er<br />
allerdings in den nächsten 10 Jahren ausstirbt ist dies zu schnell. Einen ähnlichen Zugang<br />
gibt es auch zur Klimaveränderung: Verändert sich das Klima in den nächsten 20.000 Jahren<br />
ist das ein natürlicher Vorgang. Wenn diese Veränderung allerdings in den nächsten 50<br />
Jahren stattfindet ist das ein Problem.<br />
2.9.1.1 Traditionelle Methoden zum Artenschutz<br />
Kleine Populationen sollten geschützt werden. Oft sind Populationen so klein, weil das<br />
Habitat fehlt. Die Frage die sich also stellt ist, ob die vorhandenen Ressourcen für Arten-<br />
oder Habitatschutz (Schutz von Hot-Spots) verwendet werden sollte. Beide<br />
Schutzmöglichkeiten spielen aber eng zusammen, da die Natur aus Patches besteht.<br />
Schützt man eine Art muss man auch das entsprechende Habitat schützen. Ökologische<br />
Modelle fassen die Natur aber als homogen auf. Es kommen keine Patches vor.<br />
33 / 143
Fig. 1.2 zeigt diese Ansätze. Das Mosaik Modell zeigt ein realistisches Bild: Es hat viele Details und ist komplex. Diese Ideen sind wichtig für den<br />
Naturschutz, da ein Aussterbensrisiko bestimmt werden muss. Welche Faktoren haben aber einen Einfluss auf die<br />
Aussterbenswahrscheinlichkeit?<br />
34/143
Wie bereits bei der Inseltheorie erwähnt haben größere Populationen ein geringeres<br />
Aussterbensrisiko. Welche Faktoren tragen aber zu einem Aussterbensrisiko bei?<br />
• Mehr demographische Varianz (z.B. Alter; mehr Alte als Junge)<br />
• Sehr fragmentierte Habitate<br />
• Genetische Drift (und daraus verursachte geringere Anpassungsfähigkeit)<br />
• Inzuchtdepression<br />
Umweltsituationen und Katastrophen können diese Effekte verstärken. Menschlicher Einfluss<br />
wäre etwa:<br />
• Habitatzerstörung<br />
• Umweltverschmutzung<br />
• zu viel Ernte/Jagd<br />
• Einfuhr exotischer Spezies<br />
Ein lokales Aussterben kann auch mit einem globalen Aussterben gleichbedeutend sein. So<br />
gibt es Pflanzenarten, die nur an einem Ort vorkommen. Stirbt diese Population aus, ist die<br />
globale Population ausgestorben (oder auch der Chinesische Flussdelfin Lipotes vexillifer 2 ).<br />
Diese Gedanken führen zur Überlebensfähigkeit einer Population. Es gibt 2 Möglichkeiten<br />
die Überlebensfähigkeit einer Population zu bestimmen. Dies wird als PVA (Population<br />
Viability Analysis) bezeichnet.<br />
1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Population nächstes Jahr ausstirbt?<br />
2. Wie groß muss eine Population mindestens sein, damit sie (unter normalen<br />
Bedingungen=freie Wildbahn) nicht ausstirbt (MVP=Minimum Viable Population)?<br />
Ein Beispiel: Für eine Großhorn-Schafpopulation wird eine 95%ige Persistenz für 100 Jahre<br />
festgelegt. Untersuchungen zeigten, dass alle Populationen mit weniger als 50 Schafen<br />
innerhalb von 50 Jahren ausstarben. Hingegen starben nur 50% aller Populationen zwischen<br />
51-100 Schafen aus. So benötigen wir für einen MVP mindestens 100 Schafe. Der<br />
Untersuchungszeitraum betrug allerdings nur 70 Jahre, was den Aufwand solcher<br />
Datenerhebungen veranschaulichen soll.<br />
2 Auch Baiji, gilt als eines der seltensten Säugetiere der Welt und ist vermutlich aufgrund<br />
massiver Umweltverschmutzung und Schifffahrt bereits ausgestorben. Sein einziges Habitat<br />
war/ist der im Jangtse.<br />
35/143
VO Populationsbiologie<br />
Eine weitere wichtige Frage ist, wie eine Population auf einen Eingriff reagiert. Dies ist nur<br />
sehr schwer vorherzusagen und es gibt im Moment 3 Möglichkeiten zu Daten für eine PVA<br />
zu gelangen:<br />
1. Datensets von Langzeitstudien (Gibt es sehr selten, da es oft schwer ist, über Jahre<br />
eine Population zu verfolgen bzw. ist dies bei stark gefährdeten Populationen nicht<br />
möglich)<br />
2. Expertenmeinungen (Ist sehr spezifisch. Man braucht einen Experten auf einem<br />
Gebiet und die ist auch sehr subjektiv. Wenn mehrere Experten zu einem Konsens<br />
kommen kann dies aber eine sehr genaue Vorhersagemöglichkeit sein.)<br />
3. Mathematische Modelle basierend auf den vorhergehenden Modellen.<br />
2.9.2 Räumliche Verteilung<br />
Fig. 9. zeigt eine Habitatfragmentierung. Die Areale werden verkleinert und es kommt von<br />
einer Population zu einer Metapopulation.<br />
36 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Fig.10.2. zeigt ein Source-Sink-System. Wenn B abgetrennt wird, wird es ausgelöscht, da es<br />
ein Sink Areal und allein nicht überlebensfähig ist. Wird C, D, und/oder E abgetrennt kommt<br />
es zu isolierten Populationen.<br />
Die Frage ist, wo das Aussterbensrisiko größer ist. In einem einzelnen großen Areal oder in<br />
mehreren kleinen Arealen (SLOSS= Single Large or Several Small). Auf diese Frage gibt es<br />
allerdings keine definitive Antwort. Es können nur grundsätzliche Vor- und Nachteile<br />
aufgezeigt werden:<br />
• Große Populationen haben ein geringeres Aussterbensrisiko aufgrund mehr<br />
Individuen, aber wenn das Habitat ausgelöscht wird (z.B. durch einen Waldbrand), ist<br />
die gesamte Population ausgelöscht. Krankheiten können sich schneller ausbreiten.<br />
Weniger Randeffekte<br />
• Das Risiko, das sämtliche mehrere kleine Populationen durch eine einzelne<br />
Katastrophe ausgelöscht werden ist geringer, aber die einzelnen Populationen sind<br />
aber weniger stabil (Inzuchtdepression). Krankheiten breiten sich weniger rasch aus.<br />
„Risikostreuung“. Hohe Randeffekte.<br />
Diese Regeln gelten nicht nur für einzelne Arten global gesehen, sondern auch für<br />
Populationen innerhalb von Naturschutzgebieten.<br />
37 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Fig 12.2 zeigt die Erhöhung der Überlebenschancen in Abhängigkeit zur Habitatfläche.<br />
Kleine unvernetzte Habitate haben ein hohes Aussterbensrisiko, große, vernetzte Habitate<br />
ein geringeres.<br />
38 / 143
VO Populationsbiologie<br />
2.9.3 Rote Liste<br />
Um aber eine einzelne Spezies gezielt schützen zu können, muss man viel über die<br />
Populationsdynamik wissen. Bis vor 10 bis 12 Jahren wurde das Aussterbensrisiko nur<br />
geschätzt. Erst 1994 wurden quantitative Parameter für eine Art festgelegt. Fig. 1 zeigt diese.<br />
Es wird zwischen verschiedenen Parametern unterschieden. Zuerst wird festgestellt, ob eine<br />
Art überhaupt untersucht ist oder nicht. Sind Untersuchungen vorhanden, wird überprüft ob<br />
genug Daten vorhanden sind. Sind genug Daten vorhanden, kann die Art wie folgt eingeteilt<br />
werden:<br />
• Ausgerottet<br />
• Ausgerottet in der Wildnis<br />
• Bedroht<br />
– Kritisch Gefährdet<br />
– Gefährdet<br />
– Bedroht<br />
• (Noch) nicht bedroht<br />
• Nicht bedroht<br />
Diese Einteilung existiert zwar schon lange, aber erst jetzt wurden 5 Kriterien festgelegt:<br />
1. Beobachtung einer Reduktion<br />
2. Areal ist reduziert<br />
3. Die gesamte beobachtete Populationsgröße ist unter 250 Individuen (und Verfolgung<br />
des Trends)<br />
4. Weniger als 50 Individuen in der Population<br />
5. Das Aussterbensrisiko ist größer als 50 % in den nächsten 10 Jahren oder 3<br />
Generationen.<br />
Diese Einteilung ist aber z.B. für Arten mit einer MVP (Minimum Viability Population) von<br />
4000 Individuen nicht aussagekräftig (z.B. Insekten).<br />
39 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Fig. 7.17 zeigt das Aussterbensrisiko für verschiedene Populationen. Je nach<br />
Bedrohungsgrad steigt das Aussterbensrisiko mit der Zeit an.<br />
2.9.4 Populationsdynamik im Zusammenhang mit Klimaveränderung<br />
Da sich die abiotischen Faktoren (Niederschlag, Temperatur...) verändern, kann es sein,<br />
dass in 50 Jahren die aktuellen Naturschutzgebiete nicht mehr ausreichen bzw. einfach in<br />
falschen Klimazonen liegen. Auch dies muss bei der Planung von Naturschutzgebieten<br />
berücksichtigt werden.<br />
40 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3 Teil Prof. Heiselmayer<br />
3.1 Populationsbiologie bei Pflanzen<br />
Populationsbiologie bei Pflanzen beschäftigt sich mit folgenden Bereichen:<br />
• Diasporenausbreitung<br />
• Diasporenbank<br />
• Keimung und Etablierung<br />
• Wachstum und Entwicklung<br />
• Klonales Wachstum und Regeneration<br />
• Bestäubung und Fortpflanzung<br />
3.2 Diasporenausbreitung<br />
Ausbreitung 3 ist die aktive oder passive Ausbringung von Diasporen 4 . Verbreitung ist<br />
hingegen ein geografischer Begriff!<br />
Ein Samen im Boden verhält sich allgemein nach dem folgenden Zyklus:<br />
• Ausbringung von Samen<br />
• Samen im Boden<br />
• Keimung<br />
• Jungpflanze<br />
• Ausgewachsene Pflanze<br />
• Blühende Pflanze<br />
• Ausbringung von Samen<br />
Dieser Zyklus gilt für alle Individuen. Kritische Punkte sind hier:<br />
• Aufkommen am Boden: Wie viele Samen können nicht keimen?<br />
• Etablierung: Kann sich die Pflanze auf dem Standort durchsetzen?<br />
Vor allem in diesen Bereichen kommt es zu hohen Ausfällen. In manchen Lebensräumen ist<br />
aber auch das Wachstum ein kritischer Punkt. Wenn z.B. ein Räuber-Beute-System vorliegt.<br />
Da Pflanzen modulare Organismen sind, sind die Auswirkungen von Herbivorie vielfältig:<br />
durch Verlust der Blüten geht die generative Phase verloren, die vegetative bleibt allerdings<br />
am Leben.<br />
3 Ausbreitungstypen enden allgemein mit -chorie (zoochorie, amneochorie...)<br />
4 Eine Diaspore ist eine Ausbreitungseinheit. Dies kann eine Spore, Samen, Frucht oder<br />
auch ein Rhizomstück sein.<br />
41 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.2.1 Fruchtformen<br />
Die Masse der Diasporen sind Früchte oder Samen. Ob es sich um Nacktsamer<br />
(Gymnospermen) oder Bedecktsamer (Angiospermen) handelt ist ein wichtiger Unterschied<br />
in der Ausbreitungsstrategie. Bedecktsamer mit freien Fruchtblättern bezeichnet man als<br />
apokarp, mit verwachsenen Fruchtblättern als coenokarp. Je nach Ausbreitungsstrategie<br />
unterscheiden sich die Diasporen durch verschiedene Merkmale:<br />
• Größe<br />
• Gewicht<br />
• Form<br />
• Oberfläche<br />
• sonstige Diasporeneigenschaften (z.B. luftgefüllt Hohlräume)<br />
So werden z.B. schwere Früchte hauptsächlich durch die Schwerkraft verbreitet. Auch<br />
abgebrochene Pflanzenteile wie etwa bei der Steppenhexe (Salsola tragus) können der<br />
Verbreitung dienen. Die abgebrochene Pflanze wird durch den Wind verfrachtet und verteilt,<br />
da sie immer wieder vom Boden abhebt und wieder aufprallt, dadurch ihre Samen. Hier<br />
spielen vor allem Größe, Gewicht und Form eine wichtige Rolle. Weitere wichtige<br />
Eigenschaften betreffen den Fruchtstand. Wie die Höhe des Fruchtstandes.<br />
42 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.2.2 Ausbreitungstypen<br />
Die wichtigsten Ausbreitungstypen sind in Tab 2 dargestellt. Es sind diese:<br />
• Barochorie (Ausbreitung durch Schwerkraft)<br />
• Autochorie (Selbstausbreitung)<br />
• Anemochorie (Ausbreitung durch Wind)<br />
• Hydrochorie (Ausbreitung durch Wasser)<br />
• Zoochorie (Ausbreitung durch Tiere)<br />
• Hemerochorie (Ausbreitung durch Menschen)<br />
43 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.2.2.1 Barochorie<br />
Als Barochorie wird die Ausbreitung von Diasporen durch Schwerkraft bezeichnet.<br />
Abb. 12 zeigt eine Frucht von Kandelia rhedii. Diese Pflanze kommt in den Mangroven vor<br />
und besitzt eine ca. 20 cm lange Frucht. Die Frucht bohrt sich in den weichen, sumpfigen<br />
Boden ein und ebnet so den Weg für die Keimung.<br />
3.2.2.2 Autochorie<br />
Diese wird wie folgt eingeteilt:<br />
• Blastochorie (Selbstablegung der Samen im Boden)<br />
• Ballochorie (Verteilung mittels Ausschleudermechanismus) und<br />
• Herpochorie (Verteilung durch kriechende Bewegung)<br />
Abb. 8 zeigt den Erdklee, welcher nach der Blüte die Blütenstängel absenkt und die Samen<br />
direkt in den Boden einbringt. Die Pflanze lebt in offenem Gelände im mediterranen Bereich.<br />
44 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 2-4 Zeigt die Erdnuss: Diese Pflanze versenkt ebenfalls die Früchte direkt im Boden.<br />
Abb.10 zeigt verschiedene Mechanismen von Selbststreuern.<br />
45 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Selbststreuer können die Samen sehr weit verbreiten. Hier werden 2 Typen unterschieden:<br />
• Austrocknungsstreuer: Hier werden durch plötzliches öffnen der Diasporen die<br />
Samen ausgeschleudert (z.B. Hülsenfrüchtler oder Geraniengewächse)<br />
• Saftdruckstreuer die die Samen mittels Wasserdruck ausstreuen (z.B. Spritzgurke<br />
oder Springkraut).<br />
Die Reichweite ist hier beträchtlich. Spirtzgurken (Ecballium elaterium) haben eine maximale<br />
Reichweite von 12,7m und sind damit Rekordhalter in dieser Kategorie. Üblich sind für<br />
Saftdruckstreuer in der heimischen Flora ca. 2-5m. Heimische Austrocknungsstreuer haben<br />
ebenfalls eine Reichweite von 2-5m. In tropischen Gebieten gibt es aber Rekordhalter mit bis<br />
zu 15 m Reichweite.<br />
46 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Eine kriechende Bewegung (Abb 2-5) kommt z.B. bei der Kornblume (Centaurea cyanus)<br />
vor. Diese hat Fortsätze mit denen eine kriechende Bewegung möglich ist. Vor allem<br />
Korbblüter weisen diesen Mechanismus auf.<br />
47 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.2.2.3 Anemochorie<br />
Hier wird vor allem die Sinkgeschwindigkeit reduziert. Die Anemochorie kann wie folgt<br />
unterteilt werden:<br />
• boleochor (Windstreuer)<br />
• meteorochor (Windflieger)<br />
o cystometeorochor (Blasen/Ballonflieger)<br />
o pterometeorochor (Flügelflieger)<br />
o trichometeorochor (Haar/Schirmflieger)<br />
• chamaechor (Bodenläufer)<br />
Die oben erwähnte Steppenhexe wäre ein Beispiel für eine chamaechore Verbreitung von<br />
Samen.<br />
48 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Trichometeorochore (Abb. 14) Verbreitung betreibt z.B. der Löwenzahn (Taraxacum<br />
officinale). Diese Verbreitungsstrategie ist relativ häufig zu finden. Auch Baumwolle und<br />
Federgras setzt auf diese Strategie.<br />
Einen Sonderfall stellen die in Abb. 14 Punkt 11 und 12 gezeigten Diasporen: Hier ist der<br />
Embryo von nur wenigen Zellen umgeben und ist damit in der Luft mehr als Aerosol<br />
anzusehen. Vor allem Orchideen (die die artenreichste Pflanzenfamilie darstellen) haben<br />
diese Form der Verbreitung. Der Embryo kann so über mehrere Kilometer verfrachtet<br />
werden. Ein Nachteil ist allerdings, dass der Embryo auf kein Nährgewebe zurückgreifen<br />
kann und somit auf eine Mykorrhiza angewiesen ist, um zu keimen. Findet dieser keinen<br />
Pilzpartner, stirbt er ab.<br />
49 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Pterometeorochore Ausbreitung verwendet Flügel um die Sinkgeschwindigkeit zu verringern.<br />
Fällt der Samen zu Boden beginnen sich die Flügen durch Autorotation zu drehen und der<br />
Samen fällt langsam zu Boden (wie bei einem Hubschrauber mit Hauptrotorausfall). Vor<br />
allem Gymnospermen verwenden dies sehr oft. Ausnahmen sind Eibe (Zoochore<br />
Ausbreitung durch Vögel), Zirbe (Tannenhäher) und Pinie.<br />
50 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Windstreuer haben einen elastischen Blütenstängel, der im Wind hin und her schwingt. Dies<br />
kann er nur bis zu einem gewissen Punkt. Danach ist die Gegenkraft des Stängels (vgl.<br />
Federkraftkonstante F = −Dx) größer als die angreifende Kraft des Windes und der Stängel<br />
schwingt zurück. Bei diesem Rückschlag werden die Samen freigesetzt.<br />
51 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.2.2.4 Hydrochorie<br />
Ist allgemein die Ausbreitung mit Hilfe des Mediums Wasser. Hydrochorie wird wie folgt<br />
unterteil:<br />
• ombrochor (über aufschlagende Regentropfen)<br />
• nautochor (Diasporen schwimmen auf dem Wasser z.B. Kokosnuss) und<br />
• bythisochor (Diasporen haben ein hohes Gewicht und werden am Boden mittels<br />
Strömung fortgetragen)<br />
Schwimmfähige Diasporen haben häufig luftgefüllt Hohlräume oder besitzen Haare, die ein<br />
Luftpolster bilden. Oft sind diese Haare hydrophob. Bythisochore Arten kommen z.B. im<br />
Hochgebirge vor, wo sie mit der Schneeschmelze ins Tal getragen werden. Dadurch findet<br />
man oft auf Schuttbänken im Tiefland Hochgebirgspflanzen. Aufgrund ihrer ökologischen<br />
Nische (hoher Lichtbedarf) können sie sich aber nur in den Schuttbänken etablieren.<br />
52 / 143
VO Populationsbiologie<br />
53 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.2.2.5 Zoochorie<br />
Es wird grob unterschieden zwischen<br />
• Endozoochorie (Verdauungsausbreitung)<br />
• Exozoochorie (Diasporen haften an der Körperoberfläche)<br />
Beispiele für Endozoochorie: Es werden z.B. Früchte von Vögeln (tendenziell rote Fruchte,<br />
da Vögel ein großes Rotspektrum sehen „vogelrot“) gefressen und nach passieren des<br />
Verdauungstrakts ausgeschieden. Aber auch Samen, die auf dem Weg in die Vorratshöhle<br />
verloren werden tragen zur Verbreitung bei. Wie später noch erwähnt wird, ist es bei<br />
manchen Samen sogar notwendig, dass sie einen Reiz durch die Magensäure erhalten um<br />
zu keimen (Skarifikation).<br />
Beispiele für Exozoochorie sind Kletten, die sich im Fell oder Federn festsetzen. Manche<br />
Trampelkletten können relativ groß (bis 15 cm) werden und verhaken sich in Hufen von<br />
Großsäugern. Zoochore Ausbreitung bedeutet immer, dass der Lebensraum der Pflanze und<br />
der Tiere ähnlich sein muss.<br />
Tab. 14 zeigt den Inhalt von Feldmaus Vorratskammern. Diese Zusammensetzung entspricht<br />
auch der Zusammensetzung des Lebensraums der Feldmaus.<br />
54 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 12 zeigt ebenfalls eine ähnliche Korrelation bei verschiedenen Tiergruppen.<br />
55 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In Tab. 16 wird die Kotzusammensetzung verschiedener Tiere betrachtet. Es zeigt sich hier,<br />
dass das Reh die wenigsten Diasporen im Kot aufweist.<br />
56 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Eine weitere Möglichkeit Zoochorie einzuteilen, ist nach ihren ausbreitenden Tieren:<br />
• Myrmekochorie - Ameisen<br />
• Lumbricidochorie - Regenwürmer<br />
• Ornitochorie - Vögel<br />
• Mammalochorie - Säuger<br />
• Chiropterochorie – Fledermäuse und Flughunde<br />
Mundwanderer sind eine weiterer Punkt in der zoochoren Ausbreitung. Dies kommt z.B. bei<br />
Ameisen (Myrmekochorie) vor. Der Same hat ein Elaisom, das die Ameise frisst bzw. in den<br />
Bau schleppt. Nach dem fressen lässt sie den Samen fallen und hat ihn damit verbreitet.<br />
57 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Weitere Verbreiter sind Regenwürmer (Lumbricidochorie). In Abb.11 wird die Korrelation von<br />
Regenwurmkot und Keimlingen gezeigt.<br />
58 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Ausbreitung durch Fledertiere (Chiropterochorie). Fledertiere zeichnen sich durch eine<br />
nachtaktive Lebensweise aus. Für die Samenverbreitung sind die Gruppe der Fledermäuse<br />
und der Flughunde (Tropen) verantwortlich. Durch ihre Lebensweise müssen die Früchte frei<br />
präsentiert werden und sollten einen Fermentationsgeruch aufweisen. Da Fledermäuse<br />
farbenblind sind (können nur Weiß und Gelb wahrnehmen) müssen die Früchte zusätzlich<br />
eher hell sein.<br />
Ausbreitung durch Vögel (Ornitochorie) ist sehr weit verbreitet. In Abb. 38 wird eine<br />
Untersuchung in einem Park in Chur gezeigt. nahezu während des gesamten Jahres haben<br />
die Vögel durch die zur Verfügung stehenden Früchte zu fressen. Die einzige Ausnahme ist<br />
zwischen Mitte Jänner und Mitte April. Doch vor dieser Hungerperiode gibt es übermäßig viel<br />
Nahrungsangebot damit die Vögel diese überstehen können.<br />
59 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.2.2.6 Anthropochorie - Hemerochorie<br />
Die Ausbreitung durch den Menschen wird in 3 Verschiedene Gruppen eingeteilt:<br />
• Ethelochorie<br />
• Speirochorie<br />
• Agochorie.<br />
Unter Ethelochorie versteht man das absichtliche Ausbreiten von Samen als Nutz- oder<br />
Zierpflanzen. Ebenfalls können die in botanischen Gärten eingebrachten Arten verwildern, so<br />
geschehen beim Persischen Ehrenpreis (Veronica persica)<br />
Speirochorie kommt vor, wenn Saatgut durch andere Samen verunreinigt wird. Dies wird im<br />
EU Raum zwar durch Saatgutverordnungen größtenteils ausgeschlossen, in anderen<br />
Ländern kommt es allerdings noch vor.<br />
Agochorie ist die Ausbreitung von Samen z.B. über den Güterverkehr. Mit Mist oder Jauche<br />
kann der Samen verbreitet werden. Aber auch bei größeren Güterbahnhöfen sind oft<br />
exotische Pflanzen zu finden. Dies kommt auch im tierischen Bereich vor.<br />
60 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.2.3 Ausbreitungsstrategien<br />
Je nach Ausbreitungstyp und Diasporen werden 3 verschiedene Ausbreitungsstrategien<br />
unterschieden:<br />
• heterokarpische Pflanzen: Diese haben unterschiedliche Diasporen mit<br />
unterschiedlichen Ausbreitungstypen.<br />
• amphikarpische Pflanzen: Die Diasporen sind kaum differenziert, können aber<br />
oberirdisch oder unterirdisch gebildet werden.<br />
• polychore Pflanzen: haben einen Diasporentyp aber unterschiedliche<br />
Ausbreitungstypen.<br />
Abb. 2-10 (fehlt) zeigt Heterotheca latifolia. Es kommen Achänen (Frucht der Korbblütler) mit<br />
und ohne Pappus (umgewandelter Kelch zur Flugverbreitung) vor.<br />
Abb 2-9 zeigt Lathyrus amphicarpus und Vicia angustifolia. Beides amphikarpische Pflanzen.<br />
61 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In Abb. 2 sind die verschiedenen Ausbreitungsmöglichkeiten der Spitzklettenart Xanthium<br />
occidentale gezeigt. Dies ist eine polychore Ausbreitung. Allein in der Ausstreuphase kann<br />
die Pflanze ihre Samen über Ballochroie, Semachorie und Barochorie verbreiten.<br />
62 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.3 Diasporenpool - Diasporenbank<br />
Diasporenpool: Diasporen aller Populationen (inkl. Subpopulationen) eines Standortes.<br />
Diasporenbank: Diasporen einer Population, einer Sippe eines Standortes.<br />
Figur 1 zeigt, dass die Diasporenbank einer Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt ist. Dies sind<br />
z.B. Ein- und Ausbringung von Diasporen oder Fraß- und Krankheitsbefall. Diasporen<br />
können durch Wind und Wasser ausgebreitet werden. Diese Mechanismen haben einen<br />
Einfluss auf den In- und Output der Diasporenbank.<br />
63 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Welche Eigenschaften der Diasporen haben einen Einfluss auf die Diasporenbank?<br />
• Lebensdauer<br />
• Dormanz (Ruhephase)<br />
• Alter (Wie alt kann eine Diaspore werden)<br />
• Menge<br />
• Zusammensetzung (im Diasporenpool)<br />
• Lebensraum<br />
• Veränderung der Landschaft<br />
• Dynamik (Immigration, Nutzung...)<br />
3.3.1 Grundtypen der Diasporen<br />
Es gibt temporäre (nur 1 Jahr lebende) und dauerhafte (länger als 1 Jahr lebende)<br />
Diasporen. Dauerhafte Diasporen sind vor allem in saisonalen Gebieten wichtig. Hier<br />
müssen sie z.B. Sommer (Trockenheit) oder Winterpausen (Kälte, Trockenheit) einlegen.<br />
Figur 2 zeigt die verschiedenen Diasporenbankgrundtypen in jahreszeitlicher Abhängigkeit.<br />
Die schwarzen Bereiche entsprechen keimfähigen Diasporen, die weißen sind Diasporen in<br />
Dormanz. Die Höhe der Balken gibt die Menge der Diasporen an.<br />
• I ist eine temporäre Diaspore die nur kurz keimfähig ist.<br />
• II ist ebenfalls temporär hat aber eine lange Dormanz.<br />
• III zeigt dauerhafte Diasporen von denen viele Auskeimen und nur wenige im Boden<br />
verbleiben.<br />
• IV entspricht ebenfalls dauerhaften Diasporen. Hier verbleiben aber viele im Boden<br />
und keimen nicht aus.<br />
64 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In Tabelle 2 sind kurz die morphologischen und keimungsbiologischen Unterschiede<br />
zwischen temporären und dauerhaften Diasporen angegeben. Tendenziell sind dauerhafte<br />
eher kleiner und leichter, temporäre eher größer und schwerer.<br />
65 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb 3-5 stellt das Schicksal der Diasporen anhand von Kriechendem Hahnenfuß<br />
(Ranunculus repens) und Knolligem Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) dar. Bei Ranunculus<br />
repens werden die Diasporen im April freigegeben und relativ bald (Mitte August) sind 50 %<br />
der Diasporen bereits vernichtet. Nur ein kleiner Teil keimt aus. Bei Ranunculus bulbosus<br />
werden tendenziell weniger Diasporen vernichtet, dafür keimen aber ca. 40 % aus.<br />
66 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb 3-3 zeigt eine Übersicht von verschiedenen keimfähigen Diasporen in einer<br />
Bodensamenbank. Es zeigt sich, dass Echter Dost (Origanum vulgare), ein Spätblüher, den<br />
höchsten Anteil an der Diasporenbank hat.<br />
Dauerhafte Diasporen können unterschiedlich alt werden. Die Lebenserwartung liegt<br />
zwischen 25 und 1.700 Jahren (siehe Tab. 3-2).<br />
67 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In Figur 3 wird die Diasporenbank von einem stark entwässerten und einem intakten<br />
Hochmoors dargestellt. In der linken Seite sind die Diasporen höherer Pflanzen und in der<br />
rechten die Sporen von Moosen aufgetragen. Besenheide (Calluna vulgaris) kommt sowohl<br />
im entwässerten als auch im intakten Moor vor. Im intakten Hochmoor sind die Diasporen<br />
allerdings tiefer im Boden versenkt. Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia) kommt<br />
nur im intakten Hochmoor vor.<br />
68 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Um zu bestimmen, wie viele keimfähige Diasporen im Boden vorkommen, werden die<br />
Diasporen ausgesiebt und eingepflanzt. Daraus kann man ersehen, wie viele Diasporen<br />
keimfähig waren.<br />
Auch Umweltveränderungen lassen sich anhand von Diasporenbanken erkennen. Figur 4<br />
zeigt die Situation einer ehemaligen Streuwiese die über längere Zeit intensiv<br />
langwirtschaftlich genutzt wird. A zeigt Arten, die nur in der aktuelle Vegetation vorkommen,<br />
B Arten die aktuell wachsen und in der Diasporenbank vorkommen und C Arten die nur in<br />
der Diasporenbank vorkommen. In C sind eher Arten die auf Feuchtwiesen beheimatet sind<br />
(Seggen Arten).<br />
Zu dieser Zusammensetzung kommt es, da durch Entwässerung einer sauren Wiese eine<br />
Futterwiese geschaffen wurde. Die Diasporen sind zwar noch im Boden vorhanden, haben<br />
aber keinen geeigneten Standort um auswachsen zu können.<br />
69 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb 3-4 zeigt die Dynamik einer Diasporenbank. Die beeinflussenden Größen sind: u. a.<br />
Einwanderung, Fortpflanzung, Keimung und Tod.<br />
3.4 Keimung und Etablierung<br />
Die Diaspore wird ausgestreut und der Same, bestehend aus Embryo, Testa und<br />
Endosperm, keimt aus. Wasser ist als Ressource grundsätzlich notwendig<br />
um eine Keimung zu gewährleisten. Es gibt 3 Schritte die der Same durchmacht:<br />
1. Samenschale quillt auf - reversibel<br />
2. Radicula streckt sich, bleibt aber noch innerhalb der Samenschale - reversibel<br />
3. Radicula bricht durch die Samenschale - irreversibel<br />
3.4.1 Keimruhe<br />
Keimung muss nicht sofort stattfinden. Es gibt eine angeborene, induzierte und<br />
aufgezwungene Dormanz. Bei einer angeborenen Keimruhe wird trotz günstiger<br />
Umweltbedingungen nicht gekeimt. Bei induzierter Keimruhe kommt es durch schlechte<br />
Umweltbedingungen zu einer Dormanz. Diese beiden Vorgänge müssen durch ein Ereignis<br />
beendet werden. Bei einer aufgezwungenen Keimruhe kommt es durch eine Änderung von<br />
ungünstigen Umweltbedingungen zu keiner Keimung. Keimung findet statt, wenn die Umwelt<br />
wieder günstiger ist<br />
Es wird außerdem zwischen hypogäischer und epigäischer Keimung unterschieden. Bei<br />
hypogäischer (=unterirdisch) Keimung streckt sich das Epikotyl und die Keimblätter<br />
verbleiben im Boden. Bei Epigäische (=überirdisch) Keimung streckt sich das Hypokotyl und<br />
hebt die Keimblätter über den Boden empor.<br />
Der Keimungsverlauf wird in 3 Typen eingeteilt:<br />
• Typ 1: Alle Samen keimen gehäuft in relativ kurzer Zeit.<br />
• Typ 2: Zwei oder mehr Häufungen, dazwischen keine.<br />
• Typ 3: Gleichmäßige Keimung über einen gewissen Zeitraum.<br />
70 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb 4-3 zeigt Beispiele für diese Keimungsverläufe. Das Alpen-Weidenröschen (Epilobium<br />
alpinum) wächst in großen Höhen, wo die Vegetationszeit nur kurz ist. Der Stachel-Lattich<br />
(Lactuca serriola) stammt ursprünglich aus wärmeren Gebieten<br />
Vorderasiens/Mittelmeerraum (ständige Keimung möglich). Der Alpen-Tragant (Astragalus<br />
alpinus) ist ebenfalls eine Alpenpflanze.<br />
71 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 4-8 zeigt einen Unterschied im Keimungsverlauf bei amphikarpischen Pflanzen auf<br />
nassen und trockenen Standorten. Bei nassen Standorten ist der Keimungsverlauf beider<br />
Diasporentypen etwa gleich. Bei trockenen Standorten haben die unterirdisch Keimenden<br />
Diasporen aber einen Vorteil.<br />
In Abb. 2-10 wird Heterotheca latifolia gezeigt. In dem Diagram wird ersichtlich, dass<br />
Achänen mit Pappus nach 8 Tagen zu 80 % keimen. Achänen ohne Pappus erst nach 32<br />
Tagen. Verhinderung von Konkurrenz.<br />
3.4.2 Keimstimulanz<br />
Eine Dormanz wird durch eine Keimstimulanz aufgehoben. Es gibt 2 Wege der<br />
Keimstimulanz:<br />
• Stratifikation: Ein Keimimpuls wird durch einen Kälteschock ausgelöst (wichtig bei<br />
Alpinpflanzen damit sie nicht zu früh keimen).<br />
• Skarifikation: Die Testa wird durch einen mechanischen oder chemischen (z.B.<br />
Magensäure) Reiz stimuliert. Samen, die von Vögeln transportiert werden weisen<br />
dies häufig auf: Durch den Schnabel wird die Testa verletzt. Ein zusätzlicher Reiz<br />
kommt durch die Magensäure zustande. Auch bei Samen, die durch Flüsse<br />
fortgeschwemmt werden kommt es zu mechanischen Reizen.<br />
72 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb 4-2 zeigt das Keimverhalten des Vogelknöterichs (Polygonum aviculare), einem<br />
Ackerunkraut. In einem gestörten Boden kommt es zu einer wesentlich häufigeren Keimung<br />
als in einem ungestörten Boden. Bearbeitung des Bodens führt zur Skarifikation<br />
In Abb 4-4 ist die Keimung verschiedener Pflanzen in Abhängigkeit zum Wasserdruck<br />
dargestellt. Wasserdruck führt zur Skarifikation.<br />
73 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.4.3 Schutzstellen - Safe Sites<br />
Schutzstellen enthalten Elemente die eine Keimruhe brechen und wo sich ein Keimling<br />
etablieren kann. Sie muss über Ressourcen verfügen die während der Keimung verbraucht<br />
werden. Dies wäre z.B. Wasser und Licht. Außerdem muss Sie vor Risiken schützen (z.B.<br />
vor Samenfresser, Konkurrenten).<br />
Es wird zwischen Keim-Schutzstelle und Etablierungs-Schutzstelle unterschieden. Bei einer<br />
Keim-Schutzstelle muss der Samen nur keimen können. Bei einer Etablierungsschutzstelle<br />
muss er sich zusätzlich etablieren können. Etablierungs-Schutzstellen müssen zusätzlich<br />
geeignete Nährstoffe vorweisen können. Gleichzeitig muss das Mikroklima passend sein und<br />
die Konkurrenz durch andere Pflanzen erträglich.<br />
Abb. 4-5 zeigt die Keimung und Sterblichkeit von Aussaaten unter verschiedenen<br />
Bedingungen. Curlex sind Matten, die etwa auf Schipisten aufgebracht werden, um vor<br />
Erosion zu schützen.<br />
In Tab 4-2 (fehlt) zeigt, dass die Schutzstellen oberhalb der Waldgrenze bestimmte<br />
Eigenschaften haben müssen wie:<br />
• Bodenoberfläche ist stabilisiert<br />
• Boden ist günstig für Verankerung<br />
• Ausreichende Bodenfeuchte<br />
• Ausreichend Licht<br />
• Ausreichend Nährstoffgehalt (niedrig bzw. limitierend)<br />
74 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In Abb. 4-9 sind die Veränderungen der Schutzstellen im Sukzessionsverlauf angeführt. Die<br />
Eigenschaften von Schutzstellen im Sukzessionsverlauf ändern sich. So hat eine<br />
Pioniergesellschaft andere Anforderungen an eine Schutzstelle als Übergangsgesellschaften<br />
oder Endgesellschaften. Bei einer Störung (z.B. durch einen Erdrutsch) und daraus<br />
resultierender Vernichtung der Endgesellschaft (oder Übergangsgesellschaft) kommt es<br />
wieder zu einem Pionierstadium. Daher sind die Schutzstellenanforderungen wieder die<br />
einer Pioniergesellschaft.<br />
75 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In Fig. 4/9 ist der Einfluss der Bodenoberfläche (in diesem Fall Farbe) auf die Keimung<br />
gezeigt. Da sich dunkle Böden stärker erwärmen als helle Böden, ist auf dunklen die<br />
Keimung forciert. Eine schnellere Keimung bedeutet einen klaren Wettbewerbsvorteil.<br />
76 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.4.4 Etablierungswachstum<br />
Sind keine Ressourcen mehr aus dem Endosperm vorhanden, kommt es zur Ausbildung von<br />
Folgeblättern und damit zum Entstehen einer selbstständigen Pflanze. Endet mit Beginn des<br />
Expansionswachstum.<br />
Abb. 16 zeigt die Keimung und die sich ausbildenden Primärblätter.<br />
Phänomen der Nurse-Plant („Kinderschwesterpflanze“) Nachbarpflanzen bieten Hilfe bei der<br />
Etablierung von Keimlingen. Einige Beobachtungen in Trockenräumen, genauerer<br />
Mechanismus ungeklärt.<br />
3.5 Wachstum und Entwicklung<br />
3.5.1 Wachstum<br />
Wachstum ist eine irreversible Zunahme an Substanz und räumlichen Umfang. Wachstum<br />
kann quantitativ oder qualitativ erfolgen. Ein quantitatives Wachstum ist die Zunahme der<br />
Biomasse oder der Individuenanzahl. Qualitatives Wachstum ist die Wandlung eines<br />
Individuums einer Population oder der Vegetation. Wachstum wird in 5 verschiedene Typen<br />
eingeteilt:<br />
1. Anfangswachstum AW<br />
2. Etablierungswachstum ETW<br />
3. Expansives Wachstum EXW<br />
4. Regeneratives Wachstum REW (Ersetzen von (z.B. Laub)<br />
5. Reproduktives Wachstum FW (Blüten und Fruchtbildung)<br />
Anfangswachstum und Etablierungswachstum sind einmalige Ereignisse. Hingegen wird<br />
expansives Wachstum regelmäßig wiederholt. Darunter fällt Befall von Pathogenen oder<br />
auch Umgang mit Konkurrenz. Regeneratives und reproduktives Wachstum sind<br />
üblicherweise mehrmalig. Außer bei einjährigen Arten, wo auch das reproduktive Wachstum<br />
einmalig ist.<br />
77 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 5-1 zeigt Beispiele verschiedener Wachstumstypen.<br />
78 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.5.1.1 Relative Wachstumsrate<br />
Ist der Biomassenzuwachs auf Individuen- und Populationsebene. Je nach<br />
Betrachtungsweise ist damit das gesamte, ober- oder unterirdische Wachstum gemeint. So<br />
zeigen z.B. trockenheitsangepasste Pflanzen mehr unterirdische Biomasse als verwandte<br />
feuchtigkeitsadaptierte Pflanzen. Grob unterteilt unter:<br />
• Konkurrenz<br />
• Standort<br />
• Verfügbarkeit der Ressourcen<br />
Dies führt zu verschiedenen zu messenden Größen:<br />
• Blattarealkoeffizient<br />
• Blattarealdauer<br />
• Biomassenzuwachs<br />
• Zunahme der Individuenzahl einer Population (nach Generationen gezählt)<br />
Entscheidend für die Wachstumsrate sind aber auch genetische Vorgaben:<br />
• Effizienz der Ressourcenaufnahme<br />
• Effizienz der internen Nutzung<br />
Diese Werte sind schwer zu bestimmen, aber sehr aussagekräftig. Diese Faktoren sind auch<br />
wichtig für Kulturpflanzen und deshalb oft das Ziel biotechnologischer Maßnahmen. So kann<br />
z.B. mit einer verbesserten Stickstoffaufnahme der Ertrag erhöht werden ohne zusätzliche<br />
Düngemaßnahmen.<br />
79 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In Abb. 5-2 sind verschiedene Kombinationen von Wachstum aufgetragen. Viele Pflanzen<br />
entsprechen dem linken Typus. Kaum eine altersmäßige Differenzierung. Dieser braucht<br />
viele Jahre um geschlechtsreif zu werden (oft bei krautigen Pflanzen auf ungünstigen<br />
Standorten). Der mittlere Typus (EXW und FO) ist bei Pflanzen auf isolierten Standorten<br />
(ohne EINWanderung) zu finden.<br />
80 / 143
VO Populationsbiologie<br />
81 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 5-4 zeigt zwei Primelarten und ihr unterschiedliches Wachstumsverhalten bei<br />
verschiedenen CO2 Drücken. Die Zwergprimel hat weniger oberirdische Biomasse, kann<br />
aber aufgrund ihrer auf Höhe adaptierten Lebensweise bei geringen CO2 Drücken effizienter<br />
Biomasse aufbauen.<br />
3.5.2 Entwicklung<br />
Die Entwicklung kann in Altersentwicklungsstufen (AES) nach RABOTNOV eingeteilt<br />
werden:<br />
• Samen se<br />
• Keimling p<br />
• juvenil j<br />
• unreife im (inmaturate)<br />
• vegetative v<br />
• generative g (g1 − g3)<br />
• subsenil ss<br />
• senil s<br />
82 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Tab. 5-5 zeigt die Altersverteilung von Populationen verschiedener Steppengräßer. In der<br />
trockenen Steppe sind die meisten Individuen in g3 − ss. Es zeigt sich deutlich eine<br />
Überalterung der Population. Nördlicher gelegene Steppen tendieren eher zu g2 und sind (im<br />
Moment) eine stabile Population. Solche Informationen sind für den Schutz von Populationen<br />
sehr wichtig.<br />
Eine Veränderung der Altersstruktur kann verschiedene Ursachen haben (z.B. eine<br />
Nährstoffveränderung, Veränderungen im Wasserhaushalt). Durch die Untersuchung der<br />
Altersstruktur kann man feststellen, ob eine Population z.B. überaltert oder juvenil ist.<br />
83 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Unterstrichen = im Maximum etwa g1 im Maximum, dann ist Pflanze in der Phase Normal<br />
(jung)<br />
84 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.5.3 Variation und Plastizität<br />
• Entwicklungsbedingte Variation<br />
• Phänotypische Plastizität<br />
Abb. 5-6 zeigt die Veränderung der Blattmorphologie in Abhängigkeit zur Jahreszeit.<br />
In Tab. 5-7 ist die phänotypische Plastizität im Fortpflanzungsverhalten gegen die<br />
Umweltveränderungen aufgetragen.<br />
85 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.6 Klonales Wachstum<br />
Die Gesamtheit der vegetativ aus einem einzigen Ausgangsindividuum hervorgegangenen<br />
Nachkommen ist ein Klon. Klone sind somit genetisch identisch.<br />
3.6.1 Morphologie<br />
• Modularer Organismus<br />
• Ramet. Ein Ramet ist eine durch klonales Wachstum einer Pflanze gebildete<br />
vegetative Einheit die zu selbstständiger Existenz fähig ist, falls sie von der<br />
Mutterpflanze getrennt wird.<br />
• Ein Ramet besteht aus Nodien und Internodien<br />
Klonales Wachstum ist die durch iterative Bildung von Ramets erkennbare Form des<br />
expansiven Wachstums eines Individuums. Auch Tiere z.B. bei Hohltieren (Coelenterata) wie<br />
Korallen oder Staatsquallen, aber auch bei Manteltieren (Tunicata) weisen dies auf.<br />
Abbildung 1.22 fehlt. Etwa bei der Gartenerdbeere<br />
Strategischer Vorteil des klonalen Wachstums: Energieeinsparung durch fehlende sexuelle<br />
Fortpflanzung, rasche Raumgewinnung<br />
Pflanzen die sich nur klonal fortpflanzen sind eher selten (z.B. Elodea canadensis). Meist<br />
kommt es zu einer Mischung aus sexueller und klonaler Fortpflanzung. Ebenso ist eine rein<br />
sexuelle Fortpflanzung selten.<br />
Abb. 10-5 zeigt verschiedene Klonierungsmuster. Bei B werden Ausläufer mit langen<br />
Internoden gebildet. Werden diese unterbrochen, wird der Ramet zur selbstständigen<br />
Pflanze. Werden die Internodien immer weiter verkürzt kommt es zur Rosettenbildung<br />
(Polsterpflanze). Hier ist es besonders schwer festzustellen, was ein einzelnes Individuum<br />
ist.<br />
86 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Der Zusammenhang zwischen Pflanzengröße und -aufbau wird in Abb. 1-3 gezeigt.<br />
87 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.6.2 Typen des klonalen Wachstums<br />
1. Fortpflanzung durch spezielle Propagulen 5<br />
2. Klonieren durch Ramets<br />
(a) Selbstklonierung (spontane Fragmentation)<br />
(b) erzwungene Klonierung<br />
5 Propagulen sind Teile einer Pflanze aus denen neue Pflanzen ohne Bestäubung und<br />
Fruchtbildung hervorgehen. Propagulen können ober- oder unterirdisch sein.<br />
88 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In Abb. 10-2 zeigt die vegetative Fortpflanzung beim Lebendgebärenden Knöterich<br />
(Polygonum viviparum).<br />
89 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.6.2.1 Selbstklonierung<br />
Selbstklonierung kann auf verschiedene Arten erfolgen:<br />
• Rasche Ablösung des Tocherramets ohne Biomassenverlust z.B. Kleine Wasserlinse<br />
(Lemna minor)<br />
• Stufenweises Absterben der Verbindungsstellen zwischen Mutter- und Tocherramets<br />
z.B. Kriechende Nelkenwurz (Geum reptans)<br />
• Fragmentierung der Mutterpflanze durch Absterben von Ramets bzw. Pflanzenteilen<br />
z.B. Polster-Segge (Carex firma)<br />
In Abb. 10-8 ist die Selbstklonierung mit Rametbildung gezeigt. Die Mutterpflanze stirbt<br />
hierbei (zumindest teilweise) ab. Es kommt auch zu einem physiologischen Stoffaustausch<br />
zwischen den Ramets.<br />
3.6.2.2 Erzwungene Klonierung<br />
Kann erfolgen durch:<br />
• Fragmentierung durch Wasser z.B. Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis)<br />
• Bodenbewegung z.B. Großblütige Gämswurz (Doronicum grandiflorum)<br />
• Viehtritt z.B. Alpen-Ehrenpreis (Veronica alpina)<br />
Bei einigen Pflanzenarten, wie etwa der Großen Brennnessel (Urtica dioica), kann aus einem<br />
Rhizomstück wieder eine vollständige Pflanze entstehen.<br />
90 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.6.2.3 Beispiele<br />
Gneum reptans in Abb. 10-7 ist ein Beispiel für oberirdische Ausbreitung durch Ramets.<br />
Hangschutt wird von den Ramets durchdrungen und befestigt ihn so.<br />
Bild 1.21 fehlt; Polygonatum verticillatum<br />
Bild Paris quadrifolia fehlt; Solanum tuberosum fehlt;<br />
91 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 6-4 zeigt die verschiedenen Typen von Ramets mit langen und kurzen Ausläufern. Bis<br />
hin zur sehr starken Verkürzung der Internodien, womit ein Kugelpolstern entsteht.<br />
92 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 6-3 zeigt dass sich auch Populationen von klonal wachsenden Pflanzen sehr stark<br />
vermischen. Viele Nachbarn, die nicht genetisch ident sind. Es existiert also eine genetische<br />
Vermischung.<br />
Abb. 2 zeigt Stängelloses Leimkraut (Silene acaulis). Eine Polsterpflanze die sich durch die<br />
Verkürzung der Internodien ein eigenes Mikroklima schafft. Im inneren der Pflanze ist es<br />
wärmer und abgestorbene Pflanzenteile landen im Wurzelbereich und können dort recycled<br />
werden.<br />
93 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Immergrünner Steinbrech (Saxifraga paniculata = Saxifraga aizoon) ist eine Gebirgspflanze.<br />
94 / 143
VO Populationsbiologie<br />
95 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.6.3 Strategien<br />
Es kann hier grob zwischen Phalanx und Guerilla-Strategen unterschieden werden. Phalanx-<br />
Strategen verdrängen ihren “Gegner” mit Masse bzw. Anzahl der Individuen, wo hingegen<br />
Guerilla-Strategen eine infiltrations- und abwartende Strategie (können Horste bzw. Pölster<br />
durch Ausläufer durchlöchern) verfolgen. Bei Guerilla-Pflanzen sind Rhizome oder Stolonen<br />
typischerweise lang und kurzlebig. Bei Phalanx-Pflanzen sind Rhizome oder Stolonen<br />
typischerweise kurz und langlebig, sowie meist dichtgepackt (wie eine antike<br />
Phalanx=Schlachtreihe).<br />
In ariden Gebieten, in der keine Beweidung stattfindet, können Guerilla-Strategen in Phalanx<br />
Strategen (Polsterpflanzen) auswachsen. Die Polster- und Horstpflanzen sind für Herbivoren<br />
weniger attraktiv als die Guerilla-Strategen. Findet nun eine Beweidung statt, fressen die<br />
Herbivoren die Guerilla-Strategen und die Phalanx-Strategen können sich durchsetzen.<br />
Abb. 6-5 zeigt Beispiele für solche Pflanzen. Die Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa)<br />
bildet Horste und wird aufgrund seiner schneidig-rauen Blätter (Schneidegras) vom Vieh<br />
gemieden.<br />
96 / 143
VO Populationsbiologie<br />
97 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.7 Regeneration<br />
Regeneration ist ein biologischer Ersetzungsprozess, der auf der natürlichen<br />
Wiedererzeugung verloren gegangener Teile beruht. Regeneration findet sowohl auf<br />
Individuen (Organe) als auch Populationsebene (Individuen) statt! Es ist nur von der<br />
Betrachtungsweise abhängig. Im Naturschutz wird man vornehmlich die Populationsebene<br />
betrachten.<br />
Es gibt verschiedene Strategien die zur Regeneration zwingen:<br />
• Fluchtstrategen: Vermeiden von ungünstigen Umweltbedingungen (z.B. durch<br />
Laubabwurf)<br />
• Toleranzstrategen: Ertragen von ungünstigen Bedingungen<br />
Toleranzstrategie kann mit und ohne Schaden erfolgen. Es kommt jedoch häufig vor, dass<br />
auf den Schaden mit Kompensation reagiert wird. Dies führt zu drei möglichen Szenarien:<br />
• Tatsächliche Kompensation: Es wird nur das ersetzt, was tatsächlich verloren<br />
gegangen ist<br />
• Überkompensation: Die Pflanze reagiert mit vermehrtem Wachstum (mehr<br />
reproduziert als vorher da war)<br />
• Unterkompensation: der entstandene Schaden wird nur teilweise kompensiert.<br />
Abb. 7-7 zeigt ein Beispiel für Überkompensation.<br />
98 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Man kann Regeneration auf Populationsebene in mehrere mögliche Stufen einteilen:<br />
1. Ersatz von Pflanzenteilen zyklisch Jahr für Jahr (z.B. Laubabwurf)<br />
2. Ersatz von Individuenteilen (regenerativ) oder ganzen Individuen<br />
3. Ersatz der ganzen Populationen. Häufig wenn die Populationen (wie oben<br />
angesprochen) überaltert sind, kommt es zu einem Ersatz durch juvenile<br />
Populationen.<br />
3.8 Bestäubung und Befruchtung<br />
Unter Bestäubung (Endung -philie)versteht man die Übertragung des Pollens vom Staubblatt<br />
zur Narbe. Befruchtung (Endung -gamie) beschreibt die Übertragung der Spermien (-zellen)<br />
von der Narbe zur Eizelle.<br />
• Bestäubung (-philie)<br />
• Befruchtung (-gamie)<br />
• Diasporenausbreitung (-chorie)<br />
Abb. 58 zeigt den Aufbau eines Pollens. Die Schale ist in Intine und Exine eingeteilt. Die<br />
Hülle des Pollens ist wichtig für das Transportmedium. Oft befinden sich Tröpfchen<br />
(Pollenkit) darauf, die das Anheften an der Narbe oder dem Transportmedium erleichtern.<br />
Bild Gliederung Sporoderm fehlt.<br />
3.8.1 Selbstbefruchtung (Autogamie)<br />
Selbstbefruchtung (Selbster) kommt bei Pflanzen hauptsächlich vor, wenn ein Mangel an<br />
Transportmedium oder Pollen herrscht. Für eine Selbstbefruchtung werden meist<br />
kleistogame Büten (Blüte bleibt geschlossen, Befruchtung durch eigenen Pollen) gebildet,<br />
die wenig auffällig und meist geschlossen sind.<br />
Selbstbefruchtung führt aber auch zu einem Verlust an genetischer Varianz. Daher haben<br />
Pflanzen auch Mechanismen ausgebildet um Selbstbefruchtung zu verhindern:<br />
• Genetische Inkompatibilität<br />
• Heterostylie (Einrichtungen an der Blüte, die eine Selbstbefruchtung verhindern:<br />
Unterschiedliche Griffellänge bzw. Platzierung) Etwa bei der Gattung Primeln<br />
(Primula).<br />
• Dichogamie (Unterschiedliche Reifezeit von Frucht- und Staubblättern, bei zwittrigen<br />
Blüten, Proteroandrie (vormännlich, Staubblätter reifen zuerst) bzw. Proterogynie<br />
(vorweiblich, Fruchtblätter reifen zuerst). Bild fehlt: Epilobium angustifolium<br />
• Herkogamie (Räumliche Trennung zwischen weiblichen und männlichen Blüten)<br />
Beispiel: Hasel,<br />
99 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Heterostylie bei der Duft-Primel (Primula veris)<br />
3.8.2 Allogamie – Fremdbefruchtung<br />
Als Blume werden Bestäubungseinheiten bezeichnet. Blüten (Kelch-, Kron-, Staub- und<br />
Fruchtblätter) nennt man die morphologische Einheit die direkt zur geschlechtlichen<br />
Fortpflanzung dient.<br />
Es gibt verschiedene Blumentypen:<br />
• Euanthium: Eine Blume besteht aus einer Blüte (z.B. Glockenblume)<br />
• Pseudanthium: Eine Blume besteht aus vielen Blüten (z.B. Korbblütler, Doldenblütler)<br />
• Meranthium: Eine Blume besteht aus einem Teil einer Blume (z.B. Iris sp.)<br />
3.8.3 Bestäubungsmedien<br />
3.8.3.1 Hydrophilie<br />
Pflanzen, die Wasser als Bestäubungmedium verwenden, haben meist unscheinbare Blüten.<br />
Die Diasporen sind oft luftgefüllt und/oder Pollen mit einer unbenetzbaren Pollenwand<br />
ausgestattet. Die Narbe ist oberflächenvergrößert. Dies kommt nur bei wenigen<br />
Wasserpflanzen vor. Bei Landpflanzen selten, jedoch kann Wasser bei der Befruchtung einer<br />
Rolle spiele (Farne, Moose).<br />
100 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 40: Blüten der Wasserschraube (Vallisneria spiralis)<br />
101 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.8.3.2 Anemophilie<br />
Übertragung über Wind (windblütig) erfordert eine große Pollenmenge, es ist aber kein Lock<br />
oder Reizmittel notwendig. Oft sind es unscheinbare Blüten mit glatten Pollen die Luftsäcke<br />
enthalten können.<br />
Beispiele sind z.B. die Hasel (Corylus avellana) und Gräser wie der Wiesen-Schwingel<br />
(Festuca pratensis), wo die Staubblätter windexponiert liegen.<br />
Bei Anemophilie wird zwischen primärer und sekundärer Anempholie unterschieden. Es<br />
existieren auch Übergänge zwischen Tier- und Windbestäuber.<br />
Primäre Anemophilie wird ursprünglich von Gymnospermen verwendet. Magnolien gelten als<br />
sehr ursprüngliche Angiospermen und verwenden primäre Anemophilie.<br />
Bei sekundärer Anemophilie herrschte zuerst Zoophilie und es erfolgte erst in einem zweiten<br />
Schritt die Bestäubung über Anemophilie (z.B. Buche, Eiche, Haselnuss). All diese Pflanzen<br />
haben einen windexponierten Lebensraum gemeinsam.<br />
3.8.3.3 Zoophilie<br />
Diese zeichnet sich durch eine geringre Pollenmenge und das Vorhandensein von Lock- und<br />
Reizmittel aus. Die Blüten haben einen Schauapparat. Lockmittel können sein:<br />
• Nahrung<br />
o Pollen (evolutiv ursprünglicher, kostbar da für Reproduktion benötigt)<br />
o Nektar (höherwertiger, Ersatz)<br />
• Mimikry mit Pheromone (Vortäuschen von Sexualpartnern (Orchideen sind hier<br />
Spezialisten)<br />
• Eiablage (Gallblüten)<br />
• Sonstiges<br />
102 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.8.3.3.1 Lockmittel<br />
Es werden spezielle Behälter für die Lockmittel benötigt. Es gibt verschiedene Blumentypen:<br />
• Pollenblumen (etwa Gattung Magnolia)<br />
• Nektarblume (etwa Gattung Ranunculus mit Nektarium)<br />
• Ölblumen<br />
• Fallenblumen<br />
• Parfumblumen (Vorteil artspezifische Befruchtung ist sehr effizient)<br />
• Brutplatzblumen (etwa bei der Feige)<br />
• Täuschungsblume (Orchideen)<br />
Pollenblume Magnolia sp.<br />
Nektarblume Acker-Hahnenfuß<br />
103 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abb. 104 zeigt verschiedene Blüten die von Insekten (Käfer) bestäubt werden.<br />
Abb 108.: „Abgestimmte“ Blühzeit um die Käfer mit konstantem Angebot zu versorgen und<br />
so quasi „bei der Stange zu halten“.<br />
Um Energie zu sparen ist die Pflanze bestrebt Pollen einzusparen. Dies gelingt dadurch,<br />
dass Nektar für die Tiere bereitgestellt wird und dieser so platziert wird, dass der Bestäuber,<br />
wenn er an ihn gelangen will, mit dem Pollen in Berührung kommt. Hierbei kommt es oft zum<br />
Nektarraub durch Hummeln, die durch den Kelch beißen um an den Nektar zu gelangen,<br />
ohne die Pflanze zu bestäuben.<br />
104 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Eine andere Möglichkeit der Zoophilie ist, dass die Pflanze als Brutplatz dient. Legt das<br />
Insekt die Eier ab, kommt es mit dem Staubblatt in Berührung. Wie bei Abb 76. der Echten<br />
Feige (Ficus carica): Eiablage nur in Gallblüten und Pollenaufnahme an den Staubblättern.<br />
Insekt wandert zur nächsten Blüte, die nur aus Samenblüten besteht, wo der Pollen auf die<br />
Narbe übertragen wird.<br />
Täuschungsblumen bilden hingegen das Abdomen von Weibchen nach wodurch es bei<br />
jedem Kontakt zu einer Verbreitung des Pollens kommt.<br />
105 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.8.4 Reizmittel<br />
Reizmittel werden wie folgt unterteilt:<br />
• optisch<br />
• chemische<br />
• Farbe.<br />
o UV-Sichtbarkeit (Hummeln und Bienen sehen kein rot)<br />
o Vogelrot<br />
o Schaueinrichtungen mit Saftmalen<br />
o Exponieren von Blüten.<br />
• Duft<br />
o Artspezifisch z.B. Kotgeruch, Aasgeruch für Fliegen<br />
o Duftmale, manche Tiere können in der Evolution immer besser riechen. Der<br />
chemische Gradient dient als Leitmittel.<br />
3.8.5 Spezialisierungen<br />
Pflanzen haben verschiedene Spezialisierungen ausgebildet um “fit” zu werden. Diese<br />
Spezialisierungen können sein:<br />
• Pollen haben einen Pollenkit und eine veränderte Oberflächenstruktur um besser zu<br />
haften<br />
• Der Haftbereich an der Narbe kann ebenfalls mit Pollenkit versehen sein oder<br />
morphologische Veränderungen aufweisen<br />
• Mechanische Anpassungen wie z.B. Hebelmechanismen, Gleitfallen, Klemmfallen,<br />
zygomorpher Bau, Reduzierung des Pollen zum Pollinium<br />
Dies führt zu verschiedenen funktionellen Blumentypen: (in Klammer beispielhafte<br />
Gattungen)<br />
• Scheiben- und Napfblumen (Anemona, Euphorbia, Bellis)<br />
• Becher- und Glockenblumen (Crocus, Campanula)<br />
• Röhren- und Stieltellerblumen (Silene, Gentiana)<br />
• Fahnen- und Schmetterlingsblumen (Corydalis, Trifolium)<br />
• Rachen- und Lippenblumen (Viola, Lamium, Orchis)<br />
• Bürsten- und Pinselblumen (Acacia, Salix)<br />
• Fallenblumen (Arum, Vincetoxicum)<br />
106 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Scheibenblume: Wachsende Narbe streift den Pollen vom Staubblatt ab.<br />
Glockenblumentyp: Auch für größere Besucher zugänglich.<br />
107 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Lippenblütler weisen eine Hebelmechanik auf. Das Insekt muss an der Unterseite landen<br />
und kommt damit zwangsläufig mit dem Staubblatt in Kontakt.<br />
Weiteres Beispiel für eine Lippenblume, hier ein Vertreter der Gattung Knabenkräuter<br />
(Orchis)<br />
108 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Fallenblumen haben z.B. einen Klemmapparat der den Rüssel des Insekts kurzzeitig festhält<br />
und so seine Pollen weitergibt.<br />
Der Gefleckte Aronstab (Arum maculatum) als Beispiel für eine Kesselfallenblume.<br />
Gleichzeitig eine Fliegenblume.<br />
109 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Je spezialisierter eine Pflanze ist, umso weniger ist sie einer Bestäuberkonkurrenz<br />
ausgesetzt und benötigt weniger Pollen für den gleichen Erfolg. Insektenblumen werden je<br />
nach ihrem assoziierten Bestäuber eingeteilt:<br />
• Insektenblumen (Entomophilie):<br />
o Käferblumen (Cantharophilie)<br />
o Fliegenblumen (Myiophilie)<br />
o Bienenblumen (Melittophilie)<br />
o Tagfalterblumen (Psychophilie): haben schmale, lange Kronröhre<br />
o Nachtschwärmerblumen (Sphingophilie)<br />
• Vogelblumen (Ornithophilie)<br />
• Fledermausblumen (Chiropterophilie)<br />
110 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Bestäubung durch Vögel (etwa bei Schwebvogelblumen Bestäubung durch Kolibris)<br />
Masse der oben angeführten Pflanzen mit roter Blütenfarbe (=Vogelrot) Blüten für nachaktive<br />
Organismen sind Pinselblumen (eher hell und mit Geruch).<br />
Magnoliaceae waren in der Kreidezeit die einzigen Angiospermen. Es gab in der Kreide auch<br />
absolut gesehen weniger Arten. Eine Spezialisierung auf bestimmte Bestäuber war daher<br />
nicht notwendig. Je mehr Arten allerdings aufkamen, umso spezialisierter mussten die<br />
Pflanzen werden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ein Beispiel für eine solche<br />
Spezialisierung sind lange Blüten, die speziell für Bestäuber mit langen dünnen<br />
Mundwerkzeugen ausgelegt sind. Pflanzen und Bestäuber durchliefen eine gemeinsame<br />
Evolution (Coevolution). Vorteile durch Mutualismus.<br />
111 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.9 Fortpflanzung<br />
Es wird zwischen sexueller Fortpflanzung und Apomixis unterschieden.<br />
Bild 9.5 fehlt. Schematische Darstellung der gametophytischen Apomixis. (Pseudogamie,<br />
Agamospermie) Bekannte Vertreter der Gattung Rubus oder Hieracium, Taraxacum.<br />
In Abb 8-5 wird die Verteilung der Biomasse auf die verschiedenen Pflanzenteile gezeigt. Bei<br />
der Feststellung der Ressourcenverteilung kann man die Anzahl der Blüten zählen. Wichtig<br />
ist, wie viele keimfähige Samen pro Kompartiment sind. Ist dieses Verhältnis gestört, kann es<br />
zu einem Absterben der Population kommen.<br />
112 / 143
VO Populationsbiologie<br />
3.9.1 Ressourcenverteilung<br />
113 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4 Teil Prof. Comes<br />
4.1 Darwin und Evolutionstheorie<br />
Charles Darwin stach am 27. Dezember 1831, im Alter von 22 Jahren, mit der Brigg Ihrer<br />
Majestät Schiff Beagle, unter dem Kommando Kapitän Fritz Roys, von Devonport aus in See.<br />
Die Reise der H. M. S. Beagle sollte 5 Jahre dauern und um die ganze Welt führen. Nach<br />
seiner Rückkehr hatte Charles Darwin die Grundzüge seiner Evolutionstheorie im Kopf. Die<br />
gesammelten Daten reichten aus, um das 1859 erschienene, revolutionäre Werk “Origin Of<br />
Species 6 ” zu veröffentlichen. Dieses Buch gilt als grundlegende Arbeit im Bereich<br />
Evolutionstheorie. Auch Alfred Russel Wallace hatte zuvor ähnliche Überlegungen angestellt,<br />
die auch an der Linnean Society vorgetragen wurden.<br />
Die besondere Bedeutung dieser Reise zeigt sich durch die Tatsache, das Darwin danach<br />
England nie wieder verließ. Er heiratete und zog sich, mit ererbten Vermögen, in ein<br />
Landhaus zurück und extrapolierte aus dem gesammelten Datenmaterial, Briefverkehr und<br />
Literatur seine Evolutionstheorie.<br />
Charles Darwin reduzierte als erster alle Arten auf eine gemeinsame Linie. Es gibt daher<br />
keine multiple Entstehung und damit auch keine gesonderte Entstehung des Menschen.<br />
Dieser Prozess führt direkt zum aussterben von Arten. Eine Linie stirbt aus, wenn die<br />
Extinktion größer ist als die Spezifikation.<br />
Dieses Prinzip wurde relativ schnell akzeptiert. Auch Jean-Baptiste de Lamarck entwickelte<br />
eine Evolutionstheorie. Er erkannte auch eine Formenveränderung mit der Zeit. Ein wichtiger<br />
Unterschied zu Charles Darwin liegt allerdings darin, dass Lamarck Evolution als etwas<br />
Zielgerichtetes verstand und an die Vererbung erworbener Eigenschaften glaubte. Ein<br />
weiterer wichtiger Unterschied zu Darwin liegt darin, dass er die multiple Entstehung von<br />
Arten vertrat. Lamarck darf also als Kreationist aufgefasst werden und hat daher in der<br />
Scientific Community einen relativ schlechten Ruf. Trotzdem hat er wichtige Beiträge zur<br />
Evolutionstheorie geleistet.<br />
John Stevens Henslow, Botanikprofessor in Cambridge, als Mentor von Charles Darwin.<br />
Lehrte ihm professionelles Herbarisieren. Bedeutung innerartlicher Variation (bei Primula,<br />
Phleum,..) Darwin sandte Henslow alle Aufsammlungen seiner Reise. Darwin sammelte<br />
mehr als 7000 Pflanzen (Herbar Cambridge). Darwins botanische Interessen waren weit<br />
reichend: Etwa Orchideen, Fremd- vs. Selbstbefruchtung, Variation floraler Merkmale,<br />
Pflanzenzüchtungen.<br />
Etwa Bestäubung von heimischen Orchideen, insbesondere der Gattung Ophrys. Pflanzen<br />
täuschen Solitärbienen. Gewisse Arten, ohne häufigen Insektenbesuch, entwickelten<br />
Selbstbestäubung. Er entwickelte 5 Grundprinzipien bzw. fasste er diese als Erster<br />
zusammen:<br />
1. Evolution als historischer Prozess<br />
2. Gemeinsame Abstammung (common descent)<br />
3. Vervielfachung der Arten<br />
4. Gradualismus (nicht unumstritten; auch Punktualismus)<br />
5. Natürliche Selektion<br />
6 Vollständiger Titel: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the<br />
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life<br />
114 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.1.1 Darwins Argumente und Schlussfolgerungen<br />
Darwin leitete aus seinen Beobachtungen und aus verschiedener Literatur 3 Argumente ab<br />
und zog 2 Schlussfolgerungen daraus. In verschiedener Literatur können diese Argumente<br />
und Schlussfolgerungen unterschiedlich eingeteilt sein, die Kernaussagen sind jedoch<br />
identisch.<br />
1. Argument: Die Zahl der Individuen einer Population wächst theoretisch exponentiell.<br />
2. Argument: Aber die Zahl der Individuen in einer Population bleibt relativ konstant.<br />
Malthus schrieb bereits 1798 in “An Essay on the Principle of Populations” das prinzipiell<br />
jede Population zu exponentiellem Wachstum fähig wäre, solange es keine Einschränkungen<br />
gibt. Diesem Einfluss wird mit dem Einführen einer Kapazitätsgrenze in Wachstumsmodellen<br />
Rechnung getragen. Auch ist die Anzahl der Arten in geologischen Zeiträumen exponentiell<br />
gestiegen, solange keine Ressourcenbegrenzung vorhanden ist.<br />
1. Schlussfolgerung: Nur ein Teil der Nachkommenschaft überlebt und nur dieser pflanzt<br />
sich erfolgreich fort. Es kommt zu einem “Struggle for existence”. Dies ist im Bezug auf<br />
relative Fitness zu sehen und kein “Kampf” im anthropozentrischen Sinn.<br />
Bei der Palmenart Euterpe globosa ist bei einem Experiment die Samenzahl gezählt worden.<br />
Von 170.000 Samen haben nur 30 % das Keimungsstadium erreicht. Davon nur 1 % das<br />
Jungbaumstadium und nur 0,001 % erreichte die reproduktive Phase (vergleiche 2.2<br />
Überlebenskurven). Sequoiadendron giganteum produziert 10^9-10^10 Samen im Leben<br />
3. Argument: Nicht alle Nachkommen sind gleich. Es lässt sich eine Variation beobachten 7 .<br />
Diese Variation kommt oft auf eine Gaußsche Normalverteilung und kann so mit statistischen<br />
Mitteln bearbeitet werden. Kommt es bei 2 Populationen zu einer Überlappung von<br />
Merkmalen (z.B. Größe auf der x-Achse geplotet, Häufigkeit auf der y-Achse) in einem<br />
Bereich von ± 2 Standardabweichungen (= 95% Konfidenz = 95 % Fläche unter dem<br />
Graphen) gibt es keine signifikante Veränderung des Mittelwertes. Ist diese Überlappung<br />
nicht gegeben weicht der Mittelwert der Populationen signifikant voneinander ab. Die<br />
Merkmale sind meist nicht diskret.<br />
2. Schlussfolgerung: Es gibt natürliche Selektion d.h. einige Varianten sind überlegen und<br />
überleben oder haben eine höhere Reproduktionsrate. Es kommt zu einer Akkumulation<br />
vorteilhafter Merkmale.<br />
Bis um 1900 sind die Mendelschen Gesetze in Vergessenheit geraten. Erst mit deren<br />
Wiederentdeckung konnte diese Akkumulation erklärt werden. Wie viele nicht diskret<br />
variierende Merkmale unterliegt deren Ausprägung einer Normalverteilung.<br />
7 Darwin besaß eine Publikation von Gregor Mendel, hat diese allerdings nie gelesen. Er<br />
kannte also den Begriff des Gens nicht. Grund für das Ignorieren dieser Arbeit dürfte<br />
gewesen sein, dass Mendel als Mönch kein Mitglied der Scientific Community war.<br />
115 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.1.2 Selektion<br />
Es gibt unterschiedliche Formen der Selektion. Ausgehend von einer Normalverteilung kann<br />
man drei Ausprägungen beobachten:<br />
1. Stabilisierend: Die Variabilität wird geringer. Die Glockenkurve wird zu beiden Seiten<br />
enger, der Mittelwert bleibt gleich.<br />
2. Gerichtet: Ein bestimmter Bereich (z.B. nur groß oder nur klein) wird forciert. Die<br />
Kurve tendiert nur nach links oder rechts und der Mittelwert verschiebt sich.<br />
3. Disruptiv: Beide Extreme werden forciert. Es kommt zu 2 verschiedenen Mittelwerten.<br />
Im Extremfall kann ein solcher Vorgang zu einer Artbildung führen. Disruptive<br />
Selektion ist in der Natur sehr selten. Durch den Genfluss wird immer ein Mittelwert<br />
angestrebt. Die Selektion müsste stark genug sein, um den Genfluss zu überwinden.<br />
Darwinfinken wären ein mögliches Beispiel für disruptive Selektion. Die extrem<br />
unterschiedlichen Schnabelformen geben den Tieren die Möglichkeit unterschiedliche<br />
Nahrungsressourcen zu verwenden und damit Konkurrenz zu vermeiden. Die<br />
Gattung der Darwinfinken (Geospiza sp.) hat viele unterschiedliche Arten. G. difficilis<br />
hat eine vampiristische Lebensweise und könnte als urtümliche Art gelten. Es ist hier<br />
jedoch wichtig zu bedenken, dass jede Art innerhalb ihres Stammbaumastes eine<br />
Evolution durchmacht. G. difficilis könnte also eine urtümliche Art sein, allerdings<br />
kann man nicht daraus schließen, dass er während der Evolution unverändert<br />
geblieben ist bzw. dass sein Aussehen und Verhalten “urtümlich” ist. Siehe auch<br />
John Endler. Arbeiten von Abzhanow behandelt den Einfluss des BMP4 Gens auf die<br />
Entwicklung der Schnabeltypen.<br />
116 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.1.2.1 Modi der geographischen Artbildung<br />
Sympatrische Artbildung: Speziation innerhalb eines Lebensraumes (ohne Auftrennung)<br />
Allopatrische Artbildung: Speziation durch geographische Auftrennung. Siehe Ernst Mayr.<br />
117 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.2 Variation<br />
Variation kann auf unterschiedliche Art erfolgen:<br />
• Kontinuierlich (=quantifizierbar, metrisch) / diskontinuierlich<br />
• ontogenetisch<br />
• Modifikation / phänotypische Plastizität<br />
• genetisch<br />
4.2.1 Kontinuierliche/diskontinuierliche Variation<br />
Diese kann inter- oder intraindividuell 8 sein. Eine Sonderform der diskontinuierlichen<br />
(genetisch bedingten) Variation innerhalb einer Population ist der Polymorphismus. Wichtige<br />
Begriffsunterscheidung: Merkmal (etwa Farbe) und Merkmalausprägung (etwa weiß).<br />
Polymorphismus ist die genetische Variation an einem Genort, die eine phänotypische<br />
Plastizität bedingt. Polymorphismus gilt dann als anerkannt, wenn die seltenere Form NICHT<br />
durch wiederholte Mutation erklärbar (Häufigkeit der Morphen >1%).<br />
Populärstes Beispiel für Polymorphismus: ist der Industriemelanismus des Birkenspanners<br />
(Biston betularia). Diskrete morphologische Formen innerhalb einer Population mit<br />
genetischer Grundlage. An einem Genort.<br />
Ein Beispiel für balancierten Polymorphismus ist die zeitlich variierende Selektion von<br />
Linanthus parryae. Weiße und blaue Formen bleiben erhalten, jedes Jahr sind sie aber in<br />
unterschiedlichem Verhältnis vorhanden. Sewall Wright bemerkte dieses Phänomen, war<br />
aber der Meinung dass es ein zufälliges Muster ist. Darwin Schemske hat dies allerdings<br />
angezweifelt und eigene Untersuchungen angestellt. Er beobachtete über Jahre hinweg die<br />
Population und kam auf extreme Variationen in der Populationsgröße, aber auch in der<br />
Verteilung von blauen und weißen Blüten. In einem Diagramm aufgetragen ergab sich eine<br />
Abhängigkeit zwischen Samenzahl und Blütenfarbe. Die Samenzahl korreliert direkt mit dem<br />
Niederschlag und kann als äquivalent angesehen werden. Das Ergebnis war, dass Pflanzen<br />
mit blauen Blüten bei geringerem Niederschlag eine höhere Fitness haben als die mit<br />
weißen. Bei normalem oder hohem Niederschlag ist aber die weiße Form dominanter.<br />
Warum?<br />
8 intraindividuell bedeutet innerhalb von Populationen, zwischen Populationen aber auch<br />
Arten etc.<br />
118 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Bestäuber spielen in diesem Beispiel keine Rolle. Es zeigt sich, dass die blauen Pflanzen bei<br />
Feuchtigkeit mehr Schwermetallionen akkumulieren als die weißen. Der Fitnessvorteil der<br />
blauen Pflanzen bei Trockenheit liegt darin begründet, dass die weißen einen Nachteil bei<br />
Trockenheit haben. Der dahinter stehende Mechanismus könnte damit zusammenhängen,<br />
dass die Pflanzen mit weißen Blüten einen Mechanismus besitzen der Schwermetallionen<br />
aussperrt, dieser Mechanismus gleichzeitig auch die Wasseraufnahme/speicherung<br />
behindert.<br />
Ein weiteres Beispiel ist der Fisch Schuppenfresser (Perissodus micolepis). Diese Art kommt<br />
als Rechtsmäuler oder Linksmäuler vor. Beide Arten sind zu gleichen Teilen in der<br />
Population vorhanden.<br />
119 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.2.2 Ontogenetische / entwicklungsbedingte Variation<br />
Diese ist intraindividuell. Sie beschreibt die Variation innerhalb eines Individuums während<br />
dessen Entwicklung (Ontogenese). Efeu bildet in jungen Jahren drei- bis fünflappige, am<br />
Grund herzförmige Blätter; wird die Pflanze älter, sind Blätter an Blühsprossen eher<br />
rautenförmig bis elliptisch.<br />
4.2.3 Modifikation/Phänotypische Plastizität<br />
Diese kann inter- und intraindividuell sein. Es ist die Fähigkeit des Genotyps unter<br />
unterschiedlichen Umweltbedingungen unterschiedliche Phänotypen hervorzubringen.<br />
Bonnier (1895) zeigte dies in einem Experiment indem er pflanzliche Klone von Prunella<br />
vulgaris in unterschiedliche Umgebungen einführte (z.B. Niederwachstum im Hochland,<br />
normales Wachstum im Niederland). Intra- und interindividuell (schwierig von<br />
ontogenetischer Variation zu unterscheiden). Es gibt einige wichtige Punkte zur Modifikation:<br />
• Modifikation ist nicht erblich<br />
• erfordern spezielle Umwelteinflüsse (z.B. N- oder O-Gehalt)<br />
• Unterschiedliche Individuen zeigen ein unterschiedliches Ausmaß an phänotypischer<br />
Plastizität (dies wird als Reaktionsnorm bezeichnet. Beim Menschen ist die<br />
Reaktionsnorm auf Sonnenlicht z.B. die unterschiedliche Sonnenverträglichkeit<br />
Aufgrund unterschiedlicher Pigmentierung).<br />
• Reaktionsnorm erblich und selektierbar<br />
Unterschiedliche Genotypen können an unterschiedlichen Umwelten verschieden stark<br />
ausgeprägt sein. Je nach Umwelt kann auch die Standardabweichung variieren. In stressiger<br />
Umwelt ist die Standardabweichung und damit die phänotypische Variation größer. Je höher<br />
die Plastizität ist, umso größer ist die relative Fitness.<br />
120 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Genotyp x Umwelt-Interaktionen: Sind von genetischen Faktoren und Umwelteffekten zu<br />
unterscheiden. Um diese Effekte zu trennen sind statistische Methoden notwendig (Analysis<br />
of Variance = ANOVA)<br />
4.2.3.1 Bedeutung der phänotypischen Plastizität<br />
Phänotypische Plastizität stellt einen Anpassungsmechanismus auf unvorhersehbare<br />
Einflüsse an die Umwelt dar. Diese sind im Leben eines Individuums oft von der<br />
Mutterpflanze verschieden. Auch puffert sie den Genotyp gegenüber der natürlichen<br />
Selektion ab. So können phänotypisch einheitliche Populationen genetische Variabilität<br />
enthalten.<br />
4.2.3.2 Genotyp vs. Phänotyp<br />
Wilhelm L. Johannsen (1909) hat von der Bohne (Phaseulus vulgaris), ein Selbstbestäuber,<br />
zwei unterschiedliche Linien genommen. Einmal kleine Samen vs. große Samen und einmal<br />
schwere Samen vs. leichte Samen. Er säte die Samen aus und erkannte, dass die Linie mit<br />
den schweren Samen immer leichtere Samen hervorbrachte und die Linie mit den leichten<br />
Samen immer schwerere (genauso verhielt es sich mit der Samengröße).<br />
121 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Die Variation wurde immer geringer. Da aber die Samengröße (genauso wie das Gewicht)<br />
genetisch determiniert ist, zeigte sich, dass die phänotypische Plastizität dies abpufferte und<br />
es so bei genotypisch unterschiedlichen Individuen zu gleichen Phänotypen kam. Merkmale,<br />
die von vielen Genen bestimmt werden und stark von der Umwelt beeinflusst werden führen<br />
zu einer Normalverteilung. Ist ein Merkmal von nur einem Gen gesteuert fehlt diese.<br />
Bezeichnet man auch als „Regression zur Mitte“ (Galton)<br />
Polygene Vererbung: Wenn Merkmal von einer großen Anzahl von Genen kontrolliert wird,<br />
sowie Einfluss von Umwelteffekte.<br />
122 / 143
VO Populationsbiologie<br />
123 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.2.4 Genetische Variation<br />
Genetische Variation kommt durch Mutation (Gen, Chromosom, Genom) oder<br />
Rekombination (zufällige Gametenpaarung = interchromosomal, intrachromosomal=crossing<br />
over) zustande. Ein wichtiger Sachverhalt bei genetischer Variation ist, dass Mutationen<br />
zufällig und ungerichtet verlaufen. Sie sind in Art und Ort unvorhersehbar. Im Nachfolgenden<br />
wird nur von Eukaryonten gesprochen!<br />
4.2.4.1 Genmutation<br />
Genmutation kann als Punktmutation auftreten. Hier werden einzelne Basenpaare<br />
ausgetauscht.<br />
• Transition: Purin wird gegen Purin (bzw. Pyrimidin gegen Pyrimidin) ausgetauscht<br />
• Transversion: Purin wird gegen ein Pyrimidin (oder umgekehrt) ausgetauscht<br />
Transversionen und Transitionen kommen mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit vor. Das<br />
erwartete Verhältnis von Transition zu Transversion sollte 1:2 sein. Es wird allerdings<br />
beobachtet, dass Transitionen wesentlich häufiger sind als Transversionen. Dies kann durch<br />
die Größenunterschiede von Purinen zu Pyrimidinen erklärt werden.<br />
Innerhalb der Transitionen sind Cytosin-Thymin Wechsel häufiger. Cytosin bildet spontan<br />
Tautomere an dem ein N mit einem H gesättigt ist. Dieses Tautomer kann nun mit Adenin<br />
paaren. Durch die semikonservative Replikation wird das A mit T gepaart und es entsteht<br />
nach der Replikation ein Strang mit einer A-T Paarung. Beim zweiten Strang kann das<br />
tautomere Cytosin in ein normales Cytosin umgewandelt werden.<br />
124 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Je nach Triplett kann diese Mutation mit und ohne Auswirkung bleiben. Arginin wird z.B.<br />
durch CGU, CGC, CGA und CGG codiert. Wenn eine Mutation an der dritten Base stattfindet<br />
bleibt diese für die Aminosäuresequenz ohne Konsequenz. Man spricht von einer<br />
synonymen Mutation. Eine Mutation kann aber auch zu einem Einbau einer anderen AS<br />
führen oder auch zu einem Strangabbruch, wenn ein Triplett für ein Stop-Codon entsteht.<br />
Eine weitere Möglichkeit ist die Deletion einer Base, dies würde zu einer Verschiebung des<br />
Codes um eine Base bedeuten.<br />
125 / 143
VO Populationsbiologie<br />
In einer Pflanze kommen 3 Genomtypen vor:<br />
• nDNA - Kern DNA<br />
• mtDNA - mitochondirale DNA<br />
• cpDNA - Chloroplasen DNA<br />
Diese Genome unterscheiden sich in Größe und Mutationsrate. Tiere haben im Allgemeinen<br />
eine höhere Mutationsrate als Pflanzen. Im Detail sehen die Genomgrößen und<br />
Mutationsraten wie folgt aus:<br />
mtDNA 200-2500 kb; 0, 2 · 10^−9 Subsitutions/Site/Year<br />
cpDNA 120-200 kb; 1 − 3 · 10^−9 s/s/y<br />
nDNA 10^4−10^8 kb; 5−30·10^−9 s/s/y bzw bei Gameten 1·10^−6 bis 5·10^−4<br />
Gen/Gamete/Generation<br />
Viele dieser Mutationen sind nachteilig und verringern die Fitness. Einige sind jedoch<br />
vorteilhaft und somit die Triebkraft der Evolution.<br />
Mutationsraten sind abhängig von:<br />
• Organismus<br />
• Genom<br />
• DNA-Region (Coded/Uncoded)<br />
• Art der Mutation (Synonym/Nicht Synonym)<br />
Eine weitere Unterscheidung ist neutrale und nicht-neutrale Mutation. Bei einer neutralen<br />
Mutation kommt es zu keiner Änderung der Aminosäuresequenz.<br />
126 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.2.4.2 Chromosomenmutation<br />
Chromosomenmutation kann in verschiedener Ausprägungsform vorkommen:<br />
• Deletion<br />
• Defizienz (Schleifenbildung im DNA Strang)<br />
• Duplikation<br />
• Inversion<br />
• Translokation (es werden Kreuzstrukturen ausgebildet)<br />
Eine weitere genetische Variation ist die schrittweise Veränderung der Chromosomenzahl.<br />
Haplopappus gracilis besitzt nur 2 Chromosomen (n=2), Ophioglossum reticulatum dagegen<br />
sehr viele 2n=1260 (N=630). Die Anzahl der Chromosomen hat allerdings nichts mit der<br />
Komplexität des Organismus zu tun.<br />
127 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.2.4.3 Rekombination<br />
Rekombination führt ebenfalls zu einer vererbbaren Variation. Eine Quelle für Rekombination<br />
ist die zufällige Kombination von Gameten (interchromosomale Rekombination) und crossing<br />
over (intrachromosomale Rekombination).<br />
Die Anzahl der möglichen Kombinationen sind bei diploiden Organismen 2 n wobei n =<br />
Chromosomenzahl. Das Ergebnis der Rekombination ist ein Gen mit zwei Allelen. Freie<br />
Rekombination führt zu g = 3 n wobei g = Anzahl der Genotypen; n = Zahl der unabhängig<br />
segregierenden Genen. Neue Formen entstehen hierbei nicht durch Mutation sondern durch<br />
Segregation.<br />
128 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Erwin Baur zeigte anhand von rot-weißen bzw. radiär-zygomorphen Blüten dass es in der F2<br />
zu einer 9:3:3:1 Verteilung kommt. Aufgrund von Dominazverhältnissen ist der Genotyp<br />
allerdings anders verteilt (rezessive bzw. dominante Gene). Abweichungen von dieser<br />
Verteilung deuten auf eine Gen-Koppelung hin.<br />
Abbildung 3: Beispiel einer 2 Faktor Kreuzung<br />
129 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Ob Gene unabhängig voneinander segregieren oder nicht hängt von ihrer Position im<br />
Genom ab. Dicht nebeneinander liegende Gene werden selten durch Crossing-Over<br />
getrennt. Das Ausmaß ist abhängig von der Chromosomenzahl und Chromosomengröße.<br />
130 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.3 Selbstbefruchtung<br />
Pflanzen sind auf Vektoren als Bestäuber angewiesen. Die Ackerschmalwand (Arabidopsis<br />
thaliana) kann sich etwa durch Selbstbefruchtung (Autogamie) fortpflanzen (bis zu 90%).<br />
Generell können sich rund 20 % der Pflanzenarten durch Selbstbefruchtung fortpflanzen.<br />
Nach nur 6 Generationen Selbstbefruchtung kommt es zu einer nahezu rein homozygoten<br />
Linie (sofern ein Genort betrachtet wird). Geschwisterbefruchtung führt ebenfalls nach<br />
wenigen Generationen zu rein homozygoten.<br />
Ein Nachteil der Selbstbefruchtung ist die Reduktion der genetischen Diversität. Diese<br />
Reduktion findet auf allen Ebenen statt (Enzyme, cpDNA, nDNA bis zu phänotypischen<br />
Variation). Selbstbefruchtung hat allerdings auch Vorteile. Sie gilt als reproduktive<br />
Rückversicherung.<br />
• für kleine Populationsgrößen (bei Pionierpflanzen, Ruderalpflanzen)<br />
• niedrige Individuendichten (wenige Paarungspartner, Arealrand)<br />
• Fehlen von Bestäubern / Pollentransfer ineffektiv (Etwa Arktis bzw. nördlicher<br />
Bereich)<br />
• Bakers-Law: Betrachtet man eine Metapopulation in einem Randbereich findet man in<br />
diesen sehr häufig Selbstbefruchtung. In den Kernzonen der Metapopulation<br />
überwiegt Fremdbefruchtung. (Bezieht sich eher auf ozeanische Arten bzw.<br />
Inselpopulationen)<br />
Trotzdem ist Selbstbefruchtung über längere Zeit ein Fitnessnachteil. Es zeigt sich, dass<br />
Nachkommen die aus Selbstbefruchtung hervorgehen im Experiment weniger Samen und<br />
eine geringer Keimlingsüberlebensfähigkeit haben.<br />
73 % aller Pflanzen sind hermaphrodit. Es gibt allerdings Möglichkeiten Selbstbestäubung<br />
bzw. Selbstbefruchtung zu verhindern. Individuen die durch Fremdbefruchtung<br />
hervorgegangen sind, haben in verschiedenen Merkmalen eine höhere Fitness.<br />
131 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Abbildung 4: gelb Selbstbefruchtung; rot Fremdbefruchtung<br />
Mechanismen um Fremdbefruchtung (Allogiamie) sicherzustellen sind:<br />
• Monözie (Einhäusigkeit): Weibliche und männliche Organe sind in unterschiedlichen<br />
Blüten untergebracht, aber am gleichen Individuum (nur rund 5%).<br />
• Diözie (Zweihäusigkeit): Weibliche und männliche Organe sind auf unterschiedlichen<br />
Individuen untergebracht (nur 4 %)<br />
• Heterostylie: z.B. bei Primelgewächsen. Es gibt eine lang- und kurzstielige<br />
Griffelvariante. Bei Insektenbestäubung wird eine Lang- auf kurzstiele Bestäubung<br />
forciert (und umgekehrt).<br />
• Herkogamie (räumliche Trennung): Beim Echten Schwarzkümmel (Nigella sativa)<br />
dienen die Kelchblätter als attraktives Blatt. Es wird eine Nektarattrappe ausgebildet.<br />
Kommt ein Insekt an diese Attrappe, senken sich die Antheren auf das Tier ab.<br />
• Dichogamie (zeitliche Trennung) Durch unterschiedliche Reifezeiten wird eine<br />
Selbstbestäubung verhindert. Hierbei wird zwischen Proterandrie (Vormännlichkeit,<br />
männliche Teile sind vor den weiblichen reif) und Proterogynie (Vorweiblichkeit,<br />
weibliche Blüten sind vor den männlichen reif) unterschieden. Herkogamie und<br />
Dichogamie sind oft gekoppelt.<br />
• Genetische Selbstinkompatibilität<br />
o Haploid/gametophytischer Mechanismus: Ein Pollenkorn mit derselben<br />
genetischen Ausstattung kann nicht auf der Narbe auswachsen. Damit wird<br />
auch die Befruchtung unter Geschwistern unterdrückt. Es ist allerdings<br />
notwendig, dass der Pollen etwas in die Narbe eindringt. Nur so können seine<br />
Oberflächenmerkmale des Pollenschlauches erkannt werden. Gekeimtes<br />
Pollenkorn = männlicher Gametophyt.<br />
o Diploid/sporophytischer Mechanismus: Hier ist kein Einwachsen des<br />
Pollenschlauchs notwendig. Die Oberflächenmarker befinden sich direkt in der<br />
Pollenwand. Aus dem Tapetum, das Teil des Sporophyten ist.<br />
132 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.4 Populationsgenetik<br />
4.4.1 Genfluss<br />
Die meiste Auskeimung findet in der Nähe der Mutterpflanze statt. Ähnliches verhält es sich<br />
bei Insekten und ihren Flugdistanzen. Diese sind immer so gewählt, dass die an das<br />
Idealverhältnis Flugdauer zu Nahrungsgewinn angestrebt wird.<br />
4.4.2 Genpool<br />
Als Beispiel wird folgende Ausgangssituation angeführt:<br />
Gesamtheit aller Allele in einer Population. Jedes der farbigen Ovale steht für ein Individuum.<br />
In diesem Genpool liegt für den Genort X der Allelanteil von X1 bei 0,20, von X2 bei 0,50 und<br />
von X3 bei 0,30<br />
Im Genpool befinden sich alle Allele innerhalb einer Population. Man kann damit die<br />
Allelfrequenz berechnen. In jeder Population gilt<br />
p =<br />
2NAA<br />
+<br />
2N<br />
wobei<br />
p Frequenz von Allel A<br />
N Gesamtzahl der Individuen in einer Population<br />
2N Gesamtzahl aller Allele<br />
N Aa<br />
Der Term 2NAA +NAa ergibt sich, da Individuen mit zwei A Allelen auch doppelt so viel zur<br />
Gesamtzahl der Allele beitragen.<br />
Im umgekehrten Schluss kann man diese Formel auch für die Allelfrequenz der a Allele<br />
verwenden (q):<br />
q =<br />
2Naa<br />
+<br />
2N<br />
N Aa<br />
133 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Bestimmung der Allelfrequenzen in einer Population bei Kenntnis der Genotyphäufigkeiten<br />
Beachte: Allelfrequenzen in Pop 1 und 2 sind gleich, aber Allele sind unterschiedlich auf<br />
Genotypen verteilt!<br />
134 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.4.3 Hardy-Weinberg-Gleichgewicht<br />
Das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht dient zur Berechnung von Genotypfrequenzen bei<br />
Kenntnis der Allelfrequenz. Es lautet:<br />
p² = Häufigkeit für Individuen AA<br />
2pq = Häufigkeit für Individuen Aa<br />
q² = Häufigkeit für Individuen aa<br />
p<br />
2<br />
+<br />
2pq +<br />
q<br />
2<br />
=<br />
1<br />
135 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Es beschreibt die Genotypfrequenz nach Random Mating. Die Genotypfrequenzen bleiben<br />
im Folgenden konstant. Damit es zu einem Hardy-Weinbert-Gleichgewicht kommt, müssen<br />
einige Bedingungen erfüllt sein:<br />
• Das Gleichgewicht kann sich erst nach einer Runde Random Mating einstellen<br />
• rein zufällige Gametenpaarung<br />
• eine unendlich große Population die einer reinen Zufallsverteilung folgt<br />
• keine Mutationen und keine Selektion (somit keine Evolution)<br />
• nicht gekoppelte Gene<br />
• keine Migration<br />
• keine Selektion<br />
In der Regel können solche Bedingungen nicht herrschen. Trotzdem lässt das Hardy-<br />
Weinberg-Gleichgewicht, vor allem bei relativ großen Populationen, eine realitätsnahe<br />
Modellierung zu.<br />
136 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.4.4 Flaschenhalseffekt und Genetische Drift<br />
Ein Flaschenhalseffekt tritt auf, wenn nur wenige Individuen einer Population ein zufälliges<br />
Ereignis überleben. Dies führt zu einer Verschiebung der Allelfrequenzen (=Gendrift)<br />
innerhalb der Population.<br />
Zwischen Punkt 3 und 4 wirkt Genetische Drift, d.h. Die Allelfrequenz verändert sich, tritt also<br />
in einem anderen Verhältnis als zur ursprünglichen Population auf.<br />
Aber auch ohne zufälliges Umweltereignis können die Allelfrequenzen innerhalb einer<br />
Population zufällig über mehrere Generationen fluktuieren. Gendrift ist also ein allgemeiner<br />
Begriff und bezeichnet die Verschiebung von Allelfrequenzen. Durch Gendrift, also ohne<br />
Selektion, können rein zufällig einzelne Allele aus dem Genpool eliminiert und andere in ihr<br />
angereichert werden.<br />
137 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.4.5 Gründereffekt<br />
Der Gründereffekt ist darauf zurückzuführen, dass nur eine kleine Anzahl von Individuen der<br />
Gesamtpopulation ein neues Gebiet (etwa eine Insel) besiedelt. Sie repräsentieren nur einen<br />
Ausschnitt des gesamten Genpools mit ggf. kleinem Teil der vorkommenden Allele, die auch<br />
in einer unterschiedlichen Frequenz auftreten. Der Gründereffekt ist somit als besonders<br />
drastischer Fall der Gendrift zu werten.<br />
Die Populationen der Taufliege Drosophila subobscura in Nord- und Südamerika enthalten<br />
weniger genetische Variabilität als die europäischen Populationen, von denen sie<br />
abstammen; gemessen wurde dies anhand der Zahl der Chromosomeninversionen in jeder<br />
Population. Innerhalb von zwei Jahrzehnten nach Ankunft in der Neuen Welt haben die<br />
Fliegen enorm an Zahl zugenommen und sich trotz ihrer verringerten genetischen<br />
Variabilität weit ausgebreitet.<br />
138 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Der Gründereffekt kann auch zur Entstehung neuer Arten beitragen (founder effect<br />
speciation)<br />
139 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Allopatrische Artbildung: Speziation durch geographische Auftrennung, wahrscheinlich der<br />
häufigste geographische Modus der Artbildung!<br />
140 / 143
VO Populationsbiologie<br />
4.4.6 Hybridisierung<br />
Treffen zwei genetisch kompatible Arten geographische zusammen, bilden sie oft Hybride.<br />
Hybridzonen können lang und schmal sein. Die schmale Zone in Europa, in denen sich die<br />
Areale von Rotbauchunke (a) und Gelbbauchunke (b) überschneiden, erstreckt sich quer<br />
durch Europa (c). Diese Hybridzone ist seit Hunderten von Jahren stabil geblieben, hat sich<br />
aber nie ausgedehnt, weil Bastarde meist eine deutlich geringere Fitness aufweisen als<br />
Individuen der Elternarten.<br />
141 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Bei Pflanzen führt Hybridisierung und damit einhergehende Polyploide oft zur Artenbildung.<br />
Schätzungsweise sind 30-40% aller Pflanzenarten polyploid. Stabil sind jedoch nur<br />
Individuen mit gerader Anzahl von Chromosomen, da es sonst zu Problemen bei der<br />
Segregation kommt und Zellen nicht die richtige Anzahl von Chromosomen aufweisen.<br />
142 / 143
VO Populationsbiologie<br />
Insbesondere bei der Gattung der Greiskräuter (Senecio) entstanden neue Arten durch<br />
Hybridisierung zwischen diploiden (2n) und tertraploiden (4n) Arten. Ähnliche Vorgänge sind<br />
bei den Gattungen Bocksbart (Tragopogon) oder auch Taubnesseln (Lamium) bekannt. Das<br />
Zusammentreffen verschiedener Arten kann auf natürliche Weise erfolgen, aber auch durch<br />
Verschleppung (Neophyten) oder gezielte Züchtung ermöglicht werden. Hierbei sei erwähnt<br />
dass der Kulturweizen (Triticium aestivum) hexaploid ist und vor einigen Jahrtausenden aus<br />
3 Grasarten entstand. Wichtig ist hierbei, dass die neue Art nicht steril ist und sich über<br />
Samen sexuell fortpflanzen kann.<br />
143 / 143