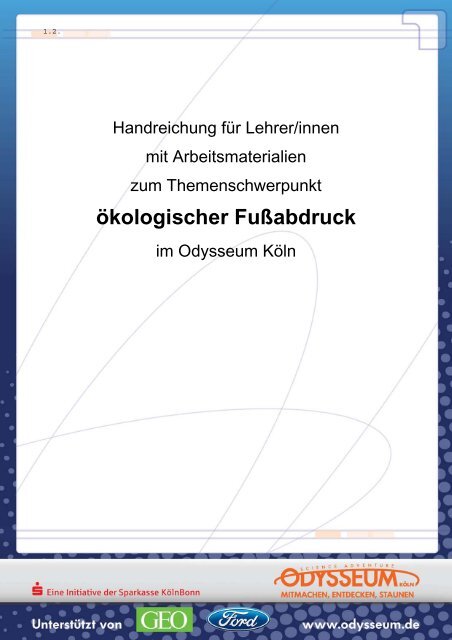ökologischer Fußabdruck - Odysseum
ökologischer Fußabdruck - Odysseum
ökologischer Fußabdruck - Odysseum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1.2.<br />
Handreichung für Lehrer/innen<br />
mit Arbeitsmaterialien<br />
zum Themenschwerpunkt<br />
<strong>ökologischer</strong> <strong>Fußabdruck</strong><br />
im <strong>Odysseum</strong> Köln
1.2.<br />
1 EINFÜHRUNG<br />
Von 02. April bis 06. September 2011 wird im <strong>Odysseum</strong> Köln das Thema <strong>ökologischer</strong><br />
<strong>Fußabdruck</strong> inhaltlich vertieft dargestellt.<br />
Die Themen Ressourcenknappheit und ökologische Nachhaltigkeit gehören zu den zentralen<br />
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Dies ist sicher einigen Schülerinnen und Schülern<br />
bewusst, dürfte aber bei vielen nicht mehr als ein diffuses Ohnmachtsgefühl und die Frage „Was<br />
gibt es denn hier überhaupt für Einflussmöglichkeiten“ hinterlassen. Das <strong>Odysseum</strong> bietet mit dem<br />
Themenschwerpunkt <strong>ökologischer</strong> <strong>Fußabdruck</strong> Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich<br />
spielerisch über dieses Thema zu informieren, sich damit vertiefend auseinanderzusetzen und<br />
mehr über Chancen und Handlungsmöglichkeiten herauszufinden.<br />
Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> ist ein Berechnungsmodell, mit dem die komplexen und vielfältigen<br />
Zusammenhänge in einem Gesamtmodell zusammengeführt werden, die beim Thema<br />
Ressourcenverbrauch und ökologische Nachhaltigkeit zusammenspielen. Er bietet eine<br />
wissenschaftliche Methode, um Angebot an und Nachfrage nach Ressourcen auszuwerten. Die<br />
komplexe Thematik wird dadurch einfacher nachvollziehbar und zudem werden<br />
Handlungsoptionen deutlich – von der individuellen, bis hin zur globalen Ebene.<br />
Zentrale Bausteine des Themenschwerpunkts sind drei Module: a) die Aktionsausstellung,<br />
b) die Dauerausstellung und c) Workshops. Diese Module werden unter 4. detailliert ausgeführt.<br />
Zusätzlichen werden verschiedenen Events den Themenschwerpunkt flankieren. Ankündigungen<br />
dazu finden Sie zu gegebener Zeit unter www.odysseum.de.<br />
2 WISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND<br />
Unsere Umweltprobleme ergeben sich ganz wesentlich aus der Art und Weise der<br />
gesellschaftlichen Stoffströme: Wir nehmen Input (Energie, Rohstoffe, Wasser und Luft) und liefern<br />
Output (Abfall, Emissionen und Abwasser). Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> ist eine Größe, die<br />
angibt, was uns die Natur zur Verfügung stellt und wie wir damit umgehen. Jahr für Jahr geben<br />
Felder Nahrung, Meere geben Fisch, Wälder geben Holz und saubere Luft. Wir nutzen und<br />
verbrauchen diese Ressourcen in Form von privaten und öffentlichen Gütern – oft ohne uns
1.2.<br />
darüber direkt bewusst zu sein. Und: Wir brauchen mehr davon. Seit etwa 1987 schon 1<br />
verbrauchen alle Menschen zusammen mehr Naturkapital, als die verschiedenen Ökosysteme im<br />
gleichen Zeitraum auf der ganzen Erde nachwachsen lassen können. Das ist ein Riesenproblem.<br />
Noch scheint genügend Natur da zu sein, aber in Wirklichkeit leben wir von unseren Vorräten. Was<br />
können wir tun, um diesen gefährlichen Trend zu stoppen und umzukehren?<br />
Das Thema Ressourcenknappheit und ökologische Nachhaltigkeit hat schon länger seinen Platz<br />
sowohl in der wissenschaftlichen als auch der öffentlichen Debatte. Ein Meilenstein dabei ist die<br />
1972 im Auftrag des Club of Rome erstellte Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft Die Grenzen des<br />
Wachstums (engl. Originaltitel: The Limits to Growth).<br />
Im Vorfeld der „Rio +20“-Konferenz im kommenden Jahr nehmen die Faktoren Zeit und das<br />
Überschreiten der physischen Grenzen unseres Globus immer mehr Bedeutung in der<br />
wissenschaftlichen und öffentlichen Debatte ein.<br />
2.1 Wieso brauchen wir das Berechnungsmodell des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s?<br />
Das Ressourcenproblem drängt. Doch wozu hilft uns hier der ökologische <strong>Fußabdruck</strong>?<br />
Ganz einfach. Weil unser Budget beschränkt ist. Wir wollen herausfinden, ob wir uns das<br />
leisten können. Wie unser persönliches Budget ist auch die Natur limitiert. Auch hier stellt sich<br />
die Frage: Können wir uns diesen Naturverbrauch überhaupt leisten? 2<br />
Antworten auf diese Frage gibt der ökologische <strong>Fußabdruck</strong>. Das Prinzip des ökologischen<br />
<strong>Fußabdruck</strong>s kann am besten verständlich gemacht werden, wenn man ihn sich wie ein<br />
Buchhaltungssystem vorstellt, das Angebot und Nachfrage auswertet. Er gibt uns einen<br />
Kontoauszug des Naturkapitals. Wenn ich weiß, was etwas kostet, weiß ich auch, ob ich es mir<br />
leisten will. Das gilt nicht nur für den Konsum im einzelnen, sondern auch „im Ganzen“. Jedes<br />
Produkt, jede Dienstleistung, etc. „kostet“ eine bestimmte Menge an Naturkapital.<br />
Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> macht zunächst eine objektive Bestandsaufnahme – ohne jede<br />
moralische Bewertung. Er berechnet, wie viel Naturkapital zur Verfügung steht und wie viel wir<br />
davon für unsere Aktivitäten benötigen. Darunter wird eine Vielzahl von unterschiedlichen<br />
Aspekten subsumiert: die Fläche, die die Ressourcen zur Produktion von Kleidung oder Nahrung<br />
1 http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_86_oekologischer_fussabruck.pdf, S. 4 (Stand vom 7. Januar 2011).<br />
2 Wackernagel, M., Beyers, B.: Der Ecological Footprint. Die Welt neu vermessen, Hamburg, 2010, S. 7.
1.2.<br />
bereitstellt, die, die zur Gewinnung von Energie dient, oder auch die Fläche, die zum Abbau des<br />
produzierten Mülls oder zum Binden des emittierten C02 erforderlich ist.<br />
Neben dem wichtigen Aspekt der Bestandsaufnahme hilft der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> aber auch<br />
gegen das Gefühl der Ohnmacht: das Problem ist wissenschaftlich „berechenbar“. Der ökologische<br />
<strong>Fußabdruck</strong> zeigt uns genau, wie es um das Naturkapital steht und wir können daraus ableiten, wo<br />
wir aktiv werden und effektive Handlungsstrategien entwickeln sollten. Er liefert uns die Daten,<br />
damit wir die Stellschrauben so setzen können, dass wir ökologisch nachhaltig leben können.<br />
2.2 Die Methode des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s<br />
Das Konzept des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s wurde von Mathis Wackernagel und William E. Rees<br />
als Berechnungsmodell und als Indikator in den 1990er Jahren entwickelt. 2003 gründete<br />
Wackernagel das Global Footprint Network, das seitdem das Berechnungsmodell beständig<br />
verfeinert und weiterentwickelt 3 .<br />
Der Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass eine ökologisch nachhaltige Lebensweise mit<br />
erneuerbaren, natürlichen Ressourcen wirtschaften muss, also mit der Biomasse, die die<br />
verschiedenen Ökosysteme bereitstellen können. Der problematische Faktor dabei ist, dass auch<br />
nachwachsende Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen, da sie entsprechend Zeit zum<br />
Nachwachsen benötigen. Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> errechnet die Ökobilanz von Angebot und<br />
Nachfrage an erneuerbaren, natürlichen Ressourcen. Dabei bringt der ökologische <strong>Fußabdruck</strong><br />
unseren ganzen Naturverbrauch „auf einen Nenner“. Er rechnet unseren Naturverbrauch um in die<br />
Einheit global Hektar, also in die produktiven Flächen, die benötigt werden, um das Naturkapital<br />
zur Verfügung zu stellen.<br />
Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, werden das Kapital der erneuerbaren, natürlichen<br />
Ressourcen und unser Verbrauch davon zunächst angegeben als die entsprechende produktive<br />
Fläche, die benötigt wird, um diese bereitzustellen. Dies geschieht in der Einheit Hektar. Es<br />
werden Ernteflächen (für zum Beispiel Futtermittel und Obstgärten) betrachtet, Weideflächen und<br />
Wiesen (für zum Beispiel tierische Produkte), Wasserflächen (für zum Beispiel Fische),<br />
Waldflächen (für zum Beispiel Holz und Holzprodukte), bebaute Flächen und Energieland (für<br />
Energiegewinnung, zum Beispiel Anbau von Raps) und CO2-Land und<br />
3 Mehr Informationen unter: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ (Stand vom 26. Januar 2011).
1.2.<br />
-Wasserfläche (für die Absorption von CO2 aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe).<br />
Bei der Berechnung des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>es wird die Flächenangabe Hektar dann in die<br />
Einheit globale Hektar umgerechnet. Die zugrundeliegende Formel für die Berechnung sieht recht<br />
einfach aus, die Berechnung ist aufgrund der Vielzahl der dafür erforderlichen Daten jedoch sehr<br />
komplex. Wir versuchen, die Methode in aller Kürze und stark vereinfacht darzustellen. Die<br />
zugrundeliegende Formel ist:<br />
Biokapazität (gha) = Fläche (ha) x Äquivalenzfaktor x Ertragsfaktor<br />
Beispiel: 1 Ha Ackerland / Deutschland = 1 ha x 2 x 2 = 4 gha<br />
Zur Erklärung:<br />
Äquivalenzfaktor und Ertragsfaktor sind die zwei Umrechnungsfaktoren, mit deren Hilfe die<br />
produktive Fläche (angegeben in der Einheit Hektar) umgerechnet wird in die Einheit globale<br />
Hektar, die den ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> angibt. Der Äquivalenzfaktor ermittelt das Potenzial<br />
einer produktiven Fläche, er stellt dazu das Produktionspotential der nachgefragten Fläche in das<br />
Verhältnis zu der durchschnittlichen Bioproduktivität aller Flächen. Für das Beispiel Ackerfläche<br />
heißt das, dass diese 2 x so hoch ist, wie die Produktivität aller Flächen im Durchschnitt.<br />
Der Ertragsfaktor ermittelt die regionalen Unterschiede der produktiven Flächen. Für das Beispiel<br />
Ackerfläche heißt dies, dass Ackerland in Deutschland 2 x so ertragreich ist, wie der weltweite<br />
Durchschnitt. Insgesamt ist demnach Ackerland in Deutschland 4 x so produktiv wie eine<br />
durchschnittliche Fläche im weltweiten Vergleich.<br />
2.3 Was leistet der ökologische <strong>Fußabdruck</strong>?<br />
Greifbarer, als die komplexen Berechnungen, die hier erforderlich sind, dürfte jedoch für die<br />
Schülerinnen und Schüler sein, was der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> denn nun konkret leistet, was wir<br />
durch ihn erfahren können. Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> kann für Waren und Dienstleistungen<br />
angegeben werden. Er kann für einzelne Personen berechnet werden, aber auch für<br />
Unternehmen, eine Stadt, ein Land oder sogar für die ganze Welt.
1.2.<br />
Betrachtet man ein paar Angaben im Vergleich, zeigt sich, wie viel der ökologische <strong>Fußabdruck</strong><br />
über unseren Ressourcenverbrauch aussagen kann und wie sehr sich Angebot an und Nachfrage<br />
nach Naturkapital in nur wenigen Jahrzehnten gewandelt hat 4 :<br />
Ökologische<br />
Buchhaltung<br />
1961<br />
(in gha / pro<br />
Kopf)<br />
Ökologische<br />
Buchhaltung<br />
2005<br />
(in gha / pro<br />
Kopf)<br />
Footprint des<br />
Konsums<br />
Welt Madagaskar Deutschland USA<br />
2,3 2,3 2,9 5,3<br />
Biokapazität 4,2 12,5 1,9 8,6<br />
Ökologische<br />
Reserve (+)<br />
oder<br />
Defizit (-)<br />
Footprint des<br />
Konsums<br />
+ 1,9 + 10,2 - 1,0 + 3,3<br />
2,7 1,1 4,2 9,4<br />
Biokapazität 2,1 3,7 1,9 5,0<br />
Ökologische<br />
Reserve (+)<br />
oder<br />
Defizit (-)<br />
- 0,6 + 2,6 - 2,3 - 4,4<br />
Sowohl in den dargestellten Ländern als auch weltweit ist der Konsum, also der ökologische<br />
<strong>Fußabdruck</strong> größer geworden, wenn auch unterschiedlich stark. Immerhin ist die Biokapazität in<br />
Deutschland von 1961 bis 2005 konstant geblieben, wobei die Bestandsaufnahme des<br />
ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s in dieser Tabelle nichts über eventuelle Verschiebungen innerhalb der<br />
einzelnen Ökosysteme aussagt. Aber sowohl in den USA, mehr noch in Madagaskar hat sich das<br />
Naturkapital bereits seit 1961 drastisch reduziert. So standen in Madagaskar 2005 pro Kopf nur<br />
noch 3,7 gha an produktiver Fläche zur Verfügung, statt 12,5 gha im Jahr 1961. Schließlich aber<br />
zeigt der Vergleich, dass die Menschen sowohl im weltweiten Durchschnitt, als auch im<br />
Ländervergleich Deutschland – USA mehr Naturkapital nutzen, als die verschiedenen Ökosysteme<br />
zeitgleich wieder auffüllen können. Und die durchschnittlich zur Verfügung stehende Biokapazität<br />
pro Kopf lag 2005 weltweit nur bei 2,1 gha. Als Zielwert eines für die natürlichen Ressourcen<br />
4 Alle Zahlen entnommen aus http://www.conservation-<br />
development.net/Projekte/Nachhaltigkeit/DVD_10_Footprint/files/pdf/zur_Serie/10_Footprint_de.pdf, S. 118 f. (Stand<br />
vom 26. Januar 2011).
1.2.<br />
verträglichen Verbrauchs wurde mit dem Berechnungsmodell des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s der<br />
weltweite Durchschnittswert von 1,8 gha errechnet.<br />
2.4 Der Overshoot<br />
Da der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> größer ist als die weltweite Biokapazität, spricht man von einem<br />
Overshoot. In Deutschland war im vergangenen Jahr der Overshoot day am 21. August. Bis dahin<br />
haben wir von unserem jährlichen Naturkapital gelebt, danach verursachten wir ein ökologisches<br />
Defizit. Wackernagel und Beyers beschreiben drei mögliche Versionen, mit dem „Overshoot“<br />
umzugehen: a) moderater Fortgang, b) langsame Reduktion und c) schnelle Reduktion 5 .<br />
Die Annahmen und Prognosen der Version des moderaten Fortgangs sind:<br />
langsames Bevölkerungswachstum, aggressive Energiesparmaßnahmen und die<br />
landwirtschaftliche Produktivität wächst weltweit weiter wie während der vergangenen vier<br />
Jahrzehnte – eine einfache Trendverlängerung. Trotzdem ergibt sich ein erstaunliches<br />
Resultat. Die Schere zwischen Footprint und Biokapazität wächst ins Uferlose […]. Im Jahr<br />
2050 würde die Menschheit jährlich nicht mehr die Erträge von 1,4 Planeten jedes Jahr<br />
konsumieren, sondern von 2,3. 6<br />
Die Entwicklung der langsamen Reduktion wird wie folgt beschrieben:<br />
die ökologischen Schulden werden erst einmal weiter wachsen, um dann, ab der Mitte des<br />
Jahrhunderts, zurück zu gehen. Etwa auf dem letzten Viertel der Strecke unterschreitet die<br />
globale Nachfrage wieder das Angebot. Die kritische Phase des planetarischen Overshoot<br />
würde demnach etwa nach einem Jahrhundert zu Ende gehen. […] Der gesamte Prozess<br />
findet unter erschwerten Umständen statt. Insbesondere die steigende Weltbevölkerung und<br />
die ökonomische Aufholjagd der bevölkerungsreichen Schwellenländer sind Faktoren, die<br />
stimulierend auf die Nachfrage wirken. 7<br />
Die schnelle Reduktion beschreibt folgende Version:<br />
Der entscheidende Unterschied zum vorhergehenden besteht darin, dass die<br />
Geschwindigkeit der Veränderung deutlich anzieht: Insgesamt soll die Menschheit den<br />
Zustand des Overshoot bereits um das Jahr 2040 verlassen. […] Das Szenario der<br />
Schnellen Reduktion würde 2100 insgesamt zu einer Verkleinerung des Footprint der<br />
Menschheit um 40 Prozent führen. Die Anstrengungen wären erheblich. 8<br />
Doch nur die dritte Version, das anspruchsvollste Szenario, würde, so die Einschätzung<br />
von Wackernagel und Beyers, wieder zu <strong>ökologischer</strong> Nachhaltigkeit und zu stabilen<br />
Verhältnissen führen. Die Aufgabe des 21. Jahrhunderts ist, Wege aus dem Overshoot zu<br />
5 Wackernagel, M., Beyers, B., s. FN 2, S. 127-140.<br />
6 Wackernagel, M., Beyers, B., s. FN 2, S. 127 f.<br />
7 Wackernagel, M., Beyers, B., s. FN 2, S. 130 f.<br />
8 Wackernagel, M., Beyers, B., s. FN 2, S. 134 f.
1.2.<br />
finden, „ohne die Wirtschaft abzuwürgen und ohne die Benachteiligten noch weiter an den<br />
Rand zu drängen […] und gleichzeitig die Lebensqualität aller [zu] sichern“. 9<br />
2.5 Von individuellen bis zu globalen Stellschrauben<br />
Soweit zur Bestandsaufnahme des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>es und zu verschiedenen<br />
wissenschaftlichen Verlaufsszenarien. Doch welche konkreten Handlungsoptionen und Spielräume<br />
bleiben nun? Bei der Frage danach, welche Akteure hier Einflussmöglichkeiten haben, zeigt sich,<br />
dass hier verschiedene Ebenen zusammenwirken und aktiv werden müssen. Jeder Einzelne hat<br />
Möglichkeiten, seine Lebensweise nachhaltiger zu gestalten. Doch nur wenn kommunale und<br />
regionale, nationale und globale Akteure die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, können<br />
wir eine wirklich weitreichende und tragende ökologische Nachhaltigkeit realisieren.<br />
Rahmenbedingungen können einerseits durch konkrete Umgestaltung der Infrastruktur, zum<br />
Beispiel der Energieversorgung optimiert werden oder aber durch das Einführen von Richtlinien<br />
und Gesetzen, deren Umsetzung dann auch sichergestellt werden muss.<br />
2.5.1 Individuelle Ebene und Sockelwert<br />
Auf der individuellen Ebene werden in erster Linie vier Bereiche betrachtet, die für die Berechnung<br />
des individuellen ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>es ausschlaggebend sind. Dies sind die Bereiche: a)<br />
Wohnen, b) Mobilität, c) Ernährung und d) Konsum. Hier gibt es natürlich einige<br />
Handlungsmöglichkeiten, von denen viele sicher den meisten Schülern und Schülerinnen bekannt<br />
sind, wie: Stoßlüften statt Heizung an und Fenster auf, Geräte ausschalten statt auf Stand-by,<br />
öfters öffentliche Verkehrsmittel und Rad nutzen statt das Auto, besser Zugfahren statt Fliegen,<br />
besser saisonale Produkte kaufen statt Obst, das 6 Monate in Kühlhallen gelagert hat, etc. Wenn<br />
sich ein Großteil der Menschen unseres Ressourcen-intensiven Lebensstils bewusst wird und<br />
beginnt, nachhaltiger zu leben, ist dies ein Anfang zur Verbesserung der Situation. Den<br />
sogenannten „change agents“ (salopp gesprochen „Trendsettern“, die mit gutem Beispiel voran<br />
gehen) kommt hier besondere Bedeutung zu. Doch werden einige Schülerinnen und Schüler mit<br />
Berechtigung argumentieren, dass Bemühungen um eine nachhaltigere Lebensweise allein auf der<br />
individuellen Ebene nicht ausreichend sind. Erst wenn zugleich auch bessere<br />
Rahmenbedingungen auf kommunaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene geschaffen und<br />
umgesetzt werden, ist eine Reduktion des Overshoots möglich.<br />
9 Wackernagel, M., Beyers, B., s. FN 2, S. 8.
1.2.<br />
Eine interessante Frage kommt auf, wenn man den eigenen ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> berechnet:<br />
Selbst bei den umweltverträglichsten und nachhaltigsten Eingaben, kann man den Wert von 1,8<br />
gha, der als durchschnittlicher weltweiter Richtwert gilt 10 , nicht erreichen. Woran liegt das? Das<br />
liegt eben daran, dass eine weitere Reduktion jenseits des individuellen Konsums Optimierungen<br />
erfordert. Je nachdem, welche Rahmenbedingungen von einer Stadt, bzw. der Region und dem<br />
Land bereitgestellt sind, wird ein Sockelwert fällig, der national bei der Berechnung des<br />
individuellen Konsums aufgeschlagen werden muss. Der Sockelwert ist der auf jeden Einzelnen<br />
umgelegte Anteil (am Verbrauch für Straßen, Feuerwehr, Krankenhäuser, Schulen und all die<br />
anderen Einrichtungen) der nicht nur einem einzelnen Verbraucher zugewiesen werden kann. In<br />
Deutschland beträgt dieser Sockelwert rund 1,8 globale Hektar – das ist fast so viel wie uns<br />
rechnerisch insgesamt zusteht. Erst wenn auch bei den regionalen und nationalen Infrastrukturen,<br />
Produktionsweisen, Transportsystemen, etc. langfristig ökologisch nachhaltige<br />
Rahmenbedingungen geschaffen werden, kann auch der individuelle ökologische <strong>Fußabdruck</strong><br />
kleiner und der Overshoot reduziert werden.<br />
2.5.2 Unternehmen<br />
Weitere wichtige Akteure auf dieser Ebene sind Unternehmen. Immer mehr Unternehmen<br />
erkennen, dass eine Reduktion ihres ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s ihre Zukunftsfähigkeit steigert, da<br />
sie sich dadurch Kosten- und Wettbewerbsvorteile erarbeiten können. So berät zum Beispiel die<br />
Firma Bayer ihre Kunden in der Bauindustrie sowie große Investoren über aufwändige<br />
Simulationen, welche Produkte zu den niedrigsten Energieverbräuchen führen.<br />
2.5.3 Kommunale und regionale Ebene<br />
Die Kommune und die Region sind ein weiterer wichtiger Akteur, um die Infrastruktur zu gestalten,<br />
innerhalb derer dann wiederum der Einzelne ein nachhaltigeres Leben führen kann. Im Rahmen<br />
von Stadtentwicklungs- und regionalen Ausbauprojekten sind die Erfordernisse <strong>ökologischer</strong><br />
Nachhaltigkeit und das Schaffen einer effizienteren Infrastruktur vor allem in den Bereichen<br />
Mobilität, Wohnen und Energiebereitstellung ein wesentlicher Aspekt. Hierbei gibt es verschiedene<br />
Leuchtturmprojekte. So soll die CO2-Emission in einem Pilotgebiet der Stadt Bottrop unter<br />
anderem durch umfangreiche Sanierungen des<br />
10 Vergleiche oben, S. 7.
1.2.<br />
Gebäudebestands im Wohn- und Gewerbebereich bis zum Jahr 2020 um 65 Prozent gesenkt<br />
werden 11 . Welche Maßnahmen gibt es hierzu in Ihrer Stadt? In den vergangenen Jahren ist in<br />
diesem Kontext auch die Bedeutung von Städtepartnerschaften gestiegen, zum Beispiel zum<br />
Austausch von Erfahrungen und „Best-Practice-Projekten“.<br />
Generell ist der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> an sich lediglich ein Berechnungsmodell, das etwas über<br />
die ökologische Bilanz aussagen kann. Die richtigen Handlungsstrategien abzuleiten, liegt an den<br />
verschiedenen Akteuren. Doch indem der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> die ökologischen Chancen und<br />
Risiken, zum Beispiel eines Unternehmens oder einer Region evaluiert, können die<br />
Schwachpunkte erkannt und gezielt die richtigen Handlungsstrategien entwickelt werden.<br />
2.5.4 Nationale Ebene<br />
So wie die kommunale und regionale Ebene die Aufgabe hat, die Rahmenbedingungen für eine<br />
nachhaltigere Lebensweise des Einzelnen zu gestalten und zu optimieren, so sind auch die<br />
Einzelnen, die Kommunen und die Regionen wieder in ihren Einflussmöglichkeiten davon<br />
abhängig, wie auf nationaler Ebene die Stellschrauben gesetzt werden. Besonders auf dieser<br />
Ebene muss an den Rahmenbedingungen für ökologische Nachhaltigkeit gearbeitet werden.<br />
Gerade auf nationaler Ebene zeigt sich, wie bedeutend der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> für die<br />
Möglichkeiten und Chancen der Entwicklung eines Landes ist. Denn das Naturkapital eines<br />
Landes beeinflusst sehr stark seine Wettbewerbsfähigkeit. Ökologische Defizite machen abhängig,<br />
die entsprechenden Ressourcen müssen importiert werden. Ökologische Reserven hingegen<br />
machen unabhängig und steigern die Produktionsfähigkeit eines Landes. Die Aufgabe ist also, das<br />
Naturkapital, das zur Verfügung steht, optimal zu nutzen. Die untenstehenden Fragen zeigen,<br />
welche Aspekte bei allen Entscheidungen und Handlungsanweisungen genau zu prüfen und zu<br />
berücksichtigen sind, damit die richtigen Stellschrauben für die zukünftige Entwicklung gesetzt<br />
werden können:<br />
1 Wie verlaufen die Footprint- und Biokapazitätstrends des Landes und der Welt)?<br />
11 Mehr Informationen dazu unter:<br />
http://www.bottrop.de/wirtschaft/downloads/Zukunft_Bottrop/InnovationCity/newsletter/ICB_Newsletter_12_2010.pdf<br />
(Stand vom 03. Februar 2011).
1.2.<br />
2 Ist das betreffende Land folglich ein <strong>ökologischer</strong> Schuldner oder ein <strong>ökologischer</strong><br />
Gläubiger?<br />
3 Welches sind die ökologischen Risiken des Landes? Wie schnell verläuft die<br />
Entwicklung? Wie wirkt sich das auf die Wettbewerbsfähigkeit aus, heute und<br />
morgen?<br />
4 Über welche natürlichen Guthaben verfügt es? Nimmt sein Defizit – oder seine<br />
Reserve – zu oder ab? Was sind die Gründe dafür?<br />
5 Was ist der optimale Ressourcenkonsum (und Kohlendioxid-Ausstoß) des Landes,<br />
im Verhältnis zu seiner Biokapazität? Zuviel Verbrauch wird zum Risiko, zuwenig<br />
macht das Leben schwieriger.<br />
6 Wächst die Nachfrage schneller als die technische Effizienz zunimmt?<br />
7 Wurden alle Möglichkeiten genutzt, um mit weniger Ressourcen besser zu leben?<br />
8 Sind die Infrastrukturinvestitionen zukunftsweisend? Oder machen sie das Land erst<br />
recht anfällig für globale Risiken? 12<br />
Indem mit dem ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> das Naturkapital eines Landes und die ökologischen<br />
Chancen und Risiken evaluiert werden, können daraus gezielt Zukunftsstrategien entwickelt<br />
werden, die die ökologische Nachhaltigkeit optimieren.<br />
Die wichtigsten Strategien können in aller Kürze in vier Punkten zusammengefasst werden 13 :<br />
� „Umweltverträgliche Produktion“<br />
Um die Biokapazität zu schonen und zu erhalten, ist eine wichtige Aufgabe, möglichst<br />
umweltverträglich zu produzieren. Hierfür ist nicht nur die Investition in technische<br />
Effizienz, sondern auch in innovative Forschung von Bedeutung.<br />
� „Lebensqualität sichern bei vermindertem Ressourcenverbrauch“<br />
Damit die Akteure auf individueller Ebene nachhaltiger leben können, muss in erster Linie<br />
auf nationaler Ebene daran gearbeitet werden, großflächig eine effizientere Infrastruktur in<br />
den Bereichen Mobilität, Wohnen und Energiebereitstellung zu schaffen.<br />
� „Bevölkerungswachstum durch Familienplanung reduzieren“<br />
Das Bevölkerungswachstum ist nach wie vor eine der wichtigsten Stellschrauben.<br />
Besonders in den bevölkerungsreichen Entwicklungs- und Schwellenländern ist dies einer<br />
der Bereich, für den dringend Strategien erarbeitet werden müssen.<br />
� „Biokapazität ausbauen“ (zum Beispiel durch Bewässerungssysteme,<br />
Aufforstungsprogramme)<br />
Um unser Naturkapital zu erhalten und zu schützen, sind innovative Konzepte und<br />
Programme gefordert. Auch hier sind Ideen und Konzepte aus der Forschung gefragt.<br />
12 Wackernagel, M., Beyers, B., s. FN 2, S. 114 f.<br />
13 Ausführlicher dazu: Wackernagel, M., Beyers, B., s. FN 2, S. 110-123.
1.2.<br />
Innovative Konzepte schaffen neue Spielräume. Aber nur, wenn diese auch langfristig um- und<br />
eingesetzt werden, kann Schritt für Schritt an einer Reduktion des Overshoots gearbeitet werden.<br />
An vielen Stellen scheitert es jedoch aktuell noch an der Umsetzung.<br />
2.5.5 Globale Ebene<br />
Die Reduktion des Overshoots ist auch eine globale Aufgabe. Wir alle leben von den Ressourcen<br />
dieser Erde und müssen zusammen Lösungswege finden, gemeinsam nachhaltiger mit unserem<br />
Naturkapital umzugehen.<br />
Zum einen gibt es bestimmte Aspekte, bei denen international, bzw. global die richtigen<br />
Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit hier ökologische Nachhaltigkeit gelingen<br />
kann. Dies wird an dem Beispiel der CO2-Reduktion deutlich. Die CO2-Emission ist einer der<br />
schwerwiegendsten Faktoren des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s. Er macht etwa 50 % des<br />
ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s aus. Den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist damit eine der wichtigsten<br />
Aufgaben, um den Overshoot überwinden zu können. Um diesen jedoch zu reduzieren, müssen<br />
Lösungswege für eine internationale Klimapolitik gefunden werden. Die internationale Klimapolitik<br />
ist dabei ein Element von Weltstaatlichkeit.<br />
Zum anderen müssten, wie auf nationaler Ebene beschrieben, noch mehr auf globaler Ebene bei<br />
allen Entscheidungen und Handlungsanweisungen, die Konsequenzen für den ökologischen<br />
<strong>Fußabdruck</strong> geprüft und berücksichtigt werden, damit die richtigen Stellschrauben für eine<br />
zukünftige nachhaltige Entwicklung gesetzt werden können.<br />
Die Berechnungen des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>es zeigen, wo weltweit die ökologischen<br />
Chancen und Risiken liegen, sie geben Auskunft über den Zustand der weltweiten Biokapazität.<br />
Diese Analyse sollte beachtet und erforderliche und zukunftstaugliche Handlungsstrategien von ihr<br />
abgeleitet werden. Nur wenn auf globaler Ebene die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt<br />
werden, kann der Overshoot tatsächlich reduziert werden.<br />
2.5.6 Fazit<br />
Als Fazit ergibt sich, dass für eine ökologisch nachhaltigere Lebensweise viele Akteure<br />
zusammenwirken müssen. Die Möglichkeiten des Einzelnen sind beschränkt, er ist darauf
1.2.<br />
angewiesen, dass die Akteure der anderen Ebenen in neue Konzepte und eine Verbesserung der<br />
ökologischen Nachhaltigkeit investieren. Der Themenschwerpunkt im <strong>Odysseum</strong> versucht, neben<br />
dem Aufzeigen der Wichtigkeit dieses Themas und der direkten Handlungsmöglichkeiten des<br />
Einzelnen, vor allem die Notwendigkeit des Zusammenarbeitens auf verschiedenen Ebenen<br />
herauszustellen. Es soll zum einen bei den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein dafür<br />
geweckt werden, dass sie in ihrem täglichen Handeln etwas für ökologische Nachhaltigkeit tun<br />
können. Zum andern sollen sie das Bewusstsein der Notwendigkeit von ökologisch nachhaltigem<br />
Handeln weitertragen und verstehen, dass sie hierfür bei verschiedenen anderen Akteuren<br />
Initiative und Verantwortlichkeit fordern können, damit bessere Rahmenbedingungen geschaffen<br />
werden und die Reduktion des Overshoots gelingen kann.<br />
3 LEHRPLANBEZUG / DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN<br />
Das Thema <strong>ökologischer</strong> <strong>Fußabdruck</strong> bietet durch seine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte eine<br />
unterrichtliche Einbindung in verschiedenen Fächern der Sekundarstufe I und II.<br />
Im Folgenden wird der Lehrplanbezug zur Sekundarstufe I hergestellt.<br />
Sekundarstufe I:<br />
Das Thema <strong>ökologischer</strong> <strong>Fußabdruck</strong> spielt vor allem im Fach Politik eine außerordentlich wichtige<br />
Rolle. Das Thema „Umweltpolitik als Herausforderung“ umfasst zum einen die verschiedenen<br />
Aspekte des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s, zum anderen lässt es sich mit den Themen<br />
„Internationale Politik“ und „Internationale Verflechtungen“ verknüpfen, wodurch das in Beziehung<br />
setzen der verschiedenen Wirkungsgrade des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s ermöglicht wird. In<br />
diesem Themengebiet gilt es nämlich nicht nur die einzelne Person, eine Stadt oder ein Land in<br />
den Fokus zu stellen, sondern vorwiegend einen globalen Blickwinkel hinsichtlich der weltweit<br />
herrschenden Ressourcenknappheit einzunehmen. So ist z. B. die Frage nach den politischen<br />
Prozessen im Hinblick auf Städtepartnerschaften eine spannende und aktuelle Frage. Weiterhin<br />
spielen innerhalb dieser Thematiken die Begriffe der globalen Stellschrauben und des Overshoot<br />
day eine Rolle. Die Tatsache, dass weltweit ein höherer Verbrauch der Ressourcen stattfindet, als<br />
die Natur zur Verfügung stellen kann, führt eine Analyse von Angebot und Nachfrage mit sich. Die<br />
daraus resultierenden Handlungsmöglichkeiten und deren verschiedenen Effektivitätsgrade bieten<br />
einen weiteren Bezug zur Umweltpolitik als Herausforderung. Hierdurch gelangt man abschließend
1.2.<br />
zu den verschiedenen Chancen und Möglichkeiten, die der Menschheit bei der Beeinflussung und<br />
der Verbesserung des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s offen stehen.<br />
Im Fach Erdkunde lassen sich der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> und seine unterschiedlichen Folgen in<br />
den Bereichen Planet Erde, Umweltprobleme und Auswirkungen auf die Natur einflechten. Ebenso<br />
sollte eine Schleife zu den verschiedenen Naturkatastrophen, als auch zu dem Themenbereich<br />
Tropischer Regenwald geschlagen werden. Hierbei kann auf regionale und globale Folgen der<br />
Zerstörung dessen mit Blick auf den ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> eingegangen werden. Eine weitere<br />
Behandlung im Unterricht bietet der Themenkomplex Hunger und Armut, wobei auch hier auf den<br />
Missstand von vorhandenen Ressourcen und deren Verbrauch durch die Menschheit hingewiesen<br />
werden sollte.<br />
Weiterhin ist das Thema hinsichtlich der verschiedenen Ökosysteme im Fach Biologie<br />
einzuordnen. Unter dem Aspekt der Ressourcenknappheit und dem Vergleich zwischen dem, was<br />
die Natur der Menschheit zur Verfügung stellt, und dem, was wir an Ressourcen verbrauchen, ist<br />
zu verdeutlichen, dass zur Erhaltung der verschiedenen Ökosysteme (und damit ist nicht nur ein<br />
Ruhen-Lassen der Natur gemeint, sondern es ist ein aktives Handeln der Menschen von Nöten!)<br />
der Umgang mit diesen zu reflektieren und zu überdenken ist. Denn die aktuelle Situation spiegelt<br />
deutlich das Missverhältnis zwischen hohem Ressourcenverbrauch und vorhandenem Naturkapital<br />
wider. In einem weitgefassten Betrachtungswinkel lassen sich also so auch im Fach Biologie die<br />
Chancen und Möglichkeiten festhalten.<br />
Zudem lässt sich der Begriff der Stoffströme ebenso im Fach Chemie behandeln, da es hierbei um<br />
die Bedeutung und Verwendung von Wasser geht. Ebenso kann ein Bezug zum Themenfeld der<br />
Gewässerverschmutzung hergestellt werden.<br />
4 MODULE IM ODYSSEUM<br />
4.1 MODUL AKTIONSAUSSTELLUNG „WAS KOSTET DIE WELT? DER ÖKOLOGISCHE<br />
FUSSABDRUCK“<br />
Die Aktionsausstellung ist mitten auf der großen Plaza im <strong>Odysseum</strong> Köln platziert und erwartet<br />
als erster Ausstellungsbereich die neu ankommenden Besucher. Der Blick fällt sofort auf einen<br />
überdimensionalen <strong>Fußabdruck</strong> und einen riesigen Fuß. Beide beherbergen eine Gruppe von<br />
insgesamt sieben Spielen, Erlebnisstationen und Experimentierbereichen.
1.2.<br />
4.1.1 Die Fußspur<br />
Bodenmarkierungen in Form eines <strong>Fußabdruck</strong>s finden sich sowohl im Eingangsbereich des<br />
<strong>Odysseum</strong>s als auch in der Dauerausstellung. Sie geben den Besuchern eine Orientierung, wo im<br />
<strong>Odysseum</strong> das Thema <strong>ökologischer</strong> <strong>Fußabdruck</strong> dargestellt wird. Zunächst führen sie die<br />
Besucher zu dem Aktionsausstellungsbereich. Von der Aktionsausstellung ausgehend führen sie<br />
die Besucher in die Dauerausstellung, um zu zeigen, wo sich weitere Erlebnisstationen zu dem<br />
Themenschwerpunkt finden (s. Näheres dazu unten, 4.2. DAUERAUSSTELLUNG). Die Fußspuren<br />
werfen einleitende Fragen auf, wie zum Beispiel: „Haben alle Amerikaner große Füße?“. Sie<br />
machen neugierig und bereiten auf das Thema vor.<br />
4.1.2 Der <strong>Fußabdruck</strong> und das Ressourcenspiel<br />
Der <strong>Fußabdruck</strong> ist der Auftakt für die Aktionsausstellung. Er ist eine ebene Podestfläche, die<br />
grafisch gestaltet ist. In den fünf Zehen führen Grafiken und Texte in die wichtigsten Aspekte des<br />
ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>es ein. Die Fußfläche ist mit den unterschiedlichen Landschaftsarten<br />
gestaltet, die der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> betrachtet. Auf der Spielfläche können alle,<br />
insbesondere aber die ganz jungen Besucher ein einfaches Würfelspiel spielen. Ein komplexeres<br />
Spiel zu diesem Thema wird im Rahmen der Workshopmodule angeboten.<br />
Die einfache Spielversion (ab 6 Jahre) besteht aus einer Reihe von Ressourcen-Würfeln und<br />
Würfelfeldern, die angeben, was man sich für die erwürfelten Ressourcen kaufen kann und die<br />
eben diese Dinge nennen. Die Besucher würfeln ihre Ressourcen-Erträge und überlegen, mit wie<br />
vielen Mitspielern sie sich diese Erträge teilen müssen und wie sie diese Erträge einsetzen wollen.<br />
4.1.3 Mitmach-Filmstation: „Kanal Footprint”<br />
Auf der Podestfläche des <strong>Fußabdruck</strong>s findet sich des Weiteren eine Filmstation. Diese zeigt eine<br />
Folge von kurzen youtube-artigen Filmeinspielungen (60–90 Sekunden), die sowohl positive als<br />
auch negative Beispiele zum Thema <strong>ökologischer</strong> <strong>Fußabdruck</strong> zeigen. Das besondere an dieser<br />
Station ist, dass diese ein partizipatives Filmprojekt darstellt, an dem sich alle Besucher der<br />
Ausstellung beteiligen können. Die Idee besteht darin, dass sich die Besucher im <strong>Odysseum</strong> zu<br />
diesem Themenschwerpunkt informieren und damit auseinandersetzen. Danach können sie selbst<br />
beurteilen, wo sie in ihrer Umgebung gute Beispiele finden, wie eine nachhaltigere Lebensweise<br />
gelingen kann oder wo schlechte Beispiele zu sehen sind, die verbessert werden müssten. Mit<br />
ihrer eigenen kleinen Reportage können sie selbst ein Teil der Ausstellung werden und dazu
1.2.<br />
beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Thematik weiterzutragen. Die einzige<br />
Vorgabe ist: Die Reportage sollte irgendwo draußen, „in der echten Welt“ spielen und ein<br />
Statement zum Thema <strong>ökologischer</strong> <strong>Fußabdruck</strong> machen. Diese Aktion wird ebenfalls in einem<br />
Workshopmodul vertieft.<br />
4.1.4 Der Fuß<br />
Der große Fuß ist der Hingucker der Aktionsausstellung. Die Besucher kommen frontal auf den<br />
Fuß zu und treffen zuerst auf das Exponat „Footprint-Mischpult“, das in die Zehen und in den<br />
Spann des Fußes integriert ist. An den Seitenwänden finden sich die Exponate „Stadt – Land –<br />
Welt“, „Kontoauszug“ und „Obacht“. Im Bereich der Ferse ist eine Öffnung im Fuß, in der sich<br />
das Exponat „Anpfiff“ verbirgt.<br />
4.1.5 Erlebnisstation „Footprint-Mischpult“<br />
Alles was wir tun, verbraucht etwas, was die Natur uns zur Verfügung stellt. Kleidung, Papier,<br />
Reisen, warmes Wasser, Essen ... Wir leben von der Natur – noch immer. Der ökologische<br />
<strong>Fußabdruck</strong> ist ein Maß dafür, wie viel Natur wir nutzen. Was macht einen großen und was macht<br />
einen kleinen <strong>Fußabdruck</strong>? Wie wirken sich die einzelnen Faktoren auf das Gesamtergebnis aus?<br />
Was kann man tun, um den <strong>Fußabdruck</strong> zu verringern?<br />
An vier der fünf Zehen des Fußes können die Besucher jeweils mit einem der Bereiche<br />
experimentieren, die für die Berechnung des individuellen <strong>Fußabdruck</strong>s von Bedeutung sind<br />
(Mobilität, Wohnen, Ernährung, Konsum). Sie können in jedem Bereich an je fünf Drehreglern ein<br />
jeweils unterschiedliches Verhalten einstellen – und unmittelbar beobachten, wie sich das jeweilige<br />
Verhalten auf das Gesamtergebnis auswirkt. Am fünften Zeh informiert eine Grafik über den<br />
ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> und seine Berechnung.<br />
Auf jedem Zeh werten eine Digitalanzeige und ein LED-Streifen das Ergebnis der jeweiligen<br />
Einstellung aus, zusätzlich laufen die Informationen der vier Gruppen in eine aufsummierte<br />
Auswertung zusammen, die sich oben auf dem Spann des Fußes befindet. Hier wird mit einer<br />
Digitalanzeige und einer großen Lauflichtanzeige das Gesamtergebnis der vier Bereiche<br />
angezeigt. Die Berechnung des individuellen ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s ist bewusst in dieser<br />
interaktiven Umsetzung angelegt, damit die Besucher über die Zusammensetzung des<br />
ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s ins Gespräch kommen und gemeinsam mit den Möglichkeiten zur
1.2.<br />
Reduzierung des Betrages experimentieren können (s. unten 6. Organisatorische Hinweise /<br />
Empfehlungen, Sozialkompetenz).<br />
4.1.6 Erlebnisstation „Stadt – Land – Welt“<br />
Nicht nur jeder Einzelne hat einen <strong>Fußabdruck</strong>, auch eine Firma, eine Stadt, ein Land und die<br />
ganze Welt haben einen. Wozu ist es gut, den ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> von Köln zu berechnen?<br />
Was können Städte und Länder für einen kleineren <strong>Fußabdruck</strong> tun? Warum ist es wichtig, sich die<br />
ganze Welt anzusehen?<br />
Das Exponat ist als Softwareexponat umgesetzt. Es besteht aus vier Ebenen die graphisch<br />
dargestellt sind: Ein Unternehmen – eine Stadt – ein Land – die ganze Welt. In jedem Bild gibt es<br />
mehrere Details zu entdecken, hinter denen sich Informationsbereiche verbergen: Welche Rolle<br />
spielt der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> auf dieser Ebene? Was ist hier auffällig? Welche Maßnahmen<br />
kann man auf dieser Ebene treffen, um den ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> zu verbessern? Die<br />
Informationsbereiche bestehen aus Texten, die in einem separaten Fenster gezeigt werden. Die<br />
vier Bilder sind größer als der Bildschirm, so dass die Besucher das Bild verschieben müssen, um<br />
alles zu entdecken.<br />
4.1.7 Erlebnisstation „Kontoauszug“<br />
Im Grunde ist es ganz einfach: Man kann nicht mehr ausgeben als man einnimmt. Das gilt für’s<br />
Taschengeld ebenso wie für das Monatsgehalt. Auch die Natur liefert uns ein „Einkommen“ – sie<br />
liefert Nahrung, Holz, Wasser, saubere Luft und vieles andere, das wir nutzen und verbrauchen.<br />
Wie geben wir unser Einkommen aus? Wie ist es um unseren Kontostand bestellt? Was würdest<br />
Du ändern?<br />
Das Exponat ist ein Kontoauszugsdrucker mit einem integrierten Touchscreen. Über den<br />
Bildschirm werden die Kontoauszugsdaten von „Deutsche Naturbank GmbH & Co. KG“ des Jahres<br />
2000 dargestellt. Es folgen eine Reihe von Abbuchungen, zum Beispiel „Datum: 26.07.2000 /<br />
Verwendungszweck: Flugreisen / Betrag: -0,05 gha / Saldo: +0,48 gha“. Am 09. Oktober 2000<br />
rutscht der Saldo ins Minus: Das nennt man Overshoot, oder Überziehung. Dann wird das<br />
Einkommen des Jahres 2005 angezeigt, aber wieder lassen die Abbuchungen den Saldo „rot“<br />
werden – und zwar noch früher als im Jahr 2000: am 10. September. Mit dem dritten Jahr werden<br />
das Einkommen und der Verbrauch des Jahres 2010 dargestellt, da war der Overshoot day bereits
1.2.<br />
am 21. August. Hier stoppt die Animation und die Besucher werden aufgefordert, selbst aktiv zu<br />
werden um mitzuhelfen, diesen negativen Trend zu stoppen. Sie können aus Vorschlägen drei<br />
Vorsätze auswählen, die helfen, den ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> zu verringern. Sie können diese<br />
ausdrucken und den Ausdruck mitnehmen und aufheben, bis sie die Vorsätze erfüllt haben.<br />
1.8 Erlebnisstation „Obacht“<br />
Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> kann uns dabei helfen, Entscheidungen im Alltag zu treffen. Wir<br />
müssen ihn nur immer im Hinterkopf behalten. Probier es aus!<br />
Diese Erlebnisstation ist als Bewegungsexponat, bzw. als „Aufmerksamkeitsspiel“ für jüngere<br />
Besucher optimiert. Die Besucher stehen vor einem Bildschirm, unmittelbar darunter befindet sich<br />
eine Kamera, die die Besucher aufnimmt und ihre Aktivitäten erfasst. Zusätzlich zur Kamera-<br />
Steuerung gibt es einen „Footprint-Button“ unterhalb des Monitors.<br />
Die Aufgabe besteht nun darin, eine Figur durch eine Stadt zu steuern. Die Steuerung erfolgt über<br />
Bewegung – je aktiver sich die Besucher vor der Kamera engagieren, desto schneller kommt die<br />
Figur auf dem Spielplan voran. Die Figur durchläuft einen vorgegebenen Weg, eine<br />
Richtungssteuerung ist daher nicht notwendig. Die Figur verlässt das Haus, geht durch Straßen,<br />
geht zur Arbeit, geht Einkaufen, etc. Dabei können die Besucher, wenn sie schnell sind, Punkte<br />
einsammeln. Die ganze Zeit über muss der Spieler die Figur aktiv bewegen, sonst bleibt sie<br />
stehen. Neben dem Laufen müssen die Besucher jedoch immer wieder auch den „Footprint-<br />
Button“ drücken, um zu zeigen, dass sie auch im Alltag daran denken, dass das, was sie gerade<br />
tun, Auswirkungen auf ihren ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> hat.<br />
4.1.9 Erlebnisstation „Anpfiff“<br />
Steck den Kopf in die Öffnung! Traust Du Dich? Ist das lustig oder ernst? Hast Du so etwas schon<br />
mal erlebt?<br />
Das Exponat ist als Film-Exponat umgesetzt. Hinten, in der Ferse des großen Fußes ist ein Loch.<br />
Die Besucher sollen ihren Kopf in die Öffnung stecken und sich dann „face-to-face“ in einer engen<br />
und nicht ganz bequemen Situation wiederfinden. Ihnen gegenüber ist ein Bildschirm, auf dem uns<br />
einer abwechslungsreich, aber nach allen Regeln der Kunst die Leviten liest: Laut, schon mit
1.2.<br />
Humor, aber durchaus ernst. Das Exponat soll den Besuchern die Brisanz und die Wichtigkeit<br />
dieses Themenschwerpunkts auf ungewöhnliche Weise verdeutlichen.<br />
4.2 MODUL DAUERAUSSTELLUNG<br />
Von der Aktionsausstellung ausgehend führen Fußspuren in die 5 Themenwelten der<br />
Dauerausstellung des <strong>Odysseum</strong>s. Auch hier gibt es verschiedene Erlebnisstationen, die einen<br />
Bezug zu dem Themenschwerpunkt <strong>ökologischer</strong> <strong>Fußabdruck</strong> haben und eine wichtige<br />
thematische Ergänzung zu dem Aktionsausstellungsbereich darstellen. Im Folgenden werden die<br />
ausgewählten Erlebnisstationen vorgestellt – sowohl in ihrem Bezug zum Themenschwerpunkt, als<br />
auch in ihrem generellen wissenschaftlichen Inhalt, zusammen mit einer Beschreibung der<br />
Erlebnisstation.<br />
4.2.1 Themenwelt „Leben“<br />
Erlebnisstation „Wie Bäume Wasser transportieren“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Die Biosphäre der Erde ist ein wichtiger Rohstofflieferant für die<br />
Bedürfnisse des Menschen. Tiere und Pflanzen existieren ihrerseits auf Grundlage der<br />
Ressourcen, die ihnen ihre Umwelt zur Verfügung stellt. Umso wichtiger ist, dass der Mensch die<br />
Belastungsgrenzen des Ökosystems Erde nicht überschreitet, da er sonst nicht nur die Grundlagen<br />
seiner eigenen Existenz gefährdet.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Bäume gehören zu den größten Lebewesen auf der Erde, besonders im<br />
Regenwald erreichen sie gewaltige Höhen. Um diese Größe zu erreichen, müssen sie u. a. in der<br />
Lage sein, Wasser, um das sie mit anderen Pflanzen konkurrieren, mit den Wurzeln aus dem<br />
Boden zu saugen und bis in ihre Blätter zu transportieren. In der Pflanze arbeiten dabei<br />
verschiedene physikalische Mechanismen zusammen: Aufgrund des Wurzeldrucks (Osmose im<br />
Wurzelgewebe) strömt das Wasser leichter in die Wurzeln ein, der Kapillareffekt leitet das Wasser<br />
im Stamm nach oben und über den Verdunstungssog in den Spaltöffnungen der Blätter entsteht<br />
ein Unterdruck, der das Aufsteigen des Wassers entgegen der Schwerkraft unterstützt.<br />
Exponatbeschreibung: Das Exponat stellt eine Analogie zwischen den Mechanismen des Baumes<br />
und den Kräften der Besucher her. Die Besucher sollen aktiv erleben, wie viel Kraft dazu nötig ist,<br />
um Wasser in die Höhe zu leiten. Die Besucher werden aufgefordert, mit einer Pumpe Wasser<br />
durch Röhren bis in die Spitzen einer Baumsilhouette zu pumpen. Der Baum ist von 60 m auf ca. 2
1.2.<br />
m herunterskaliert. Die Besucher können nachvollziehen, welche Kräfte große Bäume für die<br />
Versorgung mit Wasser aufbringen müssen. Zusätzlich werden die drei Prinzipien des pflanzlichen<br />
Wassertransports grafisch erklärt (Wurzeldruck, Kapillarkräfte und Verdunstungssog).<br />
Erlebnisstation „Pflanzen, zur Sonne!“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Die wichtigste Energiequelle auf der Erde ist die Sonne. Mit der<br />
Photosynthese hat die Natur ein Verfahren entwickelt, das es Pflanzen ermöglicht, diese Energie<br />
effektiv zu nutzen. Dabei wird das Treibhausgas Kohlendioxid in den für uns lebenswichtigen<br />
Sauerstoff umgewandelt und so in der Biomasse gebunden. Der Mensch hat sich die Pflanzen<br />
zum Vorbild genommen und mittlerweile ebenfalls Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie<br />
entwickelt, ein Beispiel ist die Photovoltaik.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Ohne Solarenergie gibt es – von wenigen Ausnahmen abgesehen –<br />
keine Energie und kein Leben auf der Erde. Auch Pflanzen benötigen die Sonne zum Überleben:<br />
Fast alle Pflanzen sind photoautotroph, das heißt sie stellen die zum Überleben erforderlichen<br />
organischen Stoffe durch Photosynthese mit Hilfe der Sonne selbst her. Über das in den Blättern<br />
enthaltene Blattgrün (Chlorophyll) nehmen die Pflanzen das Licht auf und leiten die absorbierte<br />
Energie weiter. Daher sind an vielen Pflanzen die Blätter so angeordnet, dass jedes Blatt das<br />
Maximum an Sonnenlicht aufnehmen kann.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Dieses Analogieexponat zeigt zum einen, dass Pflanzen mit<br />
Photosynthese Energie erzeugen, zum anderen, dass die Ausrichtung der Blätter wichtig ist, um<br />
diesen Prozess zu optimieren: Die Pflanze, die mehr Licht „einfängt“, wächst letztlich höher. Die<br />
Besucher versuchen, die Blätter einer künstlichen Pflanze so auszurichten, dass sie so viel<br />
„Sonnenlicht“ wie möglich aufnehmen können. Die produzierte Energie kann dabei auf einem
1.2.<br />
Bildschirm abgelesen werden. Auf einem Monitor können die Wettstreiter eine Animation<br />
beobachten, bei der die besser beschienene Pflanze höher wächst als die andere. Die Besucher<br />
stellen fest, dass die Pflanze am meisten Energie produziert, wenn möglichst wenige Blätter im<br />
Schatten anderer Blätter sind.<br />
Erlebnisstation „Holz erzählt eine Geschichte“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Holz als Beispiel für einen nachwachsenden Rohstoff ist<br />
prinzipiell nachhaltiger als Produkte aus fossilen Rohstoffe. Doch auch ein Baum muss<br />
jahrzehntelang wachsen bis er der Nutzholzgewinnung dienen kann. Außerdem ist<br />
Wiederaufforstung kein gleichwertiger Ersatz für abgeholzte Urwälder. Deshalb ist es wichtig, auch<br />
nachwachsende Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Gütesiegel zur Zertifizierung von Holz<br />
aus nachhaltiger Forstwirtschaft wie zum Beispiel das FSC- oder das PEFC-Siegel können dem<br />
Verbraucher dabei Orientierung geben.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Ein Baum ist ein riesiger, komplexer Organismus, der nicht nur Licht in<br />
Energie umwandelt, sondern auch die Umgebung kühlt, Kohlendioxid in Form von Kohlenstoff<br />
bindet und dessen abgestorbene Teile wieder als Biomasse für andere Lebewesen von Nutzen<br />
sind. Der Aufbau des Baumes lässt sich in drei Teile gliedern: in 1. die Wurzeln, 2. den aus den<br />
Wurzeln emporwachsenden Stamm und 3. seine belaubte Krone. Der Stamm des Baumes hat<br />
dabei vielfältige Funktionen. Erst der Querschnitt durch einen Baumstamm gibt den Aufbau des<br />
Stammes preis: Die Borke schützt den Baum vor Umwelteinflüssen, der Bast transportiert die im<br />
Wasser gelösten Nährstoffe und das Kambium bildet die Wachstumsschicht des Baumes. Hinter<br />
dem Kambium liegt das junge, noch aktive Splintholz, das Nährstoffe transportiert und speichert;<br />
den Kern des Stammes bildet das nicht mehr aktive Kernholz.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Ergänzend zu den anderen Exponaten, die sich mit dem Wuchs<br />
und Aufbau von Pflanzen befassen, können die Besucher hier den Aufbau eines Baumstamms in<br />
Vergrößerung sehen. Es wird eine Baumscheibe gezeigt, die die Besucher mit einer Lupenkamera<br />
betrachten können, so dass sie sehen können, wie die Jahresringe entstehen (durch winterliche<br />
Wachstumsphasen mit kleineren Zellen). Außerdem können sie Borke, Bast, Kambium, Splintholz<br />
und Kernholz unterscheiden. Zusätzlich gibt es eine hinterleuchtete mikroskopische Aufnahme, auf<br />
der die Besucher mit der Lupenkamera auch die einzelnen Zellen sehen können. In die
1.2.<br />
Baumscheibe sind Kupferplättchen mit Jahreszahlen eingelassen. Es gibt Textinformationen zur<br />
Entstehung der Jahresringe und zu den verschiedenen Zonen des Holzes.<br />
4.2.2 Themenwelt „Erde“<br />
Erlebnisstation „Google Earth“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Aus der Satellitenperspektive kann analysiert werden, wie viel<br />
Fläche der Mensch zur Deckung seiner Bedürfnisse in Anspruch nimmt. Unterscheiden lassen sich<br />
z. B. Flächen für Wohnen (Siedlungen), Transport und Mobilität (Straßen und andere<br />
Verkehrswege), Nahrungsmittelproduktion (Äcker und Weideflächen), Rohstoffabbau (Gruben und<br />
Brüche) und Flächen, die das emittierte CO2 binden (Wälder und Ozeane).<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Es gab Zeiten, da waren die meisten Satellitenbilder eine hochgeheime<br />
Sache. Doch das Ende des Kalten Krieges führte dazu, dass plötzlich riesige Mengen<br />
Satellitenbilder auf dem freien Markt auftauchten. Irgendwann war es nur noch eine Frage der Zeit,<br />
bis die Erde ins Netz kam: Die Firma Google war es, die allen im Internet mit Google Earth eine<br />
unentgeltliche Software zur Verfügung stellte. So kann heute jeder auf dem eigenen Rechner die<br />
Grundversion eines virtuellen Globus anschauen und jeden Ort auf der Erde „anfliegen“.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Die Besucher stehen vor einem Pult und können mit dem<br />
Programm Google Earth Ausschnitte der Welt herzoomen und so mehr oder weniger detaillierte<br />
Bilder der Erde sehen. Die Bilder werden auf eine große, im Raum hängende Fläche projiziert. Zur<br />
Bedienung des Exponats haben die Besucher einen Trackball zur Verfügung.<br />
Erlebnisstation „Globalisierung“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: In Zeiten der globalisierten Warenproduktion können<br />
Konsumentscheidungen in Deutschland konkrete Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch in<br />
der ganzen Welt haben. Neben den Energiekosten für den Transport der Waren, spielen dabei<br />
auch der Ressourcenverbrauch und die ökologischen und sozialen Folgen an den<br />
Produktionsstandorten eine wichtige Rolle.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Die globalisierte Produktion hat zu einer engen Vernetzung von<br />
Milliarden von Menschen geführt, einhergehend mit höherer Produktivität und einer allgemeinen<br />
Beschleunigung. Voraussetzung sind dafür Technik und Logistik. Aber damit die Prozesse konkret<br />
stattfinden und vor allem wie sie stattfinden, dafür sind die Rahmenbedingungen der Wirtschaft der
1.2.<br />
Schlüssel. Schuhe, Hemden oder Spielzeug gibt es in den Industrieländern mittlerweile für wenig<br />
Geld zu kaufen. Sie werden in China, in Vietnam oder Afrika gefertigt. Dabei sind die sozialen und<br />
ökologischen Rahmenbedingungen in den günstigeren Produktionsländern oft bedenklich.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Die Besucher stehen vor einer Exponatwand, die eine Grafik mit<br />
einer großflächigen Weltkarte zeigt. Auf dieser Weltkarte ist der Produktionsablauf eines T-Shirts<br />
dargestellt. Die verschiedenen Orte, an denen Teilproduktionen für dieses T-Shirt abgewickelt<br />
werden, sind mit einem Punkt markiert, an dem eine kleine Erklärungs-Tafel an einem Draht<br />
befestigt ist. Die Besucher können den Produktionsablauf über die Weltkarte verfolgen und lesen,<br />
an welchem Ort welche Teilschritte abgewickelt werden. Auf der linken Seite vor der Exponatwand<br />
befindet sich eine interaktive Medienstation, auf der die Besucher einen Info-Film sehen können.<br />
Dieser illustriert mit Fotografien und ebenfalls über eine Grafik auf einer Weltkarte die Produktion<br />
eines T-Shirts, die sich durch nachhaltige Produktionsabläufe auszeichnet. Rechts neben der<br />
Weltkarte befinden sich mehrere unterschiedlich große Vitrinen mit Objekten, die einzelne<br />
Produktionsschritte der T-Shirt-Produktion darstellen oder repräsentieren.<br />
Erlebnisstation „Wie schützen wir das Klima?“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Der CO2-Ausstoß ist ein wichtiger Aspekt des ökologischen<br />
<strong>Fußabdruck</strong>s und macht etwa 50 % davon aus. Er fließt in die Berechnung als die Fläche mit ein,<br />
die benötigt wird, um das in die Atmosphäre freigesetzte CO2 wieder zu binden (vor allem durch<br />
Wälder und Ozeane). Um den CO2-Ausstoß insgesamt zu senken und damit das Klima zu<br />
stabilisieren, muss die Menschheit auf verschiedenen Handlungsebenen aktiv werden. Das<br />
beginnt beim Verhalten jedes Einzelnen und geht über die Initiative von Kommunen und Regionen<br />
bis hin zu nationalen Aktionsplänen. Letztendlich können aber nur wirkungsvolle internationale<br />
Kooperationen, wie das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll, den Klimawandel verhindern.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Ein Anstieg der mittleren Temperatur auf dem Globus um etwa zwei<br />
Grad ist nicht mehr zu verhindern. Die Hoffnung ist, dass der Globus dies gerade noch verkraftet.<br />
Kann es gelingen, das Klimasystem im Verlauf des Jahrhunderts auf diesem Niveau zu<br />
stabilisieren oder steigen die Temperaturen weiter? Die Dringlichkeit der Problematik ist in den<br />
vergangenen Jahren immer offensichtlicher geworden, während Lösungsansätze nur schleppend<br />
vorankommen und in endlosen Verhandlungen zu ersticken scheinen. Bei vielen Menschen<br />
entsteht daraus ein Gefühl der Frustration – sie selbst werden zu Verhaltensänderungen und
1.2.<br />
Einsparungen aufgefordert – während „die Großen immer so weitermachen“. Dabei gibt es bereits<br />
Ideen, wie die Treibhausgas-Emissionen wirkungsvoll reduziert werden können.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Die Besucher stehen vor einer Exponatwand, auf der das Bild<br />
eines großen Verhandlungstisches dargestellt ist, an dem Menschen sitzen. Ein kleiner Teil des<br />
Tisches ragt vorne aus der Wand heraus, auf ihm befindet sich eine markierte Fläche. Rechts von<br />
dem Tisch ist ein Monitor angebracht, auf dem ein etwas ärgerlich blickender Junge zu sehen ist,<br />
neben ihm ist die Aufforderung zu lesen: „Hier muss mal einer auf den Tisch hauen!“ Es ist ein<br />
undeutliches Gemurmel zu hören. Die Besucher können der „Verhandlung“ eine Weile folgen,<br />
merken aber bald, dass da nicht viel passiert. Wenn die Besucher der Aufforderung folgen und mit<br />
der Hand auf die markierte Fläche auf dem Tisch schlagen, beginnt auf dem Monitor ein kurzer<br />
Animationsfilm mit dem kleinen Jungen. Er ärgert sich über die zähe Entwicklung der<br />
klimapolitischen Verhandlung und berichtet von guten Ideen für den Klimaschutz, die es heute<br />
schon gibt (z. B. den Emissionshandel). Im linken Bereich steht ein durchsichtiger Behälter, mit<br />
Kugeln gefüllt, die mit unterschiedlichen Länder-Flaggen bedruckt sind. Die Besucher sollen raten,<br />
ob die Verteilung der Kugeln das Verhältnis der CO2-Emissionen oder das der Pro-Kopf-Emission<br />
treibhausgasverursachender Staaten darstellt.<br />
Erlebnisstation „Bald sind wir 10 Milliarden“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> zeigt, dass die Menschheit schon<br />
heute mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde dauerhaft zur Verfügung stellen kann. Die<br />
Tatsache, dass die Weltbevölkerung weiter steigt, verschärft diese Ressourcenknappheit<br />
zusätzlich. Umso wichtiger ist es schon heute, gerade in den entwickelten Ländern, den<br />
Rohstoffverbrauch durch effizientere Nutzung und/ oder Änderung des Lebensstils zu reduzieren.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: In ihrer Frühgeschichte war die Gattung Mensch mehrfach vom<br />
Aussterben bedroht. Heute ist sie die erfolgreichste überhaupt. Ihre schiere Größe jedoch ist zu<br />
einem zentralen Problem auf dem Globus geworden. Erst recht, wenn es darum geht, allen<br />
Menschen die Entfaltung ihrer Potenziale zu ermöglichen und vergleichbare und vielfältige<br />
Lebenschancen zu bieten. Die Weltbevölkerung wächst noch immer um ca. 80 Millionen<br />
Menschen pro Jahr, auch wenn die Tendenz leicht abnehmend ist. Wie wir und all unsere<br />
Nachfahren leben werden, hängt davon ab, wie wir leben, wirtschaften und verteilen.
1.2.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Die Besucher stehen vor einer Exponatwand, die mit einer<br />
Vielzahl von Fotos von Babygesichtern graphisch gestaltet ist. Eine Digitalanzeige in der Mitte der<br />
Exponatwand zeigt die aktuelle Weltbevölkerungsanzahl. Über einen Buzzer können die Besucher<br />
die Bevölkerungszahl anhalten, sie erfahren dabei, um wie viele Personen die Weltbevölkerung in<br />
der Zwischenzeit gewachsen ist (die Hochrechnung berücksichtigt die Todesfälle, zeigt diese<br />
jedoch nicht explizit an). Auf der linken Seite befindet sich eine interaktive Medienstation, die die<br />
Entwicklung der Weltbevölkerung vom Jahr 1 n. Chr. bis 2050 visualisiert und anschaulich zu<br />
historischen Großereignissen in Beziehung setzt. Die Besucher können frei durch die Animation<br />
navigieren. Auf der rechten Seite befindet sich ein interaktives Steuerspiel. Hier werden in Form<br />
einer vereinfachten Hochrechnungssimulation wesentliche Parameter der<br />
Bevölkerungsentwicklung bis 2059 erlebbar gemacht. Die Besucher können drei Parameter<br />
einstellen (Wohlstandsfaktor, Weltbevölkerung, Ressourceneffizienz) und verfolgen, wie sich ihre<br />
Einstellung auf den zukünftigen Verbrauch an „Erden“ auswirkt. Die Besucher erkennen, dass<br />
demografische Entwicklungen veränderbar sind und dass die Beantwortung der Frage, wie viele<br />
Menschen auf der Erde leben können, davon abhängt, wie sie leben. Ein Zustand, in dem man mit<br />
unserer heutigen Erde auskommt, ist bis 2059 nicht erreichbar. Der Globus kann das über eine<br />
bestimmte Zeit jedoch verkraften.<br />
Erlebnisstation „Flieg in die Vergangenheit“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Trotz technischem Fortschritt und einer damit einhergehenden<br />
gestiegenen Ressourceneffizienz hat der Ressourcenverbrauch in den allermeisten Bereichen<br />
zugenommen. Das erklärt auch den gestiegenen ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Technischer Fortschritt führt in der Regel zu einer effizienteren Nutzung<br />
von Ressourcen und Energie. Und trotzdem führt saubere Technik unterm Strich bis heute nicht zu<br />
einer Entlastung der Natur. Denn effizientere Technik beansprucht in der Summe immer mehr<br />
Ressourcen, weil in der Folge der Verfügbarkeit von Technik immer mehr Menschen die Erde<br />
bevölkern – und zwar bei gesteigertem mittlerem Konsum, wobei der Gesamtverbrauch immer<br />
noch schneller wächst, als der Fortschritt der Technik die Umweltbelastungen pro Einheit senkt.<br />
Das ist der so genannte Bumerangeffekt (rebound effect), der die gesamte Technikgeschichte<br />
durchzieht.
1.2.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Die Besucher stehen vor einer Exponatwand, die in drei Zonen<br />
unterteilt ist, wobei jede einem Zeitpunkt zugeordnet ist, und zwar 1970, 1988 und 2008. Vor der<br />
Exponatwand befinden sich drei Stationen, die eindeutig je einer der drei Zonen zugeordnet sind.<br />
Sie vermitteln den Verlauf des technischen Fortschritts zwischen 1970 und heute anhand der<br />
Entwicklung von „Flieg-Spielen“. 1970 gab es nur ein Brettspiel, 1988 eine einfache Spielkonsole,<br />
2008 den Flugsimulator. Im oberen Bereich vermittelt eine Grafik auf der Exponatwand auf<br />
einfache Weise den eigentlichen Zusammenhang des Bumerangeffekt. Drei transparente<br />
Kerosinbehälter zeigen den immer effizienteren Ressourceneinsatz im Flugverkehr. Doch zwei<br />
Kurven verdeutlichen den Anstieg des weltweiten Flugverkehrs und damit wiederum auch den<br />
Anstieg des weltweiten Kerosinverbrauchs und die damit verbundene zunehmende<br />
Umweltbelastung.<br />
Erlebnisstation „Das Wasserkraftwerk“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Mit der absehbaren Verknappung von Erdöl und Kohle wird<br />
unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zunehmend problematisch. Deshalb gewinnen<br />
alternative Methoden zur Deckung unseres Energiebedarfs immer mehr an Bedeutung. Als<br />
besonders ressourcen- und umweltschonend gilt dabei die Nutzung von natürlichen Energieträgern<br />
wie Wasser- und Windkraft.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Technikgeschichtlich versuchte man schon sehr früh, die<br />
Bewegungsenergie von Wasser, das den Fluss hinunterfließt oder in einem Wasserfall<br />
herunterfällt, zu nutzen. Bis heute haben sich daraus eine Vielfalt von Techniken entwickelt:<br />
Wasserräder, Speicherkraftwerke, Gezeitenkraftwerke, etc. Da das verwendete Wasser nach der<br />
Energiegewinnung wieder in den natürlichen globalen Kreislauf zurückgelangt, ist Wasserkraft eine<br />
regenerative Energie.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: An dem Exponat können zwei Besucher zusammenarbeiten und<br />
ausprobieren, wie mit Wasserkraft Energie gewonnen werden kann. Ziel es ist, über einen<br />
Pumpmechanismus eine Flüssigkeit von einem unteren in ein oberes Gefäß zu pumpen. Wenn die<br />
Flüssigkeit in dem oberen Gefäß ein bestimmtes Niveau erreicht, strömt das Wasser in ein Rohr<br />
und treibt über ein großes Wasserrad einen Dynamo an, der eine Lampe zum Leuchten bringt.
1.2.<br />
Erlebnisstation „Liegender Einzylinder“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Die Erfindung des Verbrennungsmotors revolutionierte die<br />
Fortbewegung und legte so den Grundstein für die heutige Mobilität unsere Gesellschaft.<br />
Motorisierung ist heute ein selbstverständlicher Teil unseres Alltags, der allerdings mit einem<br />
enormen Ressourcenverbrauch einhergeht. So macht unser Verkehrsverhalten knapp ein Fünftel<br />
des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s in Deutschland aus. Das Ausmaß des Energieverbrauchs kann<br />
aber durch die Wahl des Verkehrsmittels beeinflusst werden (Auto, ÖPNV, Fuß oder Fahrrad,<br />
Fahrgemeinschaften, Carsharing).<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Der liegende Einzylinder-Viertaktmotor machte die Menschheit mobil.<br />
Als Ottomotor, in Köln erfunden, wurde er weltweit zum Begriff. Ursprünglich mit Leuchtgas<br />
betrieben, eignete er sich in seinen verschiedenen Weiterentwicklungen für alle Kraftstoffe, die<br />
sich in einem Tank mitführen ließen. Damit begann der Siegeszug des Automobils und des<br />
Individualverkehrs.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Die Besucher stehen vor einem echten, historischen Liegenden<br />
Einzylinder, gebaut von der Deutz AG und einem historischen Elektromotor von Siemens. Der<br />
Einzylinder ist durch einen Riemen mit dem Dynamo verbunden, der Dynamo wiederum ist mit<br />
einer historischen Lampe verbunden. Zu festen Vorführterminen können die Besucher den<br />
Liegenden Einzylinder und das Leuchten der Lampe in einer Live-Vorführung erleben. Des<br />
Weiteren können sich die Besucher an einer Medienstation tiefergehend über den Liegenden<br />
Einzylinder informieren, über seinen Erfinder, die Entwicklungsgeschichte, den Einsatzbereich und<br />
die Funktionsweise der vier Takte (Ansaugen, Verdichten, Arbeiten, Ausstoßen). Für dieses<br />
historische Szenario hat die Dombauhütte einen originalen Stein des Kölner Doms zur Verfügung
1.2.<br />
gestellt. Der Kölner Dom wurde zu seiner Einweihung Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal<br />
mit dem Liegenden Einzylinder beleuchtet.<br />
4.2.3 Themenwelt „Mensch“<br />
Erlebnisstation „Menüs aus aller Welt“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> verschiedener Länder zeigt, dass<br />
der Ressourcenverbrauch auf der Erde sehr ungleich verteilt ist. Dies beginnt bereits bei so<br />
grundlegenden Dingen wie der Ernährung. Während in manchen Teilen der Welt sogar ein Mangel<br />
an Grundnahrungsmitteln herrscht, leben die Menschen in vielen Industrienationen im Überfluss.<br />
Entsprechend groß ist auch der ökologische <strong>Fußabdruck</strong>.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Eine gewaltige Agrarindustrie, Massentourismus und Globalisierung<br />
führen zu einer Vermischung und Angleichung der Lebensmittelkultur rund um den Globus. Und<br />
dennoch offenbart sich in dem, was die Menschen essen, noch immer viel von ihrer Geschichte,<br />
ihrer Eigenart, ihrer sozialen Situation und ihrer regionalen Vorlieben. Wir sind, was wir essen: im<br />
Hunger ebenso wie im Überfluss.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Ausgangspunkt des Exponats sind Fotografien von Familien aus<br />
verschiedenen Ländern und ihrem typischen Verbrauch an Nahrungsmitteln. Diese Bilder werden<br />
durch eine Legende ergänzt, die verschiedene sozioökonomische und<br />
ernährungswissenschaftliche Informationen anbietet. Ein Posterständer enthält eine Reihe von<br />
großformatigen Bild- und Texttafeln, die eine Familie vor/neben all den Lebensmitteln zeigt, die sie<br />
innerhalb einer Woche typischerweise zu sich nimmt. Auf einem Register ist das jeweilige Land<br />
genannt, das das Bild repräsentiert. Neben den Fotos werden wie in einer Legende begleitende<br />
Daten genannt: typischer Speiseplan; Zusammensetzung der Ernährung (Fett, Eiweiße,
1.2.<br />
Kohlenhydrate; Kalorienangebot pro Kopf und Tag; Einkommen der Familie; Einkommensanteil,<br />
der für die Ernährung aufgewendet wird; durchschnittliche Lebenserwartung der Region;<br />
Kennzahlen der Ernährungs- und Gesundheitssituation). Die Besucher können die Bilder<br />
durchblättern und vergleichen.<br />
Erlebnisstation „Nahrhafte Ideen“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Gut ein Drittel des ökologischen <strong>Fußabdruck</strong>s entfällt auf die<br />
Nahrungsmittelproduktion. Dabei spielen neben dem unmittelbaren Ressourceneinsatz noch<br />
andere Aspekte eine Rolle. So ist die Landwirtschaft, und vor allem die Viehzucht, einer der<br />
größten Verursacher von Treibhausgas-Emissionen. Ackerbau und Bewässerung führen in<br />
manchen Regionen der Erde zudem zu Wüstenbildung und Wasserverknappung. Die<br />
Erlebnisstation thematisiert diese Probleme und stellt gleichzeitig Lösungsansätze zu deren<br />
Überwindung vor. Dies soll zeigen, dass auch heute schon eine effektivere Ressourcennutzung<br />
möglich wäre.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Nach der mittleren Prognose der Vereinten Nationen werden im Jahre<br />
2050 rund 9 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Für sie muss genügend Nahrung<br />
bereitgestellt werden. Diese Nahrungsmittel müssen so produziert werden, dass die Umwelt nicht<br />
so beeinträchtigt wird, dass ein Überleben auf diesem Planeten kaum noch möglich ist. Die<br />
Komplexität und die Verflechtung der Herausforderungen, vor denen die Menschheit zu Beginn<br />
des 21. Jahrhunderts steht, machen Prognosen schwierig. Eines ist jedoch klar, diese<br />
Herausforderungen sind globaler Natur: sie betreffen die Menschheit und ihren Lebensraum, die<br />
Erde, als Ganzes und es geht um das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten.
1.2.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Auf einem Sockel steht ein großer „Nahrungsglobus“. Auf der<br />
Oberfläche sind Meere, Länder und Kontinente der Erde in Form von aufgebrachten<br />
Grundnahrungsmitteln (z. B. Weizen, Reis, Hirse, Mais) dargestellt. Durch acht eingelassene<br />
Bildschirme entlang der Äquatorebene können acht Besucher gleichzeitig ins Innere der Kugel<br />
sehen. Im Innern des Globus befindet sich eine leicht verstehbare Computeranimation, die anhand<br />
ausgewählter Daten Einblicke in die gegenwärtige Situation vermittelt und ausgewählte Projekte<br />
mit Ansätzen für eine nachhaltige Entwicklung vorstellt. Die Themen sind: Wasser (-mangel),<br />
Wüsten (Desertifikation), Fairer Handel sowie Klimawandel und Landwirtschaft.<br />
Erlebnisstation „Riesige Lachse“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Eine Möglichkeit zur Verkleinerung des ökologischen<br />
<strong>Fußabdruck</strong>s ist die effizientere Erzeugung von Produkten für unseren Bedarf. Mit Hilfe der<br />
Gentechnik lassen sich tierische und pflanzliche Organismen noch besser den Anforderungen der<br />
Landwirtschaft anpassen und so die Erträge der Nahrungsmittelproduktion steigern. Ist Gentechnik<br />
also ein Weg aus der Lebensmittelknappheit oder sind die ökologischen und sozialen Risiken der<br />
Technologie zu groß?<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Transgene Lachse sind ein beeindruckendes Beispiel sowohl für die<br />
Potenziale als auch für die Risiken der Gentechnik. Sie werden in der Hälfte der Zeit bis zu<br />
sechsmal so groß bzw. schwer wie wildlebende Lachse und können daher schneller geerntet<br />
werden. Die Lachse stehen in Kanada kurz vor der Marktzulassung, währen gleichzeitig an der<br />
Übertragung des Verfahrens auf Karpfen und Tilapia geforscht wird, um einen Beitrag zur<br />
Versorgung der Menschheit mit tierischen Proteinen zu leisten. Dabei stellt sich aber auch die<br />
Frage, was passiert, wenn die transgenen Lachse in die freie Wildbahn gelangen: Eine<br />
„biologische Verschmutzung“ ist nach heutigem Wissen nicht reversibel.
1.2.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: In ein Wandsegment ist ein „virtuelles Aquarium“ mit zwei<br />
Lachsen in auffällig unterschiedlichen Größen eingelassen. Eine Sensorik registriert die Bewegung<br />
vor dem Bildschirm und steuert die Animation im virtuellen Aquarium. Die Fische kommunizieren<br />
über „Sprechblasen“ und geben zusätzlich Informationen über die Fischart, die Art der genetischen<br />
Veränderung sowie die „Vor- und Nachteile“ der Veränderung für den Fisch bzw. den Züchter.<br />
Erlebnisstation „Kurs Zukunft“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Die Zukunft der Erde ist nicht vorgegeben, sondern liegt in<br />
unseren Händen. Von den Entscheidungen die heute getroffen werden, hängt es ab, wie die Welt<br />
der kommenden Generationen aussehen wird. Voraussetzung für eine lebenswerte Zukunft ist die<br />
bewusste Entscheidung für eine ökologisch nachhaltigere Lebensweise. An jedem Einzelnen liegt<br />
es, das Bewusstsein dafür weiterzutragen und die Verantwortung der kommunalen, regionalen und<br />
nationalen Akteure einzufordern. Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong> kann dabei hilfreich sein.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Die Bewältigung der Zukunft ist alles andere als einfach und dass sie<br />
erfolgreich gelingen wird, ist nicht sicher. In einer globalisierten Welt zunehmender<br />
Interdependenzen ist der Handlungsdruck zur Bewältigung globaler Herausforderungen immens<br />
gewachsen. Wie die Welt mit diesen Herausforderungen umgeht, hängt vom Verhalten der<br />
gesamten Menschheit ab. Dabei kann jeder Einzelne Einfluss nehmen.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Das Forschungsschiff ist die letzte Station der Reise durch die<br />
Themenwelten des <strong>Odysseum</strong>. Auf der Brücke, dem Kommandostand des Schiffes, bietet u.a. die<br />
im Cockpit integrierte Computeranimation „Kurs Zukunft“ den Besuchern die Möglichkeit, selbst<br />
Kapitän zu sein und das Schiff zu steuern. Der Besucher sucht sich sein persönliches Ziel aus,<br />
steuert mit Hilfe von Steuerrad und Gashebel unter Zeitdruck durch eine virtuelle
1.2.<br />
Wasserlandschaft, versucht seinen Kurs zu halten, weicht Hindernissen aus und setzt sich so auf<br />
spielerische und bildhafte Weise mit der Frage auseinander, welche Haltungen und Einstellungen<br />
in Bezug auf die Zukunft wir mitbringen, „wohin also die Reise gehen kann“. Die Fahrt des Schiffes<br />
wird auf eine dem Schiffsbug gegenüberliegende Projektionsfläche (bestehend aus feststehenden<br />
Fahnen) großflächig übertragen und so für viele Besucher auf dem Schiff und im gesamten Raum<br />
sichtbar. Die Fahrt des Schiffes ist als abstrakte Repräsentation möglicher Zukunftsszenarien zu<br />
verstehen, auf die die Besucher zusteuern können (einsame Insel, Hightech-Stadt etc.). Im Cockpit<br />
der Brücke des Schiffes sind weiterhin eine Übersichtskarte mit der Beschreibung der Ziele der<br />
Computeranimation, ein Kompass mit persönlichen Zielen, eine Strömungskarte mit wichtigen<br />
persönlichen Strömungen und Antriebskräften sowie eine Sprechfunkverbindung zu einer nur<br />
akustisch wahrnehmbaren Mannschaft integriert. Auf dem Vorschiff sind zudem Lupen-Exponate<br />
mit „Visionen“ von einem besseren Leben angebracht.<br />
4.2.5 Kinderstadt<br />
Erlebnisstation „Energie aus der Lampe“<br />
Bezug zum Themenschwerpunkt: Die Sonnenenergie, die jeden Tag die Erde erreicht, würde mehr<br />
als das zehntausendfache des menschlichen Energiebedarfs decken 14 . Technologien, die diese<br />
Energie nutzbar machen sind deshalb besonders umweltfreundlich und zukunftsweisend und<br />
könnten mittelfristig die umstrittene Energiegewinnung durch Kohle und Kernkraft ersetzen, was<br />
sich positiv auf den Ressourcenverbrauch und somit den ökologischen <strong>Fußabdruck</strong> auswirken<br />
würde. Solartechnik umfasst neben Photovoltaik auch Solarthermie und Großanlagen wie zum<br />
Beispiel Fallwindkraftwerke.<br />
Wissenschaftlicher Inhalt: Solarzellen sind großflächige Fotodioden, die Lichtenergie in elektrische<br />
Energie umwandeln. Die traditionelle Solarzelle besteht aus einem Grundmaterial, das durch<br />
Dotierung in zwei Gebiete mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften eingeteilt wird. Bei<br />
andauernder Bestrahlung der Solarzelle entsteht zwischen den beiden Schichten ein elektrisches<br />
Feld, das eine Spannung aufbaut.<br />
Beschreibung der Erlebnisstation: Auf dem Exponattisch befinden sich mehrere (einfache)<br />
Solarspielzeuge. Oberhalb der Tischplatte verläuft ein Bügel. In diesem Bügel befinden sich<br />
14 http://www.desertec.org/fileadmin/downloads/DESERTEC-WhiteBook_en_small.pdf, S. 7 (Stand vom 31. Januar<br />
2011).
1.2.<br />
mehrere Lampen. Stellen Kinder Solarspielzeuge (zum Beispiel Hubschrauber, Karussell,<br />
Flugzeug) unter den Lichtbügel, beginnen sich die Spielzeuge zu bewegen.<br />
4.3. PROGRAMMANGEBOTE<br />
Im Rahmen der Aktionsausstellung „Was kostet die Welt? Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong>“ werden<br />
zusätzliche Programme angeboten und zwar die Mission I. Im Folgenden finden Sie Informationen<br />
zu Thema, Zielgruppe, Ablauf, Dauer, etc. der Programmangebote.<br />
4.3.1 MISSION I<br />
Für den Themenbereich „Was kostet die Welt? Der ökologische <strong>Fußabdruck</strong>“ bietet das <strong>Odysseum</strong><br />
Köln eine Mission I für die Klassenstufen 5-7 und 8-10 an. Dabei handelt es sich um eine als<br />
Klassenwettbewerb konzipierte, themenspezifische Rallye durch das <strong>Odysseum</strong>, die in ein<br />
Rollenspiel eingebettet wird. Die Schüler bekommen Bögen mit Aufgaben ausgehändigt, anhand<br />
derer sie sich die Ausstellung und das Themengebiet erschließen.<br />
Die Mission I ist auf 90 Minuten angelegt. Rechnen Sie aber damit, dass Ihre Schüler zusätzlich<br />
Zeit für die Erkundung der Ausstellung benötigen. Wir empfehlen mit einer Besuchszeit von mind.<br />
3 Stunden zu planen.<br />
5 ORGANISATORISCHE HINWEISE / EMPFEHLUNG<br />
Für einen möglichst reibungslosen und erfolgreichen Ablauf Ihres Besuches im <strong>Odysseum</strong> ist es<br />
sinnvoll bei der Vorbereitung einige Aspekte zu beachten. Wir empfehlen Ihnen Ihren Besuch<br />
frühzeitig zu planen und Ihre Klasse vorher im <strong>Odysseum</strong> anzumelden, da gerade in der Zeit vor<br />
Schulferien täglich viele Klassen in unser Haus kommen.<br />
Sachkompetenz: Machen Sie sich im Vorfeld bewusst, welche Ziele Sie mit dem Besuch im<br />
<strong>Odysseum</strong> erreichen wollen. Unsere Ausstellung bietet die Möglichkeit sich je nach ihren<br />
Vorstellungen und den Voraussetzungen Ihrer Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedlich<br />
intensiv mit den behandelten Themengebieten auseinander zu setzen.<br />
Durch die ansprechende und unterhaltsame Aufarbeitung von wissenschaftlichen Themen eignet<br />
sich das <strong>Odysseum</strong> einerseits hervorragend für Ausflüge, bei denen der Erlebnisfaktor im<br />
Mittelpunkt stehen soll, ohne dass das Lernen völlig aus den Augen verloren wird. Ein Aufenthalt
1.2.<br />
im <strong>Odysseum</strong> kann aber auch gezielt als Einstieg und Einführung in ein neues Lehrplanthema oder<br />
zur Vertiefung von bereits im Unterricht behandelten Inhalten genutzt werden. Je nach<br />
Themenschwerpunkt ist es sogar sinnvoll, die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld durch das<br />
Vermitteln des nötigen Grundlagenwissens vorzubereiten.<br />
Welche Exponate zu den einzelnen Themenschwerpunkten gehören, welche wissenschaftlichen<br />
Inhalte sie transportieren und für welches Unterrichtsfach und Altersstufe sie geeignet sind,<br />
können Sie zur Vorbereitung in der Exponatedatenbank auf der der Homepage des <strong>Odysseum</strong>s<br />
recherchieren. Dort finden Sie ebenfalls die Materialien des<br />
Lehrer-für-Lehrer-Programms, in dem Unterrichtsideen und komplette Unterrichtseinheiten zu<br />
bestimmten Themen gesammelt und bereit gestellt werden.<br />
Methodenkompetenz: Für einen optimalen Lernerfolg ist es von Vorteil, wenn die Schülerinnen<br />
und Schüler bereits in Gruppen- und Stationsarbeit geübt sind und sich selbständig in<br />
Themengebiete einarbeiten können. Das <strong>Odysseum</strong> setzt methodisch stark auf interaktive<br />
Elemente und das Prinzip „Learning by doing“. Die Erschließung von Inhalten durch eigeninitiatives<br />
Erkunden der Ausstellung fördert dabei das vernetzte und nachhaltige Lernen. Zur erklärenden<br />
Vertiefung der Inhalte vor Ort stehen ergänzend Informationsprismen an den Erlebnisstationen zur<br />
Verfügung. Natürlich stehen aber auch jederzeit die <strong>Odysseum</strong>- Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter<br />
in der Ausstellung (Scouts) für Sie und Ihre Klasse für Fragen bereit.<br />
Sozialkompetenz: Wir empfehlen Ihnen vor Beginn des Besuches Ihre Klasse mit den<br />
Verhaltensregeln im <strong>Odysseum</strong> vertraut zu machen und den Lageplan unseres Hauses<br />
gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern durchzusprechen, damit diese sich eigenständig<br />
in der Ausstellung orientieren können. Erfahrungsgemäß liegt der Schwerpunkt vieler<br />
Schulbesuche im <strong>Odysseum</strong> auf dem selbstständigen Erkunden der Ausstellung in kleinen<br />
Gruppen.<br />
Für interessierte LehrerInnen und pädagogisches Fachpersonal bietet das <strong>Odysseum</strong> regelmäßig<br />
Lehrerinformationstage an. Diese kostenlose Informationsveranstaltung bietet Ihnen die<br />
Möglichkeit unsere Ausstellung bereits vor dem Besuch mit der Klasse kennen zu lernen und die<br />
Möglichkeiten, die unsere Einrichtung als außerschulischer Lernort bietet, zu entdecken. Die<br />
aktuellen Termine der Veranstaltung können Sie der Homepage des <strong>Odysseum</strong>s entnehmen. Da
1.2.<br />
die Teilnehmerzahl aus organisatorischen Gründen begrenzt ist, bitten wir um eine vorherige<br />
Anmeldung per Internet oder unter der Telefon-Nummer<br />
0221/ 69068241. Wir benötigen dabei folgende Angaben von Ihnen: persönliche Kontaktdaten,<br />
Schule / Einrichtung mit Adressdaten und die Teilnehmerzahl.<br />
Weitere Informationen zum Schulangebot des <strong>Odysseum</strong>s finden Sie auf dem Portal „Schule &<br />
Co.“ auf unserer Homepage unter www.odysseum.de/schule-und-co.html.<br />
6 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN<br />
6.1 Bücher<br />
� Daly, H. E.: Wirtschaft jenseits von Wachstum. Die Volkswirtschaftslehre nachhaltiger<br />
Entwicklung. Salzburg, 1999.<br />
� Diamond, J.: Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen, Frankfurt a. M.,<br />
2005.<br />
� Girardet, H.: Zukunft ist möglich. Wege aus dem Klima-Chaos, Hamburg, 2007.<br />
� Jäger, J.: Was verträgt unsere Erde noch? Wege in die Nachhaltigkeit. Frankfurt a. M.,<br />
2007.<br />
� Meadows, Do., Meadows, De., Randers, J.: Grenzen des Wachstums. Das 30-Jahre-<br />
Update. Signal zum Kurswechsel, Stuttgart, 2008.<br />
� Odum, E. P.: Prinzipien der Ökologie. Lebensräume, Stoffkreisläufe, Wachstumsgrenzen,<br />
Heidelberg, 1991.<br />
� Radermacher, F.-J., Beyers, B.: Welt mit Zukunft. Überleben im 21. Jahrhundert, Hamburg,<br />
2007.<br />
� Reichholf, J. H.: Ende der Artenvielfalt? Gefährdung und Vernichtung von Biodiversität,<br />
Frankfurt a. M., 2008.<br />
� Sachs, W.: Nach uns die Zukunft. Der globale Konflikt um Gerechtigkeit und Ökologie,<br />
Frankfurt a. M. 2003.<br />
� Sieferle, R. P., Krausmann, F., Schandl, H. Winiwarter, V.: Das Ende der Fläche. Zum<br />
gesellschaftlichen Stoffwechsel der Industrialisierung, Köln, Weimar und Wien, 2006.<br />
� von Weizsäcker, E. U., Hargroves, K., Stasinopoulos, P.: Faktor fünf. Die Formel für<br />
nachhaltiges Wachstum, München, 2010.
1.2.<br />
� Wackernagel, M., Beyers, B.: Der Ecological Footprint. Die Welt neu vermessen, Hamburg,<br />
2010.<br />
� Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie: Fair Future. Begrenzte Ressourcen und<br />
globale Gerechtigkeit. München, 2006.<br />
6.2 Internet<br />
� http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/<br />
� http://www.agenda21schulen.nrw.de/page/var/www/downloads/oekologischerfussabdruck_<br />
schule.pdf<br />
� http://www.conservation-<br />
development.net/Projekte/Nachhaltigkeit/DVD_10_Footprint/files/pdf/zur_Serie/10_Footprin<br />
t_de.pdf<br />
� http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_86_oekologischer_fussabruck.pdf<br />
� http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/kologischer_fussabdruck_733.htm<br />
� http://www.uni-<br />
ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/iui.inst.040/Informationsgesellschaft_und_Globalisierung<br />
_I/%C3%96kologischer_Fussabdruck_final2.pdf<br />
� http://www.mein-fussabdruck.at/<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
SK-Stiftung CSC – Cologne Science Center<br />
Gottfried-Hagen-Straße 20<br />
51105 Köln<br />
www.sk-stiftung-csc.de<br />
Dr. Armin Frey, Geschäftsführer und Wissenschaftlicher Leiter (V.i.S.d.P.)<br />
Redaktion:<br />
Julia Maria Schropp, Wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
Sarah Gabel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
Lisa Wagner