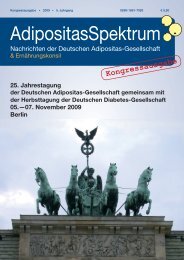LINGUAMED - Adipositas Spektrum
LINGUAMED - Adipositas Spektrum
LINGUAMED - Adipositas Spektrum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Adipositas</strong>. Molekulargenetische Analysen haben bislang zur Identifikation<br />
einer begrenzten Anzahl an bestätigten Genen mit einem Hauptgeneffekt<br />
geführt. Diese Hauptgene haben einen klaren Einfluss auf die Entwicklung<br />
des Phänotyps, allerdings sind die zugrunde liegenden Mutationen selten<br />
und daher von untergeordneter klinischer Bedeutung. Kandidatengenstudien<br />
haben sich in den letzten Jahres als wenig geeignet erwiesen, neue <strong>Adipositas</strong>gene<br />
zu identifizieren. Mittels genomweiter Assoziationsstudien (GWAs),<br />
bei denen bis zu 1.000.000 Einzelnukleotidaustausche (SNPs) pro Patient<br />
untersucht werden, sind in den letzten zwei Jahre verschiedene Gene identifiziert<br />
worden, denen ein polygener Effekt zugeschrieben wird, d. h. jedes<br />
Polygen leistet einen kleinen Beitrag zur Körpergewichtsregulation, erst in<br />
ihrer Gesamtheit können sie die Entstehung einer <strong>Adipositas</strong> bedingen. Das<br />
103I-Allel des V103I-Polymorphismus im Melanokortin-4-Rezeptorgen<br />
(MC4R) wurde als erste polygene Variante mit einem Einfluss auf den BMI<br />
identifiziert; in einer groß angelegten Meta-Analyse konnte gezeigt werden,<br />
dass der Effekt dieses Allels auf den mittleren BMI -0,5 kg/m 2 beträgt.<br />
Anhand einer kürzliche erschienenen Metaanalyse der GWA-und weiteren<br />
Genotypdaten von ca. 90.000 Probanden konnte zusätzlich die Beteiligung<br />
einer Region 188kb 3´ des MC4R an der Gewichtsregulation nachgewiesen<br />
werden. Verschiedene Varianten im ersten Intron des „Fat mass and obesity<br />
associated“ Gen (FTO) tragen zum bisher relevantesten polygenen Effekt bei<br />
der <strong>Adipositas</strong> bei. Dieser Effekt wurde in multiplen Studien bestätigt. Genomweite<br />
Assoziationsstudien werden in naher Zukunft zur Identifizierung<br />
weiterer Polygene führen.<br />
Anforderungen an die Indikation und Nachbetreuung chirurgischer<br />
<strong>Adipositas</strong>therapie aus Sicht der Diätassistenten<br />
Mario Hellbardt<br />
POLIKUM Friedenau, Ernährungsberatung, Berlin, Deutschland<br />
In der ernährungstherapeutischen Praxis stellt sich zunehmend die Frage,<br />
wie Patienten nach einem chirurgischen Eingriff zur Gewichtreduktion<br />
umfassend und nachhaltig betreut werden sollen, nicht nur von Seiten der<br />
Diätassistenten sondern insbesondere auch von Seiten der Patienten. Hier<br />
ergeben sich unterschiedliche Problemstellungen bzw. Anforderungen:<br />
Diätassistenten müssen vor und nach der Operation aktiv in den Prozess der<br />
bariatrischen Behandlung eingebunden werden. Häufig sind die Patienten<br />
vor dem Eingriff nicht ausreichend über die Veränderungen der Essgewohnheiten<br />
und Lebensmitteauswahl aufgeklärt und können diese nur schwer alleine<br />
umsetzen. Erst bei auftretenden Symptomen einer Mangelernährung<br />
finden die Patienten den Weg über den Arzt zur Ernährungsberatung. Daher<br />
ist die ernährungstherapeutische Vor- und Nachbetreuung zwingend notwendig.<br />
Auch auf der Seite der Patienten muss eine Sensibilisierung für das Thema<br />
Ernährung nach Magen-OP stattfinden, da häufig von ihnen angenommen<br />
wird, dass durch den Eingriff das Ziel einer Gewichtsreduktion erreicht<br />
ist. Auch hier leistet eine umfassende ernährungstherapeutische Betreuung<br />
vor und nach der Operation einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der<br />
Maßnahme. Übergreifend sind weitere Anforderungen an die Versorgung<br />
für Patienten nach chirurgischen Eingriffen zur Gewichtsreduktion zu stellen<br />
und umzusetzen: Fortbildung und Vernetzung der Ernährungsfachkräfte,<br />
Erstellen von Qualitätsstandards für die Ernährungstherapie und -beratung<br />
nach adipositas-chirurgischen Eingriffen sowie enge interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
mit allen Fachdisziplinen.<br />
Die Mediendarstellung der <strong>Adipositas</strong>:<br />
eine Analyse deutscher Tageszeitungen<br />
*Anja Hilbert (1), Jens Ried (2)<br />
(1) Philipps-Universität Marburg, Psychologie, Marburg, Deutschland;<br />
(2) Philipps-Universität Marburg, Evangelische Theologie,<br />
Marburg, Deutschland<br />
Zielsetzung: Stigmatisierende Einstellungen gegenüber der <strong>Adipositas</strong><br />
sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Sie sind verbunden mit internalen<br />
Attributionen der <strong>Adipositas</strong> auf ein mutmaßliches Fehlverhalten<br />
der Betroffenen sowie mit einem geringeren Informationsstand über die<br />
<strong>Adipositas</strong>. Neuere Studien weisen darauf hin, dass stigmatisierende<br />
Einstellungen durch eine negative Mediendarstellung der <strong>Adipositas</strong> im<br />
Fernsehen perpetuiert werden könnten. Ziel der vorliegenden Untersuchung<br />
war es daher, die Mediendarstellung der <strong>Adipositas</strong> in deutschen<br />
Printmedien auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Berichterstattung<br />
und der enthaltenen Wertung zu untersuchen. Materialien und Methoden:<br />
Für das Jahr 2006 wurden alle 1563 Ausgaben von insgesamt fünf<br />
der auflagenstärksten überregionalen Qualitäts- und Boulevardzeitungen<br />
sowie regionaler Tageszeiten einer systematischen Stichwortsuche unterzogen.<br />
Die identifizierten 222 Artikel über Übergewicht und <strong>Adipositas</strong><br />
wurden quantitativ-inhaltsanalytisch hinsichtlich definierter, reliabler<br />
Inhalts- und Wertungskategorien ausgewertet. Ergebnisse: Die überregionalen<br />
Zeitungen berichteten vollständiger und mehr dem aktuellen<br />
wissenschaftlichen Stand entsprechend über Prävalenz, Ätiologie, kli-<br />
Eingeladene Vorträge<br />
nische Relevanz und Prävention sowie Behandlung der <strong>Adipositas</strong> als die<br />
Boulevardberichterstattung, während regionale Tageszeitungen eine Mittelstellung<br />
einnahmen. Überregionale Tageszeitungen führten vergleichsweise<br />
häufiger jedoch auch internale Kausalattributionen insbesondere für<br />
fehlgeschlagene Interventionsansätze an. Während sich die Anzahl stigmatisierender<br />
Aussagen zwischen den Zeitungstypen nicht unterschied,<br />
waren stigmatisierende Aussagen in der Boulevardberichterstattung katastrophisierender<br />
und mehr sowie extremer personalisierend gestaltet. Zusammenfassung:<br />
Insgesamt weist die Berichterstattung zur <strong>Adipositas</strong> in<br />
deutschen Tageszeitungen inhaltliche Mängel und die Tendenz zu einer<br />
abwertenden Darstellung auf, die dazu beitragen könnten, das <strong>Adipositas</strong>stigma<br />
aufrechtzuerhalten.<br />
Essverhalten und psychologische Aufrechterhaltungsfaktoren<br />
von Essanfällen im Kindesalter:<br />
eine Ecological Momentary Assessment-Studie<br />
*Anja Hilbert (1), Julia Czaja (1)<br />
(1) Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Psychologie, Marburg,<br />
Deutschland<br />
Zielsetzung: Erste Studienergebnisse zeigen, dass Essanfälle im Kindesalter<br />
in Verbindung mit einer erhöhten Psychopathologie sowie Übergewicht<br />
und <strong>Adipositas</strong> auftreten. Weitgehend unerforscht ist bislang jedoch das Essverhalten<br />
und psychologische Aufrechterhaltungsfaktoren bei Essanfällen<br />
im Kindesalter. Die vorliegende Studie untersucht daher Essverhalten und<br />
psychologische Aufrecherhaltungsfaktoren im natürlichen Lebensumfeld<br />
von 8–13-jährigen Kindern mit versus ohne Essanfälle. Materialien und<br />
Methoden: In einem Ecological Momentary Assessment-Design wurden<br />
60 Kinder mit Essanfällen und 60 Kinder ohne Essanfälle mit Kinderhandys<br />
zu zufälligen Zeiten und vor, während und nach Mahlzeiten über ihre<br />
Stimmungen und Gedanken sowie über ihre Nahrungsaufnahme befragt.<br />
Ergebnisse: Essanfälle traten vor dem Hintergrund einer hochkalorischen,<br />
fett- und proteinreichen Ernährung auf. Während der Essanfälle wurden<br />
mehr Energie und mehr Kohlenhydrate aufgenommen als während regulärer<br />
Mahlzeiten. Hinsichtlich psychologischer Aufrechterhaltungsfaktoren zeigte<br />
sich, dass Essanfälle bei Kindern, weniger deutlich als bei Erwachsenen,<br />
durch allgemeine negative Stimmungen ausgelöst werden, diese jedoch<br />
nicht regulieren. Essanfälle waren hingegen signifikant mit essstörungsspezifischen<br />
negativen Kognitionen assoziiert. Zusammenfassung: Die Ergebnisse<br />
tragen dazu bei, die Essanfallssymptomatik im Kindesalter in ihrem<br />
Bezug zu Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> zu validieren. Die Aufrechterhaltung<br />
von Essanfällen scheint sich im Kindesalter von der im Erwachsenenalter zu<br />
unterscheiden, was in altersspezifschen Störungsmodellen Berücksichtigung<br />
finden sollte.<br />
Prävention von Hochrisiko-Personen durch Lebensstiländerung –<br />
Struktur-Planung mit Inhalten, Partnern, Zuständigkeiten<br />
Reinhart Hoffmann<br />
Deutsche Diabetes Stiftung, München, Deutschland<br />
Ziel: Prävention vor Kuration – das ist die zentrale Forderung, um die<br />
Ausbreitung der chronischen Zivilisationskrankheiten des Metabolischvaskulären<br />
Syndroms – von <strong>Adipositas</strong> über Diabetes bis zu deren Folgeerkrankungen<br />
– einzudämmen. Mit einem Nationalen Präventions-<br />
Programm und dessen flächendeckender Implementierung, von der<br />
frühzeitigen Risiko-Erkennung über machbare Intervention bis hin zu<br />
deren Nachhaltigkeit, ist die Problematik – jedenfalls theoretisch – lösbar.<br />
Die Bildung von Netzwerken, eine Koordination der Angebote und Akteure<br />
sowie ein transparentes Qualitätsmanagement sind Eckpfeiler dieser<br />
Präventionsstruktur. Maßnahmen und Möglichkeiten: Maßgebliche<br />
Experten der Arbeitsgemeinschaft des Typ 2 Diabetes mellitus der Deutschen<br />
Diabetes-Gesellschaft – AG P2, der Deutschen Diabetes-Stiftung –<br />
DDS, des Nationalen Aktionsforums Diabetes mellitus – NAFDM und der<br />
Deutschen <strong>Adipositas</strong> Gesellschaft – DAG haben sich zum Ziel gesetzt,<br />
miteinander eine zielgerichtete Präventions-Struktur aufzubauen. Durch<br />
Integration aller für die Prävention notwendigen Akteure – über das bestehende<br />
Gesundheitssystem hinaus – wird die Basis für flächendeckende<br />
Präventions-Angebote und -Maßnahmen geschaffen. Erst mit einer bestehenden<br />
Struktur und Bündelung von Verhältnis- und Verhaltens-Prävention,<br />
entsteht die Voraussetzung für eine Gesunderhaltungs-Kampagne in<br />
der Bevölkerung. Ergebnisse: Unter dem Dach der Diabetesstiftung DDS<br />
entsteht ein nationales Koordinierungszentrum – Schnittstelle zwischen<br />
Wissenschaft und Praxis, mit dem Fokus auf Qualitätsmanagement. Zusammenfassung:<br />
Prävention vor Kuration: Mit funktionstüchtigen Pilotprojekten<br />
in unterschiedlichen Settings, qualitativ prozessbegleitet durch<br />
das Koordinierungszentrum DDS, soll bis 2010 die Beweisführung für<br />
erfolgreiche Prävention erbracht werden. Eine flächendeckende, für weite<br />
Kreise von Risikopersonen nutzbare Umsetzung sollte danach möglich<br />
sein.<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
19 7