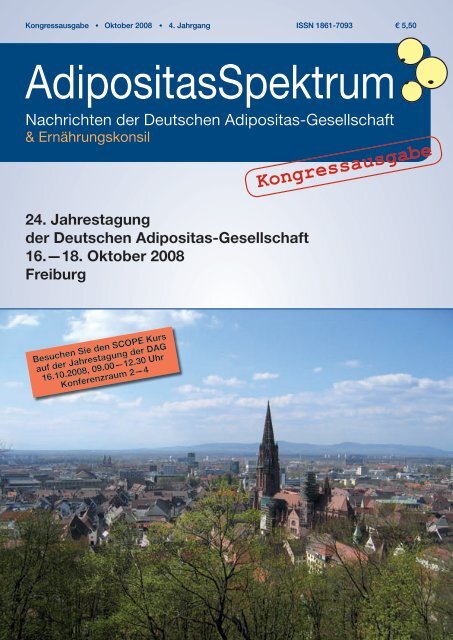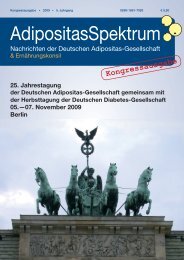LINGUAMED - Adipositas Spektrum
LINGUAMED - Adipositas Spektrum
LINGUAMED - Adipositas Spektrum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang ISSN 1861-7093 € 5,50<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong><br />
Nachrichten der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
& Ernährungskonsil<br />
24. Jahrestagung<br />
der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
16.—18. Oktober 2008<br />
Freiburg<br />
Besuchen Sie den SCOPE Kurs<br />
auf der Jahrestagung der DAG<br />
16.10.2008, 09.00—12.30 Uhr<br />
Konferenzraum 2—4<br />
Kongressausgabe
Der leichte Einstieg in die Insulintherapie: Einstieg: 1-mal täglich Levemir ®<br />
Gewichtsvorteil 2<br />
bei effektiver HbA 1c-Senkung 3–5<br />
in Kombination mit OAD 6<br />
GUT (1,7)<br />
für Handhabung<br />
(ohne Seh- und<br />
Motorikeinschränkung)<br />
Im Test:<br />
6 Insulin-Fertigpens<br />
Ausgabe 9/2006<br />
1. Plank J et al. Diabetes Care 2005;28:1107–1112; Zeit-Wirkprofi l im Vergleich zu NPH-Insulin 2. Fachinformation Levemir ® 3. Philis-Tsimikas A et al. Clinical Therapeutics 2006;28:1569–1581 4. Rosenstock J et al. Diabetologia 2008;<br />
51:408–416 5. Hermansen K et al. Diabetes Care 2006;29:1269–1274 6. Fachinformation Levemir ® . Bei Typ 2 Diabetes zu Beginn der Insulintherapie in Kombination mit oralen Antidiabetika (OAD).<br />
Levemir ® 100 E/ml Injektionslösung in einer Patrone (Penfill ® ). Levemir ® 100 E/ml Injektionslösung in einem Fertigpen (FlexPen ® ). Wirkstoff: Insulindetemir. Zusam mensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil:<br />
100 E/ml Insulindetemir, gentechnisch hergestellt aus rekombinanter DNS in Saccharomyces cerevisiae. Sonstige Bestandteile: Glycerol, Phenol, Metacresol, Zinkacetat, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumchlorid, Salzsäure, Natriumhydroxid,<br />
Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Diabetes mellitus. Art der Anwendung: Levemir ® 100 E/ml Injektionslösung in einer Patrone ist für die Anwendung mit den Insulininjektionssystemen von Novo Nordisk und NovoFine ®<br />
Injektionsnadeln entwickelt worden. Zur Verwendung von Levemir ® im FlexPen ® sind NovoFine ® Injektionsnadeln mit einer Länge von 8 mm oder kürzer vorgesehen. Gegenanzeigen: Hypoglykämie, Überempfindlichkeit gegen Insulindetemir oder<br />
einen der sonstigen Bestandteile. Es liegen keine klinischen Erfahrungen über die Verwendung von Insulindetemir bei Schwangeren oder während der Stillzeit vor. Bei der Anwendung während Schwangerschaft oder Stillzeit ist Vorsicht geboten.<br />
Nebenwirkungen: Hypoglykämien. Sehstörungen oder Ödeme zu Beginn der Behandlung. Reaktionen an der Injektionsstelle (Rötung, Schwellung, Entzündungen, Juckreiz und Blutergüsse). Lipodystrophien an der Injektionsstelle bei zu häufiger<br />
Injektion an der gleichen Stelle. Allergische Reaktionen, potenziell allergische Reaktionen, Urtikaria und Ausschläge, sehr selten generalisierte Überempfindlichkeitsreaktionen, die lebensbedrohlich sein können. Selten Sensibilitätsstörungen in Armen<br />
und Beinen bei schneller Verbesserung der Blutzuckereinstellung. Verschreibungspflichtig.<br />
Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Dänemark. Stand: Juli 2008<br />
Levemir ® , Penfill ® , FlexPen ® und NovoFine ® sind eingetragene Marken der Novo Nordisk A/S, Dänemark.
Inhalt<br />
IV Aktuelles<br />
Neue Antidiabetika mit<br />
multiplen protektiven Effekten<br />
V Im Brennpunkt<br />
<strong>Adipositas</strong>chirurgie — Auflagen<br />
der Krankenkassen oftmals<br />
wissenschaftlich sinnlos<br />
und kostspielig<br />
X Hintergrund<br />
Lipidmuster bestimmt kardiometabolisches<br />
Risiko<br />
Der Besuch lohnt sich<br />
XI Mitteilungen der<br />
Gesellschaft<br />
„Hoodia“ - Präparate zur<br />
Gewichtsabnahme nicht<br />
empfehlenswert<br />
Die 7 Sydney-Prinzipien<br />
XIV Nachrichten<br />
aus der Industrie<br />
Zuverlässige Identifikation<br />
des diabetischen Fußsyndroms<br />
XV Hintergrund<br />
BMBF-Kompetenznetz<br />
<strong>Adipositas</strong><br />
4 Abstracts<br />
Themenübersicht<br />
48 Referenten<br />
51 Service<br />
Grußwort der Präsidenten<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
nachdem wir uns mittlerweile auf einen interessanten und erfolgreichen<br />
Kongress freuen können, hofft die Deutsche <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft (DAG)<br />
zusammen mit dem verantwortlichen Veranstaltungskomitee sowie dem diesjährigen<br />
Tagungspräsident, dass Sie gerne und zahlreich unserer Einladung<br />
zum 16.-18. Oktober 2008 ins Konzerthaus nach Freiburg folgen. Hier wollen<br />
wir Sie nicht nur zum Tagungsthema „<strong>Adipositas</strong> als Krankheit“ aktuell<br />
informieren, sondern auch mit Ihnen zusammen neue Wege finden, um in der<br />
Prävention und Therapie der <strong>Adipositas</strong> erfolgreicher als bisher zu sein.<br />
Angesprochen sind nach wie vor alle, die sich um das „Gesundheitsproblem<br />
Nummer 1“ in unserem Land kümmern wollen: Ärzte und Ernährungswissenschaftler,<br />
Ernährungsberater und Sporttherapeuten, Psychologen<br />
und Pädagogen, Vereinsmanager und Politiker. Beim Wissen um die<br />
nachhaltige Wirkung des Lebensstils auf die Entwicklung von Übergewicht<br />
und Begleiterkrankungen stehen Ernährung und Bewegung so stark wie<br />
noch nie im Focus des Gesundheitsbewusstseins. Und um für die Zukunft<br />
gesund und normalgewichtig sein so wollen, müssen wir zurück zu mehr<br />
Bewegung und natürlichem Verhalten, zu mehr sozialer und ökologischer<br />
Verantwortung. Die gesundheitlichen Auswirkungen unseres adipogenen<br />
Lebensstils sind uns bekannt. Eingebettet in eine Lebenswelt mit hohem<br />
Lebensmittelangebot und mit einer hohen Verfügbarkeit von energiesparenden<br />
Verhaltensweisen sind körperliche Inaktivität und Fehlernährung<br />
heute nicht nur ein Beispiel für unsere Konsumgewohnheiten, sondern auch<br />
die bedeutendsten gesundheitlichen Risikofaktoren.<br />
So kommen wir nicht umhin, Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> als Anpassung<br />
an eine Umwelt des Überflusses und Wohlstandes zu sehen. Wir haben damit<br />
aber auch die Verpflichtung, die <strong>Adipositas</strong> in ihrer gesundheitlichen Konsequenz<br />
anders als bisher zu bewerten und als Krankheit einzustufen. Trotzdem<br />
dürfen wir nicht aufhören, darauf zu zielen, dass Gesundheit lernbar und<br />
Verhalten korrigierbar sind. Gesunde Ernährung und vermehrte körperliche<br />
Freizeitaktivität tragen nachweislich dazu bei, Übergewicht zu verhindern<br />
und krankmachende Risikofaktoren sowie das Auftreten von Folgeerkrankungen<br />
zu reduzieren. Als interdisziplinäre Fachgesellschaft setzt sich die<br />
DAG seit langem dafür ein, Gesundheitsziele Verhaltens orientiert und praxisnah<br />
anzugehen. „Gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ als Schlüssel<br />
für eine bessere Lebensqualität und Gesundheitsprognose ist deshalb eine<br />
Strategie, auf die wir uns bereits gemeinsam geeinigt haben. Die von DAG,<br />
NAFDM, BMG und BMVEL formulierten Aktionspläne gegen Übergewicht<br />
und Diabetes sind mit ihren Forderungen nicht nur ein wichtiges Thema unserer<br />
diesjährigen Veranstaltung, sondern ein wichtiger Schritt in eine gesundere<br />
und hoffentlich normalgewichtige Zukunft.<br />
Prof. Manfred J. Müller, Prof. Aloys Berg,<br />
Präsident der DAG Tagungspräsident<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
3
Aktuelles<br />
Neue Antidiabetika mit multiplen protektiven Effekten<br />
Rom. Eine neue Generation<br />
von Antidiabetika<br />
erweitert die Behandlungsmöglichkeiten<br />
von<br />
Diabetikern. Mit ihrer Wirkung auf<br />
das System der Inkretinhormone<br />
beeinflussen sie den Glukosestoffwechsel<br />
und haben darüber hinaus<br />
den Vorteil einer geringeren Hypoglykämierate<br />
sowie der fehlenden<br />
Gewichtszunahme beziehungsweise<br />
sogar einer Gewichtsreduktion. Zu<br />
den Analoga, die einerseits wie das<br />
Inkretinhormon GLP-1 wirken, andererseits<br />
aber nicht so rasch inaktiviert<br />
werden und deshalb eine längere<br />
Halbwertszeit besitzen, gehört<br />
das Inkretinmimetikum Liraglutid.<br />
Auf der 44. Jahrestagung der EASD<br />
in Rom wurde das wissenschaftliche<br />
Material dieser<br />
neuen Substanz präsentiert.<br />
Im so genannten LEAD-<br />
Programm (Liraglutide Effect<br />
and Action in Diabetes)<br />
wurde Liraglutid in Kombination<br />
mit Glimepirid bzw.<br />
Metformin (LEAD 1 und<br />
LEAD 2) sowie in Kombination<br />
mit Metformin und<br />
Rosiglitazon (LEAD 4) und<br />
in LEAD 5 mit der Standardtherapie<br />
(Sufonylharnstoff, Metformin und<br />
Insulinglargin) verglichen. Schließlich<br />
wurde in der LEAD 3-Studie<br />
die Wirksamkeit von Liraglutid als<br />
Monotherapie nachgewiesen. Das<br />
gesamte Studienprogramm umfasste<br />
rund 4.000 Menschen mit<br />
Typ-2-Diabetes mit schlecht eingestelltem<br />
Blutzucker.<br />
Insgesamt konnten die mit dem<br />
humanen-GLP-1 Analogon Liraglutid<br />
behandelten Patienten ihren<br />
HbA1c-Level im Durchschnitt um 1,6<br />
Prozent senken, und mehr Patienten<br />
erreichten die HbA1c-Grenzwerte<br />
als diejenigen mit den Vergleichsubstanzen.<br />
Bei jenen, die Liraglutid<br />
als Monotherapie erhielten, wurde<br />
eine signifikant bessere Blutzuckerkontrolle<br />
als mit Glimepirid erzielt.<br />
Dabei erreichten bis zu 51 Prozent der<br />
Patienten, die mit Liraglutid behandelt<br />
wurden, einen HbA1c-Wert von<br />
unter sieben Prozent im Vergleich zu<br />
28 Prozent in der Glimepirid-Gruppe.<br />
Durch die Liraglutid-Behandlung<br />
wurden Nüchternblutzucker<br />
und postprandiale Blutzuckerspiegel<br />
genauso wie der HbA1c gesenkt<br />
und das Körpergewicht verringert.<br />
Die Gewichtsreduktion betrug in<br />
der Kombination mit Metformin<br />
bis zu 2,8 Kilogramm. Zudem erzielte<br />
die Kombination mit Metformin<br />
und Rosiglitazon in der<br />
Liraglutid-Gruppe eine Verbesserung<br />
des systolischen Blutdrucks<br />
von bis zu 6,7 mmHg. Patienten, die<br />
mit Liraglutid behandelt wurden,<br />
hatten eine sehr geringe Hypogly-<br />
GLP-1-Mechanismen<br />
kämie-Rate. Insgesamt wurde das<br />
humane-GLP-1 Analogon als Monotherapie<br />
gut vertragen. Die häufigsten<br />
Nebenwirkungen betrafen<br />
Übelkeit.<br />
Der Diabetes mellitus Typ 2 zählt<br />
zu den Hauptrisikofaktoren für die<br />
Entstehung einer Mikro- und Makroangiopathie<br />
und rund 80 Prozent<br />
der Patienten mit Diabetes mellitus<br />
Typ 2 sterben an Gefäßkomplikationen.<br />
Insbesondere die chronisch<br />
schlechte Blutzuckereinstellung mit<br />
hohen HbA1c-Werten wird für die raschere<br />
Entstehung und Ausprägung<br />
der Atherosklerose verantwortlich<br />
gemacht. Dabei ist die Hyperglykämie<br />
direkt mit der verstärkten<br />
Produktion von Sauerstoffradikalen<br />
assoziiert, die zu einer exzessiven<br />
inflammatorisch-fibroproliferativen<br />
Reaktion des Gefäßendothels führt.<br />
IV4<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Frühere Studien deuteten an,<br />
dass GLP-1-Rezeptor Agonisten die<br />
endotheliale Dysfunktion bei Patienten<br />
mit Diabetes mellitus und<br />
koronarer Erkrankung verbessern.<br />
So verbessert z. B. natürliches humanes-GLP-1<br />
eine schwere Linksherzinsuffizienz<br />
bei Patienten nach<br />
Myokardinfarkt. Im Tierversuch<br />
schützt GLP-1 vor Myokardinfarkt<br />
am isolierten und intakten Rattenherz.<br />
Möglicherweise erfolgt die<br />
protektive Wirkung über die Aktivierung<br />
multipler Pro-Survival-<br />
Kinasen. Ebenfalls im Tiermodell<br />
konnte die dosisabhängige Beeinflussung<br />
des Gefäßvolumens durch<br />
GLP-1 nachgewiesen werden.<br />
Auf jeden Fall erschließt sich aus<br />
diesen Daten ein besonderes<br />
therapeutisches Potential<br />
dieser Medikamentenklasse.<br />
Liraglutid führt demnach<br />
zur Verbesserung von<br />
Markern der Herzkreislauf-<br />
Risiken ebenso wie zur signifikanten<br />
Senkung der<br />
Biomarker der endothelen<br />
Dysfunktion, des Blutdrucks<br />
und der Triglyzeride.<br />
In einem in vitro Modell<br />
zur Darstellung der menschlichen<br />
Endothelfunktion hemmt die Gabe<br />
des humanen-GLP-1 Analogons die<br />
Glukose-vermittelte Induktion von<br />
PAI-1 und die Expression der Adhäsionsmoleküle<br />
VCAM-1 und ICAM-<br />
1. Auf diese Weise hat Liraglutid<br />
einen möglichen hemmenden Effekt<br />
auf die Glukose vemittelte Endotheldysfunktion<br />
bei Diabetes mellitus.<br />
Eine präklinische Untersuchung im<br />
Tiermodell an Mäusen hat gezeigt,<br />
dass Liraglutid die kardiale Funktion<br />
und auch die Überlebensrate nach<br />
Infarkt verbessert. Diese Daten zeigen,<br />
dass die Behandlung mit einem<br />
GLP-1-Rezeptor Agonisten wie Liraglutid<br />
nicht nur die Blutzuckerspiegel<br />
günstig beeinflusst, sondern<br />
auch günstige Wirkungen auf die endotheliale<br />
Funktion bei Diabetikern<br />
zu erwarten sind. -rk-
ehr geehrter Herr Potrafke, wir<br />
erhielten eine Durchschrift<br />
des an Herrn Dr. Schuster<br />
gerichteten Berichts, in dem<br />
Herr Professor Dr. Wirth zu einem<br />
Gutachten des Medizinischen Dienstes<br />
der Krankenversicherung (MDK) vom<br />
12.09.2005 Stellung nimmt.<br />
Seinerzeit wurde die Notwendigkeit<br />
eines Magenbandes durch den MDK<br />
nicht bestätigt und Ihr Antrag auf Kostenübernahme<br />
mit Schreiben vom<br />
20.09.05 abgelehnt. Dieser Bescheid ist<br />
bindend, die Stellungnahme von Herrn<br />
Professor Dr. Wirth kann - drei Jahre<br />
später - nicht als Widerspruch gewertet<br />
werden.<br />
Sofern Sie erneut einen Antrag auf<br />
Kostenübernahme für ein Magenband<br />
stellen möchten, bitten wir Sie, uns<br />
diesen mit folgenden Unterlagen einzureichen:<br />
• Ihre Darstellung zum bisherigen<br />
Gewichtsverlauf und bisherigen<br />
Therapieversuchen einschließlich<br />
Angaben zu Dauer der Behand-<br />
lungen und Gewichtsverlust.<br />
• Ernährungstagebuch über 14 Tage,<br />
wobei eine mengenmäßige Anga-<br />
be notwendig ist, auch Getränke,<br />
inklusive Gewichtsangaben.<br />
• Ihre Angaben zur regelmäßigen<br />
medikamentösen Therapie.<br />
• Ausschluss endokrinologischer oder<br />
anderer Ursachen der <strong>Adipositas</strong>.<br />
• Bescheinigung über durchgeführte<br />
verhaltenstherapeutische Behand-<br />
lung mit Angaben zum Therapie-<br />
verlauf und Einschätzung der<br />
Compliance.<br />
Im Brennpunkt<br />
<strong>Adipositas</strong>chirurgie - Auflagen der Krankenkassen<br />
oftmals wissenschaftlich sinnlos und kostspielig<br />
Relativ viele Patienten mit extremer <strong>Adipositas</strong> werden mit Auflagen Ihrer Krankenkassen konfrontiert, bei denen<br />
oftmals auch ihre betreuenden Ärzte, die einen chirurgischen Eingriff ins Auge fassen, nicht weiter wissen. Die<br />
zeitlich aufwändigen und kostspieligen Forderungen, die Krankenkassen machen, entsprechen in vieler Hinsicht<br />
nicht den Empfehlungen von Experten und haben wohl nur das Ziel, den anstehenden chirurgischen Eingriff zu<br />
erschweren oder gar abzuwenden. Denn die jüngsten Publikationen zu diesem Thema belegen, dass die meisten<br />
Forderungen fachlich nicht `gerechtfertigt´ sind. Verfolgen Sie den Briefwechsel zu diesem Thema.<br />
Auffassung einer Krankenkasse: BEK an den Patienten<br />
S<br />
ehr geehrter Herr Dr. Strippel,<br />
mein Anliegen betrifft die<br />
Beurteilung der Indikation<br />
für chirurgische Maßnahmen<br />
bei <strong>Adipositas</strong>.<br />
Da sich relativ viele Patienten mit<br />
extremer <strong>Adipositas</strong> an mich wenden<br />
und die zuweisenden Ärzte im<br />
Regelfall einen chirurgischen Eingriff<br />
ins Auge fassen, habe ich viel<br />
Kontakt mit Krankenkassen und deren<br />
Stellungnahmen bzw. denen des<br />
MDK Die Formulierungen im beigelegten<br />
Schreiben der Barmer Ersatzkasse<br />
finde ich häufig. Ich gehe daher<br />
davon aus, dass der MDS den MDK<br />
diese Informationen vermittelt hat.<br />
Zur Indikation eines adpositaschirurgischen<br />
Eingriffes hat sich die<br />
Fachgesellschaft, die Deutsche <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
(DAG) auf ihrer<br />
website (www.adipositas-gesellschaft.de)<br />
in der Version von 2007<br />
geäußert Das Bundessozialgericht<br />
hat in seinem Urteil vom 19.02.2003<br />
im wesentlichen die Vorstellung<br />
der Deutschen<br />
<strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
übernommen, macht jedoch<br />
zusätzliche Ausführungen.<br />
Ich gehe daher davon<br />
aus, dass die Leitlinie<br />
der DAG und das Urteil<br />
vom BSG grundliegende<br />
Orientierungen bieten.<br />
Vor diesem Hintergrund<br />
und evidenzbasierter wissenschaftlicher<br />
Kenntnisse diskutiere ich im<br />
Folgenden die Ausführungen der<br />
Barmer:<br />
Gewichtsverlauf, bisherige<br />
Therapie<br />
Diese Informationen sind von großer<br />
Bedeutung. Sie reflektieren die<br />
Selbstbeobachtung des Patienten,<br />
• Bescheinigung über aktuell durch-<br />
geführte Ernährungsberatung in-<br />
klusive Stellungnahme zu Compli-<br />
ance und Motivation.<br />
• Fachpsychiatrische Stellungnahme<br />
zum Ausschluss von Essstörungen<br />
und anderen psychiatrischen Kon-<br />
traindikationen (Entlassungsbe-<br />
richt der Uniklinik Münster vom<br />
13.11.07 bis 05.02.08)<br />
Bitte teilen Sie uns dann auch mit,<br />
in welchem Krankenhaus der Eingriff<br />
durchgeführt werden soll.<br />
Herr Dr. Schuster sowie Herr Professor<br />
Dr. Wirth erhalten eine Durchschrift<br />
dieses Schreibens.<br />
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen<br />
selbstverständlich gerne zur Verfügung.<br />
Stellungnahme: Professor Dr. Alfred Wirth an den MDS<br />
S<br />
eine wichtige Voraussetzung für therapeutisches<br />
Handeln bei Adipösen.<br />
Ernährungstagebuch<br />
Die Führung eines Ernährungstagebuches<br />
ist<br />
ebenfalls im Rahmen der<br />
Selbstbeobachtung ein<br />
wichtiges therapeutisches<br />
Element. Leider ist ein<br />
Ernährungstagebuch ein<br />
Professor Alfred Wirth, ziemlich unzureichendes<br />
Bad Rothenfelde<br />
diagnostisches Instrument.<br />
Hintergrund ist, dass Adipöse<br />
im Regelfall eine zu geringe Energiemenge<br />
dokumentieren. Der <strong>Adipositas</strong>-Experte<br />
Prentice hat mit seinem<br />
Team im Jahr 1986 erstmals überzeugend<br />
dargestellt, dass Adipöse ca. 40<br />
Prozent zu wenig Energie berichten.<br />
Dieses Ergebnis wurde 1992 von<br />
Lichtman bestätigt, inzwischen auch<br />
von anderen Arbeitsgruppen. Diese<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
5V
Im Brennpunkt<br />
Tatsache ist seit vielen Jahren in der<br />
Adiposiologie akzeptiert. Sie hat zur<br />
Folge, dass <strong>Adipositas</strong>-Experten keine<br />
Anstrengung unternehmen, die Energieaufnahme<br />
quantitativ im Einzelfall<br />
zur Beurteilung therapeutischer Konsequenzen<br />
zu ermitteln. Die Energieaufnahme<br />
eines Patienten ermittelt<br />
man, in dem man den Energieverbrauch<br />
misst. Bei Gewichtskonstanz<br />
(im steady-state) ist Energieverbrauch<br />
= Energieaufnahme. Einzelheiten der<br />
Zusammenhänge habe ich in meinem<br />
Buch „<strong>Adipositas</strong>: Ätiologie, Folgekrankheiten,<br />
Diagnostik, Therapie“,<br />
Springer-Verlag, 3. Auflage 2008 auf<br />
den Seiten 85-92 dargestellt. Die Auflage<br />
der Barmer, der Patient möge ein<br />
Ernährungstagebuch über 14 Tage<br />
führen, ist für die Indiaktionsentscheidung<br />
zu einem adipositas-chirurgischen<br />
Eingriff irrelevant.<br />
Pharmakotherapie<br />
Die 3 auf dem Markt befindlichen<br />
effektiven Pharmaka Orlistat, Sibutramin<br />
und Rimonabant reduzieren das<br />
Körpergewicht im Mittel zwischen 3<br />
und 6 kg. Bei extrem Adipösen besteht<br />
im Regelfall ein Therapieziel mit<br />
einer Gewichtsabnahme von mehr als<br />
20 kg; eine Pharmakotherapie muss<br />
daher bei dieser Klientel als nicht ausreichend<br />
charakterisiert werden.<br />
Abgesehen davon erstatten die<br />
gesetzlichen Krankenkassen diese<br />
Pharmaka nicht, da sie den § 34a im<br />
SGB V rigide auslegen. Mir ist daher<br />
unverständlich, weshalb nach der<br />
Pharmakotherapie gefragt wird.<br />
Ausschluss anderer Ursachen<br />
Grundsätzlich muss bei jedem Adipösen<br />
eine Hypthyreose ausgeschlossen<br />
werden, was mittels einer Blut-<br />
analyse und der Messung von basalem<br />
TSH gelingt. Diese Untersuchung<br />
kann von jedem niedergelassenen<br />
Arzt simpel und einfach durchgeführt<br />
werden. Selbstverständlich muss sich<br />
jeder Arzt fragen, ob es weitere Ursachen<br />
für eine <strong>Adipositas</strong> gibt. Dies<br />
können Medikamente oder auch andere<br />
seltene Krankheiten sein (Seite<br />
120-127 in „<strong>Adipositas</strong>“). Keinesfalls<br />
ist es jedoch gerechtfertigt, wie es regelmäßig<br />
geschieht, dass die Patienten<br />
die Auflage erhalten, sich bei einem<br />
Endokrinologen untersuchen zu lassen.<br />
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit<br />
sollten daher die Krankenkassen<br />
unbedingt auf diese Auflage verzichten.<br />
Die Abklärung einer endokrinologischen<br />
Ursache wird von der DAG<br />
in der Leitlinie nicht gefordert.<br />
Verhaltenstherapeutische<br />
Behandlung<br />
Die Vorlage einer Bescheinigung für<br />
eine solche therapeutische Maßnahme<br />
kann nur den Hintergrund haben, dass<br />
inzwischen eine verhaltenstherapeutische<br />
Behandlung der <strong>Adipositas</strong> erfolgt<br />
ist. Die <strong>Adipositas</strong> ist grundsätzlich<br />
keine psychische Erkrankung und<br />
bedarf keiner Psychotherapie. Adipöse<br />
sind psychisch gesehen Menschen wie<br />
Nicht-Adipöse mit dem Unterschied,<br />
dass Depressivität und Ängstlichkeit<br />
bei ihnen häufiger vorkommen.<br />
Depressivität und Ängstlichkeit<br />
sind im Regelfall Ausdruck des beeinträchtigten<br />
Selbstwertgefühls und<br />
gestörten Body-Images; sie werden<br />
durch Gewichtsabnahme im Regelfall<br />
korrigiert Für eine Psychotherapie<br />
kommen grundsätzlich nur Patienten<br />
mit einer Psychopathologie<br />
und einer Ess-Störung im Sinne<br />
eines binge eating in Frage; das sind<br />
ca. fünf bis zehn Prozent aller Adipösen,<br />
bei extrem Adipösen ist das<br />
binge eating jedoch häufiger.<br />
Wenn Patienten mit binge eating<br />
psychotherapeutisch behandelt werden,<br />
kommt es häufig zu einer Reduktion<br />
der Essanfälle, einer Besserung<br />
der Stressbewältigung, einer<br />
Steigerung der sozialen Kompetenz<br />
und einer Abnahme von intra- und<br />
interpsychischer Probleme. „Die<br />
Annahme jedoch, dass eine Besserung<br />
psychischer Symptome eine<br />
Gewichtsabnahme nach sich zieht,<br />
bestätigt sich nicht“, wie Herr Professor<br />
Herpertz im Deutschen Ärzteblatt<br />
2003 ausführte. Die Auflage, eine<br />
Bescheinigung über stattgehabte Verhaltenstherapie<br />
beizuholen, impliziert<br />
die Vorstellung, dass jeder Adipöse<br />
vor einem adipositas-chirurgischen<br />
Eingriff psychotherapeutisch behandelt<br />
werden muss, was wissenschaftlich<br />
in keiner Weise gerechtfertigt ist.<br />
Dies wird selbstverständlich von der<br />
DAG in der Leitlinie nicht gefordert.<br />
6 <strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
VI<br />
Ernährungsberatungen<br />
Das Vorlegen von Bescheinigungen<br />
über durchgeführte Ernährungsberatungen<br />
macht Sinn, da jeder Adipöse<br />
vor einem adipositas-chirurgischen<br />
Eingriff fachkundig ernährungsmedizinisch<br />
beraten sein muss. Die Barmer<br />
fordert weitere Angaben vom Ernährungsberater<br />
zur Compliance und<br />
Motivation. Bei einem extrem Adipösen<br />
besteht auch dann die Indikation<br />
für einen adipositas-chirurgischen<br />
Eingriff, wenn er nicht complianed<br />
und nicht motiviert zur Ernährungsumstellung<br />
und zur vermehrten körperlichen<br />
Aktivität ist. Das BSG führt<br />
im Urteil vom 19.02.2003 unmissverständlich<br />
aus, dass für einen solchen<br />
Eingriff entscheidend die adipositasassoziierten<br />
Krankheiten sind. Ist der<br />
Patient aufgrund der <strong>Adipositas</strong> und<br />
den damit verbundenen Folgen krank,<br />
besteht die Indikation für eine chirurgische<br />
Maßnahme. Das BSG lehnt<br />
sich bei dieser Sicht an vergleichbare<br />
Urteile bei Rauchern oder Alkoholi-<br />
kern an. Auch rauchende und alkoholkranke<br />
Menschen werden in unserem<br />
Gesundheitssystem behandelt,<br />
auch wenn Zigarettenrauch und Alkohol<br />
den Therapieerfolg mindern.<br />
Fachpsychiatrische<br />
Stellungnahme<br />
Die Barmer fordert von jedem<br />
Patienten eine fachpsychiatrische<br />
Stellungnahme zum Ausschluss von<br />
Ess-Störungen und anderen psychiatrischen<br />
Kontraindikationen.<br />
Die DAG empfiehlt in ihrer Leitlinie,<br />
dass eine solche Untersuchung<br />
nur „bei Patienten mit Verdacht auf<br />
Depression,Psychose, Suchterkrankung<br />
oder Ess-Störung wie z.B.<br />
binge eating stattfinden müsse, nicht<br />
jedoch bei jedem Patienten.“<br />
Die vielen, zeitlich aufwändigen und<br />
kostspieligen Auflagen, die Krankenkassen<br />
Kandidaten für einen adipositas-chirurgischen<br />
Eingriff machen,<br />
entsprechen in vieler Hinsicht nicht<br />
den Empfehlungen von Experten und<br />
Fachgesellschaften. Fragt man sich<br />
nach der Absicht solcher Auflagen,<br />
gewinnt man den Eindruck, dass man<br />
das Procedere für einen anstehenden<br />
chirurgischen Eingriff erschweren<br />
will mit dem Ziel, eine solche Maß-
nahme letztlich abzuwenden. Diese<br />
Sicht halte ich nicht für eine Unterstellung,<br />
da auch den Ärzten des MDK<br />
bzw. dem MDS nicht entgangen sein<br />
dürfte, dass die meisten Auflagen<br />
fachlich nicht gerechtfertigt sind.<br />
Anliegen meines Schreibens ist,<br />
diese Vorgaben des MDS bzw. des<br />
Kommentar von Professor Dr. Rudolf A. Weiner<br />
I<br />
n der vorliegenden Stellungnahme<br />
von Professor A. Wirth<br />
wird in einer einmalig prägnanten<br />
Form auf alle relevanten<br />
Hürden in der Genehmigung<br />
<strong>Adipositas</strong>-chirurgischer Eingriffe in<br />
Deutschland Stellung genommen, die<br />
sich auf einem fundierten und langjährigen<br />
Kenntnisstand auf dem Gebiet<br />
der <strong>Adipositas</strong>-Therapie begründen.<br />
Professor Dr. A. Wirth zählt zu den<br />
anerkannten Experten auf dem Gebiet<br />
der <strong>Adipositas</strong>-Forschung<br />
und -Therapie und ist ein<br />
Senator der deutschen Fachgesellschaft<br />
für <strong>Adipositas</strong>.<br />
Wir wissen heute, dass<br />
beim Auftreten von Übergewicht<br />
aus unterschiedlichen<br />
Gründen in verschiedenen<br />
Lebensphasen ein Regula-<br />
tionsmechanismus einsetzt,<br />
der nur durch eine konsequente<br />
Lebensumstellung<br />
die Entwicklung einer <strong>Adipositas</strong> verhindern<br />
kann. Ein Übergewicht von<br />
35 bis 40 kg Fettmasse und mehr lässt<br />
sich mit konservativen Therapieansätzen<br />
nicht mehr dauerhaft reduzieren.<br />
Etablierte Therapieprogramme<br />
konservativer Art bei Patienten mit<br />
<strong>Adipositas</strong> Grad II und III versagen<br />
auf lange Sicht. Pharmakotherapeutische<br />
Ansätze erreichen Gewichtsverluste<br />
von 6 bis 9 kg pro Jahr und<br />
sind daher, unabhängig von den unerwünschten<br />
Nebenwirkungen, bei<br />
Übergewichten von 40 bis 100 oder<br />
mehr Kilogramm weit davon entfernt,<br />
als effektives Behandlungskonzept zu<br />
gelten. Die Entwicklung neuer pharmakologischer<br />
Ansätze scheint nicht<br />
in Sicht und weit davon entfernt, Gewichtsreduktionen<br />
von 20, 40 oder<br />
60 kg herbeizuführen.<br />
Die besondere medizinische Notwendigkeit<br />
der Gewichtsreduktion<br />
besteht jedoch in der Behandlung der<br />
Professor Rudolf A.<br />
Weiner, Frankfurt<br />
MDK zu revidieren. Ich würde mich<br />
daher freuen, wenn Sie beim MDS<br />
eine diesbezügliche Diskussion in<br />
die Wege leiten würden. In der Vergangenheit<br />
hat eine Diskussion zu<br />
adipositas-chirurgischen Maßnahmen<br />
beim MDS bereits stattgefunden.<br />
Im Jahre 2001 war ich mit einer<br />
<strong>Adipositas</strong>-assoziierten Erkrankungen,<br />
die sich ohne eine drastische Verringerung<br />
des Körpergewichtes nur<br />
symptomatisch, unzureichend, extrem<br />
kosteneffektiv und letztendlich nur unzureichend<br />
behandeln lassen. Bluthochdruck,<br />
Diabetes mellitus, Schlafapnoe<br />
und viele andere Folgeerkrankungen<br />
sind wirksam nur durch die drastische<br />
Gewichtsreduktion zu beseitigen oder<br />
besser zu führen. Der Diabetes mellitus<br />
stellt dabei eine besondere Herausforderung<br />
dar, da er infolge der<br />
<strong>Adipositas</strong> zu einem ökonomischen<br />
Desaster für jede<br />
Volkswirtschaft führt.<br />
Aus dieser Erkenntnislage<br />
heraus ist es völlig unverständlich,<br />
dass die Kostenträger,<br />
d.h. die Krankenkassen<br />
und in ihrem Auftrag<br />
die medizinischen Dienste<br />
der Krankenkassen, wissenschaftlich<br />
nicht begründbare<br />
Hürden aufstellen, um die letzte effektive<br />
Behandlungsmöglichkeit und damit<br />
eine Umkehr für die betroffenen morbid-adipösen<br />
Patienten mit oder ohne<br />
bereits bestehende Folgeerkrankungen<br />
zu genehmigen. Es gibt medizinisch<br />
und gesundheitspolitisch begründbare<br />
Forderungen an den Patienten, die jedoch,<br />
wie von Herrn Wirth dargestellt,<br />
sich auf wenige Fakten beschränken.<br />
Die Mehrzahl der aufgestellten Forderungen<br />
sind wissenschaftlich nicht begründbar<br />
und nicht mit den Leitlinien<br />
der Fachgesellschaften in Einklang<br />
zu bringen. Hier muss ein Umdenken<br />
einsetzen, denn der Leidensdruck der<br />
Betroffenen, die entstehenden Kosten<br />
für die Behandlung der Begleiterkrankungen<br />
und die Verkürzung der Lebenserwartung<br />
sind bedeutsam.<br />
Alle mit der Problematik Beschäftigten<br />
sind sich jedoch auch darüber<br />
im Klaren, dass die operative Intervention<br />
nicht das Problem der rasch<br />
Im Brennpunkt<br />
Delegation der DAG bei Ihnen in Essen<br />
und habe damals mit Vertretern<br />
des MDS ganztägig diskutiert.<br />
In der Hoffnung auf eine Antwort<br />
verbleibe ich mit freundlichen<br />
Grüßen,<br />
Professor Dr. Alfred Wirth<br />
zunehmenden krankhaften <strong>Adipositas</strong><br />
in einer Gesellschaft lösen kann.<br />
Sie kann nur einzelnen Betroffenen<br />
die letzte Chance geben, wieder ein<br />
lebenswertes Leben zu erlangen und<br />
die verlorene Lebensqualität wieder<br />
zu gewinnen. Für jeden Diabetologen,<br />
Hausarzt, Internisten oder auch Orthopäden<br />
stellt der extrem übergewichtige<br />
Patient mit einer krankhaften <strong>Adipositas</strong><br />
eine frustrierende Aufgabe dar,<br />
da er mit allen Medikamentenkombinationen<br />
und Ausschöpfung neuster<br />
pharmakoterer Pillen nur eine unzureichende<br />
Kosmetik anbieten kann, die<br />
den Patienten nicht aus dem Würgegriff<br />
seiner Folgeerkrankungen lässt.<br />
Es hat lange Zeit gedauert, dass<br />
sich auch wieder in Deutschland die<br />
interventionelle chirurgische <strong>Adipositas</strong>-Therapie<br />
in einem ausreichenden<br />
Qualitätsstandard etablieren konnte. Es<br />
ist weitere Zeit verstrichen, bis Diabetologen<br />
und andere Fachdisziplinen diese<br />
Chancen der <strong>Adipositas</strong>-Chirurgie<br />
erkannt haben, jetzt jedoch feststellen<br />
müssen, dass die einzige Chance für die<br />
Betroffenen durch die Krankenkassen<br />
nicht übernommen wird. Dies jedoch<br />
aus nicht begründbaren und aus internen<br />
nicht wissenschaftlich fundierten<br />
Richtlinien diese effiziente und allseits<br />
wirksame Therapie den Patienten vorenthalten.<br />
Für die Kostenträger ist die<br />
Entscheidung zur Operation, und das<br />
ist in vielen Studien inzwischen nachgewiesen,<br />
auch im Interesse aller Versicherten<br />
wesentlich kosteneffizienter<br />
als die Fortschreibung konservativer<br />
Therapiemaßnahmen, die von vornherein<br />
zum Scheitern verurteilt sind. Die<br />
von Professor Dr. A. Wirth formulierten<br />
Grundsätze zur Beurteilung einer Entscheidung<br />
zur operativen Intervention<br />
werden von der Seite der <strong>Adipositas</strong>-<br />
Chirurgen in Punkt und Komma mitgetragen.<br />
Professor Dr. Rudolf A. Weiner<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
7VII
X<br />
Hintergrund<br />
Lipidmuster bestimmt kardiometabolisches Risiko<br />
D<br />
as Metabolische Syndrom<br />
als Cluster verschiedenerRisikofaktoren<br />
gilt gemeinhin<br />
als Ursache atherosklerotischer Gefäßerkrankungen<br />
mit Herzinfarkt<br />
oder Schlaganfall als finales Ereignis.<br />
Dabei spielt die Insulinresistenz<br />
die zentrale Rolle. Fast regelhaft<br />
werden in diesem Zusammenhang<br />
Störungen des Glukose- und Triglyzeridstoffwechsels<br />
gemeinsam beobachtet.<br />
Wahrscheinlich führen<br />
Störungen des Triglyzeridstoffwechsels<br />
zu einer Erhöhung<br />
freier Fettsäuren, die über eine<br />
Reduktion der Glukoseaufnahme<br />
der Muskulatur auch zu einer<br />
Beeinflussung von Insulinsekretion<br />
und Insulinwirkung<br />
führen können. Insulinresistenz<br />
und Hyperinsulinämie setzen<br />
schließlich den pathologischen<br />
Mechanismus in Gang, der letzlich<br />
zur Atherosklerose führt.<br />
In einem Experiment an gentechnisch<br />
veränderten Mäusen<br />
konnte eine Arbeitsgruppe von<br />
der Universität Harvard einen<br />
Mechanismus nachweisen, der<br />
diese Kausalität widerlegt. 1<br />
Die fettreich ernährten Nager<br />
hatten im Blut zwar vermehrt<br />
freie Fettsäuren, allerdings fehlten<br />
die Anzeichen einer Insulinresistenz.<br />
Die Mäuse konnten<br />
zwei Fettsäure-bindende Proteine<br />
(FABP) im Fettgewebe<br />
nicht herstellen, die normalerweise<br />
den Transport der freien<br />
Fettsäuren aus dem Zytoplasma<br />
in die Mitochondrien vermitteln.<br />
Andererseits fand sich die Palmitoleinsäure,<br />
die bei diesen genveränderten<br />
Mäusen wie ein Hormon<br />
wirkte. Sie verhinderte die Anreicherung<br />
von Fett in der Leber und<br />
erhöhte die Insulin-Empfindlichkeit<br />
der Muskulatur, so dass diese<br />
leichter Zucker aufnahm. Dass<br />
eine Fettsäure aus dem Fettgewebe<br />
eine solche Wirkung auf Muskeln<br />
und Leber ausübt, ist ein neuer<br />
Anzeige<br />
Befund. Gökhan Hotamisligil und<br />
seine Mitarbeiter haben nun damit<br />
begonnen, die Palmitoleinsäurewerte<br />
von Diabetespatienten und<br />
Probanden mit Metabolischem Syndrom<br />
zu untersuchen, um sie mit denen<br />
Gesunder zu vergleichen. -rk-<br />
1 Hotamisligil G et al.: Identification of<br />
a lipokine, a lipid hormone linking adipose<br />
tissue to systemic metabolism. Cell<br />
(2008);134(6):933-44.<br />
Zink-a 2-Glykoprotein<br />
neues Signalmolekül<br />
im Lipidmetabolismus<br />
BioVendor GmbH<br />
Im Neuenheimer Feld 583<br />
69120 Heidelberg<br />
e-mail: infoEU@biovendor.com<br />
www.biovendor.com<br />
Der Besuch lohnt sich<br />
D<br />
ie stetige Zunahme Adipöser<br />
in allen Industrienationen<br />
bedingt, infolge<br />
auftretender Folgeerkrankungen,<br />
enorme Kosten im Gesundheitswesen.<br />
Allein in Deutschland<br />
ist jeder zweite übergewichtig und<br />
20 Prozent sind adipös. Erschre-<br />
10 <strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
ckend ist der in den letzten Jahren<br />
beobachtete Häufigkeitsanstieg adipöser<br />
Kinder.<br />
Eine Welt mit einem hohem Lebensmittelangebot<br />
und der Möglichkeit<br />
körperlichen Aktivitäten<br />
aus dem Wege zu gehen, macht es<br />
dem Einzelnen nicht leicht Konsumgewohnheiten<br />
zu ändern und<br />
ein erhöhtes Körpergewicht zu reduzieren.<br />
Ein wissenschaftlicher Kongress,<br />
wie die 24. Jahrestagung<br />
der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
bietet zahlreiche Gelegenheiten<br />
sich über Strategien<br />
zur Prävention und Therapie der<br />
<strong>Adipositas</strong> zu informieren und<br />
neue Wege zu finden, um die<br />
<strong>Adipositas</strong>epidemie wirksam zu<br />
bekämpfen.<br />
Zur <strong>Adipositas</strong>behandlung<br />
steht eine Fülle von Therapieverfahren<br />
zur Verfügung. Neben<br />
medikamentösen, psychologischen,<br />
psychotherapeutischen<br />
und chirurgischen Maßnahmen<br />
wird die Diättherapie am häufigsten<br />
eingesetzt.<br />
Auf dem Symposium: „Gewichtsabnahme<br />
jenseits von<br />
Diäten und Medikamenten“<br />
des Unternehmens Certmedica<br />
diskutieren namhafte Experten<br />
unter dem Vorsitz von U. Rabast<br />
(Hattingen) und B. Weisser<br />
(Kiel) die von den Fachgesellschaften<br />
formulierten Therapieziele<br />
und auch die Möglichkeiten<br />
therapeutischer Maßnahmen.<br />
Auch über die Rolle von Gehirn,<br />
Transmittern und Hormonen<br />
und deren Einfluss auf Hunger und<br />
Sättigung und damit auf die Regulation<br />
des Körpergewichtes wird ein<br />
Thema dieser Veranstaltung sein.<br />
Merken Sie sich daher den Termin<br />
dieser Veranstaltung vor:<br />
Freitag, 17. Oktober 2008; 10.00-<br />
11.30 Uhr Sat.-Symp. Certmedica<br />
International GmbH: Gewichtsabnahme<br />
jenseits von Diäten und Medikamenten<br />
-rk-
Mitteilungen der Gesellschaft<br />
„Hoodia“ - Präparate zur<br />
Gewichtsabnahme nicht<br />
empfehlenswert<br />
Die Deutsche <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft (DAG)<br />
rät Verbrauchern davon ab, „Hoodia“ (auch:<br />
“Houdia“) - Produkte zur Gewichtsabnahme<br />
zu kaufen. Tabletten und Kapseln mit<br />
Extrakten aus der südafrikanischen, kakteenähnlichen<br />
Pflanze Hoodia gordonii werden im Internet als natürliche<br />
Appetitzügler auf rein pflanzlicher Basis zur Gewichtsreduktion<br />
ohne Nebenwirkungen beworben und<br />
verkauft.<br />
„Es existieren derzeit keine publizierten<br />
wissenschaftlichen Untersuchungen,<br />
die belegen, dass<br />
Hoodia-Produkte oder ihr Inhaltsstoff<br />
„P57“ bei Menschen die Gewichtsabnahme<br />
fördern können“,<br />
so Dr. Stefan Engeli, <strong>Adipositas</strong>-<br />
forscher und Mitglied im Beirat der<br />
DAG. „Auch zu möglichen Nebenwirkungen<br />
beim Menschen gibt es<br />
Dr. Stefan Engeli,<br />
Berlin<br />
keine Studien, deshalb sind darüber keine Aussagen<br />
möglich“, so Engeli.<br />
Eine anorexigene Wirkung wird dem Oxypregnanglycosid<br />
P57 nachgesagt. In medizinischen Literaturdatenbanken<br />
finden sich ca. 18 Publikationen zum Thema<br />
Hoodia/P57, die sich weitgehend der Identifikation<br />
und Analytik von P57 widmen. Lediglich drei methodisch<br />
schwache tierexperimentelle Studien vermitteln<br />
den Eindruck einer appetithemmenden Wirkung.<br />
Hoodia-Präparate sind derzeit weder als Arzneimittel,<br />
noch als Lebensmittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel<br />
für den deutschen Markt zugelassen. Sie sind daher in<br />
Deutschland nicht verkehrsfähig und damit illegal. „Das<br />
Produkt ist als Novel Food [neuartiges Lebensmittel]<br />
eingestuft. Ein Antrag auf Zulassung wurde bisher nicht<br />
gestellt. Damit ist der Handel mit diesen Produkten in<br />
der Europäischen Union nicht zulässig“, so Dr. Wolfgang<br />
Schmid vom Bayrischen Landesamt für Gesundheit<br />
und Lebensmittelsicherheit.<br />
Darüber hinaus warnte das Bundesamt für Naturschutz<br />
(BfN) schon 2006 vor den Auswirkungen des ausufernden<br />
Handels mit Hoodia. Da die Pflanze in ihrem<br />
Bestand stark gefährdet ist, unterliegt sie den Bestimmungen<br />
des Washingtoner Artenschutzabkommens.<br />
„Wer Hoodia-Präparate direkt im Ausland oder über<br />
ausländische Foren im Internet kaufen will, braucht eine<br />
Ausfuhrgenehmigung aus dem Herkunftsland und eine<br />
Einfuhrgenehmigung für Deutschland“, so Prof. Dr. Dietrich<br />
Jelden, Leiter der Abteilung Artenschutzvollzug bei<br />
BfN. Auch Endverbraucher machten sich strafbar, wenn<br />
sie Hoodia-Produkte direkt oder online von einem Händler<br />
beziehen, der diese illegal erworben hat, so Jelden.<br />
Dr. Stefanie Gerlach<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongress Oktober 08 4. Jahrgang<br />
Foto: © FWTM/Raach<br />
Deutsche <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
24. Jahrestagung<br />
Freiburg, 16.–18. Oktober 2008<br />
Unter der Schirmherrschaft von<br />
Günther H. Oettinger, Ministerpräsident<br />
von Baden-Württemberg<br />
+++ »<strong>Adipositas</strong> als Krankheit« +++<br />
Wir wünschen allen Teilnehmern eine erfolgreiche Tagung.<br />
Veranstalter<br />
Deutsche <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft e. V.<br />
Tagungspräsident<br />
Prof. Dr. med. Aloys Berg<br />
Organisation<br />
CTW – Congress Organisation Thomas Wiese GmbH<br />
Hohenzollerndamm 125, 14199 Berlin<br />
Tel.: +49 (0)30 – 85 99 62-13<br />
Fax: +49 (0)30 – 85 07 98 26<br />
adipositas@ctw-congress.de<br />
www.ctw-congress.de
XII<br />
12<br />
Mitteilungen der Gesellschaft<br />
Die 7 Sydney-Prinzipien:<br />
IOTF fordert gesetzliche und grenzüberschreitende Regelungen zum<br />
Schutz von Kindern vor Werbung für „adipogene“ Lebensmittel<br />
itte August 2008 veröffentlichte eine Arbeitsgruppe<br />
der IOTF unter Leitung von<br />
Prof. Boyd Swinburn vom Collaborating<br />
Centre for Obesity Prevention der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) sieben grundlegende<br />
Leitkriterien zur wirkungsvollen nationalen und internationalen<br />
Unterbindung kommerzieller Produktwerbung<br />
für Junk Food und Softdrinks für Kinder und Jugendliche<br />
bis zu 16 Jahren.<br />
Die Sydney-Prinzipien sollen die Entwicklung nationaler,<br />
regionaler und globaler Marketingstandards weiter<br />
vorantreiben, da nach den aktuellen Empfehlungen<br />
der internationalen <strong>Adipositas</strong>experten neue gesetzliche<br />
Kontrollen und grenzüberschreitende Gesetze unverzichtbar<br />
seien: „Selbstverpflichtende Regelungen, selbst<br />
wenn sie vollständig erzwungen würden, können naturgemäß<br />
das große Werbeaufkommen und die hohe Wirksamkeit<br />
des Marketings adipogener Nahrungsmittel und<br />
Getränke nicht substanziell mindern“, fasst der kürzlich<br />
veröffentlichte IOTF-Bericht zusammen1 M<br />
.<br />
„Die Sydney-Prinzipien spiegeln die Grundrechte<br />
von Kindern wider und sollten der Maßstab sein, den<br />
wir an Maßnahmen seitens der Regierungen und der<br />
Nahrungsmittelindustrie anlegen, um diese Rechte zu<br />
schützen“, so Professor Swinburn.<br />
Die 7 Sydney-Prinzipien<br />
Erfolgreiche Regelungen zur Eindämmung kommerzieller<br />
Werbung für adipogene Lebensmittel sollten:<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(6)<br />
(7)<br />
... die Rechte von Kindern unterstützen<br />
im Hinblick auf angemessene, sichere Lebensmittel<br />
mit einem hohen Gehalt essentieller Nährstoffe<br />
... Kindern ausreichend Schutz bieten<br />
vor kommerzieller Ausbeutung<br />
... rechtlich verbindlich sein,<br />
um Kindern ein hohes Maß an Schutz zu gewährleisten<br />
... die Definition kommerzieller Werbung weit fassen,<br />
um alle Arten kommerzieller Werbung für Kinder einzuschließen<br />
(z.B. Fernsehwerbung, Print, Sponsoring/Patenschaften,<br />
Wettbewerbe, Treuesysteme, Produktplatzierungen,<br />
Beziehungs-Marketing, websites, Mobiltelefon, SMS, virales Marketing)<br />
... Kindern werbefreie Räume garantieren,<br />
z.B. in Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreuung<br />
... grenzüberschreitende Medien einschließen<br />
in internationalen gesetzlichen Vereinbarungen<br />
(z.B. Internet, Satelliten- und Kabel-TV, „free-to-air“-Fernsehen<br />
aus Nachbarländern)<br />
... sollten evaluiert, überwacht und rechtlich durchgesetzt werden.<br />
Die Einhaltung der Grundsätze sollte von unabhängiger Seite geprüft werden.<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Hintergrund:<br />
Der erste Entwurf der Sydney-Prinzipien wurde anlässlich<br />
des 10. Internationalen <strong>Adipositas</strong>-Kongresses<br />
in Sydney im September 2006 lanciert. Stellungnahmen<br />
von Delegierten mündeten in einen überarbeiteten zweiten<br />
Entwurf, der von November 2006 bis April 2007 einer<br />
globalen Konsultation unterzogen wurde. Die IOTF<br />
erhielt 220 schriftliche Stellungnahmen von Berufsverbänden,<br />
Wissenschaftsgesellschaften, Verbrauchervereinigungen,<br />
Industriegremien, Gesundheitsexperten<br />
etc., von denen 128 ausgewertet wurden 1 .<br />
Die Absender kamen zu 95 Prozent aus insgesamt 18<br />
einkommensstarken Ländern; 65 Prozent der Rückmeldungen<br />
wurden Gesundheitsexperten oder -organisationen<br />
zugeordnet. Die Notwendigkeit eines solchen Prinzipienkatalogs<br />
stand für 97 Prozent der Absender außer<br />
Frage. Mit Ausnahme des 3. Leitkriteriums, dessen<br />
Notwendigkeit von Industrieseite mit Hinweis auf bestehende<br />
Selbstverpflichtungsregelungen und eine notwendige<br />
Balance von Verantwortlichkeiten (Eltern und<br />
Kinder, privater Sektor, Regierung und Gesellschaft)<br />
angefochten wurde sowie einigen Kommentaren bzgl.<br />
der Schwierigkeiten der Implementierung, gab es breite<br />
Zustimmung für jedes der Prinzipien. Unterschiedliche<br />
Meinungen gab es zu den Punkten „Altersgrenze“ und<br />
„Produktgruppen“. Von den Befürwortern einer Altersgrenze<br />
(n=110) plädierten 70 Prozent für eine Werberegulierung<br />
bis zum Alter von mindestens 16 Jahren, über<br />
die Hälfte sprach sich sogar gemäß der UN-Definition<br />
„Kind“ für das Alter bis<br />
18 Jahre aus. Hinsichtlich<br />
der Produktgruppen,<br />
auf die sich die Werbebeschränkung<br />
beziehen soll,<br />
stimmten 31 Prozent für<br />
„alle Produkte“, 24 Prozent<br />
für „alle Nahrungsmittel<br />
und Getränke“ und<br />
45 Prozent für „energiedichte,<br />
nährstoffarme<br />
Nahrungsmittel und Getränke“.<br />
Nach Ansicht der<br />
IOTF-Arbeitsgruppe können<br />
die beiden letztgenannten<br />
strittigen Punkte<br />
derzeit nur im regionalen<br />
Kontext geregelt werden,<br />
ein internationaler Marketing-Code<br />
müsste hierzu<br />
konkrete Definitionen<br />
finden.
Bereits im März diesen Jahres hatten IOTF/IASO<br />
und Consumers International einen „International Code<br />
on Marketing of Food and Beverages to Children“ anlässlich<br />
des Weltverbrauchertags veröffentlicht, der der<br />
WHO als Empfehlung für einen eigenen Entwurf dienen<br />
sollte.<br />
Ausblick<br />
Die WHO wird einen Aktionsplan zur Prävention<br />
von <strong>Adipositas</strong> und nicht übertragbaren Krankheiten<br />
implementieren, der auch die Entwicklung von Empfehlungen<br />
für Gesetzesentwürfe hinsichtlich des Marketing<br />
für Kinder einschließt. Dazu wird die WHO bis<br />
Ende des Jahres Gespräche mit Vertretern von Industrie,<br />
Nicht-Regierungsorganisationen und nationalen<br />
Regierungen führen. Die Ergebnisse münden dann in<br />
eine abschließende Empfehlung der WHO an die Gesundheitsminister.<br />
Die Sydney-Prinzipien können daher<br />
Basis sein für die Entwicklung eines „WHO Code<br />
on Food and Beverage Marketing to Children“.<br />
Anzeige<br />
0 kg<br />
-2 kg<br />
-4 kg<br />
-6 kg<br />
-8 kg<br />
Mitteilungen der Gesellschaft<br />
Die DAG unterstützt die Initiativen von IOTF/IASO<br />
und wird deren Positionen gesellschaftlich und politisch<br />
vertreten.<br />
Dr. Stefanie Gerlach<br />
Literatur:<br />
1 Swinburn, B.; Sacks, G.; Lobstein, T.; Rigby, N.; Baur, L.A.; Brownell,<br />
K.D.; Gill, T.; Seidell, J.; Kumanyika, S., as International Obesity<br />
Task Force Working Group on Marketing to Children:<br />
“The `Sydney Principles´ for reducing the commercial promotion of<br />
foods and beverages to children”<br />
Public Health Nutrition 2008; 11(9): 881-886<br />
Links:<br />
Sydney Principles website:<br />
http://www.iotf.org/sydneyprinciples/index.asp<br />
International Code on Marketing of Food and Beverages to Children:<br />
http://iotf.org/documents/ConsumersInternationalMarketingCode.pdf<br />
Consumers International:<br />
http://junkfoodgeneration.org/index.php?option=com_content&tas<br />
k=view&id=33&Itemid=64<br />
UN Convention on the Rights of the Child:<br />
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm<br />
Lipidbinder zur Unterstützung der<br />
Exklusiv in der Apotheke.<br />
Abnehmen<br />
mit der Nr. 1*<br />
Gewichtsabnahme [kg] bei kalorienverminderter Ernährung<br />
Start<br />
1. Woche 2. Woche 3. Woche<br />
Prof. Allan Lassus, M.D. & Jan Abelin, M.D., Helsinki, 1994<br />
ohne L112<br />
mit L112<br />
4. Woche<br />
Wirksamkeit durch Studien bestätigt<br />
formoline L112, Lipidbinder zur Unterstützung der Behandlung von Übergewicht, Ge wichts-<br />
kon trol le und Verminderung von Cholesterin und LDL. Wirkaussagen geprüft und Leistungsfähigkeit<br />
offi ziell bestätigt durch EG-Prüfbescheinigung. Anwendung im Rahmen einer moderaten<br />
Diät. Vertrieb: Biomedica GmbH, D - 63110 Rodgau.<br />
Zusammensetzung: Hauptinhaltsstoff: ß-1,4-Polymer von D-Glucosamin und N-Acetyl-D-Glucosamin<br />
aus Krebstierpanzer, Spezifi kation L112 Weitere Bestandteile sind: Cellulose (pfl anzlich), Vitamin<br />
C, Weinsäure, Siliziumdioxid und Magnesiumstearat (pfl anzlich) Dosierung: Gewichtsreduktion:<br />
2 x tägl. 2 Tabletten; Gewichtskontrolle: 2 x tägl. 1 Tablette zu den Hauptmahlzeiten; mit ausreichend<br />
Flüssigkeit einnehmen.<br />
Zertifi ziertes Medizinprodukt Klasse III<br />
Behandlung von Übergewicht<br />
Gewichtskontrolle<br />
Verminderung von Cholesterin und LDL<br />
* formoline L112, die Nr. 1 aus der Apotheke,<br />
laut aktueller Marktforschung A.C. Nielsen,<br />
Juli 2008<br />
www.L112.com<br />
13<br />
F08/08DEde_2_F001
Nachrichten aus der Industrie<br />
Zuverlässige Identifikation des diabetischen Fußsyndroms<br />
Das diabetische Fußsyndrom<br />
als eine der gefürchtestenFolgeerkrankungen<br />
des Diabetes<br />
mellitus steht für einen Komplex<br />
von Symptomen und wird leider oft<br />
zu spät bemerkt.<br />
Eine der entscheidenden Ursachen<br />
ist die Schädigung peripherer Nerven<br />
aufgrund jahrelang erhöhter Blutzuckerspiegel.<br />
Die diabetische Neuropathie<br />
führt konsekutiv zu einem<br />
Verlust der sensiblen Wahrnehmung<br />
im Bereich des Fußes, so dass Verletzungen<br />
schlechter oder gar nicht<br />
wahrgenommen werden.<br />
Durch die Schädigung der<br />
Nerven wird weiterhin der<br />
Spannungszustand der Fußmuskulatur<br />
geschwächt. Das<br />
durch Bänder und Muskeln<br />
aufgerichtete Fußgewölbe<br />
sackt zusammen. Hieraus resultieren<br />
atypische Druckbelastungen<br />
mit der Möglichkeit<br />
weiterer Ulzerationen.<br />
Die autonome Neuropathie<br />
führt zum gesteigerten<br />
Blutfluss im subdermalen<br />
Fußbereich, während die kapilläre<br />
Durchblutung in der<br />
Lederhaut gedrosselt wird.<br />
Gleichzeitig wird die Funktion der<br />
Schweißdrüsen durch die autonome<br />
Neuropathie verändert. Während<br />
die reduzierte Mikrozirkulation zu<br />
einer Austrocknung der Epidermis<br />
von innen heraus führt, bewirkt die<br />
Änderung der Schweißdrüsenfunktion<br />
die Austrocknung von außen.<br />
Diese trockene Haut ist anfällig für<br />
Risse und Fissuren, und sie neigt zu<br />
verstärkter Hornhautbildung.<br />
Diabetische Neuropathie, trockene<br />
Haut und verhärtete Hautpartien<br />
können an exponierten Stellen<br />
schmerzlose und daher gefährliche<br />
Ulzerationen hervorrufen. Neben der<br />
Neuropathie bilden Veränderungen<br />
der arteriellen Gefäße einen weiteren<br />
wesentlichen Risikofaktor für die<br />
Entwicklung von Ulzerationen und<br />
eines diabetischen Fußsyndroms. Da<br />
die diabetische Polyneuropathie und<br />
die periphere arterielle Verschlusskrankheit<br />
oft gemeinsam auftreten,<br />
bemerken Betroffene eine Entzündung<br />
an den Zehen oder am Fuß nicht<br />
rechtzeitig. Bakterien können sich,<br />
von den infizierten Entzündungsherden<br />
ausgehend, weiter im Gewebe des<br />
Fußes ausbreiten. Die Mangeldurchblutung<br />
der Füße bewirkt zusätzlich,<br />
dass die körpereigene Abwehr gegen<br />
diese bakterielle Infektion das Zielgewebe<br />
nicht erreicht.<br />
Die bedeutendsten Konsequenzen<br />
diabetischer Fußprobleme sind daher<br />
tatsächlich Ulzerationen und<br />
Mittlere Farbumschlagzeiten des Neuropad ® Pflasters<br />
Farbumschlagzeit in Sekunden<br />
1000<br />
rechter Fuß linker Fuß<br />
Amputationen. Zwei bis zehn Prozent<br />
aller Diabetiker entwickeln einen<br />
Fußulkus.<br />
Die Neuerkrankungsrate liegt<br />
jährlich bei 2,2-5,9 Prozent. Mit<br />
über 65.000 Amputationen pro Jahr<br />
liegt Deutschland europaweit im<br />
oberen Bereich, ca. 70 Prozent aller<br />
Amputationen werden bei Patienten<br />
mit Diabetes mellitus durchgeführt.<br />
Hinzu kommen die Kosten für Hospitalisierung<br />
und Rehabilitation,<br />
die bei einer Amputation besonders<br />
hoch ausfallen.<br />
Vor diesem Hintergrund wird<br />
deutlich, dass eine präventive Fußversorgung<br />
äußerst sinnvoll ist. In<br />
der Nationalen Versorgungsleitlinie<br />
des Typ-2-Diabetes werden jährliche<br />
Fußinspektionen mit Untersuchung<br />
von Hautturgor und Schweißbildung<br />
explizit gefordert. Mit der<br />
XIV 14<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
750<br />
500<br />
250<br />
0<br />
p
BMBF-Kompetenznetz <strong>Adipositas</strong><br />
Am 11. März 2008 fand<br />
auf Einladung des Bundesministeriums<br />
für<br />
Bildung und Forschung<br />
(BMBF) die Auftaktveranstaltung<br />
für das „Kompetenznetz <strong>Adipositas</strong>“<br />
in Köln statt. Acht Verbund-<br />
Forschungsanträge zum Thema<br />
<strong>Adipositas</strong> mit jeweils vier bis acht<br />
Teilprojekten waren vom BMBF, im<br />
Anschluss an die Bewertung durch<br />
internationale Gutachter, aus insgesamt<br />
27 eingegangenen Verbundsanträgen<br />
als förderungswürdig ausgewählt<br />
worden.<br />
Professor Hans Hauner, gewählter<br />
Sprecher des Kompetenznetzes und<br />
derzeitiger president<br />
elect der Deutschen<br />
<strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
(DAG): „Das ist der<br />
Durchbruch für die<br />
<strong>Adipositas</strong>forschung<br />
und die Anerkennung<br />
der <strong>Adipositas</strong> als ein<br />
zentrales Gesundheitsproblem<br />
in Deutschland“.<br />
Das BMBF leistet<br />
mit der Förderung des Kompetenznetzes<br />
<strong>Adipositas</strong> einen extrem wertvollen<br />
Beitrag, um der Forschung in<br />
Deutschland eine sichtbare Plattform<br />
zu geben und die aktiven Gruppen zu<br />
vernetzen, so Hauner.<br />
Danksagung<br />
Professor Hans Hauner<br />
I<br />
m Namen des gesamten Programmkomitees<br />
möchte ich<br />
mich bei der LinguaMed<br />
Verlags-GmbH, speziell beim<br />
Redaktionsteam des <strong>Adipositas</strong>-<br />
<strong>Spektrum</strong>s bedanken, dass mit ihrer<br />
Hilfe der Druck der Abstracts realisiert<br />
werden konnte. Ebenso sei allen<br />
Autoren gedankt, die ein Abstract zur<br />
Veröffentlichung eingereicht haben.<br />
„Wir haben jetzt endlich erreicht, wofür<br />
sich die <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
und ihre Präsidenten immer eingesetzt<br />
haben: die <strong>Adipositas</strong>forschung<br />
ist erstmals<br />
Forschungsschwerpunkt<br />
in Deutschland”, bestätigte<br />
auch Professor Manfred J.<br />
Müller, Präsident der DAG.<br />
Die zunehmende gesundheitspolitische<br />
Bedeutung<br />
der <strong>Adipositas</strong> mit ihren<br />
Folgeerkrankungen sowie<br />
die Initiative von Professor<br />
Erik Harms, Vorsitzender<br />
der Plattform Ernährung und Bewegung,<br />
haben zu dieser positiven Entwicklung<br />
der Forschungslandschaft<br />
einen wichtigen Beitrag<br />
geleistet. Mit dem Kompetenznetz<br />
<strong>Adipositas</strong><br />
sei die deutsche <strong>Adipositas</strong>forschung<br />
jetzt<br />
international besser aufgestellt,<br />
schloss Müller.<br />
Vorrangiges Ziel<br />
krankheitsbezogener<br />
Kompetenznetze ist<br />
die Schaffung nationaler Standards<br />
zur Diagnostik und Therapie, unter<br />
angemessener Berücksichtigung besonderer<br />
Forschungsaspekte, unter<br />
anderem die Schaffung nationaler<br />
Standards für gemeinsam zu nut-<br />
Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer,<br />
wurden in diesem Jahr<br />
neben den Freien Vorträgen und<br />
Postern erstmalig auch die geladenen<br />
Referenten und die Referenten<br />
der Satellitensymposien gebeten, ein<br />
Abstract zum Druck einzureichen.<br />
Leider liegt nicht für jeden angekündigten<br />
Vortrag ein Abstract vor, aber<br />
wir hoffen, dass von diesem Angebot<br />
Professor Manfred<br />
J. Müller<br />
Hintergrund<br />
zende Biobanken und IT-Lösungen (z.<br />
B. Telematikplattformen). Das Kompetenznetz<br />
bündelt die Erforschung<br />
des starken Übergewichts<br />
und der therapeutischen<br />
Versorgung von Adipösen<br />
unter einer gemeinsamen<br />
Struktur mit eigener Geschäftsstelle.<br />
Für das Kompetenznetz<br />
<strong>Adipositas</strong> sind<br />
drei weitere Förderrunden<br />
im Dreijahrestakt geplant.<br />
Die acht Verbund-Forschungvorhaben<br />
in alphabetischer<br />
Reihenfolge ihrer Sprecher:<br />
• Professor Bischoff (Stuttgart): „Obesi-<br />
ty and the Gastrointestinal Tract“;<br />
• Professor Blüher (Leipzig): „Targeting<br />
Adipose Tissue Dysfunction“;<br />
• Professor Brüning (Köln): „Targeting<br />
Neurocircuits in Obesity”;<br />
• Professor Hauner (München): „Peri-<br />
natal Prevention of Obesity Develop-<br />
ment“;<br />
• Professor Kiess (Leipzig): „Longitu-<br />
dinal Childhood Adiposity Research<br />
in Germany – Translation of Science<br />
into Clinical Management“;<br />
• Professor Koletzko (München): „Mul-<br />
tidisciplinary Early Modification of<br />
Obesity Risk“;<br />
• Professor Müller (Kiel): “Interdiscipli-<br />
nary Consortium on Obesity Preventi-<br />
on in Children and Adolescents“;<br />
• Professor de Zwaan (Erlangen):<br />
“Weight Loss Maintenance”.<br />
ABSTRACTS<br />
ABSTRACTS<br />
in den kommenden Jahren vermehrt<br />
Gebrauch gemacht wird.<br />
Ich wünsche allen Teilnehmer-<br />
innen und Teilnehmern einen erfolgreichen<br />
Kongress<br />
Ihr Professor Aloys Berg<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
15 XV
Bestellen Sie jetzt Ihr<br />
Kombi-Abonnement.<br />
Sie erhalten:<br />
• Argumente + Fakten der Medizin<br />
• <strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong><br />
• Biological News<br />
Zum Vorzugspreis von 45,- Euro<br />
im Jahr !<br />
4<br />
MEDIZIN UND GESUNDHEIT<br />
AKTUELL ZU KONZEPTEN<br />
FORSCHUNG UND KLINIK<br />
Argumente<br />
F a k t e n<br />
der Medizin<br />
ERSCHEINT<br />
IM <strong>LINGUAMED</strong> VERLAG<br />
HERAUSGEBER<br />
KARIN WILBRAND<br />
Acarbose verbessert alle Elemente<br />
des metabolischen Syndroms 6<br />
Schonzeit für die Beta-Zellen 8<br />
Antihypertensive Therapie<br />
bei Typ-2-Diabetes 10<br />
Alle Risikomarker des Diabetes<br />
effektiv therapieren 11<br />
Insulin plus Insulin-Sensitizer<br />
senken den HbA 1c<br />
AUS<br />
MAI 2007<br />
HEFT 5<br />
17. JAHRGANG<br />
ISSN 0939-8570<br />
Editorial:<br />
Ethik und Ökonomie<br />
− Ein ärztlicher Zielkon�ikt 2<br />
Praxismanagement:<br />
Ideen und Anregungen zum Basistarif Heft 3 Mai/Juni 2007 3. Jahrgang ISSN 1861-7093 € 5,50<br />
von PD Dr. med. W. Behrendt 3<br />
Postprandiale Blutzuckerkontrolle ist<br />
der Schlüssel zum normalen HbA1c 14<br />
Kleiner Streifen − große Wirkung 16<br />
Telmisartan − größerer Schutz<br />
vor diabetischer Nephropathie 19<br />
Halbiertes Rezidivrisiko<br />
bei Depressionen 22<br />
Soziale Isolation, weil Zwangsverhalten<br />
zum Lebensinhalt wird 23<br />
Hochdrucktherapie muss auch<br />
Gefäße schützen 24<br />
Coxibe sind logische Konsequenz<br />
der Pathophysiologie 26<br />
Heft 1 / 2008 1. Jahrgang ISSN 1865-3626 LinguaMed Verlags-GmbH<br />
Biological news<br />
Biotechnologie zur Diagnostik + Therapie<br />
Biotechnologie zur Diagnostik + Therapie<br />
Editorial:<br />
Neue Ära der Medizin durch Biotechnologie 2<br />
Übersichtsarbeit:<br />
Biologika zur Therapie von Autoimmunerkrankungen 3<br />
Versorgungssituation bei Rheumatoider Arthritis<br />
ist verbesserungswürdig 8<br />
Monozyten, die phänotypisch und funktionell<br />
den Stammzellen ähnlich sind 9<br />
Übersichtsarbeit:<br />
`Biologics´ in der Therapie chronisch<br />
entzündlicher Darmerkrankungen 10<br />
Unser Anspruch:<br />
“Der Blick für das Wesentliche“<br />
Wir haben unser Repertoire um eine<br />
wichtige innovative Zeitschrift ergänzt.<br />
Biological news<br />
Biotechnologie zur Diagnostik + Therapie<br />
Aus aktuellen Themen,<br />
interessanten Forschungskonzepten<br />
und internationalen Kooperationen<br />
auf dem Gebiet der Medizin<br />
informieren wir über alle Facetten<br />
des medizinischen Fortschritts.<br />
Sparen Sie mit dem Kombi-Abo 50,- € gegenüber<br />
einem Einzelbezug<br />
Argumente + Fakten (29,-),<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> (30,-) und<br />
Biological News (36,-)<br />
Alle drei Zeitschriften jetzt für 45,- Euro!<br />
12<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong><br />
Nachrichten der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
& Ernährungskonsil<br />
news<br />
Multikinasehemmer wirksam bei Nierenzell-<br />
und hepatozellulärem Karzinom 12<br />
Hemmung des epidermalen Wachstumsfaktor-<br />
Rezeptors als Durchbruch der Krebstherapie 14<br />
Phosphatmanagement von Dialysepatienten<br />
neu definieren 19<br />
Insulin-City: Weltweite Insulinversorgung<br />
„Made in Germany“ 21<br />
Carryover-Effekt schützt weit über das<br />
Therapieende hinaus 22<br />
<strong>LINGUAMED</strong><br />
Verlags-GmbH<br />
Aktuelles:<br />
● Schützt <strong>Adipositas</strong><br />
vor den Folgen des<br />
Herzinfarkts?<br />
Mitteilungen der<br />
Gesellschaft:<br />
● Eckpunktpapier und<br />
Ziele des Nationalen<br />
Aktionsplans<br />
Schwerpunkt:<br />
● <strong>Adipositas</strong> und Krebs<br />
Ernährungskonsil:<br />
● Trans-Fettsäuren<br />
schaden Herz und<br />
Kreislauf<br />
Nachrichten aus der<br />
Industrie:<br />
● <strong>Adipositas</strong> bei Frauen<br />
nicht nur ein<br />
Figurproblem<br />
Abstracts<br />
Themenübersicht<br />
5 Eingeladene Vorträge<br />
14 Freie Vorträge<br />
Genetik, molekulare Mechanismen,<br />
pränatale Prägung<br />
16 Chirurgische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
17 Ernährungsberatung, Schulungsprogramme<br />
18 <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter I<br />
20 <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter II<br />
22 Psychologie, Epidemiologie, Umwelt<br />
24 Körperliche Aktivität und Lebensstil<br />
25 Klinische Aspekte, Komorbiditäten,<br />
Körperkomposition<br />
27 Pharmakologische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
28 Poster<br />
<strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
35 Schulungsprogramme und Reha-Konzepte<br />
37 Klinische Aspekte der <strong>Adipositas</strong><br />
und Komorbiditäten<br />
38 Körperkomposition und Energiebilanz<br />
39 Pädagogik und Psychologie<br />
Ernährungsberatung und Ernährungskonzepte<br />
40 Insulinresistenz und molekulare Mechanismen<br />
41 Genetik und pränatale Prägung<br />
42 Chirurgische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
43 Körperliche Aktivität und Lebensstil<br />
44 Pharmakologische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
45 Satellitensymposien<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang
Pharmaka bei <strong>Adipositas</strong>: Nutzen und Risiken<br />
Wirth Alfred<br />
Klinik Teutoburger Wald, Innere, Bad Rothenfelde, Deutschland<br />
Die <strong>Adipositas</strong> ist eine schwer zu behandelnde Krankheit. Nicht nur Patienten,<br />
auch Therapeuten unterschätzen häufig die Schwierigkeit, das Gewicht<br />
effektiv und dauerhaft zu senken. Liegen frustrane Therapieversuche mittels<br />
Lebens-stiländerung vor, ist eine medikamentöse Therapie indiziert. Ziel<br />
der Behandlung ist eine Reduktion der Morbidität, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit<br />
und der Lebensqualität, eine Besserung der Beschwerden und<br />
Befindlichkeit sowie eine Verhinderung von vorzeitiger Sterblichkeit. Zu fast<br />
allen Behandlungszielen liegen verlässliche Ergebnisse der einzelnen Pharma<br />
vor, nicht jedoch zur Mortalität. Orlistat, ein Hemmer intestinaler Lipasen,<br />
vermindert das Gewicht um 3 kg und verbessert alle kardiovaskulären Risikofaktoren.<br />
Ein Problem bei hohem Fettkonsum ist eine Stearrhoe. Reductil, ein<br />
Wiederaufnahmehemmer von Serotonin und Noradrenalin, bewirkt durch Verstärkung<br />
der Sättigung eine Gewichtsabnahme von 5 kg. Bei manchen Herz-<br />
Kreislauf-Krankheiten ist Reductil kontraindiziert; seit 5 Jahren läuft eine<br />
Endpunktstudie mit kardiovaskulären Hochrisikopatienten. Rimonabant, ein<br />
Endocannabinoid-1-Rezeptor-Blocker, reduziert durch zentrale Mechanismen<br />
das Gewicht und induziert durch periphere Wirkungen positive metabolische<br />
Auswirkungen. Bei depressiven Patienten darf Rimonabant nicht verordnet<br />
werden. Exenatide, ein Glukogaon-Like-Peptid Analogon, ist als Antidiabetikum<br />
zugelassen. Über kaum bekannte Mechanismen reduziert dieses Inkretin<br />
das Gewicht um ca. 4 kg. Die Behandlung mit Substanzen zur Gewichtsreduktion<br />
muss fachkundig – wie jede andere Pharmakotherapie – durchgeführt werden.<br />
Dazu sind Kenntnisse des Wirkmechanismus, Auswirkungen auf Gewicht<br />
und weitere Stoffwechselparameter sowie der Nebenwirkungen notwendig.<br />
Fit and fat – the truth about weight and health<br />
Steven N. Blair<br />
Dept. of Exercise Science and Epidemiology/Biostatistics, Arnold School<br />
of Public Health, University of South Carolina, Columbia, USA<br />
Overweight and obesity are well established as health risks, and the prevalence<br />
of these conditions is increasing rapidly in many countries around<br />
the world. There have been numerous calls to action to address the public<br />
health problem of overweight and obesity, from the World Health Organization<br />
and many national health authorities. The role of physical activity<br />
in relation to overweight or obesity and health status is mentioned in most<br />
reports and recommendations. A fit and active way of life reduces the risk<br />
of substantial weight gain over time, is useful in weight loss programs, appears<br />
to be crucial in maintaining weight loss, and provides health benefits<br />
to overweight and obese individuals. It is this last point that has largely been<br />
overlooked by those concerned with the public health problem of overweight<br />
and obesity. It is clear that inactivity and low cardiorespiratory fitness increase<br />
the risk of cardiovascular disease and all-cause mortality, as well as for<br />
morbidity from several diseases or conditions. Obese individuals who are fit<br />
have much lower risk of mortality than lean individuals who are unfit, and<br />
low cardiorespiratory fitness in overweight or obese persons is as hazardous<br />
as having other risk factors. The population attributable fraction is higher<br />
for low fitness than for other conditions, including prevalent cardiovascular<br />
disease, for those who are overweight or obese. Public health programs and<br />
recommendations on obesity should include much greater emphasis on physical<br />
activity than is done at present.<br />
Is there a genetic predisposition to obesity?<br />
Claude Bouchard<br />
Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, USA<br />
The obesity epidemic is driven by pervasive positive energy balance. When<br />
individuals living in a “restrictive” environment evolve towards an “obesogenic”<br />
environment, most are likely to gain weight. However, those with a high<br />
genetic predisposition will gain the most weight, whereas those resistant to<br />
obesity will gain little if any. A direct demonstration of the presence of human<br />
variation in the predisposition to obesity comes from a series of experiments<br />
with identical twins. These studies strongly suggest that the magnitude of the<br />
response to excess caloric consumption or negative energy balance conditions<br />
depends on a predisposition thought to be largely inherited. What are the genes<br />
and sequence variants responsible for this variation in the risk of obesity remain<br />
to be fully answered. About two dozen genes have been associated with obesity<br />
or weight gain in at least 10 studies or more. The strongest evidence is for the<br />
FTO gene. If one accepts that FTO is typical of all common obesity genes,<br />
then we would conclude that an obesity gene has a small effect size, with a<br />
rather high frequency of the risk allele. However, despite its overall small effect<br />
size, the homozygotes for the FTO risk allele weigh on average almost 4 kg<br />
more than those without the risk allele, and the population attributable risk for<br />
obesity of the FTO gene reaches 20 %. Other genes identified to-date seem to<br />
have even smaller effect sizes than FTO, suggesting that the predisposition to<br />
obesity is determined by many genes, each with a small effect size.<br />
Eingeladene Vorträge<br />
Vergleich dreier Modelle des RICHTIG ESSEN INSTITUTS<br />
zur Gewichtsreduktion<br />
Heidi Brünion<br />
RICHTIG ESSEN INSTITUT, Berlin, Deutschland<br />
Methode: Eine aktuelle Evaluierung vergleicht zwei Gruppenkurse mit<br />
dem Individualberatungskonzept. Der Gruppenkurs GB-3 hat acht Veranstaltungen<br />
über drei Monate und GB-6 zehn Termine über sechs Monate. Die<br />
Individualberatung gliedert sich in drei bzw. fünf Beratungen über drei bzw.<br />
fünf Monate (IB-3 bzw. IB-5). Die Auswertung erfolgt in GB-3 für 331 Teilnehmer,<br />
in GB-6 für 1250, in IB-3 für 37 und in IB-5 für 137 Patienten. Ergebnisse:<br />
Hinsichtlich der Geschlechterverteilung wird deutlich, dass in den<br />
Individualberatungen der höchste Männeranteil vorliegt (GB-3: 1,2 %, GB-6:<br />
21 %, IB-3: 27 %, IB-5: 38 %). Betrachtet man die Altersverteilung, bilden<br />
in der Individualberatung die Teilnehmer zwischen 31 und 40 Jahren die<br />
größte Gruppe (GB-3:17,6 %, GB-6: 25,8 %, IB-3: 35 %, IB-5: 36 %). Die<br />
Ergebnisse zum Körpergewicht zeigen, dass die Teilnehmer der Individualberatungen<br />
im Durchschnitt ein höheres Ausgangsgewicht aufweisen (GB-3:<br />
82,5 kg, GB-6: 83,4 kg, IB-3 und IB-5: 93,4 kg). Dementsprechend sind in der<br />
Individualberatung <strong>Adipositas</strong> Grad II und III am häufigsten (GB-3: 39,6 %,<br />
GB-6: 36,6 %, IB-3: 62 %, IB-5: 51 %). Die Ergebnisse zur Gewichtsreduktion<br />
zeigen, dass die Individualberatung am erfolgreichsten ist (IB-3 und<br />
IB-5: Gewichtsverlust 4,6 kg bzw. 5 %). Dann folgen GB-6 (4,2 kg bzw. 5 %)<br />
und GB-3 (3,6 kg bzw. 4,4 %). Zusammenfassung: Die Individualberatung<br />
ist bei stark adipösen Patienten der beste Weg. Eine längere Betreuung wäre<br />
wünschenswert, um die Gewichtsreduktion nachhaltig zu etablieren.<br />
Energieumsatz, Muskelmasse und körperliche Aktivität<br />
Peter Deibert<br />
Medizinische Universitätsklinik, Rehabilitative und Präventive<br />
Sportmedizin, Freiburg, Deutschland<br />
Der Energieumsatz setzt sich aus dem Grundumsatz (GU), der nahrungsinduzierten<br />
Thermogenese sowie dem Arbeits- bzw. Leistungsumsatz zusammen.<br />
Während der Grundumsatz mit der Muskelmasse und der hormonellen<br />
Regulation korreliert, lassen sich der Anteil der Thermogenese durch individuelle<br />
Nahrungsauswahl und der Leistungsumsatz durch das Aktivitätsniveau<br />
direkt beeinflussen. Der Energieaufwand für körperliche Aktivität und damit<br />
auch der tägliche Gesamtenergiebedarf kann einerseits abgeschätzt werden<br />
oder kalorimetrisch exakt bestimmen werden. Bei körperlicher Aktivität kann<br />
man je nach Belastungsdauer und -intensität das 1,5-fache bis 2-fache des GU<br />
veranschlagen. Während des Zeitraumes intensiver Muskelarbeit kann sogar<br />
ein Mehrfaches des GU umgesetzt werden. Der Arbeitsumsatz bei leichter<br />
körperlicher Arbeit macht ca. 30 % des GU aus. Dagegen fällt der Einfluss<br />
der Thermogenese eher gering aus. Generell wird der individuelle Energieverbrauch<br />
bzw. -bedarf gerne überschätzt. Der Energieverbrauch bei körperlicher<br />
Belastung hängt im Wesentlichen vom Ausmaß der eingesetzten Muskulatur<br />
und natürlich von der Intensität der Muskelarbeit ab. Bei Reduktion<br />
des Körpergewichtes sollte also dringend auf einen Erhalt der Muskelmasse<br />
geachtet werden. Bei weit verbreiteten Diätprogrammen zur Erzielung eines<br />
raschen Diäterfolges sind 25–35 % und mehr der Gewichtsreduktion durch<br />
einen Verlust an Muskelmasse bedingt. Dies bedingt einen verminderten GU<br />
sowie eine verminderten möglichen maximalen Arbeitsumsatz, wodurch der<br />
Jojo-Effekt mit erklärt wird. Wie eigene Ergebnisse sowie vergleichbare Studien<br />
aus der Literatur eindeutig zeigen, kann durch die Auswahl geeigneter<br />
Diätverfahren sowie Einbindung körperlicher Aktivität ist ein Erhalt der Muskelmasse<br />
auch bei bedeutsamer Gewichtsreduktion möglich.<br />
Polygene <strong>Adipositas</strong><br />
*Susann Friedel (1), Johannes Hebebrand (1), Anke Hinney (1)<br />
(1) Universität Duisburg-Essen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
des Kindes- und Jugendalters, Essen, Deutschland<br />
Molekulargenetische Analysen zur Etiologie der <strong>Adipositas</strong> haben bislang<br />
zur Identifikation einer begrenzten Anzahl an bestätigten Genen mit einem Haupgeneffekt<br />
geführt. Während solche Hauptgene einen klaren Einfluss auf die<br />
Entwicklung des Phänotyps haben, sind die zugrunde liegenden Mutationen<br />
extrem selten und daher von untergeordneter klinischer Bedeutung. Man geht<br />
daher davon aus, dass die genetische Prädisposition für <strong>Adipositas</strong> polygen<br />
bedingt ist; d. h. eine Anzahl solcher Varianten sollte in den meisten adipösen,<br />
aber auch in normal- und untergewichtigen Individuen gefunden werden.<br />
Demzufolge können polygene Varianten nur mittels statistischer Methoden<br />
identifiziert werden: die betreffenden Genvariante (Allel) sollte öfter in adipösen<br />
als in Kontrollindividuen vorkommen. Jedes Polygen leistet einen kleinen<br />
Beitrag zur Entstehung der <strong>Adipositas</strong>. Das 103I-Allel des V103I-Polymorphismus<br />
im Melanokortin-4-Rezeptorgen (MC4R) war die erste bestätigte<br />
polygene Variante mit einem Einfluss auf den BMI; in einer groß angelegten<br />
Meta-Analyse konnte gezeigt werden, dass der Effekt dieses Allels auf den<br />
mittleren BMI -0,5 kg/m 2 beträgt. Mittels der ersten genomweiten Assoziationsstudie<br />
(GWA) zu <strong>Adipositas</strong>, basierend auf 100.000 SNPs, die in Fami-<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
17 5
18 6<br />
Eingeladene Vorträge<br />
lien der Framingham-Studie analysiert wurden, konnte ein Polymorphismus<br />
strangaufwärts des Insulin-induzierten-Gens 2 (INSIG2) identifiziert werden.<br />
Dieser Befund wurde in verschiedenen Kollektiven repliziert, in anderen nicht.<br />
Eine Metaanalyse wird zur Aufklärung des Beitrags der INSIG2 –Variante zu<br />
<strong>Adipositas</strong> beitragen. Verschiedene Varianten im ersten Intron des „Fat mass<br />
and obesity associated“ Gen (FTO) tragen zum bisher relevantesten polygenen<br />
Effekt auf <strong>Adipositas</strong> bei. Dieser Effekt wurde bislang in multiplen Studien<br />
bestätigt. Im ersten GWA für frühmanifeste <strong>Adipositas</strong> konnten wir diesen Effekt<br />
ebenfalls nachweisen.<br />
<strong>Adipositas</strong>varianten und Abstammungsidentität: Melanocortin-4-<br />
Rezeptor SNP Analysen nicht nur für Assoziationsstudien<br />
Jessica Grothe (1), Harald Brumm (1), André Scherag (2), Anke Hinney (3),<br />
Harald Grallert (4), *Heike Biebermann (1), Annette Grüters (1)<br />
(1) Charité Campus Virchow Klinikum, Institut für Experimentelle Pädiatrische<br />
Endokrinologie, Berlin, Deutschland; (2) Universitätsklinikum Essen,<br />
Biometrie und Epidemiologie, Essen, Deutschland; (3) Rheinische Kliniken<br />
Essen, Klinik f. Psychiatrie und Psychotherapie, Essen, Deutschland;<br />
(4) Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental<br />
Health, Neuherberg, Deutschland<br />
Der Melanocortin 4 Rezeptor (MC4R) spielt eine entscheide Rolle in der<br />
hypothalamischen Gewichtsregulation. Zurzeit sind Mutationen im MC4R<br />
die häufigste genetische Ursache der <strong>Adipositas</strong>. Die häufigste Mutation ist<br />
eine Stoppmutation, Y35X, die sich als Haplotyp mit der Mutation D37V<br />
manifestiert. Darüber hinaus gibt es zwei weitere relativ häufige MC4R-<br />
Varianten: V103I tritt in ca. 2 Prozent der Bevölkerung auf und wird als<br />
<strong>Adipositas</strong>-protektiv eingestuft und eine partielle Funktionsverlustmutation:<br />
S127L. Das Vorkommen von zwei Mutationen auf einem Allel legt die<br />
Vermutung eines Founder-Effekt nahe. Neben der Doppelmutation konnten<br />
wir in seltenen Fällen auch V103I und S127L auf einem Allel bei übergewichtigen<br />
Patienten identifizieren. Um zu untersuchen, ob die MC4R-<br />
Doppelmutationen spontan entstehen oder durch Vererbung weitergegeben<br />
wurden, haben wir zur Erstellung von MC4R-Haplotypen single nucleotide<br />
Polymorphisms (SNPs) mit einer Heterozygotenhäufigkeit von mindestens<br />
40 Prozent in der Datenbank, in einem Bereich von ca. 240 kb um das<br />
MC4R-Gen zum einem in einem gesunden Normalkollektiv und zur<br />
Erstellung von Haplotypen-Trios in normalgewichtigen und adipösen<br />
Patienten untersucht. Kürzlich ist bei der Suche nach neuen <strong>Adipositas</strong>relevanten<br />
Kandidatengene in einer genomweiten Assoziations-Studie ein<br />
SNP(rs17782313), ca. 188 kb downstream vom MC4R-Gen, als hoch assoziiert<br />
mit <strong>Adipositas</strong> identifiziert worden. Die funktionelle Bedeutung ist<br />
noch völlig unklar. Untersuchungen dieses SNPs in unserem Kontrollkollektiv<br />
zeigten auch hier eine hohe Signifikanz mit Adiposits (p=0.01). Die<br />
Auswertung alle erhobenen Daten wird einerseits zeigen, ob die Doppelmutationen<br />
auf einen gemeinsamen founder hinweisen oder spontan entstanden<br />
sind und werden außerdem Aufschlüsse geben, ob rs17782313 im<br />
linkage disequilibrium mit anderen SNPs steht, welche dichter am MC4R<br />
liegen.<br />
Das Präventionsmanager-Konzept – Status Quo und Perspektiven<br />
*Ulrike Gruhl (1), Hans Hauner (2), Reinhart Hoffmann (3),<br />
Dinah Köhler (4), Rüdiger Landgraf (5), Peter Schwarz (6)<br />
(1) Nationales Aktionsforum Diabetes mellitus (NAFDM), Projektgruppe<br />
Prävention, München, Deutschland; (2) NAFDM/Else-Kröner-Fresenius<br />
Klinik für Ernährungsmedizin an der TU München, München, Deutschland;<br />
(3) Deutsche Diabetes-Stiftung, München, Deutschland; (4) Deutsche<br />
Diabetes-Stiftung, München, Deutschland; (5) NAFDM/DDS, München,<br />
Deutschland; (6) NAFDM/TU Dresden, Dresden, Deutschland<br />
Zielsetzung: Den meisten Verantwortlichen im deutschen Gesundheitssystem<br />
ist die Notwendigkeit klar, dringend qualitativ hochwertige Maßnahmen<br />
zum erfolgreichen Präventionsmanagement von <strong>Adipositas</strong>, Diabetes<br />
mellitus und anderen metabolisch-vaskulären Begleiterkrankungen in der<br />
Leistungsebene zu etablieren. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist<br />
eine einheitliche, gut abgestimmte Prozess-Struktur sowie durch entsprechende<br />
Schnittstellendefinitionen eindeutig geklärte Zuständigkeiten. Materialien<br />
und Methoden: Seit Juni 2006 arbeitet die Projektgruppe Prävention<br />
des NAFDM im Rahmen der AG Curriculum Präventionsmanager an einem<br />
Weiterbildungskonzept für Präventionsmanager (PM). Der Präventionsmanager<br />
ist vor Ort für die Durchführung der Intervention mit verschiedenen<br />
Interventionsgruppen verantwortlich. Ärzte und Apotheker sind idealerweise<br />
Partner des PM – sowohl bei der Rekrutierung als auch an der Schnittstelle<br />
der Diabetes-Diagnose im Verlauf des Programms. Die Weiterbildung<br />
richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Ernährung und Bewegung. Die<br />
Pilotweiterbildung umfasste über ein Jahr verteilt 4 Module Theorie (ca.<br />
70 Unterrichtsstunden) mit den Schwerpunkten Präventionsmanagement,<br />
Motivation/Supervision sowie Umsetzung und Stabilisierung der Verhaltensmodifikation.<br />
Begleitend erstellten die Pilotkursteilnehmer eine Pro-<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
jektarbeit, in welcher die Netzwerkbildung vor Ort und die praktische Umsetzung<br />
der Interventionsmaßnahme dokumentiert wurden. Ergebnisse: In<br />
NRW wurden 2007/2008 zwei Pilotkurse durchgeführt. Es konnten strukturelle<br />
und inhaltliche Defizite identifiziert werden, welche bei der derzeitigen<br />
Überarbeitung des Konzepts berücksichtigt werden. Zusammenfassung:<br />
Die größte Herausforderung bei der Umsetzung des Präventionsmanagerkonzepts<br />
liegt in der erfolgreichen Rekrutierung und Motivation von Risikopersonen<br />
sowie der Schaffung weiterer notwendiger Netzwerkstrukturen,<br />
um ein tragfähiges Geschäftsmodell zu etablieren. Die Frage nach einer adäquaten<br />
Finanzierung derartiger Angebote bleibt vor dem Hintergrund eines<br />
nicht geklärten Präventionsgesetzes weiter offen.<br />
Die <strong>Adipositas</strong> als klinisches Symptom in der Gynäkologie<br />
Aida Hanjalic-Beck<br />
Universitäts-Frauenklinik, Endokrinologie, Freiburg, Deutschland<br />
Das Übergewicht stellt einen wichtigen Risikofaktor in der Frauenheilkunde<br />
dar. Einerseits werden im Fettgewebe die männlichen Hormone<br />
(Androgene) in die weiblichen Hormone (Östrogene) umgewandelt. Dies<br />
spielt bei der Entstehung von Erkrankungen wie Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs<br />
eine wichtige Rolle, da diese Veränderungen eine Hormonabhängigkeit<br />
zeigen. Anderseits ist die <strong>Adipositas</strong> ein mögliches Symptom<br />
bei Polyzystischem Ovarsyndrom (PCOS). Das PCOS betrifft ca. 4–6 %<br />
der Frauen im reproduktionsfähigen Alter und ist eine der häufigsten Ursachen<br />
für Zyklusstörung und weibliche Unfruchtbarkeit. Das Hauptmerkmal<br />
dieser sehr heterogenen Erkrankung stellt die Hyperandrogenämie dar, mit<br />
klinischen Symptomen wie Akne oder verstärkte Behaarung. In der noch<br />
nicht ganz geklärten Pathogenese des PCOS kommt der Insulinresistenz eine<br />
wichtige Bedeutung zu. Die betroffenen Frauen haben ein erhöhtes gesundheitliches<br />
Langzeitrisiko für Diabetes mellitus, metabolisches Syndrom oder<br />
kardiovaskuläre Ereignisse sowie für Tumoren wie z. B. Gebärmutterkrebs.<br />
Deshalb ist das Erkennen dieser Frauen in der Praxis, die Aufklärung sowie<br />
interdisziplinäre Betreuung eine wichtige Aufgabe sowohl der Frauenärzte<br />
als auch der Hausärzte.<br />
Nationales Genomforschungsnetz „Molekulare Mechanismen<br />
der <strong>Adipositas</strong>“<br />
Johannes Hebebrand<br />
Universität Duisburg-Essen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
des Kindes- und Jugendalters, Essen, Deutschland<br />
Das Hauptziel des Forschungsnetzes „Molekulare Mechanismen der<br />
<strong>Adipositas</strong>“ ist die Identifizierung von zu <strong>Adipositas</strong> prädisponieren Genen<br />
bzw. Allelen, sowie deren anschließende Evaluation in epidemiologischer,<br />
entwicklungsbiologischer, klinischer, funktioneller und therapeutischer<br />
Hinsicht. Dazu haben sich im <strong>Adipositas</strong>netz 21 Arbeitsgruppen aus ganz<br />
Deutschland in 11 Teilprojekten und vier Arbeitsblöcken organisiert. Arbeitsblock<br />
1 dient der Identifizierung von Kandidatengenen und kombiniert<br />
Studien an Mensch und Nager, sowie Proteomics. Verschiedene systematische<br />
Ansätze werden Analysen eigener und internationaler Daten aus Genomweiten<br />
Assoziationsstudien (GWA), re-Sequenzierung, Genotypisierung<br />
und Proteomics ermöglichen. Bevor funktionelle und klinische Studien eines<br />
spezifischen humanen Kandidaten-SNPs oder -gens initiiert werden, müssen<br />
alle Kandidaten solide in unabhängigen Studiengruppen bestätigt werden<br />
(Arbeitsblock 2, Validierung). Dies wird durch die Einbeziehung von großen<br />
deutschen epidemiologischen und adipositas-spezifischen Kollektiven<br />
erreicht, die ca. 40.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene umfassen; es<br />
kann daher stark auf Entwicklungsaspekte fokussiert werden. Ziel ist es,<br />
die Kandidaten zu identifizieren, die nach dieser stringenten Prozedur übrig<br />
bleiben. Nur solche bestätigten Kandidaten werden in den nachfolgenden<br />
Projekten analysiert, um kostenintensive Studien ohne adäquate statistische<br />
a priori Evidenz zu vermeiden. Funktionelle Studien (Arbeitsblock 3) werden<br />
benötigt, um die Regulation und funktionelle Relevanz der validierten<br />
Kandidaten zu analysieren. Dabei sollen in silico Analysen und Analysen zu<br />
metabolischen Parametern wie neuronale Kontrolle, Adipogenese, Signaltransduktion,<br />
allelische Expression und Methylierung durchgeführt werden.<br />
Um die physiologische Relevanz der Kandidatengene zu untersuchen, stehen<br />
Mausmodelle zur Verfügung. In Arbeitsblock 4 (Therapie) werden Medium-<br />
und Langzeitimplikationen von ‚Weight Cycling’ und Kalorienrestriktion<br />
sowohl auf systemischer wie auch auf molekularer Ebene mit speziellem<br />
Fokus auf Entwicklungsaspekten analysiert werden.<br />
<strong>Adipositas</strong> – eine polygene Erkrankung?<br />
Johannes Hebebrand<br />
Universität Duisburg-Essen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
des Kindes- und Jugendalters, Essen, Deutschland<br />
<strong>Adipositas</strong> entsteht aufgrund des komplexen Zusammenwirkens von prädisponierenden<br />
Genen mit Umweltfaktoren. Die Identifizierung solcher Mechanismen<br />
liefert einen wertvollen Beitrag zur Erforschung der Ätiologie der
<strong>Adipositas</strong>. Molekulargenetische Analysen haben bislang zur Identifikation<br />
einer begrenzten Anzahl an bestätigten Genen mit einem Hauptgeneffekt<br />
geführt. Diese Hauptgene haben einen klaren Einfluss auf die Entwicklung<br />
des Phänotyps, allerdings sind die zugrunde liegenden Mutationen selten<br />
und daher von untergeordneter klinischer Bedeutung. Kandidatengenstudien<br />
haben sich in den letzten Jahres als wenig geeignet erwiesen, neue <strong>Adipositas</strong>gene<br />
zu identifizieren. Mittels genomweiter Assoziationsstudien (GWAs),<br />
bei denen bis zu 1.000.000 Einzelnukleotidaustausche (SNPs) pro Patient<br />
untersucht werden, sind in den letzten zwei Jahre verschiedene Gene identifiziert<br />
worden, denen ein polygener Effekt zugeschrieben wird, d. h. jedes<br />
Polygen leistet einen kleinen Beitrag zur Körpergewichtsregulation, erst in<br />
ihrer Gesamtheit können sie die Entstehung einer <strong>Adipositas</strong> bedingen. Das<br />
103I-Allel des V103I-Polymorphismus im Melanokortin-4-Rezeptorgen<br />
(MC4R) wurde als erste polygene Variante mit einem Einfluss auf den BMI<br />
identifiziert; in einer groß angelegten Meta-Analyse konnte gezeigt werden,<br />
dass der Effekt dieses Allels auf den mittleren BMI -0,5 kg/m 2 beträgt.<br />
Anhand einer kürzliche erschienenen Metaanalyse der GWA-und weiteren<br />
Genotypdaten von ca. 90.000 Probanden konnte zusätzlich die Beteiligung<br />
einer Region 188kb 3´ des MC4R an der Gewichtsregulation nachgewiesen<br />
werden. Verschiedene Varianten im ersten Intron des „Fat mass and obesity<br />
associated“ Gen (FTO) tragen zum bisher relevantesten polygenen Effekt bei<br />
der <strong>Adipositas</strong> bei. Dieser Effekt wurde in multiplen Studien bestätigt. Genomweite<br />
Assoziationsstudien werden in naher Zukunft zur Identifizierung<br />
weiterer Polygene führen.<br />
Anforderungen an die Indikation und Nachbetreuung chirurgischer<br />
<strong>Adipositas</strong>therapie aus Sicht der Diätassistenten<br />
Mario Hellbardt<br />
POLIKUM Friedenau, Ernährungsberatung, Berlin, Deutschland<br />
In der ernährungstherapeutischen Praxis stellt sich zunehmend die Frage,<br />
wie Patienten nach einem chirurgischen Eingriff zur Gewichtreduktion<br />
umfassend und nachhaltig betreut werden sollen, nicht nur von Seiten der<br />
Diätassistenten sondern insbesondere auch von Seiten der Patienten. Hier<br />
ergeben sich unterschiedliche Problemstellungen bzw. Anforderungen:<br />
Diätassistenten müssen vor und nach der Operation aktiv in den Prozess der<br />
bariatrischen Behandlung eingebunden werden. Häufig sind die Patienten<br />
vor dem Eingriff nicht ausreichend über die Veränderungen der Essgewohnheiten<br />
und Lebensmitteauswahl aufgeklärt und können diese nur schwer alleine<br />
umsetzen. Erst bei auftretenden Symptomen einer Mangelernährung<br />
finden die Patienten den Weg über den Arzt zur Ernährungsberatung. Daher<br />
ist die ernährungstherapeutische Vor- und Nachbetreuung zwingend notwendig.<br />
Auch auf der Seite der Patienten muss eine Sensibilisierung für das Thema<br />
Ernährung nach Magen-OP stattfinden, da häufig von ihnen angenommen<br />
wird, dass durch den Eingriff das Ziel einer Gewichtsreduktion erreicht<br />
ist. Auch hier leistet eine umfassende ernährungstherapeutische Betreuung<br />
vor und nach der Operation einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der<br />
Maßnahme. Übergreifend sind weitere Anforderungen an die Versorgung<br />
für Patienten nach chirurgischen Eingriffen zur Gewichtsreduktion zu stellen<br />
und umzusetzen: Fortbildung und Vernetzung der Ernährungsfachkräfte,<br />
Erstellen von Qualitätsstandards für die Ernährungstherapie und -beratung<br />
nach adipositas-chirurgischen Eingriffen sowie enge interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
mit allen Fachdisziplinen.<br />
Die Mediendarstellung der <strong>Adipositas</strong>:<br />
eine Analyse deutscher Tageszeitungen<br />
*Anja Hilbert (1), Jens Ried (2)<br />
(1) Philipps-Universität Marburg, Psychologie, Marburg, Deutschland;<br />
(2) Philipps-Universität Marburg, Evangelische Theologie,<br />
Marburg, Deutschland<br />
Zielsetzung: Stigmatisierende Einstellungen gegenüber der <strong>Adipositas</strong><br />
sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Sie sind verbunden mit internalen<br />
Attributionen der <strong>Adipositas</strong> auf ein mutmaßliches Fehlverhalten<br />
der Betroffenen sowie mit einem geringeren Informationsstand über die<br />
<strong>Adipositas</strong>. Neuere Studien weisen darauf hin, dass stigmatisierende<br />
Einstellungen durch eine negative Mediendarstellung der <strong>Adipositas</strong> im<br />
Fernsehen perpetuiert werden könnten. Ziel der vorliegenden Untersuchung<br />
war es daher, die Mediendarstellung der <strong>Adipositas</strong> in deutschen<br />
Printmedien auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Berichterstattung<br />
und der enthaltenen Wertung zu untersuchen. Materialien und Methoden:<br />
Für das Jahr 2006 wurden alle 1563 Ausgaben von insgesamt fünf<br />
der auflagenstärksten überregionalen Qualitäts- und Boulevardzeitungen<br />
sowie regionaler Tageszeiten einer systematischen Stichwortsuche unterzogen.<br />
Die identifizierten 222 Artikel über Übergewicht und <strong>Adipositas</strong><br />
wurden quantitativ-inhaltsanalytisch hinsichtlich definierter, reliabler<br />
Inhalts- und Wertungskategorien ausgewertet. Ergebnisse: Die überregionalen<br />
Zeitungen berichteten vollständiger und mehr dem aktuellen<br />
wissenschaftlichen Stand entsprechend über Prävalenz, Ätiologie, kli-<br />
Eingeladene Vorträge<br />
nische Relevanz und Prävention sowie Behandlung der <strong>Adipositas</strong> als die<br />
Boulevardberichterstattung, während regionale Tageszeitungen eine Mittelstellung<br />
einnahmen. Überregionale Tageszeitungen führten vergleichsweise<br />
häufiger jedoch auch internale Kausalattributionen insbesondere für<br />
fehlgeschlagene Interventionsansätze an. Während sich die Anzahl stigmatisierender<br />
Aussagen zwischen den Zeitungstypen nicht unterschied,<br />
waren stigmatisierende Aussagen in der Boulevardberichterstattung katastrophisierender<br />
und mehr sowie extremer personalisierend gestaltet. Zusammenfassung:<br />
Insgesamt weist die Berichterstattung zur <strong>Adipositas</strong> in<br />
deutschen Tageszeitungen inhaltliche Mängel und die Tendenz zu einer<br />
abwertenden Darstellung auf, die dazu beitragen könnten, das <strong>Adipositas</strong>stigma<br />
aufrechtzuerhalten.<br />
Essverhalten und psychologische Aufrechterhaltungsfaktoren<br />
von Essanfällen im Kindesalter:<br />
eine Ecological Momentary Assessment-Studie<br />
*Anja Hilbert (1), Julia Czaja (1)<br />
(1) Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Psychologie, Marburg,<br />
Deutschland<br />
Zielsetzung: Erste Studienergebnisse zeigen, dass Essanfälle im Kindesalter<br />
in Verbindung mit einer erhöhten Psychopathologie sowie Übergewicht<br />
und <strong>Adipositas</strong> auftreten. Weitgehend unerforscht ist bislang jedoch das Essverhalten<br />
und psychologische Aufrechterhaltungsfaktoren bei Essanfällen<br />
im Kindesalter. Die vorliegende Studie untersucht daher Essverhalten und<br />
psychologische Aufrecherhaltungsfaktoren im natürlichen Lebensumfeld<br />
von 8–13-jährigen Kindern mit versus ohne Essanfälle. Materialien und<br />
Methoden: In einem Ecological Momentary Assessment-Design wurden<br />
60 Kinder mit Essanfällen und 60 Kinder ohne Essanfälle mit Kinderhandys<br />
zu zufälligen Zeiten und vor, während und nach Mahlzeiten über ihre<br />
Stimmungen und Gedanken sowie über ihre Nahrungsaufnahme befragt.<br />
Ergebnisse: Essanfälle traten vor dem Hintergrund einer hochkalorischen,<br />
fett- und proteinreichen Ernährung auf. Während der Essanfälle wurden<br />
mehr Energie und mehr Kohlenhydrate aufgenommen als während regulärer<br />
Mahlzeiten. Hinsichtlich psychologischer Aufrechterhaltungsfaktoren zeigte<br />
sich, dass Essanfälle bei Kindern, weniger deutlich als bei Erwachsenen,<br />
durch allgemeine negative Stimmungen ausgelöst werden, diese jedoch<br />
nicht regulieren. Essanfälle waren hingegen signifikant mit essstörungsspezifischen<br />
negativen Kognitionen assoziiert. Zusammenfassung: Die Ergebnisse<br />
tragen dazu bei, die Essanfallssymptomatik im Kindesalter in ihrem<br />
Bezug zu Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> zu validieren. Die Aufrechterhaltung<br />
von Essanfällen scheint sich im Kindesalter von der im Erwachsenenalter zu<br />
unterscheiden, was in altersspezifschen Störungsmodellen Berücksichtigung<br />
finden sollte.<br />
Prävention von Hochrisiko-Personen durch Lebensstiländerung –<br />
Struktur-Planung mit Inhalten, Partnern, Zuständigkeiten<br />
Reinhart Hoffmann<br />
Deutsche Diabetes Stiftung, München, Deutschland<br />
Ziel: Prävention vor Kuration – das ist die zentrale Forderung, um die<br />
Ausbreitung der chronischen Zivilisationskrankheiten des Metabolischvaskulären<br />
Syndroms – von <strong>Adipositas</strong> über Diabetes bis zu deren Folgeerkrankungen<br />
– einzudämmen. Mit einem Nationalen Präventions-<br />
Programm und dessen flächendeckender Implementierung, von der<br />
frühzeitigen Risiko-Erkennung über machbare Intervention bis hin zu<br />
deren Nachhaltigkeit, ist die Problematik – jedenfalls theoretisch – lösbar.<br />
Die Bildung von Netzwerken, eine Koordination der Angebote und Akteure<br />
sowie ein transparentes Qualitätsmanagement sind Eckpfeiler dieser<br />
Präventionsstruktur. Maßnahmen und Möglichkeiten: Maßgebliche<br />
Experten der Arbeitsgemeinschaft des Typ 2 Diabetes mellitus der Deutschen<br />
Diabetes-Gesellschaft – AG P2, der Deutschen Diabetes-Stiftung –<br />
DDS, des Nationalen Aktionsforums Diabetes mellitus – NAFDM und der<br />
Deutschen <strong>Adipositas</strong> Gesellschaft – DAG haben sich zum Ziel gesetzt,<br />
miteinander eine zielgerichtete Präventions-Struktur aufzubauen. Durch<br />
Integration aller für die Prävention notwendigen Akteure – über das bestehende<br />
Gesundheitssystem hinaus – wird die Basis für flächendeckende<br />
Präventions-Angebote und -Maßnahmen geschaffen. Erst mit einer bestehenden<br />
Struktur und Bündelung von Verhältnis- und Verhaltens-Prävention,<br />
entsteht die Voraussetzung für eine Gesunderhaltungs-Kampagne in<br />
der Bevölkerung. Ergebnisse: Unter dem Dach der Diabetesstiftung DDS<br />
entsteht ein nationales Koordinierungszentrum – Schnittstelle zwischen<br />
Wissenschaft und Praxis, mit dem Fokus auf Qualitätsmanagement. Zusammenfassung:<br />
Prävention vor Kuration: Mit funktionstüchtigen Pilotprojekten<br />
in unterschiedlichen Settings, qualitativ prozessbegleitet durch<br />
das Koordinierungszentrum DDS, soll bis 2010 die Beweisführung für<br />
erfolgreiche Prävention erbracht werden. Eine flächendeckende, für weite<br />
Kreise von Risikopersonen nutzbare Umsetzung sollte danach möglich<br />
sein.<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
19 7
20 8<br />
Eingeladene Vorträge<br />
Sozialkompensatorische Präventionskonzeption im Kindesalter<br />
des Rhein-Kreises Neuss<br />
Beate Klapdor-Volmar<br />
Gesundheitsamt, Kinder-/Jugendärztlicher Gesundheitsdienst,<br />
Rhein-Kreis-Neuss, Deutschland<br />
Großes Engagement zeigt der Rhein-Kreis Neuss auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung<br />
des Kindes- und Jugendlter mit dem Ziel der Chancengleichheit.<br />
Auf Eigeninitiative des Gesundheitsamtes werden unter dem dach<br />
der Gesundheitskonferenz erfolgreiche Projekte und Programme in Kindertagesstätten<br />
und Schulen bevorzugt in Stadtteilen mit Merkmalen sozialer Benachteiligung<br />
durchgeführt, die richtungsweisend eine konzertierte Gesamtkonzeption<br />
erstellen. So nutzt das Gesundheitsamt Erfahrungen, Ergebnisse<br />
und Kooperationsstrukturen durch viele Jahre für das <strong>Adipositas</strong>-Präventionsprojekt<br />
gewichtig seit 2006, das die drei Säulen Ernährung, Bewegung,<br />
Seelische Gesundheit bearbeitet. Strategien wie setting-Ansatz, Stadtteilorientiertes<br />
Vorgehen, Interdisziplinäre Arbeit, besondere Berücksichtigung<br />
des Migrationshintergrundes, Partizipation, Empowerment und Multiplikatorenansatz<br />
bilden das Fundament. Erste Ergebnisse werden präsentiert. Das<br />
Projekt wird vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz bis Oktober 2009 mitfinanziert und ist eines der 24 Modellprojekte<br />
als Vorreiter in Deutschland, die seit Herbst 2006 Strategien zur<br />
primären Prävention von Übergewicht bei Kindern erproben.<br />
May myokines protect us against obesity and chronic diseases?<br />
Bente Klarlund Pedersen<br />
University of Copenhagen, The Centre of Inflammation and Metabolism,<br />
Department of Infectious Diseases and CMRC, Rigshospitalet, Faculty of<br />
Health Sciences, Kopenhagen, Dänemark<br />
Chronic low-grade systemic inflammation is a feature of chronic diseases<br />
such as cardiovascular disease and type 2 diabetes. Regular exercise offers<br />
protection against all-cause mortality, primarily by protection against atherosclerosis<br />
and insulin resistance and there is evidence that physical training<br />
is effective as a treatment in patients with chronic heart diseases and type 2<br />
diabetes. Regular exercise induces anti-inflammatory actions. During exercise,<br />
IL-6 (interleukin-6) is produced by muscle fibres. IL-6 stimulates the<br />
appearance in the circulation of other anti-inflammatory cytokines such as<br />
IL-1ra (interleukin-1 receptor antagonist) and IL-10 (interleukin-10) and inhibits<br />
the production of the pro-inflammatory cytokine TNF-alpha (tumour<br />
necrosis factor-alpha). In addition, IL-6 enhances lipid turnover, stimulating<br />
lipolysis as well as fat oxidation. It is suggested that regular exercise induces<br />
suppression of TNF-alpha and thereby offers protection against TNF-alphainduced<br />
insulin resistance. Recently, IL-6 was introduced as the first myokine,<br />
defined as a cytokine, that is produced and released by contracting skeletal<br />
muscle fibres, exerting its effects in other organs of the body. Myokines<br />
may be involved in mediating the beneficial health effects against chronic<br />
diseases associated with low-grade inflammation such as diabetes.<br />
Lebensstilintervention beim metabolischen Syndrom<br />
Daniel König<br />
Medizinische Universitätsklinik, Rehabilitative und Präventive<br />
Sportmedizin, Freiburg, Deutschland<br />
Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> sind wesentliche Faktoren für die Ausbildung<br />
des metabolischen Syndroms, das mittlerweile bei über 20 % der Erwachsenen<br />
in Deutschland nachweisbar ist. Je nach Fachverband existieren<br />
für die Diagnose des metabolischen Syndroms verschiedene Richtlinien; in<br />
der klinischen Routine haben sich vor allem die ATP III Kriterien durchgesetzt.<br />
Dabei müssen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllt sein:<br />
Taillenumfang >102 cm bei Männern oder >88 cm bei Frauen; Triglyceride<br />
(TG) >= 150 mg/dl; HDL Cholesterin =85 mm Hg und Nüchtern-Glucose >=100 mg/<br />
dl. Die Diagnose des metabolischen Syndroms ist aus 3 Gründen für den<br />
Patienten von besonderer Relevanz: 1. Die metabolische Risikokonstellation<br />
ist eng mit der Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen assoziiert. Beim<br />
metabolischen Syndrom ist auch ohne das Vorliegen eines manifesten Typ-2<br />
Diabetes mellitus das kardiovaskuläre Risiko mehr als verdoppelt. 2. Das<br />
metabolische Syndrom ist eine chronisch progrediente Erkrankung. Eine regelmäßige<br />
Neuevaluation und Korrektur der metabolischen Risikofaktoren<br />
ist daher erforderlich. 3. Sämtliche metabolische Risikofaktoren sprechen<br />
hervorragend auf eine Änderung des Lebensstils an. Eine Umstellung der<br />
Ernährung sowie vermehrte körperliche Aktivität müssen daher immer die<br />
Basis der therapeutischen Intervention sein. Hierdurch können vor allem in<br />
frühen Phasen der Erkrankung Medikamente vermieden oder zumindest eingespart<br />
werden. Eigenständige Risikoscores für die Behandlung der metabolischen<br />
Risikokonstellation existieren nicht. Die therapeutischen Zielwerte<br />
(LDL-Cholesterin; Blutdruck, HbA 1c etc.) orientieren sich entsprechend an<br />
den Risikofaktor-assoziierten Therapiezielen der entsprechenden Fachgesellschaften.<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Prävalenzangaben für Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> –<br />
ausreichende Indikatoren für die gegenwärtige Gewichtsentwicklung<br />
im Kindes- und Jugendalter?<br />
Katrin Kromeyer-Hauschild<br />
Universitätsklinikum Jena, Institut für Humangenetik und Anthropologie,<br />
Jena, Deutschland<br />
Einleitung: Der Vergleich der Häufigkeiten von Übergewicht und <strong>Adipositas</strong><br />
aus dem Kinder- und Jugendsurvey des RKI mit Daten aus länger<br />
zurückliegenden Untersuchungen zeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen<br />
die Prävalenzen in den letzten Jahren in Deutschland deutlich – vor allem<br />
bei Jugendlichen – angestiegen sind. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass<br />
durch die alleinige Beobachtung der Prävalenzveränderungen die Entwicklung<br />
des Gewichtsstatus von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren<br />
nicht ausreichend abbildet wird und damit potenzielle Gesundheitsrisiken<br />
unterschätzt werden. Material und Methoden: Anhand von Daten aus dem<br />
pädiatrischen Netzwerk CrescNet der Jahre 1999 bis 2006 und Daten von<br />
Jenaer Schulkindern aus den letzten 30 Jahren (1975–2005/06) wird die<br />
Entwicklung des BMI in der gesamten Population untersucht. Für Jenaer<br />
Kinder werden darüber hinaus auch Veränderungen der Körperzusammensetzung<br />
– speziell der Fettmasse – betrachtet. Ergebnisse: Sowohl die Daten<br />
des CresNet als auch die der Jenaer Schulkinderuntersuchungen zeigen, dass<br />
es zu einer generellen Zunahme der BMI-Werte gekommen ist. Bei Jenaer<br />
Kindern ist zusätzlich eine Zunahme der absoluten und relativen Fettmasse<br />
feststellbar. Letzteres bedeutet, dass Kinder im Jahr 2005/06 bei gleicher<br />
Körpermasse mehr Fettmasse haben als vor 30 Jahren. Diese Veränderungen<br />
sind bei Jungen in älteren Altersklassen am stärksten ausgeprägt. Zusammenfassung:<br />
Die hier aufgezeigte Verschiebung zu höheren BMI-Werten in<br />
der Gesamtpopulation stellt ein Risiko für die Entstehung von Übergewicht<br />
dar, welches durch die Veränderung der Körperzusammensetzung verstärkt<br />
wird. Diese Befunde unterstreichen die Notwendigkeit von Präventionsprogrammen,<br />
die sich an die Gesamtpopulation richten, um der Entstehung von<br />
Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> entgegen zu wirken.<br />
Prävention vor Kuration – Implementierung eines nationalen<br />
Koordinierungszentrums<br />
Rüdiger Landgraf (1), Reinhart Hoffmann (1), Ulrike Gruhl (2),<br />
Peter Schwarz (3), *Dinah Köhler (1)<br />
(1) Deutsche Diabetes-Stiftung, München, Deutschland; (2) Nationales Aktionsforum<br />
Diabetes mellitus, Prävention, München, Deutschland; (3) Tumaini<br />
Institut, Prävention, Dresden, Deutschland<br />
Zielsetzung: Mit der Implementierung eines nationalen Koordinierungszentrums<br />
zur Diabetes-Prävention sollen alle bundesweiten Aktivitäten aus<br />
diesem Bereich gebündelt und zusammengeführt werden. Im Vordergrund<br />
stehen dabei Bestrebungen, ein Nationales Programm zur Diabetes-Prävention<br />
zu etablieren, bei dem alle Beteiligten und Leistungserbringer aktiv den<br />
Prozess mitgestalten sowie die Schaffung von Strukturen für ein einheitliches<br />
Qualitätsmanagement. Aufgaben und Vorgehensweise: Aufgaben<br />
des künftigen Koordinierungszentrums sind u. a. Planung und Realisierung<br />
der Infrastruktur für die Dienstleister der Prävention; Kriterienentwicklung<br />
und fachliche Empfehlungen zu Qualitätsmanagement und Evaluation in der<br />
Prävention; Beratung von Projekten und Programmträgern; Etablierung des<br />
Präventionsmanagers NAFDM und Verankerung des Anliegens in Politik,<br />
Verwaltung und relevanten Organisationen des Gesundheitswesens. Nach<br />
der Bündelung aller Aktivitäten zur Diabetes-Prävention sollen Kriterien<br />
entwickelt werden, die Aussagen zu Qualität der jeweiligen Maßnahmen<br />
treffen können. In einem weiteren Schritt sollen einheitliche Erhebungsinstrumente<br />
erarbeitet werden, die eine schnelle und digitale Verarbeitung der<br />
Daten gewährleisten. Das Zusammenführen und Auswerten von Daten aus<br />
unterschiedlichen Präventions-Projekten wäre eine weitere Kernaufgabe des<br />
nationalen Koordinierungszentrums unter dem Dach der Deutschen Diabetes-Stiftung.<br />
Zusammenfassung: In zahlreichen Studien wurde nachgewiesen,<br />
dass die Prävention durch Lebensstil-Intervention erfolgversprechend<br />
ist, nun muss dieser Beweis in der Praxis erbracht werden. Langfristiges Ziel<br />
der angestoßenen Aktivitäten ist daher die flächendeckende Implementierung<br />
eines Managementkonzeptes zur Diabetes-Prävention in ganz Deutschland.<br />
Parallel dazu ist die Schaffung eines einheitlichen Qualitätsmanagements<br />
unabdingbar, um die Vergleichbarkeit verschiedener Präventions-Aktivitäten<br />
zu gewährleisten.<br />
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz: Hilfe gegen<br />
Diskriminierung adipöser Menschen im Berufsleben?<br />
*Sabrina Meier (1), Wolfgang Voit (1)<br />
(1) Universität Marburg, Rechtswissenschaft, Marburg, Deutschland<br />
Am 17. August 2006 ist das umstrittene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz<br />
(AGG) im Bundesgesetzblatt verkündet worden und am 18. August<br />
2006 in Kraft getreten. Es setzt vier europäische Antidiskriminierungsrichtlinien<br />
in deutsches Recht um. Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts,<br />
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der<br />
sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Das AGG regelt somit<br />
die Ansprüche und Rechtsfolgen bei Diskriminierungen sowohl für das Arbeitsleben<br />
als auch für das Zivilrecht. Vor diesem Hintergrund wird der Vortrag<br />
zunächst den Anwendungsbereich des AGG im Arbeitsrecht darlegen.<br />
Im Folgenden soll auf das Diskriminierungsmerkmal der „Behinderung“<br />
eingegangen und dargestellt werden, inwieweit die <strong>Adipositas</strong> unter das Diskriminierungsmerkmal<br />
„Behinderung“ subsumiert werden kann. Dabei wird<br />
auf die Definition der Behinderung aus § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX eingegangen.<br />
Schließlich sollen die Konsequenzen der Einordnung der <strong>Adipositas</strong> im Hinblick<br />
auf die Anwendbarkeit oder Unanwendbarkeit des AGG und die damit<br />
einhergehenden Folgen für die Betroffenen dargelegt werden.<br />
Literatur:<br />
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB<br />
Band 1/Teilband 2: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz-AGG<br />
Redakteur: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz-Jürgen Säcker. Bearbeitet von<br />
Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M. 5. Auflage 2007<br />
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Kommentar hrsg. Ursula Rust,<br />
bearbeitet von Klaus Bertelsmann, Berlin 2007<br />
Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz, Gregor Thüsing, München 2007<br />
S3-Leitlinien – Therapie der <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
*Anja Moß (1), Martin Wabitsch (1)<br />
(1) Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie, Universitätsklinik<br />
für Kinder- und Jugendmedizin, Universität Ulm, Ulm, Deutschland<br />
Einleitung: Leitlinien geben Hilfe für ärztliche Entscheidungsprozesse,<br />
Orientierungshilfe und wissenschaftlich begründete und praxisorientierte<br />
Handlungsempfehlungen. Die <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter hat<br />
in den vergangenen Jahren weltweit zugenommen. Leitlinien zur Therapie<br />
der <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter in Deutschland wurden erstmals<br />
im Jahre 2000 von der Arbeitsgemeinschaft <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
(AGA) veröffentlicht. Ziel war es nun sukzessive diese Konsensus-<br />
(S2-) Leitlinie mit einer evidenzbasierten S3-Leitlinie zu ergänzen bzw.<br />
zu ersetzen. Methodik: Nach systematischer PC-gestützter Literaturrecherche<br />
(Suchbegriffe, Medline, 1988–2006) wurde nach Literaturauswahl und<br />
–bewertung ein erster Textentwurf anhand der Kernaussagen der gesicherten<br />
Literatur verfasst. In mehreren Rückmeldungs- und Konsensschritten wurde<br />
der Text überarbeitet und in einem moderierten nominalen Gruppenprozess<br />
die Empfehlungen mit Empfehlungsgraden konsentiert. Ergebnisse: Es<br />
wurden insgesamt 19 Empfehlungen für die Kapitel kombinierte multidisziplinäre<br />
Therapie, Therapiemaßnahmen zur Ernährung, Therapiemaßnahmen<br />
zur Bewegung, verhaltenstherapeutische Maßnahmen und Bedeutung<br />
der Elterschulung formuliert und im nominalen Gruppenprozess konsentiert.<br />
Die Empfehlungen zu den Kapiteln adjuvante medikamentöse Therapie und<br />
chirurgische Maßnahmen sollen im Delphi-Verfahren konsentiert werden.<br />
Der Fließtext gibt die Ergebnisse der Literatur im Detail wieder. Ausblick:<br />
Das Kapitel Prävention der S2-Leitlinie soll zeitnah ebenfalls auf S3-Niveau<br />
gehoben werden. Es ist geplant neben der Langfassung der evidenzbasierten<br />
Leitlinie eine Kurzfassung, eine Patientenversion sowie auch einen separaten<br />
Methodenreport zu verfassen. Die Verbreitung erfolgt über die beteiligten<br />
Fachgesellschaften. Neben der Verfügbarkeit im Internet soll die<br />
Leitlinie über Publikationsorgane und Kongressveranstaltungen sowie über<br />
Informationen an Einrichtungen verbreitet werden.<br />
Essanfälle bei Binge Eating Disoder (BED):<br />
Affektregulation oder Verlangen nach Nahrung?<br />
*Simone Munsch (1), Andrea H. Meyer (1), Frank Wilhelm (1)<br />
(1) Universität Basel, Fakultät für Psychologie, Basel, Schweiz<br />
Eine Ecologic Momentary Assessment-Studie (EMA) in einer Gruppe von<br />
28 adipösen Patientinnen mit BED, die anschliessend an einer Behandlungsstudie<br />
teilnahmen zeigt, dass unmittelbar erlebte Verlangen („craving“) nach<br />
bestimmten Nahrungsmitteln sowie das subjektive Ausmaß erlebter Anspannung<br />
die wichtigsten Auslöser von Essanfällen darstellt. Im Anschluss an die<br />
Essanfälle ergibt sich wider Erwarten keine deutliche Reduktion der Spannung<br />
sowie des Verlangens. Diese Resultate sind erstaunlich, insbesondere<br />
da die Patientinnen als häufigste subjektive Gründe für das Initiieren eines<br />
Essnfalls, das Bedürfnis nach Spannungsreduktion sowie das Verlangen nach<br />
Nahrung angaben. Die Resultate werden auf dem Hintergrund bestehender<br />
Affekt-Regulationsmodelle bei BED diskutiert.<br />
Pilotprojekt NRW Glücksspiel Gesundheit zur Diabetesprävention<br />
Heike Pahl-Wurster<br />
Praxis, Mülheim, Deutschland<br />
Bisherige Maßnahmen zur Eindämmung des Diabetes waren nicht erfolgreich.<br />
Neue Konzepte sind daher von großer Bedeutung. Im Rahmen der<br />
3-Schritte-Intervention des Leitfadens Prävention Diabetes mell. (NAFDM)<br />
Eingeladene Vorträge<br />
mit Einsatz des Findrikfragebogens als Screening-Instrument werden Risikopersonen<br />
identifiziert und intensiv während der Interventionsphase betreut.<br />
Durch Einsatz weiterer motivationsfördernder Elemente zur Stärkung<br />
der intrinsischen Motivation und Entwicklung eines Kompetenznetzwerkes<br />
mit Präventionsmanagern Diabetes mell., Ernährungs- und Bewegungsfachkräften<br />
sowie Hausärzten und Apotheken wird die Nachhaltigkeit der Lebensstiländerung<br />
verbessert.<br />
Welche Rolle spielt das Therapieangebot für adipöse Jugendliche? –<br />
ein Programm für alle oder Patienten desgined approach?<br />
Thomas Reinehr<br />
Vestische Kinder- und Jugendklinik, Datteln, Deutschland<br />
Objective: Current care for overweight children is controversial, and only<br />
few data are available concerning the process of care, as well as the outcome<br />
under real-life conditions. Methods: A nationwide survey of treatment<br />
programs for overweight children and adolescents in Germany identified<br />
480 treatment centers. From the 135 institutions, who had agreed to participate<br />
in this study of process of care and outcome, 48 randomly chosen institutions<br />
were included in the study. All 1916 overweight children (mean age<br />
12.6 years, 57 % female, mean BMI 30.0 kg/m²), who presented at these institutions<br />
for lifestyle interventions, were included in this study. Diagnostic<br />
procedures according to guidelines, and the effect of lifestyle interventions<br />
on weight status at end of treatment were analyzed. Results: Screening for<br />
hypertension, disturbed glucose metabolism, and dyslipidemia were performed<br />
in 52 % of the children at baseline and in 10 % at the end of intervention.<br />
51 % of the screened overweight children demonstrated at least one<br />
cardiovascular risk factor (32 % hypertension, 5 % impaired fasting glucose,<br />
1 % diabetes mellitus, 31 % dyslipidemia). Based on an intention-to treat<br />
analysis, 75 % of the children reduced their overweight. The reduction of<br />
overweight varied widely between the treatment institutions. Conclusion:<br />
Overweight reduction is achievable with lifestyle intervention in clinical<br />
practice. However, since the outcome varied widely between different institutions,<br />
and screening for comorbidities was seldomly performed as recommended,<br />
quality criteria for institutions have to be implemented to improve<br />
medical care of overweight children under real-life conditions. A comparison<br />
which program is deal for each obese adolescent is not possible with the data<br />
set due to very different quality of interventions.<br />
Definition des metabolischen Syndroms – how to define the<br />
metabolic syndrome in children and adolescents?<br />
Thomas Reinehr<br />
Vestische Kinder- und Jugendklinik, Datteln, Deutschland<br />
Paediatricians “diagnosed” the Metabolic syndrome (MS) in children and<br />
adolescents increasingly in the recent years to describe the cardiovascular<br />
risk. Multiple definitions of the MS have been proposed for adults agreeing<br />
on the essential components – glucose intolerance, central obesity, hypertension,<br />
and dyslipidemia – but differing in detail. These definitions have been<br />
adapted to children and adolescents by different authors also varying widely<br />
in the criteria. Consequently, the prevalence of the MS is not comparable<br />
between most studies in childhood and adolescence. For example, in one<br />
cohort of obese children, the prevalence of MS varied between 6 % and<br />
39 % depending on the different definitions. Only 9 % of the children fulfilled<br />
all the definitions of the MS for children and adolescents, pointing to a<br />
low degree of overlap between the different proposals for the MS. However,<br />
principal component analysis demonstrated that total cholesterol, triglycerides<br />
and waist circumference explained the majority of the variance between<br />
the analysed children and adolescents in concordance with the concept<br />
of the MS. In order to attain the best definition of the MS in childhood and<br />
adolescence, it would be ideal to study the impact of the different definitions<br />
on later CVD. However, such longitudinal studies over decades are very<br />
difficult to perform and are still lacking. A measurement of early cardiovascular<br />
changes, which is predictive for atherosclerotic disease and already<br />
detectable in childhood, would be an alternative approach. Measuring the intima-media<br />
thickness (IMT) of the common carotid artery, as a non-invasive<br />
marker for early atherosclerotic changes, has been reported to be reliable and<br />
predictive for later CVD. In obese children, the key components of the MS,<br />
impaired glucose intolerance, high waist circumference, and hypertension<br />
were associated with IMT. Impaired glucose tolerance demonstrated the best<br />
predictive value for IMT values, even superior to all proposed definitions of<br />
the MS and the combination with the highest predictive value of IMT (combination<br />
of waist circumference, hypertension and fasting glucose). Since<br />
the proposed definitions of the MS varied widely and were not or only very<br />
weakly related to IMT as a predictive marker of atherosclerosis and later<br />
CVD, an uniform internationally accepted definition for the MS in childhood<br />
and adolescence is urgently needed which is predictive for later CVD and<br />
allows to compare the prevalence data in different studies and populations.<br />
However, the concept of the MS that clustering of risk factor increased the<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
21 9
22 10<br />
Eingeladene Vorträge<br />
risk for atherosclerosis and cardiovascular disease beyond the sum of the<br />
components of the MS has to be proven for children and adolescents. Further<br />
longitudinal outcome-driven studies are needed to prove the concept of the<br />
MS in childhood.<br />
References<br />
1. Reinehr T, Andler W, Denzer C, Siegried W, Mayer H, Wabitsch M: Car-<br />
diovascular risk factors in overweight German children and adolescents:<br />
relation to gender, age, and degree of overweight. Nutr Metab Cardiovasc<br />
Dis 2005; 15:181–187<br />
2. WHO: Alberti KG, Zimmet PZ: Definition, diagnosis and classification of<br />
diabetes mellitus and its complication. Part 1: diagnosis and classification<br />
of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabetes<br />
Med 1998;15:539–593<br />
3. Executive Summary of the Third Report of The National Cholesterol<br />
Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation,<br />
And High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA<br />
2001;285:2486–2497<br />
4. Balkau B, Charles MA: Comment on the provisional report from the<br />
WHO consultation. European Group for the Study of Insulin Resistance<br />
(EGIR). Diabet Med 1999;16:442-3<br />
5. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J; IDF Epidemiology Task Force Consen-<br />
sus Group. The metabolic syndrome--a new worldwide definition. Lancet<br />
2005;366:1059–1062. also available from http://www.idf.org/webdata/<br />
docs/metac_syndrome_def.pdf.<br />
6. Eckel RH, Zimmet PZ: The metabolic syndrome. Lancet 2005;365:1415<br />
7. Kahn R, Buse J, Ferrannini E, Stern M: American Diabetes Association;<br />
European Association for the Study of Diabetes. The metabolic syndrome:<br />
time for a critical appraisal: joint statement from the American Diabetes<br />
Association and the European Association for the Study of Diabetes. Dia-<br />
betes Care 2005;28:2289–2304<br />
8. Weiss R, Dziura J, Burgert TS, Tamborlane WV, Taksali SE, Yeckel CW,<br />
Allen K, Lopes M, Savoye M, Morrison J, Sherwin RS, Caprio S: Obe-<br />
sity and the metabolic syndrome in children and adolescents. N Engl J<br />
Med 2004;350:2362–2374<br />
9. Cook S, Weitzman M, Auinger P, Nguyen M, Dietz WH: Prevalence of a<br />
metabolic syndrome phenotype in adolescents. Findings from the third<br />
National Heath and Nutrition Examination Survery, 1988–1994. Arch Pe-<br />
diatr Adolesc Med 2003;157:821–827<br />
10. Viner RM, Segal TY, Lichtarowicz-Krynska E, Hidmarsh P: Prevalence<br />
of the insulin resistance syndrome in obesity. Arch Dis Child 2005;90:<br />
10–14<br />
11. De Ferranti SD, Gauvreau K, Ludwig DS, Neufeld EJ, Newburger JW,<br />
Rifai N: Prevalence of the metabolic syndrome in American Adolescents:<br />
Findings from the third National Health and Nutrition Examination Sur-<br />
vey. Circulation 2004;110:2494–2497<br />
12. Reinehr T, de Sousa G, Toschke AM, Andler W. Comparison of metabo-<br />
lic syndrome prevalence using eight different definitions: a critical ap-<br />
proach. Arch Dis Child 2007 92: 1067–1072<br />
13. Reinehr T, Wunsch R, de Sousa G, Toschke AM: Relationship between<br />
metabolic syndrome definitions for children and adolescents and intima-<br />
media thickness. Atherosclerosis 2008: 199:193–200<br />
14. Raitakari OT, Juonala M, Kahonen M, Taittonen L, Laitinen T, Maki-<br />
Torkko N, Jarvisalo MJ, Uhari M, Jokinen E, Ronnemaa T, Akerblom<br />
HK, Viikari JS: Cardiovascular risk factors in childhood and carotid ar-<br />
tery intima-media thickness in adulthood: the cardiovascular risk in<br />
young Finns Study. JAMA 2003; 290:2271–2276<br />
15. Davis PH, Dawson JD, Riley WA, Lauer RM: Carotid intima-media<br />
thickness is related to cardiovascular risk factors measured from child-<br />
hood through middle age: The Muscatine study. Circulation 2001;104:<br />
2815–2819<br />
16. Ahluwalia N, Drouet L, Ruidavets JB, Perret B, Amar J, Boccalon H,<br />
Hanaire-Broutin H, Ferrieres J. Metabolic syndrome is associated with<br />
markers of subclinical atherosclerosis in a French population-based sam-<br />
ple. Atherosclerosis 2006;186:345–353<br />
17. Reinehr T, Kiess W, de Sousa G, Stoffel-Wagner B, Wunsch R: Intima-<br />
media thickness in childhood obesity: relations to inflammatory marker,<br />
glucose metabolism, and blood pressure. Metabolism 2006;55:113–118<br />
18. Bots ML, Hofman A, Grobbee DE: Increased common carotid intima-<br />
media thickness. Adaptive response or a reflection of atherosclerosis?<br />
Findings from the Rotterdam Study. Stroke 1997;28:2442–2447<br />
19. Toikka JO, Laine H, Ahotupa M, Haapanen A, Viikari JS, Hartiala JJ,<br />
Raitakari OT Increased Arterial Intima-Media thickness and in Vivo<br />
LDL Oxidation in Young Men With Borderline Hypertension. Hyperten-<br />
sion 2003;36:929–923<br />
20. Atabek ME, Pirgon O, Kivrak AS. Evidence for association between in-<br />
sulin resistance and premature carotid atherosclerosis in childhood obe-<br />
sity. Pediatr Res 2007;61:345–349<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Die soziale Funktion des Stigma. Grundlagen und Modelle der gesellschaftlichen<br />
Konstruktion von Devianz am Beispiel der <strong>Adipositas</strong><br />
*Jens Ried (1), Anja Hilbert (1)<br />
(1) Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Psychologie, Marburg,<br />
Deutschland<br />
Der Erforschung stigmatisierender Einstellungen in konkreten Lebensbereichen<br />
und mit spezifischen Bezugspunkten, z. B. Körpergewicht,<br />
Ethnie oder bestimmte Erkrankungen, ist in den vergangenen Jahren und<br />
Jahrzehnten zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet worden. In der theoretischen<br />
Grundlagenforschung zur sozialen Funktionalität der Stigmata ist im<br />
Verhältnis dazu zwar weniger, dafür aber umso bemerkenswertere Bewegung<br />
zu verzeichnen. Während weitgehende Einigkeit über die identitätsbildende<br />
und -stabilisierende Funktion von Stigmatisierungsprozessen besteht,<br />
sind sowohl deren Ursprung als auch mögliche positive und daher sozial erwünschte<br />
Effekte strittig. Vor diesem Hintergrund wird der Vortrag zunächst<br />
die wichtigsten Entwicklungslinien in der Stigmaforschung ausgehend von<br />
Goffmans grundlegendem Werk bis heute nachzeichnen. Im Folgenden werden<br />
zwei aktuelle Hypothesen zur sozialen Funktion des Stigma vorgestellt<br />
und diskutiert: zum einen ein evolutionär-naturalistisches Erklärungsmodell<br />
(Kurzban & Leary, 2001), zum anderen ein politisch-ethischer Ansatz, der<br />
einen gewissen Grad an Stigmatisierung innerhalb einer Gesellschaft für<br />
wünschenswert erachtet (Arneson, 2007). In der Diskussion werden zudem<br />
gegenwärtig herrschende Konfusionen und Missverständnisse bei der Verwendung<br />
des Begriffs Stigma herausgestellt. In Abgrenzung von den genannten<br />
Theorien wird Stigmatisierung anschließend als soziales Konstrukt<br />
mit negativen gesellschaftlichen Implikationen konzeptualisiert. Schließlich<br />
werden Faktoren für eine differenziertere Verwendung des Stigmabegriffs<br />
sowie Desiderate der theoretischen und empirischen Forschung benannt.<br />
Literatur<br />
Arneson, R.J. (2007). Shame, Stigma and Disgust in the Decent Society.<br />
Journal of Ethics, 11, 31–63.<br />
Goffman, E. (1963). Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity.<br />
Englewood Cliffs: Prentice Hall.<br />
Kurzban, R. & Leary, M.R. (2001). Evolutionary Origins of Stigmatization:<br />
The Functions of Social Exclusion. Psychological Bulletin, 127, 187–208.<br />
Das deutsche Health Technology Assessment (HTA)<br />
zur <strong>Adipositas</strong>chirurgie<br />
*Stefan Sauerland (1), Maren Walgenbach (1)<br />
(1) Universität Witten/Herdecke, Institut für Forschung in der Operativen<br />
Medizin (IFOM), Köln, Deutschland<br />
Hintergrund: Im August 2008 erschien beim DIMDI (Deutsches Institut<br />
für Medizinische Dokumentation und Information) der deutsche HTA-Bericht<br />
zur <strong>Adipositas</strong>chirurgie (Band 73). Die Autoren aus den Universitäten Berlin,<br />
Hannover und Bielefeld haben auf 197 Seiten eine detaillierte Bestandsaufnahme<br />
klinischer und ökonomischer Variablen vorgelegt. Ergebnisse: Dem<br />
Bericht zufolge sind durch bariatrische Operationen starker Gewichtsverlust,<br />
eine Reduktion diverser Komorbiditäten, und eine insgesamt verminderte<br />
Sterblichkeit erreichbar. Diese Effekte sind für etwa 10 Jahre nachweisbar.<br />
Auch wenn noch nicht klar sei, welches Operationsverfahren (Magenband,<br />
Roux-Y-Magenbypass, Schlauchmagen, etc.) bei welcher Patientengruppe<br />
das ideale sei, ist die <strong>Adipositas</strong>chirurgie damit insgesamt kosteneffektiv. Daher<br />
wird empfohlen, die bislang in Deutschland sehr restriktiv gehandhabte<br />
Erstattungspraxis bariatrischer Eingriffe zu überprüfen. Diskussion: Dieser<br />
sehr gut recherchierte HTA-Bericht stellt einen wichtigen Schritt dar, um<br />
die zukünftige Rolle der <strong>Adipositas</strong>chirurgie in Deutschland zu erweitern<br />
und abzugrenzen. Im Vergleich zum Ausland besteht hier noch erheblicher<br />
Nachholbedarf. Zentral für ein breiteres Angebot bariatrischer Maßnahmen<br />
ist die Qualitätssicherung, die vor allem für die langfristige Nachsorge zu<br />
fordern ist. Auch das Thema der Zentrumsbildung und Mindestmengen darf<br />
nicht ausgespart bleiben. Die Vergütung über krankenhausindividuelle Entgelte<br />
auf Basis der DRG muss hierfür ausreichend Spielraum lassen. Auch<br />
chirurgischer Sicht sollten Vergütung und organisatorische Rahmenbedingungen<br />
die individualisierte Auswahl eines bariatrischen Verfahrens nicht<br />
beschränken. Insgesamt ist zu erwarten, dass die <strong>Adipositas</strong>chirurgie in den<br />
nächsten Jahren auch für den Bereich BMI ≤35 (metabolische Chirurgie)<br />
deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Aus diesem Grund ist eine Aktualisierung<br />
des Berichts in einigen Jahren unvermeidbar.<br />
Ernährung von adipösen Schwangeren<br />
Daniela Schmid<br />
Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin, Technische Universität<br />
München, Klinikum rechts der Isar, München, Deutschland<br />
Wie aus den aktuellen Daten der Nationalen Verzehrsstudie II hervorgeht,<br />
liegt in Deutschland die Prävalenz von <strong>Adipositas</strong> (Body-Mass-Index (BMI)<br />
> 30 kg/m²) bei den 20–39-jährigen Frauen bereits bei 11,5 %. Weitere<br />
20,7 % sind mit einem BMI zwischen 25 und 29,9 kg/m² übergewichtig. Adi-
positas, sowie eine übermäßige Gewichtszunahme in der Schwangerschaft<br />
sind jedoch eindeutig mit einem negativen Schwangerschaftsoutcome assoziiert.<br />
Zu den wichtigsten Schwangerschaftskomplikationen zählen unter<br />
anderem Gestationsdiabetes und Präeklampsie. Für das Neugeborene besteht<br />
ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Makrosomie und chronischer<br />
Erkrankungen im späteren Leben. Hinsichtlich der fötalen Programmierung<br />
kommt der mütterlichen <strong>Adipositas</strong> und Überernährung in der Schwangerschaft<br />
in Zusammenhang mit einer fötalen Überernährung, Veränderungen in<br />
der Appetitregulation und des Adipozytenmetabolismus des Neugeborenen<br />
sowie der Prädisposition für <strong>Adipositas</strong> im Erwachsenenalter eine wachsende<br />
Bedeutung zu. Aktuelle Ernährungsempfehlungen basieren derzeit<br />
auf wenigen Studiendaten. Die empfohlene Gewichtszunahme während der<br />
Schwangerschaft orientiert sich am BMI vor der Schwangerschaft. Im Rahmen<br />
einer Lebensstilintervention scheint eine ausgewogene Ernährungsweise<br />
mit niedrigem glykämischen Index, die zu einem moderaten Gewichtsanstieg<br />
von maximal sieben Kilogramm führt, bei adipösen Schwangeren<br />
jedoch vorteilhaft zu sein. Die hausärztliche/gynäkologische Betreuung<br />
adipöser schwangerer Frauen rückt besonders in den Fokus eines primärpräventiven<br />
Ansatzes zur Vermeidung nachteiliger Kurz- und Langzeitfolgen<br />
für die mütterliche und kindliche Gesundheit, wobei mit einer adäquaten<br />
Intervention schon präkonzeptionell begonnen werden sollte.<br />
Das sächsische Präventionsprojekt Diabetes mellitus Typ 2 –<br />
Struktur – Konzepte – Erkenntnisse<br />
Peter E. H. Schwarz<br />
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden,<br />
Medizinische Klinik III, Dresden, Deutschland<br />
Das sächsische Präventionsprojekt Diabetes mellitus Typ 2 fußt auf dem<br />
3-schrittigen Konzept für ein nationales Präventionsprogramm das vom NAF-<br />
DM im Leitfaden Prävention Diabetes mellitus Typ 2 vorgestellt wurde.<br />
1. Die frühzeitige Risikoerkennung mit Hilfe des FINDRISK,<br />
2. die zeitlich begrenzte Intervention mit einem zertifizierten Programm mit<br />
dem Ziel der verbesserten Motivation zu einer Lebensstilveränderung und<br />
3. die anschließend kontinuierliche Intervention zur Erhaltung der Motivati-<br />
on werden durch in Sachsen etablierte Präventionsmanager durchgeführt.<br />
Das seit Anbeginn durchgeführte Qualitätsmanagement sowie das erstmals<br />
angewandte „pay for perfomance“ Modell haben nun erste Ergebnisse generiert<br />
die vorgestellt werden. Die Evaluierung des sächsischen Präventionsprojektes<br />
hat aber auch Schwachstellen und Problembereiche aufgezeigt die<br />
ebenfalls erörtert und dargestellt werden.<br />
Entzündung im Fettgewebe und Insulinresistenz<br />
Thomas Skurk<br />
Technische Universität München, Else Kröner-Fresenius-Zentrum<br />
für Ernährungsmedizin, Freising-Weihenstephan, Deutschland<br />
<strong>Adipositas</strong> ist der wichtigste Promoter der Insulinresistenz und des Typ<br />
2 Diabetes mellitus. Bislang wurden eine Reihe lösliche Faktoren im Plasma<br />
identifiziert die beteiligt sein könnten diese Insulinresistenz auszulösen<br />
und zu unterhalten. Viele dieser Faktoren sind pro-inflammatorischer Natur<br />
und werden auch im Fettgewebe produziert und zumindest manche von<br />
diesen in die Zirkulation abgegeben. Eine Reihe von Zytokinen/Chemokinen<br />
sind im Plasma in erhöhten Spiegeln messbar und charakterisieren<br />
einen chronisch niedrig-gradigen Entzündungszustand der die Insulinresistenz<br />
zu unterhalten vermag. Bislang ist noch weitgehend unklar woher<br />
die erhöhte Kapazität Mediatoren der Entzündung in die Zirkulation abzugeben<br />
stammt. Einen wesentlichen Beitrag leisten sicherlich in das Fettgewebe<br />
eingewanderte Immunzellen, die in einer positiven Abhängigkeit<br />
zum BMI dort nachgewiesen werden können. Wie und warum Fettzellen<br />
diese Immunzellen anlocken ist derzeit Gegenstand intensiver Forschung.<br />
Eine mögliche Ursache liegt in der Vergrößerung der Fettzellen, die regelmäßig<br />
mit der Expansion der Fettgewebsmasse vergesellschaftet ist.<br />
Hypertrophierte Fettzellen zeigen vielfach veränderte metabolische Eigenschaften,<br />
aber auch ein deutlich dysreguliertes Sekretionsmuster welches<br />
überproportional durch die Freisetzung pro-inflammatorischen Faktoren<br />
abgeildet wird. Zelluläre Stressphänome scheinen dafür der Auslöser zu<br />
sein, die z. B. über eine lokale Gewebehypoxie zu einer Überlastung des<br />
endoplasmatischen Retikulums (ER) führen und Kompensationsmechanismen<br />
gegen diese Überlastung anstoßen. ER-Stress stellt demnach ein<br />
mögliches Bindeglied zwischen zellulären Anpassungeprozessen aufgrund<br />
einer vermehrten Gewebeexpansion im Rahmen von Übergewicht und<br />
<strong>Adipositas</strong> und dem Phänomen der damit verbundenen niedrig-gradigen<br />
subklinischen Entzündung dar.<br />
Stereotypisierung von adipösen Kindern und Jugendlichen<br />
durch ihre Altersgenossen<br />
*Ansgar Thiel (1), Manuela Alizadeh (1), Katrin Giel (2),<br />
Stephan Zipfel (2)<br />
Eingeladene Vorträge<br />
(1) Universität Tübingen, Institut für Sportwissenschaft, Tübingen, Deutschland;<br />
(2) Universitätsklinikum Tübingen, Abt. Psychosomatische Medizin<br />
und Psychotherapie, Tübingen, Deutschland<br />
Zielsetzung: Der Vortrag beschäftigt sich mit der sozialen Bedeutung und<br />
Stigmatisierung von <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter in Deutschland.<br />
Dabei geht es um die Frage, wie adipöse Kinder und Jugendliche von ihren<br />
Altersgenossen im Hinblick auf Sympathie, Spielpartnerpräferenz, Aktivität,<br />
Intelligenz und Attraktivität beurteilt werden. Materialien und Methoden:<br />
Insgesamt wurden 454 (230 weibliche, 224 männliche) Kinder und Jugendliche<br />
im Alter von 10–15 Jahren aus Gymnasien und Hauptschulen einer<br />
Universitätsstadt gebeten, sechs Fotografien von adipösen, normalgewichtigen<br />
und normalgewichtigen querschnittsgelähmten Mädchen und Jungen<br />
mithilfe eines Fragebogens zu bewerten. Ergebnisse: Die im Rahmen der<br />
Befragung zu bewertenden adipösen Kinder erhielten im Vergleich zu ihren<br />
nicht behinderten sowie zu ihren körperbehinderten normalgewichtigen Altersgenossen<br />
in allen erfragten Bereichen eine deutlich schlechtere Bewertung<br />
und wurden als unsympathischer, faul, weniger intelligent, unattraktiv<br />
und weniger als Spielkamerad in Frage kommend bezeichnet. Dies gilt<br />
insbesondere für den adipösen Jungen. Zusammenfassung: Befunde aus<br />
vorangegangenen US-amerikanischen Studien zum gesellschaftlichen Bild<br />
von adipösen Menschen werden für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen<br />
bestätigt. So sind negativ getönte Stereotypisierungen adipöser Menschen<br />
bereits im Kindes- und Jugendalter beobachtbar.<br />
Rauchen und <strong>Adipositas</strong> – eine verhängnisvolle Beziehung?<br />
Norbert Thürauf<br />
Psychiatrische Klinik, Sensorik, Erlangen, Deutschland<br />
Rauchen und <strong>Adipositas</strong> gelten heute als die wichtigsten Ursachen für vermeidbaren<br />
vorzeitigen Tod. Beide Erkrankungen zeichnen sich durch eine<br />
hohe Prävalenz aus: 30–35 % der Deutschen zwischen 45 und 65 Jahren sind<br />
adipös und ca. 2 % gelten mit einem BMI über 40 als extrem morbid/adipös.<br />
Jedes fünfte Kind in Deutschland leidet an Übergewicht! 4 % der Kinder und<br />
5–8 % der Jugendlichen sind adipös. Mit ca. 30 % besteht eine ähnliche Prävalenz<br />
für das Rauchen und Erstkontakt mit Nikotin wird im Mittel im Alter<br />
von 12,5 Jahren beschrieben. Für beide Erkrankungen sind verschiedene<br />
Wechselbeziehungen beschrieben. Adipöse Raucherinnen und Raucher verlieren<br />
gegenüber normalgewichtigen Nichtraucherinnen und Nichtrauchern<br />
gut 13 Jahre Lebenserwartung. Die bekannte Gewichtszunahme nach Rauchstopp<br />
stellt einen Hauptgrund für Therapieincompliance bei Frauen dar und<br />
Gewichtsprobleme/<strong>Adipositas</strong> während der Pubertät werden als Risikofaktor<br />
für eine ‚Raucherkarriere’ diskutiert. Für die Gewichtsreduktion während<br />
des Rauchens werden verschiedene Wirkungsmechanismen verantwortlich<br />
gemacht wie z. B. veränderter Stoffwechsel und erhöhter Energieverbrauch,<br />
Aktivierung der Fettoxidation, Insulinresistenz, anti-östrogene Wirkungen<br />
von Tabakstoffen, Hemmung von Appetit und Hungergefühl durch Nikotin<br />
etc.. Neuere tierexperimentelle Untersuchungen zeigen jedoch, dass Nikotin<br />
auf Dauer das Verlangen nach Nahrung erhöht. An Nikotin gewöhnte Mäuse,<br />
ließen sie sich leichter von Futter verführen als Artgenossen, die kein Nikotin<br />
erhalten hatten. Der Grund dafür sind wahrscheinlich dauerhafte Veränderungen<br />
im Belohnungszentrum des Gehirns. Aufgrund dieser Ergebnisse<br />
könnte die typische Gewichtszunahme bei ehemaligen Rauchern auch durch<br />
regelmäßigen Nikotinkonsum vor Entzug verursacht sein.<br />
Konzepte in der Ernährungsberatung – die Situation in den USA<br />
Silke Ullmann<br />
Almased USA, Inc, Greensboro, USA<br />
Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> sind ein weltweit wachsendes Gesundheitsproblem,<br />
besonders in den USA. Oftmals kommt es bereits im jungen Alter<br />
zu einer kontinuierlichen Gewichtszunahme, die mit Gesundheitsrisiken geprägt<br />
ist. Ernährungswissenschaftler, Ernährungsberater und Ärzte sind daher<br />
besonders gefragt um eine bestmögliche Lösung für Prävention bzw. Intervention<br />
zu finden. Es ist wichtig zu erkennen, wann der Patient bereit ist, sich<br />
helfen zu lassen und wie man folglich damit umgeht. Eine Variante ist das<br />
„Motivationsfördernde Interviewing“. Darin wird nach verbesserter Selbstwirksamkeit<br />
und persönlicher Kontrolle geeifert, um eine Verhaltensveränderung<br />
des Patienten hervorzurufen. Weitere Beratungskonzepte die in den USA<br />
durchgeführt werden, sind das Durchbrechen einer sogenannten Verhaltenskette<br />
und die grundlegenden Erkenntnisse der Ernährungsberatung, wie etwa<br />
spezifische Zielsetzung und realistische Erwartungen zu setzen. Da sich der<br />
Lebenstil innerhalb der letzten Jahrzehnte wesentlich verändert hat, werden in<br />
den USA verschiedene Studien durchgeführt, die sich diesem Lebensstil speziell<br />
anpassen. Zwei Studien mit eher unüblichen Herangehensweisen sollen<br />
dies beispielhaft erläutern, hier: die Unterstützung von sportlicher Bewegung<br />
bei Kindern durch bewegungsreiche Videospiele und der Einsatz von Laien<br />
als Vertrauensperson zur Lebensstilintervention.Mit verbesserter Ernährungsberatung<br />
und einer Forschung, die dem heutigen Lebensstil angepasst ist,<br />
kann man dem Problem des Übergewichts konsequenter entgegentreten.<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
23 11
24 12<br />
Eingeladene Vorträge<br />
Psychosoziale Prädiktoren der Gewichtsabnahme<br />
von übergewichtigen Kindern und Jugendlichen –<br />
Hyperaktivät und familiäre Determinanten<br />
*Andreas van Egmond-Fröhlich (1), U. Ravens-Sieberer (2), M. Bullinger (2),<br />
C. Goldapp (3), R. Mann (3), R. W. Holl (4), U. Hoffmeister (4),<br />
T. Reinehr (5), W. Westenhöfer (6)<br />
(1) Kinder-Rehaklinik Schönsicht, Berchtesgaden, Deutschland; (2) Universitätsklinikum<br />
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland; (3) Bundeszentrale<br />
für Gesundheitliche Aufklärung, Köln, Deutschland; (4) Universität<br />
Ulm, Institut für Epidemiologie, Ulm, Deutschland; (5) Universität Witten-<br />
Herdecke, Vestische Kinderklinik, Datteln, Deutschland; (6) Hochschule<br />
für Angewandte Wissenschaften, Fachbereich Ökotrophologie, Hamburg,<br />
Deutschland<br />
Einleitung und Ziel: Die EVAKuJ-Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche<br />
Aufklärung bildet die vielfältige Versorgungsrealität der deutschen<br />
Übergewichtbehandlungs ab. Die Analyse psychosozialer Erfolgsprädiktoren<br />
dient u. a. der Differentialindikationsstellung. Patienten und Methode: 870<br />
8–16-jährige (BMI>p90) von ambulanten Anbietern wurden einbezogen.<br />
Die Eltern (Bezugspersonen) wurden vor Behandlungsbeginn u. a. zum sozioökonomischen<br />
Status, zum Familienklima, zum familiären Risiko, und<br />
zur psychosozialen Anpassung ihres Kindes (SDQ) und die Kinder zu Ess-,<br />
Ernährungs- und Bewegungsverhalten, elterlicher Unterstützung, Selbstwirksamkeit<br />
und Lebensqualität befragt. Die Korrelation der obigen psychometrischen<br />
Basisvariablen mit dem Erfolgsparameter, Änderung des SDS-Scores<br />
des Körpermassenindex über die Dauer der Behandlung ( BMI-sds), wurde<br />
untersucht. Ergebnis: Der Einfluss von BMI-SDS, Behandlungsdauer und<br />
Cluster wurde kontrolliert. Stärkster psychosozialer Erfolgsprädiktor war ein<br />
niedriger Wert der SDQ-Skala ‚Hyperaktivität’ (SDQ-H). Zwei Items dieser<br />
Skala, für Unaufmerksamkeit und Impulsivität (nicht Hypermotorik), waren<br />
in multipler linearer Regression prädiktiv. Sekundäre Prädiktoren waren Interaktionen<br />
zwischen SDQ-H und Alter sowie elterlicher Unterstützung. Im<br />
Querschnitt korreliert der SDQ-H mit Familienvariablen. SDQ-H prädizierte<br />
die Veränderungen von Störbarkeit des Essverhaltens und elterlicher Unterstützung<br />
als potentielle Mediatoren. Schlussfolgerung: Unaufmerksamkeit<br />
und Impulsivität beeinträchtigen den Behandlungserfolg in einem familiären<br />
Kontext. Die Rolle und Modifizierbarkeit der Selbstregulation muss in weiteren<br />
Untersuchungen aufgedeckt werden.<br />
Respiratorische Comorbidität der pädiatrischen <strong>Adipositas</strong><br />
*Andreas van Egmond-Fröhlich (1), J. Nielinger (2), G. Schmiederer (3),<br />
T. Spindler (4), D. Kiosz (5)<br />
(1) Kinder-Rehaklinik Schönsicht, Berchtesgaden, Deutschland; (2) CJD<br />
Garz, Garz, Deutschland; (3) Fachklinik Gaißach, Gaißach, Deutschland;<br />
(4) Fachklinik Wangen, Wangen, Deutschland; (5) Universität Kiel, Institut<br />
für Humanernährung, Kiel, Deutschland<br />
Einleitung und Ziel: Die Prävalenz von Atemwegsbeschwerden und<br />
Asthmadiagnosen und ist bei adipöse Kindern aus umstrittenen Gründen<br />
erhöht. Patienten und Methode: Konsekutive 9–17-jährige Rehabilitanden<br />
mit <strong>Adipositas</strong> wurden multizentrisch bzgl. respiratorischer Beschwerden<br />
befragt. Bei Vordiagnose Asthma bronchiale und/oder Symptomatik wurde<br />
mittels Lungenfunktion, standardisierter Laufprovokationstestung, Histaminprovokationstestung<br />
und Allergie-Tests zu Beginn und Ende der Reha<br />
untersucht. Ergebnis: 79 Patienten (48 % Mädchen) im Alter von durchschnittlich<br />
13,3±2,2 Jahren mit einem BMI-SDS von 2,67±0,56 erfüllten<br />
die Einschlusskriterien. Ein Asthma wurde bei 21 vordiagnostiziert (VA+)<br />
und bei 58 nicht (VA-). VA+ wiesen eine signifikant niedrigere total lung<br />
capacity (p
Bloggen Sie schon<br />
Das Blog der <strong>Adipositas</strong> Stiftung Deutschland<br />
sucht Sie als Autor.<br />
Mehr Informationen finden Sie unter:<br />
http://blog.adipositas-stiftung.org/autor/<br />
<strong>Adipositas</strong> Stiftung Deutschland gGmbH<br />
www.adipositas-stiftung.org kontakt@adipositas-stiftung.org
26 14<br />
Freie Vorträge: Genetik, molekulare Mechanismen, pränatale Prägung<br />
körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden und die Funktionsfähigkeit<br />
im Alltag in der subjektiven Bewertung der Betroffenen (bei Kindern auch<br />
aus der Sicht der Eltern). Mittlerweile liegen zahlreiche Arbeiten vor, die die<br />
Lebensqualität von adipösen und übergewichtigen im Vergleich zu normalgewichtigen<br />
Kindern untersuchen. Die Befunde sind nicht immer eindeutig.<br />
Die methodischen Unterschiede zwischen den Studien sind groß. Im Rahmen<br />
des Vortrags soll ein Überblick zur aktuellen nationalen wie internationalen<br />
Befundlage gegeben und die Ergebnisse systematisiert werden. Dabei werden<br />
Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht der Kinder, Grad des Übergewichts<br />
und Behandlungsstatus diskutiert, um Risikogruppen für eine verminderte<br />
Lebensqualität adipöser Kinder und Jugendlicher herauszuarbeiten.<br />
Selbstkontrolle und Ernährung: Mission impossible?<br />
Petra Warschburger<br />
Universität Potsdam, Beratungspsychologie, Potsdam, Deutschland<br />
Unter Selbstregulation versteht man bewusste und unbewusste psychische<br />
Vorgänge, mit denen Personen ihre Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse<br />
und Handlungen steuern. Die Behandlung der <strong>Adipositas</strong> erfordert von den<br />
Betroffenen eine grundlegende und dauerhafte Änderung ihrer Lebensstilgewohnheiten<br />
– vor allem bezogen auf die Ernährung und Bewegung. Solche<br />
komplexen Verhaltensänderungen stellen hohe Anforderungen an die Selbstregulationsfähigkeiten:<br />
Es geht darum eine dauerhafte, langfristige Gewichtsreduktion<br />
zu erzielen, und deshalb trotz Appetit auf den leckeren Nachtisch<br />
zu verzichten („delay of gratification“), in unangenehmen Situationen nicht<br />
auf Nahrung zurückzugreifen, um die negativen Emotionen zu kontrollieren<br />
(„affect regulation“), sich ständig hinsichtlich seiner Ernährung und Gewichts<br />
zu beobachten („self-monitoring“), gesundheitsbewusstes Ess- und<br />
Ernährungsgewohnheiten aufzubauen, um nur einige Beispiele zu nennen.<br />
Die Betroffenen müssen lernen, ihr eigenes Ernährungs- und Bewegungsverhalten<br />
so zu managen, dass es langfristig zu einer Gewichtsreduktion kommt<br />
(„Selbstmanagement“). Dies ist eine lebenslange Aufgabe. Die Fähigkeiten<br />
zur Selbstregulation sind wohl angeboren – sie müssen aber gerade in den ersten<br />
Lebensjahren in Interaktion mit der Umgebung gefördert und entwickelt<br />
werden. Menschen unterscheiden sich im Ausmaß ihrer Selbstregulationsfähigkeiten<br />
voneinander. Aktuelle Behandlungsprogramme fokussieren sehr<br />
stark auf die Einübung und Etablierung von Selbstregulationsfertigkeiten, um<br />
die Betroffenen zu befähigen, ihre Ernährung und Bewegung umzustellen –<br />
dies gilt auch für die Programme für Kinder und Jugendliche. Im Rahmen des<br />
Vortrags soll diskutiert werden, ob und in wieweit sich Hinweise auf verminderte<br />
Selbstregulationsfähigkeiten bei übergewichtigen und adipösen Kindern<br />
und Jugendlichen finden und ob langfristig Selbstregulation angesichts<br />
des hohen Belohnungscharakters von Nahrung möglich ist.<br />
Die Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin<br />
Johannes Georg Wechsler<br />
Krankenhaus Barmherzige Brüder, Abteilung Innere Medizin, München,<br />
Deutschland<br />
Für eine leitlinienorientierte, strukturierte und standardisierte Behandlung<br />
der <strong>Adipositas</strong> eignen sich am besten Schwerpunktpraxen für Ernährungsmedizin.<br />
Erfolgreiche <strong>Adipositas</strong>behandlung muss leitlinienorientiert und langfristig<br />
angelegt sein. Deshalb bietet sich hierfür bevorzugt der ambulante Bereich an.<br />
Da es in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 3000 ausgebildete Ernährungsmediziner<br />
gibt, für diese Berufsbezeichnung liegt auch die Anerkennung<br />
von Landesärztekammern vor, war es naheliegend das Modell von<br />
Schwerpunktpraxen auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin und nicht primär<br />
der <strong>Adipositas</strong> anzusiedeln (Aktuelle Ernährungsmedizin 2003 / 28, 45–49).<br />
Der Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner (BDEM) hat bereits<br />
im Jahre 2004 Qualitätskriterien für die Einrichtung von Schwerpunktpraxen<br />
Ernährungsmedizin erstellt. Behandlungsziel einer Schwerpunktpraxis<br />
Ernährungsmedizin ist es die Qualität der Behandlung von Patienten mit<br />
ernährungsbedingten Erkrankungen und von Patienten mit <strong>Adipositas</strong> zu<br />
verbessern und langfristig Folgeerkrankungen zu vermeiden. Die strukturellen<br />
und personellen Vorraussetzungen für die Schwerpunktpraxis sind<br />
klar definiert, so ist die Ausbildung als Ernährungsmediziner erforderlich,<br />
ebenso müssen Ernährungsfachkraft, Verhaltenstherapeut und Bewegungstherapeut<br />
eine standardisierte Ausbildung nachweisen. Die Therapiekonzeption<br />
liegt in der ärztlichen Entscheidung, allerdings müssen Leitlinien<br />
eingehalten sein. Langfristige Behandlungskonzepte müssen ebenso angeboten<br />
werden, wie regelmäßige Gruppentherapien, die interdisziplinär aus<br />
Verhaltens-, Ernährungs- und Bewegungstherapie bestehen. Der Arzt steht<br />
im Mittelpunkt der Schwerpunktpraxis und des therapeutischen Teams, er<br />
stellt die Praxis für begleitende Diagnostik und Therapie sowie Räume für<br />
Schulungen, Beratungen und Organisation. Er trägt auch die wirtschaftliche<br />
Verantwortung. Es ist Hauptaufgabe des Arztes das interdisziplinäre Therapiekonzept<br />
zu koordinieren und die Indikationsstellung für die Behandlung<br />
sowie die medizinische Betreuung und Verantwortung während der Therapie<br />
zu übernehmen. Das Therapiespektrum muss verantwortungsbewusst und<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
leitlinienorientiert eingesetzt werden, dies gilt für spezielle Ernährungsformen<br />
sowie für die Behandlung von Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> durch<br />
Formula-Diäten und Reduktionsdiäten einschließlich psychologischer Führung<br />
und Bewegungstherapie, bis hin zum Einsatz von Medikamenten und<br />
chirurgischen Maßnahmen. Neben dem Einsatz chirurgischer Maßnahmen,<br />
wie z. B. der Banding-Operation, sind auch plastisch-chirurgische Maßnahmen<br />
oder Apherese-Verfahren zu diskutieren. Regelmäßige Dokumentation<br />
und Qualitätssicherung ist wesentliche Vorraussetzung. Die Zertifizierung<br />
der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin erfolgt durch den BDEM (Bundesverband<br />
Deutscher Ernährungsmediziner, www.bdem.de). Derzeit sind<br />
mehr als 50 Schwerpunktpraxen zertifiziert. Durch Verhandlungen mit den<br />
Ärztekammern und den Krankenkassen sollen sowohl Anerkennung auf dem<br />
Gebiet der Weiterbildung als auch der Finanzierung erfolgen.<br />
Freie Vorträge: Genetik, molekulare Mechanismen,<br />
pränatale Prägung<br />
Einfluss fettreicher Ernährung auf die Gene des Endocannabinoid-<br />
Systems im Fettgewebe und Skelettmuskel des Menschen<br />
*Stefan Engeli (1), Anne-Christin Lehmann (2), Jana Böhnke (2),<br />
Jürgen Janke (2), Kerstin Gorzelniak (2), Anke Strauß (2),<br />
Susanne Wiesner (3), Jens Jordan (1)<br />
(1) Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Klinische Pharmakologie,<br />
Hannover, Deutschland; (2) Charité Universitätsmedizin Berlin,<br />
Experimental & Clinical Research Center, Berlin, Deutschland; (3) HELIOS<br />
Klinikum Berlin-Buch, Berlin, Deutschland<br />
Zielsetzung: Bei <strong>Adipositas</strong> liegen erhöhte Konzentrationen von Endocannabinoiden<br />
im Blut und im Fettgewebe des Menschen vor. Im Tiermodell<br />
hemmt fettreiche Ernährung in der Leber den Abbau der Endocannabinoide.<br />
Wir überprüften den Einfluss des Nahrungsfettgehaltes auf die Expression<br />
der Gene des Endocannabinoid-Systems (ECS) im subkutanen Fettgewebe<br />
und im Skelettmuskel des Menschen. Material und Methoden: Achtzehn<br />
schlanke und 15 adipöse gesunde Frauen und Männer nahmen an einer randomisierten<br />
cross-over Studie teil. Diese bestand aus einer Stabilisierungsphase<br />
(30 % Fettanteil am Kaloriengehalt), einer Phase mit 15 % oder 45 % Fettanteil,<br />
gefolgt von 30 % Fettanteil, gefolgt von 45 % oder 15 % Fettanteil. Jede<br />
Phase dauerte 2 Wochen bei isokalorisch geplanter Kalorienaufnahme. Am<br />
Ende der Niedrig- und Hochfettphasen wurde die Expression von 6 Genen<br />
des ECS in Fettgewebe- und Muskelbiopsien bestimmt. Ergebnisse: Körpergewicht,<br />
Taillenumfang und Körperfettanteil der Probanden veränderten sich<br />
während der gesamten Studie nicht. Signifikante Anstiege des LDL- und HDL-<br />
Cholesterins sowie des hs-CRP zeigten die Wirksamkeit der Hochfettdiät. Im<br />
Fettgewebe wurde kein Einfluss des Nahrungsfettgehalts auf die Expression<br />
der ECS-Gene gefunden. Die gesteigerte Expression der Diacylglycerol-<br />
Lipase und die verminderte Expression der Monoglycerid-Lipase (MGL)<br />
und der Fettsäureamid-Hydrolase weisen aber auf die Fehlregulation des ECS<br />
bei <strong>Adipositas</strong> hin. Im Skelettmuskel zeigte sich eine verminderte Expression<br />
der Gene des CB1-Rezeptors und der MGL unter fettreicher Ernährung. <strong>Adipositas</strong><br />
hatte keinen Einfluss auf die ECS-Gene im Skelettmuskel. Zusammenfassung:<br />
Der Nahrungsfettgehalt erklärt die veränderte Expression von<br />
ECS-Genen im Fettgewebe bei <strong>Adipositas</strong> nicht. Im Skelettmuskel dagegen<br />
kann Fett aus der Nahrung zur Fehlregulation des ECS führen, möglicherweise<br />
durch Hemmung der Degradation von Endocannabinoiden.<br />
Einfluss der Nahrungsaufnahme auf zirkulierendes ADMA<br />
*Stefan Engeli (1), Anne-Christin Lehmann (2), Jana Böhnke (2),<br />
Dimitrios Tsikas (1), Jens Jordan (1)<br />
(1) Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Klinische Pharmakologie,<br />
Hannover, Deutschland; (2) Charité Universitätsmedizin Berlin,<br />
Experimental & Clinical Research Center, Berlin, Deutschland<br />
Zielsetzung: Bei adipösen Patienten wurde eine Zunahme der Plasmakonzentration<br />
des endogenen NO-Synthase-Inhibitors ADMA (asymmetrisches<br />
Dimethylarginin) beschrieben. Bei Typ 2 Diabetikern wurde nach Einnahme<br />
einer fettreichen Testmahlzeit eine akute Zunahme der Plasmakonzentration<br />
von ADMA beobachtet. Ziel der vorliegenden Studie war es, den Einfluss<br />
des Nahrungsfettes auf die ADMA-Plasmakonzentrationen zu charakterisieren.<br />
Material únd Methoden: An der Studie nahmen 18 schlanke und<br />
15 adipöse gesunde Frauen und Männer teil. Die randomisierte cross-over<br />
Studie bestand aus einer Stabilisierungsphase (30 % Fettanteil am Kaloriengehalt),<br />
einer Phase mit 15 % oder 45 % Fettanteil, einer Phase mit 30 %<br />
Fettanteil und einer Phase mit 45 % oder 15 % Fettanteil. Jede Phase dauerte<br />
2 Wochen bei isokalorischer Kalorienaufnahme. Am Ende der Niedrig-<br />
und Hochfettphasen wurde den Probanden morgens nach 12h Fasten eine<br />
Testmahlzeit serviert, die dem Fett- und Kohlenhydratanteil der jeweiligen<br />
Phase entsprach und mit 5 kcal/kg Körpergewicht berechnet wurde. ADMA<br />
im Plasma wurde nüchtern sowie 1h und 2h nach Beginn der Testmahlzeit<br />
mittels GC-MS/MS und einem deuterierten Standard bestimmt. Ergebnisse:
Freie Vorträge: Genetik, molekulare Mechanismen, pränatale Prägung<br />
Bei den schlanken Probanden stiegen die zirkulierenden ADMA-Konzentrationen<br />
nach 2h jeweils signifikant um 6±1 % bei kohlenhydratreicher<br />
und um 8±1 % bei fettreicher Testmahlzeit an (p=ns für den Einfluss des<br />
Fettgehalts). Bei den adipösen Probanden dagegen änderte sich die ADMA-<br />
Konzentration nach Nahrungsaufnahme nicht. Die ADMA-Konzentrationen<br />
im nüchternen Zustand waren unabhängig von der Nahrungsfettzufuhr:<br />
518±18 nM (schlank-15 %) vs. 516±16 nM (schlank-45 %) vs. 528±14 nM<br />
(adipös-15 %) vs. 521±17 nM (adipös-45 %). Zusammenfassung: Akute<br />
und chronische Änderungen des Fettgehalts der Nahrung haben keinen wesentlichen<br />
Einfluss auf zirkulierende ADMA-Konzentrationen und können<br />
somit deren Steigerung bei <strong>Adipositas</strong> nicht erklären.<br />
Expression des Capsaicin-Rezeptors TRPV1<br />
im Fettgewebe des Menschen<br />
*Stefan Engeli (1), Matthias Kern (2), Jürgen Janke (3),<br />
Kerstin Gorzelniak (3), Jens Jordan (1), Matthias Blüher (2)<br />
(1) Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Klinische Pharmakologie,<br />
Hannover, Deutschland; (2) Universitätsklinikum Leipzig, Medizinische<br />
Klinik III, Leipzig, Deutschland; (3) Charité Universitätsmedizin Berlin,<br />
Experimental & Clinical Research Center, Berlin, Deutschland<br />
Zielsetzung: Die Aktivierung des Capsaicin-Rezeptors TRPV1 hemmt<br />
im Tiermodell die Adipogenese und schützt vor diät-induzierter <strong>Adipositas</strong>.<br />
Außerdem wurde eine verringerte Expression von TRPV1 im viszeralen<br />
Fettgwebe adipöser Mäuse beschrieben. Zur Klärung der Regulation von<br />
TRPV1 bei der <strong>Adipositas</strong> des Menschen untersuchten wir dessen Expression<br />
im Fettgewebe. Material und Methoden: TRPV1 mRNA-Expression<br />
wurde mittels real-time RT-PCR bestimmt. Wir verglichen undifferenzierte<br />
und in vitro differenzierte humane Adipocyten (n=6 Experimente), schlanke,<br />
subkutan-adipöse und viszeral-adipöse Patienten (n=84) sowie adipöse Patienten<br />
vor und nach 5 % Gewichtsreduktion (n=26). Ergebnisse: Während<br />
der in vitro Adipogenese primärer humaner Präadipocyten verdoppelte sich<br />
die TRPV1 Expression (p
28 16<br />
Freie Vorträge: Chirurgische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
kardiovaskulärer Ursachen assoziiert. Zusammenfassung: Im Gegensatz<br />
zur weit verbreiteten Meinung, Adiponektin sei ein protektives Molekül,<br />
war bei Personen mittlerem bis hohem aboluten Koronarrisiko Adiponektin<br />
positiv mit dem Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben, assoziiert.<br />
Dieses überraschende Ergebnis wurde inzwischen in anderen Studien<br />
bestätigt. Zukünftige Forschungsarbeiten werden klären, ob erhöhtes<br />
Adiponektin tatsächlich immer protektiv wirkt oder ob es auch schädliche<br />
Wirkungen entfalten kann.<br />
Gen-Gen-Interaktion zwischen APOA5 und USF1<br />
*Paula Rößler (1), Jens Baumert (1), Christian Herder (2),<br />
Chrisa Meisinger (1), H. -Erich Wichmann (1), Martin Klingenspor (3),<br />
Wolfgang Rathmann (4), Thomas Illig (1), Harald Grallert (1)<br />
(1) Helmholtz-Zentrum München, Epidemiologie, Neuherberg, Deutschland;<br />
(2) Heinrich-Heine-Universität, Deutsche Diabetesklinik, Düsseldorf,<br />
Deutschland; (3) TU München, Molekulare Ernährungsmedizin, Freising,<br />
Deutschland; (4) Heinrich-Heine-Universität, Institut für Biometrie und<br />
Epidemiologie, Düsseldorf, Deutschland<br />
Weltweit zeigt das Metabolische Syndrom als ein Cluster von Risikofaktoren<br />
für kardiovaskuläre Erkrankungen einen besorgniserregenden Prävalenzanstieg.<br />
Mehrere Studien haben Assoziationen von sowohl Apolipoprotein<br />
A5 (APOA5)-Genvarianten als auch von Genvarianten von dessen<br />
Transkriptionsfaktor Upstream Stimulatory Factor 1 (USF1) mit erhöhten<br />
Blutlipidspiegeln und anderen diagnostischen Markern des Metabolischen<br />
Syndroms gezeigt. In der vorliegenden Studie haben wir eine mögliche<br />
Gen-Gen-Interaktion zwischen diesen beiden Genen auf das Risiko für Metabolisches<br />
Syndrom untersucht. Dafür haben wir Daten aus dem bevölkerungsbezogenen<br />
KORA Augsburg Survey S4 (1999/2001) mit 1622 Män-<br />
nern und Frauen im Alter zwischen 55 und 74 Jahren genutzt. Zehn APO5-<br />
Einzelbasenaustausche (SNPs) wurden mit acht USF1-SNPs kombiniert.<br />
Die Interaktionen wurden mit Hilfe der logistischen Regression in einem<br />
additiven Modell mit Adjustierung für Alter und Geschlecht berechnet. Zur<br />
Diagnose des Metabolischen Syndroms haben wir die Definition des National<br />
Cholesterol Education Program´s Adult Treatment Panel III herangezogen.<br />
Die Prävalenz für Metabolisches Syndrom in unserer Studienpopulation<br />
betrug 41 %. In der Studienpopulation zeigten drei SNP-Kombinationen<br />
eine signifikante Gen-Gen-Interaktion (ohne Korrektur für multiples Testen),<br />
jede mit einem niedrigeren Risiko für Metabolisches Syndrom assoziiert<br />
(p-Werte zwischen 0,024 und 0,047). Die Odds Ratios lagen zwischen<br />
0,33 und 0,40, jeweils für beide seltenen Allele im homozygoten Zustand.<br />
Diese Ergebnisse könnten auf einen möglichen Gen-Gen-Interaktionseffekt<br />
zwischen APOA5 und USF1-Genvarianten auf das Risiko eines Metabolischen<br />
Syndroms hinweisen.<br />
Freie Vorträge: Chirurgische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
Männlicher Hypogonadismus bei ausgeprägter <strong>Adipositas</strong> –<br />
Veränderungen nach chirurgisch-induziertem Gewichtsverlust<br />
Barbara Ernst (1), Martin Thurnheer (1), *Bernd Schultes (1)<br />
(1) Kantonsspital St. Gallen, <strong>Adipositas</strong>zentrum, Rorschach, Schweiz<br />
Zielsetzung: Wir untersuchten die Prävalenz von Hypogonadismus bei<br />
Männern mit ausgeprägter <strong>Adipositas</strong> (BMI>35 kg/m 2 ) sowie Veränderungen<br />
der Konzentration von Testosteron und Sex-Hormon-bindendem-<br />
Globulin (SHBG) ein Jahr nach erfolgter Magenbypassoperation. Materialien<br />
und Methoden: Bei insgesamt 97 adipösen Männern, die bezüglich<br />
einer bariatrischen Operation evaluiert wurden, wurde die gesamt-Testosteron<br />
sowie SHBG Konzentration gemessen. In einer Untergruppe von<br />
11 adipösen Männern wurden ein Jahr nach der bariatrischen Operation erneut<br />
die entsprechenden Blutparameter bestimmt. Ergebnisse: Insgesamt zeigten<br />
42 % der schwer adipösen Männern eine gesamt-Testosteron Konzentration<br />
12 nmol/l. Ein Jahr nach der Magen-Bypass-Operation war<br />
bei den 11 untersuchten Männern das Körpergewicht im Mittel um<br />
53±14 kg gesunken. Die gesamt-Testosteron Konzentration stieg um 64 %<br />
an (von 8.4±2.8 auf 13.8±5.2 nmol/l, P=0.001). Da auch die SHBG-Konzentration<br />
um 107 % (von 20.6±7.8 auf 42.6±19.4 nmol/l, P=0.001) anstieg,<br />
zeigte sich kein signifikanter Anstieg des freien-Testosterons (vorher:<br />
0.2±0.1 nmol/l, nachher: 0.3±0.1 nmol/l; P=0.126). Zusammenfassung:<br />
Erwartungsgemäss zeigt unsere Studie eine hohe Prävalenz von Hypogonadismus<br />
bei Männern mit ausgeprägter <strong>Adipositas</strong>. Nach einem ausgeprägten<br />
Gewichtsverlust steigt die gesamt-Testosteron Konzentration in den meisten<br />
Fällen deutlich an, was eindeutig belegt, dass der Hypogonadismus Folge<br />
und nicht Ursache der <strong>Adipositas</strong> ist. Offen bleibt trotzdessen die Frage,<br />
ob adipöse Männer mit Hypogonadismus von einer Testosteronsubstitution<br />
profitieren, insbesondere wenn eine ausgeprägte Gewichtsreduktion dauerhaft<br />
nicht zu erreichen ist.<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Langzeitergebnisse nach bariatrischer Operation bei morbid Adipösen<br />
Johann F. Kinzl<br />
Univ. Klinik f. Psychosomatische Medizin, Innsbruck, Österreich<br />
Zielsetzung: Wenig ist über die Langzeitfolgen einer bariatrischen Operation<br />
bei morbid Adipösen bekannt. Marterialien: In der vorliegenden Studie<br />
wurden 114 Probanden (91 Frauen, 23 Männer) untersucht, die sich vor mindestens<br />
sechs Jahren ein Magenband einsetzen ließen, da alle konservativen<br />
Therapiemaßnahmen scheiterten. Ergebnisse: Das präoperative Durschnittsgewicht<br />
lag bei den Frauen bei einem BMI von 44,7, bei den Männern bei<br />
47,8. Der durchschnittliche BMI zum Untersuchungszeitpunkt lag bei den<br />
Frauen bei 29,4, bei den Männern bei 33,9. Das angepeilte Gewicht haben<br />
knapp 50 % der Untersuchten erreicht, wobei die Zufriedenheit mit der Gewichtsabnahme<br />
mit 84 % bei den Frauen und 76 % bei den Männern hoch war.<br />
Ein Großteil der Untersuchten würden den Eingriff noch einmal machen lassen.<br />
Bei etwa einem Viertel der Frauen und einem Drittel der Männer war das<br />
postoperative Essverhalten weiterhinh gestört oder noch gestörter als präoperativ.<br />
Die postoperative Lebensqualität wurde von den Frauen tendenziell höher<br />
eingeschätzt als von den Männern. Mehr als drei Viertel der Untersuchten<br />
(Frauen > Männer) berichteten über eine Verbesserung der Stimmungslage,<br />
der Schlafqualität, der körperlichen und seelischen belastbarkeit, waren zufriedener<br />
mit ihrem Sexualleben und sozial aktiver. Auch erlebte sich ein<br />
Großteil als körperlich attraktiver, auch wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil<br />
der Probanden (Frauen > Männer) über negative Auswirkungen der starken<br />
Gewichtsabnahme auf den Körper berichteten. Zusammenfassung: Diese<br />
und weitere Ergebisse der Studie werden dargestellt und diskutiert.<br />
Schlauchmagenbildung: Indikation, Durchführung und Nachsorge<br />
*Matthias Schlensak (1), Jochen Erhard (1)<br />
(1) Klinikum Niederrhein, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie,<br />
Dinslaken, Deutschland<br />
Einleitung: Durch die hohe Inzidenz der morbiden <strong>Adipositas</strong> steigt die<br />
Anzahl der durchgeführten Operationen in Deutschland zunehmend. Metabolische<br />
Komplikationen stehen zunehmend im Focus. Durch die weitgehende<br />
Größenreduktion von Kardiabereich und Magenfundus werden<br />
hormonelle Regulationsmechanismen so verändert, dass dadurch die Zielkriterien<br />
Gewichtsreduktion, Verringerung der metabolischen Co-morbidität<br />
und Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden können. Patienten:<br />
Von 1/2006 bis 12/2007 haben wir bei 35 Patienten (BMI von 61 kg/m 2 ) eine<br />
Schlauchmagenbildung durchgeführt. Die vertikale Resektion erfolgte mit<br />
einem Abstand von 7 cm zum Pylorus, die Kalibrirung über eine 30 Charr.<br />
Magensonde. 29 Pat. hatten eine fortgeschrittene Leberverfettung. Der<br />
NASH Score wurde histologisch bestimmt und mit M30 Immunoexpression<br />
korreliert. 27 Pat. hatten einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus. Ergebnisse:<br />
Drei Re-Operationen waren notwendig: 1x bei Nachblutung aus dem<br />
Milzhilus, 1x bei cardianaher Nahtinsuffizienz und 1x bei einer Jejunalläsion.<br />
27 von 35 Patienten hatten nach 12 Monaten mindestens 50 % ihres<br />
Übergewichtes verloren. 4 Patienten hatten bei einem Ausgangsgewicht von<br />
240 kg ihr Körpergewicht halbiert. Bei allen Patienten waren die hepatischen<br />
Apoptoseparameter rückläufig. Bei 17 Patienten waren kurzzeitig postoperativ<br />
keine Insulingaben mehr notwendig. Passageprobleme oder Dysphagien<br />
traten bei 4 der Patienten auf. Die Lebensqualität hat sich im Baros score hat<br />
mit +0,4 deutlich verbessert. Zusammenfassung: Die Sleeve-Resektion des<br />
Magens ist als Ersteingriff bei extremer <strong>Adipositas</strong> oder Hochrisikopatienten<br />
eine hervorragende Methode zur Gewichtsreduktion und Verringerung der<br />
Comorbidität. Diabetes mellitus und NASH bessern sich dramatisch. Darüber<br />
hinaus wird eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität erreicht.<br />
Successful multi-intervention tretment of severe obesity:<br />
a 7–year prospective study<br />
Rudolf Steffen (1), Natascha Potoczna (1), Norman Bieri (1),<br />
*Fritz Horber (1)<br />
(1) Klinik Lindberg, Chirurgie, Winterthur, Schweiz<br />
Background: No long-term, high participation study of the outcome of<br />
bariatric surgery has examined how a multi-intervention approach to treat<br />
severe obesity can achieve and sustain weight loss after an initial bariatric<br />
procedure. Methods: We employed a multi-intervention treatment that combines<br />
adjustable gastric banding with intensive follow-up to support patient<br />
life-style change and use of an algorithm allowing reoperation – to bypass,<br />
if necessary – in the event of complications. 404 severely obese patients had<br />
initial AGB surgery and were followed with a high rate of face-to-face consultations<br />
(mean 3.9/patientyear) for 7 years. 75 % of the patients retained a<br />
gastric band throughout the study. Weight loss, complications, and comorbidities<br />
were studied, and quality of life was assessed using BAROS. Results:<br />
388 (96 %) patients completed the 7-year follow-up. Average BMI reduction<br />
at 5 years was 28 % and remained stable through year 7, at which the mean<br />
excess weight loss was 61 %. The preoperative prevalence of metabolic syndrome,<br />
59·7 %, decreased to 13·3 % at 7 years and was abolished for patients
Freie Vorträge: Ernährungsberatung, Schulungsprogramme<br />
with more than 40 % loss of initial BMI. Similar changes were seen for all<br />
obesity-related comorbidities. More than 60 % of patients had a “good” or<br />
higher BAROS score; 10·1 % were considered failures. Patients converted<br />
to gastric bypass and those retaining gastric bands throughout the study had<br />
very similar outcomes. Procedural mortality was 0. Non procedural mortality<br />
was 19 per 10‘000 personyears. Conclusions: Long-term, multi-intervention<br />
treatment of severe obesity can achieve and preserve weight loss, and<br />
thus improved quality of life and sustained reduction or disappearance of<br />
obesity-related comorbidities, for a high proportion of unselected severely<br />
obese patients.<br />
Laparoskopisches Gastric Banding – Ergebnisse/Komplikationen<br />
Martin Susewind<br />
Klinik für MIC, Chirurgie, Berlin, Deutschland<br />
Zielsetzung: Das laparoskopsiche Gastric banding ist ein wichtiger Bestandteil<br />
der operativen Behandlung bei pathohgologischer <strong>Adipositas</strong>. Es<br />
können dauerhafte Gewichtsreduktionen mit geringer Komplikationsrate<br />
erreicht werden, wenn die Patienenten in einem multimodalen Zentrum betreut<br />
werden. Methoden: Ergebisse von 366 operierten Patienten 8/94-12/07<br />
bezüglich Gewichtsverlauf und Komplikationsrate Ergebnisse: Durschnittlicher<br />
BMI 45 kg/m².Durchschnittlicher EWL 50 (+/- 28 %). Postoperative<br />
Komplikationen: Pouchdilatation, Slippage, Perforation, Portverkippung/infektion.<br />
Bandkomplikationen: Katheterdefekt, Cuffdefekt. Alle Komplikationen<br />
konnten laparoskopisch therapiert werden. Zusammenfassung: Das<br />
laparoskopische Gastric banding ist eine operativ einfache und risikoarme<br />
Operationsmethode bei pathologischer <strong>Adipositas</strong>. Neben operativer Erfahrung<br />
ist die dauerhafte postoperative Behandlung der Patienten in einem<br />
interdisziplinären Zentrum (Internist, Diabetologe, Bewegungstherapeut,<br />
Psychosomatiker, Verhaltenstherapeut, Chirurg) entscheidend für den dauerhaften<br />
Behandlungserfolg.<br />
Laparaskoposcher Magenbypass (Roux-en-Y) –<br />
Magenanastomose mit transoral eingeführtem Staplerkopf<br />
Martin Susewind<br />
Klinik für MIC, Chirurgie, Berlin, Deutschland<br />
Zielsetzung: Der laparoskopische Magenbypass (Roux-en-Y) ist inEuropa<br />
ein immer häufiger durchgeführtes Operationsverfahren zur Behandlung<br />
der pathologischen <strong>Adipositas</strong>. Eine wichtige Bedeutung liegt in der<br />
Größe der Magen-Dünndarm-Anstomose. Die Verwendung eines 25 mm<br />
Zirkularstaples mit ORVIL ermöglicht die Bewerkstelligung definierter Anastomosendurchmesser.<br />
Material: Videodarstellung der laparoskopischen<br />
Operationstechnik (OP und Anastomosen-Bewerkstelligung) und Röntgendarstellung<br />
(Gastrografin- und Bariumschluckam 1. postoperativen Tag und<br />
1 Jahr postoperativ). Zusammenfassung: Die laparoskopische Bewerkstelligung<br />
der Gastrojejunostomie beim Roux-en-Y Magembypass unter Verwendung<br />
eines 25 mm Zirkularstapler und Platzierung der Andruckplatte<br />
transoral ermöglicht eine sicher Durchführung der Anastomose mit reproduzierbar<br />
definiertem Anastomosenlumen.<br />
Freie Vorträge: Ernährungsberatung, Schulungsprogramme<br />
Gemeinsamkeiten und Differenzen von adipösen Kindern<br />
und deren Eltern – Grundlage für das Projekt In Form<br />
*Elisabeth Ardelt-Gattinger (1), Robert Birnbacher (2),<br />
Susanne Ring-Dimitriou (3), Markus Meindl (1)<br />
(1) Universität Salzburg, Fachbereich - Psychologie, Salzburg, Österreich;<br />
(2) Landeskrankenhaus Villach, Kinder und Jugendheilkunde, Villach,<br />
Österreich; (3) Universität Salzburg, Interfakultärer Fachbereich für<br />
Sport- und Bewegungswissenschaften, Salzburg, Österreich<br />
Die Analyse der bisherigen eher enttäuschenden internationalen Ergebnisse<br />
der <strong>Adipositas</strong>therapie und Prävention und unserer eigenen Evaluationsstudien<br />
zeigte, dass die Last der Verhaltensänderung in einer bewegungsarmen<br />
Überflussgesellschaft vom „Makrosystem“ Gesellschaft auf das „Mikrosystem“<br />
Familie verschoben wurde. Zudem wurden Ätiologiefaktoren bisher<br />
nicht ausreichend beachtet und schulenübergreifend behandelt wie etwa die<br />
Suchtaspekte der <strong>Adipositas</strong> oder die hohe Komorbidität mit Binge Eating<br />
Disorder, Bulimie und ihren vorklinischen Bildern. Auch den sehr großen<br />
Unterschieden in Ernährungswissen, Gestaltung der Nahrungsaufnahme,<br />
Bewegungsmöglichkeiten adipöser und morbid adipöser Kinder etc. wurde<br />
bisweilen nicht Rechnung getragen. Die genannte Überforderung der Eltern<br />
wird an Hand von ca. 200 Protokollen der Elternarbeit mittels qualitativer<br />
Inhaltsanalyse dargestellt. Daten von ca. 4000 Kindern zwischen 9 und<br />
16 Jahren belegen signifikante Gruppenunterschiede zwischen den Perzentilklassen<br />
in den oben genannten Ätiologievariablen. Zudem wird an einer<br />
<strong>Adipositas</strong>therapie – Evaluationsstudie an 122 Kindern gezeigt, dass diese<br />
genannten Variablen starke Prädiktoren für den Abnahmeerfolg/Misserfolg<br />
darstellen. Daraus ergeben sich zwei neue Ansätze. Einmal eine stärkere Dif-<br />
ferenzierung in Gruppenzusammenstellung und Behandlungskonzepten auf<br />
der Mikroebene der Therapie. Zum zweiten Begleitung der Therapie-Maßnahmen<br />
auf allen gesellschaftlichen Ebenen im Sinn der Verhältnisprävention<br />
bzw. Gesundheitsförderung normalen (nicht vorklinisch essgestörten)<br />
Ess- und Bewegungsverhaltens.<br />
Prozessleitlinie zur qualifizierten Ernährungstherapie<br />
*Birgit Becke (1), Miriam Hermann (1), Susanne Hipp (1),<br />
Monika Benecke (1)<br />
(1) QUETHEB e. V. , Tübingen, Deutschland<br />
Der Ruf nach Qualität macht auch im Dienstleistungsbereich nicht halt.<br />
Das Institut QUETHEB e. V. hat sich dieser Qualitätsaufforderung gestellt<br />
und Standards für den Prozessablauf von Ernährungstherapie und Ernährungsberatung<br />
entwickelt. Zielsetzung: Das Ziel hierbei ist Professionalisierung<br />
und Transparenz. Der Therapieprozess muss nachvollziehbar und<br />
überprüfbar gemacht werden, um auf allen Ebenen Sicherheit und Vertrauen<br />
zu schaffen. Die Leitlinien der wissenschaftlichen Fachgesellschaften sind<br />
dabei indikationsspezifische und fachlich verpflichtende Basis für die Ernährungstherapie.<br />
Methoden: Von der Anamnese bis zum Abschlussgespräch<br />
wird der „Leitfaden für den Therapieprozess“ in seinen einzelnen Schritten<br />
vorgestellt. Dazu werden jeweils drei Ebenen beschrieben: ein grafischer<br />
Überblick (Flow-chart), eine Art Verfahrensanweisung (Checkliste) und eine<br />
genaue, auch methodische Beschreibung der einzelnen Beratungs-/Therapieschritte<br />
(Erläuterungen). Zusammenfassung: Der Leitfaden bietet durch<br />
diese Standardisierung der Vorgehensweise dem Ernährungstherapeuten die<br />
Möglichkeit, seine Arbeit klar zu strukturieren, immer wieder zu überdenken<br />
und zu optimieren. Außerdem wird so der Beratungs- und Therapieprozess<br />
für das Therapeutenteam, die Patienten und Kostenträger transparent, nachvollziehbar<br />
und evaluierbar gemacht.<br />
Verknüpfung von stationärer Intervallrehabilitation und individueller<br />
wohnortnaher ambulanter Betreuung – ein Pilotprojekt für adipöse<br />
Kinder und Jugendliche und ihre Familien<br />
*Ines Eggers (1), Anke Mühler (1)<br />
(1) Ostsee- Kurklinik Fischland, Ostseebad Wustrow, Deutschland<br />
Zielsetzung: Entwicklung und Erprobung eines einjährigen <strong>Adipositas</strong>programms<br />
für Kinder und deren Familien durch Verknüpfung von stationärer<br />
Intervallrehabilitation und individueller ambulanter Betreuung mit<br />
dem Ziel einer nachhaltigen Gewichtsstabilisierung und Veränderung des<br />
Ess-, Ernährungs- und Bewegungsverhaltens. Methoden: Vom 1.3.2007 bis<br />
31.3.2008 nahmen 22 Kinder im Alter von 8–15 Jahren mit Mutter und/oder<br />
Vater an einem Intervallrehabilitationsverfahren über jeweils 2x3 Wochen<br />
im Abstand von 7 Monaten teil. Zwischen den stationären Aufenthalten erhielten<br />
die Familien in sechswöchigen Intervallen eine individuelle wohnortnahe<br />
Betreuung durch eine Ernährungsfachkraft des Richtig-Essen-Instituts<br />
Berlin. Bei den Kindern wurden jeweils bei Aufnahme und Entlassung in der<br />
Klinik Körpergröße und -gewicht sowie die Stoffwechselparameter nach den<br />
Kriterien der AGA erfasst und ein MOT durchgeführt. Ebenso erfolgte zu<br />
den ambulanten Terminen eine Messung von Größe und Gewicht. Die Daten<br />
der teilnehmenden Familien wurden fortlaufend im APV dokumentiert.<br />
Zudem füllten die Teilnehmer individuelle Fragebögen in Anlehnung an die<br />
KgAS-Bögen zu Beginn und Ende der Maßnahme aus. Ergebnisse: Von<br />
22 Familien haben 21 kontinuierlich über ein Jahr alle Termine wahrgenommen.<br />
10 Kinder haben nach einem Jahr ihren BMI-SDS um >=0,5 reduzieren<br />
können, 7 erreichten eine Veränderung von >=0,2. Im Bereich körperliche<br />
Aktivität und Sport zeigte sich bei allen Kindern eine deutliche Verbesserung<br />
der Kondition und Koordination. Follow-up-Untersuchungen sind in<br />
halbjährlichen Abständen über insgesamt 3 Jahre vorgesehen. Zusammenfassung:<br />
Die Verknüpfung stationärer Intervallrehabililation mit individueller<br />
ambulanter Betreuung findet bei den Familien eine hohe Akzeptanz und<br />
zeigt nach einem Jahr einen positiven Effekt auf die Gewichtsentwicklung<br />
der Kindern. Durch die kontinuierliche individuelle Unterstützung ist die<br />
Abbruchrate tendenziell gering.<br />
Besteht ein subjektiver Bedarf an Präventionsprogrammen<br />
für mäßig übergewichtige Kinder und Jugendliche?<br />
*Emily Finne (1), Thomas Reinehr (2), Anke Schaefer (2), Katrin Winkel (2),<br />
Petra Kolip (1)<br />
(1) Universität Bremen, Institut für Public Health und Pflegeforschung,<br />
Abteilung Prävention und Gesundheitsförderung, Bremen, Deutschland;<br />
(2) Vestische Kinder- und Jugendklinik, Universität Witten/Herdecke, Datteln,<br />
Deutschland<br />
Zielsetzung: Aufgrund der zunehmenden Übergewichtsprävalenz und<br />
fehlenden Angeboten für mäßig übergewichtige Kinder und Jugendliche<br />
besteht objektiv ein Bedarf an Präventionsprogrammen für diese Zielgruppe.<br />
Das sechsmonatige Schulungsprogramm Obeldicks light wird im Rahmen<br />
einer Evaluationsstudie an zwei Standorten im Kreis Recklinghau-<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
29 17
30 18<br />
Freie Vorträge: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter I<br />
sen angeboten. Nach Schätzungen leben ca. 6650 übergewichtige Kinder<br />
(90.-97. BMI-Perzentile) in der Studienregion. Das Rekrutierungsziel lag bei<br />
150 TeilnehmerInnen. Methoden: Es wurden vielfältige Rekrutierungswege<br />
genutzt. Auf die Schulung wurde in lokalen Zeitungen, dem regionalen<br />
Fernsehen und Radio hingewiesen. Außerdem wurden alle regionalen Kinderärzte<br />
über das Angebot informiert und Gewichtsscreenings in Schulen<br />
(n=568 Kinder, 13.3 % übergewichtig) durchgeführt. Die beteiligten Krankenkassen<br />
informierten in ihren Mitgliederzeitschriften. Ergebnisse: Es meldeten<br />
sich vorwiegend Familien mit adipösen Kindern für die Schulungsteilnahme<br />
(für die ersten 6 Monate: 167 Anmeldungen, 76,7 % adipös). Rückmeldungen<br />
der Kinderärzte weisen darauf hin, dass sie – genau wie viele Eltern – Schwierigkeiten<br />
haben, moderates Übergewicht festzustellen. Es wurden außerdem<br />
Bedenken geäußert, Eltern auf das Übergewicht ihrer Kinder hinzuweisen,<br />
da negative Reaktionen erwartet werden. Über 15 Monate wurden insgesamt<br />
70 Teilnehmer rekrutiert, die meisten über Medien und Kinderärzte. 16 zogen<br />
ihre Anmeldung vor Schulungsbeginn zurück. Zusammenfassung: Obwohl<br />
objektiv ein Bedarf an Präventionsprogrammen für übergewichtige Kinder<br />
und Jugendliche besteht, kann ein subjektiver Behandlungsbedarf bei den<br />
betroffenen Familien nicht vorausgesetzt werden. Dies stellt sowohl für die<br />
Evaluation als auch für den Aufbau von Angeboten ein Problem dar, da die<br />
Nachfrage u.U. in einem zu geringen Maß gegeben ist. Die Sensibilisierung<br />
für Schwierigkeiten bei der Identifikation und Thematisierung von Übergewicht<br />
könnte ein erster Schritt in der <strong>Adipositas</strong>prävention sein.<br />
Hat Eine kohlenhydratarme Diät (LOGI) bei <strong>Adipositas</strong> einen stärkeren<br />
Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel als eine fettarme Diät?<br />
*Konstanze Friedrich (1), Dietmar Plonné (2), Peter Heilmeyer (3),<br />
Silke Kohlenberg (3), Martin Huonker (1), Jürgen Steinacker (4)<br />
(1) Therapiezentrum Federsee, Innere, Bad Buchau, Deutschland; (2) Labor<br />
Dr. Gärtner, Ravensburg, Deutschland; (3) Rehabilitationsklinik Überruh,<br />
Isny-Bolsternang, Deutschland; (4) Uniklinikum Ulm, Sektion Sport/-Rehabilitationsmedizin,<br />
Ulm, Deutschland<br />
Zielsetzung: Verglichen wurden bei <strong>Adipositas</strong> die Änderungen der Nüchternwerte<br />
von Glucose, Insulin, Glucagon und des HOMA-Index unter kohlenhydratarmer<br />
Diät (n. LOGI: Fett 45 %; Kohlenhydrate 25 %; Eiweiss 30 %)<br />
und fettarmer Diät (n. DGE: Fett 30 %; KH 50 %; Eiweiss 20 %). In Abgrenzung<br />
zu den zahlreichen Ernährungsstudien wurden beide Diäten mit einem<br />
umfangreichen körperlichen Training kombiniert. Methodik: 98 Adipöse wurden<br />
in eine DGE-Kostgruppe (n=49; weiblich(w):n=21; männlich(m):n=28;<br />
Alter 47,3±5,9 Jahre; Größe 1,72±0,9 m; BMI 34,3±4,6 kg/m²) und eine<br />
LOGI-Kostgruppe (n=49; w:n=20; m:n=29; Alter 43,9±6,3 J.; Größe<br />
1,70±0,9 m; BMI 36,5±3,5 kg/m²) unterteilt. Während der 21-tägigen Intervention<br />
(stationäre Reha) betrug die durchschnittliche Tagesenergiezufuhr unter<br />
DGE 1423,0±240,7 kcal, unter LOGI 1722,3±357,7 kcal. Bei dem zusätzlich<br />
absolviertem umfangorientierten Ausdauertraining wurde der Tagesenergieverbrauch<br />
(DGE: 747,4±406,5 kcal)(LOGI: 707,3±386,5 kcal) über die Herzfrequenz<br />
ermittelt. Ergebnisse: Unter DGE-Kost zeigt sich eine signifikante<br />
Reduktion von Glucose (-7,96±16,09 mg/dl, p=0,001 vs -3,39±13,45 mg/dl,<br />
p=0,084); Insulin (-2,61 ± 5,50 U/l, p=0,002 vs 0,10±4,51 U/l, p=0,880); Glucagon<br />
(-3,57±10,7ng/l, p=0,025 vs 1,41±10,71ng/l, p=0,361) und des HOMA-<br />
Index (-0,93±1,77, p=0,001 vs -0,15±1,26, p=0,407). Ein signifikanter Gruppenunterschied<br />
wurde für den HOMA-Index (p=0,008) ermittelt. Cortisol<br />
und STH änderten sich nicht signifikant. Zusammenfassung: Bei gleichen<br />
Effekten auf das Körpergewicht steigert eine dreiwöchige fettarme Diät mit<br />
körperlichen Training die Insulinsensitivität, was durch die Glucagonwerte unterstützt<br />
wird. Ursächlich ist der hohe Energieverbrauch durch das körperliche<br />
Training, wobei die DGE-Diät hyperkalorischer als die LOGI-Diät war.<br />
Diabetes und Gewichtsreduktion: Evaluation eines ambulanten,<br />
ärztlich betreuten Ernährungskonzepts<br />
Kerstin Schmidt (1), *Christine Becker (2), Hardy Walle (2),<br />
Matthias Frank (1)<br />
(1) Saarländische Klinik, Kreuznacher Diakonie, Innere Abteilung,<br />
Neunkirchen, Deutschland; (2) BODYMED AG, Kirkel, Deutschland<br />
Zielsetzung: Auswirkungen einer Gewichtsreduktion auf Gewicht,<br />
HbA 1c und den Insulinbedarf bei Diabetikern. Studienkollektiv, Methoden:<br />
85 Diabetespatienten, die 3 Monate an dem ambulanten, ärztlich betreuten<br />
Bodymed-Ernährungskonzept teilgenommen haben. Erfasst wurden: Körpergewicht<br />
(KG), Körperfettmasse (FM, erhoben mit Infrarotspektroskopie).<br />
Weiterhin wurden HbA 1c sowie die Änderungen der verabreichten Insulinmengen<br />
während des Kursprogramms bestimmt. Ergebnisse: MW ± SD. Zu<br />
Studienbeginn: KG: 102,1 ± 18,7 kg, FM: 42,5 ± 9,5 kg. Nach 3 Monaten:<br />
KG: 94,4 ± 17,2 kg, FM: 37,4 ± 9,2 kg. Die erzielte Gewichtsreduktion,<br />
Reduktion der FM entspricht den Werten, die auch bei Nichtdiabetikern erzielt<br />
werden konnten. HbA 1c konnte während des Programms von eingangs<br />
7,3 ± 1,2 % auf 6,7 ± 1,1 % (entsprechend um 8,2 %) gesenkt werden<br />
(P ≤ 0,001), bei gleichzeitiger Reduktion der Insulindosis, siehe Tab. 1.<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Zusammenfassung: Neben der erfolgreichen Reduktion von KG, die überwiegend<br />
über die FM erfolgt, konnten die Diabetiker mit dem Bodymed-Ernährungskonzept<br />
auch das HbA 1c verbessern und die verabreichte Menge von<br />
Intermediär-, Mischinsulinen und Insulinanaloga signifikant reduzieren.<br />
Tab. 1: Folgende Insuline und Insulinanaloga konnten reduziert werden:<br />
Kursbeginn nach 3 Monaten Senkung um [%]; P<br />
Intermediärinsuline [IE] 26,0 ± 19,5 21,1 ± 13,2 18,8; ≤ 0,05<br />
Mischinsuline [IE] 90,9 ± 80,3 60,0 ± 72,4 34,0; ≤ 0,05<br />
Kurzwirkende<br />
Insulinanaloga [IE] 21,1 ± 20,9 17,7 ± 21,0 16,1; ≤ 0,05<br />
Langwirkende<br />
Insulinanaloga [IE] 27,9 ± 15,5 19,4 ± 13,7 30,5; ≤ 0,05<br />
LangzeitErgebnisse eines Ambulanten, ärztlich betreuten<br />
ErNährungskonzepts – (LEAN-Studie II)<br />
Hardy Walle (1), *Christine Becker (1)<br />
(1) BODYMED AG, Kirkel, Deutschland<br />
Zielsetzung: Evaluation eines ärztlich betreuten, ambulanten Ernährungskonzepts.<br />
Studienkollektiv, Methoden: Ein-Jahres-Ergebnisse<br />
665 übergewichtiger und adipöser (BMI ≥ 25 kg/m²) Teilnehmer am Bodymed-Ernährungskonzept.<br />
Das Konzept zeichnet sich durch die ärztliche Betreuung<br />
(v. a. Ernährungsmediziner) sowie die Schwerpunkte Ernährungsumstellung,<br />
Verhaltensänderung und Bewegung aus. Für den Einstieg in<br />
die Gewichtsreduktion wird mit proteinsubstituiertem modifizierten Fasten<br />
(PSMF, meal replacement) gearbeitet. Das Konzept ist von vielen Krankenkassen<br />
anerkannt und Bestandteil der Integrierten Versorgung (IV). Neben<br />
Körpergewicht (KG), BMI wurden mittels Infrarotspektroskopie Körperfettmasse<br />
(FM), -wasser (KW) sowie stoffwechselaktive Masse (SW, als Maß<br />
für die Muskulatur) erfasst. Ergebnisse: Die Erfolgskriterien für ambulante<br />
<strong>Adipositas</strong>programme wurden deutlich erfüllt. 77,7 % der Kursteilnehmer<br />
hatten 1 Jahr nach Programmbeginn ihr Ausgangsgewicht um mind.<br />
5 %; 47,4 % um mind. 10 % reduziert. MW ± SD. Zu Studienbeginn: KG:<br />
91,4 ± 17,2 kg, BMI: 33,4 ± 5,7 kg/m², FM: 36,0 ± 10,2 kg, KW:<br />
47,5 ± 3,7 %, SW: 13,4 ± 2,1 %. Ein Jahr nach Studienbeginn: Abnahme auf<br />
(P ≤ 0,001): KG: 81,7 ± 15,4 kg, BMI: 29,8 ± 5,2 kg/m², FM: 29,4 ± 9,4 kg,<br />
Anstieg auf (P ≤ 0,001): KW: 49,8 ± 4,2 %, SW: 14,6 ± 2,3 %. Zusammenfassung:<br />
Die Daten bestätigen, dass das Bodymed-Ernährungskonzept<br />
ein sinnvolles Instrument für die langfristige Therapie von Übergewicht und<br />
<strong>Adipositas</strong> bildet. Die Gewichtsreduktion ist insbesondere (> 65 %) auf die<br />
Reduktion von Körperfett, bei weitgehendem Erhalt der stoffwechselaktiven<br />
Masse und des Körperwassers zurückzuführen.<br />
Freie Vorträge: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter I<br />
Repräsentative Studie zum Einfluss von Übergewicht und <strong>Adipositas</strong><br />
auf den Pubertätsbeginn bei Mädchen<br />
*Anne-Madeleine Bau (1), Andrea Ernert (2), Liane Schenk (3),<br />
Susanna Wiegand (1), Peter Martus (2), Heiko Krude (1)<br />
(1) Institut für Experimentelle Pädiatrische Endokrinologie, Charite,<br />
Virchow Klinikum, Berlin, Deutschland; (2) Institut für Biometrie und klinische<br />
Epidemiologie, Charite, Berlin, Deutschland; (3) Institut für medizinische<br />
Soziologie, Charite, Berlin, Deutschland<br />
Zielsetzung: Ziel der Untersuchung war die Erfassung des aktuellem<br />
Gewicht und Größe zum Zeitpunkt der Menarche unter Berücksichtigung<br />
des sozialen und ethnischen Hintergrundes. Methode: September 2006 bis<br />
März 2007 wurde eine Querschnittsstudie in 68 Schulen in Berlin durchgeführt.<br />
Mädchen im Alter von 10–15 Jahren wurden anhand eines standardisierten<br />
Fragebogens befragt und durch eine Studienschwester vermessen<br />
sowie das genaue Menarchedatum (monatsgenau) erfragt. Ergebnisse: Das<br />
mittlere Menarchealter wurde anhand der Kaplan Meier Überlebensanalyse<br />
bei 154 Monaten (12,8 Jahre, 95 % KI, 153–155) festgelegt. 12,5 %<br />
der Mädchen waren übergewichtig und adipös und 80,2 % normalgewichtig.<br />
Mädchen mit Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> bekommen signifikant früher<br />
(150 Monate) ihre Menarche im Vergleich zu Normalgewichtigen<br />
(155 Monate) (p
Freie Vorträge: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter I<br />
tierte 1971 ein kritisches Körpergewicht von 48 kg mit der Körpergröße von<br />
158,5 cm und einem BMI von 19,1, das Mädchen benötigen, um zu menstruieren.<br />
Dieser Schwellenwert kann unter Berücksichtigung der Längenwachstumsacceleration<br />
durch die vorliegende Studie nach 30 Jahren bestätigt werden.<br />
Ein BMI von 19,4 unterstützt den Beginn der Menarche.<br />
Ein Vergleich von Schätz- und Messwerten von Körpergröße<br />
und -gewicht bei Jugendlichen<br />
*Beate Landsberg (1), Ina Bastian (1), Sandra Plachta-Danielzik (1),<br />
Dominique Lange (1), Maike Johannsen (1), Manfred J. Müller (1)<br />
(1) Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde,<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland<br />
Zielsetzung: Bestimmung der Abweichungen zwischen Mess- und<br />
Schätzwerten von Größe, Gewicht und BMI bei Jugendlichen.<br />
Methoden: In der Kieler <strong>Adipositas</strong>-Präventionsstudie (KOPS) wurden<br />
Größe und Gewicht von 2749 Jugendlichen (49,0 % Jungen) im Alter von<br />
13–16 Jahren von den Jugendlichen auf einem Fragebogen selbst angegeben<br />
(Schätzwert) und von geschultem Personal gemessen (Messwert), der<br />
BMI wurde jeweils berechnet. Die Abweichungen zwischen den Schätz- und<br />
Messwerten sowie die Auswirkungen auf die Prävalenz von Unter-, Normal-,<br />
Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> (nach Kromeyer-Hauschild et al. (2001))<br />
wurden ermittelt. Es wurde eine Regressionsanalyse zur Bestimmung des<br />
Einflusses von Geschlecht und Ernährungszustand auf die Abweichungen<br />
durchgeführt. Ergebnisse: Jugendliche überschätzten die Größe (+0,6 ±2,3 cm)<br />
und unterschätzten das Gewicht (-1,4 ±3,5 kg). Diese Fehleinschätzung hatte<br />
Auswirkungen auf den BMI (-0,7 ±1,3 kg/m 2 ). Der Effekt war stärker bei<br />
Mädchen als bei Jungen (-0,9 ±1,4 kg/m 2 vs. -0,4 ±1,2 kg/m 2 ; p90. Perzentile,<br />
n=57) nahm der Bauchumfang unabhängig von Alter und Geschlecht des<br />
Kindes sowie der Schulbildung der Eltern um -1,0±4,6 cm ab, bei übergewichtigen<br />
Kontrollkindern (n=42) um +2,1±3,6 cm zu (p
32 20<br />
Freie Vorträge: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter II<br />
Effekte von stationärer Kurz- und Langzeittherapie extrem adipöser<br />
Jugendlicher und junger Erwachsener (Insula-KoMo-Studie)<br />
*Kolja Sievert (1), Anja Moß (2), Maria Rabenbauer (1), Elisabeth Nagl (1),<br />
Alena Siegfried (1), Martin Wabitsch (2), Wolfgang Siegfried (1)<br />
(1) <strong>Adipositas</strong>-Rehazentrum Insula, Bischofswiesen, Deutschland;<br />
(2) Uniklinik Ulm, Sektion Pädiatrische Endokrinologie und<br />
Diabetologie, Ulm, Deutschland<br />
Zielsetzung: Bis heute gibt es nur wenige Untersuchungen zur Wirksamkeit<br />
einer stationären Langzeittherapie adipöser Jugendlicher und junger<br />
Erwachsener. Vor allem die Wirkung unterschiedlicher Therapiezeiten<br />
sollte untersucht werden. Methodik: 142 konsekutiv aufgenommene Patienten<br />
(80w, 62m) mit ambulant therapieresistenter <strong>Adipositas</strong> im Alter von<br />
12–31 Jahren (im Mittel 15.7 ± 3.1) wurden einer unterschiedlich langen stationären<br />
Langzeit-Therapie unterzogen. Erfasst wurden anthropometrische<br />
und laborchemische Parameter. Ergebnisse: Bisher haben 86 Patienten<br />
die Behandlung abgeschlossen. Die Behandlungsdauer betrug bis 3 Mo<br />
(7.3±2.6 Wochen) (Gruppe 1, n=12), 3–6 Mo (21.1±4.1 Wochen) (Grup-<br />
pe 2, n=44) oder 6–12 Mo (33.2±8.4 Wochen) (Gruppe 3, n=37). • Grup-<br />
pe 1: Signifikant (p
Freie Vorträge: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter II<br />
Freunden in der Freizeit. Bei den Suchtkriterien gab es keinen signifikanten<br />
Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. Die subjektiv empfundenen<br />
Abhängigkeitstendenzen entsprechen nicht dem tatsächlichen Zustand<br />
des Überkonsumierens. Schlussfolgerung: Jugendliche mit <strong>Adipositas</strong><br />
verbringen signifikant mehr Zeit vor dem Computer, speziell mit Chatten und<br />
kommunizieren so über eine virtuelle Welt, statt sich mit Freunden zu treffen.<br />
Gleichzeitig schätzen sie ihren exzessiven Computerkonsum nicht als übermäßig<br />
oder problematisch ein. Dem Schritt der Verhaltensmodifikation muss<br />
den Daten zufolge, das Schaffen einer Veränderungsmotivation vorausgehen.<br />
Dies kann nur dann gelingen, wenn den jugendlichen Adipösen ihr Problem<br />
des übermäßigen Medienkonsums als eine Ursache und aufrechterhaltende<br />
Bedingung ihrer <strong>Adipositas</strong> bewusst wird.<br />
Growth and nutrition of preterm – very low birth weight newborns<br />
until early childhood – 5.5 years follow up study<br />
*Elaheh Ghods (1), Sophie Brandstetter (2), Kurt Widhalm (1)<br />
(1) Med Uni Wien, Ernährungsmedizin und Prävention, Wien, Österreich;<br />
(2) Med Uni Wien, Neonatology und allgemeine Pädiatrie, Wien, Österreich;<br />
Objective: To evaluate the growth and nutrition of preterm-newborns after<br />
discharge from hospital until 66 months and identifying early life risk<br />
factors for obesity development. Design: retrospective cohort study from<br />
2008–2000. Setting: Department of Neonatology and general Paediatric,<br />
Division of Clinical Nutrition and Prevention, Medical university of Vienna.<br />
Study Group: 112 children born less than 32 weeks gestational age or very<br />
low birth weight (less than or equal to 1500 gram) in the 2000–2002. They<br />
were Small for Gestational Age (SGA) or Appropriate for Gestational Age<br />
(AGA).They referred after first discharge from hospital to neonatal clinic<br />
and followed there until 5.5 years old. Procedures: Preterm, very low birth<br />
weight newborn refrered after first discharge from hospital for follow up<br />
care to neonatal clinic. First visit was planned at discharge from hospital<br />
and then children were cared at 3-6-12-24-40-54-66 months. Detailed health<br />
assessment of children were written and registered by experienced physician<br />
and nurses in clinic. We fill out the questionnaire based on data sources and<br />
consulting responsible team. Anthropometric indexes (weight, height, head<br />
circumference and BMI for age) have been compared to World health Organisation<br />
(WHO-2006, Anthro2005) and Center for Disease Control and<br />
prevention (CDC-2000). Feeding information were type of milk, fortifier,<br />
introduction age of weaning and table food, collected in scheduled visits<br />
in infancy. Main Measurement: We calculated Z-score for weight for age,<br />
height for age and BMI for age. Z-score for anthropometric indexes were<br />
Calculated by corrected gestational age until 2 years old. Results: There<br />
are significant changes in growth rate based on Z-score of weight, height<br />
and BMI in early months of life. Higher growth rate after discharge until<br />
3 months could predict higher BMI at 54 months (P value=0,000) and<br />
significantly higher in girls (P value=0,000) Anthropometric Z-score have<br />
shown most adjusted curve to normal reference curve at 24 months corrected<br />
age (based on WHO) then the growth rate became slower until 66 months.<br />
Growth rate and catch up were dependent on degree of prematurity and birth<br />
weight. Breast feeding and longer duration of breastfeeding have shown significant<br />
relationship with lower anthropometric indexes in early childhood.<br />
Head circumference Zscore shows a different trend. After rapid catch up it<br />
reach the normal curve between 9-12 months. Head circumference Z-score<br />
have shown less prominent changes thereafter until the last visit. Breastfeeding<br />
have shown some protective effect on head circumference catch up<br />
growth. Conclusion: The rate of growth is significantly high in first 2 years<br />
of life and especially in the first few month of life. Faster postnatal growth<br />
were associated with higher early childhood BMI. Breast feeding and longer<br />
duration of it were significantly associated with lower growth rate in early<br />
infancy and lower weight and BMI indexes in early childhood. Higher protein<br />
intake at discharge from hospital have shown significant association with<br />
higher anthropometric indexes in early childhood.<br />
Diagnostik auf Komorbidität bei übergewichtigen und adipösen<br />
Kindern: APV (<strong>Adipositas</strong>-Patienten-Verlaufsdokumentation) –<br />
Benchmarking zeigt deutliche Verbesserung über die letzten Jahre<br />
*Ulrike Hoffmeister (1), Thomas Reinehr (2), Gerd Claußnitzer (3),<br />
Heidi Siefken-Kaletka (4), Kurt Widhalm (5), Christiane Petersen (6),<br />
Dagmar Allemand (7), Susanna Wiegand (8), Reinhard W. Holl (1)<br />
(1) Universität Ulm, Epidemiologie, Ulm, Deutschland; (2) Universität Witten-Herdecke,<br />
Kinderklinik Datteln, Datteln, Deutschland; (3) Spessart-Klinik,<br />
Bad Orb, Deutschland; (4) Edelstein-Klinik, Bruchweiler, Deutschland;<br />
(5) Universität Wien, Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Wien, Österreich;<br />
(6) Moby Dick, Hamburg, Deutschland; (7) Ostschweizer Kinderspital,<br />
St. Gallen, Schweiz; (8) Charité, Kinderklinik, Berlin, Deutschland<br />
Zielsetzung: Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> verursachen häufig schon im<br />
Jugendalter Begleiterkrankungen wie Hypertonie, Dyslipidämie, Kohlenhydratstoffwechselstörungen.<br />
Deswegen empfiehlt die AGA übergewich-<br />
tige und adipöse Kinder und Jugendliche auf mögliche Komorbiditäten zu<br />
untersuchen. Werden Anforderungen der Leitlinien umgesetzt? Hat sich<br />
die Komorbiditätsdiagnostik in den letzten Jahren verbessert? Methoden:<br />
Die APV-Datenbank erfasst Verlaufsdaten übergewichtiger und adipöser<br />
Patienten. Aktuell liegen Daten von 38168 Patienten vor (mittleres Alter<br />
12.5 Jahre [1-20], 44,9 % männlich, mittlerer BMI-SDS +2,43: 17,7 % übergewichtig<br />
(> 90 Perz.), 44,6 % adipös (> 97.Perz.), 37,7 % extrem adipös<br />
(> 99.5 Perz.)). Insgesamt beteiligten sich 132 Therapiezentren, 59,7 % der<br />
Patienten stammen aus Rehakliniken. Daten der Erstvorstellungen aus 2000<br />
bis 2007 wurden analysiert. Häufigkeiten wurden multivariat für demografische<br />
Variable adjustiert (SAS9.1). Ergebnisse: Im Jahr 2000 wurde bei<br />
26,5 % der Patienten der Blutdruck dokumentiert, 2007 bei 88,2 %. Die Lipiddiagnostik<br />
verbesserte sich von 15,6 % auf 67,1 %, die Diabetesdiagnostik<br />
von 6,5 % auf 47,6 %. Geschlechtsunterschiede fanden sich nicht, Blutdruckdiagnostik<br />
wurde stationär häufiger durchgeführt (86,3 % vs. 58,5 %;<br />
p
34 22<br />
Freie Vorträge: Psychologie, Epidemiologie, Umwelt<br />
Langzeittherapie unterziehen. Methoden: Bei n=83 Jugendlichen (33 Jungen)<br />
wurden anthropometrische und laborchemische Parameter vor und nach einer<br />
stationären Langzeittherapie (mittlere Dauer 5,45 ± 2,44 Monate) gemessen<br />
und jeweils ein OGT durchgeführt. Mittlerer BMI 41,6 ± 10,14 kg/m 2 ; BMI-<br />
SDS 3,4 ± 0,64; Alter 15,37 ± 2,42 Jahre. Die intraabdominelle Fettmasse<br />
wurde mittels Ultraschall auf der Höhe des Abgangs der Arteria mesenterica<br />
superior aus der Aorta gemessen. Ergebnisse: Bei der Eingangsuntersuchung<br />
zeigte sich eine deutliche Korrelation zwischen der intraabdominellen Fettmasse<br />
und dem Blutdruck (RR systolisch r=0,32; diastolisch r=0,45; p < 0,005)<br />
und den Leberwerten ALT (r=0,29; p < 0,05) und yGT (r=0,39; p
Freie Vorträge: Psychologie, Epidemiologie, Umwelt<br />
wickelten Bewegungssensor (DiaTrace System, Fraunhofer-Institut, Rostock)<br />
zu objektiven Quantifizierung. Dazu werden die Daten mit einem zentralen<br />
Server synchronisiert, mittels standardisierten Algorithmen ausgewertet. Der<br />
Bewegungssensor ist in ein Fotohandy integriert. Es wird gleichzeitig eine<br />
digitale Erfassung des Essverhaltens ermöglicht. Ergebnisse: Bisher wurden<br />
11 Kinder/Jugendliche eingeschlossen (Alter 14,9±3,4 Jahre, Größe<br />
1,62±0,14m, Gewicht 81,3±23,7kg, BMI 30,3±4,3kg/m 2 , BMI-SDS 2,31±0,54,<br />
82 % Mädchen). Die Kinder/Jugendlichen hatten eine körperliche Aktivität<br />
von 133,2±59,0 Minuten/Tag (10033,3±4831,0 Aktivitätseinheiten/Tag). Die<br />
Ruhezeit betrug 267,6±115,3 Minuten/Tag, der durchschnittliche Kalorienverbrauch<br />
1774,8±106,4 kcal/Tag. In den standardisierten Fragebögen hatten<br />
die Patienten tendentiell höhere körperliche Aktivität (231,9±109,7 Minuten/<br />
Tag, p=0,065 vs DiaTrace). Bivariate Korrelation nach Pearson: Korrelationen<br />
bestanden zwischen der objektiv erfassten körperlichen Aktivität und<br />
dem Alter (r=0,802, p=0,003), der Körpergröße (r=0,721, p=0,012) und dem<br />
Gewicht (r=0,741, p=0,009). Schlussfolgerung: Die objektive und subjektive<br />
Wahrnehmung der körperlichen Aktivität unterscheidet sich bei Kindern/<br />
Jugendlichen mit Übergewicht/<strong>Adipositas</strong>. Die subjektive Wahrnehmung<br />
liegt über der objektiven. Auf dem Hintergrund der großen Varianz hinsichtlich<br />
des Outcomes von Kindern/Jugendlichen nach Teilnahme an Schulungen<br />
zur Gewichtsabnahme, sollte dieser Aspekt stärker berücksichtigt werden.<br />
Die Kinder/Jugendlichen sollten hinsichtlich Selbsteinschätzung trainiert<br />
werden um im Langzeitverlauf eine optimale Einschätzung der körperlichen<br />
Aktivität zu ermöglichen, einer Unterschätzung vorzubeugen und somit zur<br />
weiteren Gewichtsreduktion/-Stabilisation beizutragen.<br />
Körpergewichtsstatus und körperbezogenes Selbstkonzept<br />
im Jugendalter<br />
*Sascha Kopczynski (1), Farida Abderrahim (1), Annette Chen-Stute (2),<br />
Michael Kellmann (3)<br />
(1) Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sportwissenschaft, Bochum,<br />
Deutschland; (2) Bethesda-Johanniter-Klinikum Duisburg, <strong>Adipositas</strong>zentrum,<br />
Duisburg, Deutschland; (3) University of Queensland, School of Human<br />
Movement Studies, Brisbane, Australien<br />
Zielstellung: Sportlichkeit und Attraktivität wird im Jugendalter ein hoher<br />
sozialer Stellenwert beigemessen. Das Studienziel bestand in der Ermittlung<br />
von Zusammenhängen zwischen dem Körpergewichtsstatus und der Selbstbeurteilung<br />
von Jugendlichen in Bezug auf sportliche Kompetenz, körperliche<br />
Erscheinung und Gesundheitszustand. Materialien und Methoden: Es wurden<br />
654 Jugendliche (345 w; 309 m) im Alter von 11 bis 16 Jahren mit Hilfe<br />
standardisierter Instrumente zu Dimensionen des Körperkonzepts und des<br />
sportbezogenen Selbstkonzepts befragt. Aus der Gesamtstichprobe wurden<br />
Teilstichproben untergewichtiger (n=37), normalgewichtiger (n=41), übergewichtiger<br />
(n=41) und adipöser (n=41) Jugendlicher separiert und varianzanalytisch<br />
analysiert. Ergebnisse: Alle motorischen Dimensionen differierten<br />
sehr signifikant in Abhängigkeit vom Körpergewichtsstatus (Allgemeine<br />
Sportlichkeit: p=.001, η2=.098; Beweglichkeit: p=.000, η2=.163; Koordination:<br />
p=.000, η2=.147; Kraft: p=.000, η2=.138; Schnelligkeit: p=.000, η2=.127;<br />
Ausdauer: p=.01, η2=.072). Während adipöse Jugendliche sich in Bezug auf<br />
alle motorischen Hauptbeanspruchungsformen schlechter einschätzten, beurteilten<br />
sie ihre Kraftfähigkeit nicht weniger positiv als normalgewichtige<br />
Gleichaltrige. In dieser Dimension erzielten die untergewichtigen Jugendlichen<br />
die niedrigsten Werte. Bei übergewichtigen und adipösen Jugendlichen<br />
war im Vergleich zu normal- und untergewichtigen Befragten eine verringerte<br />
Selbstakzeptanz des körperlichen Erscheinungsbildes (p=.001, η2=.097)<br />
sowie eine deutlich stärker ausgeprägte Wahrnehmung von Figurproblemen<br />
(p=.000, η2=.426) festzustellen. Keine bedeutsamen Gruppendifferenzen<br />
wurden bezüglich der Wahrnehmung von Gesundheitsproblemen (p=.420)<br />
beobachtet. Zusammenfassung: Die Mehrheit der körperbezogenen Selbstkonzeptdimensionen<br />
wurde mit zunehmendem Ausmaß von Übergewicht<br />
im Jugendalter negativ beeinflusst. Die Ergebnisse bieten Ansatzpunkte, wie<br />
beispielsweise ein gezielter Einsatz kraftbetonter Spiel- und Übungsformen,<br />
für die Gestaltung ressourcenorientierter Sportangebote im therapeutischen<br />
Setting sowie für körpergewichtsstatusheterogene Gruppen.<br />
Abnehmen – aber mit Vernunft: Wirksamkeitsnachweis<br />
eines psychologisch fundierten Präventionsprogramms<br />
für Erwachsene durch 1-Jahres-Katamnesen<br />
*Karin Metz (1), Lena Anna Schmid (1)<br />
(1) IFT-Gesundheitsförderung, München, Deutschland<br />
Zielsetzung: Vorstellung der Evaluationsergebnisse der 1-Jahres-Katamnesen<br />
des Präventionsprogramms „Abnehmen – aber mit Vernunft“. Methode:<br />
In einer Feldstudie mit quasi-experimentellem Kontrollgruppendesign<br />
konnten insgesamt 207 Personen mit einem durchschnittlichen BMI von<br />
32,2 für die Stichprobe rekrutiert werden. Die Kontrollgruppe (n=93) nahm<br />
an einer alten Programmversion teil, die Experimentalgruppe 1 (n=56) beinhaltete<br />
12 überarbeitete Sitzungen ohne Stabilisierungskomponente und die<br />
Experimentalgruppe 2 (n=53) beinhaltete 16 überarbeitete Sitzungen mit 4<br />
zusätzlichen Gewichtsstabilisierungssitzungen. Nach Kursende konnten insgesamt<br />
N=174 (84,1), nach einem Jahr N=167 (80,7) zu ihrem Ernährungs-<br />
und Bewegungsverhalten sowie zu weiteren gewichtsassoziierten Variablen<br />
befragt werden. Die Befragung erfolgte in schriftlicher Form. Es wurden<br />
überwiegend standardisierte Evaluationsinstrumente eingesetzt. Ergebnisse:<br />
Nach einem Jahr haben 22,3 % der Teilnehmer 5-10 %, 18,7 % mehr als 10 %<br />
ihres Ausgangsgewichts verloren. Damit konnten etwa 40 % der Teilnehmer<br />
in hohem Maße von dem Programm profitieren. Weitere 38,6 % haben<br />
ihr Gewicht um 0–5 % reduziert und damit ihr Gewicht konstant gehalten.<br />
20,5 % profitierten von dem Programm nicht. Darüber hinaus resultierten folgende<br />
signifikanten Ergebnisse: Verbesserung übergewichtsassoziierter Erkrankungen,<br />
Steigerung der körperlichen Alltagsaktivität, Verbesserung der<br />
körperlichen und psychischen Lebensqualität, Verringerung von Essanfällen<br />
und Gewichtssorgen, Steigerung der kognitiven Kontrolle, Verringerung von<br />
Hungergefühlen und Störbarkeit des Essverhaltens. Keine Unterschiede über<br />
die Zeit zeigten sich bzgl. des Ernährungsverhaltens. Zwischen den Gruppen<br />
konnten keine bedeutsamen Unterschiede festgestellt werden. Zusammenfassung:<br />
Mit dem Programm „Abnehmen – aber mit Vernunft“ existiert ein<br />
effektives Gruppenprogramm zur Verringerung von Übergewicht und <strong>Adipositas</strong>.<br />
Das Programm unterliegt einer kontinuierlichen Evaluation hinsichtlich<br />
einer Vielzahl an Veränderungsparameter. Die Studie wurde gefördert von der<br />
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.<br />
Der dicke Osmin - Dichtung oder Wahrheit? –<br />
<strong>Adipositas</strong> und Migrationshintergrund. Daten aus der Region Hannover<br />
Beate Rieck<br />
Region Hannover, Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, Hannover,<br />
Deutschland<br />
Seit 2003 werden die Daten der Schuleingangsuntersuchung für die gesamte<br />
Region Hannover erfasst. Es werden jährlich ca. 10.000 Kinder untersucht.<br />
Durch Bestimmung des Gewichts, der Größe und des Alters kann eine<br />
Einteilung in die Referenzbereiche nach Kromeyer-Hauschild vorgenommen<br />
werden. Zusätzlich werden der Bildungsgrad der Eltern und die ethnische<br />
Herkunft erfragt. In den letzten 5 Jahren lagen ca. 9 % der deutschen<br />
Kinder zur Schuleingangsuntersuchung oberhalb der 90. Perzentile. Ca.<br />
12 % der Kinder mit Migrationshintergrund und aus Familien mit niedrigem<br />
Bildungsgrad waren übergewichtig. Bei der Differenzierung der ethnischen<br />
Herkunft fällt auf, dass bereits 18 % der Kinder mit türkischer Herkunft bei<br />
der Schuleingangsuntersuchung übergewichtig sind. Türkisch stämmige<br />
Kinder stellen 10 % aller Einschulungskinder und ein Drittel der Kinder mit<br />
Migrationshintergrund. Uns interessierte die Gewichtsentwicklung bis zur<br />
4. Klasse. Im Jahr 2006 wurden 2400 Kinder der 4. Klassen untersucht. Die<br />
Daten der Schuleingangsuntersuchung dieser Kinder lagen uns vor, so dass<br />
die Entwicklung des Gewichts unter Berücksichtigung der sozialen Herkunft<br />
beurteilt werden konnte. Außerdem wurden Fragen zum Frühstücksverhalten<br />
und der Freizeitaktivität gestellt. Es fällt auf, dass weitere 10 % der türkisch<br />
stämmigen Kinder bis zur 4. Klasse übergewichtig wurden, so dass<br />
der Anteil auf über 28 % stieg, während 16 % der Kinder mit Migration aus<br />
anderen Ländern und 12 % der deutschen Kinder übergewichtig waren. Bei<br />
der Planung von <strong>Adipositas</strong>-Präventionsprojekten sollte das soziale Umfeld<br />
berücksichtigt werden. Besonders für türkisch stämmige Kinder ist es wichtig,<br />
die Familien so früh wie möglich in Präventionsprogramme einzubeziehen,<br />
da ein hoher Anteil der Kinder schon zur Schuleingangsuntersuchung<br />
übergewichtig ist.<br />
Period-specific growth, overweight and modification by breastfeeding<br />
in the GINI and LISA birth cohorts up to age 6 years<br />
*Peter Rzehak (1), Stefanie Sausenthaler (2), Sibylle Koletzko (3),<br />
Carl Peter Bauer (4), Beate Schaaf (5), Andrea von Berg (6),<br />
Dietrich Berdel (6), Michael Borte (7), Olf Herbarth (8), Ursula Krämer (9),<br />
Nora Fenske (10), H. -Erich Wichmann (1), Joachim Heinrich (2)<br />
(1) Helmholtz Zentrum München - German Research Center for Environmental<br />
Health, Institute of Epidemiology/Ludwig-Maximilians University<br />
Munich, Institute of Medical Data Management, Biometrics and Epidemiology,<br />
Chair of Epidemiology, Neuherberg/München, Deutschland;<br />
(2) Helmholtz Zentrum München - German Research Center for Environmental<br />
Health, Institute of Epidemiology, Neuherberg, Deutschland;<br />
(3) Ludwig-Maximilians-University of Munich, Dr. von Hauner Children’s<br />
Hospital, München, Deutschland; (4) Technical University of Munich, Department<br />
of Pediatrics, München, Deutschland; (5) Medical Practice for<br />
Pediatrics, Bad Honnef, Deutschland; (6) Marien-Hospital Wesel, Department<br />
of Pediatrics, Wesel, Deutschland; (7) Municipal Hospital St. Georg,<br />
Teaching Hospital of the University of Leipzig, Children’s Hospital/University<br />
of Leipzig, Department of Pediatrics, Leipzig, Deutschland; (8) UFZ<br />
Leipzig-Halle, Department of Human Exposure Research and Epidemiology/University<br />
of Leipzig, Faculty of Medicine, Department of Environmental<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
35 23
36 24<br />
Freie Vorträge: Körperliche Aktivität und Lebensstil<br />
Hygiene and Epidemiology (Environmental Medicine), Leipzig, Deutschland;<br />
(9) IUF, Institut für Umweltmedizinische Forschung at the University<br />
of Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland; (10) Ludwig-Maximilians University<br />
Munich, Department of Statistics, München, Deutschland<br />
Objective: To assess differences in velocities of longitudinal development<br />
of weight, length, body-mass-index, overweight and obesity in relation to breastfeeding<br />
from birth up to the age of 6 years. Material/Methods: This study<br />
based on pooled data of the birth-cohorts GINI-plus and LISA-plus follows<br />
7643 healthy full-term neonates, born 1995-1999, in four study-centers in<br />
Germany. Up to 9 anthropometric measurements are available. BMI and percentile-defined<br />
overweight/obesity measures are derived according to WHO-<br />
Child-Growth-Standards. Fully-breastfeeding is defined as breastfed for at<br />
least 4 month since birth. Piecewise-linear-random-coefficient-models were<br />
applied to assess growth trajectories and velocities between 0–3, 3–6, 6–12,<br />
12–24 and past the 24th months. Results: Velocities for weight-, length- and<br />
BMI-development are highest in the first 3 months after birth and are diminished<br />
with differing pace in the following periods. For overweight and obesity<br />
peak-velocities are estimated in periods 6–12 and 3–6 months. The difference<br />
in the velocity of weight gain for breastfed vs. other children is -18g/month<br />
in the first 3 months, -93g/month between month 3–6, -14g/month between<br />
month 6–12 and -3g/month past the 24th month. Velocities in length are not<br />
different between breastfed and other children. Over time a small lower risk<br />
(difference 35) zu<br />
untersuchen. 30 Personen mit Übergewicht wurden mit einem ambulanten<br />
psychoedukativen bewegungstherapeutischen Programm behandelt, während<br />
28 Teilnehmer über den gleichen Behandlungszeitraum an einem Fitnesskurs<br />
teilnahmen. Die 58 Teilnehmer wurden systematisch 4 Wochen vor Kursbeginn,<br />
bei Kursbeginn, 8 Wochen nach Kursbeginn und 6 Monate nach Kursende<br />
bzgl. des Gewichts, der Körperzusammensetzung (Bioimpendance),<br />
der aeroben Ausdauer (fahrradergometrische Belastungsuntersuchung nach<br />
dem WHO-Schema und Walking Test), der sportmotorischen Fähigkeiten<br />
Koordination und Kraft (BKT-Kur, Krafttest), der gesundheitsbezogenen Lebensqualität<br />
(SF-36), der Körpererfahrung (FKKS), der Depressivität (BDI),<br />
der Akzeptanz der Behandlungsform (DFBT) und des Bewegungsverhaltens<br />
(SFGS) untersucht. Durch beide bewegungstherapeutischen Maßnahmen<br />
konnte eine vergleichbare Gewichtsreduktion erreicht werden (F=20,20;<br />
p=0,000). Es zeigen sich keine signifikanten Gruppenunterschiede bzgl. des<br />
Körpergewichts. Sportmotorische Parameter wie die Ausdauer- und Koordinationsfähigkeit<br />
werden durch beide Interventionen verbessert. Eine Überlegenheit<br />
eines der beiden Treatments über das andere kann nicht belegt werden.<br />
Beide Bewegungsprogramme wurden von den Teilnehmern hinsichtlich<br />
ihrer Wirksamkeit positiv eingeschätzt. Das Körperkonzept (FKKS: F=6,90;<br />
p=0,01) wie auch der psychischer Gesundheitszustand (SF-36: F=10,79;<br />
p=0,002) verbessert sich signifikant mehr bei den Teilnehmern des psychoedukativen<br />
Bewegungsprogramms. Ein zusätzlicher Gruppenunterschied<br />
wird im angegebenen Bewegungsverhalten dokumentiert. Die Anzahl der<br />
sportlich Aktiven ist bei den Teilnehmern des psychoedukativen Programms<br />
zum Zeitpunkt der Katamnese deutlich höher als die der Fitnessgruppe.<br />
Evaluation des Projektes Kinder in Bewegung der bsj zur Gesundheitsförderung<br />
in Kindertagesstätten, Grundschulen und Vereinen<br />
Nicole Breithaupt (1), *Friederike Kreuser (1), Annette Schneider (1),<br />
Ulrike Korsten-Reck (1)<br />
(1) Medizinische Universitätsklinik Freiburg, Abteilung für Rehabilitative<br />
und Präventive Sportmedizin, Freiburg, Deutschland<br />
Zielsetzung: Wie haben sich die Angebote in den Bereichen Bewegung,<br />
Ernährung und Elternarbeit in Kindergärten, Grundschulen und Vereinen<br />
durch die Fortbildungstage „Kinder in Bewegung“ der Badischen Sportjugend<br />
(bsj) in den Städten und Gemeinden verändert? Materialien und Methoden:<br />
Allen Teilnehmern (N=238), die an einer Fortbildung der bsj in einer der<br />
7 Städte (Offenburg, Bad Säckingen, Singen, Baden-Baden, Teningen, Lahr,<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Staufen) teilgenommen haben, wurde ein Nachhaltigkeitsfragebogen zugesandt.<br />
Diese Ergebnisse wurden mit den Daten verglichen, die vor der Fortbildung<br />
(FOBI) erhoben wurden. Ergebnisse: Von 238 versendeten Fragebögen<br />
konnten 37 % (N=87) ausgewertet werden. Die Rücklaufquote setzte sich aus<br />
Grundschulen (16 %), Kindertagesstätten (10 %) und Sonstige (9 %) zusammen.<br />
Vor der FOBI haben rund 80 % der Institutionen mindestens einmal pro<br />
Woche ein Bewegungsangebot angeboten (25 % täglich, 57 % wöchentlich).<br />
50 % der Institutionen erweiterten nach der FOBI den Umfang ihres Bewegungsangebots.<br />
Jeweils gut 1/4 der Teilnehmer gaben vor dem Projekt an,<br />
täglich (28 %) oder monatlich (26 %) Ernährungsangebote durchzuführen,<br />
wogegen 36 % nach der FOBI einen erhöhten Umfang bzw. 55 % keine Veränderung<br />
des Umfangs solcher Angebote angaben. Überraschend viele Einrichtungen<br />
veränderten nichts im Umfang der Elternangebote (74 %). Jedoch<br />
wurden die gelernten Bewegungsinhalte so gut wie von allen Teilnehmer/<br />
innen (98 %) umgesetzt, während von 39 % Inhalte der Ernährung und von<br />
54 % Inhalte der Elternarbeit umgesetzt wurden. Nur 14 % der Institutionen<br />
gaben an, Schwierigkeiten bei der Umsetzung gehabt zu haben. Zusammenfassung:<br />
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass Bewegungsangebote<br />
sehr gut umgesetzt wurden, wohingegen Angebote bezüglich der Elternarbeit<br />
und vor allem der Ernährung weniger gute Ergebnisse erzielten. Dies<br />
sollte in zukünftigen Workshops verstärkt angeboten werden.<br />
Möglichkeiten und Probleme der objektiven Aktivitätsmessung<br />
bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen einer Evaluationsstudie<br />
*Emily Finne (1), Thomas Reinehr (2), Katrin Winkel (2), Anke Schaefer (2),<br />
Petra Kolip (1)<br />
(1) Institut für Public Health und Pflegeforschung, Universität Bremen,<br />
Abteilung Prävention und Gesundheitsförderung, Bremen, Deutschland;<br />
(2) Vestische Kinder- und Jugendklinik, Universität Witten/Herdecke,<br />
Datteln, Deutschland<br />
Zielsetzung: Das Bewegungsausmaß lässt sich durch Selbstauskunft nur<br />
unzuverlässig erfassen. Die Anwendbarkeit des StepWatch Activity Monitors<br />
(SAM) zur Erfassung des Bewegungsverhaltens wurde im Rahmen einer<br />
Studie zur Evaluation der Schulung Obeldicks light für übergewichtige<br />
Kinder und Jugendliche überprüft. Methoden: Der SAM ist ein biaxialer<br />
Akzelerometer, der von einem Teil der StudienteilnehmerInnen (n=35) jeweils<br />
über eine Woche am Fußknöchel getragen wurde und die Anzahl an<br />
Schrittzyklen je Minute für jeden Tag aufzeichnet. Als Maß für die Gesamtaktivität<br />
wurde die durchschnittliche Anzahl an Schritten pro Tag betrachtet.<br />
Für Zeiten, in denen das Gerät nicht getragen wurde, wurde die Schrittanzahl<br />
anhand der vorhandenen Informationen gültiger Zeiten und eines Protokolls<br />
geschätzt. Ergebnisse: Bei 33 TeilnehmerInnen liegen bereits 2 Messungen<br />
vor. Bei nur 59,4 % waren die Daten zu beiden Zeitpunkten auswertbar. Die<br />
durchschnittliche tägliche Schrittanzahl reichte von 7237 bis 27399 (Erstmessung:<br />
M=14347,40 ± 4369,33). Es liegt kein standardisiertes Auswertungsprotokoll<br />
vor. Der Umgang mit missing values (Zeiten, zu denen das<br />
Gerät abgenommen wurde), kann die Aktivitätswerte deutlich beeinflussen.<br />
Es zeigte sich bei der Wiederholungsmessung eine tendenziell geringere Aktivität,<br />
was darauf hindeutet, dass Motivationseffekte gerade bei der ersten<br />
Messung zu berücksichtigen sind. Die Retest-Reliabilität über 3,5–6 Monate<br />
war jedoch gut (rtt=.859). Zusammenfassung: Vorteile von Akzelerometern<br />
bei der Aktivitätsmessung liegen in einer hohen Zuverlässigkeit und Objektivität.<br />
Die Anwendung ist durch fachfremde Personen möglich, jedoch mit<br />
einem recht großen Aufwand verbunden. Eine standardisierte Auswertungsprozedur<br />
könnte die Anwendung erheblich erleichtern. Es muss mit einem<br />
Anteil nicht auswertbarer Messungen gerechnet werden, der bei Wiederholungsmessungen<br />
zu deutlichen Stichprobenverlusten führen kann.<br />
Fettoxidation bei adipösen Frauen und Männern<br />
unter körperlicher Belastung<br />
*Sven Haufe (1), Stefan Engeli (2), Michael Boschmann (1),<br />
Christoph Otto (1), Susanne Wiesner (1), Friedrich C. Luft (1), Jens Jordan (2)<br />
(1) Franz Volhard Centrum für klinische Forschung, Charité und Max Delbrück<br />
Centrum für Molekulare Medizin, Berlin, Deutschland; (2) Institut für<br />
Klinische Pharmakologie, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover,<br />
Deutschland<br />
Zielsetzung: Regelmäßiges Training in einem Intensitätsbereich bei dem<br />
der maximale Grad der Fettoxidation erreicht wird (Fatmax) verbessert die<br />
Verwertung von Fetten und die Insulinsensitivität. Bei welcher Trainingsintensität<br />
Fatmax bei Adipösen erreicht wird ist nicht hinreichend untersucht.<br />
Materialien und Methoden: 32 adipöse Frauen (42.2 ± 8.6 J., BMI<br />
34.3 ± 3.8 kg/m 2 ) und 13 Männer (45,4 ± 5,4 J., BMI 35.1 ± 5.2 kg/m 2 )<br />
wurden anthropometrisch und kardiometabolisch charakterisiert. Anschließend<br />
absolvierten alle Probanden einen Stufentest auf einem Fahrradergometer<br />
(Start: 25 Watt, Steigerung: 25 Watt alle 2 min) bis zur subjektiven<br />
Ausbelastung. Aus den Parametern des Gasaustausches wurden die Substratoxidationsraten<br />
sowie die entsprechenden Intensitätsbereiche errechnet.
Freie Vorträge: Klinische Aspekte, Komorbiditäten, Körperkomposition<br />
Ergebnisse: Die maximale absolute Fettoxidation betrug 0.24 ± 0.13 g/min<br />
bei Frauen und 0.25 ± 0.09 g/min bei Männern. Fatmax wurde bei<br />
44 ± 11 %VO2max bei Frauen und 40 ± 11 %VO2max bei Männern erzielt.<br />
Gemessen an der maximalen Herzfrequenz (Hfmax [220 – LA]) und der<br />
Laktatkonzentration an der individuellen anaeroben Schwelle (IAS) entsprach<br />
das für Frauen 66 ± 8.2 %Hfmax und 67 ± 11.8 %IAS sowie für Männer<br />
61 ± 7.4 %Hfmax und 62 ± 14 %IAS. Zusammenfassung: Im Vergleich<br />
zu untrainierten normalgewichtigen Personen ist die Kapazität zur Oxidation<br />
von Fetten während körperlicher Aktivität bei adipösen Männern und Frauen<br />
reduziert. Dementsprechend können die Empfehlungen zur Belastungsteuerung<br />
mit dem Ziel, Lipidoxidation zu maximieren, nicht uneingeschränkt<br />
von Normalgewichtigen auf Adipöse übertragen werden.<br />
Nichtmedikamentöse verhaltensbezogene <strong>Adipositas</strong>therapie<br />
unter Berücksichtigung der zugelassenen Arzneimittelbehandlung<br />
*Beate Kossmann (1), Tanja Ulle (1), Kai G. Kahl (2), Jürgen Wasem (3),<br />
Pamela Aidelsburger (1)<br />
(1) CAREM GmbH, Sauerlach, Deutschland; (2) Klinik und Poliklinik<br />
für Psychiatrie und Psychotherapie, Dresden, Deutschland; (3) Lehrstuhl<br />
für Medizinmanagement, Duisburg-Essen, Deutschland<br />
Zielsetzung: Ziel der Verhaltenstherapie bei <strong>Adipositas</strong> ist eine langfristige<br />
Veränderung der Ess- und Bewegungsgewohnheiten von adipösen<br />
Menschen. Unterstützend können gewichtsreduzierende Medikamente eingesetzt<br />
werden. Der vorliegende Health Technology Assessment (HTA), der<br />
vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information<br />
(DAHTA@DIMDI) beauftragt wurde, bewertet die medizinische und ökonomische<br />
Effektivität der Verhaltenstherapie unter Berücksichtigung zugelassener<br />
gewichtsreduzierender Arzneimittel. Methodik: In allen relevanten<br />
Datenbanken wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt.<br />
Mittels standardisierten Vorgehens wurden die identifizierten Literaturstellen<br />
systematisch selektiert, qualitativ beurteilt und zusammenfassend dargestellt.<br />
Ergebnisse: In die Bewertung wurden 18 Studien eingeschlossen,<br />
die – getrennt nach ihren unterschiedlichen Therapieansätzen – in vier Kategorien<br />
bewertet wurden. Im Vergleich zu einer Einzel-Verhaltenstherapie<br />
mit einer moderaten Therapiefrequenz zeigte sowohl die intensive Einzel-<br />
Verhaltenstherapie als auch die Gruppen-Verhaltenstherapie mit gegenseitiger<br />
sozialer Unterstützung bei den Patienten eine höhere Gewichtsreduktion.<br />
Ebenso konnten Studien, die Verhaltenstherapie in Kombination<br />
mit gewichtsreduzierenden Arzneimitteln im Vergleich zur reinen Verhaltenstherapie<br />
bewerteten, nachweisen, dass eine höhere Gewichtsreduktion<br />
durch begleitende gewichtsreduzierende Arzneimittel erreicht werden kann.<br />
Für die Studien mit zusätzlicher medikamentöser Unterstützung liegen allerdings<br />
keine Langzeitdaten vor. Im Vergleich zur medienbasierten Verhaltenstherapie<br />
(via Internet oder Telefon) konnte durch eine zusätzliche<br />
persönliche Intervention keine höhere Gewichtsreduktion erreicht werden.<br />
Für die Bewertung von ökonomischen Aspekten konnten keine relevanten<br />
Studien identifiziert werden. Zusammenfassung: Trotz der sehr schlechten<br />
Vergleichbarkeit der Therapieoptionen in den bewerteten Studien kann eine<br />
höhere Effektivität für die intensive Einzel-Verhaltenstherapie, für die Gruppentherapie<br />
mit sozialer Unterstützung und für die Verhaltenstherapie mit<br />
zusätzlicher gewichtsreduzierenden Arzneimitteln nachgewiesen werden.<br />
Zur besseren Beurteilung der Effektivität sind Studien mit einheitlichen und<br />
dadurch besser vergleichbaren Therapieansätzen erforderlich.<br />
Evaluierung neuer Strategien zur Gewichtsreduktion in übergewichtigen<br />
Familien: finanzieller Anreiz, Diätkombination und Telemedizin<br />
*Claus Luley (1), Alexandra Blaik (1), Stefanie Aronica (1), Jutta Dierkes (1),<br />
Sabine Westphal (1)<br />
(1) Klinikum der Otto-von-Guericke-Universität, Institut für Klinische Chemie,<br />
Magdeburg, Deutschland<br />
Zielsetzung: Wir verglichen neue Maßnahmen zur Gewichtsreduktion<br />
mit der konventionellen Kalorienrestriktion. Material und Methoden:<br />
111 Familien mit mindestens 1 übergewichtigen Kind und mindestens 1 übergewichtigen<br />
Erwachsenen (n=260) hielten eine Kalorienrestriktion ein. Sie<br />
wurden nach einem 3-faktoriellen Design randomisiert zu: (1) „duale Diät“,<br />
die Kalorienrestriktion mit der Bevorzugung von niedrig-glykämischen Kohlenhydraten<br />
kombiniert, (2) „Anreiz“ bestehend aus 5 € pro verlorenem kg<br />
(Erwachsene) bzw. pro SDS-Verbesserung (Kinder), (3) „Telemedizin“ durch<br />
telemetrische Kontrolle von Gewicht und Bewegungsaktivität mit wöchentlichem<br />
Motivationsbrief, (4) „Kalorienrestriktion“ = keine weitere Maßnahme.<br />
Das Studiendesign erlaubt die Evaluierung der Einzelmaßnahmen sowie<br />
der Maßnahmenkombinationen. Nach 2 Instruktionsstunden wurden die Teilnehmer<br />
nach 6 Monaten kontrolliert. Ergebnisse: Bei Kindern verlangsamte<br />
nur „Anreiz“ die Gewichtszunahme. Bei Erwachsenen differierten die Gewichtsreduktionen<br />
signifikant (p < 0,05): -2,9 versus -6,0 kg für ohne versus<br />
mit „Anreiz“, -3,0 gegenüber -5,8 kg für „Kalorienrestriktion“ versus „duale<br />
Diät“, -4,0 versus -6,6 kg für ohne versus mit „Telemedizin“. Am wirksamsten<br />
war die Kombination „Anreiz“+“duale Diät“+“Telemedizin“ mit -14,5 kg. Am<br />
wirkungslosesten war „Kalorienrestriktion“ mit -1,6 kg. Daraufhin wurde ein<br />
Programm entwickelt, das „Duale Diät“ mit „Telemedizin“ kombiniert (www.<br />
abc-diaet.com). Drei Erwachsenengruppen (n=32) erzielten mit diesem ABC-<br />
Programm eine mittlere Gewichtsreduktion von 12 kg in 3 Monaten. Zusammenfassung:<br />
(1) Kalorienreduktion erzielt die kleinste Gewichtsabnahme.<br />
(2) Nur Anreiz verlangsamt bei Kindern die Gewichtszunahme. (3) Am wirksamsten<br />
ist bei Erwachsenen die Kombination von Anreiz mit dualer Diät und<br />
Telemedizin. (4) Eine Kombination der letzteren in einem neuen Programm<br />
erzielte bei Erwachsenen nach 3 Monaten eine Abnahme von 12 kg.<br />
Maßnahmen der Prävention zur Gewichtsreduzierung<br />
bei finnischen Erwachsenen<br />
*Milly-Anna Schröer (1), Markus Lüngen (1), Andreas Gerber (1)<br />
(1) Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie,<br />
Uniklinikum Köln, Köln, Deutschland<br />
Zielsetzung: Finnlands Prävention und Gesundheitsförderung gelten weltweit<br />
als beispielhaft und genießen höchste wissenschaftliche Reputation. Ob<br />
dies auch für den Bereich der <strong>Adipositas</strong>prävention gilt, sollte in dieser Studie<br />
untersucht werden. Ziel der Studie war es, Interventionen zu identifizieren,<br />
die zum Effekt hatten, dass finnische Erwachsene durch Diäten, körperliche<br />
Aktivität oder Lebensumstellungen an Gewicht verloren. Methode: Es<br />
wurde ein systematischer Review durchgeführt. Einschlusskriterien waren<br />
finnische nichtpharmakologische Interventionen zur Gewichtsreduktion ab<br />
1970. Es wurden nur randomisiert kontrollierte Studien (RCTs) einbezogen.<br />
Zielgruppe waren finnische Erwachsene ab 18 Jahren. Ergebnisse: Zehn<br />
RCTs mit 2309 adipösen Teilnehmern erfüllten die Einschlusskriterien. Von<br />
diesen schlossen sechs mit einem signifikant positiven Effekt ab. Drei Studien<br />
zeigten keinen Unterschied in der Gewichtsabnahme zwischen Kontroll-<br />
und Interventionsgruppe. Eine resultierte lediglich in Gewichtsverlusten bei<br />
Männern. Sieben Interventionen liefen längerfristig (12 bis 38 Monate) und<br />
drei kurzfristig (3,2 bis 10 Monate). Die Gewichtsreduktionsprogramme<br />
der Studien bestanden in der Regel aus Kombinationen von niedrig kalorischer<br />
Kost, Bewegungsprogrammen und Diskussionsrunden. Es bestehen<br />
keine auffälligen Unterschiede in der Intervention zwischen den einzelnen<br />
Studien. Zusammenfassung: Die Heterogenität der Studien in Bezug auf<br />
die Studienqualität und bezüglich unterschiedlicher Vorerkrankungen und<br />
Body-Mass-Indizes der Teilnehmer verhinderte es, einen Gesamteffekt mithilfe<br />
einer Meta-Analyse zu berechnen. Dennoch lässt sich für den Bereich<br />
Gewichtsreduktion bei finnischen Frauen und Männern als gemeinsames<br />
Charakteristikum erkennen, dass erfolgreiche Interventionen, die zugleich<br />
die methodische Qualität im Studiendesign erfüllen, durch eine multistrategische<br />
Auslegung, die Beteiligung vieler Multiplikatoren, die Integration des<br />
Kontextes und des Empowerment sowie eine ausreichende Interventionszeit<br />
gekennzeichnet sind.<br />
Freie Vorträge: Klinische Aspekte, Komorbiditäten,<br />
Körperkomposition<br />
Evaluation einer ambulanten multimodalen Gruppentherapie<br />
bei <strong>Adipositas</strong> in Kombination mit einer Binge-Eating-Störung<br />
– erste Ergebnisse –<br />
*Sandra Becker (1), Axel Kowalski (1), Beatrix Eisler (1), Rosi Schabert (1),<br />
Karin von Hacht (2), Stephan Zipfel (1)<br />
(1) Uniklinikum Tübingen, Abt. für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,<br />
Tübingen, Deutschland; (2) Uniklinikum Tübingen, Abt. Sportmedizin,<br />
Tübingen, Deutschland<br />
Fragestellung: Etwa ein Drittel der adipösen Patienten, die eine Behandlung<br />
zur Gewichtsreduktion aufsuchen, leiden zusätzlich unter Symptomen<br />
einer Binge-Eating-Störung wie beispielsweise regelmäßige Essanfälle und<br />
Kontrollverlust beim Essen. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sich<br />
diese Personengruppe deutlich von anderen Übergewichtigen unterscheidet<br />
und ein spezielles Behandlungsangebot benötigt, das im medizinischen Versorgungssystem<br />
bisher wenig Berücksichtigung findet. Ziel der Studie war<br />
die Überprüfung der Wirksamkeit eines ambulanten multimodalen Gruppentherapieprogrammes<br />
bei adipösen Patienten, die gleichzeitig unter Symptomen<br />
einer Binge-Eating-Störung leiden. Methodik: 28 übergewichtige<br />
Patienten, die eine zusätzliche Binge-Eating-Störung hatten, oder zumindest<br />
subklinisch die Kriterien nach DSM-IV-TR erfüllten, wurden randomisiert<br />
einer Interventions- oder Wartekontroll-Gruppe zugeteilt. Die Teilnehmer der<br />
Interventionsgruppe besuchten über einen Zeitraum von 5 Monaten wöchentlich<br />
eine multimodale kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppentherapie.<br />
Zu drei Messzeitpunkten (Interventionsbeginn, Programmhälfte, Interventionsende)<br />
wurden für beide Gruppen essstörungsspezifische Symptome, die<br />
allgemeine Psychopathologie, die Einschätzung des eigenen Körperbildes<br />
und die Selbstakzeptanz erfasst. Zusätzlich wurden zu jedem Gruppentermin<br />
Gewichtsdaten erhoben. Die Auswertung der Verlaufsdaten erfolgte über eine<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
37 25
38 26<br />
Freie Vorträge: Klinische Aspekte, Komorbiditäten, Körperkomposition<br />
Varianzanalyse mit Messwiederholung sowie mittels Mann-Whitney U-Test<br />
und T-Test für EInzelvergleiche. Ergebnisse: Es zeigte sich ein Gesamtinterventionseffekt<br />
der Gruppentherapie in Bezug auf eine Gewichtsreduktion<br />
und einen Rückgang der essstörungsspezifischen Sympomte wie Störbarkeit<br />
des Essverhaltens, Beschäftigung mit HHA,Schlankheitsstreben,erlebte<br />
Hungergefühle und ablehnende Körperbewertung. Im Vergleich der Kontroll-<br />
zur Interventionsgruppe zeigten sich nur innerhalb der Interventionsgruppe<br />
über die drei Messzeitpunkte signifikante Veränderungen in einer<br />
Gewichtsreduktion, in der Abnahme von Depressivität (PHQ), der Ausprägung<br />
von Heißhunger- und Heißhungerattacken und in der Abnahme von<br />
Störbarkeit des Essverhaltens. Aufgrund kleiner Effektstärken unterschieden<br />
sich die Gruppen jedoch nicht signifikant voneinander.<br />
Methodenvergleich zur Bestimmung der Körperkomposition<br />
von normal- und übergewichtigen Kindern<br />
Katrin Korsten (1), *Friederike Kreuser (2), Katrin Kromeyer-Hauschild (3),<br />
H. H. Dickhuth (2), Ulrike Korsten-Reck (2)<br />
(1) Universität Freiburg, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Freiburg,<br />
Deutschland; (2) Universitätsklinik Freiburg, Rehabilitative und Präventive<br />
Sportmedizin, Freiburg, Deutschland; (3) Universität Jena, Institut für Humangenetik<br />
und Anthropologie, Jena, Deutschland<br />
Zielsetzung: Der Body-Mass-Index ist die allgemein gebräuchliche Methode<br />
zur Bestimmung und Kategorisierung der Körperzusammensetzung.<br />
Er ist allerdings nicht in der Lage in Fettmasse und fettfreie Masse zu unterscheiden.<br />
Dies limitiert seine Aussagekraft. Ein wichtiges Ziel jeder Gewichtsreduktionstherapie<br />
ist allerdings die Abnahme der Fettmasse und die<br />
Zunahme fettfreier Masse. Dies erfordert Methoden, mit deren Hilfe diese<br />
Differenzierung getroffen werden kann. Da innerhalb der hierfür geeigneten<br />
Untersuchungsmethoden ebenfalls erhebliche Unterschiede bestehen<br />
wurden in vorliegender Untersuchung drei verschiedene Methoden zur Bestimmung<br />
der Körperfettmasse ( %FM) angewendet und deren Eignung für<br />
normal- und übergewichtige Kinder geprüft. Methodik: Bei 33 normal- und<br />
28 übergewichtigen Kindern im Alter zwischen 7 und 11 Jahren wurde die<br />
Fettmasse mittels Hautfaltendickenmessungen (HFD), Bioelektrischer Impedanzanalyse<br />
(BIA) sowie Air-Displacement Plethysmographie (BodPod)<br />
bestimmt. Mittels Bland-Altman-Plot und t- bzw. U-Test (p
Freie Vorträge: Pharmakologische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
setzung einschließen, den Formeln mit anthropometrischen Variablen nicht<br />
überlegen. Insgesamt scheint die indirekte Kalorimetrie für die korrekte Bestimmung<br />
des REE bei adipösen Männern unabdingbar.<br />
Viszerale <strong>Adipositas</strong> korreliert nur bei Männern mit erhöhter<br />
Sympathikusaktivität<br />
*Jens Tank (1), Karsten Heusser (1), Andre Diedrich (2),<br />
Dagmara Hering (3), Friedrich C. Luft (4), Andreas Busjahn (5),<br />
Krzysztof Narkiewicz (3), Jens Jordan (1)<br />
(1) Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Klinische Pharmakologie,<br />
Hannover, Deutschland; (2) Vanderbilt University School of Medicine,<br />
Division of Clinical Pharmacology, Nashville, USA; (3) Medical University<br />
of Gdansk, Department of Hypertension and Diabetology, Gdansk, Polen;<br />
(4) Charité Universitätsmedizin Berlin, Experimental & Clinical Research<br />
Center, Berlin, Deutschland; (5) HealthTwiSt GmbH, Berlin, Deutschland<br />
Zielsetzung: Die mit zunehmender <strong>Adipositas</strong> ansteigende Aktivität<br />
des sympathischen Nervensystems fördert Insulin-Resistenz und arterielle<br />
Hypertonie. Unterschiede in der Beziehung zwischen <strong>Adipositas</strong> und<br />
sympathischer Aktivität zwischen Männern und Frauen könnten zu den<br />
bekannten Geschlechtsunterschieden im kardiovaskulären Risiko beitragen.<br />
Wir haben deshalb untersucht, ob zwischen Männern und Frauen eine<br />
unterschiedliche Korrelation zwischen Muskelsympathikusnervenaktivität<br />
(MSNA) und Taillenumfang besteht. Material und Methoden: Die Daten<br />
zweier Mikroneurografie-Labors in Berlin und Gdansk wurden für eine<br />
Querschnittstudie zusammengeführt. Es wurden 111 normotensive, gesunde<br />
Kaukasier untersucht (70 Männer und 41 Frauen, Alter 19–62 Jahre,<br />
BMI 18-40 kg/m²). Nach 30-minütiger Ruhe in Rückenlage wurden Herzfrequenz,<br />
Blutdruck und MSNA aufgezeichnet. Ergebnisse: Die MSNA<br />
(gemessen als Anzahl der Aktionspotenzial-Salven/min) zeigte bei beiden<br />
Geschlechtern eine Altersabhängigkeit (Männer: r=0,56, Frauen: r=034,<br />
p
40 28<br />
Poster: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
von Glimepirid + Metformin). Sowohl Liraglutid 1,2 mg als auch Liraglutid<br />
1,8 mg in Kombination mit Metformin reduzierten den prozentualen Fettanteil<br />
(signifikanter Unterschied gegenüber dem Anstieg mit Glimepirid + Metformin).<br />
Zwischen Liraglutid + Metformin und Plazebo + Metformin bestand<br />
hinsichtlich der Verminderung des prozentualen Fettanteils kein signifikanter<br />
Unterschied. In LEAD 3 verminderten beide Liraglutiddosierungen die Fettmasse<br />
und den prozentualen Fettanteil (signifikanter Unterschied gegenüber<br />
dem Anstieg mit Glimepirid). Zusammenfassung: Verglichen mit Glimepirid<br />
vermindert Liraglutid bei Patienten mit Typ 2 Diabetes sowohl als Monotherapie,<br />
als auch bei additiver Gabe zu Metformin das Körpergewicht, die<br />
Fettmasse und den prozentualen Anteil des Körperfetts.<br />
Poster: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
Interdisziplinäres Testsystem zur Diagnostik und Evaluation<br />
bei <strong>Adipositas</strong> und anderen durch Ess- und Bewegungsverhalten<br />
beeinflussbaren Krankheiten wie Diabetes, metabolisches Syndrom,<br />
Herzkreislauferkrankungen, Erkrankungen oder Störungen<br />
des Bewegungsapparats etc.<br />
*Elisabeth Ardelt-Gattinger (1), Markus Meindl (1),<br />
Susanne Ring-Dimitriou (2), Daniel Weghuber (3)<br />
(1) Universität Salzburg, Fachbereich Psychologie, Salzburg, Österreich;<br />
(2) Universität Salzburg, Fachbereich Sport und Bewegungswissenschaft,<br />
Salzburg, Österreich; (3) Landeskrankenhaus Salzburg, Univ. klinik f. Kinder-<br />
und Jugendheilkunde, Salzburg, Österreich<br />
Einleitung: Das Interdisziplinäre Testsystem AD-EVA umfasst 10 Fragebögen<br />
und einen sportmotorischen Test. Die einzelnen Verfahren liegen je<br />
in einer Version für Erwachsene (Eltern) und einer für Kinder/Jugendliche<br />
zwischen 9 und 16 Jahren vor. Es wurde zur Diagnostik und zur Vergleichbarkeit<br />
von chirurgischen und konservativen therapeutischen Maßnahmen wie<br />
zur Evaluation von Präventionskampagnen gegen <strong>Adipositas</strong> und mit diesen<br />
komorbid auftretenden Essstörungen entwickelt. Erfasst werden: Medizinische<br />
Daten, pathogenes und das salutogenes Essverhalten, Körperbild, Körperzufriedenheit,<br />
Craving nach und Abhängigkeit von übermäßigem Essen,<br />
vorklinische und klinische Essstörungen (inkl. Differenzierung von Big Eating<br />
und Binge Eating), Lebensqualität, Sportmotivation, physische Fittness<br />
und Nahrungsmittelpräferenzen. Methode: Die Entwicklung erfolgte an ca.<br />
6000 Jugendlichen und 4000 Erwachsenen aller Gewichtsgruppen, die Normierung<br />
an unterschiedlich großen repräsentativen Stichproben von Erwachsenen<br />
(pro Verfahren mindestens ca. 1600) und Kindern/Jugendlichen (mindestens<br />
ca. 2000). Die Internen Konsistenzen liegen zwischen .85 und .95,<br />
für die Kurzskalen (2-3 Items) bei .65-.75. Die Retest-Reliabilitäten liegen<br />
zwischen .80 und .95. Die Itemtrennschärfen sind hoch und die Verteilung der<br />
Schwierigkeitsindizes ist ausgewogen. Konstrukt- und Kriteriumsvalidität<br />
wurden für jedes einzelne Verfahren geprüft. Praktische Verwendung: Mit<br />
der standardisierten Erfassung der interdisziplinären Daten dient AD-EVA<br />
der Planung und Analyse von Präventionsmaßnahmen sowie chirurgischen<br />
und konservativen Therapien und ermöglicht somit auch einen Vergleich zwischen<br />
verschiedenen präventiven und therapeutischen Interventionen.<br />
Ein extrem adipöser Junge mit Missense-Mutation (Glu308Lys)<br />
im Melanocortin-4-Rezeptor-Gen<br />
*Gideon de Sousa (1), Susann Friedel (2), Anke Hinney (2),<br />
Thomas Reinehr (1), Johannes Hebebrand (2)<br />
(1) Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln, Universität Witten/Herdecke,<br />
Datteln, Deutschland; (2) Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
des Kindes- und Jugendalters, Rheinische Kliniken Essen, Universität<br />
Duisburg-Essen, Essen, Deutschland<br />
Einleitung: Der Melanokortin-4-Rezeptor (MC4R) wird im Gehirn exprimiert<br />
und ist in die Sättigungsregulation involviert. Circa 1–5 Prozent der extrem<br />
adipösen Kinder- und Jugendlichen haben funktionsrelevante Mutationen<br />
im MC4R-Gen. Bislang sind mehr als 90 verschiedene MC4R-Mutationen beschrieben<br />
worden, die zu einer eingeschränkten oder vollständig aufgehobenen<br />
Rezeptorfunktion und damit zu einer gestörten Sättigungsregulation führen.<br />
Wir berichten über einen extrem adipösen Jungen, bei dem eine Missense-<br />
Mutation (Glu308Lys) im Melanocortin-4-Rezeptor-Gen nachgewiesen werden<br />
konnte. Fallbericht: Aufgrund einer frühkindlichen, extremen <strong>Adipositas</strong><br />
(3 Jahre, BMI 33 kg/m 2 , SDS-BMI 5,01) wurde eine molekulargenetische Analyse<br />
des MC4R veranlasst. Es konnte eine Missense-Mutation (Glu308Lys)<br />
identifiziert werden. Auch beim Vater des Kindes (BMI 31,8 kg/m 2 ) konnte die<br />
Mutation Glu308Lys nachgewiesen werden. Weiterhin gelang der Nachweis<br />
dieser Mutation beim Großvater väterlicherseits (BMI 33 kg/m 2 ) sowie beim<br />
Bruder des Vaters (BMI 34,8 kg/m 2 ). Diskussion: Die Mutation Glu308Lys<br />
wurde bisher nur einmal in der Literatur beschrieben. In funktionellen Studien<br />
ließ sich eine reduzierte Rezeptorfunktion nachweisen, was eine Relevanz für<br />
die <strong>Adipositas</strong> vermuten lässt. Schlussfolgerung: Bei frühkindlicher, extremer<br />
<strong>Adipositas</strong> sollte über eine Analyse des MC4R nachgedacht werden. Beim<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Vorliegen einer funktionsrelevanten Mutation kann die Untersuchung weiterer<br />
Familienmitglieder sinnvoll sein. Die Wissen um die genetischen Ursachen<br />
der <strong>Adipositas</strong> wirkt in betroffenen Familien entlastend und kann therapeutische<br />
Interventionen unterstützen.<br />
Bewegungsverhalten und TV-Konsum adipöser Kinder:<br />
Welchen Einfluss haben elterliche Selbstwirksamkeitserwartungen?<br />
*Ivonne Döring (1), Petra Warschburger (1)<br />
(1) Universität Potsdam, Institut für Beratungspsychologie, Potsdam/Golm,<br />
Deutschland<br />
Zielsetzung: Mangelnde Bewegung trägt neben ungesunder Ernährung<br />
zur Entstehung und Aufrechterhaltung der kindlichen <strong>Adipositas</strong> bei. Eltern<br />
sind Hauptansprechpartner bei der Veränderung dieses Verhaltens.<br />
Selbstwirksamkeitserwartungen gelten als entscheidende Prädiktoren für<br />
Verhaltensänderungen. Zurzeit ist wenig darüber bekannt, wie wirksam<br />
und kompetent sich Eltern adipöser Kinder in Bezug auf diese notwendigen<br />
Verhaltensumstellungen erleben und welche Auswirkungen dies auf das<br />
Verhalten der Kinder hat. Materialien/Methoden: Die vorgestellten Daten<br />
sind Teil einer laufenden RCT-Langzeitstudie (EPOC). Im Rahmen der<br />
Studie werden Daten von 7–12-jährigen Kindern, die sich wegen <strong>Adipositas</strong><br />
(BMI > 97. Perzentile) in stationärer Rehabilitation befinden und ihren<br />
Eltern erhoben. Die elterliche Selbstwirksamkeit wird mit dem SW-ADI-E<br />
(Warschburger et al., 2006) erhoben. Das kindliche Bewegungsverhalten<br />
und der Medienkonsum werden über Selbstberichtsdaten und über Elternfragebögen<br />
(KiGGS-Fragen) erfasst. Ergebnisse: Erste Analysen konnten<br />
zeigen, dass die Eltern sehr hohe Selbstwirksamkeitserwartungen haben.<br />
Für den Bereich der Bewegung ergaben sich keine Zusammenhänge zwischen<br />
der elterlichen Selbstwirksamkeit und dem Ausmaß der kindlichen<br />
Bewegung. Eltern von Kindern mit einem angemessenen TV-Konsum<br />
(max. 2 h pro Tag) berichteten über signifikant höhere Selbstwirksamkeitserwartungen<br />
als Eltern von Kindern mit einem zu hohen TV-Konsum. Vorgestellt<br />
werden sollen weiterhin Daten zu moderierenden Einflüssen (Alter,<br />
Geschlecht, Gewicht) auf die Beziehung zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen<br />
und dem Verhalten des Kindes. Zusammenfassung: Eltern adipöser<br />
Kinder erleben sich als hoch selbstwirksam bezüglich notwendiger<br />
Verhaltensumstellungen. Die Höhe ihrer Selbstwirksamkeitserwartung<br />
steht aber nicht immer in Beziehung zum kindlichen Verhalten. Weitere Untersuchungen<br />
sollten klären, ob sich Eltern unter Umständen überschätzen,<br />
um im Rahmen von Interventionsmaßnahmen gezielt realistische Selbstwirksamkeitserwartungen<br />
zu erarbeiten.<br />
<strong>Adipositas</strong>prävention an Grundschulen der Region Hannover<br />
Cornelia Ehrhardt (1), *Susanne Bantel (1)<br />
(1) Region Hannover, Fachbereich Jugend, Team Sozialpädiatrie<br />
und Jugendmedizin, Hannover, Deutschland<br />
Die Daten der Schuleingangsuntersuchungen für die Region Hannover<br />
zeigen, dass die Zunahme des Übergewichts bereits in der Grundschulzeit<br />
beginnt. Dieser Entwicklung möchte das Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin<br />
der Region Hannover mit dem Projekt, das Teil der vom Bundesministerium<br />
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geförderten<br />
Initiative „Besser essen. Mehr bewegen. Kinderleicht Regionen“ ist,<br />
entgegenwirken. Anhand der Datenlagen wurden Grundschulen ermittelt, in<br />
denen bereits zum Zeitpunkt der Einschulung ein überdurchschnittlich hoher<br />
Anteil an Kindern übergewichtig ist. Ziel ist die<br />
• Reduktion der Gewichtszunahme von der ersten bis zur vierten Klassen-<br />
stufe durch gleichwertige Verbesserung des Ernährungs- und Bewegungs-<br />
verhaltens<br />
• Stärkung der Persönlichkeit und Selbststeuerungsfähigkeit eines jeden Kindes<br />
• Bildung eines Gesundheitsverständnisses und die Etablierung von Ge-<br />
sundheit als ein Bildungsziel im pädagogischen Konzept der Schule: Die<br />
Intervention setzt im Setting Grundschule an und dehnt sich auf Freizeit<br />
und Elternhaus aus.<br />
Das Programm besteht aus drei Leitmodulen Bewegung, Ernährung und<br />
Selbststeuerungsfähigkeit, die Wissen, Selbsterfahrung sowie den Gewinn<br />
lebenspraktischer Fertigkeiten vermitteln. Zwei Präventionsansätze – Multiplikatorenansatz<br />
und Interventionsansatz – werden verfolgt, indem Bezugspersonen<br />
ausgebildet werden und eine Ernährungs- und Bewegungskultur<br />
entwickelt wird. Das Projekt trägt zur Optimierung der Schulverpflegung,<br />
zur Sicherstellung des täglich gesunden Schulfrühstücks durch die Sensibilisierung<br />
der Eltern und zu einer Unterrichts- und Schulhofgestaltung bei,<br />
die vielfältige Bewegungsanreize anbietet. Die Umsetzung erfolgt durch<br />
ein interdisziplinäres Team bestehend aus Oecotrophologinnen, Gesundheitsberaterin,<br />
Sportwissenschaftlerin, Übungsleiter, Psychologinnen und<br />
Schulärztinnen. Der Prozess wird durch ein großes Netzwerk fachspezifische<br />
Kooperationspartner unterstützt. Erste Zwischenergebnisse, z. B.<br />
Frühstücksverhalten sowie Erfahrungen aus der Elternarbeit, insbesondere<br />
bei Familien mit Migrationshintergrund werden vorgestellt.
Wegweiser zur bezahlbaren Medizin<br />
Günther S. Hanzl Ist unsere Medizin noch zu retten?<br />
0-48-1<br />
Verlags-GmbH, Neu-Isenburg<br />
Günther S. Hanzl<br />
Günther S. Hanzl<br />
Ist unsere Medizin<br />
noch zu retten?<br />
Plädoyer für eine<br />
Horizonterweiterung<br />
G. S. Hanzl setzt sich mit neuen Methoden zur Effizienz in der Medizin auseinander.<br />
Er ist der wichtigste Vordenker eines medizinischen Wandels, analysiert<br />
Wege und Irrwege der modernen Medizin. Sein ganzheitliches Denken passt<br />
Diagnostik und Therapie chronischer Erkrankungen einer naturwissenschaftlich<br />
begründbaren Realität an.<br />
Das Buch bietet eine Grundlage für eine dringend notwendige<br />
Gesundheitsdebatte, um langfristig effektiv und wirtschaftlich zur wieder bezahlbaren<br />
Medizin zu finden.<br />
In den 27 Kapiteln des Buches geht es unter anderem um:<br />
• unsere gegenwärtige medizinische Misere – nur ein finanzielles Problem?<br />
• das neue kybernetische Krankheitsmodell, Basis einer ganzheitlichen Medizin<br />
• Placebo – unbekanntes Wirkprinzip oder Begriffskeule<br />
• Homöopathie – entmystifiziert<br />
• Regulationsmedizin plus Akut- und Intensiv-Medizin, das neue universelle<br />
Gebäude der Medizin<br />
IST UNSERE MEDIZIN<br />
NOCH ZU RETTEN?<br />
Plädoyer für eine Horizonterweiterung<br />
LinguaMed Verlags-GmbH<br />
316 Seiten<br />
55 teilweise farbige Abbildungen<br />
ISBN 3-928610-48-1<br />
45,00 Euro<br />
<strong>LINGUAMED</strong><br />
Verlags-GmbH
42 30<br />
Poster: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
Veränderung der Körperzusammensetzung von Jenaer Kindern<br />
zwischen 1975 und 2005 in Abhängigkeit vom Gewichtsstatus<br />
*Nancy Gläßer (1), Konrad Zellner (1), Katrin Kromeyer-Hauschild (1)<br />
(1) Universitätsklinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena,<br />
Institut für Humangenetik und Anthropologie, Jena, Deutschland<br />
Einleitung und Ziel: Zwischen 1975 und 2005 hat sich die Übergewichtsprävalenz<br />
von Jenaer Kinder mehr als verdoppelt. Zielstellung dieser<br />
Studie ist es, die Veränderungen der Körperzusammensetzung in diesem<br />
Zeitraum zu beschreiben, wobei zwischen übergewichtigen sowie nicht<br />
übergewichtigen Kindern differenziert wird. Material und Methoden: Daten<br />
von 4157 Kindern und Jugendlichen (1975:1016 Jungen und 997 Mädchen;<br />
2005:1120 Jungen und 1024 Mädchen) aus Jena im Alter von 7 bis<br />
14 Jahren werden ausgewertet. Die Körperzusammensetzung wird anhand<br />
der Hautfaltendicken über dem Trizeps und unter der Scapula charakterisiert.<br />
Außerdem werden der BMI und die prozentuale Fettmasse betrachtet. Kinder<br />
mit einem BMI≤ P90 (AGA-Referenz) werden als nicht übergewichtig<br />
bzw. mit BMI-Werten > P90 als übergewichtig eingestuft. Mittels Varianzanalysen<br />
wird die Variabilität der o. g. Parameter in den Untersuchungsjahren<br />
und den Gewichtsgruppen auf Signifikanz geprüft. Ergebnisse: Zwischen<br />
1975 und 2005 ist es zu einer generellen Zunahme der SDS-Werte von<br />
Hautfaltendicken, prozentualer Fettmasse und BMI gekommen. Bei Unterteilung<br />
in Gewichtsgruppen ergibt sich ein differenziertes Bild: während die<br />
SDS-Werte in der Gruppe der übergewichtigen Kinder keine signifikanten<br />
Unterschiede zwischen 1975 und 2005 aufweisen, haben diese bei den nicht<br />
übergewichtigen Kindern signifikante Zunahmen erfahren. Zusammenfassung:<br />
Die hier gefundene Veränderung der Körperzusammensetzung zu<br />
höheren BMI-Werten bzw. Fettmassen bei nicht übergewichtigen Kindern,<br />
weisen auf eine Entwicklung hin, die anhand einer alleinigen Betrachtung<br />
von Prävalenzraten unbemerkt bleibt. Aber gerade diesen Veränderungen<br />
sollte größere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da eine erhöhte Fettmasse<br />
im Normalgewichtsbereich die Entstehung von Übergewicht begünstigt.<br />
Die ambulante <strong>Adipositas</strong>schulung „KLAKS“ für Familien<br />
mit Kindern im Schulalter<br />
*Franziska Hauskeller (1), Alexandra Keller (1), Katja Warich (2),<br />
Wieland Kiess (1), Susann Blüher (1)<br />
(1) Universitätsklinikum, Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendliche,<br />
Leipzig, Deutschland; (2) Sportwissenschaftliche Fakultät, Universität Leipzig,<br />
Institut für Rehabilitationssport, Sporttherapie und Behindertensport, Leipzig,<br />
Deutschland<br />
Zielstellung: Ziel der Studie ist die Evaluation der Wirksamkeit einer interdisziplinären<br />
<strong>Adipositas</strong>schulung („KLAKS“ = Konzept Leipzig: bewegungsaktive<br />
<strong>Adipositas</strong>schulung für Kinder im Schulalter). Das 1-jährige ambulante<br />
Schulungsprogramm richtet sich an Familien mit übergewichtigen oder adipösen<br />
Kindern/Jugendlichen und wird in Leipzig angeboten. Material: Die familienorientierte<br />
<strong>Adipositas</strong>schulung kombiniert die Module Ernährungstherapie,<br />
Bewegungsförderung, Medizin und Verhaltenstraining. Die Teilnehmer<br />
werden von einem interdisziplinären Team aus Kinderärzten, Sozialwissenschaftlern,<br />
Psychologen, Sportwissenschaftlern und Diätassistenten/Ökotrophologen<br />
betreut. Es finden wöchentlich 2 Sporteinheiten sowie abwechselnd<br />
Ernährungs-, Verhaltens- und Medizinschulungen statt. Ergänzend werden Elternabende,<br />
Kochvormittage und Familienexkursionen angeboten. Zu Beginn<br />
der Intervention, nach 6 sowie 12 Monaten findet eine ausführliche medizinische<br />
Untersuchung und Verhaltensdiagnostik der Teilnehmer statt. Folgende<br />
anthropometrische Parameter werden erfasst: Alter, Geschlecht, Körpergröße,<br />
Körpergewicht, BMI, BMI-SDS, Hüft- und Taillenumfang, Hautfaltendicken<br />
und die Pubertätsstadien nach Tanner. Weiterhin werden Blutdruck und Herzfrequenz<br />
gemessen. Das Ess/Ernährungs-, Bewegungs- und Freizeitverhalten<br />
sowie psychosoziale Parameter werden mittels Eltern- und Kinderfragebögen<br />
sowie Ernährungstagebuch erhoben. Ergebnisse: 30 Kinder/Jugendliche im<br />
Alter von 8–17 Jahren (Durchschnittsalter: 12,2 Jahren; 18 Mädchen, 12 Jungen)<br />
werden altersspezifisch in Gruppen geschult. Zu Beginn der Studie lag<br />
der durchschnittliche BMI bei 30,2 kg/m 2 und der BMI-SDS bei 2,4910. Nach<br />
6-monatiger Intervention ist der mittlere BMI um 0,89 kg/m 2 auf 29,3 kg/m 2<br />
(p=0,002) gesunken und der mittlere BMI-SDS hat sich auf 2,3589 (p
Poster: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
rigen Daten konnten einen positiven Zusammenhang zwischen der elterlichen<br />
Unterstützung der Bewegung und der Häufigkeit des Vereinssports, jedoch<br />
einen negativen Zusammenhang zur kindlichen Bewegung im Freien aufzeigen.<br />
Die emotionale Unterstützung wirkte sich entgegen den Erwartungen<br />
negativ auf die Häufigkeit körperlicher Aktivität aus. Die Unterstützung der<br />
Ernährung stand in keinem signifikanten Zusammenhang zu einer gesunden<br />
Ernährung des Kindes. Zusammenfassung: Die ersten Auswertungen deuten<br />
darauf hin, dass familiäre Unterstützung zwar im Zusammenhang mit den<br />
Verhaltensweisen des Kindes steht, dies jedoch entgegen den Erwartungen<br />
nicht immer positiv ist. Weitere Analysen sollen zeigen, inwieweit bestimmte<br />
Variablen (z. B. Alter, Geschlecht) diesen Zusammenhang moderieren.<br />
Identifikation von Determinanten der Gewichtsreduktion bei Kindern<br />
und Jugendlichen mit Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> (IDA-Insel)*<br />
*Alexander Kaps (1), Ralf Schiel (1)<br />
(1) MEDIGREIF-Inselklinik Heringsdorf GmbH, Fachklinik für Diabetes<br />
und Stoffwechselkrankheiten, Seeheilbad Heringsdorf, Deutschland<br />
Nach Teilnahme an strukturierten Behandlungs-/Schulungsprogrammen<br />
(SBSP) haben Kinder/Jugendliche mit Übergewicht/<strong>Adipositas</strong> eine hohe<br />
Outcome-Varianz. Häufig ergibt sich initial Gewichtsreduktion, danach aber<br />
Gewichtszunahme. Subgruppenanalysen 6/12 Monate belegen eine Splittung<br />
in „gute Responder“ mit effektiver, langfristiger und „marginale Responder“<br />
ohne dauerhafte Gewichtsreduktion. Ziel der Untersuchung war die Identifikation<br />
von Prädiktoren. Patienten/Methoden: Interdisziplinär wird ein standardisierter<br />
Fragebogen entwickelt (Stichprobengröße: 80 Kinder, Poweranalyse<br />
α
44 32<br />
Poster: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
Statistische Modellierung von Gewichtsänderungen und Beispielperzentilen<br />
für Gewichtsänderung auf Basis der CrescNet-Daten<br />
Christof Meigen (1), *Katrin Kromeyer-Hauschild (2), Eberhard Keller (1)<br />
(1) CrescNet gGmbH, Leipzig, Deutschland; (2) Universitätsklinikum Jena,<br />
Institut für Humangenetik und Anthropologie, Jena, Deutschland<br />
Zielsetzung: Erstellung von Standards für eine statistisch fundierte Einschätzung<br />
von Gewichtsänderungen im Kindes- und Jugendalter. Hintergrund:<br />
Bei der Beurteilung des Gewichts/BMI-Verlaufes eines Kindes spielt neben<br />
den Abolutwerten auch die Veränderung eine große Rolle. Zur Beurteilung<br />
muss diese in Bezug zu einem als normal akzeptierten Erwartungsspielraum<br />
gesetzt werden, wie dies bei Absolutwerten anhand anerkannter Perzentilwerte<br />
geschieht. Während in der Literatur hauptsächlich diskutiert wird, die Veränderung<br />
welchen Maßes (BMI, BMI-SDS oder Perzentilwerte) beobachtet<br />
werden sollte, fehlen Standards zur Beurteilung der Normalität einer konkret<br />
vorliegenden Gewichts/BMI-Entwicklung. Diese sind schwierig zu erstellen,<br />
weil viele Faktoren (Abstand der Messungen, Alter, Vorliegen von Übergewicht/<strong>Adipositas</strong><br />
etc.) berücksichtigt werden müssen. Material und Methoden:<br />
Die von der WHO empfohlene statistische Modellierung mit GAMLSS<br />
erlaubt die Erstellung von Perzentilen mit mehreren unabhängigen Variablen.<br />
Das CrescNet bietet eine einmalige Datenbasis für solche komplexen Modelle.<br />
Es wird jeweils ein Messpaar von im CrescNet longitudinal gemessenen<br />
Kindern ausgewählt (ca. 280‘000). Die Verteilung der gemessenen Gewichtsänderungen<br />
wird unter Einbeziehung des Alters, Geschlechtes, der Größe, der<br />
Größenänderung, des Abstandes der Messungen und des anfänglichen BMI-<br />
SDS mit GAMLSS modelliert. Ergebnisse: Anhand des errechneten Modells<br />
kann die Normalität einer beobachteten Gewichtsänderung beurteilt werden,<br />
d. h. für zwei beliebige Messungen wird eine Gewichtsänderungsperzentile in<br />
Bezug zu den CrescNet-Daten angegeben. Vereinfachte Modelle für praktisch<br />
relevante Spezialfälle wie die Gewichtsentwicklung nach einem Jahr bzw.<br />
zwischen Vorsorgeuntersuchungen sind auch ohne komplexe Rechnungen<br />
nutzbar. Zusammenfassung: Neue statistische Methoden und die Menge der<br />
Daten in der CrescNet-Datenbank ermöglichen die Erstellung von flexiblen<br />
und fundierten Modellen zur Beurteilung von Gewichtsänderungen.<br />
Mutationen des Melanocortin-4 Rezeptors – Eine häufige Ursache<br />
der kindlichen <strong>Adipositas</strong>?<br />
*Christin Melchior (1), Angela Schulz (1), Torsten Schöneberg (1),<br />
Wieland Kiess (2)<br />
(1) Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Institut für Biochemie, Molekulare<br />
Biochemie, Leipzig, Deutschland; (2) Universität Leipzig, Universitätsklinik<br />
und Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Leipzig, Deutschland<br />
Mutationen des Melanocortin-4 Rezeptors (MC4R) gelten als die häufigste<br />
monogenetische Ursache der kindlichen und adulten <strong>Adipositas</strong>. Bis dato<br />
wurden ca. 70 verschiedene MC4R-Varianten beschrieben. Informationen<br />
über die klinische Relevanz sind jedoch uneinheitlich. Interessanterweise<br />
scheint die Prävalenz auch enormen regionalen Schwankungen zwischen<br />
1–6 % zu unterliegen. In diesem Kontext wurde die Frequenz von MC4R-<br />
Mutationen in einer Kohorte adipöser Kinder und Jugendlicher aus dem<br />
Einzugsgebiet der Universitätskinderklinik Leipzig ermittelt. Das Screening<br />
der <strong>Adipositas</strong>-Kohorte (n=300, mittlerer BMI SDS=2,72±0,61, mittleres<br />
Alter=12,3±3,66 Jahre) erfolgte durch DNA-Sequenzierung des kodierenden<br />
Exons des MC4R. Die adipösen Patienten der Kohorte sind umfassend<br />
klinisch und labormedizinisch charakterisiert. Auf dieser Grundlage erfolgte<br />
die Analyse von Assoziationen zwischen Genotyp und adipösem Phänotyp.<br />
Detektierte MC4R-Varianten wurden heterolog in Säugerzellen exprimiert<br />
und die Rezeptorfunktion in verschiedenen Assays getestet. In der untersuchten<br />
Kohorte wurde eine Prävalenz von 6,0 % für MC4R-Varianten ermittelt.<br />
Dabei zeigte sich, dass die Häufigkeit der funktionell relevanten Mutationen<br />
(G181D, D90N, R165W) bei 1,0 % liegt. Weitere 5 % der adipösen<br />
Kinder sind Träger von Varianten (V103I, I251L, M200V, T112M, Y35Y),<br />
welche zu keiner signifikanten Funktionsänderung des Rezeptors in vitro<br />
führen. Identifizierte Varianten des relativ polymorphen Gens wurden hinsichtlich<br />
ihrer funktionellen Bedeutung evaluiert. Unsere Daten legen nahe,<br />
dass MC4R-Defekte als Ursache für die kindliche <strong>Adipositas</strong> in der Region<br />
Mitteldeutschland als selten anzusehen sind.<br />
Langzeitverlauf nach einem 12-monatigen multimodalen Gewichtsreduktionsprogramm<br />
bei einer Kohorte von 10-14 Jahre alten<br />
Kindern mit <strong>Adipositas</strong> (BMI >97.P.)<br />
Ulrike Müller (1), Otmar Ullrich (1), Sigrid Hohorst (1),<br />
*Klaus-Michael Keller (1)<br />
(1) Deutsche Klinik für Diagnostik, FB Kinder- und Jugendmedizin,<br />
Wiesbaden, Deutschland<br />
Ziel: Gewichtsreduktionsprogramme mit Langzeitverlauf sind selten und<br />
oft enttäuschend. Eine Finanzierung solcher Programme durch die Krankenkassen<br />
ist meist schwierig. Wir berichten über den Verlauf von 3 Jahren<br />
nach einem intensiven Programm. Methodik: 105 adipöse Kinder (46 Mäd-<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
chen; 10–14 Jahre alt; BMI >97.P.; 41 Kinder aus inkompletten Familien;<br />
48 % Mütter mit niedrigem Schulabschluss) durchliefen ein multimodales<br />
Programm mit Ernährungsberatung, strukturiertem Sportprogramm 2x/<br />
Woche und psychologischer Unterstützung falls erforderlich (gemäß Empfehlungen<br />
der a-g-a.de). Ergebnisse: 68 von 105 Kindern beendeten das<br />
1-Jahresprogramm: N=10/68 (14 %) waren normalgewichtig (BMI
Poster: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
In einer logistischen Regressionsanalyse erwiesen sich mütterliche Depressivität<br />
und Vorhandensein adipöser Geschwister als beste und voneinander<br />
unabhängige Prädiktoren.<br />
Positive Auswirkungen einer stationären <strong>Adipositas</strong>-Therapie<br />
auf den Fettstoffwechsel bei übergewichtigen und adipösen Kindern<br />
und Jugendlichen<br />
*Anja Pertl (1), Monika Siegrist (1), Nathalie Göhl (1), Melanie Rank (1),<br />
Bernd Wolfarth (1), Alexander Livadas (2), Helmut Langhof (2),<br />
Martin Halle (1)<br />
(1) Klinikum rechts der Isar der TU München, Präventive und Rehabilitative<br />
Sportmedizin, München, Deutschland; (2) Rehabilitationsklinik Schönsicht,<br />
Berchtesgaden, Deutschland<br />
Zielsetzung: Die Auswirkungen einer auf Ernährungsumstellung und Erhöhung<br />
der körperlichen Aktivität basierenden stationären <strong>Adipositas</strong>-Therapie<br />
auf den Fettstoffwechsel von übergewichtigen und adipösen Kindern<br />
und Jugendlichen wurden untersucht. Material und Methoden: Zu Beginn<br />
und bei Abschluss der 4–6-wöchigen Therapie wurden das LDL- und HDL-<br />
Cholesterin von 303 übergewichtigen und adipösen Kindern/Jugendlichen<br />
(BMI=33,6±6,0kg/m 2 ) im Alter von 8-18 Jahren gemessen. Die Studienteilnehmer<br />
wurden entsprechend ihrer Fettstoffwechsel-Werte in 4 Gruppen<br />
eingeteilt: Normalbefund (LDL40mg/dl), erhöhtes LDL-<br />
Cholesterin (LDL>125mg/dl, HDL>40mg/dl), erniedrigtes HDL-Cholesterin<br />
(LDL
46 34<br />
Poster: <strong>Adipositas</strong> im Kindes- und Jugendalter<br />
Beginn und am Ende der stationären Therapie sowie nach 6 und 12 Monaten<br />
hinsichtlich Anthropometrie (Körpergröße, Körpergewicht, Bauchumfang)<br />
sowie Bewegungs- und Ernährungsverhalten (Fragebogen) untersucht. Während<br />
des Aufenthalts in der Klinik erhielten die Kinder eine kalorienreduzierte<br />
Mischkost und nahmen an einem Sportprogramm sowie an verhaltenstherapeutischen<br />
Gruppen teil. Ergebnisse:<br />
1. Die Gewichtsreduktion betrug während der Therapie im Mittel 8,9±4,7<br />
kg und lag nach einem Jahr noch signifikant unter den Ausgangswerten<br />
(im Durchschnitt -4,5 kg±9,7 kg, p97.Perzentile) am<br />
KinderLeicht-Abnehmprogramm teil. Am Beginn und zum Ende der Therapie<br />
wurden Körpergewicht und -größe gemessen und mit dem APV-Programm<br />
verarbeitet, mit den APV-Fragebögen wurde die Lebensqualität erfasst. Die<br />
Benchmarkingergebnisse erlauben einen Vergleich von 114 ambulanten und<br />
stationären <strong>Adipositas</strong>therapieeinrichtungen in Deutschland. Seit 06/2006 wird<br />
das KinderLeicht-Programm durch die Beobachtungsstudie (EvAKu-Projekt)<br />
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung evaluiert. Ergebnisse:<br />
Der deutschlandweite Benchmarking-Vergleich zeigt, dass das 6-monatige<br />
KinderLeicht-Abnehmprogramm die Senkungsrate des BMI-SDS-Verlaufes<br />
um Minus 0.51 verändert und damit die besten Therapieergebnisse erzielt hat.<br />
Die Auswertung erfolgte durch den APV-Daten-Pool. Insgesamt nahmen von<br />
6/2006 bis 10/2007 38 Kinder am Programm teil. Das Durchschnittsalter betrug<br />
10,7 Jahre. Die Drop-out-Quote lag bei 5 %, also zwei Teilnehmern. Die<br />
Entwicklung des BMI zwischen Therapiebeginn (To) und Therapieende (T1)<br />
zeigt eine Senkung um durchschnittlich 1,32. Zusammenfassung: Die Daten<br />
bestätigen, dass KinderLeicht – Das ambulante Abnehmprogramm eine sinnvolle<br />
und erfolgreiche Therapie bei <strong>Adipositas</strong> ist. Die nachweisbaren Erfolge<br />
lassen sich durch das qualifizierte und interdisziplinär arbeitende Team, den<br />
ganzheitlichen, lösungsorientierten und familiensystemischen Therapieansatz<br />
begründen. Das therapeutische Zaubern übernimmt dabei als Motivationselement<br />
eine wichtige Rolle.<br />
Neues zur Komorbidität der <strong>Adipositas</strong> bei Kindern<br />
und Jugendlichen- Besonderheiten bei Migranten<br />
Susanna Wiegand<br />
Charité Universitätsmedizin Berlin, Pädiatrische Endokrinologie<br />
und Diabetologie, Berlin, Deutschland<br />
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sind in Deutschland doppelt<br />
so häufig adipös im Vergleich zu Kindern deutscher Herkunft. Adipöse<br />
Jugendliche mit afrikanischer, spanischer oder idianischer Abstammung,<br />
die in den USA leben, haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines<br />
Typ 2 Diabetes und gelten deshalb als „ethnische Risikogruppen“. Für Europa<br />
ist bisher ungeklärt, ob es vergleichbare Risikokonstellationen gibt.<br />
Wir untersuchten deshalb 932 adipöse Kinder und Jugendliche (50,1 %<br />
deutscher, 26.4 % türkischer und 23.5 % anderer Herkunft) bezüglich der<br />
Häufigkeit einer Insulinresistenz und eines metabolischen Syndroms, unter<br />
Berücksichtigung des Migrationshintergrundes. Der R-HOMA-Wert (als<br />
Maß für die Insulinresistenz) wurde berechnet und die Prävalenz des metabolischen<br />
Syndroms (nach WHO) bestimmt. Die bivariaten Analysen wurden<br />
mit Chi²- und Mann-Whitney-U-Test, die multivariaten Analysen mit<br />
einer multiplen logistischen Regression durchgeführt: Die türkische Patientengruppe<br />
zeigte signifikant häufiger eine pathologische Erhöhung des<br />
R-HOMA-Wertes verglichen mit Kindern deutscher (p
Poster: Schulungsprogramme und Reha-Konzepte<br />
te gegenüber einer Kontrollgruppe der BMI-SDS signifikant gesenkt und die<br />
motorische Leistungsfähigkeit signifikant gesteigert werden. Das Programm<br />
hat sich damit als effektive Maßnahme zur Primärprävention von <strong>Adipositas</strong><br />
im Vorschulalter erwiesen. Die Nachhaltigkeit der Effekte gilt es nach weiteren<br />
12 Monaten zu überprüfen.<br />
*Mit Unterstützung des BKK-Landesverbandes Niedersachsen/Bremen<br />
und des Nationalen Aktionsforums Diabetes Mellitus (NAFDM)<br />
Poster: Schulungsprogramme und Reha-Konzepte<br />
Langfristig Leichter Leben. Etappenheilverfahren <strong>Adipositas</strong><br />
nach dem Bad Säckinger Modell<br />
*Johannes Bauer (1), Ernst-Ludwig Karl (2)<br />
(1) Hochrhein-Eggberg-Klinik, Bad Säckingen, Deutschland;<br />
(2) DRV Baden-Württemberg, Karlsruhe, Deutschland<br />
Zielsetzung: In Deutschland stellen metabolische Erkrankungen und<br />
Herz-Kreislauf-Erkrankungen die höchsten Belastungen für das Gesundheitssystem<br />
dar. Mehr als 80 % der gesamten Krankheitslast dieser beiden<br />
Erkrankungen werden modifizierbaren Risikofaktoren zugeschrieben.<br />
Das Etappenheilverfahren <strong>Adipositas</strong> hat zum Ziel, Risikopersonen im<br />
Stadium des metabolischen Syndroms im betriebsärztlichen Setting zu<br />
identifizieren sowie im Rahmen einer mehrmaligen erfolgsabhängigen<br />
Intervention die Teilnehmer zu einer nachhaltigen Lebensstiländerung<br />
zu motivieren. Materialien und Methoden: Voraussetzungen für die<br />
Teilnahme sind: deutliches Übergewicht mit einem Body Mass Index<br />
über 35 kg/qm, hohe Motivation, vorhandene Arbeitsfähigkeit, ausreichende<br />
Beweglichkeit ohne schwerwiegende Gelenkprobleme. Sind diese<br />
Voraussetzungen erfüllt, stellt der Betriebs- oder Hausarzt für den<br />
Teilnehmer bei der DRV Baden-Württemberg einen Reha-Antrag, in<br />
dem er eine Teilnahme am Etappenheilverfahren Langfristig Leichter<br />
Leben (LLL) befürwortet. Das gesamte Etappenheilverfahren dauert<br />
35 Tage und wird aufgeteilt in ein Grundheilverfahren sowie in eine<br />
1. Etappe und 2. Etappe nach jeweils 6 Monaten. Ergebnisse: Seit dem<br />
Jahr 2006 sind mittlerweile 46 Teilnehmer in das Etappenheilverfahren<br />
<strong>Adipositas</strong> eingeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen haben bisher<br />
12 Teilnehmer mit einer mittleren Gewichtsabnahme von minus 16,3kg<br />
nach einem Jahr. Mittlerer BMI zu Beginn: 40 kg/m 2 . 60 % erfüllten die<br />
ATP III NCEP-Kriterien des metabolischen Syndroms. Dropout: bisher<br />
12 Teilnehmer wegen zwischenzeitlicher Gewichtszunahme. Zusammenfassung:<br />
Das Etappenheilverfahren <strong>Adipositas</strong> in Zusammenarbeit mit der<br />
DRV Baden-Württemberg bietet sich an als effektive Methode, 1. Risikopersonen<br />
im Stadium des Metabolischen Syndroms im betriebsärztlichen<br />
Setting zu identifizieren, 2. im stationären Setting die notwendige Lebensstiländerung<br />
einzuleiten und 3. die Nachhaltigkeit der Lebensstiländerung<br />
durch eine kontinuierliche Betreuung über ein Jahr zu gewährleisten.<br />
„Wenn das Gewicht an Gewicht verliert“ –<br />
Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung!<br />
*Franz Flaggl (1), Michaela Lientscher (2), Walter Döller (2)<br />
(1) Landeskrankenhaus, Klinische Psychologie, Wolfsberg, Österreich;<br />
(2) Landeskrankenhaus, Zentrum für Lymphologie, Wolfsberg, Österreich<br />
Zielsetzung: Am Zentrum für Lymphologie werden Patienten mit den<br />
verschiedensten Formen des Lymphödems behandelt. <strong>Adipositas</strong> ist eine<br />
häufige Komorbidität (77 %), oft aber auch ein Triggerfaktor für die Entstehung<br />
von Lymphödemen. In einer multiprofessionellen Zusammenarbeit<br />
wird die <strong>Adipositas</strong> bei Rehab-Patienten zu einem Behandlungsschwerpunkt<br />
gemacht. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Patienten<br />
in ihren Selbstmanagementfähigkeiten zu stärken und sie zu befähigen,<br />
bezüglich ihrer angestrebten Ziele, Experten in eigener Sache zu werden.<br />
Materialien und Methoden: Federführend in der Strategieentwicklung<br />
sind die Betroffenen selbst. Mit multiprofessioneller Unterstützung entwickeln<br />
die Patienten ihre persönlichen Strategien zur Gewichtsreduktion<br />
und damit auch zur Lebensstilveränderung. Aufbauend auf Erkenntnissen<br />
der Gehirnforschung werden die Patienten angeleitet, dabei auch unbewusste<br />
Prozesse zu berücksichtigen (z. B. Konzept der somatischen Marker).<br />
Schuldgefühle und Selbstzweifel werden abgebaut und positive Ziele<br />
werden unter Berücksichtigung des gesamten Lebenskontextes erstellt.<br />
Angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse, werden flexible Nachsorgekonzepte<br />
(Telefon, E-Mail, persönlicher Kontakt) angeboten. Ergebnisse: Die<br />
Patienten berichten generell über ein erhöhtes Selbstwertgefühl und über<br />
eine Verbesserung der Lebensqualität. Das Erreichen der ursprünglich angestrebten<br />
Gewichtsreduktion wird von den Patienten oft „nur“ als angenehmer<br />
Nebeneffekt bezeichnet. Zusammenfassung: Der Perspektivenwechsel<br />
vom problemorientierten hin zum ressourcenorientierten Zugang<br />
zeigt eine erhöhte Zufriedenheit der Patienten, deutliche Ergebnisse in der<br />
Gewichtsreduktion und auch eine Verbesserung der Arbeitszufriedenheit<br />
im multiprofessionellen Team.<br />
Ernährungstherapie bei adipösen Typ 2-Diabetikern mit kohlenhydratreduzierter<br />
Kost (LOGI ® Methode) in der Reha-Klinik Überruh<br />
Peter Heilmeyer (1), *Silke Kohlenberg (1), Angeklika Dorn (1),<br />
Susanne Faulhammer (1), Rudolf Kliebhan (1)<br />
(1) Rehaklinik Überruh, Isny, Deutschland<br />
Zielsetzung: Wirksamkeitsüberprüfung einer kohlenhydratreduzierten<br />
Kostform (Logi ® -Methode) kombiniert mit Bewegungstherapie auf selektierte<br />
Stoffwechselparameter, Körpergewicht und -fett, bei übergewichtigen<br />
Patienten mit Diabetes mellitus Typ-2 während einer stationären Reha-Maßnahme<br />
(3 Wochen). Material und Methoden: 45 Typ-2 Diabetiker (BMI<br />
34,8 ± 6,1) mit Typ 2-Diabetes erhielten über 3 Wochen eine kohlenhydratreduzierte<br />
Kostform (LOGI ® -Kost: 30 % Kohlenhydrate, 25 % Eiweiß,<br />
45 % Fett) ad libitum, zusätzlich ein Trainingsprogramm (ca. 200-400 kcal<br />
Kalorienmehrverbrauch pro Tag). Gewicht, Stoffwechseldaten und die Medikation<br />
wurden am 1. Tag und 18. Tag erfasst. Vergleichsgruppe: 45 Typ<br />
2-Diabetiker (BMI 36,1 ±7,9) aus den Jahren 1999-2001 behandelt mit einer<br />
1500 kcal fettreduzierten Kost (30 % Fett) und identischem Bewegungsprogramm.<br />
Ergebnisse: Hochsignifikanter Gewichtsverlust (-2,9 kg) in der<br />
LOGI-Gruppe, bei den Stoffwechselparametern hochsignifikante (p
48 36<br />
Poster: Schulungsprogramme und Reha-Konzepte<br />
(1) Psychosomatische Klinik, Bad Grönenbach, Deutschland; (2) Fachklinik<br />
Allgäu, Pfronten, Deutschland; (3) Klinik Bad Reichenhall, Pneumologie,<br />
Bad Reichenhall, Deutschland<br />
Als multifaktorielle Störung ist die <strong>Adipositas</strong> eine Erkrankung, die durch<br />
Probleme im Ess- und Bewegungsverhalten verursacht wird und viele Auslöser<br />
im psychischen Bereich hat (Binge-Eating, Sweet-Eating). Bei vielen<br />
Adipösen lässt sich ein durch emotional belastete Situationen ausgelöster<br />
Teufelskreis nachweisen, was durch Nahrungsaufnahme z. T. in Essanfällen<br />
zur kurzfristigen Stimmungsverbesserung führt. Dies führt jedoch zu<br />
langfristig negativen Konsequenzen, was den Teufelskreis erneut unterhält.<br />
Daher wurde eine verhaltenstherapeutische multimodale Gruppe zur Modifikation<br />
des Essverhaltens mit Ernährungsberatung, Sporttherapie, Schulungsbuffett,<br />
Lehrküche und Selbsthilfegruppe ohne diätetische Maßnahmen<br />
bzgl. ihrer langfristigen Wirkung nachuntersucht. Patienten und Methode:<br />
Eingeschlossen wurden alle Patienten der o. g. Gruppe (n = 261) mit einem<br />
BMI > 30kg/m 2 sowie BMI 25–30 mit komplizierenden Erkrankungen.<br />
Es erfolgte eine Fragebogen gestützte Nachuntersuchung über 24 Monate<br />
(Fragebogen zum Essverhalten nach PUDEL und WESTERHOFER) zu 10<br />
Messzeitpunkten. Ergebnis: Der Rücklauf der Fragebögen lag bei 58,7 %<br />
(Range der Messzeitpunkte 41,6 %–100 %). Insgesamt nahmen die Patienten<br />
im Mittel von 101,7 kg auf 92,4 kg ab (p=0,000). In den Fragebögen<br />
zeigte sich zudem ein Zunahme der kognitiven Kontrolle von 9,15 auf 13,59<br />
(von 21) Items, nahm ab dem 12. Monat leicht auf 12,47 ab. Die Störbarkeit<br />
des Essverhaltens nahm von 8,2 auf 5,9 (von 16 Items) ab. Die Wahrnehmung<br />
des Hungergefühls nahm von 5,9 auf 3,8 (von 14 Items) ab. Alle<br />
Ergebnisse waren hochsignifikant. Schlussfolgerung: Mit einem multimodalen<br />
verhaltenstherapeutischen Ansatz, der auch die psychischen Ursachen<br />
des Essverhaltens mitberücksichtigt, ist es möglich, das Essverhalten langfristig<br />
zu modifizieren.<br />
Je länger und aufwändiger desto besser? Sind Gruppenkonzepte<br />
tatsächlich der individuellen Betreuung von übergewichtigen/<br />
adipösen Kindern und Jugendlichen überlegen?<br />
Sonja Mannhardt<br />
Praxis für Ernährungstherapie PommeFRIZ, Schliengen, Deutschland<br />
Zielsetzung: In der Literatur wird die Hypothese geschürt, dass Einzeltherapien<br />
wegen ihrer fehlenden Interdisziplinarität und der kurzen Betreuungszeit<br />
wenig Erfolg versprechend sind und interdisziplinäre Jahresschulungen<br />
den golden Standard darstellen. Konkrete Ergebnisse im Clustervergleich<br />
von unterschiedlichen Anbietern wird die BzgA Studie liefern. In dieser Studie<br />
soll diese These durch die Betrachtung verschiedener Angebote eines<br />
einzelnen Anbieters betrachtet werden, sowie es der üblichen Angebotsstruktur<br />
auf dem freien ambulanten Markt entspricht. Einzeltherapien nach<br />
§43 SGV V, Gruppenkonzepte mit Schwerpunkt Ernährung §20 SGB V und<br />
Einjahresschulungen nach §43 SGB V der Praxis für Ernährungstherapie<br />
PommeFRIZ stehen sowohl Kostenträgern, Betroffenen und Arztpraxen<br />
des ambulanten <strong>Adipositas</strong>netzwerkes Markggräflerland zur Verfügung und<br />
werden verglichen? Methode: Gibt es bei gleichbleibender Struktur- und<br />
Prozessqualität des Anbieters Unterschiede in der BMI-Reduktion am jeweiligen<br />
Ende der Maßnahme? Um dieser Frage nachzugehen wurden aus<br />
dem APV-Gesamtdatenpool der Praxis für Ernährungstherapie drei Cluster<br />
gebildet 1. Patienten mit Enährungstherapie (n=19) 2. Patienten mit Ernährungskurs<br />
(n=15) 3. Patienten mit Jahresschulung (n=12). Die Eingangs<br />
BMI-werte waren 25,5 +/- 0,3 vergleichbar, ebenso das Durchschnittsalter.<br />
Ergebnisse und Zusammenfassung: Die Ergebnisse können nicht bestätigen,<br />
dass Einzeltherapien den Gruppenkonzepten unterlegen sind. Einzelberatungen<br />
wie sie in der Praxis durchgeführt werden, sind ebenso erfolgreich<br />
zum Zeitpunkt T1 wie das Jahresprogramm. Hingegen schneiden die<br />
Präventionskurse mit dem Schwerpunkt Ernährung deutlich schlechter ab.<br />
Die Ergebnisse sollen in diesem Beitrag vorgestellt, die möglichen Ursachen<br />
zur Diskussion gestellt werden und abschliessend die daraus resultierenden<br />
Konsequenzen für die Angebotsstruktur der ambulanten Praxis für Ernährungstherapie<br />
PommeFRIZ, sowie des ambulanten <strong>Adipositas</strong>netzwerkes<br />
Markgräflerlandes vorgestellt werden.<br />
Ernährungssituation von übergewichtigen Kinder und Jugendlichen<br />
in der Evaluationsstudie Obeldicks light<br />
*Anke Schaefer (1), Katrin Winkel, Emily Finne (2), Petra Kolip,<br />
Thomas Reinehr (1)<br />
(1) Vestische Kinder- und Jugendklinik, Obeldicks, Datteln, Land;<br />
(2) Universität Bremen, Public Health, Bremen, Deutschland<br />
Zielsetzung: Während für adipöse Kinder und Jugendliche verstärkt ambulante<br />
Therapieprogramme angeboten werden, gibt es bislang für Übergewichtige<br />
im präventiven Bereich kein entsprechendes evaluiertes Angebot.<br />
„Obeldicks light“ schließt übergewichtige Kinder und Jugendliche in ein<br />
sechsmonatiges interdisziplinäres Schulungsprogramm ein. Zu Anfang und<br />
am Ende der Schulung erstellen die Teilnehmer dreitägige Ernährungspro-<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
tokolle. Ziel ist herauszufinden, ob sich das Ernährungsverhalten langfristig<br />
verändert. Methoden: Ein Randomisierungsprinzip unterteilt in eine Wartekontrollgruppe<br />
(t0) und eine Interventionsgruppe (t1). Die Wartekontrollgruppe<br />
beginnt sechs Monate nach der Anmeldung mit der Intervention. Zu<br />
Beginn und nach sechs Monaten wird ein dreitägiges Ernährungs-Wiege-<br />
Protokoll angefertigt. Die Teilnehmer der Wartekontrollgruppe erhalten zur<br />
Überbrückung eine Broschüre mit Ernährungsempfehlungen. Ergebnisse:<br />
Bei der bisherigen Protokollauswertung können 21 Teilnehmer (11 weiblich,<br />
10 männlich) von zwei Studienstandorten herangezogen werden. Die Wartekontrollgruppe<br />
besteht aus 5 Teilnehmern. Die Protokolle der Wartekontrollgruppe<br />
zu t0 ergaben in der Auswertung einen Fettanteil von 33,18 %, Kohlenhydratanteil<br />
von 47,30 % und Eiweißanteil von 16,80 %. Die Teilnehmer<br />
haben bis zum Interventionsbeginn t1 weiter an Gewicht zugenommen und<br />
im Durchschnitt mehr Fett verzehrt. Betrachtet man die Interventionsgruppe<br />
(n=21) zur Kontrollgruppe (n=14) anhand der Ernährungsprotokolle ist<br />
kein signifikanter Unterschied in der Hauptnährstoffverteilung zu erkennen.<br />
Der Vergleich der Protokolle von to zu t1 zeigt, dass allein die Information<br />
über gesunde Ernährung anhand einer Broschüre nicht ausreicht. Zusammenfassung:<br />
Die Ernährungsprotokolle zeigen einen Minderverzehr von<br />
Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Milch, Milchprodukten und eine zu geringe<br />
Flüssigkeitszufuhr. Die Auswertung muß „Underrepording“ berücksichtigen.<br />
Die Protokollierung hat jedoch den Vorteil, daß den Kindern und<br />
Jugendlichen ihr Eßverhalten bewußter wird.<br />
Psychosomatische Rehabilitation – Therapiekonzept in der<br />
Behandlung von schwerstgewichtigen Patienten (BMI > 50)<br />
Christian Stierle (1), *Stefan Schmidt (1)<br />
(1) MediClin Seepark Klinik, Bad Bodenteich, Deutschland<br />
Mit dem statistisch nachgewiesenen Anstieg der übergewichtigen Menschen<br />
in Deutschland, steigt auch die Anzahl der <strong>Adipositas</strong> Grad III Patienten<br />
(BMI >50). Diese Patienten stellen eine besondere Herausforderung<br />
in der medizinischen/psychosomatischen Behandlung dar. Oft eingetretene<br />
langjährig chronifizierte Immobilität stellt eine schwer überwindbare Schranke<br />
für den Gesundungsprozess des Patienten dar. Die klassische Liste von<br />
psychischen und körperlichen Komorbiditäten sowie die soziale Ausgrenzung<br />
bilden einen nur schwer zu durchbrechenden Teufelskreis. Für viele<br />
Parameter gibt es bisher wenige oder keine gesicherten Daten, zumal die<br />
Diagnostik erschwert ist. Dies birgt erhebliche Risiken. Wir möchten diese<br />
anhand eines Fallbeispieles aufzeigen. Dazu beschreiben wir den Therapieverlauf<br />
eines primär immobilen Patienten mit ausgeprägten körperlichen und<br />
psychischen Begleiterkrankungen nach GASTRIC SLEEVE Op. mit einem<br />
BMI von 65,3.<br />
Integrierte Versorgung bei <strong>Adipositas</strong> und Metabolischem Syndrom<br />
*Anja Vogt (1), Elke Bresch (1), Christina Terán (2),<br />
Elisabeth Steinhagen-Thiessen (1), Andrea Riedl (3),<br />
Anne Ahnis (3), Burghard Klapp (3), Rüya Kocalevent (4)<br />
(1) Charité, Virchow-Klinikum, Interdisziplinäres Stoffwechsel-Centrum,<br />
Berlin, Deutschland; (2) St. Hedwigs Krankenhaus, Psychiatrische Abteilung,<br />
Berlin, Deutschland; (3) Charité, Campus Mitte, Psychosomatik, Berlin,<br />
Deutschland; (4) Freie Universität, Public Health, Berlin, Deutschland<br />
Hintergrund: Obwohl die zunehmende Inzidenz von Übergewicht und<br />
<strong>Adipositas</strong> genauso wie die notwendigen Änderungen des Lebensstiles gut<br />
bekannt sind, bleibt es nahezu unmöglich, das Gesundheitsverhalten der Betroffenen<br />
nachhaltig zu verändern. Teilweise ist dies darauf zurückzuführen,<br />
daß die Krankenkassen die entstehenden Kosten nicht oder nur teilweise<br />
übernehmen. Ziele: Basierend auf unseren mehrjährigen Erfahrungen mit einer<br />
strukturierten, multi-disziplinären Gruppentherapie für adipöse Erwachsene,<br />
die über ein halbes Jahr lief, haben wir gemeinsam mit einer Krankenversicherung<br />
eine Gruppentherapie über ein Jahr im Rahmen eines Vertrages<br />
zur Integrierten Versorgung entwickelt. Neben den positiven psychosomatischen<br />
und medizinischen Effekten erwarten wir außerdem wegen der gesicherten<br />
Kostenübernahme eine höhere Teilnahmerate. Methode: Der Vertrag<br />
zur Integrierten Versorgung ist eine Kooperation der Charité mit der DAK<br />
(Deutsche Angestellten Krankenkasse). Vor der Aufnahme in das Programm<br />
erfolgt eine strikte Auswahl, um ungeeignete Patienten, z. B. ohne intrinsische<br />
Motivation oder mit schwerwiegenden Krankheiten, auszuschließen,<br />
die von dieser Art Programm nicht profitieren würden. Das Programm läuft<br />
über ein Jahr und beinhaltet internistische Begleitung, Bewegungstherapie,<br />
Verhaltenstherapie und Progressive Muskelrelaxation sowie Ernährungsberatung<br />
und Lehrküchen. Interdisziplinäre Verlaufsuntersuchungen erfolgen<br />
vierteljährlich. Für Patienten mit morbider <strong>Adipositas</strong> besteht im Verlauf die<br />
Möglichkeit der bariatrischen Operation. Außerdem ist die enge Zusammenarbeit<br />
mit den Hausärzten implementiert, um die begleitenden kardiovaskulären<br />
Risikofaktoren zu verbessern. Ausblick: Wir erwarten neben einer<br />
regulierten Rekrutierung und einer vereinfachten Organisation eine nachhaltige<br />
Gewichtsreduktion sowie eine Verbesserung der Lebensqualität und des
Poster: Klinische Aspekte der <strong>Adipositas</strong> und Komorbiditäten<br />
Gesundheitsverhaltens. Durch die Kursdauer über ein Jahr sollten die guten<br />
Ergebnisse, die wir mit dem halbjährigen Programm erreichen konnten, weiter<br />
verbessert werden können.<br />
Poster: Klinische Aspekte der <strong>Adipositas</strong> und Komorbiditäten<br />
Sekundärer Hyperparathyreoidismus bei <strong>Adipositas</strong><br />
ist nicht mit Insulinresistenz assoziiert<br />
*Barbara Ernst (1), Martin Thurnheer (1), Bernd Schultes (1)<br />
(1) Kantonsspital St. Gallen, <strong>Adipositas</strong>zentrum, Rorschach, Schweiz<br />
Zielsetzung: Das häufige Vorkommen eines sekundären Hyperparathyreoidismus<br />
im Rahmen einer <strong>Adipositas</strong> ist ein bekanntes Phänomen. In<br />
einer Querschnittsstudie untersuchten wir an einem grossen Kollektiv adipöser<br />
Patienten, ob ein sekundärer Hyperparathyreoidismus mit einer Insulinresistenz<br />
assoziiert ist. Materialien und Methoden: Insgesamt wurden<br />
231 adipöse Patienten mit einem BMI > 30 kg/m 2 in unserem interdisziplinären<br />
<strong>Adipositas</strong>zentrum untersucht. Neben den Blutparametern wurde die<br />
Fettmasse (FM) der untersuchten Personen mittels bioelektrischer Impedanz-<br />
analyse ermittelt. Der sekundäre Hyperparathyreoidismus wurde definiert<br />
als eine Erhöhung der intakten Parathormon (iPTH) Konzentration > 6.5 pmol/l<br />
bei normaler Calcium-Konzentration. Ergebnisse: Einen sekundären Hyperparathyreoidismus<br />
wiesen 37.8 % der untersuchten Patienten auf. In<br />
einer bivariaten Korrelationsanalyse wurde ein positiver Zusammenhang<br />
zwischen iPTH und Alter (r=0.20, P
50 38<br />
Poster: Körperkomposition und Energiebilanz<br />
Zielsetzung: Einflussfaktoren wie Bewegungsmangel, überkalorische Ernährung<br />
und dysfunktionales Essverhalten steigern die Inzidenzrate von Übergewicht<br />
und <strong>Adipositas</strong> stetig. Hauptziel des „Schwerelos“-Programms ist<br />
die langsame und nachhaltige Gewichtsreduktion mit Hilfe einer dauerhaften<br />
Umstellung der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten. Weitere Ziele sind<br />
Reduktion von Komorbiditäten und Folgeerkrankungen. Das PSZW Eggenburg<br />
untersucht die Effektivität dieser stationären Intensivbehandlung mit anschließendem<br />
Nachbetreuungskonzept bei adipösen Patienten mit psychischer<br />
Komorbidität. Material und Methoden: Das „Schwerelos“-Programm beruht<br />
auf den 4 Säulen Ernährung, Bewegung, Verhalten und Emotionsregulation.<br />
Das „Schwerelos“-Programm orientiert sich an den international anerkannten<br />
Leitlinien der Deutschen <strong>Adipositas</strong>gesellschaft, sowie Bausteinen<br />
des wissenschaftlich evaluierten „Schlank ohne Diät“-Programms nach Kiefer,<br />
Kunze und Schoberberger. Speziell weiterentwickelt wurden Trainings<br />
zur Affektregulation. Die stationäre Therapiedauer beträgt zwischen 8 und<br />
12 Wochen, die Patienten werden anschließend im 3-Monats-Rhythmus<br />
nachuntersucht. Wichtige Therapieelemente sind Selbstwertförderung, Verbesserung<br />
psychischer Beeinträchtigungen und gesundheits-bezogener Lebensqualität,<br />
sowie die Steigerung der körperlichen Aktivität. Mit Hilfe einer<br />
Ernährungsumstellung auf gesundheitsbewusste Mischkost mit geregeltem<br />
Mahlzeitenrhythmus und Einübung eines flexibel kontrollierten Essverhaltens<br />
soll eine langfristige Gewichtsstabilisierung mit ausgeglichener Energiebilanz<br />
erreicht werden. Ein wichtiges Therapieinstrument ist die Protokollführung<br />
zur Erfassung von Nahrungs- und Bewegungsenergiewerten, sowie der Affektivität.<br />
Die Protokollführung erfolgt schriftlich oder mittels „Schlank ohne<br />
Diät“-online-Programm. Ergebnisse & Zusammenfassung: Bisherige Daten<br />
zeigen, dass die langfristig angelegte Behandlung von hochgradig übergewichtigen<br />
Personen mit hoher psychischer und somatischer Komorbidität von<br />
großer Relevanz ist. Die vorgestellte Langzeitstudie weist überdurchschnittlich<br />
hohe Efektstärken in allen relevanten Zielparametern auf.<br />
Strukturierte Behandlung und Schulung von Kindern<br />
und Jugendlichen mit Übergewicht und <strong>Adipositas</strong><br />
*Ralf Schiel (1), Tanja Nieschalk (1), Steffi Heiland (1),<br />
Guido Kramer (1), Alexander Kaps (1)<br />
(1) MEDIGREIF-Inselklinik Heringsdorf GmbH, Fachklinik für Diabetes<br />
und Stoffwechselkrankheiten, Seeheilbad Heringsdorf, Deutschland<br />
Die Prävalenz von Übergewicht und <strong>Adipositas</strong> bei Kindern und Jugendlichen<br />
zwischen 3 und 17 Jahren beträgt bis zu 15 %. Ziel der Querschnittsuntersuchung<br />
war die Analyse von metabolischen und kardiovaskulären Risikofaktoren<br />
bei Patienten einer Rehabilitationsklinik. Methoden: Es wurden<br />
alle Kinder und Jugendlichen (n=558, Alter 13,8±2,5 Jahre, 55 % Mädchen,<br />
Größe 1,63±0,12 m, Gewicht 79,3±22,5 kg) erfasst, die 04/2004 bis 04/2008<br />
eingewiesen wurden. Mittels standardisierter Erfassungsbögen wurden Charakteristika,<br />
sozialer und psychologischer Status sowie metabolische und<br />
kardiovaskuläre Risikofaktoren erhoben. Ergebnisse: Während des Aufenthaltes<br />
über 36,2±8,1 Tage sanken BMI (29,2±6,1 vs 27,1±5,3 kg/m², p
stisch analysiert. Ergebnisse: Der mittels Hautfaltenmessung ermittelte Körperfettanteil<br />
lag durchschnittlich um 3,78 ± 3,75 Prozentpunkte (p = .000)<br />
niedriger als bei der Bioimpedanzanalyse. Beide Messverfahren korrelierten<br />
mit r = .88 (p = .000). Die mit Hilfe der Bland-Altman-Analyse ermittelten<br />
limits of agreement betrugen -3,57 % und 11,13 %. Die mittlere Abweichung<br />
(Bioimpedanzanalyse – Hautfaltenmessung) nahm mit steigendem mittlerem<br />
Körperfettanteil ([Hautfaltenmessung + Bioimpedanzanalyse)/2] zu<br />
(r = .75; p = .000) und differierte in Abhängigkeit vom Geschlecht (weiblich:<br />
5,73 ± 3,33; männlich: 1,80 ± 3,06; p = .000). Zusammenfassung: Die Ergebnisse<br />
weisen auf eine höhere Übereinstimmung von Hautfaltenmessung und<br />
Körperfettanalyse-Waage bei Jugendlichen mit niedrigerem Körperfettanteil<br />
hin, wodurch auch die bei Jungen im Vergleich zu Mädchen höhere Messwertkongruenz<br />
erklärbar ist. Ein direkter Vergleich der Messwerte beider Methoden<br />
ist somit nicht möglich und ein substituierender Einsatz der Verfahren<br />
unter Feldbedingungen lediglich auf Gruppenvergleichsebene zu empfehlen.<br />
Selbstwirksamkeit bei übergewichtigen und adipösen Kindern<br />
und Jugendlichen<br />
*Tanja Nieschalk (1), Thekla Weihs-Godenrath (1), Guido Kramer (1),<br />
Ralf Schiel (1)<br />
(1) MEDIGREIF-Inselklinik Heringsdorf GmbH, Fachklinik für Diabetes<br />
und Stoffwechselkrankheiten, Haus Gothensee, Seeheilbad Heringsdorf,<br />
Deutschland<br />
Wesentlich für die langfristige Gewichtsreduktion und -stabilisierung ist<br />
die Steigerung der Selbstwirksamkeit. Das Ziel der Untersuchung war die<br />
Erfassung der Selbstwirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht<br />
und <strong>Adipositas</strong>, die an einem strukturierten Behandlungs- und<br />
Schulungsprogramm (SBSP) teilgenommen hatten. Methoden: Es wurden<br />
vorläufig alle Kinder/Jugendlichen (Alter 12,6±3,2 Jahre; 45,5 % Mädchen,<br />
BMI 30,9±5,1; BMI-SDS 2,6±0,4; Gewicht 81,0 ± 25,0) erfasst, die seit<br />
01/2008 in unserer Klinik am SBSP teilgenommen haben. Selbstwirksamkeit<br />
wurde mit dem Gewichtsbezogenen Selbstwirksamkeitsfragebogen<br />
(GW-SW-KJ) erhoben. Ergebnisse: Selbstwirksamkeit zu Therapiebeginn<br />
(r=0,33; p=0,17) und Therapieende (r=0,36; p=0,17) zeigten eine tendenzielle<br />
Korrelation mit der Gewichtsreduktion. Patienten mit einem besseren<br />
Therapieerfolg (Mediansplit) berichten bereits zu Beginn von einer höheren<br />
Selbstwirksamkeit (53,8±6,8 vs. 61,3±8,4; p=0,05). Weiterhin zeigte sich ein<br />
tendenzieller Zusammenhang zwischen Ausgangsgewicht und Selbstwirksamkeit<br />
bei Therapiebeginn (r=0,37; p=0,15). Im Geschlechtervergleich berichten<br />
Mädchen höhere Selbstwirksamkeitswerte (61,1±8,6 vs. 53,3±8,3;<br />
p=0,013). Die Korrelation zwischen Selbstwirksamkeit und Depressivität<br />
wurde signifikant. (r=-0,47; p=0,006). In der multivariaten Analyse (abhängige<br />
Variable Gewichtsreduktion; unabhängige Variablen Selbstwirksamkeit<br />
zu Therapiebeginn und -ende, Alter) kann nur die Variable Alter die Signifikanzgrenze<br />
erreichen (ß=0,63; p=0,025). Schlussfolgerung: Selbstwirksamkeit<br />
könnte eine Determinante der Depressivität sein. Höhere Selbstwirksamkeit<br />
ist assoziiert mit stärkerer Gewichtsreduktion. Es scheint so zu sein,<br />
dass die Motivation und die wahrgenommene persönliche Wirkmächtigkeit<br />
einen starken Einfluss auf das tatsächliche Therapieergebnis haben. Auch im<br />
Hinblick auf die Fortführung der Therapie nach der stationären Maßnahme<br />
ist die Steigerung der Selbstwirksamkeit von Bedeutung.<br />
Poster: Pädagogik und Psychologie<br />
Auswirkung eines Gewichtsreduktionsprogramms auf die gesundheitsbezogene<br />
Lebensqualität von adipösen Männern und Frauen<br />
*Ingrid Frey (1), Andreas Berg (2), Aloys Berg (1)<br />
(1) Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Universitätsklinik,<br />
Rehabilitative und Präventive Sportmedizin, Freiburg, Deutschland;<br />
(2) M. O. B. I. L. I. S. e. V, Freiburg, Deutschland<br />
Zielsetzung: Im Folgenden soll untersucht werden, ob sich die gesundheitsbezogene<br />
Lebensqualität (QoL) bei Adipösen infolge eines Gewichtreduktionsprogramms<br />
verändert und ob sich Männer und Frauen hinsichtlich<br />
der Einflussgrößen unterscheiden. Material und Methoden: 488 adipöse Erwachsene<br />
(248 Männer, 240 Frauen) nahmen an einem Gewichtsreduktionsprogramm<br />
(M.O.B.I.L.I.S.-Programm) teil. Vor Beginn und nach Abschluss<br />
des Programms wurden die anthropometrischen Daten erfasst, der Umfang<br />
körperlicher Aktivität (FFKA), die körperliche Leistungsfähigkeit (Watt/kg)<br />
sowie die gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF36) ermittelt. Ergebnisse:<br />
Hinsichtlich Alter, Eingangs-BMI und mittlerer relativen Gewichtsabnahme<br />
waren Männer und Frauen vergleichbar. Vor der Intervention lag<br />
bei beiden Geschlechtern die gesundheitsbezogene QoL im Mittel niedriger<br />
als in der deutschen Normstichprobe und bei beiden Geschlechtern führte<br />
die Intervention zu einer Verbesserung ihrer QoL (körperliche Funktionsfähigkeit<br />
(p0.001), Vitalität (p
52 40<br />
Poster: Insulinresistenz und molekulare Mechanismen<br />
hier mit einer erhöhten Disaccharidaufnahme assoziiert. Die Disaccharide<br />
können aus Obst, Milchprodukten und Zuckerarten stammen.<br />
Tabelle 1<br />
Gruppe N gesamt N Completers Gewichtsveränderung Standardin<br />
kg (ITT Baseline abweichung<br />
carried forward)<br />
LC 53 13 (24,5 %) -1,44 3,44<br />
LF 52 15 (28,9 %) -0,43 3,10<br />
LFRGL 53 18 (34,0 %) -1,66 3,37<br />
Proteinreiche Ernährung mit Ersatzmahlzeiten zur Behandlung<br />
des metabolischen Syndroms<br />
*Marion Flechtner-Mors (1), Herwig Ditschuneit (1),<br />
Gwendolin Etzrodt-Walter (1), Bernhard Böhm (1)<br />
(1) Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Innere Medizin I, Ulm, Deutschland<br />
Zielsetzung: Kann die Wirksamkeit einer gewichtsreduzierenden Diät<br />
durch Erhöhung des Proteinanteils und auch durch Einbeziehung von Ersatzmahlzeiten<br />
in den Diätplan gesteigert werden? Wir untersuchten eine gewichtsreduzierende<br />
Diät mit unterschiedlichem Proteinanteil und Einbeziehung von<br />
Ersatzmahlzeiten auf die Wirksamkeit bei Patienten mit dem metabolischen<br />
Syndrom. Material und Methoden: Die Energiezufuhr lag 500 Kcal unter<br />
dem individuellen Bedarf. In den Diätplan wurden Ersatzmahlzeiten integriert,<br />
in Form von kalorienkontrollierten, vitaminreichen Getränken, die bei Bedarf<br />
mit Proteinpulver angereichert wurden. Die proteinreiche Diät enthielt 30E %<br />
Protein, die konventionelle Diät 15E % Protein. Für die prospektive, randomisierte<br />
Studie wurden 110 Patienten (25-70 Jahre, BMI 27–45 kg pro m²)<br />
mit dem metabolischen Syndrom je zur Hälfte einer der beiden Diätgruppen<br />
zugeordnet. Die Behandlung ging über 12 Monate. Ergebnisse: Beide Diäten<br />
wurden gut toleriert. 74 Patienten (31 in der Proteingruppe [P] und 43 in<br />
der Kontrollgruppe [K]) vollendeten die Studie. Die P Patienten hatten einen<br />
Gewichtsverlust von 11,21 ± 6,43 kg im Vergleich zu 6,52 ± 5,85 kg bei den<br />
K Patienten (p
Regulation der Fettgewebsmasse durch Akt/PKB Isoformen<br />
*Sina Horenburg (1), Alexandra Killian (1), Martin Wabitsch (1),<br />
Pamela Fischer-Posovszky (1)<br />
(1) Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie, Universitätsklinik<br />
für Kinder- und Jugendmedizin, Universität Ulm, Ulm, Deutschland<br />
Zielsetzung: Klinische und experimentelle Studien zeigen, dass zwei<br />
Isoformen von Akt/PKB, Akt1 und Akt2, wichtige Regulatoren der Fettgewebsmasse<br />
sind. Unsere Voruntersuchungen ergaben, dass Akt2 die Fettgewebsmasse<br />
hauptsächlich durch die Regulation der Fettzellzahl beeinflusst;<br />
nämlich sowohl durch Inhibition von Proliferation und Differenzierung, als<br />
auch durch Modulation des zellulären Überlebens. In dieser Studie wurde<br />
die Rolle von Akt/PKB für die Apoptosesensitivität der Fettzellen untersucht.<br />
Material und Methoden: Mithilfe des BLOCK-iT RNAi Systems<br />
(Invitrogen) wurden humane SGBS Präadipozyten generiert, die stabil Akt1<br />
bzw. Akt2 RNAi exprimieren. Apoptose wurde durch Serumentzug oder<br />
Stimulation von CD95 induziert. Die Apoptoserate wurde mittels Durchflusszytometrie<br />
bestimmt. Veränderungen auf Proteinebene wurden mittels<br />
Western Blot Analyse untersucht. Ergebnisse: Durch die lentiviral vermittelte<br />
Expression von Isoform-spezifischer RNAi wurde die Expression von<br />
Akt1 und Akt2 um > 90 % inhibiert. Serumentzug und CD95-Aktivierung<br />
führten bei Akt2-defizienten Zellen zu einem Anstieg der Apoptoserate um<br />
43.2 bzw. 48.5 % im Vergleich zu Wildtypzellen, die durch die auto- bzw.<br />
parakrine IGF1 Signalwirkung vor Apoptoseinduktion geschützt sind. Versuche<br />
mit dem Caspaseninhibitor zVAD-fmk zeigten, dass es sich hierbei<br />
um eine Caspasen-abhängige Form des Zelltodes handelt. Akt1-defiziente<br />
Zellen zeigten keine erhöhte Sensitivität für apoptotische Stimuli. Die Akt2-<br />
Defizienz führte zu Veränderungen sowohl des Expressionslevels, als auch<br />
des Phosphorylierungsstatus von Apoptosemodulatoren wie z. B. Bad und<br />
GSK3β. Schlussfolgerungen: Unsere Ergebnisse verdeutlichen die wichtige<br />
Rolle der Akt/PKB Isoform Akt2 für die Regulation der Fettgewebsmasse.<br />
Die Deletion des Glucosetransporters GLUT8 in Mäusen<br />
führt zu einer gesteigerten Bewegungsaktivität<br />
Stefan Schmidt (1), Verena Gawlik (1), Sabine Hölter (2), Robert Augustin (1),<br />
Andrea Scheepers (1), Maik Behrens (3), Wolfgang Wurst (2),<br />
Valérie Gailus-Durner (2), Helmut Fuchs (2), Martin Hrabé de Angelis (2),<br />
Reinhart Kluge (1), *Hans-Georg Joost (1), Annette Schürmann (1)<br />
(1) Deutsches Institut für Ernährungsforschung, Pharmakologie, Potsdam,<br />
Deutschland; (2) Deutsche Mausklinik, GSF Forschungszentrum für Umwelt<br />
und Gesundheit, Neuherberg, Deutschland; (3) Deutsches Institut für<br />
Ernährungsforschung, Molukulare Genetik, Potsdam, Deutschland<br />
Zielsetzung: In neuronalen Zellen wird der Glucosetransport überwiegend<br />
durch die Glucosetransporter GLUT1 und GLUT3 vermittelt. Zusätzlich<br />
wird GLUT8 im Gehirn exprimiert. GLUT8 gehört zur Klasse III der<br />
Glucosetransporter, die intrazellulär lokalisiert sind. Bis heute konnte kein<br />
Stimulus nachgewiesen werden, der zur Translokation von GLUT8 an die<br />
Plasmamembran führt. Zur Untersuchung der physiologischen Bedeutung<br />
von GLUT8 im Hinblick auf neuronale Funktionen haben wir sein Gen in<br />
der Maus ausgeschaltet und ihr Verhalten analysiert. Materialien und Methoden:<br />
Die Lokalisation von GLUT8 im Gehirn wurde mittels in situ Hybridisierung,<br />
quantitativer real time PCR und Immunhistochemie untersucht.<br />
Die Slc2a8 -/- Mäuse wurden mit dem Cre/LoxP-Rekombinationsprinzip<br />
generiert und ihr Verhalten mit Hilfe des modified-hole-board (mHB) Verhaltenstests<br />
analysiert. Zudem wurden die körperliche Aktivität, das Körpergewicht<br />
und die Körperzusammensetzung, sowie die Plasmaparameter<br />
bestimmt. Ergebnisse: GLUT8 wurde vor allem im Hippocampus, sowie<br />
im Thalamus und im Cortex nachgewiesen. Im mHB-Test bewegten sich die<br />
Slc2a8 -/- Mäuse durchschnittlich schneller und legten größere Strecken zurück<br />
als ihre Wildtyp-Geschwister, außerdem führten sie häufiger Richtungswechsel<br />
durch. Diese Hyperaktivität wurde ebenfalls im offenen Haltungkäfig<br />
mittels Infrarot-Detektor und im Laufrad bestätigt. Die Hyperaktivität<br />
der Slc2a8 -/- Mäuse führt zu einem leicht reduzierten Körpergewicht. Außerdem<br />
zeigten die Slc2a8-/- Mäuse verringerte Plasma-Triglyceridwerte und<br />
Blutglucosespiegel nach Fasten. Zusammenfassung: Unsere Daten lassen<br />
vermuten, dass die Hyperaktivität der Slc2a8 -/- Mäuse auf Fehlfunktionen in<br />
neuronalen Prozessen zurückzuführen ist, möglicherweise als Konsequenz<br />
auf einen gestörten Glucosemetabolismus im Gehirn.<br />
Poster: Genetik und pränatale Prägung<br />
Der neue Fokus in der Therapie der <strong>Adipositas</strong> –<br />
weight loss maintenance<br />
*Martina de Zwaan (1), Barbara Mühlhans (1)<br />
(1) Universitätsklinikum Erlangen, Psychosomatische und Psychotherapeutische<br />
Abteilung, Erlangen, Deutschland<br />
Kurzfritige Gewichtsreduktion kann mit verschiedenen Methoden erreicht<br />
werden, der langfristiger Gewichtserhalt (weight loss maintenance) ist jedoch<br />
Poster: Genetik und pränatale Prägung<br />
in klinischen Gruppen nur bei einer Minderheit der Patienten erfolgreich. In<br />
einer bevölkerungsbasierten repräsentativen Stichprobe (n=957) wurde die<br />
Häufigkeit einer erfolgreichen Gewichtsstabilisierung nach Gewichtsverlust<br />
erhoben. Als erfolgreiche Gewichtsstabilisierung wurde ein über zumindest<br />
ein Jahr gehaltener Gewichtsverlust von zumindest 10 % des maximalen Gewichts<br />
definiert. Jene Teilnehmer, die zum Zeitpunkt ihres Maximalgewichtes<br />
übergewichtig oder adipös waren gaben zu 17,7 % an, dass sie seit mindestens<br />
einem Jahr 10 % weniger wiegen würden als zum Zeitpunkt ihres Maximalgewichtes.<br />
Die Zahl steigt auf 29,7 % bei jenen Teilnehmern, deren Maximalgewicht<br />
im adipösen Bereich lag (BMI>30). Prädiktoren für eine erfolgreiche<br />
Gewichtsstabilisierung waren jüngeres Alter, weibliches Geschlecht und ein<br />
höherer maximaler Lebenszeit BMI. Die Resultate machen deutlich, dass eine<br />
erfolgreiche Gewichtsstabilisierung in der Allgemeinbevölkerung häufiger<br />
vorzukommen scheint als man nach den Langzeitergebnissen klinischer Gewichtsreduktions-Studien<br />
erwarten würde. Im Rahmen des Kompetenznetz<br />
<strong>Adipositas</strong> wird sich eine Registerstudie mit den Strategien beschäftigen, die<br />
Menschen in der Allgemeinbevölkerung eine erfolgreiche Gewichtsstabilisierung<br />
nach Gewichtsverlust ermöglichen.<br />
Literatur<br />
de Zwaan M, Hilbert A, Herpertz S, Zipfel S, Beutel M, Gefeller O, Muehlhans<br />
B. Weight Loss Maintenance in a Population-based Sample of German<br />
Adults. Obesity 2008, 21, Epub ahead of print.<br />
Non-replication of an association of CTNNBL1 polymorphisms<br />
and obesity<br />
*Carla Ivane Ganz Vogel (1), Brandon Greene (2), André Scherag (3),<br />
Timo D. Müller (1), Susann Friedel (1), Harald Grallert (4), Thomas Illig (4),<br />
H-Erich Wichmann (4), Anke Hinney (1), Johannes Hebebrand (1)<br />
(1) Universty of Duisburg-Essen, Department of Child and Adolescent Psychiatry,<br />
Essen, Deutschland; (2) Philipps-University of Marburg, Institute of<br />
Medical Biometry and Epidemiology, Marburg, Deutschland; (3) University<br />
of Essen, Institute for Medical Informatics, Biometry and Epidemiology,<br />
Essen, Deutschland; (4) Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit<br />
(GSF), Institute of Epidemiology, Munich-Neuherberg, Deutschland<br />
A recent genome-wide association (GWA) study of U.S. Caucasians showed<br />
that single CTNNBL1 single nucleotide polymorphisms (SNPs) are<br />
associated with obesity and increased fat mass. For rs6013029 the results<br />
reached genome-wide significance. Objective: We attempted to replicate<br />
these findings in a case-control GWA for early onset obesity and in a GWA<br />
on a population-based cohort of adults as well as in a separate family-based<br />
obesity study. Materials and Methods: The GWA studies were carried out<br />
using Affymetrix ® SNP Chips with approximately 500,000 SNPs markers<br />
each. In the obesity families (at least one obese child and both parents), SNP<br />
rs6013029 was genotyped using the TaqMan ® allelic discrimination assay.<br />
The German case-control GWA included 487 extremely obese children and<br />
adolescents and 442 healthy lean individuals. The adult GWA included 1,644<br />
individuals from a German population-based study (KORA-Kooperative Gesundheitsforschung<br />
im Raum Augsburg, Survey 3). The independent German<br />
family sample (n = 775 families) consisted of extremely obese children and<br />
adolescents and their parents recruited at the University of Marburg and the<br />
University of Duisburg-Essen. Results: We found no evidence for an association<br />
of the reported variants in CTNNBL1 with early onset obesity or increased<br />
BMI. Furthermore, in our family-based study we found no evidence for<br />
overtransmission of the rs6013029 risk-allele T to obese children. In conclusion,<br />
we could not replicate the recent findings pertaining to an association of<br />
variants in CTNNBL1 with obesity in a well powered replication effort.<br />
Genetic variation in the Resistin gene and the metabolic syndrome<br />
in the KORA study<br />
*Harald Grallert (1), Eva-Maria Sedlmeier (2), Barbara Kollerits (3),<br />
Cornelia Huth (1), Christa Meisinger (1), Christian Herder (4),<br />
Stephen Hunt (5), Ted Adams (5), Klaus Strassburger (6),<br />
Bernhard Paulweber (7), Guido Giani (6), H-Erich Wichmann (1),<br />
Hans Hauner (2), Florian Kronenberg (3), Thomas Illig (1),<br />
Wolfgang Rathmann (6)<br />
(1) Helmholtz Zentrum München, Institute of Epidemiology, Neuherberg,<br />
Deutschland; (2) Techische Universität München, Else Kröner-Fresenius-<br />
Centre for Nutritional Medicine, Freising, Deutschland; (3) Innsbruck Medical<br />
University, Division of Genetic Epidemiology; Department of Medical<br />
Genetics, Molecular and Clinical Pharmacology, Innsbruck, Österreich;<br />
(4) German Diabetes Centre, Leibniz Institute at Heinrich Heine University,<br />
Institute for Clinical Diabetes Research, Düsseldorf, Deutschland; (5) University<br />
of Utah, Cardiovascular Genetics Division, Department of Internal<br />
Medicine, Salt Lake City, USA; (6) German Diabetes Centre, Leibniz Institute<br />
at Heinrich Heine University, Institute of Biometrics and Epidemiology, Düsseldorf,<br />
Deutschland; (7) St. Johann Spital, Paracelsus Private Medical University<br />
Salzburg, First Department of Internal Medicine, Salzburg, Österreich<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
53 41
54 42<br />
Poster: Chirurgische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
Obesity and related conditions such as insulin resistance, type 2 diabetes,<br />
hyperlipidaemia, and hypertension are influenced by resistin expression and<br />
secretion. Thus, the Resistin gene (RETN) is a candidate gene for certain<br />
risk factors which cluster in the metabolic syndrome (MetS). Therefore, we<br />
analysed the association between single nucleotide polymorphisms (SNPs) of<br />
the human RETN and MetS or related parameters. The analysed populationrepresentative<br />
sample comprised 1462 subjects from the German KORA Study.<br />
The SAPHIR study and a sample from Utah were used for replication. Genotyping<br />
was carried out by matrix-assisted laser desorption ionization-time<br />
of flight (MALDI-TOF) analysis of allele-dependent primer extension products.<br />
We found no association of RETN SNPs with MetS, or type 2 diabetes.<br />
Among the single components of MetS, a statistically significant difference<br />
between the genotype groups was observed for RETN SNP rs3760678 with<br />
triglyceride levels (p=0.0003). This association as well as the association with<br />
lower triglyceride levels of rs3760678 minor allele carriers was significant in<br />
combined analysis of all three samples (5100 subjects) despite inconsistent<br />
results in the single samples. Altough the functionality of this genetic variant<br />
has to be clarified; these results may support the role of resistin in lipid metabolism<br />
with differences between normal and obese subjects.<br />
Poster: Chirurgische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
Ernährungstherapeutische Vor-und Nachsorge<br />
bei <strong>Adipositas</strong>chirurgien<br />
Lucia Deluiz-Ecker<br />
Praxis Lucia Deluiz-Ecker, Homburg, Deutschland<br />
Bei jeder Art von <strong>Adipositas</strong>chirurgien ist es unerlässlich, dem Patienten<br />
bewusst zu machen, dass sein Essverhalten eine grundlegende Änderung erfahren<br />
muss. Im Hinblick auf einen erfolgreichen Eingriff ist der Patient auf<br />
die ihn zu erwartende neue Realität vorzubereiten. Auch ist er vor der Maßnahme<br />
detailliert über die Risiken des Eingriffes aufzuklären. Nach dem chirurgischen<br />
Eingriff wird der Patient mittels eines Leitfadens auf seinen neuen<br />
Lebensabschnitt vorbereitet und ihm wird verdeutlich, wie er eine bessere Lebensqualität<br />
erreichen und erhalten kann. Mit der Prä-operativen Ernährunstherapie<br />
ist erfahrungsgemäß bei allen Arten von <strong>Adipositas</strong>chirurgien bereits<br />
2–3 Wochen vor dem Eingriff zu beginnen, wobei die psychische Verfassung<br />
des Patienten einen bedeutenden Faktor darstellt, um möglichen Komplikationen<br />
rechtzeitig begegnen zu können. Die Post-Operative Ernährungstherapie<br />
bei Einsatz von Magenballon und Gastric Banding erfolgt noch während<br />
der stationären Unterbringung in Form von individuellen Beratungen,<br />
zur Verfügungstellung eines Leitfadens und weiteren Kontrollmaßnahmen<br />
im Anchluss an den Klinikaufenthalt. Die Post-Oprative Ernährungstherapie<br />
bei Schlauchmagen und Magenbaypass startet mit intensiven, individuellen<br />
Ernährungsberatungen mit Kontrolle von Fett-und Kohlenhydratemenge ab<br />
der erstmaligen Nahrungsaufnahme nach dem erfolgten Eingriff. Im weiteren<br />
Verlauf sind die Nahrungskonsistenz, der Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydrategehalt<br />
bis zur Entlassung zu kontrollieren. Als Begleiter für die ersten 14<br />
Tage nach dem Klinikaufenthalt soll ein Ernährungsleitfaden dienen, dessen<br />
Zielsetzung es ist, den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen. Um<br />
Mangelerscheinungen vorzubeugen sollte sich der Patient dauerhaft mit Mineral-<br />
und Vitaminpräparaten versorgen.<br />
Wer profitiert von einem Magenballon?<br />
Thomas P. Hüttl (1), *Reinhold A. Lang (1), E. Poliwoda (1), P. Rittler (1),<br />
F. W. Spelsberg (1), F. Obeidat (1), N. Zügel (1), K. -W. Jauch (1)<br />
(1) Klinikum der Universität München, Chirurgische Klinik und Poliklinik-<br />
Großhadern, Ernährungsmedizin, München, Deutschland<br />
Einleitung: Für erfolgreiche Langzeitergebnisse in der Therapie der<br />
<strong>Adipositas</strong> ist der Magenballon umstritten. Für die schnelle Gewichtsabnahme<br />
bei Super-Obesity wird der Ballon von mehreren Arbeitsgruppen<br />
zur Senkung des operativen Risikos empfohlen. Ziel der Untersuchung<br />
war, die Wirksamkeit der Ballontherapie abhängig von Patientenmotivation,<br />
dem <strong>Adipositas</strong>grad und der Stringenz einer begleitenden Ernährungsberatung<br />
zu evaluieren. Methode: 60 Patienten (38 w, 22m; 19–62 Jah-<br />
re) erhielten nach interdisziplinärer Befürwortung einen Magenballon.<br />
BMI, Komorbiditäten, psychischer Leidensdruck sowie zu erwartende<br />
Compliance wurden berücksichtigt. Die Ballone (30 Heliosphere, 30<br />
BIB-Systeme) wurden endoskopisch eingebracht. Ab einer <strong>Adipositas</strong><br />
Grad III erfolgte die Intervention unter Anästhesie-Standby. Alle 2 Monate<br />
erfolgte eine telefonische bzw. klinische Untersuchung mit Evaluation<br />
anhand eines standardisierten Fragebogens. Ergebnisse: In 48 Fällen<br />
bewirkte die 6-monatige Magenballon-Therapie eine Gewichtsreduktion<br />
um 15 kg. Der Ausgangs-BMI von 41 kg/m² (29–62 kg/m²) konnte auf<br />
36 kg/m² reduziert werden. Die Therapie war bei hohen BMI-Werten<br />
≥ 45 kg/m² am effektivsten. Der Smiley-Score (0–4) verbesserte sich in<br />
6 Monaten signifikant von 4 auf 2 Frauen sowie Patienten, die regelmäßig<br />
Sport betrieben und die Empfehlungen unserer Ernährungsberatung<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
beachteten, profitierten am meisten. 10 Therapien wurden vor Ablauf der<br />
vorgesehenen 180 Tage beendet, z. B. wegen Volumenverlust (2x), Gastritis<br />
(1x) und Ulkus (1x). Schlussfolgerung: Der anhaltende Erfolg der<br />
Ballontherapie hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die Patienten ihr Essverhalten<br />
und ihre sportlichen Aktivitäten während und nach der Ballontherapie<br />
ändern. Dabei ist die dauerhafte Begleitung der Patienten durch das<br />
<strong>Adipositas</strong>zentrum für ein erfolgreiches Behandlungskonzept unerlässlich.<br />
Insbesondere für Hochrisikopatienten, die für eine Operation noch nicht in<br />
Frage kommen, ist der Ballon eine erfolgreiche Lösung für eine zügige präoperative<br />
Gewichtsreduktion.<br />
„Aktiv und gesund durch die Schwangerschaft“<br />
Ein Konzept zur Primärprävention von <strong>Adipositas</strong><br />
Nicole Satzinger (1), *Ines Gellhaus (2)<br />
(1) Universität Paderborn, Department Sport und Gesundheit, Paderborn,<br />
Deutschland; (2) Universität Paderborn, Department Sport und Gesundheit,<br />
Paderborn, Deutschland<br />
Das vom BMELV im Rahmen der Kampagne „Besser essen. Mehr bewegen.“<br />
geförderte Projekt „Paderborner <strong>Adipositas</strong>-Prävention und Intervention“<br />
(PAPI) der Universität Paderborn entwickelt Maßnahmen und Strategien<br />
zur Prävention der kindlichen <strong>Adipositas</strong> im Kreis Paderborn. Die Interventionen<br />
beginnen mit der Feststellung der Schwangerschaft und gehen über<br />
das Säuglings- und Kleinkindalter bis hin zu Kindertageseinrichtungen und<br />
Grundschulen. Für das Modul Schwangerschaft wurde u. a. ein handlungsorientiertes<br />
Präventionskonzept entwickelt, das weit über die eigentliche Geburtsvorbereitung<br />
und Schwangerschaftsgymnastik hinausgeht. Hintergrund<br />
ist die Bewegungsarmut der Schwangeren sowie die Bedeutung der peripartalen<br />
Prägung für die Entwicklung des Kindes. Das innovative Kurskonzept<br />
„Aktiv und gesund durch die Schwangerschaft“ bietet eine Kombination aus<br />
einem gezielten Bewegungsangebot und einer zielgruppenspezifischen Ernährungsschulung.<br />
Ziel ist die Reduktion peripartaler und perinataler Komplikationen<br />
und die Sensibilisierung der werdenden Eltern auf die Relevanz<br />
ihres eigenen Lebensstils für das gesunde, unbeschwerte Aufwachsen ihres<br />
Kindes. Neben dem primärpräventiven Ansatz kann der Kurs auch als sekundärpräventives<br />
Angebot für bereits übergewichtige Schwangere, unter<br />
Berücksichtigung der festgelegten Ausschlusskriterien, genutzt werden. Der<br />
Kurs bietet 10–12 Schwangeren im 2. Trimenon über einen Zeitraum von<br />
3 Monaten einmal pro Woche eine Bewegungseinheit, die von einer speziell<br />
geschulten Hebamme geleitet wird. Zwei der zwölf Kurseinheiten zu je<br />
90 Minuten dienen der Wissensvermittlung zur Ernährung in Schwangerschaft,<br />
Stillzeit und zur Säuglingsernährung. Das Kurskonzept wird derzeit<br />
in einem Pilotkurs evaluiert, um die Finanzierung über §20 SGB V durch<br />
die Krankenkassen zu sichern. Die Zusatzqualifikation für Hebammen wird<br />
derzeit mit dem Landessportbund NRW erarbeitet.<br />
Hedonischer Hunger nach bariatrischer Chirurgie<br />
*Bernd Schultes (1), Barbara Ernst (1), Martin Thurnheer (1),<br />
Manfred Halschmid (2)<br />
(1) Kantonsspital St. Gallen, <strong>Adipositas</strong>zentrum, Rorschach, Schweiz; (2) Universität<br />
zu Lübeck, Institut für Neuroendokrinologie, Lübeck, Deutschland<br />
Zielsetzung: Essen und Nahrungsaufnahme dienen nicht nur der Zufuhr<br />
von Energie, sondern sind meist auch mit Genuss verbunden. Hinweise bestehen,<br />
dass bei <strong>Adipositas</strong> dieser hedonische Aspekt der Nahrungsaufnahme<br />
verstärkt ist. Bariatrische Operationen stellen zurzeit die effektivste Methode<br />
zur Gewichtsreduktion dar, wobei eine Reduktion des „hedonischen<br />
Hungers“ hierbei eine wesentliche Rolle spielen könnte. Materialien und<br />
Methoden: In einer Querschnittstudie wurde das Ausmass des hedonischen<br />
Hunger gemessen mittels eines neuen validierten Fragebogens („Power of<br />
Food Scale“) bei Personen vor oder nach einer bariatrischer Operation. Insgesamt<br />
wurden 45 adipöse Personen ohne Operation (BMI: 45.9±6.6 kg/m²),<br />
70 Personen mit St. n. Magenband-Implantation (BMI initial: 44.7±4.6 kg/m²,<br />
aktuell: 34.8±5.6 kg/m²), 49 Personen mit St. n. Magenbypass-Operation<br />
(BMI initial: 46.5±5.1 kg/m², aktuell: 29.4±4.6 kg/m²) sowie 46 nicht-adipöse<br />
Kontrollpersonen (BMI 22.2±2.1 kg/m²) untersucht. Ergebnisse: Im<br />
Vergleich zur nicht-adipösen Kontrollgruppe wiesen die nicht-operierten adipösen<br />
Patienten einen deutlich erhöhten hedonischen Hunger auf (46.6±1.6<br />
vs. 56.9±2.6, P
Poster: Körperliche Aktivität und Lebensstil<br />
Invagination des Restmagens ins Duodenum: eine seltene<br />
Komplikation nach Magenbypass – eine Falldarstellung<br />
*Uta Waidner (1), Andreas Hillenbrand (1), Anna Wolf (1),<br />
Doris Henne-Bruns (1)<br />
(1) Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Ulm,<br />
Deutschland<br />
Einleitung: Eine Vielzahl von Operationsformen steht für die Therapie<br />
der extremen <strong>Adipositas</strong> zur Verfügung. Für jede dieser Operationmethoden<br />
sind unterschiedliche Komplikationen beschrieben. Eine seltene Komplikation<br />
nach Magenbypass wird hier dargestellt: die Invagination des Restmagens<br />
ins Duodenum. Falldarstellung: Eine 42-jährige Patientin mit einem<br />
BMI von 44 kg/m 2 wurde mit abdominellen Schmerzen, Erbrechen und<br />
Cholestase in unserer Notfallaufnahme aufgenommen. In der Vorgeschichte<br />
war bei der Patientin in einer auswärtigen Klinik aufgrund ihrer <strong>Adipositas</strong><br />
1999 eine Gastroplastik nach Mason durchgeführt worden. Aufgrund erneuter<br />
Gewichtzunahme wurde in dieser Klinik 2005 eine Umwandlung in<br />
einen Gastric Bypass vorgenommen. Laborchemisch zeigten sich erhöhte<br />
Cholestaseparameter. Mit dem Verdacht auf eine Choledocholithiasis wurde<br />
eine Sonographie durchgeführt. Dort zeigte sich ein erweiterter Ductus<br />
Hepatocholedochus. Da aufgrund des Magenbypasses eine ERCP nicht<br />
möglich war, wurde zur weiteren Diagnostik eine Computertomographie<br />
herangezogen. Mit Hilfe der CT wurde die Verdachtsdiagnose einer Invagination<br />
des Restmagens in das Duodenum gestellt. Intraoperativ zeigte sich<br />
der Restmagen tatsächlich ins Duodenum invaginiert. Durch diese Invagination<br />
wurde der Galleabfluss behindert, der ursächlich für die Cholestase<br />
war. Es wurden eine Deinvagination sowie Resektion des Restmagens<br />
durchgeführt. Der postoperative Verlauf war unauffällig. Zusammenfassung:<br />
Die Ursache des mobilen Magens muss durch die Mobilisation der<br />
großen Kurvatur bei der Magenbypass Operation entstanden sein. Dass dies<br />
zu einer Invagination führen kann, wurde bisher noch nie beschrieben. Eine<br />
besondere perioperative Sorgfalt zur Erkennung und Vermeidung von Komplikationen<br />
ist bei der <strong>Adipositas</strong>chirurgie vonnöten. Von speziellem Interesse<br />
sind das klinische Erscheinungsbild sowie die operative Handhabung<br />
in diesem seltenen Fall.<br />
Erste Klinische Erfahrungen mit dem TANTALUS ® -System<br />
für die chirurgische Therapie des Diabetes Mellitus Typ 2<br />
*Sylvia Weiner (1), Rudolf Weiner (1), Andreas Hamann (2), Angela Hoenig<br />
(2), Sophia Theodoridou (1), Gerhard Weigand (1), Anna Helferich (2)<br />
(1) Krankenhaus Sachsenhausen, Chirurgie, Frankfurt, Deutschland; (2) Diabetes<br />
Klinik Bad Nauheim GmbH, Diabetologie, Bad Nauheim, Deutschland<br />
Hintergrund: Bei Patienten mit <strong>Adipositas</strong> und Diabetes mellitus bieten<br />
bariatrische Eingriffe eine chirurgische Option der Beeinflussung der<br />
Stoffwechselerkrankung im Rahmen des Metabolischen Syndroms. Das<br />
TANTALUS ® System (MetaCure Limited) ist ein minimal-invasiv implantierbares<br />
Gerät zur Magenstimulation, welches keine malabsorptiven oder<br />
restriktiven Einflüsse hat. Die ersten Erfahrungen mit der chirurgischen<br />
Implantation dieses Systems in einem chirurgischen Zentrum werden in<br />
dieser Arbeit beschrieben. Ziel der Studie ist die Untersuchung der Effekte<br />
des TANTALUS ® Systems auf die glykämische Situation bei Patienten mit<br />
Diabetes Mellitus bei stabiler oraler Medikation. Methodik: Das TANTA-<br />
LUS ® System wurde bei neun Patienten laparoskopisch implantiert. Die Patienten<br />
hatten ein mittleres Alter von 50 ± 3,9 Jahren (45–58); 6 (66,7 %)<br />
waren männlichen Geschlechts. Der mittlere BMI (Body Mass Index) war<br />
38,91 ± 3,19 (33,6–44,8). Die Eingriffe wurden im Zeitraum von September<br />
bis Oktober 2007 durchgeführt. Der mittlere HbA 1c war 7,64 %<br />
(6,8 %–8,6 %). Die Patienten werden in einem Zeitraum von 48 Wochen<br />
regelmäßig hinsichtlich HbA 1c , Blutglukose, Körpergewicht und verschiedener<br />
gastrointestinaler Hormone evaluiert. Ergebnisse: Die mittlere Operationsdauer<br />
betrug 106,7 ± 16 Minuten.Intraoperativ gab es keine Komplikationen.<br />
Derzeit haben acht Patienten ein Follow-up von drei Monaten.<br />
Hier konnten signifikante Verbesserungen des HbA 1c (präop: 8.0±0.1 %;<br />
nach 3 Monaten: 6.9±0.3 %, p10 %. Zur Kontrolluntersuchung<br />
1 Jahr nach Therapieende erschienen 20 (67 %) Personen. Sechs hatten<br />
das Ausgangsgewicht wieder erreicht, 3 weiter abgenommen, die übrigen<br />
1,5–8 kg zugelegt. NBZ, TG und LDL waren gestiegen, BU und Blutdruck<br />
unverändert bei beibehaltener Aktivität. Nur 12 (32 %) Gruppenteilnehmer<br />
kamen nach 2 Jahren zur Untersuchung. Bis auf BMI, NBZ und HDL<br />
hatten sich die übrigen Parameter verschlechtert – BU + 2 cm, TG 228 vs<br />
157 mg/dl –, die Aktivität abgenommen. Blutdruck (135/82 vs 141/86 mm Hg)<br />
und LDL (111 vs 134 mg/dl) waren medikamentös bedingt besser. Zusammenfassung:<br />
Die intensive multimodale <strong>Adipositas</strong>-Therapie über 1 Jahr<br />
erreicht bei 88 % der Teilnehmer eine Gewichtsreduktion und Verbesserung<br />
des Stoffwechsels. Ohne permanente Betreuung ist eine dauerhafte Lebensstilmodifikation<br />
nicht möglich.<br />
Welchen Einfluss hat die körperliche Aktivität auf das subjektive<br />
körperliche Wohlempfinden bei Grundschulkindern?<br />
*Annette Schneider (1), Klaus-Günter Collatz (1), Miriam Seel (2),<br />
Ulrike Korsten-Reck (3)<br />
(1) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Biologie, Freiburg,<br />
Deutschland; (2) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Psychologie,<br />
Freiburg, Deutschland; (3) Universitätsklinikum Freiburg, Rehabilitative<br />
und Präventive Sportmedizin, Freiburg, Deutschland<br />
Zielsetzung: Ein wichtiger Baustein in der pädiatrischen Präventionsmedizin<br />
ist die körperliche Aktivität. Deren möglicher Einfluss auf das subjektive<br />
Wohlbefinden bei Grundschulkindern war ein Teilaspekt einer Studie<br />
zum Körperbewusstsein. Materialien und Methoden: Insgesamt nahmen<br />
237 Kinder (7–13 Jahre) aus Freiburg und Umgebung an der Studie teil:<br />
150 Kinder (mittlerer BMI=18,1; SD=2,523) aus zufällig ausgewählten<br />
Grundschulklassen, 39 sportlich aktive Kinder aus unterschiedlichen Sportvereinen<br />
(mittlerer BMI = 17,6; SD=2,611) und 48 adipöse Kinder (mittlerer<br />
BMI=26,8; SD=4,918), welche am ambulanten Therapieprogramm<br />
„FITOC“ der RPS Freiburg teilnahmen. Die Befragung zum quantitativen<br />
Aktivitätsverhalten, dem subjektiven Gesundheitsempfinden und dem Körpergefühl<br />
erfolgte mittels des „Freiburger Fragebogens zum Körperbewusstsein<br />
(FFKB)“. Ergebnisse: Die Sportvereinskinder waren am zufriedensten<br />
mit Aussehen (89,5 %) und Gesundheit (94,4 %), die adipösen Kinder am<br />
wenigsten zufrieden (Aussehen 29,6 % und Gesundheit 77,1 %). Ein positives<br />
Körpergefühl hatten 81,6 % der Sportkinder, 75 % der Grundschulkinder<br />
und 37,5 % der adipösen Kinder. Die Studienteilnehmer wurden in<br />
3 Klassen eingeteilt: geringe Aktivität (≤ 3 Bewegungsstunden pro Woche),<br />
mittlere Aktivität (4–6 Bewegungsstunden pro Woche) und hohe Aktivität<br />
(≥ 6 Bewegungsstunden pro Woche). Kinder mit einer geringen wöchentlichen<br />
Aktivität waren am zufriedensten mit ihrem Aussehen (76,3 %), jene<br />
mit einer hohen Aktivität am wenigsten zufrieden (69,8 %). Bei den Angaben<br />
zur Gesundheit äußersten die bewegungsfreudigsten Kinder die größte<br />
Zufriedenheit (89,4 %), die am wenigsten Bewegungsfreudigen die geringste<br />
Zufriedenheit (82,4 %). Zusammenfassung: Die Ergebnisse zeigen, dass<br />
die körperliche Aktivität einen positiven Einfluss auf das subjektive Wohlempfinden<br />
hat. Entscheidend scheint die Qualität und weniger die Quantität<br />
der Bewegungsaktivität zu sein.<br />
ABC-Programm: Verbesserung von Gewicht, Gefäßfunktion<br />
und Stoffwechsel<br />
*Sabine Westphal (1), Alexandra Blaik (1), Claus Luley (1)<br />
(1) Institut für Klinische Chemie, Magdeburg, Deutschland<br />
Zielsetzung: Das kostenpflichtige ABC-Programm verbindet eine Diätkombination<br />
mit dem kontinuierlichen Telemonitoring von Gewicht und<br />
körperlicher Aktivität. Diese Studie untersuchte Gewichtsabnahme, Gefäßfunktion<br />
und Stoffwechselparameter nach 3-monatiger Teilnahme. Material<br />
und Methoden: 21 Frauen und 4 Männer mit einem mittleren BMI von 34,8<br />
befolgten die „Magdeburger duale Diät“. Diese besteht aus einer konventionellen<br />
Kalorienrestriktion und einer Bevorzugung von Kohlenhydraten mit<br />
niedrigem glykämischen Index. Gleichzeitig nutzten sie einen Aktivitätssen-<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
55 43
56 44<br />
Poster: Pharmakologische Therapie der <strong>Adipositas</strong><br />
sor und eine Waage, die die täglichen Messwerte an die Betreuer übertrugen.<br />
Ergebnisse und motivierende Kommentare wurden in einem wöchentlichen<br />
Brief übermittelt. Ergebnisse: Der Mittelwert der Gewichtsreduktion nach<br />
3 Monaten betrug 11,2 kg. Damit gingen folgende Veränderungen einher:<br />
Fluß-induzierte Vasodilatation: +0,5 % (p=0,035), Blutdruck: -13/-8 mm/Hg<br />
(p=0,004), Leptin: -18,1 ng/ml (p=0,000), C-Peptid: -187 pmol/l (p=0,013),<br />
Insulin -19 pmol/l (p=0,001), Harnsäure -25 mmol/l (p=0,035), ALAT:<br />
-0,13 µmol/sec*l (p=0,03), ASAT: -0,07 µmol/sec*l (p=0,02), gGT:<br />
-0,13 µmol/sec*l (p=0,001). Zusammenfassung: Das ABC-Programm<br />
(www.abc-diaet.com) erwies sich als sehr wirksam. Zusätzlich zur ausgeprägten<br />
Gewichtsreduktion wurden signifikant verbessert: Gefäßfunktion,<br />
Blutdruck, Harnsäure sowie Parameter der Blutzuckerregulation und der<br />
Leberfunktion.<br />
Einfluss von normobaren Hypoxietraining auf<br />
metabolische Risikomarker bei adipösen Patienten<br />
*Susanne Wiesner (1), Sven Haufe (1), Stefan Engeli (2),<br />
Harry Mutschler (3), Uta Haas (3), Friedrich C. Luft (1), Jens Jordan (2)<br />
(1) Universitätsmedizin Berlin, Charité Campus Buch, Franz-Volhard-<br />
Centrum für Klinische Forschung, Berlin, Deutschland; (2) Medizinische<br />
Hochschule Hannover, Institut für Klinische Pharmakologie, Hannover,<br />
Deutschland; (3) Höhenbalance AG, Köln, Deutschland<br />
Zielstellung: Vergleich von normobarem Hypoxietraining auf kardiovaskuläre<br />
und metabolische Parameter bei adipösen Probanden vs. Normoxietraining.<br />
Materialien und Methoden: 45 übergewichtige, gesunde Frauen<br />
und Männer (42.1±7.1 Jahre, BMI 30.2±3.6 kg/m 2 , Hf 69.1±7.9/min) wurden<br />
in Hypoxie- (HG, FiO2=15 %) bzw. Normoxiegruppe (NG, FiO2=21 %)<br />
randomisiert. Training erfolgte 3x1 Stunde pro Woche über 4 Wochen bei<br />
einer Herfrequenz, entsprechend 65 % der maximalen Sauerstoffaufnahme<br />
(VO2max). Vergleich von Blutdruck (RR), Herzfrequenz (Hf), Körperzusammensetzung,<br />
Nüchternglucose, Nüchterninsulin, Homeostasis model<br />
assessment (HOMA), Lipide vor und nach der Trainingsphase. Ergebnisse:<br />
n=21 (NG) vs. n=24 (HG). Die Trainingsausbelastung in der NG war niedriger<br />
als in der HG, wobei die Hf sich nicht signifikant unterschied. Respiratorischer<br />
Quotient und Lactat sanken nur in der HG bei der aerob-anaeroben<br />
Schwelle (p
von 30,5±5,3 kg/m 2 in die Studie eingeschlossen. Ergebnisse: Bei den Patienten<br />
mit Liraglutid wurde der HbA 1c um 1,33 % gesenkt. Im Vergleich dazu<br />
betrug die HbA 1c -Absenkung mit Insulinglargin 1,09 % und mit Plazebo<br />
0,24 % (ANCOVA: p=0,0015 bzw. p
58 46<br />
Satellitensymposien<br />
bolischen Syndroms und damit auch die kardiovaskuläre Morbidität stark<br />
an. Mit dem beschriebenen Mahlzeitenersatz lässt sich auch bei postmenopausalen<br />
Frauen eine deutliche Abnahme des Körpergewichtes sowie eine<br />
signifikante Verbesserung der metabolischen Risikofaktoren erreichen. Ein<br />
Mahlzeitenersatz durch Sojaprotein ist möglicherweise effektiver ist als eine<br />
fett- und kalorienreduzierte Diät im Hinblick auf die Verbesserung der metabolischen<br />
Risikofaktoren, des Leptin- und Insulinspiegels sowie anthropometrischer<br />
Parameter. Auch bei postmenopausalen Frauen ist hierdurch eine<br />
deutliche Verbesserung des Risikoprofiles möglich.<br />
Ergebnisse zur Mehrschritttherapie mit dem formoline-Konzept<br />
Wolfgang Grebe et. al<br />
Internistische Praxis und Sportmedizin, Frankenberg/Eder, Deutschland<br />
Zur Gewichtsreduktionstherapie wird eine eiweißbetonte Ernährung mit<br />
einem ausgewogenen Verhältnis zwischen pflanzlichem und tierischem Eiweiß<br />
als besonders hilfreich angesehen. Im Rahmen einer Studie zur Mehrschritttherapie<br />
der <strong>Adipositas</strong> wurden 42 Patienten aus zwei Allgemeinpraxen<br />
mit dem formoline-Konzept therapiert. Die rekrutierten Patienten<br />
mussten ein Übergewicht mit einem BMI >26, einen Taillenumfang von<br />
> 80 cm bei Frauen bzw. > 94 cm bei Männern sowie einen Diabetes mellitus<br />
Typ 2 aufweisen. Die primären Zielparameter einer Gewichtsreduktion von<br />
5 % des Ausgangsgewichtes und einer Verminderung des Taillenumfanges<br />
> 2 cm beziehen sich auf die gesamte Beobachtungszeit von 20 Wochen mit<br />
einem update nach weiteren 20 Wochen. Zu Studienbeginn wurden folgende<br />
Parameter dokumentiert: Alter, Größe, Geschlecht, Gewicht, Taillenumfang,<br />
Bioimpedanzanalyse (BIA), Körperfett, Körperzellmasse (BCM), Raucher/<br />
Nichtraucher, diabetische Begleitmedikation, Blutdruck und Parameter zur<br />
Lebensqualität. Darüberhinaus wurden folgende Laborparameter bestimmt:<br />
BZ, HbA 1c und Cholesterin. Nach der Einführung in das Diätprogramm erhielten<br />
die Patienten die formoline Eiweißdiät und die Sport-DVD für die<br />
Anwendung über die nächsten 24 Tage. Die formoline eiweiß-diät nach<br />
§ 14a Diätverordnung enthält Soja- und Molke-Protein zu gleichen Teilen.<br />
Nach den 24 Tagen wurde in einer Übergangsfrist von 4 Wochen eine Mahlzeit<br />
weiter durch die formoline eiweiß-diät ersetzt und eine fettmodifizierte<br />
Mahlzeit mit 2 Tabletten formoline L112 therapiert. Gleichzeitig startete der<br />
Ernährungskurs, der aus 10 Modulen bestand. Dann folgte eine vierwöchige<br />
Phase mit formoline L112 zu den beiden Hauptmahlzeiten, danach eine Phase<br />
mit halber Dosierung und schließlich bis zum Abschluss der Studie nur<br />
noch fakultativer Dosierung je nach Typ der Mahlzeit. Die Ergebnisse werden<br />
zum Symposium vorliegen.<br />
Einfluss eines polyglucosaminhaltigen Medizinproduktes<br />
auf den Wirkstoffspiegel von Metformin bei Typ-2-Diabetikern<br />
*Andreas Hahn (1), Bärbel Mang (1), Andreas Lueg (2), Olaf Ney (3)<br />
(1) Leibniz Universität Hannover, Institut für Lebensmittelwissenschaft und<br />
Ökotrophologie, Hannover, Deutschland; (2) Diabetische Schwerpunktpraxis,<br />
Hameln, Deutschland; (3) Diabetische Schwerpunktpraxis, Neustadt am<br />
Rübenberge, Deutschland<br />
Als unterstützende Maßnahme zur Gewichtsreduktion werden u. a. Polyglucosaminpolymere<br />
eingesetzt, die als natürliche, unverdauliche Faserstoffe<br />
über lipidbindende Eigenschaften verfügen. Da polyglucosaminhaltige<br />
Medizinprodukte auch von Typ-2-Diabetikern verwendet werden, stellt<br />
sich die Frage, ob es hierdurch zu Interferenzen mit antihyperglykämischen<br />
Wirkstoffen mit lipophilem Charakter kommt. In einer Pilotstudie wurde<br />
untersucht, inwieweit die Verabreichung eines polyglucosaminhaltigen Medizinproduktes<br />
bei mit Metformin behandelten Typ-2-Diabetikern zu einer<br />
Veränderung der Metforminspiegel führt. Die sechswöchige Pilotstudie wur-<br />
de als randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Cross-over-Studie<br />
an 12 Typ-2-Diabetikern (Alter 63,3 ± 7,76 Jahre, BMI 34,7 ± 4,25 kg/m²)<br />
durchgeführt und bestand aus drei 14-tägigen Phasen. In der ersten und<br />
dritten Phase nahmen die Probanden zusätzlich zur antihyperglykämischen<br />
Therapie Verum oder Placebo ein (2 x 2 Tabletten/Tag). Zu Beginn und<br />
am Ende jeder Phase wurden folgende Blutparameter bestimmt: Metformin,<br />
HbA 1c , Nüchternglucose, Gesamt-, LDL-, HDL-Cholesterol, Triglyceride.<br />
Unter der Einnahme des polyglucosaminhaltigen Prüfproduktes sanken<br />
die Metforminspiegel durchschnittlich von 1,42 mg/l auf 0,71 mg/l, unter<br />
Placebo von 0,88 mg/l auf 0,64 mg/l. Insgesamt zeigten sich zwischen<br />
Prüfprodukt und Placebo keine signifikanten Unterschiede (p>0,05). Auch<br />
innerhalb der jeweiligen Gruppe erwiesen sich die Veränderungen im Interventionsverlauf<br />
nicht als signifikant. Bei HbA1c, Nüchternglucose und den<br />
Lipidparametern ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen<br />
den Gruppen oder beim Vergleich der Werte vor und nach der Intervention<br />
innerhalb der Gruppen. Nach den in dieser Pilotstudie gewonnenen Daten<br />
ist nicht davon auszugehen, dass die Verabreichung von Polyglucosamin<br />
einen klinisch relevanten Einfluss auf die Metforminspiegel ausübt. Weitere<br />
Beobachtungen an einem größeren Probandenkollektiv sind zur Bestätigung<br />
wünschenswert.<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Einfluss des glykämischen Index auf den Belastungsstoffwechsel<br />
Daniel König<br />
Medizinische Universitätsklinik, Rehabilitative und Präventive<br />
Sportmedizin, Freiburg, Deutschland<br />
Ein hoher Kohlenhydratanteil in der Ernährung verbessert nachweislich<br />
die körperliche Leistungsfähigkeit während längeren und intensiven Ausdauerbelastungen.<br />
Allerdings gibt es nur wenige Studien, die Fragestellungen<br />
zur Qualität der Kohlenhydratzufuhr, insbesondere in Bezug auf den glykämischen<br />
Index, untersucht haben. Die postprandiale Regulation des Insulinspiegels<br />
verändert sich jedoch in Abhängigkeit des glykämischen Index der<br />
zugeführten Nahrung. Insulin spielt nicht nur im Kohlenhydratstoffwechsel,<br />
sondern auch im Fett- und Proteinstoffwechsel eine zentrale Rolle. Die Höhe<br />
des Insulinspiegels vor und während Belastung ist daher mitentscheidend, ob<br />
während der körperlichen Aktivität vorwiegend Fettsäuren oder Kohlenhydrate<br />
verbrannt werden. Es konnte gezeigt werden, dass Kohlenhydrate mit<br />
einem niedrigen glykämischen Index zu einer prozentual gesteigerten Fettoxidation<br />
während Ausdauerlastung führen. Dies konnte an verschiedenen<br />
Sportlerkollektiven, aber auch bei Patienten mit Übergewicht und metabolischem<br />
Syndrom gezeigt werden. Verglichen mit einem hoch-glykämischen<br />
Getränk wiesen Sportler nach Zufuhr eines Getränkes mit einem niedrigen<br />
glykämischen Index während einer 90 minütigen Ausdauerbelastung eine<br />
Mehroxidation von 57.1 g Fett auf. Es gilt zu prüfen, ob eine vermehrte<br />
Fettoxidation bei Zufuhr von niedrig glykämischen Kohlenhydraten auch in<br />
der Regulation der Fettmasse, sowohl vor, während oder nach körperlicher<br />
Belastung, metabolisch genutzt werden kann. Von denkbarem Vorteil wäre<br />
dies beispielsweise hinsichtlich einer verzögerten Ausbildung oder dem Entgegenwirken<br />
einer Insulinresistenz mit den entsprechenden Auswirkungen<br />
für die Körperkomposition und Entwicklung eines Typ-2-Diabetes mellitus.<br />
Ergebnisse einer multinationalen Gewichtsreduktionsstudie<br />
in der Anwendung von formoline L112 gegen Placebo<br />
Carsten Otto et al.<br />
Praxis für Innere Medizin, Gräfelfing, Deutschland<br />
Zur Prognoseverbesserung der <strong>Adipositas</strong> wird von den Fachgesellschaften<br />
eine Gewichtsreduktion von 5 % des Ausgangsgewichtes empfohlen. Seit<br />
2006 wird eine multinationale Anwendungsbeobachtung des formoline-Konzeptes<br />
zur Gewichtsreduktion durchgeführt. Die Ergebnisse dieser multinational<br />
über die Länder Deutschland, Litauen, Finnland, Österreich und Estland<br />
durchgeführten Anwendungsbeobachtung über 12 Wochen werden in diesem<br />
Vortrag dargestellt. Alle Patienten mit BMI > 26 und einem Diabetes mellitus<br />
Typ II erhielten einen Ernährungskurs nach DGE-Vorgaben im Sinne einer<br />
Standardtherapie. Die ersten 50 % der Fälle erhielten Placebo und die weiteren<br />
50 % der Fälle erhielten das Polyglucosamin-Polymer formoline L112<br />
zur Unterstützung der Gewichtsreduktion. Dieser unverdauliche Faserstoff<br />
bindet einen Großteil der Nahrungsfette und leitet sie der natürlichen Ausscheidung<br />
zu. Das Signifikanzniveau der biometrischen Auswertung war bei<br />
5 % festgelegt worden. Zielparameter waren neben der Gewichtsreduktion<br />
die Taillenweite sowie Stoffwechselparameter. Aufgrund der Verbesserung<br />
der Prognose durch eine Gewichtsreduktion war es aus ethischen Gründen<br />
empfehlenswert diabetische Patienten in diese Studie einzuschließen, obwohl<br />
diese Patientengruppe besondere Probleme bei der Gewichtsreduktion hat.<br />
Umso bemerkenswerter sind die erzielten Ergebnisse.<br />
Möglichkeiten der <strong>Adipositas</strong>therapie<br />
Udo Rabast<br />
Hattingen, Deutschland<br />
Fachgesellschaften empfehlen als Stufe 1 in der <strong>Adipositas</strong>therapie die<br />
Reduktion des Fettverzehrs. Stufe 2 gilt als sinnvollste Maßnahme der<br />
Langzeittherapie. Die Energiezufuhr sollte moderat um ca. 500–800 kcal/d<br />
reduziert werden. Einen guten Sättigungseffekt erzielt man mit der Zufuhr<br />
von 20 Energie- % Protein, ballaststoffreichen Kohlenhydraten und 500g<br />
Gemüse pro Tag. Das Nahrungsvolumen lässt sich so nahezu verdoppeln.<br />
Fett sollte unter 20 %, der Zuckerverzehr unter 5 % der zugeführten Energiemenge<br />
liegen. Es sollte bevorzugt auf pflanzliche Fette (z. B. Rapsöl,<br />
Olivenöl) und auf einen ausreichenden Anteil an n-3 FS geachtet werden.<br />
Die zu erwartende Gewichtsreduktion liegt bei 5,1 kg in 12 Monaten.<br />
1000–1200 kcal-Diäten gelten im Vergleich hierzu als stressbeladener. Ausreichende<br />
körperliche Aktivität, möglichst 3–5 Stunden Bewegung pro Woche<br />
und die Verhaltensänderung gelten als wichtige Faktoren für die erfolgreiche<br />
Abnahme und den dauerhaften Therapieerfolg. Bei unzureichendem<br />
Erfolg kommt der Einsatz von Formuladiäten (Mahlzeitenersatz oder als<br />
alleinige Therapie) in Frage. Abzulehnen sind die häufig mit großem Werbeaufwand<br />
propagierten Außenseiterdiäten in Form von Blitz- oder Crashdiäten.<br />
Bei mehr als 3–6-monatiger erfolgloser Therapie werden zusätzlich<br />
medikamentöse Verfahren empfohlen. Neben Appetitzüglern werden die<br />
Fettabsorption reduzierende Medikamente in Form eines Lipaseinhibitors<br />
oder Fett direkt absorbierende Medizinprodukte (Polyglucosamin, z. B. For-
moline L112) eingesetzt. Die innerhalb von 12 Wochen erzielte Gewichtsreduktion<br />
lag mit dem Polyglucosaminpräparat mit ca. 4,7 kg signifikant höher<br />
als in einer Kontrollgruppe (3,3 kg; p40kg/m², bei schwerwiegenden Begleit- oder Folgeerkrankungen<br />
ab einem BMI>35 kg/m“ und erfolgloser konservativer Therapie<br />
sind operative Verfahren zu erwägen.<br />
Use of a meal replacement weight loss intervention in survivors<br />
of ER/PR negative breast cancer<br />
Mara Vitolins<br />
Wake Forest University School of Medicine, Public Health Sciences,<br />
Department of Epidemiology and Prevention, Winston-Salem, USA<br />
Large-scale prospective studies that have evaluated the longer term effects<br />
of obesity have noted that being obese increases one’s risk of developing<br />
cancer. One study reported that body size (weight or Body Mass Index) was<br />
associated with all breast cancer recurrence and was found to be more pronounced<br />
for women with estrogen and progesterone receptor negative (ER/<br />
PR-) tumors. Treatment of obesity by weight loss through changes in diet<br />
and physical activity has been reported to beneficially impact blood markers<br />
associated with increased breast cancer risk. Since overweight is a risk factor<br />
for recurrence and death from breast cancer and studies in survivors indicate<br />
that extra weight gained during treatment has been noted to negatively impact<br />
body image, a pilot study was conducted to determine the feasibility<br />
of recruiting survivors of breast cancer (ER/PR-) to participate in a meal<br />
replacement (Almased ® ) weight loss intervention. The study assessed the<br />
participant’s ability to adhere to the intervention protocol and to measure<br />
changes in health-related quality of life and body weight. Nineteen women<br />
(median age 59 years; 14 white, 5 black) participated in this 3 month study.<br />
Significant improvements in body weight were noted, only one participant<br />
failed to lose weight by the end of the study, and the mean weight change<br />
was -13.8 ± 8.0 pounds (p
48<br />
Referenten<br />
Abderrahim Farida 23<br />
Adam Sibylle 20<br />
Adam Olaf 39<br />
Adams Frauke 15<br />
Adams Ted 41<br />
Ahnis Anne 36<br />
Aidelsburger Pamela 25<br />
Al-Hasani Hadi 40<br />
Alexandridis Jannis 24<br />
Alizadeh Manuela 11<br />
Allemand Dagmar 21<br />
Antic Slobodan 44<br />
Ardelt-Gattinger Elisabeth 17, 28<br />
Aronica Stefanie 25<br />
Aschemeier Bärbel 34<br />
Augustin Robert 15, 41<br />
Austel Anja 39<br />
Bannert B. 26, 37<br />
Bantel Susanne 28<br />
Bastian Ina 19<br />
Bau Anne-Madeleine 18<br />
Bauer Carl Peter 23<br />
Bauer Johannes 35<br />
Baumert Jens 16<br />
Baumstark Manfred 22<br />
Becke Birgit 17<br />
Becker Christine 18<br />
Becker Sandra 25<br />
Behrens Maik 41<br />
Benecke Monika 17<br />
Berdel Dietrich 23<br />
Berg Swantje 22<br />
Berg Aloys 22, 37, 39, 45<br />
Berg Andreas 22, 39<br />
Bieber Gerald 22<br />
Biebermann Heike 6<br />
Bieri Norman 16<br />
Birnbacher Robert 17<br />
Blaik Alexandra 25, 43<br />
Blair Steven N. 5<br />
Blüher Matthias 15<br />
Blüher Susann 30<br />
Bockhorst Rüdiger 45<br />
Böhm Bernhard O. 15<br />
Böhm Bernhard 40<br />
Böhnke Jana 14, 27<br />
Borchard Ulrich 45<br />
Bornholt Carla 30<br />
Borte Michael 23, 24, 27<br />
Boschmann Michael 15<br />
Bosy-Westphal Anja 38<br />
Bouchard Claude 5<br />
Brändle Michael 44<br />
Brandstetter Sophie 21<br />
Brandstetter Susanne 22<br />
Bräuer Wolfgang 20<br />
Breithaupt Nicole 24<br />
Bresch Elke 36<br />
Brumm Harald 6<br />
Brünion Heidi 5<br />
Budziarek Petra 27<br />
Bulat Meral 19<br />
Bullinger M. 12<br />
Burg Isabelle 19<br />
Busjahn Andreas 27<br />
Chen-Stute Annette 23, 38<br />
Clausen Kerstin 19<br />
Claußnitzer Gerd 20, 21<br />
Collatz Klaus-Günter 19, 43<br />
Czaja Julia 7, 30<br />
Dammann Dirk 20<br />
Dankhoff Mark 30<br />
Danne Thomas 34<br />
de Sousa Gideon 28<br />
de Zwaan Martina 41<br />
Debatin Klaus-Michael 40<br />
Deibert Peter 5, 45<br />
Deluiz-Ecker Lucia 42<br />
Dickhuth H. H. 26<br />
Diedrich Andre 27<br />
Dierkes Jutta 25<br />
Ditschuneit Herwig 40<br />
Dobberstein Kerstin 27<br />
Dobe Michael 22<br />
Döller Walter 35, 37<br />
Döring Ivonne 28<br />
Dorn Angeklika 35<br />
Dreja Tanja 40<br />
Drennig Saskia 26, 37<br />
Dunitz-Scheer Marguerite 33<br />
Düring Maria 27, 44<br />
Eggers Ines 17<br />
Ehrhardt Cornelia 28<br />
Eisler Beatrix 25<br />
Ellrott Thomas 39<br />
Engeli Stefan 14, 15, 24, 27, 44<br />
Erbs Sandra 21<br />
Erhard Jochen 16<br />
Ernert Andrea 18<br />
Ernst Barbara 16, 26, 27, 37, 42<br />
Etzrodt-Walter Gwendolin 40<br />
Faulhammer Susanne 35<br />
Fenske Nora 23<br />
Finne Emily 17, 24, 36<br />
Fischer-Posovszky Pamela 40, 41<br />
Flaggl Franz 35<br />
Flechtner-Mors Marion 40<br />
Foley James E. 27<br />
Frank Matthias 18<br />
Frey Ingrid 22, 37, 39<br />
Frid Anders 27, 44<br />
Friedel Susann 5, 28, 41<br />
Friedrich Konstanze 18<br />
Fuchs Helmut 41<br />
Fulda Simone 40<br />
Gailus-Durner Valérie 41<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Galm Christoph 22<br />
Ganz Vogel Carla Ivane 41<br />
Garber Alan 27, 44<br />
Garten Antje 40<br />
Gasperl Alexandra 20<br />
Gaugg Markus 37<br />
Gawlik Verena 41<br />
Gellhaus Ines 42<br />
Gerber Andreas 25<br />
Ghods Elaheh 21<br />
Giani Guido 41<br />
Giel Katrin 11<br />
Gläßer Nancy 30<br />
Gnauer S. 26, 37<br />
Goele Kristin 38<br />
Göhl Nathalie 33<br />
Goldapp C. 12<br />
Gorzelniak Kerstin 14, 15<br />
Gottschalk Simone 15<br />
Gräbe Thomas 35<br />
Grallert Harald 6, 16, 41<br />
Grebe et. Al Wolfgang 46<br />
Greene Brandon 41<br />
Grothe Jessica 6<br />
Gruhl Ulrike 6, 8<br />
Grüters Annette 6<br />
Guggenberger Christina 20<br />
Haas Uta 44<br />
Hahn Andreas 46<br />
Halle Martin 19, 33<br />
Halschmid Manfred 42<br />
Hamann Andreas 43<br />
Hanjalic-Beck Aida 6<br />
Hartmann Andrea 20, 30<br />
Hasengschwandtner Franz 38<br />
Haufe Sven 24, 44<br />
Hauner Hans 6, 41<br />
Hauskeller Franziska 30<br />
He YanLing 27<br />
Hebebrand Johannes 5, 6, 28, 41<br />
Heiland Steffi-Kathrin 32<br />
Heiland Steffi 38<br />
Heilmeyer Peter 18, 35<br />
Heinrich Joachim 23<br />
Helferich Anna 43<br />
Helfert Susanne 30<br />
Hellbardt Mario 7<br />
Hellmond Frank 35<br />
Henkel Janin 15<br />
Henne-Bruns Doris 43<br />
Herbarth Olf 23<br />
Herder Christian 16, 41<br />
Hering Dagmara 27<br />
Hermann Miriam 17<br />
Hermansen Kjeld 27, 44<br />
Herpertz Stephan 12, 26<br />
Hesse Deike 15<br />
Heusser Karsten 27
Hilbert Anja 7, 10, 30<br />
Hillenbrand Andreas 43<br />
Hinney Anke 5, 6, 28, 41<br />
Hipp Susanne 17<br />
Hitze Britta 33<br />
Hoenig Angela 43<br />
Hoffmann Reinhart 6, 7, 8<br />
Hoffmeister U. 12<br />
Hoffmeister Ulrike 21<br />
Hoffmeyer André 22<br />
Hohorst Sigrid 32<br />
Holl R. W. 12<br />
Holl Reinhard W. 21<br />
Hölter Sabine 41<br />
Hommel Angela 15<br />
Horber Fritz 16<br />
Horenburg Sina 41<br />
Hrabé de Angelis Martin 41<br />
Hudjetz Annekatrin 30<br />
Hunt Stephen 41<br />
Huonker Martin 18<br />
Huth Cornelia 41<br />
Hüttl Thomas P. 42<br />
Illig Thomas 16, 41<br />
Imhof Patricia 19<br />
Jaehrig Dietlind 33<br />
Jaeschke Robert 35<br />
Janke Jürgen 14, 15<br />
Jauch K.-W. 42<br />
Jendle Johan 27<br />
Johannsen Maike 19<br />
Joost Hans-Georg 15, 40, 41<br />
Jordan Jens 14, 15, 24, 27, 44<br />
Kahl Kai G. 25<br />
Kaps Alexander 22, 31, 32, 38<br />
Karl Ernst-Ludwig 35<br />
Keller Alexandra 30<br />
Keller Eberhard 32<br />
Keller Klaus-Michael 32<br />
Kellmann Michael 23, 38<br />
Kern Matthias 15<br />
Kersting Anette 12<br />
Kersting Mathilde 19<br />
Ketzscher Rita 21<br />
Kiess Wieland 21, 30, 32, 40<br />
Killian Alexandra 41<br />
Kinzl Johann F. 16<br />
Kiosz D. 12<br />
Kirschenmann Karina 39<br />
Klapdor-Volmar Beate 8<br />
Klapp Burghard 36<br />
Kleinjung Frank 40<br />
Kleiser Christina 31<br />
Klenk Jochen 22<br />
Kliebhan Rudolf 35<br />
Klingenspor Martin 16<br />
Kluge Reinhart 40, 41<br />
Kocalevent Rüya 36<br />
Kohlenberg Silke 18, 35<br />
Köhler Dinah 6, 8<br />
Koletzko Sibylle 23<br />
Kolip Petra 17, 24, 36<br />
Kollerits Barbara 41<br />
Kollmann Matthias 35<br />
König Daniel 8, 22, 37, 46<br />
Konz Kornelia 43<br />
Kopczynski Sascha 23, 38<br />
Körner Antje 21, 40<br />
Korsten Katrin 26<br />
Korsten-Reck Ulrike 19, 24, 26,<br />
43, 45<br />
Kossmann Beate 25<br />
Kowalski Axel 25<br />
Kraaibeek Hanna-Kathrin 20<br />
Kramer Guido 22, 38, 39<br />
Krämer Ursula 23<br />
Kratzsch Jürgen 40<br />
Kreuser Friederike 24, 26<br />
Kromeyer-Hauschild Katrin 8, 26,<br />
30, 32, 34<br />
Kronenberg Florian 41<br />
Krude Heiko 18<br />
Kuhn Gabriele 35<br />
Kukulus Vera 40<br />
Kunz Inge 35<br />
Kurth Bärbel-Maria 31<br />
Lagerpusch Merit 38<br />
Lalic Nebojsa 44<br />
Lammel Christoph 19<br />
Landgraf Rüdiger 6, 8<br />
Landsberg Beate 19<br />
Lang Reinhold A. 42<br />
Lange Dominique 19<br />
Lange Karin 34<br />
Langhof Helmut 33<br />
Latsch Joachim 37<br />
Legenbauer Tanja 26<br />
Lehmann Anne-Christin 14<br />
Libuda Lars 19<br />
Liebl Andreas 27, 44<br />
Lientscher Michaela 35, 37<br />
Livadas Alexander 33<br />
Lorenz Yvonne 39<br />
Lueg Andreas 46<br />
Luft Friedrich C. 15, 24, 27, 44<br />
Luley Claus 25, 43<br />
Lüngen Markus 25<br />
Mall Werner 45<br />
Mang Bärbel 46<br />
Mangge Harald 15<br />
Mann R. 12<br />
Mannhardt Sonja 31, 36<br />
Marquardt Erika 34<br />
Martus Peter 18<br />
März Winfried 15<br />
Matthews David 27, 44<br />
Referenten<br />
Mayer-Popken Otfried 31<br />
Meier Sabrina 8<br />
Meigen Christof 32<br />
Meindl Markus 17, 28<br />
Meisinger Christa 16, 41<br />
Melchior Christin 32<br />
Mensink Gert B. M. 31<br />
Metz Karin 23<br />
Meusel Sabine 43<br />
Meyer Andrea H. 9<br />
Mitha Ismail H. 44<br />
Moß Anja 9, 20, 21<br />
Muckelbauer Rebecca 19<br />
Mühler Anke 17<br />
Mühlhans Barbara 41<br />
Müller Ulrike 32<br />
Müller Manfred J. 19, 33, 38<br />
Müller Timo D. 41<br />
Munsch Simone 9<br />
Muser Klaus 37<br />
Mutschler Harry 44<br />
Nagl Elisabeth 20<br />
Narkiewicz Krzysztof 27<br />
Nauck Michael A. 27, 44<br />
Ney Olaf 46<br />
Nielinger J. 12<br />
Nieschalk Tanja 32, 38, 39<br />
Obeidat F. 42<br />
Otto Christoph 24<br />
Otto et al. Carsten 46<br />
Pahl-Wurster Heike 9<br />
Pauli-Pott Ursula 32<br />
Paulweber Bernhard 41<br />
Pedersen Bente Klarlund 8<br />
Pertl Anja 33<br />
Peter Richard 22<br />
Petersen Christiane 21<br />
Petzold Stefanie 40<br />
Pietrowsky Reinhard 12<br />
Pilz Stefan 15<br />
Plachta-Danielzik Sandra 19, 33<br />
Pleyer Isabelle 39<br />
Plininger Irina 43<br />
Plonné Dietmar 18<br />
Poliwoda E. 42<br />
Potoczna Natascha 16<br />
Pott Wilfried 32<br />
Predel Georg 22, 37<br />
Preuß Ulrike 33<br />
Prinz-Langenohl Reinhild 31<br />
Prokopchuk Dmytro 22<br />
Pudel Volker 39<br />
Püschel Gerhard Paul 15<br />
Rabast Udo 46<br />
Rabenbauer Maria 20<br />
Radinger Anna 33<br />
Rank Melanie 33<br />
Ranke Catrin 39<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
49
50<br />
Referenten<br />
Rathmann Wolfgang 16, 41<br />
Ravens-Sieberer U. 12<br />
Ravn Gabriela 44<br />
Reinehr Thomas 9, 12, 17, 19, 21,<br />
22, 24, 28, 36<br />
Remmel Andreas 26, 37<br />
Rett Kristian 43<br />
Rieck Beate 23<br />
Ried Jens 7, 10<br />
Riedl Andrea 36<br />
Ring-Dimitriou Susanne 17, 28<br />
Rittler P. 42<br />
Rößler Paula 16<br />
Rudolphi Birgit 20<br />
Rümcker Birgit 38<br />
Ruppnig Markus 33<br />
Russell-Jones David 44<br />
Rustenbach Stephan Jeff 12<br />
Rzehak Peter 23<br />
Sadeghian Evelin 34<br />
Satzinger Nicole 42<br />
Sauerland Stefan 10<br />
Sausenthaler Stefanie 23<br />
Schaaf Beate 23<br />
Schabert Rosi 25<br />
Schaefer Anke 17, 22, 24, 36<br />
Schaffrath Angelika 31<br />
Scheepers Andrea 41<br />
Scheidt-Nave Christa 31<br />
Schein Alex 33<br />
Schenk Liane 18<br />
Scherag André 6, 41<br />
Schiel Ralf 22, 31, 32, 38, 39<br />
Schlensak Matthias 16<br />
Schmid Daniela 10<br />
Schmid Lena Anna 23<br />
Schmid Sebastian M. 26, 27<br />
Schmidt Kerstin 18<br />
Schmidt Stefan 36, 41<br />
Schmidt-Trucksäss Arno 19<br />
Schmiederer G. 12<br />
Schmitz Ole 44<br />
Schneider Annette 19, 24, 43<br />
Schnurr Carolin 39<br />
Schoberleitner Karin 33<br />
Schöneberg Torsten 32<br />
Schröer Milly-Anna 25<br />
Schultes Bernd 16, 26, 27, 37, 42<br />
Schultz Konrad 35<br />
Schulz Angela 32<br />
Schürmann Annette 15, 41<br />
Schwarz Peter 6, 8<br />
Schwarz Peter E. H. 11<br />
Schwarzenberger S. 26, 37<br />
Schwerin Heiko 33<br />
Sedlmeier Eva-Maria 41<br />
Seebach Henning 22<br />
Seel Miriam 19, 43<br />
Seelhorst Ursula 15<br />
Sethi Bipin K. 44<br />
Shah Nalini S. 44<br />
Shaw Jonathan 44<br />
Siefken-Kaletka Heidi 21<br />
Siegfried Wolfgang 20, 21<br />
Siegfried Alena 20, 21<br />
Siegrist Monika 19, 33<br />
Sievert Kolja 20, 21<br />
Simo Rafael 44<br />
Skurk Thomas 11<br />
Spelsberg F. W. 42<br />
Spindler T. 12<br />
Steffen Rudolf 16<br />
Steinacker Jürgen 18<br />
Steinacker Jürgen M. 22<br />
Steiner Ronald 22<br />
Steinhagen-Thiessen Elisabeth 36<br />
Stierle Christian 36<br />
Stockburger Hildegard 35<br />
Strassburger Klaus 41<br />
Strauss Anke 14, 27<br />
Strauss Boyd J. 27<br />
Streber Agnes 34<br />
Susewind Martin 17<br />
Sweep Fred C. G. J. 27<br />
Tank Jens 27<br />
Tankova Tsvetalina 44<br />
Terán Christina 36<br />
Tewes Alexander 34<br />
Theodoridou Sophia 43<br />
Thiel Ansgar 11<br />
Thomas Hella 20<br />
Thürauf Norbert 11<br />
Thurnheer Martin 16, 26, 27, 37, 42<br />
Tiran Beate 15<br />
Töpfer Madlen 21<br />
Toschke André Michael 19<br />
Tsikas Dimitrios 14<br />
Tuschen-Caffier Brunna 12<br />
Ulle Tanja 25<br />
Ullmann Silke 11<br />
Ullrich Otmar 32<br />
Unterkircher Thomas 40<br />
Vaag Allan 44<br />
van Egmond-Fröhlich Andreas 12,<br />
20<br />
Vitolins Mara 12, 47<br />
Vocks Silja 12<br />
Vogt Anja 36<br />
Voit Wolfgang 8<br />
von Berg Andrea 23<br />
von Hacht Karin 25<br />
von Taube Christopher 45<br />
Wabitsch Martin 9, 20, 21, 22,<br />
40, 41<br />
Waidner Uta 43<br />
Walgenbach Maren 10<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
Walle Hardy 18<br />
Walter T. 26, 37<br />
Warich Katja 30<br />
Warschburger Petra 12, 14, 28, 30<br />
Wartha Olivia 22<br />
Wasem Jürgen 25<br />
Wechsler Johannes Georg 14<br />
Weghuber Daniel 28<br />
Wegner Karin 39<br />
Weigand Gerhard 43<br />
Weihs-Godenrath Thekla 39<br />
Weiner Sylvia 43<br />
Weiner Rudolf 43<br />
Weitz Elke 43<br />
Wellnitz Britta 15<br />
Westenhöfer W. 12<br />
Westenhöfer Joachim 20<br />
Westphal Sabine 25, 43<br />
Wichmann H.-Erich 16, 23, 41<br />
Widhalm Kurt 21<br />
Wieczorek Gabriele 38<br />
Wiegand Susanna 18, 21, 34<br />
Wiesner Susanne 14, 24, 44<br />
Wilhelm Frank 9<br />
Wilms Britta 26, 27<br />
Winkel Katrin 17, 22, 24, 36<br />
Winkelmann Bernhard 15<br />
Wirth Alfred 5, 47<br />
Witschnig M. 26, 37<br />
Wolf Anna 43<br />
Wolfarth Bernd 33<br />
Worm Nicolai 47<br />
Würbach Ariane 34<br />
Wurst Wolfgang 41<br />
Zahn Claudia 15<br />
Zdravkovic Milan 27, 44<br />
Zellner Konrad 30, 34<br />
Zern Nadine 39<br />
Ziegler Claudia 34<br />
Zinman Bernard 44<br />
Zipfel Stephan 11, 25<br />
Zügel N. 42
Termine<br />
Oktober 2008<br />
24. Jahrestagung der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
Freiburg/Brsg., 16.10.-18.10.2008<br />
www.adipositas-gesellschaft.de/veranstaltungen.php<br />
November 2008<br />
Herbsttagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft<br />
Berlin, 07.11.-08.11.2008<br />
www.herbsttagung-ddg.de<br />
5. Frankfurter Meeting für <strong>Adipositas</strong>chirurgie<br />
Frankfurt, 13.11.-14.11.2008<br />
www.frankfurter-meeting.de<br />
MEDICA<br />
40. Weltforum der Medizin<br />
Düsseldorf, 19.11.-22.11.2008<br />
www.medicacongress.de<br />
März 2009<br />
46. DGE-Kongress<br />
Gießen, 12.03.-13.03.2009<br />
www.dge.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&p<br />
id=39<br />
4. Diabetologie-Update-Seminar<br />
Düsseldorf, 20.03.-21.03.2009<br />
www.diabetes-update.com<br />
April 2009<br />
75. Jahrestagung der DGK<br />
Mannheim, 16.04.-18.04.2009<br />
http://ft2009.dgk.org<br />
115. Kongress der Deutschen Gesellschaft<br />
für Innere Medizin<br />
Wiesbaden, 18.04.-22.04.2009<br />
www.dgim2009.de<br />
Mai 2009<br />
44. Jahrestagung der DDG<br />
Leipzig, 20.05.-23.05.2009<br />
www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/jahrestagung2009<br />
Juni 2009<br />
8. Dreiländertagung der AKE, DGEM und GESKES<br />
Zürich, 04.06.-06.06.2009<br />
www.dgem.de/veranst.htm<br />
November 2009<br />
25. Jahrestagung der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
Berlin, 05.11.-07.11.2009<br />
www.ddg-dag.de<br />
Impressum<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong><br />
Nachrichten der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
& Ernährungskonsil<br />
ISSN 1861-7093<br />
Herausgeber<br />
Vorstand der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
Wissenschaftlicher Beirat<br />
Prof. Dr. Winfried Banzer, Frankfurt<br />
Prof. Dr. Hans Hauner, München<br />
Prof. Dr. Johannes Hebebrand, Essen<br />
Prof. Dr. Andreas Plagemann, Berlin<br />
PD Dr. Thomas Reinehr, Datteln<br />
Prof. Dr. Martin Wabitsch, Ulm<br />
Prof. Dr. Rudolf Weiner, Frankfurt<br />
Prof. Dr. Eberhard Windler, Hamburg<br />
Prof. Dr. Alfred Wirth, Bad Rothenfelde<br />
Prof. Dr. Stephan Zipfel, Tübingen<br />
Chefredaktion<br />
Prof. Dr. med. Andreas Hamann, Bad Nauheim<br />
Dr. med. Karin Wilbrand, Neu-Isenburg<br />
Stellvertretender Chefredakteur<br />
Prof. Dr. med. Stephan Jacob<br />
Redaktion<br />
Dr. Stefanie Gerlach, Richard Kessing, Dr. Petra Stübler<br />
Helene Bernardelli, Kerstin Eck<br />
Verlag und Produktion<br />
LinguaMed Verlags-GmbH<br />
Friedensallee 30<br />
63263 Neu-Isenburg<br />
Tel.: (06102) 71 57 0<br />
Fax: (06102) 71 57 71<br />
Internet: http://www.linguamed.de<br />
http://www.adipositasspektrum.de<br />
E-Mail: info@linguamed.de<br />
Grafik/Layout<br />
Helene Bernardelli<br />
Verlagsleitung/Marketing<br />
Richard Kessing<br />
Internet & Technische Redaktion<br />
Jens Calisti<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Tel.: (06102) 71 57-42<br />
Service<br />
Druck<br />
Wilhelm & Adam Werbe- und Verlagsdruck OHG, Werner-von-Siemens-Str. 29,<br />
63150 Heusenstamm<br />
Einzelpreis € 5,50; Erscheinungsweise: 6 x pro Jahr<br />
Für Mitglieder der Deutschen <strong>Adipositas</strong>-Gesellschaft<br />
sind die Abo-Kosten im Mitgliedsbeitrag enthalten.<br />
Hinweis<br />
Manuskripte für Originalarbeiten können unverlangt an den Verlag eingesandt werden.<br />
Voraussetzung für den Abdruck ist, dass es sich um ein unveröffentlichtes Manuskript<br />
handelt, das keiner anderen Redaktion angeboten wurde und über dessen alleinige<br />
Rechte der Autor verfügt. Mit der Annahme der Publikation gehen alle Rechte an Text<br />
und Abbildungen für den Nachdruck, Abbildungen, Übersetzungen oder Lizenzen an<br />
den LinguaMed-Verlag über.<br />
Copyright<br />
Für die Dauer des Urheberrechts sind alle Beiträge und Abbildungen urheberrechtlich<br />
geschützt, jede Verwertung außerhalb des Urheberrechts darf nur mit Genehmigung des<br />
Verlages erfolgen.<br />
Textinhalte<br />
Die Textinhalte geben die Autorenmeinung wieder und stimmen nicht zwangsläufig mit<br />
der Meinung der Herausgeber überein. Für die Richtigkeit der wissenschaftlichen Beiträge<br />
zeichnen die Schriftleitung und die Autorenschaft verantwortlich. Der Leser<br />
wird darauf hingewiesen, Handlungsweisen und Dosisrichtlinien kritisch<br />
zu überprüfen, für die der Verlag keine Verantwortung übernimmt.<br />
„Nachrichten aus der Industrie“ geben nicht die Meinung der Herausgeber<br />
und der Redaktion wieder.<br />
geprüfte Auflage<br />
<strong>Adipositas</strong><strong>Spektrum</strong> Kongressausgabe Oktober 2008 4. Jahrgang<br />
51
PALATINOSE –<br />
the better energy<br />
PALATINOSE von BENEO-Palatinit ist das einzige niedrig glykämische Kohlenhydrat mit lang anhaltender<br />
Energiebereitstellung für innovative Sport- und Energy-Produkte. Ernährungsphysio logische<br />
Vorteile machen PALATINOSE zum optimalen „Energiespender“ in einer kohlenhydratbetonten,<br />
ausgewogenen Ernährung:<br />
• Langsam und vollständig verfügbares Kohlenhydrat<br />
• Niedrig glykämische Wirkung (low GI)<br />
• Signifi kant längere Energiezufuhr<br />
• Unterstützt die Fettverbrennung<br />
• Zahnfreundlich<br />
• Natürliche zuckerähnliche Süße<br />
BENEO-Palatinit GmbH · Telefon: 0621 421-150 · palatinose@beneo-palatinit.com · www.beneo-palatinit.com<br />
Energie<br />
PALATINOSE – the better energy<br />
PALATINOSE <br />
Glukose<br />
Zeit