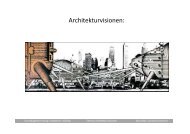Download - Wohnbau - TU Wien
Download - Wohnbau - TU Wien
Download - Wohnbau - TU Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sabine Pollak<br />
WOHNEN UND PRIVATHEIT<br />
Materialien zur Vorlesung im Modul <strong>Wohnbau</strong> 12/13<br />
Sämtliche Texte und Bilder sind nur für Unterrichtsszwecke bestimmt und dürfen nicht<br />
veröffentlicht oder kopiert werden, auch nicht Teile der Texte!<br />
Der Beginn des Privaten, das Ende des Öffentlichen<br />
Ende 1998 hatten über fünfzehn Millionen japanische Zusehende jeden Sonntag<br />
im Abendprogramm eines japanischen Fernsehsenders den 23- jährigen Japaner<br />
Nasubi in seinem kleinen Apartment beobachtet. Die beliebteste Reality-Serie des<br />
Jahrzehnts, Susunu! Denpa Sho-Nen (Don’t Go For It, Electric Boy!) wurde unter<br />
untergewöhnlichen Bedingungen gedreht: Nasubi war vollkommen nackt in das<br />
Apartment gesperrt worden und musste sich, bis auf eine kleine Anfangsration,<br />
alles Lebensnotwendige über Preisausschreiben gewinnen. Wenn er die<br />
Gewinnsumme von einer Millionen Yen erreicht hätte, würde er frei gelassen<br />
werden. Im leeren Apartment wurden ihm dazu Stapel von Zeitschriften und<br />
Postkarten bereit gestellt, von denen er monatlich Tausende abschickte. Nach<br />
einiger Zeit gewann er einen Sack Reis, aber auch für ihn unbrauchbare Dinge wie<br />
ein Fahrrad oder Tickets für eine Kinovorführung. Das einzige Stück Privatheit, das<br />
Nasubi während seiner einjährigen Beobachtung beanspruchen konnte, war ein<br />
dunkler Fleck, den die Zensur während der Übertragung über seinem Geschlecht<br />
platzierte.<br />
Seit dem Beginn von Reality-TV Anfang der 1970er Jahre mit der Dokumentation<br />
An American Family, der Loud Family (USA, 1973) scheint das Interesse am<br />
Privatleben Anderer ungebrochen. Zwölf Monate lang wurde die Familie Loud in<br />
Santa Monica, Kalifornien gefilmt und bot den Zusehenden Alltag, Liebe, Streit<br />
bis hin zu Details wie Homosexualität und letztlich der Scheidung der Eltern. Das<br />
Zurschaustellen intimster Handlungen ist mittlerweile Gewohnheit geworden,<br />
und dennoch produzieren Szenen intimster Alltäglichkeit nach wie vor den latenten<br />
Voyeurismus der Zusehenden. Der Wunsch nach dem Eindringen in fremde<br />
Privatwelten ist augenscheinlich ebenso beständig wie der Wunsch nach Privatheit<br />
selbst. Und es ist ebendieser Wunsch nach dem Eigenen, dem Uneingesehenen<br />
und dem Abgeschotteten, der die Architektur des Wohnens seit Jahrhunderten<br />
mehr als Moden, Stile und Modelle bestimmt. Der folgende Text nähert sich den<br />
jeweiligen Ausformulierungen und Interpretationen von Privatheit im Wohnen westlicher<br />
Kultur an, seien diese historisch bedingt, als Symbol verstanden, als Mode<br />
transportiert oder als radikaler Versuch einer Neuordnung des privaten Wohnens<br />
getestet. Weder chronologisch noch vollständig, sondern eher assoziativ wird versucht,<br />
den Konventionen und Alltäglichkeiten, den Grenzen und Überschreitungen<br />
des Privaten auf die Spur zu kommen.<br />
Dabei geht es um Phänomene des Privaten, vor allem jedoch um Praktiken des<br />
Privaten, also Essen, Schlafen, Erholen, Hauswirtschaften, Sexualität. Auch wenn<br />
diese Praktiken im ersten Moment frei wählbar scheinen, so gehorchen sie trotz<br />
der intimen Sphäre einem relativ genauen Regelwerk. Die richtige Ausübung<br />
dieser Praktiken funktioniert über geschriebene oder überlieferte Verhaltensregeln,<br />
sie kann jedoch nur auch über räumliche Codierungen funktionieren. Die präzise<br />
Auswahl, Organisation und Positionierung von Materialien, Begrenzungen und<br />
Gegenständen sind wichtige Bestandteile von Codierungen, über die jede einzelne<br />
Praktik des Privaten präzise bestimmt wird. Die Oberfläche jedes häuslichen Privaten<br />
formiert also letztlich ein sehr genau definiertes Terrain, auf dem die gesellschaftliche<br />
Konventionen ausgetragen werden: Die Gesetze der Gastfreundschaft,<br />
die Verteidigung der Sicherheit und des Eigentums des Privaten, die Ausübung<br />
vordefinierter Geschlechterrollen, die Praktiken der Sexualität, die Wahrung der<br />
häuslichen Hygiene, die körperliche Erholung und das Einhalten ehelicher Vereinbarungen.<br />
Das Funktionieren dieser Konventionen wird vor allem über räumliche<br />
Codes sichergestellt. Die Konventionen des Privaten funktionieren also nur über<br />
Architektur.<br />
An American Family, The Loud Family<br />
USA, 1973. Pat, Bill, Lance, Delilah, Grant,<br />
Kevin and Michelle Loud, 10 MIO Zusehende<br />
Phänomene, Praktiken, Alltäglichkeiten,<br />
Traditionen und Überschreitungen von Privatheit<br />
Privatheit radikal anders: Superstudio 1972.<br />
Neue NomadInnen treffen sich auf der neutralen<br />
Fläche eines allumspannenden Rasters
Zuordnungen, Unterscheidungen, Trennungen<br />
1979 installierte die kroatische Künstlerin Sanja Ivekovic 1979 eine achtzehnminütige<br />
Aktion an der Schnittstelle zwischen privat und öffentlich. Tag der Handlung:<br />
der Tag, an dem der Präsident Tito die Stadt besucht. Eine Parade wird ihm zu Ehren<br />
abgehalten. Ort der Handlung: der Balkon der Privatwohnung der Künstlerin.<br />
Ivekovic betritt den Balkon mit einem Whiskeyglas und einem Buch in der Hand.<br />
Sie registriert einen Polizisten am Dach des Wohnhauses gegenüber und einen<br />
auf der Straße, beide mit Funkgeräten. Sie setzt sich und gibt vor, eine intime<br />
Handlung, eine Masturbation durchzuführen, so lange, bis ein Polizist an ihrer Türe<br />
läutet und befiehlt, augenblicklich alle Personen und Objekte von dem Balkon zu<br />
entfernen. Ivekovic dokumentiert die von ihr „Triangle“ (die zwei Polizisten und die<br />
Künstlerin als Dreieckkonstrukt) benannte Aktion mit Fotografien und einer pragmatischen<br />
Beschreibung des Ablaufs der Aktion. In dieser Mischung aus Pragmatik<br />
und Radikalität thematisiert Triangle die (scheinbare) Freiheit im Privaten sowie die<br />
(scheinbare) Freiheit in der ideologisch aufgeladenen Stadtlandschaft im sozialistischen<br />
Zagreb der ausgehenden 1970er Jahre zugleich.<br />
Das Terrain, auf dem die gesellschaftlichen<br />
Konventionen ausgetragen werden (durch<br />
Architektur): Verteidigung der Sicherheit und<br />
des Eigentums des Privaten, die Ausübung<br />
vordefinierter Geschlechterrollen, die Praktiken<br />
der Sexualität, die Wahrung der häuslichen<br />
Hygiene, die körperliche Erholung und<br />
das Einhalten ehelicher Vereinbarungen.<br />
Was bedeutet privat, was bedeutet öffentlich Wie veränderten sich die beiden<br />
Kategorien im Laufe der Zeit Welche Freiheiten und welche Form von Kontrolle<br />
bestimmen die beiden Raumkategorien heute Welche Bilder von Privatheit<br />
bleiben unverändert, welche Sehnsüchte nach Privatheit bleiben unerfüllbar Wie<br />
definiert man die Konvention von Privatheit und wie überwindet man diese Folgt<br />
man Hannah Ahrendt, so beschreibt diese Öffentlichkeit als die Teilnahme der Polis<br />
an der Öffentlichkeit auf der Agora (der griechischen Antike). Sie sei dem freien<br />
Bürger (wohl hauptsächlich dem männlichen Bürger, folgt man etwa Richard Sennett)<br />
vorbehalten gewesen, der die Lebensnotwendigkeiten des privaten Haushalts<br />
(Oikos) überwunden habe. Privatheit hingegen definiere sich als die Sphäre des<br />
Eigentums (nicht des Besitzes) im Haushalt des freien Bürgers.<br />
Die Zuordnungen von Wohnen und Arbeiten, die Wunschvorstellung von einem<br />
haus mit Garten im Grünen sowie die damit verbundenen geschlechtlichen Zuordnungen,<br />
ausformuliert vor allem in den Planungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts,<br />
haben ihre Ursprünge in historischen Vorbildern und Zuordnungen<br />
und wurden über die Jahrhunderte wiederholt reformuliert. Bereits der Raum der<br />
griechischen Antike etwa wurde durch die Dualismen öffentlich/privat, innen/außen<br />
und männlich/weiblich geprägt. Die antike griechische Stadt basierte auf der<br />
Paarung von polis (Stadtstaat, die Gesamtheit der freien männlichen Bürger) einerseits<br />
und privatem Haus, Haushalt und Familie oder oikos andererseits.<br />
Leon Battista Alberti, 1570:<br />
Sakralbauten „...dass man zu ihrer Hoheit und<br />
zur Bewunderung ihrer Schönheit nichts mehr<br />
hinzufügen könnte“<br />
Privatbauten „...dass man ihnen dagegen<br />
nichts scheint wegnehmen zu können, was<br />
mit ausnehmender Würde verbunden wäre.“<br />
Der präzisen Unterscheidung zwischen öffentlicher Stadt und privatem Heim entsprachen<br />
ebenso präzise verteilte Aufgaben für Mann und Frau: Die männlichen<br />
Bürger mussten die polis in Form von politischen Ämtern aufbauen und in Form<br />
von Kriegsdienst verteidigen, Frauen hingegen mussten den oikos versorgen. Sie<br />
hatten keine Bürgerrechte und übten bis auf soziale Arbeit innerhalb der Familie<br />
keinerlei berufliche Tätigkeiten aus. Polis und oikos widerspiegelten also auch<br />
Mann und Frau. Das Bild der antiken Stadt reflektierte in Plan und Struktur die<br />
Differenzierung zwischen öffentlichem und privatem sowie zwischen männlichem<br />
und weiblichem Körper.<br />
Dieser Differenzierung lag eine wissenschaftliche Theorie zugrunde, die Basis<br />
für alle naturwissenschaftlichen Theorien wie auch für die gesellschaftliche und<br />
räumliche Ordnung innerhalb der antiken Stadt bildete. In naturwissenschaftlichen<br />
Schriften, wie sie etwa von Aristoteles verfasst wurden, wird das größte Augenmerk<br />
auf die Temperatur des Körpers gelegt. Die jeweilige Wärme oder Kälte<br />
des Körpers bestimmte dessen Gesundheit und Konstitution sowie letztlich auch<br />
dessen Geschlecht. Mediziner und Philosophen waren überzeugt davon, dass<br />
jeder Körper von einer Flüssigkeit durchströmt werde, deren Temperatur wiederum<br />
die Trennung der Geschlechter bestimmte. Die Grundtheorie dafür war die „Elemente-<br />
oder Säftelehre“, die im fünften Jahrhundert vor Christus von den „jüngeren<br />
Naturphilosophen“ entwickelt wurde.<br />
Sanja Ivecovic, Triange. Eine Performance zur<br />
scheinbaren Freiheit im Privaten.
Alkmeon von Kroton oder Empedokles von Agrigent vertraten etwa zwischen 530<br />
bis 430 vor Chr. die Theorie, dass die Gesundheit und Konstitution des menschlichen<br />
Körpers durch die vier Grundelemente Wasser, Feuer, Luft und Erde sowie<br />
durch eine ständige Mischung und Entmischung dieser vier Elemente definiert<br />
wurde. Diese Elemente- oder Säftelehre wurde von der Medizin der Neuzeit<br />
übernommen und besaß bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Gültigkeit. Sie ordnete<br />
von Beginn an Mann und Frau unterschiedliche Grundelemente und somit auch<br />
unterschiedliche Eigenschaften zu. Sämtliche medizinische Theorien, die also auf<br />
der Basis der antiken Säftelehre aufbauten, gingen von vornherein von geschlechtlich<br />
differenzierten physischen wie auch psychischen Eigenschaften des menschlichen<br />
Körpers aus. Somit wurde eine der Grundvoraussetzungen der Differenz von<br />
Mann und Frau fünf Jahrhunderte vor Christus festgelegt und über Jahrhunderte<br />
hindurch überliefert, um schließlich bis in das späte 19. Jahrhundert als natürliche<br />
Entität, die von nahezu niemandem angezweifelt werden konnte, zu bestehen.<br />
verbunden.<br />
Analog zu den vier Grundelementen identifizierten die Theoretiker der Antike vier<br />
Körpersäfte, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, die vier dazugehörigen<br />
Organe Herz, Gehirn, Leber und Milz sowie die vier elementaren Qualitäten warm,<br />
feucht, kalt und trocken. Wenn die Mischung der einzelnen Säfte bzw. Elemente<br />
stimmte, war der Körper gesund, wenn die Mischung aus dem Gleichgewicht<br />
geriet, wurde der Körper krank (eukrasie versus dyskrasie von eu = gut, krásis =<br />
Mischung und dys = fehlerhaft). Der männliche Körper wurde als warmer und damit<br />
gesunder Körper assoziiert, der weibliche und damit kalte Körper als abnormal<br />
und krank. Desgleichen wurden jene Männer, die nicht dem gängigen Bild von<br />
Männlichkeit entsprachen, als „verweiblicht“ und mit zu kalter Flüssigkeit verbunden.<br />
Diese Differenzierung in kalte und warme Körper definierte den gesellschaftlichen<br />
Status von Mann und Frau ebenso wie die räumliche Teilung der Stadt in<br />
einen öffentlichen und einen privaten Raum. Betrachtet man Pläne antiker Städte<br />
wie etwa jene von Athen, so vermag man die Theorie von warmen und kalten Körpern<br />
in der Einteilung der Stadt ebenso zu lesen wie in der Einteilung der privaten<br />
Häuser selbst.<br />
Eingang, Hof, Andron, Oikos<br />
Mann/Frau, hell/dunkel, sprechen/schweigen,<br />
stark/schwach, öffentlich/privat<br />
Die Theorie einer geschlechtlichen Einteilung schrieb sich gleichermaßen in Boden<br />
und Stein der Stadt ein, um als unumstößliches Grundgesetz das Leben der Stadt<br />
nahezu Jahrhunderte lang zu dominieren. Sämtliche öffentlichen Einrichtungen auf<br />
der Agora dienten der Bewegung und Artikulation der männlichen Bürger, entsprechend<br />
wichtig wurde die Akademie als Ausbildungsort dieser Bürger verstanden.<br />
Die Unterscheidung in Oikos, was ja mehr umfasste als das Haus allein, und fein<br />
abgestimmte und differenzierte Öffentlichkeit der Agora lässt sich mit Sicherheit<br />
nicht mehr auf heutige Gegebenheiten übertragen. Weder sind die komplexen<br />
Organisationseinheiten eines Oikos noch mit heutigen Wohnungen zu vergleichen,<br />
noch zeigen öffentliche Räume heute auch nur irgendeine Ähnlichkeit mit der Agora<br />
in der griechischen Antike.<br />
Mit Sicherheit haben sich auch heute sämtliche Grenzen, vormals dicke Mauern<br />
zwischen einem völlig in sich geschlossenen Inneren und einem offenen, freien<br />
Außen, verschoben. Bis an das Ende des 19. Jahrhunderts war diese Grenze in<br />
europäischen Städten noch mehr als präsent, als sich Öffentlichkeit mit wuchtiger<br />
Präsenz monumentaler Typologien behauptete und die Stadt laut, schnell, dicht<br />
und schmutzig, eben zutiefst öffentlich war. In dieser Stadt schien auch die Definition<br />
des Privaten einfach.<br />
Haus/Agora/Akademie, private und öffentliche<br />
Einrichtungen, die der Physis und der Psyche<br />
von Mann und Frau entsprechen.<br />
Am Ende des 19. Jahrhunderts definierte sich privat allein durch seine Unterscheidung<br />
zum Öffentlichen, privat bildete die intime Höhle im monumentalen<br />
Öffentlichen und schirmte ab vor Lärm, Chaos und Gefahr. Am Beginn des 20.<br />
Jahrhunderts wurde diese Unterscheidung zunehmend unklarer. Moderne Planung<br />
assoziierte mit der neuen Stadt vor allem eine größtmögliche Leere zwischen<br />
Objekten. Öffentlicher Raum sollte so neutral und daher auch so leer wie möglich<br />
sein, Wohnen sollte ebenso neutral (zumindest in Hinsicht auf Erschließung und<br />
Belichtung) und daher so gleichförmig wie möglich sein.<br />
Privatheit als schwer zu definierendes, jedoch<br />
universelles Modell.
Paradigmatisch für diese Haltung der Moderne steht etwa ein Entwurf von Ludwig<br />
Hilberseimer für Berlin Mitte der 1920er Jahre. Parallele, identische Scheibenhäuser<br />
stehen möglichst weit voneinander entfernt, der Raum zwischen den Scheiben<br />
fungiert als das, was er zu sein hatte, als ein Korridor für den Durchzug von<br />
frischer Luft und hat all das verloren, was bislang den öffentlichen Raum der Stadt<br />
definiert hatte: Dichte, Reibung, Auseinandersetzung, Sensation. Auf die Sensation<br />
der Gleichzeitigkeit unterschiedlichster Ereignisse folgte die visuelle Sensation von<br />
Leer- und Grünräumen.<br />
Vor allem seit der Einbeziehung von Medien in private Haushalte (seit den 1930er<br />
Jahren Radio und seit den 1960er Jahren Fernsehen) verlagern sich Grenzen<br />
zwischen öffentlich und privat schneller als je zuvor und zwar in beide Richtungen.<br />
Eine Schnittstelle dabei wurde im Jahr 1991 markiert. „Live as it happens“, so<br />
nannten amerikanische Fernsehsender wie CNN oder FOX News Sendungen über<br />
den Golfkrieg. Angebliche Direktübertragungen vom Krieg in private Haushalte<br />
- ein sauber definiertes Ziel, zerschossene gegnerische Panzer, ein einsamer<br />
Soldat im Sonnenuntergang - ermöglichten es den amerikanischen BürgerInnen,<br />
den Krieg im Privaten hautnah zu erleben. Man erfand das so genannte<br />
Frühstücksfernsehen neu und beide Sender steigerten mit zensurierten Bildern<br />
ihre Einschaltquoten enorm. USA rechtfertigte die Zensur, man hätte schließlich<br />
schon den Vietnamkrieg nur auf Grund falscher Medienberichterstattung verloren.<br />
2009 wiederum war es umgekehrt und ein Medium, das bislang hauptsächlich<br />
zum Austausch von privaten Belanglosigkeiten benutzt worden war, wurde höchst<br />
öffentlich. Am 16. Juni 2009 riefen iranische Demonstrantinnen via Twitter zur<br />
Teilnahme an den Protesten gegen die widersprüchliche Wahl des Präsidenten<br />
auf. Zum Einen kamen Tausende auf die Straßen, zum Anderen erfuhr die<br />
gesamte Welt über die Vorgänge. Die iranische Regierung brauchte lange, um<br />
das social network zu durchschauen. Aufrufe wie „jeder filmt heute so viel er kann<br />
mit der Handykamera“ wurden befolgt, die Bilder wurden ins Netz gestellt und<br />
die weltweiten NutzerInnen übten Druck auf Twitter aus, worauf die Betreibenden<br />
sogar auf die periodischen Wartungszeiten verzichteten. Twitter wurde, so war in<br />
den Meiden zu lesen, im Zuge dieser Berichte erwachsen, es erlangte erstmals<br />
politische Dimension. Die Straßenschlachten fanden real statt, die Revolution<br />
digital.<br />
Ludwig Hilberseimer, Berlin: Neutrales Wohnen,<br />
neutrale Öffentlichkeit<br />
Kann man im Haus Tugendhat wohnen Mies<br />
van der Rohe, Haus Tugendhat, Brünn 1929<br />
Erste Privatheit, private Gegenstände<br />
„Privat“ ist ein nur relativ zu beschreibender Begriff und Privatheit daher ein<br />
ebenso relatives und dehnbares Konzept. Sucht man nach der etymologischen<br />
Erklärung, so wurde der Begriff privat im 16. Jahrhundert aus dem Lateinischen<br />
entlehnt, in dem die ursprüngliche Bedeutung von privare berauben und befreien<br />
bedeutete: Die Eigenschaft privatus bezeichnete etwas, das der Amtsgewalt<br />
oder Herrschaft beraubt, vom Staat und von der Öffentlichkeit abgesondert,<br />
für sich stehend, einzeln, eigentümlich oder einer Sache beraubt war. Diese<br />
Erklärungen verdeutlichen, dass dem Inbegriff des Persönlichen, Individuellen und<br />
Unbeobachteten vorerst ein gewaltsamer Akt der Befreiung vorausgegangen war.<br />
Wahlen Iran, 2009. Twitter wird erwachsen<br />
Am Beginn einer ersten Individualität im Wohnen kam dem Begriff des Privaten<br />
also weitaus mehr Bedeutung zu, als wir es heute in unserem allgemeinen Sprachgebrauch<br />
vermuten, denn die Eigenschaft privat bezeichnete alles das, was erfolgreich<br />
der Kontrolle des Staates oder der Kirche geraubt worden war. Von da an<br />
beschreibt nun privat alles das, was persönlich, vertraulich, nicht amtlich, heimlich,<br />
zurückgezogen oder nicht öffentlich, einem mehr oder weniger einzelnen gehörend<br />
und nicht staatlich ist. Erste Privatheit wurde ab dem 16. Jahrhundert nicht über<br />
Räume, sondern über Gegenstände manifestiert. Das Schreiben von Briefen oder<br />
das Sammeln von Souvenirs als Andenken an geliebte Personen schufen einen<br />
virtuellen privaten Raum, dem Kästchen, Truhen und Schränke folgten, die in der<br />
Renaissance etwa ganze Häuser im Haus formierten. Über Gegenstände und Gewohnheiten<br />
wurde das formiert, was wir seit jeher unter Privatheit verstehen. Das<br />
universelle Modell des Konzeptes Privatheit bleibt trotz aller Stilwandel, Moden<br />
und Umwälzungen und trotz aller kulturellen Unterschiede und Merkmale unglaublich<br />
bestän dig.<br />
Die Sondermodelle des Peter Fritz: Idente<br />
Abfolgen von öffentlich, repräsentativ, privat<br />
bis intim. Eingang, Wohnzimmer, Esszimmer,<br />
Küche, Bad, Schafzimmer.
Die meisten Wohnkonzepte wenden bis heute das selbe Modell konventioneller<br />
Privatheit an, wie es seit Jahrhunderten durch Architektur verwirklicht wird. Bis<br />
heute wird eine Serie unterschiedlicher Räume in einer graduellen Abstufung von<br />
öffentlich, repräsentativ, familiär, privat bis intim aneinander und übereinander gereiht,<br />
wie es der allgemein anerkannten und geforderten Vorstellung von Privatheit<br />
entspricht.<br />
In nahezu allen privaten Häusern liegen die formal-repräsentativen Räume wie<br />
Wohnzimmer und Esszimmer nahe dem Eingang, wo auch die Küche liegt, um<br />
Familie und Fremde schnell zu versorgen, und die intimen Individualräume wie<br />
Schlafzimmer, die Räume für körperliche Reinigung, Regeneration und Sexualität<br />
liegen in dem von der Öffentlichkeit am weitesten entfernten Teil der Privatheit, um<br />
das repräsentative Bild des Privaten nicht mit der Emotion und der Sinnlichkeit von<br />
intimen Vorgängen zu kontaminieren.<br />
In der Projektierung und Realisierung des Privaten reproduziert Architektur bis<br />
heute im Normalfall jenes traditionelle, konventionelle und gängige Bild von<br />
Privatheit, das sich (zumindest) seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis auf modische<br />
oder stilistische Eigenheiten kaum verändert hat. Sie realisiert die rigorose<br />
Abgrenzung all dessen, was außerhalb des Privaten liegt, das Ausschließen von<br />
allem Fremden aus diesem Privaten, eine ebenso rigorose Aufteilung des Privaten<br />
in intim, privat und repräsentativ sowie die Wahrung des intakten „öffentlichen“<br />
Bildes der Privatheit in den gängigen Emblemen wie Blumenfenster oder „Picture<br />
window“, Fußabstreifer, Rasen, Vorhänge, Gartenzwerge, Briefkasten, Jalousien,<br />
Garage, Haustiere, Namensschilder, Adressen etc. Privatheit wird bei aller Relativität<br />
dennoch mit einem universellen Wert verbunden. Seit den Anfängen bürgerlichen<br />
Wohnens im 16. und 17. Jahrhundert westlicher Kultur besteht ein von<br />
kulturellen und zeitlichen Merkmalen nahezu unabhängiger und gleichbleibender<br />
Wunsch nach der Verwirklichung von Privatheit: es steht als Synonym für Individualität,<br />
Subjektivierung und Repräsentation. Realisiert durch Ausgrenzung und<br />
Abgrenzung von dem, was augenblicklich zu einem „Anderen“ wird, sobald es vom<br />
„Eigenen“ ausgeschlossen wird. Diese Formierung eines „Anderen“ ist ein ebenso<br />
relatives Konzept, das sich jedoch ebenso standhaft behauptet wie das, was<br />
eingeschlossen ist. Es ist immer das Andere, das definiert werden muss, um das<br />
Eigene behaupten zu können. In der Formierung dieses Anderen findet sich auch<br />
das, was alle Konzepte des Privaten trotz aller Relativität strategisch verbindet.<br />
„Gesellschaften werden immer ein konstitutives Anderes brauchen, das der eigentliche<br />
Grund ihres Zusammenhaltes ist.“, schreibt etwa Georg Schöllhammer 1998.<br />
„Es ist dieses Außen, das ihnen die Existenz versichert, das ständig neu evaluiert<br />
wird.“<br />
Der Beginn von Privatheit: Das Schreiben von<br />
Briefen, Sammeln von Souvenirs<br />
Die Embleme des Privaten: Blumenfenster,<br />
Kamin, Sitzgarnitur<br />
Das Private bei Walter Benjamin<br />
Zurück zum prototypischen Privaten des 19. Jahrhunderts. „...Ein Stimulans des<br />
Rausches und des Traums...“ - mit einem durch Haschischrauchen verursachten<br />
Zustand vergleicht Walter Benjamin im Passagenwerk diesen „innersten<br />
Kern bürgerlicher Gemütlichkeit“, das Interieur des privaten Wohnens des 19.<br />
Jahrhunderts. „In ihnen leben“, schreibt er weiter, „war ein dichtes sich eingewebt,<br />
sich eingesponnen haben in ein Spinnennetz, in dem das Weltgeschehen<br />
verstreut, wie ausgesogene Insektenleiber herumhängt.“ - ein verstricktes und<br />
versponnenes, mit „ausschweifender Tapezierkunst“ verkleidetes Inneres, eine<br />
Höhle, in die das Äußere des öffentlichen Geschehens nur soweit zugelassen<br />
wurde, als es kokonhaft und bedeutungslos wie Rauch im Raum hängt, ohne<br />
diesen wirklich zu besetzen. Dieses Interieur des ausgehenden 19. Jahrhunderts,<br />
bestehend aus unzähligen Teilen eines Mobiliars, verkleidet in Stilen aller<br />
vergangenen Epochen, abgeschlossen, verhüllt und angefüllt steht bis heute<br />
prototypisch für das Konzept des Privaten schlechthin. In einer Zeit, als sich<br />
Großstädte zu formieren begannen und große öffentliche Bauten diese besetzten,<br />
wurde der Rückzug in das Private wichtiger denn je, man füllte es mit umso mehr<br />
Schichten und Gegenständen, um die Grenze zwischen innen und außen zu<br />
verdichten, zwischen der Wohnung und dem öffentlichen Raum wurden (je nach<br />
Wohlstand) ganze Abfolgen von Entrees, Vorräumen, Fluren und Comptoirs, um<br />
die Berührung zwischen innen und außen hinauszuzögern.<br />
Ulrich Seidl, Hundstage, 2001. Ganz normale<br />
Privatheit.
Der Begriff des Privaten ist nicht nur mit einem universellen Wert verbunden,<br />
„Privatleben“, „Privatsphäre“ und die Abgrenzung eines „private home“ von der<br />
Kontrolle der Öffentlichkeit stehen auch für ein universelles Modell westlicher<br />
Kultur, das zugleich für ein universelles und kollektives Begehren steht, dem<br />
Begehren nach Einzigartigkeit innerhalb einer Masse an Gleichförmigkeit und dem<br />
kollektiven Begehren nach dem Besitz dessen, was von niemandem genommen<br />
werden kann: die eigenen vier Wände. Dieses universelle Modell geht von einem<br />
Paradigma aus, das die Grundlage jedes architektonischen Konzeptes seit der<br />
Antike bestimmt, dem Paradigma eines geteilten Raumes. Es teilt des Raum in<br />
einen hierarchisch höher gestellten Raum des öffentlichen Lebens und in einen<br />
zweitrangigen Raum des privaten Wohnens, in einen Raum der Arbeit und der<br />
Erholung, in einen Raum der Produktivität und der Reproduktivität, in ein Innen<br />
und ein Außen, in Kultur und Natur. In allen Konzepten der Architektur wird von<br />
vornherein von der Existenz zweier solcher Raumhälften ausgegangen, in denen<br />
sich die eine Hälfte des Raumes ständig von der anderen Hälfte abgrenzen<br />
muss. Architektur übersetzt diesen geteilten Raum durch gezielte Strategien<br />
einer Aus- und Abgrenzung in prototypische Konzepte des privaten Wohnens: in<br />
dicke Mauern oder zumindest solche, die Dicke vortäuschen, um das Außen vom<br />
Innen fern zu halten, in Zäune, die das Private gegen das Öffentliche abgrenzen,<br />
und in variable, schließbare und limitiert gewählte Öffnungen, die nur bestimmte<br />
Informationen von außen in das Innere einfließen lassen und diese über Schichten<br />
so lange filtern, bis sie reibungslos in das Private übergehen können.<br />
Das Interieur des 19. Jahrhunderts: Schichten,<br />
um sich im Inneren vom Äußeren abzugrenzen<br />
Öffentlichkeit versus Privatheit: Grenzen und Abgrenzung<br />
Tatsächlich war das, was wir heute als typisch privat verstehen wie etwa Darstellungen<br />
holländischer Interieurs aus dem 17. Jahrhundert oder Stadtvillen aus<br />
dem 19. Jahrhundert immer schon von Öffentlichkeit durchsetzt und auch Medien<br />
waren im Privaten immer schon vertreten. In Bildern des niederländischen Malers<br />
Jan Vermeer etwa aus dem frühen 17. Jahrhundert sind die in der privaten Häuslichkeit<br />
abgebildeten Personen fast ausschließlich am Fenster, also an der Schnittstelle<br />
zwischen dem Wohnen und der Straße dargestellt. Immer fällt Licht durch<br />
dieses Fenster in das Innere, oft ist das Fenster geöffnet und die Personen richten<br />
den Blick offen und direkt nach außen. In vielen Darstellungen zeugen zudem<br />
Applikationen an den Wänden von einer zusätzlichen Verbindung mit dem Außen.<br />
Landkarten, die im Hintergrund anstelle von Bildmotiven als Wandschmuck in den<br />
Privathäusern zu sehen sind, erzählen von dem offenen, also der Öffentlichkeit<br />
zugewandten Geist der BewohnerInnen, sie bilden ein zusätzliches Fenster, das<br />
Ausblicke in andere Welten erlaubt und sind Vorläufiger heutiger Bildschirme. So<br />
antizipiert eine solche Karte etwa in dem 1657 fertig gestellten Bild „Lachendes<br />
Mädchen und Beamter“ neben dem tatsächlichen Fenster eine weitere Öffnung im<br />
Privaten, wie es heute Computer in nahezu allen privaten Interieurs darstellen.<br />
Öffentlichkeit am Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
als Gegensatz zum Privaten<br />
Auf Karte wie auch auf Bildschirm richtet man den Blick, wenn man mittels Bilder<br />
abschweifen will, ohne wirkliche Objekte betrachten zu müssen, aus dem Fenster<br />
sieht man, wenn man das konkrete Außen sehen will. Auch die junge Frau, die in<br />
dem 1664 gemalten Bild einen Wasserkrug in der Hand hält, ist einerseits gerade<br />
im Begriff, das Fenster zu öffnen und steht andrerseits vor dem „Fenster“ einer<br />
Landkarte, die in diesem Bild deutlich im Hintergrund zu erkennen ist. 1672 bildet<br />
Vermeer eine junge Frau mit ihrer Magd am Schreibtisch sitzend wiederum vor<br />
dem Fenster ab. Beide Frauen kommunizieren mit der Außenwelt. Während die<br />
Magd neugierig aus dem Fenster blickt, schreibt die Frau einen Brief, über den sie<br />
mit der Außenwelt in Kontakt tritt. Fenster, Landkarte und Briefe dienen vor allem<br />
den Frauen des 17. Jahrhundert zu einer komplexen Kommunikationsform mit<br />
einem Außen und einer Öffentlichkeit, die von den männlichen Stadtbewohnern<br />
beherrscht wurde, von der sie jedoch nicht zur Gänze ausgeschlossen schienen.<br />
Auch das 200 Jahre zuvor entstandene, berühmte Porträt von Giovanni Arnolfini<br />
und seiner Frau, das Jan van Eyck 1434 malte, zeigt im Hintergrund des Bildes<br />
eine Öffnung, die neben dem herkömmlichen Fenster eine Verbindung zum Außenraum<br />
sowie zum reflektierten Innenraum zugleich erzeugt. In diesem Spiegel,<br />
der im Zentrum des Bildes liegt, wird auch der Blick, den man auf das Bild wirft,<br />
fokussiert.<br />
Case Study Häuser: Unkonventionelle Materialien,<br />
konventionelle Privatheit
Betrachtet man den Spiegel genauer, so sieht man die Reflexion von zwei Figuren<br />
im Spiegel, die soeben aus dem Öffentlichen in das Private eintreten, indem sie<br />
die Schwelle des Zimmers überschreiten. Die Figuren erklären sich als der Maler<br />
und sein Gehilfe, die sich hier im Spiegel des selbst gemalten Bildes präsentieren.<br />
Zudem werden in dem Spiegel nicht nur der Boden und die Decke des Zimmers<br />
reflektiert, sondern auch der Himmel und der Garten, der so durch das geöffnete<br />
Fenster in das Innere wörtlich hineingeholt wird. Es scheint also beinahe, als würde<br />
der Spiegel nicht reflektieren, sondern mehr wie ein Loch in der Wand wirken,<br />
durch das man in das Innere und das Äußere dieses Raumes zugleich schauen<br />
kann.<br />
Grenzen zwischen privat und öffentlich, die Variabilität von Schnittstellen<br />
Auch war das Private nicht immer eindeutig zum Öffentlichen abgegrenzt und<br />
Schnittstellen verliefen nicht immer entlang materieller Begrenzungen, sondern an<br />
gesellschaftlich konstruierten Trennlinien. So hat sich innerhalb der Geschichte der<br />
Architektur die Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen selten an der<br />
Hausaußenseite und der äußersten Schicht der Wand, also der äußersten Kante<br />
des Außenputzes befunden, sondern war oft entweder weit im Inneren des Hauses<br />
selbst zu suchen, oder aber war ausgelagert und lag weit vor dem Gebäude selbst.<br />
Im Haus des 19. Jahrhunderts etwa verlief die Grenze zwischen dem Privaten und<br />
dem Öffentlichen nicht an der Hausaußenkante, sondern entlang einer fiktiven<br />
und doch genau definierten Linie zwischen Entrée, Zimmer des Herrn und Salon,<br />
schloss all diese Räume als weitgehend öffentlich noch in sich ein und endete<br />
mit dem Zimmer der Dame, dessen Charakter beinahe zur Gänze dem Privaten<br />
zugeschrieben wurde.<br />
Im Gegensatz dazu verläuft in Amerikanischen Häusern etwa bis heute<br />
die Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen nicht an der<br />
Hausaußenkante, die ja auch viel weniger als bei uns Massivität ausstrahlt,<br />
sondern an einer zwar kaum markierten und dennoch von allen akzeptierten Linie<br />
zwischen privater Rasenfläche und Straße, eine Linie, die nicht wie in Europa mit<br />
dichten Hecken bepflanzt ist, sondern meist frei und einsehbar bleibt und durch<br />
elektronische Überwachungen oder Signale wie „Strictly Private“ Unbefugte vor<br />
einem Überschreiten der Grenze bewahrt. In einer Arbeit über den „American<br />
Lawn“ verweisen Elizabeth Diller & Ricardo Scofidio auf die Fiktionalität der<br />
„Hausgrenze“ und Brutalität der Grenzen von „private Properties“, mittels der<br />
sich ein Grundstück vom nächsten abzugrenzen versucht, ohne diese Grenze<br />
tatsächlich materiell zu konstruieren. Sie zeigt sich vielmehr durch graduelle<br />
Unterschiede in der Länge der Grashalme des Rasens, in der Art, wie der Rasen<br />
gemäht ist oder in der Farbe des Rasens, kreiert durch künstliche Düngung. Um<br />
das verborgene Regelwerk an Gesetzen, die die Wahrung der Eigentumsgrenzen<br />
sichern, zu zeigen, die, obwohl nicht sichtbar, jede Überschreitung dieses<br />
Eigentums aufs Schärfste bestrafen, montieren Diller & Scofidio als illustrierende<br />
Texte die in diesen Distrikten aufgenommenen Delikte, in denen Eigentumsrechte<br />
überschritten wurden.<br />
Auch wenn in nahezu allen westlichen Kulturen dem Wunsch nach Privatheit<br />
Genüge getan wird, so ist die Grenze zwischen privat und öffentlich und der Grad<br />
an Öffentlichkeit, der innerhalb des Privaten zugelassen wird, kulturell unterschiedlich.<br />
Während es etwa in ländlichen Regionen durchaus üblich ist, dass Fremde<br />
oft ohne Vorbehalte zumindest bis in die Küche von privaten Häusern gehen,<br />
führt man im städtischen Umfeld eine ganze Reihe von Schichten ein, die zwischen<br />
dem öffentlichen Raum und dem privaten Raum geschoben werden, um<br />
tatsächlichen Kontakt zwischen Fremden und dem Privaten so weit wie möglich<br />
hinauszuzögern. Dafür gibt es im Urbanen weitaus weniger Schranken betreffend<br />
Einsehbarkeit in Privaträume. In den Niederlanden beispielsweise besteht<br />
eine lange Tradition an einsehbaren Privaträumen, die sich durch die Geschichte<br />
der Handelshäuser sowie durch die geringe Fläche zur Belichtung der schmalen<br />
Grundstücke ergibt. Bis heute sieht man oft nicht nur in die großen, raumbreit und<br />
raumhoch verglasten Wohnräume niederländischer Wohnhäuser hinein, die oft<br />
unvermittelt an einen öffentlichen Weg oder an die Kanäle anschließen, man sieht<br />
oft tatsächlich durch diese Häuser hindurch.<br />
Spiegel und Reflexionen: das Äußere wird<br />
in das Innere geholt (Vermeer).<br />
Landkarten im Interieur bei Vermeer<br />
Diller & Scofidio, American Lawn
Privates und Geschlecht<br />
Die Unterscheidung in zwei Raumhälften schließt auch die Unterscheidung in<br />
einen männlichen und einen weiblichen Raum mit ein. Sobald Architektur das gängige<br />
Modell des geteilten Raumes verwirklicht, das den Raum in einen öffentlichen<br />
und einen privaten, einen geordneten und einen ungeordneten, einen produktiven<br />
und einen reproduktiven Raum differenziert, produziert und reproduziert Architektur<br />
auch die gängigen Modelle von Geschlechterverhältnissen, produziert und reproduziert<br />
Architektur also auch die gängigen Vorstellungen von Differenz, von Rollen,<br />
von Zuweisungen und geschlechtlicher Identität: Architektur produziert also mit der<br />
Konzeption und Konstruktion privaten Wohnens Geschlecht und Geschlechterdifferenzen.<br />
Nur selten ist in das Konzept des privaten Wohnens eine Kritik an den<br />
gängigen Modellen inkludiert, im Gegenteil, meistens verstärken und formieren<br />
architektonische Konzepte die gängigen Modelle und damit auch die gängigen<br />
Wertvorstellungen und Machtstrukturen.<br />
Gerade privates Wohnen und Privatraum beschreiben jenen Topos der Architektur,<br />
der seit jeher mit bestimmten geschlechtlichen Zuweisungen in Verbindung<br />
gebracht wird. Das Innen, das Innere und das Umschlossene des Wohnens sowie<br />
die Ausgestaltung und Dekoration dieser inneren Oberfläche der privaten Wohnung<br />
wurde immer schon mit dem Weiblichen verbunden, während die Konstruktion<br />
und die Struktur des Raumes, also die öffentliche Sichtbarkeit und Präsenz mit<br />
dem Männlichen verbunden wurde. Die Trennung des Öffentlichen vom Privaten<br />
waren also seit jeher mit traditionellen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen<br />
verbunden, die die Frau in das Innere, in die Reproduktionsarbeit und im Privaten,<br />
den Mann hingegen in das Außen, die Öffentlichkeit und in die produktive<br />
Arbeit positionieren. Umgekehrt kann man von der Annahme ausgehen, dass der<br />
Raum des privaten Wohnens niemals neutral und die Praktik des privaten Wohnens<br />
niemals neutrale Praktik sein kann. Im Gegenteil, schon in die Vorstellung<br />
von Wohnen, also schon in die Idee, in das Konzept, in die Erinnerung und in die<br />
Projektion von Wohnen sind alle Vorstellungen einer Geschlechterdifferenz bereits<br />
fest eingeschrieben.<br />
Martha Rosler, Bringing War Home<br />
„House Beautiful“. Kritik am Vietnamkrieg,<br />
Kritik an Geschlechterrollen, Kritik an der<br />
Werbestrategie der USA<br />
Haus, Home, Suburbia<br />
Das Haus als Inbegriff des Wohnens schlechthin vermag sich mehr als jede<br />
andere Wohnform erfolgreich gegen das Außen abzuschotten. Je unruhiger die<br />
Außenwelt, desto mehr müssen das Bild des Häuslichen gewahrt und das Fremde<br />
ausgeblendet werden. Die Fotocollagen der amerikanischen Künstlerin Martha<br />
Rosler aus der Serie „Bringing War Home“ aus den 1960er Jahren verweisen<br />
auf die Ausblendung des Vietnamkriegs im privaten Wohnen in den USA, auf die<br />
Formierung eines heimeligen „Homes“ einerseits und auf die Ignoranz gegenüber<br />
der Außenwelt andererseits. In die Aufnahmen von aus einem Hochglanzmagazin<br />
stammenden Interieurs mischen sich Abwehrraketen, der Ausblick aus dem<br />
dekorierten Fenster zeigt ein Schlachtfeld und vor dem neuen Bungalow sitzt ein<br />
Soldat in Wartestellung.<br />
Die Vorstadt bei Crewdson: Unheimlich,<br />
heimelig, heimlich und unheilvoll zugleich (Vgl.<br />
Antony Vidler, The Un(s)canny in Architecture.<br />
Die Aufnahmen spielen mit den Mitteln der Massenmedien, jener der Modeund<br />
Heimdekorfotografie und jener der Affekt-heischenden Fotografie von<br />
Kriegsdokumentation. Die Intention der Montage war nicht, sie in Museen<br />
als Kunst auszustellen, sondern vielmehr, sie in Form von Kopien bei<br />
Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg in New York und Kalifornien zu<br />
verteilen. Mehr als dreißig Jahre später wiederholte Rosler den Vorgang in<br />
neuerlichen Montagen, die nun Bilder aus dem Irakkrieg in alltägliche Szenen<br />
brachten. Die Wiederholung sollte auch aufzeigen, dass sich nach so vielen Jahren<br />
die Bilder, die Idealvorstellungen sowie auch die Vorgangsweise im Kriegführen<br />
kaum änderten. In einem Interview spricht Martha Rosler über ihr Erstaunen<br />
darüber, wie auf einer Seite von Magazinen Bilder aus Kriegsgeschehen gezeigt<br />
wurden und auf der nächsten Seite ein wunderschönes Haus oder Interieur. Die<br />
USA versuchte damit, so Rosler, zu zeigen, dass die Vorgangsweise in Vietnam<br />
richtig sei, indem sie die Bilder vom Krieg mit jenen von zu Hause gleichstellte.<br />
Gregory Crewdson, Setting Suburbia. Inszenierte<br />
Typisierung
Einen weniger direkten Eindruck vermitteln wiederum die Fotografien des amerikanischen<br />
Künstlers Gregory Crewdson. Die gestellten und präzise choreographierten<br />
Szenen aus der Serie „Setting Suburbia“ zeigen in konstruierten Bildgeschichten<br />
das unheilvolle Ambiente scheinbar heiler Vorstadtwelten. Dem pastellfarbenen<br />
Ambiente einer Vorstadtsiedlung mischt sich eine unheimliche Leere hinzu, das<br />
geöffnete Auto und die Figur davor in einer nächtlichen Vorstadtstraße vermitteln<br />
den Anschein eines soeben geschehenen Verbrechens, das beleuchtete Haus<br />
vermittelt Unbehagen. Vorstadt, Haus, Garten und die Siedlung inkludieren von<br />
sich aus beides, das Behagliche und das Unheimliche, das Offenherzige und das<br />
Verborgene zugleich. Die Vorstadtwelt wird in den Aufnahmen zu einem Filmset. In<br />
den aufwendig und oft über Monate hindurch produzierten Aufnahmen werden wenige<br />
Menschen gezeigt, die jedoch meist in einem komplexen Beziehungsrahmen<br />
zwischen der abgebildeten Natur, der Architektur und verschiedenen Utensilien<br />
stehen. Oft sind dies Personen aus der tatsächlichen Nachbarschaft, was den Grat<br />
zwischen Fiktion und Realität noch einmal schmäler macht.<br />
Dan Graham, Alteration to a suburban House<br />
1978. Fassade/Glas, Rückwand/Spiegel.<br />
Öffentliches Privates, Privates Privates.<br />
Interieur als Shopwindow, Reflexion der anderen<br />
Häuser, Zäune, Gärten, Reflexion der<br />
Beobachtenden<br />
Der Amerikanische Künstler Dan Graham drückte in seiner Arbeit „Alteration to a<br />
suburbian Home“ die Absurdität von Rückzug und Repräsentation im Privaten zugleich<br />
aus. Von einem konventionellen Vorstadthaus wird die Vorderwand entfernt<br />
und durch Glas ersetzt, die Mittelwand wird mit einem Spiegel verkleidet und Besuchende<br />
sehen sich selbst reflektiert im fremden Privaten.<br />
Vielleicht lässt sich Privatheit auch eher über solche geheimen, verborgenen<br />
oder gewünschten Sehnsüchte beschreiben. 1985 verwendeten die Schweizer<br />
Architekten Jacques Herzog und Pierre De Meuron die Erinnerung an<br />
geheime Wünsche zur Darstellung eines Hauses. Für den von der Firma Lego<br />
ausgeschriebenen Wettbewerb zeigen sie kein neues Haus, sondern eine<br />
Rekonstruktion des Mansardenzimmers ihrer Jugend oder dessen, was dies in<br />
ihrer Erinnerung hätte sein können. In einem Pexiglasmodell eines prototypischen<br />
Hauses wird lediglich die Mansarde in Lego gebaut, von Herzog & De Meuron<br />
eingerichtet und über einen Videofilm beschrieben. In einem Filmstill erzählen die<br />
Architekten von der Essenz des privaten Wohnens der Kindheit schlechthin, es ist<br />
der kurze, unerlaubte Blick durch den offenen Türspalt in das Zimmer der großen<br />
Schwester, die eben im Begriff ist, sich zu entkleiden. Das Videobild, so erklären<br />
die Architekten in „Naturgeschichte“ , helfe ihnen, die von ihnen konstruierten und<br />
gebauten Räume „aufzubrechen“.<br />
We show a view into and from one specific room: images of a child’s room; images<br />
„connected with our youth, our memories of fantasies we had during the day and at<br />
night; and images of fear, sleep and eroticism.“<br />
Herzog & De Meuron, Legohaus. Analog zur<br />
Phänomenologie Gaston Bachelards: Die<br />
Dachbodentreppe, die man immer nur hinauf<br />
geht (im Traum), die Kellertreppe, die man<br />
immer nur hinabsteigt.<br />
Die Brüchigkeit der heilen Welt des Vorstadtwohnens bildet auch die Oberfläche<br />
des Films „Blue Velvet“, den der amerikanische Regisseur David Lynch 1986 drehte.<br />
Die ersten Einstellungen vermitteln die diese heile Welt in Cinemascope: Gelbe<br />
Tulpen und rote Rosen in Großaufnahme vor einem weiß lackierten Zaun und<br />
strahlend blauem Himmel als Hintergrund. Blue Velvet beginnt mit Bildern, die einer<br />
künstlich kolorierten Postkarte gleichen: Farben, die leuchtender, ein Licht, das<br />
strahlender und ein Bild, das echter sind als die Realität selbst. Der Film verbreitet<br />
anfangs die optimistische Stimmung jener frohen Gleichförmigkeit, die Familie und<br />
Haus, Haus und Garten, Garten und Gartenzaun immer versprechen, amerikanischer<br />
Traum der suburbanen Idylle.<br />
Die erste Szene zeigt den alten Mr. Beaumont, der soeben seinen Rasen spritzt,<br />
aus einem vorbeifahrenden Auto winkt freundlich ein Feuerwehrmann und Kinder<br />
werden fürsorglich über die Straße geführt. Die Szene ändert sich, angekündigt<br />
durch den losgelösten Schlauch und umherspritzendes Wasser, der Mann fällt zu<br />
Boden. Danach hört man ein eigentümliches Geräusch, dem die Kamera zu folgen<br />
scheint, sie zoomt in die Wiese, scheint i die Erde einzudringen und zeigt zwei<br />
Käfer, die miteinander kämpfen. Das Eintauchen unter die Oberfläche steht für<br />
eine dunkle Seite, die sich hinter der Kleinstadtidylle auftut, es folgen Gewalt und<br />
Verbrechen.<br />
David Lynch, Blue Velvet. Die scheinbar heile<br />
Welt an der Oberfläche.
Die bürgerliche Wohnung um 1900<br />
Bürgerliches Wohnen des späten 19. Jahrhunderts verkörperte die gesellschaftliche<br />
Regel der strikten Geschlechtertrennung. Selbst in bürgerlichen Mietwohnungen<br />
wurde trotz relativ geringem Raumangebot zwischen repräsentativen und<br />
bedienenden Räumen sowie zwischen Salon, Wohnzimmer, Esszimmer, Herrenzimmer<br />
und Damenzimmer unterschieden. Die Wohnungen und Häuser praktizierten<br />
die Geschlechtertrennung und verkörperten das Geschlecht: Privater Raum,<br />
Intimität und Geschlecht waren untrennbar miteinander verbunden.<br />
Das Zimmer des Herrn<br />
Ein „unentbehrliches Zimmer“, so nennt Herman Muthesius 1917 trotz allgemeinem<br />
Kleinerwerden der Wohnungen das Zimmer des Herrn. Diese Unentbehrlichkeit<br />
entspricht der bedeutsamen Stellung, die der Mann auch am Beginn des 20.<br />
Jahrhunderts aufrechterhalten muss. Auch wenn es längst nicht mehr als einzige<br />
Arbeitsstätte diente, so war es nun, da die Arbeit in den nervenaufreibenden Städten<br />
außerhalb der Wohnungen erledigt wurde, als Stätte der Erholung wichtiger<br />
denn je. Das Zimmer des Herrn sollte deshalb auch dem Hausherrn ermöglichen,<br />
„Ruhe zu pflegen”. Meist lag es in bürgerlichen Wohnungen und Häusern des<br />
späten 19. Jahrhunderts möglichst nahe dem Eingang und möglichst weit vom<br />
familiären Leben entfernt. Oft wurde es direkt von dem geräumigen Vorraum oder<br />
Vorzimmer erschlossen, da es auch die Funktion des Büros und privaten Arbeitszimmers<br />
übernahm und Konsultierende nicht in den privaten Teil der Wohnungen<br />
gelangen sollten.<br />
Das Zimmer des Herrn hatte vielerlei Funktionen zu erfüllen: Es diente der Erholung<br />
nach der produktiven Arbeit außerhalb des Hauses, dem Genuss von<br />
Rauch- und Rauschmitteln, dem Betrachten intimer Sammlungen, der privaten<br />
Korrespondenz und Buchhaltung oder, vor allem, wenn die Tätigkeit des Hausherrn<br />
künstlerischer Natur war, als Werkstätte. Wenn das Zimmer des Herrn nicht<br />
vorrangig als Arbeitszimmer und Büro diente, wofür es helles Licht verlangte, wurde<br />
eine eher indirekte, mit transluzenten Oberlichtgläsern erzeugte Beleuchtung<br />
empfohlen, die der naturwissenschaftlichen oder philosophischen Betätigung des<br />
Mannes als förderlich galt. Alle Praktiken, für die das Zimmer des Herrn eigene<br />
Vorrichtungen erhielt, wie das Lesen ernsthafter Literatur, das Spielen, der Genuss<br />
von Rauchwaren und Alkoholika sowie das Sammeln von Büchern, Jagdwerkzeugen,<br />
Antiken und Kunst waren bis am Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu<br />
ausschließlich männliche Praktiken des Privaten.<br />
Das wichtigste Möbel im Zimmer des Herrn war der von Hermann Muthesius als<br />
„Brennpunkt des Zimmers“ bezeichnete Schreibtisch, der unabhängig von der<br />
beruflichen Tätigkeit des Herrn immer einen entsprechenden Platz im Raum erhielt.<br />
Er musste so positioniert sein, dass vom Schreibtisch aus alle in das Zimmer<br />
Eintretenden gut sichtbar waren, stand oft gleich einem Monument auf einer Stufe<br />
oder auf einem Podest und musste eine ausgewählte Belichtung von linker Seite<br />
erhalten, um ein bequemes Arbeiten am Tisch zu ermöglichen. Um die Jahrhundertwende<br />
war der „Diplomatentisch“ besonders beliebt, eine mit Leder bespannte,<br />
ein Meter breite und bis zu zwei Meter lange Platte mit Schubladenkästen an beiden<br />
Seiten zur Abstützung. Der Tisch wies keine Rückwand auf und konnte daher<br />
frei in den Raum gestellt werden, so dass der am Schreibtisch sitzende Hausherr<br />
den gesamten Raum frei überblicken konnte. Der frei im Raum aufgestellte<br />
Schreibtisch ermöglichte dem Mann jedoch vor allem auch Kontrolle über die<br />
Personen, die in das Zimmer eintreten wollten. Die Wände des Zimmers des Herrn<br />
mussten alle Vorkehrungen zur Aufbewahrung und zum Verbergen jener Objekte<br />
beinhalten, die auch dem Herrn des Hauses zugeordnet waren. In besonderen<br />
Regalen und Wandschränken mit ausgewählten Fächern, Laden und Auszügen<br />
mussten die zahlreichen Bücher, Folianten, Atlanten, Mappen und Zeitschriften<br />
untergebracht und aufgelegt werden können.<br />
ArbeiterInnenküche ohne direktes Tageslicht.<br />
Getrennte Räume nach Geschlechtern sind<br />
im ArbeiterInnwohnen kein Thema, sehr wohl<br />
jedoch unterschiedliche Rollen im Privaten.<br />
Zimmer des Herrn: Schreibtisch als Brennpunkt<br />
Zimmer des Herrn: Wissenschaftlich-künstlerische<br />
Tätigkeiten
Das Zimmer der Dame<br />
Das Zimmer der Dame musste in seiner Anordnung und in seiner Ausstattung zur<br />
Gänze anderen Anforderungen entsprechen. Es lag niemals wie das Zimmer des<br />
Herrn nahe dem Eingang und war nur im seltensten Falle direkt vom Vorraum<br />
aus zugänglich. Meistens war es im entgegengesetzten Teil der Wohnung oder<br />
des Hauses positioniert: Es lag oft im Anschluss an den Salon und war meist von<br />
einem intimen, schmalen Flur, der auch die Schlafräume erschloss, zugänglich.<br />
Wenn das Zimmer der Dame nicht ausdrücklich als Empfangsraum auch gesellschaftlichen<br />
Zwecken bestimmt war, diente es vor allem der Erholung der Frau.<br />
In jedem kleinsten Detail sollten die idealen weiblichen Eigenschaften verkörpert<br />
werden. Anordnung, Ausstattung und Stimmung des Zimmers der Dame orientierten<br />
sich nicht an aktiven Tätigkeiten, sondern an jener Eigenschaft, die mit dem<br />
Idealbild des Weiblichen verbunden wurde: Passivität.<br />
Das Zimmer der Dame war eine „Stätte der Ruhe“ und „ein Ort der Sammlung<br />
und des Alleinseins“ und enthielt fast ausschließlich Möbel, um zu ruhen, sich<br />
auszurasten und um sich hinzulegen. 1911 beinhaltete das typische Zimmer der<br />
Dame bis auf ein „Schreibtischchen“, das nicht größer als ein Blumenstock war,<br />
vor allem unterschiedliche Möbel, auf denen sich die Frau entweder halb oder zur<br />
Gänze hinlegen sollte: Sofa, Kanapee, Chaiselongue, Bett und Fauteuil. Weißer<br />
Stoff verhängte die Einrichtung dieser Zimmer, wie er auch den Körper der Frauen<br />
verhüllte. Hinter zugezogenen weißen Vorhängen, unter dem Licht von mit weißen<br />
Spitzen verhängten Lampen und unter den Schichten von unzähligen weißen<br />
Decken und Polstern sollte ein Bild gewahrt werden, das mit jenem der jungfräulichen<br />
Braut überstimmen musste: gebleicht, blass und strahlend, wie die weiße<br />
und leicht errötende Haut der Frauen selbst. Alles war darauf vorbereitet, dass die<br />
wartende, jungfräuliche Braut erschöpft, müde, gelangweilt, untätig und vor allem<br />
liegend den Mann in ihrem Zimmer empfangen konnte.<br />
So empfiehlt die Wohnungs-Baukunde einen „Sitzplatz in Erkerform“, ein „Schreibtischchen“,<br />
einen „Blumentisch“ sowie „Sitzmöbel verschiedener Art“. Zudem wäre<br />
es wünschenswert, anschließend an das Zimmer der Dame ein sogenanntes<br />
„Boudoir“ anzuordnen, das „nur wenige Möbel, etwa ein Ruhebett, ein Schreibtischchen,<br />
ein Schränkchen und dergl. zu enthalten braucht, wie sie der engl.-japanische<br />
Stil in reizender Zierlichkeit geschaffen hat.“<br />
Zimmer für einen Jagdliebhaber<br />
Zimmer der Dame: Textilien, Ruhemöbel<br />
Das Boudoir<br />
1910 hat das in der Wohnungs-Baukunde erwähnte Boudoir alle Erotik lustvoller<br />
Ausschweifungen, die etwa dem Boudoir des 18. Jahrhunderts noch eigen war,<br />
verloren. Bis in die 1920er Jahre findet man dennoch immer wieder einen zusätzlichen,<br />
nun ausschließlich der Frau zugeordneten Raum, der das in hellem Licht<br />
strahlende Zimmer der Dame ergänzt, jedoch zur Gänze andere Eigenschaften<br />
erhält. Das Wort Boudoir wurde am Ende des 18. Jahrhunderts aus dem Französischen<br />
übernommen, das die Bezeichnung des Raumes von dem Wort „bouder“,<br />
was soviel wie schmollen bedeutete, ableitete. Aus dieser Übersetzung entstanden<br />
auch die ungenauen, deutschen Übersetzungen des Boudoirs als „Schmollwinkel“,<br />
„Launewinkel“ und „Schmollzimmerchen“. Im 19. Jahrhundert war das Boudoir<br />
ein kleiner Raum, in den sich Frauen zurück-ziehen konnten, wenn sie tatsächlich<br />
allein sein wollten.<br />
Das Boudoir war in keinem Fall ein Gesellschaftsraum. An das Boudoir wurden<br />
deshalb auch ganz andere Ansprüche als an das Zimmer der Dame gestellt, da<br />
es mehr Intimität aufweisen musste. Während das Zimmer der Dame dem weißen,<br />
hellen und strahlenden Idealbild der jungfräulichen Braut entsprechen sollte,<br />
schien das Boudoir sich eher den Zuständen der Unpässlichkeit und den Zeiten<br />
der Launenhaftigkeit, die Frauen aufgrund ihrer „angegriffenen Natur“ zugeschrieben<br />
wurden, anzupassen. Für das Boudoir empfohlen alle Handbücher und Baufibeln<br />
wenige Fenster und, wenn große Fenster vorhanden waren, so sollten diese<br />
vollkommen abgedunkelt werden können.<br />
Zimmer der Dame: abgerundete Möbel zum<br />
Ausruhen und Boudoir
Zumindest sollte jedes Boudoir eine Seite des nach Möglichkeit länglichen Zimmers<br />
erhalten, die dem Fenster so weit wie möglich entfernt liegen sollte, um einen<br />
„Halbschatten“ zu erzeugen, welcher durch ein „geschicktes Spiel von Vorhängen<br />
und spitzenbesetzten Stores“ erhöht werden sollte. So empfiehlt das Handbuch<br />
der Architektur als Dekoration und Wandschmuck des Boudoirs nur kleinformatige<br />
Bilder, keine „schwungvollen Skizzen“, keine „ersten Versuche“ sowie keine „breit<br />
behandelten Arbeiten, die ein zu eingehendes Studium verlangten, um gehörig<br />
gewürdigt zu werden“.<br />
Zimmer der Dame, vor allem jedoch Boudoir waren Vorkehrungen bzw. Mechanismen,<br />
die der angenommenen Physis und Psyche der Frau im 19. Jahrhundert<br />
entsprachen, insbesondere dem „Idealbild“ der hysterischen Frau. Die Gesellschaft<br />
reagierte auf die Hysterie gespalten: Einerseits antworteten die Angehörigen der<br />
Frauen sowie deren Hausärzte mit der Isolierung der Kranken. Die betroffenen<br />
Frauen wurden in die intime Sphäre des Privaten gedrängt. Andererseits wurden<br />
die emotionellen Ausbrüche der Frauen von der prüden Gesellschaft auch zunehmend<br />
mit gesteigertem Interesse verfolgt. Wissenschafter begannen, hysterische<br />
Frauen in öffentlich inszenierten Spektakeln zu demonstrieren.<br />
Adolf und Lina Loos: Sie blickt auf ihn, er<br />
sieht „in die Ferne“<br />
Hysterie als Denken eines grundlegenden „Andersseins“ von Frau<br />
Der Begriff der Hysterie stammt aus der griechischen Antike. Hystéra bedeutete<br />
„Gebärmutter, die Gebärmutter betreffend und von der Gebärmutter herkommend“.<br />
Man nahm an, dass die Hysterie auf einer Störfunktion der Gebärmutter beruhte,<br />
weshalb sie auch nur an Frauen diagnostiziert werden konnte.<br />
Sowohl in Altägypten, in der griechischen als auch in der römischen Antike vermuteten<br />
Ärzte, dass die Hysterie auf einen „Stau der Körpersäfte“ zurückzuführen sei.<br />
Dadurch beginne die Gebärmutter im Körper zu wandern und im Körperinneren<br />
„wie ein wildes Tier wütete“ zu wüten. So meinte etwa Platon, die Hysterie sei ein<br />
Tier, das glühend nach Kindern verlange. Die Hysterie wurde also mit der Unfruchtbarkeit<br />
von Frauen in Zusammenhang gebracht. Blieb eine Frau über einen<br />
längeren Zeitraum hindurch unfruchtbar, so würde ihre Gebärmutter den ganzen<br />
Körper durchziehen und ihre Atemwege verstopfen. Hysterische Frauen widersprachen<br />
den gewohnten Schemata und Regeln von Heirat und Gebären. Männer<br />
standen alleinstehenden, unverheirateten und kinderlosen Frauen immer skeptisch<br />
gegenüber. Das Bild einer nicht den Regeln entsprechenden Weiblichkeit führte im<br />
Mittelalter dazu, dass hysterische Frauen mit dem Teufel in Verbindung gebracht<br />
wurden. Hysterisch galt als „vom Teufel besessen“. Die Beweise dafür waren die<br />
unerklärlichen, dunklen Mächte, die von dem Körper der Frauen Besitz ergriffen<br />
und das vermeintlich gesteigerte sexuelle Begehren, das immer mit der Hysterie in<br />
Verbindung gebracht wurde.<br />
Das Schlafzimmer für meine Frau, Adolf Loos,<br />
<strong>Wien</strong> 2004, ein typisches Zimmer der Dame,<br />
eine Verkörperung der Frau.<br />
Über Jahrhunderte hinweg bestimmte die Hysterie das Bild der gesunden wie der<br />
kranken Frau. Für Männer verkörperten hysterische Frauen in ihrer Mischung aus<br />
Angst, Ohnmacht und Erregtheit zugleich ein Wunschbild als auch ein Schreckensbild.<br />
In der Zeit der anatomischen Untersuchungen des 18. Jahrhunderts führte<br />
die Verbindung zwischen der Hysterie und dem Geschlecht der Frauen vermehrt<br />
zu gynäkologischen Behandlungen an der Gebärmutter selbst. Der anatomische<br />
Körper der Aufklärung bestimmte auch den Umgang mit der Hysterie, die nun als<br />
eine physische Deformation der weiblichen Geschlechtsorgane diagnostiziert wurde,<br />
die auch physisch behandelt werden konnte. In der Folge wurden hysterische<br />
Patientinnen zunehmend durch operative Eingriffe an der Gebärmutter behandelt.<br />
Bis in das späte 19. Jahrhundert wurde die Hysterie als eine physisch verursachte<br />
Krankheit alleinig Frauen zugeschrieben.<br />
Die Patientinnen wurden ausschließlich physiotherapeutisch behandelt. Die Behandlung<br />
von Hysterikerinnen erfolgte zumeist durch Hydro- oder Elektrotherapien.<br />
Um die Verbreitung der Krankheit einzudämmen, wurde etwa bereits in der Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts die Installation hydrotherapeutischer Geräte in den Badezimmern<br />
privater Haushalte empfohlen.<br />
Zimmer der Dame: wie im Innersten eines<br />
Schneckenhauses. Adolf Loos, Villa Müller,<br />
Prag, 1930
Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann die Medizin, die Bedingung der Hysterie<br />
in einer Störung des zentralen Nervensystem zu suchen. Hysterie wurde zu<br />
einer „Nervenkrankheit“. Die Ursache war nun nicht mehr in einer Deformierung<br />
des weiblichen Körpers zu finden, sondern in einer ohnehin typischen, weiblichen<br />
Eigenschaft zu suchen, der Übersensibilität der Nerven.<br />
Die Salpêtrière galt im 19. Jahrhundert als größtes Hospiz Frankreichs, spezialisiert<br />
vor allem für die bahndlung der Hysterie. Die Anlage des Krankenhauses war<br />
weitläufig, unzählige Zellentrakte mit Höfen, im Zentrum eine große, kreuzförmige<br />
Kirche. In seinen Vorlesungen demonstrierte Charcot verkrümmte, verzückte, ohnmächtige<br />
und halb entblößte Frauen, die unter Schreien und Stöhnen die hysterische<br />
Ekstase vorbildlich zur Schau stellten. Das voyeuristische Interesse der Männer<br />
war groß. Die „Dienstagsvorlesungen“, die einem ausschließlich männlichen<br />
Publikum die Krankheit visuell vergegenwärtigen sollten, waren meist gut besucht.<br />
Mediziner, Literaten, Kunstsammler, Politiker, Maler, Bildhauer, Architekten wie<br />
etwa Charles Garnier und sogar Kardinäle bestaunten die Vorführungen hysterischer<br />
Patientinnen. Das Interesse der Männer an dem Phänomen der Hysterie war<br />
wissenschaftlicher und erotischer Natur.<br />
Die Dienstagsvorlesungen auf der Salpetriere<br />
Die Anfälle im Vorlesungssaal der Salpêtrière mussten, um sie zeitgerecht vorführen<br />
zu können, unterstützt und initiiert werden, sie mussten also von Charcot<br />
selbst herbeigeführt werden, um sie dem Publikum vorführen zu können. Die<br />
Techniken, mit denen die Frauen dazu gebracht wurden, die typischen Gesten,<br />
Bewegungen und Mimiken, Verkrampfungen und Verzerrungen auszuführen, waren<br />
vielfältig. Dazu zählten die Reizung durch Elektrisieren der Haut und Muskeln,<br />
Blenden durch grelles Licht und Magnesiumflammen, laute Schläge mit dem Gong,<br />
Reizen der Haut mit Stimmgabeln, Reizung mit schlechten Gerüchen, Inhalationen<br />
von Äther und vor allem die Hypnose. In Hypnose versetzt, führten hysterische<br />
Frauen wie durch ein Wunder alle erwünschten Kontraktionen und Anfälle vorbildlich<br />
auch vor einem großen Publikum vor.<br />
Sowohl die öffentlichen Darbietungen als auch die Aufzeichnungen der Kranken<br />
gehorchten nicht nur vollkommen den ästhetischen Ansprüchen, die Charcot an<br />
seine Studien gestellt hatte, sie gehorchten auch den voyeuristischen Ansprüchen<br />
des Publikums. Charcots vorbildlichste Hysterikerin, sein „Meisterwerk“ war<br />
die erst 15-jährige Augustine, deren Hysterie nach einer frühen Vergewaltigung<br />
aufgetreten war. Die in der Ikonografie abgebildeten Posen von Augustine tragen<br />
die Bezeichnungen „Erotisme“, „Supplication Amoreuse“, „Exstase“, „Moquerie“,<br />
„Appel“ und lesen sich wie die Beschreibung eines erotischen Bildbandes. Die verschiedenen<br />
für die Hysterie typischen Gesten und Verkrampfungen Augustines, die<br />
seltsam verkrümmten und erstarrten Gliedmaßen, das Zittern und das kreisförmige<br />
Biegen des Körpers wurden in Charcots Vorlesungen als ein perfekter Gestenkatalog<br />
des Krankheitssyndroms präsentiert. Wie zufällig öffnete sich wohl das weiße<br />
Hemd Augustines und bot den neugierigen Blicken der Männer ein Dekolltee, das<br />
freizügiger war, als es die Schicklichkeit je erlaubt hätte.<br />
Inszenierung und Aufzeichnung der Hysterie:<br />
Die Ikonografie<br />
Zimmer des Herrn, Beispiele<br />
Das „Junggesellenapartment“ verweist als eine moderne Referenz auf die ästhetisierende<br />
Form des Alleinewohnens von Männern, die sich in der abgeschiedenen<br />
Lage des Zimmer des Herrn der Jahrhundertwende ankündigt. Junggesellentum<br />
wurde in den 1950er Jahren erneut romantisiert und spielte etwa neben<br />
der Femme Fatale und dem Mädel vom Land die wichtigste Rolle im Film der<br />
Nachkriegszeit. Junggesellen widersetzten sich der Vorstellung einer glücklichen<br />
Kleinfamilie, sie verweigerten das Idealbild, das in den 1950er Jahren mit allen<br />
Wertvorstellungen einer Nachkriegszeit und allen Hoffnungen auf eine neue Zeit<br />
aufgeladen war.<br />
Die Amerikanische Version des Junggesellen erhielt in den Nachkriegsjahren eine<br />
besondere Form der Ästhetisierung, da Junggesellen dort mit der Freiheit des<br />
ungebundenen Lebens, mit der neuen Musik und den neuen Vergnüglichkeiten der<br />
Großstädte und vor allem mit dem Prädikat „Playboy“ gleichgesetzt wurden.<br />
Augustine, die Lieblingshysterikerin von<br />
Charcot
Junggesellen erhielten einen besonderen Status und waren im Unterschied<br />
zu alleinstehenden Frauen dem Status der Familie nahezu gleichgestellt.<br />
Junggesellen waren urbane Phänomene. Während in ländlichen Gebieten<br />
alleinstehende Männer wie Frauen als suspekt angesehen wurden, waren<br />
sie im urbanen Umfeld nicht nur akzeptiert, sie waren eine direkte Folge einer<br />
veränderten Bedingung des Großstadtlebens. Das gesamte Genre der<br />
Detektivromane und Detektivfilme wäre undenkbar, wenn die Protagonisten<br />
der Filme und Geschichten verheiratete Männer mit Familie und Haus im<br />
Grünen wären. Der einsame Detektiv, der allein in einem Apartment oder<br />
gar in seiner Detektivkanzlei wohnt und im Zuge seiner Ermittlungen reihenweise<br />
Abenteuer mit verführerischen Frauen erlebt, bestimmt die Rahmenhandlungen<br />
solcher Erzählungen bis heute.<br />
Melancholie als männliche Entsprechung der Hysterie,<br />
Möglichkeit eines „Andersseins“<br />
Diese urbane Erfahrung und dieses Bild eines Junggesellenlebens bildete<br />
sich auch in einer eigenen Architektur ab. Junggesellen widersetzten sich<br />
dem Abbild der Kleinfamilie, also dem freistehenden Einfamilienhaus mit<br />
Garten in der Vorstadt und benötigten daher auch eine eigene Wohnform.<br />
Das „Junggesellenapartment“ entsprach jenem Bild, das Junggesellen<br />
verkörperten und es entsprach vollkommen den „Bedürfnissen“ von Junggesellen.<br />
Eine ästhetisierende Lebensform erhielt ein Set für einen entsprechenden,<br />
urbanen Lebensstil. Die Amerikanische Version dieses Junggesellenapartments<br />
bot alle Einrichtungen, die für den Junggesellen notwendig<br />
waren, um seinen gleichsam vordefinierten Lebensstil auszuleben. In den<br />
1950er Jahren bestanden diese Einrichtungen vor allem aus neuen Möbeln,<br />
die multifunktional waren oder neue, dem männlichen Lebensstil entsprechende<br />
Formen sowie aus einen ausgeklügelten technischen Equipment.<br />
Das Magazin Playboy, das 1956 den Prototypen eines solchen Apartments<br />
veröffentlichte, beschrieb den prototypischen Junggesellen als „sophisticated,<br />
intelligent, urban“. Von der Zeitschrift selbst entworfen und ausgestattet<br />
sollte das Apartment alle Bedürfnisse des Junggesellen befriedigen und alle<br />
für seinen urbanen Lebensstil notwendigen Einrichtungen und Utensilien<br />
beinhalten.<br />
Apartment und Lebensweise werden beschrieben als „[...] a penthouse<br />
apartment for the urban bachelor – a man who enjoys good living, a sophisticated<br />
connoisseur of the lively arts, of food and drink, and congenial<br />
companions of both sexes. A man very much, perhaps, like you. In such<br />
a place, you might live in elegant comfort, in a man’s world which fits your<br />
mood and desires, which is a tasteful, gracious setting for an urban personality.“<br />
In Materialien, Einrichtung und technischer Ausstattung entspricht das<br />
Playboys Bachelor Apartment vollkommen dem Bild idealisierter Männlichkeit.<br />
Die Wände sind in dunklem Primaveraholz verkleidet, im Vorraum<br />
wird die Beleuchtung mit einem Aquarium gekoppelt, Stauraum soll für die<br />
Unterbringung aller für Junggesellen typischen Sportutensilien wie Schi,<br />
Golfschläger, Rucksack und Kameras sorgen, im Badezimmer ist eine<br />
Wand zur Gänze mit einem raumgroßen Jagdgemälde verziert und eine<br />
Verbindung zwischen Badezimmer und Schlafzimmer soll ein diskretes<br />
Verschwinden weiblicher Besucherinnen ermöglichen.<br />
Ein Klapptisch im Esszimmer sorgt dafür, dass der Raum bei Parties freigeräumt<br />
werden kann, Schiebetüren öffnen sich „wie von selbst“ und ebenso<br />
leicht lässt sich die „Flip Flop Couch“ in ein Bett verwandeln, die Geschirrspülmaschine<br />
spielt Musik, um das Waschgeräusch zu übertönen, der<br />
Küchensessel ist aus einem Traktorsitz angefertigt, der kreisrunder Herd ist<br />
durchsichtig und höhenverstellbar, im Livingroom sorgt ein „Schwedisches<br />
Feuer“ für ein romantisches tete-a-tete, die HiFi-Anlage ist mit allen Räumen<br />
des Apartments verkabelt, ein Fernseher kann in einer Primaverawand<br />
versteckt werden, ein Projektor kann Bilder auf eine Leinwand, die sich<br />
hinter dem Gemälde versteckt, projizieren, die eingebaute und gekühlte Bar<br />
macht es dem Junggesellen möglich, alle Drinks zu mixen, ohne den Raum<br />
zu verlassen, das Licht kann bis zur Dunkelheit stufenlos gedimmt werden<br />
und ein Telefon verhindert, dass die Dame vom Vorabend das Rendevous<br />
des Abends stören könnte.<br />
1956: Die Wohnung für Männer in der Zeitschrift für<br />
Männer<br />
...die RЯckeroberung des Wohnens durch<br />
MКnnlichkeit....<br />
Wohnen wird wieder männlich: das Playboy City<br />
House
Der tatsächliche Sinn und Zweck dieser „Junggesellenmaschinerie“ findet sich<br />
jedoch im Schlafraum, der von einer riesigen Bettlandschaft dominiert wird, die<br />
gleich einem Plateau die Hälfte des Raumes einnimmt. Auch dieses Bett, neben<br />
dem ein ovaler, kleiner Tisch das Einnahmen eines romantischen Nightcups mechanism<br />
ermöglichen soll, ist ganz im Sinne einer Maschine konzipiert. Auch hier to haunt wird die<br />
„Funktion“ des Playboys durch ein maschinelles System unterstützt und im Rücken<br />
der Schlafebene ist eine Art Kontrollebene angeordnet, mit der die gesamte<br />
women.<br />
Elektrik des Hauses kontrolliert werden kann und eingebaute Lautsprecher sorgen<br />
für Musik.<br />
The house: a<br />
Finally:<br />
The rotating<br />
playboybed!<br />
Wohnen als Mechanismus mit nur einem Ziel:<br />
Frauen zu verführen. das kreisrunde Bett als<br />
Zentrum des Mechanismus<br />
The Playboys Penthouse Apartment. Typisierte<br />
Junggesellenschaft, die Antwort auf das<br />
häusliche Suburbia<br />
Geschlechtliche Zuweisung im 50er Jahre - Stil, entwickelt von Playboy für Playboys. Wohnen als Maschinerie zur Verführung von Frauen.
Grundlegende Raumkonzept im Wohnene. Raumplan<br />
versus Plan Libre.<br />
Adolf Loos, Raumplan<br />
Die Raumkonzepte von Adolf Loos (1870 - 1933) und Le Corbusier (1887 -<br />
1965), der beiden vermutlich bekanntesten Architekten ihrer Epoche, lassen sich<br />
weder direkt vergleichen noch als Gegensatz formulieren. Die Entwürfe beider<br />
Architekten haben jedoch eine grundlegende Raumkonzeption zur Basis, die<br />
sich als zwei unterschiedliche Möglichkeiten in der Konzeption von Raum und<br />
Stadtraum anbieten: der Raumplan einerseits und der so genannte Plan Libre<br />
andererseits. Die Frage nach einer möglichen Offenheit oder Vordefinition im Plan,<br />
die Frage, inwiefern Raum bestimmt und Handlungen initiiert werden müssen oder<br />
sich zur Gänze von selbst entwickeln sollen sowie die Frage nach einer räumlichen<br />
oder programmatischen Vielfalt sind bis heute aktuell.<br />
Haus Moller: Implodierter Würfel, theatralische<br />
Inszenierung von Wohnraum<br />
Der Raumplan von Adolf Loos bietet ein vertikal geschachteltes System, das<br />
innerhalb eines gegebenen, meist kubischen Volumens Raum gliedert in Bereiche<br />
unterschiedlicher Raumgrößen und Raumhöhen, verschiedene Ein- und Ausblicke<br />
bietet sowie wählbare Raumverbindungen schafft. Die Loosschen Villenräume<br />
sind kompakt und beziehen sich nicht wie etwa jene von Frank Lloyd Wright auf<br />
eine horizontale Erweiterung des Hauses in die Natur, im Gegenteil, sie grenzen<br />
sich deutlich von jener ab. Nach außen hin klar begrenzt, nach innen hin äußerst<br />
komplex zerteilt und auf Bewegung durch den Raum basierend. Die Bewegung<br />
zwischen innen und außen wird eher abgeblockt. Die Aufsplittung in mehrere<br />
Niveaus hatte zur Folge, dass Außen- wie Innenwände fast ausschließlich als<br />
tragende Wände konzipiert wurden. Es ging also weniger um die Sichtbarmachung<br />
eines konstruktiven Systems, als vielmehr um das innere räumliche Angebot.<br />
Ein Beispiel für ein kleines, jedoch äußerst komplexes Haus, das dem Konzept<br />
des Raumplans folgt, gibt das Haus Moller in <strong>Wien</strong>, von Adolf Loos 1928 geplant.<br />
Das Haus bildet einen einfachen 3 - 4 - geschossigen Kubus in einer Reihe<br />
von Häusern. Von außen differenziert das Gebäude klar zwischen Haupt- und<br />
Seitenansichten sowie zwischen Vorder- und Rückseite. Die Straßenfassade ist<br />
streng symmetrisch gehalten und erhält durch einen vorspringenden Erker mit<br />
quer liegendem Fenster sowie zwei darüber angeordneten Fenstern eine klare<br />
Akzentuierung. Diese Seite ist graphisch, reduziert und skulptural behandelt, die<br />
Gartenfassade hingegen erhält durchgehend große Öffnungen mit Austritten auf<br />
den Balkon. Während die Straßenfassade keine Rückschlüsse zulässt über das<br />
komplexe Innere, widerspiegelt die Gartenfassade eher dieses.<br />
Haus Moller: Komplexe Raumverschneidungen<br />
rund um die Treppe<br />
Zentraler Raum des Hauses bildet die Halle, über die man über eine halb gewendelte<br />
Treppe kommt. Rund um diese Halle sind mehr oder weniger offen Boudoir,<br />
Musikzimmer, Esszimmer und Küche gruppiert. Raumverbindungen werden über<br />
Blickachsen und variable Verbindungselemente inszeniert, Podeste schaffen unterschiedliche<br />
Raumhöhen und durch den Raumplan und die mehrfach ausgerichteten<br />
Treppen wird ein Theater-artiger Bühnenraum geschaffen.<br />
Le Corbusier, Petit Maison und Villa Savoye<br />
Le Corbusiers Raumansatz war ein zur Gänze gegensätzlicher. Seine prototypischen<br />
Wohnhäuser sind flach, auf einer oder übereinander geschachtelten Ebenen<br />
konzipiert, bieten eine möglichst offene Wohnebene an, in die Einrichtungen und<br />
Raumteilungen wie Körper (Organe) frei hinein gestellt sind. Auch wenn verschiedene<br />
Häuser wie etwa die Villa Savoye zur Bewegung animieren, basieren die<br />
meisten Räume dennoch eher auf eine statische Erfahrung mit einem visuell definierten<br />
Konzept. Der ideale Blick von innen nach außen wird thematisiert und zelebriert<br />
und durch geeignete Öffnungen wie etwa das cinematografische Langfenster<br />
hergestellt. Fenster werden wie Objektive behandelt, Häuser wie eine Kamera,<br />
fokussiert auf Natur. Wände mit Öffnungen bilden dazu den Rahmen und formieren<br />
den Unterschied zwischen dem reinen „Schauen“ und dem konkreten „Sehen“.
EIn Beispiel dafür bildet etwa das Haus „Petit Maison“ am Genfer See, das Le Corbusier<br />
1923 für seine Eltern plante. Eine Mauer umschließt das Grundstück, nach<br />
dreieinhalb Seiten hin offen, darin eingeschrieben ein 4x16m großes Rechteck mit<br />
frei hinein gestellten Einbauten, die eine Bewegung erlauben und unterschiedliche<br />
Blicke auf See und Berge schaffen. Die Anfangsskizze Le Corbusiers zeigt die<br />
Intention: Eine menschliche Figur ist gezeigt, davor ein überdimensionales Auge,<br />
in Richtung See orientiert, dazwischen das Haus. Das Haus ist das, was zwischen<br />
Betrachtende und Aussicht, zwischen Auge und Landschaft tritt (siehe dazu:<br />
Beatrize Colomina, Domestic Voyerism). In der Skizze, die den Plan des Hauses<br />
zeigt, bleibt das Haus ohne Kontext (zumindest im Grundriss), statt dessen ist<br />
dem Grundrissplan eine Ansicht der Aussicht hinzugefügt. Wichtigstes Element für<br />
das Haus bildet das 11m lange Fenster in Richtung See. Le Corbusier in seiner<br />
Beschreibung das Haus als eine Maschine, um darin zu wohnen, für ihn also ein<br />
kleiner Prototyp seiner Überlegung zu einer industriellen Herstellung von Häusern.<br />
Wie Maschinenteile sind auch Möblierungen frei in den Kubus gestellt, von halb<br />
umschließenden Wänden umfasst. Zweimal rahmt LC den Blick, einmal cinematografisch<br />
längs entlang des Kubus, einmal fokussiert durch eine quadratische<br />
Öffnung in der Gartenmauer.<br />
In den 1920er Jahren entwickelte Le Corbusier zwei Prototypen, die in seinem<br />
gesamten späteren Werk moduliert Anwendung fanden: Das Maison Citrohan und<br />
das Maison Domino. 1927 bauten Le Corbusier und sein Partner Pierre Jeanneret<br />
in der Weißenhofsiedlung in Stuttgart einen Citrohan-Typus als Haus und sie<br />
präsentierten anlässlich einer Ausstellung zur Weißenhofsiedlung zugleich die<br />
„Fünf Punkte einer Neuen Architektur“, die alle kommenden Planungen bestimmen<br />
sollten: 1. Die Pilotis, 2. Der Dachgarten, 3. Der freie Grundriss, 4. Das Langfenster,<br />
5. Die freie Fassade.<br />
Das Citrohanhaus zeigt ein System, das Le Corbusier aus der räumlichen Erfahrung<br />
in seinem Pariser Studio entwickelte: ein zweigeschossiger Wohnraum mit<br />
großer Verglasung in Richtung Aussicht, alle Nebenräume auf zwei Geschossen<br />
im rückwärtigen Teil, eine außen liegende Treppe als Erschließung des oberen<br />
Geschosses. Kochen, Hygiene und Schlafen sind auf minimalem Raum untergebracht,<br />
um den restlichen Raum offen, hoch und frei zu halten. Noch abstrakter<br />
entwickelt als das Maison Citrohan zeigt das Haus Domino, entwickelt von LC<br />
1915, bereits alle Merkmale der Fünf Punkte. Drei parallele Ebenen sind auf Pilotis<br />
aufgestelzt, bieten eine offene Fläche für freie Nutzungen, eine Treppe verbindet<br />
die Ebenen und am Rand kann sich eine freie Fassade entfalten.<br />
Le Corbusier, Villa Stein in Garches, 1927<br />
Le Corbusier: Typus Domino, Typus Citrohan,<br />
Die 5 Punkte, der Modulor......Ein System für<br />
alles!<br />
Le Corbusier: Le Petit Maison: Haus als Kamera<br />
zum Betrachten der landschaft<br />
VIlla Floriac, Rem Koolhaas, OMA<br />
Ein Villenprojekt von Rem Koolhaas/OMA zeigt Variationen bzw. Kombinationen<br />
aus Raumplan und Plan Libre. Die 1998 fertig gestellte Villa Floriac außerhalb von<br />
Bordeaux demonstriert drei unterschiedliche Raumkonzepte innerhalb eines Hauses<br />
noch besser. Das für einen querschnittsgelähmten Mann und dessen Familie<br />
konzipierte Haus ist in drei Ebenen mit jeweils eigener Raumkonzeption gegliedert.<br />
Das Untergeschoss gräbt sich höhlenartig in den Hang hinein, die Erdgeschossebene<br />
ist gläsern, offen und frei, das Obergeschoss ist geschlossen und intim.<br />
Verbunden werden die drei Ebenen durch einen Liftraum mit 3 x 3,5 m Größe, der<br />
als Büro, Weinkeller und Bibliothek zugleich fungiert. Der bewegte Raum verändert<br />
je nach Lage die Raumkonfigurationen.<br />
Die unterste, höhlenartige Ebene ist für das private Familienleben vorbehalten,<br />
hier ist die Küche platziert, gegenüber über dem Hof das Gästehaus. In der mittleren,<br />
verglasten Ebene ist halb innen liegend, halb außen der Wohnraum situiert<br />
und in der obersten Ebene die Schlafräume, unterteilt in „ein Haus für die Kinder“<br />
und „ein Haus für die Eltern“. Das oberste Geschoss ist weitgehend geschlossen,<br />
die Betonwände erlauben auf Grund der Statik nur kleine (runde) Öffnungen. Sie<br />
liegen auf einem Balken auf und sind von einem zweiten Balken abgehängt, der<br />
auf der Ummantelung der Wendeltreppe asymetrisch aufliegt, weshalb er durch ein<br />
Gegengewicht gehalten werden muss.<br />
Villa Floriac, OMA: 3 Geschosse, 3 Raumkonzepte.<br />
Höhle, Glashaus, geschlossene<br />
Box. Verbindendes Element: der bewohnbare<br />
Farstuhl. Die unterste Ebene: ein Höhlenhaus
Betten, Bettdecken, Schlafräume und andere Bewusstseinsgrenzen<br />
Das aus dem Boden der Erde erhobene Bett stellt neben dem Herd die<br />
zweitwichtigste Institution im privaten Wohnen dar. Das Bett beschreibt<br />
und besetzt auch mehr als alle anderen privaten Objekte genaue Grenzen:<br />
Eigentumsgrenzen, Territoriumsgrenzen, Intimitätsgrenzen, sexuelle Grenzen<br />
und Bewusstseinsgrenzen. Die ersten Betten des 14. Jahrhunderts waren oft<br />
kleine Häuschen, die mitten im Raum standen, viel Platz einnahmen und oft<br />
mehreren Personen Platz zum Schlafen boten. Solche Betten erhielten seitliche<br />
Truhen zum Aufsteigen, Vorhänge und einen Himmel als Dach. Erst im Laufe<br />
der Zeit und mit dem Anerkennen einer eigenen, privaten Körperlichkeit wurden<br />
Betten individuelle Orte des Alleinseins. Aus dem nahezu öffentlichen Bett, dass<br />
in adeligen Kreisen oft mitten in einem Saal stand, formierte sich im Laufe der<br />
Zeit parallel zur bürgerlichen Familie das individuelle Schlafzimmer. Mit der<br />
Ausdifferenzierung des Wohnens an sich wurden auch die einzelnen kleinen<br />
Räume als Raumfolgen ausgebildet. Von einem fließenden Übergang zwischen<br />
öffentlich und privat wurden die Grenzen zunehmend geschlossen, aus dem noch<br />
offenen intimen Bereich zwischen Bett und Wand, der ruelle, wo erste kleine intime<br />
Wertgegenstände aufbewahrt wurden, wurde schließlich ein eigener Raum, das<br />
Schlafzimmer.<br />
Schlafen und Sterben sind, wie Sexualität und Tod zwei untrennbare Prinzipien.<br />
Schlafen ist eine unkontrollierbare Praktik. Schlafen bedeutet, in einen unbewussten<br />
Teil des Alltäglichen zu wechseln. Unter Ausruhen versteht man normalerweise<br />
jene Praktik, in der man von der vertikalen Alltäglichkeit in die horizontale Alltäglichkeit<br />
übergeht. Die Linie zwischen Wand und Decke bildet nun den neuen, sonst<br />
selten in das Blickfeld gefassten Horizont. Eine Reihe von Emblemen rund um<br />
das Bett bilden das Netzwerk für die richtige Ausübung der Praktik des Schlafens:<br />
Sie markieren das intime Territorium, das sich gleich der ruelle rund um das Bett<br />
ausdehnt: Hausschuhe, Bettvorleger, Nachttisch, Nachttischlampe, Deckchen, Uhr,<br />
Sessel für Kleider, Kopfpolster, Duchend, Leintuch, Überdecke, Zierpolster etc.<br />
bilden ein exakt definiertes und positioniertes Netzwerk aus Schichten und Objekten,<br />
die die Praktik des Schlafengehens und des Schlafens regulieren. Als häusliche<br />
Praktik des Privaten haben sich Schlafen und Ausruhen in den Jahrhunderten<br />
nicht verändert. Und es gibt nur wenige Beispiele an Architektur des Privaten, die<br />
an der Praktik des Schlafens tatsächlich etwas veränderten und sich Norm und<br />
Moral widersetzten.<br />
Notwendige Schichten, um Körperlichkeit zu<br />
verdecken<br />
Le Corbusier, Doppelhaus Weißenhofsiedlung.<br />
Die Betten verschwinden im Wandschrank<br />
Enzyklopädien<br />
1920 malte Max Ernst das eigentümliche Bild eines Interieurs mit dem rätselhaften<br />
Titel „Das Schlafzimmer des Meisters es lohnt sich darin eine nacht zu verbringen“.<br />
Bär, Schaf, Fisch, Wal, Fledermaus, Schlange, Tisch, Bett und Baum sind in die<br />
beengende Perspektive eines Schlafzimmers gebannt. Die Irritation wird vor allem<br />
durch den fundamentalen Gegensatz zwischen der korrektesten Organisation<br />
und der gleichzeitigen Irrationalität der Anordnung ausgelöst. Das irritierende<br />
Szenarium des zoologischen Interieurs ist Teil einer Serie von Bildern, deren<br />
Technik Max Ernst als ein malerisches Äquivalent zur écriture automatique<br />
(automatischen Schreibweise) entwickelt hatte. Ernst war 1919 zufällig auf die<br />
illustrierten Seiten des Kölner Lehrmittelkatalogs „Bibliotheca paedagogica“ mit<br />
anthropologischen, mikroskopischen und physiologischen Demonstrationsobjekten<br />
gestoßen, von denen ein eigenartiger „visueller Zwang“ ausging. Die banalen<br />
und naturgetreu gezeichneten enzyklopädischen Bildbögen, die ursprünglich<br />
als Schulbehelf zusammengestellt worden waren, wiesen eine solche Vielfalt<br />
absurdester Elemente auf, dass in Max Ernst augenblicklich eine halluzinatorische<br />
Folge von Bildern entstand: „Ich brauchte folglich nur mit Pinsel oder Stift den auf<br />
diesen Katalogseiten dargestellten Dingen etwas Farbe oder Blei, eine fremdartige<br />
Landschaft, Wüste oder Himmel, einen geologischen Schnitt, einen Boden, eine<br />
einzige Linie als Horizont hinzuzufügen, um das genaue, gesicherte Bild meiner<br />
Halluzination zu erhalten und die zuvor banalen Druckseiten in Dramen zu<br />
verwandeln, die meine geheimsten Wünsche verrieten.“ Betrachtet man das Bild<br />
genauer, dann spürt man den Zusammenhang, so absurd dieser Zusammenhang<br />
auch sein mag.<br />
Max Ernst, Das Schlafzimmer des Meisters, es<br />
lohnt sich, darin eine Nacht zu verbringen<br />
Max Ernst, Das Schlafzimmer des Meisters, es<br />
lohnt sich, darin eine Nacht zu verbringen
Russland<br />
In Russland dachte man wissenschaftlich: So war auch in Russland in den 20er<br />
Jahren die „Anthropotechnik“ Bestandteil der wissenschaftlichen Forschungen.<br />
Soziale und ökonomische Veränderungen sowie eine rein psychische Manipulation<br />
des Menschen konnten die radikalen Forderungen der Revolution nicht realisieren,<br />
solange der Organismus des Menschen unverändert bliebe. Die „Anthropotechnik“<br />
sollte alle wissenschaftlichen Möglichkeiten austesten, um den individuellen und<br />
für Krankheiten anfälligen Körper in einen kommunalen und resistenten Körper<br />
umzuformen. Dieser neue Körper sollte nicht nur resistent gegenüber Krankheiten,<br />
sondern vor allem gegenüber dem Tod sein. 1923 hatte der Wissenschaftler<br />
Valerian Muraviev in seinem Traktat über „Produktive Mathematik“ die Vision<br />
eines durch chemische Experimente manipulierten Körpers proklamiert: Die<br />
„Anthropotechnik“ sollte nicht nur einen neuen physischen Typus erschaffen, sie<br />
sollte die Verjüngung, die Wiederbelebung und die Wiedergeburt des Körpers<br />
ermöglichen, der nun im Dienste eines kollektiven Körpers bzw. einer Symbiose<br />
aller Körper stand.<br />
Konstantin Melnikov kannte die anthropotechnischen Experimente am physischen<br />
Körper und er kannte die Proklamationen Muravievs. Als er 1929 für den Wettbewerb<br />
einer „Grünen Stadt“ – eine Erholungsstadt für Moskauer Arbeitende - das<br />
Projekt einer ringförmig aufgebauten Stadt entwickelte, positionierte er auch im<br />
Zentrum ein anthropotechnisches Institut, das „Institut zur Formveränderung des<br />
Menschen“. Die wirkliche Sehnsucht Melnikovs lag jedoch in einem ganz anderen<br />
Teil des Projektes, dem sogenannten „Laboratorium des Schlafes“ – ein Gebäude,<br />
dessen einzige Funktion darin bestehen sollte, die aus Moskau ankommenden<br />
Arbeitenden in Schlaf zu versetzen: SONaia SONata. Künstlich herbeigeführter<br />
Schlaf sollte die Ankommenden für das neue und kommunale Leben der „Grünen<br />
Stadt“ vorbereiten und sie von traditionellen Arbeitende in kommunale Arbeitende<br />
umwandeln. Das lang gestreckte Laboratorium des Schlafes bestand neben einem<br />
zentralen Umkleide- und Waschraum vor allem aus zwei schräggestellten Schlafflügeln,<br />
an deren Endpunkten zwei Kontrollräume die Schlafintensität je nach<br />
Notwendigkeit in sanften Schlaf, leichten Schlaf, tiefen Schlaf oder Dämmerschlaf<br />
steuern konnten. Sauerstoffzufuhr, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung,<br />
Gerüche, Geräusche sowie unterschiedliche Lichtqualitäten sollten die dazu notwendige<br />
Atmosphäre verändern. Über mechanische Verbindungen jedoch konnte<br />
jedes der schräg gestellten Betten zusätzlich in leichtes Schwingen, in sanftes<br />
Stoßen und schließlich in starkes Rütteln versetzt werden, was den Schlaf bis zur<br />
Bewusstlosigkeit steigern sollte. Melnikov hatte - unbewusst oder bewusst - ein<br />
Projekt entwickelt, das den kommenden Bewohnern der „Grünen Stadt“ nahezu<br />
„Ozeanischen Erfahrungen“ des Träumens ermöglichen würde, ein Grund allerdings,<br />
weshalb die Jury vehement gegen sein Projekt stimmte, da diese Zustände<br />
nicht dem aufstrebenden revolutionären Russland entsprachen.<br />
In seinem eigenen Wohnhaus in Moskau verwirklichte Melnikov wiederum eine<br />
seltsame Mischung aus Fortschrittlichkeit und Tradition. Die dicken Ziegelwände<br />
der ineinander geschobenen Zylinder erinnern an eine mittelalterliche Burg, sind<br />
jedoch im Inneren ungewöhnlich geöffnet und bilden keine abgeschlossenen<br />
Schlafzimmer für Eltern und Kinder aus. Eine Hälfte eines Zylindergeschosses<br />
formiert hier eine offene Halle mit aus dem Boden in einem Schwung erhobenen<br />
Plateaus und zwei frei in den Raum gestellten Wandfragmente, die lediglich Sichtschutz<br />
bieten. Ein Blick in das Schlafzimmer zeigt einen unkonventionellen Raum,<br />
der in seiner Stimmung an einen sakralen Raum erinnert, ohne Trennung zwischen<br />
einzelnen Intimbereichen.<br />
Konstantin Melnikov, Sonaia Sonata<br />
Das Laboratorium des Schlafes<br />
Konstantin Melnikov, Moskau: Trdaierte<br />
bauformen, unkonventionelle Privatheit<br />
Schlafpodeste, Raumteiler
Tisch und Bett. Wohnen und Körperfunktionen<br />
Grundrisse ändern sich und dennoch bleiben zwei Funktionen und zwei Möbel<br />
seit Jahrhunderten nahezu unverändert: Tisch und Bett. Sie bilden die materielle<br />
Verkörperung und das Symbol für die essentiellen Grundbedürfnisse des Wohnens<br />
schlechthin. Essen am Tisch und Schlafen im Bett sind die häufigsten Praktiken im<br />
privaten Wohnen und diejenigen, die sich über die Jahrhunderte hinweg am wenigsten<br />
verändert haben. Tische sind rund, quadratisch oder rechteckig, Betten im<br />
Normalfall Rechtecke im Verhältnis 1:2. Tische und Betten erhalten bei oder nach<br />
Gebrauch traditionellerweise Schichten, die jede Spur des intimen oder körperlichen<br />
Gebrauchs verdecken, Tischdecke oder Tagesdecke. Ein unaufgeräumter<br />
Tisch verrät Nachlässigkeit, ein ungemachtes Bett Faulheit. Tisch und Bett gehören<br />
zusammen und sind dennoch genau getrennt. Tische bilden Versammlungsorte<br />
für informelle oder formelle Essen, Betten stehen für Intimität. Essen steht für<br />
ein soziales Ereignis, das zu Bett gehen für das Ende dessen.<br />
Zum Gelage ausartend stand das Essen miteinander für eine Friedensbezeugung<br />
und für eine menschliche Vereinigung. Für lange Zeit galt, dass wenn in<br />
einer Ehe Tisch und Bett getrennt waren, die Ehe auch als geschieden betrachtet<br />
und getrennt werden konnte. Und dennoch haben sich die Gebrauchsweisen der<br />
Möbel, die Sitten und Gebräuche im Laufe der Zeit verändert. Betten etwa bedeuteten<br />
nicht immer ausschließlich die absolute Intimität einer Person oder zweier<br />
sehr nahe stehender Personen. Von Julius Cäsar etwa wird berichtet, dass er<br />
mit seinen Soldaten in einem Bett schlief, MonarchInnen nahmen sich Tiere oder<br />
Hofzwerge ins Bett. Solche Betten bildeten ganze Räume, erhielten Wände und<br />
Dach und versammelten alle möglichen Personen und Tiere. Barocke Schlossherren<br />
und -frauen wiederum empfingen in ihrem Schlafzimmer Besuchende, die<br />
Räume waren also weitgehend öffentlich zugängig. Eigene Schlafzimmer im Sinne<br />
eines Intimraums waren in normalen Häusern wiederum bis zum 18. Jahrhundert<br />
nicht üblich und dem Anspruch, ein eigenes Bett zu besitzen wurde erst am Beginn<br />
des 20. Jahrhunderts tatsächlich Genüge getan.<br />
Heinrich Hoffmann: Struwelpeter, 1845.<br />
Familiäre Kontrolle schon für Kleinkinder<br />
In der westlichen Kultur bedeutet Essen am Tisch ebenso wie das Schlafen im Bett<br />
die Loslösung einer Handlung von der Ebene des Bodens in eine erhobene Ebene<br />
und damit eine kulturelle Errungenschaft. Ursprünglich stellten Tische bewegliche<br />
Schüsseln auf einem Gestell dar (discus, tisk), aus denen auch am Boden sitzend<br />
gegessen werden konnte. In der römischen und griechischen Antike wurde noch<br />
halb liegend gegessen, Tische wurden vorerst nicht gebraucht. Man stützte sich<br />
mit einer Hand auf und konnte somit auch keine Esswerkzeuge benutzen, weshalb<br />
Speisen von Sklaven auch mundgerecht vorbereitet wurden. In islamischen oder<br />
afrikanischen Kulturen wiederum bedeutet der Boden auch heute noch oft mehr<br />
als ein erhobenes Plateau.<br />
Im Mittelalter schließlich wurde der hohe, große Esstisch zentraler Ort der<br />
Familienversammlung, der weit über die Funktion des Essens hinaus ging. Ähnlich<br />
das Bett, dass von einer Schlafmulde im Boden zunehmend an Höhe gewann<br />
und schließlich im Spätmittelalter eine beachtliche, über Stufen und Truhen<br />
erreichbare Höhe erlangte. Mit dem Sitzen am Tisch verbunden war der Gebrauch<br />
beider Hände beim Essen sowie die Verwendung von Messer und Löffel und<br />
schließlich der Gabel. Auch wenn sich die Rituale des Essens heute geändert, die<br />
Gedecke sich vereinfacht und die Speisefolgen sich verkürzt haben, so hat der<br />
Tisch in seiner Bedeutung an nichts verloren. Bis heute wird jeder Tagesablauf<br />
in eine Reihe von Mahlzeiten eingeteilt, die in ihrer Bedeutung nahezu gleich<br />
geblieben sind, lediglich Mittag- und Abendessen wechseln an Bedeutung. Die<br />
Speisen selbst haben sich hingegen geändert. So wurden im 17. Jahrhundert<br />
in betuchten Kreisen noch 6.000 Kalorien am Tag gegessen. Frühe Tische<br />
waren flexible Holzplatten auf Böcken, wie man sie etwa in Bildern von Brueghel<br />
erkennen kann. Im Barock schließlich wurden die fixen Tische verziert und wurden,<br />
um die Intarsien zu schützen, erstmals mit einem Tischtuch belegt, was dem<br />
Schutz diente und zugleich als Serviette fungierte. Im 18. Jahrhundert schließlich<br />
entstanden eigene kleine Sonderformen von unzähligen Tischen und Tischchen für<br />
bestimmte Tätigkeiten wie das Nähtischchen, das Spiel- oder Lesetischchen.<br />
Der Tisch als das Terrain, auf dem Konventionen<br />
des privaten Wohnens ausgetragen<br />
werden.
Besteck wiederum wurde über die Jahrhunderte zunehmend komplexer und<br />
verfeinert. Vom ursprünglichen Fallbeil zum Messer, von der Schöpfkeule zum<br />
Löffel und erst sehr spät zur Gabel wurden Tafelkultur, Trink- und Esssitten<br />
sowie die Tischmanieren ständig verfeinert. Die Gabel etwa kam erst in der<br />
Renaissance in Mode. Im Mittelalter wurde die Gabel als ein Hexen- oder<br />
Teufelswerkzeug bezeichnet, erste Gabeln waren vorerst kostbar und verziert, aus<br />
Silber oder Elfenbein hergestellt und erst die industrielle Anfertigung Ende des 19.<br />
Jahrhunderts brachte eine allgemeine Verbreiterung.<br />
Im 17. Jahrhundert begann sich das zu entwickeln, was man heute allgemein<br />
unter „Tischsitten“ versteht. Diese Tischsitten hatten unterschiedliche Gründe:<br />
ein wachsender Individualismus, ein erhöhter Wunsch nach Reinlichkeit, eine<br />
größere Praktikabilität etc. Die größte Bedeutung der Tischsitten lag jedoch in der<br />
Markierung sozialer Unterschiede. Mit den Tischsitten waren die Sitzordnung, die<br />
Speisefolge und die Rangordnung genau beschrieben. Herzögliche Festessen<br />
wie etwa am Hof des Schlosses Ezterhazy in Eisenstadt bestanden oft aus 16<br />
Suppen, 13 Vorspeisen, 28 Hors d´oevres, 16 Braten, 13 Zwischengerichten<br />
und 57 unterschiedliche Desserts. Der visuelle Reiz war fast wichtiger, als der<br />
geschmackliche Reiz: Figuren aus Zucker und Goldstaub, ausgestopfte Fasane<br />
und Blumen entsprachen der Vielfalt der Gänge. Das barocke Tafelmuster bildete<br />
eine streng geordnete Komposition, eine Aufzeichnung, die etwa dem streng<br />
geordneten Tanz des Barocken entspricht oder der Gesten. Sitzordnung bedeutete<br />
Rangordnung, und hier vor allem patriarchalische Rangordnung. In vielen Kulturen<br />
durften Frauen lange Zeit nicht am selben Tisch essen wie Männer, in bäuerlichen<br />
Kulturen wird bis heute der Platz an der Schmalseite, der am weitesten von der<br />
Küche entfernt ist und den offenen Blick in den Raum gewährt, dem Mann als<br />
Oberhaupt der Familie vorbehalten, oft war dies der bequemste Sessel, während<br />
alle anderen auf harten Bänken saßen. In bürgerlichen und adeligen Kreisen<br />
wurde zwischen Dienstboten und Herrschaften sowie zwischen Erwachsenen und<br />
Kindern, zwischen Speisesaal und Küche getrennt.<br />
Tisch und Sessel bilden die Einrichtungen für geregelte Abläufe und periodische<br />
Höhepunkte von Festen, sie bilden trotz geringem Platzanspruch, so Gert Selle,<br />
eine „unsichtbare Zeit-Raum-Einheit in der persönlichen Geschichte des Wohnens<br />
und Lebens ab.“ (Selle, S. 117). Bei aller Gelassenheit bestimmen dennoch auch<br />
heute noch eine Reihe von Regeln das Essen, die über die Jahrhundert hindurch<br />
entwickelt, verfeinert, gelockert und dennoch weiter transportiert wurden. Der<br />
„richtig“ gedeckte, mitteleuropäische Tisch etwa, folgt man Einrichtungsbüchern,<br />
beinhaltete in den 1950er Jahren exakt 52 Regeln. Diese wurden teils mündlich<br />
überliefert, teils wurden sie über Gegenstände und Markierungen fixiert, über<br />
in die Oberfläche des Tischtuchs gleichsam eingeschriebene Codierungen. Sie<br />
beschreiben die exakten Lagebedingungen der Gedecke und sie codieren zugleich<br />
die exakte Ausübung der Praktiken bei Tisch. Die Regeln für den gedeckten Tisch<br />
sind dem 1957 herausgegeben Ratgeber „Der Gute Ton“ entnommen. Als Beispiel<br />
sind hier die ersten fünf Regeln heraus genommen:<br />
1. Das Tischtuch soll an der geraden Kante 20 cm über die Tischkante hängen.<br />
2. Das Tischtuch legt man über eine Wollunterlage. Das bewirkt, dass alle<br />
Geräusche, die durch das Essen und Trinken verursacht werden, vollständig<br />
absorbiert werden.<br />
3. Die Essteller stehen in der Mitte des Gedecks, ihr unterer Rand schließt mit dem<br />
Tischrand ab.<br />
4. Die Messer liegen mit der Schneide nach innen rechts vom Teller, die Gabeln<br />
mit dem Hohlraum nach oben links vom Teller, die Suppenlöffel, ebenfalls mit dem<br />
Hohlraum nach oben, entweder quer hinter dem Essteller oder neben dem Messer,<br />
der Kompottlöffel neben oder unter dem Suppenlöffel. Das Fischmesser liegt<br />
rechts neben dem großen Messer, die Fischgabel links neben der großen Gabel.<br />
5. Die Serviette liegt möglichst glatt entweder auf dem Ess- oder Suppenteller oder<br />
links neben dem Besteck.<br />
Oder etwa die Regeln, wie man richtig Krebse isst, 21 Regeln:<br />
Der Krebs wird mit der linken Hand am Panzer angefasst, mit der rechten Hand<br />
reisst man mit einem kräftigen Ruck die Scheren mit den Gelenken vom Panzer<br />
ab. Man löst dann jedes Gelenk einzeln ab und saugt das Fleisch aus den<br />
Sitzordnung, Speisefolge, Rangordnung<br />
Barocke Tafelmuster<br />
Tisch- und Esssitten. Lageplan des Gedecks<br />
Richtiges Essen
Gelenken heraus. Die kleinere Scherenseite wird abgebrochen und die Spitze<br />
mittels des Loches im Krebsmesser abgeknickt. Der Inhalt lässt sich nun bequem<br />
herausdrücken oder mit der Gabel herausziehen. Auch bei der größeren Schere<br />
wird die Spitze abgebrochen und nun der obere Teil des festen Panzers mit dem<br />
Krebsmesser abgelöst. Der Schereninhalt wird mit Toast oder Butter gegessen.<br />
Etc.<br />
With-Drawing-Room, Diller & Scofidio, Capp Street, San Francisco, 1987<br />
Die Praktiken des Häuslichen zu bewahren heißt, die Kontrolle des Häuslichen und<br />
die Disziplin des Körpers zu bewahren. In einem 1987 verwirklichten Installationsprojekt<br />
von Diller & Scofidio werden gerade eben diese Regeln und Konventionen<br />
des Privaten visualisiert. Diller & Scofidio sehen in der Oberfläche Privaten, des<br />
Hauses und des Häuslichen jenes Terrain, in dem sich kulturelle Codes manifestieren.<br />
Die Vorbereitung und Aufbereitung des Häuslichen sei ein Netzwerk aus<br />
unterschiedlichen Codierungen, das nicht nur den Raum organisiere, sondern<br />
auch die Objekte, Handlungen, Aktionen und Körper. Die Codes, die das Häusliche<br />
betreffen sind juridische Codes, die das Eigentum und die eindeutige Grenze<br />
zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen sichern, die Regeln der Etiquette, die<br />
den Umgang mit den Fremden sichern sowie moralische Codes, die die Rechte<br />
und Pflichten dem anderen Körper gegenüber sichern.<br />
Die Installation „With Drawingroom“ unterscheidet sich kaum von jeder konventionellen,<br />
installierten Häuslichkeit, wie sie in jedem Mittelklassehaus in den USA<br />
finden. With Drawingroom wurde in einem von dem Künstler David Ireland umgebauten<br />
Holzframehaus in San Franzisko als eine Mischung aus Haus und Galerie<br />
installiert. Das Häusliche und die Privatheit des Künstlers sowie die mögliche<br />
„voyeuristische“ Observation durch die Besucher wurde hier zugleich Ort als auch<br />
Thema der Installation. Die Beobachtung, der voyeuristische Blick ermöglichen<br />
den Betrachtenden sowohl Einblicke in die reale Häuslichkeit des Künstlers als<br />
auch Einblicke in die installierte Häuslichkeit. Die Ebenen der Realität werden also<br />
relativiert. Und sie ermöglichen den Blick aus dem Häuslichen heraus - dem realen<br />
wie auch dem simulierten Häuslichen - in das sogenannte Öffentliche. Die Installation<br />
invertiert also die Sicht, den Blick und den Standpunkt mehrfach.<br />
Der gute Ton bei Tisch<br />
Zwei sich überkreuzende Wände definieren - wie in jedem Amerikanischen Haus,<br />
wo meist im Mittelpunkt Kamin oder Stiege bzw. der Fernseher liegen - die häuslichen<br />
Zonen und unterschiedlichen Terrains von Privatheit bzw. die Praktiken der<br />
bewohnenden Körper. With Drawing – Raum mit Zeichnung, Raum mit Bezeichnung<br />
- verwendet genau jene abstrahierte Methode der Architektur, die Zeichnung,<br />
die in ihrer objektiven Abstraktion versucht, das Reale zu simulieren. Die<br />
Repräsentation der Zeichnung wird hier zur Visualisierung eines Mechanismus der<br />
Reduktion. Neben dem subjektiven Blickwinkel und dem voyeuristischen Blickwinkel<br />
bildet nun der objektive Blickwinkel der Zeichnung als Schnitt, horizontal oder<br />
vertikal, eine zusätzliche Ebene des Häuslichen, die normalerweise im gebauten<br />
Haus nicht mehr sichtbar ist. Die Spuren der Reduktion werden also wieder aufgezeichnet.<br />
Der Schnitt wird auch methodisch als eine Praktik des designierens oder designens<br />
verwendet, um die konventionellen Bedeutungen der Objekte des Häuslichen<br />
zu zerschneiden, zu entfernen, um damit eine weitere, zusätzliche Bedeutungsebene<br />
herzustellen. Die dabei entstehenden Spuren wiederum durch das<br />
Zerschneiden, das Entfernen oder Hinzufügen werden genauso aufgezeichnet,<br />
wie die Spuren des Alltäglichen, die Spuren von Gläsern auf dem Tisch, die<br />
Spuren des zerknitterten Bettes und alle Spuren, die normalerweise sofort eliminiert<br />
werden. Diller & Scofidio entschlüsseln die konventionellen Praktiken und<br />
sie versehen die Objekte der Praktiken mit prothetischen Vorrichtungen, die das<br />
Bezeichnen, das Aufzeichnen, das Einschreiben nicht nur verdeutlichen, sondern<br />
tatsächlich vollziehen.<br />
Diller & Scofidio, With Drawing Room<br />
Einschreiben von Regeln<br />
Visualisieren von Körperpraktiken<br />
Der Tisch etwa wird hier als das Terrain des Hauses bezeichnet, das gleichsam<br />
einen mikro-organisierten Ort repräsentiert, wo kulturelle Codes ausgespielt<br />
werden und wo Konventionen zwischen Fremden und Bewohnenden, zwischen<br />
vordefinierten Geschlechterrollen, zwischen Objekt und Körper in die Oberfläche
des Tisches eingeschrieben sind. Das Bett der installierten Häuslichkeit ist genau<br />
an der Symmetrieachse zerschnitten und ist nur mehr an einem einzigen Punkt am<br />
Kopf des Bettes, einem gelenkigen Verbindungspunkt, verbunden. Die eine Hälfte<br />
des Bettes ist fixiert, die andere Hälfte erlaubt eine limitierte Beweglichkeit um zumindest<br />
180 Grad. Diese Fixierung im Zentrum des Hauses ist eine mechanische<br />
Vorrichtung, wo Positionierungen zusammenhängen, jedoch immer wieder aufs<br />
Neue verhandelt werden müssen.<br />
Daniel Spoerri, Essen, Kochen, Kunst<br />
1960 wurden in Paris am Festival d´art d´avantgarde erstmals die vom Künstler<br />
Daniel Spoerri so genannten „Fallenbilder“ ausgestellt. Ihr Autor Daniel Spoerri<br />
bezeichnete sie im Weiteren als „optische Lektionen über unbewusste Kreuzpunkte<br />
menschlicher Tätigkeiten“. Er verbot, sie als Kunst zu betrachten. Fallenbilder<br />
sind fixierte und zufällige Wirklichkeitsausschnitte aus Objekten und Unterlage,<br />
aus Tischtuch und Gedecken, die nach einem stattgefundenen Essen meistens<br />
von einer horizontalen Ausgangslage in eine vertikale Lage gebracht wurden. Es<br />
gibt keine identischen Fallenbilder. Als 1964 in der Galerie Allan Stone in New York<br />
31 Tische mit denselben Gedecken aufgestellt wurden, entstanden 31 unterschiedliche<br />
Fallenbilder. Fallenbilder zeichnen die Spuren einer stattgefundenen Einladung<br />
zum Essen auf: Teller, Essensreste, abgebrochene Baguettestücke, volle<br />
Aschenbecher, umgeworfene Weingläser etc. Oder sie zeigen den eingefrorenen<br />
Zustand eines plötzlich abgebrochenen Essens, wie zum Beispiel durch die Verkündigung,<br />
dass es sich bei dem servierten Gulasch um Pferdefleisch handle.<br />
Alle Spuren, die unsere Körper in den Interieurs hinterlassen, sind Fallenbilder,<br />
Reste und Indizien eines häuslichen Tatbestandes, die einen vorübergehenden<br />
Wirklichkeitsausschnitt des Interieurs abbilden, bevor die Spuren dieser Wirklichkeit<br />
durch Hausarbeit beseitigt werden. Um die häusliche Oberfläche von<br />
bleibenden Spuren freizuhalten und um Verfestigungen der Körperabdrücke zu<br />
verhindern, haben wir in einem taktischen Manöver zwischen dem Interieur und<br />
dem Körper ein Netzwerk aus regenerierbaren oder austauschbaren Schichten<br />
eingeführt: Fußabstreifer, Teppiche, Schoner, Läufer, Vorhänge, Handtücher,<br />
Badematten, Geschirrtücher, Schürzen, Bettücher, Überzüge, Decken, Servietten,<br />
Glasunterlagen, Tellersets und Tischtücher: Sie schieben sich zwischen das<br />
Material des Interieurs und die Hautoberfläche. Diese traditionell textilen Schichten<br />
sind maßgeblich an der hygienischen Prophylaxe des Häuslichen beteiligt. Für die<br />
Tisch- und Bettwäsche etwa gilt bis heute das Ideal der strahlend-weißen, gebügelten,<br />
im Idealfall gebleichten und gestärkten Leinen- oder Damastwäsche. Das<br />
weiße Tischtuch und die weiße Serviette sind Relikte aus dem Interieur des 19.<br />
Jahrhunderts und waren Bestandteile der ehelichen Aussteuer. Mädchen arbeiteten<br />
seit ihrem frühen Kindheitsalter an der Aussteuer, um sie bis zum Zeitpunkt<br />
ihrer Verlobung fertigstellen zu können.<br />
Daniel Spoerri, Fallenbilder<br />
Restaurant Spoerri, nach dem Dinner<br />
Futuristisches Kochen<br />
Als neue Architektur- und Kunstströmung versuchte der Futurismus auch auf alltägliche<br />
Praktiken wie das Kochen und Essen einzuwirken. 1908 deklarierte Filippo<br />
Tommaso Marinetti mit einem neuen Konzept der Literatur und einem Plädoyer<br />
für den „freien Vers“ öffentlich als „Futuristischen Manifest“. Im Gegensatz zum<br />
subversiven und jede Ideologie untergrabenden Dadaismus und im Unterschied zu<br />
den unterbewussten, Trance- artigen Zuständen des Surrealismus hatte der Futurismus<br />
die Bewegung im Sinne einer positiven Weiterbewegung und einer Dynamisierung<br />
aller Lebensprozesse (und damit letztlich auch den Krieg) zum Ziel. „Nieder<br />
mit allen vergangenen, historischen, akademischen und traditionellen Begriffen<br />
des Lebens.“ Die Lösungen waren nicht länger in den Vorbildern zu finden, dazu<br />
hatte der Krieg zu viel zerstört, sondern vielmehr im Neuen, in der Fortbewegung<br />
und einem umfassenden Konzept einer Dynamisierung. Kontinuität, Elastizität<br />
und permanente Transformation waren die künstlerischen Prämissen, unter denen<br />
futuristischen Arbeiten entstanden. Das futuristischen Manifest erklärte, dass die<br />
„dynamische Sensation“, d.h. der bestimmte Rhythmus eines Objektes gezeichnet<br />
werden muss, seine Neigung, seine Bewegung und schließlich, seine „inneren<br />
Marrinetti: Neue Stadt, neue Architektur, neue<br />
Menschen, neues Essen
Kräfte“. Die Gleichzeitigkeit der Darstellung aller Aspekte eines Gegenstandes entsprach<br />
der Simultanität und der Geschwindigkeit der neuen Lebensbedingungen.<br />
Boccioni etwa verfolgte eine synthetische Darstellung mit den Bestandteilen von<br />
Licht und Farbe, um dem Gegenstand, seinen Aspekten und immanenten Zuständen<br />
die Aspekte der Zeit, Dauer und des Prozesses der Erinnerung hinzuzufügen.<br />
Das Futuristische Kochbuch schließlich, 1932 von Marinetti veröffentlicht, sollte<br />
auch mit dem traditionellen Essen des bourgeoisen 19. Jahrhunderts brechen und<br />
Kochen und Essen in ein dynamisches, technologisches und urbanes Konzept<br />
des 20. Jahrhunderts überführen. Marinettis Kochbuch kreierte nicht neue Menüs,<br />
es sollte alle konventionellen Praktiken revolutionieren: Leicht, kalorienarm und<br />
technisch, synästetisch und dynamisch sollte das futuristische Essen dem schnellen<br />
Leben der Großstädte entsprechen und den Menschen des 19. Jahrhunderts<br />
in den modernen Großstadtmenschen verwandeln. Farben waren dabei ebenso<br />
wichtig wie Geschmack: Spinat, Tomaten, Eiweiß und Pflaumen etwa bestimmten<br />
das lustvolle Gebilde auf dem futuristischen Teller und sollten von den Zwängen<br />
des bürgerlichen Essens befreien. Im futuristischen Restaurant in Turin, das von<br />
Fillìa ausgestattet war, fanden „futuristischen Banketts“ statt, zu deren Eröffnung<br />
es einen „Totalreis, Skulpturenfleisch und Elastikkuchen“ gab. Gerüche und<br />
Geräusche wurden als sinnliche Wahrnehmungen ernst genommen, bei den so<br />
genannten „Simultanessen“ wurden Parfüms versprüht und neue Musik begleitete<br />
die Menüs. Das Restaurant war fast ausschließlich in Aluminium verkleidet, da Auminium<br />
das moderne Leben am Besten ausdrücken konnte: metallisch, scheinend,<br />
elastisch und leicht. In Kombination mit Licht sollte das Innere des Restaurants so<br />
Veränderung, Bewegung und Aktivität ausdrücken. „Pillen statt Pasta!“<br />
Effiziente Körper<br />
In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts waren es vor allem zwei<br />
Erfindungen, die deutlich machten, dass der (herkömmliche) Körper unzulänglich<br />
ist und im Sinne einer gesteigerten Produktion geformt werden musste: die Erfindung<br />
der Lochkarte durch Hollerith und die Erfindung der Fließbandarbeit durch<br />
Ford. Beide knapp nacheinander in Amerika erfundenen Strategien der Beobachtung<br />
und Kontrolle über produktive und körperliche Vorgänge hatten ihre Vorläufer<br />
jedoch bereits im 18. Jahrhundert.<br />
Eines der ersten großen städtebaulichen Ensembles, die zur Gänze auf eine<br />
optimierte Arbeitswelt ausgerichtet waren, stellt die von Claude Nicolas Ledoux<br />
1773 gebaute Salinenstadt in Arc-et-Senans in Frankreich dar. Sowohl symbolisch<br />
als auch strukturell stellt diese die optimierte Arbeit, die Kontrolle über die arbeitenden<br />
Körper sowie eine maximierte Produktion in den Vordergrund. Im Zentrum<br />
der kreisförmig arrangierten Anlage steht als Machtdemonstration das Haus des<br />
Direktors, kombiniert mit einer kleinen, wiederum zentral angeordneten Kapelle,<br />
die gewissermaßen sowohl Arbeit als auch diktatorisches Beobachten und Bestimmen<br />
dieser Arbeit sanktionieren soll. Die Anlage dient dem Zweck der optimierten<br />
Produktion einerseits und der effektivsten Überwachung über diese Produktion<br />
andererseits - kurze Wege, minimierte Bewegungen und perfekte Überwachung.<br />
Die vollkommene Integration der ArbeiterInnenhäuser in die Produktionsanlage<br />
folgte vor allem diesen Prinzipien der kurzen Wege, der ununterbrochenen Produktionslinie<br />
und der Überwachung. Wohnen wird nicht mehr länger als eine von der<br />
Produktion getrennte Einheit betrachtet, sondern man versucht eher, das Leben<br />
der Arbeitenden soweit wie möglich in die Produktion zu integrieren. Eine erste<br />
Formung des gesellschaftlichen, sozialen und physischen Körpers der Arbeitenden<br />
beginnt also gewissermaßen. Das Prinzip der Überwachung wird in den ArbeiterInnenhäusern<br />
fortgesetzt, in denen eine zentrale Halle, ein „Hotel de réunion“ mit<br />
einem wiederum zentral positionierten Herd Gemeinsamkeit ermöglicht und zugleich<br />
eine interne Kontrollfunktion ausübt. Ramón M. Reichert nennt die Form der<br />
Salinen ein „Industrie-Theater“ (siehe: Weltmaschine, Wunscherfindung). Theatralisch<br />
waren sowohl die verwendeten Formen und Applikation wie die applizierten,<br />
Salz speienden Köpfe, theatralisch war jedoch vor allem die Anlage selbst. Über<br />
eine weit in den Hügeln vor La Chaux beginnenden Achse erreicht man durch eine<br />
schmale Öffnung einen ersten Vorhof, um dann in den tatsächlichen kreisrunden<br />
Hof zu gelangen, dessen geschlechtliche Metaphorik offensichtlich scheint.<br />
Futuristisches Essen für futuristische Menschen,<br />
Pillen statt Pasta!<br />
Elizabeth Diller&Ricardo Scofidio:<br />
Indigestion, 1995. Essen als Rollenspiel,<br />
visualisiert auf einem interaktiven Videoscreen-Tisch.<br />
Salinenstadt von Ledoux: Überwachung,<br />
Kontrolle
Perfektioniert wurde die kreisförmige Anlage lediglich durch das ebenso Ende des<br />
18. Jahrhunderts entwickelte „Panopticon“, das der Engländer Jeremy Bentham<br />
im Sinne der großen, zum Vergnügen konstruierten wissenschaftlichen Schaupanoptiken<br />
benannte: ein modellhaften Gebäude, das sich sowohl als Schule, als<br />
Erziehungsanstalt, als Krankenhaus, als ArbeiterInnenwohnhaus wie auch als<br />
Gefängnis eignen sollte. Das Prinzip des Panopticons glich jenem der Salzfabrik:<br />
In einer kreisrunden, geschlossenen Anstalt sollte zentral ein Beobachtungsposten<br />
eingerichtet sein, der mit einem Blick alle rundum angeordneten Zellen visuell<br />
erfassen konnte. Dieses Prinzip wurde noch durch die Lichtführung verstärkt. Die<br />
Oberlichter waren so angebracht, dass der Aufseher selbst im Dunkeln blieb, während<br />
die Arbeitenden oder GefängnisinsassInnen beleuchtet wurden - man konnte<br />
beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Nach dem Vorbild des Panopticons<br />
wurden vor allem Gefängnisse und Erzeihungsanstalten errichtet.<br />
Jeremy Bentham, Panopticon<br />
Aufzeichnung, Abstraktion, Rationalisierung<br />
Am Ende des 19. Jahrhunderts begann man in Amerika, Codier- und Adressiertechniken<br />
zur Auswertung von gesammelten Datenmaterialien wie etwa im Zuge<br />
von Volkszählungen anzuwenden. Hermann Hollerith entwickelte dazu Lochkarten,<br />
auf denen eingestanzte Löcher einen elektrischen Kontakt ermöglichten und als<br />
Daten erfasst werden konnten. Im Jahr 1890 konnte so eine Volkszählung innerhalb<br />
von zwei Jahren ausgewertet werden, was beinahe fünfmal so schnell war<br />
wie bislang. Lochkarten dienten also vorerst der Übersetzung körperlicher Daten in<br />
abstrakte Muster sowie zu deren Aufzeichnung und Speicherung.<br />
Eine mit der Methode nach Hollerith erfolgte Volkszählung in Österreich im Jahr<br />
1891 erfasst bereits Daten wie Alter, Religion und Sprache der Personen samt<br />
Familien, die Mitbewohnenden, das Einkommen, die Anzahl der Haustiere, die Art<br />
der Kleidung, die Anzahl der bewohnten Räume samt deren Raumhöhen sowie<br />
die Daten der Geburtsurkunden. Lochkarten fanden Anwendungen in statistischen<br />
Zählungen, vor allem jedoch in der inneren Organisation der Firmen, die<br />
zunehmend wuchsen, was die Verwaltung sowie die finanzielle Betriebsführung<br />
erschwerte. Mittels Lochkarten konnten große Datenmengen verarbeitet und gespeichert<br />
werden. Mechanische Rechenmaschinen und Schreibmaschinen erleichterten<br />
den verwaltungstechnischen Aufwand, Zählmaschinen hingegen überwachten<br />
die Arbeitenden selbst. In dem Bestreben, immer größere Datenmengen zu<br />
erfassen und zu bearbeiten, entwickelte die führende Lochkartenfirma IBM schließlich<br />
die ersten Computer. Die von Hollerith entwickelten Maschinen wurden auch<br />
im Nationalsozialismus eingesetzt, um Volkszählungen durchführen zu können, in<br />
denen auch die Religionszugehörigkeit festgestellt wurde.<br />
Ètienne Jules Marey, 19. Jahrhundert: Verstehen<br />
der Physiognomie, Aufzeichnen der<br />
Bewegung, Übersetzen in abstrakte Spuren,<br />
pornografisches Interesse am Körper<br />
Edweard Muybridge, Animal Locomotion<br />
Während Ökonomen des 19. Jhdts. mit der Industrialisierung der Arbeit und der<br />
Herstellung maschineller Produktionsanlagen beschäftigt waren, legte man am Beginn<br />
des 20. Jhdts. wiederum mehr Aufmerksamkeit auf die Arbeitenden selbst, auf<br />
deren physische und psychische Konstitution sowie vor allem auf deren Effektivität<br />
bei der Arbeit. Durch die Erfindung der Lochkarte konnten betriebliche Vorgänge<br />
rechnerisch erfasst und kontrolliert werden, die Arbeitenden selbst jedoch stellten<br />
in dieser Kontrolle und Erfassung immer noch den größten Unsicherheitsfaktor dar.<br />
Die Ausklammerung dieses Unsicherheitsfaktors, d.h. die vollkommene Trennung<br />
zwischen Produktion und Entscheidungskraft der Arbeitenden über diese<br />
Produktion war somit das übergeordnete Ziel jener Untersuchungen, wie sie von<br />
Frederic Taylor und dem Ehepaar Frank und Lillian Gilbreth angestrebt wurden. In<br />
den „Principles of Scientific Managements“ legte Taylor schließlich ein optimiertes<br />
Zeitsystem fest, das jedem einzelnen Arbeitsschritt eine bestimmte Zeitspanne und<br />
somit auch eine bestimmte Lohneinheit zuordnete.<br />
1916 begann Taylor, die Untersuchungen der Arbeit zu systematisieren, indem er<br />
etwa fünfzehn Versuchsarbeitende bestimmte Arbeitsschritte vollziehen ließ, diese<br />
mit einer Stoppuhr maß und schließlich die schnellste Art, die Bewegung zu verrichten,<br />
herausfilterte. Indem er anschließend alle falschen und unnötigen Bewegungen<br />
ausschloss, konnten tabellarisch die optimierten Bewegungsabläufe festgehalten<br />
und auch kontrolliert werden. Lillian und Frank Gilbreth fanden schließlich<br />
in den „Lightline – Studies“ eine ideale Methode, um die Arbeitsvorgänge selbst zu<br />
Herman Hollerith: Datenaufzeichnung für<br />
Volkszählung, Arbeitszeitmanagement
systematisieren. Am ausführenden Körperteil eines Arbeitenden wurden Glühbirnen<br />
befestigt, die Bewegung wurde mit einer Langzeitbelichtung fotografiert und<br />
zeigte sich in der Entwicklung als eine einzige, leuchtende Spur. Mittels dieses „Zyklographen“<br />
oder Bewegungsaufzeichner konnten die Kurven als optimierte, oder<br />
aber als zögerliche, verlangsamte oder unsichere Bewegung identifiziert werden.<br />
In diesem Eleminieren aller unnötigen Arbeitsschritte erreichten die Gilbreths<br />
schließlich eine Klassifizieren der Arbeit. Sie stellten eine Summe aus möglichen<br />
Einzelschritten auf und kamen schließlich auf 17 Grundelemente, in die sich jede<br />
Arbeit zerlegen ließ. Übernommen wurden diese Erkenntnisse schließlich in der<br />
Autoproduktion durch Henry Ford, der sein revolutionäres Auto namens „Model T“<br />
nach den Gesetzen der in Einzelteile zerlegten und optimierten Arbeit entwickelte.<br />
Model T wurde aus standardisierten Einzelteilen produziert, die in einer genauen<br />
Abfolge hergestellt und zusammengefügt wurden. Arbeitende, Einzelteile, die Gesamtheit<br />
der Arbeitenden und die zusammengefügten Teile schlossen sich zu einer<br />
einzigen, perfekt organisierten Maschinerie zusammen.<br />
Im Gegensatz zur persönlichen Kontrolle durch einen Aufseher, der im Zentrum<br />
panoptischer Überwachung steht, vollzieht die Maschine selbst diese Überwachung<br />
und die ArbeiterInnen sind vollkommen dem Maschinensystem untergeordnet.<br />
Eine künstlerische Entsprechung der Fließbandarbeit wurde in den großen<br />
„Girlrevuen“ gefunden, wie sie in den 1920er und 1930er Jahren in Amerika<br />
entstanden. Eine Reihe von möglichst vielen, möglichst gleich aussehenden<br />
Revuetänzerinnen, so genante „Girls“ übten mathematisch genau einstudierte<br />
Bewegungsabfolgen in einer völligen Übereinstimmung aus. Jede individualistische<br />
Bewegung wurde ausgeschlossen zugunsten eines einzigen, kollektiven<br />
Bewegungskörpers, einer „Girlsmaschine“, deren Aufstellung entlang einer Chorusline<br />
der Perfektion einer Fließbandproduktion nachempfunden war. Weiblichkeit<br />
und Maschinenästhetik, Geschlechtlichkeit, die funktioniert wie eine Maschine und<br />
ein vervielfachter Frauenkörper folgten einer männlichen Phantasie eines neuen<br />
Lebens, das dem Stakkato der Maschinen angepasst war.<br />
Perfektionierung der Arbeit,Perfektionierung<br />
der Körper<br />
Der effiziente Haushalt und die Taylorsche Küche<br />
Im Zuge der Funktionalisierung der produktiven Arbeit wurde auch die Arbeit im<br />
Haushalt auf ihre Funktion und Effizienz hin untersucht und wurde „Fordismus“ als<br />
Prinzip auch in die privaten Haushalte gebracht. Der Funktionalismus transferierte<br />
zwei Prinzipien aus der industriellen Produktion in das private Wohnen: Effizienz<br />
und Hygiene. Die Untersuchungen, die Taylor und die Gilbreths in Amerika für die<br />
industrielle Produktion gemacht hatten, fanden nun den Einzug in das Private.<br />
Man begann, die Bewegungsabläufe in Küchen zu messen, aufzuzeichnen und<br />
schließlich zu optimieren. Unter dem Prinzip der Effizienz stattete die Industrie<br />
die Wohnung mit einer Vielzahl an technischen Geräten aus, um Arbeitsschritte<br />
zu sparen: Staubsauger, Mixer, Waschmaschine und Bügeleisen waren klein,<br />
handlich, elektrisch betrieben, stromlinienförmig geformt und mit verführerischen<br />
Formen und Oberflächen versehen. Das Prinzip der Hygiene führte die Materialien<br />
des Krankenhausstandards ein: Stahlrohr, Glas und keramische Platten garantierten<br />
keimfreie Oberflächen.<br />
Das Führen des Haushaltes, die Hausarbeit und die Hauswirtschaft wurden immer<br />
mehr zu einem wissenschaftlichen Management der elektrischen Ausstattung bzw.<br />
zu einer medizinischen Prophylaxe. Hauswirtschaftsräume wurden zunehmend<br />
zu Kontrollräumen und Haushaltsbücher waren technische Manuals. Die Küche<br />
der 20er Jahre wurde wie ein Kleinbetrieb behandelt, in dem Frauen systematisch<br />
ihre Arbeit nach einem durch die Architektur der Küche vorgelegten Plan erledigen<br />
sollten. Die Küche sollte möglichst klein sein, um Platz und Baukosten zu sparen,<br />
sie reduzierte sich also von einer Großküche zu einer minimalisierten, reinen<br />
Arbeitsküche.<br />
Die neue Ausstattung der Hauswirtschaftsräume und vor allem der Küche ging<br />
Hand in Hand mit einem neuen Frauenbild. Die „Neue Frau“ war eine befreite<br />
Frau. Diese Befreiung bezog sich nicht nur auf ihre Kleidung, sie bezog sich vor<br />
allem auf ihre Arbeitsbereiche innerhalb des Privaten.<br />
Fließbandarbeit und Girlrevues
Nicht nur die Reduktion der Ermüdung durch Hausarbeit war das Ziel, das Ziel war,<br />
Ermüdung abzuschaffen. Ermüdung durfte nicht mehr existieren. Das moderne<br />
Leben war schnell und verlangte sich schnell bewegende Körper. Die Stuttgarter<br />
Küche von Erna Meyer, die Frankfurter Küche von Grete Schütte-Lihotzky und<br />
andere verkürzten die Arbeit und reduzierten die Arbeitsschritte, wodurch Frauen<br />
in der restlichen Zeit an dem öffentlichen, männlichen Leben teilhaben sollten. Mit<br />
Abmessungen von lediglich 1,9 x 3,4m stellte die 1926 von der österreichischen<br />
Architektin komzipierte Frankfurter Küche wahrscheinlich das Rationalisierungsprinzip<br />
am besten dar.<br />
Von Ernst May für die großen Stadterweiterungen in Frankfurt in AUftrag gegeben<br />
wurde die Küche über 10.000 Mal hergestellt, ihr minimaler Zuschnitt hatte jedoch<br />
auch zur Folge, dass wiederum die Frau im Zentrum der Hausarbeit stand, lediglich<br />
durch eine Durchreiche mit dem restlichen Wohnraum verbunden. Auch die<br />
Durchreiche war ein typisches Element, das in den 20er Jahren von der industriellen<br />
Küche in die private Küche eingeführt wurde. Sie sollte unnötige Schritte in<br />
das Esszimmer ersparen. Da jedoch nur im seltensten Falle hinter der Durchreiche<br />
Dienstpersonal stand, bedeutete dies, dass die Hausfrau so lange alleine in der<br />
Küche das Essen herausreichte, bis alle Familienmitglieder zum Essen hatten.<br />
Sowohl die „Kälte“ als auch die Technologie der neuen Oberfläche der Interieurs<br />
imitierten nicht nur die männliche Arbeitswelt, sie täuschten eine männliche Arbeit,<br />
also eine männliche Öffentlichkeit vor. Das Versprechen der Moderne, Frauen<br />
durch Technologie von der Hausarbeit zu befreien, um ihnen den Zugang in die<br />
öffentliche Welt der bezahlten Arbeit zu ermöglichen, war nichts als ein modernes<br />
Täuschungsmanöver gewesen. Ein Manöver, das Frauen verführen sollte, das<br />
neue und moderne Interieur wiederum als ihren Arbeitsplatz zu akzeptieren. Dabei<br />
spielte das glatte Material und die stromlinienförmige Form eine große Rolle:<br />
Formen, Oberflächen und Farben dienten dazu, eine direkte, nahezu erotische<br />
Beziehung zwischen dem Körper und dem Gerät herzustellen.<br />
Lightline - Studies in der Küche<br />
Die Versuche mit den stromlinienförmigen Geräten stammten fast ausschließlich<br />
aus dem militärischen Bereich. Man nahm die Erkenntnisse aus den militärischen<br />
Untersuchungen, um sie strategisch in den privaten Haushalten einsetzen zu können.<br />
Das Hauptziel dabei war, den Konsum zu wecken und die Produktion dadurch<br />
anzukurbeln. Die Befreiung wie auch die Entlastung der Hausfrau durch die neue<br />
Küche blieb eine Fiktion.<br />
Viele der Arbeitsschritte, die nun durch neue Geräte effizient und produktiv ablaufen<br />
konnten, mussten erst gelernt werden. Auch wenn die Hausarbeit der Frau<br />
nach wie vor als „natürlich“ betrachtet wurde, so lag der Umgang mit den neuen<br />
Materialien, Formen und Maschinen nicht zwingend in ihrer „Natur“. Über Demonstrationsküchen<br />
wurde in Kursen gezeigt, wie das neue und optimierte Kochen<br />
ablaufen sollte. Ähnlich wie an den Fordschen Fließbändern standen Frauen an<br />
Frauen und übten idealisierte Bewegungsabläufe.<br />
Im Nationalsozialismus schließlich wurde nun wiederum eine neue, veränderte<br />
Küche Teil eines architektonischen Programms. 1941 erklärte Hitler die „Wohnküche“<br />
als die einzig richtige Küche des deutschen Volkes. Wiederum wurde mit<br />
den genuin natürlichen Eigenschaften der Frau argumentiert, die nun vor allem<br />
Hausfrau und Mutter sei und für die Aufzucht ihrer Nachkommen da zu sein hatte.<br />
Wohnen wurde Teil eines ethischen Programms und diente vor allem der Vergrößerung<br />
des deutschen Volkes. In der Wohnküche sollte sich die deutsche Familie<br />
in der Früh, mittags und abends versammeln. Dere Esstisch als wichtigester Teil<br />
dieser Küche mit der Eckbank rundherum diente der Überwachung der Kinder und<br />
der Einhaltung aller häuslichen und ethischen Pflichten. Analog zu dieser Essküche<br />
mit der nun wiederum zentralen Aufgabe der Frau als Hausfrau gestalteten<br />
sich die Häuser in einem tradierten Stil mit massiven Wänden, kleinen Fenstern<br />
mit Fensterläden und einem steilen Ziegeldach. Die zuvor formulierten Typologien<br />
für allein stehende personen, kinderlose Haushalte und arbeitende Paare wichen<br />
nun der Typologie der Familienwohnung.<br />
Frankfurter Küche (1926) von Margarete<br />
Schütte-Lihotzky mit kurzen Wegen, die Ein-<br />
Personenküche<br />
Nationalsozialistische Essküche
Bad Press<br />
1993 entwickelten die ArchitektInnen Elizabeth Diller und Ricardo Scofidio, NY, ein<br />
Projekt, das sich in ironischer Weise auf die Abhängigkeit des Häuslichen von den<br />
Paradigmen der Effizienz bezog: Bad Press. Keine andere Tätigkeit des Häuslichen,<br />
so Diller&Scofidio, sei so geprägt von den Regeln der Hygiene und Effizienz<br />
wie das Bügeln von weissen (Herren-) Hemden. In einer Installation zeigen sie, wie<br />
es wäre, wenn sich diese Regeln und Praktiken vollständig von diesen Codierungen<br />
befreien würden. Sie stellen gewissermaßen „neue Regeln“ auf, die Hemden<br />
in einer völlig neuen Form des Faltens zeigen. Genau werden die Faltanleitungen<br />
dieser „neuen Hemden“ beschrieben. Für Diller & Scofidio gilt das Beispiel des<br />
„dissidenten Bügelns“ als ein Beispiel dafür, wie sich die Praktiken des Wohnen<br />
vollkommen von jeder herkömmlichen Vorstellung und Tradition sowie auch von jeder<br />
geschlechtlichen Zuordnung (Frauen bügeln die Hemden der Männer) befreien<br />
könnten. „The articulations produced by a practice of dissident ironing could, like<br />
the system developed by inmates, reprogram the codes of efficiency.“<br />
1924 entwickelte der deutsche Architekt Ludwig Hilberseimer das wohl rationalste<br />
Stadtprojekt dieser Jahre, die Hochhausstadt. Sein Entwurf folgt fast ausschließlich<br />
der otpimalen Belichtung von Wohnungen in parallel ausgestellten, schmalen<br />
Scheiben. Anders als bei Entwürfen etwa von le Corbusier werden hier die einzelnen<br />
Funktionen nicht in einzelne Zonen der Stadt gruppiert, sondern vertikal<br />
geschichtet. In den unteren Geschossen der Stadt sind Büros positioniert, darüber<br />
die Wohnungen, die einzelnen Verkehrsarten stapeln sich in drei Niveaus, wobei<br />
die Ebene für den Autoverkehr die größte Fläche einnimmt. Hilberseimer spricht in<br />
seinen theorien von einer notwendigen „Entindividualisierung“ von Stadt: Die Stadt<br />
der Zukunft sei nicht für den individuellen, sondern für den kollektiven Menschen<br />
gemacht und solle als Organisationsdiagramm entworfen werden. Tatsächlich gleichen<br />
die Darstellungen etwa den zeichnungen Giorgio de Chiricos: glatte, kahle<br />
Wände von Häusern in leeren Stadträumen mit vereinzelten, abstrakten Körpern<br />
gleich Gliederpuppen. Nach seiner Emmigration in die USA entwarf Hilberseimer<br />
weniger vertikal verdichtete und eher sich horizontal ausbreitende, dezentrale<br />
Stadterweiterungen, deren Form er meist aus einem Verkehrsdiagramm oder aus<br />
Einflüssen wie Wind oder Lärm ableitet.<br />
Reprogramming the Codes of efficiency, Bad<br />
Press<br />
Ludwig Hilberseimer, die Hochhausstadt. Die<br />
abstrakte Stadt für abstrakte Körper<br />
Ludwig Hilberseimer in den USA, The Decentralizes<br />
City.<br />
Trennung der Verkehrswege, eine Stadt ohne Zentrum, idente Bedingungen für alle.<br />
Le Corbusier, Immeuble Villas
Le Corbusier: Ausgestelltes Wohnen als Utopie<br />
1922 präsentierte Le Corbusier am Herbstsalon in Paris ein Plan für eine gigantische,<br />
neue Stadt, die Stadt der gegenwart oder die Stadt für 3 Millionen EinwohnerInnen.<br />
Der Plan stellt gewissermaßen das Paradigma eines „Stadtplans“ als<br />
alleingültiges Mittel zur Beschreibung eines idealisierten Endzustandes von Stadt<br />
dar. Le Corbusier entwickelte einen Plan und wandte diesen gleich mehrfach an,<br />
als Plan für die neue Stadt an sich, für das neue Paris, das neue New York oder<br />
das neue Buenos Aires. In einer frühen Collage vermittelt Le Corbusier eindeutig<br />
das Prinzip dieser neuen Stadt: Wie eine Lunge soll sie Durchlüftung garantieren,<br />
wie eine Pflanze Osmose ermöglichen - die alte dichte Stadt hingegen, aus<br />
ihr müsse man ganze Stadtteile wie ein wucherndes Krebsgeschwür herausschneiden.<br />
1922 entstand der fiktive Plan, 1925 der Plan Voisin, der ein ganzes<br />
Stadtviertel in Paris ersetzen sollte. Die dichte Struktur wird herausgenommen,<br />
das Terrain geleert und aufbereitet für die neue, strahlende Stadt: 18 gläserne<br />
Türme („horizontale“ Wolkenkratzer) ersetzten die alte Stadt, dazwischen Raum<br />
für Infrastruktur. Die neue Struktur ersetzte auch in ihrer Geradlinigkeit sämtliche<br />
ungeraden Wege der alten Stadt. Die gerade Linie sei, so Le Corbusier, ein der<br />
wichtigsten Errungenschaften des modernen Menschen:<br />
Die Stadt für 2 Millionen EinwohnerInnen<br />
„Man walks in a straight line because he has a goal and knows where he is going.<br />
The curved line is that of the donkey.“<br />
Die verschiedenen Entwürfe Le Corbusiers für solche Turmstädte zeigen vollkommen<br />
symmetrische, den Parkanlagen eines Renaissanceschlosses nicht unähnliche,<br />
riesige Flächen, auf denen in kanonischer Ordnung und strenger Hierarchie<br />
nur wenige Gebäude gesetzt sind, riesige Parks mit locker verteilten Türmen in einem<br />
Abstand von 250 bis 300 Metern, kreuzförmig, 60 Stockwerke hoch, gläsern.<br />
Trotz der großen Parkfläche wäre die Bevölkerungsdichte in diesen Turmstädten<br />
„verfünffacht bis verzehnfacht“, so Le Corbusier. Analog zur formalen Logik der<br />
Struktur der Stadt sollten auch eine strenge soziale Ordnung und Hierarchie unter<br />
den Bewohnenden herrschen. So sollte das Stadtzentrum mit den 24 gläsernen<br />
Hochhaustürmen ausschließlich aus Büroeinheiten bestehen. Anschließend daran<br />
gruppierten sich sogenannte „Villen-Blocks“, die mit einem hohen Grad an Service<br />
zweigeschossige „Villen“ in verdichteter Form für eine gutbürgerliche Führungsschicht<br />
anboten. Und erst anschließend daran, an der Peripherie der Stadt, würde<br />
die städtische Mittelschicht in Form von Gartenstädten wohnen.<br />
Diese Gartenstädte wiederum waren nicht in Form von Einzelhäusern und Gärten<br />
geplant, sondern in verdichteten Blockstrukturen, in denen die Gärten als „hängende<br />
Gärten“ integriert waren, vertikal organisierte Wohnungen, die wie kleine<br />
Häuser übereinander gestapelt wären. Der von Le Corbusier gelieferte Plan ließ<br />
keinerlei Interpretationsspielraum zu, das einzige freie Element in der Planung war<br />
ein zuletzt hinzu gefügter Layer aus sich scheinbar wild entwickelnder Natur, der<br />
sich zwischen den symmetrischen Baukörpern entwickelte.<br />
Als Prototypen baute er schließlich 1925 den Pavillion L‘Esprit Nouveau auf der<br />
Ausstellung der Dekorativen Künste in Paris. Das 2- geschossige Wohnhaus wurde<br />
eingerichtet präsentiert, daran anschließend ein Ausstellungsraum mit seltsam<br />
geschwungenen Wänden für die Präsentation der großen Stadtdioramen. Verdichtet<br />
bzw. gestapelt sollten die L-förmigen Hofhäuser die so genannten „Immeuble<br />
Villas“ ergeben, groß auseinander gezogene Blockbebauungen mit riesigen<br />
Innenhöfen.<br />
Schichten, Zonen, Leere<br />
Im Zentrum der Kartesianische Wolkenkratzer<br />
Pavillion L‘Esprit Nouveau, Prototyp für die<br />
Immeuble Villas
Wohnen in Medien, Ausstellungswohnen<br />
Privates Wohnen selbst kann selbst zum Medium werden, um medial eine prototypische<br />
Architektur und ein prototypisches Wohnen zu verbreiten. Ein Beispiel dafür<br />
sind jene Bauausstellungen der 20er und 30er Jahre in Deutschland, in denen<br />
unter anderem vor allem die Frage „Wie wohnt man richtig“ beantwortet werden<br />
sollte. Wie nie zuvor wurde Privatheit so weit wie möglich von jeder Individualität<br />
befreit, um standardisiert, ausstellbar und öffentlich sein zu können.<br />
Weißenhof: Körperloses Wohnen<br />
1927 errichtete Le Corbusier auf der Weißenhofsiedlung in Stuttgart unter anderem<br />
ein Doppelhaus, welches das neue Wohnen und auch eine neue Körperlichkeit<br />
zugleich vermitteln sollte. Die beiden beinahe identischen, aneinander gebauten<br />
Häuser waren zweistöckig mit einem ebenerdigen Kellergeschoss, einem<br />
Wohngeschoss und einem als Dachterrasse ausgebauten Flachdach errichtet. Das<br />
Innere des Wohngeschosses war so konzipiert, dass sich durch verschiebbare<br />
Elemente bei Tag und Nacht zwei verschiedene Grundrisse ergaben. Tagsüber<br />
sollte die gesamte Ebene offen zum Wohnen genutzt werden. Nachts reduzierten<br />
sich die privaten Schlafzimmer auf offene Schlafnischen, ausgestattet jeweils mit<br />
einem Bett und einem Schrank für die persönlichen Dinge als Raumteiler zwischen<br />
den Zellen. In diesen Schränken, auf deren Konstruktion und Ausarbeitung Le Corbusier<br />
besonderen Wert gelegt hatte, sollten tagsüber die Schiebebetten untergebracht<br />
wurden. Dadurch entstand ein einheitlicher, großer Wohnraum mit durchlaufendem<br />
Fensterband, das sich bis in das an die Zellen angrenzende Badezimmer<br />
fortsetzte.<br />
Die Flexibilität der Häuser Nr. 14 und Nr. 15 hatte auch eine allgemein erzieherische<br />
Funktion, wie aus der Beschreibung von Alfred Roth, der die Durchführung<br />
des Entwurfes in Stuttgart übernommen hatte, hervorgeht: „Zu einem Raum, den<br />
man erst ergänzen oder gar schaffen muss, bekommt man durch die dazugelegte<br />
Arbeit ein ganz neues, engeres Verhältnis. Der Raum geht mit dem täglichen<br />
Leben mit.“ In dem verlängerten Treppenabsatz, dem „Sprechzimmer“, wo auch<br />
die „früh am Morgen erscheinenden Gäste“ empfangen wurden, sollte nach Le<br />
Corbusiers Vorstellungen vom Dienstmädchen das Frühstück serviert werden. Le<br />
Corbusiers Konzept eines modernen Wohnens war das eines bürgerlichen Intellektuellen.<br />
Während die Bewohnenden sich in diesen vom übrigen Haus exponierten<br />
Bereich zurückziehen konnten, sollte das Dienstmädchen in den übrigen Räumen<br />
alle Spuren des Schlafens beseitigen. Damit wurden auch alle Vorstellungen eines<br />
Unbewussten, Unterbewussten und Unkontrollierbaren, alle Erinnerungen an eine<br />
tatsächliche Körperlichkeit abgeschoben und verdrängt. Das Ehebett als letzter<br />
potentieller Ort eines Konflikts zwischen rationalem Handeln und subjektiven Empfinden<br />
wurde in der exakten Schnittstelle zwischen dem Bettteil der Frau und dem<br />
des Mannes gespalten und eliminiert.<br />
Le Corbusier, Weioßenhof: Körperloses Wohnen,<br />
Betten im Wanschrank, das Haus für den<br />
Tag und für die Nacht.<br />
Horizontales Wohnen, Bauausstellung<br />
Berlin 1931<br />
Bauausstellung Berlin 1931<br />
1931 wurden in einer der bedeutendsten Ausstellungen des Neuen Wohnens<br />
der Moderne in Berlin neben der neuen Architektur des privaten Wohnens auch<br />
die neuen BewohnerInnen vorgestellt. „Die Wohnung unserer Zeit“, so das Motto<br />
dieser Ausstellung, zeigte in dem von Ludwig Mies van der Rohe konzipierten<br />
Gesamtkonzept ein „Haus für ein kinderloses Ehepaar“ von Mies van der Rohe,<br />
ein „Haus für den Sportsmann“ von Marcel Breuer, ein „Erdgeschosshaus“ von<br />
Lilly Reich, Boardinghäuser, Häuser und Wohnungen für kinderlose Ehepaare,<br />
StudentInnenheime und Ähnliches. Mit den neuen Raumkonzepten wurden die<br />
neuen BewohnerInnen dieses zukünftigen Wohnens gleich mit geplant. Sie würden<br />
sportlich, alleinstehend und kinderlos sein, und das neue Wohnen dieser neuen<br />
NutzerInnen hatte sich horizontal auszubreiten, so vermitteln es Aufnahmen aus<br />
der in einer Halle gebauten Prototypen. Nur wenn das Wohnen auf einer Ebene,<br />
und dies auf der „öffentlichen Ebene“ des Erdgeschosses blieb, konnte es nicht in<br />
abgeschiedene und abgegrenzte Bereiche privater Uneinsehbarkeit, privater Individualität<br />
und falsch verstandenem „Komfort“ entkommen. Die vertikale Öffnung der<br />
Häuser, die horizontale Befreiung des Grundrisses und die Ausbreitung auf einer<br />
einzigen Ebene machte Privatheit so gering und brachte so viel Öffentlichkeit wie<br />
nur möglich in das Wohnen.<br />
Marcel Breuer, das Haus des Sportsmanns<br />
Kochschrank und fließender Raum
Die in den Folgejahren in Deutschland veranstalteten Bauausstellungen standen<br />
ab 1933 unter den Grundsätzen des Nationalsozialismus. Sowohl Wohnungs- und<br />
Haustypologien als auch die angenommenen NutzerInnen wurden zur Gänze unterschiedlich<br />
definiert. Ausstellungen wie jene in Nürnberg, Stuttgart oder Frankfurt<br />
zeigten nun kleine, überschaubare Siedlungen mit Einfamilienhäusern, einem zentralen<br />
Dorfplatz mit Dorfkrone (Gemeinschaftshaus) und Haustypen, die an das 19.<br />
Jahrhundert erinnerten: Holzfachwerkshäuser oder hell verputzte Häuser, entgegen<br />
der vormals definierten Horizontalität nun auf einen Sockel gestellt, ausgebaute<br />
Dachmansarden, kleine Fenster mit Teilungen und Fensterläden sowie durchwegs<br />
steile Dächer. Als wären alle Bemühungen der 1920er Jahre, das Wohnen<br />
zu öffnen, vergessen, wurden nun wieder geschlossene Grundrisse mit Fluren und<br />
einzelnen Zimmern propagiert. Das wichtigste Element in diesen Häusern bildete<br />
die Wohnküche, zugeordnet nun wieder der Frau und Mittel zur internen Kontrolle.<br />
Bauausstellungen nach 1931: Wohnküche,<br />
Vollfamilie, Fachwerkshäuser und Siedlung<br />
mit Dorfkrone als Idealvorstellung<br />
Traditionelle Häuser mit Sockel, Steildach und<br />
Fensterläden als 1:1 - Bauausstellung<br />
Verleihung des Mutterverdienstkreuzes<br />
Lilly Reich, Boardinghaus. Küchenlose Wohnungen mit fließendem Raum, reduzierte Möblierung. Fortschrittliche Grundrisse für eine fortschrittliche<br />
Gesellschaft als Prototyp 1:1 auf der Bauausstellung in berlin 1931.
Grün, offen, flach, ausbreitend<br />
Nahezu alle Versuche im 20. Jahrhundert, das Wohnen zu reformieren, basierten<br />
auf einem Konzept des „Grünen“. Gemeinschaftsgärten, Balkone und Terrassen,<br />
auf Pilotis gestelzte Baukörper, Belichtung, Durchlüftung, offene Übergänge<br />
zwischen Natur und Raum und freie Bewegungsmöglichkeiten waren deklariertes<br />
Ziel nahezu aller vor- und spätmoderner Wohnutopien. Insbesondere in den ersten<br />
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde in aufgelockerten, landschaftsbezogenen<br />
Wohn- und Lebenskonzepten das Allheilmittel jeglichen (städtischen) Übels<br />
gesehen. Dem Chaos der Großstadt wurde die lockere Bebauung mit Punkten,<br />
Ypsilons, Scheiben und Reihen in (nahezu) unberührtem Grün gegenüber gestellt.<br />
Raumkonzepte des Neuen Wohnens weckten ein Sehnsuchtsbedürfnis nach<br />
fließenden Übergängen zwischen innen und außen, Wohnraum und Landschaft,<br />
nach heilendem Licht, hygienischem Durchzug und befreiendem Weitblick. Die<br />
Architektur des Wohnens hatte gesellschaftspolitische und ökonomische wie auch<br />
physische und psychologische Funktionen zu erfüllen.<br />
Frank Lloyd Wright, Broadacre City. Pragmatische<br />
Einteilung, naive Wohnvorstellung<br />
Broadacre City, Frank Lloyd Wright<br />
Während europäische ArchitektInnen sich vor allem in der Neudefinition der Großstadt<br />
versuchten und neue Dichtemodelle auf leere Terrains projizierten, schien<br />
das weite Land Amerikas wie gemacht für ländliche Gegenmodelle. 1911 begann<br />
der Protagonist Amerikanischer Architektur, Frank Lloyd Wright auf einem abgelegenen<br />
Grundstück in Spring Green, Wisconsin mit dem Bau eines eigenwilligen<br />
Komplexes, der seinen persönlichen Vorstellungen von einem Leben auf dem<br />
Land entsprach: Taliesin, eine weitläufige Anlage aus Wohnräumen, Großraumateliers<br />
und verschiedenen Außenräumen. Ungewöhnlich war das Material (roher,<br />
grob behauener Stein), deutlich sichtbar die Struktur (rotes Holz) und horizontal<br />
flach die Baukörper. Ungewöhnlich war jedoch vor allem das Gemeinschaftsleben<br />
auf Taliesin. Der wegen seiner mehrfachen ehelichen und unehelichen Beziehungen<br />
argwöhnisch beobachtete Architekt bewohnte mit verschiedenen Frauen und<br />
Ehefrauen das Haus, ließ junge ArchitektInnen aus der ganzen Welt kommen, die<br />
im Atelier zeichneten, in der Großküche kochten und im Garten Gemüse anpflanzten<br />
und praktizierte mit Frauen, Kindern und SchülerInnen eine unkonventionelle,<br />
zugleich offene und puritanische Lebensform in einfacher Selbstversorgung,<br />
gepaart mit Kultur und Intellekt. Neben der Gartenarbeit zeichnete man an den<br />
wichtigsten Projekten Wrights, veranstaltete Picknicks, nahm an agrarischen<br />
Wettbewerben teil, übte selbst auferlegten Alkoholverzicht aus, organisierte private<br />
Soirées und nahm schlimme Rückschläge wie Brand, Mord und Verteidigungen vor<br />
Gericht in Kauf. Das Leben ist eben hart am Land.<br />
Broadacre: Programmatische Stadtplanung,<br />
Utopie im Grünen, flache Ausbreitung<br />
Nach zwei Jahrzehnten ruraler Erfahrung wurde daraus ein allgemeines Wohnund<br />
Lebenskonzept, das Amerika verändern sollte. 1932 polemisierte Wright in<br />
verschiednen Schriften gegen Großstädte wie New York oder Los Angeles. Sie<br />
seien wuchernde Krebserkrankungen, das eine zu stark verdichtet, das andere<br />
durch ein sich ausbreitendes Siedeln rund um das Zentrum unkontrollierbar. Da<br />
dieses Phänomen der Besiedelung ländlicher Gebiete durch Personen, die eigentlich<br />
der Stadt verpflichtet waren, nicht aufzuhalten war, müsse man Pläne in Angriff<br />
nehmen, um kontrollierte Alternativen zu schaffen. Zwei Jahre später präsentierte<br />
er in der Zeitschrift Architectural Record das erste konkrete Modell einer solchen<br />
Alternative: eine dezentralisierte Wohn- und Lebensform, weder Stadt noch Land,<br />
die sich horizontal als weitläufige, bebaute Stadtlandschaft endlos auszubreiten<br />
schien, feine Linien als Einschnitte im Boden, offen und doch höchst organisiert:<br />
„Broadacre City, a new community plan“.<br />
Broadacre City folgte dem Amerikanischen Traum, in dem Land okkupierbar ist, die<br />
Landschaft kein Ende zeigt und ein gleichförmiger, orthogonaler Raster das Land<br />
unterteilt und verfügbar macht. Stadt und Land, Bebautes und Landschaft waren<br />
nur unscharf voneinander abgegrenzt, der Raster teilte sich in ein Subsystem aus<br />
Anbauflächen und war punktuell mit Bauten markiert. Das raumgroße Modell eines<br />
vier Quadratmeilen großen Stück Landes ohne konkreten Ort vermittelte detailgenau<br />
eine heile, bunte und mit viel Natur überzogene Lebenswelt für ein selbst<br />
bestimmtes, „organisches“ Leben, basierend auf einer Landzuteilung<br />
Democracity: ein vertikales Zentrum, die<br />
restliche Stadt ausufernd
von je einem acre (ca. 4000 m²) und einem Tauschhandel von agrarischen und<br />
künstlerischen Produkten, ein Groß-Taliesin also für alle. Intellektuelle SelbstversorgerInnen<br />
würden ihre produzierten Güter auf Marktplätzen tauschen, ein<br />
seriengefertigtes Einfamilienhaus von Frank Lloyd Wright bewohnen, sich in ihren<br />
Automobilen fortbewegen und so eine wahrhaft Amerikanische Lebensweise (Usonian<br />
way of Life) leben. Als Gesellschaftsmodell mutet das Konzept heute seltsam<br />
an, der neutrale Raster hingegen besticht durchaus. Die kontextuell anpass- und<br />
ausbaubare Struktur der programmatischen Quadranten ist etwa mit der Pragmatik<br />
aktueller niederländischer Stadtplanungen vergleichbar. Ob das mit dem Tauschen<br />
Zukunft haben könnte bleibt dahin gestellt, Broadacre City wurde nie gebaut, es<br />
fehlt das Testmodell.<br />
Democracity, New York: Zentrum - Suburbs,<br />
ein neues Wohngefühl!<br />
Democracity, Futurama<br />
Wenig später, 1939, wurde das tatsächliche Ende der vertikal verdichteten Großstadt<br />
auf der Weltausstellung in Flushing Meadows, New York unter dem Titel „The<br />
World of Tomorrow“ einem breiten Publikum werbewirksam vorgestellt. In den zentralen<br />
Bauten und Wahrzeichen der Ausstellung, einer Perisphäre mit über sechzig<br />
Metern Durchmesser, begleitet von einem nadelförmigen, über zweihundert Meter<br />
hohen Trylon wurde ein Stadtmodell gezeigt, das der suburbanen Version von<br />
Wright sehr ähnlich war: Democracity, eine Stadtvision für das Jahr 2039, entworfen<br />
vom Architekten Wallace K. Harrison, ein flaches Anti - New York, ein Gegenentwurf<br />
zur Apotheose der Verdichtung. Auf zwei umlaufenden Galerien wurde<br />
unter einer einer blauen Himmelskuppel die neue Stadt bestaunt, garniert mit<br />
Musik- und Filmvorführungen, die einen Tagesablauf in Democracity simulierten.<br />
Im Zentrum der ringförmigen Struktur stand ein vereinzelter Turm, der alle kulturellen<br />
Einrichtungen beherbergen sollte (ein letzter Hauch von „Manhattanismus“, wie<br />
Rem Koolhaas in Delirious New York bemerkt), umgeben von niedrigen Wohnhäusern<br />
geringer Dichte in überwiegendem Grün. Democracity wurde bestaunt wie<br />
einstmals die großen Stadtpanoramen, nur bestimmte nun anstelle einer Skyline<br />
ein weiter, offener Horizont das Bild. Die Stadt war zum Park mutiert, Gebautes,<br />
Landschaft, Straßen und Häuser verschwammen zu einem ein Siedlungsteppich,<br />
der (noch) frohlockend eine durchgrünte Zukunft verkündete.<br />
Das Interesse der Bevölkerung an neuen Wohn- und Lebenskonzepten war<br />
enorm. In den zwei Jahren der Ausstellung wurden rund 50 Millionen BesucherInnen<br />
gezählt. Neben Democracity wurde in New York ein weiteres Modell für<br />
das zukünftige Leben gezeigt. Der Pavillon von General Motors, entworfen von<br />
Norman Bel Geddes, vermittelte eine nähere, für das Jahr 1960 gedachte Vision:<br />
„Futurama“, keine singuläre Stadt, sondern gleichsam ein ganzes Stück Amerika,<br />
bestehend aus Verdichtung, Landschaft, Landwirtschaft, utopischen Türmen und<br />
flächig verzweigten Ansiedlungen. Auf rotierenden Sitzen mit eingebauten Lautsprechern<br />
schwebten staunende Besuchende über einer gigantischen und detailgetreue<br />
gebauten, Miniaturlandschaft, deren Fiktion durchschaubar und dennoch<br />
wie alle Fiktionen, die auf Weltausstellungen gezeigt wurden, mit „ungebrochener<br />
Faszination als Zukunftsmodell in Erwägung gezogen wurde.“ Ein bekannter<br />
Radiomoderator erzählte mit suggestiver Stimme die unwahrscheinlichen, unglaublichen<br />
Möglichkeiten von Futurama: vollautomatisierte Farmen und Flughäfen,<br />
Schwebebahnen über weite Landschaften, neuartige Gebäude für Erholung,<br />
Industrie und Erziehung, Apartmenthäuser im Grünen und futuristisch verdichtete<br />
Zentren. Aus verschiedenen Kapseln, Zellen und Hüllen sollte Landschaft von<br />
nun an nicht mehr erwandert und erforscht, sondern von innen heraus betrachtet<br />
werden. Dementsprechend dominierte auch das notwendige Mittel für diese neue<br />
Landschaftserfahrung das Modell: die Highways. Auf vielfachen parallelen und sich<br />
kreuzenden Spuren und Schichten durchzogen sie die Landschaft, vermittelten<br />
die Bedeutung des Automobils und verkündeten die Botschaft: Industrieller Aufschwung,<br />
intakte Natur und fortschrittliches Leben konnten nur realisiert werden,<br />
wenn Amerika seine Städte neu baute – weit auseinander gezogen, horizontal und<br />
flach, sie mit gigantischen Highways verband und alle Bewohnenden ausnahmslos<br />
mit Autos ausstattete. Von der Kapsel des Autos in die aromatisierte Atmosphäre<br />
der Warenhäuser, die Klimahülle der Bürotürme und schließlich in das eingehüllte<br />
„Home“ des Vorstadthauses. Suburbia!<br />
Futurama: Das Versprechen der Highways<br />
Futurama: Die neue Stadt, das neue Wohnen<br />
und das neue Auto
Berlin, Hansaviertel: Interbau 1957. Die ikonisierte Moderne.<br />
„Die Stadt von morgen“. Schon die Typografie auf dem Schild der Ausstellung<br />
Interbau in Berlin im Jahr 1957 versprach viel: In Kleinbuchstaben geschrieben<br />
wendete sie sich von jedem traditionellen Diktat ab. Sie vermittelte das absolut<br />
Neue: ein neues Leben nach dem Krieg, ein Füllen der Leere, die Krieg und Bombardement<br />
hinterlassen hatten und ein neues Lebensgefühl, das in neuen Wohntypologien<br />
stattfinden soll. Die Bauausstellung Interbau 1957 zeigt, wie in einer<br />
bestimmten Zeit bestimmte Wertmaßstäbe über Wohnen euphorisch vermittelt<br />
wurden. Gesellschaft sollte nicht nur beeinflusst, sondern nach dem Krieg gewissermaßen<br />
neu kreiert werden.<br />
Dem ursprünglichsten Bedürfnis nach einer (neuen) Wohnung und (neuen) Einrichtungsgegenständen<br />
folgend wurde so ein ganzes Stadtviertel als didaktisches<br />
Instrument für ein neues Berlin angewandt. 1953 hatte der Berliner Senat zu einem<br />
Wettbewerb aufgerufen und schließlich wurden 53 ArchitektInnen (die teils zuvor<br />
aus Deutschland emigriert waren) aus vierzehn verschiedenen Ländern engagiert,<br />
um einen neuen Stadtteil im Zentrum Berlins neben dem Tiergarten zu planen, der<br />
im Krieg durch Bombenangriffe stark beschädigt worden war. Die ausschreibende<br />
Stelle gab die Forderung an die Planenden weiter, ein Quartier zu konzipieren, das<br />
den „Denk- und den Lebensformen der freien Völker“ entspreche. Somit setzte<br />
Westberlin auch einen Gegenpol zu Ostberlin und das Hansaviertel einen westlichen<br />
Gegensatz zur Stalinallee, der sozialistischen Vorstellung eines idealen<br />
Stadtteils in nur zehn Kilometer Luftlinie entfernt. Das Interesse an der dreimonatigen<br />
Ausstellung war groß, es kamen mehr als 1,4 Millionen Besuchende, denen<br />
ein offenes und demokratisches Westdeutschland mit entsprechendem Ambiente<br />
demonstriert wurde.<br />
Der städtebauliche Plan, offen, aufgelockert und durchgrünt, demonstrierte dies<br />
bereits sehr gut. Weit voneinander entfernte, zerstreute Einzelgebäude ließen<br />
keine Erinnerung an Miethausblöcke aus dem Westen oder an Machtdemonstration<br />
aus dem Osten aufkommen. Stadtplan, Freiraum und Musterwohnungen<br />
gaben den Ton an für eine neue Wohn- und Lebensform von morgen. Zur Ausstellungseröffnung<br />
wurden ein Hebekran als Aussichtspunkt und eine Seilbahn, mit<br />
der man über das Ausstellungsgelände schweben konnte installiert. Die neuen<br />
Wohnungen waren nieder (2,50m) und benötigten dementsprechend neue Möbel,<br />
da die alten schlichtweg nicht mehr Platz hatten. EIn Viertel für für 1.250 Personen<br />
steht als Ikone moderner Stadtplanung schlechthin und beeinflusste als Modellstadt<br />
die Planung großflächiger Wohnquartiere maßgeblich. Als eine der ersten<br />
großen Neuplanungen Berlins in der Zeit nach dem Krieg erfüllte das Quartier vor<br />
allem eine symbolische Funktion: Es vermittelte den Aufbruch in eine neue Ära,<br />
die sich von Krieg und Nachkriegszeit deutlich abhob und ein Wohnen unter völlig<br />
neuen Bedingungen ermöglichte. Das Projekt „Neues Hansaviertel“ ist weniger<br />
bezüglich seines Erfolges oder seines Scheiterns zu beurteilen, sondern vielmehr<br />
als ein Zeitdokument eines Jahrzehnts. Dass es bis heute ein gut funktionierendes<br />
Stadtquartier darstellt, mag vor allem an seiner innerstädtischen Lage in Zusammenhang<br />
mit einem dichten Naturraum liegen.<br />
Neue Architektur, neue Möbel, neues Lebensgefühl.<br />
Nachkriegswohnen in Berlin<br />
Ungewohnte Typen wie Splitlevelhäuser<br />
Das Märkische Virtel in Berlin, die „aufeglockerte<br />
Stadt“, das Problem der vertikalen<br />
Stapelung.<br />
Großwohnsiedlungen der Spätmoderne<br />
Großwohnsiedlungen werden heute, so stellt Sabine Kraft in ARCH+ 203 fest,<br />
heute differenzierter betrachtet. Weder könne man sie insgesamt als gescheitert<br />
betrachten, noch würden Erneuerungsprogramme für alle Siedlungen wirksam<br />
werden. Ihr Funktionieren oder Nichtfunktionieren in der Entstehungszeit sowie<br />
bis heute sei von unterschiedlichen Faktoren wie Lage, BewohnerInnenschaft,<br />
Größe, Form der Adaptierungen und vielem mehr abhängig. Ein Beispiel für einen<br />
bis heute gut funktionierenden Großwohnbau stellt die Wohnstadt Asemwald in<br />
Stuttgart aus dem Jahr 1961, genannt „Hannibal“ von den Architekten Otto Jäger,<br />
Werner Müller und H.P. Wirth dar. Drei Scheiben (zwei parallel, eine quer dazu) mit<br />
20 - 23 Geschossen mit 1140 Wohnungen und 3600 BewohnerInnen steht markant<br />
außerhalb von Stuttgart ohne jegliche Anbindung an die Stadt und funktioniert<br />
dennoch. Die Wohnungen sind mehrfach als Eigentum geplant, es gibt eine Reihe<br />
an Folgeeinrichtungen und während andere Siedlungen wie verschiedene Unités<br />
von Le Corbusier an der Randlage scheiterten, punktet Hannibal mit der Lage im<br />
Grünen.<br />
Bauteil O.M. Ungers: Freispielung von funktionales<br />
Bauteilen, Nischenbildung, Offenheit, Vielfalt,<br />
jedoch: keine Variationen in den Geschossen.
Während Hannibal in rigoroser Scheibenbauweise realisiert wurde, zeigen andere<br />
Großsiedlungen wie etwa das Märkische Viertel in Berlin aus den Jahren 1963<br />
- 1974 (städtebauliches Konzept von Werner Düttmann u.a.) einen weitaus differenzierteren<br />
Umgang mit Raum und Form. Obwohl die Siedlung im städtischen Bereich<br />
liegt und eine Reihe an geschlossenen oder halboffenen Freiräumen kreiert,<br />
weist sie dennoch weitaus mehr Probleme auf. Die Grundrisse der Bauteile von<br />
O.M. Ungers zeigen zugleich das Potential des Konzeptes wie auch dessen Problematik.<br />
Der Lageplan zeigt sich als feingliedrige Struktur, offen und beinahe organisch<br />
aneinander gefügte Zellen, die Einzelgrundrisse bieten erstaunliche offene<br />
Wohnungstypologien, der Gesamtbau konterkariert diese Feinheit jedoch in seiner<br />
vertikalen Verdichtung und eigenen Verschattung. Mit 1305 Wohnungen, Gebäudetiefen<br />
von 23 bis 32 Metern und einer Erschließungstypologie als 5 - Spänner<br />
geht <strong>Wohnbau</strong> hier an seine Grenzen. Die Ausdifferenziertheit und Asymmetrie im<br />
Grundriss erhält keine Entsprechung in der Vertikalität, es werden gleiche Typen<br />
übereinander geschachtelt.<br />
Hannibal bei Stuttgart. Rigorose Scheiben im<br />
Grünen, die dennoch bis heute funktionieren.<br />
Brutalismus. Beton, Wucherungen, Lagerungen<br />
Ab den 1970er Jahren wurden Großwohnprojekte zunehmend differenzierter, man<br />
experimentierte mit Strukturen, testete beton in allen Varianten und entwickelte<br />
teils ungewöhnlichen Wohnkonzepte. Ein solches Projekt stellt etwa das Stadtzentrum<br />
mit 600 Wohnungen, Rathaus, Bibliothek und EInkaufszentrum von Jean<br />
Renaudie in Ivry-sur-Seine aus den Jahren 1971 bis 1980 dar. Zwischen Hochhäusern<br />
entwickelt sich eine vollkommen freie Struktur, sternenförmig übereinandergelegt<br />
Grundrisse ergeben eine Vielzahl an Typologien und ein inmitten der Stadt<br />
ungewöhnliches Terrasengebilde, das sich wie ein Rhizom frei nach allen Seiten<br />
hin zu entwickeln scheint. ÄHnliche auch der Torres Blancas (es hätten ursprünglich<br />
zwei sein sollen) in Madrid aus dem Jahr 1969 vom Architekten Sáez de Oiza.<br />
Die Grundrisse des 21 Geschosse hohen Turms entwickeln sich aus Kreisen,<br />
formieren sich irregulär zu freien Gebilden und erhalten wie eine Baumstruktur<br />
gewachsen kreisrunde Terrassen. Die beiden Projekte kennzeichnen sich durch<br />
ihre markante Gestalt, den frei gelegten Sichtbeton sowie durch von jeder Doktrin<br />
der Moderne losgelöste Grundrissvarianten.<br />
Das Projekt Robin Hood Gardens von Peter und Alison Smithson ist bei aller Ambition<br />
als gescheitert zu betrachten. 1972 wurde es in London eröffnet. Mit den so<br />
genannten „Streets in the air“, großzügigen Laubengängen, die Nachbarschaftsleben<br />
ermöglichen sollten, schufen sie eine gut nutzbare, weil belichtete Variante<br />
der Innengangerschließung von Le Corbusier. Warum das Projekt letztlich scheiterte<br />
und nun abgerissen wird, bleibt unklar. Vermutlich ist es die schwierige Lage<br />
zwischen zwei stark befahrenen Straßen. Zwei geknickte Scheiben mit 7 und 10<br />
Geschossen bilden einen großzügigen Innenraum, in dem durch den Aushub ein<br />
markantes Gelände geschaffen wurde. Ein Laubengang in jedem dritten Geschoss<br />
erschließt Maisonetten, an den Knicken weitet sich der Gang jeweils zu größeren<br />
Freiräumen. Von verschiedenen Architekturpetitionen wurde versucht, den Abriss<br />
zu stoppen, unter dem Titel „Redevelopment“ wird die Erinnerung an die Spätmoderne<br />
entfernt und sollen nun 1600 neue Sozialwohnungen errichtet werden.<br />
Anders das Projekt Park Hill, 1961 von den Architekten Jack Lynn und Ivor Smith<br />
in Sheffield als mehrgeschossige, schlangenförmig geknickte Struktur gebaut.<br />
Das Projekt basiert ähnlich wie Robin Hood Gardens auf „Streets in the sky“,<br />
Laubengänge, die Maisonetten erschließen. Mit 950 Wohnungen und mehr als<br />
2000 Personen wurde es auf einem Hügel erbaut und schnell zu einem (ungeliebten)<br />
Wahrzeichen für die Stadt. Als in den 1980er Jahren eine ökonomische Krise<br />
einsetzte, waren es vor allem die hoch gelegten Erschließungsstraßen, die mit<br />
Vandalismus und Kriminalität verbunden wurden. Schließlich entschloss sich die<br />
Stadt dennoch zum Umbau anstelle eines Abrisses. Das beauftragte Büro Urban<br />
Slash entkernt den Bau zur Gänze. Der Gesamtcharakter bleibt erhalten, Teile<br />
wie die Fassenfüllungen, die zuvor wenig sensibel mit Ziegel ausgefacht worden<br />
waren, werden nun durchJack Lynn und Ivor Smith, Sheffield 1961 Leichtbauplatten<br />
ergänzt. Die Wohnungen werden teils vergrößert, die Laubengangbereiche zu<br />
semiprivaten Aneignungeflächen, die Wände zu den Küchen werden entfernt und<br />
die Bäder vergrößert.<br />
Große Wohnungen im Eigentum, gute Grundrisse,<br />
Folgeeinrichtungen für Einkaufen und<br />
Erholung. Hannibal<br />
Jean Renaudie: Vielfalt, Irregularität<br />
Robin Hood Gardens, Peter und Alison Smithson.<br />
Abriss statt Weiterdenken. Gute Grundrisse,<br />
Problematische Lage.
Haus, Heim, Heimat<br />
In den Jahren nach 1945 wurden insbesondere in den USA solche Idealvorstellungen<br />
eines eigenen Hauses wiederum wichtig. Die Frage nach leistbaren, massengefertigten<br />
und zugleich das „Home“ verkörpernden Einfamilienhäusern wurde<br />
aktuell, als Soldaten aus dem Krieg zurückkehrten und bereit waren, eine Familie<br />
zu gründen. Verbunden mit diesem Wunsch nach einer Familie war der Wunsch<br />
nach einem zwar kleinen, da günstigen, aber eigenen Haus. Die nach dem Krieg<br />
stornierende Metallindustrie führte dabei zur Produktion des ersten vorgefertigten<br />
Stahlhauses, das so genannte „Lustron House – the „all metal dream house“. Carl<br />
Strandlund hatte 1947 die Idee geboren, aus seinen vormals für Tankstellen produzierten<br />
Metallpaneelen ein System für ein Fertighaus zu machen. Mit einflussreichen<br />
Freunden unter Trumans Regierung wurde das Vorhaben geplant, hundert<br />
Häuser täglich für den Preis von je 7.000 Dollar zu produzieren. Innerhalb weniger<br />
Monate wurden die Konstruktionszeichnungen für ein eingeschossiges, rechteckiges<br />
Haus mit zwei Schlafzimmern, einem Livingroom, einem Diningroom, einem<br />
Bathroom mit Schrankraum, einer Küche und einer überdachten Veranda mit einem<br />
leicht geneigten Satteldach gezeichnet. Auch wenn Konstruktion und Material<br />
außergewöhnlich waren, wies das Haus einen relativ konservativen Grundriss und<br />
Zuschnitt auf.<br />
In der Standardausstattung inbegriffen waren vier große „Picture windows“, Heizpaneele,<br />
die in die Decke integriert waren, eine Reihe von eingebauten Schränken<br />
und Regalen in Küche, Livingroom und Master Bedroom. Bis auf den Boden, der<br />
mit Fliesen auf Asphaltbasis bedeckt war, war die gesamte Innenoberfläche mit<br />
emaillierten Metallpaneelen bedeckt, ein gewöhnungsbedürftiges Material, da Bilder<br />
anstatt mit Nägeln mit Magneten befestigt werden mussten. Die elektrisch eingerichtete<br />
Küche war über eine Durchreiche mit dem Diningroom verbunden, die<br />
Schränke in den Schlafräumen waren mit großen Schiebetüren ausgestattet und<br />
um Platz zu sparen, wurden die Türen zwischen den Zimmern in die Trennwände<br />
geschoben. Ein Wirtschaftsraum im Anschluss an die Küche machte die Konstruktion<br />
eines Kellers unnotwendig. Ein ehemaliger Flugzeughangar in Columbus<br />
wurde für die Produktion angemietet, 1946 wurden die ersten Lustron Houses<br />
errichtet, wenig später als Demonstrationshäuser geöffnet und mit entsprechender<br />
Werbung war das Interesse für die Besichtigung äußerst groß.<br />
„Florida likes the idea of a house impervious to scorching sunlight, salt air and<br />
termites!“, war etwa in Floridas Zeitungen zu lesen. Man war begeistert von der<br />
Idee, dass ein Haus gewaschen werden konnte wie ein Auto und niemals neu<br />
gestrichen werden musste. Dennoch blieb die Produktionszahl weit unter den<br />
Erwartungen. Anstelle von hundert wurden lediglich 26 Häuser pro Tag gebaut, die<br />
Errichtung war mit 300 Stunden zwar sportlich, blieb aber weit über den Versprechungen.<br />
1949 wurde zum Standardtypus mit zwei Schlafzimmern zusätzlich der<br />
Typus „Deluxe“ mit drei Schlafzimmern angeboten. 1950 wurde schließlich ein<br />
vom Architekten Carl Koch verändertes Modell angeboten, das sich mit großen<br />
Fenstern zum Garten öffnete und konstruktiv den Stahlverbrauch auf ein Minimum<br />
reduzierte. Um die Häuser entsprechend vermarkten zu können wurde die „Lustron<br />
family“ konzipiert. Eine fiktive dreiköpfige Familie wurde bei ihren Rollen entsprechenden<br />
häuslichen Tätigkeiten fotografiert. Die Frau des Hauses beim Kochen<br />
und im Hauswirtschaftsraum, der in seiner Ausstattung eher einer industriellen Produktionsanlage<br />
ähnelte als einem privaten Haushalt, der Mann des Hauses nach<br />
getaner Arbeit beim Zeitunglesen. Mit der ersten Produktion von amerikanischen<br />
Serienhäusern wurden amerikanische Rollenbilder gleich mitgeliefert. Die Lustron<br />
Company existierte nur drei Jahre und produzierte insgesamt 2500 Häuser. Die relativ<br />
geringe Produktionsdauer hatte wohl mit dem sperrigen Material Stahl zu tun.<br />
Die Lustron - Family<br />
Von der Stahlproduktion zur Hausproduktion<br />
Praktisch, schnell errichtet, günstig<br />
Der Lustron - Truck<br />
Levittown<br />
Eine Fertighausproduktion von Holzhäusern im großen Stil hingegen wurde 1946<br />
vom Industrieunternehmen Lewitt and Sons in Angriff genommen. Die während der<br />
Wirtschaftskrise gegründete Firma hatte bereits vor dem dem Zweiten Weltkrieg<br />
einige kleinere Siedlungen. Nach dem Krieg wurde von Abraham Levitt und den<br />
beiden Söhnen William und Alfred schließlich ein System für eine Massenpro-<br />
Levittown Long Island, der kollektive Traum des<br />
Nachkriegsamerika
duktion von Fertighäusern entwickelt für Siedlungen in unglaublichen Ausmaßen.<br />
So genannte „Levittowns“ entstanden am Rand bzw. außerhalb von Großstädten<br />
in der Nähe von New York, in Pennsylvania und auf New Jersey, bildeten in sich<br />
abgeschlossene Siedlungen mit mehr als 17.000 identischen Häusern und eigener<br />
Infastruktur und erfüllten einen kollektiven Amerikanischen Traum der Lower<br />
Middle Class.<br />
Die Miniaturausgaben amerikanischer Villen wurden zu denkbar niedrigsten<br />
Preisen angeboten und waren auf die aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten mit<br />
ihren neu zu gründenden Familien zugeschnitten. Der erste Typus, den Levitt auf<br />
den Markt brachte, war das so genannte Cap Code Haus – eine einfache Box mit<br />
steilem Dach. In diesem Typ orientierte sich die Küche noch auf die Straße, um der<br />
in der Küche arbeitenden Frau die optimale Kontrolle über die auf der Straße spielenden<br />
Kindern zu ermöglichen. 1949 schließlich brachte Levitt ein neues Modell<br />
auf den Markt, das so genannte Ranch House, in dem nun der Living- und Diningroom<br />
zum privaten Garten orientiert war, Zeichen einer zunehmenden Privatisierung.<br />
Beide Häuser waren für die 1950er Jahre relativ konservativ, entsprachen<br />
jedoch vollkommen dem Ideal der Nachkriegszeit.<br />
Das Haus (oder Home) wurde nun als ein von der restlichen Stadt und vom Ort der<br />
Arbeit möglichst weit getrennter Ort betrachtet. Das Vorstadthaus, das sich beinahe<br />
zur Gänze zum privaten Garten hin öffnete, wurde zur kollektiven Wunschvorstellung<br />
Amerikas, ein Ort, an dem man (bzw. der Mann) nach getaner Arbeit<br />
zurückkehren konnte. Die rigorose Teilung zwischen Ort des Wohnens und Ort<br />
des Arbeitens bewirkte auch eine geschlechtsspezifische Teilung des Raums. Der<br />
männliche Ort der produktiven Arbeit fand seine Entsprechung im weiblich konnotierten<br />
Raum des Wohnens, der nun auch weit abseits der Stadtzentren in den<br />
neuen Vororten lag. Dieser Ort wurde sehr bald von zusätzlichen Orten für Frauen<br />
begleitet, den Orten der Konsumation. Güter füllten in den Häusern die Leere, die<br />
mangels produktiver Arbeit entstanden war. Die männliche produktive Arbeit fand<br />
eine Entsprechung in weiblichem Konsum, der über entsprechende Werbung als<br />
unwiderbringliche Notwendigkeit vermittelt wurde.<br />
Tatsächlich vermittelt wurde dies über das Fernsehen. Jene Programme, die in den<br />
1950er Jahren in den neu installierten TV – Sets der Vorstadthäuser gesendet wurden,<br />
waren so konzipiert, dass Frauen die Illusion vorgespielt wurde, sie befänden<br />
sich tatsächlich in der Öffentlichkeit. Fernsehen erlangte in Amerika genau zu dem<br />
Zeitpunkt große Verbreitung, als ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung in die<br />
Vorstädte und in private Häuser gesiedelt war. Häuser in Levittown waren nicht nur<br />
besonders preisgünstig und mit einer von General Electric entwickelten „Wunderküche“<br />
ausgestattet, sie wurden mit einem fix unter der Stiege des Livingrooms<br />
eingebauten Fernsehapparat errichtet. In einer Serie von persönlichen Fotos, die<br />
eine Familie in Levittown, Long Island von sich aufnahm, sind immer wieder Familienmitglieder<br />
vor dieser entlang der Treppe angeordneten Fernsehwand abgebildet.<br />
Fernsehen trug viel dazu bei, den Ort des privaten Heims als Zufluchtsort nach der<br />
Arbeit zu sehen. Zugleich festigte es die traditionellen Strukturen von geschlechtlicher<br />
Arbeitsteilung. Das moderne Haus, durch Picture windows geöffnet und durch<br />
Medien scheinbar mit der Außenwelt verbunden, war tatsächlich auf typisierte Verhältnisse<br />
zugeschnitten, in denen Frauen den Haushalt und die Kinder versorgten<br />
und Männer der produktiven Arbeit nachgingen.<br />
Organischer Plan, identische Häuser, keine<br />
Garagen<br />
Die Idealfamilie vor dem Idealhaus<br />
Cap Code - Typ<br />
Fix montierte Fernseher, auf Konsum zugeschnittene<br />
TV -Programme, Shoppingmalls<br />
Monsanto House of the Future. „The future won‘t wait“<br />
Ideale Wohnvorstellungen waren in der Geschichte der Prototypentwicklung meist<br />
auch mit Interessen von Industrien verbunden. Neue, seriengefertigte Häuser<br />
sollten die Betonindustrie (1920 - 1933), die Holzindustrie (1933 - 1945), die<br />
Stahl- und Asbestindustrie (1945 - 1955) des jeweiligen Landes beleben. Eine<br />
Verstrickung zwischen industriellem Interesse eines Großkonzerns, universitärer<br />
Forschung und der Macht eines Unterhaltungskonzernes zeigt das „Monsanto<br />
House“, ein Versuchshaus aus Plastik, das 1957 vom Disneykonzern, vom Konzern<br />
Monsanto, führend in der Entwicklung von chemischen Stoffen und Düngemittel<br />
und vom Massachustes Institute of Technology in den USA entwickelt wurde<br />
und das zwölf Millionen Interessierte als Haus der Zukunft besichtigten: Plastik<br />
Monsanto House: Glückliche Zusammenfügung<br />
von Industrie, Unterhaltung und universitärer<br />
Forschung
als Konstruktionsmaterial, Teppich, Vorhangstoff, Polsterbezug und Objektdesign<br />
verbunden mit der Suggestivität der filmischen Vermittlung durch Walt Disney. „It<br />
was decided that only a full-scale display house would demon strate these grow ing<br />
appli cations both to builders and the public.“<br />
1957 wurde in Disneyland, Kalifornien im so genannten „Tomorrowland“ vor dem<br />
Hintergrund eines künstlichen Matterhorns in kleinem Maßstab das Prototypenhaus<br />
errichtet. Eingeschossig, auf einem Sockel aufgestelzt und mit vier auskragenden,<br />
kreuzförmigen Flügeln versehen wurde das Neue des Wohnens vor allem<br />
durch das Material Plastik vermittelt. „Better living through chemistry“, so lautete<br />
das Motto von Monsanto und nach diesem Motto war tatsächlich nahezu das<br />
gesamte Haus samt Einrichtung aus Plastik hergestellt. L- förmige, abgerundete<br />
Paneele wurden vor Ort zusammen montiert, das Innere der Kreuzflächen war<br />
zur Gänze verglast und technische Neuheiten wie ein bewegliches Waschbecken<br />
(aus Plastik), ein neuartiges Tastentelefon (aus Plastik), ein Mikrowellenherd (aus<br />
Plastik), eine zentrale Klimakontrolle sowie frei geformte Plastikeinrichtungen<br />
begeisterten die BesucherInnen. “The floors on which you are walking, the gently<br />
sloping walls around you, and even the ceilings are made of plastics.”, so lauteten<br />
die begeisterten Berichte. Mit Adjektiven wie „ultramodern“ oder „entirely synthetic“<br />
wurde das Ausstellungshaus als ein Blick in die Zukunft des Wohnens vermittelt.<br />
Man berichtete, die Flügel des Baukörpers würden gleichsam über der (künstlichen)<br />
Landschaft schweben, die einzelnen Zimmer seien für den „Boy of the<br />
future“ und für „the girl of the future“ entwickelt, die Badezimmer seien aus einem<br />
Stück (Plastik) geformt und im Masterbedroom sei ein gigantischer, raumhoher TV<br />
- Screen montiert.<br />
1960 wurde das Monsanto House bereits umgebaut, vieles, was 1957 noch zukunftsweisend<br />
gewesen war, war drei Jahre später bereits Standard in amerikanischen<br />
Haushalten geworden. Die Firma Monsanto verwendete die Erfolgsberichte<br />
über das Ausstellungshaus, um ihre Produkte zu platzieren, für Disney war es Teil<br />
eines größeren Ausstellungskonzeptes, das Einblicke in das Leben der Zukunft<br />
geben sollte und dennoch erwies sich Plastik nicht wirklich zielführend als Baustoff<br />
für <strong>Wohnbau</strong>ten, was sich spätestens beim schwierigen Abbruch des Hauses im<br />
Jahr 1967 erwiesen haben mag.<br />
Leicht, offen, modern, aus Kunststoff<br />
Teppich aus Plastik, Möbel aus Plastik, Konstruktion<br />
aus Plastik<br />
EPCOT - Experimental prototype community of tomorrow<br />
Das Monsanto House blieb nicht die einzige Vision, die Walt Disney in Bezug auf<br />
ein Wohnen und Leben der Zukunft entwickelte. Am Beginn der 1960er Jahre<br />
begann er zum einen, die Ostküste der USA für einen zweiten Vergnügungspark<br />
zu sondieren, zum anderen entwickelte er eine utopisch anmutende und doch<br />
baubare Vision einer künstlich errichteten Stadt. EPCOT - Experimental prototype<br />
community of tomorrow lautete der zukunftsweisende Name des Projektes, geplant<br />
für ein Grundstück in Orlando, Florida, das schließlich 1971 zu Disneyland werden<br />
sollte. Diese sehr genau formulierte Vorstellung eines besseren Lebens in einer<br />
besseren Stadt ist nur in Zusammenhang mit der filmischen Produktion Disneys<br />
zu verstehen. Filmische Elemente, utopischer Charakter, eine relativ wirklichkeitsfremde<br />
Vorstellung gepaart mit einer genauen Regelung gleich einem Drehbuch<br />
sowie der traditionelle politische Hintergrund Disneys formierten das Terrain, in<br />
dem die Idee von EPCOT entstand.<br />
„A showcasing and testing and demonstrating new materials and systems“, so<br />
beschrieb Disney sein Vorhaben. Sein Plan basierte auf einer Kritik der modernen<br />
Großstadt, die chaotisch, schmutzig und gefährlich sei. 1964 hatte Disney seine<br />
Vorstellungen bereits bei der Weltausstellung in New York demonstriert, der Plan<br />
für ein Disneyworld an der Ostküste gedieh und schließlich kaufte Disney ein Stück<br />
Land in der Größe von 120km2 in der Nähe von Orlando, Florida. Am 27. Oktober<br />
1966 präsentierte Disney das Projekt: Ein Vergnügungspark und eine Stadt für<br />
20.000 Einwohnende. Das Konzept dieser Stadt war prototypisch aufgebaut und<br />
sollte, so Disney in der ganzen Welt das Problem der Stadt an sich lösen. Das<br />
Stadtmodell selbst war traditionell, auch traditionell utopisch in seiner Mischung<br />
aus neuester (noch nicht realisierter) Technologie und rigiden Stadtregeln. Ein<br />
radialer Aufbau verdichtet sich im Zentrum und wird in den Außenringen lockerer.<br />
Geschichten erzählen: Der mächtigste Konzern<br />
der USA definiert das Wohnen der Zukunft<br />
Futuristische Architektur, traditionelles Konzept
Erschlossen werden sollte die Stadt durch den WEDway (peoplemover), eine<br />
Schwebebahn in erhöhter Lage, der Stadt-eigene Flughafen sollte Disneyworld<br />
und EPCOT an die Welt anschließen. „The pedestrian will be the king“. Im Zentrum<br />
sollte ein Dom ein künstliches Klima schaffen für Shopping, im Brennpunkt des<br />
Kreises stand ein 30- geschossiges Hotel und Convention Center. In den Außenringen<br />
sollten 20.000 EinwohnerInnen in verdichtetem Flachbau wohnen, umgeben<br />
von einer Stadteigenen Industrie und einem Grüngürtel mit Erholungseinrichtungen,<br />
also eine sehr herkömmliche Idee von Stadt, kombiniert mit einem rigiden<br />
Regelwerk und neuester Technologie.<br />
Niemand sollte Land besitzen, alle EinwohnerInnen sollten bis an ihr Lebensende<br />
arbeiten, Personen, die sich nicht an die Regeln hielten, sollten der Stadt verwiesen<br />
werden, es gab kein Wahlrecht für BürgerInnen, da sie ja kein Land besassen<br />
und EinwohnerInnen in den besten Nachbarschaften sollten von Disney ausgewählt<br />
werden, insofern sie sich für die Stadt engagierten.<br />
Bis zu seinem Tod im Jahr 1966 forcierte Disney das Stadtprojekt. Die Bilder, mit<br />
denen Disney das Projekt propagierte, zeigen eine ambivalente Haltung. Im Stadtzentrum<br />
sind alle Gebäude höchst futuristisch konzipiert, in den Wohnbezirken der<br />
Außenringe zeigen sich höchst traditionelle Haustypen mit historisierenden Fassaden.<br />
Organischer Plan, genaue Regeln<br />
„It will be a planned, controlled community, a showcase for American industry and<br />
research, schools, cultural and educational opportunities. In EPCOT there will be<br />
no slum areas because we will not let them develop. There will be no landowners<br />
and therefore no voting control. […] There will be no retirees; everyone must be<br />
employed. One of the requirements is that people who live in EPCOT must help<br />
keep it alive.“<br />
Das propagierte Glück und die Beschäftigung für alle konnten nur realisiert werden,<br />
wenn der Disneykonzern die Kontrolle über das Land verfügte und die Regeln<br />
für die Stadt definierte. Zwei Monate, nachdem Disney sein Projekt öffentlich<br />
vorgestellt hatte, starb er. Das Stadtprojekt wurde aus mehreren Gründen nicht<br />
weiter verfolgt, zum einen fehlte die leitende Figur Disney, zum anderen war die<br />
wirtschaftliche Entwicklung nicht entsprechend. In Folge entstanden auf dem Areal<br />
Disneyworld sowie die ebenso vom Disneykonzern geplante und realisierte, ähnlich<br />
regulierte Stadt Celebration als eine der ersten künstlichen (Gated) Communities<br />
in den USA, eine reduzierte aber umso ausformuliertere Version von EPCOT.<br />
Celebration<br />
Im Sinne des New Urbanism basiert auch Celebration aus einer Kombination von<br />
tradierten Wohnformen und Nachbarschaften und moderner Kommunikationstechnologie.<br />
1995 wurden die ersten Häuser verkauft. Wie EPCOT wurde auch<br />
Celebration für 20.000 BewohnerInnen geplant. Autofreie Straßen sollten nachbarschaftliche<br />
Kontakte erzeugen, tradierte Hausformen im Stil der kolonialen<br />
„Südstaatenhäuser“ sollten das Gefühl einer „guten alten Zeit“ näher bringen. Die<br />
Eigenart von Celebration liegt wohl in der Kombination von Tradition (oder besser<br />
gesagt jenen Bildern, die Tradition vermitteln) und Technologisierung. Celebration<br />
war eine der ersten Städte, die zur Gänze mit einem digitalen System für Serviceeinrichtungen<br />
ausgestattet war. Per Intranet kann etwa eine KrankenpflegerIn<br />
laut Foto bestellt werden, die Stadt verfügte sehr früh über einen internen Chatroom<br />
und im Gegensatz dazu symbolisiert der weisse Lattenzaun rund um die frei<br />
stehenden Häuser Sicherheit und Kontrolle über das private wie öffentliche Leben.<br />
Celebration ist nicht wirklich eingezäunt, die Community bleibt jedoch unter sich,<br />
das Klientel wird über Wohnungspreise reguliert.<br />
Neue Technologie gepaart mit traditionellen<br />
Vorstadthäusern<br />
Auch die Form der Stadt orientiert sich an EPCOT. Wiederum radial aufgebaut,<br />
allerdings nur in einem Halbkreis wird die fehlende Hälfte durch einen künstlichen<br />
Teich ergänzt. Im Zentrum aller amerikanischer Häuser nach 1960, dort, wo das<br />
TV - gerät platziert ist, liefert der von Disney betriebene Stadt-eigene Sender alle<br />
Neuigkeiten der Stadt direkt in die Haushalte.<br />
Wohnen wie für Mickeymouse: Celebration
Gated Communities als späte Form utopischen Inseldenkens.<br />
Wie Ethnofood, Eventkultur und Cluburlaub orientiert sich nun auch spätkapitalistisches<br />
Wohnen vor allem an Themen. Mit thematisch verdichteten Bauvorhaben<br />
wie Golfsiedlungen, Teichsiedlungen, Reitsiedlungen, intelligentem Wohnen, autofreien<br />
Siedlungen und Ökodörfern locken InvestorInnen ausgesuchte Schichten<br />
an. Das marktgerechte Angebot solcher selbstgewählter Wohnghettos gehorcht<br />
dem steigenden Wunsch nach vorgefertigten Lebensmodellen. Die Bedeutung von<br />
Themensiedlungen liegt daher weniger im Thema selbst als in der synergetischen<br />
Konzeption eines exklusiven Wohnmodells für eine limitierte Anzahl von NutzerInnen,<br />
in dem ein konformer Lebensentwurf von vornherein inkludiert ist.<br />
Die Idee eines solchen Themenwohnens stammt aus den USA. Dort gehören<br />
ausgesuchte Reservate der Reichen, in die Sport, Shopping und Betreuung inkludiert<br />
sind, seit den 90er Jahren zum alltäglichen Bild der Städte und Vorstädte.<br />
Hier bedeuten thematische Wohnsiedlungen vor allem die Abgrenzung und das<br />
Ausschließen von Anderen. Das Motiv für den Rückzug in Intentional Communities<br />
und Common-Interest-Developments liegt in der irreal steigenden und medial<br />
dramatisierten Angst vor der Gefahr in amerikanischen Großstädten. Diese Angst<br />
bewirkt das Absiedeln all jener aus den Stadtzentren, die es sich leisten können,<br />
was wiederum die ohnehin steigende Polarisierung der Gesellschaft verstärkt. Geschlossene<br />
Wohngemeinschaften sollen die wohlhabende Klasse vor ethnischen<br />
Minderheiten, MigrantInnen, Obdachlosen und Gewalttätigen schützen, artifizielle<br />
„Dörfer“ und Enklaven des Glücks abseits des potentiellen Verbrechens in der<br />
Großstadt. In härteren Varianten werden Exklusivität und Status der Siedlung sowie<br />
die Differenz von Orten und Personen auch baulich manifestiert.<br />
Über eine Festungsmentalität verwirklicht die thematisch von dem Begriff der Sicherheit<br />
dominierte Architektur solcher Gated Communities die Teilung der Gesellschaft<br />
in Ein- und Ausgeschlossene. In den von Mauern umgrenzten Wohnghettos<br />
mit strategischen Bepflanzungen und Videoüberwachungsanlagen sorgt ein<br />
privater, mit Waffen ausgestatteter Sicherheitsdienst, die selbsternannte Polizei, für<br />
Ordnung. Gated Communities bilden ultimative Wohnfestungen, die an mittelalterliche<br />
Städte mit Stadtmauern erinnern, sie verschweissen die von ihr Eingeschlossenen<br />
zu einer verschworenen Gemeinschaft und verwandeln ganze Stadtteile in<br />
„No go aereas“ für Ausgeschlossene. Räumliche Prozesse, die Wohnsiedlungen<br />
in Festungen verwandeln, visualisieren Exklusionsprozesse von Minderheiten, die<br />
auf sozialer und ethnischer Ebene längst erfolgt sind. Sie schließen also längst aus<br />
der Gesellschaft Ausgeschlossene zeichenhaft neuerlich aus.<br />
Neue Häuser, vermittelt im Stil um 1900<br />
Logo: weißer Lattenzaun, Ahornbaum, sichere<br />
Straßen, Vernetzung<br />
Die Eröffnung, weltweit vielbeachtet<br />
Truman Show, Seaside<br />
Als 1998 der Film „The Truman Show“ in den Kinos gezeigt wurde, waren im „Sunbelt“<br />
der USA bereits einige Hunderte thematischer Modellsiedlungen entstanden,<br />
die den Stil der im Film gezeigten Architektur zu imitieren schienen. Die Filmstadt<br />
„Seaheaven Island“, im Drehbuch als künstliche Stadtkulisse für den Protagonisten<br />
Truman Burbank dargestellt, verkörperte einen Stil, der Erinnerungen an jene Zeit<br />
weckte, in denen Straßen noch sicher, Communities noch intakt und Familien noch<br />
glücklich gewesen waren. Tatsächlich erwies sich die Realität von „Seaheaven<br />
Island“ schneller, echter und authentischer als die im Film dargestellte, hyperreale<br />
Illusion. „The Truman Show“ wurde nicht in der Kulisse einer potemkinschen Stadt<br />
gedreht, sondern in der soeben fertiggestellten Stadt „Seaside“, eine auf 90 Hektar<br />
entlang der Küste im Nordwesten von Florida erbaute, nahezu prototypische Themensiedlung,<br />
die das Flair einer Feriensiedlung vermitteln soll. Auch wenn „Seaside“<br />
nicht physisch von der Umgebung abgezäunt ist, vermittelt es dennoch den<br />
Eindruck einer geschlossenen Gemeinschaft, die unter sich bleiben will: Häuser<br />
wie im Bilderbuch, umgeben von einem weißen Jägerzaun und Symbole eines vergangen<br />
geglaubten Glücks. Im viktorianischen Stil verkörpern sie die Sauberkeit,<br />
Moral und Sicherheit einer Kleinstadt der Jahrhundertwende, als die Welt noch in<br />
Ordnung schien.<br />
Rund um die vielbeachtete Planung von Seaside entstand die Bewegung des<br />
„New Urbanism“. Die Planenden dieses „Neuen Städtebaus“ vertreten die Ideolo-<br />
Häuser im Südstaatenstil, Nachbarschaft,<br />
Überwachbarkeit<br />
Fontana: Industrie, Macht und Idealvorstellung<br />
von Wohnen
gie der intakten, homogenen Kleinstadt, die von keinerlei Verdichtung oder Strip<br />
verunstaltet ist und praktizieren Städtebau mit den Paradigmen einer präindustriellen<br />
Zeit. Die fiktiven Kleinstädte, die jeden realen Vorbilds entbehren, werben,<br />
ähnlich wie die nur für Truman Burbank gebaute Stadt, für ein ausschließliches Klientel,<br />
das sich von der Heterogenität normaler Städte der USA abheben soll. Eine<br />
solchermaßen homogene, wie aus einem Guss gemachte Gesellschaft erinnert<br />
auch an jene Gemeinschaften, die etwa in frühen Utopieentwürfen wie Campanellas<br />
„Sonnenstaat“ oder Thomas Morus „Utopia“ beschrieben wurden: eine ausgesuchte,<br />
glückliche und homogene Gemeinschaft, aufrechterhalten durch ein rigides<br />
und moralisierendes Regelwerk.<br />
Fontana: Sicherheit, Abgrenzung, Gated<br />
Community ohne Gate<br />
FONTANA. Heimatliche Variation<br />
Auch in Österreich steht seit 1998 ein „Celebration“ nicht unähnliches, geklontes<br />
amerikanisches Dorf. 1994 erwarb der kanadische Autozulieferant steirischen<br />
Ursprungs, Frank Stronach, 20km südlich von <strong>Wien</strong> am Rand der niederösterreichischen<br />
Gemeinde Oberwaltersdorf ein 170 ha großes Grundstück, um darauf<br />
vorerst die Europazentrale des Magnakonzerns zu errichten. Um seinen GeschäftpartnerInnen<br />
ein entsprechendes Ambiente bieten zu können, errichtete Stronach<br />
im Anschluss an die Firmenzentrale einen Wohnpark sowie einen der größten<br />
Golfplätze Europas: Fontana.<br />
Das Konzept der Siedlung folgt dem amerikanischen Vorbild einer distanzierten<br />
Gemeinschaft mit homogenem Bau- und Lebensstil. Siedlungen wie Fontana<br />
funktionieren vor allem durch ihre isolierte Lage. Wenn die Stadt selbst keinen<br />
geeigneten Lebensraum mehr bietet, der den gehobenen Ansprüchen entspricht,<br />
so wird abseits der Stadtzentren das künstliche Modell einer Kleinstadt entworfen,<br />
das besser ist als das Vorbild Stadt selbst, da es spezifische Themen fokussiert<br />
und unerwünschte Themen ausschließt. Das Leben kann so fast ausschließlich<br />
in „sicheren“ Orten organisiert werden: Von der Wohnung kommend steigt man in<br />
das Auto, um über die Autobahn direkt zum Arbeitsplatz, in die Shoppingmall oder<br />
in das Stadtzentrum zu gelangen, ohne mit unerwünschten Personen und Orten,<br />
also mit dem Unbekannten und Fremden der Stadt in Kontakt zu kommen.<br />
In Fontana regelt sich der eingeschränkte Zugang durch den Preis , der von vornherein<br />
bestimmte Schichten und Personen abweist.<br />
Apartmentwohnungen in Schloßform<br />
Der 10 ha große See mit weißem Sandstrand, das exklusive Clubhaus, getarnt<br />
als Neoschloss, der professionelle Fitnessclub, die Golfanlage, Tennis, eine<br />
Haubengastronomie und klassizistische Häuser im Südstaatenstil verströmen im<br />
alltäglichen Wohnen das Gefühl eines exquisiten Urlaubsambientes und weisen<br />
jene ab, die sich um profanere Dinge des Lebens kümmern müssen. Die von Peter<br />
Marcuse am Ende der 80er Jahre heraufbeschworene „geviertelte Stadt“ erhält<br />
nun ihr Pendant, ihre Außenstelle, ihre Eremitage mitten im Grünen, über ein strategisches<br />
Konzept gleichsam „natürlich“ befestigt und wie von selbst isoliert, ein<br />
Luxusghetto der Reichen, Schönen und Mächtigen. Bei solcher Exklusivität bleibt<br />
die unerwünschte Klientel freiwillig draußen.<br />
Die Bilder, mit denen für die Wohnungen und Häuser geworben wird, gleichen<br />
jenen ersten Bildern, mit denen David Lynch im Film „Blue Velvet“ die scheinbar<br />
sorglose und heile Welt der Kleinstadt Lumberton vermittelt: leuchtend rote und<br />
gelbe Blumen vor einem weiß gestrichenen Zaun unter blitzblauem Himmel. In<br />
dem beigefügten Text wird Fontana unter dem Slogan des „Paradieses“ verkauft:<br />
ein „Tennisparadies“ mit fünf ganzjährig bespielbaren Hallenplätzen und 9 „bestens<br />
präparierten“ Freiplätzen, ein „18-Loch-Golfparadies“, das sowohl das „Beste<br />
aus dem europäischen“ als auch aus dem „nordamerikanischen Raum“ zu einem<br />
„beeindruckenden Freizeiterlebnis“ verbindet und ein „Wohnen wie im Paradies“ in<br />
350 Häusern und 65 Apartments, mit „einzigartige Lebensqualität“ inmitten „herrlicher<br />
Natur“. Die Häuser dieses paradiesischen Wohnens vermitteln den Eindruck<br />
einer Villa aus dem 19. Jahrhundert mit großer Wohnhalle im Erdgeschoss und intimen<br />
Schlafräumen unter einem Stabilität und Ewigkeit versprechenden, gewalmten<br />
Dach, massiven oder zumindest Massivität vortäuschenden Wänden, klein<br />
unterteilten Fenstern und dicken Balustraden an den Balkonen. Auch die Grundrisse<br />
der Wohnungen repräsentieren massive Zurückgezogenheit: abgeschlossene,<br />
Badesee und Golfclub
isolierte Zimmer, die über eine Unzahl an Gängen und Fluren erschlossen werden,<br />
ein Wohnsalon sowie eine dem herrschaftlichen Stil des Hauses entsprechende,<br />
große „Wohnküche“. Die KundInnen von Einzelhäusern können ein Grundstück<br />
erwerben und anhand eines Musterhauses aus acht Grundrissen sowie aus einer<br />
Farbpalette mit 25 Pastellfarben wählen. Alles Weitere ist vorbestimmt.<br />
Fontana verkörpert ein in eine exklusive Freizeitwelt eingebundenes Wohnen<br />
gleich einem Cluburlaub, in dem individuelle Entscheidungen so gering wie möglich<br />
gehalten werden. Die Gartengestaltung entwerfen hauseigene GartenarchitektInnen,<br />
die Verwaltung erfolgt durch das Facility Management, „Greenkeeper“<br />
kümmern sich um das Grün und eine eigene Securityfirma sorgt für die Sicherheit.<br />
Eine Studie über den Fontana-Club untersuchte die Auswirkungen der Anlage auf<br />
die bestehende Infrastruktur und auf die dort ansässige Bevölkerung. Es hätte, so<br />
die Studie, einen Aufschwung für die Gemeinde gegeben, sie profitiere durch die<br />
Kommunalsteuer und die gesamte Region erwarte sich eine „touristische Publicity“,<br />
einen wirtschaftlichen Aufschwung, eine Verbesserung der teils tristen Situation<br />
des Einzelhandels sowie eine Kultivierung der Landschaft.<br />
Nur wenige Kilometer entfernt erhält diese „kultivierte Landschaft“ der ressorthaften<br />
Künstlichkeit von Fontana nun ein Pendant. Trotz Proteste, negativer Gutachten<br />
der Umweltbehörde und einer Verwarnung durch die EU-Kommission errichtet<br />
Frank Stronach in der Gemeinde Ebreichsdorf auf Hunderten Hektar Grünland ein<br />
ehrgeiziges Projekt. Hier soll ein dem Golfclub Fontana nicht unähnlicher Pferdesportpark<br />
entstehen. Ohne wasserrechtliche Bewilligung wird naturgeschütztes<br />
Moorland abgetragen und werden kilometerlange, mehrspurige Fahr- und Rennbahnen<br />
errichtet. Das Konzept des „Just do it“ funktioniert auch hier. Nicht nur die<br />
Bilder glücklicher Kinder auf autofreien Strassen, der restriktive Verhaltenscodex<br />
und das konforme Äußere, nach denen Ressorts dieser Art konzipiert werden,<br />
stammen aus den USA. Aus dem goldenen Westen stammt auch die Gewissheit<br />
und die Zuversicht einiger weniger, reicher und mächtiger Magnaten, dass mit<br />
genügend Geld alles käuflich ist: Land, Utopien, Ideale und auch Architektur.<br />
Clubhaus im Stil französischer Schlossarchitektur<br />
Südstaatenhäuser in Niederösterreich
Literatur:<br />
ARCH + 203: Planung und Realität. Strategien im Umgang mit Großwohnsiedlungen<br />
Ariès, Philippe und Georges Duby, Hrsg., Geschichte des Privaten Lebens, Band<br />
1-5, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1992<br />
Benjamin, Walter, Das Passagen-Werk, Erster Band, Suhrkamp Verlag, Frankfurt<br />
am Main 1982<br />
Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Gender Studies, Edition Suhrkamp,<br />
Frankfurt 1991<br />
Corbusier, Le, Ausblick auf eine Architektur, Bauwelt Fundamente, Verlag Ullstein<br />
GMBH, Frankfurt/M-Berlin 1963, Original Paris 1922<br />
Diller, Ricardo + Elizabeth Scofidio: Flesh. Architectural Probes. Princeton 1996<br />
DOMUS 787: Steiner, Dietmar: A Diary of Disney‘s Celebration<br />
Elias, Norbert, Über den Prozeß der Zivilisation. Soiogenetische und psychogenetische<br />
Untersuchungen. Erster Band. Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen<br />
Oberschichten des Abendlandes. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am<br />
Main, 1997<br />
Freud, Sigmund Zur Psychopathologie des Alltagslebens, Fischer Verlag, Frankfurt<br />
am Main, 1954<br />
Giedion, Sigfried, Befreites Wohnen, Syndikat Verlag, Frankfurt am Main 1985,<br />
Orig. Zürich-Leipzig 1929<br />
Giedion, Sigfried, Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag zur anonymen<br />
Geschichte, Hrsg. Henning Ritter, Europäische Verlagsanstalt, Orig. Oxford 1948<br />
Metken, Günter, Hrsg., Als die Surrealisten noch recht hatten. Texte und Dokumente,<br />
Reclam Verlag, Stuttgart 1976, Orig. 1936, Paris<br />
Reed, Christopher, Ed.: Not at Home. The Suppression of Domesticity in Modern<br />
Art and Architecture, Thames and Hudson Verlag, London 1996<br />
Schwab, Alexander Das Buch vom bauen, 1930 – Wohnungsnot, Neue Technik,<br />
Neue Baukunst, Städtebau aus sozialistischer Sicht. Bauwelt Fundamente 42,<br />
Hrsg. Ulrich Conrads, Bertelsmann Fachverlag, Düsseldorf 1973, Orig. unter dem<br />
Pseudonym Albert Sigrist, Berlin 1930<br />
Selle, Gert, Die eigenen vier Wände. Zur verborgenen Geschichte des Wohnens.<br />
Campus Verlag, Frankfurt am Main und New York, Frankfurt am Main 1996<br />
Sennet, Richard: Fleisch und Stein. Der Körper und die Stadt in der westlichen<br />
Zivilisation, Berlin, , Berlin 1995<br />
Theyssot, Georges, Die Krankheit des Domizils. Wohnen und <strong>Wohnbau</strong> 1800 –<br />
1930, Bauwelt Fundamente 87, F. Vieweg & Sohn Verlag, Braunschweig 1989<br />
Total Housing. Alternatives to Urban Sprawl. Actar, Barcelona 2010<br />
Vidler, Anthony: The Architectural Uncanny. Essays in the Modern Unhomely, MIT<br />
Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1992.<br />
Wigley, Mark, White walls, Designer Dresses. The Fashioning of Modern Architecture,<br />
MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1995.