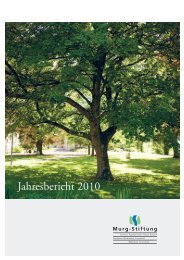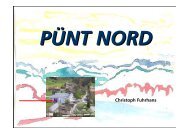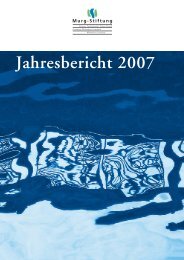Jahresheft 2002 - Murg Stiftung
Jahresheft 2002 - Murg Stiftung
Jahresheft 2002 - Murg Stiftung
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Jahresheft</strong> <strong>2002</strong><br />
Wandel – Entwicklung – Projekte:<br />
Littenheid, die lernende Organisation.
Die 14 Stationen der Klinik Littenheid ermöglichen den ca. 200 Patientinnen<br />
und Patienten eine auf das individuelle Krankheitsbild abgestimmte<br />
Behandlung. Sie gliedern sich in folgende Fachbereiche:<br />
Unsere drei offenen Therapiestationen ermöglichen eine intensive psychotherapeutische<br />
Behandlung. Für einzelne neurotische und psychosomatische<br />
Störungen (z. B. Essstörungen, Angst- und Zwangserkrankungen) bieten<br />
wir spezialisierte Behandlungsprogramme an.<br />
Auf unseren vier modernen und freundlich gestalteten Akutstationen<br />
nehmen wir Patientinnen und Patienten entweder direkt in einer Notfallsituation<br />
auf oder nach einem abklärenden Vorgespräch zur Krisenintervention<br />
oder für die Einleitung einer länger dauernden Therapie.<br />
Unsere vier gerontopsychiatrischen Stationen betreuen Alterspatienten:<br />
Ein multiprofessionelles Team leistet die notwendige medizinische, psychiatrische<br />
und therapeutische Hilfe und fördert und unterstützt wo immer<br />
möglich die Eigenaktivität. Gerade unsere betagten Patientinnen und<br />
Patienten profitieren von den sozialen Möglichkeiten unserer lebendigen<br />
Dorfgemeinschaft.<br />
Unser jugendpsychiatrisches Behandlungsangebot auf drei Stationen<br />
umfasst Abklärung und Beratung, kurz dauernde Krisenintervention sowie<br />
Therapie und Rehabilitation in offenem oder geschlossenem Rahmen.<br />
Wir arbeiten nach milieu- und psychotherapeutischen sowie sozialpädagogischen<br />
Prinzipien und nehmen jugendliche Patientinnen und Patienten<br />
zwischen 14 und 18 Jahren auf.
Inhalt<br />
Vorwort<br />
Hans Schwyn, Allgemeine Leitung 2<br />
Wandel – Entwicklung – Projekte: Einführung ins Jahresthema<br />
Dr. med. Markus Binswanger, Chefarzt 4<br />
Umgang mit der Macht<br />
Dr. Sibille Kühnel, Oberärztin Jugendpsychiatrie 6<br />
Standards für die Seele<br />
Dr. med. Jörg Burmeister, Leitender Arzt Akutpsychiatrie 11<br />
Ohne Projekt – keine Veränderung<br />
Dr. med. Susanne Kunz, Leitende Ärztin stationäre Psychotherapie 16<br />
Das Skillstraining nach der Dialektisch-Behavioralen Therapie<br />
Martin Weyer, Stationsleiter stationäre Psychotherapie, Projekt- und Gruppenleiter Skillstrainig 20<br />
«Hart, hilfreich und einfach genial!» Ein Interview mit einer Teilnehmerin der Skillstrainigsgruppe<br />
Mathias Erne, Stationsleiter stationäre Psychotherapie, Leiter der Skillstrainingsgruppe 24<br />
Jünger werden; «Bericht aus der Werkstatt» der Psychotherapiestation für junge Erwachsene<br />
Dr. med. Pia Ineichen, Oberärztin stationäre Psychotherapie 25<br />
Vom Müssen zum Dürfen<br />
Dr. med. Jürg Wunderwald, Oberarzt stationäre Psychotherapie 27<br />
Littenheid: Ein Stück Lebensweg<br />
Sandra Rust 29<br />
Stationäre Psychotherapie bei Adoleszenten – der Föhrenberg im steten Wandel<br />
Dr. med. Oliver Bilke, Leitender Arzt Jugendpsychiatrie 35<br />
Konzept und Entwicklung Station Linde G<br />
Heidi Eckrich, Oberärztin Jugendpsychiatrie 38<br />
Wie viel Entwicklung verträgt die Alterspsychiatrie heute<br />
Dr. med. Jokica Vrgoc-Mirkovic, Leitende Ärztin Gerontopsychiatrie 41<br />
Zeitwandel konkret<br />
Anna Guadagnini, Aktivierungstherapeutin Gerontopsychiatrie 43<br />
Stations-Ergotherapie: Eröffnung und Erfahrung<br />
Zeljka Slijepcevic, Stationsleiterin Gerontopsychiatrie / Monika Eberli, Stationsergo Gerontopsychiatrie 44<br />
Statistik 2001<br />
Dr. med. Oliver Bilke, Leitender Arzt Jugendpsychiatrie 46<br />
Dienstjubiläen/Lehrabschlüsse, Leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 50
Vorwort<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
2<br />
Mit den Beiträgen unseres <strong>Jahresheft</strong>es<br />
<strong>2002</strong> berichten wir<br />
über abgeschlossene und aktuelle<br />
Arbeiten und Projekte zur qualitativen Weiterentwicklung<br />
unserer Behandlungsangebote mit dem<br />
Ziel, bestehende und zukünftige Anforderungen<br />
erfolgreich bewältigen zu können. Dabei gilt es,<br />
die Prioritäten richtig zu setzen: Welche Entwikklungen<br />
erfordern eine nachhaltige Anpassung<br />
der therapeutischen und pflegerischen Konzepte<br />
und wie werden die limitierten finanziellen und<br />
personellen Mittel entsprechend den Erfordernissen<br />
eingesetzt<br />
Dank einer klaren Führungsstruktur durch einen<br />
ärztlichen Leiter und eine Bereichsleitung<br />
Pflege für die vier Behandlungsschwerpunkte<br />
Akutpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Jugendpsychiatrie<br />
und stationäre Psychotherapie erfolgt die<br />
Entwicklungsarbeit und der Veränderungsprozess<br />
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen<br />
Berufsgruppen und Verantwortungsebenen<br />
«vor Ort», wobei sich ein strukturiertes<br />
Projektmanagement mit inhaltlichen Rahmenbedingungen<br />
und zeitlichen Vorgaben bewährt<br />
hat.<br />
In diesem Heft werden die Konzeptarbeit zur<br />
Eröffnung der Akutstation für Jugendliche, die<br />
«Zukunftswerkstatt stationäre Psychotherapie»<br />
sowie die Behandlungsrichtlinien bei Depression<br />
und Suizidalität näher vorgestellt. Gute Erfahrungen<br />
machen wir mit dem Beizug externer Fachleute,<br />
welche unsere «Binnensicht» hinterfragen<br />
und ihr spezielles Fachwissen in die Projektarbeit<br />
einbringen.<br />
Als Vertragsklinik für die Behandlung grundversicherter<br />
Patienten der Kantone Thurgau,<br />
Schwyz und Zug werden auch Menschen gegen<br />
ihren Willen in die Klinik Littenheid eingewiesen.<br />
Im Frühling 2001 besuchte eine Delegation<br />
des «Ausschusses zur Verhütung von Folter und<br />
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung»<br />
des Europarates überraschend die Klinik<br />
Littenheid und überprüfte in allen Details die Behandlung<br />
dieser Patienten. Eine anfängliche<br />
Skepsis wich bald dem Respekt vor der Objektivität<br />
und Genauigkeit, mit der die Delegationsmitglieder<br />
jeden Einzelfall abklärten. Seit diesem<br />
Frühling liegt der Schlussbericht vor; im Beitrag<br />
«Umgang mit Macht» berichtet Frau Dr. Kühnel,<br />
Oberärztin Jugendpsychiatrie, über den Besuch<br />
und seine Ergebnisse.<br />
Im Rückblick über mehrere Jahre lässt sich in<br />
der Entwicklung der Patientenzahlen eine deutliche<br />
Zunahme der Eintritte feststellen, wobei der<br />
Anteil grundversicherter Patientinnen und Patienten<br />
mit zwei Dritteln der Pflegetage und der<br />
Hälfte aller Eintritte über die letzten Jahre leicht<br />
gestiegen ist. Diese Tendenz wird in diesem Jahr<br />
durch den Betrieb einer 3. Akutstation für Jugendliche<br />
nochmals deutlich zunehmen, wir rechnen<br />
in der Jugendpsychiatrie mit einer Verdoppelung<br />
von 63 auf 130 Eintritte in diesem Jahr.
Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass die<br />
zweite KVG-Revision zur Spitalfinanzierung, die<br />
diesen Herbst im Nationalrat behandelt wird,<br />
die finanzielle Benachteiligung der Privatkliniken<br />
beheben wird, wonach die Krankenversicherer für<br />
grundversicherte Patienten in öffentlichen Spitälern<br />
maximal die Hälfte der anrechenbaren Kosten,<br />
in Privatspitälern aber die vollen Kosten zu<br />
begleichen haben. Diese Wettbewerbsverzerrung<br />
verschärft sich mit dem Urteil des Eidgenössischen<br />
Versicherungsgerichtes, welches auch<br />
zusatzversicherten Patienten in öffentlichen Spitälern<br />
Anrecht auf den Sockelbeitrag der Grundversicherung<br />
gibt, nicht aber bei einer Behandlung in<br />
einem Privatspital.<br />
Wir möchten weiterhin einen breit gefächerten<br />
und qualitativ hochstehenden Beitrag zur Gesundheitsversorgung<br />
leisten und hoffen, dass die<br />
gesetzlichen und gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen,<br />
welche «gleich lange Spiesse» zwischen<br />
den Spitälern schaffen, nicht mehr lange<br />
auf sich warten lassen.<br />
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich<br />
für Ihr Interesse an unserer Arbeit und wünsche<br />
Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der folgenden<br />
Beiträge.<br />
3<br />
H. Schwyn
Dr. med. Markus Binswanger, Chefarzt<br />
Wandel – Entwicklung – Projekte:<br />
Einführung ins Jahresthema<br />
4<br />
Jahresberichte von Institutionen und Organisationen<br />
dienen in erster Linie dazu, Rechenschaft<br />
über eine Geschäftsperiode zu<br />
geben. Die Veröffentlichung von betrieblichen<br />
Kennzahlen, grafisch aufgearbeiteten Statistiken sowie eines<br />
Revisionsberichtes dokumentieren seriöse Geschäftsführung<br />
und ermöglichen Kontrolle und Vergleich. Differenzierte inhaltliche<br />
Tätigkeitsberichte sind indessen eher selten, Fachbeiträge die<br />
Ausnahme. Nicht ganz zu Unrecht wird davon ausgegangen, dass<br />
in unserer Zeit des Informationsüberflusses eine Leserschaft nur<br />
durch äusserst knappe Berichterstattung, allenfalls ergänzt durch<br />
ansprechendes Bildmaterial, erreicht werden kann.<br />
In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Littenheid beschreiten<br />
wir seit vielen Jahren einen etwas anderen Weg. Unsere<br />
ausführlichen <strong>Jahresheft</strong>e sind jeweils einem fachlichen Schwerpunktthema<br />
gewidmet und sollen vertieften Einblick in die institutionelle<br />
psychiatrische Arbeit sowie vor allem in die Behandlung<br />
psychisch kranker Menschen vermitteln. Nach Festlegung der<br />
Themenwahl durch ein breit gefächertes Redaktionskomitee wird<br />
eine grössere Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen<br />
Klinikbereichen und Berufsfeldern eingeladen, aus<br />
unterschiedlicher Perspektive ihre besonderen Erfahrungen zur<br />
Darstellung zu bringen. Ebenfalls werden regelmässig Patientinnen<br />
und Patienten um eigene Beiträge gebeten oder von uns zur<br />
gewählten Thematik befragt. In den vergangenen Jahren haben<br />
wir uns folgenden Themen gewidmet:<br />
● Lebensphasen – Übergänge, Krisen und Chancen (1999)<br />
● Zwang und Freiheit – Fremd- und Selbstbestimmung in der<br />
Psychiatrie (2000)<br />
● Sinnvolle Notwendigkeit – Gesundheitsförderung und Prävention<br />
in der Psychiatrie ( 2001)<br />
Diese Form der Auseinandersetzung mit aktuellen Aspekten unserer<br />
täglichen Arbeit findet bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
Anklang und Interesse. Mit Genugtuung dürfen wir feststellen,<br />
dass unsere Anfragen nach Erstellung eines Artikels fast<br />
durchwegs positiv beantwortet werden – angesichts der hohen Arbeitsbelastung<br />
keine Selbstverständlichkeit! Auch die Resonanz<br />
bei der Leserschaft unserer <strong>Jahresheft</strong>e ist erfreulich. Nicht selten<br />
wird unser Jahresthema auch von anderen Institutionen aufgegriffen<br />
und zum Anlass genommen, sich damit näher auseinanderzusetzen.<br />
Auch von unseren Patientinnen und Patienten und deren<br />
Angehörigen erhalten wir anerkennende Rückmeldungen. So sehen<br />
wir uns ermutigt, auch zukünftig auf diesem Weg Öffentlichkeitsarbeit<br />
für Anliegen der Psychiatrie und deren Entstigmatisierung<br />
zu leisten.<br />
Im vorliegenden <strong>Jahresheft</strong> haben wir darauf verzichtet, ein<br />
umschriebenes Fachthema zu behandeln. Vielmehr möchten wir<br />
unter dem Leitmotiv Wandel – Entwicklung – Projekte unsere Leserinnen<br />
und Leser gleichsam zu einem Werkstattbesuch einladen<br />
– mit der Absicht, uns in der Auseinandersetzung mit aktuellen<br />
Anpassungs- und Entwicklungsaufgaben begleiten und beobachten<br />
zu lassen. So betrachtet könnte das Jahresthema auch mit<br />
«Changemanagement in der lernenden Organisation» umschrieben<br />
werden.<br />
Die Klinik Littenheid weist ein komplexes gesundheitspolitisches<br />
und versorgungspolitisches Umfeld auf. Im Gegensatz zu psychiatrischen<br />
Kliniken mit umschriebenem kantonalem Leistungsauftrag<br />
sind wir mit einer Vielzahl verschiedener Aufgabenstellungen betraut.<br />
Unsere vier Klinikbereiche mit ihren insgesamt vierzehn Stationen<br />
erfüllen unterschiedliche Leistungsaufträge für verschiedene<br />
Vertragskantone. Die verantwortlichen Gesundheitspolitiker erwarten<br />
von uns zu Recht, dass unsere Angebote rechtzeitig den sich<br />
wandelnden Bedürfnissen angepasst und besonders Anforderungen<br />
an eine überregionale Spezialversorgung kompetent erfüllt werden.<br />
Auch die für unsere Klinik wichtige Gruppe der zusatzversicherten<br />
Patientinnen und Patienten stellt sowohl bezüglich Erwartungen an<br />
unsere Hotellerie als auch an die psychiatrisch-psychotherapeutische<br />
Behandlung vielfältige Ansprüche, denen wir als einzige psychiatrische<br />
Privatklinik in der Ostschweiz soweit als möglich genügen<br />
möchten. Vor diesem Hintergrund werden wir immer wieder mit<br />
herausfordernden Veränderungen in unserer Arbeit konfrontiert,<br />
was Flexibilität, rasche Handlungs- und Anpassungsbereitschaft sowie<br />
innovative Unternehmungsführung verlangt.<br />
Die Methoden des Wandels und der Erneuerung sind vielgestaltig<br />
und müssen immer wieder den aktuellen Gegebenheiten<br />
angepasst werden. In der Vergangenheit und insbesondere im abgelaufenen<br />
Berichtsjahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass in<br />
unserer Klinik – basierend auf unserer spezifischen Betriebskultur<br />
– sich besondere Merkmale von Veränderungsprozessen identifizieren<br />
lassen und bestimmte Methoden des «Changemanagements»<br />
sich als wirksam und hilfreich erweisen. Es stellt sich also<br />
die Frage: Was haben wir als Organisation gelernt<br />
Paradigmatisch für intensive Lernerfahrung im Rahmen eines<br />
Anpassungs- und Veränderungsprozesses war das in diesem Heft
eschriebene Projekt «Zukunftswerkstatt – stationäre Psychotherapie».<br />
Basierend auf der von der Klinikleitung auf strategischer<br />
Ebene getroffenen Entscheidung, den gesamten Psychotherapiebereich<br />
hinsichtlich Strukturen und Prozessen zu überprüfen,<br />
wurde den Bereichsverantwortlichen ein Projektauftrag erteilt. Als<br />
äusserst wertvoll erwies sich der Entscheid, einen psychotherapeutisch<br />
und milieutherapeutisch kompetenten, gleichzeitig in<br />
psychodynamischer Organisationsentwicklung erfahrenen externen<br />
Berater hinzuzuziehen. In der Person von Herrn Dr. phil.<br />
Matthias Lohmer konnten wir eine Fachperson gewinnen, die uns<br />
von Anfang an mit mutigen Ideen, anregenden und kreativen<br />
Neuerungsvorschlägen herausgefordert und gleichzeitig unterstützend<br />
begleitet hat. Im Rahmen dieses einjährigen Prozesses haben<br />
wir die einzelnen therapeutischen Angebote sowie die gesamten<br />
Behandlungskonzepte der drei Psychotherapiestationen überprüft<br />
und wichtige neue Akzente gesetzt. Einzelheiten der entwickelten<br />
Behandlungsangebote sowie vor allem auch subjektive Projekterfahrungen<br />
sind in den verschiedenen Artikeln des Psychotherapiebereiches<br />
eingehend beschrieben.<br />
Wir haben viel gelernt! Zu nennen wären gegenseitig vermittelte<br />
Impulse sowohl für die Fach- als auch für die Teamentwicklung.<br />
Für viele von uns hilfreich waren zudem Erfahrungen<br />
im Zusammenhang mit der Wirkung des «Unbewussten in der<br />
Unternehmung» (Lohmer). Die psychodynamische Organisationsanalyse<br />
und -beratung hat innert kurzer Zeit dazu verholfen,<br />
blockierte anstehende Veränderungs- und Umsetzungsprozesse in<br />
ihrer verborgenen Natur besser zu verstehen und so Voraussetzungen<br />
zu schaffen für neue Entwicklungen. Aber auch das Aufspüren<br />
von Mängeln und eigentlichen Fehlern im Projektablauf waren<br />
wichtig für fruchtbare neue Wechselwirkungen zwischen unserer<br />
Fehler- und Lernkultur.<br />
Die gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse<br />
werden in zukünftige Projekte in unserer Klinik einfliessen. Mit<br />
der beraterischen Unterstützung von Herrn Professor Hartmut<br />
Radebolt, Kassel, hat der Bereich Gerontopsychiatrie im Frühjahr<br />
<strong>2002</strong> ebenfalls ein ähnlich aufgebautes Projekt «Zukunftswerkstatt»<br />
in Angriff genommen. Auch die Bereichsverantwortlichen<br />
der Akutpsychiatrie haben ein Vorprojekt abgeschlossen, welches<br />
später vor allem die Auseinandersetzung mit dem Qualitätsbegriff<br />
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit fokussieren soll. Für<br />
dieses im Herbst <strong>2002</strong> beginnende Projekt hat Herr Professor Asmus<br />
Finzen, Basel, als externer Berater seine Mitarbeit zugesichert.<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Klinik sind sich<br />
also bewusst, dass einmal erarbeitete und im Alltag bewährte Konzepte<br />
von Zeit zu Zeit in Frage zu stellen sind und hinsichtlich<br />
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit überarbeitet werden müssen –<br />
und sei es nur, um mit neu gewonnener Einsicht das Bisherige<br />
fortzusetzen. Allerdings sind solche Phasen von Veränderung und<br />
Neuerung aufgrund unserer gemachten Erfahrungen immer auch<br />
potenzielle Quellen von ernsthaften Konflikten und Spannungen.<br />
Die Diskussion um Veränderungen von Strukturen und Abläufen<br />
wird nicht selten als Kritik am Bestehenden erlebt und kann<br />
Ablehnung oder gar Widerstand erzeugen. Verunsicherung, negative<br />
Befürchtungen und Zukunftsängste können sich – vor allem<br />
bei Projektbeginn – sowohl beim Einzelnen als auch in ganzen Teams<br />
einstellen. Reale oder fantasierte Konsequenzen von Veränderungsmassnahmen<br />
stehen dann einer wirksamen Umsetzung entgegen<br />
und drohen das Projekt als Ganzes zum Scheitern zu<br />
bringen. Besonders heikel sind institutionelle Konflikte, welche<br />
ungelöst über längere Zeit im Verborgenen schlummern und nun<br />
in Phasen des Wandels und des Übergangs reaktiviert werden und<br />
ihre unheilvolle Wirkung entfalten. Diese Phänomene sind uns in<br />
verschiedener Form begegnet. Die beschriebenen Projekte haben<br />
alle mehr oder weniger kritische Phasen durchlaufen, welche zum<br />
Teil selbständig, zum Teil aber auch dank Interventionen von<br />
aussen gemeistert werden konnten. Mit Stolz stellen wir fest, dass<br />
trotz – oder vielleicht auch gerade wegen – dem Auftreten derartiger<br />
Veränderungswiderstände die beschriebenen Entwicklungsprozesse<br />
wirksam in Gang gesetzt oder bereits abgeschlossen werden<br />
konnten.<br />
Evolutionäre Anpassungen gehören ebenso zur individuellen<br />
Entwicklung wie zum Leben in Gruppen und Institutionen. Allerdings<br />
darf Wandel nie zum Selbstzweck werden, sondern bedarf<br />
der Einbettung in ein übergeordnetes Ganzes. Die in einer psychiatrischen<br />
Klinik untergebrachten und dort arbeitenden Menschen<br />
sind häufig mit einem Übermass an schwerem Schicksal und Leiden<br />
konfrontiert. Es drohen Ohnmacht, Pessimismus und Resignation.<br />
Dem steht Neugier und Mut gegenüber, gepaart mit der<br />
Bereitschaft, sich zu verändern und von vorne zu beginnen. Dann<br />
kommt auch immer wieder Freude und Hoffnung auf.<br />
Markus Binswanger<br />
5
Dr. Sibille Kühnel, Oberärztin Jugendpsychiatrie<br />
Umgang mit der Macht<br />
6<br />
Der Besuch des Europäischen Ausschusses<br />
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher<br />
Behandlung.<br />
Das europäische Übereinkommen zur Verhütung<br />
von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung<br />
führte 1987 zum Einsatz eines Ausschusses (CPT)<br />
durch den Europarat.<br />
Dieser Ausschuss besuchte im Frühjahr 2001 turnusmässig<br />
ausgewählte Institutionen der Schweiz. In diesem Zusammenhang<br />
wurde die Klinik Littenheid visitiert.<br />
Macht und Zwang im Widerspruch zu einer<br />
vertrauensvollen Arzt-Patienten Beziehung<br />
Das Selbstbestimmungsrecht ist eines der höchsten Rechtsgüter<br />
das auch gesetzlich verankert ist. Auch die Zustimmung zu einer<br />
medizinischen Behandlung ist höchstpersönliches Recht und steht<br />
allein im Ermessen des jeweils Betroffenen. Dem Selbstbestimmungsrecht<br />
des Patienten wird der Vorrang gegenüber moralischen<br />
Handlungsangeboten des Arztes, der von Berufs wegen nach<br />
dem von ihm geleisteten hippokratischen Eid zu Lebensschutz<br />
verpflichtet ist, eingeräumt. In der Regel gestaltet sich die Arzt-Patienten<br />
Beziehung in der Psychiatrie auf Freiwilligkeit und gegenseitigem<br />
Einverständnis. In Einzelfällen, z. B. bei mangelnder<br />
Einschätzungsfähigkeit des eigenen Gesundheits- bzw. Krankheitszustandes,<br />
kann eine Entscheidung zu einer Hospitalisation<br />
auch gegen den Willen des Betroffenen gefällt werden.<br />
Der Rechtsgeber hat für diese Situationen Ausnahmeregeln benannt,<br />
die es ermöglichen, Personen gegen ihren Willen einer Behandlung<br />
zuzuführen wenn: «…wegen Geisteskrankheit, Geistesschwäche…<br />
oder schwerer Verwahrlosung die nötige persönliche<br />
Fürsorge nicht anders erwiesen werden kann.» (Art. 397a Schweizerisches<br />
Zivilgesetzbuch, Fürsorgerischer Freiheitsentzug).<br />
Die Ausübung von Zwang widerspricht grundsätzlich einer auf<br />
Vertrauen basierenden Arzt-Patienten Beziehung. Das ergibt einen<br />
Konflikt per se. Die Ausübung von Zwang impliziert auch die<br />
Ausübung von Macht, bzw. stellt ein Machtgefälle dar zwischen<br />
demjenigen, der autorisiert ist Zwang auszuüben und demjenigen,<br />
den die Zwangsmassnahme ereilt.<br />
Unfreiheit und Macht in der Pädagogik<br />
Auch im Rahmen der Pädagogik, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
untrennbar mit dem medizinisch-therapeutischen<br />
Aspekt verbunden ist, existieren Bereiche der «Unfreiheit». Erziehungsmacht<br />
impliziert ebenfalls ein Machtgefälle zwischen den Erwachsenen<br />
und den Kindern und Jugendlichen, die angewiesen<br />
sind auf die Führung und Begleitung durch ihre Erziehungsberechtigten.<br />
Im gelungenen Fall ist Erziehung durch das Konzept «Verständigung<br />
und Respekt» getragen. Pädagogik ist das Ergebnis von<br />
Aushandlungsprozessen zwischen den Erwachsenen und Kindern<br />
bzw. Jugendlichen. Im schlimmsten Fall werden Kinder durch<br />
Machtmissbrauch verletzt, gedemütigt und innerlich gebrochen.<br />
Sowohl die Ausübung von medizinisch begründbarer Macht<br />
und pädagogischer Macht provozieren notwendigerweise (externe)<br />
Kritik und (interne) Selbstkritik.<br />
Daraus folgt, dass eine kontinuierliche reflektierte Auseinandersetzung<br />
unter Einbezug aller von der Thematik Betroffenen<br />
unabdingbar ist.<br />
Diese Notwendigkeit von Kontrolle aller Institutionen in denen,<br />
durch behördliche Verfügung angeordnet, mit unfreiwilligen<br />
Festhaltungen von<br />
Personen gearbeitet<br />
werden muss, wurde<br />
überregional auch im<br />
Europarat behandelt.<br />
Im Sinne einer institutionalisierten<br />
externen<br />
Kritik ist daher<br />
auch der Tätigkeitsbereich<br />
des Europäischen<br />
Ausschusses zur<br />
Die Initiative für die<br />
Gründung des CPT (European<br />
Committee for the<br />
Prevention of Torture<br />
and Inhuman or Degrading<br />
Treatment or<br />
Punishment) geht auf<br />
den Schweizer Jean<br />
Jaques Gautier zurück.<br />
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender<br />
Behandlung, CPT, zu sehen.<br />
Der Ausschuss ging, initiiert durch den Schweizer Jean Jaques<br />
Gautiers, aus den Arbeiten des Europarates hervor und hat seinen<br />
Sitz in Strassburg. Richtungsweisend war die Tätigkeit des Internationalen<br />
Roten Kreuzes, das Kriegsgefangenen und politisch Inhaftierten<br />
in regelmässigen Abständen Besuche abstattet. Der Ausschuss<br />
wurde am 26.6.1987 verabschiedet, auch von der Schweiz<br />
ratifiziert und ist hier seit dem 1.2. 1989 in Kraft.<br />
Multinationaler Ausschuss<br />
Mittlerweile ist der CPT von 41 Mitgliedsstaaten ratifiziert. Die<br />
Personen, die von den einzelnen Staaten in den Ausschuss entsandt<br />
werden, sind unabhängig, d.h. nicht an die Weisung einer
Regierung gebunden. Die beruflichen Tätigkeitsfelder dieser Personen<br />
kommen u. a. aus den Bereichen der Rechtswissenschaften<br />
und Medizin.<br />
Der zentrale Aufgabenbereich des Ausschusses ist die Prävention<br />
von Misshandlung bei Personen, die aufgrund behördlicher<br />
Verfügung gegen ihren Willen festgehalten werden. Diese Festhaltungen<br />
stellen Freiheitsentzüge aus strafrechtlichen, zivil- und<br />
verwaltungsrechtlichen sowie militärstrafrechtlichen Gründen<br />
dar. Somit ist neben Polizei-, Untersuchungshaft, Strafvollzug und<br />
Militärarrest auch der Fürsorgerische Freiheitsentzug (FFE) davon<br />
erfasst.<br />
Der Ausschuss entsendet Delegationen aus mindestens zwei<br />
Mitgliedern die, unter Beiziehung von Experten und Dolmetschern,<br />
den Mitgliedsstaaten bzw. deren ausgewählten Institutionen<br />
in regelmässigen Abständen Besuche abstatten.<br />
Die Delegation überprüft die Lebensbedingungen der festgehaltenen<br />
Personen und setzt sich, so nötig, für einen besseren<br />
Schutz ein.<br />
Jedem Besuch folgt ein Bericht und eine entsprechende Empfehlung<br />
die auch der Regierung des besuchten Landes zugestellt wird.<br />
Der Ausschuss besitzt jedoch keine Anklagefunktion. Er zielt<br />
nicht auf eine Verurteilung. Jeder Bericht wird grundsätzlich vertraulich<br />
gehandhabt. Jede Regierung kann jedoch um Veröffentlichung<br />
des Berichtes ansuchen.<br />
Verweigert ein Mitgliedsstaaat die Zusammenarbeit oder die<br />
Umsetzung der Empfehlungen, kann der Ausschuss eine öffentliche<br />
Erklärung abgeben.<br />
Verpflichtung zur Kooperation<br />
Die Mitgliedsstaaten gehen durch die Ratifizierung Verpflichtungen<br />
gegenüber dem Ausschuss ein. Sie gewähren uneingeschränkten<br />
Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet. Sie erteilen Auskünfte über<br />
alle Orte an denen Personen gegen ihren Willen festgehalten werden.<br />
Sie sichern den Delegationsmitgliedern freien Zugang zu allen<br />
Orten zu und ermöglichen die Gesprächsführung mit den betroffenen<br />
Personen, deren Angehörigen, dem Personal der<br />
Institutionen ohne Zeugen.<br />
Im Falle von psychiatrischen Kliniken muss ihnen auch Einsicht<br />
in alle medizinischen Unterlagen gewährt werden. Eine Verweigerung<br />
unter Berufung auf die ärztliche Schweigepflicht<br />
ist nicht möglich, da in diesem Fall die gesetzlich vorgesehene<br />
Durchbrechung im Sinne der Rechtspflege vorliegt.<br />
Die Visite durch den Ausschuss wird der Regierung eines Landes<br />
schriftlich mitgeteilt. Nach Bekanntgabe aller Institutionen, in<br />
denen Personen festgehalten werden, trifft der Auschuss eine Auswahl<br />
und lässt durch die Bundes- bzw. kantonale Regierung seine<br />
Visite kurzfristig ankündigen.<br />
Besuch des CPT in der Klinik Littenheid<br />
Am 1.2.2001 wurde die Klinikleitung vom Justizministerium<br />
überraschend über den Besuch des CPT in Kenntnis gesetzt. Die<br />
Visite fand 4 Tage später am 5.2.2001 statt. Diese kurze Zeitspanne<br />
diente zur Vorbereitung der Ausschussmitglieder auf die<br />
lokalen Gegebenheiten. Dies umfasste die Bereitstellung der<br />
bundesrechtlichen und kantonalrechtlichen Grundlagen zum Fürsorgerischen<br />
Freiheitsentzug ebenso wie die Bekanntgabe der Patientendaten<br />
und die Information über die Infrastruktur unserer<br />
Klinik.<br />
Herausforderung für die Klinik und ihre Mitarbeiter<br />
Die Visite der Delegation stellte für die Klinik und ihre Mitarbeiter<br />
eine Herausforderung dar. Gewohnt, das eigene Handeln miteinander<br />
in regelmässigen Arbeitssitzungen und in Supervisionen<br />
kontinuierlich zu reflektieren,<br />
stellte die<br />
Visite doch eine neue<br />
Misshandlungen vorzubeugen<br />
ist das zentrale<br />
Art der externen Reflexion<br />
dar.<br />
Aufgabengebiet des CPT.<br />
Die Tätigkeit der<br />
Dazu besuchen die Mitglieder<br />
des CPT regelmäs-<br />
«offiziellen Institution<br />
CPT» löste den<br />
sig Personen, die aufgrund<br />
behördlicher Verfütrolle<br />
aus. So entstan-<br />
Eindruck von Kongung<br />
gegen ihren Willen den vorerst Gefühle<br />
festgehalten werden von Skepsis, Prüfungsängsten<br />
bis hin<br />
zu Entrüstung.<br />
Das grundlegende Selbstverständnis des Helferberufes, zu ethischem<br />
Handeln verpflichtet zu sein, schien erschüttert und in<br />
Frage gestellt. Der externe Blick auf routinierte Handlungsabläufe<br />
unserer Alltagspraxis liess vorübergehend die Rolle des Helfers zur<br />
Rolle des «Angeklagten» werden.<br />
Die akribische, fachlich fundierte und sehr zeitintensive Arbeit<br />
der Delegation erforderte von den Mitarbeitern einen hohen Ein-<br />
7
8<br />
satz neben der Tagesarbeit. Durch das breite Interesse der Delegationsmitglieder<br />
für unsere Tätigkeit, die ethische Grundhaltung<br />
der Mitarbeiter, den Kontakt zu den PatientInnen, also ein Interesse,<br />
das weit über die formal rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
hinausging, entstand sehr rasch der Eindruck einer vollumfänglichen<br />
Würdigung und Wertschätzung unserer Arbeit. Damit<br />
klang auch die anfängliche Irritation ab.<br />
Die PatientInnen nahmen die Visite durchwegs positiv auf.<br />
Alle waren über ihren rechtlichen Status ausreichend informiert<br />
und konnten darüber Auskunft geben. Es gab keine Klagen oder<br />
Beschwerden gegenüber den Delegationsmitgliedern. Vereinzelt<br />
setzten die PatientInnen Hoffnung in die Delegation, dass sie ihren<br />
Rechtsstatus ändern würde.<br />
Die Ziele der Visite<br />
Die Visite erstreckte sich über 3 Tage, an denen die Bereiche Akut-,<br />
Jugend- und Gerontopsychiatrie eingesehen wurden. Der Bereich<br />
Stationäre Psychotherapie blieb ausgespart, da hier keine Patienten<br />
mit Fürsorgerischem Freiheitsentzug untergebracht sind.<br />
Zentrales Augenmerk der Visite waren die rechtlichen Grundlagen<br />
für den Fürsorgerischen Freiheitsentzug sowie deren praktische<br />
Umsetzung im Klinikalltag. Die 6 Delegationsmitglieder,<br />
bestehend aus einem Psychiater, einem Psychologen, zwei JuristInnen,<br />
und zwei Dolmetschern, nahmen rigoros Einblick in<br />
die Umsetzungspraxis des bundesgesetzlich geregelten Fürsorgerischen<br />
Freiheitsentzugs auf kantonaler Ebene. Die Besonderheiten<br />
und Differenzen in den einzelenen Kantonen stiessen dabei auf<br />
besonderes Interesse.<br />
● Wer ist autorisiert, einen FFE auszustellen Was waren die konkreten<br />
Gründe für Zwangszuweisungen bei unseren PatientInnen<br />
● Wie werden die PatientInnen über ihre rechtlichen Möglichkeiten<br />
zum Rekurs informiert<br />
● Wie wird seitens der PatientInnen davon Gebrauch gemacht<br />
Dies ist ein Auszug aus der Palette von Fragestellungen, die durch<br />
die Delegationsmitglieder eingebracht wurden.<br />
Auch die Grundlagen und die Praxis der Überprüfung<br />
von freiheitsbeschränkenden Massnahmen wurde kontrolliert:<br />
Zwangsmassnahmen sind ausschliesslich so lange aufrechtzuerhalten<br />
bis «..die persönliche Fürsorge anders erwiesen werden kann.<br />
Die betroffene Person muss entlassen werden, sobald ihr Zustand<br />
es erlaubt.» (Art.397a, Abs. 3 Schweizerisches Zivilgesetzbuch)<br />
Dies impliziert die regelmässige Überprüfung der Notwenigkeit<br />
der Massnahme und somit eine Verlaufsbeurteilung der PatientInnen.<br />
Diese Praxis der Evaluation wurde von der Kommission<br />
ebenso überprüft wie die zentrale statistische Erfassung der<br />
FFE-Daten.<br />
Innerhalb des Stationssettings wurden die in unserer Klinik für<br />
Zwangsbehandlungen ausgearbeiteten Standards auf ihren Alltagseinsatz<br />
überprüft. So liessen sich die Delegationsmitglieder<br />
den Vorgang einer zwangsweise verabreichten Medikation detailliert<br />
schildern. Sie<br />
nahmen Einsicht in<br />
Die Zielpunkte der Visite<br />
waren breit gestreut<br />
und erfassten sowohl formal-rechtliche<br />
Grundlagen<br />
als auch ethische<br />
Grundhaltungen<br />
die Information und<br />
Aufklärung der PatientInnen<br />
über die<br />
Anordnung und in<br />
die Vorgehensweise,<br />
wie die Massnahmen<br />
mit den PatientInnen<br />
nachbearbeitet werden.<br />
Anhand unserer schriftlichen Dokumentationen, die jede<br />
Zwangsmassnahme begleiten, wurden die Indikationen, die Zeitdauer<br />
der Massnahmen und die Patientenbetreuung während der<br />
Massnahmen überprüft.<br />
Die PatientInnen wurden zu ihrem Wissen über ihren Rechtsstatus<br />
und ihren Einspruchsmöglichkeiten, zur Behandlung, zur<br />
verabreichten Medikation befragt und dadurch indirekt auf die<br />
Aufklärungspraxis durch die Mitarbeiter rückgeschlossen.<br />
Die Ausstattung und Handhabung der Intensivzimmer wurde<br />
ebenfalls eingesehen.<br />
Neben den formal-rechtlichen Bedingungen interessierte sich<br />
die Delegation auch für die Lebensbedingungen der PatientInnen.<br />
Zimmerausstattung, sanitäre und Hygienebedingungen, Ausgangsregelungen<br />
und Freizeitangebote wurden überprüft.<br />
Auf Klinikleitungs- und Mitarbeiterebene wurde in den Personalschlüssel<br />
eingesehen und dieser mit dem Aufgabenbereich der<br />
Klinik in Beziehung gesetzt. Die Mitarbeiter wurden gebeten,<br />
ihren Tätigkeitsbereich zu beschreiben und wurden zu ihrem Wissenstand<br />
der Zwangsmassnahmen befragt.<br />
Littenheid mit Bestnoten<br />
Nach Abschluss der 3-tägigen Visite erfolgte eine Woche später<br />
eine erste Abschlusssitzung, an der Regierungsmitglieder sowie die
Klinikleitung teilnahmen. Die erste schriftliche Stellungnahme<br />
durch den Ausschuss erfolgte einen Monat später. Schon in dieser<br />
ersten Zusammenfassung wurde die Arbeit unserer Klinik als hervorragend<br />
bewertet!<br />
Die gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen<br />
für Zwangsunterbringungen<br />
und -massnahmen<br />
waren in jedem<br />
Fall erfüllt<br />
worden. Insbesondere<br />
Die Beurteilung unserer<br />
Arbeitspraxis durch<br />
den Ausschuss war hervorragend<br />
wurde neben den guten räumlichen Bedingungen der äusserst sensible<br />
und verantwortungsvolle Umgang aller Mitarbeiter mit den<br />
PatientInnen hervorgehoben!<br />
Der erste Bericht wurde dann 4 Monate später, im Juli 2001,<br />
durch den Europarat genehmigt und ging dann im August 2001 in<br />
seiner endgültigen Fassung an den Bundesrat.<br />
Die Auseinandersetzung<br />
mit ethischen<br />
Fragen bei psychiatrischen<br />
Zwangsmassnahmen<br />
wurde auf erfreuliche<br />
Weise neu<br />
sensibilisiert<br />
Änderunngsvorschläge an Institution,<br />
Kanton und Bund<br />
Einige Änderungsvorschläge wurden von der Kommission angeregt:<br />
Auf institutioneller Ebene wurde die bessere zentrale statistische<br />
Erfassung der FFE-Daten empfohlen.<br />
Auf politischer Ebene wurde angeregt, die bisherige Praxis zur<br />
Überprüfung der Zeitdauer für Zwangsunterbringungen auf einen<br />
Zeitraum von 3 Monaten zu verkürzen. Eine entsprechende Gesetzesnovelle<br />
wurde angeregt.<br />
Kritische Anmerkungen gab es auch bezüglich der bundesrechtlichen<br />
Grundlagen des FFE und des Vormundschaftsrechtes.<br />
Ab dem Zeitpunkt des Endberichtes wurden 6 Monate Frist<br />
eingeräumt, um zu den Verbesserungsvorschlägen Stellung zu nehmen,<br />
was mittlerweile auch erfolgt ist.<br />
Auch der Schlussbericht des CPT stellte der Klinik Littenheid<br />
ein sehr gutes Zeugnis aus. Sowohl die allgemeine Führung und<br />
Organisation der Klinik als auch die Handhabung der FFE- und<br />
Zwangsmassnahmen wurden positiv bewertet.<br />
Der Bericht der Kommission war für die Mitarbeiter eine<br />
enorme Bestätigung ihrer Arbeit. Das positive feed back spornte<br />
an, den sensiblen Bereich «Zwang und Macht» im psychiatrischen<br />
Alltag durch verstärkte Reflexionen neu zu beleben. Es entstanden<br />
sogar spontane Arbeitsgruppen, die sich im Jugendbereich insbesondere<br />
mit dem Grenzbereich Pädagogik und medizinische<br />
Zwangsmassnahmen auseinandersetzten.<br />
Der Besuch des CPT hat erfreulicherweise neu sensibilisiert<br />
und das gute Ergebnis die Mitarbeiter in ihrem Handeln gestärkt<br />
und bestätigt.<br />
Die anfängliche Irritation wurde sowohl bei den Mitarbeitern<br />
als auch bei der Klinikleitung durch einen positive Haltung<br />
abgelöst, da deutlich wurde, dass eine hohe interdisziplinäre fachliche<br />
Kompetenz eine<br />
gemeinsam Arbeit erleichterte<br />
und auch<br />
kantonal- bzw. bundespolitisch<br />
unklare<br />
juristische Verhältnisse<br />
prägnant benannt<br />
wurden.<br />
Der Abschlussbericht<br />
und die entsprechenden<br />
Würdigungen<br />
der zuständigen Behörden ermutigen die Mitarbeiter in ihrer<br />
klinischen Arbeit, zumal die Umsetzungsvorschläge sehr genau auf<br />
die Alltagssituation der PatientInnen und der Stationen bezogen<br />
waren.<br />
Der vollständige Bericht ist unter folgender Internet-Adresse abzurufen:<br />
www.cpt.coe.int<br />
9
An der Grenze von Geistes- und<br />
Naturwissenschaft.<br />
Werkstattbericht aus der Akutpsychiatrie
Dr. med. Jörg Burmeister, Leitender Arzt Akutpsychiatrie<br />
Standards für die Seele<br />
In einer breit abgestützten Projektarbeit wurden<br />
Leitlinien für die Erfassung, Einschätzung<br />
und angemessene Therapie bei Depression<br />
und Suizidalität erarbeitet.<br />
Das Fachgebiet der psychiatrischen Medizin und allgemeiner der<br />
psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung liegt seit jeher im<br />
Spannungsfeld zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Einerseits<br />
funktioniert auch der «psychische Apparat» aufgrund neuronaler<br />
Netzwerke, die im zentralen Nervensystem, aber auch im Bauchraum<br />
(!) untergebracht sind, kann entsprechend instrumentell<br />
untersucht oder therapeutisch angegangen werden, andererseits vollziehen<br />
sich Verhaltensweisen im Rahmen komplexer, «ganzheitlicher»<br />
Handlungsmuster, die auch durch den Bauch (den Körper)<br />
und das Herz (den Affekten)geprägt werden. Dabei entziehen sich<br />
viele Vorgänge einer bewussten oder objektiven Kontrolle und Kontrollierbarkeit<br />
(die Dimension des Unbewussten). Soziale und<br />
emotionale Einflüsse hinterlassen zudem unmittelbare «Spuren» in<br />
unserem zentralen Nervensystem, Nervenbahnen<br />
und -verbindungen verändern sich durch<br />
Umwelteinflüsse. Diese enorme Anpassungsleistung<br />
unseres Gehirns, seine sogenannte<br />
Plastizität als biologische Grundlage seelischer<br />
Prozesse, macht einmal mehr deutlich wie<br />
sehr eben beides, organisch körperliche und psychisch feinstoffliche<br />
Sphäre, miteinander verwoben und nur künstlich trennbar sind.<br />
Die seit dem Altertum bekannte Spaltung zwischen Leib und<br />
Seele scheint damit eigentlich überwunden und wissenschaftlich ad<br />
acta gelegt worden zu sein. Gerade aber auch deshalb regen sich bei<br />
dem Versuch, Diagnostik und Behandlungsschritte in der Psychiatrie<br />
zu vereinheitlichen und «standardisierte» Empfehlungen auszusprechen,<br />
«natürliche» Widerstände. Von dem Versuch, dessen ungeachtet<br />
ein entsprechendes Programm in der vielschichtigen Struktur und<br />
Dynamik unserer Institution zu entwickeln und für die Anwendung<br />
in der Praxis fruchtbar zu machen, soll hier die Rede sein.<br />
Schrittweises Vorgehen in der Projektarbeit<br />
So häufig Depressionen weltweit vorkommen (die WHO geht davon<br />
aus, dass im Jahr 2010 depressive Erkrankungen die häufigste<br />
Erkrankung weltweit sein werden und damit die Rolle der Herz-<br />
Kreislauferkrankungen ablösen werden), so sehr stellen die nicht nur<br />
für die Betroffenen unmittelbar spürbaren Belastungen, sondern<br />
auch die sekundären Folgen für Angehörige, Behandelnde und Gesellschaft<br />
eine der grössten Herausforderungen an unser Fachgebiet<br />
der Psychiatrie und Psychotherapie dar. Depressive Erkrankungen<br />
machen naturgemäss auch einen erheblichen Anteil an der Gesamtzahl<br />
aller in unserer Klinik behandelten Patientinnen und Patienten<br />
aus. Und so liegt es nahe, gerade dieses Störungsbild als Pilotprojekt<br />
für qualitätssichernde und qualitätsfördernde Behandlungsempfehlungen<br />
in unserer Klinik zu etablieren.<br />
Ausgehend von einem Beschluss der Klinikleitung, in dem ein<br />
entsprechender Auftrag an den Berichterstatter übertragen worden<br />
war, bildete sich eine Projektgruppe, die auf Kaderebene alle Bereiche<br />
und Angehörige der beiden wichtigsten Berufsgruppen (therapeutische<br />
Mitarbeiter und Mitarbeiter des Pflegebereiches) vereinigte.<br />
In dieser Projektgruppe wurde der Auftrag inhaltlich<br />
abgestimmt und das konkrete Vorgehen in Einzelschritten bis zum<br />
Projektabschlusses geplant. Es entspricht der Tradition und der Kultur<br />
unseres Hauses, dass von Anfang an keine einheitliche Lösung<br />
für alle Bereiche und alle Stationen in unserem Haus angestrebt<br />
Es entspricht der Tradition und der Kultur unseres<br />
Hauses, dass von Anfang an keine einheitliche Lösung<br />
für alle Bereiche und alle Stationen in unserem<br />
Haus angestrebt wurde.<br />
wurde. Vielmehr wurden die bestehenden Unterschiede, die sich ja<br />
in der Praxis tagtäglich bewähren und ihre Rechtfertigung aus dieser<br />
Praxis schöpfen, vom Grundsatz her explizit bestätigt. Als weiteres<br />
wesentliches Prinzip galt es den Eindruck zu vermeiden, durch das<br />
Qualitätsprojekt Kritik an der gewachsenen institutionellen Praxis<br />
üben zu wollen oder diese Praxis von Aussen unnötig «scharf» kontrollieren<br />
oder gar reglementieren zu wollen. Als letztes musste vor<br />
allem der Einsatz aller beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
an dem Projekt immer wieder an die vorhandenen Ressourcen in Bezug<br />
auf Zeit, Energie und Motivation angeglichen werden.<br />
Aufnahme des Ist-Zustandes<br />
Die Projektgruppe erarbeitete als ersten Schritt einen Fragebogen, in<br />
dem die bestehende Praxis in den verschiedenen Bereichen und Stationen<br />
möglichst detailliert erfasst und abgebildet werden sollte.<br />
Gleichzeitig wurde über das Projekt an den regelmässig stattfindenden<br />
Mitarbeiterveranstaltungen in unserem Haus breit informiert<br />
(Informationen durch die Klinikleitung an Vertreter aller Berufsgruppen,<br />
z. B. auch Handwerker, Ökonomie, oder Verwaltung, in<br />
11
12<br />
sechswöchigen Abständen). Dabei stellte von Anfang an die Abklärung<br />
des Weiterbildungsbedarfs und der Wünsche nach Vertiefung<br />
einzelner Themen eines der Hauptanliegen des Projektes dar. Parallel<br />
zur Gewinnung von Daten durch den Einsatz der Fragebögen, die<br />
durch die Mitglieder der Projektgruppe (Bereichsleitung) auf allen<br />
Stationen der jeweiligen Bereiche persönlich vorgestellt und abgesprochen<br />
worden waren, entwickelte der Referent insgesamt sieben<br />
inhaltliche Standards zum Projektauftrag (Qualitätsmanagement<br />
Depression und Suizidalität, siehe Kasten).<br />
In Ihnen werden die weiter oben dargelegten Gesichtspunkte<br />
umgesetzt: Respektierung und Einbezug der bestehenden Praxis, die<br />
sich bewährt hat, möglichst individuelle, stations- oder bereichsbezogene<br />
Lösungen, die dennoch eine gemeinsame inhaltliche Struktur<br />
und gemeinsame Eckwerte abdecken. Dabei zeigte sich auch an<br />
dieser Stelle, wie stark in der Projektgruppe selbst die Bedürfnisse<br />
nach Erhalt eigener Autonomie, eigener Traditionen und die Respektierung<br />
der für die eigene Selbstbestimmung wichtigen Unterschiede<br />
mit anderen Bereichen in das Thema der Behandlungsempfehlungen<br />
hineinspielt.<br />
Zum Beispiel verfügt sowohl der Jugendbereich wie auch der gerontopsychiatrische<br />
Bereich über spezifische Instrumente und Vorgehensweisen<br />
in ihrer Praxis, die sich von der Praxis in anderen Bereichen<br />
deutlich abhebt. Aber auch Abläufe, konzeptuelles<br />
Selbstverständnis und strukturelle Vorgaben im Psychotherapiebereich<br />
(z.B. Vorgespräche, längere Behandlungsverläufe) unterscheiden<br />
diesen wiederum von allen anderen Bereichen. Hinzu kamen<br />
Verbindlichkeiten und Verpflichtungen durch andere, gleichzeitig<br />
stattfindende Projekt, welche die Bedeutung und die Umsetzung des<br />
hier beschriebenen Projektes in jedem Bereich wieder anders gewichten<br />
liess.<br />
Bei der Auswertung der Fragebögen zeigte sich über alle Stationen<br />
und Bereiche hinweg eine hohe professionelle Qualität, was Erfassung<br />
und Abklärung von Depressionen oder suizidalen Krisen betrifft.<br />
Lücken zeigten sich jedoch bei der Frage, wie man sich selbst<br />
als Behandelnde gerade in der Therapie der Depression oder der Beantwortung<br />
suizidaler Krisen gegen Überforderungsmomente schützen<br />
kann (so genannte Verhütung von Burn-Out), in der Frage wie<br />
eine möglichst breite und in sich stimmige Information für alle von<br />
der Behandlung Betroffenen gewährleistet werden kann (Transparenz<br />
der Behandlung, Informationen an Angehörige und Dritte, sogenannter<br />
Informed Consent) oder wie genau das Vorgehen bei<br />
schwerwiegenden Zwischenfällen, insbesondere bei Suizidhandlungen,<br />
auf den jeweiligen Stationen und für die Gesamtklinik einheitlich<br />
geregelt werden soll. Die Ergebnisse der Befragung wurden<br />
gesamthaft von den jeweiligen Bereichsleitungen mit jeder Station<br />
und ihren Mitarbeitern besprochen.<br />
Erarbeitung einer gemeinsamen Haltung<br />
Aufgrund der Gespräche konstituierten sich Arbeitsgruppen in den<br />
einzelnen Bereichen. Sie begannen vor dem Hintergrund der Ergebnisse<br />
der Befragung die Inhalte der einzelnen Standards pro Bereich<br />
und in Bezug auf jede einzelne Station im Detail zu entwickeln. Um<br />
den Austausch zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen zu erleichtern,<br />
wurde eine gemeinsame Abfolge der einzelnen Standards vereinbart.<br />
Zunächst beschäftigten sich die Arbeitsgruppen mit dem<br />
Prozess der Diagnosestellung bei depressiven Zuständen, der Abklärung<br />
und Einschätzung von Suizidalität sowie der Art und Weise,<br />
wie Informationen über die beabsichtigte Behandlung dem Betroffenen<br />
vermittelt werden könnten (Informed Consent).<br />
So fliessen zum Beispiel in den Prozess der Diagnosestellung die<br />
Informationen von Zuweisern, Angehörigen und früheren Behandlern<br />
ebenso ein wie die Befunde, die sich im Laufe der ersten Behandlungssequenz<br />
in den verschiedenen therapeutischen Begegnungen<br />
und stationären Schauplätzen der Behandlung ergeben haben.<br />
Gleichzeitig werden aber auch spezielle Instrumente zur Diagnosestellung<br />
verwendet (Tests, Fragebögen), welche die so gewonnenen<br />
Daten breiter abstützen und eine Verlaufskontrolle ermöglichen.<br />
Unterschiede zwischen den Bereichen und Stationen ergeben sich<br />
aufgrund unterschiedlicher Behandlungszeiten, unterschiedlicher<br />
Behandlungskonzepte, die ein anderes Störungsmodell und damit<br />
auch andere Daten für die Diagnosestellung erforderlich machen<br />
und durch unterschiedliche Behandlungserfahrungen einzelner Teams<br />
und Bereiche (z. B. seit langem eingeführte und sich bewährende<br />
Instrumente). Wie ergibt sich aber eigentlich «Qualität» durch<br />
einen Standard, wenn viele Elemente der Behandlung unverändert<br />
bleiben und sich auch schon früher bewährt haben<br />
Zum einen bewirkt die bewusste Auseinandersetzung und gemeinsame<br />
Durcharbeitung der bestehenden Behandlungsrealität für<br />
alle Stationen und alle Bereiche eine ungemein wichtige Sensibilisierung<br />
für die in den Standards angesprochenen Themen. Die<br />
durch die Arbeit an den Standards gewonnene Distanz zum eigenen<br />
Handeln wirkt schöpferisch. Sie erlaubt, allenfalls bestehende Lücken<br />
(z. B. bei der Koordination von Schnittstellen zwischen therapeutischen<br />
und pflegerischen Aktivitäten) in der Gesamtbehand-
lung zu schliessen, aber auch Bedeutung, Wert und Sinn des eigenen<br />
Vorgehens gemeinsam überprüfen zu können. Erst auf dieser<br />
Grundlage kann eine gemeinsame Haltung und Kultur gedeihen<br />
und verankert werden. Die Arbeit an den Standards schärft den<br />
Blick für die Bedürfnisse der anvertrauten Patientinnen und Patienten<br />
und der Ihnen verbundenen Angehörigen, Zuweisern und anderen<br />
Personen ausserhalb der Klinik. Gleichzeitig vermittelt sie zwischen<br />
den Bereichen und den Stationen, schafft Transparenz und<br />
13<br />
Standard Depression und Suizidalität<br />
Jede Abteilung kennt ihren (!) Prozess der Diagnosestellung<br />
und regelt ihn einvernehmlich.<br />
Kommentar: dazu gehören u. a. Zeitvorgaben, Sachvorgaben<br />
(Einbezug von Informationen/Materialien) und Vorgaben<br />
zum Setting. Dazu gehören somatische Abklärungen, ICD-10,<br />
MAS (im Jugendalter) und Pflegediagnose. Dazu können<br />
weiterhin gehören Angaben zur Genese, zu aufrechterhaltenden<br />
Faktoren der Depression (z. B. incl. OPD-Kriterien), zur<br />
Ausprägung der Depression (z. B. Hamilton-Score) aber auch<br />
zu «antidepressiven» Ressourcen inclusive dem vorherrschenden<br />
Bewältigungsstil (Achse-V DSM-IV)<br />
Jede Abteilung kennt mindestens ein Modell zur Entstehung<br />
und Verlauf von depressiven Störungen und<br />
wendet es an.<br />
Kommentar: dazu gehört u. a. die Kenntnis und Zuordnung<br />
typischer anamnestischer, somatischer, psychosozialer und<br />
interpersonaler Faktoren und Befunde in ein plausibles Erkärungsmodell.<br />
Jede Abteilung wendet das Prinzip des Informed Consent<br />
bei der Behandlung an.<br />
Kommentar: zum Informed Consent gehört u. a. eine Aufklärung<br />
über Störungs- und Behandlungsmodelle der Depression<br />
incl. alternative Behandlungsmöglichkeiten oder medikamentöse<br />
Wirkungen/Nebenwirkungen. Wenn erforderlich<br />
kann ein Behandlungsvertrag abgeschlossen werden.<br />
Jede Abteilung verfügt über ein Modell der gemeinsamen<br />
Therapieplanung. Die Therapieplanung wird regelmässig<br />
evaluiert.<br />
Kommentar: dazu gehören u. a. Zeitvorgaben, Sachvorgaben<br />
(Einbezug von Informationen/Materialien) und Vorgaben<br />
zum Setting. Dazu gehören weiterhin Aussagen über die<br />
medikamentöse Therapie, die psychotherapeutische Behandlung,<br />
die soziale Rehabilitation, den Einbezug von Angehörigen<br />
und die Prophylaxe zukünftiger depressiver Phasen. Die<br />
medikamentöse Therapie kann auf einen sogenannten Algorhytmus<br />
abgestützt werden.<br />
Jede Abteilung verfügt über ein Modell der Abklärung von<br />
Suizidalität und der Intervention bei Suizidalität.<br />
Kommentar: bei allen depressiven Störungen sollte die Suizidalität<br />
regelmässig beurteilt werden. Für die Beurteilung,<br />
aber auch für die allenfalls erforderliche Intervention, sollten<br />
Vorgaben zu Zeit, Art und beteiligten Personen incl. Entscheidungsprozessen<br />
vorhanden sein.<br />
Jede Abteilung trifft Vorkehrungen zum Schutz der<br />
Behandelnden (Anti-Burn-Out Massnahmen).<br />
Kommentar: der objektive Behandlungsanspruch depressiver<br />
Störungen kann alle (!) Behandelnden auf Dauer überfordern,<br />
Schutzmassnahmen für einzelne aber auch für ganze<br />
Teams sehen zeitliche und emotionale Entlastungsmöglichkeiten<br />
vor.<br />
Jede Abteilung vereinbart ein abgesprochenes Vorgehen<br />
bei vollzogenem Suizid oder anderen schweren und unerwarteten<br />
Zwischenfällen in der Behandlung.<br />
Kommentar: «Critical incidents» wie etwa ein vollzogener<br />
Suizid lösen eine Vielzahl emotionaler Prozesse auf Teamund<br />
Patientenebene gleichzeitig aus, die eine vernunftgeleitete<br />
Absprache über das weitere Vorgehen erheblich behindern.<br />
Vereinbarungen legen deshalb verschiedene Formen<br />
der Bewältigung schon vorab fest (Gruppeninterventionen<br />
und Einzelinterventionen im Sinne des Defusing und des<br />
Debriefing, juristische und administrative Belange, längerfristige<br />
Nachbereitung).
14 Verständigung für den Anderen und das Andere. Insgesamt verbessert<br />
sich im Laufe der gemeinsamen Arbeit auch die Zusammenarbeit<br />
und der Zusammenhalt im Rahmen der Gesamtklinik.<br />
gischen Vorfalles müssen angemessen behandelt<br />
werden. Da das Thema aber an sich häu-<br />
abschliessen, die Standards sind immer nur vorläufige<br />
Das Bemühen um Qualität lässt sich nicht wirklich<br />
fig der Verdrängung anheimfällt («das wird bei Ansätze, die in der Praxis verändert und angepasst<br />
uns sicher nicht passieren»), ist eine bewusste werden müssen.<br />
Auseinandersetzung in Ruhe und ohne Handlungsdruck<br />
so ungemein wichtig. Als Ergebnis der Diskussion ist<br />
eine konkrete Checkliste erarbeitet worden, mit der das Vorgehen<br />
Schritt für Schritt und im Detail vorgegeben wird. Zusätzlich sind<br />
verschiedene Planungs- und Organisationshilfen entstanden, mit<br />
denen etwa die Durchführung von Gruppensitzungen, die Betreuung<br />
von einzelnen Betroffenen oder die wichtigsten Gesichtspunkte<br />
bei der inhaltlichen Gestaltung der Betreuung selbst zwischenzeitlich<br />
gestaltet werden können.<br />
Nach einer mehr als 3-jährigen Projektphase nähern sich die einzelnen<br />
Arbeitsschritte und damit die Umsetzung des Projektausschriebs<br />
ihrem Ende. Jeder Bereich hat mittlerweile eigene Behandlungsempfehlungen<br />
und Standards geschaffen, wobei bei einzelnen<br />
Themen (Informed Consent, Behandlungsmodelle, De-Briefing<br />
nach vollzogenem Suizid) auch bereichsübergreifende, klinikweite<br />
Lösungen erarbeitet worden sind. Das Ergebnis des Projektes ist<br />
zum Teil veröffentlicht, zum Teil an internationalen Kongressen vorgetragen<br />
worden. Die einzelnen Instrumente werden in der Praxis<br />
regelmässig überprüft, zum Teil ergänzt oder ersetzt: Das Bemühen<br />
um Qualität lässt sich in diesem Sinne nicht wirklich abschliessen,<br />
die Standards sind immer nur vorläufige Ansätze, die in der Praxis<br />
verändert und angepasst werden müssen. Darüber hinaus sind auch<br />
neue Gremien und Foren entstanden (z. B. Suizidkonferenz und<br />
Peer Review nach erfolgtem Suizid, spezielle Weiterbildungen im<br />
Suizid Monitoring). Es hat sich aber auch gezeigt, dass solche Projekte<br />
die eingangs erwähnten Kriterien wie überschaubare Dauer,<br />
messbare Erfolge und Reduktion von Kontrolle und Fremdbestimmung<br />
unbedingt einhalten müssen, um letztlich erfolgreich sein zu<br />
können. Standards stehen und fallen mit den Mitarbeitern, die sie<br />
einsetzen und mit den Patienten, derer Behandlung sie dienen sollen.<br />
Den einen sei für ihre jahrelange unermüdliche Mitarbeit an<br />
den Standards an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt, den andern<br />
für ihre Geduld und Nachsicht, wenn trotz allem keine wirklich<br />
rasche Besserung gelingt.<br />
Standards helfen, schwierige Situationen zu meistern<br />
Einige Themen tauchen aber auch erstmalig und als solche ganz neu<br />
im Bewusstsein der Arbeitsgruppen auf: die schwierige, aber notwendige<br />
Frage, wie etwa nach einem geschehenen Suizid innerhalb<br />
der Klinik die betroffene Station das tragische Ereignis für Angehörige,<br />
Mitpatienten aber nicht zuletzt auch in Bezug auf die eigenen<br />
Mitarbeiter auffangen und angemessen beantworten kann oder die<br />
Frage, wie sich Mitarbeiter selbst vor den Folgen einer übermässigen<br />
Beanspruchung durch die Kräfte zehrende Therapie von schwer depressiv<br />
erkrankten Menschen schützen können, um nicht etwa selbst<br />
in den Sog von Überforderungsgefühlen, Versagensängsten und Enttäuschung<br />
hineingezogen zu werden. Was das genau bedeutet, soll<br />
anhand der Überlegungen zum Vorgehen nach einem erfolgten Suizid<br />
in der Klinik beantwortet werden.<br />
Die beschriebene Situation stellt sicher eine absolute Ausnahmesituation<br />
im klinischen Alltag dar (z. B. hat sich in der Klinik Littenheid<br />
in den letzten zehn Jahren maximal ein Suizid jährlich ereignet).<br />
Dennoch stellt gerade diese Situation ganz besondere<br />
Herausforderungen an das Behandlungsteam: die ungewohnte und<br />
unerwartete Krise erreicht durch ihre existentielle und der ihr innewohnenden<br />
Destruktivität und Gewalt traumatische Ausmasse. Dies<br />
führt zu heftigen, vernunftmässig nur bedingt steuerbaren emotionalen<br />
Reaktionen, die eine ruhige und geordnete Vorgehensweise gerade<br />
besonders erschweren. Es müssen so schnell wie möglich alle<br />
wichtigen Personen benachrichtigt werden, es muss die medizinische<br />
und psychologische Betreuung der betroffenen Mitpatienten<br />
und Teammitglieder gewährleistet sein und auch die formalen bis<br />
hin zu juristischen Aspekte eines solchen tra-
Hilfestellung für das Gleichgewicht<br />
der Seele.<br />
Werkstattberichte aus der Stationären Psychotherapie
Dr. med. Susanne Kunz, Leitende Ärztin stationäre Psychotherapie<br />
Ohne Projekt – keine Veränderung<br />
16<br />
Die drei 3 Stationen des Bereiches stationäre<br />
Psychotherapie haben im letzten Jahr<br />
ihre therapeutischen Konzepte überprüft<br />
und neue Inhalte erarbeitet. Die differenzierte<br />
Projektplanung hat sich als hilfreich erwiesen, um die zeitlichen<br />
Vorgaben einzuhalten und die gesteckten Ziele zu erreichen.<br />
Ausgangslage und Fragestellung<br />
Im Juli 1999 wurde die Klinik Littenheid in die 4 verschiedene Bereiche<br />
Akut-, Jugend-, Geronto- und Psychotherapie unterteilt.<br />
Seither sind für den Psychotherapiebereich Susy Wagner, Bereichsleiterin<br />
und Dr. Susanne Kunz, Leitende Ärztin, zuständig.<br />
Nach einem Jahr intensiver Einarbeitung stellte sich die Frage<br />
nach der weiteren Entwicklung des Bereiches, worauf wir uns zukünftig<br />
konzentrieren sollten.<br />
Welche therapeutischen Leitlinien haben wir bisher verfolgt,<br />
welche haben sich bewährt oder sind auch veränderungsbedürftig<br />
Auf welche Weise lässt sich der Bereich «stationäre Psychotherapie»<br />
auf dem Weg der Integration unterstützen Wie kann die inhaltliche<br />
Weiterentwicklung gefördert werden Wie können<br />
mittel- bis längerfristig bedarfsgerechte therapeutische Angebote<br />
nach neuestem wissenschaftlichem Erkenntnisstand und bei<br />
gleichzeitiger Optimierung der betriebswirtschaftlichen Aspekte<br />
entwickelt werden<br />
An welche Menschen wird sich auch zukünftig unser Angebot<br />
richten Entspricht der praktische und theoretische Ausbildungsstand<br />
fremden als auch eigenen Erwartungen <br />
Diese Fragen beschäftigten uns und bedurften einer vertieften<br />
Auseinandersetzung. Zwecks Optimierung der Aussenperspektive<br />
und Intensivierung des Veränderungsprozesses zogen wir einen<br />
Organisationsberater hinzu und von der Klinikleitung wurde uns<br />
ein detaillierter Projektauftrag erteilt.<br />
Projektgruppe<br />
Die Projektgruppe setzte sich aus VertreterInnen<br />
aller drei Stationen und interdisziplinär<br />
zusammen. Zusätzlich sollten in dieser<br />
Gruppe alle verbalen und nonverbalen Therapien<br />
vertreten sein. Der Chefarzt nahm als<br />
Vertreter der Klinikleitung teil. Die Leitung<br />
der Projektgruppe übernahmen die Bereichsleiterinnen,<br />
wobei Frau Wagner für den strukturellen Teil und<br />
Frau Kunz für den inhaltlichen Prozess zuständig war.<br />
Die Projektgruppe traf sich monatlich und das Projekt sollte<br />
innert Jahresfrist abgeschlossen sein.<br />
Planung<br />
Unsere Planung für das Projekt enthielt folgende Teilschritte:<br />
● Literaturüberblick<br />
● Erarbeitung und Erfassung des aktuellen wissenschaftlichen<br />
Standards für stationäre psychotherapeutische Behandlungen<br />
● Besuch anderer Institutionen<br />
● Mitarbeiterbefragung<br />
● Bereichs-Klausurtagung zwecks Koordination aller Informationen<br />
● Besuch von Herrn Lohmer (Organisationsberater) im Mai und<br />
Oktober 2001<br />
● Beschluss konzeptioneller Veränderungen nach dem ersten Besuch<br />
● Zweiter Besuch mit Evaluation des bisher Erreichten<br />
● Im Anschluss Einleitung aller notwendigen Maßnahmen<br />
Besuche<br />
Wir besuchten die psychotherapeutische Station und die Tagesklinik<br />
von Prof. Dr. med. J. Küchenhoff in Basel. Dort interessierte<br />
uns vor allem die Tagesklinik mit dem speziellen teilstationären<br />
Behandlungssetting als auch die Borderline-Station, die von Dr.<br />
med. Dammann oberärztlich geleitet wird. In der Nachbarklinik<br />
Wil trafen wir Dr. med. F. Altorfer, Leitender Arzt des Psychotherapiebereiches,<br />
und seinem Team zusammen. Es war übrigens das<br />
erste Zusammentreffen dieser Art mit der Psychiatrischen Klinik<br />
Wil und der Austausch war für alle Beteiligten sehr spannend.<br />
Hier interessierte uns, neben den verschiedensten inhaltlichen<br />
Fragen auch ökonomische Probleme wie Belegung, Aufenthaltsdauern,<br />
allgemeine Kosten und Personalschlüssel.<br />
Wie können mittel- bis längerfristig bedarfsgerechte<br />
therapeutische Angebote nach neuestem wissenschaftlichem<br />
Erkenntnisstand und bei gleichzeitiger Optimierung<br />
der betriebswirtschaftlichen Aspekte entwickelt<br />
werden
Nach einer ersten Auswertung des aktuellen Diskussionsstandes<br />
psychotherapeutischer Standards in der Literatur konnten wir<br />
beginnen, spezifische Fragestellungen zu erarbeiten und zu vertiefen,<br />
wozu wir unsere Klausurtagung im Februar nutzten.<br />
Mitarbeiterbefragung<br />
Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung nahmen einen eigenen<br />
Stellenwert ein. Die Umfrage ergab ein deutliches Ergebnis. Neben<br />
finanziellen Aspekten stand der Wunsch nach pflegeorientierter<br />
Weiterbildung, besseren Räumlichkeiten und Vorschlägen zur<br />
Qualitätsverbesserung im täglichen Behandlungssetting weit im<br />
Vordergrund.<br />
Auftrag<br />
Aus den unterschiedlichen fachlichen und strukturellen Fragestellungen<br />
formulierten wir einen konkreten Auftrag an Herrn Lohmer<br />
und planten einen ersten Besuch im Mai 2001.<br />
Die Vorbereitung dieses Besuches durch die Bereichsleitung<br />
hatte einen hohen Stellenwert, um mit entsprechenden Informationen<br />
über Entstehung und Geschichte des Bereiches den inhaltlichen<br />
Diskurs gut vorzubereiten.<br />
Besuch von Herrn Lohmer<br />
Für die Teilnahme an diesem Event wünschten wir den Einbezug<br />
aller Berufsgruppen, um unserem Unternehmensberater einen<br />
möglichst breiten und tiefen Einblick in den aktuellen inhaltlichen<br />
und strukturellen Prozess zu gewährleisten. In den ersten<br />
2 Tagen fanden Gespräche auf den Stationen mit Einzelpersonen<br />
oder auch in kleineren Gruppen statt.<br />
Ebenfalls einbezogen wurden die Patienten der drei Stationen,<br />
mit denen Gruppeninterviews geführt wurden. Auch bereichsübergreifende<br />
Gespräche mit dem Personal<br />
aus dem Akutbereich und der Klinikleitung<br />
schienen uns für die Schnittstellen der Zusammenarbeit<br />
auf institutioneller Ebene sehr<br />
wichtig .<br />
Nach diesen zwei dichten Tagen kamen<br />
wir zum ereignisreichsten Tag, einem Klausur-Tag<br />
mit Grossgruppe(ca. 40 Personen),<br />
deren Teilnehmer sich aus dem Bereich rekrutierten. Herr Lohmer<br />
hatte aus den verschiedenen Gesprächen und schriftlichen Unterlagen<br />
für jede Station einige strukturelle und inhaltliche Thesen<br />
formuliert. Die Sitzungsstruktur planten wir nach Art der Balintgruppen<br />
mit Innen- und Aussenkreis. Jede Station hatte im<br />
Innenkreis die Möglichkeit, sich mit den aus den Gesprächen entstandenen<br />
Thesen auseinander zu setzen, während die zwei anderen<br />
Stationen im Aussenkreis mit kritischen Fragen Impulse gaben<br />
und die Diskussion anregten.<br />
Neuerungen<br />
Was sind nun die wesentlichen Veränderungen<br />
Pünt Süd<br />
Pünt Süd soll auf der Basis seiner langjährigen Geschichte mit<br />
dem Fokus auf Einzelpsychotherapie und individueller Ausrichtung<br />
der Behandlungskonzepte zukünftig eine bestimmte Gruppe<br />
von PatientInnen mit Persönlichkeitsstörungen, aber auch leichteren<br />
neurotischen Störungen behandeln, welche besonders von diesem<br />
Stationskonzept (keine Nachtwache, reduzierte Wochenendbetreuung<br />
und damit mehr Eigenverantwortung, sehr individuelle<br />
Therapieplanung) profitieren können. Weiter wird ein Kurztherapiekonzept<br />
(2–3 Wochen) entwickelt, welches die Eintrittsschwelle<br />
niedrig hält und bei sozial gut integrierten Patienten therapeutische<br />
Kriseninterventionen (beispielsweise bei Burnout und<br />
Mobbing) oder Intervallbehandlungen in Zusammenarbeit mit<br />
den ZuweiserInnen erlaubt.<br />
Wir wünschten den Einbezug aller Berufsgruppen, um<br />
unserem Unternehmensberater einen möglichst<br />
breiten und tiefen Einblick in den aktuellen inhaltlichen<br />
und strukturellen Prozess zu gewährleisten.<br />
Pünt Mitte<br />
Als erstes wurde eine grundlegend neue Behandlungsphilosophie<br />
erarbeitet: Vom «Müssen zum Dürfen».(siehe auch Artikel von<br />
Dr. Jörg Wunderwald). Dieser Denkansatz brachte einen grossen<br />
Umdenkungsprozess in Gang. So wurde in weiterer Folge ein Stufenmodell<br />
für Patienten mit Abhängigkeitsstörungen konzeptualisiert,<br />
welches Behandlungen über vier, acht und zwölf Wochen erlauben<br />
soll. Wesentliche Neuerungen des Konzeptes bestehen<br />
darin, die PatientInnen mit Abhängigkeitsstörungen in den ersten<br />
17
18<br />
Wochen ihres Aufenthaltes zu intensiveren Therapien entweder zu<br />
motivieren oder aber auch, nach gemeinsamer Einschätzung, bei<br />
weniger Motivation wieder zu entlassen.<br />
Darüber hinaus bietet diese Station in Kombination mit Abhängigkeitsstörungen<br />
auch für andere psychiatrische Störungsbilder,<br />
allen voran bei Depressionen und Angstzuständen, Behandlungen<br />
an.<br />
Pünt Nord<br />
Pünt Nord wird die bisherige Entwicklung mit dem Fokus auf spezielle<br />
Behandlungsangebote für Adoleszente und junge Erwachsene<br />
weiter führen (siehe auch Artikel von Dr. Pia Ineichen) und<br />
sowohl milieutherapeutisch als auch psychotherapeutisch<br />
gezielte Weiterbildungen<br />
durchführen. Erfreulicherweise konnten wir<br />
für die Ausbildung eine enge Kooperation<br />
mit den Psychotherapiestationen der KPK<br />
Wil aufbauen.<br />
Insgesamt war die Erkenntnis wichtig,<br />
dass unsere sowohl im ärztlichen als auch im<br />
pflegerischen Bereich eher auf das Setting<br />
der Zweierbeziehung orientierte Haltung im<br />
stationären Rahmen (Einzelpsychotherapie, Bezugspersonengespräche)<br />
Korrekturen in Richtung konsequenter Nutzung milieutherapeutischer<br />
Prinzipien bedarf. Dazu sind gruppen- und milieutherapeutische<br />
Schulungen ebenso wichtig wie grundsätzlich<br />
neue Akzentuierungen hinsichtlich Einstellungen, Haltungen und<br />
Wertungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit.<br />
Prozess<br />
Nach diesem ersten Treffen mit Herrn Lohmer war eine ziemliche<br />
Verunsicherung spürbar. Zu welchen Veränderungen würden diese<br />
neuen Konzeptvorschläge wohl führen Besonders für die Station<br />
Pünt Nord waren die Konsequenzen am greifbarsten, was sich zunächst<br />
einmal in der Veränderung der Altersgrenze auswirkte. War<br />
auf Pünt Nord bislang eine altersmässig recht gemischte Patientengruppe<br />
zu finden, konzentrierten wir uns nun gezielter auf die<br />
Behandlung junger Adoleszenter zwischen 18 und 25 Jahren. Es<br />
brachte einiges in Bewegung und für einzelne Mitglieder des Pflegeteams<br />
wurde fraglich, ob sie auch zukünftig mit dieser jungen<br />
Patientengruppe arbeiten würden. Aber auch auf den anderen Stationen<br />
wurden kritische Diskussionen geführt.<br />
Zwischen dem ersten und zweiten Besuch von Herrn Lohmer<br />
hatten wir ein halbes Jahr Zeit, uns mit den Fragen auseinander zu<br />
setzen und die gemeinsam erarbeiten Vorschläge auf ihre Realisierbarkeit<br />
zu überprüfen.<br />
Im Rahmen von Konzeptsitzungen aller drei Stationen diskutierten<br />
wir die geplanten Veränderungen und erstellten konkrete<br />
Teilziele auf struktureller, inhaltlicher und personeller Ebene. In<br />
der Projektgruppe konnten wir den laufenden Diskussionsstand<br />
kritisch reflektieren, Bedenken und Befürchtungen im Wechsel<br />
mit enthusiastischen Veränderungswünschen auffangen und in<br />
den Prozess einfliessen lassen. Die Projektleitung begleitete diesen<br />
Prozess und bereitete den 2. Besuch von Herrn Lohmer vor.<br />
In der Projektgruppe konnten wir den laufenden<br />
Diskussionsstand kritisch reflektieren, Bedenken und<br />
Befürchtungen im Wechsel mit enthusiastischen<br />
Veränderungswünschen auffangen und in den Prozess<br />
einfliessen lassen.<br />
Der 2. Besuch diente im wesentlichen der Festigung und Vertiefung<br />
der begonnenen Entwicklung, erneut sollten fachliche Fragen<br />
nachhaltig diskutiert und evaluiert werden.<br />
Anlässlich der Gespräche wurde allen Beteiligten die unterschiedliche<br />
Veränderungskultur und Prozessdynamik jeder Station<br />
sehr deutlich. Gerade diese Offenheit miteinander trug wesentlich<br />
zur Entwicklung gegenseitigen Vertrauens bei.<br />
Resultate<br />
Konkrete Resultate des Projektes finden sich nun in den konzeptuellen<br />
Anpassungen, die Ende des Jahres festgelegt wurden. Für<br />
die Einführung der Methode der Dialektisch Behavioralen Therapie<br />
wurde eine Unterprojektgruppe gebildet, die sich in Koordination<br />
mit der Nachbarklinik mit der Realisierung der Ausbildung<br />
beschäftigt. Die Planung einer bereichsübergreifenden DBT-<br />
Gruppe ist abgeschlossen und wird seit Februar dieses Jahres im<br />
Bereich angeboten. Die Station Pünt Mitte bietet den Patienten<br />
seit Jahresanfang eine Behandlung mit zeitlich gestaffelten Therapien<br />
an und Pünt Süd verfügt über ein neues Konzept für<br />
Kurzzeitpsychotherapien und befasst sich konzeptuell mit der
Diagnostik und Behandlung von Patienten mit narzisstischen Problemstellungen.<br />
So zeigt sich, dass die konkreten Ergebnisse unseren<br />
Patienten und Patientinnen zugute kommen sollen.<br />
Im weiteren hat die TFP-Ausbildung für Therapeuten (Transferenced<br />
fokussed Therapie ) begonnen. Ebenso konnte mit personellen<br />
Umstrukturierungen den neuen Bedingungen Rechnung<br />
getragen werden.<br />
Mit der Umsetzung und Einleitung dieser Teilschritte wurde<br />
das Projekt abgeschlossen. Im Anschluss daran informierten wir<br />
alle Zuweiser und Interessenten inner- und ausserhalb der Institution<br />
Anfang des neuen Jahres über die Veränderungen in den Therapiekonzepten.<br />
19<br />
Resümee<br />
Ist der Titel «ohne Projekt keine Veränderung» gerechtfertigt Was<br />
hat das Projekt nun eigentlich gebracht<br />
Diese Prozesse wären ohne zeitlich und inhaltlich begrenzten<br />
Rahmen so nicht durchführbar gewesen. Wir haben uns mit der<br />
Planung und Realisierung des Projektes auf wesentliche inhaltliche<br />
und strategische Fragen der Weiterentwicklung des Bereiches<br />
konzentrieren können. Die Ausrichtung wurde somit für die nächsten<br />
drei Jahre festgelegt. Die gesteckten Ziele und Vorstellungen<br />
haben wir umsetzen und der Bereich hat im Rahmen des Projektes<br />
seine Identität ausbauen können. Der gewünschte bereichsübergreifende<br />
inhaltliche und personelle Ressourcentransfer<br />
macht sich deutlich bemerkbar. Die individuelle Entwicklung vieler<br />
Teammitglieder hat starken Auftrieb bekommen und wird im<br />
weiteren mit einem Zuwachs von Kompetenz einher gehen. Jede<br />
Station hat für sich neue Zielsetzungen entwickelt, alle drei Stationen<br />
zusammen ergänzen sich und sind aufeinander abgestimmt.<br />
Mit dem Spannungsverhältnis zwischen Routine und Neuerungen,<br />
therapeutischen Einheiten und dem Bereich als Ganzes<br />
stellen sich neue Herausforderungen, die für die zukünftige lebendige<br />
Entwicklung unabdingbar sind.<br />
Unser Ziel war und ist es, kompetente und nach wissenschaftlichen<br />
Ergebnissen abgestützte Behandlungen anbieten zu können.<br />
Dabei möchte ich in diesem Zusammenhang darauf hinweisen,<br />
dass bei allen Neuerungen in den verhaltenstherapeutischen<br />
und den analytisch orientierten Therapieverfahren weiterhin das<br />
Bemühen um ein individuelles Verständnis des Menschen die Basis<br />
unseres therapeutischen Handelns ist.
Martin Weyer, Stationsleiter stationäre Psychotherapie, Projekt- und Gruppenleiter Skillstraining<br />
Das Skillstraining nach der<br />
Dialektisch-Behavioralen Therapie<br />
20<br />
Seit Februar wird ein neues, störungsspezifisches<br />
Konzept zur Behandlung von<br />
Borderline-Persönlichkeitsstörungen angewandt,<br />
das sich während der Therapie und<br />
auch nach dem Klinikaufenthalt als sehr wirksam erwiesen hat.<br />
Das Verringern von:<br />
● Chaotischen zwischenmenschlichen Beziehungen<br />
● Starken Gefühls- und Stimmungsschwankungen<br />
● Übermässiger Impulsivität<br />
● Identitätsunsicherheit und Denkstörungen<br />
Einleitung<br />
Ein erheblicher Anteil unseres in psychotherapeutischer Behandlung<br />
befindlichen Klientels leidet unter einer diagnostizierten<br />
Borderline-Persönlichkeitsstörung. Diese Störung ist in der Regel<br />
mit massiven selbstschädigenden, suizidalen und therapieschädigenden<br />
Verhaltensweisen der Patienten verbunden und stellt hohe<br />
therapeutische Anforderungen an die Behandler.<br />
Vor diesem Hintergrund sahen sich die Bereichsleitung und die<br />
Stationsleitungen der drei Littenheider Psychotherapiestationen<br />
veranlasst, nach wirksamen, störungsspezifischen Behandlungsmethoden<br />
für Borderline-Patienten Ausschau zu halten mit dem<br />
Ziel, diese in das bestehende Behandlungsangebot zu implementieren.<br />
Ein erwiesenermassen effektives, weil klinisch validiertes Behandlungskonzept<br />
für die Therapie von Borderline-Patienten ist<br />
die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) nach Marscha Linehan<br />
(Seattle/USA). Die DBT wurde 1996 von Dr. Martin Bohus<br />
an der Universitätsklinik Freiburg (D) erstmalig für den deutschsprachigen<br />
Raum mit Erfolg adaptiert. Seit Februar <strong>2002</strong> bietet<br />
auch die Stationäre Psychotherapie Littenheid eine Variante dieser<br />
Behandlungsmethode an. Im folgenden soll diese Variante genauer<br />
dargestellt werden.<br />
1. Generelle Ziele des Skillstrainings nach der DBT<br />
Die generelle Zielsetzung des Fertigkeitentrainings ist der Erwerb<br />
und das Training von funktionalen und adaptiven psychosozialen<br />
Fertigkeiten in den folgenden Verhaltensbereichen (Modulen):<br />
● Achtsamkeit für sich selbst<br />
● Stresstoleranz<br />
● Bewusster Umgang mit Gefühlen<br />
● Zwischenmenschliche Beziehungen<br />
Mit Hilfe des Erwerbs und der Anwendung von Fertigkeiten in<br />
den oben genannten Verhaltensmodulen werden die folgenden<br />
spezifischen Therapieziele avisiert:<br />
Das Fördern von:<br />
● Befriedigenden zwischenmenschlichen Beziehungen<br />
● Fähigkeiten zur Regulation von Stimmungsschwankungen<br />
● Spannungs- und Frustrationstoleranz<br />
● Fähigkeit zur Achtsamkeit für sich selbst<br />
Kernstück der stationären DBT ist eine hierarchische Gliederung<br />
der Behandlungsziele:<br />
1. Aufbau von Überlebensstrategien zur Bewältigung suizidaler<br />
Verhaltensmuster<br />
2. Aufbau von aktiver Mitarbeit an der Therapie (Therapiecompliance)<br />
anstelle von therapieschädigenden Verhaltensmustern<br />
3. Befähigung zur ambulanten Therapie<br />
a) Aufbau von Fertigkeiten zur Bewältigung von akutem<br />
ambulanten Problemverhalten<br />
b) Aufbau von Fertigkeiten zur Vermeidung von Hospitalisierung<br />
und Behandlungsverlängerung<br />
Leider bildet der stationäre Behandlungsrahmen für die Zementierung<br />
der erworbenen dysfunktionalen Verhaltensmuster der<br />
Borderline-PatientInnen häufig ideale Bedingungen:<br />
Professionelle Helfer, die auch auf problematische interaktionelle<br />
Muster nicht mit Beziehungsabbruch reagieren, Schutz<br />
vor Alleinsein, verständnisvolle MitpatientInnen, Schutz vor<br />
Leistungsanforderungen, häufig die Bestätigung negativer Selbsteinschätzung.<br />
Gerade weil diese Bedingungen so ideal sind, muss<br />
diese Gefahr von Anfang an benannt werden (Therapieplanung<br />
ist Entlassungsplanung).<br />
Die PatientIn<br />
muss über Lerngesetze,<br />
Verstärker und<br />
den Zusammenhang<br />
zwischen Verhalten,<br />
Konsequenzen und<br />
der Wahrscheinlichkeit<br />
der Wiederho-<br />
Die Fertigkeiten-Trainingsgruppe<br />
ist keine<br />
therapeutische Prozessgruppe,<br />
sondern eine<br />
psychoedukative Gruppe<br />
mit dem Fokus der<br />
Vermittlung von Fertigkeiten.
lung oder Verringerung des Verhaltens (Kontingenzmanagement)<br />
aufgeklärt werden, um so frühzeitig mit ihr zusammen dysfunktionalen<br />
Tendenzen entgegenzusteuern.<br />
● Besprechen von neuen Hausaufgaben für das stationäre Skillstraining<br />
● Wind-down via Achtsamkeitsübung<br />
21<br />
2. Die Behandlungsstrukturen des stationären<br />
Skillstrainings<br />
2.1. Erwerb und Förderung der Skillskompetenz in<br />
der stationsübergreifenden Skillstrainingsgruppe<br />
Ziele der Trainingsgruppe sind die Vermittlung und Einübung von<br />
psychosozialen Fertigkeiten in den Verhaltensmodulen innere<br />
Achtsamkeit, Stresstoleranz, Umgang mit Gefühlen und zwischenmenschliche<br />
Beziehungen. Demzufolge ist die Fertigkeiten-Trainingsgruppe<br />
keine therapeutische Prozessgruppe, sondern eine<br />
psychoedukative Gruppe mit dem Fokus der Vermittlung von Fertigkeiten.<br />
Struktur der Skillstrainingsgruppe<br />
Gruppengrösse:<br />
drei bis maximal acht PatientInnen<br />
Frequenz:<br />
ein Mal pro Woche, jeweils zwei Stunden<br />
Leitung:<br />
zwei in der DBT ausgebildete TrainerInnen aus der Pflege<br />
Modalität:<br />
offene Gruppe<br />
Beginn und Dauer:<br />
je nach Indikation und nach Dauer des stationären Aufenthaltes;<br />
Beginn in der Regel ab Behandlungsphase II (Übertritt in die Therapiephase)<br />
Verlauf der Sitzungen<br />
● Begrüssung/Einstiegsritual: Erklärung der DBT- und Gruppenregeln;<br />
Einstieg via Achtsamkeitsübung<br />
● Evaluation der in der Gruppe vermittelten und auf der Station<br />
angewendeten Skills:<br />
– Besprechung der Hausaufgaben<br />
– Besprechung von Verhaltensanalysen<br />
– Besprechung und Controlling der individuell eingerichteten<br />
Notfall- und Skillskoffer<br />
● Kleine Pause<br />
● Vermittlung von neuen Skills gemäss den individuellen Behandlungsaufträgen<br />
Einrichten von individuellen Fertigkeitentrainings-<br />
Ordnern<br />
Jede PatientIn legt für sich einen individuellen Skillstrainings-<br />
Ordner an.<br />
Inhalt des Ordners:<br />
– Anmeldeformular mit Indikationsstellung und Behandlungsauftrag<br />
– Behandlungsvertrag für die Teilnahme an der Trainingsgruppe<br />
– Grundregeln DBT<br />
– Skills-Arbeitsblätter<br />
– Hausaufgabenblätter<br />
– Verhaltensanalysen<br />
Anmeldung für die Skillstrainingsgruppe<br />
Für die indikations-, ziel- und auftragsgebundene Durchführung<br />
des Skillstrainings ist eine vorgängige, formalisierte Anmeldung<br />
mit der Indikationsstellung und der Auftragsformulierung notwendig.<br />
Die Indikation und die Behandlungsziele werden von der<br />
jeweiligen TherapeutIn der in Frage stehenden PatientIn erstellt.<br />
2.2. Skillstraining auf der Station<br />
Ziele<br />
Die PatientInnen erkennen und problematisieren ihre maladaptiven,<br />
dysfunktionalen und selbstschädigenden Verhaltensweisen<br />
und können diese durch adaptive, funktionale, nicht selbstschädigende<br />
Verhaltensweisen ersetzen, indem sie die ihnen in der Skillstrainingsgruppe<br />
vermittelten Fertigkeiten auf der Station situativ<br />
gezielt und erfolgreich anwenden.<br />
Rolle der PatientInnen<br />
Fokussiert auf ihr Problemverhalten wenden die PatientInnen die<br />
ihnen in der Trainingsgruppe vermittelten Fertigkeiten konsequent<br />
und gezielt an. Dabei greifen sie systematisch auf die Hilfsmittel<br />
ihres individuell eingerichteten Notfallkoffers sowie auf die<br />
Arbeitsblätter ihres Fertigkeitentrainings-Ordners zurück. Dysfunktionale,<br />
selbstschädigende Verhaltensweisen werden über die<br />
Erarbeitung und Auswertung von Verhaltensanalysen problematisiert.
22<br />
Rolle der Pflege<br />
Die pflegerischen Bezugspersonen der betreffenden PatientInnen<br />
begleiten diese bei der Problematisierung dysfunktionaler und bei<br />
der Anwendung und Evaluierung funktionaler Verhaltensweisen.<br />
Bezüglich der Problematisierung dysfunktionalen Verhaltens achten<br />
sie auf die gezielte und vollständige Erarbeitung von Verhaltensanalysen<br />
durch die PatientInnen und evaluieren diese Verhaltensanalysen<br />
gemeinsam mit ihnen (fokussiert auf alternative<br />
Verhaltensstrategien). Die pflegerischen Bezugspersonen unterstützen<br />
die PatientInnen in der Anwendung funktionaler Verhaltensweisen,<br />
indem sie die in der Trainingsgruppe erworbenen<br />
Skills im Rahmen der Verhaltensanalyse abrufen und die PatientInnen<br />
bei der gezielten und korrekten Durchführung ihrer Skills<br />
unterstützen.<br />
Rolle der EinzeltherapeutInnen<br />
Die TherapeutInnen stellen die Indikation und setzen den generellen<br />
Behandlungsfokus für das Skillstraining. Eine wichtige Aufgabe<br />
der Einzeltherapie ist es, die PatientInnen dazu zu motivieren,<br />
ihre Skills anstelle ihrer gewohnten<br />
dysfunktionalen Verhaltensweisen einzusetzen.<br />
Dementsprechend ist es die Aufgabe der<br />
Einzeltherapeuten, eine mangelnde Motivation<br />
der PatientInnen bezüglich des Skillstrainings<br />
therapeutisch zu bearbeiten.<br />
Kommt es im Rahmen des Skillstrainings<br />
zu häufigem therapiestörenden Verhalten<br />
(z. B. Nichterscheinen, häufiges Zuspätkommen,<br />
Verweigerung von Verhaltensanalysen<br />
oder Hausaufgaben), melden die Skillstrainer und pflegerischen<br />
Bezugspersonen dies der EinzeltherapeutIn zurück. Die Verantwortung<br />
für die Bearbeitung von therapiegefährdenden Verhaltensweisen<br />
liegt bei der TherapeutIn.<br />
3. Auswirkungen des neuen Behandlungskonzeptes<br />
für die Arbeitsweise und für das Selbstverständnis<br />
der Pflege<br />
An der Umsetzung des neuen Behandlungskonzeptes ist das Pflegepersonal<br />
massgeblich beteiligt und zu jeder Zeit der Therapie<br />
aktiv eingebunden. Voraussetzungen für diese Art der Arbeit sind<br />
zentrale Annahmen im Selbstverständnis der Pflege. Die Pflege<br />
sieht sich:<br />
Die pflegerischen Bezugspersonen unterstützen die<br />
PatientInnen in der Anwendung funktionaler Verhaltensweisen,<br />
indem sie die in der Trainingsgruppe<br />
erworbenen Fertigkeiten im Rahmen der Verhaltensanalyse<br />
abrufen und die PatientInnen bei der<br />
gezielten und korrekten Durchführung unterstützen.<br />
Zielorientiert: das bedeutet, sich nicht auf Nebenschauplätzen der<br />
PatientIn aufzuhalten, sondern sich an den vereinbarten Therapiezielen<br />
zu orientieren.<br />
Zurückhaltend: in der Einstellung gegenüber der PatientIn, d. h.<br />
Verantwortung zurückgeben.<br />
Validierend: d.h. die PatientIn in ihren Gefühlen und Wahrnehmungen<br />
ernst nehmen, sie darin bestärken, dass ihr Verhalten für<br />
uns nachvollziehbar ist.<br />
Offen: Die Dinge beim Namen nennen, d.h. Selbstverletzungen<br />
sowie Gefühle wie Scham und Hass direkt ansprechen, so dass der<br />
PatientIn die Angst vor dem Ansprechen genommen wird und ihr<br />
gleichzeitig ein Modell geboten wird.<br />
Flexibel: zwar bestehen genaue Strukturen in der Verhaltenstherapie,<br />
was das Vorgehen angeht, im Mittelpunkt stehen aber immer<br />
die individuellen Bedürfnisse, Probleme und Problemlösungen<br />
der PatientIn.<br />
Nicht wertend: d.h. sowohl den Menschen als solchen mit seiner<br />
Borderline-Störung akzeptieren als auch die Situationen, die auf<br />
der Station auftreten und versuchen, mit der PatientIn zu erarbeiten,<br />
was es ihr im Moment schwer macht, Alternativen zu ihrem<br />
Verhalten zu sehen.<br />
Sachlich: mit der Problematik der PatientIn sachlich umgehen.<br />
Direktiv: direktiv arbeiten, d. h. Problemsituationen mit der<br />
PatientIn genau analysieren und auf Alternativen hinweisen.<br />
Ressourcenorientiert: Orientierung an den Ressourcen der jeweiligen<br />
PatientIn, die oft vorhanden sind, aber von vielen PatientInnen<br />
als solche nicht wahrgenommen werden.<br />
Dialektisch: dialektisch mit der PatientIn arbeiten, d.h. die Balance<br />
finden zwischen der Akzeptanz der Situation und gleichzeitigem<br />
Hinweisen auf mögliche Veränderungen.<br />
Aus dieser Haltung und der Umsetzung des oben beschriebenen<br />
Behandlungskonzeptes ergeben sich aufgrund der bisherigen
Erfahrungen unter anderem die folgenden Veränderungen im<br />
Pflegealltag:<br />
● Die Sicherheit im Umgang mit Borderline-PatientInnen ist<br />
spürbar gestiegen.<br />
● Der Umgang mit Selbstverletzungen findet in einem ruhigen<br />
und sachlichen Rahmen statt.<br />
● Das Pflegepersonal erlebt mehr Eigenverantwortung und Partizipationsmöglichkeiten<br />
im Behandlungsplan.<br />
● Der Zeitaufwand für die jeweilige PatientIn wurde auf ein therapeutisches<br />
Mass reduziert.<br />
● Die Beziehung zwischen PatienIn und der pflegerischen Bezugsperson<br />
ist tragfähiger, weil Absprachen von beiden Seiten besser<br />
eingehalten werden, was gleichzeitig eine aktivere Beziehungsgestaltung<br />
seitens der PatientIn bedeutet.<br />
● Die PatientInnen haben mehr Eigenverantwortung für ihre<br />
Handlungen im stationären Rahmen und können ihr dysfunktionales<br />
Verhalten vermehrt alternativ ersetzen.<br />
23
Mathias Erne, Stationsleiter stationäre Psychotherapie, Leiter der Skillstrainingsgruppe<br />
«Hart, hilfreich und einfach genial!»<br />
Ein Interview mit einer Teilnehmerin der Skillstrainingsgruppe<br />
24<br />
Frau Salver (Pseudonym), eine Patientin<br />
mit einer Borderline-Störung, ist seit vier<br />
Monaten in Behandlung auf einer Psychotherapiestation<br />
für junge Erwachsene. Sie<br />
besuchte die Skillstrainingsgruppe regelmässig und steht jetzt<br />
kurz vor ihrem Austritt.<br />
M.Erne: Bewertet auf einer Skala von eins bis zehn, wie hilfreich<br />
war die Skillsgruppe für Sie<br />
Fr.Salver: Sie hat mir total viel gebracht, acht bis neun auf der<br />
Skala.<br />
M.Erne: Wie belastend waren die wöchentlichen, zweistündigen<br />
Gruppensitzungen für Sie<br />
Fr.Salver: Je nach Thema sehr belastend. Auf der Skala auch bei<br />
acht bis neun.<br />
M.Erne: Was waren die schwierigen Themen<br />
Fr.Salver: Vor allem die Themen Selbstverletzungen und Selbstmord.<br />
M.Erne: War Ihnen die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung<br />
vorher schon bekannt, wie gingen Sie damit um<br />
Fr.Salver: Ich erfuhr die Diagnose das erste Mal bei meiner Anmeldung<br />
für die Skillsgruppe. Danach begann ich mich mit dem<br />
Thema auseinander zusetzen. Ich holte mir alles vom Internet<br />
herunter. Mit der Zeit lernte ich die Diagnose zu akzeptieren. Es<br />
ging mir besser dabei, und ich schnitt mich weniger.<br />
M.Erne: Hat die Skillsgruppe Ihnen etwas Besonderes vermittelt<br />
Fr.Salver: Ja, schon, die Skillsgruppe finde ich einfach genial.<br />
M.Erne: Was ist das Spezielle an der Gruppe<br />
Fr.Salver: Einfach in der Gruppe sein. Alle haben etwa die gleichen<br />
Probleme mit Spannungen, die man miteinander austauschen<br />
kann. Fast wie in einer Familie, man fühlt sich nicht so allein. Du<br />
lernst auch zu weinen und zu sagen, es geht mir jetzt wirklich<br />
schlecht, ohne sich schämen zu müssen, weil du weisst, zehn Minuten<br />
später kann es einem Anderen genau so gehen.<br />
M.Erne: Unterscheidet sich die Behandlung in der Skillsgruppe<br />
von den anderen Therapien<br />
Fr.Salver: Ja, in der Skillsgruppe wurde ich herausgefordert, und<br />
zwar aufs Härteste und aufs Tiefste.<br />
M.Erne: Wie empfanden Sie die vielen Gruppenregeln ( Behandlungsvertrag,<br />
Hausaufgaben, Videoaufzeichnung)<br />
Fr.Salver: Sehr hart! Doch ich sagte mir, jetzt musst du das halt<br />
akzeptieren, denn Regeln braucht es. Die Videokamera habe ich<br />
gar nicht so bemerkt, war mir ehrlich gesagt auch egal.<br />
M.Erne: Hat Ihr Therapeut Sie auf die Skillsgruppe oder auf Ihr<br />
Skillstraining angesprochen<br />
Fr.Salver: Es war einmal Thema, als es für mich in der Gruppe mit<br />
Ihnen schwierig wurde, in der Sitzung, wo ich mich von Ihnen<br />
übersehen fühlte.<br />
M.Erne: Was nehmen Sie für Ihren bevorstehenden Austritt mit<br />
von der Gruppe<br />
Fr.Salver: Sehr viel. Ich habe gelernt, mit meinen Gefühlen besser<br />
umzugehen und meine Spannungen besser auszuhalten, was sehr<br />
schwierig ist. Ich habe gelernt, dass es andere Hilfsmittel gibt, als<br />
mich zu schneiden. Und zwar einen ganzen Haufen, nicht nur<br />
zwei oder drei. Ich konnte mir in der Gruppe immer wieder neue<br />
Skills dazuschreiben.<br />
M.Erne: Was aus der Gruppe hilft Ihnen nach Ihrem Austritt, und<br />
wozu hilft es<br />
Fr.Salver: Sicher die ganzen Skills anzuwenden. Wenn ich es nicht<br />
mehr aushalte, mich zu wehren, zu sagen, es geht jetzt nicht mehr,<br />
ich brauche Hilfe, egal, ob zu Hause oder bei der Arbeit oder im<br />
Ausgang. Ich habe die Skillsliste zu Hause aufgehängt. Auch die<br />
Spannungskurve, für meinen Freund, wo ich mit einer Büroklammer<br />
hin und her fahren kann und ihm so meine momentane Spannung<br />
anzeigen kann.<br />
M.Erne: Sie haben Ihren Freund in die Spannungskurve eingeweiht<br />
Fr.Salver: Ja, damit er weiss, woran er ist. Wenn ich bei 50 bin,<br />
kann er mich auffordern spazieren zu gehen, wenn nötig, mit<br />
Steinchen im Schuh.<br />
M.Erne: Er hilft Ihnen also bei der gezielten Anwendung Ihrer<br />
Skills<br />
Fr.Salver: Ja, denn oft bin ich in meinen Gedanken so gefangen,<br />
dass ich mich nur noch schneiden möchte. Ich habe auch viele<br />
Hilfsmittel immer bei mir, den Igelball, die Steinchen im Portemonnaie,<br />
das Tabascofläschchen in der Handtasche, zwei Coldpack<br />
im Eisfach.<br />
M.Erne: Sehr gut! Möchten Sie zum Schluss noch etwas sagen<br />
Fr.Salver: Ich finde die Gruppe toll, und es wäre gut, wenn es das<br />
auch auf anderen Stationen und in anderen Kliniken gäbe. Es<br />
wäre auch gut, wenn ich ambulant in eine solche Gruppe gehen<br />
könnte.<br />
M.Erne: Frau Salver, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und für<br />
Ihren Mut, sich diesen Fragen gestellt zu haben. Ich wünsche Ihnen<br />
einen achtsamen Umgang mit sich und Ihrer Mitwelt.
Dr. med. Pia Ineichen, Oberärztin stationäre Psychotherapie<br />
Jünger werden<br />
«Bericht aus der Werkstatt» der Psychotherapiestation<br />
für junge Erwachsene<br />
Pünt Nord im Frühjahr <strong>2002</strong>. Auf der<br />
Piazza vor dem Haus liegen junge Leute in<br />
der Sonne. Der Tischtennisball klackert<br />
hektisch auf der warmen Platte. Laute Musik<br />
beschallt den Eingang ins Klinikdorf, lässt Ankommende mitwippen<br />
oder gequält das Gesicht verziehen. Versuche, Gespräche<br />
zu führen. Die Stationskatze sucht dazwischen ihr Plätzchen…<br />
Seit einem Jahr behandelt die offene milieutherapeutische und<br />
psychodynamisch orientierte Psychotherapiestation Pünt Nord<br />
mit 20 Betten fast aussschliesslich junge Erwachsene zwischen 18<br />
und 25 Jahren.<br />
Psychotherapiestationen arbeiten mit freiwillig eintretenden<br />
Klientinnen und Klienten, denen die Probleme, die sie zum Aufenthalt<br />
bewogen haben, im Wesentlichen bekannt sind und die<br />
sich im geschützten, aber auch konfrontativen Setting mehrere<br />
Wochen bis Monate mit sich auseinandersetzen wollen. Das Ziel<br />
der Therapie ist es, weniger an Symptomen zu leiden und besser<br />
mit der Umwelt zurecht zu kommen. Unsere Psychotherapiestation<br />
hat ein strukturiertes, gruppenorientiertes Setting und, weil<br />
sie sich als Hausgemeinschaft versteht, feste Vorgaben, die das Zusammenleben<br />
regeln.<br />
In der Adoleszenz – der Begriff wird heute überwiegend für die<br />
Alterstufe von 14 bis 25 Jahre verwendet – sind für junge Menschen<br />
wesentliche Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Dazu gehören<br />
bei allen Adoleszenten u. a.<br />
● Identitätsfindung, -stabilisierung<br />
● Veränderte Körperwahrnehmung<br />
● Ablösung vom Elternhaus und Neudefinition der Eltern-<br />
Kind-Beziehung<br />
● Gestaltung von Beziehungen zu Gleichaltrigen mit Aufnahme<br />
intimer bzw. sexueller Beziehungen<br />
● Hinterfragung der geltenden Werte, in der Folge Entwicklung<br />
eines eigenen erwachsenen Wertesystems<br />
● berufliche Orientierung und Entwicklung von Zukunftsperspektiven.<br />
Bei unseren Patientinnen und Patienten treten Störungen auf, die<br />
mit dieser Lebensphase eng verknüpft sind.<br />
Frau X ist 18 Jahre alt. Seit 4 Jahren versucht sie ihren Wunsch<br />
nach perfekter Identität, genährt aus gesellschaftlichen, familiären<br />
und eigenen Ansprüchen, zu erreichen. Sie ist hübsch, intelligent,<br />
gut angezogen, wirkt viel erwachsener als ihr Geburtsdatum suggeriert.<br />
Aus Angst vor Kritik versucht sie es allen recht zu machen.<br />
Alle Regeln gilt es einzuhalten. Die ständige Frustration, der Idealvorstellung<br />
nicht zu entsprechen, erschöpft sie. Zum Spannungsabbau<br />
und zum Erhalt eines schlanken Körpers isst und<br />
bricht sie mehrmals täglich.<br />
Herr Y ist 18 Jahre alt. Seit 4 Jahren konsumiert er Cannabis in<br />
immer höheren Mengen. Sinnlosigkeit und innere Leere setzen<br />
ihm zu. Er ist hübsch, intelligent und gut angezogen, wirkt jünger<br />
als sein Geburtdatum vorgibt. Regeln gelten ihm nichts, ausser als<br />
Anlass, sich darüber hinwegzusetzen. Seine Regeln definiert er<br />
selbst und eckt damit überall an. Er wird oft wütend, so wütend,<br />
dass er alles kurz und klein schlagen könnte.<br />
Beide Adoleszente kommen nun zur Therapie. Bereits die Voraussetzungen<br />
sind unterschiedlich. Während Frau X aus hohem<br />
Leidensdruck wegen der Essstörung Hilfe sucht, kommt Herr Y<br />
nur auf Druck seiner Umgebung. Er weiss nicht so recht was passiert,<br />
wenn er sich dem Druck nicht anpasst, aber zumindest die<br />
Gefährdung seiner Schullaufbahn ist ihm erkenntlich. Während<br />
Frau X auf der Station freundlich hilfsbereit ihre Therapie aufnimmt,<br />
kämpft Herr Y von Anfang an um Freiheit. Wo wir im<br />
Verlauf der Therapie mit Frau X versuchen sie zu motivieren, eigene<br />
Meinungen zu vertreten, Kritik herauszufordern, ja auch mal<br />
eine unserer Regeln zu brechen und sich mit den Folgen auseinander<br />
zu setzen, stellt Herr Y von Anfang an alles in Frage, was wir<br />
ihm anbieten. Das Verbot Cannabis zu konsumieren wird belächelt<br />
und hintergangen, Konsequenzen werden als ungerechtfertigte<br />
Strafen erlebt. Frau X passt sich an Herrn Y an, der das tut,<br />
was sie vielleicht gerne würde und unterstützt ihn bei Diskussionen<br />
freundlich aber deutlich gegen das Behandlungsteam.<br />
Dieses Beispiel- ein konstruiertes- verdeutlicht das Spannungsfeld,<br />
in dem Therapie von Adoleszenten stattfindet. Als Psychotherapiestation<br />
wollen wir den jeweiligen persönlichen Eigenheiten<br />
der KlientInnen gerecht werden und vielfältiges Wachstum im<br />
Sinne der oben genannten Entwicklungsaufgaben fördern. Wir<br />
haben keine «Normmenschen» zum Therapieziel oder als Idealvorstellung.<br />
Gleichzeitig treten wir klar für unsere Stations- und<br />
Therapieregeln ein. Dabei geraten wir häufig in Elternpositionen,<br />
die, ebenfalls ganz im Spannungsfeld der adoleszentären Situation,<br />
heftig bekämpft werden müssen. Die Gratwanderung, wieviel<br />
Hinterfragung, Entwertung und Regelverstoss im Einzelfall möglich<br />
ist und wo wir als Behandler die Grenzen setzen wollen und<br />
müssen, ist nicht immer einfach. Die z. T. schwerwiegenden Störungsbilder<br />
unserer PatientInnen erfordern häufig rasches Han-<br />
25
26<br />
deln. Die Fähigkeit zur Antizipation der Konsequenzen eigener<br />
Handlungen oder der Verhaltensweisen Anderer sind bei Adoleszenten<br />
oft noch wenig entwickelt. Es braucht viel Unterstützung<br />
im Umgang mit Alltagsanforderungen und Beziehungsgestaltung.<br />
Etwas pointierter ausgedrückt stecken wir in einem fliessenden<br />
Übergang von Psychotherapie – individuell, intrapsychisch und<br />
verstehend orientiert – und Pädagogik – gesellschaftlich, interpersonell<br />
und überindividuell ausgerichtet. Als Behandlungsteam<br />
müssen wir uns deshalb ständig mit unserem jeweiligen Standpunkt<br />
und Blickwinkel auseinander setzen und uns klar werden,<br />
in welchem der beiden Felder unsere Interventionen liegen und<br />
wie wir unseren jungen Patienten gerecht werden können.<br />
Die Behandlung Adoleszenter ist nicht nur «schwierig». Unsere<br />
PatientInnen stehen am Anfang ihres Erwachsenenlebens. Sie sind<br />
in der Regel sehr kreativ, spontan, klug und lebendig. Ihr Hinterfragen<br />
geltender Werte ist von immenser Wichtigkeit. Zunächst<br />
für sie selbst, aber auch für die Gesellschaft, die ohne Wertewandel<br />
und Veränderung in ihrer Entwicklung genauso stecken bleibt<br />
wie das einzelne Individuum. Unsere gemeinsame Arbeit ist anspruchsvoll<br />
und spannend. Fortschritte erleben wir als sinngebend<br />
und als Belohnung für uns alle, PatientInnen und Behandler.<br />
Pünt Nord im Frühjahr <strong>2002</strong>. Frau X isst und bricht deutlich<br />
seltener. Sie erscheint ungeschminkt in der Gruppe und lebt immer<br />
mehr ihre eigenen Bedürfnisse. Regeln gelten immer noch,<br />
aber man kann ja zumindest mal fragen… Herr Y übt sich im Umgang<br />
mit seinen Aggressionen. Innerer Leere versucht er mit neuen<br />
Aktivitäten zu begegnen. Cannabis ist immer noch wichtig. Aber<br />
seit ein paar Wochen einen klaren Kopf zu haben macht auch<br />
Spass, ist ein echter Aufsteller. Und Regeln Na ja, man muss ja<br />
nicht alle verletzen…<br />
Das Behandlungsteam sitzt manchmal mit in der Sonne, klakkert<br />
an der Tischtennisplatte. Regeln Man muss ja nicht immer<br />
alle stur anwenden.<br />
Wir versuchen, als Station unsere Entwicklungsaufgaben wahrzunehmen.<br />
Das Behandlungskonzept wird ständig weiterentwikkelt,<br />
die Stationsidentität tiefer geprägt und gefestigt. Das Personal<br />
mit den unterschiedlichen Berufsbildern setzt sich mit seinen Zukunftsperspektiven<br />
auseinander. Die Station löst sich langsam von<br />
früheren und entwickelt eigene neue Werte, ohne Altes radikal zu<br />
verwerfen. Beziehungen unter den Behandlern und zu den PatientInnen<br />
wollen immer neu gestaltet werden. Nur gut, dass unsere<br />
KlientInnen uns diese Aufgaben immer lebhaft vor Augen halten.
Dr. med. Jürg Wunderwald, Oberarzt stationäre Psychotherapie<br />
Vom Müssen zum Dürfen<br />
In unserem <strong>Jahresheft</strong> 2000 ging es um das<br />
Thema «Zwang und Freiheit: Selbst- und<br />
Fremdbestimmung in der Psychiatrie». Der<br />
Referent ging das Thema damals mit Blick<br />
auf den Patienten an, dem es aus seinem teils selbstverschuldeten,<br />
teils krankheitsbedingten Verlust an Selbstbestimmung gilt, therapeutisch<br />
herauszuhelfen. Es ist einfacher, derartige Defizite bei<br />
Mitmenschen, insbesondere Patienten, aufzuspüren, als bei sich<br />
selber. Nur zu leicht neigen wir professionell Tätigen dazu, sei es<br />
im psychotherapeutischen, sozialen oder pflegerischen Bereich,<br />
unsere Patienten verstehen, ihnen helfen und sie disziplinieren zu<br />
müssen; d.h. es verbirgt sich hinter unserem Helferwillen ein Stück<br />
weit ein moralischer Druck, diese hilfsbedürftiger als wir selbst erscheinenden<br />
Menschen fürsorglich zu belagern. Der Schweizer<br />
Pionier der Milieutherapie, E. Heim, versuchte Mitte der Siebzigerjahre<br />
in der Psychiatrischen Klinik Schlössli in Ötwil am See,<br />
diese alteingesessenen, hartnäckigen kustodialen Strukturen aus<br />
der Anstaltspsychiatrie durch sozio- und psychodynamische<br />
Strukturen in neu zu gestaltenden multiprofessionellen Teams zu<br />
ersetzen. Dabei stützte er sich auf das klassische Konzept der<br />
«Therapeutischen Gemeinschaft». Diese entstand Ende des<br />
2. Weltkrieges in Grossbritannien unter dem Druck des Erfordernisses,<br />
eine grosse Zahl psychisch erkrankter Soldaten zu behandeln.<br />
Der Begriff selbst wurde 1946 von T. F. Main geprägt und<br />
von einer Reihe britischer Autoren, unter ihnen M. Jones,<br />
S. H. Foulkes und W. R. Bion, aufgegriffen. Der Grundgedanke<br />
war, eine Station als ein Gruppenganzes anstatt einer Ansammlung<br />
einzelner verhaltensgestörter Individuen zu betrachten. Dies beinhaltete<br />
eine Reihe von Konsequenzen, insbesondere für die Organisationsstruktur<br />
in der Klinik oder einer Station. «Hierarchie»<br />
wurde dabei als tendenziell hinderlich betrachtet, sie sollte durch<br />
eine horizontale demokratische Struktur ersetzt werden. Die Offenheit<br />
und Durchlässigkeit für Informationen und Gefühle zwischen<br />
den verschiedenen Berufsgruppen galt als förderlich für die<br />
Entwicklung des Gemeinschaftssinnes und ermöglichte in den<br />
Siebzigerjahren die Konzeptualisierung der stationären Psychotherapie,<br />
die um das Beziehungsparadigma der angewandten Psychoanalyse<br />
erweitert wurde.<br />
Diskurs über den freien Willen<br />
Eines unserer grossen Probleme ist die Erkenntnis dessen, was<br />
Freiheit ist. Das Bedürfnis danach scheint im Wachsen begriffen<br />
zu sein, wo es so viele und unterschiedliche Formen äusserer und<br />
innerer Zwänge, aber auch chaotische und widersprüchliche Haltungen<br />
und Meinungen in unserem Zeitalter grenzenloser Informationsmöglichkeiten<br />
gibt. So wird es immer schwieriger, frei zu<br />
denken und Eigensinn zu entwickeln. Wir sind solche Experten<br />
geworden im Zitieren, was andere Leute sagen oder gesagt haben,<br />
dass wir uns nostalgisch an das alte Volkslied erinnern mögen «die<br />
Gedanken sind frei» – wohl wissend, dass wir in unseren Entwikklungs-<br />
und Lehrjahren denken, was uns von den Eltern, von Lehrern,<br />
aus Büchern oder Zeitungen mitgeteilt wurde. Eigenständiges<br />
Denken will also mühsam gelernt sein.<br />
Unser postmodernes Zeitalter ist geprägt durch Verlust an verbindlicher<br />
Moral, Willkür in den Lehrmeinungen, jedoch auch<br />
durch die Herausforderung, bisher unversöhnlich Erscheinendes<br />
in neuen Zusammenhängen zu sehen. So zeichnet sich ein deutlicher<br />
Trend ab, Neurobiologie und Psychoanalyse als komplementäre<br />
Zweige der Humanwissenschaften zu sehen. Auch Neurowissenschaftler<br />
sind sich heute einig, dass das Unterbewusstsein in<br />
letzter Instanz all unser Tun und Lassen lenkt. Das Bewusstsein ist<br />
nur ein Zuträger, ein Ratgeber dabei, wenn auch ein wichtiger. Ein<br />
führender Politiker kann zwar ohne Ratgeber nicht auskommen,<br />
entscheiden tut er jedoch weitgehend «aus dem Bauch heraus».<br />
Ungefähr die Hälfte unserer Eigentümlichkeiten und Fähigkeiten<br />
als Persönlichkeit sind genetisch bestimmt. Weitere etwa 30% werden<br />
geformt durch frühere Konditionierung, d.h. durch Lernprozesse<br />
in den ersten 3 bis 4 Lebensjahren. Das Prinzip ist einfach:<br />
werde ich für ein bestimmtes Verhalten belohnt oder bestraft Bin<br />
ich bedroht, muss ich Angst haben Kann ich zufrieden und zuversichtlich<br />
sein Das Unbewusste merkt sich die Antwort nachhaltig.<br />
Die ersten Lebensjahre, die Beziehung zwischen Eltern und<br />
Kind sind deshalb sehr wichtig. Mit etwa 4–5 Jahren ist unsere<br />
Persönlichkeit in den Grundzügen geprägt. Die übrigen rund 20%<br />
flexiblen Anteile stehen dann bestenfalls für die Entfaltung des<br />
«freien Willens» zur Verfügung. Die eigentlichen Antriebe oder<br />
Ursachen unseres Handelns liegen jedoch weitgehend im Verborgenen.<br />
Das Gefühl von «das will ich jetzt» ist nur die bewusste<br />
Rückmeldung des vorangegangenen unbewussten Abwägens.<br />
Vom Müssen zum Dürfen<br />
Dürfen will gelernt sein. Dies vermittelte uns bereits der Münchner<br />
Volkssänger und Komiker Karl Valentin in einem Brief an<br />
seine Geliebte:<br />
27
28<br />
«Mögen hätt’ ich schon wollen, aber dürfen hab’ ich mich nicht<br />
getraut». Hier ist also ein Basiskonflikt angesprochen, der sich<br />
zwischen den Polen Lust und Last bewegt. Um gleichsam dürfen<br />
zu können, bedarf es eines flexiblen Gewissens, eines reifen Überichs,<br />
im Gegensatz zu unserem archaischen, das vor allem verfolgenden<br />
Charakter hat und uns Strafe androht für den Fall, dass wir<br />
es mit unserem Luststreben übertreiben.<br />
Es ist bemerkenswert, dass das archaische Überich ein Relikt<br />
unseres ältesten Hirnteils aus der Reptilienphase darstellt. Neuerdings<br />
wissen wir auch, dass das Prinzip Belohnung und Bestrafung<br />
ein nachweisbares Substrat in unserem Zwischenhirn (mesolimbisches<br />
System) hat. Dürfen hat also etwas mit erworbener Freiheit<br />
zu tun, die nur dadurch entsteht, dass wir versuchen, uns lernend<br />
von konstitutionellen, anerzogenen und damit verinnerlichten<br />
Zwängen ein Stück weit zu befreien. Der Sozialpsychologe<br />
E. Fromm war es, der sich in einem Buch mit der «Furcht vor der<br />
Freiheit» befasste und die Vision eines Menschen hatte, der im<br />
weitesten Sinne frei für etwas wird und nicht ständig damit zu<br />
kämpfen hat, frei von Anpassungszwängen zu sein. Dies setzt allerdings<br />
einen Menschen voraus, der sich den Anforderungen des Lebens<br />
einpassen kann und nicht Anpassungsleistungen erbringen<br />
muss, die zu seiner Selbstentfremdung führen.<br />
Gerade der Umgang mit Suchtpatienten zeigt, wie diese Menschen<br />
oft zu Fehl-, Schein- und Überanpassung neigen und zu<br />
Drogen greifen, um Schmerzliches aus ihrem Bewusstsein auszublenden,<br />
ihr Gewissen aufzuweichen und damit zu verdrängen. Im<br />
Umgang mit Sucht sind wir Helfer im weitesten Sinne aufgefordert,<br />
unseren eigenen Kopf frei zu machen von verinnerlichten<br />
Doppel-Moralvorstellungen, die wir zur eigenen Entlastung oft<br />
auf unsere Patienten projizieren.<br />
die Motivation des Patienten für eine psychotherapeutische Arbeit<br />
unter Abstinenz und damit Ernüchterung und Enttäuschung in drei<br />
Schritten prozesshaft zu erarbeiten versucht. Motivation also nicht<br />
als Voraussetzung, sondern als Weg. Schon allein diese Vorstellung<br />
gibt Luft und damit therapeutischen Spielraum. So ist die Teilnahme<br />
an einer therapeutischen Gruppe nicht mehr ein Muss,<br />
sondern ein Darf. In einer ersten Phase des Ankommens auf der<br />
Abteilung wird an einem Standortgespräch mit dem Patienten die<br />
Indikation für eine Teilnahme an der therapeutischen Gruppe besprochen.<br />
Nach einer Probezeit wird dann Bilanz gemacht, ob sich<br />
Patient und die Therapiemethode gegenseitig zuträglich sind.<br />
Damit kommt das Prinzip der Bewährung und damit auch der<br />
Qualitätssicherung zum Tragen. Nach dieser zweiten Phase des eigentlichen<br />
Therapieprozesses wird zu gegebener Zeit die Austrittsphase<br />
eingeleitet, die auf die alte oder neue Umgebung vorbereiten<br />
soll. Noch stehen wir am Anfang dieses Paradigmawechsels,<br />
können aber schon jetzt festhalten, dass Müssen auf Betreuer- und<br />
auf Patientenseite mit Zwang und Unlust, Dürfen jedoch mit lustvoller<br />
Selbstentfaltung einhergehen kann.<br />
Vom Müssen zum Dürfen im milieutherapeutischen<br />
Umgang mit Süchtigen<br />
Bereits bei Vorgesprächen mit Suchtpatienten zeigt sich deren<br />
Schwierigkeit mit der Selbst-Motivation. Suchtkranke sind aufgrund<br />
ihrer Struktur eines «falschen Selbst» oft schwer zu beurteilen,<br />
so auch in ihrer Motivation für ein Psychotherapieprogramm.<br />
Alkoholiker neigen in nüchternen Phasen dazu, fromme Bekenntnisse<br />
und Versprechungen abzugeben, auf die wir Betreuer teils<br />
positiv, teils aber aus Erfahrung recht skeptisch reagieren.<br />
So haben wir inzwischen mit Hilfe eines auswärtigen Experten<br />
ein Stufenprogramm für unsere Station Pünt Mitte erarbeitet, das
Sandra Rust<br />
Littenheid: Ein Stück Lebensweg<br />
Als Barbina in der Theaterrolle. Als Sandra Rust in der Lebensrolle.<br />
Verrückt, trotzend, nach dem Verstehen schreiend, pflegt,<br />
hilft und beratet Kinder und Erwachsene, kämpft, liebt.<br />
Vor Littenheid.<br />
Verloren<br />
Das Tram rollt durch die Stadt. Mit mir, einem Haufen Körper,<br />
dessen Seele nicht in diesem Tram mitfährt.<br />
Oder doch<br />
Warum befiehlt sie dem so lästigen, erschlafften Körper nicht auszusteigen<br />
Warum kommt der Tramführer nicht aus seiner Kabine, nimmt<br />
mich in seine starken Arme und führt mich selbstbestimmt an den<br />
Ort, wo ich wieder lerne zu leben<br />
Obwohl ich absolut nicht an das erträgliche, lohnende Leben<br />
glaube. Wie kann ich, wenn die Bedrohung überall tanzt<br />
Wie hier bei der Haltestelle, eine Insel mitten in der Stadt, umzingelt<br />
von lärmenden Autos. Immer in Bewegung verwandeln<br />
sich die rollenden Bleche in<br />
klebrige Monster, die sich<br />
mir immer mehr nähern,<br />
mich hämisch angrinsen<br />
und sich an die Fenster des<br />
Trams drücken und bedrohlich<br />
an das Glas trommeln.<br />
Warum reagiert denn keiner<br />
im Tram. Sehen sie denn<br />
nicht, was ich sehe<br />
Der Film dreht weiter und<br />
weiter, bis ich erschöpft<br />
irgendwo aussteige.<br />
Ich muss zu meiner Freundin, sagt der eine Kopf.<br />
Jahr 2000 und 2001<br />
5 Tage Kriseninterventionsstation Basel: 27.März 2000–1.April 2000<br />
Übertritt nach Littenheid (1. Etappe): 1.April 2000<br />
Austritt: 5.Juli 2000<br />
Beginn 80% Arbeit (normales Arbeitspensum): 6.Juli–26. August 2000<br />
Wiedereintritt Littenheid (2.Etappe): 27.August 2000<br />
Austritt: 8.Dezember 2000<br />
40% krank geschrieben, Arbeitsbeginn: 8.Januar 2001–7.April 2001<br />
Eintritt: Herberge Häutligen 9.April 2001<br />
Austritt und 80% Arbeitspensum: 9.Mai 2001<br />
Ich schaffe das nicht, sagt der andere Kopf. Aber doch, ich muss,<br />
sagt der eine.<br />
Und dann Wo bringt sie mich hin Psychiatrie!<br />
Nein, ich gehöre nicht in eine Nervenanstalt, sagt der eine Kopf.<br />
Aber ich kann nicht mehr, ich muss Begleitung haben, ich kann<br />
nicht mehr Verantwortung tragen, ich bin so erschöpft und verwirrt,<br />
ich, ich,… sagt der andere. Zu Hause liegt seit Wochen ungeöffnet<br />
die Post. Schlaflos sitze ich nachts vor dem Computer<br />
und trinke und spiele bis 5 Uhr morgens, um dann noch 2 Stunden<br />
zu schlafen, bevor ich zur Arbeit gehe. Die Filme erwarten<br />
mich schon überall, beim Klienten, im Auto, im Zug, im Büro.<br />
Aber niemand merkt es mir an… Das ist die Hauptsache…<br />
So sitze ich am Strassenrand, irgendwie, einige Häuserblocks von<br />
meiner Freundin entfernt.<br />
Sie muss kommen und mich finden.<br />
Ich muss gehen und mich finden lassen.<br />
Ich muss finden und gehen.<br />
Das Natel. Ich rede mit mir: Anrufen, jetzt. Ja, drück. Nein. Ein<br />
Druck, gleich Psychiatrie.<br />
Also los, ruf an, sag wo Du steckst.<br />
Nachdem sie mich schon so erfolgreich telefonisch begleitete<br />
und mir aufzählte, was ich packen muss. So, dass meine Köpfe<br />
mich nicht dauernd bearbeiten konnten, dieses oder jenes zu tun<br />
– selbstverständlich waren sie nie gleicher Meinung – und mein<br />
ganzes Sein auseinander rissen und mich in unbewegliche, leere<br />
Erschöpfung zwangen.<br />
Auch zum Bahnhof in Luzern habe ich gefunden und den Zug<br />
nach Basel, dank ihren telefonischen Zusprüchen und Orientierungshilfen.<br />
Und wenn ich dann in Basel sei, meint meine Freundin,<br />
werde sie mich dorthin begleiten, wo ich meinem Psychiater<br />
zugesichert habe, hinzugehen. Auf die Kriseninterventionsstation.<br />
Ich sitze im Zug, der mich ins Verderben, in die grösste meiner<br />
Demütigungen führt. In die Psychiatrie.<br />
Die Verbindung zu meiner Freundin haben wir unterbrochen.<br />
Bis dann, bei mir zu Hause. Bist du sicher, dass du alleine den Weg<br />
findest, fragt meine Freundin fürsorglich.<br />
29
30 Ja, sagt der automatische Kopf. Der aufgelöste Kopf denkt,<br />
nein, ich falle, ich spüre mich nicht.<br />
So sitze ich da am Strassenrand irgendwo in Basel und schaffe es<br />
tatsächlich, mit meinen Finger die eingespeicherte Nummer meiner<br />
Freundin zu drücken.<br />
Dann lief alles. Alles lief. Ich lief nicht. Aber ich rauchte, sah<br />
Das Leben neu erleben<br />
Das Leben<br />
neu erleben<br />
Dem Strampeln ein Ende setzen<br />
Genug vom Irren und Hetzen<br />
Es wird Zeit den inneren Asketen<br />
Fernsehen, lag auf meinem Bett. 5 Tage auf der Kriseninterventionsstation.<br />
Reise und Aufnahmegespräch in Littenheid. Zusage.<br />
mit beten<br />
auf eine harte Probe zu stellen<br />
Packen. Eintritt. Tritt ein, in die unvergessliche Welt der Verrükkten.<br />
sich zu den heulenden Wölfen gesellen<br />
Schützen und staunen<br />
Während Littenheid:<br />
1. Etappe:<br />
Eigenverantwortung, Netzwerke und Schlupflöcher<br />
Hier sitze ich nun, auf der Akutpsychiatrie in Littenheid und versuche<br />
mir bewusst zu werden, wo ich bin, warum ich bin, was ich<br />
bin. Aber so Fragen kann ich gar nicht einordnen, weil ich zu erschöpft<br />
bin, zu verwirrt und gefüllt mit Bildern und Gedanken,<br />
die mir den Boden unter den Füssen wegziehen. Ich habe panische<br />
Angst vor den dauernden Begegnungen, respektive dem Zusammensein<br />
mit den gleichen Menschen. Das löst eine lähmende<br />
Erstarrung in mir aus, wo ich in meine wohlbekannte Welt der destruktiven<br />
Filme flüchte, die nur ich sehe. Ich will weg, aber es<br />
geht nicht. Gegen aussen wirkte ich völlig «normal». Ich strengte<br />
mich an, mich als gut und lieb darzustellen. Das kenne ich schon<br />
viele Jahre und frisst meine ganze Energie auf, weil ich auf verschiedenen<br />
Ebenen gleichzeitig schalte und walte.<br />
Ich schäme mich zutiefst, meinen ArbeitskollegInnen meine<br />
Arbeit auch noch aufzubrummen, wo wir doch gerade soviel zu<br />
tun haben. Ich verurteile und bestrafe mich, dass ich versage. Natürlich<br />
mache ich mir noch vor, dass ich in 2 Wochen wieder<br />
draussen bin und völlig cool und gelassen mein zukünftiges Leben<br />
leben werde. Na ja. Diese Vorstellung nahm einen anderen Lauf.<br />
Auf der akuten Psychiatrie war nichts los. Ein Absitzen, ab und<br />
zu wurden wir eingesperrt, weil wieder jemand sich das Leben<br />
nehmen wollte. Rauchen, Kaffee trinken. Ein bisschen Ergotherapie,<br />
ein bisschen Gruppentherapie und 1–2 Sitzungen beim Psychiater.<br />
Sich alleine für Spaziergänge zu motivieren war schwierig.<br />
Zum Glück wurde ich nach 3 Wochen auf das Pünt Süd, eine<br />
Psychotherapie-Station mit 20 MitbewohnerInnen verlegt. Nachts<br />
ohne Betreuung und das Wochenende verbringt man/frau zu<br />
Hause. Eigenverantwortung. Das ist gefragt hier. Melden wenn du<br />
hinnehmen die wogenden Launen<br />
lieben, jagen, kämpfen<br />
die Emotionen nicht gefiltert dämpfen<br />
Auch ein Bauchkribbeln darf sein<br />
Abschiedstränen im Schein<br />
der Urgewalt der Instinkte vertrauen<br />
auf den Zauber des Zentrums schauen<br />
im Licht der Feuerspucker stehen<br />
auf fruchtbarem Boden gehen<br />
überlieferte Zeremonien tragen das ihre bei<br />
um den stummen Schrei<br />
hörbar zu machen<br />
und achtsam darüber zu wachen<br />
dass die ewige Verlockung nach Schweigen versiegt<br />
weil im Urschrei die eigene Wahrheit liegt.<br />
Littenheid, 5.12.2000<br />
Weitere Gedichte von Sandra Rust finden Sie unter www.littenheid.ch im<br />
Kapitel «Fenster zur Welt»
was brauchst oder wenn es dir nicht gut geht. Tönt gut. Klar schaff<br />
ich doch. Da meldet sich meine destruktive Stimme zu Wort. Du<br />
bist doch zu nutzlos und unkreativ,um das Leben zu managen.<br />
Stell dir vor, soviel Eigenverantwortung zu übernehmen. In deinem<br />
miserablen, verkümmerten Zustand.<br />
Und tatsächlich stellte sich dieser Schritt als grosse Herauforderung<br />
und Hindernis heraus. Die Bezugsperson um Hilfe zu bitten<br />
war alles andere als selbstverständlich und einfach, wenn es wieder<br />
mit mir durchdrehte und die Bilder und Gedanken, die unaufhörlich<br />
auftauchten und nicht enden wollten und mich bedrohten.<br />
Ja, ich habe um Hilfe geschrieen. Aber ich habe so gelernt zu<br />
schreien, dass es niemand hört. Stumm. Das geht wirklich. Ich<br />
habe gehört, wie laut ich schreien konnte, gespürt, wie mein Körper<br />
vibrierte und wie die Augen voller Hoffnung auf die Tür gerichtet<br />
waren. In der stillen Illusion: Diesmal kommt bestimmt jemand<br />
und nimmt mich in die Arme oder schüttelt mich wach.<br />
Denn ich wusste nicht, dass die grusligen Filme, die ich sah, nicht<br />
Realität waren. Und es war sehr schwer für mich, die Filme abzuschalten.<br />
Mit der Zeit lernte ich es selber zu tun, aber anfangs<br />
musste man mich rausreissen aus der Tretmühle und mir zeigen,<br />
wie ich den Abschaltknopf betätige. Ich fühlte mich isoliert und<br />
alleine. Abgeschnitten von allem.<br />
Zu diesem Zeitpunkt des tiefen Abgrundes und Unterganges<br />
meiner selbst, hat mir die Psychotherapiestation viele Auffang-,<br />
Verarbeitungs- und Weiterkommensmöglichkeiten angeboten,<br />
welche punktuell gesehen geniale Unterstützungen waren.<br />
In meinem Dämmerzustand haben die BetreuerInnen und BegleiterInnen<br />
es immer wieder geschafft, an meiner Kreativität und<br />
meiner Haltung zu rütteln. In der Maltherapie z. B. entstanden<br />
Geschichten und Gedichte, durch die Gespräche mit den Bezugspersonen<br />
fand ich immer wieder Mut, trotzdem ja zum Leben zu<br />
sagen oder wir erfanden Rollenspiele, um Themen spielerisch zu<br />
gestalten. Ihre ehrlich gemeinte und mitfühlende Unterstützung<br />
und Geduld gab mir immer wieder das Gefühl, jemand Liebenswerter<br />
zu sein. Obwohl ich immer wieder ihre geduldig wiederholende<br />
Meinung erfolgreich verdrängte. Wir erfanden auch Taktiken,<br />
um die Filme loszuwerden. Ich fand den Mut, wieder zu<br />
malen. Der Psychiater unterstützte mich, die spirituelle Ebene auszuleben,<br />
um so zur Wahrnehmung meiner selbst zu kommen. Mit<br />
einem Wohngenossen von Pünt Süd haben wir ein morgendliches<br />
Meditieren in der Kapelle einige Zeit aufgebaut (Danke Herr Kollege).<br />
Leider fehlen die spirituellen Angebote in Littenheid. In der<br />
Körperwahrnehmung konnten die ganzen Gefühle über den Körper<br />
ausgelebt und erkannt werden. Der Masseur hat für Entspannung<br />
gesorgt. In der Werkstatt konnte die Kreativität und handwerklichen<br />
Ressourcen ausgeschöpft werden, im Sportangebot<br />
wurde heilend geschwitzt. Die Pfarrer boten Gespräche für die<br />
Sorgen der Seelen an. Alle Pünt Süd-Bewohner bewegten mich unbewusst<br />
zum Hinschauen, um an Aktivitäten und der Auseinandersetzung<br />
mit der Gesellschaft teilzunehmen. Danke allen.<br />
Ich möchte kein einziges Gespräch oder Begleitung in jeglicher<br />
Art missen. Alle waren wertvoll, auch wenn ich es in jener Zeit<br />
nicht immer so gesehen habe.<br />
Doch gab es viele Schlupflöcher und Fluchtorte in diesem grossen<br />
Betreuungsnetz.<br />
Wenn eine Therapie etwas Trauriges, Schreckliches oder nicht<br />
Aussprechbares ausgelöst oder aufgerissen hat in mir, war das<br />
Schlupfloch da und hat mich verschlungen. Zum handeln selber<br />
unfähig. Die Eigenverantwortung ein zu hohes Ideal im Moment.<br />
Und ich habe geschrieen. Stumm. Und niemand kam.<br />
Zu häufig gelang es mir mit List oder vor Kummer und<br />
Schmerz, zu fliehen. Mich abzuwenden von der Notwenigkeit der<br />
intensiven Auseinandersetzung mit mir selber. Fluchtorte gab es<br />
viele. In Form von Ablenkungen, indem ich mich mehr auf das<br />
Geschehen der MitbewohnerInnen einliess als auf das eigene.<br />
Bangen um die Borderliner, die sich verletzten. Suchen einer Bulimiekranken,<br />
die sich im Keller hinter die Essensreste macht. Rätseln<br />
und ängstigen um das Verschwinden einer liebgewonnenen<br />
Mitgenossin. Zuhören. Mitleiden. Trösten und gute Ratschläge<br />
geben. Ins Zimmer flüchten. Unter die Bettdecke. 12 Tassen Kaffee<br />
trinken…<br />
Fluchtorte und Schlupflöcher waren überall und häufig.<br />
Mich vergleichen mit anderen war auch ein geliebtes Verhalten<br />
aus dem Schlupfloch heraus. Wenn ich das Gefühl hatte, meine<br />
Zimmerkollegin sei ärmer dran als ich, hatte ich wieder einen<br />
Grund, mich zu bestrafen und verletzen.<br />
Vor allem in der Zeit der Destruktivität und Selbstvernichtung<br />
hätte ich den Wunsch gehabt, engmaschiger betreut zu werden. Das<br />
Netz sollte zu mir kommen – wenn ich stumm schreie; das Netz<br />
sollte mir einen Spiegel vorhalten – mir zeigen wie ich bin: trotzig,<br />
ausgelaugt und gedemütigt; und was am wichtigsten wäre, es sollte<br />
mir von morgens bis abends Aufgaben zum lösen geben – dass es für<br />
mich unmöglich war, vor mir auszuweichen; das Netz sollte sich<br />
vermehrt absprechen – um mir keinen Fluchtweg zu lassen.<br />
31
32<br />
Ich habe mir den Aufenthalt auf Pünt Süd mit diesem Konzept<br />
mehr oder weniger selber gewählt, und ich hätte auch nirgends anders<br />
hinwollen und trotzdem war mir die an mich gestellte Selbstverantwortung<br />
zuviel. Wenigstens in der ersten Etappe auf dem<br />
Stück Lebensweg in Littenheid.<br />
Ein ganz wichtiges und lehrreiches Highlight kurz vor meinem<br />
Austritt war das Theater «Irrgärten: König und Narr» unter der<br />
Regie von Jo Eisfeld, einem Konstanzer Theaterpädagogen. Während<br />
der 2-wöchigen Vorbereitung der Theaterproduktion konnten<br />
alle Beteiligten Erstaunliches erbringen in ihren Rollen. Die<br />
Anforderung war gross, die Doppelrollen zu bewältigen. Einerseits<br />
die Theaterrolle und andererseits die Lebensrolle einer lebensmüden,<br />
selbstzerstörerischen Patientin der Psychiatrischen Klinik in<br />
Littenheid. Aber letztendlich war der Erfolg der Aufführungen<br />
Balsam für die Seele.<br />
Austritt. Nach Hause. 80% arbeiten. Für 6 Wochen reichen die<br />
frisch gewonnen Erkenntnisse und Euphorie aus. Und dann. Der<br />
grosse seelische Schmerz lässt mich nicht in Ruhe. Zerreisst mein<br />
Herz und verwirrt meine Gedanken, dass ich vor Erschöpfung,<br />
Enttäuschung und angefülltem Lebensunwille, wieder in Littenheid<br />
eintrete.<br />
Während Littenheid: 2. Etappe:<br />
Aufwachen<br />
Zu früh bin ich ausgetreten im Juli. Alle haben mir gesagt, ich soll<br />
bleiben. Nun bin ich wieder da. Das Leben war noch zu ungeordnet<br />
in der schnellen Welt.<br />
Zum 2. Mal auf der Akutpsychiatrie wurde mir bewusst, als<br />
sich meine Zimmerkollegin die Pulsadern ankratzte, dass ich Ja<br />
zum Leben sage. Dass ich weg will von der Selbstzerstörung und<br />
lebensverneinenden Haltung. Meine Mitkameradin hat sich bei<br />
mir so gespiegelt, wie ich mich selber verhalte und bin. Und das<br />
hat mich erschreckt, was ich gesehen und gefühlt habe.<br />
Meine ehemaligen Bezugspersonen und mein Psychiater erhörten<br />
meinen flehenden Hilferuf, mich aus der Akutpsychiatrie herauszuholen,<br />
so wechselte ich auf Pünt Süd zurück.<br />
Dort wo man Ja zum Leben sagt. Aber auch da gibt es viele Momente<br />
– und jeder Moment ist zuviel – wo man das Ja anzweifelt,<br />
es davonschleicht und einem einfach so stehen lässt. Alleine. Wertlos.<br />
Sinnlos.<br />
Aber der Lebensfunke war nicht mehr zu löschen. So konnte<br />
ich endlich die Eigenverantwortung wahrnehmen und den Tyrannen<br />
ins Gesicht blicken. Ich lernte, mir Hilfe zu holen für mein<br />
Seelenheil. Ich lernte, mir helfen zu lassen. Ich lernte zu fallen,<br />
und wieder aufzustehen. Ich lernte, nicht zu dramatisieren. Ich<br />
verlernte zu trotzen – und mir selber im Wege zu stehen. Und ich<br />
lernte zu vertrauen – trotzdem. Ich lernte und mir wurde gelehrt.<br />
Ich lernte anzunehmen, dass ich noch viel zu lernen habe.<br />
Ich lernte, meiner Familie zu begegnen und meinem Vorgesetzten.<br />
Ich lernte, mir Gedanken zu machen über meine zukünftige<br />
Wohnsituation und lernte, betreute Wohngruppen anzuschauen<br />
und klar und differenziert zu überlegen, ob ich es mir in diesem<br />
und jenem Wohnheim vorstellen könnte. Ich lernte nicht, mich zu<br />
entscheiden. Die Kündigung der Wohnung ist geschrieben, aber<br />
eine neue Bleibe ist noch nicht in Sicht. Und ich lernte durch und<br />
mit den MitbewohnerInnen. Wir haben gelernt zu singen. Zu Singen<br />
und zwei Konzerte zu füllen mit unseren Liedern, im Kanon.<br />
Wir berührten und motivierten uns gegenseitig, uns aufzuraffen<br />
und uns einzulassen in stundenlanges Üben. Und es war Balsam<br />
für die Seele. Bei dieser Gelegenheit möchte ich all meinen damaligen<br />
«Gspänli» danken für das starke Miteinander und die grossartige<br />
Achtung, die wir uns entgegengebracht haben. Wir haben<br />
viele Velotouren gemacht und sind gejoggt. Der Körper hat seine<br />
Erschöpfung überwunden und die Selbstzerstörung verdrängt.<br />
Der Austritt war soweit. Freude. Tränen des Abschiedes. Aufgefüllte<br />
Seele mit Erwartungen, neuer Lebensbrunst und Respekt<br />
vor dem, was kommen wird. Gewappnet mit Werkzeugen, um bei<br />
jeder misslungenen Handlung sofort eine neu erlernte Überlebensstrategie<br />
zu zücken.<br />
Nach Littenheid<br />
Zu Hause. Fuss fassen.<br />
Die Tyrannen treiben weiter ihr Spiel nach dem Austritt aus der<br />
Klinik. Tyrannen, negative Glaubenssätze, die 2.Stimme in mir<br />
oder was auch immer. Schade, dass ich sie nicht zurücklassen und<br />
einschliessen konnte in einem Safe für Hinterlassenschaften der<br />
Vergangenheit. So euphorisch, aber auch so ungeschützt, nackt<br />
und frisch ausgeschlüpft wie ich mich fühlte, versuchte ich den<br />
verlorenen Alltag zu leben. Einkaufen Kochen Waschen Administrationen<br />
erledigen All diesen Dingen konnte ich mich entziehen.<br />
Ich konnte 6,5 Monate an einen gedeckten Tisch sitzen,<br />
meine Administration mit einem Sozialarbeiter der Klinik erledigen,<br />
mein Zimmer und Badezimmer putzen lassen und meinen<br />
Alltag mit vielseitiger Begleitung strukturieren.
40% Arbeit, 40% krank geschrieben. Was mache ich mit den<br />
restlichen Stunden Sagen wir, ich schlafe 8 Stunden, 4,2 Stunden<br />
Arbeit pro Tag, 1 Stunde Arbeitsweg. Das macht 13,2 Stunden<br />
strukturierte Stunden. Fehlen noch 10,8 wache Stunden. Die es zu<br />
ordnen und zu leben gilt. Glücklich wie ich bin, darf ich noch 1–2<br />
Stunden pro Woche zum Psychotherapeuten.<br />
Die Angst vor dem abermaligen Versagen, dass ich von der Arbeit<br />
und meinem Freundeskreis wegfalle – ausfalle – einfalle – auffalle<br />
ist gross. Diese Faktoren: Überforderung im Strukturieren des<br />
Alltags und Angst sorgten wieder für zunehmenden Energieverlust,<br />
damit mangelnden Selbstvertrauens, und erneut zu Isolation. Der<br />
Teufelskreis ist wieder perfekt. Die kleinen und grossen Entscheide,<br />
die ich treffen musste, trugen das ihre bei zum erneuten Chaos. Ob<br />
ich einen Liter oder einen halben Liter Milch kaufen sollte, wurde<br />
zum Tagesthema stilisiert, bis die Geschäfte abends schlossen und<br />
ich wieder vor einem leeren Kühlschrank sass.<br />
Mit der Erwartung an mich, das Leben nun endlich selber zu<br />
meistern und dem vormachen eines «normalen» Lebens, traute ich<br />
meine Freunde nicht mehr um Hilfe zu bitten, mir Einkaufslisten<br />
zu machen, Listen für «zu erledigen» aufzustellen, Einzahlungen<br />
(resp. Mahnungen) zu erledigen oder mich zu unterstützen, meine<br />
Wohnsituation zu klären.<br />
Die Wohnung war auf den 31. März 2001 gekündigt. Und<br />
nichts Neues in Sicht. Der Gedanke an ein Wohnen in einem<br />
Wohnheim liess mich beelenden, vor allem weil ich ein Zimmer<br />
hätte teilen müssen, oder vor allem chronisch psychisch kranke<br />
Menschen darin hausten und ich mich da nicht einordnen konnte<br />
und wollte.<br />
Ja, die Illusion war da, ein «normales» Leben selbständig gestalten<br />
zu können.<br />
4 Monate profitierte ich von der Kraft und den Erkenntnissen<br />
des 6,5 monatigen Aufenthaltes in Littenheid, bis ich im April<br />
schon wieder mit einem Erschöpfungssyndrom für einen Monat in<br />
die Herberge Häutligen eintrat.<br />
Nach dem Austritt aus der Herberge war mein grösster<br />
Wunsch, von einer neutralen Person zu Hause begleitet zu werden.<br />
So eine Art Spitex für psychisch Kranke, die nach Austritt aus einer<br />
Klinik oder bei wiederholten Lebenskrisen einem intensiv begleitet,<br />
um eventuell einen Klinikeintritt zu vermeiden. Vor allem<br />
um zu lernen, den Alltag in den eigenen vier Wänden und im eigenen<br />
sozialen Umfeld zu gestalten und bewältigen. Es ist eine<br />
grosse Herausforderung für viele meiner MitbewohnerInnen, mit<br />
denen ich heute noch Kontakt habe, zu überleben, bis die eigene<br />
Seele, Psyche und Körper einen Weg gefunden haben, ein Leben<br />
zu leben, ohne dass jeder winzigste Wind einem umstösst. Und das<br />
kann je nachdem Jahre dauern.<br />
Jeder Mensch ist einzigartig. Und alle brauchen verschiedene<br />
Angebote.<br />
Die Psychiatrie war ein Angebot in meinem Leben, um ein<br />
Stück Lebensweg zu beschreiten. Hinterlassen hat es Eindrücke,<br />
die bleiben. Viel Geschehenes muss ich noch verdauen. Ich<br />
möchte all jenen danken, die mich unterstützt haben zu lernen,<br />
verstehen und weiterzukommen und an mich geglaubt haben. Die<br />
Erkenntnisse und Strategien, die ich mit eurer Unterstützung entwickelt<br />
habe, sind mir heute immer wieder eine Hilfe, das Leben<br />
bekömmlicher zu machen.<br />
Und ich möchte der Herberge danken, dass sie mich Aufrichtigkeit,<br />
Aufmerksamkeit und Achtung lehrte, um der Natur und<br />
dem Leben mit offenen Augen und einem geduldigen Herzen täglich<br />
neu zu begegnen.<br />
Ich möchte nicht auslassen, meiner Mutter und meinem Bruder<br />
für die direkte und ehrliche Auseinandersetzung zu danken.<br />
Und dafür, dass wir miteinander wachsen dürfen. Und ich umarme<br />
meine Freunde, die mich begleitet und an mich geglaubt haben.<br />
Jeder und jede auf seine Art.<br />
Jetzt und heute.<br />
Ich lebe auf einem Bio Bauernhof mit einer Freundin zusammen.<br />
Der Kontakt zu der Bauernfamilie, den Tieren, der Natur und<br />
dem natürlichen Fluss des Lebens ist ein Geschenk. Die Tyrannen<br />
sind immer noch meine treuen Begleiter. Doch ich habe gelernt<br />
und lerne immer noch, mit ihnen zu leben. Und ich glaube,das gelingt<br />
mir ganz gut und macht das Leben schön. Immer wieder.<br />
Mai <strong>2002</strong>, Sandra Rust<br />
33
Die Jugend im harten Spannungsfeld<br />
der Gesellschaft.<br />
Werkstattberichte aus der Jugendpsychiatrie
Dr. med. Oliver Bilke, Leitender Arzt Jugendpsychiatrie<br />
Stationäre Psychotherapie bei Adoleszenten –<br />
der Föhrenberg im steten Wandel<br />
Im Haus Föhrenberg wurde die erste jugendpsychiatrische<br />
Station der Klinik Littenheid<br />
im Jahre 1995 eröffnet. Der<br />
Schwerpunkt der Station liegt heute in einem<br />
differenzierten Angebot psychotherapeutischer Behandlungsangebote<br />
auf der Individual-, Gruppen- und Familienebene sowie<br />
der sozialpädagogisch geführten Milieu- und Soziotheapie.<br />
Die stationäre Psychotherapie gehört zu den intensivsten und<br />
aufwändigsten Verfahren in der Psychiatrie und Psychotherapie.<br />
Bei jugendlichen Patientinnen und Patienten kommt zu den aus<br />
dem Erwachsenenalter bekannten multidisziplinären Ansätzen die<br />
Notwendigkeit einer (sozial)-pädagogischen Führung und Begleitung<br />
hinzu.<br />
Eine Psychotherapiestation für Jugendliche ist daher in einem<br />
ständigen internen und externen Austauschprozess, entwickelt<br />
Konzepte und Standards, setzt diese um und reflektiert sie kritisch.<br />
Der Wechsel zwischen Konstanz und Wandel, Konstanz und<br />
Flexibilität, manchmal zwischen Struktur und Chaos gehört zum<br />
spannenden Alltag einer solchen Station.<br />
Die Entwicklung des Föhrenberg<br />
Als erstes jugendpsychiatrisches Angebot der Klinik Littenheid<br />
wurde im Jahre 1995 das Haus Föhrenberg nach Modellen aus Basel<br />
und Tiefenbrunn eröffnet. Seither ist diese Station einer der<br />
anspruchsvollsten Arbeitsbereiche unserer Klinik. Nach einer anfänglichen<br />
Pionierphase mit hohem persönlichen Einsatz aller Berufsgruppen<br />
erfolgte ab 1997 eine Konsolidierung, als es möglich<br />
wurde, deutlich zu akut psychiatrisch kranke Jugendliche in anderen<br />
Stationen der Klinik zu betreuen und ab 1998 mit der Eröffnung<br />
der geschlossenen Akutstation Linde H auch im Jugendbereich<br />
selbst zu versorgen.<br />
Dennoch war das Team des Föhrenberg immer wieder damit<br />
konfrontiert, dass Patientinnen und Patienten aufgenommen wurden,<br />
die das offene und die individuelle Entwicklung fördernde<br />
Klima nicht aushalten konnten und gegen die beziehungsorientierte<br />
und konfliktfreudige Therapiehaltung opponierten.<br />
Erst mit der Eröffnung unserer zweiten offenen Station Linde<br />
G im September 2001 wurde es möglich, den Patientinnen und<br />
Patienten, die aufgrund ihrer Störungsbilder eine stärker verhaltenstherapeutisch<br />
und sozialpsychiatrisch orientierte Station brauchen,<br />
dieses Angebot zu machen. Die permanente Vollbelegung<br />
dieser neuen Station belegt seither eindrücklich den Bedarf.<br />
Der Föhrenberg kann sich seither erstmalig in seiner Geschichte<br />
vollumfänglich seinen «eigentlichen» Aufgaben widmen.<br />
Erfreulicherweise konnte zeitgleich im Herbst 2001 das aktuelle<br />
Leitungstandem bestehend aus dem Stationsleiter Peter Fleischmann<br />
und der Oberärztin Heidi Eckrich etabliert werden, das<br />
jetzt für das tägliche und für das konzeptionelle Geschehen auf der<br />
Station verantwortlich ist.<br />
Aufgabenprofil und Konzeption<br />
Was ist nun der spezifische Auftrag des Föhrenberg im Jahre <strong>2002</strong><br />
Ueblicherweise folgen auf diese Fragen lange Listen von Indikationsstellungen,<br />
wie dies für Kostenträger nötig ist…<br />
Dies wollen wir auch pflichtgemäss tun, viel wichtiger ist aber<br />
die Frage, welche adoleszentären Entwicklungskrisen und Entwicklungsaufgaben<br />
bei uns auf dem Föhrenberg angegangen werden<br />
können.<br />
Diagnosespektrum Föhrenberg:<br />
● Persönlichkeitsentwicklungsstörungen<br />
● Nichtakute Psychosen<br />
● Zwangsstörungen<br />
● Chronifiziertes ADD/H<br />
● Atypische Essstörungen<br />
● Depressive Störungen<br />
● Dissozialität und Aggressivität<br />
● PTSD<br />
● Angststörungen<br />
Wir begleiten Patientinnen und Patienten, die einerseits teils<br />
bis zu vier psychiatrische Diagnosen haben, andererseits aber die<br />
alterstypischen Entwicklungsschritte ebenfalls bewältigen müssen.<br />
Manchmal behindern sich diese Komplexe gegenseitig, manchmal<br />
befruchten sich die jeweiligen Herausforderungen und führen zu<br />
unkonventionellen Lösungen. Im einzelnen begegnen wir häufig<br />
bei folgenden Themen besonderen krisenhaften Zuspitzungen der<br />
Entwicklung:<br />
● Neudefinition des Körperbildes<br />
● Sexuelle Identitätsfindung<br />
● Aggressionsentwicklung<br />
● Erste Drogenerfahrungen<br />
35
36<br />
● Ausbildungsabschluss<br />
● Berufsfindung<br />
● Ablösung vom Elternhaus<br />
● Integration in peergroups<br />
● Ablösung von Helfersystemen und Therapeuten<br />
Diese Entwicklungsaufgaben treffen selbstverständlich auf alle<br />
Menschen zwischen 12 und 18 Jahren zu, sind aber bei unseren<br />
Patientinnen und Patienten oft verzögert, verstrickt, ausgefallen<br />
oder «pseudoautonom» beschleunigt. Damit nicht normale entwicklungspsychologische<br />
Krisen und spezifische krankhafte Störungsbilder<br />
konzeptionell vermischt werden, ist eine standardisierte<br />
Diagnostik für die Therapieplanung um so wichtiger.<br />
Hierzu wenden wir verschiedene Instrumente an, welche die Problematik<br />
und den Erfolg unserer Arbeit abbilden.<br />
Instrumente der Diagnosestellung und Klassifikation<br />
1. MAS/ICD-10<br />
1.1 Psychiatrisches Syndrom<br />
1.2 Teilleistungsstörungen<br />
1.3 Intelligenz<br />
1.4 Körperliche Störungen<br />
1.5 Abnorme psychosoziale Umstände<br />
2. OPD-KJ (Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik)<br />
2.1 Beziehung<br />
2.2 Konflikte<br />
2.3 Struktur<br />
2.4 Behandlungsvoraussetzungen<br />
3. YSR/CBCL (Youth Self Report, Child Behaviour Checklist)<br />
4. BADO (Basisdokumentation)<br />
5. FBB (Fragebogen zur Therapiezufriedenheit)<br />
Therapeutische Ansätze<br />
Moderne Psychotherapie integriert in allen Altersgruppen mehrere<br />
Ansätze im Sinne der multimodalen Therapie.<br />
Stationäre jugendpsychiatrische Behandlung komorbider Patienten<br />
stellt in typischer Weise eine multimodale und interdisziplinäre<br />
Herangehensweise an komplexe biopsychosoziale und familiäre<br />
Problemstellungen und Entwickungspathologien dar. Es<br />
sind differenzierte Therapieebenen zu berücksichtigen, die teils<br />
parallel, teils zeitversetzt besondere Wichtigkeit haben.<br />
Die psychotherapeutischen Interventionen, sei es auf Individual-,<br />
Gruppen- oder Familienebene, stehen im Zentrum der<br />
Stationsarbeit. Nach dem Ende sinnloser «Schulenstreits» sind<br />
empfehlenswerterweise, je nach individuellem Störungsbild und<br />
Entwicklungspsychopathologie, die entsprechenden psychotherapeutischen<br />
Strategien anzuwenden. Hier gibt es bei chronifizierten<br />
Patientinnen und Patienten die Besonderheit, dass nicht nur<br />
individuelle oder familienbezogene Interventionen zu planen sind,<br />
sondern auch das gesamte schulische, berufliche oder sonstige private<br />
Umfeld in die therapeutischen Überlegungen mit integriert<br />
werden sollte. Bei bis in das Erwachsenenalter hineinreichenden<br />
Störungsbildern ist die Ausbildungs- und Arbeitsumgebung hierbei<br />
von langfristiger Bedeutung.<br />
Diese theoretischen Standards und Postulate sind allerdings bei<br />
Jugendlichen mit multiplen psychiatrischen Störungen z.B. im<br />
Rahmen einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung vom instabilen<br />
oder Borderline-Typus (ICD-10 Nr. F60.3, siehe Fallbeispiel)<br />
nicht immer einwandfrei anzuwenden und es verlangt viel Geschick<br />
und Anpassungsfähigkeit von allen, um den individuellen<br />
Ansprüchen unserer oft schwer traumatisierten Patienten gerecht<br />
zu werden.<br />
Auch wenn ohne individuell geplante Pharmakotherapie bei<br />
vielen Patienten kein wirklicher Behandlungserfolg zu erwarten<br />
ist, so obliegt es doch eindeutig der beziehungs- und lösungsorientierten<br />
Psychotherapie, die vielfältigen Problemkonstellationen<br />
im individuellen, familiären und sozialen Rahmen so aufzuarbeiten,<br />
dass retrospektiv-biographische, gegenwartsorientiertalltagsrelevante<br />
und zukunftsorientierte Aspekte integriert werden.<br />
Im stationären Alltag bilden die psychodynamische Psychotherapie<br />
ergänzt durch störungsspezifische Medikation die Hauptachse<br />
der Behandlungsstrategie, allerdings wegen der erheblichen<br />
Unterschiede in der Schweregradausprägung mit wichtigen Variationen<br />
im Vergleich zu ambulanten Settings.<br />
Die dritte Säule des Föhrenbergs ist die sozialpädagogisch geführte<br />
Milieu- oder Soziotherapie. Der Rahmen einer Therapiestation<br />
ermöglicht auch dem schwer gestörten Patienten, neue<br />
kreative Potentiale zu entdecken und eigene Problemverhaltensweisen<br />
in einer prinzipiell wertneutralen und akzeptierenden Umgebung<br />
zu variieren. Integrierte Sozialkompetenzgruppen, stressreduzierter<br />
Schulunterricht in Kleingruppen, Verhaltensanalyen<br />
und die tägliche pädagogische Reflexionsmöglichkeit im Tagesrückblick<br />
tragen dazu bei, subjektiv chaotisch erlebte und zu-
nächst belastende Situationen neu zu bedenken und im Sinne des<br />
«reframing» als hilfreiche Herausforderung zu erleben.<br />
Fallvignette ( «Maria»)<br />
Nachdem die Kindheit der Patientin als «Sonnenschein» der Familie<br />
verlaufen war, zog sich Maria nach dem Krebstod des Vaters<br />
im Alter von zwölf Jahren immer mehr zurück. Während die Mutter<br />
mittels Aufbau einer eigenen Praxis die Trauer durch Arbeit<br />
verdrängte, verwickelte sich die Patientin zunehmend in eine<br />
Traumwelt aus Fantasy-Romanen, Internet-Chats und Astrologie.<br />
Die Stimmungslage verringerte sich langsam<br />
Eine beziehungs- und lösungsorientierte Psychotherapie<br />
integriert die vielfältigen Problemkonstellationen,<br />
welche auf individueller, familiärer oder<br />
sozialer Ebene bestehen.<br />
und fast unmerklich und auch die Schulleistungen<br />
wurden schlechter, ohne dass dies<br />
bei den Lehrern stärker bemerkt wurde. Erst<br />
als Maria im Alter von 16 Jahren nicht mehr<br />
in der Lage war, am Schulunterricht teilzunehmen,<br />
da sie sich auf keine konkreten Aufgaben mehr konzentrieren<br />
konnte, wurde die Mutter und die nähere soziale Umgebung<br />
aufmerksam. Ambulante Psychotherapieversuche und eine<br />
antidepressive Pharmakotherapie hatten keinen Erfolg und Maria<br />
wurde immer teilnahmsloser. Auffällig war, dass die junge Frau am<br />
Wochenende und insbesondere sonntags erstaunlich aktiv war und<br />
auch mental in besserer Verfassung schien.<br />
Nach der mehrfach verschobenen klinischen Aufnahme zeigte<br />
sich auf dem Föhrenberg zunächst das bekannte häusliche Bild der<br />
Isolation und Zurückgezogenheit, das sich auch durch die Gleichaltrigengruppe<br />
kaum beeinflussen liess.<br />
Nach einigen Wochen der Beobachtung, multiplen Urinkontrollen<br />
und in der Einzeltherapie erfolgtem Vertrauensaufbau berichtete<br />
die Patientin über ihr jahrelanges etabliertes Doppelleben.<br />
Während die Woche in relativer Drogenfreiheit verlief, konsumierte<br />
die Patientin am Wochendende zunächst bei Parties, dann<br />
zunehmend allein kontinuierlich steigende Mengen von Ecstasy<br />
bis zu 10 Tabletten am Tag und zusätzlich Halluzinogene wie LSD<br />
und psylocibinhaltige Pilze («Magic mushrooms»). Diese Kombinationen<br />
verstärkten die Realitätsflucht und liessen die Patientin<br />
den belastenden Alltag vollständig vergessen. Zunehmende Derealisation,<br />
Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, erhebliche Konzentrationsschwankungen<br />
und Motivationslosigkeit prägten dann<br />
auch den monatelangen Therapieverlauf unter zunächst stark kontrollierenden<br />
Bedingungen. Medikamentöse Interventionen blieben<br />
weitgehend erfolglos, allein eine Art Substitution der Designerdrogen<br />
durch SSRI (Antidepressiva) verringerte das Verlangen<br />
nach Ecstasy.<br />
Erst nach kontinuierlicher Entwöhnung und langsamem Realitätsaufbau<br />
mit Hilfe der Bezugsperson konnte die Patientin zu den<br />
zugrundeliegenden familiären und individuellen Traumatisierungen<br />
kommen und diese psychotherapeutisch bearbeiten. Schuldzuweisungen<br />
an die Mutter, Verlassenheitsängste und erhebliche<br />
Aggressivität bis hin zur Suizidalität kamen zum Vorschein und<br />
zur therapeutischen Bearbeitung. Mehrfaches Weglaufen und<br />
Selbstverletzungen konnten das einmal geschlossene therapeutische<br />
Bündnis nicht grundsätzlich stören. Nach 13-monatiger Behandlung<br />
war eine Reintegration in eine neue Schule möglich und<br />
unter regelmässiger antidepressiver Medikation konnte der Übergang<br />
in eine ambulante Therapie realisiert werden.<br />
Ausblick<br />
Die stationäre Psychotherapie steht mit Recht fachlich und gesundheitsökonomisch<br />
auf dem kritischen Prüfstand als langes, aufwändiges<br />
und teures Verfahren. Bei sorgfältiger Indikationsstellung,<br />
ausführlicher Diagnostik und konsequenter Therapieplanung<br />
ist sie aber eine Methode, die weit über eine Symptomheilung hinaus<br />
kreative und gesunde Anteile unserer oft jahrelang körperlich,<br />
sexuell oder seelisch traumatisierten Patientinnen und Patienten<br />
fördert. Da alle Langzeitstudien zeigen, dass eine frühkindliche<br />
Traumatisierung zeitlebens ein schweres Risiko für psychische und<br />
übrigens auch körperliche Krankheiten darstellt, sehen wir es als<br />
unsere vornehme Aufgabe an, mit denjenigen jungen Menschen,<br />
die bereits beim Einstieg in den Lebens- und Arbeitsprozess so<br />
grosse Schwierigkeiten zeigen, in einer förderlichen Umgebung<br />
langfristige innerpsychische und soziale Stabilität aufzubauen, um<br />
später chronifizierte Patientenlebensläufe zu vermeiden.<br />
Katamnestische Nachuntersuchungen unserer Patientinnen<br />
und Patienten sind daher in der Planung und stellen einen neuen<br />
Schritt in der selbstkritischen und selbstbewussten Entwicklung<br />
des Föhrenberg dar.<br />
Es gibt noch viel zu tun!<br />
37
Heidi Eckrich, Oberärztin Bereich Jugendpsychiatrie<br />
Konzept und Entwicklung Station Linde G<br />
38<br />
Aufgrund des hohen Aufnahmedruckes<br />
wurde die Eröffnung einer 3. Station für jugend<br />
psychiatrische Patientinnen und Patienten<br />
geplant. Die Station wurde im Sommer<br />
2001 eröffnet und ergänzt als offen geführte Akutstation die<br />
bestehenden Angebote.<br />
Acht Tage vor Weihnachten 1999 traf sich ein Häufchen engagierter<br />
Mitarbeiter der Klinik Littenheid zum kollektiven Brainstorming.<br />
Sie nannten sich «Projektgruppe Rössli» und setzten<br />
sich interdisziplinär zusammen. In vier Sitzungen (und mit vielen<br />
Hausaufgaben…) entstand ein Grobkonzept. Es galt, eine neue<br />
Station zu konzipieren, die den Aufnahme- und Weitervermittlungsdruck<br />
auf die bestehenden Jugend-Stationen Föhrenberg<br />
und Linde H sowie auf die unterstützenden<br />
Erwachsenen-Aufnahmestationen<br />
erleichtern<br />
und gleichzeitig ein neues, anderes Setting<br />
bieten sollte. Der damalige Konzeptentwurf<br />
sah eine Rehabilitations-Station mit<br />
längerfristiger Intensivbetreuung chronifizierter Störungen vor bei<br />
geplanter Mindestaufenthaltsdauer von 1–2 Jahren und einer<br />
Gruppengrösse von 6–8 Personen. An Ausschlussdiagnosen wurden<br />
zu diesem Zeitpunkt u. a. Borderline-Störungen, schwere<br />
Selbstverletzung und akutpsychiatrische Krankheitsbilder genannt,<br />
ebenfalls nicht vorgesehen waren eine Assistenzarztstelle<br />
sowie mehr als 20% Oberarzt-Betreuung. Drei Monate später<br />
zeigte sich unter Einbezug der Klinikleitung rasch, dass ein so anspruchsvolles<br />
Projekt nicht realisierbar sein würde, dass aber eine<br />
Erweiterung der Kapazitäten für akute Behandlungen aufgrund des<br />
Versorgungsauftrages für die Kantone Thurgau, Schwyz und Zug<br />
und des hohen Aufnahmedruckes im Bereich Jugendpsychiatrie erforderlich<br />
war. Die Errichtung einer psychiatrisch unterstützten<br />
Wohngruppe wurde deshalb zurückgestellt.<br />
Bei konstantem Aufnahmedruck und mit neuem Personal startete<br />
im Oktober 2000 die «Projektgruppe Linde G», nun unter Federführung<br />
von O. Bilke und U. Gasser, den Bereichsleitern Jugendpsychiatrie,<br />
unter Einbezug der neu eingestellten Oberärztin<br />
S. Kühnel. Konzipiert wurde eine offene Akutaufnahmestation<br />
mit 12–14 Betten. Der Umbauauftrag ging an das Architekturbüro<br />
Peter Jäger in Wil, die Fertigstellung wurde für Ende August<br />
2001 terminiert. So geschah es, am 31.8.01 war interne und am<br />
20.9.01 die offizielle Eröffnungsfeier. Dazwischen gab es mancherlei<br />
Überraschungen, die aber allen nur neuer Ansporn war.<br />
Sukzessiver Aufbau und Teamentwicklung<br />
Gestartet wurde mit vier Jugendlichen und noch nicht vollständigem<br />
Team. Trotz allen Versuchen, den Dingen vorausschauend zu<br />
begegnen, gab jede Erhöhung der Patientenanzahl, auch jede Erweiterung<br />
des Teams immer wieder neue Bewegung, manchmal<br />
auch kleinere «Erdbeben». Interessante Phänomene am Rande waren<br />
dabei der Übergang von «den Patienten» zur «Patientengruppe»,<br />
die gleichbleibende Länge der Besprechungszeiten des<br />
Teams und Verhaltensänderungen einzelner Jugendlichen durch<br />
ihre neue Position innerhalb der sich wandelnden Gruppe.<br />
Die Erweiterung des Teams durch das Hinzukommen von<br />
Ober- und später Assistenzärztin erforderte jedesmal einen Adaptationsprozess<br />
des Einzelnen und der Gruppe. Hier zeigt sich die<br />
Die Interdisziplinarität des Teams mit Fachkräften<br />
verschiedenster Berufsgruppen erfordert ein hohes<br />
Mass an Kommunikationskultur.<br />
Teamsupervision als enorm wichtig und hilfreich, wiewohl – nicht<br />
zuletzt durch weitere Personalmutationen – der Prozess noch nicht<br />
als abgeschlossen gelten kann. Auch die Multi-Nationalität<br />
(Schweiz, Deutschland, Österreich, Tibet, Portugal, etc.) und<br />
Interdisziplinarität (Psychiatriefachpflege, Krankenpflege, Sozialpädagogik,<br />
(Kleinkind-) Erzieher, Lehrer, etc.) erfordern ein hohes<br />
Mass an Kommunikationskultur beim Einzelnen. Ein grosser Verdienst<br />
liegt hier bei der unermüdlichen Stationsleiterin Phüntsok<br />
Dahortsang, die selbstkritisch Verbindlichkeiten zu erzeugen und<br />
für ein offenes Klima zu sorgen weiss.<br />
Cui bono<br />
An wen richtet sich nun das Behandlungsangebot der Linde G<br />
Wem will sie und wem kann sie nützen<br />
Aufgenommen werden Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren<br />
beiderlei Geschlechts. Voraussetzung ist eine psychiatrische<br />
oder psychosomatische Behandlungsbedürftigkeit, der nicht oder<br />
nur ungenügend im ambulanten oder teilstationären Rahmen<br />
entsprochen werden kann. Folgende Hauptindikationen sind zu<br />
nennen:<br />
● Suizidalität<br />
● Psychosen<br />
● Misshandlungen und posttraumatisches Stress-Syndrom<br />
● depressive Zustandsbilder
● Persönlichkeitsentwicklungsstörungen<br />
● Angststörungen<br />
● Zwangsstörungen<br />
● Hyperkinetische Syndrome<br />
● Psychosomatosen<br />
Folgende Angebote bestehen:<br />
● Kriseninterventionen (sofern ein offener Rahmen vertretbar ist)<br />
● Diagnostik und Abklärung bei unklaren Zustandsbildern und<br />
Verhaltensstörungen<br />
● mittel- und längerfristige Therapie und Wiedereingliederung<br />
● Begutachtungen im Auftrag der Jugendanwaltschaften und<br />
Vormundschaftsbehörden<br />
Absolute Kontraindikationen für eine Aufnahme auf Linde G sind<br />
ausschliesslich schwere Verwahrlosung und Dissozialität, gravierende<br />
Minderbegabung sowie manifeste, im Vordergrund stehende<br />
Substanzabhängigkeit.<br />
Diagnoseunabhängige Kriterien ergeben sich aus dem Pflichtversorgungsauftrag,<br />
den Linde G für die drei Vertragskantone<br />
Schwyz, Zug und Thurgau wahrnimmt. Eine ausserkantonale Versorgung<br />
nebst den genannten Vertragskantonen ist bei dem derzeitig<br />
hohen Aufnahmedruck auch bei Vorliegen einer Kostengutsprache<br />
nur selten möglich, oft nur in Ausnahmefällen, wenn eine<br />
gute Zusammenarbeit mit Vormundschaftsbehörden und den im<br />
betreffenden Kanton zuständigen Erwachsenenpsychiatrien und<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten einen planbaren<br />
Eintrittstermin und eine Verkürzung des Aufenthaltes ermöglicht.<br />
Behandlungskonzept<br />
Konzept ist ein integrativer systemisch-lösungsorientierter, verhaltenstherapeutischer<br />
und medizinischer Ansatz, gemäß «biopsycho-soziologischen»<br />
Erklärungsansätzen bzgl. der Entstehung<br />
psychischer Erkrankungen. Soweit evidenzbasierte Methoden vorliegen,<br />
kommen diese zum Einsatz, wobei dies vom jeweiligen<br />
Stand der Forschung und Klinik abhängt. Ein intensiver Einbezug<br />
der Familie ist – je nach Entwicklungsstand des Jugendlichen – ein<br />
zentraler Baustein der Therapie, die durchschnittlich drei (1–6)<br />
Monate dauert. Das Behandlungsangebot umfaßt verschiedene<br />
Formen der Psychotherapie (kognitive Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch<br />
fundierte Gesprächstherapie etc.), Gestaltungs- und<br />
Bewegungstherapien, medikamentöse Behandlung, milieutherapeutische<br />
Elemente, Tagesstrukturen, Beschulung sowie Sozialund<br />
Berufsberatung.<br />
Eine ambulante Nachbehandlung wird übergangsweise angeboten,<br />
bis eine Anbindung an externe Dienste möglich ist.<br />
Weiterentwicklungen<br />
Nach dem einwöchigen, komplikationsfreien und von allen Beteiligten<br />
als sehr positiv wahrgenommenen Skilager im März <strong>2002</strong><br />
der fast kompletten Station Linde G stellte sich das Team – nicht<br />
ganz zu Unrecht – die Frage, was die Jugendlichen denn eigentlich<br />
wirklich und zentral therapeutisch bräuchten.<br />
Die Psychopharmakotherapie blieb bei dieser kritischen Diskussion<br />
aussen vor, da eine konsequente Weiterführung auch in<br />
diesem Rahmen erfolgte und als Grundlage für die Durchführungsmöglichkeit<br />
dieser Unternehmung zu sehen war, wiewohl<br />
durchaus eine Reduktion der benötigten Reserve-Medikation verzeichnet<br />
wurde. Tagesstruktur und professionelle, ungewöhnlich<br />
zeitintensive Zuwendung seitens des interdisziplinären Betreuungspersonals<br />
sowie Gruppenaktivitäten in den Bereichen Sportund<br />
Freizeitgestaltung als Elemente der sogenannten Milieu-Therapie<br />
waren vorhanden. Entspannung brachte die Abwesenheit<br />
von Anforderungen des Alltags wie z. B. Schule oder Ausbildung.<br />
Diesem kurzfristigen Erlebnis- und Entlastungs-Phänomen<br />
muss natürlich im stationären Alltag anderweitig und mit den<br />
Austritt überdauernden Methoden nahe zu kommen versucht werden.<br />
Hier gibt es noch viel zu tun.<br />
In eigener Sache – ein Dank!<br />
Ich bin als Oberärztin im Oktober 2001 dazu gestossen, neu in<br />
meiner Rolle in einem neuen Team auf einer neuen Station in einem<br />
«neuen» Land. Nicht gerade ein junger Hase im Fach, sehr<br />
wohl «neugierig», aber nach zwei Jahren selbständiger und alleinverantwortlicher<br />
Ambulanz- und Praxistätigkeit gewohnt, rasch<br />
und vorwiegend als einzige Entscheidungsträgerin zu handeln. Sicherlich<br />
nicht leicht für ein noch im Aufbau und Selbstfindungsprozess<br />
befindliches Team so jemanden «einzubremsen», der noch<br />
nicht einmal die Sprache beherrscht… Meine innere Ungeduld<br />
liess mich oft schweigen, was – entgegen dem Sprichwort – in einem<br />
Team nur Silber ist. Nicht nur deswegen möchte ich dem<br />
Linde G-Team und der Bereichsleitung an dieser Stelle danken,<br />
mich sehr persönlich aufgenommen und mir die Chance gegeben<br />
zu haben, mich zu integrieren.<br />
39
Individuelle Angebote für den<br />
alternden Menschen.<br />
Werkstattberichte aus der Alterspsychiatrie
Dr. med. Jokica Vrgoc-Mirkovic, Leitende Ärztin Gerontopsychiatrie<br />
Wie viel Entwicklung verträgt die<br />
Alterspsychiatrie heute<br />
Die Behandlung älterer Menschen hat sich<br />
in den letzten Jahren durch neue medizinische<br />
Erkenntnisse und die entsprechenden<br />
therapeutischen Angebote sowie einem erweiterten<br />
Behandlungsnetz ambulanter, teilstationärer und stationärer<br />
Betreuungsdienste stark verändert. Es gilt, diese dynamsiche<br />
Entwicklung in die bestehenden therapeutischen Angebote zu<br />
intergrieren.<br />
Der Alterungsprozess<br />
verläuft sehr individuell,<br />
es lassen sich deshalb<br />
auch keine allgemeingültigen<br />
Aussagen zu einheitlichen<br />
Kriterien des<br />
Altwerdens formulieren.<br />
Demographische Entwicklung<br />
Der demographische Wandel in der Bevölkerungsstruktur westeuropäischer<br />
Länder ist unübersehbar. Innerhalb der letzten 100<br />
Jahre hat sich die Lebenserwartung der Menschen etwa verdoppelt.<br />
1890 lag die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen<br />
bei 39 und für Männer bei 36 Jahren. Heute hat eine 60-jährige<br />
Frau statistisch gesehen weitere 22 Jahre, ein gleichaltriger Mann<br />
noch 17,5 Jahre zu leben. Durch die Verbesserung zahlreicher Faktoren<br />
wie z. B. der hygienischen Bedingungen und der Entwikklung<br />
von Impfstoffen erfolgte einerseits eine deutliche Abnahme<br />
der Kindersterblichkeit, zum andern haben der Aufbau eines modernen<br />
medizinischen Behandlungssystems und der Anstieg des<br />
allgemeinen Lebensstandards eine deutliche Verringerung der<br />
Krankheits- und Sterberisiken im Erwachsenenalter bewirkt. Mit<br />
der zunehmenden Lebenserwartung verändert sich gleichzeitig die<br />
Ehedauer, so dass immer mehr Paare die Möglichkeit haben, ihre<br />
«goldene Hochzeit» zu feiern und auf eine 50-jährige Zweisamkeit<br />
zurück zu blicken.<br />
Diese Tatsachen nehmen wir meistens zur Kenntnis, ohne uns<br />
zugleich mit der Frage auseinander zu setzen, inwieweit uns diese<br />
Entwicklung selber betreffen wird. Natürlich werden wir jeden<br />
Tag, jede Woche, jedes<br />
Jahr älter, dazu<br />
müssen wir nichts<br />
beitragen – älter werden<br />
wir von selbst<br />
und «alt» sind im<br />
Zweifelsfall eher die<br />
anderen. In einer klinikinternen<br />
Umfrage<br />
unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie sie sich ihr eigenes<br />
Alter nach dem 65. Lebensjahr vorstellen, berichteten sie über<br />
ihre zahlreichen Wünsche und Ideen wie Reisen, Bücher lesen,<br />
Freunde besuchen. Erstaunlicherweise wurden fast ausschliesslich<br />
positive Erwartungen an das eigene Alter geäussert. Im Gegensatz<br />
zu unserer persönlichen Erwartungshaltung ist unser «Bild» älterer<br />
Menschen oft durch negative Vorstellungen geprägt, die unsere eigenen<br />
Erfahrungen mit Vertretern einer älteren Generationen<br />
spiegeln, zum Beispiel den Grosseltern, und diese früheren Erfahrungen<br />
werden auf die heutige Situation übertragen.<br />
Altwerden beinhaltet sehr viele positive Aspekte wie:<br />
● über viele Erfahrungen und Kenntnisse verfügen<br />
● mit Freude und Stolz auf die Vergangenheit zurückblicken<br />
● Freizeit geniessen<br />
● Zeit für Partnerschaft und Beziehungen haben<br />
● Hobbys ausbauen und pflegen («endlich Zeit für mich»)<br />
● keine finanziellen Sorgen mehr haben<br />
● häufiger Ferien machen können, usw.<br />
Das Älter werden – ein individueller Prozess<br />
Der Alterungsprozess verläuft sehr individuell, es lassen sich<br />
deshalb auch keine allgemeingültigen Aussagen zu einheitlichen<br />
Kriterien des Altwerdens formulieren. Viele Faktoren wie die biologischen<br />
Veränderungen, die seelische Befindlichkeit und Entwicklung,<br />
soziale und familiäre Beziehungen und die Integration<br />
in die Gesellschaft ermöglichen verschiedenste Entwicklungsverläufe.<br />
Auch äussere Kriterien wie der Übertritt in den Ruhestand<br />
sind von Land zu Land sehr verschieden, in der Türkei erreicht<br />
man das Rentenalter mit 55 Jahren, hingegen bei uns erst mit 63<br />
oder 65 Jahren.<br />
Strukturelle und konzeptuelle Änderungen in den<br />
psychiatrischen Kliniken<br />
In den 90er Jahren fand in vielen psychiatrischen Kliniken eine<br />
Bettenreduktion auf den Stationen der Gerontopsychiatrie statt,<br />
in dem Patienten in Altersheime oder in neu geschaffene Wohnheime<br />
verlegt wurden. Dadurch reduzierte sich ein spezialisiertes<br />
Behandlungsangebot und es wurden nur noch in wenigen Kliniken<br />
dem Alter angepasste, differenzierte Therapiekonzepte entwickelt.<br />
Dies steht in Widerspruch zur demographischen Entwicklung<br />
und könnte den Eindruck erwecken, als ob ältere<br />
Menschen psychische Belastungen wie den Verlust des Ehepartners,<br />
Trennung von den Kindern, Pensionierung mit Verlust des<br />
Selbstwertgefühles und damit verbundenen finanziellen Einbus-<br />
41
42<br />
sen, zunehmende körperliche Einschränkung und Krankheiten<br />
ohne fachliche Betreuung meistern können oder müssen. Auch ältere<br />
Menschen stellen oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst und<br />
schämen sich, wenn sie psychotherapeutische Hilfe beanspruchen<br />
müssen.<br />
Wie sieht die Entwicklung der Gerontopsychiatrie<br />
in der Klinik Littenheid aus<br />
Von den 4 Stationen des Bereiches Gerontopsychiatrie haben die<br />
Stationen Park B und Waldegg C einen Behandlungsauftrag mit<br />
Schwerpunkt Krisenintervention und Therapie. Im Alltag werden<br />
wir mit zwei verschiedenen Altersgruppen konfrontiert: Ältere,<br />
häufig multimorbide und demenzkranke Patienten, die ein niederschwelliges<br />
Therapieangebot benötigen (Waldegg C) sowie jüngere<br />
Patienten, die Anspruch auf eine differenzierte psychotherapeutische<br />
Behandlung (Park B) erheben. Die unterschiedlichen<br />
Konzepte und Therapieangebote der Stationen ermöglichen individuell<br />
angepasste und attraktive Therapieangebote für Menschen<br />
in der zweiten Lebenshälfte.<br />
Die zwei Stationen Waldegg A und Waldegg B bieten längere<br />
Behandlungen im Sinne der Akut-Rehabilitation mit unterschiedlichen<br />
milieutherapeutischen Schwerpunkten. Beide Stationen integrieren<br />
ressourcenorientierte, verhaltenstherapeutische Prinzipien<br />
mit dem Ziel der persönlichen Stabilisierung.<br />
Dank grösseren baulichen Anpassungen, welche mit der<br />
Wiedereröffnung des Hauses Waldegg im Herbst 2000 abgeschlossen<br />
wurden, bieten auch die Gemeinschaftsräume und Patientenzimmer<br />
der Stationen eine optimal angepasste Infrastruktur<br />
mit einem gehobenen Wohnkomfort.<br />
Unsere täglichen Erfahrungen und die wertvollen Rückmeldungen<br />
unserer Patientinnen und Patienten veranlassen uns, die<br />
bestehenden Konzepte laufend zu überprüfen und anzupassen.<br />
Über diesen normalen Entwicklungsprozess<br />
hinaus haben wir eine interdisziplinäre Projektgruppe<br />
gebildet, welche sich in den Die unterschiedlichen Konzepte der Stationen<br />
nächsten Monaten Gedanken über eine moderne<br />
zukünftige Altersversorgung macht. attraktive Therapieangebote für Menschen in<br />
ermöglichen individuell angepasste und<br />
Wir suchen nach Antworten zu Fragen nach der zweiten Lebenshälfte.<br />
den zukünftige Anforderungen an eine stationäre<br />
Behandlung, der Rolle der beteiligten Berufsgruppen, die<br />
Aufgabenteilung zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer<br />
Behandlung und die möglichen Konsequenzen zur Mitarbeiterrekrutierung<br />
und -schulung. Denn wie sich die Lebensgestaltung<br />
und die Bedürfnisse älterer Menschen geändert haben<br />
und auch weiterhin ändern werden, so müssen sich auch die Behandlungsangebote<br />
nach diesen Wünschen und Erfordernissen<br />
richten.<br />
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass das Entwicklungspotential<br />
und die Entfaltungsmöglichkeiten älterer Menschen sehr<br />
gross sind. «Das Alter gleicht dem Übergang vom Tag zur Nacht.<br />
Wer sich im Halbdunkeln bewegen will, muss lernen, verschiedene<br />
Grautöne zu unterscheiden. Wer sich an die Dunkelheit gewöhnt<br />
und sein Bewegungstempo auf die Dunkelheit abgestimmt<br />
hat, macht die Erfahrung, dass die Finsternis nicht absolut und<br />
lähmend ist, sondern dass die Dunkelheit zu leben beginnt. Im<br />
Dunkeln werden dabei Erlebnisse ermöglicht, die im grellen Tageslicht<br />
übersehen werden. Sie verleihen der Dunkelheit – ähnlich<br />
wie dem Alter – einen einmaligen Reiz.» (Goldbrunner 1994)
Anna Guadagnini, Aktivierungstherapeutin Gerontopsychiatrie<br />
Zeitenwandel konkret<br />
Die Anforderungen an die Aktivierungstherapie<br />
haben sich in letzter Zeit geändert, gefragt<br />
sind heute mehr kreative und individuellere<br />
Therapieformen.<br />
Die Aktivierungstherapie (AT) in Littenheid hilft Menschen in<br />
der zweiten Lebenshälfte, indem sie ihre sozialen, geistigen und<br />
körperlichen Ressourcen unterstützt und fördert. Mit ausgewählten<br />
und angepassten therapeutischen Mitteln und Aktivitäten<br />
richtet die AT ihr Augenmerk auf die vorhandenen Fähigkeiten<br />
der Patientinnen und Patienten. In gezielten Einzel- und Gruppentherapien<br />
trägt die AT so zur Erhaltung und Förderung der<br />
Lebensqualität bei. In verschiedenen Gruppenangeboten werden<br />
beispielsweise Malaktivitäten, handwerkliche Arbeiten oder Themengruppen<br />
durchgeführt. Doch je länger je<br />
mehr ist ein Wandel in den Bedürfnissen<br />
und Gewohnheiten unserer Patientinnen<br />
und Patienten festzustellen. Genügten die<br />
obengenannten Aktivitäten, um die ältere<br />
Generation, ich möchte sie mit «Kriegserfahrungsgeneration»<br />
bezeichnen, zu beschäftigen<br />
und dadurch zu aktivieren, so ist unser heutiges Klientel anspruchsvoller<br />
und verlangt einen anderen und manchmal auch<br />
ganz individuellen Zugang.<br />
Ein Beispiel aus den Malgruppen soll dies verdeutlichen: Einen<br />
Blumenstrauss auf dem Tisch abzuzeichnen galt bei den früheren<br />
Patienten als gelungen, wenn er möglichst originalgetreu auf dem<br />
Blatt Papier wieder zu erkennen war. Demgegenüber werden Äpfel<br />
heute auch schon als gelungen betrachtet, wenn sie violett auf<br />
dem Blatt leuchten. Man könnte diese Tendenz als Wechsel in der<br />
Wahrnehmung vom «Haben» zum «Sein» bezeichnen.<br />
Ein ausdrucksstarkes Bild, welches vermehrt auch abstrakt gemalt<br />
wird, kann uns Therapeutinnen häufig als Anknüpfungspunkt<br />
dienen für Gespräche über Lebenserfahrungen und<br />
Gewohnheiten unserer Patienten. In dieser folgerichtigen Entwicklungsrichtung<br />
entstehen immer wieder neue gruppentherapeutische<br />
Angebote wie Malen mit verschiedenen Techniken<br />
(Kohlemalen, Nass-in-nass, Stimmungs- oder Ausdrucksmalen<br />
etc.), Gedächtnistraining (neudeutsch als Hirnjogging bezeichnet)<br />
oder auch Poesiegruppen (Auseinandersetzen mit diversen Literaturformen<br />
oder gar selber Gedichte oder Texte entwickeln). Diesen<br />
Wechsel kann man auch erkennen bei Garten- und anderen<br />
manuellen Arbeiten. Man hört auch schon die Bemerkung wie<br />
«ich habe das ganze Leben gearbeitet und jetzt soll ich wieder im<br />
Garten arbeiten oder stricken» Bei den früheren Generationen<br />
war hingegen durch die Aktivierung von ehemals gut bekannten<br />
manuellen Fertigkeiten eine gewisse Befriedigung erkennbar im<br />
Sinne von «ich fühle mich noch sinnvoll und gebraucht hier» oder<br />
«ich kann doch noch etwas machen».<br />
Die neuen Anforderungen unterstreichen je länger je mehr die<br />
Notwendigkeit der Professionalisierung im aktivierungstherapeutischen<br />
Bereich. Diesem Wandel hat sich auch die Klinik Littenheid<br />
gestellt und als schönes äusseres Zeichen dafür können wir<br />
unsere Angebote seit gut einem Jahr in zweckmässig umgebauten<br />
und renovierten Räumlichkeiten durchführen. Unsere Lokalitäten<br />
sind jetzt alle rollstuhlgängig (inkl. WC) und die übersichtlichen,<br />
Ein ausdrucksstarkes Bild, welches vermehrt auch<br />
abstrakt gemalt wird, kann uns Therapeutinnen<br />
häufig als Anknüpfungspunkt dienen für Gespräche<br />
über Lebenserfahrungen und Gewohnheiten<br />
unserer Patienten.<br />
hellen und grossen Räume lassen eine warme Atmosphäre aufkommen.<br />
Die grösser gestalteten Räume gestatten es uns, auch die<br />
individuellen Therapieplätze grosszügiger zu bemessen und dadurch<br />
besser auf die einzelnen Personen eingehen zu können. So<br />
müssen wir nicht mehr zurückschrecken, auch mal grössere Malereien<br />
durchzuführen oder entsprechend grössere Therapiegruppen<br />
anzubieten.<br />
Dieser Wandel in der Zeit, dem wir alle, ob Patient oder Therapeut,<br />
auch ganz individuell ausgesetzt sind, bietet immer wieder<br />
neue und spannende Herausforderungen, die unser Leben und<br />
Sein hier in Littenheid anspornen und uns zu neuen und manchmal<br />
unkonventionellen Lösungen vorantreiben.<br />
43
Zeljka Slijepcevic, Stationsleiterin Gerontopsychiatrie / Monika Eberli, Stationsergo Gerontopsychiatrie<br />
Stations-Ergotherapie:<br />
Eröffnung und Erfahrung<br />
44<br />
Die Ergotherapie ist<br />
ein hilfreiches therapeutisches<br />
Angebot,<br />
um handwerkliche<br />
Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern. Bei der Auswahl der Tätigkeiten<br />
versuchen wir, frühere Neigungen und Interessen der Patienten<br />
zu berücksichtigen.<br />
Mancher Leser wird sich fragen: «Was ist Ergo, was versteht<br />
man unter diesem Namen Welche Bedeutung hat die Erogtherapie<br />
in der Gerontopsychiatrie» Ich versuche, mit dem folgenden<br />
Artikel diese Frage zu beantworten. Zunächst mal, wer sind wir<br />
Die Station Waldegg B ist eine von vier Stationen der Gerontopsychiatrie<br />
der Klinik Littenheid. Wir bieten für 20 Patienten<br />
komfortable Zimmer und Aufenthaltsräume. Die Behandlung ist<br />
auf die Bedürnisse von Patienten mit längeren Aufenthaltszeiten<br />
zugeschnitten. Ein multiprofessionelles und multikulturelles Team<br />
steht dafür zur Verfügung. Die Stationsergo ist seit fast zwei Jahren<br />
in unserem Angebot integriert. Das Wort «Ergon» kommt aus dem<br />
griechischen und bedeutet Tätigkeit, Aufgabe und Werk. In der<br />
Gerontopsychiatrie ist das Ziel die Erhaltung und Förderung der<br />
Selbständigkeit der PatientInnen.<br />
In der Ergotherapie unterscheidet man zwischen dem funktionellen,<br />
berufsorientierten und dem Selbsthilfe-Training. Je nach<br />
den Bedürfnissen der sind Einzel- und Gruppentherapien möglich.<br />
Für uns vom Pflegeteam ist vor allem das funktionelle und<br />
das Selbsthilfetraining wichtig. Deren Ziel ist die Erhaltung und<br />
Förderung der geistigen und körperlichen Beweglichkeit. Die Aufgabe<br />
der Pflegeperson bzw. der Stations-Ergotherapeutin ist es,<br />
Stärken und Schwächen der Patienten zu erkennen und entsprechende<br />
Massnahmen zu ergreifen, die mit den Patienten besprochen<br />
werden. Die Biografiearbeit ist eine der möglichen Vorgehensweisen,<br />
wie wir einen Patieten näher kennen lernen<br />
können.<br />
Das folgende Beispiel erzählt über eine solche Erfahrung. Aus<br />
der Erzählung eines Patienten wusste ich, dass er früher seinen<br />
Garten pflegte und hegte. Ich schlug ihm vor, dies auch hier zu<br />
tun. Daraufhin fragte er selbständig bei der zuständigen Person,<br />
ob er ein paar Gartenbeete bewirtschaften könne. Dies wurde ihm<br />
auch bewilligt. Zuerst fuhren wir nach Wil, um sein eigenes Gartenwerkzeug<br />
zu kaufen. Beim nächsten Mal organisierte ich beim<br />
naheliegenden Bauernhof Dünger, den wir zusammen mit der<br />
Schubkarre holten. Durch die Gärtnerei erhielten wir die verschiedenen<br />
Setzlinge, die etappenweise gepflanzt wurden. Eingeplant<br />
für die Bearbeitung von zwei Beeten Blumen und einem<br />
Beet mit Tomaten und Gurken waren zwei Wochenstunden. Doch<br />
wir merkten schnell, dass zwei Stunden viel zu kurz waren für die<br />
Arbeiten. Der Patient verblieb im Sommer nicht mehr oft auf der<br />
Station, sein Garten wurde von ihm stündlich begutachtet und bearbeitet.<br />
Er überhäufte uns den ganzen Sommer mit Blumen, Tomaten,<br />
Gurken und Zucchetti.<br />
Das nächste Beispiel erzählt, wie PatientInnen mit unterschiedlichen<br />
Persönlichkeiten miteinander arbeiten können und<br />
dabei vernachlässigte Fähigkeiten aktivieren: Die Backgruppe existiert<br />
schon seit einigen Jahren. Zu Beginn ermittelten wir die<br />
Wünsche und Interessen der Patienten. Auf einer Liste wurde alles<br />
festgehalten, was benötigt wurde, daraufhin wurden die Zutaten<br />
bestellt. Allein richtete ich am Montagmorgen die Backzutaten<br />
und stellte sie auf dem Tisch bereit. Die Teilnehmerinnen<br />
nahmen ihren Platz ein, dann wurden die Aufgaben bis ins Detail<br />
abgesprochen. Es wurde sogar abgemacht, wer den Kuchen aus<br />
dem Ofen nimmt. Während meiner Abwesenheit konnte die<br />
Backgruppe autonom von einer Teilnehmerin geführt werden. An<br />
den Montagen, an denen ich fehlte, wurde die Backgruppe von<br />
den Teilnehmerinnen gestaltet. In der Zwischenzeit backte die<br />
Gruppe der Saison entsprechende Kuchen, Weihnachtsguetzli,<br />
Salzgebäcke und sogar verschiedenen Desserts.<br />
Das Vertrauen zwischen den einzelnen Pflegenden und den PatientInnen<br />
wächst mit der Zeit: Beim Übertritt einer Patientin<br />
wurde uns rapportiert, dass Frau K. sehr zurückgezogen lebe und<br />
die meiste Zeit des Tages in ihrem Zimmer verbringen würde. Zu<br />
Beginn war dies auch bei uns der Fall. Des öfteren beanspruchte<br />
sie meine Unterstützung, sei es beim Stricken oder beim Malen ihrer<br />
Bilder. Nach einigen Tagen erklärte ich ihr, dass ich nicht so<br />
viel Zeit bei ihr im Zimmer verbringen könne, denn sie wisse, wo<br />
sie mich finden könne und ich lud sie persönlich ins Ergozimmer<br />
ein. Nach kurzem Zögern folgte Frau K. meiner Einladung. Seit<br />
diesem Zeitpunkt lud sie mich nur noch gelegentlich zu sich ins<br />
Zimmer, denn sie kam stets zu mir und malte und strickte. Anfänglich<br />
tauschten wir nur wenige Worte miteinander aus, aber<br />
mit der Zeit vertraute sie mir mehr aus ihrem Leben an.<br />
Die Ergotherapie ist ein wichtiger Baustein für unsere Patienten,<br />
um ihre Selbständigkeit zu erhalten oder wieder zu erlangen.<br />
Sie ermöglicht ihnen eine sinnvolle und strukturierte Tagesgestaltung<br />
und fördert die sozialen Kontakte zwischen den Patienten.
Zahlen und Fakten zur Klinik<br />
Littenheid.<br />
Das Jahr 2001 im Spiegel der Statistik
Dr. med. Oliver Bilke, Leitender Arzt Jugendpsychiatrie<br />
Statistik 2001<br />
46<br />
Eintritte nach Geschlechtern 1997–2001<br />
Im Jahr 2001 setzte sich die Steigerung der Eintritte fort, im Vergleich zum Vorjahr um 7%, zu 1997 um 31%. Im betrachteten Fünfjahres-Zeitraum<br />
betrug die durchschnittliche Zuwachsrate an Eintritten pro Jahr 6%. Die Geschlechtsrelation hat sich 2001 geringfügig<br />
von 1:1,39 auf 1:1,29 verändert.<br />
Jahr Männer Frauen Total Geschlechtsrelation<br />
1997 255 345 600 1:1,35<br />
1998 269 326 595 1:1,21<br />
1999 278 302 580 1:1,09<br />
2000 307 427 734 1:1,39<br />
2001 342 441 783 1:1,29<br />
Männer<br />
Frauen<br />
Total<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
1997 1998 1999 2000 2001<br />
Eintritte nach Alter 1997–2001<br />
Die Verteilung der Altersgruppen ist in den letzten Jahren weitgehend konstant. Die Zunahme der Gesamtaufnahmezahl zeigt sich in<br />
allen Altersgruppen. Die altersabhängigen Zahlen steigen proportional zu den Gesamtaufnahmezahlen.<br />
Jahr 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–99<br />
1997 93 126 116 118 75 37 21 14<br />
1998 107 104 119 140 60 39 15 11<br />
1999 95 111 123 107 84 33 21 6<br />
2000 89 144 145 140 110 58 31 17<br />
2001 96 158 170 149 128 34 32 16
Eintritte nach Kantonen 1997–2001<br />
Gegenüber dem Vorjahr nahm die Zahl der Eintritte aus den Vertragskantonen Thurgau, Schwyz und Zug sowie die Eintritte zusatzversicherter<br />
Patienten leicht zu. Gegenüber dem Vorjahr betrug die Steigerung im Standortkanton Thurgau 5%, in den Vertragskantonen<br />
Schwyz 15% und Zug 6%.<br />
47<br />
Kanton 1997 1998 1999 2000 2001<br />
TG 211 238 200 300 315<br />
SZ 59 45 60 110 126<br />
ZG 23 21 28 52 55<br />
ZH 161 115 113 75 71<br />
SG 67 84 87 89 93<br />
Übrige 79 92 92 108 123<br />
Total 600 595 580 734 783<br />
TG<br />
SZ<br />
ZG<br />
ZH<br />
SG<br />
Übrige<br />
400<br />
375<br />
350<br />
325<br />
300<br />
275<br />
250<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0<br />
1997 1998 1999 2000 2001<br />
Eintritte nach Klinikbereichen 1997–2001<br />
Die Zahl der Eintritte spiegelt auch die unterschiedlichen Aufgabengebiete der vier Klinikbereiche wieder. Während in der Gerontopsychiatrie<br />
(Zuwachs 9%) und der stationären Psychotherapie (Zuwachs 14%). Wahleintritte dominieren, hat die Akutpsychiatrie (Zuwachs<br />
2%) und Jugendpsychiatrie vor allem einenVersorgungsauftrag für die Vertragskantone Thurgau, Schwyz und Zug zu erfüllen.<br />
1997 1998 1999 2000 2001<br />
Akutpsychiatrie 323 311 294 418 428<br />
Stationäre Psychotherapie 132 127 124 125 143<br />
Gerontopsychiatrie 69 81 84 137 149<br />
Jugendpsychiatrie 66 76 78 54 63<br />
übrige 10 0 0 0 0<br />
Total 600 595 580 734 783
48 Eintrittsdiagnosen 1997–2001<br />
Die einzelnen Diagnosegruppen nach ICD-10 entwickeln sich gesamtklinisch recht homogen. Die dominierenden Bereiche F3 (stabil)<br />
und F4 (plus 9%) sind weiter bedeutsam. Aufgrund mangelnder institutioneller Weiterplatzierungsmöglichkeiten stieg die<br />
Zahl sekundär sozial auffälliger Jugendlicher (F9) von 2000 auf 2001 aus den Pflichtversorgungsgebieten (plus 45%) und die Zahl der<br />
Benutzer psychotroper Substanzen (F1) nahm im gleichen Zeitraum um 30% zu.<br />
1997 1998 1999 2000 2001<br />
F0 19 16 15 25 22<br />
F1 96 79 52 71 92<br />
F2 92 74 75 113 113<br />
F3 182 207 236 274 278<br />
F4 108 112 98 147 160<br />
F5 26 23 22 32 27<br />
F6 39 46 48 49 56<br />
F7 5 2 1 1 2<br />
F8 3 3 2 0 1<br />
F9 30 33 31 22 32<br />
F0 Organische inkl. symptomatischer psychischer Störungen<br />
F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope<br />
Substanzen<br />
F2 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen<br />
F3 Affektive Störungen<br />
F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen<br />
F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen<br />
und Faktoren<br />
F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen<br />
F7 Intelligenzminderung<br />
F8 Umschriebene Entwicklungsstörungen<br />
F9 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in<br />
Kindheit und Jugend<br />
2001<br />
F0 2,8%<br />
F1 11,7%<br />
F2 14,4%<br />
F3 35,5%<br />
F4 20,4%<br />
F5 3,4%<br />
F6 7,2%<br />
F7 0,3%<br />
F8 0,1%<br />
F9 4,1%
Mehrfachdiagnosen (Austrittsdiagnosen) 1998–2001<br />
Mittlerweile haben 246 von 777 Patienten drei psychiatrische Diagnosen, d.h. 32% aller Patienten sind mehrfach von seelischem Leid<br />
betroffen. Bei 12% der austretenden Patienten mussten sogar vier Diagnosen gestellt werden, bei 5% fünf Diagnosen.<br />
49<br />
HD ND1 ND2 ND3 ND4 u. mehr<br />
1998 639 254 87 23 8<br />
1999 573 330 133 44 10<br />
2000 727 514 221 63 15<br />
2001 777 549 246 91 36<br />
Anteil an Privat- und Halbprivat versicherten PatientInnen<br />
Der Anteil an Privat und Halbprivat versicherten Patientinnen und Patienten konnte durch weiterentwickelte diagnostische und<br />
therapeutische Angebote sowie eine Optimierung in der Betreuung und Hotellerie ausgebaut werden, was sich in einem Zuwachs von<br />
18% bzw. 69% der Pflegetage abbildet.<br />
Pflegetage Privat/Halbprivat<br />
9000<br />
Privatpatienten<br />
2000: 3’169<br />
2001: 3’738<br />
2000: 4,5%<br />
2001: 5,1%<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
Halbprivatpatienten<br />
2000: 5’236<br />
2001: 8’849<br />
2000: 7,4%<br />
2001: 12,1%<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
3’169<br />
3’738<br />
5’236<br />
8’849<br />
2000<br />
4,5%<br />
7,4%<br />
7,4%<br />
12,1%<br />
2000<br />
2001<br />
1000<br />
0<br />
Privatpatienten<br />
Halbprivatpatienten
Wir gratulieren<br />
50<br />
Dienstjubiläenm 2001<br />
40 Dienstjahre<br />
Helmut Hauptmann<br />
30 Dienstjahre<br />
Hans Zimmerli<br />
25 Dienstjahre<br />
Gyurmie Buga<br />
Rita Knecht<br />
Brigitte Susanek<br />
20 Dienstjahre<br />
Aral Gülizar<br />
Elsa Baumgartner<br />
Heidi Grob<br />
Radmila Miljkovic<br />
Rakip Saiti<br />
Hüsnü Yücel<br />
Schlosser<br />
Schreiner<br />
Hilfspfleger<br />
Anmeldung/Information<br />
Psychiatrieschwester<br />
Hilfsschwester<br />
Angestellte Laden<br />
Hilfsschwester<br />
Krankenschwester<br />
Angestellter Gärtnerei<br />
Angestellter Gärtnerei<br />
Gianna Caramazza Krankenpflegerin FASRK<br />
Werner Egli<br />
Zimmermann<br />
Ursula Fuchs<br />
Psychiatrieschwester<br />
Astrid Herzog<br />
Aerztesekretariat<br />
Atidzda Ljatifi<br />
Hausdienst<br />
Heike Panov<br />
Psychiatrieschwester<br />
Sonja Ruckstuhl<br />
Gärtnerin<br />
Caterina Scuderi<br />
Hilfsschwester<br />
Elsa Stauffacher<br />
Anmeldung/Information<br />
Martin Waldispühl Gärtnermeister<br />
Wir danken den Jubilaren herzlich für ihre langjährige und<br />
aktive Mitarbeit.<br />
Lehrabschlüsse 2001<br />
15 Dienstjahre<br />
Ernst Abbt<br />
Hanspeter Bachmann<br />
Danica Bucan<br />
Dincer Furtana<br />
Rosmarie Kathriner<br />
Corinne Klopfer<br />
Axel Krausse<br />
Lina Odermatt<br />
Jela Pavlovic<br />
Maria Siegenthaler<br />
Albert Thür<br />
Marie Vetsch<br />
Bojana Vurusic<br />
10 Dienstjahre<br />
Maria Teresa Aebischer<br />
Roland Asprion<br />
Makus Binswanger<br />
Brigitta Bommer<br />
Elisabeth Burtscher<br />
Leiter Schlosserei<br />
Koch<br />
Stationsleiterin<br />
Reinigung<br />
Angestellte Wäscherei<br />
Psychiatrieschwester<br />
Psychiatriepfleger<br />
Anmeldung/Information<br />
Stationshilfe<br />
Reinigung<br />
Leiter Klinikschule<br />
Hausbeamtin<br />
Psychiatrieschwester<br />
Hilfsschwester<br />
Sozialarbeiter<br />
Chefarzt<br />
Maltherapeutin<br />
Stationsleiterin<br />
Das Diplom-Niveau II für psychiatrische Krankenpflege des<br />
Schweizerischen Roten Kreuzes erwarben:<br />
● Marianne Frei<br />
● Sonja Giezendanner<br />
● Rebekka Grögli<br />
● Eveline Karlen<br />
● Andrea Keller<br />
● Christof Koller<br />
● Kurt Steiner<br />
● Marlis Stürm<br />
● Fritz Wüest<br />
Die Lehre schlossen ab:<br />
● Thomas Langensand als Schreiner Richtung Bau + Fenster<br />
● Luzia Bühler als Koch<br />
● Tatjana Mäder als Kleinkindererzieherin
Leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
Allgemeine Leitung Hans Schwyn<br />
51<br />
Chefarzt Dr. med. Markus Binswanger Chefarzt-Stellvertreter Dr. med. Jörg Burmeister<br />
Leitende Ärzte/innen Dr. med. Oliver Bilke; Dr. med. Susanne Kunz Mehlstaub, Dr. med. Jokica Vrgoc<br />
Oberärzte/innen Dr. med. Heidi Eckrich; Dr. med. Eckhard Freund; Dr. med. Pia Ineichen; Dr. med. Josef Jenewein;<br />
Dr. med. Elisabeth Koppensteiner; Dr. med. Sibille Kühnel; Dr. med. Gudrun Rohrbeck; Dr. med. Thomas Schuhmann;<br />
Dr. med. Christiane Thomas; Dr. med. Jörg Wunderwald<br />
Stationsärzte/innen Dr. med. Britta Baumann-Schanné; Dr. med. Judith Bühler; Dr. med. Oliver Christen;<br />
Dr. med. Matthias Esenwein; Dr. med. Gabriele Feigl; Dr. med. Bernd Frank; Dr. med. Cordula Illner; Dr. med. Regina Korth;<br />
Dr. med. Andrea Kreissl; Dr. med. Julie Mannchen; Dr. med. Christoph Müller; Dr. med. Björn Press; Dr. med. Jürgen Rüegg;<br />
Dr. med. Stefan Sannwald; Dr. med. Antje Schatton; Dr. med. Maria Veraar; Dr,. med. Bettina Völkle<br />
Klinische Psychologen/innen Dr. phil. Margitta Backes; Noori Beg; Sophie Christen; Peter Fischer; Dr. phil. Monika Földényi;<br />
Colette Guillaumier; Lilli-Anne Howaldt; Christian Rappan; Ute Vetter<br />
Sozialdienst Roland Asprion; Caroline Welsch<br />
Aktivierungstherapie Anna-Marie Guadagnini<br />
Arbeitstherapie/Beschäftigung Jürg Denzler; Verena Mächler; Bruno Meier<br />
Ergotherapie Ulla Ogger<br />
Maltherapie Brigitta Bommer<br />
Physio- und Bewegungstherapie Bettina Baldo; Monika-Rosanna Corrodi; Martin Kempf<br />
Apotheke Monika Haag<br />
Labor Ingrid Hofmann<br />
Leiter Pflegedienst Hubert Dietschi<br />
Bereichsleiter/in Pflege Stephan Albert; Raymond Scheer; Susy Wagner<br />
Bereichsleiter Pädagogik Jugendpsychiatrie Urs Gasser<br />
Stationsleiter/innen Irene Blumer; Ernst Boos; Elisabeth Burtscher; Louis Chopard; Phuntsok Dahortsang; Mathias Erne;<br />
Peter Fleischmann; Annelies Helfenberger; Hendrik Johannes Houwing; Monika Hüppi; Kaarina Karlstedt;<br />
Henricus Slaats; Zeljka Slijepcevic; Martin Weyer<br />
Klinikschule Albert Thür, Leiter; Jeannette Röösli; Beate Tonina<br />
Seelsorge, Pfarrherren Peter Schüle, Evang. Pfarramt Sirnach; Beat Muntwyler, kath. Pfarrer, Kantonsspital Frauenfeld;<br />
Martin Geu, Methodistenkirche Eschlikon<br />
Leiter Oekonomie Lucien Kessler<br />
Leiter Verwaltung Daniel Wild<br />
Leiter Organisationsentwicklung/QM Urs Zürcher<br />
Betriebe Ernst Abbt, Schlosserei; Heidi Aggeler, Lingerie; Carmen Breu, Café «Huggi»; Andrea Caspar, Kinderkrippe;<br />
Helene Leonardi, Näherei; Erwin Brauchli, Techn. Betriebe; Werner Pfister, Malerei; Andreas Schneider, Schreinerei;<br />
Markus Scheiwiller, Küche; Marie Vetsch, Hausw. Betriebsleiterin; Martin Waldispühl, Gärtnerei;<br />
Edith Weiss, Hausw. Betriebsleiterin Stand: Juli <strong>2002</strong>
52<br />
<strong>Stiftung</strong>szweck<br />
Zweck der <strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong> ist die Einrichtung und der Betrieb<br />
geeigneter Arbeitsstätten, um den psychisch Behinderten eine<br />
ihrer Individualität entsprechende Tätigkeit und Verdienstmöglichkeit<br />
zu bieten, sowie die Schaffung weiterer Einrichtungen<br />
wie Beratungsstellen, Wohnheime usw. Beratungsstelle und<br />
Ambulatorium des Externen Psychiatrischen Dienstes Sirnach<br />
sind der <strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong> angeschlossen.<br />
<strong>Stiftung</strong>srat<br />
Humbert Entress, Präsident, Aadorf<br />
Hans Schwyn jun., Vizepräsident, Littenheid<br />
Dr. med. Markus Binswanger, Littenheid<br />
Myrta Klarer, Sirnach<br />
Dr. med. Ulrich Paul Rotach, Oberwangen<br />
Paul Holenstein, Fischingen<br />
Die eng mit unserer Klinik verbundene <strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong> ergänzt<br />
unser Angebot und entfaltet folgende Aktivitäten:<br />
Wohnheim Littenheid<br />
Das Wohnheim Littenheid bietet seinen Bewohnerinnen und<br />
Bewohnern eine stabile und geregelte Wohnsituation zur Förderung<br />
der Selbstständigkeit.<br />
Geschützte Werkstätten Littenheid<br />
Die verschiedenen Werkstätten und geschützten Arbeitsplätze<br />
schaffen eine sinnvolle Tagesstruktur für psychisch Behinderte<br />
und dienen der Wiedereingliederung in die Arbeitswelt.<br />
EPD Sirnach<br />
Der externe psychiatrische Dienst Sirnach ist im Auftrag des<br />
Kantons Thurgau für die ambulante psychiatrische und psychotherapeutische<br />
Versorgung der Region Hinterthurgau zuständig.<br />
Postcheckkonto 85-7186-6, «<strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong>»<br />
Frauenfeld<br />
Schaffhausen<br />
Konstanz<br />
Münchwilen<br />
Zürich<br />
Winterthur<br />
Frauenfeld<br />
Wil<br />
St. Gallen<br />
Ausfahrt Münchwilen<br />
A1<br />
Gloten<br />
Kreuzlingen/Konstanz<br />
Wil<br />
Altstadt<br />
Weinfelden/Bürglen<br />
Zürich<br />
Littenheid<br />
Uster<br />
Sirnach<br />
SBB<br />
Rest.<br />
Ilge<br />
Rapperswil<br />
Wattwil<br />
N<br />
Hub<br />
Lagerhaus AG<br />
Wil<br />
Ausfahrt<br />
Wil<br />
St. Gallen<br />
Zug<br />
Busswil<br />
Wilen<br />
Rickenbach<br />
Waro<br />
Luzern<br />
Schwyz<br />
Klinik Littenheid<br />
Wegweiser Littenheid<br />
Wattwil<br />
0 1 2 km
Der Patient als Partner<br />
Unsere Klinik steht Menschen bei, die ihr seelisches Gleichgewicht verloren haben und<br />
zeitweilig auf einen geschützten Rahmen angewiesen sind. Die Vielfalt und Professionalität<br />
unseres psychiatrischen und therapeutischen Angebotes soll dazu dienen, die<br />
psychischen, sozialen und körperlichen Störungen zu beheben oder zu mildern sowie<br />
vorhandene Kräfte und Fähigkeiten wieder zu stärken. Dabei ist es unser gemeinsames<br />
Ziel, die Patientinnen und Patienten so rasch wie möglich und so behutsam wie nötig<br />
in den Alltag zurückzuführen. Eine schöne und ruhige Umgebung, der architektonische<br />
Komfort unserer Gebäude sowie der Dorfcharakter unserer Klinik bieten dazu ein<br />
optimales Umfeld.<br />
Die umsichtige Planung des Klinikeintrittes<br />
Von einem ersten informellen Besuch, einer unverbindlichen Klinik-Führung bis zum<br />
eigentlichen ärztlichen Abklärungs- resp. Eintrittsgespräch sind verschiedene Formen<br />
der Kontaktaufnahme möglich. In der Regel erfolgt die Anmeldung durch den<br />
Hausarzt. Gerne geben wir auch Auskunft über weitere Fragen des Klinikaufenthaltes,<br />
über spezifische Behandlungsangebote auf den einzelnen Stationen sowie über die<br />
Fragen der Finanzierung des Klinikaufenthaltes. Als Kontaktperson steht Frau Brigitte<br />
Kühni, Ärztesekretariat, für Auskünfte zur Verfügung.<br />
Adresse:<br />
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
CH-9573 Littenheid<br />
Telefon Ärztesekretariat 071 929 63 50<br />
Fax Ärztlicher Dienst 071 929 60 10<br />
Telefon Klinik/Empfang 071 929 60 60<br />
Fax Verwaltung 071 929 60 30<br />
E-Mail: info@littenheid.ch<br />
www.littenheid.ch<br />
Öffentliche Verkehrsmittel<br />
Ab dem Bahnhof Wil/SG (ca. 4 km) besteht eine Busverbindung nach Littenheid im<br />
Stundentakt.<br />
Freibettenfonds<br />
<strong>Stiftung</strong>szweck dieses Fonds ist es, bedürftigen Patienten durch Beiträge den Klinikaufenthalt<br />
über kürzere oder längere Zeit zu ermöglichen.<br />
Postcheckkonto 85-227-0, Vermerk «Freibettenfonds»
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmen der Littenheid-Holding AG:<br />
Abbt-Peterer Ernst, Abduli Zimrije, Adams-Gschwend William, Aggeler Heidi, Ahorn Judith, Albert Sonja,<br />
Albert Stephan, Ammann Frieda, Amrhein Tanja, Aral Gülizar, Arnold Claudia, Asprion-Heule Roland, Babic<br />
Marlen, Bachmann-Müller Hans Peter, Backes Margitta, Baisch Thomas, Baldo-Kirschmann Bettina, Baric-Zloh<br />
Zlatka, Bärlocher Iris, Bartels Michael, Bauer Erika, Baumann Désirée, Baumann-Schanné Britta, Baumberger<br />
Anna, Baumgartner Elsa, Baumgartner Hansruedi, Beg Noori, Bein Rosmarie, Belt Johannes, Berlinger Valérie,<br />
Bernhart Herbert, Bilke Oliver, Bindschedler Marcel, Binswanger Markus, Blumer Irene, Bolt Maria, Bommer<br />
Fusco Brigitta, Boos Ernst, Borgards Cornelia, Brand-Ahcin Marija, Brändle-Faust Zita, Brauchli Erwin, Braun<br />
Edith, Braun-Stegemann Markus, Braunwalder Eliane, Breu Carmen, Brockhus Marcellus C.M., Broger<br />
Manuela, Brömmer Martin, Brotzer Roman, Brühwiler Monika, Brunner Eva, Brunschwiler Rahel, Büchel<br />
Monika, Büchi Mohl Madeleine, Buga Gyurmie, Bühler Judith, Burmeister Jörg, Burtscher Elisabeth, Cakir-<br />
Köseoglu Halil, Camenzind Christine, Caramazza Gianna, Casangcapan Rufina, Caspar Andrea, Ceta Danijela,<br />
Chandrasegeram-Kühne Anita, Chopard Louis, Christen Oliver, Christen Sophie, Christen Ulrich, Conconi Silvio,<br />
Corrodi Monika-Rosanna, Crivelli Alessandra, Dahortsang Peng Cuo Da Ji, Dahortsang Phuntsok, De Stradis<br />
Raffaella, Deari Dzemilije, Denzler-Häberli Jürg, Dietschi Hubert, Djukic-Grmas Marija, Dodic Catherine,<br />
Dübendorfer Christa, Dudli-Müller Eveline, Ebeling Susann, Eberle Lukas, Eberli-Kammermann Rosmarie,<br />
Eberli-Lehmann Monika, Eckrich Heidemarie, Edelmann Ramona, Egger Sonja, Egli Werner, Eigenmann<br />
Sandra, Eisenring Margrit, Erne-Schmitz Mathias, Erni Anna, Esenwein Matthias, Etzensperger Barbara, Falk<br />
Heidi, Faller Eveline, Fehrmann Erika, Feigl Gabriele, Fischer Peter, Fleischmann Peter, Fluri Michaela, Földényi<br />
Monika, Frank Bernd, Frehner Erwin, Frei Marianne, Freund Eckhard, Frick Daniel, Fröhlich Ruth Laura, Fuchs<br />
Ursula, Furrer Renata, Furtana-Alci Dincer, Furtana-Alci Elif, Furtana-Kara Halil, Furtana-Kara Hatice, Gadola<br />
Erika, Gamba Daniela, Gämperli Johanna, Gasser Urs, Gavranic Mara, Gehrig Daniel, Gerber Markus, Giesser<br />
Tamara, Giezendanner Sonja, Giger Maya, Girsberger Andri, Gisinger Erich, Gisler Christoph, Glaser Michael,<br />
Gostic Spomenka, Grabher Martin, Graf Daniel, Gremaud François, Grob Evelyn, Grob Heidi, Grögli Heidi,<br />
Grossglauser Christoph, Guadagnini Annamarie, Guillaumier Colette, Günay Kadir, Günay Nebiye, Haag<br />
Monica, Haas Yvonne, Handschin Eveline, Harder Roland, Hasler Olivia, Hasler-Schönenberger Jolanda, Hauck<br />
Ursula, Hauptmann Helmut, Hauser Heidi, Heider Stephanie, Heijerman Jacoba, Heimberg Susanne, Helbling<br />
Simone, Helfenberger Annelies, Hensle Renate, Herzig Claudia, Herzog Astrid, Hess Marlene, Hess Sonja,<br />
Hilgart Christian, Hofmann-Stabenau Ingrid, Hohl-Kammermann René, Holenstein Claudia, Hoost Karla,<br />
Houwing Hendrik Johannes, Howaldt Lilli-Anne, Hüppi Monika, Hürlemann Madeleine, Hürlemann Margrit,<br />
Hürner Ilona, Iacobozzi Alberto, Illner Cordula, Ineichen Pia, Injodikaran Reena, Iseli Krähenmann Beatrice,<br />
Jacob-Ebbinghaus Luzia, Janett Maria, Jäppinen Kauko, Jaun Walter, Jenewein Josef, Jung Michael, Jung<br />
Monika, Karge Wolfgang, Karisik-Imsic Emina, Karlstedt Kaarina, Karrer Renate, Karsay Margrit, Kathriner<br />
Rosmarie, Keist Sonja, Keller Franz, Keller Hansruedi, Kempf Martin, Kesim Raziye, Kesim-Kücük Abdullah,<br />
Keskin Dilek, Keskin Yilmaz, Keskin-Dalkic Pembe, Keskin-Dalkic Yilmaz, Kessler-Hunziker Lucien, Kessler-<br />
Hunziker Margrith, Khair Semira, Kilbey-Kartal Gülay, Kilbey-Kartal Necmettin, Kis Gabor, Klaus Veronika,<br />
Klauser Doris, Kljajic Milanka, Kljajic Zorica, Klopfer Corinne, Knecht Rita, Kobelt Esther, Kocka Mihaly, Kocka<br />
Miroslava, Kofel Ursula, Koller Christof, Koller Ruth, Kont Ali, Koppensteiner Elisbeth, Korth Regina,<br />
Kouwenhoven Menno, Krausse Axel, Kreissl Andrea, Kühnel Sibille, Kühni Brigitte, Kunz Mehlstaub Susanne,<br />
Künzle Urs, Künzli Margaritha, Kurian Jansamma, Kütük Hüseyin, Lahti-Arendain Aida, Lahti-Arendain Jukka,<br />
Landolt Jakob, Lederer Anatoli, Ledergerber Yvonne, Leiterer-Hörni Gertrud, Leiterer-Hörni Gertrud, Lenz<br />
Eva, Leonardi Grazia, Leonardi Helene, Leuenberger Cornelia, Leven Katrin, Liurni Clementine, Liurni Robert,<br />
Ljatifi Atidza, Lonardi Herrmann Corina, Luder Anneliese, Ludescher Nadja, Lüdt Ruth, Lukac Ilija, Lüthi<br />
Andrea, Mächler Verena, Mäder Tatjana, Mannchen Julie, Marko Bojan, Mattle Silvia, Meier Bruno, Meier<br />
Elsbeth, Meier Rosmarie, Meier Ruth, Meile Beat, Meili Lucia, Memeti Jetmire, Menegola Pia, Menzi Kuno,<br />
Micic Radojka, Mijatovic Adriana, Mikolasek Eeva, Mitic Dubravka, Moravac Maca, Müller Annemarie, Müller<br />
Christoph, Müller Fabienne, Müller Hans, Müller Susanne, Munana Petra, Nussbaumer Daniel, Oberholzer<br />
Anne-Marie, Oberthaler David, Ochsner Monika, Odermatt Lina, Odermatt Renata, Oehlschlegel Cornelia,<br />
Ogger-Jaakkola Ulla, Omollo Omondi, Osmani Dzemile, Osmani Hajrije, Osswald Miriam, Oswald Felix,<br />
Parampett Elzamma, Pavlica Milka, Pavlovic Jela, Pelli Marja, Petrovic Simka, Pfister Werner, Pinheiro Luis,<br />
Pollmann André, Press Björn, Preter Karin, Räbsamen Regula, Radovanovic-Milosevic Danka, Ramsperger<br />
André, Rappan Christian, Ratkic Ljubica, Rauch Bettina, Reimann-Schwager Marta, Ricek Vida, Rickenbach<br />
Alex, Rodriguez Marcial, Rohrbeck Gudrun, Romanelli Katharina, Romer Astrid, Römer Jacqueline, Röösli<br />
Jeannette, Roth Martin, Ruckstuhl Sonja, Ruckstuhl Yvonne, Rüegg Jürgen, Rüegger Christina, Rüesch Anton,<br />
Ruf Stefan, Rütsche-Rüesch Ruth, Saiti Rakip, Saiti-Vejsiu Luljeta, Sampaio Alexandre, Sannwald Stefan, Savic-<br />
Jovanovic Milina, Schatton Antje, Scheer Raymond, Schefer Monika, Scheiwiller-Gemperle Markus, Scheurer<br />
Linda, Schmeitz Paul H.C., Schmid Annemarie, Schmid Claudia, Schmid Doris, Schneider Andreas, Schöb Guido,<br />
Scholz-Kolloeffel Yvonne, Scholz-Kollöffel Walter, Schuhmann Thomas, Schulz Manuela, Schwarz Elisabeth,<br />
Schwyn-Weber Hans, Schwyn-Weber Hans, Schwyn-Weber Marianne, Scuderi Caterina, Seiringer Andrea, Senn<br />
Brigitte, Shitsetsang Dickie, Siegenthaler Maria-Roswitha, Simon-Bott Heidrun, Simon-Bott Heinz, Slaats<br />
Henricus, Slijepcevic Zeljka, Stadler Marie-Louise, Stahel Carmen, Starke Messikommer Katrin, Stauffacher<br />
Elsa, Steiner Kurt, Steudler Matthias, Stöckli-Böhi Guido, Stoll Alexander, Storrer Lisbeth, Stössel Michael,<br />
Stricker Hans-Peter, Stucki-Angele Kurt, Stürm Marlis, Subramaniam Jeevakanthan, Suntharampillai Vijayakumar,<br />
Susanek Brigitte, Sutter-Tönz Luzia, Tamao-Palma Anna Maria, Thieme Bernd, Thomas Christiane,<br />
Thür-Brütsch Albert, Thüringer Arno, Tikvic Nikola, Tinner Roger, Tobler Brigitta, Tobler Patrick, Tobler-<br />
Paulitsch Heidi, Todorovic Milena, Tonina-Hollerbach Beate, Topalovic Miroslav, Travaini-Zellweger Edith,<br />
Trieblnig Doris, Trüb Markus, Uhrig Evelyne, Vasiljevic-Bozic Jelica, Vasiljevic-Micic Rada, Veraar Maria-<br />
Katharina, Verloove Frits, Vetsch Marie, Vetter-Grün Ute, Völkle Bettina, Vrgoc-Mirkovic Jokica, Vurusic<br />
Bojana, Vurusic Ivan, Vurusic Stefka, Wagner Susy, Waldispühl Martin, Walt Konrad, Weber-Hermann<br />
Rosmarie, Wehrlin Corinne, Weiss Edith, Weiss Edith, Weiss Edith, Welsch Caroline, Wey Beatrice, Weyer<br />
Martin, Widmer Linda, Wielatt Rosa, Wiesli Lilly, Wiesli Waltraud, Wild-Bruggmann Andrea, Wild-Bruggmann<br />
Daniel, Wildersinn Ralf, Wüest Fritz, Wunderwald-Nierhaus Jörg, Würmli Karin, Würmli Karin, Wyrsch Heidi,<br />
Yücel Derya, Yücel Hüsnü, Yücel Meryem, Zimmerli Hans, Zivanovic Djurdjija, Zivanovic Milica, Zuberbühler<br />
Marianne, Zulic Azra, Zulic Mirzeta, Zuppinger Brigitte, Zürcher-Hasler Urs Stand: Juli <strong>2002</strong>