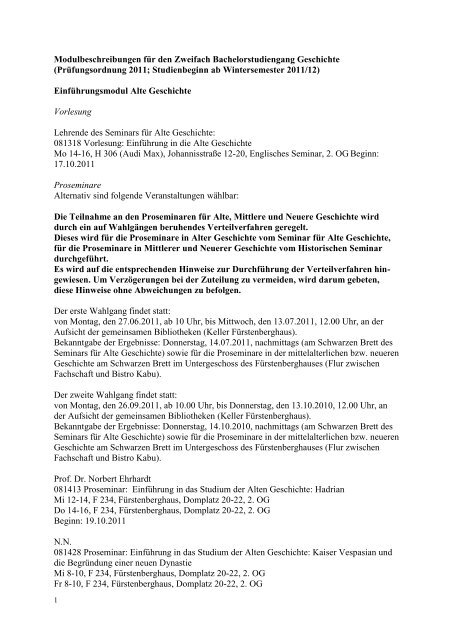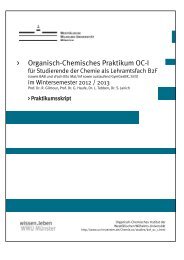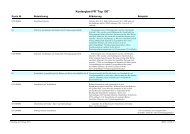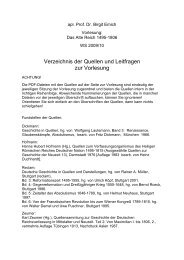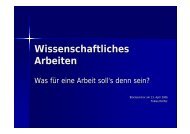Prüfungsordnung 2011; Studienbeginn ab Wintersemester 201
Prüfungsordnung 2011; Studienbeginn ab Wintersemester 201
Prüfungsordnung 2011; Studienbeginn ab Wintersemester 201
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Modulbeschreibungen für den Zweifach Bachelorstudiengang Geschichte<br />
(Prüfungsordnung <strong><strong>201</strong>1</strong>; <strong>Studienbeginn</strong> <strong>ab</strong> <strong>Wintersemester</strong> <strong><strong>201</strong>1</strong>/12)<br />
Einführungsmodul Alte Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Lehrende des Seminars für Alte Geschichte:<br />
081318 Vorlesung: Einführung in die Alte Geschichte<br />
Mo 14-16, H 306 (Audi Max), Johannisstraße 12-20, Englisches Seminar, 2. OG Beginn:<br />
17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Proseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Die Teilnahme an den Proseminaren für Alte, Mittlere und Neuere Geschichte wird<br />
durch ein auf Wahlgängen beruhendes Verteilverfahren geregelt.<br />
Dieses wird für die Proseminare in Alter Geschichte vom Seminar für Alte Geschichte,<br />
für die Proseminare in Mittlerer und Neuerer Geschichte vom Historischen Seminar<br />
durchgeführt.<br />
Es wird auf die entsprechenden Hinweise zur Durchführung der Verteilverfahren hingewiesen.<br />
Um Verzögerungen bei der Zuteilung zu vermeiden, wird darum gebeten,<br />
diese Hinweise ohne Abweichungen zu befolgen.<br />
Der erste Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10 Uhr, bis Mittwoch, den 13.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 12.00 Uhr, an der<br />
Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Der zweite Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10.00 Uhr, bis Donnerstag, den 13.10.<strong>201</strong>0, 12.00 Uhr, an<br />
der Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.10.<strong>201</strong>0, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081413 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Hadrian<br />
Mi 12-14, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Do 14-16, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081428 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Kaiser Vespasian und<br />
die Begründung einer neuen Dynastie<br />
Mi 8-10, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Fr 8-10, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
1
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081432 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Rom und die<br />
hellenistische Staatenwelt<br />
Mi 12-14, F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller - Flur<br />
Do 10-12, Raum: F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Matthias Haake<br />
081447 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Severer<br />
Mo 10-12, F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller<br />
Di 10-12, F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller<br />
Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081451 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Demosthenes<br />
Mi 16-20, F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG-Foyer<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Johannes Engels<br />
081466 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die griechischrömische<br />
Historiographie und Biographie als Quellengattungen<br />
Di 14-16, F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller-Flur<br />
Mi 14-16, F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller-Flur<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Martin Fell<br />
081470 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen und Sparta im<br />
5./4. Jh. v.Chr. – vom Freund zum Feind<br />
Do 12-14 F 234<br />
Do 14-16 F 029<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081485 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: griechisch<br />
Zeit und Raum: siehe HISLSF<br />
Beginn: 10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081490 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: römisch<br />
Zeit und Raum: siehe HISLSF<br />
Beginn: 10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Einführungsmodul Mittelalterliche Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
081710 Einführungvorlesung: Das Mittelalter<br />
Di 8-10, Raum: F 2<br />
2
Proseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Die Teilnahme an den Proseminaren für Alte, Mittlere und Neuere Geschichte wird<br />
durch ein auf Wahlgängen beruhendes Verteilverfahren geregelt.<br />
Dieses wird für die Proseminare in Alter Geschichte vom Seminar für Alte Geschichte,<br />
für die Proseminare in Mittlerer und Neuerer Geschichte vom Historischen Seminar<br />
durchgeführt.<br />
Es wird auf die entsprechenden Hinweise zur Durchführung der Verteilverfahren hingewiesen.<br />
Um Verzögerungen bei der Zuteilung zu vermeiden, wird darum gebeten,<br />
diese Hinweise ohne Abweichungen zu befolgen.<br />
Der erste Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10 Uhr, bis Mittwoch, den 13.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 12.00 Uhr, an der<br />
Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Der zweite Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10.00 Uhr, bis Donnerstag, den 13.10.<strong>201</strong>0, 12.00 Uhr, an<br />
der Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.10.<strong>201</strong>0, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Dr. Torsten Hiltmann<br />
081834 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Die Geburt<br />
Europas im Frühmittelalter<br />
Do 10-12 und Do 14-16 in Raum: F 030, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
081849 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte:<br />
„Verfassung“ und „politische Kultur“ im Mittelalter<br />
Mittwoch 8-12, Raum: F 33, Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Nils Bock, M.A.<br />
081853 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Hof und<br />
höfische Kultur im Mittelalter<br />
Di. 10-12h in Raum F 029 und Di. 14-16h in Raum F 153, Beginn: 18.10.<br />
Jan Clauß, M.A.<br />
081868 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Auswärtige<br />
Beziehungen und Kulturpolitik unter Karl dem Großen<br />
Mi 12-14 und Mi 16-18, Raum: F 030, Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Christian Scholl<br />
081872 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Juden im<br />
mittelalterlichen Reich<br />
3
Do 12-14 und 16-18, Raum: F 029, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Károly Goda<br />
081887 Proseminar: Westmittel- und Ostmitteleuropa im Spätmittelalter: Territorien und<br />
Städte im Vergleich<br />
Mo 10−12, Die 10−12, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Königsstraße 46,<br />
Sitzungszimmer, Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Alhedydis Plassmann<br />
082879 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte:<br />
Königserhebung und Königswahl im Mittelalter<br />
Mi 12- 14 in Raum F 3, Fr 12-14 in Raum ULB 101, Beginn: 26.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Einführungsmodul Neuere Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister<br />
081758 Einführungsvorlesung Neuere und Neueste Geschichte<br />
Mi 16-18<br />
Raum: SP 7<br />
Proseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Die Teilnahme an den Proseminaren für Alte, Mittlere und Neuere Geschichte wird<br />
durch ein auf Wahlgängen beruhendes Verteilverfahren geregelt.<br />
Dieses wird für die Proseminare in Alter Geschichte vom Seminar für Alte Geschichte,<br />
für die Proseminare in Mittlerer und Neuerer Geschichte vom Historischen Seminar<br />
durchgeführt.<br />
Es wird auf die entsprechenden Hinweise zur Durchführung der Verteilverfahren hingewiesen.<br />
Um Verzögerungen bei der Zuteilung zu vermeiden, wird darum gebeten,<br />
diese Hinweise ohne Abweichungen zu befolgen.<br />
Der erste Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10 Uhr, bis Mittwoch, den 13.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 12.00 Uhr, an der<br />
Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Der zweite Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10.00 Uhr, bis Donnerstag, den 13.10.<strong>201</strong>0, 12.00 Uhr, an<br />
der Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.10.<strong>201</strong>0, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Tim Neu, M.A.<br />
4
081891 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Gegen Tyrannei und Korruption<br />
Republiken und Republikanismus in der Frühen Neuzeit<br />
Mo 12:00-14:00 und Mo 16:00-18:00, Raum: F 029, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Debora Gerstenberger M.A.<br />
081910 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Geschichte der Stadt in<br />
Lateinamerika<br />
Mi 10-12 in Raum S 10, Mi 14-16 in Raum ULB 101, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081906 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die USamerikanische<br />
Revolution: „Geschichte der Un<strong>ab</strong>hängigwerdung der vereinigten Kolonien“ in<br />
Nordamerika, 1760-1790<br />
Di. 10-12, Mi. 10-12, Raum: F 030, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081978 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Es wird kalt.<br />
Polarforschung im 19. Jahrhundert<br />
Dienstag 14-18 Uhr, Raum: F 104, Beginn 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Thomas Tippach<br />
081925 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Der preußische<br />
Verfassungskonflikt<br />
Di 12-14 in Raum ULB 101, Mi 12-14 in Raum F 102, Beginn 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
081930 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Katholiken im<br />
Kaiserreich: Die Bistümer Münster und Paderborn 1871-1914<br />
Mo 14-18 Uhr, F3 Erdgeschoss, Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Stefan Lehr<br />
081959 Proseminar: Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung in und aus Osteuropa im<br />
20. Jahrhundert<br />
Do 8-12, Raum: F 33, Beginn 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Daniel Schmidt<br />
081944 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Krise und Untergang der<br />
Weimarer Republik 1929-1933<br />
Di 10-12 in Raum F 6, Do 10-12 in Raum ULB 1, Beginn 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Christoph Lorke<br />
081963 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Zwischen Abgrenzung und<br />
Verflechtung: Deutsch-deutsche Geschichte 1945-1990<br />
Mo 12-16, Raum: F 043, Beginn 17.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Ergänzungsmodul (Alte Geschichte)<br />
Vorlesungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
5
081322 Vorlesung: Die griechische Staatenwelt im 5. Jahrhundert v. Chr.<br />
Fr 10-12, Raum: F 043, Beginn 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Johannes Engels<br />
081337 Vorlesung: Griechische Geschichte im Zeitalter Philipps II. und Alexander des<br />
Großen<br />
Mi 10-12, Raum: F 043, Beginn 19.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081341 Vorlesung: Caesar und Augustus<br />
Mi 12-14, Raum: F 2, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Kurse<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Dr. Michael Jung<br />
081409 Kurs: Die griechische Staatenwelt von den Perserkriegen bis zur Schlacht Leuktra<br />
Do 16-18, Raum: F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 1.OG, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081394 Kurs:<br />
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
Ergänzungsmodul (Mittelalterlichen Geschichte)<br />
Vorlesungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Prof. Dr. Peter Johanek<br />
081724 Vorlesung: Epochen der Papstgeschichte im Mittelalter<br />
Fr 10 – 12<br />
Raum: H 4<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
081739 Vorlesung: Geschichte Spaniens im Mittelalter<br />
Di 10-12<br />
Raum: F 2<br />
Kurse<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Torben Gebhardt, M.A.<br />
081982 Kurs zur mittelalterlichen Geschichte<br />
Do 18-20, Raum: H 2, Beginn. 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
081997 Kurs: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der spätmittelalterlichen Stadt<br />
Mi 10-12 Uhr, Raum: S 2, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Károly Goda<br />
6
082864 Kurs: Adventus, Extroitus and Processio: Ceremonial Culture in Late Medieval<br />
Western and Central Europe<br />
Di 12-14, Raum: S 2, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Ergänzungsmodul (Neuere und neueste Geschichte)<br />
Vorlesungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Prof. Dr. Peter Oestmann<br />
030167 Deutsche Rechtsgeschichte<br />
Di 8-10, Raum: JUR 3<br />
Prof. Dr. Peter Oestmann<br />
030410 Strafrechtsgeschichte<br />
Mi 8-10, Raum: J 5<br />
Jun.Prof. Dr. Matthias Pohlig<br />
081762 Öffentlichkeit in der Frühen Neuzeit<br />
Mi 10-12, Raum: H 2<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
081777 Das Reich in Europa 1648-1806<br />
Mi 10-12, Raum: F 2<br />
Prof. Dr. Heike Bungert/Prof. Dr. Silke Hensel<br />
081781 Vorlesung: Begegnung zweier Welten Indianer in den Amerikas von der ersten<br />
Besiedlung bis heute<br />
Do. 10-12 Uhr, Raum: HHÜ, Hüfferstraße 1, Beginn 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Martina Winkler<br />
081796 Vorlesung: Nation und Nationalismus in Ostmitteuropa (18.-20- Jh)<br />
Mo 10-12, Raum: F 5<br />
Jun. Prof. Dr. Martin Uebele<br />
081800 Vorlesung: Geschichte der Globalisierung seit 1850<br />
Di 14:00-16:00, Raum: F 2, Fürstenberghaus; Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister<br />
081815 Vorlesung: Sozialstaat und Gesellschaft seit 1880<br />
Di 16-18, Raum: Audi Max, Beginn 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Uwe Spiekermann<br />
081820 Vorlesung: Die Weimarer Republik. Wirtschaft – Gesellschaft – Kultur<br />
Di 12-14, Raum: F 2<br />
Kurse<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Christian Müller<br />
7
082003 Kurs: Mechanismen des Internationalismus – Aspekte einer Globalgeschichte der<br />
internationalen Ordnung, 1848-1949<br />
Mo 14-16, Raum: H 4, Beginn 17.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Christine Fertig<br />
08<strong>201</strong>8 Kurs: Familie, Verwandtschaft und Haushalt in der Neuzeit<br />
Mo 14-16, Raum: F 6, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Rüdiger Schmidt<br />
082022 Kurs zur Neueren und Neuesten Geschichte: Deutsche Außenpolitik 1871-1939<br />
Montag 18-20 h, Raum: F 2, Beginn: zweite Vorlesungswoche<br />
Christine Fertig<br />
082037 Kurs: Arbeiteralltag und Arbeiterkultur in Kaiserreich und Weimarer Republik<br />
Mo 10-12, Raum: F 6, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Modul zu den Historischen Grundwissenschaften<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Dr. Jens Heckl<br />
082792 Übung: Paläographische Übungen an ausgewählten deutschsprachigen Texten des 16.<br />
bis 19. Jahrhunderts<br />
Mittwoch 16-18 Uhr im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen (Staatsarchiv Münster)<br />
Bohlweg 2, 48147 Münster<br />
Dr. S<strong>ab</strong>ine Happ<br />
082587 Übung: Paläographische Übung zur Geschichte der Universität Münster im 19. und<br />
20. Jahrhundert<br />
Do 14-16, Raum: Sitzungszimmer im Universitätsarchiv, Leonardo-Campus 21, Beginn:<br />
13.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
082663 Übung: Der Historiker im Interview<br />
Mittwoch 10-12 Uhr, Raum: F 104<br />
Dr. Thomas Tippach<br />
082811Übung: Kartographie für Historiker<br />
Mi 14-16, Raum: ULB 1, Beginn: 19.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Károly Goda<br />
082850 Übung: Hilfswissenschaften zur spätmittelalterlichen Sozialgeschichte: Diplomatik,<br />
Sphragistik, Heraldik und Genealogie<br />
Mo 12−14, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Königsstraße 46, Sitzungszimmer<br />
Beginn: 10.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Lektüremodul<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
N.N.<br />
082276 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 8-10, Raum: F 042<br />
8
N.N.<br />
082280 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 12-14, Raum: ES 227<br />
N.N.<br />
082295 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 16-18, Raum: F 042<br />
N.N.<br />
082300 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Fr 14-16, Raum: F 042<br />
N.N.<br />
082371 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Mo 16-18, Raum: F 030<br />
N.N.<br />
082386 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Di 10-12, Raum: ULB 202<br />
N.N.<br />
082390 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Di 14-16, Raum: ULB <strong>201</strong><br />
N.N.<br />
082405 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Mi 10-12, Raum: ULB 1<br />
N.N.<br />
082659 Übung:»Das Museum als Erkenntnisort« – Schreiben über Ausstellungen<br />
Mittwoch 16-18 Uhr, Raum: ES 227<br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081629 Quellen zur Geschichte der Christenverfolgung<br />
Do 14-16, Raum: F 3<br />
Dr. Arnulf Jürgens<br />
082606 Französischsprachige Quellen: Das französische Deutschland-Bild im 18.und<br />
19.Jahrhundert. Sachanalyse und sprachliche Kompetenz.<br />
Di 10 - 12, Raum: F 229, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Thies Schulze<br />
082481 Übung „Quellen zur Geschichte der Weimarer Republik“<br />
Mittwoch, 10-12 Uhr, Raum: SCH 122.<strong>201</strong>, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Felicity Jensz<br />
082955 Übung: Deutsche Freidenker in Amerika im 19. Jahrhundert<br />
Do 16-18, Raum: Johannisstr. 12-20, ES 227<br />
Beginn: zweite Semester Woche<br />
9
Modulbeschreibungen für den Bachelorstudiengang (BA 2-Fach; BA KiJu)<br />
(Prüfungsordnungen 2005; Beginn des Studiums vor dem <strong>Wintersemester</strong> <strong><strong>201</strong>1</strong>/12)<br />
Einführungsmodul Alte Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Lehrende des Seminars für Alte Geschichte:<br />
081318 Vorlesung: Einführung in die Alte Geschichte<br />
Mo 14-16, H 306 (Audi Max), Johannisstraße 12-20, Englisches Seminar, 2. OG Beginn:<br />
17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Proseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Die Teilnahme an den Proseminaren für Alte, Mittlere und Neuere Geschichte wird<br />
durch ein auf Wahlgängen beruhendes Verteilverfahren geregelt.<br />
Dieses wird für die Proseminare in Alter Geschichte vom Seminar für Alte Geschichte,<br />
für die Proseminare in Mittlerer und Neuerer Geschichte vom Historischen Seminar<br />
durchgeführt.<br />
Es wird auf die entsprechenden Hinweise zur Durchführung der Verteilverfahren hingewiesen.<br />
Um Verzögerungen bei der Zuteilung zu vermeiden, wird darum gebeten,<br />
diese Hinweise ohne Abweichungen zu befolgen.<br />
Der erste Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10 Uhr, bis Mittwoch, den 13.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 12.00 Uhr, an der<br />
Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Der zweite Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10.00 Uhr, bis Donnerstag, den 13.10.<strong>201</strong>0, 12.00 Uhr, an<br />
der Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.10.<strong>201</strong>0, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081413 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Hadrian<br />
Mi 12-14, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Do 14-16, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081428 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Kaiser Vespasian und<br />
die Begründung einer neuen Dynastie<br />
Mi 8-10, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Fr 8-10, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
10
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081432 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Rom und die<br />
hellenistische Staatenwelt<br />
Mi 12-14, F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller - Flur<br />
Do 10-12, F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Matthias Haake<br />
081447 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Severer<br />
Mo 10-12, F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller<br />
Di 10-12, F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller<br />
Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081451 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Demosthenes<br />
Mi 16-20, F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG-Foyer<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Johannes Engels<br />
081466 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die griechischrömische<br />
Historiographie und Biographie als Quellengattungen<br />
Di 14-16, F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller-Flur<br />
Mi 14-16, F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller-Flur<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Martin Fell<br />
081470 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen und Sparta im<br />
5./4. Jh. v.Chr. – vom Freund zum Feind<br />
Do 12-14 F 234<br />
Do 14-16 F 029<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081485 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: griechisch<br />
Zeit und Raum: siehe HISLSF<br />
Beginn: 10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081490 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: römisch<br />
Zeit und Raum: siehe HISLSF<br />
Beginn: 10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Kurse<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Dr. Michael Jung:<br />
081409 Kurs: Die griechische Staatenwelt von den Perserkriegen bis zur Schlacht von<br />
Leuktra<br />
Do 16-18, F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 1. OG, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
11
N.N.<br />
081394 Kurs:<br />
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081614 Übung: Die Juden im Imperium Romanum<br />
Do 16-18, F 3, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG<br />
Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081629 Übung: Quellen zur Geschichte der Christenverfolgungen<br />
Do 14-16, F 3, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG<br />
Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Michael Jung<br />
081633 Übung: Die homerische Gesellschaft<br />
Do 18-20, F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann:<br />
081648 Rom und Germanien<br />
Di 16-18, F 4, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081652 Übung zur alten Geschichte<br />
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
N.N.<br />
081667 Übung zur alten Geschichte<br />
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
N.N.<br />
081671 Übung: Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten<br />
Di 8-10, F 6, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Einführungsmodul Mittelalterliche Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
081710 Einführungvorlesung: Das Mittelalter<br />
12
Di 8-10, Raum: F 2<br />
Proseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Die Teilnahme an den Proseminaren für Alte, Mittlere und Neuere Geschichte wird<br />
durch ein auf Wahlgängen beruhendes Verteilverfahren geregelt.<br />
Dieses wird für die Proseminare in Alter Geschichte vom Seminar für Alte Geschichte,<br />
für die Proseminare in Mittlerer und Neuerer Geschichte vom Historischen Seminar<br />
durchgeführt.<br />
Es wird auf die entsprechenden Hinweise zur Durchführung der Verteilverfahren hingewiesen.<br />
Um Verzögerungen bei der Zuteilung zu vermeiden, wird darum gebeten,<br />
diese Hinweise ohne Abweichungen zu befolgen.<br />
Der erste Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10 Uhr, bis Mittwoch, den 13.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 12.00 Uhr, an der<br />
Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Der zweite Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10.00 Uhr, bis Donnerstag, den 13.10.<strong>201</strong>0, 12.00 Uhr, an<br />
der Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.10.<strong>201</strong>0, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Dr. Torsten Hiltmann<br />
081834 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Die Geburt<br />
Europas im Frühmittelalter<br />
Do 10-12 und Do 14-16, Raum: F 030, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
081849 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte:<br />
„Verfassung“ und „politische Kultur“ im Mittelalter<br />
Mittwoch 8-12, Raum: F 33, Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Nils Bock, M.A.<br />
081853 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte. Hof und<br />
höfische Kultur im Mittelalter<br />
Di. 10-12h in Raum F 029 und Di. 14-16h in Raum F 153, Beginn: 18.10.<br />
Jan Clauß, M.A.<br />
081868 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Auswärtige<br />
Beziehungen und Kulturpolitik unter Karl dem Großen<br />
Mi 12-14 und Mi 16-18 Raum: F 030, Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Christian Scholl<br />
13
081872 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Juden im<br />
mittelalterlichen Reich<br />
Do 12-14 und 16-18, Raum: F 029, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Károly Goda<br />
081887 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Westmittelund<br />
Ostmitteleuropa im Spätmittelalter: Territorien und Städte im Vergleich<br />
Mo 10−12, Die 10−12, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Königsstraße 46,<br />
Sitzungszimmer, Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Alhedydis Plassmann<br />
082879 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte:<br />
Königserhebung und Königswahl im Mittelalter<br />
Mi 12- 14 in Raum F 3, Fr 12-14 in Raum ULB 101, Beginn: 26.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Kurse<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Torben Gebhardt, M.A.<br />
081982 Kurs Mittelalterliche Geschichte<br />
Do 18-20, Raum: H 2, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
081997 Kurs: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der spätmittelalterlichen Stadt<br />
Mi 10-12 Uhr, Raum: S 2, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Károly Goda<br />
082864 Kurs: Adventus, Extroitus and Processio: Ceremonial Culture in Late Medieval<br />
Western and Central Europe<br />
Di 12-14, Raum: S 2, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
N.N.<br />
082276 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 8-10, Raum: F 042<br />
N.N.<br />
082280 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 12-14, Raum: ES 227<br />
N.N.<br />
082295 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 16-18, Raum: F 042<br />
N.N.<br />
082300 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Fr 14-16, Raum: F 042<br />
14
Einführungsmodul Neuere Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister<br />
081758 Einführungsvorlesung Neuere Geschichte<br />
Mi 16-18, Raum: SP 7<br />
Proseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Die Teilnahme an den Proseminaren für Alte, Mittlere und Neuere Geschichte wird<br />
durch ein auf Wahlgängen beruhendes Verteilverfahren geregelt.<br />
Dieses wird für die Proseminare in Alter Geschichte vom Seminar für Alte Geschichte,<br />
für die Proseminare in Mittlerer und Neuerer Geschichte vom Historischen Seminar<br />
durchgeführt.<br />
Es wird auf die entsprechenden Hinweise zur Durchführung der Verteilverfahren hingewiesen.<br />
Um Verzögerungen bei der Zuteilung zu vermeiden, wird darum gebeten,<br />
diese Hinweise ohne Abweichungen zu befolgen.<br />
Der erste Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10 Uhr, bis Mittwoch, den 13.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 12.00 Uhr, an der<br />
Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Der zweite Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10.00 Uhr, bis Donnerstag, den 13.10.<strong>201</strong>0, 12.00 Uhr, an<br />
der Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.10.<strong>201</strong>0, nachmittags (am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen bzw. neueren<br />
Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses (Flur zwischen<br />
Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Tim Neu, M.A.<br />
081891 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: : Gegen Tyrannei und<br />
Korruption Republiken und Republikanismus in der Frühen Neuzeit<br />
Mo 12:00-14:00, Mo 16:00-18:00, Raum: F 029, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Debora Gerstenberger, M.A.<br />
081910 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Geschichte der Stadt in<br />
Lateinamerika<br />
Mi 10-12 in Raum S 10, 14-16 in Raum ULB 101, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081906 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die USamerikanische<br />
Revolution: „Geschichte der Un<strong>ab</strong>hängigwerdung der vereinigten Kolonien“ in<br />
Nordamerika, 1760-1790<br />
Di. 10-12, Mi. 10-12 Raum: F 030, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
15
N.N.<br />
081978 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Es wird kalt.<br />
Polarforschung im 19. Jahrhundert<br />
Di 14-18 Uhr, Raum: F 104, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Thomas Tippach<br />
081925 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Der preußische<br />
Verfassungskonflikt<br />
Di 12-14 in Raum ULB 101, Mi 12-14 in Raum F 102, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
081930 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Katholiken im<br />
Kaiserreich: Die Bistümer Münster und Paderborn 1871-1914<br />
Mo 14-18 Uhr, Raum: F3 Erdgeschoss, Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Stefan Lehr<br />
081959 Proseminar: Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung in und aus Osteuropa im<br />
20. Jahrhundert<br />
Do 8-12, Raum: F 33, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Daniel Schmidt<br />
081944 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Krise und Untergang der<br />
Weimarer Republik 1929-1933<br />
Di 10-12 in Raum F 6, Do 10-12 in Raum ULB 1, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Christoph Lorke<br />
081963 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Zwischen Abgrenzung und<br />
Verflechtung: Deutsch-deutsche Geschichte 1945-1990<br />
Mo 12-16, Raum: F 043, Beginn: 17.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Kurse<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Christian Müller<br />
082003 Kurs: Mechanismen des Internationalismus – Aspekte einer Globalgeschichte der<br />
internationalen Ordnung, 1848-1949<br />
Mo 14-16, Raum: H 4, Beginn: 17.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Christine Fertig<br />
08<strong>201</strong>8 Kurs: Familie, Verwandtschaft und Haushalt in der Neuzeit<br />
Mo 14-16, Raum: F 6, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Rüdiger Schmidt<br />
082022 Kurs zur Neueren und Neuesten Geschichte: Deutsche Außenpolitik 1871-1939<br />
Montag 18-20 h, Raum: F 2, Beginn: zweite Vorlesungswoche<br />
Christine Fertig<br />
082037 Kurs: Arbeiteralltag und Arbeiterkultur in Kaiserreich und Weimarer Republik<br />
Mo 10-12, Raum: F 043, Beginn 17.10.<strong>201</strong>0<br />
16
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
N.N.<br />
082371 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Mo 16-18, Raum: F 030<br />
N.N.<br />
082386 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Di 10-12, Raum: ULB 202<br />
N.N.<br />
082390 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Di 14-16, Raum: ULB <strong>201</strong><br />
N.N.<br />
082405 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Mi 10-12, Raum: ULB 1<br />
Geschichtswissenschaftliches Grundlagenmodul<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083469 Einführung in die Geschichtskultur<br />
Do 14-16, Raum: F 1, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Methodische Übungen<br />
Prof. Dr. Silke Hensel, Matthias Friedmann, Henrik Kipshagen, Frank Schlegel, Philipp<br />
Spreckels,<br />
082261 Übung: Geschichte im Radio: Migration in globalhistorischer Perspektive<br />
Do. 16-18 Uhr, Raum: F 102, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Jens Heckl<br />
082792 Übung: Paläographische Übungen an ausgewählten deutschsprachigen Texten des 16.<br />
bis 19. Jahrhunderts<br />
Mittwoch 16-18 Uhr im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen (Staatsarchiv Münster)<br />
Bohlweg 2, 48147 Münster<br />
N.N.<br />
082663 Übung: Der Historiker im Interview<br />
Mittwoch 10-12 Uhr, Raum: F 104<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
082807 Übung: Adel im Film<br />
Blocktermine: Einführungssitzungen Mo., 17.10 und 24.10., jeweils 16-18 in Raum ULB 101;<br />
Arbeitssitzungen Fr. 18.11., 16.12., 20.1., jeweils 10-17, Raum: F 102<br />
17
Dr. Markus Köster<br />
082496 Übung: Von Caligari bis Hitler – Zur Kultur- und Politikgeschichte des Films in der<br />
Weimarer Republik<br />
Donnerstag, 18-20 Uhr, vierzehntägig; sowie Blockveranstaltung vom 13.-15.1.<strong>201</strong>2<br />
Ort: LWL-Medienzentrum für Westfalen und Akademie Franz Hitze Haus<br />
Anmeldung erforderlich: markus.koester@uni-muenster.de<br />
Beginn: 27.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
082659 Übung:»Das Museum als Erkenntnisort« – Schreiben über Ausstellungen<br />
Mittwoch 16-18 Uhr, Raum: ES 227<br />
Dr. Thomas Tippach<br />
082811Übung: Kartographie für Historiker<br />
Mi 14-16, Beginn 19.10. <strong><strong>201</strong>1</strong>, Raum: ULB 1<br />
Dr. Wolfhart Beck<br />
083602 Übung: Auf den Spuren der Schulgeschichte – Archivpädagogische Angebote im<br />
Lernort Landesarchiv<br />
14-tägl. Fr 14-17, NW-Landesarchiv, Abt. Westfalen, Bohlweg 2, Beginn 21.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083617 Übung: Virtuelle Geschichte<br />
Fr 8-10, R 304, Beginn 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083621 Übung Film - + Geschichtswerkstatt<br />
Fr 10-12, R 304, Beginn 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Markus Drüding, M.A./Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083693 Übung zur Vorlesung: Einführung in die Geschichtskultur<br />
Di 12-14, R 304, Beginn 18.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Markus Drüding, M.A./Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083799 Übung zur Vorlesung: Einführung in die Geschichtskultur<br />
Di 18-20, R. 304 Beginn 18.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Markus Drüding, M.A./Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083894 Übung zur Vorlesung: Einführung in die Geschichtskultur<br />
Do 16-18, R 304, Beginn 20.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Sebastian Wemhoff, M.A./Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083708 Übung zu Vorlesung: Einführung in die Geschichtskultur<br />
Mi 12-14, R 304, Beginn 19.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Sebastian Wemhoff, M.A./Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083803 Übung zu Vorlesung: Einführung in die Geschichtskultur<br />
Mi 16-18, R. 304, Beginn 19.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Sebastian Wemhoff, M.A./Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083909 Übung zu Vorlesung: Einführung in die Geschichtskultur<br />
18
Do 10-12, R. 304 Beginn 20.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Károly Goda<br />
082850 Übung: Hilfswissenschaften zur spätmittelalterlichen Sozialgeschichte: Diplomatik,<br />
Sphragistik, Heraldik und Genealogie<br />
Mo 12−14, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Königsstraße 46, Sitzungszimmer<br />
Beginn: 10.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul Alte Geschichte / Vertiefungsmodul zur sektoralen Geschichte:<br />
Griechische Geschichte<br />
Vorlesungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081322 Vorlesung: Die griechische Staatenwelt im 5. Jh. v.Chr.<br />
Fr 10-12, Raum: F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Hörsaaltrakt, 1. OG<br />
Beginn: 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Johannes Engels<br />
081337 Vorlesung: Griechische Geschichte im Zeitalter Philipps II. und Alexanders des<br />
Großen<br />
Mi 10-12, Raum: F 043, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller-Flur, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081538 Hauptseminar: Grenzen der Oikumene<br />
Di 14-16, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Johannes Engels<br />
081542 Hauptseminar: ‚Aristoteles Athenaion Politeia und die athenische Demokratie<br />
zwischen 403 und 322 v.Chr.„<br />
Di 18-20, Raum: F 102, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 1. OG, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Dr. Michael Jung<br />
081633 Übung: Die homerische Gesellschaft<br />
Do 18-20, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul Alte Geschichte / Vertiefungsmodul zur sektoralen Geschichte:<br />
Römische Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081341 Vorlesung: Caesar und Augustus<br />
Mi 12-14, Raum: F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Hörsaaltrakt, 1. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
19
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081538 Hauptseminar: Grenzen der Oikumene<br />
Di 14-16, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081519 Hauptseminar: Verfassungsrecht, Verfassungspraxis und Verfassungsentwicklung in<br />
der römischen Republik<br />
Fr 12-14, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG, Beginn: 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
Hauptseminar: Das römische Kleinasien<br />
Mi 14-16, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081614 Übung: Die Juden im Imperium Romanum<br />
Do 16-18,Raum: F 3, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081629 Übung: Quellen zur Geschichte der Christenverfolgungen<br />
Do 14-16, Raum: F 3, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081648 Übung: Rom und Germanien<br />
Di 16-18, Raum: F 4, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22 Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
N.N.<br />
081671 Übung: Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten<br />
Di 8-10, F 6, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul zur Mittelalterlichen Geschichte / Vertiefungsmodul zur sektoralen<br />
Geschichte: Religion und Politik<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Peter Johanek<br />
081724 Vorlesung: Epochen der Papstgeschichte im Mittelalter<br />
Fr 10 – 12<br />
Raum: H4<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
PD Dr. Thomas Bauer<br />
20
082041 Hauptseminar: Da ging er hin, ein neuer Konstantin - 'Staat' und Kirche im<br />
Frankenreich der Merowinger und Karolinger<br />
Fr. 8:30-10, Raum: Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, Beginn: 14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Alhedydis Plassmann<br />
082883 Hauptseminar: Christianisierung und Akkulturation im frühen Mittelalter<br />
Mi 16-18, Raum: F 234, Vorbesprechung: 26.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> / Beginn: 2.11.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Dr. Patrick Baker<br />
083951 Lektüreübung: Athen und Jerusalem. Zur Verhandlung zwischen klassischer Kultur<br />
und christlicher Zivilisation<br />
Mi 12-14, Raum: R. 304, Bogenstr. 15/16<br />
Philipp Stenzig<br />
083928 Übung: Magister sententiarum – Petrus Lombardus und seine Epoche<br />
Mo. 16-18 Uhr, Raum: Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit,<br />
Bogenstraße 15/16, Bibliotheksraum im 3. Stock (R. 304), Beginn 10.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
max. Teilnehmerzahl: 20<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
082314 Übung: Transkulturelle Geschichte im Mittelalter: Juden zwischen christlicher und<br />
islamischer Herrschaft<br />
Mi 16-18, Raum: F 104<br />
Dr. Karsten Igel<br />
082333 Übung: Religiosität in der spätmittelalterlichen Stadt – Ausstellungsprojekt<br />
Osn<strong>ab</strong>rück um 1500<br />
Mi 14-16 Uhr, Raum: Institut für vergleichende Städtegeschichte, Beginn: 19. Oktober<br />
Vertiefungsmodul zur Mittelalterlichen Geschichte / Vertiefungsmodul zur sektoralen<br />
Geschichte: Europäische Dimensionen Mittelalterlicher Politik und Kultur<br />
Vorlesung:<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
081739 Vorlesung: Geschichte Spaniens im Mittelalter<br />
Di 10-12, Raum: F 2<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
082056 Hauptseminar: Ritterorden und Rittergesellschaften<br />
Mi 10-12, Raum: F 3, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Kay Peter Jankrift<br />
082060 Hauptseminar II: Friedensverhandlungen und –verträge im Mittelalter<br />
(A2, B1-5, B8, C2)<br />
21
Blockseminar, 7.-9. Februar <strong>201</strong>2, jeweils 10.00-17.00 Uhr s.t., Raum: F 102<br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
082314 Übung: Transkulturelle Geschichte im Mittelalter: Juden zwischen christlicher und<br />
islamischer Herrschaft<br />
Mi 16-18, Raum: F 104<br />
Dr. Liliya Berezhnaya, Jun.Prof. Dr. Michael Grünbart<br />
082329 Übung: Byzanz als Idee im osteuropäischen Raum<br />
Mi 12-14, Raum: ES 24<br />
PD Dr. Alheydis Plassmann<br />
082898 Übung: Herrscherlob und Tyrannenschelte in der englischen Geschichtsschreibung<br />
des 12. Jahrhunderts<br />
Fr 14-16, Raum: F 153, Beginn: 4.11.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul Frühe Neuzeit I / Vertiefungsmodul zur sektoralen Geschichte: Frühe<br />
Neuzeit I<br />
Vorlesung<br />
Jun.Prof. Matthias Pohlig<br />
081762 Öffentlichkeit in der Frühen Neuzeit<br />
Mi 10-12, Raum: H 2<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger<br />
082080 Hauptseminar II Klüngel, Korruption, Klienten: Informelle Strukturen in der Frühen<br />
Neuzeit.<br />
Mo 14-16, Raum: F 102<br />
Prof. Dr. Peter Oestmann, Sandro Wiggerich<br />
031675 Hauptseminar II: Das Gericht der Universität – Die Universität als Gericht<br />
Blockseminar vom 13. bis zum 15. Februar <strong>201</strong>2<br />
Vorbesprechung: Dienstag, 12. Juli, 15.30 Uhr in der Rechtshistorischen Bibliothek<br />
(Juridicum, J 406)<br />
Für diejenigen, die an der ersten Vorbesprechung nicht teilnehmen konnten, findet eine<br />
weitere Vorbesprechung statt.<br />
Eine vorherige Anmeldung wird erbeten an Sandro Wiggerich, wiggerich@uni-muenster.de<br />
Übung<br />
Philip Hoffmann-Rehnitz, M.A.<br />
082424 Übung: Krisen in der Frühen Neuzeit<br />
Mi 16-18 Uhr (14-tägig) plus Blockveranstaltung am 8./9. Februar <strong>201</strong>2, Raum: S 6<br />
22
Vertiefungsmodul Frühe Neuzeit II / Vertiefungsmodul zur sektoralen Geschichte:<br />
Frühe Neuzeit II<br />
Vorlesung<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
081777 Das Reich in Europa 1648-1806<br />
Mi 10-12, Raum: F 2<br />
Hauptseminar<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
082094 Geistliche Territorien im Alten Reich<br />
DI 10-12, Raum: F 33, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora / Dr. Michael Hecht<br />
082678 Übung/Exkursion: Residenzlandschaft Anhalt<br />
Termin: Woche vom 10.-14. Oktober (die genauen Daten werden in der Vorbesprechung<br />
mitgeteilt)<br />
Vorbesprechung: 14.7.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18 Uhr c.t., Raum: F 104<br />
Dr. Arnulf Jürgens<br />
082606 Französischsprachige Quellen: Das französische Deutschland-Bild im 18.und<br />
19.Jahrhundert. Sachanalyse und sprachliche Kompetenz.<br />
Di 10-12, Raum: F 229, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Philip Hoffmann-Rehnitz, M.A.<br />
082424 Übung: Krisen in der Frühen Neuzeit<br />
Mi 16-18 Uhr (14-tägig) plus Blockveranstaltung am 8./9. Februar <strong>201</strong>2, Raum: S 6<br />
Dr. Sita Steckel/Dr. Astrid Reuter<br />
082773 Übung: The Making of Religion Die Ausdifferenzierung von Religion in<br />
Vormoderne und Moderne<br />
Mi 10-12, Raum: S1, Schlossplatz 2, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Art der Veranstaltung: als Seminar (Soziologie) oder Übung (Geschichte, LN oder TN)<br />
wählbar<br />
Anmeldung unter sita.steckel@gmx.net nötig.<br />
Vertiefungsmodul Frühe Neuzeit III / Vertiefungsmodul zur sektoralen Geschichte:<br />
Deutsche Rechtsgeschichte<br />
Vorlesungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Peter Oestmann<br />
030167 Vorlesung: Deutsche Rechtsgeschichte<br />
Di 8-10, Raum: JUR 3 Juridicum, Beginn: 11.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
23
Prof. Dr. Peter Oestmann<br />
030410 Vorlesung: Strafrechtsgeschichte<br />
Mi 8-10, Raum: J 5 Juridicum, Beginn: 12.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Peter Oestmann, Sandro Wiggerich<br />
031675 Hauptseminar II: Das Gericht der Universität – Die Universität als Gericht<br />
Blockseminar vom 13. bis zum 15. Februar <strong>201</strong>2<br />
Vorbesprechung: Dienstag, 12. Juli, 15.30 Uhr in der Rechtshistorischen Bibliothek<br />
(Juridicum, J 406)<br />
Für diejenigen, die an der ersten Vorbesprechung nicht teilnehmen konnten, findet eine<br />
weitere Vorbesprechung statt.<br />
Eine vorherige Anmeldung wird erbeten an Sandro Wiggerich, wiggerich@uni-muenster.de<br />
Prof. Dr. Peter Oestmann, Sandro Wiggerich<br />
031675 Rechtshistorisches Seminar: Das Gericht der Universität – Die Universität als Gericht<br />
Blocktermin s.A., Raum: siehe HISLSF<br />
Übung<br />
Sandro Wiggerich<br />
031660 Rechtshistorische Methodenübung<br />
Di 10-12, Raum: JUR 406, Beginn: 11.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul Frühe Neuzeit IV / Vertiefungsmodul zur sektoralen Geschichte:<br />
Geschichte der Amerikas: Begegnung zweier Welten<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Heike Bungert/Prof. Dr. Silke Hensel<br />
081781 Vorlesung: Begegnung zweier Welten Indianer in den Amerikas von der ersten<br />
Besiedlung bis heute<br />
Do. 10-12 Uhr, Raum: HHÜ, Hüfferstraße 1, Beginn 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082128 Hauptseminar: Die Beziehungen zwischen Indianern und Weißen in den USA<br />
Di. 14-16, Raum: ULB 1, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082113 Hauptseminar II: Vom internen Kolonialismus zum plurikulturellen Staat Indianer<br />
in Lateinamerika im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Mi. 10-12 Uhr, Raum: F 153, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
24
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082439 Übung: Rassismustheorien<br />
Zeit: Do. 14-16 Uhr, Raum: F 102, Beginn 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082443 Übung: Image(s) of Native Americans in Film<br />
Do 16-19, Raum: F 33, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul zur Geschichte des 19. / 20. Jahrhunderts / Vertiefungsmodul zur<br />
sektoralen Geschichte: Geschichte der Amerikas: Begegnung zweier Welten<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Heike Bungert/Prof. Dr. Silke Hensel<br />
081781 Vorlesung: Begegnung zweier Welten Indianer in den Amerikas von der ersten<br />
Besiedlung bis heute<br />
Do. 10-12 Uhr, Raum: HHÜ, Hüfferstraße 1, Beginn 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082113 Hauptseminar: Vom internen Kolonialismus zum plurikulturellen Staat Indianer in<br />
Lateinamerika im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Mi. 10-12 Uhr, Raum: F 153, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082128 Hauptseminar: Die Beziehungen zwischen Indianern und Weißen in den USA<br />
Di. 14-16, Raum: ULB 1, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082439 Übung: Rassismustheorien<br />
Zeit: Do. 14-16 Uhr, Raum: F 102, Beginn 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Stephan Ruderer<br />
082553 Übung: Religion und Politik in Lateinamerika in der zweiten Hälfte des 20.<br />
Jahrhunderts<br />
Di. 14-16 Uhr und ! Tagung 9.- 10. 12. <strong><strong>201</strong>1</strong>, Raum: ULB 202, Beginn: 11.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082443 Übung: Image(s) of Native Americans in Film<br />
Do. 16-19, Raum: F 33, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Anja-Maria Bassimir/ Anne Overbeck<br />
082568 Übung: All <strong>ab</strong>out Abortion and Gay Rights Die konservative Wende in den USA<br />
von Nixon bis Reagan<br />
25
Mi 10-12, Raum: F 029, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Felicity Jensz<br />
082955 Übung: Deutsche Freidenker in Amerika im 19. Jahrhundert<br />
Do 16-18, Raum: Johannisstr. 12-20, ES 227<br />
Beginn: zweite Semester Woche<br />
(Die Übung ist nur im Rahmen des Vertiefungsmoduls zur Geschichte des 19. / 20.<br />
Jahrhunderts / Vertiefungsmoduls zur sektoralen Geschichte: Geschichte der Amerikas:<br />
Begegnung zweier Welten zu studieren und nicht im Rahmen des Vertiefungsmoduls<br />
Frühe Neuzeit IV / Vertiefungsmoduls zur sektoralen Geschichte: Geschichte der<br />
Amerikas: Begegnung zweier Welten.)<br />
Fortsetzung des Vertiefungsmoduls zur Geschichte des 19. / 20. Jahrhunderts /<br />
Vertiefungsmodul zur sektoralen Geschichte: Geschichte des Rassismus (Fortsetzung<br />
des Moduls aus dem Sommersemester <strong><strong>201</strong>1</strong>)<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082113 Hauptseminar: Vom internen Kolonialismus zum plurikulturellen Staat Indianer in<br />
Lateinamerika im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Mi. 10-12 Uhr, Raum: F 153, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082128 Hauptseminar: Die Beziehungen zwischen Indianern und Weißen in den USA<br />
Di. 14-16, Raum: ULB 1, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082439 Übung: Rassismustheorien<br />
Zeit: Do. 14-16 Uhr, Raum: F 102, Beginn 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> Raum:<br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082443 Übung: Image(s) of Native Americans in Film<br />
Do. 16-19, Raum: F 33, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul zur Geschichte des 19./20. Jahrhunderts / Vertiefungsmodul zur<br />
sektoralen Geschichte: Geschichte der Internationalen Beziehungen<br />
Vorlesung<br />
Dr. Martina Winkler<br />
081796 Vorlesung: Nation und Nationalismus in Ostmitteuropa (18.-20. Jh)<br />
Mo 10-12, Raum: F 5<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
26
Prof. Dr. Rolf Ahmann<br />
082170 Hauptseminar II: Ansätze und Probleme des „post-conflict“ und „post-colonial“<br />
nation-building im 20. Jahrhundert<br />
Di 14-16, Raum: F 3<br />
Dr. Martina Winkler<br />
082109 Hauptseminar II: How to Lie with maps – zur Geschichte der Kartographie<br />
Mi 10-12, Raum: Sitzungszimmer des IStGs, Königsstr. 46<br />
PD Dr. Michael Schwartz<br />
082936 Italienische Einheit: Nationalismus und Nationalstaatsbildung in Italien als<br />
internationales Problem von Politik und Medienöffentlichkeiten 1798-1919<br />
Blocktermine: Mo 24.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 11-13 Uhr im F 041 (Vorbesprechung), Do / Fr 8. und<br />
9.12.<strong><strong>201</strong>1</strong>, je 9-18 Uhr, Raum: ULB 202<br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Dr. Raoul Zühlke<br />
082477 Übung: Der Erste Weltkrieg als Krieg um die Vorherrschaft in Südosteuropa<br />
Blockveranstaltung: 06./07.01.<strong>201</strong>2 und 13./14.01.<strong>201</strong>2 Vorbesprechung: 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18.00<br />
Uhr in Raum F 33<br />
Prof. Dr. Hartmut Rüß<br />
082515 Übung: Die deutsche Besatzungspolitik in Weißrussland 1941-1944<br />
14tägig, Mi 9-13Uhr, Raum: F 229, Beginn: 19. 10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Thomas Busch<br />
082534 Russisch für Historiker: Die Sowjetunion in den außenpolitischen Krisen nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg.<br />
Mo 18-20, Raum: F 041<br />
David Schrock, M.A.<br />
082549 Übung: „Die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland im<br />
Kalten Krieg: von der Staatsgründung bis zum NATO-Doppelbeschluss"<br />
Di. 18-20 Uhr, Raum: F 104<br />
Prof. Dr. Rolf Ahmann<br />
082572 Übung: Ansätze der Forschung zur neuesten Geschichte der Internationalen<br />
Beziehungen<br />
Di 16-18 Uhr, Raum: F 102 , Beginn: 18.10.<br />
Dr. Stefan Lehr<br />
082902Übung: Prag und seine Historiker (mit <strong>ab</strong>schließender Exkursion nach Prag)<br />
Mi 8-10, Raum: F 153, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul zur Geschichte des 19. / 20. Jahrhunderts / Vertiefungsmodul zur<br />
sektoralen Geschichte: Verfassungen und Zivilgesellschaften<br />
Vorlesung<br />
27
PD Dr. Uwe Spiekermann<br />
081820 Die Weimarer Republik. Wirtschaft – Gesellschaft – Kultur<br />
Di 12-14, Raum: F 2<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Jun.Prof. Dr. André Krischer<br />
082132 Vom Hochverrat zum Terrorismus: Der Strukturwandel politischer Kriminalität in<br />
Großbritannien im 19. Jahrhundert<br />
Mi 10-12, Raum: SCH 100.124<br />
PD Dr. Uwe Spiekermann<br />
082185 Die Mitte. Bürgertum und middle classes in Deutschland und Großbritannien im 19.<br />
Und 20. Jahrhundert<br />
Mo 12-14, Raum: F 3<br />
PD Dr. Uwe Spiekermann<br />
082826 Die Stasi. Terror – Aufklärung – Aufarbeitung<br />
Di 16-18, Raum: F 3<br />
PD Dr. Michael Schwartz<br />
082936 Italienische Einheit: Nationalismus und Nationalstaatsbildung in Italien als<br />
internationales Problem von Politik und Medienöffentlichkeiten 1798-1919<br />
Blocktermine: Mo 24.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 11-13 Uhr im F 041 (Vorbesprechung), Do / Fr 8. und<br />
9.12.<strong><strong>201</strong>1</strong>, je 9-18 Uhr, Raum: ULB 202<br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Rüdiger Schmidt<br />
082462 Übung: Zur Politik und Ideologie der „Mitte“: Soziale Ordnungsvorstellung und<br />
politischer Diskurs im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Mi 16-18, Raum: ULB 1<br />
Dr. Markus Köster<br />
082496 Übung: "Von Caligari bis Hitler – Zur Kultur- und Politikgeschichte des Films in der<br />
Weimarer Republik"<br />
Termin: vierzehntägig, Donnerstag, 18-20 Uhr, sowie Blockveranstaltung vom 13.-15.1.<strong>201</strong>2<br />
Dr. Thies Schulze<br />
082481 Übung „Quellen zur Geschichte der Weimarer Republik“<br />
Mi 10-12 Uhr, Raum: SCH 122.<strong>201</strong> , Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Peter Fleck<br />
082500 Übung: Wider den totalen Staat. Der Münsteraner Uni-Prof. Peter Tischleder<br />
(Sozialethik/Moraltheologie) in der NS-Zeit und seine Bezugnahme auf den Weimarer Staatsund<br />
Verfassungsrechtler Gerhard Leibholz.<br />
Mi 10 - 12 Uhr, Raum: Raum: S 055<br />
28
Prof. Dr. Rolf Ahmann<br />
082520 Übung: Widerstand und Opposition in der DDR 1949-1989<br />
Mi 14-16, Raum: F 3<br />
Kornelius Ens, M.A, M.A.<br />
Ideologische Erziehungsarbeit als Konfliktfeld zwischen Staat und Kirche in der SBZ/DDR<br />
Do 16-18, Raum: F 153<br />
Vertiefungsmodul zur Geschichte des 19. / 20. Jahrhunderts / Vertiefungsmodul zur<br />
sektoralen Geschichte: Wirtschaftsgeschichte<br />
Vorlesung<br />
Jun.Prof. Dr. Martin Uebele<br />
081800 Vorlesung: Geschichte der Globalisierung seit 1850<br />
Di 14:00-16:00, H 152 (F 2), Fürstenberghaus; Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Ulrich Pfister und Jun.-Prof. Martin Uebele<br />
082147 Hauptseminar: Wenn Staaten Pleite gehen - Kapitalmärkte und Zahlungsprobleme<br />
souveräner Schuldner seit 1850"<br />
Mi 8:00-10:00, Raum: F 102, Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
082151 Hauptseminar: Dörfer im Münsterland: Agrarwirtschaft, ländliche Industrialisierung<br />
und Kommunalpolitik im 19. Jahrhundert<br />
Mi 16-18 Uhr, Raum: F 3, Beginn: 12.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar.<br />
Jun.Prof. Dr. Martin Uebele<br />
082458 Übung: Ausgewählte Kapitel der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20.<br />
Jahrhunderts",<br />
Mo 14:00-16:00, Raum: F 153, Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Dr. Julia Paulus<br />
082591 Übung: "Das Berufsausbildungssystem in Deutschland (1900-1980)"<br />
Do. 16-18h, Raum: F 104, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Vertiefungsmodul zur Geschichte des 19. / 20. Jahrhunderts/ Vertiefungsmodul zur<br />
sektoralen Geschichte: Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister<br />
081815 Vorlesung: Sozialstaat und Gesellschaft seit 1880<br />
Di 16-18, Raum: Audi Max<br />
29
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister/ Christine Fertig<br />
082166 Hauptseminar: Arbeiterbewegung in Kaiserreich und Weimarer Republik<br />
Di 10-12, Raum: F 102<br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
Hauptseminar: Dörfer im Münsterland: Agrarwirtschaft, ländliche Industrialisierung und<br />
Kommunalpolitik im 19. Jahrhundert<br />
Mi 16-18 Uhr, Raum: F3 Erdgeschoss, Beginn: 12.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Christine Fertig<br />
08<strong>201</strong>8 Übung: Familie, Verwandtschaft und Haushalt in der Neuzeit<br />
Mo 14-16, Raum: F 6, Beginn 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Rüdiger Schmidt<br />
082462 Übung: Zur Politik und Ideologie der „Mitte“: Soziale Ordnungsvorstellung und<br />
politischer Diskurs im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Mi 16-18, Raum: ULB 1<br />
Christine Fertig<br />
082037 Übung: Arbeiteralltag und Arbeiterkultur in Kaiserreich und Weimarer Republik<br />
Mo 10-12, Raum: F 043, Beginn 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Studiengang BA KJ<br />
Fachdidaktisches Modul I<br />
Eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist nur nach Eintragung in die<br />
entsprechende Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich.<br />
Anmeldelisten liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der<br />
Geschichte aus.<br />
Einführungsvorlesung<br />
Die Vorlesung „Einführung in die Unterrichtsdidaktik“ wird stets nur im Sommersemester<br />
angeboten.<br />
Fachdidaktische Proseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083492 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Di 16-18, R. 309, Beginn 18.10.11<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083511 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Di 8.30-10, R. 309, Beginn 18.10.11<br />
30
Dr. Oliver Näpel<br />
083640 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Do 10-12, R. 304, Beginn 20.10.11<br />
Fachdidaktische Spezialvorlesung<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083416 Geschichte in Film und Fernsehen. Chancen und Grenzen für historisches<br />
Lernen<br />
Do 12-14, Raum: S 10, Beginn 20.10.11<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083420 Filmanalyse im Geschichtsunterricht<br />
14-tägig, Di 14-17, R. 304, Beginn: 18.10.11<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083435 Was Schüler wirklich sehen! Empirische Erkundungen zum Filmverstehen<br />
Di 8-10, R. 304, Beginn: 18.10.11<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083488 Erkundender Geschichtsunterricht: historisches Lernen in Museen und<br />
Gedenkstätten<br />
Do 16-18, R. 309, Beginn: 20.10.11<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083473 Raum als Kategorie der Geschichtsdidaktik: unterrichtliche und<br />
geschichtskulturelle Aspekte<br />
Di 12-14, R. 309, Beginn: 18.10.11<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083530 Bilder und Historisches Lernen: Theorie – Empirie – Pragmatik<br />
Di 18-20, R. 309, Beginn: 18.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083655 Herausforderung Holocaust<br />
Do 8-10, R. 304, Beginn: 20.10.11<br />
Dr. Ulrich Kröll<br />
083856 Digitale Medien zur Regionalgeschichte<br />
Mi 16-18, R. 309, Beginn 12.10.11<br />
Dr. Wilhelm Pohlkamp<br />
083507 Familie im Mittelalter<br />
Di 14-16, R. 309, Beginn: 18.10.11<br />
Dr. Nikolaus Gussone<br />
083860 Münster gedenkt. Orte, Zeiten und Institutionen des historischen Gedenkens<br />
31
Mo 18-20 Uhr, Raum 304, Beginn: 17.10.11<br />
Fachdidaktisches Modul II/ Fachstudien mit fächerübergreifenden Bezügen<br />
Eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist nur nach Eintragung in die<br />
entsprechende Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich.<br />
Anmeldelisten liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der<br />
Geschichte aus.<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083469 Einführung in die Geschichtskultur<br />
Do 14-16, Raum: F 1, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Seminar mit fächerübergreifenden Bezügen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Dr. Wilhelm Pohlkamp<br />
083507 Hauptseminar I: Familie im Mittelalter<br />
Di 14-16, R 309, Beginn 18.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083636 Kunst und Geschichte<br />
Di 10-12, R. 309, Beginn 19.10.11<br />
Dr. Ulrich Kröll<br />
083856 Digitale Medien zur Regionalgeschichte<br />
Mi 16-18, R. 309, Beginn 12.10.11<br />
Methodische Übung<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083617 Virtuelle Geschichte<br />
Fr. 8-10, R. 304, Beginn 21.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083621 Film-+ Geschichtswerkstatt<br />
Fr. 10-12, R. 304, Beginn 21.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083636 Kunst und Geschichte<br />
Di 10-12, R. 304, Beginn 18.10.11<br />
Roswitha Link<br />
083818 Auf den Spuren der Stadtgeschichte – Archivpädagogische Angebote im<br />
Lernort Stadtarchiv<br />
Blockveranstaltung<br />
Einführung: 19.10.11, 16-18 Uhr<br />
Fr 11.11.11, 14-19 Uhr, Sa 12.11.11, 11-17.30 Uhr<br />
32
Fr 27.01.12, 14-19 Uhr, Sa 28.01.12, 11-17.30 Uhr<br />
Master of Education (Gym / Ges)<br />
Fachdidaktisches Modul<br />
Eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist nur nach Eintragung in die<br />
entsprechende Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich.<br />
Anmeldelisten liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der<br />
Geschichte aus.<br />
Spezialvorlesung<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083416 Geschichte in Film und Fernsehen. Chancen und Grenzen für historisches<br />
Lernen<br />
Do 12-14, S 10, Beginn 20.10.11<br />
Proseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083492 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Di 16-18, R. 309, Beginn 18.10.11<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083511 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Di 8.30-10, R. 309, Beginn 18.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083640 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Do 10-12, R. 304, Beginn 20.10.11<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083420 Filmanalyse im Geschichtsunterricht<br />
14-tägig, Di 14-17 R. 304, Beginn: 18.10.11<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083435 Was Schüler wirklich sehen! Empirische Erkundungen zum Filmverstehen<br />
Di 8-10, R. 304, Beginn: 18.10.11<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083488 Erkundender Geschichtsunterricht: historisches Lernen in Museen und<br />
Gedenkstätten<br />
Do 16-18, R. 309, Beginn: 20.10.11<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083473 Raum als Kategorie der Geschichtsdidaktik: unterrichtliche und<br />
geschichtskulturelle Aspekte<br />
33
Di 12-14, R. 309, Beginn: 18.10.11<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083564 Geschichts- (und Politik)-unterricht zwischen Kompetenzorientierung und<br />
Inhaltsfixierung<br />
Mo. 10-12, R. 309, Beginn 17.10.11<br />
Dr. Ulrich Kröll<br />
083856 Digitale Medien zur Regionalgeschichte<br />
Mi 16-18, R. 309, Beginn 12.10.11<br />
Dr. Wilhelm Pohlkamp<br />
083507 Familie im Mittelalter<br />
Di 14-16, R. 309, Beginn: 18.10.11<br />
Dr. Nikolaus Gussone<br />
083860 Münster gedenkt. Orte, Zeiten und Institutionen des historischen Gedenkens<br />
Mo 18-20 Uhr, R. 304, Beginn: 17.10.11<br />
PD Dr. A. Kneppe<br />
083712 Geschichtsdidaktik in der Schulpraxis. Gym/Ges Begleitseminar zum<br />
Kernpraktikum.<br />
Mi. 10-12, R. 304, 19.10.11<br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083617 Virtuelle Geschichte<br />
Fr. 8-10, R. 304, Beginn 21.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083621 Film-+ Geschichtswerkstatt<br />
Fr. 10-12, R. 304, Beginn 21.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083636 Kunst und Geschichte<br />
Di 10-12, R. 304, Beginn 18.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083655 Herausforderung Holocaust<br />
Do 8-10, R. 304, Beginn 20.10.11<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083440 Film im Museum. Museumspädagogische Konzepte der Filmarbeit im Vergleich –<br />
Exkursion nach Berlin<br />
Vorbesprechung, Mo. 17.10.11, 18 Uhr Institut für Didaktik der Geschichte<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083440 Quellenarbeit: Quellen zum Umgang mit der NS-Zeit nach 1945<br />
Blockveranstaltung<br />
34
VERPFLICHTENDE VORBESPRECHUNG: 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr !!!<br />
04.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 17−20 Uhr<br />
15.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 09−16 Uhr<br />
29.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 09−16 Uhr<br />
09.11.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083545 Unterrichtsplanung und Aufg<strong>ab</strong>enkultur<br />
Blockveranstaltung<br />
02.11.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr<br />
15.01.<strong>201</strong>2, 10−18 Uhr<br />
22.01.<strong>201</strong>2, 10−18 Uhr<br />
25.01.<strong>201</strong>2, 18−20 Uhr<br />
Dr. Wolfhart Beck<br />
083602 Auf den Spuren der Schulgeschichte – Archivpädagogische Angebote im Lernort<br />
Landesarchiv<br />
Fr. 14–17s.t., 14-tägig, Raum: Vortragsraum Landesarchiv, Bohlweg 2, Beginn 21.10.11<br />
Master of Education (HR)<br />
Fachdidaktisches Modul<br />
Eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist nur nach Eintragung in die<br />
entsprechende Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich.<br />
Anmeldelisten liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der<br />
Geschichte aus.<br />
Hauptseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083420 Filmanalyse im Geschichtsunterricht<br />
14-tägig, Di 14-17, R. 304, Beginn: 18.10.11<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083435 Was Schüler wirklich sehen! Empirische Erkundungen zum Filmverstehen<br />
Di 8-10, R. 304, Beginn: 18.10.11<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083488 Erkundender Geschichtsunterricht: historisches Lernen in Museen und<br />
Gedenkstätten<br />
Do 16-18, R. 309, Beginn: 20.10.11<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083564 Geschichts- (und Politik)-unterricht zwischen Kompetenzorientierung und<br />
Inhaltsfixierung<br />
Mo. 10-12, R. 309, Beginn 17.10.11<br />
Dr. Ulrich Kröll<br />
083856 Digitale Medien zur Regionalgeschichte<br />
35
Mi 16-18, R. 309, Beginn 12.10.11<br />
Dr. Wilhelm Pohlkamp<br />
083507 Familie im Mittelalter<br />
Di 14-16, R. 309, Beginn: 18.10.11<br />
Dr. Nikolaus Gussone<br />
083860 Münster gedenkt. Orte, Zeiten und Institutionen des historischen Gedenkens<br />
Mo 18-20 Uhr, R. 304, Beginn: 17.10.11<br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083617 Virtuelle Geschichte<br />
Fr. 8-10, R. 304, Beginn 21.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083621 Film-+ Geschichtswerkstatt<br />
Fr. 10-12, R. 304, Beginn 21.10.11<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083636 Kunst und Geschichte<br />
Di 10-12, R. 304, Beginn 18.10.11<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083440 Film im Museum. Museumspädagogische Konzepte der Filmarbeit im Vergleich –<br />
Exkursion nach Berlin<br />
Vorbesprechung, Mo. 17.10.11, 18 Uhr Institut für Didaktik der Geschichte<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083440 Quellenarbeit: Quellen zum Umgang mit der NS-Zeit nach 1945<br />
Blockveranstaltung<br />
VERPFLICHTENDE VORBESPRECHUNG: 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr !!!<br />
04.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 17−20 Uhr<br />
15.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 09−16 Uhr<br />
29.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 09−16 Uhr<br />
09.11.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083545 Unterrichtsplanung und Aufg<strong>ab</strong>enkultur<br />
Blockveranstaltung<br />
02.11.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr<br />
15.01.<strong>201</strong>2, 10−18 Uhr<br />
22.01.<strong>201</strong>2, 10−18 Uhr<br />
25.01.<strong>201</strong>2, 18−20 Uhr<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083655 Herausforderung Holocaust<br />
Do 8 - 10, R. 304, Beginn 20.10.11<br />
36
37<br />
1. Vorlesungen<br />
Lehrende des Seminars für Alte Geschichte<br />
081318 Vorlesung: Einführung in die Alte Geschichte<br />
Mo 14-16, H 306 (Audi Max), Johannisstraße 12, Englisches Seminar, 2. OG<br />
Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Vorlesung richtet sich vor allem an Studierende, die das Studium der Alten Geschichte<br />
aufnehmen. Nach einer knapp gehaltenen allgemeinen Einführung in das althistorische<br />
Fachstudium bietet sie einen chronologischen Überblick über die Geschichte der antiken Welt<br />
von der mykenischen Zeit bis ins Zeitalter Justinians. In einem zweiten Teil werden unter<br />
strukturellen Gesichtspunkten Grundlagen und Eigenart der antiken Welt ausgeleuchtet. Die<br />
einzelnen Vorlesungsstunden werden von verschiedenen Dozenten gestaltet so bietet sich<br />
auch die Möglichkeit, die am Seminar für Alte Geschichte Lehrenden, ihre Arbeitsweise und<br />
Schwerpunkte kennenzulernen.<br />
Diese Veranstaltung wird <strong>ab</strong> WS <strong><strong>201</strong>1</strong>/<strong>201</strong>2 in jedem Sommer- und in jedem <strong>Wintersemester</strong><br />
stattfinden.<br />
Literatur: H.-J. Gehrke – H. Schneider (Hrsg.), Geschichte der Antike, Stuttgart 2006; W.<br />
Dahlheim, Die Antike. Griechenland und Rom, Paderborn 2 1995; O. Murray u.a., dtv-<br />
Geschichte der Antike, 7 Bde., München 1985ff. (und Neuauflagen; auch in zwei günstigen<br />
textgleichen Sonderausg<strong>ab</strong>en zu Griechenland bzw. Rom erhältlich).<br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081322 Vorlesung: Die griechische Staatenwelt im 5. Jh. v. Chr.<br />
Fr 10-12, Raum: F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Hörsaaltrakt, 1. OG<br />
Beginn: 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Nach der Abwehr der Perser, an der nur ein Teil der griechischen Mächte beteiligt war,<br />
vollzog sich die politische Entwicklung Griechenlands ohne Druck von außen. Relevant war<br />
der Aufstieg Athens zur zweiten Großmacht neben Sparta: Der Dualismus dieser beiden<br />
Staaten prägte das 5. Jh., wobei ein Antagonismus nur zeitweise bestand – anders als<br />
Thukydides es darstellt. Auf gesellschaftlichem und kulturellem Gebiet kam es vor allem in<br />
den Städten zu einem beachtlichen Aufschwung (Literatur, Philosophie, Architektur, Kunst),<br />
der oft als ‚Klassik‟ bezeichnet wird. Ebenfalls in den Blick zu nehmen sind die mittleren<br />
Staaten, auch wenn sie quellenmäßig schlechter greifbar sind. Schließlich wird die athenische<br />
Demokratie als Besonderheit unter den damaligen Verfassungen zu analysieren sein.<br />
Literatur: J.M. Balcer, The Persian Conquest of the Greeks 545-450 BC, Konstanz 1995<br />
(Xenia, 38); K. W. Welwei, Das klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4.<br />
Jahrhundert, Darmstadt 1999; M. Dreher, Athen und Sparta, München 2001; P. Funke, Athen<br />
in klassischer Zeit, München 3 2007 (Beck‟sche Reihe, 2074); A. P<strong>ab</strong>st, Die athenische<br />
Demokratie, München 2003 (Beck‟sche Reihe, 2308).<br />
Prof. Dr. Johannes Engels<br />
081337 Vorlesung: Griechische Geschichte im Zeitalter Philipps II. und Alexanders des<br />
Großen<br />
Mi 10-12, Raum: F 043, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller – Flur<br />
Beginn: 19.20.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Während in der älteren Forschung die Regierungszeit Philipps II. noch eindeutig (und mit<br />
einem problematischen Endpunkt der Schlacht von Chaironeia 338 v. Chr.) der
spätklassischen Epoche zugewiesen und vom neuen, hellenistischen Zeitalter seit Alexander<br />
dem Großen deutlich <strong>ab</strong>gehoben wurde, überwiegt inzwischen die Ansicht, von einer<br />
Übergangsperiode unter Philipp II und Alexander mit starken Kontinuitätslinien, andererseits<br />
<strong>ab</strong>er auch schon unter Philipp auf den Hellenismus vorausweisenden Strukturen und<br />
Entwicklungen zu sprechen. Die Vorlesung wird Grundprobleme der makedonischen und<br />
griechischen Geschichte im Zeitraum ca. 359-323 v. Chr. erörtern und auch die Entstehung<br />
der neuartigen Universalmonarchie Alexanders des Großen behandeln.<br />
Lit.: Lewis, D.M. / Boardman, J. /Hornblower, S. /Ostwald, M. (Hgg.), The Cambridge<br />
Ancient History, Vol. VI: The Fourth Century B.C., Cambridge 1994 2 ; Buckler, J., Aegean<br />
Greece in the Fourth Century BC, Leiden u.a. 2003; Brulé, P. / Descat, R. (Hgg.), Le monde<br />
grec aux temps classiques, Vol. 2: Le IVe siècle, Paris 2004; Meißner, B., Hellenismus,<br />
Darmstadt 2007; Engels, J., Philipp. II. und Alexander der Große, Darmstadt 2006; <strong><strong>201</strong>1</strong> 2<br />
(erscheint Sept. <strong><strong>201</strong>1</strong>).<br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081341 Vorlesung: Caesar und Augustus<br />
Mi 12-14, Raum: F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Hörsaaltrakt, 1. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Caesar und sein Adoptivsohn Octavian Augustus gehören zu den bedeutendsten Gestalten der<br />
römischen Geschichte; ihr Wirken markiert den Übergang von der Republik zum Kaiserreich.<br />
Vor dem Hintergrund der krisenhaften Veränderung der späten Republik sollen die<br />
Lebenswerke der beider Politiker rekonstruiert, ihr innenpolitisches Reformwerk gewürdigt<br />
und die Grundlinien ihrer Außenpolitik nachgezeichnet werden. Im Mittelpunkt steht d<strong>ab</strong>ei<br />
die Schaffung einer neuen Staatsform, des Principates, der de iure auf dem Staatsrecht der<br />
Republik fußte, de facto <strong>ab</strong>er auf eine neuartige, autokratische Herrschaftsform hinauslief, die<br />
der politischen Tradition Roms völlig widersprach.<br />
Einführende Literatur: R. Syme, Die römische Revolution (= The Roman Revolution),<br />
Stuttgart 1957; K. Christ, Krise und Untergang der römischen Republik, Darmstadt 1979; M.<br />
Jehne, Der Staat des Dictators Caesar, Köln - Wien 1987; W. Eck, Augustus und seine Zeit<br />
(Beck´sche Reihe 2084), München 1998; D. Kienast, Augustus. Prinzeps und Monarch,<br />
Darmstadt 3 1999.<br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
081710 Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Di 8-10, Raum: F 2, Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Wie kaum eine andere Epoche, fasziniert das Mittelalter bis heute. Ausstellungen, Belletristik<br />
und Kinofilme finden reges Interesse in der Öffentlichkeit. Nicht als längst vergangene<br />
Zeiten, sondern als eine Zeit des ganz Anderen, <strong>ab</strong>er auch überraschender Parallelen zur<br />
modernen Welt bietet das Mittelalter vielfältige Perspektiven der Untersuchung. Entsprechend<br />
verändern sich auch die Ansätze wissenschaftlicher Erforschung und die Antworten auf die<br />
Frage, wann und was das Mittelalter gewesen sei. Üblicherweise als die Zeit von ungefähr<br />
500 bis 1500 verstanden und als Epoche der zentraleuropäischen Geschichte, wird das<br />
Mittelalter heute unter weiteren kulturgeschichtlichen Perspektiven verstanden, mit Bezug<br />
nicht nur auf die christliche, sondern auch die muslimische und jüdische Geschichte und mit<br />
der Frage nach begründeten Epochenzäsuren. Die Vorlesung führt ein in die wichtigsten<br />
Phasen der mittelalterlichen Geschichte und stellt exemplarisch Ereignisse, Akteure und<br />
Einflußfaktoren vor, die die historische Entwicklung zwischen der Antike und der<br />
beginnenden Moderne geprägt h<strong>ab</strong>en.<br />
38
Lit. Gerhard Lubich, Das Mittelalter, Paderborn <strong>201</strong>0; Bernd Schneidmüller, Grenzerfahrung<br />
und monarchische Ordnung. Europa 1200-1500, München <strong><strong>201</strong>1</strong>.<br />
Prof. Dr. Peter Johanek<br />
081724 Vorlesung: Epochen der Papstgeschichte im Mittelalter<br />
Fr 10-12, Raum: H 4<br />
Das Papsttum gehört zu den zentralen politischen und religiösen Wirkungskräfte des<br />
Mittelalters. Die Vorlesung soll einen Überblick über seine Geschichte vom Ausgang der<br />
Antike bis zu denReformkonzilien des 15. Jahrhunderts geben. Sie wird sich auf die<br />
wichtigsten Schwer- und Wendepunkte konzentrierem und diese exemplarisch in vertiefter<br />
Darstellung behandeln, nach Möglichkeit unter Interpretation wichtiger Quellentexte.<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
081739 Vorlesung: Geschichte Spaniens im Mittelalter<br />
Di 10-12, Raum: F 2<br />
In der Mitte des 20. Jahrhunderts entstand – motiviert durch zeitgenössische Problemlagen –<br />
der Mythos vom vermeintlichen goldenen Zeitalter im mittelalterlichen Spanien, als Vertreter<br />
der drei monotheistischen Weltreligionen, also Juden, Christen und Muslime, in friedlichem<br />
Nebeneinander zusammengelebt hätten (convivencia). In der jüngeren Forschung ist dieses<br />
etwas einseitige Bild korrigiert worden, indem einerseits auf die tatsächlich nicht so seltenen<br />
Konflikte und andererseits auf die ideologischen Voraussetzungen und Implikationen dieser<br />
spezifischen Interpretation der spanischen Geschichte verwiesen wurde.<br />
Die Vorlesung stellt die Hauptepochen der mittelalterlichen spanischen Geschichte seit der<br />
westgotischen Spätantike vor und richtet das Augenmerk insbesondere auf das Verhältnis<br />
zwischen unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen sowie auf ihre jeweilige<br />
Bedeutung für die Konstruktion einer kohärenten Erzählung von einer „spanischen“<br />
Geschichte.<br />
Literatur: Herbers, Klaus, Geschichte Spaniens im Mittelalter. Vom Westgotenreich bis zum<br />
Ende des 15. Jahrhunderts, Stuttgart 2006; Vones, Ludwig, Geschichte der Iberischen<br />
Halbinsel im Mittelalter (711 - 1480). Reiche, Kronen, Regionen, Sigmaringen 1993;<br />
Walther, Helmut G., Der gescheiterte Dialog. Das ottonische Reich und der Islam, in:<br />
Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter (Miscellanea Medievalia 17), ed. Albert<br />
Zimmermann/Ingrid Craemer-Ruegenberg, Berlin/New York 1985, 20-44; Wasserstein,<br />
David J., The Caliphate in the West. An Islamic Political Institution on the Iberian Peninsula,<br />
Oxford 1993; Watt, W. Montgomery, A History of Islamic Spain, Edinburgh 1965.<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister:<br />
081758 Vorlesung: Einführung in die Neuere und Neueste Geschichte<br />
Mi 16-18, Raum: SP 7, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Vorlesung unterrichtet einerseits über die Grundfragen der Neueren und Neuesten<br />
Geschichte, andererseits stellt sie die wichtigsten Teildisziplinen dieser historischen Epoche<br />
vor. Sie ergänzt damit die in der Regel auf ein Spezialthema ausgerichteten Proseminare um<br />
einen umfassenden Blick auf die Neuzeit. Für Studierende der BA-Prüfungsordnung 2005 ist<br />
der Besuch einer der die Vorlesung begleitenden Lektüreübungen Pflicht; Studierenden nach<br />
der BA-Prüfungsordnung <strong><strong>201</strong>1</strong> wird sie dringend empfohlen.<br />
Literaturhinweise: G<strong>ab</strong>riele Metzer, Einführung in das Studium der Zeitgeschichte, Paderborn<br />
2004; Christoph Nonn, Das 19. und 20. Jahrhundert, Paderborn 2007; Anette Völker-Rasor<br />
(Hg.), Frühe Neuzeit, München ²2006.<br />
39
Jun.Prof. Dr. Matthias Pohlig<br />
081762 Vorlesung: Öffentlichkeit in der Frühen Neuzeit<br />
Mi 10-12, Raum: H 2, Beginn: 12.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Öffentlichkeit ist ein zentrales Phänomen der Moderne – <strong>ab</strong>er auch der Vormoderne Zum<br />
Begriff der Öffentlichkeit gehört als Gegenbegriff einerseits die Privatheit, anderseits das<br />
Geheimnis. Was also kann man unter Öffentlichkeit verstehen – und hat sie eine Geschichte<br />
Die Vorlesung versucht zweierlei: Einerseits in die wichtigsten begrifflichen und<br />
methodischen Fragen einzuführen, die mit dem Problem der Öffentlichkeit verbunden sind.<br />
Zweitens soll die Öffentlichkeitsthematik genutzt werden, um über einen zentralen<br />
Themenbereich einen generellen Einblick in die frühneuzeitliche Geschichte von 1500 bis<br />
1800 zu bekommen – also sozusagen von der reformatorischen Öffentlichkeit bis zu den<br />
Geheimgesellschaften der Aufklärung. Dazu bietet sich das Thema Öffentlichkeit an, weil es<br />
mit allen wichtigen Bereichen frühneuzeitlicher Gesellschaft – Politik, Religion, Wirtschaft,<br />
Krieg, Bildung – aufs engste verknüpft ist.<br />
Einführende Literatur: Opgenoorth, Ernst, Publicum - privatum - arcanum. Ein Versuch zur<br />
Begrifflichkeit frühneuzeitlicher Kommunikationsgeschichte, in: Kommunikation und Medien<br />
in Preußen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, hg. v. Bernd Sösemann, Stuttgart 2002, 22-44<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
081777 Vorlesung: Das Reich in Europa 1648-1806<br />
Mi 10-12, Raum: F 2, Beginn: 19.10.<br />
Die Vorlesung wird einen Überblick über die Geschichte des Heiligen Römischen Reichs<br />
vom Westfälischen Frieden bis zu seinem Ende 1806 anbieten. Aus einer europäischen<br />
Perspektive ist diese Phase geprägt von Fürstenstaaten und Republiken, deren innere<br />
Herrschaftsverhältnisse inzwischen weitgehend st<strong>ab</strong>ilisiert waren, die sich <strong>ab</strong>er im Rahmen<br />
eines europäischen Mächtekonzerts in dauernder, oft kriegerischer Rivalität befanden. Der<br />
eine Brennpunkt der Vorlesung muß sich daher auf die Verwicklung des Reichs in diesen<br />
dynamischen Prozeß politischer Konkurrenz und auf die Umstände konzentrieren, unter denen<br />
sich das Reich als politisches System behaupten konnte. Der zweite Brennpunkt wird auf die<br />
politische Kultur des Reichs selbst gerichtet sein, auf die Institutionalisierungen von<br />
politischer Herrschaft, Mitsprache und Kommunikation ebenso wie auf die kulturell<br />
determinierten Handlungsformen, Spielräume und Inszenierungen seiner politischen Eliten.<br />
Auch d<strong>ab</strong>ei kommen grenzüberschreitende Austauschprozesse in den Blick. So oder so wird<br />
die vielfach umstrittene Frage zu diskutieren sein, wie die Entwicklung des Reichs im<br />
Spannungsfeld zwischen traditionellen Sinnstiftungen und moderner Staatsraison angemessen<br />
zu interpretieren ist. D<strong>ab</strong>ei werden systematische Überlegungen gegenüber chronologischen<br />
Erzählungen überwiegen.<br />
Erste Literaturhinweise: Axel Gotthard: Das Alte Reich 1495-1806, 4. Aufl. Darmstadt 2009<br />
(zuerst: 2003); Barbara Stollberg-Rilinger: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte<br />
und Symbolsprache des Alten Reiches, München 2008; Karl-Otmar Freiherr von Aretin: Das<br />
Alte Reich 1648-1806, 3 Bde. und ein Registerband, Stuttgart 1993-1997, 2000; Heinz<br />
Schilling: Höfe und Allianzen. Deutschland 1648-1763, Berlin 1989; Horst Möller:<br />
Fürstenstaat und Bürgernation. Deutschland 1763-1815, Berlin 1989.<br />
Prof. Dr. Heike Bungert/Prof. Dr. Silke Hensel<br />
081781 Vorlesung: Begegnung zweier Welten Indianer in den Amerikas von der ersten<br />
Besiedlung bis heute<br />
40
Do. 10-12 Uhr, Raum: HHÜ, Hüfferstraße 1, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Entdeckung und Eroberung Amerikas durch Europäer im 15. Jahrhundert wurde lange<br />
Zeit als der Beginn der Geschichte des Kontinents gesehen. Tatsächlich war die indigene<br />
amerikanische Bevölkerung, von Kolumbus Indianer genannt, zwischen 15.000 und 10.000<br />
u.Z. eingewandert, und es waren unterschiedlichste Gesellschaften entstanden. Seit den<br />
europäischen Eroberungen wurde die indigene Bevölkerung stark dezimiert und verlor -- nach<br />
wirtschaftlichen und kulturellen Interaktionen -- trotz vielfältiger Widerstandshandlungen für<br />
mehrere Jahrhunderte jegliche Souveränität. Die Vorlesung will beginnend in der<br />
vorkolonialen Zeit bis ins 21. Jahrhundert die indigene Bevölkerung in den Blick nehmen und<br />
die jeweils für Latein- und Nordamerika besonderen politischen, sozialen, wirtschaftlichen<br />
und kulturellen Entwicklungen untersuchen. Zentral d<strong>ab</strong>ei wird es sein, die Angehörigen<br />
dieser Bevölkerungsgruppen als Akteure der Geschichte ernst zu nehmen. Zudem werden<br />
Ähnlichkeiten, Unterschiede und transnationale Verflechtungen zwischen Indianern in Nordund<br />
Südamerika herausgearbeitet.<br />
Literatur: George A. Collier (Hg.), The Inca and Aztec States, 1400-1800, New York 1982; R.<br />
David Edmunds et al., The People: A History of Native America, New York 2006; Roger L.<br />
Nichols, American Indians in U.S. History. Norman, OK, 2003; Wolfgang Lindig, Mark<br />
Münzel, Die Indianer: Kulturen und Geschichte, München 1992; Greg J. S. Urban, Nation-<br />
States and Indians in Latin America, Austin 1991.<br />
Dr. Martina Winkler<br />
081796 Vorlesung: Nationen und Nationalismus in Ostmitteleuropa<br />
Mo 10-12, Raum: F 5, Beginn 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
„Nation“ ist ein klassisches, d<strong>ab</strong>ei nach wie vor aktuelles und vor allem hoch umstrittenes<br />
Thema für Historiker. Die Vorlesung führt ein in theoretische Fragen und Probleme und<br />
betrachtet die komplexen, ganz und gar nicht linearen Prozesse dessen, was viel zu<br />
vereinfachend „Nationsbildung“ genannt wird. D<strong>ab</strong>ei stehen die Entwicklungen in<br />
Ostmitteleuropa vom späten 18. bis ins 20. Jahrhundert im Mittelpunkt des Interesses.<br />
Einführende Literatur: Spencer, Philip (Hrsg.), Nations and Nationalism: A Reader, New<br />
Brunswick 2005; Puttkamer, Joachim von, Nationalismus in Ostmitteleuropa – eine<br />
Zwischenbilanz, in: http://www.zeitenblicke.de/2007/2/puttkamer/dippArticle.pdf<br />
Jun. Prof. Dr. Martin Uebele<br />
081800 Vorlesung: Geschichte der Globalisierung seit 1850<br />
Di 14:00-16:00, Raum: F 2, Fürstenberghaus; Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Die „Globalisierung“ beginnt in den meisten Köpfen in der frühen Nachkriegszeit.<br />
Tatsächlich ist<br />
<strong>ab</strong>er schon um die Mitte des 19. Jh. ein deutlicher Aufschwung des internationalen Handels<br />
sowie der grenzüberschreitenden Mobilität von Arbeit und Kapital festzustellen. Die Jahre<br />
1850–1913 werden daher gelegentlich als die „Erste Globalisierung“ bezeichnet. Zwischen<br />
dieser und der „Zweiten Globalisierung“ liegt eine Periode der De-Globalisierung, die in der<br />
Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929–1932 gipfelte. Die Vorlesung behandelt Güterhandel,<br />
Finanzströme und Arbeitsmigration seit der ersten Hälfte des 19. Jh. bis ca. 1990.<br />
Beschreibung und Analyse der internationalen Wirtschaftsbeziehungen beinhalten u. a. die<br />
Rolle von Wechselkursregimen wie z. B. den Goldstandard. Für den Güterhandel und<br />
Migration wird die Rolle von Transportinfrastruktur diskutiert sowie relative Faktorpreise.<br />
Schließlich werden auch die Folgen internationalen Handels für Wirtschaftswachstum<br />
(Konvergenz von Pro-Kopf-Einkommen) und die weltweite Wohlfahrtsverteilung erörtert.<br />
41
Literatur: Foreman-Peck, James: A history of the world economy. International economic<br />
relations since 1850, Brighton 1995; O‟Rourke, Kevin H. und Jeffrey Williamson:<br />
Globalization and history. The evolution of a nineteen-century Atlantic economy, Cambridge,<br />
Mass. 1999; Broadberry, Stephen N. (Hrsg.): The Cambridge economic history of modern<br />
Europe, Bd. 2, Cambridge: <strong>201</strong>0; Pfister, Ulrich: Globalisierung und Weltwirtschaft, S. 277–<br />
336 in: WBG Weltgeschichte, Bd. 6, Darmstadt: <strong>201</strong>0.<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister<br />
081815 Vorlesung: Sozialstaat und Gesellschaft seit 1880<br />
Di 16-18, Raum: Audi Max, Beginn 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Umverteilung von Ressourcen für soziale Zwecke stellt mit Abstand die Hauptaufg<strong>ab</strong>e<br />
des modernen Staats dar. Die Vorlesung behandelt im Überblick die Entwicklung der<br />
modernen Sozialpolitik seit dem späten 19. Jh., die damit verbundenen Veränderungen der<br />
Wahrnehmung gesellschaftlicher Problemlagen ebenso wie der Erwartungen hinsichtlich ihrer<br />
Steuerbarkeit. In diesem Zusammenhang wird auch die Geschichte sozialer Großgruppen,<br />
insbesondere der Arbeiterschaft und der freien Berufe, sowie deren Interessenverbände und<br />
Bewegungen behandelt. Gesellschaftliche Gruppen waren einerseits wichtige Adressaten der<br />
staatlichen Sozialpolitik, nahmen <strong>ab</strong>er andererseits auch mit unterschiedlicher Intensität<br />
Einfluss darauf.<br />
Literaturhinweise: Jens Alber, Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zu<br />
Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa, Frankfurt a. M. 1987; Eberhard<br />
Eichenhofer, Geschichte des Sozialstaats in Europa. Von der „sozialen Frage“ bis zur<br />
Globalisierung, München 2007; Gerhard A. Ritter, Der Sozialstaat. Entstehung und<br />
Entwicklung im internationalen Vergleich, München 1991.<br />
42<br />
2. Proseminare<br />
Die Teilnahme an den Proseminaren für Alte, Mittlere und Neuere Geschichte wird<br />
durch ein auf Wahlgängen beruhendes Verteilverfahren geregelt.<br />
Dieses wird für die Proseminare in Alter Geschichte vom Seminar für Alte Geschichte,<br />
für die Proseminare in Mittlerer und Neuerer Geschichte vom Historischen Seminar<br />
durchgeführt.<br />
Es wird auf die entsprechenden Hinweise zur Durchführung der Verteilverfahren hingewiesen.<br />
Um Verzögerungen bei der Zuteilung zu vermeiden, wird darum gebeten,<br />
diese Hinweise ohne Abweichungen zu befolgen.<br />
Der erste Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10 Uhr, bis Mittwoch, den 13.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 12.00 Uhr, an der<br />
Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, nachmittags (am Schwarzen Brett<br />
des Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen<br />
bzw. neueren Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses<br />
(Flur zwischen Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Der zweite Wahlgang findet statt:<br />
von Montag, den 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong>, <strong>ab</strong> 10.00 Uhr, bis Donnerstag, den 13.10.<strong>201</strong>0, 12.00 Uhr,<br />
an der Aufsicht der gemeinsamen Bibliotheken (Keller Fürstenberghaus).<br />
Bekanntg<strong>ab</strong>e der Ergebnisse: Donnerstag, 14.10.<strong>201</strong>0, nachmittags (am Schwarzen Brett<br />
des Seminars für Alte Geschichte) sowie für die Proseminare in der mittelalterlichen
zw. neueren Geschichte am Schwarzen Brett im Untergeschoss des Fürstenberghauses<br />
(Flur zwischen Fachschaft und Bistro K<strong>ab</strong>u).<br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081413 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Hadrian<br />
Mi 12-14, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Klass. Philologie, 2. OG<br />
Do 14-16, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Klass. Philologie, 2. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Im Verhältnis der römischen Kaiser zu Volk, Senat und Provinzialen lässt sich für die Zeit<br />
von Augustus bis zum Ende des 2. Jhs. n. Chr. insgesamt viel Kontinuität feststellen, <strong>ab</strong>er fast<br />
jeder Herrscher setzte eigene Akzente und hatte besondere Vorlieben bis hin zu Marotten, die<br />
politisch relevant sein konnten. Hadrian ist vor allem als der Reisekaiser bekannt geworden:<br />
Er bereiste fast alle Teile des Imperiums, eine Verhaltensweise, die bei den Zeitgenossen auf<br />
Kritik wie auf Zustimmung traf. Eher befremdet war man im Altertum (und meist auch in der<br />
modernen Forschung), dass er aus einer päderastischen Liaison eine Staatsaktion machte:<br />
Seinen verstorbenen Liebling Antinoos ließ er vergöttlichen und bedachte ihn mit einem<br />
reichsweiten Kult. – Insgesamt bietet die Zeit Hadrians eine Fülle an literarischen,<br />
epigraphischen, numismatischen und archäologischen Zeugnissen, mittels derer eine<br />
umfassende und systematische Einführung in die Alte Geschichte geboten werden kann.<br />
Das Seminar führt in die Grund- und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte ein<br />
(Epigraphik, Numismatik und Papyrologie), ferner werden die Hilfsmittel und Methoden<br />
vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele der Umgang mit ihnen eingeübt.<br />
Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine schriftliche Hausarbeit<br />
und eine Abschlussklausur obligatorisch.<br />
Literatur: M. Zahrnt, Hadrian, in: M. Clauss (Hrsg.), Die römischen Kaiser. 55 historische<br />
Portraits von Caesar bis Iustinian, München 1997, 124-136; A. R. Birley, Hadrian. Der<br />
rastlose Kaiser, Mainz 2006 (zuerst London 1996); H. Knell, Des Kaisers neue Bauten.<br />
Hadrians Architektur in Rom, Athen und Tivoli, Mainz 2008.<br />
N.N.<br />
081428 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Kaiser Vespasian und<br />
die Begründung einer neuen Dynastie<br />
Mi 8-10, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Fr 8-10, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dozent wird noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am Schwarzen Brett des<br />
Seminars für Alte Geschichte und im HISLSF achten.<br />
Mit dem Selbstmord Neros im Jahre 68 n. Chr. endete die unter Augustus begründete, beinahe<br />
100 Jahre währende Herrschaft des julisch-claudischen Kaiserhauses. Es folgten blutige<br />
Auseinandersetzungen um den Kaiserthron in den Bürgerkriegswirren des sog.<br />
Vierkaiserjahres, als deren Sieger Vespasian hervorging. Während seiner zehnjährigen<br />
Herrschaft gelang es ihm, das politisch und finanziell zerrüttete Römische Reich zu<br />
konsolidieren und mit seinen Söhnen Titus und Domitian eine neue Dynastie zu begründen.<br />
Im Zentrum des Proseminars steht die Person Vespasians, ein General ritterlicher Herkunft,<br />
der bei seinem Regierungsantritt 60 Jahre zählte und der als gerechter, bodenständiger und<br />
volksnaher Herrscher, <strong>ab</strong>er auch als zynisch-humorvoller Mensch und als Geizkragen galt.<br />
Ziel soll es sein, die Besonderheiten der Regierungszeit Vespasians herauszuarbeiten,<br />
insbesondere seine Strategien der Reichskonsolidierung und Herrschaftssicherung<br />
43
aufzuzeigen, daneben <strong>ab</strong>er auch, Vespasians Herrschaft in den weiteren Zusammenhang der<br />
römischen Kaiserzeit einzuordnen.<br />
Das Seminar führt in die Grund- und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte ein<br />
(Epigraphik, Numismatik und Papyrologie), ferner werden die Hilfsmittel und Methoden<br />
vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele der Umgang mit ihnen eingeübt.<br />
Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine schriftliche Hausarbeit<br />
und eine Abschlussklausur obligatorisch.<br />
Literatur: S. Pfeiffer, Die Zeit der Flavier. Vespasian – Titus – Domitian, Darmstadt 2009<br />
(Geschichte kompakt). A.J. Boyle – W.J. Dominik (Hrsg.), Flavian Rome. Culture, Image,<br />
Text, Leiden – Boston 2003. M. Griffin, s.v. The Flavians, CAH XI (2000), 1-83. B. Levick,<br />
Vespasian, London – New York 1999. F. Coarelli (Hrsg.), Divus Vespasianus. Il bimillenario<br />
dei Flavi, Milano 2009. K. Christ, Geschichte der römischen Kaiserzeit, München 5 2005, 243-<br />
284.<br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081432 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Rom und die<br />
hellenistische Staatenwelt<br />
Mi 12-14, Raum: F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller - Flur<br />
Do 10-12, Raum: F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller - Flur<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Im Verlauf des 2. Jhs. v. Chr. verband sich die Geschichte Roms mit der Griechenlands und<br />
Asiens in einer einzigartigen Weise und mit einer einzigartigen Geschwindigkeit. Die<br />
Auseinandersetzungen Roms mit den hellenistischen Königreichen bis zur Schlacht von<br />
Actium 31 v. Chr. stehen deshalb im Zentrum dieses Proseminars. D<strong>ab</strong>ei wird insbesondere<br />
nach den Gründen für den Aufstieg Roms zur Weltmacht und nach den sich ändernden<br />
außenpolitischen Zielen Roms in diesem Zeitraum zu fragen sein, ebenso nach den<br />
Rückwirkungen dieses Prozesses auf die römische Innenpolitik. In gleicher Weise sollen <strong>ab</strong>er<br />
auch die Belange und Interessen der hellenistischen Staaten Berücksichtigung finden.<br />
Das Seminar führt in die Grund- und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte ein<br />
(Epigraphik, Numismatik und Papyrologie), ferner werden die Hilfsmittel und Methoden<br />
vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele der Umgang mit ihnen eingeübt.<br />
Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine schriftliche Hausarbeit<br />
und eine Abschlussklausur obligatorisch.<br />
Literatur: J. Deininger, Der politische Widerstand gegen Rom in Griechenland 217-86 v. Chr.,<br />
1971; R. Werner, Das Problem des Imperialismus und die römische Ostpolitik im 2. Jh. v.<br />
Chr., ANRW I 1 (1972), 412 ff.; R.M. Errington, The Dawn of the Empire. Rome´s Rise to<br />
World Power, 1972; D. Braund, Rome and the Friendly King: The Character of Client<br />
Kingship, 1984; E. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome. 2 Bde., 1984 (ND<br />
1986, 1990); A.N. Sherwin-White, Roman Foreign Policy in the East 168 B.C. to A.D.1,<br />
1984; R.M. Errington, Neue Forschungen zu den Ursachen der römischen Expansion im 3.<br />
und 2. Jh. v. Chr., HZ 250, 1990, 93 ff.; P. Green, Alexander to Actium. The Historical<br />
Evolution of the Hellenistic Age, 1990; D. Vollmer, Symploke. Das Übergreifen der<br />
römischen Expansion auf den griechischen Osten, 1990; R.M. Kallet-Marx, Hegemony to<br />
Empire: The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C., 1995; R.<br />
Bernhardt, Rom und die Städte des hellenistischen Ostens (3.-1. Jh. v. Chr.), 1998; B.<br />
Meißner, Hellenismus, 2007 (Geschichte Kompakt).<br />
Dr. Matthias Haake<br />
081447 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Severer<br />
44
Mo 10-12, Raum: F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller<br />
Di 10-12, Raum: F 040, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller<br />
Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Unter der Herrschaft der Severer (193-235 n. Chr.) vollzogen sich wichtige<br />
Transformationsprozesse im Imperium Romanum; einerseits standen die Severer noch in der<br />
Tradition der ‚Hohen Kaiserzeit„, zugleich vollzogen sich jedoch Wandlungen, die Probleme<br />
aufzeigen, die später von zentraler Bedeutung während der ‚Krise des Dritten Jahrhunderts„<br />
werden sollten. D<strong>ab</strong>ei ist die vierzig-jährige Dauer der Herrschaft der Severer keineswegs als<br />
ein monolithischer Block anzusehen, sondern vielmehr als eine Zeit voller Dynamik.<br />
Ziel des Seminars ist neben der Erarbeitung eines geschichtlichen Überblicks über die<br />
severische Dynastie eine Analyse der politischen, religiösen und sozialen Prozesse im<br />
Imperium Romanum. Wesentlicher Bestandteil wird d<strong>ab</strong>ei die Untersuchung der Modi der<br />
Interaktion der jeweiligen Kaiser mit der stadtrömischen Plebs, dem Senat, dem Heer und den<br />
provinzialen Bevölkerungen sein.<br />
Das Seminar führt in die Grund- und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte ein<br />
(Epigraphik, Numismatik und Papyrologie), ferner werden die Hilfsmittel und Methoden<br />
vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele der Umgang mit ihnen eingeübt.<br />
Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine schriftliche Hausarbeit<br />
und eine Abschlussklausur obligatorisch.<br />
Literatur: B. Campbell, The Severan Dynasty, in: CAH² XII, Cambridge 2005, 1-27; S. Swain<br />
– S. Harrison, J. Elsner (eds.): Severan Culture, Cambridge 2007; J. Sünskes Thompson,<br />
Aufstände und Protestaktionen im Imperium Romanum. Die severischen Kaiser im<br />
Spannungsfeld innenpolitischer Konflikte, Bonn 1990; M. Handy, Die Severer und das Heer,<br />
Berlin 2009; E. Flaig, E.; Den Kaiser herausfordern, HZ 253, 1991, 371-384<br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081451 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Demosthenes<br />
Mi 16-20, Raum: F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG-Foyer<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Demosthenes war der berühmteste Redner der Antike; er lebte im Athen des 4. Jahrhunderts<br />
v. Chr. Ein Redner war in dieser Zeit nicht nur ein Anwalt, sondern auch ein Politiker, der<br />
nicht nur wegen seiner Kunst, sondern auch wegen seiner Erfahrung Einfluss besaß. In die<br />
Zeit des Demosthenes fällt der Aufstieg Philipps II. von Makedonien, auf den Athen reagieren<br />
musste - und die Frage nach der richtigen Reaktion war in Athen stark umstritten. Solche<br />
Streitigkeiten wurden oft vor Gericht ausgetragen, und die 330 gehaltene "Kranzrede" des<br />
Demosthenes ist nichts anderes als die Verteidigung eines politischen Lebenswerkes:<br />
Demosthenes war der wichtigste Gegner der Makedonen in Athen gewesen. Die<br />
Beschäftigung mit dieser und anderen Reden führt uns in das Leben eines athenischen<br />
Politikers und Redners, in das Funktionieren des attischen Staates und die Veränderung der<br />
griechischen Welt im 4. Jahrhundert.<br />
Das Seminar führt in die Grund- und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte ein<br />
(Epigraphik, Numismatik und Papyrologie), ferner werden die Hilfsmittel und Methoden<br />
vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele der Umgang mit ihnen eingeübt.<br />
Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine schriftliche Hausarbeit<br />
und eine Abschlussklausur obligatorisch.<br />
Einführende Literatur: Demosthenes, Rede für Ktesiphon über den Kranz, hg. v. W. Zürcher,<br />
Darmstadt 1983; J. Bleicken, Die athenische Demokratie, Paderborn 4 1995; N.G.L. Hammond<br />
- G.Th. Griffith, A History of Macedonia II, Oxford 1979; R. M. Errington, A History of<br />
Macedonia, Berkeley 1990.<br />
45
PD Dr. Johannes Engels<br />
081466 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die griechischrömische<br />
Historiographie und Biographie als Quellengattungen<br />
Di 14-16, Raum: F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller – Flur<br />
Mi 14-16, Raum: F 029, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Keller – Flur<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Das augusteische Zeitalter (31 v. - 14 n. Chr.) markiert in der griechisch-römischen<br />
Geschichte eine wichtige Epochenwende. In einem rückblickend unerhört erfolgreichen,<br />
langjährigen Reformprozess wurden die Fundament für die Ordnung des römischen<br />
Kaiserreiches gelegt. Unter allen Quellen dieser relativ gut dokumentierten Periode der Alten<br />
Geschichte ragt der inschriftlich überlieferte Tatenbericht des Prinzeps am Ende seines langen<br />
Lebens als zeitgenössisches Dokument der Propaganda heraus. Im Seminar werden auf der<br />
Basis der Interpretation dieses Schlüsseltextes und durch Vergleiche mit anderen Quellen die<br />
Grundlagen der neuen Staatsordnung erörtert. Zugleich wird eine allgemeine Einführung in<br />
das Studium der Alten Geschichte (Epochen, Quellenarten, Themenfelder, methodische<br />
Probleme) gegeben.<br />
Das Seminar führt in die Grund- und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte ein<br />
(Epigraphik, Numismatik und Papyrologie), ferner werden die Hilfsmittel und Methoden<br />
vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele der Umgang mit ihnen eingeübt.<br />
Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine schriftliche Hausarbeit<br />
und eine Abschlussklausur obligatorisch.<br />
Literatur: E. Weber, Augustus. Meine Taten. Res Gestae Divi Augusti, Lateinisch-Deutsch,<br />
München 1985 4 (Tusculum); M. Giebel, Augustus Res Gestae. Tatenbericht (Monumentum<br />
Ancyranum), lat., gr. und dt. Übers., komm. und. hg. von M.Giebel, Stuttgart 1975 (oder ND<br />
Reclam); A.K. Bowman - E. Champlin - A. Lintott (Hgg.), The Augustan Empire, 43 B.C. -<br />
A.D. 69, (= CAH vol. X 2 ), Cambridge 1996; J. Bleicken, Augustus. Eine Biographie, Berlin<br />
2000.<br />
N.N.<br />
081485 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: griechisch<br />
Das Seminar führt in die Grund- und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte ein<br />
(Epigraphik, Numismatik und Papyrologie), ferner werden die Hilfsmittel und Methoden<br />
vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele der Umgang mit ihnen eingeübt.<br />
Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine schriftliche Hausarbeit<br />
und eine Abschlussklausur obligatorisch.<br />
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
N.N.<br />
081490 Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Geschichte: römisch<br />
Das Seminar führt in die Grund- und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte ein<br />
(Epigraphik, Numismatik und Papyrologie), ferner werden die Hilfsmittel und Methoden<br />
vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele der Umgang mit ihnen eingeübt.<br />
Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine schriftliche Hausarbeit<br />
und eine Abschlussklausur obligatorisch.<br />
46
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
Dr. Torsten Hiltmann<br />
081834 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Die Geburt<br />
Europas im Frühmittelalter<br />
Do 10-12 und 14-16 Uhr, Raum: F 030, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Europa, das sind für uns vor allem die verschiedenen Länder und Nationen, die es bewohnen,<br />
deren verschiedenen Sprachen und Kulturen. In historischer Perspektive, zumal mit Blick auf<br />
das Mittelalter, denkt man zuallererst an die beiden Universalgewalten, das Kaisertum und<br />
das Papsttum, an Königreiche wie Frankreich und England und natürlich an den alles<br />
bestimmenden Einfluß der christlichen Religion. Doch was aus heutiger Sicht so unwandelbar<br />
vorhanden scheint, ist tatsächlich das Ergebnis vielfältiger Entwicklungen in den ersten<br />
Jahrhunderten des Mittelalters. Wie die Gebiete nördlich der Alpen das Mittelmeer<br />
zunehmend als zentralen Macht- und Kulturraum <strong>ab</strong>lösten, wie aus dem antiken Rom das<br />
mittelalterliche Europa entstand und letztlich die Grundlagen für jenes Europa gelegt wurden,<br />
wie wir es heute kennen, soll Inhalt dieses Seminars sein. Anhand ausgewählter Aspekte<br />
sollen d<strong>ab</strong>ei theoretische Fragen und Sachprobleme der Epoche diskutiert und die<br />
wesentlichen Techniken und Arbeitsmethoden des Studiums der mittelalterlichen Geschichte<br />
kennengelernt werden. Für den Scheinerwerb sind regelmäßige Teilnahme, ein Referat, eine<br />
Abschlußklausur und eine schriftliche Hausarbeit obligatorisch.<br />
Literatur: Hans-Werner GOETZ, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 3. Aufl., Stuttgart 2006.<br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
081849 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte:<br />
„Verfassung“ und „politische Kultur“ im Mittelalter<br />
Mittwoch 8-12, Raum: F 33, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Das europäische Mittelalter war keine barbarische Zeit, kannte <strong>ab</strong>er auch noch keine moderne<br />
Gewaltenkontrolle und Staatlichkeit. Dennoch waren das soziale Leben und die<br />
herrschaftliche Ordnung organisiert, kannte man Verfahrensformen der Rechtsfindung, des<br />
Gerichtsurteils und der Entscheidungsfindung. Anhang exemplarischer Entwicklungen und<br />
Ereignisfelder wird in dem Seminar die Leitfrage behandelt, inwieweit für die mittelalterliche<br />
Gesellschaft bereits von dem Vorhandensein einer Verfassung oder einer politischen Kultur<br />
gesprochen werden kann. Im thematischen Teil des Seminars werden Quellenüberlieferungen<br />
aus der Zeit behandelt, Texte und Bilder, <strong>ab</strong>er auch Kunst- und Bauwerke sowie Zeugnisse<br />
der symbolischen Kultur, und es wird zu prüfen sein, welche modernen Begrifflichkeiten und<br />
Beschreibungsformen sich für eine wissenschaftliche Bearbeitung des Themas eignen. Im<br />
methodischen Teil werden die Historischen Hilfswissenschaften vorgestellt und es wird in die<br />
Methoden kritischen historischen Arbeitens eingeführt.<br />
Lit. Claudia Märtl, Die 101 wichtigsten Fragen. Mittelalter, München 2006; Martha Howell,<br />
Walter Prevenier, Werkstatt des Historikers, Köln 2004.<br />
Nils Bock, M.A.<br />
081853 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Hof und<br />
höfische Kultur im Mittelalter<br />
Di. 10-12h in Raum F 029 und Di. 14-16h in Raum F 153, Beginn: 18.10.<br />
Was ist der mittelalterliche Hof Schon die Zeitgenossen hatten Schwierigkeiten eine klare<br />
Definition des Hofes zu geben oder äußerten sich gar kritisch ihm gegenüber. Auch in der<br />
47
modernen Forschung stellt sich der Hof je nach Perspektive unterschiedlich als Markt<br />
sozialen Tausches, als sozial-diskursives System, als Kommunikationszentrum oder einfach<br />
als das Machtzentrum des alten Europas dar. Tatsächlich bietet der Hof als Zentrum des<br />
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Lebens einen hervorragenden Einblick<br />
in die wichtigsten Strukturen des Mittelalters und in die aktuelle Mittelalterforschung.<br />
Anhand von Quellen unterschiedlicher Gattungen soll sich in dieser Veranstaltung dem<br />
historischen Phänomen des Hofs und der höfischen Kultur genähert werden. Von der<br />
Bearbeitung des Themas ausgehend werden Grundprobleme und –begriffe des Studiums der<br />
mittelalterlichen Geschichte sowie seiner Methoden, Techniken und Hilfsmittel behandelt.<br />
Für den Erwerb eines Leistungsnachweises sind regelmäßige und aktive Teilnahme an den<br />
Sitzungen, die Übernahme eines Referats, das Bestehen einer Abschlussklausur sowie die<br />
Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit obligatorisch.<br />
Im März <strong>201</strong>2 ist eine Exkursion nach Wien geplant.<br />
Literatur: Hans-Werner Goetz: Proseminar Geschichte: Mittelalter, 3. Auflage, Stuttgart 2006;<br />
Mathias Meinhardt u.a. (Hgg.): Mittelalter (Oldenbourg Geschichte Lehrbuch), München<br />
2007; Joachim Bumke: Höfische Kultur: Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, 9.<br />
Aufl. München 1999; Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich: Bilder und<br />
Begriffe, hg. von Werner Paravicini, bearb. von Jan Hirschbiegel und Jörg Wettlaufer, 2 Bde.,<br />
Ostfildern 2005 (Residenzenforschung, 15).<br />
Jan Clauß, M.A.<br />
081868 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Auswärtige<br />
Beziehungen und Kulturpolitik unter Karl dem Großen<br />
Mi 12-14 und Mi 16-18 Raum: F 030, Beginn: 19.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Christian Scholl<br />
081872 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Juden im<br />
mittelalterlichen Reich<br />
Do 12-14 und 16-18, Raum: F 029, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Im thematischen Teil des Proseminars werden verschiedene Aspekte jüdischen Lebens im<br />
mittelalterlichen Reich behandelt. Dazu zählen insbesondere die Anfänge jüdischer<br />
Besiedlung im 9./10. Jahrhundert, das jüdische Gemeindeleben, die Rechtsstellung der Juden<br />
(„Kammerknechtschaft“ und Bürgerstatus), ihre wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder sowie die<br />
vielfältigen Beziehungen zur christlichen Umwelt, die sich von friedlicher Koexistenz zu<br />
beiderseitigem Vorteil (concivilitas) bis hin zu Judenverfolgungen und -vertreibungen<br />
erstreckten. Vor dem Hintergrund dieses Themas gibt der propädeutische Teil des<br />
Proseminars einen Einblick in die Arbeitsweisen, Hilfsmittel und Methoden des Fachs<br />
mittelalterliche Geschichte. Für den Erwerb eines Leistungsnachweises sind neben<br />
regelmäßiger und aktiver Teilnahme ein Referat, eine Abschlussklausur und eine Hausarbeit<br />
erforderlich.<br />
Literatur: Michael Toch, Die Juden im mittelalterlichen Reich (Enzyklopädie deutscher<br />
Geschichte 44), München ²2003; Germania Judaica, Bd. 1: Von den ältesten Zeiten bis 1238,<br />
hg. von Ismar Elbogen, Aron Freiman und Haim Tykocinski, Breslau 1917-1934, Ndr.<br />
Tübingen 1963; Germania Judaica, Bd. 2: Von 1238 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, hg.<br />
von Zvi Avneri, Tübingen 1968; Germania Judaica, Bd. 3: 1350-1519, hg. von Arye Maimon,<br />
Mordechai Breuer und Yacov Guggenheim, Tübingen 1987-2003; Europas Juden im<br />
Mittelalter. Beiträge des internationalen Symposions in Speyer vom 20.-25. Oktober 2002, hg.<br />
von Christoph Cluse, Trier 2004; Hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter<br />
(UTB 1719: Geschichte), Stuttgart ³2006.<br />
48
Dr. Károly Goda<br />
081887 Proseminar: Westmittel- und Ostmitteleuropa im Spätmittelalter: Territorien und<br />
Städte im Vergleich<br />
Mo 10−12, Die 10−12, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Königsstraße 46,<br />
Sitzungszimmer, Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Als Hauptthemen der spätmittelalterlichen Landes- und Städtegeschichte Mitteleuropas<br />
bezeichnet die ältere und traditionelle Forschung die Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte<br />
der deutschen Kerngebiete. Das Schwergewicht der Untersuchungen lag d<strong>ab</strong>ei in der Analyse<br />
der Tätigkeit von Landesherr und Hof, Rat und Gemeinde, der Verfassung und Rechtsetzung,<br />
der Rechtssprechung und der Gerichtsbarkeit sowie des allgemeinen Finanzwesens.<br />
Zusätzlich zu diesen Inhaltsfeldern widmet das Proseminar besondere Aufmerksamkeit den<br />
sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekten. Weiterhin unterscheiden sich die mittelalterlichen<br />
Territorien und Städte Ostmitteleuropas genuin auf vielfältige Weise von denjenigen im<br />
Reich. In der Zusammenschau wird es also nicht zuletzt darum gehen, Unterschiede und<br />
Gemeinsamkeiten in der spätmittelalterlichen Landes- und Städtegeschichte Mitteleuropas<br />
kennenzulernen. Ziel des Proseminars ist es, Zugänge zur spätmittelalterlichen Geschichte zu<br />
erarbeiten und einen Überblick zu den Charakteristika der ob genannten historischen<br />
Thematik im Zeitraum von etwa 1200 bis 1500 zu geben. Die allgemeine Besonderheiten und<br />
Gemeinsamkeiten der mitteleuropäischen Territorien und Städte sowie ihre zeitspezifischen<br />
und zeitübergreifenden Aspekte und Bedeutungen sollen vergleichend untersucht werden.<br />
Ausgehend von einem strukturellen Überblick wird das Proseminar die Problematik aus ganz<br />
unterschiedlichen, etwa sozial-, kultur- und rechtsgeschichtlichen Perspektiven betrachten, um<br />
die Komplexität des Themas zu vermitteln. Für den Scheinerwerb sind rege Mitarbeit in den<br />
Sitzungen, die Übernahme eines Referats, das Verfassen einer schriftlichen Hausarbeit und<br />
das Bestehen einer Abschlussklausur obligatorisch. Teilnehmerzahl: maximal 20 Studierende<br />
(bitte bis zum 01.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> per E-mail anmelden!) E-mail: karoly.goda@gmail.com<br />
Einführende Literatur: Josef Engel (Hg.): Grosser Historischer Weltatlas. 3 Bde. und<br />
Kommentarbde., 2. Aufl., München, 1979; Friedrich-Wilhelm Henning: Handbuch der<br />
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands. Bd. 1. Deutsche Wirtschafts- und<br />
Sozialgeschichte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Paderborn, 1991; Eberhard<br />
Isenmann: Die deutsche Stadt im Spätmittelalter. 1250–1500. Stadtgestalt, Recht,<br />
Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft. Stuttgart, 1988; Georg Wilhelm Sante:<br />
Geschichte der deutschen Länder. „Territorien-Ploetz”, Bd. 1. Würzburg,1964.<br />
PD Dr. Alhedydis Plassmann<br />
082879 Proseminar: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte:<br />
Königserhebung und Königswahl im Mittelalter<br />
Mi 12- 14 in Raum F 3, Fr 12-14 in Raum ULB 101, Beginn: 26.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Inhaltlich soll im Seminar die Frage behandelt werden, wie man im Mittelalter König wurde.<br />
Die Frage nach der Königswahl hat die Forschung insbesondere die sogenannte<br />
Verfassungsgeschichte des Mittelalters schon lange intensiv beschäftigt. Dass die Erhebung<br />
zum König d<strong>ab</strong>ei keineswegs nach festen Regeln verlief, ist ebenso hervorzuheben wie die<br />
Unterschiede in den verschiedenen Reichen Europas im frühen und hohen Mittelalter. Über<br />
das Semester hinweg sollen Entwicklungslinien und Grundgegebenheiten von<br />
Königserhebung und –wahl herausgearbeitet werden. Sukzessive werden im Seminar anhand<br />
des Themas Methoden und Arbeitsweisen der Mediävistik und der Hilfswissenschaften<br />
vorgestellt.<br />
49
Literatur: Art. König, Art. Wahl im Lexikon des Mittelalters.; Art. König, Art. Königswahl,<br />
Art. Kurfürsten im Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte.; H. Mitteis, Die<br />
Deutsche Königswahl. Ihre Rechtsgrundlagen bis zur Goldenen Bulle, Darmstadt 1987 (ND<br />
der 2. erweiterten Auflage von 1944); J. Rogge, Die deutschen Könige im Mittelalter – Wahl<br />
und Krönung, Darmstadt 2006.<br />
Tim Neu, M.A.<br />
081891 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Gegen Tyrannei und<br />
Korruption Republiken und Republikanismus in der Frühen Neuzeit<br />
Mo 12:00-14:00, Mo 16:00-18:00 Raum: F 029, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Wenn von der heute international maßgeblichen Staatsform – mehr als zwei Drittel aller<br />
Staaten der Erde bezeichnen sich als ‚Republik„ – die Rede ist, so wird sie regelmäßig als<br />
Produkt einer spezifisch ‚westlichen„ Entwicklung dargestellt, die von der Antike bis zu<br />
Gegenwart reicht. In diesem Vergangenheitskonstruktion kommt nun der Frühen Neuzeit eine<br />
Schlüsselrolle zu: Im Italien der Renaissance soll aus der Kombination antiker Philosophie<br />
und mittelalterlichen Gemeindestrukturen ein ‚klassischer Republikanismus„ entwickelt<br />
worden sein, der dann – vermittelt v.a. über das kurzlebige englische ‚Commonwealth„ des<br />
17. Jahrhunderts – sowohl die Amerikanische als auch die Französische Revolution<br />
beeinflusste und letztlich dazu beitrug, die repräsentativ-rechtsstaatlich verfasste Republik als<br />
Inbegriff des modernen Staates zu et<strong>ab</strong>lieren. Allerdings hebt diese Darstellung einseitig und<br />
verkürzend die ‚modernen„ Aspekte der Frühen Neuzeit heraus. Im Zentrum des Proseminars<br />
steht daher der Versuch, im Rahmen einer Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten die<br />
Eigenart und Komplexität der frühneuzeitlichen Republiken und<br />
Republikanismuskonzeptionen zu erschließen, um auf diese Weise ein kritisches Verhältnis<br />
zu einem wichtigen Element des politischen Systems der Gegenwart zu ermöglichen.<br />
Literatur: Birgit Emich, Geschichte der Frühen Neuzeit studieren, Konstanz 2006 (=UTB<br />
2709); Winfried Schulze, Einführung in die neuere Geschichte, 5., überarb. und aktualisierte<br />
Aufl., Stuttgart <strong>201</strong>0 (=UTB 1422); Wolfgang E. J. Weber: Republikanismus, in: Friedrich<br />
Jaeger u.a. (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 11, Stuttgart/Weimar <strong>201</strong>0, S. 88–95;<br />
Thomas Maissen: Republiken unter Monarchien: Europa im 17. Jahrhundert, in: ders., Die<br />
Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen<br />
Eidgenossenschaft, Göttingen 2006, S. 77–163.<br />
N.N.<br />
081906 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die USamerikanische<br />
Revolution: „Geschichte der Un<strong>ab</strong>hängigwerdung der vereinigten Kolonien“ in<br />
Nordamerika, 1760-1790<br />
Di. 10-12, Mi. 10-12 Raum: F 030, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Amerikanische Revolution, der zentrale Gründungsmythos der USA wird in der<br />
populären Wahrnehmung oft auf Parolen, Ikonen und Legenden reduziert. Ziel des Seminars<br />
ist es, diese Narrative zu hinterfragen und einzuordnen sowie die Ereignisse der<br />
amerikanischen Staatsgrünung in ihrer Komplexität nachzuvollziehen. Wie wirkte sich der<br />
Un<strong>ab</strong>hängigkeitskrieg auf verschiedene Teile der kolonialen Gesellschaft aus Welche<br />
Debatten begleiteten die Ausarbeitung der US-amerikanischen Verfassung Bei einem<br />
nationalgeschichtlich so prägenden Ereignis gilt es auch die kulturellen Nachwirkungen zu<br />
bedenken, vor allem <strong>ab</strong>er muss die historiographische Einordnung thematisiert werden. Nicht<br />
zuletzt stellt sich die Frage: Handelt es sich hier überhaupt um eine Revolution<br />
Der größte Teil der themenrelevanten Forschungsliteratur und damit auch der Seminartexte ist<br />
in englischer Sprache.<br />
50
Vorbereitende Literatur: Cogliano, Frank. Revolutionary America, 1763-1815. A Political<br />
History. London: Routledge, 2000; Gibson, Alan: Interpreting the Founding. Guide to the<br />
Enduring Debate over the Origins and Foundations of the American Republic. Lawrence:<br />
University Press Kansas, 2006; Lerg, Charlotte. Die Amerikanische Revolution. Tübingen:<br />
UTB/Profile, <strong>201</strong>0.<br />
Dr. Debora Gerstenberger<br />
081910 Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Geschichte der Stadt in<br />
Lateinamerika<br />
Mittwoch 10-12 in Raum S 10, Mi 14-16 Uhr in Raum ULB 101, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Stadt gilt als „Motor“ des historischen Wandels. Wenn Städten in der (Neueren)<br />
Geschichte allgemein eine wichtige Rolle zukommt, so gilt dies in besonderem Maße für die<br />
Städte Lateinamerikas. Ohne urbane Zentren hätten sich die Kolonialmächte Spanien und<br />
Portugal vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in Lateinamerika nicht behaupten können. Doch<br />
gerade hier wurde andererseits koloniale Herrschaft geschwächt und bekämpft: Die<br />
Un<strong>ab</strong>hängigkeitsbewegungen im 19. Jahrhundert gingen nicht zufällig maßgeblich von<br />
Städten aus. Im 20. Jahrhundert waren die Metropolen Lateinamerikas Orte der<br />
Industrialisierung und Modernisierung, auf sie wurde die Hoffnung einer (nachholenden)<br />
Entwicklung projiziert. In aktuellen Prozessen der Globalisierung schließlich spielen „global<br />
cities“ wie Mexiko-Stadt und São Paulo eine herausragende Rolle. Da in urbanen Räumen<br />
stets unterschiedliche Welten aufeinanderprallen, waren und sind Städte jederzeit auch<br />
Schauplätze gewaltsamer Auseinandersetzungen. In diesem Proseminar sollen wichtige<br />
Themen der Neueren Geschichte anhand der lateinamerikanischen Stadt analysiert werden,<br />
zum Beispiel die St<strong>ab</strong>ilisierung und Dest<strong>ab</strong>ilisierung von Herrschaft, die (vermeintlichen)<br />
Gegensätze zwischen Tradition und Moderne sowie unterschiedliche soziale, religiöse und<br />
ethnische Ungleichheiten und Konflikte. Spanisch- oder Portugiesischkenntnisse sind keine<br />
Bedingung für die Teilnahme, Englischkenntnisse (Lesefähigkeit) werden jedoch<br />
vorausgesetzt.<br />
Literatur: Gilbert, Alan (1994): The Latin American City. London: Latin America Bureau;<br />
Jacobs, Jane M. (1996): Edge of Empire. Postcolonialism and the City. London: Routledge;<br />
Löw, Martina; Steets, Silke; Stoetzer, Sergej (2008): Einführung in die Stadt- und<br />
Raumsoziologie. 2., aktualisierte Aufl. Opladen: Budrich (UTB Soziologie, 8348).<br />
N.N.<br />
081978 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Es wird kalt.<br />
Polarforschung im 19. Jahrhundert<br />
Dienstag 14-18 Uhr, Raum: F 104, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Jürgen Osterhammel hat in seiner epochalen Studie über »Die Verwandlung der Welt« darauf<br />
hingewiesen, dass das Reisen im 19. Jahrhundert »mehr als jemals zuvor […] zur Quelle<br />
wissenschaftlicher Autorität« wurde und sich d<strong>ab</strong>ei individuelle geographische<br />
Einzelleistungen in eine »wissenschaftliche Disziplin, also ein durch Institutionen<br />
<strong>ab</strong>gesichertes Kollektivunternehmen« transformierten. Dieser Transformationsprozess soll<br />
beginnend mit den frühen geographischen Expeditionen des 19. Jahrhunderts bis hin zum<br />
Wettlauf zu den Polen exemplarisch erschlossen werden. Die Polarforschung steht d<strong>ab</strong>ei<br />
symptomatisch für das letzte Zeitalter der Entdeckungen zwischen nationalen Expeditionen<br />
und internationalen Kooperationen. Neben Expeditionstagebüchern und Reiseberichten<br />
werden Bilder und Karten Berücksichtigung finden, die d<strong>ab</strong>ei halfen, neue Wissensdiskurse<br />
und Vorstellungsmuster über die polaren Regionen zu et<strong>ab</strong>lieren, übernahmen doch in der<br />
Polarforschung wie anderswo Photographien Beglaubigungs- und Versachlichungsfunktionen,<br />
51
die <strong>ab</strong> der Jahrhundertwende auch Einzug in populärwissenschaftliche Publikationen hielten.<br />
Doch Werke der bildenden Kunst hatten einen nicht geringen Anteil am polaren<br />
Imaginationsprozess, denn un<strong>ab</strong>hängig vom wissenschaftlichen Charakter der jeweiligen<br />
Forschungsreisen speisten sich die Darstellungen »immer auch aus Elementen des<br />
Abenteuerlichen, Heroischen und Geheimnisvollen« (Dorit Müller).<br />
Thomas Tippach<br />
081925 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Der preußische<br />
Verfassungskonflikt<br />
Di 12-14 in Raum ULB 101 und Mi 12-14 in Raum F 102, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Der preußische Verfassungskonflikt gehört zu den entscheidenden Wendepunkten in der<br />
preußisch-deutschen Geschichte zwischen der Revolution von 1848 und der Gründung des<br />
Kaiserreichs. Aus den Debatten über die Heeresreorganisation seit 1859 erwuchs ein<br />
grundsätzlicher Konflikt, der sich auf die Alternativen „Königsherrschaft oder<br />
Parlamentsherrschaft, Militärstaat oder Verfassungsstaat“ (Langewiesche) zuspitzen lässt. Die<br />
Auseinandersetzung endete bekanntlich mit der Niederlage der preußischen Liberalen. Das<br />
Seminar will Ursachen, Verlauf und Ausgang des Konflikts untersuchen und hierbei vor allem<br />
seine Bedeutung für die Entwicklung des Liberalismus im Deutschen Reich untersuchen.<br />
Literaturhinweise: Friedrich Lenger, Industrielle Revolution und Nationalstaatsgründung<br />
(Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 15), Stuttgart 2003; Dierk Walter,<br />
Preußische Heeresreformen 1807-1870. Militärische Innovation und der Mythos der<br />
“Roonschen Reform” (Krieg in der Geschichte 16), Paderborn, München, Wien, Zürich 2003;<br />
Andreas Biefang, Politisches Bürgertum in Deutschland 1857-1964. Nationale Organisationen<br />
und Eliten, Düsseldorf 1994; Rolf Helfert, Der preußische Liberalismus und die Heeresreform<br />
von 1860, Bonn 1989.<br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
081930 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Katholiken im<br />
Kaiserreich: Die Bistümer Münster und Paderborn 1871-1914<br />
Mo 14-18 Uhr, Raum: F3 Erdgeschoss, Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Das Verhältnis der Katholiken zum Deutschen Reich protestantisch-preußischer Prägung war<br />
spannungsgeladen und von gegenseitigem Misstrauen geprägt: Für die Verfechter des<br />
Liberalismus und für die preußischen Eliten galten die Katholiken als „Innere Reichsfeinde“<br />
und von Rom gesteuert; für die Katholiken galt der Staat als Instanz, welche sich in die<br />
Belange der Kirche einmischte und die öffentliche Manifestation des Glaubens einschränkte.<br />
Zudem standen weite Teile der katholischen Hierarchie vielen Aspekten gesellschaftlicher<br />
und kultureller Modernisierung, wie sie das Deutsche Reich erlebte, <strong>ab</strong>lehnend gegenüber.<br />
Am Beispiel der westfälischen Bistümer will das Proseminar diese Konfliktlinien, <strong>ab</strong>er auch<br />
die allmähliche Annäherung nach 1890 untersuchen. Gegenstand werden im ersten Teil die<br />
inneren Strukturen des Katholizismus um 1900 sein, also das sog. Katholische Milieu mit<br />
seinen Vereinen, den spezifischen Frömmigkeitsformen, der starken Stellung der kirchlichen<br />
Hierarchie und dem Zentrum. Im zweiten Teil geht es um die staatlichen Restriktionen im<br />
Rahmen des „Kulturkampfes“ und die Widerständigkeiten seitens der Katholiken; es folgt<br />
eine Betrachtung des katholischen Patriotismus im Zeitalter Wilhelms II.<br />
Literatur: Es wird von Woche zu Woche ein Reader durchgearbeitet.<br />
Dr. Daniel Schmidt<br />
081944 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Krise und Untergang<br />
der Weimarer Republik 1929-1933 (A 4, B 2)<br />
52
Di 10-12 in Raum F 6, Do 10-12 in Raum ULB 1, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Das Scheitern der Weimarer Republik stellte die Weichen für das „Dritte Reich“. Nicht<br />
zuletzt dieser Zusammenhang hat dazu geführt, dass die (zweite) Krisenphase der ersten<br />
deutschen Republik bis heute Gegenstand ebenso umfangreicher wie kontroverser<br />
Erörterungen der Geschichtswissenschaft ist. Im Mittelpunkt des Proseminars stehen die<br />
Ursachen für den Untergang der Republik, die anhand der eingehenden Untersuchung der<br />
verschiedenen politisch-sozialen Akteure und ihrer politisch-kulturellen Praktiken erarbeitet<br />
werden sollen. Es gilt also zu klären, unter welchen Umständen sich die ökonomische Krise<br />
seit 1929 zur letztlich tödlichen politischen und gesellschaftlichen Systemkrise ausweiten<br />
konnte.<br />
Das Proseminar hat das Ziel, Studienanfänger am Beispiel seines inhaltlichen Schwerpunkts<br />
in die grundlegenden Methoden, Arbeitstechniken und Hilfsmittel der Neueren und Neuesten<br />
Geschichte einzuführen. Für den Erwerb eines Leistungsnachweises sind neben regelmäßiger<br />
aktiver Teilnahme die Gestaltung einer Sitzung, das Bestehen einer Abschlussklausur sowie<br />
das Verfassen einer schriftlichen Hausarbeit erforderlich.<br />
Einführende Literatur: Blasius, Dirk: Weimars Ende. Bürgerkrieg und Politik 1930-1933,<br />
Göttingen 2005; Jasper, Gotthard: Die gescheiterte Zähmung. Wege zur Machtergreifung<br />
Hitlers 1930-1934, Frankfurt a. M. 1986; Marcowitz, Reiner: Die Weimarer Republik 1929-<br />
1933, Darmstadt 2005; Swett, Pamela E.: Neighbors and Enemies. The Culture of Radicalism<br />
in Berlin, 1929-1933, Cambridge (UP) 2005.<br />
Dr. Stefan Lehr<br />
081955 Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Flucht, Vertreibung und<br />
Zwangsaussiedlung in und aus Ostmitteleuropa im 20. Jh.<br />
Do 8-12, Raum: F 33, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Vertreibung von mehr als 11 Millionen Deutschen aus dem östlichen Europa seit dem<br />
Ende des Zweiten Weltkriegs innerhalb von wenigen Jahren ist ein zentrales geschichtliches<br />
Ereignis, welches den Charakter Ostmitteleuropas grundlegend verändert hat und für viele<br />
Menschen mit Leid, Verlusten und einem völligen Neuanfang verbunden war. Bis heute ist<br />
das Thema aktuell und in den Medien gegenwärtig. So wird über die geplante Ausstellung der<br />
„Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ und einen Vertriebenen-Gedenktag diskutiert.<br />
Auch in den bilateralen Beziehungen Deutschlands zu seinen beiden östlichen Nachbarn<br />
Polen und Tschechien spielen die Ereignisse von damals noch heute eine wichtige Rolle.<br />
Ziel des Proseminars ist es, Voraussetzung, Verlauf und Folgen dieses vielschichtigen<br />
Prozesses zu untersuchen und in den internationalen Kontext zu stellen. So soll auf die<br />
deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa, die NS-Okkupationspolitik, die Politik der<br />
Alliierten bei der Beschlussfassung und vergleichbare Vorgänge in der Vergangenheit<br />
eingegangen werden. Der letztlich nicht einheitliche Verlauf von Flucht, wilder Vertreibung<br />
und organisierter Zwangsaussiedlung wird d<strong>ab</strong>ei ebenso behandelt werden wie die Integration<br />
und Rolle der Vertriebenen in der BRD und DDR.<br />
Einführende Literatur: Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939-1959. Atlas zur<br />
Geschichte Ostmitteleuropas. Hg. von der Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2009;<br />
Detlef Brandes, Holm Sundhaussen, Stefan Troebst (Hg.): Lexikon der Vertreibungen.<br />
Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts,<br />
Wien <strong>201</strong>0; Wolfgang Benz (Hg.): Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Ursachen,<br />
Ereignisse, Folgen. Neuausg<strong>ab</strong>e, Frankfurt am Main 1995; Eva Hahn, Hans Henning Hahn:<br />
Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte. Paderborn u.a. <strong>201</strong>0,<br />
Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945.<br />
53
München 2008; Norman Naimark, "Fires of Hatred". Ethnic Cleansing in Twentieth - Century<br />
Europe. Cambridge 2001.<br />
Christoph Lorke<br />
081963 Proseminar: Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Zwischen<br />
Abgrenzung und Verflechtung. Deutsch-deutsche Geschichte 1949-1989<br />
Montags, 12-14 und 14-16 Uhr, Raum: F 043, Anfangsdatum: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Wiedervereinigung von 1990 markierte einen grundlegenden Paradigmenwechsel für die<br />
zeitgeschichtliche Historiographie: Wie sollte deutsch-deutsche Geschichte für die Zeit der<br />
Teilung angemessen konzipiert und verfasst werden Seither h<strong>ab</strong>en zahlreiche Zeithistoriker<br />
den Versuch unternommen, konzeptionelle Antworten auf diese Frage zu liefern und d<strong>ab</strong>ei<br />
neben <strong>ab</strong>weichenden auch die integrierenden Elemente einer seit Beginn des Kalten Krieges<br />
prima vista getrennt verlaufenen Entwicklung zu berücksichtigen.<br />
Das Proseminar nimmt die 40 Jahre zwischen beiden Staatsgründungen und dem Mauerfall in<br />
den Blick. Neben unbestritten starken Eigenentwicklungen in Bundesrepublik wie DDR g<strong>ab</strong><br />
es in jener Zeit der Teilung nicht zuletzt viele Elemente, die ohne die wechselseitige<br />
Verflechtung und Abgrenzung nicht angemessen zu verstehen sind. D<strong>ab</strong>ei waren beide<br />
deutsche Staaten nicht nur in politisch relevanten Ereignissen – genannt sei der 17. Juni 1953,<br />
der Mauerbau 1961 oder die Entspannungspolitik in den 1970er Jahren – stets aufeinander<br />
bezogen, auch gesellschaftlich, ökonomisch und kulturell g<strong>ab</strong> es zahlreiche Momente der<br />
Verflechtung und Abgrenzung. Diese Konstellation soll im Seminar aufgegriffen und im<br />
Sinne einer „asymmetrisch verflochtenen Parallelgeschichte“ (Christoph Kleßmann)<br />
beleuchtet werden. D<strong>ab</strong>ei soll versucht werden, sowohl dem Trennenden als auch dem<br />
Verbindenden der deutsch-deutschen Beziehungsgeschichte nach 1949 nachzugehen.<br />
Im Seminar sollen die Studierenden mit den grundlegenden Methoden und Techniken der<br />
Neueren und Neuesten Geschichte vertraut gemacht werden. Hierfür sind umfangreiche<br />
praktische Übungsanteile vorgesehen. Für einen Leistungsnachweis sind neben einer<br />
regelmäßigen und aktiven Teilnahme das Halten eines Referats, das Bestehen einer Klausur<br />
sowie das Verfassen einer Hausarbeit erforderlich.<br />
Empfohlene Literatur zur Einführung: Bauerkämper, Arnd u.a. (Hg.): Doppelte<br />
Zeitgeschichte. Deutsch-deutsche Beziehungen 1945-2000, Berlin 1999; Bender, Peter:<br />
Episode oder Epoche Zur Geschichte des geteilten Deutschland, München 1997; Jarausch,<br />
Konrad H.: „Die Teile als Ganzes erkennen“. Zur Integration der beiden deutschen<br />
Nachkriegsgeschichten, in: Zeithistorische Forschungen, 1 (2004), H.1, S. 1-14; Kleßmann,<br />
Christoph: Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955 - 1970, Bonn 1972; Möller,<br />
Frank/ Mählert, Ulrich (Hg.): Abgrenzung und Verflechtung. Das geteilte Deutschland in der<br />
zeithistorischen Debatte, Berlin 2008; Wengst, Udo/ Wentker, Hermann: Das doppelte<br />
Deutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz, Bonn 2008; Wentker, Hermann: Zwischen<br />
Abgrenzung und Verflechtung: deutsch-deutsche Geschichte nach 1945, in: Aus Politik und<br />
Zeitgeschichte 1/2 (2005), S. 10-17 (auch online einsehbar).<br />
3. Kurse<br />
Seminar für Alte Geschichte<br />
Die Anmeldelisten zu den Kursen, Hauptseminaren und Übungen im WS <strong><strong>201</strong>1</strong>/<strong>201</strong>2<br />
liegen in der Zeit<br />
vom 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 15.07.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12) und<br />
vom 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12)<br />
54
im Hilfskraftzimmer (Zimmer 247) bzw. in den Geschäftszimmern (Zimmer 246 u. 248)<br />
des Seminars für Alte Geschichte aus.<br />
Eine Anmeldung nur in HISLSF ist nicht zulässig!!<br />
Historisches Seminar: Abteilung Mittelalterliche Geschichte und Neuere und Neueste<br />
Geschichte<br />
Abgesehen von den Kursen von Frau Fertig ist keine Anmeldung notwendig. Die<br />
Anmeldelisten für Frau Fertig liegen in der Zeit<br />
vom 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 15.07.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12) und<br />
vom 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12)<br />
im Sekretariat der Wirtschaftsgeschichte (Fürstenberghaus, R. 138) aus.<br />
Dr. Michael Jung<br />
081409 Kurs: Die griechische Staatenwelt von den Perserkriegen bis zur Schlacht von<br />
Leuktra<br />
Do 16-18, Raum: F 2, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 1. OG, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Geschichte der griechischen Staatenwelt in der „Klassik“ soll im Mittelpunkt dieses<br />
Kurses stehen. Die Entwicklungschancen der inneren Ordnung der Polisverfassungen sollen<br />
ebenso diskutiert werden wie die außenpolitischen Perspektiven der griechischen Staatenwelt<br />
seit der Konfrontation mit der Expansion des Perserreichs. Exemplarisch sollen auch aktuelle<br />
Forschungsprobleme erörtert werden.<br />
Literatur: Rhodes, Peter J., A History of the Classical Greek World. 478 – 323 B.C. Blackwell<br />
– Malden – Oxford 2006.<br />
Die Anmeldelisten zu den Kursen, Hauptseminaren und Übungen im WS <strong><strong>201</strong>1</strong>/<strong>201</strong>2 liegen in<br />
der Zeit<br />
vom 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 15.07.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12) und<br />
vom 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12)<br />
im Hilfskraftzimmer (Zimmer 247) bzw. in den Geschäftszimmern (Zimmer 246 u. 248) des<br />
Seminars für Alte Geschichte aus.<br />
Eine Anmeldung nur in HISLSF ist nicht zulässig!!<br />
N.N.<br />
081394 Kurs:<br />
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
Torben Gebhardt, M.A.<br />
081982 Kurs zur mittelalterlichen Geschichte<br />
Do 18-20, Raum: H 2, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Dr. Károly Goda<br />
082864 Kurs: Adventus, Extroitus and Processio: Ceremonial Culture in Late Medieval<br />
Western and Central Europe<br />
Di 12-14, Raum: S 2, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
The main aim of this course held in English is to provide an international introduction into the<br />
closely interwoven cultural relationships between ecclesiastical and secular ceremonies and<br />
territorial and local politics through presenting the integrating and legitimising role of late<br />
55
medieval and Renaissance entries, acts of departures and various processions. These cultural<br />
acts occasionally created, implemented and reflected social and political rule and order<br />
utilising the staging of religious ceremonies in a secular context. Besides shaping and selffashioning<br />
regional and local communal identities these secular and/or religious performances<br />
functioned both in Western and Central Europe as spheres of conflict and co-operation<br />
between local interest groups and mighty external, i.e. ecclesiastical, ducal and royal<br />
influences. The course presenting interregional, cross-disciplinary and comparative examples<br />
intends to put under scrutiny the comprehensive transformation of the latter political and<br />
cultural phenomena through analyzing textual as well as visual sources. The course focuses<br />
not only on the organizers and participants but also on the meaning of the ceremonials<br />
shaping communal, regional and state identities. Accordingly, themes dedicated to allinclusive<br />
or smaller regional or local ceremonies targeting the spheres of spirituality and<br />
politics in Western and Central Europe are widely incorporated. The course embraces a<br />
number of different methodological approaches ranging from historical anthropology over the<br />
theories of communication to the new concepts of „spatial turn”. Among the main topics the<br />
cultural (re)formation of regional political and religious hierarchies, the means of external<br />
interventions and the (re)invention of the ceremony as a „lieu de mémoire” deserve a special<br />
attention. Please register until 01.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> via e-mail: karoly.goda@gmail.com<br />
Literature: Barbara A. Hanawalt – Kathryn L. Ryerson (eds.): City and Spectacle in Medieval<br />
Europe. Medieval Studies at Minnesota 6, Minneapolis, 1994; Alexandra F. Johnston – Wim<br />
Hüsken (eds.): Civic Ritual and Drama. “Ludus” Medieval and Early Renaissance Theatre<br />
and Drama 2, Amsterdam – Atlanta, GA, 1997; Kathleen Ashley – Wim Hüsken (eds.):<br />
Moving subjects. Processional performance in the Middle Ages and the Renaissance. “Ludus”<br />
Medieval and Early Renaissance Theatre and Drama 5, Amsterdam – Atlanta, GA, 2001;<br />
Peter Johanek – Angelika Lampen (Hg.): Adventus. Studien zum herrscherlichen Einzug in<br />
die Stadt. Städteforschung A 75, Köln/Weimar/Wien, 2009; Katja Gvozdeva – Hans Rudolf<br />
Velten (Hg.): Medialität der Prozession. Performanz ritueller Bewegung in Texten und<br />
Bildern der Vormoderne / Médialité de la procession. Performance du mouvement rituel en<br />
textes et en images à l‟époque pré-moderne. Germanisch-romanische Monatsschrift Beiheft<br />
39, Heidelberg, <strong><strong>201</strong>1</strong>.<br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
081997 Kurs: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der spätmittelalterlichen Stadt<br />
Mi 10-12 Uhr, Raum: F 2, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die neue Kulturgeschichte des Politischen und die Kommunikationsgeschichte h<strong>ab</strong>en sozialund<br />
wirtschaftsgeschichtliche Zugriffe auf die Stadt des Mittelalters in den Hintergrund treten<br />
lassen. Die Vorlesung will demgegenüber die Erträge der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte<br />
bilanzieren, <strong>ab</strong>er auch Engführungen aufzeigen. Dass die Stadt des Okzidents im Kern<br />
Marktort und Gewerbezentrum war, soll ebenso behandelt werden wie die soziale Schichtung<br />
der Stadt. In einem weiteren Zugriff sollen Städtetypen und funktionale Beziehungen des<br />
„Stadtkörpers“ diskutiert werden. Es wird ein Anliegen sein, auch die Methoden der<br />
Stadtgeschichte vorzustellen, etwa Kartographie, Sozialtopographie, Prosopographie und<br />
Netzwerkanalyse.<br />
Literatur: Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter 1250-1500. Stadtgestalt,<br />
Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart 1988; Felicitas Schmieder,<br />
Die mittelalterliche Stadt, Göttingen 2005.<br />
Christian Müller<br />
56
082003 Kurs: Mechanismen des Internationalismus – Aspekte einer Globalgeschichte der<br />
internationalen Ordnung, 1848-1949<br />
Mo 14-16, Raum: H 4, Beginn 17.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Möglichkeiten der Nationalstaaten zur Beeinflussung und Lenkung der internationalen<br />
Politik sind in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, und internationale Organisationen<br />
nehmen in Zeiten fortschreitender Globalisierung weltweit mehr Einfluss auf Politik und<br />
Gesellschaft. Allerdings sind dies keine genuin neuen Phänomene einer modernen<br />
Globalisierung, sondern sie lassen sich historisch in der Entwicklung der internationalen<br />
Ordnung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verorten. In dem Kurs sollen die Entstehung von<br />
Abkommen, Regierungsorganisationen und Staatenbünden wie der Völkerbund und die UNO<br />
ebenso in den Blick genommen werden wie die Mechanismen der Institutionalisierung,<br />
Differenzierung und Verdichtung grenzübergreifender Kontakte. Internationale<br />
Ausstellungen, Konferenzen und Nicht-Regierungsorganisationen sowie die Bedeutung<br />
verbindender Akteure und Akteursgruppen stehen hierbei im Vordergrund.<br />
Im Verlauf des Kurses werden zunächst Begriffe, Forschungsansätze und Erkenntnisziele<br />
thematisiert und formuliert. Danach werden die Entwicklungen und Verknüpfungen zwischen<br />
internationalem Staatensystem und der Ausbildung von grenzübergreifenden Netzwerken und<br />
Organisationen bis zum Beginn des ersten Weltkrieges (1840-1914) ein Hauptthema sein.<br />
Exemplarisch wird dies an Weltausstellungen, Friedens- und Völkerrechtsbewegungen,<br />
religiösen und wissenschaftlichen Kongressen aufgezeigt. Ein zweites Hauptthema bilden die<br />
Weltstaatkonzepte zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Errichtung und Praxis des<br />
Völkerbundes als Fortführung internationaler Ordnungsvorstellungen vor dem ersten<br />
Weltkrieg. Ein dritter Themenkomplex widmet sich der Ausweitung der europäischen Politik<br />
als internationalem System hin zu einem globalen Politiksystem unter den Bedingungen der<br />
Moderne mit Einbeziehung der USA, Südamerikas, Japans, Chinas und Indiens zwischen den<br />
1870er und den 1920er Jahren. In einem vierten Themenkomplex sollen die<br />
Internationalismus-Probleme der 1930er Jahre und die Errichtung einer internationalen<br />
Nachkriegsordnung mit der Entstehung der UNO und der Menschenrechtscharta in den Blick<br />
genommen werden. Abschließend werden die Transformationsprozesse der internationalen<br />
Ordnung zwischen Kaltem Krieg und Gegenwart problematisiert.<br />
Lesekenntnisse im Englischen sind notwendig und werden für die begleitende Text- und<br />
Quellenlektüre in begrenztem Maße vorausgesetzt. Der Leistungsnachweis wird durch eine<br />
Abschlussklausur am Semesterende erbracht.<br />
Literatur zur Einführung: Madeleine Herren, Internationale Organisationen seit 1865. Eine<br />
Globalgeschichte der internationalen Ordnung (Darmstadt, 2009); F.S.L. Lyons,<br />
Internationalism in Europe 1815-1914 (Leyden, 1963); Martin H. Geyer, Johannes Paulmann<br />
(Hg.), The Mechanisms of Internationalism (Oxford-New York, 2001); Akira Iriye, Pierre-<br />
Yves Saunier (Hg.), The Palgrave Dictionary of Transnational History (Basingstoke, 2009).<br />
Christine Fertig<br />
08<strong>201</strong>8 Kurs: Familie, Verwandtschaft und Haushalt in der Neuzeit<br />
Mo 14-16, Raum: F 6, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Bis zur Durchsetzung einer industriellen Produktionsweise und dem Aufkommen der<br />
modernen Sozialversicherung seit dem späten 19. Jh. war der Haushalt der dominierende Ort<br />
der Produktion, <strong>ab</strong>er auch der materiellen und der kulturellen Reproduktion. Die Familie gilt<br />
daneben als Vermittlungsinstanz zwischen Individuen, Institutionen und den Prozessen des<br />
sozialen Wandels. Über den Kontext von Familie und Haushalt hinaus reichen<br />
verwandtschaftliche Beziehungen, deren Bedeutung für die materielle und soziale<br />
Reproduktion in der modernen Welt erst seit wenigen Jahren thematisiert wird. Die Übung<br />
57
erarbeitet wichtige Ergebnisse der neuen historischen Forschung zu Familie, Verwandtschaft<br />
und häuslicher Arbeit. Darüber hinaus werden wir uns mit Quellen und Methoden der<br />
angesprochenen Forschungsfelder beschäftigen.<br />
Literaturhinweise: Marzio Barbagli und David Kertzer (Hg.): The History of the European<br />
Family (New Haven 2001); Andreas Gestrich: Geschichte der Familie im 19. und 20.<br />
Jahrhundert (=Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd. 50, München 1999); David W. S<strong>ab</strong>ean,<br />
Simon Teuscher und Jon Mathieu (Hg.): Kinship in Europe. Approaches to Long-Term<br />
Development 1300-1900 (New York u. a. 2007).<br />
Die Teilnahme ist auf 30 Studierende begrenzt. Eine Anmeldung im Sekretariat von Frau<br />
Schlee (R 138) ist für die Teilnahme verbindlich.<br />
Rüdiger Schmidt<br />
082022 Kurs zur Neueren und Neuesten Geschichte: Deutsche Außenpolitik 1871-1939<br />
Montag 18-20 h, Raum: F 2, Beginn: zweite Vorlesungswoche<br />
In Fortsetzung einer älteren fachdisziplinären Tradition hat sich die deutsche Historiographie<br />
auch nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt der Geschichte der Außenpolitik zugewandt,<br />
bevor erst gegen Ende der sechziger Jahre im Rahmen der seinerzeit geführten Theorie- und<br />
Methodendebatte die Dominanz einer vor allem diplomatiegeschichtlich geprägten<br />
außenpolitischen Betrachtungsweise vehement in Frage gestellt worden war. Inzwischen ist<br />
der auch von seinen Protagonisten längst wieder verworfene “Primat der Innenpolitik” einer<br />
Sichtweise gewichen, in der jenseits verfehlter Kategorien irgendeines Primats der genuine<br />
Stellenwert der Außenpolitik ebenso Anerkennung findet, wie eine kohärente<br />
Betrachtungsweise von Innen- und Außenpolitik als methodisch leitender Perspektive der<br />
Forschung kaum noch in Frage gestellt wird. Der Kurs versucht u.a. Elemente der Kontinuität<br />
und Diskontinuität deutscher Außenpolitik zwischen 1871 und 1939 herauszuarbeiten und<br />
greift damit jene Fragestellung auf, die die Forschung über längere Zeit vorrangig stimuliert<br />
hat.<br />
Literatur zur Einführung: Klaus Hildebrand, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik<br />
von Bismarck bis Hitler, Stuttgart 1995. Ders., Deutsche Außenpolitik 1871-1918, München<br />
1989. Andreas Hillgruber, Bismarcks Außenpolitik, Freiburg 1972. Ders., Die gescheiterte<br />
Großmacht. Eine Skizze des Deutschen Reiches 1871-1945, Düsseldorf 1980. Peter Krüger,<br />
Die Außenpolitik der Republik von Weimar, Darmstadt 1993. Thomas Nipperdey, Deutsche<br />
Geschichte 1866-1918, Bd. II: Machtstaat vor der Demokratie, München 1992.<br />
Christine Fertig<br />
082037 Kurs: Arbeiteralltag und Arbeiterkultur in Kaiserreich und Weimarer Republik<br />
Mo 10-12, Raum: F 043, Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Mit der Entstehung einer breiten städtischen Arbeiterschicht im 19. Jahrhundert kam es zur<br />
Herausbildung neuer, spezifisch unterbürgerlicher Lebenswelten. In der Übung sollen Kultur<br />
und Alltagsleben von Arbeitern thematisiert werden. Neben der Arbeiterbewegungskultur<br />
werden auch Arbeitswelt, Freizeitformen und Familienleben im Mittelpunkt stehen. Die<br />
Veranstaltung ist als Lektüreübung angelegt; es wird auch darum gehen, gemeinsam das<br />
strukturierte Erfassen wissenschaftlicher Texte einzuüben. Die Teilnahme an der Übung setzt<br />
die Bereitschaft zu regelmäßiger Lektüre Texte und zu mündlichem Diskutieren der Inhalte<br />
voraus.<br />
Literaturhinweise: Wolfgang Kaschuba: Lebenswelt und Kultur der unterbürgerlichen<br />
Schichten im 19. und 20. Jahrhundert (=Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd. 5, München<br />
1990); Dagmar Kift (Hg.): Kirmes, Kneipe, Kino. Arbeiterkultur im Ruhrgebiet zwischen<br />
Kommerz und Kontrolle, 1850 – 1914 (Paderborn 1992).<br />
58
Die Teilnahme ist auf 30 Studierende begrenzt. Eine Anmeldung im Sekretariat von Frau<br />
Schlee (R 138) ist für die Teilnahme verbindlich.<br />
4. Hauptseminare I (ausschließlich für Studierende Lehramt Sek I, Lehramt HRGe,<br />
Bachelor KJ)<br />
Dr. Wilhelm Pohlkamp<br />
083507 Hauptseminar I: Familie im Mittelalter<br />
Di 14-16, Raum: 309, Beginn: 18.10.11<br />
Untersuchungen zur Geschichte der (mittelalterlichen) Familie sind ohne persönliche<br />
Betroffenheit durch eigenes Erleben nicht, zumindest <strong>ab</strong>er schwer denkbar. Un<strong>ab</strong>hängig<br />
davon, ob man die aktuellen Krisendiagnosen vom Untergang oder vom ‚Auslaufen‟ der<br />
klassischen Lebensform Familie teilt oder nicht, sind Zweifel darüber, ob die Kernaspekte<br />
‚heterosexuelles Paar‟ (Paarbeziehung) und ‚Generation‟ (Eltern-Kind-Beziehung) noch<br />
unangefochten klassische Rahmendaten der Lebensform Familie sind, kaum mehr zu<br />
verdrängen. Hier können Historiker aktuelle Diskussionen dadurch versachlichen helfen, dass<br />
sie nachdrücklich das ‚Gewordensein‟ und somit die ‚Veränderbarkeit‟ scheinbar ‚natürlicher‟<br />
und ‚überzeitlicher‟ Formen des familiären Zusammenlebens aufzeigen. Didaktisch zielt dies<br />
auf eine gegenwartsbezogene und problemorientierte (Sozial- oder Kultur-) Geschichte der<br />
Familie. Wissenschaftlich erfordert dies eine fächerverbindende, interdisziplinäre<br />
Orientierung an Erkenntnissen der Soziologie, Ethnologie, Anthropologie und<br />
Biologie/Ethologie. In diesem Sinne sollen in dem Seminar die mittelalterlichen<br />
Lebensformen der Familie in ihrer Kontinuität oder Alterität zu familiärem Zusammenleben<br />
der Gegenwart untersucht und diskutiert werden.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083655 Hauptseminar I: Herausforderung Holocaust<br />
Do 8 - 10, Raum: 304, Beginn: 20.10.11<br />
Der Holocaust gilt als Zivilisationsbruch schlechthin. Adornos Diktum, die ‚allererste<br />
Aufg<strong>ab</strong>e von Bildung sei es, dass Auschwitz nie wieder geschehe„ kann angesichts der<br />
Unfassbarkeit dieses Verbrechens kaum verwundern. Gleichzeitig <strong>ab</strong>er sind viele Aspekte<br />
einer solchen ‚Holocaust-Erziehung„ umstritten bzw. werden durchaus kontrovers gesehen:<br />
Erinnerung und Wiedergutmachung, Schuld und Verantwortung der heutigen Generation, die<br />
Gefahr einer ‚Übersättigung„, die Undarstellbarkeit der Todeserfahrungen, <strong>ab</strong>er auch ob der<br />
Holocaust ein Thema schon für die Grundschule sein darf, kann oder sogar muss.<br />
Das Seminar wird sich zunächst den historischen Rahmenbedingungen widmen, und<br />
anschließend den gegenwärtigen geschichtskulturellen Umgang mit dem Holocaust<br />
thematisieren (Spielfilme, Dokumentationen, Gedenkstätten etc.), um die gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen differenziert in den Blick zu nehmen. Anschließend sollen speziell auf<br />
die Schule bezogene <strong>ab</strong>er auch geschichtskulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche<br />
einer kritischen Analyse unterzogen werden. Auf der Grundlage hieraus gewonnener<br />
Erkenntnisse sollen eigene Zugänge und Angebote zur Darstellungen des Holocaust<br />
entwickelt und wenigstens in Ansätzen auch umgesetzt werden.<br />
59
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083660 Hauptseminar I: Geschichte der Fremdheit – Stereotype als Herausforderung für die<br />
heutigen und für vergangene Gesellschaften<br />
Mi. 8-10, Raum: 304, Beginn: 19.10.11<br />
Im Lauf der Geschichte kam es seit jeher zu Berührungen und Auseinandersetzungen<br />
verschiedener Kulturen. Die hierbei produzierten und instrumentalisierten Selbst- und<br />
Fremdbilder (Auto- und Heterostereotypen) h<strong>ab</strong>en d<strong>ab</strong>ei eine erstaunlich Zählebigkeit an den<br />
Tag gelegt und sind bis heute in stellenweise kaum veränderter Gestalt wirkungsmächtig<br />
geblieben, man denke nur an die weitgehend unwidersprochene Akzeptanz von Negerkuss<br />
und Sarottimohr, <strong>ab</strong>er auch an die Schreckbilder des barbarischen ‚Hunnen/Deutschen„,<br />
‚Russen/Bolschewisten„ oder seit den Anschlägen auf das World-Trade-Center jüngst wieder<br />
des ‚grausamen Orientalen„.<br />
Seit jeher tritt der Mensch mit ‚Fremden„ in Kontakt – mal in friedlicher, mal in feindlicher<br />
Absicht. Für den Verlauf des Kontaktes sind <strong>ab</strong>er nicht nur die jeweiligen Motive<br />
verantwortlich, sondern meistens auch, welche ‚Bilder„ sich das Eigene von sich selbst und<br />
von den ‚Fremden„ macht bzw. gemacht hat. Das Seminar wird sich in einem<br />
epochenübergreifenden Zugriff solchen Fremdkontakten und den mit ihnen verbundenen<br />
Selbst- und Fremdbildern widmen. Hierbei sollen möglichst unterschiedliche<br />
Quellengattungen zu Rate gezogen und im Seminar ausführlich behandelt werden.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
5. Hauptseminare II<br />
Seminar für Alte Geschichte<br />
Die Anmeldelisten zu den Kursen, Hauptseminaren und Übungen im WS <strong><strong>201</strong>1</strong>/<strong>201</strong>2 liegen in<br />
der Zeit<br />
vom 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 15.07.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12) und<br />
vom 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12)<br />
im Hilfskraftzimmer (Zimmer 247) bzw. in den Geschäftszimmern (Zimmer 246 u. 248) des<br />
Seminars für Alte Geschichte aus.<br />
Eine Anmeldung nur in HISLSF ist nicht zulässig!!<br />
Historisches Seminar, Abteilungen für Mittelalterliche Geschichte und Neuere und Neueste<br />
Geschichte<br />
Die Anmeldelisten zu den Hauptseminaren im WS <strong><strong>201</strong>1</strong>/<strong>201</strong>2 liegen in der Zeit<br />
vom 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 15.07.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12) und<br />
vom 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12)<br />
in den jeweiligen Sekretariaten der DozentenInnen aus.<br />
Eine Anmeldung nur in HISLSF ist nicht zulässig!!<br />
60
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081519 Hauptseminar II: Verfassungsrecht, Verfassungspraxis und Verfassungsentwicklung<br />
in der römischen Republik<br />
Fr 12-14, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, Klass. Philologie, 2. OG<br />
Beginn: 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die römische Staats- und Verfassungsordnung bestand aus einer Mischung von<br />
ungeschriebenen Regeln (mores) und schriftlich fixierten Gesetzen (leges). Nach römischer<br />
Tradition g<strong>ab</strong> es schon im 5. Jh. v. Chr. Gesetze, die sich auf die staatlichen Institutionen<br />
bezogen; historisch gesichert ist eine größere Regelungsdichte für die Zeit seit ca. 220 v. Chr.,<br />
die auf dem Hintergrund des sich verschärfenden Konkurrenzkampfes innerhalb der<br />
regierenden Schicht (Nobilität) zu sehen ist. Bis in das späte 2. Jh. v. Chr. blieb die<br />
Verfassung dann st<strong>ab</strong>il und zugleich flexibel; literarische und epigraphische Quellen<br />
ermöglichen einen umfassenden Einblick. – Die Teilnehmer werden gebeten, sich bis zum<br />
Beginn der Veranstaltung einen Überblick über die zentralen staatlichen Institutionen der<br />
römischen Republik zu verschaffen.<br />
Literatur: J. Bleicken, Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlin –<br />
New York 1975; Ders., Die Verfassung der römischen Republik, 7. Aufl. Paderborn 1995; I.<br />
König, Der römische Staat. Ein Handbuch, Stuttgart 2007.<br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081523 Hauptseminar II: Das römische Kleinasien<br />
Mi 14-16, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-2, 2. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Mit dem Beginn der römischen Expansion in der östlichen Mittelmeerwelt gerät im 2.<br />
Jahrhundert v. Chr. auch der kleinasiatische Raum zunehmend in den Einflussbereich Roms.<br />
Als Folge des Testamentes Attalos III., der sich anschließenden Gründung der provincia Asia<br />
sowie der Neuordnung Kleinasiens durch Pompeius nach dem militärischen Erfolg über<br />
Mithradates VI von Pontos war zu Beginn des Prinzipats fast ganz Kleinasien unter römischer<br />
Herrschaft. Neben diesen politischen Geschehnissen sollen insbesondere auch Fragen der<br />
imperialen Administration sowie der kulturellen und religiösen Verhältnisse Kleinasiens im<br />
Verlauf der römischen Kaiserzeit diskutiert werden.<br />
Literatur: D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Cenrury after Christ.<br />
2 Vols., 1950; E. D<strong>ab</strong>rowa, L`Asie Mineure sous les Flaviens. Recherches sur la politique<br />
provinciale, 1980; M. Sartre, L`orient romain: provinces et sociétés provinciales en<br />
Méditerranée orientale d`Auguste aux Sévères, 1991; S. Mitchell, Anatolia. Land, men and<br />
Gods in Asia Minor. 2 Bde., 1993; M. Sartre, L`Asia Mineure et lÀnatolie d`Alexandre à<br />
Diocletien, 1995; E. Schwertheim, Kleinasien in der Antike. Von den Hethitern bis<br />
Konstantin, 2005; Chr. Marek, Geschichte Kleinasiens in der Antike. Unter Mitarbeit von P.<br />
Frei, <strong>201</strong>0.<br />
Prof Dr. Klaus Zimmermann:<br />
081290 Hauptseminar II: Grenzen der Oikumene<br />
Di 14-16, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Form und Oberflächenbeschaffenheit der Erde sind dem durchschnittlich gebildeten<br />
modernen Menschen wenigstens in ihren groben Linien bekannt: Wir alle wissen um die<br />
Kugelgestalt unseres Planeten, um den Zusammenhang der Weltmeere und die Lage der<br />
61
Kontinente; wo unser Wissen endet, da ist der Griff zum Weltatlas eine<br />
Selbstverständlichkeit.<br />
Die Aussage, dass dies in der Antike grundlegend anders war, scheint banal. Versuchen wir<br />
indes einmal, das uns vertraute Kartenbild konsequent beiseite zu lassen, so bringt uns die<br />
Frage, wie für einen antiken Dichter, Geographen oder Historiker die Welt ausgesehen hat,<br />
rasch in erhebliche Schwierigkeiten: Unklar ist nicht nur häufig, wie weit im Einzelfall die<br />
konkrete Kenntnis ferner Länder reichte. Problematisch ist für den heutigen Betrachter auch<br />
der Versuch, sich in die geographische Vorstellungswelt einer Gesellschaft zu versetzen, die<br />
eine nennenswerte Verbreitung von Karten als Hilfsmittel zur Darstellung nicht kannte. Und<br />
doch stellt eine wenigstens annähernde Kenntnis des jeweiligen Weltbildes eine wichtige<br />
Voraussetzung für unser Verständnis der gesamten Antike dar.<br />
Das Hauptseminar lädt dazu ein, am Beispiel ausgewählter Gewährsleute - Homer, Herodot,<br />
Polybios, Str<strong>ab</strong>on, Pomponius Mela, Ptolemaios, um nur einige zu nennen - wesentliche<br />
Schritte in der Entwicklung des antiken Weltbildes nachzuvollziehen, ihre Ursachen, <strong>ab</strong>er<br />
auch ihre Auswirkungen weit über die "Grenze" der Antike hinaus verstehen zu lernen.<br />
Einführende Literatur: E. Olshausen, Einführung in die Historische Geographie der Alten<br />
Welt, Darmstadt 1991; K. Brodersen, Terra Cognita. Studien zur römischen Raumerfassung,<br />
Hildesheim 1995.<br />
Prof. Dr. Johannes Engels<br />
081542 Hauptseminar II: Aristoteles Athenaion Politeia und die athenische Demokratie<br />
zwischen 403 und 322 v. Chr.<br />
Di 18-20, Raum: F 102, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 1. OG<br />
Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Aristoteles' "Athenaion Politeia" bietet den für die griechische polyzentrische Staatenwelt<br />
einzigartigen Fall einer annähernd vollständig erhaltenen, zeitgenössischen Beschreibung der<br />
Geschichte der Entwicklung der athenischen Demokratie (Teil I) und zugleich ihrer Struktur<br />
(Teil II der Schrift). Im Seminar werden auf der Grundlage dieser Schlüsselquelle für unser<br />
Verständnis der Demokratie und durch Vergleiche mit historiographischen, biographischen,<br />
staatsphilosophischen, rhetorischen sowie inschriftlichen Quellen in der aktuellen Forschung<br />
wichtige Problemfelder diskutiert. Eine Verg<strong>ab</strong>e von Referatsthemen erfolgt in der ersten<br />
Seminarsitzung.<br />
Lit.: M. Chambers, Aristoteles AQHNAIWN POLITEIA, Leipzig 1998 (Teubner); P.J.<br />
Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford 1981 (ND 1985); M.<br />
Chambers, Aristoteles. Staat der Athener, (Übersetzung und Kommentar im Rahmen der<br />
deutschen Aristoteles-Gesamtausg<strong>ab</strong>e Band 10,1), Berlin / Darmstadt 1990; M. Dreher, Der<br />
Staat der Athener, Stuttgart 1993 (Reclam): Übersetzung mit Einleitung; L'Athenaion Politeia<br />
di Aristotele 1891-1991. Per un bilancio di cento anni di studi, Neapel 1995<br />
(Forschungsbilanz); M. H. Hansen, Die Athenische Demokratie im Zeitalter des<br />
Demosthenes. Struktur, Prinzipien und Selbstverständnis, Akademie Verlag, Berlin 1995.<br />
Thomas Bauer<br />
082041 Hauptseminar: Da ging er hin, ein neuer Konstantin - 'Staat' und Kirche im<br />
Frankenreich der Merowinger und Karolinger<br />
Freitag 08.30-10, Raum: Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, Beginn:<br />
14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Taufe Chlodwigs, auf die das Eingangszitat des großen merowingerzeitlichen<br />
Historiographen und Hagiographen Gregor von Tours († 594) Bezug nimmt, und die<br />
Christianisierung der Franken prägten, gerade auch in der Entscheidung für das nizänische<br />
62
Bekenntnis, nicht nur den Übergang von der Spätantike in das Frühmittelalter wesentlich mit,<br />
sondern schufen auch die Grundlage für die Herausbildung des christlichen Europa. Leisteten<br />
Kirchen und vor allem Klöster in der Merowingerzeit hier den Hauptteil, so verlagerten sich<br />
die Schwerpunkte unter den Karolingern in den 'staatlichen' Bereich - zweifellos auch eine<br />
Folge der im Umfeld des fränkisch-päpstlichen Bündnisses und konkret des Dynastiewechsels<br />
von 751 erhöhten christlich-sakralen Legitimation des Königtums. Das Verhältnis von 'Staat'<br />
und Kirche wurde dadurch auf eine neue Grundlage gestellt, die sich, bei allen tiefgehenden<br />
Erschütterungen wie bspw. dem Investiturstreit, für mehr als ein Jahrtausend als tragfähig<br />
erweisen sollte.<br />
Das Hauptseminar behandelt, wobei der begleitenden gemeinsamen Lektüre und<br />
Interpretation ausgewählter Quellen eine tragende Rolle zukommen soll, Strukturen und<br />
Entwicklungen des Verhältnisses von 'Staat' und Kirche im Frankenreich der Merowinger und<br />
Karolinger, wobei auch innerkirchliche bzw. innerreligiöse Aspekte und Phänomene wie<br />
Kirche(n) in der Kirche, Reformbestrebungen, Frömmigkeit, theologische und dogmatische<br />
Streitfragen etc. in den Blick genommen werden.<br />
Einführende Literatur:Angenendt, Arnold, Das Frühmittelalter. Die <strong>ab</strong>endländische<br />
Christenheit von 400 bis 900, Stuttgart 2 2001. Borgolte, Michael, Die mittelalterliche Kirche<br />
(Enzyklopädie Deutscher Geschichte 17), München 2 2004. Ewig, Eugen, Die Merowinger<br />
und das Frankenreich; mit Literaturnachträgen von Ulrich Nonn (Urban-Taschenbücher 392),<br />
Stuttgart 5 2006. Schieffer, Rudolf, Die Karolinger (Urban-Taschenbücher 411), Stuttgart<br />
4 2006. Schneider, Reinhard: Das Frankenreich (Oldenbourg Grundriß der Geschichte 5),<br />
München 4 2001. Wallace-Hadrill, John Michael, The Frankish Church (Oxford History of the<br />
Christian Church), Oxford 1983 (Ndr. ebd. 1985).Weitere und spezielle Literatur wird in der<br />
ersten Sitzung bzw. im Reader zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.<br />
PD Dr. Alhedydis Plassmann<br />
082883 Hauptseminar: Christianisierung und Akkulturation im frühen Mittelalter<br />
Mi 16-18, Raum: F 234, Vorbesprechung: 26.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> / Beginn: 2.11.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Mission und Christianisierung bilden eine wichtige Konstante im frühen und hohen<br />
Mittelalter. Die Ausbreitung des Christentums bedeutete eine Vereinheitlichung hin zu einer<br />
spezifisch europäischen Kultur. Gleichzeitig hatte eine Christianisierung immer auch<br />
schwerwiegende politische Folgen für die bekehrten gentes. Im Seminar soll zum einen<br />
beleuchtet werden, welche unterschiedlichen Motive und Vorgehensweise von Seiten der<br />
Missionare zu konstatieren sind, es soll <strong>ab</strong>er auch auf mögliche Beweggründe der<br />
Christianisierten eingegangen werden. D<strong>ab</strong>ei soll insbesondere auch auf die unterschiedlichen<br />
Bekehrungssituationen eingegangen und der Frage nachgegangen werden, inwieweit<br />
Missionierungstechniken auch pragmatisch an bestehende Verhältnisse angepasst wurden. Die<br />
unterschiedlichen Formen der Mission und der Akkulturationsprozesse sollen in Referaten mit<br />
begleitender Quellenlektüre erarbeitet werden. Voraussetzung zur Teilnahme ist daher die<br />
Bereitschaft zu stetiger Mitarbeit und die Übernahme eines Referates. Schriftliche Hausarbeiten<br />
können zu ausgewählten Aspekten verfasst werden.<br />
Einführende Literatur: Arnold Angenendt, Das Frühmittelalter. Die <strong>ab</strong>endländische<br />
Christenheit von 400-900, Stuttgart 3 2001; Christianizing Peoples and Converting Individuals,<br />
hg. von Guyda Armstrong – Ian N. Wood (International Medieval Research 7) Turnhout<br />
2000; Daniel König, Bekehrungsmotive. Untersuchungen zum Christianisierungsprozess im<br />
römischen Westreich und seinen romanisch-germanischen Nachfolgern (4.-8. Jahrhundert)<br />
(Historische Studien 493) Husum 2008; Lutz von Padberg, Die Christianisierung Europas im<br />
Mittelalter, Stuttgart 1998 (Reclam, zur Anschaffung empfohlen).<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
082056 Hauptseminar: Ritterorden und Rittergesellschaften<br />
63
Mi 10-12, Raum: F 3, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Als Folge der Kreuzzugsbewegung bildete sich eine neue Form geistlicher Gemeinschaften<br />
heraus, in denen das altkirchliche Ideal der militia Christi neu interpretiert wurde: Der Kampf<br />
für Christus wurde nicht mehr wie vorher rein spirituell verstanden, sondern auch als<br />
tatsächlicher Kampf mit Waffen. Trotz anfänglicher Widerstände gegen diese neue Form des<br />
geistlichen Lebens entstanden mehrere geistliche Ritterorden, einige als Umbildungen bereits<br />
bestehender Einrichtungen zur Armen- und Krankenpflege. Den geistlichen Ritterorden kam<br />
eine erhebliche Bedeutung bei der Verteidigung der lateinischen Kreuzfahrerherrschaften in<br />
der Levante zu. Daneben leisteten die spanischen Ritterorden einen wichtigen Beitrag nicht<br />
nur zur sogenannten Reconquista, der „Rückeroberung“ ehemals christlicher Territorien durch<br />
nordspanische Königreiche, sondern auch bei der nachfolgenden Besiedlung neueroberter<br />
Gebiete. Dem Deutschen Orden gelang gar der Aufbau eines eigenen Ordensstaates im<br />
Baltikum.<br />
Im späten Mittelalter entstanden mit den sogenannten weltlichen Ritterorden neue<br />
institutionelle Formen, die auf einen Fürsten als Ordenssouverän ausgerichtet waren und der<br />
Propagierung der ritterlicher Lebensweise dienten, darüber hinaus <strong>ab</strong>er auch als Mittel zur<br />
Integration des Adels in monarchische Herrschaftssysteme und als Instrument fürstlicher<br />
Außenpolitik eingesetzt wurden. Davon zu unterscheiden sind genossenschaftlich<br />
ausgerichtete Adelsgesellschaften. Das Seminar stellt die unterschiedlichen Formen<br />
geistlicher und weltlicher Rittergemeinschaften vor, analysiert ihre politische und kulturelle<br />
Bedeutung und zieht <strong>ab</strong>schließend einen Vergleich zu islamischen Institutionen (ribāt und<br />
futuwwa), die in der Forschung als mögliche Parallelen oder gar Vorbilder für christliche<br />
Institutionen des Glaubenskampfes diskutiert worden sind.<br />
Literatur: Czaja, Roman/Jürgen Sarnowsky (eds.), Die Ritterorden als Träger der Herrschaft:<br />
Territorien, Grundbesitz und Kirche (Colloquia Torunensia Historica 14), Torun 2007;<br />
Demurger, Alain, Die Ritter des Herrn. Geschichte der geistlichen Ritterorden, München 2003<br />
Elm, Kaspar, Die Spiritualität der geistlichen Ritterorden des Mittelalters, in: Militia Christi e<br />
Crociata neo secoli XI-XIII (Miscellanea del Centro di studi medioevali 30; Scienze storiche<br />
48), Mailand 1992, 477-518; Fleckenstein, Josef, Die Rechtfertigung der geistlichen<br />
Ritterorden nach der Schrift De laude novae militiae Bernhards von Clairvaux, in: id.,<br />
Ordnungen und formende Kräfte des Mittelalters, Göttingen 1989, 377-392; Nowak, Hubert<br />
Zenon/ Roman Czaja (eds.), Vergangenheit und Wirklichkeit der Ritterorden. Die Rezeption<br />
der Idee und die Wirklichkeit (Ordines militares 11), Torun 2001; Sarnowsky, Jürgen, Das<br />
historische Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden, Zeitschrift für Kirchengeschichte<br />
110 (1999), 315-330.<br />
PD Dr. Kay Peter Jankrift<br />
082060 Hauptseminar II: Friedensverhandlungen und –verträge im Mittelalter<br />
(A2, B1-5, B8, C2)<br />
Blockseminar, 7.-9. Februar <strong>201</strong>2, jeweils 10.00-17.00 Uhr s.t., Raum: F 102<br />
Kriege und gewaltsame Konflikte in rascher Abfolge durchziehen die mittelalterlichen und<br />
frühneuzeitlichen Jahrhunderte. Doch wie fanden die Auseinandersetzungen ihr Ende Im<br />
Mittelpunkt dieses Seminars stehen Formen und Wege der Konfliktlösung. Anhand<br />
ausgewählter Friedensschlüsse sollen das Wirken der Diplomaten und der Gang der<br />
Verhandlungen ebenso betrachtet werden, wie die Inhalte der Verträge und deren Folgen<br />
sowie deren Rezeption. Zur Arbeit mit den Quellen sind ausreichende Kenntnisse des<br />
lateinischen oder einer romanischen Sprache erforderlich.<br />
Einführende Literatur: Daniela Frigo, Politics and diplomacy in early modern Italy, 1450-<br />
1800, Cambridge <strong><strong>201</strong>1</strong>; Martin Kintzinger, Internationale Beziehungen im europäischen<br />
64
Mittelalter, Stuttgart <strong><strong>201</strong>1</strong>; Kay Peter Jankrift, Europa und der Orient im Mittelalter,<br />
Darmstadt 2007; Donald E. Queller, The office of ambassador in the Middle Ages, Princeton<br />
1967.<br />
PD Dr. Wilhelm Ribhegge<br />
083880 Erasmus von Rotterdam und Martin Luther. Europäischer Humanismus oder<br />
deutsche Reformation<br />
Mi 10-12, Raum: 309, Beginn: 19.10.11<br />
In der deutschen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts von Ranke bis Lortz<br />
wurde die Reformation zum „nationalen Ereignis“ und Luther wurde zum Nationalhelden<br />
stilisiert. Mit dessen Biografie verbinden sich die 95 Thesen gegen die Ablässe von 1517<br />
seine Programmschriften von 1520 („An den christlichen Adel deutscher Nation“, „Von der<br />
b<strong>ab</strong>ylonischen Gefangenschaft der Kirche“ und „Von der Freiheit eines Christenmenschen“),<br />
sein berühmter Auftritt vor dem Reichstag in Worms 1521, seine deutsche Bibelübersetzung<br />
und seine deutschen Predigten und Lieder.<br />
In der westeuropäischen Geschichtsschreibung wurde dagegen Luthers Zeitgenosse Erasmus<br />
von Rotterdam zur historischen Leitfigur erhoben. Mit dessen Biografie verbindet sich die<br />
Kritik an Kirche, Politik und Gesellschaft im „Lob der Torheit“ (1511) und in der „Klage des<br />
Friedens“ (1517), die Edition antiker Texte und der griechisch-lateinischen Ausg<strong>ab</strong>e des<br />
Neuen Testaments (1516). Erasmus warb für die Erneuerung der Bildung und die Reform des<br />
religiösen Lebens. In seinen Erziehungsschriften setzte er sich für zivile Umgangsformen ein.<br />
Die satirischen Dialoge über Fehlentwicklungen der Frömmigkeit in seinen populären<br />
„Kolloquien“ wurden von der Sorbonne in Paris verurteilt. Erasmus wehrte sich gegen die<br />
aufkommende Militanz der neuen Konfessionen. Anders als Luther hielt er an der Einheit der<br />
Kirche fest. In seiner umfangreichen Korrespondenz mit Humanisten, Theologen und<br />
Reformatoren, Fürsten und Bischöfen in ganz Europa - von Polen bis Spanien und von<br />
England bis Italien – entstand durch den Buchdruck eine europäischen Öffentlichkeit, in der<br />
sich die Zeitgeschichte wie in einem Focus spiegelt. Das anfänglich freundliche Verhältnis<br />
zwischen Erasmus und Luther zerbrach in ihrer Kontroverse über den „freien Willen“.<br />
Der Europäer Erasmus wurde aus dem deutschen Geschichtsbewusstsein weitgehend<br />
verdrängt. Auch die derzeitigen Vorbereitungen für das Lutherjubiläum des Jahres <strong>201</strong>7<br />
(„Luther-Dekade“) scheinen noch diesem Trend zu folgen. Das Seminar wird sich mit der<br />
historischen Rolle von Erasmus und Luther im 16. Jahrhundert auseinandersetzen und deren<br />
Beurteilung in der späteren Geschichtsschreibung verfolgen.<br />
Zur Einführung: Heiko A. Oberman: Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel, München<br />
1986<br />
Wilhelm Ribhegge, Erasmus von Rotterdam, Darmstadt <strong>201</strong>0; Jean-Claude Margolin: Erasme<br />
précepteur de l'Europe, Paris 1995; Wilhelm Ribhegge: German or European Identity Luther<br />
and Erasmus in Nineteenth- and Twentieth-Century German Cultural History and<br />
Historiography, in: Christian Emden / David Midgley (Hgg.), Cultural Memory and Historical<br />
Consciousness in the German Speaking World Since 1500, Bd. 1: Papers from the Conference<br />
„The Fragile Tradition‟, Cambridge 2002, Oxford u. a. 2004, S.139-163<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
082094 Hauptseminar: Geistliche Territorien im Alten Reich<br />
Di 10-12, Raum: F33, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
65
Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation wurden nicht wenige Territorien von<br />
geistlichen Würdenträgern regiert, seien es geistliche Kurfürsten, Fürstbischöfe, Äbte, auch<br />
einige Äbtissinen. Nicht zuletzt zählte ja auch das Fürstbistum Münster dazu. Die Frage ist,<br />
ob solche Landesherrschaften durch besondere Merkmale gekennzeichnet waren, wie sie ihre<br />
politische Selbständigkeit behaupten konnten und inwiefern sie eine eigene politische Kultur<br />
entwickelt h<strong>ab</strong>en. Schließlich ließ sich die Herrschaft nicht vererben und setzte also besondere<br />
Mechanismen der Herrschaftsübertragung und St<strong>ab</strong>ilisierung voraus. Und offenbar waren<br />
geistliche Territorien besonders gefährdet, verschwanden doch eine ganze Reihe von ihnen im<br />
Zuge der Reformation von der Landkarte, die übrigen wurden 1803 mit einem Schlag<br />
säkularisiert. Ohnehin gelten die geistlichen Landesherrschaften als rückständige Nachzügler<br />
im Staatsbildungsprozeß, <strong>ab</strong>er ob das den Menschen im Land geschadet hat oder ob sich<br />
dahinter nicht auch eine grundsätzliche verfassungspolitische Alternative verborgen hat, wäre<br />
zu diskutieren. Immerhin gingen aus den geistlichen Staaten überwältigende Leistungen in<br />
repräsentativer, also politisch relevanter Kunst und Architektur hervor, die noch heute die<br />
Reiseführer insbesondere Süddeutschlands füllen. Genauer zu untersuchen wäre auch ihre<br />
Rolle im Prozeß der Konfessionalisierung und ihre Haltung gegenüber den<br />
Herausforderungen der Aufklärung; womöglich läßt sich unter dem Begriff des Barock eine<br />
eigenständige, auf ihre Weise epochenprägende, katholische Leit- und Gegenkultur<br />
definieren. Nicht zuletzt blieben auch die geistlichen Staaten Horte der Adelswelt, deren<br />
soziopolitische Bedeutung nicht zuletzt in erstaunlichen Karrieren und engen Verknüpfungen<br />
mit Kaiser und Reich zum Ausdruck kam. Alle diese Fragen machen die<br />
Auseinandersetzungen mit den geistlichen Staaten zu einem Königsweg zum Verständnis der<br />
vormodernen Herrschafts- und Gesellschaftstrukturen in Deutschland.<br />
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist ausnahmslos eine vorherige Anmeldung<br />
erforderlich. Anmeldelisten liegen vom 27.6. bis zum 15.7. und vom 26.9. bis zum 14.10 aus,<br />
jeweils von 10 bis 12 Uhr im Sekretariat des Lehrstuhls für Frühe Neuzeit, F-Haus, Raum<br />
140.<br />
Erste Literaturhinweise: Bettina Braun u. a. (Hrsg.): Geistliche Fürsten und Geistliche Staaten<br />
in der Spätphase des Alten Reiches, Epfendorf 2008; Silvia Schraut: das Haus Schönborn.<br />
Eine Familienbiographie. Katholischer Reichsadel 1640-1840, Paderborn 2005; Kurt<br />
Andermann (Hrsg.): Die geistlichen Staaten am Ende des Alten Reiches. Versuch einer<br />
Bilanz, Tübingen 2004; Bettina Braun u. a. (Hrsg.): Geistliche Staaten im Nordwesten des<br />
Alten Reiches. Forschungen zum Problem frühmoderner Staatlichkeit, Köln 2003; Rolf Decot<br />
(Hrsg.): Säkularisation der Reichskirche 1803. Aspekte kirclichen Umbruchs, Mainz 2002;<br />
Wolfgang Wüst (Hrsg.): Geistliche Staaten in Oberdeutschland im Rahmen der<br />
Reichsverfassung, Epfendorf 2002; Ute Küppers-Braun: Frauen des hohen Adels im<br />
kaiserlich-freiweltlichen Damenstift Essen (1605-1803), Münster 1997; Eike Wolgast:<br />
Hochstift und Reformation. Studien zur Geschichte der Reichskirche zwischen 1517 und<br />
1648, Stuttgart 1995.<br />
Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger<br />
082080 Hauptseminar II Klüngel, Korruption, Klienten: Informelle Strukturen in der Frühen<br />
Neuzeit.<br />
Mo 14-16, Raum: F 102<br />
Die Frühe Neuzeit gilt als die Epoche, in der sich die moderne bürokratische Staatlichkeit und<br />
als deren Korrektiv eine kritische Öffentlichkeit herausgebildet h<strong>ab</strong>en. Lange Zeit hat die<br />
historische Forschung die informelle Kehrseite dieser Entwicklung nicht beachtet bzw. allein<br />
als Defekt oder Devianz wahrgenommen: Phänomene wie Patronage, Klientelismus,<br />
Freundschaft usw. Inzwischen hat sich dagegen die Erkenntnis durchgesetzt, dass man mit<br />
den formalen Strukturen nur eine Seite der Medaille, ihre Schauseite, im Blick hat, und dass<br />
66
man die Staatsbildung ohne die Kehrseite der Medaille nicht verstehen kann. Patronage wird<br />
in der neueren Forschung in einem umfassenden Sinne als „Kulturform“ und Schlüssel zu<br />
vormodernen Gesellschaften überhaupt verstanden. In dem Seminar soll gefragt werden, was<br />
informelle Strukturen sind, wie sie funktionieren, inwiefern sich legitime von illegitimen<br />
Erscheinungen unterscheiden lassen usw. Im Zentrum wird die gemeinsame Quellenlektüre<br />
stehen. Dazu sollen die Teilnehmer/innen Kurzreferate zur Einführung beitragen.<br />
Erste Literaturhinweise: Birgit Emich u.a., Stand und Perspektiven der Patronageforschung,<br />
in: Zeitschrift für historische Forschung 32 (2005), S. 233-265. - Birgit Emich, Die<br />
Formalisierung des Informellen: Der Fall Rom, in: Reinhardt Butz, Jan Hirschbiegel, Hgg.,<br />
Informelle Strukturen bei Hof, Münster 2009, S. 149-156. - Niels Grüne, Simona Slanicka,<br />
Hgg., Korruption: Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation,<br />
Göttingen <strong>201</strong>0. - Wolfgang Reinhard, Paul V. Borghese (1605-1621). Mikropolitische<br />
Papstgeschichte (Päpste und Papsttum 37), Stuttgart 2009, Einleitung.<br />
Prof. Dr. Peter Oestmann, Sandro Wiggerich<br />
031675 Hauptseminar II: Das Gericht der Universität – Die Universität als Gericht<br />
Blockseminar vom 13. bis zum 15. Februar <strong>201</strong>2<br />
Vorbesprechung: Dienstag, 12. Juli, 15.30 Uhr in der Rechtshistorischen Bibliothek<br />
(Juridicum, J 406)<br />
Für diejenigen, die an der ersten Vorbesprechung nicht teilnehmen konnten, findet eine<br />
weitere Vorbesprechung statt.<br />
Eine vorherige Anmeldung wird erbeten an Sandro Wiggerich, wiggerich@uni-muenster.de<br />
I. Überblick<br />
Das Seminar behandelt die Stellung der Universitäten als Organe der Rechtsprechung im<br />
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. D<strong>ab</strong>ei lassen sich mit akademischer Gerichtsbarkeit<br />
und Spruchtätigkeit zwei unterschiedliche Wirkungskreise unterscheiden:<br />
1. Das Gericht der Universität<br />
Das Gerichtsverfassungsgesetz 1877/1879 beseitigte in Deutschland die Reste eines Privilegs,<br />
das seit dem Mittelalter ein Wesensmerkmal der Universitäten gewesen war. Diese hatten bis<br />
dahin die Gerichtsbarkeit über Professoren, Studenten, Universitätsbedienstete und sogar<br />
deren Familien inne: Der Rektor oder ein Universitätsgericht urteilten über Zivilklagen gegen<br />
Professorenfrauen ebenso wie über strafbare Duelle von Studenten. Einige Universitäten<br />
verhängten im Rahmen dieser akademischen Gerichtsbarkeit sogar Todesurteile gegen ihre<br />
Mitglieder.<br />
Dieses Recht, das im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit auch vielen anderen<br />
Korporationen zukam, wurzelt bereits in den ersten Universitätsgründungen des<br />
Hochmitttelalters in Bologna, Paris und Oxford. Die akademische Gerichtsbarkeit stand<br />
grundsätzlich selbständig neben kirchlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit. In der<br />
Rechtspraxis kam es jedoch immer wieder zu Konflikten, wenn etwa Studenten mit<br />
Handwerksgesellen oder Soldaten aneinander geraten waren und daher auch städtische oder<br />
militärische Gerichte die Zuständigkeit für sich beanspruchten.<br />
Die zunehmende Monopolisierung der rechtsprechenden Gewalt durch den Staat ging zu<br />
Lasten der akademischen Gerichtsbarkeit: Landesherren sicherten sich Eingriffs- und<br />
Bestätigungsrechte. Im 19. Jahrhundert wurden die Universitätsgerichte in die staatliche<br />
Justizverwaltung eingebunden, zudem wurde diskutiert, wodurch die Privilegierung der<br />
Universitäten und insbesondere der Studenten gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen zu<br />
rechtfertigen sei.<br />
67
Nach Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes verblieb den Universitäten nur noch eine<br />
Disziplinargerichtsbarkeit über ihre Studenten, das in der Bundesrepublik durch ein<br />
verwaltungsrechtliches Ordnungsrecht <strong>ab</strong>gelöst wurde.<br />
2. Die Universität als Gericht<br />
Die Universitäten übten jedoch nicht nur Gerichtsbarkeit über ihre Mitglieder aus, sondern<br />
wirkten auch als Spruchkollegien nach außen. Frühneuzeitliche Gerichte, die lange mit<br />
ungelehrten Urteilern besetzt waren, entschieden die bei ihnen anhängigen Prozesse oft nicht<br />
selbst, sondern schickten die Akten mit der Bitte um rechtliche Belehrung an eine juristische<br />
Fakultät. Die Befassung wissenschaftlich ausgebildeter Juristen war insbesondere in<br />
Strafprozessen, in denen die Appellation seit 1530 verboten war, zweckmäßig. So kam es zu<br />
einer doppelten Einbindung der Universitäten in die Gerichtsverfassung.<br />
Ein besonderes Problem war die Anwendung von Partikularrecht, also dem örtlichen Recht,<br />
das dem Reichsrecht vorging, durch auswärtige Juristenfakultäten. Häufig fügten die<br />
anfragenden Gerichte Auszüge aus den entscheidungserheblichen Partikulargesetzen bei.<br />
Verstieß die Fakultät dennoch offenkundig gegen Partikularrecht, so war ihr Spruch<br />
unverbindlich.<br />
Auch die Tätigkeit der Universitäten im Rahmen der Aktenversendung verlor mit dem<br />
Erstarken der Landesherrschaft an Bedeutung. Für das herrschaftliche Selbstverständnis<br />
musste es als Einschränkung der Rolle als oberster Gerichtsherr erscheinen, wenn<br />
einheimische Gerichte ihre Prozesse durch auswärtige Universitäten entscheiden ließen.<br />
Teilweise wurde die Versendung in andere Territorien daher untersagt. Je straffer zudem die<br />
Gerichtsverfassung organisiert wurde, desto geringer war die Notwendigkeit für<br />
Aktenversendungen. Sie wurde daher nach und nach in verschiedenen Bundesstaaten verboten<br />
und fand ebenfalls mit dem Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes ihr Ende.<br />
II. Themenvorschläge<br />
Besonders erwünscht ist eigenständiges, möglichst exegetisches Arbeiten an selbstgewählten<br />
Quellen. Eigene Themenvorschläge der Teilnehmer sind möglich und ausdrücklich<br />
erwünscht. Die folgende Liste kann d<strong>ab</strong>ei eine Orientierung bieten:<br />
1. Das Gericht der Universität<br />
(1) Bologna und Paris: Ursprünge der akademischen Gerichtsbarkeit<br />
(2) Handh<strong>ab</strong>ung der akademischen Gerichtsbarkeit an einzelnen Universitäten (Münster,<br />
Paderborn, Duisburg; Göttingen, Kiel, Marburg, ...)<br />
(3) Rektor, Senat, Pedell: Zusammensetzung und Personal der Universitätsgerichte<br />
(4) Verfahrensgrundlagen der akademischen Gerichtsbarkeit<br />
(5) Karzer und Relegation: Sanktionen der akademischen Strafgerichtsbarkeit<br />
(6) Einbindung in den Instanzenzug und staatliche Kontrolle<br />
(7) Schuldklagen, Duelle, Prostitution: Aufg<strong>ab</strong>enbereiche der Universitätsgerichte<br />
(8) Jurisdiktionskonflikte: Die Universität in ihrer sozialen Umwelt<br />
(9) „Eine Beleidigung auch des Studirenden“: Die Debatten um Reform und Abschaffung der<br />
akademischen Gerichtsbarkeit im 19. Jahrhundert<br />
(10) Disziplinargerichtsbarkeit und Ordnungsrecht: Universitätsgerichtsbarkeit nach 1879,<br />
1933 und 1945<br />
2. Die Universität als Gericht<br />
(1) Die italienischen Konsiliatoren<br />
(2) Normative Grundlagen der Spruchtätigkeit im Alten Reich<br />
(3) Organisation der Spruchkollegien<br />
(4) Universitäten nach Gutachten in Privatanfragen Professoren<br />
(5) Einbindung der Spruchkollegien in Strafprozesse<br />
(6) Einbindung der Spruchkollegien in Zivilprozesse<br />
(7) Zur frühneuzeitlichen Entscheidungsliteratur<br />
(8) Diskussionen um das „Palladium deutscher Freiheit“ im 19. Jahrhundert<br />
68
(9) Das Ende der Aktenversendung<br />
III. Literatur (Auswahl)<br />
1. Das Gericht der Universität<br />
- Friedrich Stein, Die akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland, Leipzig 1891; Stefan<br />
Brüdermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit im 18. Jahrhundert,<br />
Göttingen 1990; Bettina Bubach, Richten, Strafen und Vertragen, Berlin 2005; Heinz-Joachim<br />
Toll, Akademische Gerichtsbarkeit und akademische Freiheit, Neumünster 1979; Peter<br />
Woeste, Akademische Väter als Richter, Marburg 1987.<br />
2. Die Universität als Gericht<br />
- Ulrich Falk, Consilia. Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit,<br />
Frankfurt a.M. 2006; Heiner Lück, Die Spruchtätigkeit der Wittenberger Juristenfakultät,<br />
Köln 1998<br />
- Artikel „Aktenversendung“ im Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (dort<br />
Literatur zu einzelnen Universitäten).<br />
Während des Semesters findet eine Rechtshistorische Methodenübung statt, die als Ergänzung<br />
zum Seminar besucht werden kann; die Teilnahme ist jedoch nicht verpflichtend.<br />
Dr. Martina Winkler<br />
082109 Hauptseminar: „How to Lie with Maps“ – zur Geschichte der Kartographie<br />
Mi 10-12; Raum: Sitzungszimmer des IStGs, Königsstr. 46, Beginn: 12.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Kartographiegeschichte ist seit einer Weile kein Monopol der Geographen mehr, sondern<br />
wird zunehmend zu einem Feld für „echte“ Historiker. Staatsbildung, Raumwahrnehmung,<br />
Herrschaftskonstruktion und das Verständnis von Nation sind die zentralen Probleme, bei<br />
deren Verständnis uns Karten weiterhelfen können. Wir werden versuchen, dieses relativ<br />
neue Forschungsfeld auszuloten und den quellenkritischen Umgang mit Karten üben. D<strong>ab</strong>ei<br />
wird zwar ein Schwerpunkt auf Osteuropa gelegt, theoretische und vergleichende Aspekte<br />
spielen jedoch ebenfalls eine große Rolle.<br />
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082113 Hauptseminar: Vom internen Kolonialismus zum plurikulturellen Staat Indianer in<br />
Lateinamerika im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Mi. 10-12 Uhr, Raum: F 153, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Eine Besonderheit der lateinamerikanischen Geschichte stellt die seit über 500 Jahren<br />
bestehende ethnische Differenzierung der Gesellschaften dar. Die Nachfahren der<br />
europäischen Konquistadoren stehen der indigenen Bevölkerung ebenso wie den Nachfahren<br />
der afrikanischen Sklaven gegenüber. Mit dem Ende der Kolonialzeit zu Beginn des 19.<br />
Jahrhunderts endete keineswegs die Diskriminierung von Indianern. Diese sozialen<br />
Ungleichheitsverhältnisse werden häufig als eine Fortsetzung der kolonialen Verhältnisse<br />
durch die herrschenden Eliten beschrieben. Erst in den letzten Jahrzehnten des 20.<br />
Jahrhunderts gelang es den indigenen Bewegungen in verschiedenen lateinamerikanischen<br />
Ländern, Verfassungen durchzusetzen, in denen die multikulturelle Prägung der<br />
Gesellschaften anerkannt und damit auch besondere Rechte der Indianer verknüpft werden.<br />
Das Seminar fragt nach der Geschichte der Indianer, den Bedingungen sozialer Ungleichheit,<br />
den sozialen Kämpfen der indigenen Bevölkerungen sowie dem Wandel ihrer politischen<br />
Rechte.<br />
Bitte melden Sie sich in der Zeit vom 27.6.-15.7. und vom 26.9. -14.10. für dieses Seminar im<br />
Sekretariat bei Frau Simon (R 123) an.<br />
69
Literatur: Greg Joel S. Urban: Nation-States and Indians in Latin America, Austin 1991.<br />
Leticia Reina (Hg.): La reindianización de Amércia, Mexiko 1997. Peter Wade: Race and<br />
Ethnicity in Latin America, London 1997.<br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082128 Hauptseminar: Die Beziehungen zwischen Indianern und Weißen in den USA<br />
Di. 14-16, Raum: ULB 1, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Seit dem 15. Jahrhundert kamen die über 600 indianischen Gruppen in Nordamerika in<br />
Kontakt mit weißen Erkundern, Händlern und Siedlern. Das Seminar analysiert die Kontakte<br />
zwischen Weißen und indianischen Gruppen insbesondere zu Beginn der Besiedlung, <strong>ab</strong>er<br />
auch bis in die heutige Zeit. D<strong>ab</strong>ei sollen vor allem die Interaktionen und Beeinflussungen<br />
zwischen weißen und indianischen Kulturen in den Blick genommen werden. Gerade zu<br />
Beginn des Kontakts waren indianische Gruppen hier viel stärker Handelnde als allgemein<br />
angenommen.<br />
Ein Großteil der Lektüre besteht aus englischsprachigen Texten. Um Anmeldung im<br />
Sekretariat der Abteilung Außereuropäische und Nordamerikanische Geschichte (F-Haus,<br />
Raum 123) zwischen 25.6.-15.7. bzw. 26.9.-14.10. wird gebeten.<br />
Literatur: R. David Edmunds et al., The People: A History of Native America. New York<br />
2006; Daniel K. Richter, Facing East from Indian Country. Cambridge, MA, 2003; Jane P.<br />
Merritt, At the Crossroads: Indians and Empires on a Mid-Atlantic Frontier, 1700-1763.<br />
Chapel Hill, NC, 2003; Richard White, The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics<br />
in the Great Lakes Region, 1650-1815. Cambridge 1991; Frederick Hoxie/Peter<br />
Mancall/James Merrell (Hg.), American Nations: Encounters in Indian Country, 1850 to the<br />
Present. New York 2001; Joane Nagel, American Indian Ethnic Renewal: Red Power and the<br />
Resurgence of Identity and Culture. New York 1996.<br />
Jun.Prof. Dr. André Krischer<br />
082132 Hauptseminar: Vom Verräter zum Terroristen Die Genealogie moderner politischer<br />
Delinquenz im 19. Jahrhundert: Großbritannien und das Empire<br />
Mi 10-12, Raum: SCH 100.124<br />
Dem Terrorismus der Gegenwart wird häufig ein lange Vorgeschichte attestiert. Ursprünge<br />
werden bei der syrischen Assassaninen-Sekte im Mittelalter oder bei den englischen<br />
Pulverfaßverschwörern im Konfessionellen Zeitalter gesucht. Die Frage ist <strong>ab</strong>er, ob eine<br />
solche Form der Traditionsstiftung historisch erkenntnisfördernd ist. Im Seminar wollen wir<br />
daher versuchen, die Entstehung moderner politischer Delinquenz am britischen Beispiel<br />
genauer zu untersuchen. Vorausgesetzt wird d<strong>ab</strong>ei, daß zum Verständnis dieses Phänomens<br />
ein möglichst komplexes Gesamtbild erarbeitet werden muß. Bei politischer Delinquenz geht<br />
es nicht nur um die Täter und ihre unterschiedlichen Motive. Zu berücksichtigen sind auch der<br />
Wandel von Politik, Religion und der Diskurse darüber, die Durchsetzung moderner<br />
Staatlichkeit und ihrer Sicherheitstechnologien, der Wandel der normativen Definitionen von<br />
Delinquenz, des Rechtssystems und der Gerichtsverfahren, eine veränderte Medienlandschaft<br />
und eine Umformung von Öffentlichkeit mit weltgesellschaftlichen Dimensionen.<br />
Entsprechend ausdifferenziert werden auch die im Seminar zu diskutierenden Quellen sein.<br />
Unsere Genealogie beginnt mit der Kriminalisierung politischer Agitation (z.B. (Radikalismus<br />
und Chartismus) vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, führt über die<br />
Gewaltaktionen irischer Nationalisten in der zweiten Jahrhunderthälfte bis hin zur Deutung<br />
kolonialer Aufstände in Britisch-Indien als Terrorismus um 1900.<br />
70
Anforderungen: Essay und ggf. Hausarbeit, aktive Mitarbeit, selbständige Erarbeitung der<br />
wiss. Fragestellungen. Literatur und Quellen sind überwiegend fremdsprachig.<br />
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Eine Liste wird ausgelegt.<br />
Erste Literaturhinweise: Peter Heehs, Revolutionary Terrorism in British Bengal, in: Elleke<br />
Boehmer / Stephen Morton (Hg.), Terror and the postcolonial: A concise companion, Oxford<br />
<strong>201</strong>0, 153-176; ders., The bomb in Bengal: the rise of revolutionary terrorism in India, 1900-<br />
1910, Dehli 1994; Niall Whelan: “Cheap as soap and common as sugar". The Fenians,<br />
dynamite and scientific warfare, in: Fearghal McGarry / James R. R. McConnel (Hg.), The<br />
black hand of republicanism: Fenianism in modern Ireland, Dublin / Portland (OR) 2009, 105-<br />
120; Michael Silvetsri, "The Sinn Féin of India" : Irish nationalism and the policing of<br />
revolutionary terrorism in Bengal, in: Journal of British Studies 39 (2000), 454-486.<br />
Prof. Dr. Michael Schwartz<br />
082936 Italienische Einheit: Nationalismus und Nationalstaatsbildung in Italien als<br />
internationales Problem von Politik und Medienöffentlichkeiten 1798-1919<br />
Blocktermine: Mo 24.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 11-13 Uhr im F 041 (Vorbesprechung), Do / Fr 8. und<br />
9.12.<strong><strong>201</strong>1</strong>, je 9-18 Uhr, Raum: ULB 202<br />
Vor 150 Jahren wurde 1861 der italienische Einheitsstaat geschaffen, der schrittweise über<br />
1866, 1870 und 1919 annähernd seine heutige Ausdehnung erreichte. Untersucht werden<br />
sollen insbesondere folgende Fragen: Die italienische Einheit als Problem der internationalen<br />
Staatengemeinschaft und des europäischen Gleichgewichts; die italienische Einheits- und<br />
Freiheitsbewegung als mediales Vorbild für andere europäische Nationalbewegungen (z.B.<br />
Heldenverehrung wie bei Pellico, Mazzini, Garibaldi oder d'Annunzio); die innere Spaltung<br />
der italienischen Nationalbewegung (Liberalismus versus radikale Demokratie); die innere<br />
Spaltung der italienischen Nation (Nord-Süd, Nationalisten vs. Katholiken); die Wendung des<br />
italienischen Nationalismus zum Imperialismus.<br />
Einführende Literatur: Altgeld, Wolfgang (Hg.): Kleine Italienische Geschichte, Stuttgart<br />
2002; Clark, Martin: The Italian Risorgimento, Edinburgh e.a. 1998; Procacci, Giuliano:<br />
Geschichte Italiens und der Italiener, München 1989;Reinhardt, Volker: Geschichte Italiens.<br />
Von der Spätantike bis zur Gegenwart, München 2003.<br />
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung im Sekretariat der Neueren und<br />
Neuesten Geschichte (Raum 137) zwischen dem 26.09. und dem 14.10. jeweils Montags bis<br />
Freitags von 10 bis 12 Uhr erforderlich.<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister, Prof. Dr. Martin Uebele<br />
082147 Hauptseminar: Wenn Staaten Pleite gehen - Kapitalmärkte und Zahlungsprobleme<br />
souveräner Schuldner seit 1850<br />
Mi 8-10, Raum: F 102, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Beim Schreiben dieser Zeilen (Mai <strong><strong>201</strong>1</strong>) schaut die Welt gebannt nach Griechenland und<br />
fragt sich, ob das Land in der nächsten Zeit seine Schulden umstrukturieren muss oder nicht.<br />
Im ersteren Fall wäre es nach 1826, 1893 und 1932 das vierte Mal in seiner Geschichte.<br />
Zahlungsschwierigkeiten souveräner Schuldner sind eine wichtige Begleiterscheinung<br />
globalisierter Finanzmärkte seit der Entfaltung der Weltwirtschaft <strong>ab</strong> dem 19. Jh. Das<br />
Hauptseminar behandelt das derzeit höchst aktuelle Thema aus historischer Sicht. Im Zentrum<br />
stehen folgende Aspekte: Formen und Gründe von Zahlungsschwierigkeiten; Folgen von<br />
Zahlungsschwierigkeiten souveräner Schuldner für die betroffenen Länder und das weltweite<br />
Finanzsystem; Formen der Schuldenregelungsmechanismen.<br />
71
Literaturhinweise: James Foreman-Peck, A history of the world economy. International<br />
economic relations since 1850, Brighton 1995; Ulrich Pfister, Globalisierung und<br />
Weltwirtschaft, S. 277–336 in: WBG Weltgeschichte, Bd. 6, Darmstadt <strong>201</strong>0; Carmen<br />
Reinhart / Kenneth S. Rogoff, This time is different. Eight centuries of financial folly,<br />
Princeton 2009; Christian Suter, Schuldenzyklen in der Dritten Welt. Kreditaufnahme,<br />
Zahlungskrisen und Schuldenregelungen peripherer Länder im Weltsystem von 1820 bis<br />
1986, Frankfurt a. M. 1990.<br />
Prof. Dr. Werner Freitag<br />
082151 Hauptseminar: Dörfer im Münsterland: Agrarwirtschaft, ländliche Industrialisierung<br />
und Kommunalpolitik im 19. Jahrhundert<br />
Mi 16-18 Uhr, Raum: F3 Erdgeschoss, Beginn: 12.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Seminar Neuzeit im Vertiefungsmodul Bachelor Sozialgeschichte /Wirtschaftsgeschichte<br />
Dörfer im Münsterland: Agrarkapitalismus, ländliche Industriealisierung und kommunale<br />
Politik im 19. Jahrhundert<br />
Der Untergang des Alten Reiches brachte für die ländliche Gesellschaft des Münsterlands<br />
einschneidende Veränderungen mit sich: „Bauerbefreiung“, Markenteilung und<br />
Verkoppelungen ließen eigenbehörige Bauern zu Marktakteuren werden; die preußische<br />
Landgemeindeordnung von 1841 führte zu neuen kommunalen Verwaltungsstrukturen, die es<br />
erlaubten, lokale Interessen zu verfolgen; Agrarkonjunkturen und die Anbindung an<br />
überregionale Absatzmärkte führten zu sozialer Unrast und zur Bildung marktbedingter<br />
sozialer Klassen. Und auch die überkommene Trennung von Stadt und Land in<br />
wirtschaftlicher Hinsicht wurde durchlässiger: Spezifisch auf das Land zugeschnittene<br />
Gewerbe- und Industriebetriebe, etwa Molkereien und Ziegeleien, siedelten sich an.<br />
Das Seminar will diesen Strukturwandel der ländlichen Gesellschaft aufzeigen. D<strong>ab</strong>ei werden<br />
Themen- und Ortsreferate sich <strong>ab</strong>wechseln.<br />
Literatur: Die Ortsliteratur ist reichhaltig, <strong>ab</strong>er manchmal heimatlich geprägt. Ein<br />
Seminarapparat wird zu Semesterbeginn aufgebaut.<br />
Einführend: Werner Troßbach u. Clemens Zimmermann, Die Geschichte des Dorfes: Von den<br />
Anfängen im Frankenreich zur bundesdeutschen Gegenwart, Stuttgart 2006.<br />
Zusätzlich zu HISLSF ist eine Anmeldung im Sekretariat der Abteilung für westfälische<br />
Landesgeschichte (F-Haus, Raum 35) erforderlich: vom 27.06.-15.07. bzw. vom 26.09.-<br />
14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>.<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister, Christine Fertig<br />
082166 Hauptseminar: Arbeiterbewegung in Kaiserreich und Weimarer Republik<br />
Di 10-12, Raum: F 102, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Arbeiterbewegung war die am breitesten in der Bevölkerung verankerte soziale<br />
Bewegung des ausgehenden 19. und frühen 20. Jh. Ihre historische Erforschung stellt ein<br />
klassisches Thema der politischen Sozialgeschichte dar. Das Hauptseminar behandelt<br />
ausgewählte Bereiche des Themas und stellt d<strong>ab</strong>ei folgende Aspekte in der Vordergrund:<br />
Elemente der organisierten Arbeiterbewegung (Gewerkschaften, Vereine; weniger Parteien)<br />
in ihren Beziehungen zu Politik und öffentlichen Einrichtungen; Formen des Protests und des<br />
Arbeitskampfs; Beziehung der Arbeiterbewegung zum Milieu der Industriearbeiterschaft.<br />
Literaturhinweise: Friedhelm Boll, Arbeitskämpfe und Gewerkschaften in Deutschland,<br />
England und Frankreich. Ihre Entwicklung vom 19. zum 20. Jahrhundert, Bonn 1992;<br />
Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des 18.<br />
-2007; Karen Hagemann, Frauenalltag und Männerpolitik.<br />
Alltagsleben und gesellschaftliches Handeln von Arbeiterfrauen in der Weimarer Republik,<br />
72
Untersucht am Beispiel des sozialdemokratischen Milieus in Hamburg, Bonn 1990; Axel<br />
Kuhn, Die Deutsche Arbeiterbewegung, Stuttgart 2004.<br />
Prof. Dr. Rolf Ahmann<br />
082170 Hauptseminar: Ansätze und Probleme des „post-conflict“ und „post-colonial“<br />
„nation-building“/ „state-building“ im 20. Jahrhundert<br />
Di, 14-16 Uhr, Raum: F 3, Beginn: 18.10.<br />
Anmeldung erforderlich, im Sekretariat (bei Frau Ibrahim/ Frau Michelson)<br />
„Nation-building“ bzw. "state-building" ist in jüngster Zeit - vor dem Hintergrund innerer<br />
Zerfallserscheinungen vieler Staaten - mehr als zuvor zu einer Herausforderung der<br />
internationalen Staatengemeinschaft avanciert. Verbunden damit hat sich eine Diskussion<br />
über historische Beispiele erfolgreicher, problematischer bzw. gescheiterter „nationbuilding/state-building“<br />
Versuche in und außerhalb Europas im Gefolge der großen Kriege<br />
und der Entkolonialisierungsprozesse des 20. Jahrhunderts entwickelt. Das Hauptseminar<br />
behandelt - im Anschluss an eine nähere Betrachtung der historisch-politischen Entwicklung<br />
der Diskussion über „nation-building/state-building“ - anhand mehrerer historischer<br />
Fallbeispiele weltweit: die unterschiedlichen Anforderungen des „post-conflict“ und des<br />
„post-colonial“ „nation-building/state building“ im Verlauf des 20. Jahrhundert in<br />
verschiedenen Regionen und Staatsformationen, die damit verbundenen Ansätze und<br />
Bemühungen sowie die hinsichtlich ihrer Erfolge, Probleme oder ihres Scheiterns relevanten<br />
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Aspekte.<br />
Einf. Lit.: Berit Bliesemann de Guevara / Florian P. Kühn: Illusion Statebuilding: Warum sich<br />
der westliche Staat so schwer exportieren lässt. Hamburg <strong>201</strong>0; Roland Paris/ Timothy D.<br />
Sisk (Hrsg.): The Dilemmas of State-building. Confronting the Contradictions of Postwar<br />
Peace Operations. London, New York 2009; Francis Fukuyama: Staaten bauen. Die neue<br />
Herausforderung internationaler Politik. Berlin 2006; Klaus Schlichte: Der Staat in der<br />
Weltgesellschaft. Politische Herrschaft in Asien, Afrika und Lateinamerika. Frankfurt a. M. ,<br />
New York 2005; Jochen Hippler: Nation-Building. Ein Schlüsselkonzept für friedliche<br />
Konfliktbearbeitung. Bonn 2004; Robert I. Rosberg (Hrsg.): State Failure and State Weakness<br />
in a Time of Terror. Washington D.C. 2003; James Dobbins u.a.: America's Role in Nation-<br />
Building. From Germany to Iraq. New York 2003; Norbert Elias: Processes of State<br />
Formation and Nation Building: In: Transactions of the 7th World Congress of Sociology<br />
1970. Bd. 3. Sofia 1972 , S. 274-84.<br />
5. Oberseminare<br />
Prof. Dr. Peter Funke<br />
081380 Oberseminar: Das Verhältnis von Religion und Politik im antiken Griechenland im<br />
Spiegel literarischer und epigraphischer Zeugnisse<br />
Mo 18-20, Raum: F 229, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG<br />
Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Im Mittelpunkt des Oberseminars steht die Analyse des Verhältnisses von Religion und<br />
Politik im antiken Griechenland im Spiegel literarischer und epigraphischer Zeugnisse.<br />
Darüber hinaus besteht die Gelegenheit für Studierende und Doktoranden Abschlussarbeiten<br />
und laufende Forschungsvorh<strong>ab</strong>en zur Diskussion zu stellen.<br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081375 Oberseminar: Neue Quellen zur griechisch-römischen Welt<br />
73
Mi 15-16.30 (14 tg.), Raum: 254, Seminar für Alte Geschichte, Fürstenberghaus, Domplatz<br />
20-22, 2. OG, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Programm und Ablauf sollen in der ersten Sitzung mit den Teilnehmern <strong>ab</strong>gesprochen<br />
werden. – Rechtzeitige persönliche Anmeldung erforderlich.<br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
082190 Oberseminar/Masterseminar: Amor Patriae und Global History. Methoden der<br />
Mediävistik.<br />
Do 8-10, Raum: F 104, Beginn: 13.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Unterschiedlichen gesellschaftlichen Absichten ist die Beschäftigung mit der mittelalterlichen<br />
Geschichte seit der Renaissance und bis zur modernen Gegenwart nutzbar gemacht worden.<br />
Wissenschaftliche Ansätze ihrer Erforschung h<strong>ab</strong>en sich in diesem Rahmen entwickelt und so<br />
dazu beigetragen, Bilder von Geschichte in der zeitgenössischen Gesellschaft zu generieren<br />
und Aussagen zu treffen zum Verhältnis der eigenen Zeit zu ihrer Vergangenheit. Daran hat<br />
sich bis heute grundsätzlich wenig geändert. Das Seminar will die Entwicklung der Methoden<br />
historischer Mediävistik vom 15. bis zum 21. Jahrhundert untersuchen und vergleichend<br />
analysieren. D<strong>ab</strong>ei wird ebenso von den Grundlagen der Quellenkritik und des historischen<br />
Positivismus zu sprechen sein wie von den Herausforderungen der modernen<br />
Kulturwissenschaften und den aktuellen Tendenzen einer Global History.<br />
Lit. Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte, Frankfurt/M. 2001; Lutz Raphael,<br />
Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme, München 2003; Werner Paravicini, Die<br />
Wahrheit der Historiker, München <strong>201</strong>0; Wolfram Drews, Transkulturelle Perspektiven in der<br />
mittelalterlilchen Historiographie, in: Historische Zeitschrift 292 (<strong><strong>201</strong>1</strong>), S. 31-59.<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
082204 Oberseminar/Masterseminar: Reconquista und Kreuzzüge<br />
Di 16-18, Raum: F 153<br />
Bald nach 711 wurden große Teile der Iberischen Halbinsel von muslimischen Truppen<br />
erobert; lediglich im Norden blieben einige Landstriche in christlicher Hand. Aus späterer<br />
Rückschau erschien es so, als hätte bald darauf die christliche „Rückeroberung“ des<br />
„verlorenen“ Gebietes begonnen. Die Forschung hat kontrovers darüber diskutiert, ob für die<br />
hiermit verbundenen militärischen Unternehmungen religiöse oder vielmehr nur politische<br />
oder auch ökonomische Gründe angenommen werden müssen. Erst mit der Entstehung der<br />
Kreuzzugsbewegung in Frankreich <strong>ab</strong> dem 11. Jahrhundert kam es verstärkt zur Teilnahme<br />
nichtspansicher Kämpfer an den Kriegszügen auf der Iberischen Halbinsel, was deren<br />
Charakter nachhaltig veränderte. Der päpstliche Kreuzzugs<strong>ab</strong>laß wurde auf Spanien<br />
übertragen, und hier entstanden eigene Ritterorden, die nicht nur militärische, sondern auch<br />
siedlungspolitische Aufg<strong>ab</strong>en übernahmen. Das Seminar behandelt Grundzüge der<br />
Ereignisgeschichte, was als Grundlage für die Diskussion unterschiedlicher<br />
Forschungspositionen zur Verhältnisbestimmung zwischen der (vermeintlichen) Reconquista<br />
und der vornehmlich französisch-päpstlichen Kreuzzugsideologie dient.<br />
Literatur: Bronisch, Alexander Pierre, Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des<br />
Krieges im christlichen Spanien von den Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert (Spanische<br />
Forschungen der Görres-Gesellschaft II/ 35), Münster 1998; Engels, Odilo, Reconquista und<br />
Landesherrschaft (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-<br />
Gesellschaft N. F. 53), Paderborn/München/Wien/Zürich 1989; Erdmann, Carl, Die<br />
Entstehung des Kreuzugsgedankens (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte 6),<br />
Stuttgart 1935, ND Darmstadt 1965; Forey, Alan J., The Military Religious Orders and the<br />
74
Spanish Reconquest in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Traditio 40 (1984), 197-234;<br />
Jaspert, Nikolas, Die Kreuzzüge, Darmstadt 2003; Lomax, Derek W., The Reconquest of<br />
Spain, London/ New York 1978; Schwenk, Bernd, Calatrava. Entstehung und Frühgeschichte<br />
eines spanischen Ritterordens zisterziensischer Observanz im 12. Jahrhundert (Spanische<br />
Forschungen der Görres-Gesellschaft II/ 28), Münster 1992.<br />
Dr. Martina Winkler<br />
082219 Oberseminar/Masterseminar: „Unter der gnädigen Herrschaft Ihrer überaus<br />
großherzigen Majestät“: Das Russländische Imperium, 16. -19. Jahrhundert<br />
Di 10-12, Raum: F 104, Beginn: 11.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Russländische Geschichte fand nicht nur in Moskau und St. Petersburg statt, sondern auch auf<br />
zentralasiatischen Baumwollfeldern, im „wilden“ Kaukasus und in den Dörfern aleutischer<br />
Robbenjäger. Wie man mit dieser Erkenntnis umgeht, weshalb das Imperium „russländisch“<br />
und nicht einfach „russisch“ heißt, warum man von einem „imperial turn“ spricht und wie er<br />
unseren Blick (nicht nur) auf die russische Geschichte verändert hat – diese Fragen stehen im<br />
Zentrum des Seminars. Wir werden uns beschäftigen mit den Wegen der Expansion und den<br />
Methoden imperialer Herrschaft, kultureller Vielfalt und imperialen Identitäten.<br />
Einführende Literatur: Kappeler, Andreas, Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung -<br />
Geschichte - Zerfall, München 2001.<br />
Jun.Prof. Dr. André Krischer<br />
082223 Oberseminar/Masterseminar „Von der Alten Stadt zu Metropole: London und der<br />
Wandel des Urbanen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert“<br />
Mi 16-18 Uhr, Raum: F 153<br />
London erlebte zwischen 1500 und 1900 ein Bevölkerungswachstum wie keine andere Stadt<br />
im frühmodernen Europa: Von rund 50.000 zu über 5 Mio. Einwohnern. Im 19. Jahrhundert<br />
war London die größte Stadt der Welt. Für die Stadtgeschichtsschreibung stellt dieser Wandel<br />
eine besondere Herausforderung dar. Es geht nicht nur darum, die Veränderungen in<br />
sozialgeschichtlicher Perspektive nachzuvollziehen, sondern auch in kulturhistorischer Sicht:<br />
Wie erlebten und beschrieben die Zeitgenossen die Umbrüche Was war für sie eigentlich<br />
'London' Wie ließ sich der kaum mehr zu überschauende städtische Raum überhaupt noch als<br />
Einheit begreifen G<strong>ab</strong> es eine neue städtische Öffentlichkeit London war jener Ort, an dem<br />
sich die moderne Gesellschaft in ihren unterschiedlichen und widersprüchlichen Facetten<br />
ganz konkret ausdifferenzierte und d<strong>ab</strong>ei wirtschaftliche Prosperität, soziale Verwerfungen,<br />
Geistesfreiheit und politische Spannungen gleichzeitig zu integrieren hatte. Im Seminar<br />
wollen wir versuchen, diesen Wandel exemplarisch zu rekonstruieren, und zwar aus der<br />
Perspektive von Sozial-, Politik-, Rechts-, Kultur- und Mediengeschichte. Wir suchen nach<br />
Konzepten, um urbane Konfigurationen und deren Wandel zu erklären und fragen d<strong>ab</strong>ei auch<br />
bei der Stadt- und Raumsoziologie nach. Was besagt etwa der Begriff 'Metropole' Wir<br />
vergleichen London d<strong>ab</strong>ei auch mit anderen urbanen Formationen im frühmodernen Europa,<br />
mit anderen Großstädten wie Liss<strong>ab</strong>on und Paris ebenso wie mit Köln. Auf diese Weise<br />
wollen wir genauere Aufschlüsse darüber erhalten, ob und inwiefern die Geschichte Londons<br />
einen Sonderfall darstellt.<br />
Anforderungen: Essay und ggf. Hausarbeit, aktive Mitarbeit, selbständige Erarbeitung der<br />
wiss. Fragestellungen. Literatur und Quellen sind überwiegend fremdsprachig.<br />
Erste Literaturhinweise: Roy Porter: London: A Social History, London 1994; Francis<br />
Sheppard, London. A History, Oxford 1998; Peter Clark (Hg.): The Cambridge Urban History<br />
of Britain, Vol. II 1540-1840, Cambridge 2000, hier S. 315-346; Paul Griffiths /Mark Jenner<br />
(Hg.): Londinopolis: Essays in the cultural and social history of early modern London,<br />
75
Manchester 2000; Andreas Fahrmeier: Ehrbare Spekulanten. Stadtverfassung, Wirtschaft und<br />
Politik in der City of London (1688-1900), München 2003.<br />
Prof. Dr. Heike Bungert/Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082238 Oberseminar/Masterseminar: Nation und Nationalismus in den Amerikas<br />
Mi 14-16, Raum: F 102, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Nationen stellen bis heute eine wichtige Einheit im globalen Geschehen dar. Sie sind d<strong>ab</strong>ei<br />
allerdings ein relativ junges Phänomen, das erst im 18. Jahrhundert mit der USamerikanischen<br />
Un<strong>ab</strong>hängigkeit und der französischen Revolution in Erscheinung trat.<br />
Anders als auch in der Geschichtswissenschaft lange angenommen, stellten Nationalismen<br />
keine der Nation nachgeordnete Entwicklung dar, sondern gingen ihr vielmehr auch voran<br />
und trugen zur Ausbildung von Wir-Gruppen auf der Basis einer geteilten Nationalität bei.<br />
Wie allerdings diese Nation aussah bzw. aussehen sollte, hing von den jeweiligen historischen<br />
Umständen <strong>ab</strong>. Das Seminar will nach einer Erarbeitung der theoretischen Grundlagen anhand<br />
von Beispielen aus der lateinamerikanischen und nordamerikanischen Geschichte die<br />
Entstehungsprozesse von Nationen ebenso wie die beständige Neuaushandlung ihres<br />
konkreten Inhalts, die Inklusions- und Exklusionsmechanismen in Bezug auf andere ethnische<br />
Gruppen beleuchten.<br />
Ein Großteil der Lektüre besteht aus englischsprachigen Texten. Um Anmeldung im<br />
Sekretariat der Abteilung Außereuropäische und Nordamerikanische Geschichte (F-Haus,<br />
Raum 123) wird gebeten.<br />
Literatur: Nancy P. Appelbaum et al. (Hg.), Race and Nation in Modern Latin America,<br />
Chapel Hill 2003. Sara Castro-Klarén, John Ch. Chasteen (Hg.), Beyond Imagined<br />
Communities: Reading and Writing the Nation in Nineteenth-Century Latin America, London<br />
2003. Nicole Miller, The Historiography of Nationalism and Nation Identity in Latin<br />
America, in Nations and Nationalism 12,2 (2006), S. <strong>201</strong>-221; Don H. Doyle and Marco<br />
Antonio Pamplona (Hg.): Nationalism in the New World, Athens, Ga. 2006; John E. Bodnar<br />
(Hg.), Bonds of Affection: Americans Define their Patriotism, Princeton, NJ, 1996; David<br />
Waldstreicher, In the Midst of Perpetual Fetes: The Making of American Nationalism, Chapel<br />
Hill, NC, 1997; Wilbur Zelinsky, Nation into State: The Shifting Symbolic Foundations of<br />
American Nationalism, Chapel Hill, NC, 1988.<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister, Prof. Dr. Martin Uebele<br />
082147 Oberseminar/Masterseminar: Wenn Staaten Pleite gehen - Kapitalmärkte und<br />
Zahlungsprobleme souveräner Schuldner seit 1850<br />
Mi 8-10, Raum: F 102, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Beim Schreiben dieser Zeilen (Mai <strong><strong>201</strong>1</strong>) schaut die Welt gebannt nach Griechenland und<br />
fragt sich, ob das Land in der nächsten Zeit seine Schulden umstrukturieren muss oder nicht.<br />
Im ersteren Fall wäre es nach 1826, 1893 und 1932 das vierte Mal in seiner Geschichte.<br />
Zahlungsschwierigkeiten souveräner Schuldner sind eine wichtige Begleiterscheinung<br />
globalisierter Finanzmärkte seit der Entfaltung der Weltwirtschaft <strong>ab</strong> dem 19. Jh. Das<br />
Hauptseminar behandelt das derzeit höchst aktuelle Thema aus historischer Sicht. Im Zentrum<br />
stehen folgende Aspekte: Formen und Gründe von Zahlungsschwierigkeiten; Folgen von<br />
Zahlungsschwierigkeiten souveräner Schuldner für die betroffenen Länder und das weltweite<br />
Finanzsystem; Formen der Schuldenregelungsmechanismen.<br />
Literaturhinweise: James Foreman-Peck, A history of the world economy. International<br />
economic relations since 1850, Brighton 1995; Ulrich Pfister, Globalisierung und<br />
Weltwirtschaft, S. 277–336 in: WBG Weltgeschichte, Bd. 6, Darmstadt <strong>201</strong>0; Carmen<br />
Reinhart / Kenneth S. Rogoff, This time is different. Eight centuries of financial folly,<br />
76
Princeton 2009; Christian Suter, Schuldenzyklen in der Dritten Welt. Kreditaufnahme,<br />
Zahlungskrisen und Schuldenregelungen peripherer Länder im Weltsystem von 1820 bis<br />
1986, Frankfurt a. M. 1990.<br />
77<br />
6. Übungen<br />
Seminar für Alte Geschichte<br />
Die Anmeldelisten zu den Kursen, Hauptseminaren und Übungen im WS <strong><strong>201</strong>1</strong>/<strong>201</strong>2<br />
liegen in der Zeit<br />
vom 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 15.07.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12) und<br />
vom 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12)<br />
im Hilfskraftzimmer (Zimmer 247) bzw. in den Geschäftszimmern (Zimmer 246 u. 248)<br />
des Seminars für Alte Geschichte aus.<br />
Eine Anmeldung nur in HISLSF ist nicht zulässig!!<br />
Historisches Seminar, Abteilungen für Mittelalterliche Geschichte und Neuere und<br />
Neueste Geschichte<br />
Die Anmeldelisten zu den Hauptseminaren im WS <strong><strong>201</strong>1</strong>/<strong>201</strong>2 liegen in der Zeit<br />
vom 27.06.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 15.07.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12) und<br />
vom 26.09.<strong><strong>201</strong>1</strong> bis 14.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> (Mo-Fr 10-12)<br />
in den jeweiligen Sekretariaten der DozentenInnen aus.<br />
Eine Anmeldung nur in HISLSF ist nicht zulässig!!<br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081614 Übung: Die Juden im Imperium Romanum<br />
Do 16-18, Raum: F 3, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Geschichte des antiken Judentums ist seit der Eroberung Palästinas durch Alexander d.<br />
Gr. geprägt von dem Spannungsfeld zwischen Anpassung an eine zunehmend hellenistisch<br />
geprägte Umwelt und Wahrung der eigenen – jüdischen – Traditionen. Damit einher gingen<br />
massive Konflikte innerhalb des Judentums, die zur Zeit der römischen Vorherrschaft in<br />
Palästina zu bewaffneten Aufständen gegen Rom führten. Die Zerstörung Jerusalems und des<br />
2. Tempels 70 n. Chr. sind bis heute prägend für die historische Entwicklung des Judentums.<br />
Neben diesen im 1. und 2 Jh. n. Chr. eskalierenden politischen und militärischen Auseinandersetzungen<br />
stellt die Frage nach der schwierigen Integration der Juden innerhalb der<br />
römischen Gesellschaft einen weiteren Themenschwerpunkt dar, spielten diese doch im<br />
Alltagsleben vieler Städte des Römischen Reiches eine wichtige Rolle. D<strong>ab</strong>ei soll der<br />
nachkonstantinischen Zeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, als die Juden die<br />
einzige staatlich tolerierte nichtchristliche Religionsgemeinschaft innerhalb des christlichen<br />
Imperium Romanum bildeten.<br />
Literatur: E.M. Smallwood, The Jews under Roman Rule from Pompey to Diocletian. A<br />
Study in Political Relations, 2 Auflage 1981; A. Linder, The Jews in Roman Imperial<br />
Legislation, 1987; J. Maier, Geschichte des Judentums im Altertum. Grundzüge, 2. Auflage<br />
1989; J. Lieu/J. North/T. Rajak (Hg.), The Jews among Pagans and Christians in the Roman<br />
Empire, 1992; R. Jütte/A.P. Kustermann (Hg.), Jüdische Gemeinden und Organisationsformen<br />
von der Antike bis zur Gegenwart, 1996; K.L. Noethlichs, Das Judentum und der<br />
Römische Staat. Minderheitenpolitik im antiken Rom, 1996; K. L. Noethlichs, Die Juden im<br />
christlichen Imperium Romanum (4.–6. Jahrhundert), 2001 (Studienbücher Geschichte und<br />
Kultur der Alten Welt); K. Bringmann, Geschichte der Juden im Altertum. Vom
<strong>ab</strong>ylonischen Exil bis zur ar<strong>ab</strong>ischen Eroberung, 2005; H. Hillel Ben-Sasson (Hrsg.):<br />
Geschichte des jüdischen Volkes - von den Anfängen bis zur Gegenwart. Übersetzt von S.<br />
Schmitz), 5. erweiterte Auflage 2007.<br />
Prof. Dr. Engelbert Winter<br />
081629 Übung: Quellen zur Geschichte der Christenverfolgungen<br />
Do 14-16, Raum: F 3, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, EG, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Obwohl das Christentum erst zu Beginn des 4. Jhs. n. Chr. den Status einer religio licita, einer<br />
erlaubten Religion, erhielt, verhielt sich der römische Staat gegenüber den frühen Christen<br />
grundsätzlich tolerant. Dennoch können im Verlauf der ersten drei nachchristlichen<br />
Jahrhunderte gegen die Christen gerichtete staatliche Erlasse und Repressalien ebenso wenig<br />
übersehen werden wie einzelne Christenverfolgungen, deren Umfang und Härte <strong>ab</strong> der Mitte<br />
des 3. Jahrhunderts unübersehbar zunahmen. Deren Verlauf, <strong>ab</strong>er auch deren Anlässe und<br />
Ursachen vor dem Hintergrund der Situation der frühen Christen in Staat und Gesellschaft der<br />
vorkonstantinischen Zeit zu analysieren, ist zentrales Anliegen dieser Übung.<br />
Quellengrundlagen: P. Guyot/R. Klein, Das frühe Christentum bis zum Ende der<br />
Verfolgungen, Bd. 1: Die Christen im heidnischen Staat; Bd. 2: Die Christen in der<br />
heidnischen Gesellschaft, 1997 (zuerst 1993-1994).<br />
Literatur: J. Moreau, Die Christenverfolgung im Römischen Reich, 1971 2 ; R. Klein (Hg.):<br />
Das frühe Christentum im römischen Staat, WdF 267, 1971; J. Molthagen, Der römische Staat<br />
und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert, 1975 2 ; K. Bringmann, Christentum und<br />
römischer Staat im ersten und zweiten Jh. n. Chr., GWU 29 (1978) 1 ff.; H. D. Stöver,<br />
Christenverfolgung im Römischen Reich: ihre Hintergründe und Folgen, 1987; K.-H.<br />
Schwarte, Diokletians Christengesetz, in: E fontibus haurire. Beiträge zur römischen<br />
Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften, 1994, 203 ff.; J. Molthagen, Christen in der<br />
nichtchristlichen Welt des Römischen Reiches der Kaiserzeit (1.–3. Jahrhundert n. Chr.),<br />
2005; B. Bleckmann, Zu den Motiven der Christenverfolgung des Decius, in: Deleto paene<br />
imperio Romano. Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und<br />
ihre Rezeption in der Neuzeit. Hg. v. K.-P. Johne u.a., 2006, 57 ff.; K. Piepenbrink, Antike<br />
und Christentum, 2007.<br />
Dr. Michael Jung<br />
081633 Übung: Die homerische Gesellschaft<br />
Do 18-20, Raum: F 234, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Griechenland im Übergang von den Dark Ages zur Archaik war eine Gesellschaft im<br />
Umbruch. Die homerischen Epen stellen eine einzigartige Quelle für diese Zeit dar, allerdings<br />
birgt die historische Auswertung der Epen methodische Probleme, die in der Übung<br />
exemplarisch diskutiert werden sollen. Zugleich soll die Arbeit an den Quellen den Blick<br />
schärfen für die Bedeutung einer wichtigen Formationsperiode der griechischen Geschichte.<br />
Literatur: Ulf, Christoph: Die homerische Gesellschaft. Materialien zur analytischen<br />
Beschreibung und historischen Lokalisierung. München 1990.<br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081648 Übung: Rom und Germanien<br />
Di 16-18, Raum: F 4, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Mit der Romanisierung Südwestdeutschlands begann vor etwa 2000 Jahren ein Prozess,<br />
dessen Folgen für die geschichtliche Entwicklung unseres Landes in ihrer Bedeutung kaum<br />
hoch genug einzuschätzen sind. Römische Zivilisation prägte seitdem für Jahrhunderte nicht<br />
78
nur die unmittelbar zum Imperium gehörigen Gebiete, sondern auch die benachbarte<br />
Germania libera; zugleich gelangte seit Caesars Rheinübergängen erstmals genauere Kunde<br />
über die Bevölkerung des europäischen Nordens nach Rom. Gegenstand der Übung wird<br />
beides sein: die römische Expansion in ihren wichtigsten Etappen, <strong>ab</strong>er auch die Reflexe, die<br />
die Kontakte mit unseren Vorfahren in den Werken römischer Autoren hinterlassen h<strong>ab</strong>en.<br />
Einführende Literatur: Germanen, Germania, Germanische Altertumskunde, hg. v. H. Beck<br />
(Studienausg<strong>ab</strong>e aus: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde), Berlin - New York<br />
2 1998; R. Wiegels - W. Spickermann, DNP IV, 1998, 954-963, s. v. Germani, Germania; R.<br />
Wolters, Die Römer in Germanien, München 2000.<br />
N.N.<br />
081652 Übung<br />
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
N.N.<br />
081667 Übung<br />
Dozent, Thema, Zeit und Raum werden noch bekanntgegeben. Bitte auf Aushang am<br />
Schwarzen Brett des Seminars für Alte Geschichte oder im HISLSF achten!!!<br />
N.N.<br />
081671 Übung: Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten<br />
Di 8-10, F 6, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22 Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Entwicklung und Ausbreitung des Christentums im Imperium Romanum während der<br />
ersten drei Jahrhunderte n. Chr. stellt einen einmaligen Vorgang in der römischen Geschichte<br />
dar. Obwohl sich Christen wiederholt staatlichen Repressionen ausgesetzt sahen, breiteten<br />
sich christliche Gemeinden im gesamten Imperium aus. Diese Gemeinden standen in engem<br />
Austausch miteinander – für die religiöse Landschaft des Römischen Reiches ein<br />
exzeptioneller Vorgang. Die Übung verfolgt das Ziel neben der Analyse der<br />
Verfolgungssituationen, Gründe und Ursachen für die Attraktivität des Christentums zu<br />
beleuchten.<br />
Einführende Literatur: Guyot, P./Klein, R., Das frühe Christentum bis zum Ende der<br />
Verfolgungen. Eine Dokumentation, 2 Bde., Darmstadt 1997 (TzF 60). Brox, N.,<br />
Kirchengeschichte des Altertums, Düsseldorf 61998 (Leitfaden Theologie 8). Markschies,<br />
Chr., Das antike Christentum. Frömmigkeit, Lebensformen, Institutionen, München 2006.<br />
Piepenbrink, K., Antike und Christentum, Darmstadt 2007.<br />
N.N.<br />
082663 Übung: Der Historiker im Interview<br />
Mi 10-12, Raum F 104<br />
Das Interview ist ein vor allem im deutschen Sprachraum bisher nur wenig genutztes<br />
Instrument zur epistemologischen Erforschung der Geschichtswissenschaft. D<strong>ab</strong>ei kann das<br />
wissenschaftliche Fragestellen gerade die Zwischenräume des eigenen Fachbereichs ausloten,<br />
der kein L<strong>ab</strong>or zum räumlichen Zuhause hat: Mit welchen Ordnungs- und<br />
Archivierungssystemen arbeiten Historikerinnen und Historiker Nach welchen Kriterien<br />
wählen sie ihre Forschungsobjekte und mit welchen Praktiken und Erkenntnismethoden<br />
versuchen sie sich diese zu erschließen Wie strukturieren sie das produzierte Wissen und<br />
79
präsentieren sie ihre Erkenntnisse – Das Erforschen der Geschichte ist wie auch das<br />
naturwissenschaftliche Forschen ein spannender, keineswegs gleichförmiger Prozess, bei dem<br />
im Vorfeld oft noch ungewiss ist, zu welchen Ergebnissen die Arbeit führt. Diese Prozesse<br />
sollen exemplarisch über Interviews mit Historikerinnen und Historikern der Westfälischen<br />
Wilhelms-Universität Münster erfragt werden. Dazu werden zunächst die Methoden des<br />
wissenschaftlichen Fragestellens und Interviewtechniken gemeinsam erarbeitet, ehe die<br />
entsprechenden Fragekatologe durch die jeweiligen Interviewteams im Seminar vorgestellt<br />
werden sollen. Nach dem erfolgten Interview werden die anstehenden Arbeitsschritte von der<br />
Transkription über die Politur bis hin zur Korrektur durch die Interviewpartner durch das<br />
Seminar begleitet. Am Ende des Semesters soll idealerweise eine Publikation der Interviews<br />
erfolgen.<br />
N.N.<br />
082659 Übung:»Das Museum als Erkenntnisort« – Schreiben über Ausstellungen<br />
Mi 16-18, Raum: ES 227<br />
Das Museum als Institution der Geschichtskultur führte lange Zeit ein Schattendasein<br />
innerhalb der Geschichtswissenschaft. Gegenwärtig steht jedoch außer Frage, dass Museen<br />
auf vielfältige Art und Weise historische Erkenntnisse vermitteln und erfahrbar machen.<br />
Zudem scheinen sie der ureigenen Institution der Geschichtswissenschaft, dem Archiv, nicht<br />
unverwandt zu sein, sind doch auch sie mit dem Sammeln, Archivieren und Systematisieren<br />
von Objekten beauftragt. Aber wie wird aus einzelnen Exponaten ein Erkenntnisgegenstand<br />
Nach welchen Systematiken werden diese im Raum angeordnet Wie wird historische<br />
Erkenntnis präsentiert, erfahrbar gemacht Wie funktioniert das Ausstellungsmachen – Im<br />
Arbeitskurs wird zunächst der Erfahrungsraum Ausstellung/Museum theoretisch erschlossen,<br />
ehe über ein oder zwei Exkursionen dieser Raum auch praktisch erfahren werden soll. Am<br />
Ende des Arbeitskurses steht das Verfassen von Ausstellungskritiken auf dem Programm.<br />
Prof. Dr. Silke Hensel, Matthias Friedmann, Henrik Kipshagen, Frank Schlegel, Philipp<br />
Spreckels,<br />
082261 Übung: Geschichte im Radio: Migration in globalhistorischer Perspektive<br />
Do 16-18, Raum: F 102, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
„Ich möchte nicht, dass wir zu Fremden im eigenen Land werden“: Mit Sätzen wie diesen<br />
löste Thilo Sarrazin im letzten Jahr eine neue Debatte über Migration und Integration aus. In<br />
den Medien erhält das Thema seitdem verstärkt Aufmerksamkeit. Doch wie fundiert ist diese<br />
Debatte Die Geschichtswissenschaft kann hier wertvolle Hintergründe liefern. Welche<br />
Folgen hatte Migration für die jeweiligen Länder Wie wurden die Migranten wahr-/<br />
aufgenommen Welche Auswirkungen hatten beispielsweise Rassenvorstellungen auf die<br />
soziale Inklusion bzw. Exklusion der Migranten In der Übung soll eine Radiosendung über<br />
unterschiedliche, auf globaler Ebene stattfindende Migrationsbewegungen erarbeitet werden,<br />
um die aktuelle Debatte anhand historischer Beispiele kritisch zu hinterfragen. Neben dieser<br />
inhaltlichen Beschäftigung mit der Migrationsgeschichte soll die praktische Umsetzung von<br />
Geschichte im Radio im Vordergrund stehen. Die Seminarteilnehmer werden in Kleingruppen<br />
einen Beitrag eigenständig entwerfen und produzieren, der dann auch gesendet werden soll.<br />
Die Bereitschaft für Engagement außerhalb der Übung ist für die Teilnahme wichtig. Die<br />
Übung findet in Kooperation mit dem Campusradio Radio Q statt. Wegen der technischen<br />
Radioausbildung ist die TeilnehmerInnenzahl auf 15 begrenzt. Bitte tragen Sie sich zu den<br />
allgemeinen Terminen bei Frau Simon (R 123) in die Liste ein.<br />
Literatur: Wolf Schneider, Deutsch für Profis, Berlin <strong>201</strong>0. Margarete Bloom-Schinnerl, Der<br />
gebaute Beitrag. Ein Leitfaden für Journalisten, Konstanz 2002, Walther von la Roche, Radio-<br />
80
Journalismus: Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis im Hörfunk, München 1980.<br />
http://www.qhistory.de. Dirk Hoerder, Geschichte der deutschen Migration, München <strong>201</strong>0.<br />
Dirk Hoerder, Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millennium, Durham u.a.<br />
2002. Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur<br />
Gegenwart, München 2000. Jochen Oltmer, Migration im 19. und 20. Jahrhundert,<br />
München/Oldenburg 2009.<br />
Dr. Thomas Tippach<br />
082811 Übung: Kartographie für Historiker<br />
Mi 14-16, Raum: ULB 1, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>.<br />
Landkarten stellen eine wichtige Quellengattung dar, gleichwohl sind sie erst in den letzten<br />
Jahren verstärkt in den Fokus der Geschichtswissenschaft gerückt. Im ersten Teil dieser<br />
Übung sollen die Möglichkeiten und Grenzen der Analyse und Interpretation von Altkarten<br />
diskutiert werden. In einem zweiten Teil sollen Konzepte, Methoden und Anwendungen<br />
historisch-thematischer Kartographie vorgestellt werden.<br />
Literatur: Chr. Dipper/U. Schneider (Hg.), Kartenwelten. Der Raum und seine Repräsentation<br />
in der Neuzeit, Darmstadt 2006; U. Schneider, Die Macht der Karten. Ein Geschichte der<br />
Kartographie vom Mittelalter bis heute, Darmstadt 2004; D. Cosgrove,/S. Daniel (Ed.), The<br />
Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use Past<br />
Enviroments, Cambridge 1988; F. Dickmann, K. Zehner, Computerkartographie und GIS,<br />
Braunschweig ²2001; E. Arnberger, Theamtische Kartographie, Braunschweig 4 1997.<br />
Dr. Károly Goda<br />
082850 Übung: Hilfswissenschaften zur spätmittelalterlichen Sozialgeschichte: Diplomatik,<br />
Sphragistik, Heraldik und Genealogie<br />
Mo 12−14, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Königsstraße 46, Sitzungszimmer<br />
Beginn: 10.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Historischen Hilfswissenschaften werden wegen ihrer grundlegenden Bedeutung auch als<br />
Grundwissenschaften der Geschichte bezeichnet und ihre Vertreter leisten unverzichtbare<br />
Grundlagenarbeit für die Geschichtsforschung. Die Übung wird sich mit dem nichtpaläographischen<br />
Quellentypen des Spätmittelalters befassen. Neben der theoretischen<br />
Einführung wird sich d<strong>ab</strong>ei ein besonderes Augenmerk auf die Frage richten, wie der Umgang<br />
mit verschiedenen Quellengattungen geübt werden kann. In der Veranstaltung werden die<br />
Grundlagen und Methoden der Historischen Hilfswissenschaften erlernt und geübt. Vermittelt<br />
werden d<strong>ab</strong>ei grundlegende Kompetenzen im Umgang mit unterschiedlichen Quellen des<br />
Spätmittelalters. Grundkenntnisse des Lateinischen sind von Vorteil, für einen allgemeinen<br />
Leistungsnachweis jedoch nicht Bedingung. Nach der Einführungsphase dienen die<br />
Übungssitzungen zum Gedankenaustausch, zur gemeinsamen Problemlösung und zur<br />
Rückmeldung. Unerlässliche Voraussetzung für eine gewinnbringende Teilnahme ist das<br />
regelmäßige und intensive Lesen der Sekundärliteratur. Teilnehmerzahl: maximal 15<br />
Studierende (bitte bis zum 01.10.<strong><strong>201</strong>1</strong> per E-mail anmelden!) E-mail:<br />
karoly.goda@gmail.com<br />
Einführende Literatur: Ahasver v. Brandt: Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die<br />
Historischen Hilfswissenschaften. Stuttgart, 2003; Eckart Henning: Auxilia historica. Beiträge<br />
zu den historischen Hilfswissenschaften und ihren Wechselbeziehungen. Köln, 2004; Toni<br />
Diederich – Joachim Oepen (Hg.): Historische Hilfswissenschaften. Stand und Perspektiven<br />
der Forschung. Köln, 2005.<br />
N.N.<br />
81
082276 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 8-10, Raum: F 042<br />
N.N.<br />
082280 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 12-14, Raum: ES 227<br />
N.N.<br />
082295 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Mo 16-18, Raum: F 042<br />
N.N.<br />
082300 Übung zur Einführungsvorlesung: Das Mittelalter<br />
Fr 14-16, Raum: F 042<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
082314 Übung: Transkulturelle Geschichte im Mittelalter: Juden zwischen christlicher und<br />
islamischer Herrschaft<br />
Mi 16-18, Raum: F 104<br />
In jüngerer Zeit werden in der Geschichtswissenschaft verstärkt Fragen und Ansätze der<br />
globalen und transkulturellen Geschichte diskutiert. Die Übung stellt eingangs einige der in<br />
diesem Zusammenhang vertretenen Positionen vor und behandelt anschließend die Frage, ob<br />
derartige Zugänge auch für die vormodernen Epochen, namentlich das Mittelalter, fruchtbar<br />
gemacht werden können. Als Beispiel für die Diskussion von Problemen der Verflechtung<br />
und Migration wird die Geschichte einer jüdischen Familie aus dem byzantinischen und<br />
islamischen Süditalien vorgestellt, deren Lektüre im Zentrum der Veranstaltung steht. Im<br />
Jahre 1054 vollendete der jüdische Gelehrte Ahimaaz ben Paltiel aus Oria in Süditalien eine<br />
Familienchronik, in der er die Erinnerung an Taten und Leistungen seiner Vorfahren mit<br />
legendenhaften Schilderungen sowie mit Reminiszenzen an die süditalienische Lokal- und<br />
Regionalgeschichte verband, <strong>ab</strong>er auch mit Hinweisen auf die byzantinische Geschichte sowie<br />
auf diejenige ar<strong>ab</strong>isch-islamischer Fürstentümer im Mittelmeerraum. Die Geschichte dieser<br />
jüdischen Familie zeigt beispielhaft, wie Juden im Mittelmeerraum als Vermittler zwischen<br />
unterschiedlichen politischen Herrschaftsbereichen, <strong>ab</strong>er auch verschiedenen kulturellen und<br />
religiösen Traditionen agierten.<br />
Literatur: Borgolte, Michael/Juliane Schiel/Bernd Schneidmüller/Annette Seitz (eds.),<br />
Mittelalter im L<strong>ab</strong>or. Die Mediävistik testet Wege zu einer transkulturellen<br />
Europawissenschaft (Europa im Mittelalter 10), Berlin 2008; Conrad, Sebastian/Andreas<br />
Eckert/Ulrike Freitag (eds.), Globalgeschichte. Theorien, Ansätze, Themen (Globalgeschichte<br />
1), Frankfurt/New York 2007; Drews, Wolfram, Koordinaten eines historischen Bewußtseins<br />
in der mittelalterlichen jüdischen Historiographie. Das Beispiel des Ahimaaz von Oria, in:<br />
Klaus Hödl (ed.), Historisches Bewußtsein im jüdischen Kontext. Strategien – Aspekte –<br />
Diskurse (Schriften des Centrums für Jüdische Studien 6), Innsbruck/Wien/München/Bozen<br />
2004, 13-28; Höfert, Almut, Anmerkungen zum Konzept einer „transkulturellen“ Geschichte<br />
in der deutschsprachigen Forschung, in: Wolfram Drews/Jenny Rahel Oesterle (eds.),<br />
Transkulturelle Komparatistik. Beiträge zu einer Globalgeschichte der Vormoderne =<br />
Comparativ 18/3 (2008), 15-26; Kaufmann, David, Die Chronik des Achimaaz von Oria (850-<br />
1054). Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Süditalien, Frankfurt/ M. 1896; Die Chronik<br />
des Achimaaz von Oria [850-1054], in: id., Gesammelte Schriften, Bd. 3, Frankfurt/ M. 1915,<br />
1-55; Osterhammel, Jürgen, Transkulturell vergleichende Geschichtswissenschaft, in: Heinz-<br />
82
Gerhard Haupt/ Jürgen Kocka (eds.), Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse<br />
international vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt/ M. – New York 1996, 271-313<br />
Salzman, Marcus, The Chronicle of Ahimaaz (Columbia University Oriental Studies 18),<br />
New York 1924, ND 1966; Skinner, Patricia, Gender, Memory and Jewish Identity. Reading a<br />
Family History from Medieval Southern Italy, Early Medieval Europe 13 (2005), 277-296.<br />
Dr. Liliya Berezhnaya, Jun.Prof. Dr. Michael Grünbart<br />
082329 Übung: Byzanz als Idee im osteuropäischen Raum<br />
Mi 12-14, Raum: ES 24<br />
Seit Nicolae Iorga‟s bekanntem Buch Byzance après Byzance (1935) ist das Thema der<br />
byzantinischen „brauchbaren Vergangenheit“ (us<strong>ab</strong>le past) in Ost-, Ostmittel- und<br />
Südosteuropa ein riesiges Forschungsfeld geworden. Was ist vom versunkenen<br />
Byzantinischen Reich in den neuen Staaten Europas geblieben und vor allem in welcher<br />
Form Seit dem 19. Jahrhundert h<strong>ab</strong>en verschiedene intellektuelle Traditionen in der Region<br />
versucht, auf eigene Weise dieses Erbe identitätsstiftend zu machen. Das betrifft vor allem<br />
Russland, wo die Slawophilen die Lebendigkeit des Byzantinischen Erbes in der Orthodoxen<br />
Kirche, im Rechtssystem, in der Architektur, der bildenden Kunst, <strong>ab</strong>er auch in der<br />
Weltanschauung und in der Volkstradition stark gemacht h<strong>ab</strong>en. Das betrifft ferner die<br />
Ideologie des Panslawismus, die im 19. Jh. als Ziel die kulturelle, religiöse und politische<br />
Einheit aller slawischen Völker Europas gesetzt hat. Die tausendjährige Geschichte des<br />
Byzantinischen Reiches diente oft als Modell für staatlich-kirchliche Beziehungen, sowie für<br />
Formen erfolgreicher Koexistenz in einem multiethnischen Staat.<br />
Unser Kurs befasst sich mit Fragen der translatio imperii im osteuropäischen Raum. Er<br />
besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil gilt den Besonderheiten der Byzantinischen<br />
Geschichte, Theologie, Staatsformen und Kunst. Der zweite ist verbunden mit Fragen nach<br />
Spuren dieses Erbes im heutigen Ost- und Südosteuropa. Wir wollen betrachten, wie Byzanz<br />
als eine Form des kulturellen Gedächtnisses oder anders formuliert als Geschenk in den<br />
Ländern, die stark von der Griechisch-Orthodoxen Tradition geprägt sind (in Russland, in der<br />
Ukraine, Weißrussland, Bulgarien, Rumänien, Serbien oder Moldawien) jeweils in<br />
Staatsideologie, diplomatischem Zeremoniell und Kunstformen, im Kirchenleben und in<br />
Volkstraditionen, weiterwirkt und noch präsent ist. Wir wollen außerdem verfolgen, ob und<br />
wie die Eroberung von Byzanz durch die Osmanen ein lebendiges Trauma im osteuropäischen<br />
Gedächtnis geworden ist.<br />
PD Dr. Alheydis Plassmann<br />
082898 Übung: Herrscherlob und Tyrannenschelte in der englischen Geschichtsschreibung<br />
des 12. Jahrhunderts<br />
Fr 14-16, Raum: F 153, Beginn: 4.11.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Das englische Königtum hatte sich in der Folge der normannischen Eroberung Englands 1066<br />
zu einer Herrschaft entwickelt, die im Vergleich zu anderen europäischen Regionen sehr viel<br />
stärker zentralisiert und deren Instrumentarium zur Machtausübung weiter entwickelt war.<br />
Das Vorgehen der englischen Könige bei der Ausweitung ihrer Herrschaft bedurfte indes<br />
besonderer Legitimationsstrategien, da ihre Handlungsweise von traditionellen christlichen<br />
Königsidealen oftmals nicht <strong>ab</strong>gedeckt war. Auf die Wahrnehmung der Zeitgenossen, die wir<br />
in der überaus reichen lateinischen historiographischen Überlieferung in vielen Facetten<br />
fassen können, hat die Legitimierung der Könige offenbar nur begrenzt gewirkt. Dem<br />
Vorwurf der willkürlichen Tyrannei oder zumindest der ungerechten Herrschaft schließen<br />
sich eine Vielzahl von zeitgenössischen Stimmen an. Zum einen ist die Frage zu stellen,<br />
inwieweit sich in historiographischen Zeugnissen verzerrt die Legitimationsbemühungen der<br />
83
Herrscher spiegeln. Zum anderen sollte in den Blick genommen werden, weshalb die<br />
Vermittlung der Legitimierung an die Beherrschten offenbar zu großen Teilen versagte.<br />
Voraussetzung zur Teilnahme ist die Bereitschaft zu intensiver Lektüre der lateinischenglischen<br />
Quellenausg<strong>ab</strong>en.<br />
Einführende Literatur: R. Bartlett, England under the Norman an Angiovin Kings, Oxford<br />
2000; J. Gillingham, The Angevin Empire, London u.a. 2 2001; A. Gransden, Historical<br />
Writing in England I. c. 550 to c. 1307, London 1974; C. Harper-Bill – N. Vincent (Hrsg.),<br />
Henry II. New Interpretations, Woodbridge 2007.<br />
Dr. Patrick Baker<br />
083951 Lektüreübung: Athen und Jerusalem. Zur Verhandlung zwischen klassischer Kultur<br />
und christlicher Zivilisation<br />
Mi 12-14, Raum: Bogenstr. 15/16, R. 304<br />
Schon im Neuen Testament (Col. 2:8) taucht die Problematik auf, die im 3. Jahrhundert durch<br />
Tertullianus ihre emblematische Formulierung bekommt: „Was hat also Athen mit Jerusalem<br />
zu schaffen, was die Akademie mit der Kirche, was die Häretiker mit den Christen” (De<br />
praescriptione haereticorum, 7). Seitdem ist sie zentraler Bestandteil der <strong>ab</strong>endländischen<br />
Tradition geblieben. Bei den Kirchenvätern der Spätantike bildete die Spannung zwischen<br />
klassischer Rhetorik und christlichem Glauben ein Kernproblem, wie im „Traum des heiligen<br />
Hieronymus“ ersichtlich wird, dem der Vorwurf gemacht wird, er sei kein Christ sondern ein<br />
Ciceronianus. In der Scholastik, etwa im Corpus von Thomas von Aquin, ging es eher um das<br />
korrekte Verhältnis zwischen ‚heidnischer‟ Philosophie und Theologie. Im Humanismus<br />
wurde der Ort der antiken Gelehrsamkeit in der christlichen Zivilisation neu verhandelt, u.a.<br />
in Schriften Vallas, Erasmus‟ und Melanchthons. In dieser Übung widmen wir uns einigen<br />
zentralen Quellen dieser historischen Debatte vom 1. bis zum 17. Jahrhundert. Gute<br />
Lateinkenntnisse sind Voraussetzung für die Teilnahme an der Übung.<br />
Texte: (Auszüge von:) Paulus, Epistula ad Colossenses; Tertullianus, De praescriptione<br />
haereticorum; Hieronymus, Epistolae; Augustinus, De doctrina Christiana; Boethius, De<br />
Trinitate; Thomas von Aquin, Expositio super Boethium; Carmina Burana; Petrarca,<br />
Secretum; Giovanni Dominici, Lucula noctis; Leonardo Bruni, Praefatio in librum magni<br />
Basilii Ad adolescentes; Lorenzo Valla, Encomium s. Thomae; Erasmus, Antibarbarorum<br />
liber u. Vita Hieronymi; Melanchthon, Praefatio in Homerum; Ratio studiorum.<br />
Dr. Philipp Stenzig<br />
08 Übung: Magister sententiarum – Petrus Lombardus und seine Epoche<br />
Mo. 16-18 Uhr, Raum: Seminar für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit,<br />
Bogenstraße 15/16, Bibliotheksraum im 3. Stock (R. 304), Beginn 10.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
max. Teilnehmerzahl: 20<br />
Eines der wichtigsten theologischen Lehrbücher des Mittelalters und ein zentraler Basistext<br />
der ganzen Scholastik sind die „Sententiarum libri IV‟ (1150-1158) des Petrus Lombardus (†<br />
1160), der seit den 1140er Jahren in Paris lehrte. Der Kanoniker an Notre Dame und spätere<br />
Bischof der Stadt war ein Zeitgenosse des Bernhard von Clairvaux († 1153), welcher sich zu<br />
seinen Gunsten eingesetzt hatte, er schöpfte – neben einer breiten Verwendung der<br />
Kirchenväter – namentlich aus den Lehren des Hugo von St. Viktor († 1141), des Anselm von<br />
Canterbury († 1109) und der übrigen bedeutenden Theologen seiner Epoche.<br />
In den vier Büchern der „Sententiae‟ – „De mysterio Trinitatis‟; „De rerum creatione‟; „De<br />
Incarnatione Verbi‟ und „De doctrina signorum‟ (über die Sakramente) – widmet sich Petrus<br />
Lombardus der Aufg<strong>ab</strong>e, die Gesamtheit der Dogmatik anhand der Hl. Schrift und der Väter<br />
darzustellen; der sophistischen „Dialektik‟ stellt er das Verfahren seiner distinctiones<br />
84
entgegen und harmonisiert die Autoritäten, statt sie gegeneinander auszuspielen. So gelingt<br />
ihm die Lösung wichtiger theologischer Streitfragen in Übereinstimmung mit der Tradition<br />
und dem Lehramt. Im 13. Jhdt. waren diese „Sententiae‟ an der maßgeblichen Universität von<br />
Paris der allgemeine Lehrstoff für das Theologiestudium geworden, sie wurden regelmäßig im<br />
Rahmen eines zweijährigen Zyklus durchgearbeitet und kommentiert. Bald schon entwickelte<br />
sich daraus die feststehende Form des „Sentenzenkommentars‟: Die Verfassung solcher<br />
Kommentare, wie sie etwa von Albertus Magnus und Thomas von Aquin vorliegen, war –<br />
zum Teil bis ins 16. Jhdt. – gleichsam das konventionelle „Meisterstück‟ und die<br />
Qualifikationsarbeit des scholastischen Theologen. Das vierte Laterankonzil (1215)<br />
verteidigte Petrus Lombardus ausdrücklich gegen die Angriffe des Joachim von Fiore und<br />
stützte sich auf die in den „Sententiae‟ dargelegte Trinitätslehre (can. 2). Im Rahmen der<br />
Lektüreübung soll vor allem der Umgang mit den überlieferten Vorlagen und Zeugnissen, die<br />
den „Sententiae‟ zugrundeliegen, die Methode ihrer Konkordanz und die Rezeption des<br />
Werkes in Gestalt der späteren Kommentierungen untersucht werden, darüber sollen<br />
besonders auch die scholastische Terminologie und der Entstehungskontext der „Sententiae‟<br />
behandelt werden. Vermittelt werden zudem grundlegende Kompetenzen im Umgang mit<br />
lateinischen Texten des Mittelalters; wichtige Hilfsmittel des Faches und einführende<br />
Literatur werden in der Veranstaltung vorgestellt.<br />
Für diese Veranstaltung sind gute Kenntnisse der lateinischen Sprache erforderlich. Der<br />
Erwerb eines Leistungsnachweises beinhaltet, soweit in den jeweiligen Modulbeschreibungen<br />
vorgesehen, eine Klausur von 90 min. Dauer.<br />
Literatur: Sententiae in IV libris distinctae, in: Migne, Patrologia Latina, Bd. CXCII, Sp. 521–<br />
962; kritische Edition = Spicilegium Bonaventurianum, Bde. IV-V, 3. Auflage Rom<br />
1971/1981; Friedrich Stegmüller, Repertorium Commentariorum in Sententias Petri<br />
Lombardi, 2 Bde., Würzburg 1947; Victorinus Doucet, Commentaires sur les Sentences,<br />
Quaracchi 1954; Philippe Delhaye, Pierre Lombard. Sa vie, ses œuvres, sa morale, Paris 1961.<br />
Dr. Karsten Igel<br />
082333 Übung: Religiosität in der spätmittelalterlichen Stadt – Ausstellungsprojekt<br />
Osn<strong>ab</strong>rück um 1500<br />
Mi 14-16 Uhr, Raum. Sitzungszimmer des Instituts für vergleichende Städtegeschichte,<br />
Königsstraße 46, Beginn: 19. Oktober<br />
Im Sommer <strong>201</strong>2 widmet sich ein von mehreren Institutionen getragenes Ausstellungsprojekt<br />
der Lebenswelt in Osn<strong>ab</strong>rück in der Zeit um 1500. Einen wichtigen Teil nimmt in einer<br />
Epoche, in der letztlich nicht zwischen säkular und sakral geschieden werden kann, natürlich<br />
der Blick auf das geistliche Leben und die bürgerliche Frömmigkeit in der<br />
spätmittelalterlichen Stadt ein. In der Übung soll einerseits ein Überblick der d<strong>ab</strong>ei für<br />
Osn<strong>ab</strong>rück vorzustellenden Themenfelder erarbeitet werden und andererseits auch über die<br />
Möglichkeiten der Umsetzung in einer Ausstellung diskutiert und so ein Grundkonzept<br />
erarbeitet werden.<br />
Angesichts des Themas wird von den Teilnehmern ein entsprechendes aktives Engagement<br />
mit Kurzvorstellungen einzelner Themensegmente und der Arbeit an möglichen<br />
Ausstellungstexten sowie der Diskussion der vorgestellten Ergebnisse erwartet. Von Vorteil<br />
sind zudem Vorkenntnisse der spätmittelalterlichen Stadt- und/oder Kirchengeschichte.<br />
Hirschmann, Frank G.: Die Stadt im Mittelalter, München 2009; Schmieder, Felicitas: Die<br />
mittelalterliche Stadt, Darmstadt 2005; Isenmann, Eberhardt: Die deutsche Stadt im<br />
Spätmittelalter, Stuttgart 1988; Rothert, Hermann: Geschichte der Stadt Osn<strong>ab</strong>rück im<br />
Mittelalter, in: Osn<strong>ab</strong>rücker Mitteilungen 57 (1937)/58 (1938); Poeck, Dietrich W.:<br />
Osn<strong>ab</strong>rück im späten Mittelalter, in: Steinwascher, Gerd (Hg.): Geschichte der Stadt<br />
Osn<strong>ab</strong>rück, Osn<strong>ab</strong>rück 2006 S., 87-160; Queckenstedt, Hermann: Die Armen und die Toten.<br />
85
Sozialfürsorge und Totengedenken im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Osn<strong>ab</strong>rück,<br />
Osn<strong>ab</strong>rück 1997; Kaster, Karl Georg und Steinwascher, Gerd: 450 Jahre Reformation in<br />
Osn<strong>ab</strong>rück, Osn<strong>ab</strong>rück 1993; Gleba, Gudrun: Klöster und Orden im Mittelalter, Darmstadt<br />
²2006; Meckseper, Cord: Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter,<br />
Darmstadt 1982.<br />
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt und eine vorherige Anmeldung an karsten.igel@unimuenster.de<br />
daher erforderlich.<br />
N.N.<br />
082371 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Mo 16-18, Raum: F 030<br />
N.N.<br />
082386 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Di 10-12, Raum: ULB 202<br />
N.N.<br />
082390 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Di 14- 16, Raum: ULB <strong>201</strong><br />
N.N.<br />
082405 Übung zur Einführungsvorlesung: Einführung in die neuere und neueste Geschichte<br />
Mi 10-12, Raum: ULB 1<br />
Dr. Jens Heckl<br />
082792 Übung: Paläographische Übungen an ausgewählten deutschsprachigen Texten des 16.<br />
bis 19. Jahrhunderts<br />
Mi 16-18, Raum: Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen (Staatsarchiv Münster) Bohlweg<br />
2, 48147 Münster<br />
Die Studenten sollen das Lesen handschriftlicher Texte der Frühen Neuzeit erlernen, wobei<br />
ihnen Methoden vermittelt werden, um bestehende Probleme beim Entschlüsseln älterer Texte<br />
zu überwinden. Des Weiteren erfahren sie Grundlegendes über gebräuchliche Richtlinien bei<br />
der Transkription frühneuzeitlicher Quellentexte sowie aus der Aktenkunde. Eine Führung<br />
durch das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Staatsarchiv Münster ist im Programm der<br />
Übung ebenso enthalten wie eine Einführung in die Schriftgeschichte der Neuzeit und<br />
Moderne.<br />
Teilnehmerzahl: maximal 10 Personen (bitte vorher per E-mail anmelden:<br />
jens.heckl@lav.nrw.de!)<br />
Dr. Sita Steckel/Dr. Astrid Reuter<br />
082773 Übung: The Making of Religion Die Ausdifferenzierung von Religion in<br />
Vormoderne und Moderne<br />
Mi 10-12, Raum: S1, Schlossplatz 2, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Art der Veranstaltung: als Seminar (Soziologie) oder Übung (Geschichte, LN oder TN)<br />
wählbar<br />
Anmeldung unter sita.steckel@gmx.net nötig.<br />
Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch eine funktionale Differenzierung von<br />
Handlungssphären wie Religion und Politik, Recht, Wissenschaft, Wirtschaft usw. aus – das<br />
ist zumindest eine Grundannahme sozialwissenschaftlicher Forschung. Doch Religion und<br />
86
Politik, Recht, Wissenschaft, Wirtschaft usw. sind keine historisch invarianten Kategorien,<br />
deren Unterscheidung nur für moderne Gesellschaften sinnvoll sein kann. Was Religion war<br />
und ist, hat sich vielmehr in historischen Prozessen der Differenzierung von ihrer Umwelt erst<br />
herausgebildet und verändert sich stetig weiter. In diesem Sinne wurde und wird Religion<br />
‚gemacht‟.<br />
Die Lehrveranstaltung soll in einer Überkreuzung historischer und soziologischer<br />
Perspektiven in den Blick nehmen, wie sich Religion in Prozessen der Abgrenzung von<br />
anderen gesellschaftlichen Handlungssphären herausgebildet und gewandelt hat. Auch soll die<br />
Frage thematisiert werden, ob und wie vor diesem Hintergrund interdisziplinär angemessen<br />
von Religion gesprochen werden kann.<br />
Die Lehrveranstaltung richtet sich vorwiegend an fortgeschrittene Studierende im Masterbzw.<br />
Magister- und Promotionsstudium. Teil der Anforderungen ist der Umgang mit einigen<br />
Texten der englischsprachigen Fachliteratur.<br />
Die Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.<br />
Philip Hoffmann-Rehnitz<br />
082424 Übung: Krisen in der Frühen Neuzeit<br />
Mi 16-18 Uhr (14-tägig) plus Blockveranstaltung am 8./9. Februar <strong>201</strong>2, Raum: S 6<br />
Finanzkrise, Eurokrise, Koalitionskrise, Schalke-Krise, Beziehungskrise – nicht nur im<br />
öffentlichen Diskurs sind Krisen omnipräsent, auch im privaten Leben sind wir beständig mit<br />
tatsächlichen oder möglichen Krisen konfrontiert. In der Geschichtsschreibung sind Krisen<br />
und Krisenszenarien ebenfalls weit verbreitet; man denke etwa an die Krise der römischen<br />
Republik, die Krise des Spätmittelalters, die Krise des 17. Jahrhunderts oder die Krise der<br />
Weimarer Republik. Was jedoch genau gemeint ist, wenn man von Krise spricht, ist hingegen<br />
oftmals nicht klar, gerade auch in den Geschichtswissenschaften. Von daher wird es ein Ziel<br />
der Übung sein, die Frage zu diskutieren, welche Möglichkeiten <strong>ab</strong>er auch welche Probleme<br />
mit der Krise als einer historiographischen Kategorie verbunden sind. Hierfür ist die Frühe<br />
Neuzeit gerade deswegen von besonderem Interesse, als sich erst im 18. Jahrhundert die<br />
‚Krise„ als Begriff der politisch-sozialen Sprache heraus bildete und verbreitete. Neben<br />
solchen konzeptionellen Fragen und einem Überblick über Forschungsstand und<br />
Forschungsdebatten zu Krisen in der Frühen Neuzeit werden in der Übung einzelne<br />
(politische, wirtschaftliche wie kulturell-religiöse) Krisen und Krisenphänomene vor allem<br />
aus dem 17. Jahrhundert als dem frühneuzeitlichen Krisenjahrhundert besprochen (z. B. das<br />
Ende der Tulpenmanie in Holland 1637 oder die politische Krise im England der 1640er<br />
Jahre): wir werden uns d<strong>ab</strong>ei nicht nur die Ursachen, den Verlauf und die Folgen der<br />
jeweiligen Krisen genauer anschauen, sondern auch danach fragen, wie diese Ereignisse von<br />
den Zeitgenossen wahrgenommen und beschrieben wurden und inwieweit sie überhaupt als<br />
Krisen bezeichnet und begriffen werden können.<br />
Literatur: Reinhart Koselleck, Art. ‚Krise„, in: Otto Brunner/ Werner Conze u.a. (Hrsg.),<br />
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon der politisch-sozialen Sprache in<br />
Deutschland, Bd. 3, Stuttgart 1982, S. 617-650; Helga Scholten (Hrsg.), Die Wahrnehmung<br />
von Krisenphänomenen. Fallbeispiele von der Antike bis in die Neuzeit, Köln u.a. 2007;<br />
Manfred Jakubowski-Tiessen (Hrsg.), Krisen des 17. Jahrhunderts. Interdisziplinäre<br />
Perspektiven, Göttingen 1999; Monika Hagenmeier/ S<strong>ab</strong>ine Holtz (Hrsg.), Krisenbewußtsein<br />
und Krisenbewältigung in der Frühen Neuzeit – Crisis in Early Modern Europe. Festschrift<br />
für Hans-Christoph Rublack, Frankfurt a.M. u.a. 1992.<br />
Apl. Prof. Dr. Michael Sikora / Dr. Michael Hecht<br />
082678 Übung/Exkursion: Residenzlandschaft Anhalt<br />
87
Termin: Woche vom 10.-14. Oktober (die genauen Daten werden in der Vorbesprechung<br />
mitgeteilt), Vorbesprechung: 14.7.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18 Uhr c.t., Raum: F 104<br />
Eine Fülle imposanter historischer Zeugnisse auf engstem Raum – mit diesem und ähnlichen<br />
Slogans werben die Tourismusverbände für die Region Anhalt. In der Tat sind infolge der<br />
politischen Strukturen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit im kleinen Fürstentum<br />
Anhalt – das nach mehreren Erbteilungen von unterschiedlichen Linien der Dynastie der<br />
Askanier regiert wurde – zahlreiche Monumente entstanden, die noch heute von den<br />
Ansprüchen, Möglichkeiten und Grenzen hochadliger Herrschaft zeugen. Anhand der Burgen,<br />
Schlösser und Kirchen in Bernburg, Dessau, Köthen und Oranienbaum sowie des (auf der<br />
UNESCO-Welterbeliste stehenden) Wörlitzer Gartenreichs lassen sich viele Phänomene der<br />
vormodernen Geschichte eindrucksvoll studieren: Wie wurden Fürstenrang und<br />
Landesherrschaft symbolisch zum Ausdruck gebracht, welchen Einfluss besaßen dynastische<br />
Heiratsverbindungen und kulturelle Transferprozesse auf das Land, wie wandelten sich die<br />
Konzeptionen von Herrschaft zwischen Spätmittelalter und 19. Jahrhundert In einer ca.<br />
viertägigen Exkursion nach Anhalt soll in der zweiten Oktoberwoche diesen und weiteren<br />
Fragen vor Ort nachgegangen werden. Die Exkursion findet im Anschluss an das<br />
Hauptseminar „Kleinen Fürsten im Alten Reich – das Beispiel Anhalt“ vom Sommersemester<br />
statt. Sie richtet sich vornehmlich an die Teilnehmer des Hauptseminars, steht <strong>ab</strong>er auch<br />
anderen Studierenden offen, sofern noch freie Plätze zu besetzen sind. Interessenten sollten<br />
sich in jedem Fall bis zum 12.7.<strong><strong>201</strong>1</strong> bei den Veranstaltern melden (sikora@uni-muenster.de /<br />
michael.hecht@uni-muenster.de). Bei einer obligatorischen Vorbesprechung am 14.7.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
werden alle organisatorischen Fragen behandelt.<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
082807 Übung: Adel im Film<br />
Blocktermine: Einführungssitzungen Mo., 17.10 und 24.10. in Raum ULB 101, jeweils 16-18;<br />
Arbeitssitzungen Fr. 18.11., 16.12., 20.1., jeweils 10-17, Raum: F 102<br />
Adel ist ‚in‟, dank regelmäßiger Prinzenhochzeiten und gelegentlicher Skandale. Aber damit<br />
ist auch klar: Die heutigen Vorstellungen von Adel werden im wesentlichen über das<br />
Fernsehen vermittelt. Dem steht die Selbstwahrnehmung derer, die sich selbst zum Adel<br />
zählen, ebenso gegenüber wie der historische Befund eines seiner wesentlichen Privilegien<br />
eigentlich längst entkleideten ehemaligen Herrschafsstandes. Am Schnittpunkt dieser drei<br />
Perspektiven soll in der Übung das Experiment gewagt werden, unterschiedliche<br />
Visualisierungen adliger Lebenswelten zu diskutieren. D<strong>ab</strong>ei wird zu fragen sein nach den<br />
Logiken und Techniken, um bestimmte Vorstellungen zu erzeugen. Es soll <strong>ab</strong>er auch zur<br />
Debatte stehen, inwieweit das Medium Film umgekehrt besondere Möglichkeiten eröffnet,<br />
komplexe Wertvorstellungen und kulturelle Praktiken in einer Art und Weise zu visualisieren,<br />
wie dies Texten nicht möglich ist. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit filmische Entwürfe<br />
als Medien der reflektierten Vermittlung in Unterricht und Öffentlichkeit geeignet erscheinen.<br />
Die Auswahl der Beiträge wird sich von der Aktualität lösen und auch ältere Produktionen<br />
einbeziehen. Damit keine Mißverständnisse entstehen: Es geht nicht um Blockbuster, es muß<br />
vielmehr auch mit schnulzigen Klassikern, langatmigen Literaturverfilmungen und spröden<br />
Dokumentationen gerechnet werden. Vor- und Aufbereitungen werden auch jenseits der<br />
Sitzungen einige Zeit beanspruchen. Schließlich müssen Grundkenntnisse insbesondere zur<br />
vormodernen Adelswelt erwartet werden können, um sich zügig den praktischen Aufg<strong>ab</strong>en<br />
und speziellen Problemen widmen zu können. Die Lektüre des Aufsatzes von Oexle wird<br />
daher schon zur ersten Sitzung verbindlich vorausgesetzt. Die Zahl der Teilnehmer ist<br />
überdies streng begrenzt, um noch eine konzentrierte Auseinandersetzung gewährleisten zu<br />
88
können. Anmeldelisten liegen vom 27.6. bis zum 15.7. aus, jeweils von 10 bis 12 Uhr im<br />
Sekretariat des Lehrstuhls für Frühe Neuzeit, F-Haus, Raum 140.<br />
Literaturhinweise: Michael Sikora: Der Adel in der Frühen Neuzeit, Darmstadt 2009; Ronald<br />
Asch: Europäischer Adel in der Frühen Neuzeit, Köln u. a. 2008; Monika Wienfort: Der Adel<br />
in der Moderne, Göttingen 2006; Monique de Saint Martin: Der Adel. Soziologie eines<br />
Standes, Konstanz 2003 (zuerst: frz., 1993); Otto Gerhard Oexle: Aspekte der Geschichte des<br />
Adels im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.): Europäischer<br />
Adel 1750-1950 (Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 13), Göttingen 1990, S. 19-56;<br />
Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse, 4. Aufl. Stuttgart 2007; Thomas Kuchenbuch:<br />
Filmanalyse. Theorien. Methoden. Kritik., 2. Aufl. Wien u.a. 2005.<br />
Christine Fertig<br />
08<strong>201</strong>8 Übung/Kurs: Familie, Verwandtschaft und Haushalt in der Neuzeit<br />
Mo 14-16, Raum: F 6, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Bis zur Durchsetzung einer industriellen Produktionsweise und dem Aufkommen der<br />
modernen Sozialversicherung seit dem späten 19. Jh. war der Haushalt der dominierende Ort<br />
der Produktion, <strong>ab</strong>er auch der materiellen und der kulturellen Reproduktion. Die Familie gilt<br />
daneben als Vermittlungsinstanz zwischen Individuen, Institutionen und den Prozessen des<br />
sozialen Wandels. Über den Kontext von Familie und Haushalt hinaus reichen<br />
verwandtschaftliche Beziehungen, deren Bedeutung für die materielle und soziale<br />
Reproduktion in der modernen Welt erst seit wenigen Jahren thematisiert wird. Die Übung<br />
erarbeitet wichtige Ergebnisse der neuen historischen Forschung zu Familie, Verwandtschaft<br />
und häuslicher Arbeit. Darüber hinaus werden wir uns mit Quellen und Methoden der<br />
angesprochenen Forschungsfelder beschäftigen.<br />
Literaturhinweise: Marzio Barbagli und David Kertzer (Hg.): The History of the European<br />
Family (New Haven 2001); Andreas Gestrich: Geschichte der Familie im 19. und 20.<br />
Jahrhundert (=Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd. 50, München 1999); David W. S<strong>ab</strong>ean,<br />
Simon Teuscher und Jon Mathieu (Hg.): Kinship in Europe. Approaches to Long-Term<br />
Development 1300-1900 (New York u. a. 2007).<br />
Die Teilnahme ist auf 30 Studierende begrenzt. Eine Anmeldung im Sekretariat von Frau<br />
Schlee (R 138) ist für die Teilnahme verbindlich.<br />
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082439 Übung: Rassismustheorien<br />
Do. 14-16 Uhr, Raum: F 102, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Der Rassismus oder besser Rassismen stellen ein weit verbreitetes Muster zur Erklärung<br />
gesellschaftlicher Verhältnisse dar und sind darin erschreckend aktuell. Als ausgeprägte<br />
Weltanschauung entstand der Rassismus im 18. Jhd. und prägte Politik und Wissenschaften<br />
sowie Alltagsvorstellung und –praktiken in vielfacher Hinsicht. Die Hintergründe dieser<br />
Entwicklung ebenso wie wissenschaftliche Theorien zu ihrer Erklärung stehen im Zentrum<br />
der Übung. D<strong>ab</strong>ei ist das Augenmerk weniger auf die Suche nach der „einen“ Theorie<br />
gerichtet, sondern darauf, welche theoretischen Ansätze welche historischen Situationen am<br />
plausibelsten zu erklären vermögen.<br />
Literatur: Martin Bulmer, John Solomos (Hg.): Racism, Oxford 1999; George Fredrickson,<br />
Rassismus, Ein historischer Abriss, Hamburg 2004; Nora Räthzel (Hg.): Theorien über<br />
Rassismus, Hamburg 2000.<br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082443 Übung: Image(s) of Native Americans in Film<br />
89
Do 16-19, Raum: F 33, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
After briefly looking into ways how historians can use films as sources, the class will review<br />
differing images of Natives Americans in film. Special attention will be paid to the<br />
stereotypes of the “bad”, savage Indian as well as the “good”, noble Indian. The class will<br />
look at western movies, historical films, road movies, detective films, and documentaries,<br />
mainly from Hollywood, but also from Canadian or American Indian directors.<br />
Since we will be viewing films, we will be meeting three hours per week. As this equals an<br />
extra half an ECTS point, there will be less reading required and only a short written handout<br />
for the oral presentation of one of the films.<br />
Literatur: John E. O'Connor (Hg.), Image as Artifact: The Historical Analysis of Film and<br />
Television. Mal<strong>ab</strong>ar, FL, 1990; Robert F. Berkhofer, Jr., The White Man's Indian: Images of<br />
theAmerican Indian from Columbus to the Present. New York 1978; Jacquelyn Kilpatrick,<br />
Celluloid Indians: Native Americans and Film. Lincoln, NE, 1999; Philip J. Deloria, Playing<br />
Indian. New Haven, CT, 1998; Angela Aleiss, Making the White Man‟s Indian: Native<br />
Americans and Hollywood Movies. Westport, CT, 2005; Michael Hilger, From Savage to<br />
Nobleman: Images of Native Americans in Film. Lanham, MD, 1995; John E. O'Connor/Peter<br />
C. Rollins (Hg.), Hollywood's Indian: The Portrayal of the Native American in Film.<br />
Lexington, KY, 1998.<br />
Dr.Arnulf Jürgens<br />
082606 Übung: Französisch für Historiker: Das französische Deutschlandbild im 18. und<br />
19.Jahrhundert. Sachanalyse und sprachliche Kompetenz.<br />
Di 10-12, Raum: F 229, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Verschiedene französische Autoren (z.B. Mauvillon, Montesquieu, Voltaire, Boulainvilliers,<br />
div. Positionen innerhalb der Französischen Revolution, Napoleon, Mme de Stael, Beugnot,<br />
Victor Hugo) sollen in bezug auf ihr Deutschlandbild befragt und analysiert werden.<br />
Äußerungen zivilisatorischer Überlegenheit oder der Abgrenzung, Vergleiche innerhalb von<br />
Klimatheorien, Gründungsmythen des Adels, Vergleiche der politischen Systeme u.a.m.: der<br />
Blick auf das Fremde als Pol der Profilierung des Eigenen. Im Mittelpunkt der gemeinsamen<br />
Arbeit werden das Übersetzen und Analysieren von französischsprachigen Texten stehen. Die<br />
2-stündige Übung soll allgemein Gelegenheit geben, sich im Umgang mit historischen<br />
Quellen zu üben. Eine Grundlage von Kenntnissen der französischen Grammatik und des<br />
französischen Wortschatzes wird vorausgesetzt. Es wird angestrebt, sprachliche Defizite<br />
auszugleichen und die speziell für den Historiker erforderliche funktionale Beherrschung des<br />
Französischen zu festigen. Bei aktiver und regelmäßiger Mitarbeit wird am Ende des<br />
Semesters ein - ggfls. benoteter -Übungsschein (Studiengänge Bachelor, Master,<br />
Staatsexamen, Magister, Grund- oder Hauptstudium) ausgestellt. Zudem kann in einer<br />
Klausur der durch die Studienordnung geforderte Nachweis funktionaler Sprachkenntnisse<br />
des Französischen erbracht werden.<br />
Jun.Prof. Dr. Martin Uebele<br />
082458 Übung: Ausgewählte Kapitel der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20.<br />
Jahrhunderts",<br />
Mo 14-16, Raum: F 153 (teilweise PC-Pool Wiwi 1 im Juridikum), Beginn: 2.<br />
Vorlesungswoche<br />
Die Übung vermittelt erstens die Fähigkeit, sich eigenständig mit aktuellen<br />
Forschungsergebnissen des Fachgebiets auseinanderzusetzen. Aktuelle Forschungsarbeiten<br />
werden in Referaten vorgestellt und anschließend diskutiert. Vor allem sollen<br />
90
englischsprachige Texte, die wirtschaftswissenschaftlich und historisch argumentieren und<br />
ökonomische Methoden verwenden, diskutiert werden. Zweitens werden auch praktische<br />
Übungen zur quantitativen Analyse von historischen Daten im PC-Pool vermittelt.<br />
Grundkenntnisse der Volkswirtschaftslehre und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit<br />
englischsprachigen Texten sind daher Teilnahmevoraussetzungen. Inhaltliche Schwerpunkte<br />
sind Handel und Marktintegration im 19. Jahrhundert sowie die Rolle von Finanzsystemen für<br />
das Wirtschaftswachstum. Die Übung wird interdisziplinär für Studierende der<br />
Wirtschaftswissenschaften und der Geschichte angeboten. Für einen Teilnahmeschein oder 2<br />
LP mit Note sind regelmäßig aktive Mitarbeit und ein Referat oder eine ca. sechsseitige<br />
Skizze eines empirischen Projektes nötig.<br />
On request the course may be given in English. The course outline is avail<strong>ab</strong>le in English<br />
from the course leader.<br />
Literatur: Feinstein, Charles H. and Mark Thomas (2002): Making History Count. A Primer in<br />
Quantitative Methods for Historians.<br />
Rüdiger Schmidt<br />
082462 Übung: Zur Politik und Ideologie der „Mitte“: Soziale Ordnungsvorstellung und<br />
politischer Diskurs im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Mittwoch 16-18 h, Raum: ULB 1, Beginn: zweite Vorlesungswoche<br />
Die Vorstellung von sozialem Gleichgewicht, von politisch-sozialem Ausgleich und einer<br />
gesellschaftlichen Mitte hat bereits im Denken des 19. Jahrhunderts seinen Niederschlag<br />
gefunden. Doch erst die Prägung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch das „Zeitalter<br />
der Extreme“ (Hobsbawm) hat – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des<br />
Wirtschaftswunders in der Bundesrepublik bzw. der „Trentes Glorieuses“ in Frankreich –<br />
dazu beigetragen, der politischen „Mitte“ über die Parteigrenzen hinweg eine besondere<br />
Verantwortung für die Integration und politisch-soziale St<strong>ab</strong>ilität des Gemeinwesens<br />
zuzuweisen. Die in der zeitgenössischen Soziologie prominente Vorstellung von einer<br />
„nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ (Schelsky) und einer sozialen Prägung der Gesellschaft<br />
durch die Mittelschichten bestimmt die politische Debatte bis in die Gegenwart. Das Seminar<br />
bilanziert zunächst die Voraussetzungen und Ergebnisse des Mitte-Diskurses im politischen<br />
Denken des 19. Und 20. Jahrhunderts und be<strong>ab</strong>sichtigt anschließend die um die „Mitte“<br />
geführte Richtungsdebatte für die Geschichte der Bundesrepublik in den Blick zu nehmen.<br />
Literatur zur Einführung: Herfried Münkler, Mitte und Maß. Der Kampf um die richtige<br />
Ordnung, Berlin <strong>201</strong>0. Paul Nolte, Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf<br />
und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert, München 2000.<br />
Christine Fertig<br />
082037 Übung: Arbeiteralltag und Arbeiterkultur in Kaiserreich und Weimarer Republik<br />
Mo 10-12, Raum: F 043, Beginn: 17.10.<strong>201</strong>0<br />
Mit der Entstehung einer breiten städtischen Arbeiterschicht im 19. Jahrhundert kam es zur<br />
Herausbildung neuer, spezifisch unterbürgerlicher Lebenswelten. In der Übung sollen Kultur<br />
und Alltagsleben von Arbeitern thematisiert werden. Neben der Arbeiterbewegungskultur<br />
werden auch Arbeitswelt, Freizeitformen und Familienleben im Mittelpunkt stehen. Die<br />
Veranstaltung ist als Lektüreübung angelegt; es wird auch darum gehen, gemeinsam das<br />
strukturierte Erfassen wissenschaftlicher Texte einzuüben. Die Teilnahme an der Übung setzt<br />
die Bereitschaft zu regelmäßiger Lektüre Texte und zu mündlichem Diskutieren der Inhalte<br />
voraus.<br />
Literaturhinweise: Wolfgang Kaschuba: Lebenswelt und Kultur der unterbürgerlichen<br />
Schichten im 19. und 20. Jahrhundert (=Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd. 5, München<br />
91
1990); Dagmar Kift (Hg.): Kirmes, Kneipe, Kino. Arbeiterkultur im Ruhrgebiet zwischen<br />
Kommerz und Kontrolle, 1850 – 1914 (Paderborn 1992).<br />
Die Teilnahme ist auf 30 Studierende begrenzt. Eine Anmeldung im Sekretariat von Frau<br />
Schlee (R 138) ist für die Teilnahme verbindlich.<br />
Dr. Julia Paulus<br />
082591 Übung: Das Berufsausbildungssystem in Deutschland (1900-1980)<br />
Zeit: Do., 16-18.00h, Raum: F 104, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Geschichte der Berufsbildung von weiblichen und männlichen Jugendlichen bildete sich<br />
Rahmen unterschiedlicher sozialer, ökonomischer und gesellschaftlicher Bedingungen heraus.<br />
Während für die männliche Jugend die betriebliche Form der Ausbildung (das sog. ‚duale<br />
System„) die historisch vorherrschende war, zu der in Ergänzung dann die schulische trat,<br />
orientierten sich die Berufsbildungsansätze für die weibliche Jugend hauptsächlich am Prinzip<br />
der schulischen Ausbildung. Auf diese Formierung schulischer Berufsbildungsformen wirkte<br />
sich wiederum aus, dass Frauen der Weg zur akademischen Bildung lange Zeit versperrt war,<br />
so dass für Frauen bürgerlicher Milieus sich auf diesem Hintergrund gerade solche<br />
Ausbildungsbereiche auf der mittleren Berufsebene heraus kristallisierten.<br />
Welche Auswirkungen zeitigten die politischen Brüche im langen 20. Jahrhundert Mit<br />
welchen sozialen, kulturellen und ökonomischen Kontinuitäten ist das<br />
Berufsausbildungssystem bis heute konfrontiert Mit diesen und ähnlichen Fragen möchte<br />
diese Übung dem Zusammenhang von ‚Beruf, Arbeit und Geschlecht im 20. Jahrhundert'<br />
nachgehen.<br />
Dr. S<strong>ab</strong>ine Happ<br />
082587 Paläographische Übung zur Geschichte der Universität Münster im 19. und 20.<br />
Jahrhundert<br />
Donnerstag 14-16 Uhr, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>; Raum: Benutzerraum des Universitätsarchivs<br />
statt. Anschrift: Leonardo-Campus 21. Eine Wegebeschreibung und ein Lageplan finden sich<br />
auf der Homepage des Universitätsarchivs: www.uni-muenster.de/archiv.<br />
In der Übung sollen handschriftliche Quellen des Universitätsarchivs aus dem 19. und dem<br />
beginnenden 20. Jahrhundert transkribiert werden. Die Übung bietet damit auch Einblicke in<br />
die Geschichte der Universität Münster.<br />
Um sicherzustellen, dass möglichst alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit zur<br />
praktischen Übung h<strong>ab</strong>en, ist die Teilnehmerzahl auf 12 begrenzt.<br />
Eine Anmeldung bitte per Mail ist daher zwingend erforderlich: s<strong>ab</strong>ine.happ@unimuenster.de<br />
Eine Literaturliste wird in der Übung zur Verfügung gestellt.<br />
Dr. Raoul Zühlke<br />
082477 Übung: Der Erste Weltkrieg als Krieg um die Vorherrschaft in Südosteuropa<br />
Blockveranstaltung: 06./07.01.<strong>201</strong>2 und 13./14.01.<strong>201</strong>2 Vorbesprechung: 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18.00<br />
Uhr in Raum F 33<br />
Der Erste Weltkrieg begann als ein Hegemonialkrieg auf dem Balkan. Ein Umstand, der in<br />
der heutigen Kriegswahrnehmung in Deutschland allenfalls noch als Randnotiz der<br />
Geschichte, als Lunte am Pulverfass Europas wahrgenommen wird. Doch Kriegverlauf und<br />
Kriegergebnisse im Südosten Europas unterschieden sich grundlegend und nachhaltig von<br />
denen der Hauptkriegsschauplätze. Den Mittelmächten gelang es hier zum Beispiel,<br />
Bündnispartner zu gewinnen. Es bildeten sich (insbesondere im italienisch-österreichischen<br />
92
Grenzraum mit dem Gebirgskrieg) eigene Formen des Krieges heraus, der vor allem im<br />
südöstlichen Abschnitt der Front zu Russland auch viel seltener zum Stellungskrieg erstarrte.<br />
Die wichtigste Folge dürfte <strong>ab</strong>er wahrscheinlich die Implosion der Staatenwelt auf dem<br />
Balkan gewesen sein, die den Raum deutlich stärker umgeprägt hat, als dies durch den schon<br />
als besonders tiefgreifend empfundenen Versailler Vertrag in Mitteleuropa passierte. Ziel der<br />
Veranstaltung ist es, den Ersten Weltkrieg auf dem Balkan in seinen Besonderheiten zu<br />
erfassen und seine Bedeutung für (Süd-)Osteuropa zu verdeutlichen.<br />
Die Veranstaltung dient zudem der Vorbereitung auf eine Exkursion an die Kriegsschauplätze<br />
im Dreiländereck Österreich-Slowenien-Italien im Sommer <strong>201</strong>2.<br />
Literatur: William C. Fuller: The Eastern Front, in: Winter, Jay u.a.: The Great War and the<br />
twentieth century, New Haven & London 2000. Imanuel Geiss: Deutschland und Österreich-<br />
Ungarn beim Kriegsausbruch 1914. Eine Machthistorische Analyse, in: Gehler, Michael:<br />
Ungleiche Partner Österreich und Deutschland in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung;<br />
historische Analysen und Vergleiche aus dem 19. und 20. Jahrhundert, (= Historische<br />
Mitteilungen, Beiheft 15), Stuttgart 1996, S. 375–395. Gerhard P. Groß (Hrsg.): Die<br />
vergessene Front. Der Osten 1914/15 Ereignis, Wirkung, Nachwirkung, Paderborn, 2009.<br />
Zühlke, R. (Hrsg.): Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg (20th Century Imaginarium, Bd. 4),<br />
Hamburg 2000.<br />
Dr. Thies Schulze<br />
082481 Übung „Quellen zur Geschichte der Weimarer Republik“<br />
Mi 10-12, Raum: SCH 122.<strong>201</strong>, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Weimarer Republik wird in der historischen Forschung oftmals unter dem Aspekt ihres<br />
Scheiterns betrachtet. Die erste deutsche Republik, die lediglich vierzehn Jahre lang Bestand<br />
hatte, galt von Beginn an als krisenanfällig und als politisch, sozial wie auch wirtschaftlich<br />
inst<strong>ab</strong>il. So war der Aufstieg der NSDAP zur Macht eng mit den Schwächen des Weimarer<br />
Staates verknüpft. Allerdings kann Weimar nicht ausschließlich unter dem Aspekt seines<br />
Scheiterns beurteilt werden: Auf künstlerischem, literarischem und kulturellem Gebiet etwa<br />
erlebte Deutschland in der Weimarer Epoche eine Blütezeit, und auch im politisch-sozialen<br />
Bereich erwiesen sich viele Entwicklungen durchaus als modellbildend für die westdeutsche<br />
Demokratie nach 1949. Die Übung dient dazu, die Geschichte der Weimarer Republik anhand<br />
ausgewählter Quellen nachzuvollziehen und zu diskutieren. Schwerpunkte werden u.a. auf die<br />
Bereiche von Verfassung und Parteienstaat, Kultur und Außenpolitik gelegt.<br />
Für die Teilnahme wird die Bereitschaft zur vorbereitenden Lektüre von Quellen (und<br />
Forschungsliteratur) vorausgesetzt. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 25 begrenzt. Die<br />
Voranmeldung (mit Namen und Matrikelnummer sowie Ang<strong>ab</strong>en zu Scheinanforderungen<br />
und Studiengang) ist obligatorisch und wird – zusätzlich zur elektronischen Anmeldung (!) –<br />
per E-Mail bis zum 7. Oktober <strong><strong>201</strong>1</strong> erbeten an: tschulze@uni-muenster.de.<br />
Literatur: Andreas Wirsching: Die Weimarer Republik. Politik und Gesellschaft<br />
(Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 58), München 22008; Eberhard Kolb: Die Weimarer<br />
Republik (Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Bd. 16), München 21988; Detlev Peukert:<br />
Die Weimarer Republik. Krisenjahre der Klassischen Moderne, Frankfurt a. M. 1987.<br />
Dr. Markus Köster<br />
082496 Übung: Von Caligari bis Hitler – Zur Kultur- und Politikgeschichte des Films in der<br />
Weimarer Republik<br />
Donnerstag, 18-20 Uhr, vierzehntägig; sowie Blockveranstaltung vom 13.-15.1.<strong>201</strong>2<br />
Ort: LWL-Medienzentrum für Westfalen und Akademie Franz Hitze Haus<br />
Anmeldung erforderlich: markus.koester@uni-muenster.de<br />
Beginn: 27.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
93
Die politisch und wirtschaftlich krisenhafte Zeit der ersten deutschen Demokratie war auch<br />
eine Epoche des kulturellen Aufbruchs. Kaum etwas spiegelt dies deutlicher als der<br />
Aufschwung von Film und Kino. Von Konservativen als „neuzeitliche Seelenmalaria“<br />
verdammt und durch Zensurmaßnahmen bekämpft, entwickelte sich die „Kinematographie“<br />
nach 1918 zu einer eigenständigen Kunstform und zu einem massenkulturellen Faktor ersten<br />
Ranges. Die deutsche Filmlandschaft jener Jahre war vielfältig: sie reichte von heute noch<br />
weltbekannten Kunstfilmen wie „Nosferatu“ und „Metropolis“ bis zu populären Musik- und<br />
Historienfilmen, Krimis und Komödien. Im Verlauf der Weimarer Republik wurde Film<br />
zunehmend zum Gegenstand politischer Debatten und Instrumentalisierungsversuche.<br />
Die Übung möchte unter der Leitfrage nach Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten von<br />
Kultur- und Politikgeschichte sowohl die generellen Entwicklungslinien des Filmschaffens<br />
zwischen 1918 und 1933 beleuchten als auch ausgewählte Filme vorstellen und auf ihre<br />
Inhalte, ihre Sprache und ihre Rezeption hin analysieren. Ziel ist nicht zuletzt, den Umgang<br />
mit Film als Quelle lernen.<br />
Nach mehreren Vorbereitungsterminen im LWL-Medienzentrum für Westfalen wird der<br />
Hauptteil der Veranstaltung ein Blockseminar in der Akademie Franz-Hitze-Haus mit dem<br />
Filmhistoriker Hans Gerhold als zusätzlichem Referenten sein. Für die gute Verpflegung dort<br />
wird ein Kostenbeitrag von 35 € p.P. fällig.<br />
Zur Einführung empfohlen: Thomas Elsaesser: Das Weimarer Kino, in: Geoffrey Nowell-<br />
Smith, (Hg.): Geschichte des internationalen Films, Stuttgart u.a. 1998, S. 130-142 Siegfried<br />
Kracauer: Von Caligari bis Hitler. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Films, Hamburg<br />
1958 (engl. 1947); www.filmundgeschichte.de; Markus Köster: Vom Nutzen des Spielfilms<br />
für die Geschichte, in: Claudia Brack, Johannes Burkardt, Wolfgang Günther und Jens<br />
Murken (Hg.): Kirchenarchiv mit Zukunft. Festschrift für Bernd Hey zum 65. Geburtstag,<br />
Bielefeld. 2007, S. 333-343.<br />
Dr. Peter Fleck<br />
082500 Übung: Wider den totalen Staat. Der Münsteraner Universitätsprofessor Peter<br />
Tischleder (Moraltheologie/Sozialethik) in der NS-Zeit und seine Bezugnahme auf den<br />
Weimarer Staats- und Verfassungsrechtler Gerhard Leibholz<br />
Mi 10-12, Raum: S 055, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
„Wenn der totale Staat, Trust und Kirche zugleich sein will, dann hat freilich G. Leibholz mit<br />
seiner Meinung Recht, ein in diesem Sinne totaler Staat könne sich heute gar nicht<br />
konstituieren, ohne daß dissentierende Minderheitengruppen physisch oder geistig vernichtet<br />
würden.“ In erstaunlicher Freimütigkeit zitiert so Tischleder 1938 den 1933<br />
zwangspensionierten „nichtarischen“ Göttinger Juristen Leibholz – den Schwager von<br />
Bonhoeffer und Dohnanyi – in seinem Lehrbuch. Um dessen für den NS-Staat „heikle“<br />
Stellen – auch zu Rasse, Eugenik, Krieg und religiösen Wandel – soll es in dieser Übung<br />
gehen. Sie soll veranschaulichen, wie ein Münsteraner Professor, der seit Beginn seiner<br />
wissenschaftlichen Qualifikationsphase (1919) vorbehaltlos für die Weimarer Republik<br />
eintrat, die aus seiner Sicht relevanten Werte präsentierte und damit die Legitimität des<br />
totalen Staates bestritt.<br />
Literatur: Peter Walter, Ein Mainzer Theologe über das Verhältnis von Kirche und Staat in<br />
schwieriger Zeit. Peter Tischleder (1891-1947), in: Weg und Weite. Festschrift für Karl<br />
Lehmann, hg. von Albert Raffelt, Freiburg 2001, S. 327-341; Peter Fleck, „Der Gemeinde<br />
größter Sohn.“ Peter Tischleders Lebensweg (...), in: Archiv für hessische Geschichte und<br />
Altertumskunde 56 (1998), S. 205-254.<br />
Prof. Dr. Hartmut Rüß<br />
94
082515 Übung: Die deutsche Besatzungspolitik in Weißrussland 1941-1944<br />
14tägig, Mi 9-13 Uhr, Raum: F 229, Beginn: 19. 10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Entsprechend den ideologischen und machtpolitischen Vorg<strong>ab</strong>en war die Besatzungspolitik<br />
im Osten in mancher Hinsicht markant von der in anderen unter deutscher Herrschaft<br />
stehenden Gebieten Europas unterschieden. Die Übung verfolgt das Ziel, die Komplexheit der<br />
Problematik in einem begrenzten Raum, dem zivilverwalteten sog. Generalkommissariat<br />
Weißruthenien, unter den Bedingungen einer sich verändernden Kriegslage aufzuzeigen.<br />
Weißrussische, polnische oder russische Sprachkenntnisse sind besonders erwünscht, <strong>ab</strong>er<br />
nicht Bedingung.<br />
Lit.: A. Dallin, German Rule in Russia 1941-1945: A Study in Occupation Policy. London<br />
1981; J. Turonak, Belarus' pad njameckaj akupacyjaj. Minsk 1993; Hartmut Rüß, SD u<br />
Baranavicach (1941-1943) u kanteksce lakal'naga akupacyjnaga rezimy. In: Belarusian<br />
Historical Review 5 (1998), S. 67-87; Chr. Gerlach, Kalkulierte Morde. Die deutsche<br />
Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944. Hamburg 1999;<br />
Kooperation und Verbrechen. Formen der "Koll<strong>ab</strong>oration" im östlichen Europa 1939-1945.<br />
Hrg. von Chr. Dieckmann, B. Quinkert, T. Tönsmeyer. Göttingen 2003; A. Brakel, Unter<br />
Rotem Stern und Hakenkreuz: Baranowicze 1939 bis 1944. Das westliche Weißrussland unter<br />
sowjetischer und deutscher Besatzung. Paderborn 2009; B. Qinkert, Propaganda und Terror in<br />
Weißrussland 1941-1944. Paderborn 2009.<br />
Prof. Dr. Rolf Ahmann<br />
082520 Übung: Widerstand und Opposition in der DDR 1949-1989<br />
Mi 14-16, Raum: F 3, Beginn: 19. 10<br />
Anmeldung erforderlich, im Sekretariat (bei Frau Ibrahim/ Frau Michelson) oder in den<br />
Sprechstunden<br />
Die Übung behandelt die Entwicklungen und Formen von widerständigem bzw.<br />
oppositionellem Verhalten von Einzelnen, Gruppen bzw. Bewegungen in der DDR in<br />
Relation zur Entwicklung der Art und den Verfassungen des SED-Regimes von den 1950er<br />
zu den 1980er Jahren. Sie analysiert ihre jeweiligen Zielsetzungen, Erscheinungen und<br />
Organisationen, ihre Probleme und Bedeutungen sowie ihre Bekämpfung durch die SED-<br />
Führungen und beleuchtet die damit verbundenen Forschungsdiskussionen. Ein Schwerpunkt<br />
liegt in der näheren Betrachtung der Entwicklungen im Jahre 1989 - der Flüchtlingswellen,<br />
der Art und Ziele der sogenannten Bürgerrechtsbewegung und ihrer Gruppen, der<br />
Entwicklung und Forderungen der Leipziger Montagsdemonstrationen - sowie der Gestaltung<br />
des Prozesses der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990.<br />
Einführende Literaturauswahl: Günther Heydemann: Die Innenpolitik der DDR. München<br />
2003; Ehrhart Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989.Bonn, 2. Aufl.<br />
2000; Philip Zelikow/ Condoleeza Rice: Sternstunde der Diplomatie. Die deutsche Einheit<br />
und das Ende der Spaltung Europas. Berlin 1999; Stefan Wolle: Die heile Welt der Diktatur.<br />
Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989. Berlin 1998; Matthias Judt (Hrsg.): DDR-<br />
Geschichte in Dokumenten. Beschlüsse, Berichte, interne Materialien und Alltagszeugnisse.<br />
Berlin 1997; Ulrike Poppe u.a. (Hrsg.): Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen<br />
des Widerstandes und der Opposition in der DDR. Berlin 1995; Volker Gransow /Konrad<br />
Jarausch: Die deutsche Vereinigung. Dokumente zur Bürgerbewegung, Annäherung und<br />
Beitritt. Köln 1991; Karl Wilhelm Fricke: Opposition und Widerstand in der DDR. Ein<br />
politischer Report. Köln 1984.(Eine ausführlichere Literaturliste wird zu Beginn der Übung<br />
geboten).<br />
95
Thomas Busch<br />
082534 Übung Russisch für Historiker: Die Sowjetunion in den außenpolitischen Krisen nach<br />
dem zweiten Weltkrieg<br />
Mo 18-20, Raum: F 041, Beginn: 10.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Übung beschäftigt sich mit dem Verhalten der Sowjetdiplomatie in der Nachkriegszeit<br />
anhand einzelner Krisen (Berlin-Krise, Kuba-Krise etc.).<br />
In der Übung sollen russische Texte zu diesem Themenkomplex gelesen und übersetzt<br />
werden.<br />
Soweit Teilnehmer in der Übung funktionale Sprachkenntnisse gem. Studienordnung<br />
nachweisen wollen, sind Grundkenntnisse des Russischen (nicht nur des Alph<strong>ab</strong>ets)<br />
erforderlich.<br />
Allen Teilnehmern steht die Möglichkeit eines allgemeinen Leistungsnachweises offen.<br />
Lit. zur Einführung entsprechende Kapitel im Handbuch der Geschichte Rußlands und bei<br />
Hildermeier, Manfred: Geschichte der Sowjetunion (1917-1991), München 1998.<br />
David Schrock, M.A.<br />
082549 Übung: „Die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland im<br />
Kalten Krieg: von der Staatsgründung bis zum NATO-Doppelbeschluss"<br />
Di 18-20, Raum: F 104<br />
Ziel der Übung ist es, die Entwicklung der (west-)deutschen Außen- und Sicherheitspolitik<br />
seit der Regierungsübernahme Konrad Adenauers bis zum Beginn des „Zweiten Kalten<br />
Krieges“ in der Kanzlerschaft Helmut Schmidts nachzuzeichnen.<br />
Zentrale Stationen der deutschen Nachkriegsgeschichte wie die Westintegration, die Debatte<br />
um die Wiederbewaffnung und die Priorität der Wiedervereinigung, der Mauerbau und die<br />
darauf folgende westdeutsche Reaktion stehen ebenso im Mittelpunkt wie die<br />
zwischenstaatlichen Beziehungen der BRD sowohl zu den Westmächten, hier insbesondere zu<br />
den USA, als auch zu den Staaten des Ostblocks und hier vor allem der Sowjetunion.<br />
Gleichzeitig soll ein globaler Blick auf die Europäische Integration und den Kalten Krieg<br />
erfolgen: welche Rolle die BRD etwa im Koreakrieg und in Vietnam übernommen hat und<br />
welches (militär-) strategische Konzept letztlich eine Ausweitung zum „heißen Krieg“<br />
verhindert hat, wird ebenso gefragt werden wie danach, ob und inwieweit es bereits in der<br />
Frühphase der BRD Ansätze für eine gemeinsame „europäische Außenpolitik“ gegeben hat.<br />
Neben den inhaltlichen Fragen, werden bei entsprechendem Interesse auch von Seiten der<br />
Studenten eingebrachte Ideen und Schwerpunktsetzungen bei der thematischen Aufbereitung<br />
zu Beginn des Semesters gerne berücksichtigt.<br />
Die Übung verfolgt hierbei insbesondere das Ziel, Themenfelder unter Einbezug von<br />
Quellentexten genauer zu beleuchten, anhand derer das „Handwerkszeug des Historikers“<br />
auch im Hinblick auf wissenschaftliche Arbeiten und den pädagogischen Einsatz in der<br />
Schule eingeübt werden soll.<br />
Die Übung richtet sich sowohl an Studienanfänger wie auch an fortgeschrittene Semester und<br />
kann nach Wunsch und Bereitschaft der Studierenden auch zum Teil als Blockseminar<br />
veranstaltet werden.<br />
Teilnahmevoraussetzungen sind Freude am offenen Diskurs, die Bereitschaft, etwas<br />
dazulernen zu wollen und die Übernahme eines kreativ aufzubereitenden Referats.<br />
Anmeldungen erbeten an: d_schr09@uni-muenster.de<br />
Dr. Stephan Ruderer<br />
082553 Übung: Religion und Politik in Lateinamerika in der zweiten Hälfte des 20.<br />
Jahrhunderts<br />
96
Di 14-16 und Tagung 9.- 10. 12. <strong><strong>201</strong>1</strong>, Raum: ULB 202, Beginn: 11.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die katholische Kirche ist auch heute noch eine Institution mit großem politischem Gewicht<br />
in Lateinamerika, deren Einfluss weit über die seelsorgerischen Aufg<strong>ab</strong>en hinausgeht. Die<br />
Übung will aus historischer Perspektive den vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen<br />
katholischer Religion und Politik in Lateinamerika seit ca. Mitte des 20. Jahrhunderts<br />
nachgehen. D<strong>ab</strong>ei wird das Verhältnis der Kirche zur populistischen Regierung Peróns in<br />
Argentinien ebenso in den Blick genommen, wie die Rolle des Katholizismus in der<br />
Kubanischen Revolution. Daneben soll sowohl nach dem Einfluss des kolumbianischen<br />
Priesters Camilo Torres, der als Guerillakämpfer starb, der Befreiungstheologie und linken<br />
Priestergruppen in Chile und Argentinien gefragt werden, als auch nach der Rolle von<br />
konservativen katholischen Gruppierungen und dem Verhalten der Kirchenhierarchie<br />
während der Militärdiktaturen auf dem Kontinent. Auch die Analyse des Einflusses der<br />
Kirche auf die Friedensprozesse der neunziger Jahre, wie z. B. in Guatemala, oder auf den<br />
zapatistischen Aufstand in Mexiko soll dazu dienen, den Blick für den „politischen“ Akteur<br />
Kirche und den Einfluss der katholischen Religion auf die historische Entwicklung in<br />
Lateinamerika zu schärfen.<br />
Teil der Übung und Voraussetzung für den Scheinerwerb ist die Teilnahme an der Tagung<br />
„Chile zwischen Diktatur und Demokratie. Menschenrechte und Solidarität in Chile und<br />
Deutschland“, die am 9. und 10. 12. <strong><strong>201</strong>1</strong> im Franz-Hitze-Haus stattfindet. Auf dieser Tagung<br />
wird ausführlich über die Rolle der chilenischen Kirche während der Militärdiktatur<br />
debattiert, die Wechselbeziehungen zwischen Religion und Politik werden d<strong>ab</strong>ei explizit<br />
angesprochen. Aufgrund der Teilnahme an der Tagung wird die letzte Sitzung der Übung<br />
schon in der Woche vor Weihnachten stattfinden, im Jahr <strong>201</strong>2 wird es also keine weiteren<br />
Sitzungen geben.<br />
Literatur: Johannes Meier/Veit Straßner (Hrsg.): Kirche und Katholizismus seit 1945. Band 6:<br />
Lateinamerika und Karibik, Paderborn 2009.<br />
Anja-Maria Bassimir und Anne Overbeck<br />
082568 All <strong>ab</strong>out Abortion and Gay Rights Die konservative Wende in den USA von Nixon<br />
bis Reagan<br />
Mi 10-12, Raum: F 029, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Nach dem liberalen Klima der 68er Revolution erlebten die USA einen politischen und<br />
kulturellen Rechtsrutsch. Die 1970er bis 90er waren geprägt durch Krisen wie die Beendigung<br />
des Vietnamkriegs, den Watergate-Skandal, die Desegregation von Schulen, die Iran-<br />
Hostage-Crisis und die Ölkrise. Politiker, wie der als „Mr. Conservative“ bekannte<br />
Präsidentschaftskandidat Barry Goldwater, und die Präsidenten Richard Nixon , der<br />
wiedergeborene Christ Jimmy Carter und der wirtschaftsliberale Ronald Reagan lenkten die<br />
Politik.<br />
Die Übung wird sich mit der Frage beschäftigen, wie es zu der Entwicklung des Conservative<br />
Backlash kam. Welche Rolle spielten wirtschaftliche und außenpoltische Faktoren bei dem<br />
Richtungswechsel in der Innenpolitik und der Herausbildung der Bürgerbewegungen der<br />
neuen Rechten Warum nahmen gerade Themen wie Abtreibung, Schwulenrechte oder<br />
Affirmative Action – Maßnahmen, die historisch benachteiligte Gruppen wie Schwarze,<br />
Native Americans und Frauen fördern sollten - eine derart zentrale Rolle in der politischen<br />
Debatte ein Welche Bedeutung kommt d<strong>ab</strong>ei der christlichen Rechten zu, die einen<br />
Kreuzzug für ein christliches Amerika proklamierte und politischen Einfluss suchte Kann<br />
man pauschal von einer einheitlichen konservativen Ära sprechen in Anbetracht von z.B.<br />
Nixons fortschrittlicher Umwelt- und Indianerpolitik<br />
Literatur und Quellen sind in englischer Sprache.<br />
97
Literatur: Ruth Murray Brown, For a “Christian America”: A History of the Religious Right,<br />
New York 2002. Peter N. Carroll, It Seemed Like Nothing Happened: America in the 1970s,<br />
New Brunswick 2000. Donald G. Mathews and Jane Sherron De Hart, Sex, Gender, and the<br />
Politics of ERA: A State and a Nation, New York 1990. Gil Troy, Morning in America: How<br />
Ronald Reagan Invented the 1980s, Princeton 2005.<br />
Dr. Felicity Jensz<br />
082955 Übung: Deutsche Freidenker in Amerika im 19. Jahrhundert<br />
Donnerstags: 16-18, Johannisstr. 12-20, ES 227<br />
Beginn: zweite Semester Woche<br />
Wie in vielen europäischen Ländern gründeten sich im 19. Jahrhundert auch im<br />
deutschsprachigen Raum Freidenker-Vereinigungen, die kirchen-, regierungs-, und<br />
gesellschaftkritisch auftraten. Um der angespannten politischen Lage um 1848 zu entgehen,<br />
wanderten deutsche Freidenker nach Nord-Amerika aus. Dort machten sie ihre politischen<br />
Meinungen weiterhin publik: Zum einen in gesellschaftskritischen Zeitschriften in deutscher<br />
Sprache, zum anderen in Vorträgen und Versammlungen. Die Übung wird einen Überblick<br />
über die Geschichte der deutsch-amerikanischen Freidenker geben: Von ihrer Gründung in<br />
Europa bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als sie an Einfluss verloren h<strong>ab</strong>en. Anhand von<br />
Primärquellen der Freidenker und ergänzt durch Sekundärliteratur wird ihre Haltung u.a. zu<br />
Staat, Religion, Politik sowie Militarismus, Bildung und Säkularismus untersucht. Schließlich<br />
wird da Phänomen der Freidenker im Kontext zeitgenössischer gesellschaftlicher Normen<br />
sowohl in den USA als auch in Europa betrachtet.<br />
Prof. Dr. Rolf Ahmann<br />
082572 Übung: Ansätze der Forschung zur neuesten Geschichte der Internationalen<br />
Beziehungen<br />
Di 16-18, Raum: F 102, Beginn: 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Anmeldung erforderlich, im Sekretariat (bei Frau Ibrahim/ Frau Michelson) oder in den<br />
Sprechstunden<br />
Die Erforschung der Geschichte der internationalen Beziehungen hat als historische<br />
Teildisziplin in jüngster Zeit verschiedene Erneuerungen bzw. Erweiterungen erfahren. Dies<br />
nicht nur, <strong>ab</strong>er insbesondere im Bereich der neuesten Geschichte der internationalen<br />
Beziehungen im Gefolge des Endes des Kalten Krieges und der jüngsten Prozesse der<br />
Globalisierung. Ziel der Übung ist es, die Bandbreite der jüngsten Forschungsansätze zur<br />
neuesten Geschichte der internationalen Beziehungen zu verdeutlichen und d<strong>ab</strong>ei ihre<br />
jeweiligen Besonderheiten und Wertigkeiten zu erfassen und zu diskutieren.<br />
Einführende Literaturauswahl: M. Mösslang, Th. Riotte (Hrsg.): The Diplomats‟ World. A<br />
Cultural History of Diplomacy, 1815-1914. Oxford University Press 2008; Siegfried<br />
Schieder/ Manuela Spindler (Hrsg.): Theorien der internationalen Beziehungen. 2. Aufl.<br />
Opladen 2006; Francis Fukuyama: Staaten bauen. Die neue Herausforderung internationaler<br />
Politik. Berlin 2006; Gunilla Bude/Sebastian Conrad/ Oliver Janz (Hrsg.): Transnationale<br />
Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien. Göttingen 2006; E. Conze u.a. (Hrsg.):<br />
Geschichte der internationalen Beziehungen. Erneuerung und Erweiterung einer historischen<br />
Disziplin. Köln, Weimar, Wien 2004; Herfried Münkler: Die neuen Kriege. Reinbeck bei<br />
Hamburg 2002; Jürgen Osterhammel: Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats.<br />
Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen 2001; W. Loth / J.<br />
Osterhammel (Hrsg.): Internationale Geschichte. Themen – Ergebnisse – Aussichten.<br />
München 2000.<br />
98
Kornelius Ens, M.A.<br />
082845 Ideologische Erziehungsarbeit als Konfliktfeld zwischen Staat und Kirche in der<br />
SBZ/DDR<br />
Do 16-18, Raum: F 153<br />
Am 29. September 1957 formulierte Walter Ulbricht in seiner sogenannten „Sonneberger<br />
Rede“ unter dem Titel „Lernen für das Leben – Lernen für den Sozialismus“ folgende<br />
Aussage: „Bei uns wird die Wahrheit gelernt und nicht irgendwelche Hirngespinste.“ Und<br />
weiter: Es sollten „nicht Zirkel für atheistische, sondern für naturwissenschaftliche<br />
Propaganda […]“ gebildet werden. „Am Ende kommt dann Atheismus heraus.“ Diese und<br />
ähnliche Ausführungen geben Einblicke in die erziehungsideologischen<br />
Auseinandersetzungen, die ein zentrales Konfliktfeld im Verhältnis von Staat und Kirche in<br />
der SBZ/DDR darstellten.<br />
Nicht nur die SED begriff die Jugend als Träger und Garant für die Zukunft. Auch für die<br />
Kirchen war sie für eine gefestigte Gemeindestruktur von existenzieller Bedeutung. Aufgrund<br />
der weltanschaulichen Differenzen der Institutionen erg<strong>ab</strong> sich zwangsläufig eine<br />
Konkurrenzsituation. Für die SED stand fest, dass ihr politisches Anliegen der<br />
Zurückdrängung der Kirchen aus der Gesellschaft nur erreicht werden kann, wenn sie die<br />
weltanschauliche Deutungsmacht besitzt. Die Erziehungsfrage wurde somit zu einem eminent<br />
bedeutungsvollen Spannungsfeld.<br />
Für die Veranstaltung wird sich die Frage stellen, mit welchen herrschaftsmethodischen<br />
Strategien die Staatsführung ihr politisches Ziel umsetzte, die Mehrheitsmeinung auf<br />
ideologischem und weltanschaulichem Feld v. a. bei Jugendlichen zu prägen. Im Zentrum der<br />
Analyse werden ihre diesbezüglichen Probleme und Erfolge stehen sowie die Reaktionen der<br />
Kirche.<br />
Literatur: Dähn, Horst/Gotschlich, Helga (Hg.), „Und führe uns nicht in Versuchung …“<br />
Jugend im Spannungsfeld von Staat und Kirche in der SBZ/DDR 1945 bis 1989, Berlin 1998;<br />
Helmberger, Peter, Blauhemd und Kugelkreuz. Konflikte zwischen der SED und den<br />
christlichen Kirchen um die Jugendlichen der SBZ/DDR, München 2008; Mählert,<br />
Ulrich/Stephan, Gerd-Rüdiger (Hg.), Blaue Hemden – Rote Fahnen. Die Geschichte der<br />
Freien Deutschen Jugend, Opladen 1996; Ohlemacher, Jörg/Blühm, Reimund, Repression<br />
gegen die christliche Jugend, in: Landtag Mecklenburg-Vorpommern (Hg.), Leben in der<br />
DDR, Bd. VII,, Schwerin 1999, S. 109–121; Schroeder, Klaus, Der SED-Staat. Geschichte<br />
und Strukturen der DDR, München 2000; Skyba, Peter, Vom Hoffnungsträger zum<br />
Sicherheitsrisiko. Jugend in der DDR und Jugendpolitik der SED 1949–1961, Köln u. a.<br />
2000; Ueberschär, Ellen, Junge Gemeinde im Konflikt. Evangelische Jugendarbeit in SBZ und<br />
DDR 1945–1961, Stuttgart 2003; Wiegmann, Ulrich, Pädagogik und Staatssicherheit. Schule<br />
und Jugend in der Erziehungsideologie und -praxis des DDR-Geheimdienstes, Berlin 2007.<br />
Dr. Stefan Lehr<br />
082902 Übung: Prag und seine Historiker (mit anschließender Exkursion nach Prag)<br />
Mittwoch 8-10, Raum: F 153, Beginn 18.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prag wurde jahrhundertelang durch eine tschechisch-deutsch-jüdische kulturelle Vielfalt<br />
geprägt. Erst der moderne Nationalismus führte zur Trennung der Nationalitäten, die mit der<br />
nationalsozialistischen Besatzung des sog. Protektorats Böhmen und Mähren im Zweiten<br />
Weltkrieg ihren Höhepunkt im Judenmord und der Verfolgung von Tschechen sowie nach<br />
dem Krieg in der Vertreibung und Zwangsaussiedlung der Deutschen fand. Diese allgemeinen<br />
politischen Ereignisse wirkten sich auch auf das Wirken und Schaffen von Historikern aus.<br />
In der Übung wird die Entwicklung des deutsch-tschechischen Nationalitätenkonflikts von der<br />
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges am Beispiel mehrerer<br />
99
Prager deutscher Historiker, die an der Philosophischen Fakultät der Deutschen (Karls-)<br />
Universität wirkten, betrachtet. D<strong>ab</strong>ei soll der Frage nachgegangen werden, ob und inwiefern<br />
sich Historiker in den Dienst der „nationalen Sache“ stellten und wie sich dieses<br />
nationalpolitische Engagement auf ihre wissenschaftlichen Arbeiten auswirkte. Hierzu wird<br />
die institutionelle Entwicklung der (deutschen) Geschichtswissenschaft in Prag nachvollzogen<br />
und auf mehrere einflussreiche Historiker wie Josef Pfitzner, Heinz Zatschek, Wilhelm<br />
Wostry, Eduard Winter und Wilhelm Weizsäcker sowie ihre tschechischen Kollegen<br />
eingegangen. Neben diesem institutionell-biographischen Ansatz steht die Lektüre der<br />
wissenschaftlichen Werke und Aufsätze der genannten Geisteswissenschaftler zu Themen der<br />
deutsch-tschechischen Geschichte im Zentrum der Übung.<br />
Der an die Übung anschließende Aufenthalt in Prag im März <strong>201</strong>2 dient dem Besuch und der<br />
Arbeit mit mehreren Nachlässen in den Prager Archiven (Nationalarchiv, Archiv der<br />
Akademie der Wissenschaften, Archiv der Karls-Universität) sowie Begegnungen mit<br />
einschlägigen Forschungsinstitutionen und Historikern (Jüdisches Museum, Institut für<br />
Zeitgeschichte, Institut für Internationale Studien der Karls-Universität, Pädagogische und<br />
Philosophische Fakultät der Karls-Universität).<br />
Interessenten an der Exkursion – für die ein finanzieller Zuschuss aus dem Exkursionsfond<br />
beantragt wird – werden gebeten, sich per Mail vor<strong>ab</strong> bis spätestens zum 31.9.<strong><strong>201</strong>1</strong> an<br />
stlehr@uni-muenster.de anzumelden und ihren Teilnahmewunsch zu begründen. Die<br />
Teilnehmerzahl ist beschränkt.<br />
Einführende Literatur: Prager Professoren 1938 – 1948: zwischen Wissenschaft und Politik.<br />
Hrsg. von Monika Glettler u. Alena Míšková. Essen 2001; Geschichtsschreibung zu den<br />
böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Christiane Brenner, Erik K. Franzen, K.<br />
Erik Franzen, Peter Haslinger, Robert Luft. München 2006; Österreichische Historiker 1900–<br />
1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in<br />
wissenschaftsgeschichtlichen Porträts. Hrsg. von Karel Hruza. Wien 2008; Handbuch der<br />
völkischen Wissenschaften. Personen – Institutionen – Forschungsprogramme – Stiftungen.<br />
Hrsg. von Ingo Haar, Michael Fahlbusch, Matthias Berg. München 2008.<br />
Ursula Horstmeier<br />
082610 Französisch für Historiker I<br />
Di 8-9:30 in Raum ES 227 und Do 16-17:30 in Raum ES 24<br />
Erster Teil des Sprachkurses zur Vermittlung der für das Geschichtsstudium erforderlichen<br />
Sprachkenntnisse.<br />
Ursula Horstmeier<br />
082625 Französisch für Historiker I<br />
Di 10 -11:30 in Raum SCH 109.6 und Do 18-19:30 in Raum F 4<br />
Erster Teil des Sprachkurses zur Vermittlung der für das Geschichtsstudium erforderlichen<br />
Sprachkenntnisse.<br />
Margarita Alvarez<br />
082630 Übung: Spanisch für Historiker I<br />
Mo 10-12, Do 12-14, Raum: F 4<br />
Erster Teil des Sprachkurses zur Vermittlung der für das Geschichtsstudium erforderlichen<br />
Sprachkenntnisse.<br />
Margarita Alvarez<br />
082644 Übung: Spanisch für Historiker II<br />
100
Mo 12-14 in Raum F 4 und Do 10-12, Raum: SCH 109.6<br />
Fortsetzung des im Sommersemester begonnenen Sprachkurses zur Vermittlung der für das<br />
Geschichtsstudium erforderlichen Sprachkenntnisse.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083617 Virtuelle Geschichte<br />
Fr. 8-10, R. 304, Beginn 21.10.11<br />
Museums- und Ausstellungswesen gehören maßgeblich zum Berufsfeld des Historikers. Ziel<br />
dieser Veranstaltung ist zum einen die Aneignung und Diskussion ausstellungsdidaktischer<br />
Grundlagen, die zum zweiten <strong>ab</strong>er auch konkret in der Gestaltung einer virtuellen Ausstellung<br />
ihre praktische Anwendung finden sollen. Hierfür werden Teams weitgehend autonom<br />
arbeiten. Die Übungssitzungen dienen – nach der Einführungsphase – entsprechend zum<br />
Gedankenaustausch, zur gemeinsamen Problemlösung, zur Rückmeldung bzgl. des<br />
Fortschrittes in den Gruppen. Gleichzeitig werden Ausstellungen durch Exkursionen bzw.<br />
‚virtuell‟ vergleichend in den Blick genommen.<br />
Grundkenntnisse sind nicht erforderlich, <strong>ab</strong>er dass für diese Übung besonderes Engagement<br />
bzgl. außerhalb der Übung anzueignender und zu vertiefender Kenntnisse im Umgang mit<br />
Multimedia, Neuen Medien und Webseitengestaltung erforderlich sein wird, liegt auf der<br />
Hand; zudem wäre es von Vorteil, wenn ein Laptop (oder mindestens ein Heim-PC)<br />
vorhanden wäre.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083621 Film-+ Geschichtswerkstatt<br />
Fr. 10-12, R. 304, Beginn 21.10.11<br />
Geschichte wird gemacht! Und nirgends wird dies so augenfällig wie im ‚Fernsehen„. Die<br />
Veranstaltung wird sich einerseits analytisch mit unterschiedlichen audio-visuellen<br />
Geschichtsformaten auseinandersetzen, um so deren geschichtsdidaktische und<br />
geschichtskulturelle Chancen und Grenzen auszuloten, wobei die Perspektive der ‚Macher„<br />
sowie die Rahmenbedingungen fernsehgerechter und zielgruppenadäquater<br />
Geschichtskonstruktion nicht außer Acht gelassen werden soll.<br />
Im Zentrum der Veranstaltung steht die Produktion eigener audio-visueller<br />
Geschichtsnarrationen, wie auch die Erstellung von Begleitmaterial zu existierenden<br />
Angeboten bzw. die Entwicklung von Unterrichtsvorschlägen o.ä. zum Umgang mit audiovisuellen<br />
Geschichtserzählungen in der Schule.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Wolfhart Beck<br />
083602 Auf den Spuren der Schulgeschichte – Archivpädagogische Angebote im<br />
Lernort Landesarchiv<br />
Fr. 14–17s.t., 14-tägig, Raum: Vortragsraum Landesarchiv, Bohlweg 2, Beginn: 21.10.11<br />
Die Erforschung der Geschichte des eigenen Umfelds, vom Wohnort über den Sportverein bis<br />
hin zur eigenen Schule, stellt für Schülerinnen und Schüler einen ebenso lebensnahen wie<br />
101
spannenden Zugang zur Geschichte dar. Das Archiv mit seinen Beständen und<br />
archivpädagogischen Angeboten bietet sich hierbei als außerschulischer Lernort in besonderer<br />
Weise an: Schülerinnen und Schüler können anhand von originalen Quellen forschendentdeckend<br />
auf historische Spurensuche gehen und selber Geschichte schreiben.<br />
Am Beispiel von Schulgeschichte(n) soll dieser Ansatz in der Übung vorgestellt und<br />
ausprobiert werden. Nach einer Einführungsphase, in der die Aufg<strong>ab</strong>en,<br />
Nutzungsmöglichkeiten und Bestände sowie das archivpädagogische Konzept des<br />
Landesarchivs vorgestellt werden, sollen die Studierenden dann zunächst selbst auf<br />
Spurensuche gehen (z.B. zur Geschichte der eigenen Schule) und auf dieser Grundlage dann<br />
archivpädagogische Module und Handreichungen für Schülerinnen und Schüler erstellen und<br />
ggf. auch praktisch erproben. Als inhaltliche Schwerpunkte bieten sich z. B. an: Unterricht im<br />
Kaiserreich, ideologische Indoktrination oder Resistenz in der NS-Diktatur, Erziehung im<br />
Krieg, Bildungsreform und Schülerprotest in der Bundesrepublik u.v.m.<br />
Literatur: Dittmer, Lothar/ Siegfried, Detlef (Hg.), Spurensucher. Ein Praxisbuch für<br />
historische Projektarbeit, überarb. und erw. Neuauflage, Hamburg 2005; Lange, Thomas/<br />
Lux, Thomas, Historisches Lernen im Archiv, Schwalbach/Ts. 2004<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Sebastian Wemhoff, M.A.<br />
083708 Übung zur Vorlesung Einführung in die Geschichtskultur<br />
Mi 12-14, R. 304, Beginn: 19.10.11<br />
Sebastian Wemhoff, M.A.<br />
083803 Übung zur Vorlesung Einführung in die Geschichtskultur<br />
Mi 16-18, R. 304, Beginn: 19.10.11<br />
Sebastian Wemhoff, M.A.<br />
(83909 Übung zur Vorlesung Einführung in die Geschichtskultur<br />
Do 10-12, R. 309, Beginn: 20.10.11<br />
Die Übung ist als begleitende Veranstaltung zur gleichnamigen Vorlesung (bei Prof.<br />
Schönemann) konzipiert. In der Vorlesung behandelte Themen werden aufgegriffen und<br />
durch ergänzende Lektüre vertieft. Anhand einschlägiger Basisliteratur soll die Systematik<br />
des heuristischen Konzepts Geschichtskultur (Institutionen, Professionen, Medien, Publika)<br />
erschlossen werden. Darüber hinaus sind Diskussionen über konkrete geschichtskulturelle<br />
Phänomene (Museum, Denkmal, Gedenktage, Geschichte im Fernsehen) Bestandteil der<br />
Übung – sie sollen zur Anschaulichkeit der Thematik beitragen.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Markus Drüding, M.A.<br />
083693 Übung zur Vorlesung Einführung in die Geschichtskultur<br />
Di 12-14, R. 304, Beginn: 18.10.11<br />
Markus Drüding, M.A.<br />
083799 Übung zur Vorlesung Einführung in die Geschichtskultur<br />
Di 18-20, R. 304, Beginn: 18.10.11<br />
102
Markus Drüding, M.A.<br />
083894 Übung zur Vorlesung Einführung in die Geschichtskultur<br />
Do 16-18, R. 304, Beginn: 20.10.11<br />
Die Übung ist als begleitende Veranstaltung zur gleichnamigen Vorlesung (bei Prof.<br />
Schönemann) konzipiert. In der Vorlesung behandelte Themen werden aufgegriffen und<br />
durch ergänzende Lektüre vertieft. Anhand einschlägiger Basisliteratur soll die Systematik<br />
des heuristischen Konzepts Geschichtskultur (Institutionen, Professionen, Medien, Publika)<br />
erschlossen werden. Darüber hinaus sind Diskussionen über konkrete geschichtskulturelle<br />
Phänomene (Museum, Denkmal, Gedenktage, Geschichte im Fernsehen) Bestandteil der<br />
Übung – sie sollen zur Anschaulichkeit der Thematik beitragen.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
7. Kolloquien<br />
Lehrende des Seminars für Alte Geschichte<br />
081360 Forschungskolloquium des Seminars für Alte Geschichte<br />
Mi 20-22<br />
Beginn und Programm: siehe gesonderte Anschläge sowie Internet!!<br />
Im Kolloquium sprechen auswärtige Gäste und Angehörige des Seminars und der anderen<br />
altertumswissenschaftlichen Institute zu aktuellen Problemen des Faches sowie der<br />
Nachbardisziplinen. Die Vortragsthemen und –termine werden jeweils mit Anschlägen und<br />
im Internet bekannt gemacht.<br />
Prof. Dr. Gerd Althoff, Prof. Dr. Wolfram Drews, Prof. Dr. Werner Freitag, Prof. Dr. Michael<br />
Grünbart, Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
082590 Kolloquium: 800-1800 Forschungskolloquium Mittelalter und Frühe Neuzeit<br />
Mi 18-20, Raum: F 102<br />
Das Programm des Kolloquiums wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.<br />
Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger, Jun.prof. Dr. André Krischer, Jun.prof. Dr. Matthias<br />
Pohlig, apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
082720 Forschungskolloquium Frühe Neuzeit<br />
Mi 18-20 Uhr, Raum: F 6<br />
Das Forschungskolloquium gibt vor allem auswärtigen Historiker/innen der Frühen Neuzeit<br />
Gelegenheit, Vorträge über ihre laufenden Forschungsarbeiten zur Diskussion zu stellen. Das<br />
Programm wird zu Beginn des Semesters auf der Homepage des Historischen Seminars<br />
bekanntgegeben. - Die Teilnahme steht allen Interessierten offen.<br />
Prof.s Dr.s Rolf Ahmann, Heike Bungert, Thomas Großbölting, Silke Hensel, Franz-Werner<br />
Kersting, Bernd Walter, Martina Winkler<br />
Kolloquium: Münsteraner Gespräche zur Geschichte: Kommunikation über Gewalt<br />
Mi 18-20, Raum: F 4, Beginn: 19.10.<br />
103
Dr. Wilfried Ehbrecht, Prof. Dr. Werner Freitag, Dr. Michael Hecht, Prof. Dr. Peter Johanek,<br />
Dr. Angelika Lampen<br />
082585 Kolloquium Probleme vergleichender Städtegeschichte<br />
Fr 16-18, Institut für vergleichende Städtegeschichte<br />
Im Rahmen des Kolloquiums des Instituts für vergleichende Städtegeschichte werden<br />
laufende Forschungsvorh<strong>ab</strong>en und aktuelle Arbeitsergebnisse einschlägiger<br />
Forschungsprojekte Münsteraner und auswärtiger Wissenschaftler als Einzelvorträge<br />
präsentiert und diskutiert. Interessierte Studierende sind zur Teilnahme herzlich eingeladen.<br />
Ein ausführliches Programm wird zu Beginn des Semesters auf der Homepage des Instituts<br />
für vergleichende Städtegeschichte (http:www.uni-muenster.de/staedtegeschichte)<br />
bekanntgegeben.<br />
Prof. Dr. Thomas Großbölting<br />
082826 Doktorandenkolloquium<br />
21./20. 10. <strong><strong>201</strong>1</strong> Veranstaltungsort: Villa ten Hompel, nur nach persönlicher Anmeldung bei<br />
christoph.lorke@uni-muenster.de<br />
Dr. Martina Winkler<br />
Examenskolloquium<br />
Mo 14-16 Uhr, Raum: F 104<br />
Prof. Dr. Saskia Handro/Prof.Dr. Bernd Schönemann<br />
083454 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden<br />
14-tägig, Do 18-21 Uhr<br />
8. Exkursionen<br />
apl. Prof. Dr. Michael Sikora / Dr. Michael Hecht<br />
082678 Übung/Exkursion: Residenzlandschaft Anhalt<br />
Termin: Woche vom 10.-14. Oktober (die genauen Daten werden in der Vorbesprechung<br />
mitgeteilt), Vorbesprechung: 14.7.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18 Uhr c.t., Raum: F 104<br />
Eine Fülle imposanter historischer Zeugnisse auf engstem Raum – mit diesem und ähnlichen<br />
Slogans werben die Tourismusverbände für die Region Anhalt. In der Tat sind infolge der<br />
politischen Strukturen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit im kleinen Fürstentum<br />
Anhalt – das nach mehreren Erbteilungen von unterschiedlichen Linien der Dynastie der<br />
Askanier regiert wurde – zahlreiche Monumente entstanden, die noch heute von den<br />
Ansprüchen, Möglichkeiten und Grenzen hochadliger Herrschaft zeugen. Anhand der Burgen,<br />
Schlösser und Kirchen in Bernburg, Dessau, Köthen und Oranienbaum sowie des (auf der<br />
UNESCO-Welterbeliste stehenden) Wörlitzer Gartenreichs lassen sich viele Phänomene der<br />
vormodernen Geschichte eindrucksvoll studieren: Wie wurden Fürstenrang und<br />
Landesherrschaft symbolisch zum Ausdruck gebracht, welchen Einfluss besaßen dynastische<br />
Heiratsverbindungen und kulturelle Transferprozesse auf das Land, wie wandelten sich die<br />
Konzeptionen von Herrschaft zwischen Spätmittelalter und 19. Jahrhundert In einer ca.<br />
viertägigen Exkursion nach Anhalt soll in der zweiten Oktoberwoche diesen und weiteren<br />
Fragen vor Ort nachgegangen werden. Die Exkursion findet im Anschluss an das<br />
Hauptseminar „Kleinen Fürsten im Alten Reich – das Beispiel Anhalt“ vom Sommersemester<br />
statt. Sie richtet sich vornehmlich an die Teilnehmer des Hauptseminars, steht <strong>ab</strong>er auch<br />
anderen Studierenden offen, sofern noch freie Plätze zu besetzen sind. Interessenten sollten<br />
sich in jedem Fall bis zum 12.7.<strong><strong>201</strong>1</strong> bei den Veranstaltern melden (sikora@uni-muenster.de /<br />
104
michael.hecht@uni-muenster.de). Bei einer obligatorischen Vorbesprechung am 14.7.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
werden alle organisatorischen Fragen behandelt.<br />
105
Masterstudiengang Master of Arts<br />
Modul Geschichtsbilder/Theorie<br />
Seminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
082190 Oberseminar: Amor Patriae und Global History. Methoden der Mediävistik.<br />
Donnerstag 8-10, Raum: F 104, Beginn 13.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Unterschiedlichen gesellschaftlichen Absichten ist die Beschäftigung mit der mittelalterlichen<br />
Geschichte seit der Renaissance und bis zur modernen Gegenwart nutzbar gemacht worden.<br />
Wissenschaftliche Ansätze ihrer Erforschung h<strong>ab</strong>en sich in diesem Rahmen entwickelt und so<br />
dazu beigetragen, Bilder von Geschichte in der zeitgenössischen Gesellschaft zu generieren<br />
und Aussagen zu treffen zum Verhältnis der eigenen Zeit zu ihrer Vergangenheit. Daran hat<br />
sich bis heute grundsätzlich wenig geändert. Das Seminar will die Entwicklung der Methoden<br />
historischer Mediävistik vom 15. bis zum 21. Jahrhundert untersuchen und vergleichend<br />
analysieren. D<strong>ab</strong>ei wird ebenso von den Grundlagen der Quellenkritik und des historischen<br />
Positivismus zu sprechen sein wie von den Herausforderungen der modernen<br />
Kulturwissenschaften und den aktuellen Tendenzen einer Global History.<br />
Lit. Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte, Frankfurt/M. 2001; Lutz Raphael,<br />
Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme, München 2003; Werner Paravicini, Die<br />
Wahrheit der Historiker, München <strong>201</strong>0; Wolfram Drews, Transkulturelle Perspektiven in der<br />
mittelalterlilchen Historiographie, in: Historische Zeitschrift 292 (<strong><strong>201</strong>1</strong>), S. 31-59.<br />
PD Dr. Uwe Spiekermann<br />
082830 Transnationale Geschichte. Chancen und Grenzen<br />
Mo 16-18 Uhr, Raum: F 153<br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Jun.Prof. Dr. Matthias Pohlig<br />
082788 Übung: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben<br />
Do 10-12, Raum: F 104, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Welchen Nutzen hat die Beschäftigung mit der Geschichte Hat sie auch Nachteile Kann<br />
man aus der Geschichte lernen, und wenn ja: was Oder konnte man das früher und kann es<br />
jetzt nicht mehr Welche Art von „Nutzen“ meinen wir eigentlich sinnvollerweise, wenn wir<br />
vom Nutzen der Geschichte sprechen Ausgehend von einer eingehenden Lektüre von<br />
Nietzsches klassischem Text über den Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben und<br />
dem Versuch, seine Fragen für heute neu zu stellen, soll in dieser Übung nach privatem und<br />
öffentlichem Gebrauch historischen Wissens gefragt werden. Das Spektrum der zu<br />
diskutierenden Phänomene reicht d<strong>ab</strong>ei von der ciceronischen Maxime „historia magistra<br />
vitae“ bis zu Guido Knopp, von Humboldts Universitätskonzeption zu „public“ und „applied<br />
history“.<br />
Anmeldung erwünscht unter matthias.pohlig@uni-muenster.de.<br />
Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082439 Übung: Rassismustheorien<br />
106
Zeit: Do. 14-16 Uhr, Raum: F 102, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Kommentar: Der Rassismus oder besser Rassismen stellen ein weit verbreitetes Muster zur<br />
Erklärung gesellschaftlicher Verhältnisse dar und sind darin erschreckend aktuell. Als<br />
ausgeprägte Weltanschauung entstand der Rassismus im 18. Jhd. und prägte Politik und<br />
Wissenschaften sowie Alltagsvorstellung und –praktiken in vielfacher Hinsicht. Die<br />
Hintergründe dieser Entwicklung ebenso wie wissenschaftliche Theorien zu ihrer Erklärung<br />
stehen im Zentrum der Übung. D<strong>ab</strong>ei ist das Augenmerk weniger auf die Suche nach der<br />
„einen“ Theorie gerichtet, sondern darauf, welche theoretischen Ansätze welche historischen<br />
Situationen am plausibelsten zu erklären vermögen.<br />
Literatur: Martin Bulmer, John Solomos (Hg.): Racism, Oxford 1999; George Fredrickson,<br />
Rassismus, Ein historischer Abriss, Hamburg 2004; Nora Räthzel (Hg.): Theorien über<br />
Rassismus, Hamburg 2000.<br />
Dr. Sita Steckel/Dr. Astrid Reuter<br />
082773 Übung: The Making of Religion Die Ausdifferenzierung von Religion in<br />
Vormoderne und Moderne<br />
Mi 10-12, Raum: S1, Schlossplatz 2, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Art der Veranstaltung: als Seminar (Soziologie) oder Übung (Geschichte, LN oder TN)<br />
wählbar<br />
Anmeldung unter sita.steckel@gmx.net nötig.<br />
Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch eine funktionale Differenzierung von<br />
Handlungssphären wie Religion und Politik, Recht, Wissenschaft, Wirtschaft usw. aus – das<br />
ist zumindest eine Grundannahme sozialwissenschaftlicher Forschung. Doch Religion und<br />
Politik, Recht, Wissenschaft, Wirtschaft usw. sind keine historisch invarianten Kategorien,<br />
deren Unterscheidung nur für moderne Gesellschaften sinnvoll sein kann. Was Religion war<br />
und ist, hat sich vielmehr in historischen Prozessen der Differenzierung von ihrer Umwelt erst<br />
herausgebildet und verändert sich stetig weiter. In diesem Sinne wurde und wird Religion<br />
‚gemacht‟.<br />
Die Lehrveranstaltung soll in einer Überkreuzung historischer und soziologischer<br />
Perspektiven in den Blick nehmen, wie sich Religion in Prozessen der Abgrenzung von<br />
anderen gesellschaftlichen Handlungssphären herausgebildet und gewandelt hat. Auch soll die<br />
Frage thematisiert werden, ob und wie vor diesem Hintergrund interdisziplinär angemessen<br />
von Religion gesprochen werden kann.<br />
Die Lehrveranstaltung richtet sich vorwiegend an fortgeschrittene Studierende im Masterbzw.<br />
Magister- und Promotionsstudium. Teil der Anforderungen ist der Umgang mit einigen<br />
Texten der englischsprachigen Fachliteratur.<br />
Die Literatur wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.<br />
Praxismodul<br />
N.N.<br />
082663 Übung: Der Historiker im Interview<br />
Mi 10-12 Uhr, Raum: F 104<br />
Das Interview ist ein vor allem im deutschen Sprachraum bisher nur wenig genutztes<br />
Instrument zur epistemologischen Erforschung der Geschichtswissenschaft. D<strong>ab</strong>ei kann das<br />
wissenschaftliche Fragestellen gerade die Zwischenräume des eigenen Fachbereichs ausloten,<br />
der kein L<strong>ab</strong>or zum räumlichen Zuhause hat: Mit welchen Ordnungs- und<br />
Archivierungssystemen arbeiten Historikerinnen und Historiker Nach welchen Kriterien<br />
107
wählen sie ihre Forschungsobjekte und mit welchen Praktiken und Erkenntnismethoden<br />
versuchen sie sich diese zu erschließen Wie strukturieren sie das produzierte Wissen und<br />
präsentieren sie ihre Erkenntnisse – Das Erforschen der Geschichte ist wie auch das<br />
naturwissenschaftliche Forschen ein spannender, keineswegs gleichförmiger Prozess, bei dem<br />
im Vorfeld oft noch ungewiss ist, zu welchen Ergebnissen die Arbeit führt. Diese Prozesse<br />
sollen exemplarisch über Interviews mit Historikerinnen und Historikern der Westfälischen<br />
Wilhelms-Universität Münster erfragt werden. Dazu werden zunächst die Methoden des<br />
wissenschaftlichen Fragestellens und Interviewtechniken gemeinsam erarbeitet, ehe die<br />
entsprechenden Fragekatologe durch die jeweiligen Interviewteams im Seminar vorgestellt<br />
werden sollen. Nach dem erfolgten Interview werden die anstehenden Arbeitsschritte von der<br />
Transkription über die Politur bis hin zur Korrektur durch die Interviewpartner durch das<br />
Seminar begleitet. Am Ende des Semesters soll idealerweise eine Publikation der Interviews<br />
erfolgen.<br />
N.N.<br />
082659 Übung:»Das Museum als Erkenntnisort« – Schreiben über Ausstellungen<br />
Mi 16-18 Uhr, Raum: ES 227<br />
Das Museum als Institution der Geschichtskultur führte lange Zeit ein Schattendasein<br />
innerhalb der Geschichtswissenschaft. Gegenwärtig steht jedoch außer Frage, dass Museen<br />
auf vielfältige Art und Weise historische Erkenntnisse vermitteln und erfahrbar machen.<br />
Zudem scheinen sie der ureigenen Institution der Geschichtswissenschaft, dem Archiv, nicht<br />
unverwandt zu sein, sind doch auch sie mit dem Sammeln, Archivieren und Systematisieren<br />
von Objekten beauftragt. Aber wie wird aus einzelnen Exponaten ein Erkenntnisgegenstand<br />
Nach welchen Systematiken werden diese im Raum angeordnet Wie wird historische<br />
Erkenntnis präsentiert, erfahrbar gemacht Wie funktioniert das Ausstellungsmachen – Im<br />
Arbeitskurs wird zunächst der Erfahrungsraum Ausstellung/Museum theoretisch erschlossen,<br />
ehe über ein oder zwei Exkursionen dieser Raum auch praktisch erfahren werden soll. Am<br />
Ende des Arbeitskurses steht das Verfassen von Ausstellungskritiken auf dem Programm.<br />
Prof. Dr. Silke Hensel, Matthias Friedmann, Henrik Kipshagen, Frank Schlegel, Philipp<br />
Spreckels,<br />
082261 Übung: Geschichte im Radio: Migration in globalhistorischer Perspektive<br />
Do 16-18, Raum: F 102, Beginn: 20.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
„Ich möchte nicht, dass wir zu Fremden im eigenen Land werden“: Mit Sätzen wie diesen<br />
löste Thilo Sarrazin im letzten Jahr eine neue Debatte über Migration und Integration aus. In<br />
den Medien erhält das Thema seitdem verstärkt Aufmerksamkeit. Doch wie fundiert ist diese<br />
Debatte Die Geschichtswissenschaft kann hier wertvolle Hintergründe liefern. Welche<br />
Folgen hatte Migration für die jeweiligen Länder Wie wurden die Migranten wahr-/<br />
aufgenommen Welche Auswirkungen hatten beispielsweise Rassenvorstellungen auf die<br />
soziale Inklusion bzw. Exklusion der Migranten In der Übung soll eine Radiosendung über<br />
unterschiedliche, auf globaler Ebene stattfindende Migrationsbewegungen erarbeitet werden,<br />
um die aktuelle Debatte anhand historischer Beispiele kritisch zu hinterfragen. Neben dieser<br />
inhaltlichen Beschäftigung mit der Migrationsgeschichte soll die praktische Umsetzung von<br />
Geschichte im Radio im Vordergrund stehen. Die Seminarteilnehmer werden in Kleingruppen<br />
einen Beitrag eigenständig entwerfen und produzieren, der dann auch gesendet werden soll.<br />
Die Bereitschaft für Engagement außerhalb der Übung ist für die Teilnahme wichtig. Die<br />
Übung findet in Kooperation mit dem Campusradio Radio Q statt. Wegen der technischen<br />
Radioausbildung ist die TeilnehmerInnenzahl auf 15 begrenzt. Bitte tragen Sie sich zu den<br />
allgemeinen Terminen bei Frau Simon (R 123) in die Liste ein.<br />
108
Literatur: Wolf Schneider, Deutsch für Profis, Berlin <strong>201</strong>0. Margarete Bloom-Schinnerl, Der<br />
gebaute Beitrag. Ein Leitfaden für Journalisten, Konstanz 2002, Walther von la Roche, Radio-<br />
Journalismus: Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis im Hörfunk, München 1980.<br />
http://www.qhistory.de. Dirk Hoerder, Geschichte der deutschen Migration, München <strong>201</strong>0.<br />
Dirk Hoerder, Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millennium, Durham u.a.<br />
2002. Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur<br />
Gegenwart, München 2000. Jochen Oltmer, Migration im 19. und 20. Jahrhundert,<br />
München/Oldenburg 2009.<br />
Dr. Karsten Igel<br />
082333 Übung: Religiosität in der spätmittelalterlichen Stadt – Ausstellungsprojekt<br />
Osn<strong>ab</strong>rück um 1500<br />
Mi 14-16 Uhr, Raum. Sitzungszimmer des Instituts für vergleichende Städtegeschichte,<br />
Königsstraße 46, Beginn: 19. Oktober<br />
Im Sommer <strong>201</strong>2 widmet sich ein von mehreren Institutionen getragenes Ausstellungsprojekt<br />
der Lebenswelt in Osn<strong>ab</strong>rück in der Zeit um 1500. Einen wichtigen Teil nimmt in einer<br />
Epoche, in der letztlich nicht zwischen säkular und sakral geschieden werden kann, natürlich<br />
der Blick auf das geistliche Leben und die bürgerliche Frömmigkeit in der<br />
spätmittelalterlichen Stadt ein. In der Übung soll einerseits ein Überblick der d<strong>ab</strong>ei für<br />
Osn<strong>ab</strong>rück vorzustellenden Themenfelder erarbeitet werden und andererseits auch über die<br />
Möglichkeiten der Umsetzung in einer Ausstellung diskutiert und so ein Grundkonzept<br />
erarbeitet werden.<br />
Angesichts des Themas wird von den Teilnehmern ein entsprechendes aktives Engagement<br />
mit Kurzvorstellungen einzelner Themensegmente und der Arbeit an möglichen<br />
Ausstellungstexten sowie der Diskussion der vorgestellten Ergebnisse erwartet. Von Vorteil<br />
sind zudem Vorkenntnisse der spätmittelalterlichen Stadt- und/oder Kirchengeschichte.<br />
Hirschmann, Frank G.: Die Stadt im Mittelalter, München 2009; Schmieder, Felicitas: Die<br />
mittelalterliche Stadt, Darmstadt 2005; Isenmann, Eberhardt: Die deutsche Stadt im<br />
Spätmittelalter, Stuttgart 1988; Rothert, Hermann: Geschichte der Stadt Osn<strong>ab</strong>rück im<br />
Mittelalter, in: Osn<strong>ab</strong>rücker Mitteilungen 57 (1937)/58 (1938); Poeck, Dietrich W.:<br />
Osn<strong>ab</strong>rück im späten Mittelalter, in: Steinwascher, Gerd (Hg.): Geschichte der Stadt<br />
Osn<strong>ab</strong>rück, Osn<strong>ab</strong>rück 2006 S., 87-160; Queckenstedt, Hermann: Die Armen und die Toten.<br />
Sozialfürsorge und Totengedenken im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Osn<strong>ab</strong>rück,<br />
Osn<strong>ab</strong>rück 1997; Kaster, Karl Georg und Steinwascher, Gerd: 450 Jahre Reformation in<br />
Osn<strong>ab</strong>rück, Osn<strong>ab</strong>rück 1993; Gleba, Gudrun: Klöster und Orden im Mittelalter, Darmstadt<br />
²2006; Meckseper, Cord: Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter,<br />
Darmstadt 1982.<br />
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt und eine vorherige Anmeldung an karsten.igel@unimuenster.de<br />
daher erforderlich.<br />
Modul Sprachen<br />
PD Dr. Alheydis Plassmann<br />
082898 Übung: Herrscherlob und Tyrannenschelte in der englischen Geschichtsschreibung<br />
des 12. Jahrhunderts<br />
Fr 14-16, Raum: F 153, Beginn: 4.11.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Das englische Königtum hatte sich in der Folge der normannischen Eroberung Englands 1066<br />
zu einer Herrschaft entwickelt, die im Vergleich zu anderen europäischen Regionen sehr viel<br />
stärker zentralisiert und deren Instrumentarium zur Machtausübung weiter entwickelt war.<br />
109
Das Vorgehen der englischen Könige bei der Ausweitung ihrer Herrschaft bedurfte indes<br />
besonderer Legitimationsstrategien, da ihre Handlungsweise von traditionellen christlichen<br />
Königsidealen oftmals nicht <strong>ab</strong>gedeckt war. Auf die Wahrnehmung der Zeitgenossen, die wir<br />
in der überaus reichen lateinischen historiographischen Überlieferung in vielen Facetten<br />
fassen können, hat die Legitimierung der Könige offenbar nur begrenzt gewirkt. Dem<br />
Vorwurf der willkürlichen Tyrannei oder zumindest der ungerechten Herrschaft schließen<br />
sich eine Vielzahl von zeitgenössischen Stimmen an. Zum einen ist die Frage zu stellen,<br />
inwieweit sich in historiographischen Zeugnissen verzerrt die Legitimationsbemühungen der<br />
Herrscher spiegeln. Zum anderen sollte in den Blick genommen werden, weshalb die<br />
Vermittlung der Legitimierung an die Beherrschten offenbar zu großen Teilen versagte.<br />
Voraussetzung zur Teilnahme ist die Bereitschaft zu intensiver Lektüre der lateinischenglischen<br />
Quellenausg<strong>ab</strong>en.<br />
Einführende Literatur: R. Bartlett, England under the Norman an Angiovin Kings, Oxford<br />
2000; J. Gillingham, The Angevin Empire, London u.a. 2 2001; A. Gransden, Historical<br />
Writing in England I. c. 550 to c. 1307, London 1974; C. Harper-Bill – N. Vincent (Hrsg.),<br />
Henry II. New Interpretations, Woodbridge 2007.<br />
Prof. Dr. Heike Bungert<br />
082443 Übung: Image(s) of Native Americans in Film<br />
Do. 16-19, Raum: F 33, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
After briefly looking into ways how historians can use films as sources, the class will review<br />
differing images of Natives Americans in film. Special attention will be paid to the<br />
stereotypes of the “bad”, savage Indian as well as the “good”, noble Indian. The class will<br />
look at western movies, historical films, road movies, detective films, and documentaries,<br />
mainly from Hollywood, but also from Canadian or American Indian directors.<br />
Since we will be viewing films, we will be meeting three hours per week. As this equals an<br />
extra half an ECTS point, there will be less reading required and only a short written handout<br />
for the oral presentation of one of the films.<br />
Literatur: John E. O'Connor (Hg.), Image as Artifact: The Historical Analysis of Film and<br />
Television. Mal<strong>ab</strong>ar, FL, 1990; Robert F. Berkhofer, Jr., The White Man's Indian: Images of<br />
theAmerican Indian from Columbus to the Present. New York 1978; Jacquelyn Kilpatrick,<br />
Celluloid Indians: Native Americans and Film. Lincoln, NE, 1999; Philip J. Deloria, Playing<br />
Indian. New Haven, CT, 1998; Angela Aleiss, Making the White Man‟s Indian: Native<br />
Americans and Hollywood Movies. Westport, CT, 2005; Michael Hilger, From Savage to<br />
Nobleman: Images of Native Americans in Film. Lanham, MD, 1995; John E. O'Connor/Peter<br />
C. Rollins (Hg.), Hollywood's Indian: The Portrayal of the Native American in Film.<br />
Lexington, KY, 1998.<br />
Dr. S<strong>ab</strong>ine Happ<br />
082587 Übung: Paläographische Übung zur Geschichte der Universität Münster im 19. und<br />
20. Jahrhundert<br />
Do 14-16, Raum: Universitätsarchiv, Leonardo Campus, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
In der Übung sollen handschriftliche Quellen des Universitätsarchivs aus dem 19. und dem<br />
beginnenden 20. Jahrhundert transkribiert werden. Die Übung bietet damit auch Einblicke in<br />
die Geschichte der Universität Münster.<br />
Um sicherzustellen, dass möglichst alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit zur<br />
praktischen Übung h<strong>ab</strong>en, ist die Teilnehmerzahl auf 12 begrenzt.<br />
Anmeldung bitte per Mail: s<strong>ab</strong>ine.happ@uni-muenster.de<br />
Eine Literaturliste wird in der Übung zur Verfügung gestellt.<br />
110
Die Übung findet im Benutzerraum des Universitätsarchivs statt. Anschrift: Leonardo-<br />
Campus 21. Eine Wegebeschreibung und ein Lageplan finden sich auf der Homepage des<br />
Universitätsarchivs: www.uni-muenster.de/archiv.<br />
Prüfung: Klausur<br />
Thomas Busch<br />
082534 Russisch für Historiker: Die Sowjetunion in den außenpolitischen Krisen nach dem 2.<br />
Weltkrieg<br />
Mo 18-20, Raum: F 041<br />
Die Übung beschäftigt sich mit dem Verhalten der Sowjetdiplomatie in der Nachkriegszeit<br />
anhand einzelner Krisen (Berlin-Krise, Kuba-Krise etc.).<br />
In der Übung sollen russische Texte zu diesem Themenkomplex gelesen und übersetzt<br />
werden.<br />
Soweit Teilnehmer in der Übung funktionale Sprachkenntnisse gem. Studienordnung<br />
nachweisen wollen, sind Grundkenntnisse des Russischen (nicht nur des Alph<strong>ab</strong>ets)<br />
erforderlich.<br />
Allen Teilnehmern steht die Möglichkeit eines allgemeinen Leistungsnachweises offen.<br />
Lit. zur Einführung entsprechende Kapitel im Handbuch der Geschichte Rußlands und bei<br />
Hildermeier, Manfred: Geschichte der Sowjetunion (1917-1991), München 1998.<br />
Modul Alte Geschichte<br />
Vorlesungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Norbert Ehrhardt<br />
081322 Vorlesung: Die griechische Staatenwelt im 5. Jahrhundert v. Chr.<br />
Fr 10-12, Raum: F 043, Beginn: 21.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
PD Dr. Johannes Engels<br />
081337 Vorlesung: Griechische Geschichte im Zeitalter Philipps II. und Alexander des<br />
Großen<br />
Mi 10-12, Raum: F 043, Beginn: 19.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Prof. Dr. Klaus Zimmermann<br />
081341 Vorlesung: Caesar und Augustus<br />
Mi 12-14, Raum: F 2 , Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Masterseminare<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Peter Funke<br />
081380 Oberseminar: Das Verhältnis von Religion und Politik im antiken Griechenland im<br />
Spiegel literarischer und epigraphischer Zeugnisse<br />
Mo 18-20, Raum: F 229, Fürstenberghaus, Domplatz 20-22, 2. OG, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Im Mittelpunkt des Oberseminars steht die Analyse des Verhältnisses von Religion und<br />
Politik im antiken Griechenland im Spiegel literarischer und epigraphischer Zeugnisse.<br />
Darüber hinaus besteht die Gelegenheit für Studierende und Doktoranden Abschlussarbeiten<br />
und laufende Forschungsvorh<strong>ab</strong>en zur Diskussion zu stellen.<br />
111
PROF. DR. NORBERT EHRHARDT<br />
081375 Oberseminar: Neue Quellen zur griechisch-römischen Welt<br />
Mi 15-16.30 (14 tg.), Raum: 254, Seminar für Alte Geschichte, Fürstenberghaus, Domplatz<br />
20-22, 2. OG, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Programm und Ablauf sollen in der ersten Sitzung mit den Teilnehmern <strong>ab</strong>gesprochen<br />
werden. – Rechtzeitige persönliche Anmeldung erforderlich.<br />
Kolloquium<br />
Lehrende des Seminars für Alte Geschichte<br />
081360 Forschungskolloquium des Seminars für Alte Geschichte<br />
Mi 20-22, Raum: siehe HISLSF<br />
Beginn und Programm: siehe gesonderte Anschläge sowie Internet!!<br />
Im Kolloquium sprechen auswärtige Gäste und Angehörige des Seminars und der anderen<br />
altertumswissenschaftlichen Institute zu aktuellen Problemen des Faches sowie der<br />
Nachbardisziplinen. Die Vortragsthemen und –termine werden jeweils mit Anschlägen und<br />
im Internet bekannt gemacht.<br />
Modul Mittelalterliche Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
081739 Vorlesung: Geschichte Spaniens im Mittelalter<br />
Di 10-12, Raum: F 2<br />
In der Mitte des 20. Jahrhunderts entstand – motiviert durch zeitgenössische Problemlagen –<br />
der Mythos vom vermeintlichen goldenen Zeitalter im mittelalterlichen Spanien, als Vertreter<br />
der drei monotheistischen Weltreligionen, also Juden, Christen und Muslime, in friedlichem<br />
Nebeneinander zusammengelebt hätten (convivencia). In der jüngeren Forschung ist dieses<br />
etwas einseitige Bild korrigiert worden, indem einerseits auf die tatsächlich nicht so seltenen<br />
Konflikte und andererseits auf die ideologischen Voraussetzungen und Implikationen dieser<br />
spezifischen Interpretation der spanischen Geschichte verwiesen wurde.<br />
Die Vorlesung stellt die Hauptepochen der mittelalterlichen spanischen Geschichte seit der<br />
westgotischen Spätantike vor und richtet das Augenmerk insbesondere auf das Verhältnis<br />
zwischen unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen sowie auf ihre jeweilige<br />
Bedeutung für die Konstruktion einer kohärenten Erzählung von einer „spanischen“<br />
Geschichte.<br />
Literatur: Herbers, Klaus, Geschichte Spaniens im Mittelalter. Vom Westgotenreich bis zum<br />
Ende des 15. Jahrhunderts, Stuttgart 2006; Vones, Ludwig, Geschichte der Iberischen<br />
Halbinsel im Mittelalter (711 - 1480). Reiche, Kronen, Regionen, Sigmaringen 1993;<br />
Walther, Helmut G., Der gescheiterte Dialog. Das ottonische Reich und der Islam, in:<br />
Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter (Miscellanea Medievalia 17), ed. Albert<br />
Zimmermann/Ingrid Craemer-Ruegenberg, Berlin/New York 1985, 20-44; Wasserstein,<br />
David J., The Caliphate in the West. An Islamic Political Institution on the Iberian Peninsula,<br />
Oxford 1993; Watt, W. Montgomery, A History of Islamic Spain, Edinburgh 1965.<br />
Masterseminare<br />
112
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Prof. Dr. Wolfram Drews<br />
082204 Masterseminar: Reconquista und Kreuzzüge<br />
Di 16-18, Raum: F 153<br />
Bald nach 711 wurden große Teile der Iberischen Halbinsel von muslimischen Truppen<br />
erobert; lediglich im Norden blieben einige Landstriche in christlicher Hand. Aus späterer<br />
Rückschau erschien es so, als hätte bald darauf die christliche „Rückeroberung“ des<br />
„verlorenen“ Gebietes begonnen. Die Forschung hat kontrovers darüber diskutiert, ob für die<br />
hiermit verbundenen militärischen Unternehmungen religiöse oder vielmehr nur politische<br />
oder auch ökonomische Gründe angenommen werden müssen. Erst mit der Entstehung der<br />
Kreuzzugsbewegung in Frankreich <strong>ab</strong> dem 11. Jahrhundert kam es verstärkt zur Teilnahme<br />
nichtspansicher Kämpfer an den Kriegszügen auf der Iberischen Halbinsel, was deren<br />
Charakter nachhaltig veränderte. Der päpstliche Kreuzzugs<strong>ab</strong>laß wurde auf Spanien<br />
übertragen, und hier entstanden eigene Ritterorden, die nicht nur militärische, sondern auch<br />
siedlungspolitische Aufg<strong>ab</strong>en übernahmen. Das Seminar behandelt Grundzüge der<br />
Ereignisgeschichte, was als Grundlage für die Diskussion unterschiedlicher<br />
Forschungspositionen zur Verhältnisbestimmung zwischen der (vermeintlichen) Reconquista<br />
und der vornehmlich französisch-päpstlichen Kreuzzugsideologie dient.<br />
Literatur: Bronisch, Alexander Pierre, Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des<br />
Krieges im christlichen Spanien von den Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert (Spanische<br />
Forschungen der Görres-Gesellschaft II/ 35), Münster 1998; Engels, Odilo, Reconquista und<br />
Landesherrschaft (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-<br />
Gesellschaft N. F. 53), Paderborn/München/Wien/Zürich 1989; Erdmann, Carl, Die<br />
Entstehung des Kreuzugsgedankens (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte 6),<br />
Stuttgart 1935, ND Darmstadt 1965; Forey, Alan J., The Military Religious Orders and the<br />
Spanish Reconquest in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Traditio 40 (1984), 197-234;<br />
Jaspert, Nikolas, Die Kreuzzüge, Darmstadt 2003; Lomax, Derek W., The Reconquest of<br />
Spain, London/ New York 1978; Schwenk, Bernd, Calatrava. Entstehung und Frühgeschichte<br />
eines spanischen Ritterordens zisterziensischer Observanz im 12. Jahrhundert (Spanische<br />
Forschungen der Görres-Gesellschaft II/ 28), Münster 1992.<br />
Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
082190 Masterseminar: Amor Patriae und Global History. Methoden der Mediävistik.<br />
Donnerstag 8-10, Raum: F 104, Beginn: 13.10. <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Unterschiedlichen gesellschaftlichen Absichten ist die Beschäftigung mit der mittelalterlichen<br />
Geschichte seit der Renaissance und bis zur modernen Gegenwart nutzbar gemacht worden.<br />
Wissenschaftliche Ansätze ihrer Erforschung h<strong>ab</strong>en sich in diesem Rahmen entwickelt und so<br />
dazu beigetragen, Bilder von Geschichte in der zeitgenössischen Gesellschaft zu generieren<br />
und Aussagen zu treffen zum Verhältnis der eigenen Zeit zu ihrer Vergangenheit. Daran hat<br />
sich bis heute grundsätzlich wenig geändert. Das Seminar will die Entwicklung der Methoden<br />
historischer Mediävistik vom 15. bis zum 21. Jahrhundert untersuchen und vergleichend<br />
analysieren. D<strong>ab</strong>ei wird ebenso von den Grundlagen der Quellenkritik und des historischen<br />
Positivismus zu sprechen sein wie von den Herausforderungen der modernen<br />
Kulturwissenschaften und den aktuellen Tendenzen einer Global History.<br />
Lit. Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte, Frankfurt/M. 2001; Lutz Raphael,<br />
Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme, München 2003; Werner Paravicini, Die<br />
Wahrheit der Historiker, München <strong>201</strong>0; Wolfram Drews, Transkulturelle Perspektiven in der<br />
mittelalterlilchen Historiographie, in: Historische Zeitschrift 292 (<strong><strong>201</strong>1</strong>), S. 31-59.<br />
113
Kolloquium<br />
Prof. Dr. Gerd Althoff, Prof. Dr. Wolfram Drews, Prof. Dr. Werner Freitag, Prof. Dr. Michael<br />
Grünbart, Prof. Dr. Martin Kintzinger<br />
082590 Kolloquium: 800-1800 Forschungskolloquium Mittelalter und Frühe Neuzeit<br />
Mi 18-20, Raum: F 102<br />
Modul zur Geschichte der Frühen Neuzeit<br />
Vorlesung<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Jun. Prof. Dr. Matthias Pohlig<br />
081762 Vorlesung: Öffentlichkeit in der Frühen Neuzeit<br />
Mi 10-12, Raum: H 2, Beginn: 12.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Öffentlichkeit ist ein zentrales Phänomen der Moderne – <strong>ab</strong>er auch der Vormoderne Zum<br />
Begriff der Öffentlichkeit gehört als Gegenbegriff einerseits die Privatheit, anderseits das<br />
Geheimnis. Was also kann man unter Öffentlichkeit verstehen – und hat sie eine Geschichte<br />
Die Vorlesung versucht zweierlei: Einerseits in die wichtigsten begrifflichen und<br />
methodischen Fragen einzuführen, die mit dem Problem der Öffentlichkeit verbunden sind.<br />
Zweitens soll die Öffentlichkeitsthematik genutzt werden, um über einen zentralen<br />
Themenbereich einen generellen Einblick in die frühneuzeitliche Geschichte von 1500 bis<br />
1800 zu bekommen – also sozusagen von der reformatorischen Öffentlichkeit bis zu den<br />
Geheimgesellschaften der Aufklärung. Dazu bietet sich das Thema Öffentlichkeit an, weil es<br />
mit allen wichtigen Bereichen frühneuzeitlicher Gesellschaft – Politik, Religion, Wirtschaft,<br />
Krieg, Bildung – aufs engste verknüpft ist.<br />
Einführende Literatur: Opgenoorth, Ernst, Publicum - privatum - arcanum. Ein Versuch zur<br />
Begrifflichkeit frühneuzeitlicher Kommunikationsgeschichte, in: Kommunikation und Medien<br />
in Preußen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, hg. v. Bernd Sösemann, Stuttgart 2002, 22-44<br />
Masterseminar<br />
Jun.Prof. Dr. André Krischer<br />
082223 Masterseminar „Von der Alten Stadt zu Metropole: London und der Wandel des<br />
Urbanen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert“<br />
Mi 16-18, Raum: F 153<br />
London erlebte zwischen 1500 und 1900 ein Bevölkerungswachstum wie keine andere Stadt<br />
im frühmodernen Europa: Von rund 50.000 zu über 5 Mio. Einwohnern. Im 19. Jahrhundert<br />
war London die größte Stadt der Welt. Für die Stadtgeschichtsschreibung stellt dieser Wandel<br />
eine besondere Herausforderung dar. Es geht nicht nur darum, die Veränderungen in<br />
sozialgeschichtlicher Perspektive nachzuvollziehen, sondern auch in kulturhistorischer Sicht:<br />
Wie erlebten und beschrieben die Zeitgenossen die Umbrüche Was war für sie eigentlich<br />
'London' Wie ließ sich der kaum mehr zu überschauende städtische Raum überhaupt noch als<br />
Einheit begreifen G<strong>ab</strong> es eine neue städtische Öffentlichkeit London war jener Ort, an dem<br />
sich die moderne Gesellschaft in ihren unterschiedlichen und widersprüchlichen Facetten<br />
ganz konkret ausdifferenzierte und d<strong>ab</strong>ei wirtschaftliche Prosperität, soziale Verwerfungen,<br />
Geistesfreiheit und politische Spannungen gleichzeitig zu integrieren hatte. Im Seminar<br />
wollen wir versuchen, diesen Wandel exemplarisch zu rekonstruieren, und zwar aus der<br />
114
Perspektive von Sozial-, Politik-, Rechts- , Kultur- und Mediengeschichte. Wir suchen nach<br />
Konzepten, um urbane Konfigurationen und deren Wandel zu erklären und fragen d<strong>ab</strong>ei auch<br />
bei der Stadt- und Raumsoziologie nach. Was besagt etwa der Begriff 'Metropole' Wir<br />
vergleichen London d<strong>ab</strong>ei auch mit anderen urbanen Formationen im frühmodernen Europa,<br />
mit anderen Großstädten wie Liss<strong>ab</strong>on und Paris ebenso wie mit Köln. Auf diese Weise<br />
wollen wir genauere Aufschlüsse darüber erhalten, ob und inwiefern die Geschichte Londons<br />
einen Sonderfall darstellt.<br />
Anforderungen: Essay und ggf. Hausarbeit, aktive Mitarbeit, selbständige Erarbeitung der<br />
wiss. Fragestellungen. Literatur und Quellen sind überwiegend fremdsprachig.<br />
Erste Literaturhinweise: Roy Porter: London: A Social History, London 1994; Francis<br />
Sheppard, London. A History, Oxford 1998; Peter Clark (Hg.): The Cambridge Urban History<br />
of Britain, Vol. II 1540-1840, Cambridge 2000, hier S. 315-346; Paul Griffiths /Mark Jenner<br />
(Hg.): Londinopolis: Essays in the cultural and social history of early modern London,<br />
Manchester 2000; Andreas Fahrmeier: Ehrbare Spekulanten. Stadtverfassung, Wirtschaft und<br />
Politik in der City of London (1688-1900), München 2003.<br />
Kolloquium<br />
Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger, Jun.prof. Dr. André Krischer, Jun.prof. Dr. Matthias<br />
Pohlig, apl. Prof. Dr. Michael Sikora<br />
082720 Forschungskolloquium Frühe Neuzeit<br />
Mi 18-20 Uhr, Raum: F 6<br />
Modul Osteuropäische Geschichte<br />
Vorlesung<br />
Dr. Martina Winkler<br />
081796 Vorlesung: Nationen und Nationalismus in Ostmitteleuropa<br />
Mo 10-12, Raum: F 5, Beginn: 17.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
„Nation“ ist ein klassisches, d<strong>ab</strong>ei nach wie vor aktuelles und vor allem hoch umstrittenes<br />
Thema für Historiker. Die Vorlesung führt ein in theoretische Fragen und Probleme und<br />
betrachtet die komplexen, ganz und gar nicht linearen Prozesse dessen, was viel zu<br />
vereinfachend „Nationsbildung“ genannt wird. D<strong>ab</strong>ei stehen die Entwicklungen in<br />
Ostmitteleuropa vom späten 18. bis ins 20. Jahrhundert im Mittelpunkt des Interesses.<br />
Einführende Literatur: Spencer, Philip (Hrsg.), Nations and Nationalism: A Reader, New<br />
Brunswick 2005; Puttkamer, Joachim von, Nationalismus in Ostmitteleuropa – eine<br />
Zwischenbilanz, in: http://www.zeitenblicke.de/2007/2/puttkamer/dippArticle.pdf<br />
Masterseminar<br />
Dr. Martina Winkler<br />
082219 Masterseminar: „Unter der gnädigen Herrschaft Ihrer überaus großherzigen<br />
Majestät“: Das Russländische Imperium, 16. -19. Jahrhundert<br />
Di 10-12, Raum: F 104, Beginn: 11.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Russländische Geschichte fand nicht nur in Moskau und St. Petersburg statt, sondern auch auf<br />
zentralasiatischen Baumwollfeldern, im „wilden“ Kaukasus und in den Dörfern aleutischer<br />
Robbenjäger. Wie man mit dieser Erkenntnis umgeht, weshalb das Imperium „russländisch“<br />
und nicht einfach „russisch“ heißt, warum man von einem „imperial turn“ spricht und wie er<br />
115
unseren Blick (nicht nur) auf die russische Geschichte verändert hat – diese Fragen stehen im<br />
Zentrum des Seminars. Wir werden uns beschäftigen mit den Wegen der Expansion und den<br />
Methoden imperialer Herrschaft, kultureller Vielfalt und imperialen Identitäten.<br />
Einführende Literatur: Kappeler, Andreas, Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung -<br />
Geschichte - Zerfall, München 2001.<br />
Kolloquium<br />
Prof.s Dr.s Rolf Ahmann, Heike Bungert, Thomas Großbölting, Silke Hensel, Franz-Werner<br />
Kersting, Bernd Walter, Martina Winkler<br />
Forschungskolloquium „Kommunikation über Gewalt“:<br />
Mi. 18-20 Uhr, Raum: F 4, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Modul: Geschichte der Amerikas<br />
Vorlesung<br />
Prof. Dr. Heike Bungert/Prof. Dr. Silke Hensel<br />
081781 Vorlesung: Begegnung zweier Welten Indianer in den Amerikas von der ersten<br />
Besiedlung bis heute<br />
Do 10-12, Raum: siehe HISLSF, Beginn: 13.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Die Entdeckung und Eroberung Amerikas durch Europäer im 15. Jahrhundert wurde lange<br />
Zeit als der Beginn der Geschichte des Kontinents gesehen. Tatsächlich war die indigene<br />
amerikanische Bevölkerung, von Kolumbus Indianer genannt, zwischen 15.000 und 10.000<br />
u.Z. eingewandert, und es waren unterschiedlichste Gesellschaften entstanden. Seit den<br />
europäischen Eroberungen wurde die indigene Bevölkerung stark dezimiert und verlor -- nach<br />
wirtschaftlichen und kulturellen Interaktionen -- trotz vielfältiger Widerstandshandlungen für<br />
mehrere Jahrhunderte jegliche Souveränität. Die Vorlesung will beginnend in der<br />
vorkolonialen Zeit bis ins 21. Jahrhundert die indigene Bevölkerung in den Blick nehmen und<br />
die jeweils für Latein- und Nordamerika besonderen politischen, sozialen, wirtschaftlichen<br />
und kulturellen Entwicklungen untersuchen. Zentral d<strong>ab</strong>ei wird es sein, die Angehörigen<br />
dieser Bevölkerungsgruppen als Akteure der Geschichte ernst zu nehmen. Zudem werden<br />
Ähnlichkeiten, Unterschiede und transnationale Verflechtungen zwischen Indianern in Nordund<br />
Südamerika herausgearbeitet.<br />
Literatur: George A. Collier (Hg.), The Inca and Aztec States, 1400-1800, New York 1982; R.<br />
David Edmunds et al., The People: A History of Native America, New York 2006; Roger L.<br />
Nichols, American Indians in U.S. History. Norman, OK, 2003; Wolfgang Lindig, Mark<br />
Münzel, Die Indianer: Kulturen und Geschichte, München 1992; Greg J. S. Urban, Nation-<br />
States and Indians in Latin America, Austin 1991.<br />
Seminare<br />
Prof. Dr. Heike Bungert/Prof. Dr. Silke Hensel<br />
082238 Masterseminar: Nation und Nationalismus in den Amerikas<br />
Mi 14-16, Raum: F 102, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Nationen stellen bis heute eine wichtige Einheit im globalen Geschehen dar. Sie sind d<strong>ab</strong>ei<br />
allerdings ein relativ junges Phänomen, das erst im 18. Jahrhundert mit der USamerikanischen<br />
Un<strong>ab</strong>hängigkeit und der französischen Revolution in Erscheinung trat.<br />
Anders als auch in der Geschichtswissenschaft lange angenommen, stellten Nationalismen<br />
116
keine der Nation nachgeordnete Entwicklung dar, sondern gingen ihr vielmehr auch voran<br />
und trugen zur Ausbildung von Wir-Gruppen auf der Basis einer geteilten Nationalität bei.<br />
Wie allerdings diese Nation aussah bzw. aussehen sollte, hing von den jeweiligen historischen<br />
Umständen <strong>ab</strong>. Das Seminar will nach einer Erarbeitung der theoretischen Grundlagen anhand<br />
von Beispielen aus der lateinamerikanischen und nordamerikanischen Geschichte die<br />
Entstehungsprozesse von Nationen ebenso wie die beständige Neuaushandlung ihres<br />
konkreten Inhalts, die Inklusions- und Exklusionsmechanismen in Bezug auf andere ethnische<br />
Gruppen beleuchten.<br />
Ein Großteil der Lektüre besteht aus englischsprachigen Texten. Um Anmeldung im<br />
Sekretariat der Abteilung Außereuropäische und Nordamerikanische Geschichte (F-Haus,<br />
Raum 123) wird gebeten.<br />
Literatur: Nancy P. Appelbaum et al. (Hg.), Race and Nation in Modern Latin America,<br />
Chapel Hill 2003. Sara Castro-Klarén, John Ch. Chasteen (Hg.), Beyond Imagined<br />
Communities: Reading and Writing the Nation in Nineteenth-Century Latin America, London<br />
2003. Nicole Miller, The Historiography of Nationalism and Nation Identity in Latin<br />
America, in Nations and Nationalism 12,2 (2006), S. <strong>201</strong>-221; Don H. Doyle and Marco<br />
Antonio Pamplona (Hg.): Nationalism in the New World, Athens, Ga. 2006; John E. Bodnar<br />
(Hg.), Bonds of Affection: Americans Define their Patriotism, Princeton, NJ, 1996; David<br />
Waldstreicher, In the Midst of Perpetual Fetes: The Making of American Nationalism, Chapel<br />
Hill, NC, 1997; Wilbur Zelinsky, Nation into State: The Shifting Symbolic Foundations of<br />
American Nationalism, Chapel Hill, NC, 1988.<br />
Kolloquium<br />
Prof.s Dr.s Rolf Ahmann, Heike Bungert, Thomas Großbölting, Silke Hensel, Franz-Werner<br />
Kersting, Bernd Walter, Martina Winkler<br />
Forschungskolloquium „Kommunikation über Gewalt“<br />
Mi. 18-20 Uhr, Raum: F 4, Beginn 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Mastermodul Wirtschaftsgeschichte (19./20. Jahrhundert)<br />
Vorlesung<br />
Jun. Prof. Dr. Martin Uebele<br />
081800 Vorlesung: Geschichte der Globalisierung seit 1850<br />
Di 14-16, Raum: F 2, Fürstenberghaus; Beginn: 2. Vorlesungswoche<br />
Die „Globalisierung“ beginnt in den meisten Köpfen in der frühen Nachkriegszeit.<br />
Tatsächlich ist <strong>ab</strong>er schon um die Mitte des 19. Jh. ein deutlicher Aufschwung des<br />
internationalen Handels sowie der grenzüberschreitenden Mobilität von Arbeit und Kapital<br />
festzustellen. Die Jahre 1850–1913 werden daher gelegentlich als die „Erste Globalisierung“<br />
bezeichnet. Zwischen dieser und der „Zweiten Globalisierung“ liegt eine Periode der De-<br />
Globalisierung, die in der Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929–1932 gipfelte. Die Vorlesung<br />
behandelt Güterhandel, Finanzströme und Arbeitsmigration seit der ersten Hälfte des 19. Jh.<br />
bis ca. 1990. Beschreibung und Analyse der internationalen Wirtschaftsbeziehungen<br />
beinhalten u. a. die Rolle von Wechselkursregimen wie z. B. den Goldstandard. Für den<br />
Güterhandel und Migration wird die Rolle von Transportinfrastruktur diskutiert sowie relative<br />
Faktorpreise. Schließlich werden auch die Folgen internationalen Handels für<br />
Wirtschaftswachstum (Konvergenz von Pro-Kopf-Einkommen) und die weltweite<br />
Wohlfahrtsverteilung erörtert.<br />
117
Literatur: Foreman-Peck, James: A history of the world economy. International economic<br />
relations since 1850, Brighton 1995; O‟Rourke, Kevin H. und Jeffrey Williamson:<br />
Globalization and history. The evolution of a nineteen-century Atlantic economy, Cambridge,<br />
Mass. 1999; Broadberry, Stephen N. (Hrsg.): The Cambridge economic history of modern<br />
Europe, Bd. 2, Cambridge: <strong>201</strong>0; Pfister, Ulrich: Globalisierung und Weltwirtschaft, S. 277–<br />
336 in: WBG Weltgeschichte, Bd. 6, Darmstadt: <strong>201</strong>0.<br />
Masterseminar<br />
Prof. Dr. Ulrich Pfister, Jun. Prof. Dr. Martin Uebele<br />
082147 Seminar: Wenn Staaten Pleite gehen - Kapitalmärkte und Zahlungsprobleme<br />
souveräner Schuldner seit 1850<br />
Mi 8-10, Raum: F 102, Beginn: 19.10.<strong><strong>201</strong>1</strong><br />
Beim Schreiben dieser Zeilen (Mai <strong><strong>201</strong>1</strong>) schaut die Welt gebannt nach Griechenland und<br />
fragt sich, ob das Land in der nächsten Zeit seine Schulden umstrukturieren muss oder nicht.<br />
Im ersteren Fall wäre es nach 1826, 1893 und 1932 das vierte Mal in seiner Geschichte.<br />
Zahlungsschwierigkeiten souveräner Schuldner sind eine wichtige Begleiterscheinung<br />
globalisierter Finanzmärkte seit der Entfaltung der Weltwirtschaft <strong>ab</strong> dem 19. Jh. Das<br />
Hauptseminar behandelt das derzeit höchst aktuelle Thema aus historischer Sicht. Im Zentrum<br />
stehen folgende Aspekte: Formen und Gründe von Zahlungsschwierigkeiten; Folgen von<br />
Zahlungsschwierigkeiten souveräner Schuldner für die betroffenen Länder und das weltweite<br />
Finanzsystem; Formen der Schuldenregelungsmechanismen.<br />
Literaturhinweise: James Foreman-Peck, A history of the world economy. International<br />
economic relations since 1850, Brighton 1995; Ulrich Pfister, Globalisierung und<br />
Weltwirtschaft, S. 277–336 in: WBG Weltgeschichte, Bd. 6, Darmstadt <strong>201</strong>0; Carmen<br />
Reinhart / Kenneth S. Rogoff, This time is different. Eight centuries of financial folly,<br />
Princeton 2009; Christian Suter, Schuldenzyklen in der Dritten Welt. Kreditaufnahme,<br />
Zahlungskrisen und Schuldenregelungen peripherer Länder im Weltsystem von 1820 bis<br />
1986, Frankfurt a. M. 1990.<br />
Übungen<br />
Alternativ sind folgende Veranstaltungen wählbar:<br />
Jun. Prof. Dr. Martin Uebele<br />
082458 Übung: Ausgewählte Kapitel der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20.<br />
Jahrhunderts",<br />
Mo 14:00-16:00, Raum: F 153 (teilweise PC-Pool Wiwi 1 im Juridikum), Beginn: 2.<br />
Vorlesungswoche<br />
Die Übung vermittelt erstens die Fähigkeit, sich eigenständig mit aktuellen<br />
Forschungsergebnissen des Fachgebiets auseinanderzusetzen. Aktuelle Forschungsarbeiten<br />
werden in Referaten vorgestellt und anschließend diskutiert. Vor allem sollen<br />
englischsprachige Texte, die wirtschaftswissenschaftlich und historisch argumentieren und<br />
ökonomische Methoden verwenden, diskutiert werden. Zweitens werden auch praktische<br />
Übungen zur quantitativen Analyse von historischen Daten im PC-Pool vermittelt.<br />
Grundkenntnisse der Volkswirtschaftslehre und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit<br />
englischsprachigen Texten sind daher Teilnahmevoraussetzungen. Inhaltliche Schwerpunkte<br />
sind Handel und Marktintegration im 19. Jahrhundert sowie die Rolle von Finanzsystemen für<br />
das Wirtschaftswachstum. Die Übung wird interdisziplinär für Studierende der<br />
Wirtschaftswissenschaften und der Geschichte angeboten. Für einen Teilnahmeschein oder 2<br />
118
LP mit Note sind regelmäßig aktive Mitarbeit und ein Referat oder eine ca. sechsseitige<br />
Skizze eines empirischen Projektes nötig.<br />
On request the course may be given in English. The course outline is avail<strong>ab</strong>le in English<br />
from the course leader.<br />
Literatur: Feinstein, Charles H. and Mark Thomas (2002): Making History Count. A Primer in<br />
Quantitative Methods for Historians.<br />
119
DIDAKTIK DER GESCHICHTE<br />
1. Vorlesungen<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083416 Geschichte in Film und Fernsehen. Chancen und Grenzen für historisches<br />
Lernen<br />
Do 12-14, Raum: S 10, Beginn 20.10.11<br />
Filme prägen unsere Vorstellungen von Geschichte und das Fernsehen erreicht mit<br />
historischen Sendeformaten ein Millionenpublikum und formt somit in der<br />
Mediengesellschaft das Geschichtsbewusstsein großer Teile der Bevölkerung. Überzeugungen<br />
wie diese scheinen weit verbreitet und lösen reflexartig Kritik an Formen und Inhalten<br />
massenmedialer Vermittlung von Geschichte aus. Die wissenschaftsförmigen Kritikpunkte<br />
sind fast schon zu einem Kanon geronnen: Film erzählt fertige Geschichten und generiert<br />
durch Emotionalisierung, Dramatisierung, Personalisierung und vor allem durch<br />
Visualisierung wirkmächtige Geschichtsbilder. Diese Vorbehalte gegen den Film sind so alt<br />
wie das Medium selbst und sie spiegeln nicht zuletzt Modi der Grenzziehung zwischen einem<br />
wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Umgang mit Geschichte. Damit soll jedoch<br />
keinesfalls die geschichtskulturelle Bedeutung des Mediums nivelliert werden, vielmehr<br />
bilden diese Überlegungen den Ausgangspunkt sich mit dem Film als Medium und dem<br />
Fernsehen als Institution der Geschichtskultur in systematisierender Absicht<br />
auseinandersetzen und geschichtswissenschaftliche und geschichtsdidaktische Potentiale zu<br />
diskutieren. Ausgehend von typologischen Überlegungen zu filmischen und televisuellen<br />
Inszenierungen von Geschichte werden Filme als historische Quellen und Darstellungen in<br />
exemplarischen Zugriffen untersucht, geschichtswissenschaftlich und geschichtsdidaktisch<br />
relevante Methoden der Filmanalyse vorgestellt, Untersuchungen zu Filmwirkungen diskutiert<br />
und letztlich auch Methoden unterrichtlicher Filmarbeit problematisiert. In diesem Sinne<br />
bietet die Vorlesung einen Einblick in zentrale Fragen der geschichtswissenschaftlich und<br />
geschichtsdidaktisch relevanten Arbeit mit Filmen und betrachtet gleichrangig die<br />
geschichtskulturellen Funktionen des Fernsehens in der Mediengesellschaft.<br />
Literatur: Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. 3. Aufl., Stuttgart 2001. Werner<br />
Faulstich: Grundkurs Filmanalyse. 2. Aufl., Paderborn 2008. Thomas Fischer/Rainer Wirtz<br />
(Hrsg.): Alles authentisch Popularisierung der Geschichte im Fernsehen. Konstanz 2008.<br />
Waltraud Wara Wende: Filme, die Geschichte(n) erzählen. Filmanalyse als<br />
Medienkulturanalyse. Würzburg <strong><strong>201</strong>1</strong>. Alan S. Marcus: Celloid Blackboard. Teaching History<br />
with Film. NC 2008. Marnie Hughes-Warrington: History Goes to the Movies. Studying<br />
History on Film. London/New York 2007.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
2. Proseminare<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083492 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Di 16-18, Raum: 309, Beginn: 18.10.11<br />
120
Das Proseminar vermittelt einen einführenden Überblick über die Aufg<strong>ab</strong>en und<br />
Arbeitsbereiche der Geschichtsdidaktik. Es behandelt theoretische, empirische und<br />
pragmatische Fragestellungen, setzt <strong>ab</strong>er einen klaren Schwerpunkt im Bereich der<br />
schulischen Geschichtsvermittlung und den dafür maßgeblichen geschichtsdidaktischen<br />
Positionen. Darüber hinaus erfüllt die Veranstaltung eine propädeutische Funktion, indem sie<br />
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit fachspezifischen Arbeitstechniken vertraut macht<br />
und sie in die Benutzung der einschlägigen Handbücher, Kompendien und Periodica einweist.<br />
Literatur: Hilke Günther-Arndt (Hrsg.): Geschichts-Didaktik. Praxishandbuch für die<br />
Sekundarstufe I und II. 2. Aufl. Berlin 2005; Marko Demantowsky/Bernd Schönemann<br />
(Hrsg.): Neue geschichtsdidaktische Positionen. 3. Aufl. Bochum, Freiburg 2007.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083511 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Di 8.30-10, Raum: 309, Beginn: 18.10.11<br />
Im Proseminar wird eine Einführung in die wesentlichen Arbeitsbereiche (Theorie, Empirie,<br />
Pragmatik) der Geschichtsdidaktik gegeben. Neben außerschulischen Aspekten von<br />
Geschichtskultur geht es vor allem um den Bereich der schulischen Geschichtsvermittlung<br />
und die dafür maßgeblichen geschichtsdidaktischen Positionen, Konzepte, Methoden und<br />
Medien. In diesem Zusammenhang werden auch die einschlägigen Handbücher, Lexika und<br />
Fachzeitschriften vorgestellt.<br />
Literatur: Hilke Günther-Arndt (Hrsg.): Geschichts-Didaktik. Praxishandbuch für die<br />
Sekundarstufe I und II. 3. Aufl. Berlin 2008; Hilke Günther-Arndt (Hrsg.): Geschichts-<br />
Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin 2007; Ulrich Mayer u.a. (Hrsg.):<br />
Wörterbuch Geschichtsdidaktik. 2., überarb. u. erw. Aufl. Schwalbach/Ts. 2009; Ulrich<br />
Mayer/Hans-Jürgen Pandel/Gerhard Schneider (Hrsg.): Handbuch Methoden im<br />
Geschichtsunterricht. 2., überarb. Aufl. Schwalbach/Ts. 2007; Hans-Jürgen Pandel/Gerhard<br />
Schneider (Hrsg.): Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. 4. Aufl. Schwalbach/Ts. 2007.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083640 Einführung in die Didaktik der Geschichte<br />
Do 10-12, Raum: 304, Beginn: 20.10.11<br />
Ausgehend von den Erfahrungen und Vorstellungen der TeilnehmerInnen mit bzw. zur<br />
Geschichtsdidaktik sollen diese im Verlaufe des Seminars überprüft, vertieft und erweitert<br />
werden. Wenngleich die Praxis der Geschichtsvermittlung ein wesentlicher Bestandteil des<br />
Seminars sein wird, kann eine Beschäftigung mit ihr nicht ohne theoretische Grundkenntnisse<br />
geschehen, die gerade für das spätere Berufsleben und das Referendariat von nicht zu<br />
überschätzender Bedeutung sind, da beides auf der vertieften Kenntnis dieses Bereichs fußt<br />
und sich dort sonst erst mühsam angeeignet werden muss.<br />
In einem zweiten Teil werden die hier gewonnenen Erkenntnisse auf praktische Bereiche der<br />
Geschichtsvermittlung angewendet und teilweise auch erprobt werden. Hierfür werden die<br />
SeminarteilnehmerInnen gehalten, zu von Ihnen selbst bestimmten Schwerpunkten aus den<br />
121
Bereichen der Praxis der Geschichtsvermittlung in Kleingruppen eigenständig Sitzungen zu<br />
planen, zu gestalten und auch durchzuführen.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
3. Hauptseminare<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083420 Filmanalyse im Geschichtsunterricht<br />
14-tägig, Di 14-17, Raum: 304, Beginn: 18.10.11<br />
Empirische Untersuchungen zeigen, dass sich Filme als Medien historischen Lernens bei<br />
Schülerinnen und Schülern größter Beliebtheit erfreuen. Ebenso unstrittig ist die<br />
geschichtskulturelle Bedeutung historischer Filme. Als Medien historischen Lernens bieten<br />
sie zweifellos die Chance, für Geschichte zu begeistern und komplexe Zusammenhänge zu<br />
erzählen. Doch jenseits der Veranschaulichung gehört es zu den Zielen eines modernen<br />
Geschichtsunterrichts, Einsichten in die Konstruktionsprinzipien filmischer Inszenierungen zu<br />
vermitteln, immanente Geschichtsbilder zu hinterfragen und filmische Quellen kritisch zu<br />
analysieren. Anliegen des Seminars ist es, Lernziele im Umgang mit historischen Filmen und<br />
Filmdokumenten zu diskutieren, Methoden der Filmanalyse an ausgewählten Filmgattungen<br />
zu erproben und eigenständig Modelle zur Filmarbeit im Unterricht zu entwickeln. Als<br />
Voraussetzung für eine Teilnahme am Seminar ist der Besuch der Vorlesung „Geschichte in<br />
Film und Fernsehen. Chancen und Grenzen für historisches Lernen“ wünschenswert. Zudem<br />
wird die Teilnahme an der Exkursion „Film im Museum. Museumspädagogische Konzepte<br />
der Filmarbeit im Vergleich“ empfohlen. Diese Exkursion kann auch als Übung angerechnet<br />
werden.<br />
Literatur: Waltraud Schreiber/Anna Wenzl (Hgg.): Geschichte im Film. Beiträge zur<br />
Förderung historischer Kompetenz. Neuried 2006. Knut Hickethier: Film- und<br />
Fernsehanalyse. 3. Aufl., Stuttgart 2001. Werner Faulstich: Grundkurs Filmanalyse. 2. Aufl.,<br />
Paderborn 2008. Gerhard Schneider: Filme. In: Hans-Jürgen Pandel/Gerhard Schneider<br />
(Hrsg.): Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. 3. Aufl., Schwalbach/Ts. 2005, S. 365-<br />
386.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083435 Was Schüler wirklich sehen! Empirische Erkundungen zum Filmverstehen<br />
Di 8-10, Raum: 304, Beginn: 18.10.11<br />
‚Filme prägen das Geschichtsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler nachhaltiger als jeder<br />
Geschichtsunterricht‟ – Überzeugungen wie diese finden sich immer wieder. Doch halten sie<br />
einer empirischen Überprüfung stand Was lernen Schülerinnen und Schüler, wenn sie Filme<br />
sehen Empirisch fundierte Antworten auf diese sehr komplexe Frage sind rar. Auf der<br />
Grundlage vorliegender empirischer Befunde und theoretischer Überlegungen zur Prozessen<br />
der Filmrezeption sollen die Teilnehmer des Seminars Untersuchungsdesigns zur explorativen<br />
Erkundung filmischer Rezeptionsprozesse entwickeln und in Gruppen kleinere empirische<br />
Untersuchungen in unterschiedlichen Schulformen durchführen. Interesse an eigenständiger<br />
Forschungsarbeit und ggf. schon Erfahrung in der Durchführung empirischer Projekte im<br />
Bereich der Lehr- und Lernforschung sind wünschenswert.<br />
122
Literatur: Peter Strittmatter: Wissenserwerb mit Bildern bei Film und Fernsehen. In: Bernd<br />
Weidenmann (Hrsg.): Wissenserwerb mit Bildern. Instruktionale Bilder in Printmedien, Film,<br />
Video und Computerprogrammen. Bern u.a. 1994, S. 177-193. Marco Dohle/Werner<br />
Wirth/Peter Vorderer: Emotionalisierte Aufklärung. Eine empirische Untersuchung zur<br />
Wirkung der Fernsehserie „Holokaust“ auf antisemitisch geprägte Einstellungen. In:<br />
Publizistik 48(2003)3, S. 288-309. Alan S. Marcus: Celloid Blackboard. Teaching History<br />
with Film. NC 2008. Alexander Geimer: Filmrezeption und Filmaneignung. Eine qualitativrekonstruktive<br />
Studie über Praktiken der Rezeption bei Jugendlichen. Wiesbaden <strong>201</strong>0.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083488 Erkundender Geschichtsunterricht: historisches Lernen in Museen und<br />
Gedenkstätten<br />
Do 16-18, Raum: 309, Beginn: 20.10.11<br />
Erkundender Geschichtsunterricht ist ein geschichtsdidaktisches Lehr-Lernkonzept mit drei<br />
Hauptmerkmalen: Erstens wird die Schule verlassen und ein außerschulischer Lernort<br />
aufgesucht; zweitens begegnen die Schülerinnen und Schüler originalen Quellen und arbeiten<br />
mit ihnen; drittens können sie Realerfahrungen mit geschichtskulturellen Institutionen<br />
sammeln. Das Hauptseminar konkretisiert dieses Konzept am Beispiel der beiden<br />
Institutionen Museum und Gedenkstätte. Schwerpunkte bilden jeweils die Genese der<br />
Institution, ihre Typologie und ihr pädagogisches Programm. Ein besonderer Akzent liegt auf<br />
dem Zusammenhang von schulischem historischen Lernen und außerschulischer<br />
Geschichtskultur.<br />
Literatur: Hilke Günther-Arndt (Hrsg.): Geschichts-Methodik. Handbuch für die<br />
Sekundarstufe I und II. Berlin 2007, S. 119-147; Hildegard Vieregg: Geschichte des<br />
Museums. Eine Einführung. München 2008; Hannelore Kunz-Ott (Hrsg.): Museum und<br />
Schule. Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft. München, Berlin 2005; Klaus Ahlheim<br />
u.a.: Gedenkstättenfahrten. Handreichung für Schule, Jugend- und Erwachsenenbildung in<br />
Nordrhein-Westfalen. Schwalbach/Ts. 2004.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083473 Raum als Kategorie der Geschichtsdidaktik: unterrichtliche und geschichtskulturelle<br />
Aspekte<br />
Di 12-14, Raum: 309, Beginn: 18.10.11<br />
Geschichte als Rekonstruktion von Vergangenheit hat immer auch eine räumliche Dimension,<br />
die im Unterschied zur zeitlichen Dimension jedoch häufig unterschätzt wird.<br />
Die Veranstaltung will dem entgegenarbeiten, indem sie zwei Schwerpunkte setzt: Erstens<br />
befasst sie sich mit der Bedeutung des Raumes für die inhaltliche, mediale und methodische<br />
Gestaltung des Geschichtsunterrichts. D<strong>ab</strong>ei geht es nicht nur um die angemessene<br />
Berücksichtigung des historisch-politischen Raumspektrums, das von der Lokal- über die<br />
Regional- und Landesgeschichte, die Nationalgeschichte, die europäische und<br />
außereuropäische Geschichte bis hin zur Weltgeschichte reicht, sondern auch um den Einsatz<br />
von Geschichtskarten und die Arbeit mit ihnen. Der zweite Schwerpunkt richtet sich auf die<br />
geschichtskulturelle Imprägnierung von Räumen, fragt also danach, wie historische<br />
123
Sinnbildungen und Deutungen in topographische Räume eingeschrieben werden: durch<br />
Benennungen von Straßen und Plätzen, durch Stolpersteine, durch Denkmäler oder durch die<br />
Schaffung komplexer Erinnerungs- bzw. Gedenkorte.<br />
Literatur: Hans Georg Kirchhoff (Hrsg.): Raum als geschichtsdidaktische Kategorie. Bochum<br />
1987; Christina Böttcher: Umgang mit Karten. In: Ulrich Mayer u.a. (Hrsg.): Handbuch<br />
Methoden im Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2004, S. 225-254; Saskia Handro/Bernd<br />
Schönemann (Hrsg.): Orte historischen Lernens. Berlin 2008; Christoph Markschies/Hubert<br />
Wolf (Hrsg.): Erinnerungsorte des Christentums. München <strong>201</strong>0.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083530 Bilder und Historisches Lernen: Theorie – Empirie – Pragmatik<br />
Di 18-20, Raum: 309, Beginn: 18.10.11<br />
Bilder sind in den vergangenen Jahren zunehmend zum Gegenstand historischer und<br />
geschichtsdidaktischer Forschung geworden. Ihre Relevanz für Wissenschaft und Unterricht<br />
wird inzwischen kaum noch bestritten. Ziel des Seminars ist zunächst die theoretische<br />
Auseinandersetzung mit verschiedenen Bildbegriffen und Modellen der Bildinterpretation<br />
sowie die exemplarische Analyse ausgewählter „Schlüsselbilder“ des 20. Jahrhunderts.<br />
Danach sollen empirische Befunde zu historischen Lernprozessen mit Bildquellen diskutiert<br />
werden. Und schließlich geht es um eine kritische Beurteilung methodischer Figuren der<br />
„Bildarbeit“ im Geschichts- bzw. Sachunterricht.<br />
Literatur: Saskia Handro/Bernd Schönemann (Hrsg.): Visualität und Geschichte. Berlin <strong><strong>201</strong>1</strong><br />
(Geschichtskultur und historisches Lernen, Bd. 1); Hans-Jürgen Pandel: Bildinterpretation.<br />
Die Bildquelle im Geschichtsunterricht. Bildinterpretation I. 2. Aufl. Schwalbach/Ts. <strong><strong>201</strong>1</strong>;<br />
Gerhard Paul (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bd. II: 1949 bis heute. Bonn 2008; Michael<br />
Sauer: Bilder im Geschichtsunterricht. Typen – Interpretationsmethoden –<br />
Unterrichtsverfahren. 3. Aufl. Seelze-Velber 2007; Martin Schulz: Ordnungen der Bilder.<br />
Eine Einführung in die Bildwissenschaft. München 2005.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083564 Geschichts- (und Politik)-unterricht zwischen Kompetenzorientierung und<br />
Inhaltsfixierung<br />
Mo. 10-12, Raum: 309, Beginn: 17.10.11<br />
„Viel zu wissen ist zu wenig“. Mit diesen Worten hat Hans-Jürgen Pandel kürzlich prägnant<br />
darauf hingewiesen, dass sich guter Geschichtsunterricht nicht auf die Vermittlung<br />
festgeschriebener Inhalte und kanonisierter Wissensbestände beschränken könne, sondern<br />
dass es im Kern auf die Vermittlung historischer Kompetenzen ankomme. Nach Jahren einer<br />
z.T. recht eindimensional geführten Kompetenzdebatte herrscht allerdings nach wie vor oft<br />
Ratlosigkeit: Wie lässt sich der Kompetenzbegriff angemessen definieren Inwieweit lassen<br />
sich einzelne Domänen (z.B. Geschichte und Politik) sinnvoll voneinander <strong>ab</strong>grenzen<br />
Welche Kompetenzbereiche lassen sich theoretisch modellieren und – vor allem – empirisch<br />
validieren In welchem Verhältnis stehen Inhalte, Wissen und Kompetenzen Wie kann man<br />
kompetenzorientiert unterrichten Und welche Lehrerkompetenzen sind dazu erforderlich<br />
124
Das Ziel des Hauptseminars besteht zunächst darin, diese Fragen in fachspezifischen und<br />
fachübergreifenden Zugriffen theoretisch zu diskutieren. Danach geht es um die Erörterung<br />
(wenn möglich: auch eigene Erhebung) empirischer Befunde. Und schließlich sollen<br />
forschungs- sowie unterrichtspragmatische Konsequenzen zur Diskussion gestellt werden.<br />
Literatur: Eine Literaturliste kann beim Dozenten per Mail angefordert werden.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083655 Herausforderung Holocaust<br />
Do 8 - 10, Raum: 304, Beginn: 20.10.11<br />
Der Holocaust gilt als Zivilisationsbruch schlechthin. Adornos Diktum, die ‚allererste<br />
Aufg<strong>ab</strong>e von Bildung sei es, dass Auschwitz nie wieder geschehe„ kann angesichts der<br />
Unfassbarkeit dieses Verbrechens kaum verwundern. Gleichzeitig <strong>ab</strong>er sind viele Aspekte<br />
einer solchen ‚Holocaust-Erziehung„ umstritten bzw. werden durchaus kontrovers gesehen:<br />
Erinnerung und Wiedergutmachung, Schuld und Verantwortung der heutigen Generation, die<br />
Gefahr einer ‚Übersättigung„, die Undarstellbarkeit der Todeserfahrungen, <strong>ab</strong>er auch ob der<br />
Holocaust ein Thema schon für die Grundschule sein darf, kann oder sogar muss.<br />
Das Seminar wird sich zunächst den historischen Rahmenbedingungen widmen, und<br />
anschließend den gegenwärtigen geschichtskulturellen Umgang mit dem Holocaust<br />
thematisieren (Spielfilme, Dokumentationen, Gedenkstätten etc.), um die gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen differenziert in den Blick zu nehmen. Anschließend sollen speziell auf<br />
die Schule bezogene <strong>ab</strong>er auch geschichtskulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche<br />
einer kritischen Analyse unterzogen werden. Auf der Grundlage hieraus gewonnener<br />
Erkenntnisse sollen eigene Zugänge und Angebote zur Darstellungen des Holocaust<br />
entwickelt und wenigstens in Ansätzen auch umgesetzt werden.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Ulrich Kröll<br />
083856 Digitale Medien zur Regionalgeschichte<br />
Mi 16-18 , Raum: 309, Beginn: 12.10.11<br />
Vor dem Hintergrund einer Regionalgeschichte des Münsterlandes untersucht die<br />
Veranstaltung audiovisuelle Medien zur Geschichte der Region, die heute in aller Regel in<br />
digitaler Form vorliegen. Es sind dies historische Film-Dokumente, ältere und jüngere<br />
historische Spielfilme sowie historische Dokumentationen. Einige der Dokumentationen zu<br />
regionalhistorischen Themen, so die vom Westfälischen Landesmedienzentrum, sind<br />
ausdrücklich für den schulischen Gebrauch konzipiert, beispielsweise mit zusätzlichen<br />
Arbeits- und Aufg<strong>ab</strong>enblättern. Ziel der Veranstaltung ist es, zu herausragenden Themen der<br />
Geschichte des Münsterlandes das audiovisuelle Angebot zu sichten und zu analysieren – und<br />
damit Kriterien einer Medienkompetenz zur Lokal- und Regionalgeschichte im Unterricht zu<br />
entwickeln. Auch einige CD-ROM-Entwicklungen und digitale Lernspiele sollen in die<br />
Untersuchung einbezogen werden.<br />
Die Möglichkeiten, mit Schülern selbst historische Dokumentationen zu gestalten, sollen an<br />
1-2 Bespielen vorgeführt werden.<br />
Im Rahmen der Seminarzeit ist ein Informationsbesuch im Westfälischen<br />
Landesmedienzentrum in Münster vorgesehen.<br />
125
In der Veranstaltung können Teilnahmenachweise und Leistungsnachweise erworben werden.<br />
Die Veranstaltung ist Grundlage für eine mögliche Modulprüfung.<br />
Literatur: Ulrich Kröll: Das Geschichtsbuch des Münsterlandes. Münster <strong>201</strong>0 (Agenda<br />
Verlag); Ulrich Kröll: Digitale Werkstatt für Geschichtspädagogen. Mit Neuen Medien<br />
Geschichte lehren und lernen. Münster 2007 (ZfL-Digital Nr. 3)<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Wilhelm Pohlkamp<br />
083507 Familie im Mittelalter<br />
Di 14-16, Raum: 309, Beginn: 18.10.11<br />
Untersuchungen zur Geschichte der (mittelalterlichen) Familie sind ohne persönliche<br />
Betroffenheit durch eigenes Erleben nicht, zumindest <strong>ab</strong>er schwer denkbar. Un<strong>ab</strong>hängig<br />
davon, ob man die aktuellen Krisendiagnosen vom Untergang oder vom ‚Auslaufen‟ der<br />
klassischen Lebensform Familie teilt oder nicht, sind Zweifel darüber, ob die Kernaspekte<br />
‚heterosexuelles Paar‟ (Paarbeziehung) und ‚Generation‟ (Eltern-Kind-Beziehung) noch<br />
unangefochten klassische Rahmendaten der Lebensform Familie sind, kaum mehr zu<br />
verdrängen. Hier können Historiker aktuelle Diskussionen dadurch versachlichen helfen, dass<br />
sie nachdrücklich das ‚Gewordensein‟ und somit die ‚Veränderbarkeit‟ scheinbar ‚natürlicher‟<br />
und ‚überzeitlicher‟ Formen des familiären Zusammenlebens aufzeigen. Didaktisch zielt dies<br />
auf eine gegenwartsbezogene und problemorientierte (Sozial- oder Kultur-) Geschichte der<br />
Familie. Wissenschaftlich erfordert dies eine fächerverbindende, interdisziplinäre<br />
Orientierung an Erkenntnissen der Soziologie, Ethnologie, Anthropologie und<br />
Biologie/Ethologie. In diesem Sinne sollen in dem Seminar die mittelalterlichen<br />
Lebensformen der Familie in ihrer Kontinuität oder Alterität zu familiärem Zusammenleben<br />
der Gegenwart untersucht und diskutiert werden.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Nikolaus Gussone<br />
083860 Münster gedenkt. Orte, Zeiten und Institutionen des historischen Gedenkens<br />
Mo 18-20, R. 304, Beginn: 17.10.11<br />
In Münster, einer Stadt mit über 1200-jähriger Geschichte, findet sich eine Vielfalt von<br />
Formen des öffentlichen Gedenkens: Denkmäler, Gedenkstätten, z. B. für Personen<br />
(Rüschhaus für Annette von Droste-Hülshoff)oder künstlerisch überformt (Zwinger,<br />
Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus), periodisch sich wiederholendes Gedenken<br />
an Ereignisse (Westfälischer Frieden), große Jubiläen (Stadt 1993; Bistum 2005),<br />
Straßennamen, die an historische Ereignisse oder Persönlichkeiten erinnern sollen u. s. w.<br />
Das Seminar stellt sich die Aufg<strong>ab</strong>e, die einzelnen Formen des Gedenkens zu erfassen, zu<br />
untersuchen und nach dem Kontext ihres Entstehens sowie nach ihrer oft langen Geschichte<br />
und heutigen Bedeutung zu fragen. Zu beachten sind d<strong>ab</strong>ei: Das Verhältnis von religiösen und<br />
profanen Motiven, die jeweilige Haltung zur Vergangenheit von politisch motiviertem Ringen<br />
um ihre Deutung bis zur Vermarktung im Interesse der Image-Werbung der Stadt und<br />
schließlich die allgemein-menschliche, <strong>ab</strong>er kulturell vari<strong>ab</strong>le Beziehung der Lebenden zu den<br />
Toten.<br />
Bei der Arbeit im Seminar soll zunächst in gemeinsamer Diskussion die Gesamtthematik in<br />
Teilthemen aufgeteilt werden, z. B. nach den Orten oder Formen des Gedenkens, und<br />
126
einzelnen Studierenden oder kleinen Gruppen zur selbständigen Bearbeitung übertragen<br />
werden. In den Seminarsitzungen sollen diese jeweils über die Arbeitsschritte und –ergebnisse<br />
berichten, auch über mögliche Probleme, um sie gemeinsam zu lösen. In der Diskussion<br />
sollen Anregungen gegeben und auch Hilfestellung angeboten werden. Am Ende sollen kurze<br />
Papiere die Arbeitsergebnisse zusammenfassen.<br />
Das Seminar wendet sich an Studierende, die im Studium fortgeschritten sind und Freude an<br />
selbständiger Arbeit h<strong>ab</strong>en.<br />
Literatur: Bei der Anmeldung zum Seminar wird ein Faltblatt der Stadt Münster ausgegeben;<br />
es enthält erste Hinweise zum Thema, die den Ausgangspunkt der Seminararbeit bilden<br />
sollen. Zum Kontext vgl. Franz-Josef Jakobi (Hg.) Geschichte der Stadt Münster, 3 Bde.,<br />
Münster ³1994 und allgemein Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen<br />
des kulturellen Gedächtnisses, München ³2006.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
PD Dr. A. Kneppe<br />
083712 Geschichtsdidaktik in der Schulpraxis. Gym/Ges Begleitseminar zum<br />
Kernpraktikum.<br />
Mi. 10-12, Raum: 304, Beginn: 19.10.11<br />
Dieses Begleitseminar dient sowohl der unmittelbaren Begleitung einer Phase des<br />
Kernpraktikums während der Vorlesungszeit wie auch der Vor- bzw. Nachbereitung einer<br />
Phase des Kernpraktikums in der vorlesungsfreien Zeit.<br />
Es werden alle wesentlichen Aspekte behandelt, die generell für die Praxis des<br />
Geschichtsunterrichts an Gymnasien bzw. Gesamtschulen und speziell für Praktikant(inn)en<br />
maßgeblich sind.<br />
Thematische Schwerpunkte der einzelnen Seminarsitzungen werden u. a. sein: Inner- und<br />
außerschulische Prämissen des Geschichtsunterrichts; Richtlinien und Lehrpläne im Fach<br />
Geschichte; Lernzielproblematik im Fach Geschichte; Methoden und Medien im<br />
Geschichtsunterricht (u.a.: Einsatz von Quellen, Karten, Schulbüchern und audiovisuellen<br />
Medien); Konzeption von Unterrichtsreihen und Unterrichtsstunden im Fach Geschichte;<br />
Exemplarische Unterrichtsplanung für das Praktikum; Gestaltung eines schriftlichen<br />
Stundenentwurfs; Beobachtung von Unterrichtsstunden; Reflexion von Unterrichtsstunden.<br />
Zum Abschluss des Seminars werden mit den einzelnen Teilnehmer(inne)n gemäß den<br />
jeweiligen Interessen Themen für Beobachtungsaufg<strong>ab</strong>en festgelegt, die im Verlauf des<br />
Praktikums bearbeitet werden sollen und Teil des Praktikumsberichts sind.<br />
Voraussetzung der Teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Grundstudiums bzw. des<br />
Orientierungspraktikums.<br />
Literatur:H. Kretschmer, J. Stary, Schulpraktikum. Eine Orientierungshilfe zum Lernen und<br />
Lehren, Berlin 2007; H. Günther-Arndt (Hrsg.), Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die<br />
Sekundarstufe I und II, Berlin 2005; H. Günther-Arndt (Hrsg.), Geschichtsmethodik.<br />
Handbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2007; M. Sauer, Geschichte unterrichten.<br />
Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, Seelze-Velber 2004.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
4. Kernpraktika<br />
PD Dr. A. Kneppe<br />
127
083727 Kernpraktikum im Fach Geschichte (Gym/Ges; BA-2 Fach; MA Ed)<br />
Di 10-12, Raum: Schule, Beginn: 18.10.11<br />
Die hier angebotene Phase des Kernpraktikums ist semesterbegleitend und auf den<br />
Geschichtsunterricht bezogen. Sie wird in einem Gymnasium in Münster durchgeführt. In den<br />
ersten Wochen des Praktikums hospitieren die Teilnehmer/innen am Geschichtsunterricht, in<br />
der Folgezeit werden eigene Geschichtsstunden geplant, durchgeführt und reflektiert.<br />
Dieser semesterbegleitende Typ des Kernpraktikums wird auf die Gesamtzeit des<br />
Kernpraktikums mit 2 Wochen oder 10 Tagen oder 40 Stunden angerechnet.<br />
Eine Betreuung wird ebenfalls für eine weitere, sich in der vorlesungsfreien Zeit<br />
anschließende Phase des Kernpraktikums angeboten, so dass in diesem Bereich eine<br />
personelle Kontinuität gewährleistet ist. Diese Phase des Praktikums würde an einer von den<br />
Studierenden zu wählenden Schule durchgeführt.<br />
Empfohlen wird die Teilnahme am Begleitseminar zum Kernpraktikum „Geschichtsdidaktik<br />
in der Schulpraxis“, das als Begleitseminar sowohl zur semesterbegleitenden Phase wie auch<br />
zu einer in der anschließenden vorlesungsfreien Zeit zu wählenden Phase angerechnet wird.<br />
Voraussetzung der Teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Grundstudiums bzw. des<br />
Orientierungspraktikums.<br />
Ein erstes Treffen der Teilnehmer/innen findet am 18.10. um 10.15 Uhr im Institut f. Didaktik<br />
der Geschichte, Domplatz 23, statt.<br />
Für diese Veranstaltung ist ebenfalls eine spätere Anmeldung im Zentrum für Lehrerbildung<br />
erforderlich. Sollten weitere Fragen zu diesem Praktikum bestehen, können sie in meinen<br />
Sprechstunden (mittwochs 14.30-16.00 Uhr, R. 313, Inst. f. Didaktik d. Geschichte) oder per<br />
e-mail (kneppe@uni-muenster.de) gestellt werden.<br />
Literatur: H. Kretschmer, J. Stary, Schulpraktikum. Eine Orientierungshilfe zum Lernen und<br />
Lehren, Berlin 2007; H. Günther-Arndt (Hrsg.), Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die<br />
Sekundarstufe I und II, Berlin 2005; H. Günther-Arndt (Hrsg.), Geschichtsmethodik.<br />
Handbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2007; M. Sauer, Geschichte unterrichten.<br />
Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, Seelze-Velber 2004<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
128<br />
5. Übungen<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083617 Virtuelle Geschichte<br />
Fr. 8-10, Raum: 304, Beginn: 21.10.11<br />
Museums- und Ausstellungswesen gehören maßgeblich zum Berufsfeld des Historikers. Ziel<br />
dieser Veranstaltung ist zum einen die Aneignung und Diskussion ausstellungsdidaktischer<br />
Grundlagen, die zum zweiten <strong>ab</strong>er auch konkret in der Gestaltung einer virtuellen Ausstellung<br />
ihre praktische Anwendung finden sollen. Hierfür werden Teams weitgehend autonom<br />
arbeiten. Die Übungssitzungen dienen – nach der Einführungsphase – entsprechend zum<br />
Gedankenaustausch, zur gemeinsamen Problemlösung, zur Rückmeldung bzgl. des<br />
Fortschrittes in den Gruppen. Gleichzeitig werden Ausstellungen durch Exkursionen bzw.<br />
‚virtuell‟ vergleichend in den Blick genommen.<br />
Grundkenntnisse sind nicht erforderlich, <strong>ab</strong>er dass für diese Übung besonderes Engagement<br />
bzgl. außerhalb der Übung anzueignender und zu vertiefender Kenntnisse im Umgang mit
Multimedia, Neuen Medien und Webseitengestaltung erforderlich sein wird, liegt auf der<br />
Hand; zudem wäre es von Vorteil, wenn ein Laptop (oder mindestens ein Heim-PC)<br />
vorhanden wäre.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083621 Film-+ Geschichtswerkstatt<br />
Fr. 10-12, Raum: 304, Beginn: 21.10.11<br />
Geschichte wird gemacht! Und nirgends wird dies so augenfällig wie im ‚Fernsehen„. Die<br />
Veranstaltung wird sich einerseits analytisch mit unterschiedlichen audio-visuellen<br />
Geschichtsformaten auseinandersetzen, um so deren geschichtsdidaktische und<br />
geschichtskulturelle Chancen und Grenzen auszuloten, wobei die Perspektive der ‚Macher„<br />
sowie die Rahmenbedingungen fernsehgerechter und zielgruppenadäquater<br />
Geschichtskonstruktion nicht außer Acht gelassen werden soll.<br />
Im Zentrum der Veranstaltung steht die Produktion eigener audio-visueller<br />
Geschichtsnarrationen, wie auch die Erstellung von Begleitmaterial zu existierenden<br />
Angeboten bzw. die Entwicklung von Unterrichtsvorschlägen o.ä. zum Umgang mit audiovisuellen<br />
Geschichtserzählungen in der Schule.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083655 Herausforderung Holocaust<br />
Do 8-10, Raum: 304, Beginn: 20.10.11<br />
Der Holocaust gilt als Zivilisationsbruch schlechthin. Adornos Diktum, die ‚allererste<br />
Aufg<strong>ab</strong>e von Bildung sei es, dass Auschwitz nie wieder geschehe„ kann angesichts der<br />
Unfassbarkeit dieses Verbrechens kaum verwundern. Gleichzeitig <strong>ab</strong>er sind viele Aspekte<br />
einer solchen ‚Holocaust-Erziehung„ umstritten bzw. werden durchaus kontrovers gesehen:<br />
Erinnerung und Wiedergutmachung, Schuld und Verantwortung der heutigen Generation, die<br />
Gefahr einer ‚Übersättigung„, die Undarstellbarkeit der Todeserfahrungen, <strong>ab</strong>er auch ob der<br />
Holocaust ein Thema schon für die Grundschule sein darf, kann oder sogar muss.<br />
Das Seminar wird sich zunächst den historischen Rahmenbedingungen widmen, und<br />
anschließend den gegenwärtigen geschichtskulturellen Umgang mit dem Holocaust<br />
thematisieren (Spielfilme, Dokumentationen, Gedenkstätten etc.), um die gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen differenziert in den Blick zu nehmen. Anschließend sollen speziell auf<br />
die Schule bezogene <strong>ab</strong>er auch geschichtskulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche<br />
einer kritischen Analyse unterzogen werden. Auf der Grundlage hieraus gewonnener<br />
Erkenntnisse sollen eigene Zugänge und Angebote zur Darstellungen des Holocaust<br />
entwickelt und wenigstens in Ansätzen auch umgesetzt werden.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Oliver Näpel<br />
083636 Kunst und Geschichte<br />
Di 10-12, Raum: 304, Beginn: 18.10.11<br />
129
Kunstwerke aus geschichtswissenschaftlicher Sicht als Quelle zu befragen, stellt den<br />
Fragenden oft vor eine Reihe methodischer Probleme. Anhand ausgewählter Beispiele aus<br />
verschiedenen Epochen – Auswahlkriterium soll idealtypisch auch das Interesse der<br />
SeminarteilnehmerInnen sein – soll eine methodische Einführung und aktive Einübung der<br />
Quelleninterpretation verschiedenster Kunstgattungen sein, angefangen von antiker<br />
Vasenmalerei über mittelalterliche Buchillustrationen und der Malerei der Renaissance bis hin<br />
zum Film und Cyberspace. Im Zentrum der Seminararbeit wird d<strong>ab</strong>ei die aktive<br />
Auseinandersetzung mit möglichst vielen dieser Quellen stehen.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende Liste im<br />
Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten liegen <strong>ab</strong> dem<br />
11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083440 Film im Museum. Museumspädagogische Konzepte der Filmarbeit im Vergleich –<br />
Exkursion nach Berlin<br />
Vorbesprechung, Mo. 17.10.11, 18 Uhr, Raum: Institut für Didaktik der Geschichte<br />
Im kulturwissenschaftlichen Paradigma des kulturellen Gedächtnisses werden die<br />
Medialisierung und Visualisierung als nachhaltige Zäsur beschrieben, die mit einer<br />
tiefgreifenden Umstrukturierung des Wissens über Gegenwart und Vergangenheit einhergeht.<br />
Somit sind Film und Fernsehen nicht nur als Teil der Mediengeschichte eine interessanter<br />
Gegenstand, sondern auch geschichtskulturell von großer Bedeutung, da sie in der<br />
Kommunikationsgesellschaft das Wissen über Wirklichkeit maßgeblich organisieren und<br />
steuern. Tendenzen dieser Entwicklung lassen sich zum einen anhand der zunehmenden<br />
Integration filmischer Inszenierungen in Ausstellungen beobachten und zum anderen sind<br />
Film und Fernsehen auch selbst Gegenstand von Musealisierung. Doch welche Funktion<br />
h<strong>ab</strong>en audiovisuelle Medien in musealen Inszenierungen Welche Dimensionen der Film- und<br />
Fernsehgeschichte werden als Mediengeschichten musealisiert, welche Potentiale bieten diese<br />
Trends für historisches Lernen im Museum und welche museumspädagogischen Konzepte<br />
ermöglichen einen reflektierten Umgang mit Film und Fernsehen in historischer Perspektive<br />
Am Beispiel des Deutschen Historischen Museum, des Filmmuseums Potsdam und der<br />
Deutschen Kinemathek- Museum für Film und Fernsehen in Berlin sollen im Rahmen einer<br />
Berlin-Exkursion diese Fragen diskutiert werden. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer im<br />
Rahmen von Filmworkshops in den Museen Methoden der Filmanalyse erproben und<br />
gleichzeitig museumspädagogische Angebote analysieren und diskutieren.<br />
Voraussetzung für eine Teilnahme an der Exkursion ist der Besuch der Vorlesung<br />
„Geschichte in Film und Fernsehen. Chancen und Grenzen für historisches Lernen“ und/oder<br />
des Seminars „Filmanalyse im Geschichtsunterricht“.<br />
Die Exkursion findet vom 20.03.-24.03.<strong>201</strong>2 statt. Um schriftliche Voranmeldung im<br />
Sekretariat wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die verbindliche Anmeldung<br />
mit weiteren organisatorischen Hinweisen erfolgt im Rahmen der Vorbesprechung zur<br />
Exkursion am 25.10. <strong>201</strong>2, um 17.00, im Institut für Didaktik der Geschichte, Domplatz 23, R<br />
304.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende Liste im<br />
Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten liegen <strong>ab</strong> dem<br />
11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083440 Quellenarbeit: Quellen zum Umgang mit der NS-Zeit nach 1945<br />
130
Blockveranstaltung<br />
Wirft man einen Blick in aktuelle Schulgeschichtsbücher, dann fällt auf, dass das Thema<br />
Nationalsozialismus immer noch recht einseitig vermittelt wird. Als Teil der Zeitgeschichte<br />
ist der Nationalsozialismus nämlich nicht nur Gegenstand wissenschaftlicher Forschung,<br />
sondern vor allem ein geschichtskulturell relevantes Phänomen. In Film und Fernsehen, in<br />
Printmedien und Internetforen, in Gedenkstätten, Museen und Denkmalkontroversen – die<br />
NS-Vergangenheit scheint allgegenwärtig. Nicht zuletzt spielen für historische Lehr-<br />
Lernprozesse auch familiäre Erinnerungsspuren eine entscheidende Rolle. Will man die<br />
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler ernst nehmen, dann müssen Erinnerungsund<br />
Geschichtskultur und vor allem die mit ihnen verbundenen Kontroversen integraler<br />
Bestandteil guter Unterrichtsmaterialien werden. Hier besteht ein großer Nachholbedarf, weil<br />
die Rezeptionsgeschichte des Nationalsozialismus, die für den Prozess historischer<br />
Bewusstseins- und Identitätsbildung von zentraler Bedeutung ist, meistens allenfalls am<br />
Rande thematisiert wird. Nur wenn dieses Defizit behoben wird, können Schülerinnen und<br />
Schüler verstehen, welche lebensweltliche Relevanz das Thema Nationalsozialismus immer<br />
noch hat und warum der aus heutiger Sicht lange defizitäre deutsch-deutsche Umgang mit der<br />
NS-Zeit nach 1945 mittlerweile umstrittener ist als die NS-Vergangenheit selbst.<br />
Ausgehend von diesen Überlegungen, wird es in der Übung darum gehen,<br />
geschichtskulturelle Quellen zum Umgang mit der NS-Vergangenheit zu eruieren, zu<br />
diskutieren, geschichtsdidaktisch aufzubereiten und <strong>ab</strong>schließend in Form eines<br />
kommentierten Quellenfundus für alle Teilnehmer der Übung zur Verfügung zu stellen.<br />
Die Übung findet als Blockveranstaltung statt:<br />
VERPFLICHTENDE VORBESPRECHUNG: 14.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr !!!<br />
04.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 17−20 Uhr<br />
15.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 09−16 Uhr<br />
29.10.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 09−16 Uhr<br />
09.11.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr<br />
Literatur: Wird im Rahmen der Vorbesprechung bekannt gegeben.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Holger Thünemann<br />
083545 Unterrichtsplanung und Aufg<strong>ab</strong>enkultur<br />
Blockveranstaltung<br />
Wohl mehr als in anderen Fächern erweist sich die Planung guten Geschichtsunterrichts in der<br />
Praxis als enorm komplexes Verfahren. Entscheidend ist nicht zuletzt die Formulierung<br />
anspruchsvoller historischer Lernaufg<strong>ab</strong>en und Arbeitsaufträge. Ausgehend von einer kurzen<br />
Wiederholung maßgeblicher geschichtsdidaktischer Positionen, Konzepte und Methoden<br />
werden Sie zu ausgewählten historischen Themen selbst Lernaufg<strong>ab</strong>en und<br />
Unterrichtssequenzen konzipieren und diese anschließend zur Diskussion stellen.<br />
Die Übung findet als Blockveranstaltung statt:<br />
02.11.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 18−20 Uhr<br />
15.01.<strong>201</strong>2, 10−18 Uhr<br />
22.01.<strong>201</strong>2, 10−18 Uhr<br />
25.01.<strong>201</strong>2, 18−20 Uhr<br />
Literatur: Peter Gautschi: Guter Geschichtsunterricht. Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise.<br />
Schwalbach/Ts. 2009; Hilke Günther-Arndt (Hrsg.): Geschichts-Didaktik. Praxishandbuch für<br />
die Sekundarstufe I und II. 3. Aufl. Berlin 2008; Hilke Günther-Arndt (Hrsg.): Geschichts-<br />
131
Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin 2007; Christian Heuer:<br />
Gütekriterien für kompetenzorientierte Lernaufg<strong>ab</strong>en im Fach Geschichte. In: Geschichte in<br />
Wissenschaft und Unterricht 62 (<strong><strong>201</strong>1</strong>) [im Druck]; Holger Thünemann: Geschichtsunterricht<br />
ohne Geschichte Überlegungen und empirische Befunde zu historischen Fragen im<br />
Geschichtsunterricht und im Schulgeschichtsbuch. In: Saskia Handro/Bernd Schönemann<br />
(Hrsg.): Geschichte und Sprache. Berlin <strong>201</strong>0 (Zeitgeschichte – Zeitverständnis, Bd. 21), S.<br />
49–59.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Dr. Wolfhart Beck<br />
083602 Auf den Spuren der Schulgeschichte – Archivpädagogische Angebote im Lernort<br />
Landesarchiv<br />
Fr 14–17s.t., 14-tägig, Raum: Vortragsraum Landesarchiv, Bohlweg 2, Beginn: 21.10.11<br />
Die Erforschung der Geschichte des eigenen Umfelds, vom Wohnort über den Sportverein bis<br />
hin zur eigenen Schule, stellt für Schülerinnen und Schüler einen ebenso lebensnahen wie<br />
spannenden Zugang zur Geschichte dar. Das Archiv mit seinen Beständen und<br />
archivpädagogischen Angeboten bietet sich hierbei als außerschulischer Lernort in besonderer<br />
Weise an: Schülerinnen und Schüler können anhand von originalen Quellen forschendentdeckend<br />
auf historische Spurensuche gehen und selber Geschichte schreiben.<br />
Am Beispiel von Schulgeschichte(n) soll dieser Ansatz in der Übung vorgestellt und<br />
ausprobiert werden. Nach einer Einführungsphase, in der die Aufg<strong>ab</strong>en,<br />
Nutzungsmöglichkeiten und Bestände sowie das archivpädagogische Konzept des<br />
Landesarchivs vorgestellt werden, sollen die Studierenden dann zunächst selbst auf<br />
Spurensuche gehen (z.B. zur Geschichte der eigenen Schule) und auf dieser Grundlage dann<br />
archivpädagogische Module und Handreichungen für Schülerinnen und Schüler erstellen und<br />
ggf. auch praktisch erproben. Als inhaltliche Schwerpunkte bieten sich z. B. an: Unterricht im<br />
Kaiserreich, ideologische Indoktrination oder Resistenz in der NS-Diktatur, Erziehung im<br />
Krieg, Bildungsreform und Schülerprotest in der Bundesrepublik u.v.m.<br />
Literatur: Dittmer, Lothar/ Siegfried, Detlef (Hg.), Spurensucher. Ein Praxisbuch für<br />
historische Projektarbeit, überarb. und erw. Neuauflage, Hamburg 2005; Lange, Thomas/<br />
Lux, Thomas, Historisches Lernen im Archiv, Schwalbach/Ts. 2004.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
Roswitha Link<br />
083818 Auf den Spuren der Stadtgeschichte – Archivpädagogische Angebote im Lernort<br />
Stadtarchiv<br />
Blockveranstaltung<br />
Einführung: 19.10.11, 16-18 Uhr<br />
Fr 11.11.11, 14-19 Uhr, Sa 12.11.11, 11-17.30 Uhr<br />
Fr 27.01.12, 14-19 Uhr, Sa 28.01.12, 11-17.30 Uhr<br />
„Geschichte vor Ort“ zählt zu den wesentlichen Merkmalen eines schülerbezogenen<br />
Geschichtsunterrichts. Fragen nach beispielsweise der NS-Zeit, dem Wiederaufbau nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg oder auch der Hexenverfolgung in der eigenen Stadt motivieren<br />
Schülerinnen und Schüler für die Beschäftigung und die kritische Auseinandersetzung mit der<br />
Vergangenheit. Archive als außerschulische Lernorte eignen sich für diese Spurensuche in<br />
132
esonderer Weise. Das dort aufbewahrte authentische Quellenmaterial in Schrift-, Bild- und<br />
Tonform bietet sich für forschend-entdeckendes Lernen im Rahmen eines modernen<br />
kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts in jeder Altersstufe an. Mit den<br />
unterschiedlichen Quellengattungen der Archive wird auch Grundschulkindern sowie<br />
leseungeübten Kindern und Jugendlichen handlungs- und projektorientiertes Lernen<br />
ermöglicht.<br />
In dieser Übung geht es nach einer kurzen Einführung in die Archivarbeit um die<br />
Entwicklung von Unterrichtseinheiten im Lernort Archiv, insbesondere für Grund-, Hauptund<br />
Realschulen. Nach Möglichkeit sollen die Ausarbeitungen auch praktisch erprobt werden.<br />
Literatur: Thomas Lange, Thomas Lux: Historisches Lernen im Archiv, Schwalbach/Ts. 2004<br />
Edwin Hamberger: Lernort Archiv. In: Waltraud Schreiber (Hrsg.): Erste Begegnungen mit<br />
Geschichte. Grundlagen historischen Lernens. Bd. 1, Neuried 1999, S. 577-588. Monika<br />
Fenn: Mit Grundschülern ins Archiv Möglichkeiten historischen Lernens aus<br />
geschichtsdidaktischer Perspektive. http://www.did.geschichte.uni-muenchen.de/forschung/<br />
publikationen/aufsaetze/publ_fe_grund_archiv.html#top (aufgerufen: 15.04.<strong><strong>201</strong>1</strong>)<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende<br />
Liste im Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten<br />
liegen <strong>ab</strong> dem 11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
6. Kolloquien<br />
Prof. Dr. Saskia Handro/Prof. Dr. Bernd Schönemann<br />
083454 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten und Doktoranden<br />
Do 18-21, 14-tägig, Teilnahme auf Einladung<br />
7. Exkursionen<br />
Prof. Dr. Saskia Handro<br />
083440 Film im Museum. Museumspädagogische Konzepte der Filmarbeit im<br />
Vergleich – Exkursion nach Berlin<br />
Vorbesprechung: Mo, den 17.10.11, 18 Uhr, Raum: Institut für Didaktik der Geschichte<br />
Im kulturwissenschaftlichen Paradigma des kulturellen Gedächtnisses werden die<br />
Medialisierung und Visualisierung als nachhaltige Zäsur beschrieben, die mit einer<br />
tiefgreifenden Umstrukturierung des Wissens über Gegenwart und Vergangenheit einhergeht.<br />
Somit sind Film und Fernsehen nicht nur als Teil der Mediengeschichte eine interessanter<br />
Gegenstand, sondern auch geschichtskulturell von großer Bedeutung, da sie in der<br />
Kommunikationsgesellschaft das Wissen über Wirklichkeit maßgeblich organisieren und<br />
steuern. Tendenzen dieser Entwicklung lassen sich zum einen anhand der zunehmenden<br />
Integration filmischer Inszenierungen in Ausstellungen beobachten und zum anderen sind<br />
Film und Fernsehen auch selbst Gegenstand von Musealisierung. Doch welche Funktion<br />
h<strong>ab</strong>en audiovisuelle Medien in musealen Inszenierungen Welche Dimensionen der Film- und<br />
Fernsehgeschichte werden als Mediengeschichten musealisiert, welche Potentiale bieten diese<br />
Trends für historisches Lernen im Museum und welche museumspädagogischen Konzepte<br />
ermöglichen einen reflektierten Umgang mit Film und Fernsehen in historischer Perspektive<br />
Am Beispiel des Deutschen Historischen Museum, des Filmmuseums Potsdam und der<br />
Deutschen Kinemathek- Museum für Film und Fernsehen in Berlin sollen im Rahmen einer<br />
Berlin-Exkursion diese Fragen diskutiert werden. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer im<br />
133
Rahmen von Filmworkshops in den Museen Methoden der Filmanalyse erproben und<br />
gleichzeitig museumspädagogische Angebote analysieren und diskutieren.<br />
Voraussetzung für eine Teilnahme an der Exkursion ist der Besuch der Vorlesung<br />
„Geschichte in Film und Fernsehen. Chancen und Grenzen für historisches Lernen“ und/oder<br />
des Seminars „Filmanalyse im Geschichtsunterricht“.<br />
Die Exkursion findet vom 20.03.-24.03.<strong>201</strong>2 statt. Um schriftliche Voranmeldung im<br />
Sekretariat wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die verbindliche Anmeldung<br />
mit weiteren organisatorischen Hinweisen erfolgt im Rahmen der Vorbesprechung zur<br />
Exkursion am 25.10. <strong>201</strong>2, um 17.00, im Institut für Didaktik der Geschichte, Domplatz 23, R<br />
304.<br />
Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist nur nach Eintragung in die entsprechende Liste im<br />
Institut für Didaktik der Geschichte und in HISLSF möglich. Anmeldelisten liegen <strong>ab</strong> dem<br />
11.07.<strong><strong>201</strong>1</strong>, 8.30 Uhr, im Institut für Didaktik der Geschichte aus.<br />
134