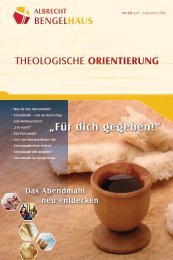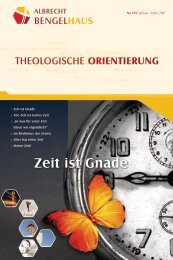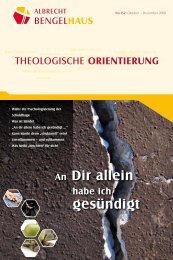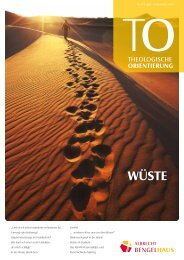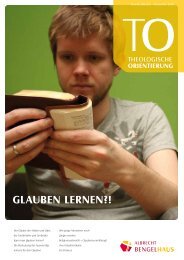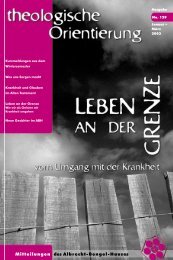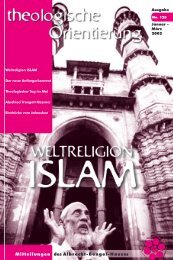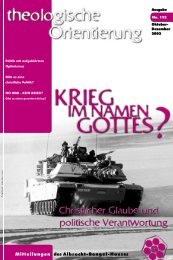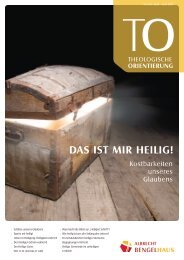Nr. 134, April-Juni 2004 - Albrecht-Bengel-Haus
Nr. 134, April-Juni 2004 - Albrecht-Bengel-Haus
Nr. 134, April-Juni 2004 - Albrecht-Bengel-Haus
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Titelfoto: diakonissenmutterhaus aidlingen<br />
Ausgabe<br />
No. <strong>134</strong><br />
<strong>April</strong> –<br />
<strong>Juni</strong><br />
<strong>2004</strong><br />
Gottesdienst im Alten<br />
und Neuen Testament<br />
Liturgie – Last oder Lust<br />
Zwischen Tradition und<br />
Erlebnisorientierung<br />
Theologie des Gottesdienstes<br />
Grundlage, Geschichte, Gestalt<br />
Mitteilungen des <strong>Albrecht</strong>-<strong>Bengel</strong>-<strong>Haus</strong>es
GOTTESdienst<br />
INHALT<br />
2 Editorial<br />
Rolf Hille<br />
4 Gottesdienst im Alten Testament<br />
Hartmut Schmid<br />
5 Gottesdienst im Neuen Testament<br />
Volker Gäckle<br />
7 Liturgie – Last oder Lust<br />
Joachim Kummer<br />
11 Zwischen Tradition und<br />
Erlebnisorientierung<br />
Johannes Zimmermann<br />
18 Theologie des Gottesdienstes<br />
Eberhard Hahn<br />
21 Infos aus dem <strong>Haus</strong><br />
22 Schnuppertage<br />
23 Einladung Theologischer Tag<br />
IMPRESSUM<br />
Die Mitteilungen des <strong>Albrecht</strong>-<strong>Bengel</strong>-<strong>Haus</strong>es erscheinen<br />
vierteljährlich. Nachdruck auch auszugsweise nur mit<br />
Einwilligung des Herausgebers.<br />
Der Bezug ist mit keinen Verpfl ichtungen verbunden.<br />
Herausgeber: Dr. Rolf Hille im Auftrag des Vereins<br />
<strong>Albrecht</strong>-<strong>Bengel</strong>-<strong>Haus</strong> e.V.<br />
Ludwig-Krapf-Str. 5, 72072 Tübingen<br />
Tel 07071/7005-0 / Fax 7005-40<br />
E-Mail: theologische-orientierung@bengelhaus.de<br />
Internet: www.bengelhaus.de<br />
Redaktion:<br />
Grafik:<br />
Druck:<br />
Fotos:<br />
Konten:<br />
ABH-Verein:<br />
ABH-Stiftung:<br />
Volker Gäckle, Joachim Kummer<br />
KraussWerbeagentur.de, Herrenberg<br />
Druckerei Zaiser, Nagold<br />
abh/photos.com<br />
EKK Stuttgart<br />
BLZ 600 606 06 Konto 41 90 01<br />
EKK Stuttgart<br />
BLZ 600 606 06 Konto 41 95 83<br />
Dr. Rolf Hille - Rektor<br />
Liebe Leser!<br />
zur Zeit erleben wir eine beeindruckende<br />
Abfolge von Jubiläen anlässlich der<br />
Gedenktage herausragender pietistischer<br />
Theologen. So konnten wir im November<br />
2003 gemeinsam mit der Fakultät und<br />
dem Evangelischen Stift unseres Namenspatrons<br />
Johann <strong>Albrecht</strong> <strong>Bengel</strong> gedenken.<br />
In diesem Jahr feierten wir am 22. Februar<br />
in Balingen den 200. Geburtstag des bedeutenden<br />
Bibeltheologen Johann Tobias<br />
Beck. Und im nächsten Jahr steht das Spenerjubiläum<br />
an. Johann Tobias Beck hatte<br />
den weiten Horizont des Reiches Gottes.<br />
Er rückte im Zeitalter des Rationalismus die<br />
biblische Heilsgeschichte in den Mittelpunkt<br />
der Theologie und erwies sich so als ein<br />
Schüler <strong>Bengel</strong>s. Beck bekannte die „ewige<br />
und geschichtliche Offenbarungsfülle Gottes“<br />
in der Schrift. Diese hat er lebensvoll<br />
seinen Studenten ausgelegt. Wir freuen<br />
uns als <strong>Bengel</strong>haus, dass wir heute diese<br />
Tübinger Lehrtradition unter den Voraussetzungen<br />
des 21. Jahrhunderts aufnehmen<br />
und weiterführen können.<br />
Am Samstag, den 11. Dezember <strong>2004</strong><br />
planen wir nun ebenfalls gemeinsam mit<br />
der Fakultät und dem Stift, einen öffentlichen<br />
Studientag über Beck im Theologicum,<br />
zu dessen Abschluss unser Landesbischof<br />
Dr. Gerhard Maier einen Vortrag<br />
halten wird. Sie werden hierzu mit Programm<br />
noch eingeladen.<br />
An zwei weitere Geburtstage von besonderen<br />
Freunden und Förderern des <strong>Bengel</strong>hauses<br />
möchte ich in diesem Geleitwort<br />
dankbar erinnern. Am 1. Februar konnte<br />
editorial<br />
Prof. Dr. Peter Beyerhaus, der erste Rektor<br />
des ABH, seinen 75. Geburtstag feiern.<br />
Prof. Beyerhaus hat sich in den schwierigen<br />
Gründungsjahren des <strong>Bengel</strong>hauses mit<br />
viel Mut und Umsicht für uns eingesetzt.<br />
Er hat u. a. den Entwurf zur Grundordnung<br />
verfasst und damit das <strong>Haus</strong> nachhaltig<br />
geprägt.<br />
Am 24. Februar konnte unser langjähriges<br />
Vorstandsmitglied und bewährter Rechner<br />
Manfred Rieger seinen 65. Geburtstag<br />
begehen. Er hat sich in zahllosen Sitzungen<br />
als guter Ratgeber und tüchtiger Finanzmann<br />
erwiesen, der immer mit großem<br />
persönlichen Einsatz hinter unserer Studienarbeit<br />
stand.<br />
Beiden Jubilaren möchte ich an dieser<br />
Stelle von Herzen danken und ihnen für<br />
das neue Lebensjahr viel Freude, gute Gesundheit<br />
und vor allem den Segen unseres<br />
Herrn wünschen.<br />
Im Schlusskonvent des Wintersemesters<br />
mussten wir nach dreieinhalbjähriger Tätigkeit<br />
als Studienassistenten Martin Flaig ins<br />
Pfarramt nach Gärtringen verabschieden.<br />
Martin Flaig hat sich großartig in die Arbeit<br />
des <strong>Bengel</strong>hauses hineingegeben. Seine<br />
Lehrveranstaltungen – zunächst in der Kirchengeschichte,<br />
später in der Praktischen<br />
Theologie – wurden von unseren Studenten<br />
sehr geschätzt. Er hat sich mit großer<br />
Kreativität und Sorgfalt dieser Lehraufgabe<br />
gewidmet und durch die Verbindung von<br />
wissenschaftlicher Theologie und einem<br />
echten geistlichem Anliegen zahlreiche<br />
Studenten geprägt. Auch in der Studienberatung<br />
und seelsorgerlichen Begleitung<br />
hat er großes Vertrauen gefunden. Nicht<br />
wenige Gemeindeglieder lernten ihn durch<br />
seine bildhaften und lebendigen Bibelarbeiten,<br />
Predigten und Vorträge kennen und<br />
schätzen. Für das <strong>Bengel</strong>haus ist sein Weggehen<br />
ein echter Verlust. Wir wünschen ihm<br />
– verbunden mit großem Dank – Gottes<br />
Geleit und viel Vollmacht in seinem künftigen<br />
Wirken als Gemeindepfarrer.<br />
Dieses Heft der „Theologischen Orientierung“<br />
steht unter dem Thema „Gottesdienst“.<br />
Unsere Studenten bewegt die<br />
Gestaltung des gottesdienstlichen Lebens<br />
seit einigen Semestern stark. Das ist ein<br />
gutes und hoffnungsvolles Zeichen, denn<br />
hier schlägt das Herz aller Gemeindearbeit.<br />
Wie können wir moderne Menschen<br />
im Gottesdienst erreichen Was spricht<br />
die junge Generation an und hält doch<br />
Junge und Alte zusammen Wir möchten<br />
diese wichtigen Fragen im Wintersemester<br />
<strong>2004</strong>/2005 als Lehrerschaft in einer Vorlesungs-<br />
bzw. Seminarreihe aufnehmen und<br />
vertiefen.<br />
Für heute darf ich Sie, liebe Leser, mit guten<br />
Wünschen aus Tübingen grüßen und Ihnen<br />
für alle Unterstützung im Gebet und durch<br />
Gaben herzlich danken.<br />
Ihr Rolf Hille<br />
2 3
Gottesdienst im Alten Testament<br />
Bei Diskussionen über den Gottesdienst<br />
in unserer Zeit stehen sehr häufi g Fragen<br />
der Gestaltung und des Ablaufs im Vordergrund.<br />
Befragen wir daraufhin das Alte<br />
Testament, so müssen wir ernüchtert feststellen,<br />
dass wir keine detaillierten Informationen<br />
über den Ablauf des Gottesdienstes<br />
im Alten Testament fi nden. Dies hat verschiedene<br />
Gründe. Es ist zunächst damit zu<br />
rechnen, dass die Form des Gottesdienstes<br />
in der langen Zeit, die das Alte Testament<br />
umgreift, Veränderungen unterworfen war.<br />
Die Gottesdienstform, den Gottesdienstablauf<br />
hat es nicht gegeben. Es wurden in<br />
verschiedenen Zeiten und Regionen und<br />
je nach Anlass sicherlich unterschiedliche<br />
Gottesdienstformen praktiziert. Von größerer<br />
Bedeutung ist die andere Beobachtung.<br />
Wichtiger als Form und Ablauf des<br />
Gottesdienstes ist das Wesen des Gottesdienstes.<br />
Worum geht es im Zentrum des<br />
Gottesdienstes Wir können feststellen: das<br />
„was“ ist wichtiger als das „wie“!<br />
Das Wesen des Gottesdienstes<br />
Die entscheidende Frage des Gottesdienstes<br />
ist die Frage, welcher Gott in<br />
diesem Gottesdienst verehrt wird, wer das<br />
Gegenüber der gottesdienstlichen Versammlung<br />
ist. Wahrer Gottesdienst in Israel<br />
kann nur Jahwe, den einen Gott Israels als<br />
Gegenüber haben. Hinter dieser Grundfrage<br />
treten alle anderen Fragen nach<br />
der Gestaltung zurück. An dieser Frage<br />
entscheidet sich wahrer und falscher Gottesdienst<br />
in Israel.<br />
Diesem Gegenüber hat der Gottesdienst<br />
auch in seiner Ausgestaltung zu entsprechen.<br />
Form und Inhalt des Gottesdienstes<br />
kann nicht im Widerspruch stehen zu dem<br />
Gott, der verehrt wird.<br />
Hartmut Schmid - Studienleiter<br />
Elemente des Gottesdienstes<br />
Wir können einzelne Elemente benennen,<br />
die in der Regel für die Gestaltung<br />
des Gottesdienstes wichtig waren.<br />
Gottesdienste wurden gefeiert an bestimmten,<br />
dafür vorgesehenen heiligen<br />
Orten. Diese Orte waren abgegrenzt und<br />
mit einem Altar versehen. In der Regel<br />
stand auch entsprechendes Kultpersonal<br />
(Priester) für die Durchführung der Gottesdienste<br />
zur Verfügung.<br />
Von großer Bedeutung waren die Opfer.<br />
Die verschiedenen Opfer bringen<br />
Hingabe an Gott, Sühne und die Gemeinschaft<br />
der Opfernden zum Ausdruck.<br />
Damit werden zentrale Aspekte im Verhältnis<br />
zu Gott und im Blick auf die gottesdienstliche<br />
Gemeinde ausgedrückt.<br />
Vor allem Gebete, aber auch Lieder<br />
gehörten selbstverständlich dazu.<br />
Nach 4Mo 6,22-27 ist der Segen ein<br />
wichtiges Element des Gottesdienstes.<br />
Ganz unsicher ist, in welcher Weise die<br />
Verkündigung im Gottesdienst vorkam.<br />
Es ist kaum an Predigten im heutigen<br />
Sinn zu denken, eher ist mit Lesungen<br />
und mit persönlichen Worten an Einzelne<br />
zu rechnen. Die Propheten haben für ihre<br />
Verkündigung gelegentlich das Umfeld des<br />
Gottesdienstes genutzt (Jer 7,1-15; 36,10).<br />
Besondere Gottesdienste und Feste<br />
Ausführlichere Darstellungen fi nden wir<br />
bei besonderen Gottesdiensten anlässlich<br />
besonderer Ereignisse wie etwa dem Passafest<br />
(2Mo 12), dem Bundesschluss am<br />
Sinai (2Mo 24), bei der Überführung der<br />
Lade (2Sam 56,17-19), bei der Einweihung<br />
des Tempels (1Kön 8).<br />
Im Jahreskreislauf wiederkehrende Feste<br />
waren die Höhepunkte des gottesdienstlichen<br />
Lebens (2Mo 23,14-16; 3Mo 16;<br />
23; 5Mo 1-17). Die Feste hatten den Dank<br />
für die Ernte, die Erinnerung an Gottes<br />
Handeln an Israel und die Versöhnung<br />
durch Sühne zum Inhalt. 5Mo 26,1-11<br />
zeigt, wie auch bei einem Erntefest Israels<br />
Heilsgeschichte in Erinnerung gerufen wird<br />
und damit lebendig bleibt.<br />
Der falsche Gottesdienst<br />
Bei den Propheten stoßen wir z.T. auf<br />
heftige Kritik an den Gottesdiensten (Jes<br />
1,10-15; Am 5,21-24). Was ist der Grund<br />
für diese Kritik Die Propheten haben den<br />
Gottesdienst nicht grundsätzlich abgelehnt.<br />
> Wenn Ihr<br />
zusammenkommt <<br />
Ursprung und Inhalt<br />
Der Ursprung bzw. das „Grundmodell“<br />
der neutestamentlichen Gottesdienste war<br />
der jüdische Synagogengottesdienst, in<br />
dem wohl ausnahmslos alle Jünger und<br />
Apostel groß geworden sind und „zuhause“<br />
waren. Schon dort hatten das Gebet,<br />
die Schriftlesung und deren Auslegung<br />
und der Segen einen festen Platz (vgl. Luk<br />
4,15-28). Gleichzeitig ist der christliche<br />
Gottesdienst ebenso eine Neuschöpfung,<br />
wie der christliche Glaube. Die Begegnung<br />
mit dem auferstandenen Herrn, der sich als<br />
der Messias erwiesen hatte, sprengte alle<br />
vorgegebenen Modelle. Von nun an waren<br />
sein Wort und die Verkündigung seines<br />
Todes und seiner Auferstehung das unverrückbare<br />
Zentrum des Gottesdienstes. Dies<br />
wird schon rein äußerlich daran deutlich,<br />
dass sich die Gemeinde nicht mehr am jüdischen<br />
Sabbat versammelte, sondern am<br />
Sonntag, dem Auferstehungstag Jesu (1Kor<br />
Aber sie beobachten in ihrer Zeit, wie das<br />
Verhalten im Alltag dem Willen Gottes nicht<br />
entspricht, wie Gottes Gebot, das die Liebe<br />
und die Fürsorge für den Nächsten befiehlt,<br />
missachtet wird. Gott lässt sich durch schöne<br />
Gottesdienste nicht von diesen Missständen<br />
ablenken. Wir haben oben festgestellt, dass<br />
der Gottesdienst dem Wesen des verehrten<br />
Gottes entsprechen soll. Der Gott der Bibel<br />
erhebt Anspruch auf das ganze Leben und<br />
dessen Gestaltung. Darum soll der Gottesdienst<br />
der Orientierung an Gottes Willen für<br />
den Alltag dienen. Rechter Gottesdienst dient<br />
dem Alltag und der Alltag gipfelt wiederum in<br />
der Feier des Gottesdienstes.<br />
Der Gottesdienst nach dem Neuen Testament<br />
Volker Gäckle - Studienleiter<br />
16,2; Apg 20,7; Offb 1,10). So ist es nicht<br />
übertrieben, wenn man die Form der ersten<br />
christlichen Gottesdienste als eine Anknüpfung<br />
an den jüdischen Synagogengottesdienst<br />
bezeichnet, aber den Inhalt als eine<br />
Neuschöpfung Gottes selbst.<br />
Christsein und Gottesdienst gehören<br />
zusammen<br />
Für die neutestamentlichen Gottesdienste<br />
gilt dasselbe wie für die alttestamentlichen:<br />
Wir fi nden im ganzen NT keine Gottesdienstordnung.<br />
Zu Form und Liturgie macht<br />
das NT keine normativen, d.h. maßgebenden<br />
Aussagen. Noch nicht einmal die<br />
Feier des Gottesdienstes wird geboten (z.B.<br />
„Versammelt euch!“). Es gibt keinen „Gottesdienstbefehl<br />
Jesu“, vergleichbar mit dem<br />
Missionsbefehl.<br />
4 5
Deutlich ist aber, dass sich die ersten<br />
Christen von Anfang an ganz selbstverständlich<br />
zum Gottesdienst versammelt<br />
haben. Es gibt in der 2000jährigen Geschichte<br />
des christlichen Glaubens keine<br />
Zeit, in der die Gemeinde von sich aus auf<br />
den Gottesdienst verzichtet hätte. Er war<br />
und ist der Ort, an dem die Gemeinde die<br />
Gemeinschaft mit ihrem Herrn glaubte,<br />
feierte und erlebte.<br />
„Es blieb unserer Zeit vorbehalten, zu<br />
meinen, es könne und dürfe so etwas wie<br />
ein gottesdienstloses Christentum geben<br />
und sogar noch zu versuchen, das theologisch<br />
zu rechtfertigen“ (Johannes Zimmermann).<br />
Verkündigung, Vielfalt und Freiheit<br />
Zu den Inhalten und Elementen dieser<br />
Gottesdienste gibt es mehrere Informationen,<br />
wobei – wie erwähnt - keine Stelle den<br />
Anspruch erhebt, eine feste Regel zu sein:<br />
„Sie blieben aber beständig in der Lehre<br />
der Apostel und in der Gemeinschaft und<br />
im Brotbrechen und im Gebet“ (Apg 2,42).<br />
„Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein<br />
jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat<br />
eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede,<br />
er hat eine Auslegung. Lasst alles geschehen<br />
zur Erbauung“ (1Kor 14,26).<br />
„Lasst das Wort Christi reichlich unter<br />
euch wohnen: lehrt und ermahnt einander<br />
in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen<br />
und geistlichen Liedern singt Gott<br />
dankbar in euren Herzen“ (Kol 3,16).<br />
In diesen wenigen, ausgewählten Belegen<br />
kommt die Vielfalt der gottesdienstlichen<br />
Elemente der ersten Christen zum<br />
Ausdruck, aber auch ihre Variabilität. Nicht<br />
immer und überall muss alles geschehen<br />
und Platz haben. Bemerkenswert ist aber,<br />
dass gegenüber dem alttestamentlichen<br />
Befund das Gewicht des gesprochenen<br />
Wortes in Form der Lehre oder der Prophetie<br />
einen deutlich größeren Raum einnimmt.<br />
Das „Wort Christi“ bzw. die darauf<br />
aufbauende „Lehre der Apostel“ hatten von<br />
Anfang an eine zentrale Stellung in diesen<br />
Gottesdiensten.<br />
Wozu dient der Gottesdienst<br />
Fragt man nach dem Ziel und Zweck<br />
dieser Gottesdienste, so kann man drei<br />
zentrale Anliegen umschreiben. Der Gottesdienst<br />
soll erstens dem Kontakt und der<br />
Kommunikation der Gläubigen mit Gott<br />
bzw. Christus und untereinander dienen. In<br />
der Verkündigung, in den Sakramenten der<br />
Taufe und des Abendmahls und im Gebet<br />
treten Menschen in eine Gemeinschaft<br />
mit ihrem Herrn ein. In der gegenseitigen<br />
Seelsorge in Ermutigung und Ermahnung<br />
begegnen sie einander. Zweitens soll der<br />
Gottesdienst der „Erbauung“ bzw. genauer<br />
gesagt der „Auferbauung“ des Einzelnen<br />
und der Gemeinde dienen. Das eine ist<br />
nicht ohne das andere zu haben und wenn<br />
die Auferbauung des Einzelnen von der der<br />
Gemeinde getrennt wird, dann ist das nicht<br />
mehr neutestamentlich. Zum dritten soll in<br />
Psalm und Lobpreis Gott die Ehre gegeben<br />
werden.<br />
Rücksicht auf die<br />
> Noch-nicht-Kirchlichen <<br />
In 1Kor 14 kommt noch ein weiterer<br />
Aspekt der urchristlichen Gottesdienste<br />
zur Geltung, nämlich der missionarische.<br />
Paulus behandelt dort die in Korinth umstrittene<br />
Frage der Zungenrede im Gottesdienst<br />
und ein wesentlicher Punkt seiner<br />
Argumentation ist die Verständlichkeit der<br />
Gottesdienste. Außenstehende sollen, wenn<br />
sie zufällig oder aufgrund einer Einladung<br />
in den Gottesdienst kommen, das Geschehen<br />
mit ihrem Verstand erfassen können,<br />
was bei der Zungenrede nicht gegeben<br />
wäre (1Kor 14,19-25). Damit ist die Gemeinde<br />
angehalten, bei ihrer Gottesdienstgestaltung<br />
immer auch die „Unkundigen“<br />
und „Ungläubigen“ (14,23) mit zu berücksichtigen.<br />
Insgesamt eröffnet uns das NT sowohl<br />
klare Leitlinien für die Inhalte und die Verkündigung<br />
in den Gottesdiensten als auch<br />
eine große Gestaltungsfreiheit, die gemäß<br />
dem Prinzip der Liebe (1Kor 10,23) zur Erbauung<br />
der Gemeinde genützt werden soll.<br />
Liturgie - Last oder Lust<br />
Joachim Kummer – Studienassistent<br />
Liturgie! Ein Reizwort, das für verkrustete,<br />
überalterte und unverständliche Formen<br />
steht Oder vielmehr ein altehrwürdiges<br />
Gebäude, an dem nicht zu rühren ist, weil es<br />
Denkmalschutz genießt<br />
Unser Gottesdienst mit allen seinen Teilen<br />
ist heiß umkämpft. Findet die Gemeinde vor<br />
Ort zumeist einen tragfähigen Kompromiss<br />
– etwa durch Einführung eines Zweitgottesdienstes<br />
mit neuen Gestaltungselementen,<br />
so bleibt doch die Argumentation vielfach in<br />
gegenseitigem Missverstehen stecken. Unstrittig<br />
ist, dass Alter allein noch kein Anrecht<br />
auf ewigen Bestand sichern kann. Ebenso<br />
einleuchtend dürfte sein, dass Unverstandenes<br />
noch lange nicht unverständlich sein und<br />
bleiben muss. Auch die feste Form an sich<br />
stellt noch keinen Mangel dar: Wie ein geregelter<br />
Tagesablauf von der ständig neuen<br />
Entscheidung, was nun zu tun sei, entlastet<br />
und für inhaltliches Wirken frei macht, so<br />
sorgt ein verlässlicher Ablauf des Gottesdienstes<br />
dafür, dass ich mich auf Predigt,<br />
Lied und Gebet konzentrieren, ja in diesen<br />
Formen sogar heimisch werden kann und<br />
nicht ständig fragen muss: „Und was kommt<br />
jetzt“<br />
Unsere Liturgie ist ein schwieriges Erbe. Das<br />
gilt aber, wenn wir Goethe glauben dürfen,<br />
vom Erbe überhaupt. Diese Schwierigkeit<br />
überwinden wir, wenn wir seinem Rat folgen:<br />
„Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es,<br />
um es zu besitzen!“ Entziehen wir uns diesem<br />
Geschäft des „Erwerbens“, so schlagen wir<br />
entweder ein Erbe in den Wind, das wir nicht<br />
kennen, oder wir halten künstlich Formen am<br />
Leben, die uns im Innersten fremd bleiben.<br />
Dieses „Erwerben“ vollzieht sich im Konkreten.<br />
Deshalb wollen wir uns nun dem<br />
Württembergischen Predigtgottesdienst, seiner<br />
Herkunft und dem Sinn, der in seinem<br />
Ablauf steckt, zuwenden.<br />
I. Herkunft<br />
Nach den Erfahrungen, die Luther in<br />
Wittenberg mit den radikalen „Bilderstürmern“<br />
machen musste, von denen alles<br />
Überkommene in Bausch und Bogen<br />
verworfen wurde, riet Luther zur Mäßigung<br />
und zu bedachten Reformen. Davon ist<br />
auch seine Gottesdienstreform geprägt.<br />
Die katholische Messe, in deren Zentrum<br />
das Abendmahl steht, wurde nicht als solche<br />
abgeschafft, sondern von unevangelischen<br />
Elementen gereinigt. Seine „gefegte<br />
Messe“ ist daher z.B. frei von Gebetsformulierungen,<br />
die das Abendmahl als Opfer<br />
kennzeichnen, das der Priester dem Vater<br />
darbringt.<br />
Im Südwesten gab es neben der Messe<br />
bereits eine andere Gottesdiensttradition:<br />
Weil die Messe oftmals ohne Predigt gehalten<br />
wurde, viele Priester auch weder die<br />
entsprechende Ausbildung noch Fähigkeit<br />
hatten zu predigen, wurden v.a. in den freien<br />
Reichsstädten Stellen geschaffen für sogenannte<br />
Prädikanten. Solche Prädikanten<br />
waren etwa die späteren Reformatoren Johannes<br />
Brenz in Schwäbisch Hall und Matthäus<br />
Alber in Reutlingen. Auf Anfrage lässt<br />
Luther Alber wissen: „Die bei euch geänderten<br />
Zeremonien gefallen mir gut. Auch<br />
wir haben Änderungen vorgenommen und<br />
6 7
auf Drängen unserer Nachbarn bereits<br />
hinausgegeben. Verändere nun aber bloß<br />
nicht deine Zeremonien wiederum nach<br />
unserem Vorbild, sondern bleibe bei dem,<br />
was du angefangen hast, unbedingt...“<br />
II. Ablauf<br />
Schauen wir uns den Ablauf unseres<br />
heutigen Gottesdienstes an:<br />
1. Sammlung und Anrufung<br />
Der Gottesdienst beginnt mit Geläut:<br />
Das Vorläuten ruft uns auf, die Arbeit niederzulegen<br />
und uns für den Gottesdienst<br />
vorzubereiten. Unter dem festlichen Geläut<br />
aller Glocken betreten wir die Kirche.<br />
Begrüßungen bringen ein Interesse aneinander<br />
zum Ausdruck. Das geschieht<br />
sinniger Weise beim Betreten der Kirche.<br />
Warum nicht z.B. durch Kirchengemeinderäte<br />
Der Glockenklang schützt die Stille des<br />
Einzelnen, der sich auf die Begegnung<br />
mit Gott einstimmt. Höhepunkt dieser<br />
stillen Vorbereitung ist das Gebet in der<br />
Bankreihe vor dem Platznehmen und dem<br />
Begrüßen der Nachbarn. Inhalt dieses Gebetes<br />
ist die Bitte um Segen für sich und die<br />
Gemeinde in dieser Stunde.<br />
Das Vorspiel der Orgel, anderer Instrumente<br />
oder eines Chors hilft uns zu innerer<br />
Sammlung und nimmt bereits das Thema<br />
des Gottesdienstes bzw. der Kirchenjahreszeit<br />
auf.<br />
Als Eingangslied der Gemeinde eignet<br />
sich an Festtagen ein dafür vorgesehenes<br />
Lied. Stets passend sind Pfi ngstlieder, in<br />
denen die Gemeinde um die Gegenwart<br />
des Geistes Gottes bittet, wie auch einige<br />
Morgenlieder, soweit sie nicht – ganz oder<br />
strophenweise – auf die wochentägliche<br />
Arbeit ausgerichtet sind.<br />
Die Gemeinde erhebt sich nun, nicht<br />
um Belehrungen oder Begrüßungen des<br />
Pfarrers entgegen zu nehmen, sondern in<br />
Ehrerbietung vor Gott, dessen Name über<br />
dem Sonntagsgottesdienst ausgerufen<br />
wird. Was nun geschehen soll, geschieht<br />
im Herrschaftsbereich und nach dem Willen<br />
Gottes. Deshalb feiern wir den Gottesdienst<br />
im Namen Gottes, nicht im Namen des<br />
Pfarrers oder im Namen eines Vorbereitungsteams.<br />
Der Ausrufung des Namens<br />
Gottes kann nun ein biblisches Votum folgen,<br />
etwa der Wochenspruch, der auf das Thema<br />
des Gottesdienstes hinweist.<br />
Der im Wechsel gesprochene Psalm ist<br />
nicht Zeichen eines verarmten Gebetslebens,<br />
das auf vorgeprägte Worte angewiesen wäre.<br />
Die Psalmen verbinden alle Christen aller<br />
Zeiten, Orte und Generationen, sie verbinden<br />
die Glaubenden des Alten und Neuen<br />
Testamentes, sie öffnen uns einen Raum in<br />
dem wir uns bergen können und bereichern<br />
durch ihre sprechenden Bilder auch unser<br />
freies Gebet. Auch Jesus hat das Psalmgebet<br />
gepfl egt – bis in die Todesstunde hinein.<br />
Im gesungenen „Ehr’ sei dem Vater“ bekennen<br />
wir in Dank und Anbetung, dass die<br />
Psalmen über ihren menschlichen Ursprung<br />
hinaus Wort des Dreieinigen Gottes sind.<br />
Unmittelbar schließt entweder ein Eingangsgebet<br />
an, in dem wir die Sorgen und<br />
Lasten des Alltags vor Gott ablegen, um<br />
nun innerlich frei unserem Gott begegnen<br />
zu können. Eine andere Möglichkeit ist das<br />
sogenannte Kollektengebet, das am Kirchenjahr<br />
orientiert ist und in einem trinitarischen<br />
Lobpreis endet. Es besteht nur aus einem<br />
einzigen langen Satz. Darin ist eine Bitte enthalten,<br />
die sich auf den Gottesdienst bezieht<br />
und zugleich über ihn hinausweist.<br />
Die Bedeutung des Stillen Gebetes lässt<br />
sich erkennen an seiner Vorform im Prädikantengottesdienst.<br />
Inhalt des Gebetes ist<br />
die Bitte um den Heiligen Geist für den, der<br />
Gottes Wort auszurichten hat, wie auch für<br />
die hörende Gemeinde.<br />
Durch ein biblisches Votum, etwa ein<br />
Psalmwort, wird das Stille Gebet abgeschlossen.<br />
Auch derjenige, der sein Gebet noch<br />
nicht beendet hat, darf seine Bitte in diesem<br />
Wort aufgehoben wissen.<br />
Das Glaubensbekenntnis fand sich im Lauf<br />
der liturgischen Entwicklung an unterschiedlichen<br />
Orten. Die Gottesdienstordnung von<br />
1982 sieht es vor der Lesung vor. Denkbar ist<br />
aber auch das Bekennen im Anschluss an<br />
die Lesung als Antwort auf das Evangelium.<br />
Der Bitte um Gottes Gegenwart im Stillen<br />
Gebet entspricht nun die Lesung des Wortes<br />
Gottes. Bei der Lesung wird es sich um<br />
eine Evangelienlesung, den Sonntagstext<br />
der Reihe 1 der Perikopenordnung handeln.<br />
Ist jedoch ein Evangelientext bereits<br />
Predigttext festgelegt, wird man aus den<br />
Reihen 2 bis 6 einen Brieftext oder einen<br />
alttestamentlichen Text auswählen. All diese<br />
Texte orientieren sich an dem Thema<br />
des Sonntags. Zur Lesung wird man die<br />
Altarbibel verwenden und durch den Ort<br />
an dem man spricht (Altar, ggf. Lesepult),<br />
durch Einleitung und Schlusswort deutlich<br />
machen, dass es sich um Gottes Wort<br />
handelt, das verlesen wird bzw. wurde (Hört<br />
als Lesung für den... Sonntag Gottes Wort<br />
aus.../ Selig sind, die Gottes Wort hören<br />
und bewahren).<br />
2. Verheißung und Weisung<br />
Das nun folgende Hauptlied bzw. Wochenlied<br />
nimmt wie Wochenspruch, Lesung<br />
und Predigttext das Sonntagsthema auf. Es<br />
kehrt jährlich am gleichen Sonntag wieder<br />
und zählt so zum Kernbestand evangelischen<br />
Liedgutes.<br />
Der Kanzelgruß („Gnade sei mit euch<br />
und Frieden...“) hatte im Prädikantengottesdienst<br />
seinen Sinn, insofern der ganze<br />
Gottesdienst von der Kanzel aus gehalten<br />
wurde. Wenn Liturg und Prediger unterschiedliche<br />
Personen sind, ist ein Kanzelgruß<br />
immer noch sinnvoll.<br />
Der Predigt liegt ein Predigttext zugrunde.<br />
Diesem, wie auch der Schrift als ganzer ist<br />
der Prediger verantwortlich im Bemühen,<br />
Gottes Wort der Gemeinde auszurichten.<br />
In diesem Sinne stellt der Prediger nicht seine<br />
eigenen Vorstellungen und Gedanken<br />
zur Disposition, sondern verkündigt unter<br />
denkbar höchster Autorität und Verantwortlichkeit<br />
Gottes Wort (Lk 10,16: „Wer euch<br />
hört, der hört mich“). Gottes Gesetz, das<br />
mir meine Sünde und mein Versagen aufdeckt,<br />
wird ebenso zur Sprache kommen,<br />
wie Gottes Gnade, die dem vorbehaltlos<br />
gilt, der Vergebung sucht. Schon die Bezeichnung<br />
„Predigtgottesdienst“ macht deutlich,<br />
dass diesem Teil des Gottesdienstes besondere<br />
Bedeutung zukommt. Die Predigt ist das<br />
offene Element des Gottesdienstes innerhalb<br />
eines liturgischen Gesamtrahmens.<br />
Im Lied nach der Predigt bekräftigt die Gemeinde<br />
den gepredigten Willen Gottes.<br />
3. Sendung und Segnung<br />
Im Allgemeinen Kirchengebet kommt das<br />
allgemeine Priestertum der Gemeinde zum<br />
Ausdruck: Sie steht hier für andere vor Gott.<br />
Das Gebet ist predigtunabhängig, kann aber<br />
ein Anliegen der Predigt ergänzend aufnehmen.<br />
Dabei ist das Gebet niemals Information,<br />
Indoktrination oder Selbstrefl exion,<br />
sondern Fürbitte. Die Fürbitte geschieht nun<br />
für die Kirche (Ausbreitung des Evangeliums,<br />
für die verfolgten Glaubensgeschwister), für<br />
die Welt (für Verantwortungsträger wie auch<br />
für die Schöpfung) und für die Bedürftigen,<br />
für die Alten, Kranken und Sterbenden.<br />
Im abschließenden Vaterunser, dem Gebet,<br />
das Jesu selbst lehrte und zu beten befahl,<br />
ist auch unser unausgesprochenes Bitten<br />
und Fürbitten zusammengefasst. Wie die<br />
Psalmen verbindet es uns mit den Jüngern<br />
Jesu Christi aller Zeiten. Das Vaterunserläuten<br />
nimmt auch die am Gottesdienstbesuch<br />
Verhinderten in die Gemeinschaft des Gebetes<br />
mit hinein.<br />
Das Schlusslied stärkt uns für die vor uns<br />
liegende Woche durch Segens-, Amen- oder<br />
Gloriastrophen. Geeignet sind oftmals die<br />
Schlussstrophen des Eingangs- oder Wochenliedes.<br />
Die Abkündigungen bringen die Leiblichkeit<br />
der Gemeinde zum Ausdruck:<br />
Opferzweck und Hinweis auf den nächsten<br />
Gottesdienst sind hier an rechter Stelle. Taufe,<br />
Trauung und Bestattung werden mit der<br />
Bitte um Fürbitte der Gemeinde mitgeteilt.<br />
Als kirchliche Veranstaltungsübersicht sind<br />
die Abkündigungen freilich missverstanden.<br />
Die ganze Fülle der Angebote einer Kirchengemeinde<br />
ist im Gemeindebrief oder auf<br />
der Homepage der Kirchengemeinde besser<br />
aufgehoben.<br />
8 9
Die Gemeinde erhebt sich nun noch<br />
einmal zur gesungenen Friedensbitte und<br />
um den Segen zu empfangen. Der Entlasssegen<br />
– der Aaronitische Segen oder<br />
ein trinitarisches Segenswort – ist nicht<br />
Abschiedsgruß, frommer Wunsch oder<br />
Bitte des Liturgen, sondern Gottes Segen,<br />
den er auf sein Volk zu legen befohlen hat.<br />
Unterstrichen wird dieser Gabecharakter<br />
des Segens durch die segnende Geste. Im<br />
glaubenden Bekennen singt die Gemeinde<br />
daraufhin das dreifache „Amen“.<br />
Sich zum Nachspiel noch einmal zu<br />
setzen ist nicht nur etwas für Orgelfreunde.<br />
Hier bietet sich die Gelegenheit die Gedanken<br />
zu sammeln und zu ordnen, bevor<br />
man sich im Hinausgehen dem Nachbarn<br />
zuwendet. Andernfalls verkommt das<br />
Nachspiel zum Geräuschteppich, der in<br />
Konkurrenz zur eigenen Stimme tritt.<br />
Die hiermit skizzierte Gottesdienstform<br />
ist die Grundform des Württembergischen<br />
Gemeindegottesdienstes. Der Abendmahlsgottesdienst<br />
ist dadurch aber nicht an den<br />
Rand gedrängt. Was beide Formen voneinander<br />
unterscheidet ist ihre Form von<br />
Öffentlichkeit. Gerhard Hennig formuliert:<br />
„Das Abendmahl ist keine unbegrenzte<br />
öffentliche Angelegenheit; unsere Predigtgottesdienste<br />
sind es“.<br />
III. Äußerlichkeiten<br />
Ist der Ablauf des Gottesdienstes damit in<br />
aller Kürze abgeschritten, bleiben vielleicht<br />
noch Fragen in Bezug auf Regelungen, die<br />
uns als „bloße Äußerlichkeiten“ erscheinen,<br />
denen wir aber bei genauem Hinsehen<br />
doch einen guten Sinn abgewinnen können.<br />
Dafür zum Schluss zwei Beispiele:<br />
1. Wieso geht der Pfarrer auf die Kanzel<br />
„Der ist doch auch nicht besser als wir!“<br />
Goldrichtig! Der Pfarrer ist ein Sünder wie<br />
ich und du. Deshalb steht er auch nicht<br />
für seine Person dort oben, sondern weil<br />
er uns Gottes Wort auszurichten hat. Und<br />
Gottes Wort, das uns zu Buße und Umkehr<br />
ruft und uns die Vergebung zusagt, steht<br />
tatsächlich über unserem Wort, und zwar<br />
himmelhoch. An diesen Auftrag erinnert<br />
übrigens die Taube, die sich als Symbol des<br />
Heiligen Geistes an der Unterseite vieler<br />
Kanzeldeckel befi ndet. Teilt uns der Pfarrer<br />
oder die Pfarrerin hingegen seine/ihre<br />
Privatgedanken mit, dürfen wir uns zurecht<br />
bzw. zu Unrecht abgekanzelt fühlen.<br />
2. Wieso hat der Pfarrer einen Talar an<br />
Der Talar ist eine Amtstracht – zugegeben.<br />
Diese Tracht ist Konvention – Übereinkunft,<br />
Sitte, Tradition. Der Talar ist kein<br />
Textil von Bekenntnisrang. Gut daran fi nde<br />
ich, dass der Talar den Pfarrer von der<br />
Frage entlastet, welches Outfi t er seiner<br />
Gemeinde zumuten möchte. Was tut der<br />
Pfarrer nicht sich und allen Mitfeiernden<br />
an, wenn seine Erscheinung Sonntag für<br />
Sonntag zur ästhetischen Provokation oder<br />
zum geschmacklichen Offenbarungseid<br />
wird. Nebenbei: Wenn ich den Mitliturgen<br />
an der Kleidung ansehe, dass sie gerne<br />
jagen, wandern oder joggen, dann kann<br />
ich vielleicht erahnen, wie sie den Sonntag<br />
begonnen haben, bzw. den Rest desselben<br />
gestalten werden. Die dadurch vermittelte<br />
Privatheit bringt mich aber nicht näher in<br />
die Gegenwart Gottes. Wir „feiern“ unseren<br />
Gottesdienst. Das darf auch äußerlich<br />
sichtbar werden.<br />
Abschließend können wir feststellen:<br />
Die Liturgie ist nicht vom Himmel gefallen,<br />
weshalb wir nicht sklavisch an sie gebunden<br />
sind. Zugleich hat sich gezeigt, dass<br />
sie einen guten Sinn hat. Wer sie versteht<br />
und mit ihr lebt, der möchte sie nicht mehr<br />
missen. Unsere „evangelische Freiheit“ wird<br />
also nicht durch die Liturgie abgeschnürt.<br />
Es ist vielmehr umgekehrt: Die verstandene<br />
Liturgie zeigt mir erst sinnvolle Variationsmöglichkeiten<br />
auf. In diesem Sinne sei<br />
wiederum mit Goethe geschlossen:<br />
„... das Gesetz nur kann uns Freiheit geben“.<br />
Literaturhinweise:<br />
- Liturgischer Wegweiser, in: Kirchenbuch für die<br />
Ev. Landeskirche in Württ., Teil 1, Stuttgart 1988.<br />
- Gerhard Hennig: Der evangelische Predigtgottesdienst<br />
in Württemberg, Stuttgart 2003.<br />
Zwischen Tradition<br />
und Erlebnisorientierung -<br />
Gottesdienste in alter und neuer Gestalt<br />
Die folgenden Ausführungen waren Teil<br />
eines umfangreicheren Vortrages, den<br />
Dr. Johannes Zimmermann bei einem<br />
Studientag für Pfarrerinnen und Pfarrer im<br />
Dezember 2003 in Stuttgart gehalten hat.<br />
Der Autor ist württembergischer Pfarrer und<br />
ab <strong>April</strong> <strong>2004</strong> wissenschaftlicher Geschäftsführer<br />
des Instituts zur Erforschung von<br />
Evangelisation und Gemeindeentwicklung<br />
in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern).<br />
Gottesdienst - Krise oder Boom<br />
Wie häufi g gehen Sie in die Kirche<br />
Auf diese Frage gaben nach der neuesten<br />
Mitgliedschaftsumfrage der EKD von 2002<br />
10% der Befragten an, den Gottesdienst jeden<br />
oder fast jeden Sonntag zu besuchen,<br />
weitere 13% ein- oder zweimal pro Monat.<br />
In bemerkenswertem Kontrast dazu stehen<br />
die kirchlichen Zählungen, die eher<br />
die Realität widerspiegeln dürften als die<br />
Selbsteinschätzungen. Am Sonntag Invokavit<br />
2001 wurde ein durchschnittlicher<br />
Gottesdienstbesuch von 3,9% der Kirchenmitglieder<br />
erhoben, seit mehreren Jahren<br />
liegen die Zahlen um die 4% . Deutlich<br />
höher, nämlich etwa vier mal so groß sind<br />
die Zahlen der römisch-katholischen Kirche<br />
(2001 waren es 15,9%).<br />
Betrachtet man diese Zahlen, kann<br />
man von einer Krise des Gottesdienstes<br />
sprechen, insbesondere des evangelischen<br />
Gottesdienstes. Nun ist die Rede von der<br />
Dr. Johannes Zimmermann<br />
Krise des Gottesdienstes nicht neu. Neu<br />
dürfte allerdings ein Traditionsabbruch sein,<br />
der vor allem in den Neuen Bundesländern,<br />
aber auch in Großstädten des Westens<br />
an die Substanz geht. Wo niemand<br />
den Gottesdienst mehr besucht, da ist<br />
er nicht nur in der Krise, sondern am<br />
Sterben.<br />
Es besteht auch wenig Hoffnung, dass<br />
die Leute wenigstens im Alter wieder den<br />
Weg in den Gottesdienst fi nden. Das<br />
mag vereinzelt vorkommen, aber Untersuchungen<br />
zeigen einen deutlichen<br />
Zusammenhang zwischen der Einübung in<br />
den Gottesdienst in der Kindheit und der<br />
späterer Verbundenheit mit Kirche. Wo also<br />
Menschen nicht schon als Kinder und Jugendliche<br />
einen Zugang zum Gottesdienst<br />
fi nden, kann dies auch für die Altersphase<br />
nicht einfach erwartet werden.<br />
Das ist freilich nur die eine Seite: der<br />
verschärften Krise des traditionellen Sonntagsgottesdienstes<br />
steht ein Boom anderer<br />
Gottesdienstformen gegenüber, die häufi g<br />
gut besucht sind: Gottesdienste am Heiligen<br />
Abend, Familiengottesdienste, Zweitgottesdienste,<br />
Schulanfängergottesdienste,<br />
Konfi rmationsgottesdienste und andere<br />
mehr. Während der Gottesdienstbesuch<br />
im Wochenzyklus – Sonntag für Sonntag<br />
- vielerorts am Schwinden ist, mancherorts<br />
fast am Verschwinden, sind Gottesdienste<br />
im Jahresrhythmus und im Lebensrhythmus<br />
nach wie vor gefragt.<br />
10 11
Den Gottesdienst reformieren -<br />
aber wie<br />
Sowohl die Krise des sonntäglichen<br />
Gottesdienstes wie der Boom der „besonderen“<br />
Gottesdienste hat vielerorts zu<br />
einer gewaltigen Reformwelle in Sachen<br />
Gottesdiensten geführt. Dies gilt v.a. dort,<br />
wo Zweitgottesdienste entstanden sind oder<br />
wo versucht wurde, Elemente dieser neuen<br />
Formen in den Sonntagvormittagsgottesdienst<br />
zu integrieren.<br />
Diese Reformbemühungen haben aber<br />
auch ganz neu die Frage aufgeworfen,<br />
was eigentlich ein Gottesdienst ist und was<br />
jenseits der konkreten Form sein eigentlicher<br />
Sinn und sein Ziel sein soll. Überprüft<br />
man unter diesen Fragestellung einmal das<br />
Neue Testament und die Antworten der<br />
Theologiegeschichte – was in diesem Heft<br />
an anderer Stelle geschieht -, dann ergeben<br />
sich vier Antworten:<br />
1. Der Gottesdienst ist ein Begegnungsgeschehen:<br />
Gott redet zu uns durch sein<br />
heiliges Wort, und wir antworten ihm im<br />
Gebet und Lobgesang (so Martin Luther).<br />
Von daher ist alles, was im Gottesdienst<br />
geschieht, zu befragen: Dient es der Begegnung<br />
mit Gott Wird Gottes Zusage,<br />
das Evangelium, laut Wird der Antwort<br />
des Menschen Raum gegeben<br />
2. Der Gottesdienst ist ausgerichtet auf<br />
die Gemeinschaft des Einzelnen und der<br />
Gemeinde mit Gott und untereinander.<br />
3. Er dient der Erbauung des Einzelnen<br />
und damit dem Aufbau der Gemeinde<br />
– also dem Gemeindeaufbau.<br />
4. Im Gottesdienst soll Gott die Ehre gegeben<br />
werden.<br />
Wenn wir diese Punkte als „Kern“ des<br />
Gottesdienstes festhalten, dann ergibt sich<br />
für die Gestaltung eine große Weite und<br />
Freiheit.<br />
Für Paulus ist das wichtigste Kriterium<br />
dabei die Liebe (vgl. 1Kor 8,1; 10,23;<br />
13,1ff.). Ihr muss sich alles andere ein- und<br />
unterordnen. Die Liebe fragt: Wie kann<br />
ich den Gottesdienst so gestalten, dass<br />
er dem Nächsten zur Erbauung, zur<br />
Gottesbegegnung dient Das müssen<br />
die sich fragen lassen, die ständig alles<br />
verändern wollen: Dient das wirklich dem<br />
andern Das müssen aber auch die sich<br />
fragen lassen, die jede Veränderung ablehnen<br />
und alles so lassen wollen wie es ist:<br />
Dient das wirklich dem andern<br />
Es dient sicher nicht der Erbauung, wenn<br />
wir so tun, als habe es vor uns keine richtigen<br />
evangelischen Gottesdienste gegeben,<br />
als seien wir die ersten, die begriffen<br />
hätten, wie rechter Gottesdienst aussieht.<br />
Es dient aber auch nicht der Erbauung,<br />
wenn wir nur unverändert fortschreiben,<br />
was unsere Väter und Mütter taten. Es dient<br />
nicht der Erbauung, die Tradition und die<br />
Geschichte, ihre Erfahrungen und ihren<br />
Reichtum außer Acht zu lassen. Unsere<br />
Aufgabe ist es aber auch nicht, was sie<br />
taten, wie in einem Museum zu bestaunen.<br />
Vielmehr besteht unsere Verantwortung<br />
darin, auf dem Fundament, auf dem sie<br />
bauten, so weiterzubauen, dass es dem<br />
Gemeindeaufbau heute dient. Dabei müssen<br />
wir sogar damit rechnen, dass das,<br />
was in einer früheren Zeit dazu diente, dass<br />
Menschen dem lebendigen Gott begegneten,<br />
heute diese Funktion nicht mehr erfüllt<br />
und schlimmstenfalls dieser Begegnung<br />
hinderlich sein kann.<br />
Wer soll > erbaut< werden<br />
Eine der Hauptfragen bei der Gestaltung<br />
eines Gottesdienstes ist: Wen sollen wir<br />
dabei im Blick haben Sollen wir zuerst auf<br />
die Kerngemeinde sehen, auf die treuen<br />
Gottesdienstbesucher, und darauf achten,<br />
dass für sie der Gottesdienst eine Heimat<br />
bleibt Es zeugt in der Tat von wenig Liebe,<br />
wenn man Gottesdienstbesucher vergrault<br />
und verärgert. Und eine Gefahr besteht<br />
darin, dass Dinge verändert für Leute, die<br />
nicht kommen, ohne zu wissen, ob dadurch<br />
überhaupt jemand Neues kommt.<br />
Und was bewirkt wird, ist, dass die, die bisher<br />
kamen, nicht mehr kommen. Trotzdem<br />
sollte unsere Liebe nicht auf die beschränkt<br />
bleiben, die schon in den Gottesdienst<br />
kommen.<br />
Dazu Martin Luther, der seine Überlegungen<br />
zur Gestalt des Gottesdienstes so<br />
zusammenfasst: Denn summa: Wir stellen<br />
diese Ordnung gar nicht um derjenigen willen<br />
auf, die bereits Christen sind; denn die<br />
bedürfen dieser Dinge keines … Aber um<br />
derjenigen willen muß man solche Ordnungen<br />
habe, die erst noch Christen werden<br />
oder es stärker werden sollen … Allermeist<br />
aber geschieht es um der Einfältigen und<br />
des jungen Volkes willen“ (Insel-Ausgabe<br />
V, 75).<br />
Während die genannten Personengruppen<br />
zu Luthers Zeiten noch eher im<br />
Gottesdienst zu fi nden waren, bedarf es<br />
heute intensiver Bemühungen, damit sie<br />
überhaupt kommen. Gleichwohl ist die<br />
Richtung klar: Die Frage der Gestaltung<br />
des Gottesdienstes soll zuerst diejenigen im<br />
Blick haben, die noch nicht Christen sind<br />
bzw. diejenigen, die es noch stärker werden<br />
sollen. Und konkret nennt Luther dann „die<br />
Einfältigen“ und das „junge Volk“. Darf ich<br />
es zugespitzt sagen: Unsere Gottesdienste<br />
sollten so gestaltet werden, dass<br />
die Konfirmanden sich darin Zuhause<br />
fühlen und gerne kommen, dass sie<br />
attraktiv, anziehend werden für solche,<br />
die der Kirche fern stehen. Ich hoffe,<br />
Sie spüren, was da für ein Sprengstoff drin<br />
steckt!<br />
Im Gegensatz dazu steht folgende Einstellung:<br />
Die andern dürfen gern in den<br />
Gottesdienst kommen, wir sind auch dafür,<br />
dass die Zahl der Gottesdienstbesucher zunimmt.<br />
Aber viele erwarten, dass die Gottesdienste,<br />
die für uns eine Heimat sind,<br />
genau so für andere zur Heimat werden.<br />
Und ein solches Denken ist lieblos. Statt zu<br />
fragen: Wie können wir ihnen den Zugang<br />
zum Gottesdienst erleichtern, bleiben wir<br />
selbstgefällig, wie wir sind. Ich sage „wir“,<br />
weil ich damit eine Mentalität meine, die in<br />
unseren Gemeinden weit verbreitet ist. Da<br />
gibt es Gemeinden, die wollen offen und<br />
missionarisch sein. Aber so, wie sie sind<br />
und sich verhalten, verhindern sie gerade<br />
das, was sie wollen. Statt den andern entgegenzukommen,<br />
verlangen sie von ihnen,<br />
dass sie genauso werden, wie sie selbst<br />
sind.<br />
Vielleicht ist das erste, was dran ist, auch<br />
gar nicht, dass wir die Gottesdienste verändern.<br />
Grundlegend ist eine Änderung<br />
unserer Einstellung. Die Liebe denkt zuerst<br />
an die andern, was ihnen dient, damit sie<br />
Christus begegnen können.<br />
Gottesdienst zwischen Tradition<br />
und Erlebnisorientierung<br />
Ein Kennzeichen unserer traditionellen<br />
Gottesdienste ist, dass sie vom regelmäßigen<br />
Vollzug leben. Es ist eine Form, in<br />
die man sich hineinfi nden muss, mit der<br />
man vertraut werden muss. Sie erschließt<br />
sich oft nicht beim ersten Mal, sondern<br />
erst allmählich. Dafür ist es eine Form,<br />
die man nicht ständig umkrempeln muss,<br />
sondern die eine Dauerhaftigkeit hat und<br />
zur Heimat werden kann. Ich nenne dieses<br />
Modell „Liturgiedidaktik“. Nach diesem<br />
Modell arbeitet weithin auch der Konfi r-<br />
12 13<br />
Reformmotor „Liebe“
mandenunterricht. Ich halte viel von Liturgiedidaktik.<br />
Für diejenigen, die regelmäßig<br />
zum Gottesdienst kommen, ist sie hilfreich.<br />
Das Problem beginnt, wenn Menschen nur<br />
selten kommen.<br />
Wie sollen wir darauf reagieren Wir<br />
könnten sagen: Du musst regelmäßig<br />
kommen, dann „bringt“ es dir etwas. So<br />
sehr ich mir das wünsche, dass Menschen<br />
regelmäßig kommen, nur wenige lassen<br />
sich derzeit darauf ein. Ich halte es deshalb<br />
für hilfreicher, zu denken: Wenn er oder<br />
sie auch nur einmal kommt, soll er etwas<br />
verstehen und mitnehmen können. Ich will<br />
nicht fordern: Du musst regelmäßig<br />
kommen!, sondern den Gottesdienst<br />
so gestalten, dass er von selbst wieder<br />
kommt, dass ihm der eine Gottesdienst<br />
Appetit auf mehr macht. Ja mehr noch,<br />
ich möchte den Gottesdienst so gestalten,<br />
dass ich gerne auch meine Nachbarn und<br />
Freunde dazu einladen kann. Das mag ein<br />
hoher Anspruch und ein weiter Weg sein,<br />
aber wir brauchen Ziele, die uns die Richtung<br />
angeben.<br />
Wie aber sieht ein Gottesdienst aus, der<br />
den Empfi ndungen und Gewohnheiten der<br />
Menschen heute entspricht Ich möchte es<br />
mit dem Stichwort „Erlebnisorientierung“<br />
bezeichnen. Eines der Kennzeichen ist, dass<br />
„unmittelbare Evidenz“ gefragt ist. Dem distanzierten<br />
und kirchenfernen Zeitgenossen<br />
genügt es nicht, wenn er gesagt bekommt,<br />
beim regelmäßigen Gottesdienstbesuch<br />
werde sich ihm das Geheimnis des Gottesdienstes<br />
erschließen. Heute erwarten<br />
Menschen, v. a. sog. „Distanzierte“, dass<br />
der Gottesdienst, an dem sie teilnehmen,<br />
für sie nachvollziehbar und für ihr Leben<br />
relevant ist. Sie fragen ganz einfach: Was<br />
bringt mir der Gottesdienst Um sie mit<br />
dem Evangelium zu erreichen, müssen<br />
wir uns auf ihre Interessen einlassen, auch<br />
auf ihre Sprachgewohnheiten und musikalischen<br />
Vorlieben. Hinter dem Bedürfnis<br />
nach Erlebnis steckt auch der Wunsch nach<br />
Ganzheitlichkeit. Das ist durchaus berechtigt:<br />
Der Glaube, die Gottesbeziehung ist<br />
nicht nur etwas für den Kopf, sondern umfasst<br />
den ganzen Menschen.<br />
Was aber bedeutet „Erlebnisorientierung“<br />
Heißt das, dass wir den Gottesdienst<br />
wie eine Unterhaltungsveranstaltung<br />
an ständig wechselnde Kundenbedürfnisse<br />
anpassen - frei nach dem Motto: Sie<br />
wünschen, wir spielen Hier tut sich ein<br />
Problem auf: Die Erlebnisorientierung ist<br />
ambivalent. Auf der einen Seite ist sie notwendig.<br />
Eine Gemeinde, die aus Liebe den<br />
Menschen entgegenkommen und sie dort<br />
abholen möchte, wo sie sind, wird nicht<br />
darum herumkommen.<br />
Auf der anderen Seite ist die „Erlebnisorientierung“<br />
auch keine neutrale Verpackung.<br />
Dazu Manfred Josuttis: „Wer sich<br />
dem Diktat der Erlebnisgesellschaft<br />
unterwirft, hat schon verloren“. Er begibt<br />
sich in den Zwang, immer neue und<br />
bessere Erlebnisse produzieren zu müssen.<br />
Heute ist es ein Anspiel, morgen braucht<br />
man eine Band, und übermorgen muss<br />
ein Elefant in den Gottesdienst, um etwas<br />
Neues und ansprechendes zu bieten. Unter<br />
dem „Diktat der Spaßgesellschaft“ wird der<br />
Gottesdienst zum „event“, zu einer Unterhaltungsveranstaltung,<br />
die sich bruchlos an<br />
die Seite von Disco, Kino und Internet stellt<br />
und zum unverbindlichen Konsum einlädt.<br />
Ulrich H. Körtner formuliert es in einem<br />
anderen Zusammenhang noch pointierter:<br />
„Während manche Spielarten neureligiöser<br />
Spiritualität, aber auch der christlichen<br />
charismatischen Bewegungen ein religiöser<br />
Doppelgänger unserer heutigen Erlebnisgesellschaft<br />
sind, zeigt sich die Volkskirche<br />
als Spiegelbild unserer Konsum- und<br />
Versorgungsmentalität“. Die Folge: aus<br />
der Gemeinde wird das Publikum, aus<br />
dem Besucher der Kunde. Damit will<br />
ich mich in keiner Weise gegen eine<br />
phantasiereiche und kreative Gottesdienstgestaltung<br />
wenden! Es<br />
heißt auch nicht, dass die traditionellen<br />
Gottesdiensten frei<br />
von Gefährdungen wären.<br />
„Gottesdienst zwischen<br />
Tradition und Erlebnisorientierung“<br />
ist also keine rhetorische<br />
Frage, sondern eine Aufgabe, die sich<br />
jeder Zeit neu stellt. Sie führt zu einer Gratwanderung:<br />
Wir müssen uns auf legitime<br />
Erlebnisbedürfnisse unserer Mitmenschen<br />
einlassen - und uns zugleich billigen Anpassungserwartungen<br />
verweigern.<br />
Zielgruppenorientierung -<br />
missionarische Notwendigkeit<br />
oder Gefährdung der Einheit<br />
Seit langem gibt es bei uns Gottesdienste<br />
für spezielle Zielgruppen: Gottesdienste in<br />
Altersheimen und Krankenhäusern, Gottesdienste<br />
für Schüler, für Studierende und<br />
für Soldaten, Gottesdienste für Deutsche in<br />
Moskau und für Koreaner in Tübingen.<br />
Das Anliegen der „neuen“ Zielgruppenorientierung<br />
besteht in der Beobachtung,<br />
dass der bestehende Gottesdienst zwar den<br />
Anspruch hat, für alle da zu sein, aber faktisch<br />
nur einen Ausschnitt der Gesellschaft<br />
erreicht: „Empirisch gesehen finden die<br />
meisten evangelischen Gottesdienste<br />
als Zielgruppen-Gottesdienste statt,<br />
auch wenn dies oft … nicht bewußt<br />
ist“. Die „liturgische Form führt dazu, dass<br />
ältere Erwachsene aus der Kleinbürger- bis<br />
Mittelschicht zum Gros der Gottesdienstgemeinde<br />
gehören“ (Christian Grethlein).<br />
Die zunehmende Pluralisierung der<br />
Gesellschaft macht es schwer, wenn nicht<br />
sogar unmöglich, eine Gottesdienstform zu<br />
fi nden, die allen entspricht: „In einer pluralistischen<br />
Gesellschaft, in der Menschen<br />
verschieden gebildet sind und dementsprechend<br />
unterschiedliche<br />
Wahrnehmungs- und Kommunikationsformen<br />
pfl egen, droht für das gottesdienstliche<br />
Angebot die Gefahr, einzelne Gruppen<br />
besonders zu bevorzugen. „Es erscheint<br />
gegenwärtig … (fast) unmöglich, eine alle<br />
Menschen in unserem Land gleichermaßen<br />
ansprechende, d.h. (mit Luther) ‘zum Glauben<br />
reizende’ Veranstaltungsform zu fi n-<br />
den“ (Christian Grethlein). In der multikulturellen<br />
Gesellschaft wird man tatsächlich<br />
fragen müssen, ob es nicht einer Vielzahl<br />
von kulturell angepassten Angeboten bedarf,<br />
um alle zu erreichen.<br />
Gleichzeitig stellt sich mit der Zielgruppenorientierung<br />
die Frage, ob dadurch<br />
nicht die Gemeinde zerklüftet wird. Wird<br />
hier aus besten missionarischen Absichten<br />
etwas auseinander gerissen, was biblisch<br />
zusammengehört<br />
Zielgruppenorientierung steht in der<br />
Spannung zwischen 1Kor 14,19ff (wo Paulus<br />
die Verständlich keit für „Unkundige und<br />
Ungläubige“ einfordert) und 1Kor 9,20-22<br />
(„den Juden bin ich wie ein Jude geworden,<br />
… Ich bin allen alles geworden, damit ich<br />
auf alle Weise einige rette“) auf der einen<br />
und Gal 3,26-28 („hier ist nicht Jude noch<br />
Grieche … denn ihr seid allesamt einer<br />
in Christus Jesus“) auf der anderen Seite.<br />
Aber hüten wir uns vor einer falschen Alternative.<br />
Beides ist nötig: die Orientierung an<br />
den Zielgruppen - weil nur so Menschen<br />
in ihrer Situation erreicht werden - und das<br />
Überschreiten gesellschaftlicher Grenzen<br />
innerhalb der Gemeinde. Damit sage ich<br />
nicht, dass beides von einer bestimmten<br />
Gottesdienstform geleistet werden muss,<br />
wichtig ist, dass beides in einer Gemeinde<br />
im Blick ist und angestrebt wird. Wie und<br />
wo, das kann je nach Situation variieren.<br />
Die Frage nach der missionarischen Öffnung<br />
durch Zweitgottesdienste muss also<br />
immer auch in Verbindung mit der Frage<br />
nach der Einheit der Gemeinde gesehen<br />
werden. Wo eine bestehende Gemeinde<br />
über den Streit um angemessene missionarische<br />
Formen und Methoden zerbricht und<br />
uneins wird, nimmt auch die Glaubwürdigkeit<br />
nach außen und damit zugleich die<br />
14 15
missionarische Ausstrahlung Schaden.<br />
Schon in der Bibel gibt es aber auch<br />
den Fall, dass es besser ist, auseinander zu<br />
gehen, als in ständigem Konfl ikt zu leben.<br />
Aber der Idealfall ist das nicht. Der Idealfall<br />
ist es nicht, wenn ein Zweitgottesdienst<br />
entsteht, weil die Frömmigkeitsstile in einer<br />
Gemeinde so auseinandergehen, dass sie<br />
nicht mehr im Gottesdienst zusammenfi n-<br />
den können.<br />
Zweitgottesdienste -<br />
Chancen und Grenzen<br />
Dazu drei Aspekte<br />
1. Einen kritischen Punkt bei fast allen<br />
Zweitgottesdiensten in unserem Umfeld sehe<br />
ich in der Frage der Regelmäßigkeit. Die<br />
hohen Ziele, die viele mit Zweitgottesdiensten<br />
verbinden, lassen sich mit einem Gottesdienst,<br />
der nur 5-6 mal, meinetwegen<br />
auch 10-12 Mal im Jahr stattfi ndet, kaum<br />
erreichen. Auch die Vorbilder in England<br />
und den USA feiern in der Regel häufi ger,<br />
wenn nicht sogar wöchentlich Gottesdienst.<br />
Findet der Gottesdienst nur in so großen<br />
Abständen statt, überwiegt der event-<br />
Charakter, der Gottesdienst ist das Außergewöhnliche.<br />
Gottesdienst soll sich aber<br />
dadurch auszeichnen, dass er im positiven<br />
Sinn etwas Gewöhnliches und Gewohntes<br />
darstellt.<br />
Natürlich ist mir bewusst, dass ein 14tägiger<br />
oder gar wöchentlicher Rhythmus<br />
bei den meisten Zweitgottesdiensten in<br />
Württemberg kaum denkbar ist. An vielen<br />
Orten sind die Mitarbeiter auch so schon<br />
an ihren Grenzen. Der hohe Aufwand für<br />
Werbung, Raumgestaltung, Anspiel, Imbiss<br />
usw. lässt sich nicht beliebig ausweiten. Aus<br />
diesem Grund sollte über „fl ankierende“<br />
Maßnahmen nachgedacht und darauf geachtet<br />
werden, dass der Zweitgottesdienst<br />
nicht alleine steht, sondern Teil des Gemeindeaufbaus<br />
ist.<br />
2. Zweitgottesdienste zwischen missionarischer<br />
Öffnung und profi lierter Frömmigkeit<br />
- so möchte ich einen weiteren Spannungsbogen<br />
bezeichnen. Fragt man die<br />
Mitarbeiter von Zweitgottesdiensten nach<br />
ihrem Ziel und ihrer Zielgruppe, so gibt es<br />
zwei Typen von Antworten:<br />
a) Die einen streben eine Öffnung an.<br />
Sie wollen einen bewusst missionarisch<br />
gestalteten Gottesdienst, der Gruppen erreicht,<br />
die vom traditionellen Gottesdienst<br />
nicht erreicht werden, häufi g Jugendliche<br />
oder junge Familien.<br />
b) Die anderen wollen Gottesdienste<br />
feiern, die ihnen entsprechen. Oft suchen<br />
sie einen Raum für ihren Frömmigkeitsstil,<br />
der für sie im traditionellen Gottesdienst zu<br />
wenig vorkommt: die einen liturgisch oder<br />
von Taizé her geprägt, andere erwecklich,<br />
wieder andere charismatisch.<br />
Ich halte beide Anliegen für berechtigt,<br />
sofern die Profi lierung eines Frömmigkeitsstils<br />
nicht mit einer arroganten Selbstgenügsamkeit<br />
verbunden ist. In der Praxis<br />
können beide Anliegen nahe beieinander<br />
liegen. Gleichwohl halte ich es für wichtig,<br />
sie zu unterscheiden. Wer missionarische<br />
Öffnung auf seine Fahnen schreibt,<br />
sollte selbstkritisch darauf achten, dass<br />
es sich nicht de facto um einen Rückzug<br />
in die Nische handelt, geprägt vom<br />
Wunsch, die eigene Frömmigkeit ungestört<br />
unter Gleichgesinnten pfl egen zu können.<br />
Dazu gehört auch die Frage nach dem<br />
Liedgut!<br />
3. Einen weiteren wichtigen Aspekt können<br />
wir von der Willow Creek-Gemeinde<br />
in Chicago lernen. Sie ist vor allem durch<br />
Gottesdienste für Kirchendistanzierte bekannt.<br />
Was aber nicht immer gesehen<br />
wird, ist, dass diese Gottesdienste Teil einer<br />
umfassenden Konzeption sind. Grundlage<br />
ist die Absicht, für andere einen Weg hin<br />
zum Glauben und in die Gemeinde zu<br />
gestalten. Das beginnt bei persönlichen<br />
Freundschaften, geht über persönliche Gespräche<br />
weiter zu Einladungen zum Gottesdiensten<br />
für Gäste. Kommen die Freunde<br />
regelmäßig, werden sie zu Glaubenskursen<br />
und dann in Kleingruppen eingeladen.<br />
Der Kreis schließt sich dann, wenn diese<br />
Freunde selbst zu Mitarbeitern werden und<br />
andere einladen. Innerhalb dieses Weges<br />
hat der Gottesdienst für Kirchendistanzierte<br />
seinen festen Platz. Wichtig ist nicht dieser<br />
Gottesdienst als solcher, sondern das Zusammenspiel<br />
aller Elemente.<br />
Kurzum: Ein gut besuchter Gottesdienst<br />
oder Zweitgottesdienst ist erfreulich, aber<br />
er braucht „fl ankierende Maßnahmen“, ein<br />
Vorfeld ebenso wie eine Weiterführung.<br />
Der Gottesdienst als<br />
Gestaltungsaufgabe<br />
Zum Gemeindeaufbau bedarf es wacher<br />
Augen, die die Realität unverstellt wahrnehmen.<br />
Es bedarf aber auch Augen des<br />
Glaubens, die auch in der Ärmlichkeit<br />
einer versammelten Gemeinde den<br />
Reichtum und die Herrlichkeit Gottes<br />
sehen. Und zugleich Augen, die von Gottes<br />
Reichtum her die Armut der Gemeinde erkennen.<br />
Anders formuliert: Beides ist wichtig:<br />
Situationen annehmen zu können, so wie sie<br />
sind - aber sich auch nicht zufrieden geben<br />
damit, dass eine Gemeinde unter ihren<br />
Möglichkeiten, Begabungen und Berufungen<br />
lebt. Beides ist nötig: eine Gelassenheit, die<br />
geduldig auf Gottes Wirken wartet, und eine<br />
geistgewirkte Unruhe, die die anstehenden<br />
Aufgaben erkennt und anpackt. Wir brauchen<br />
das Gebet - und wir brauchen Mitarbeiter,<br />
die bereit sind, sich von Gott in Dienst<br />
nehmen zu lassen.<br />
Das Wesentliche am Gottesdienst können<br />
wir nicht machen: Dass der lebendige Gott<br />
in unseren Gottesdiensten gegenwärtig ist,<br />
dass er Menschen begegnet, dass er Glauben<br />
weckt und stärkt.<br />
Wie aber wirkt der Heilige Geist Er wirkt<br />
in der Regel nicht unmittelbar, sondern durch<br />
Werkzeuge, durch „Instrumente“. In Verbindung<br />
mit Wort und Sakrament kann alles, was<br />
irgendwie mit dem Gottesdienst zu tun hat,<br />
zum „Instrument“ werden, dessen sich der Heilige<br />
Geist bedient: Der Raum, die Atmosphäre,<br />
die Musik, die Personen der Mitwirkenden, die<br />
Gemeinde. Das alles möchte ich sehr ernst<br />
nehmen. Der Heilige Geist soll „Instrumente“<br />
vorfinden, die brauchbar und nützlich sind!<br />
Darf ich das am Bild von Musikinstrumenten<br />
noch etwas weiterführen Mir ist<br />
dabei wohl bewusst, dass instrumentum im<br />
Lateinischen eine weitere Bedeutung hat im<br />
Sinne von Werkzeug, Mittel. Der Heilige<br />
Geist kann mit ungepflegten und ungestimmten<br />
Instrumenten gute Musik<br />
machen. Das spricht für ihn, aber nicht<br />
für die, die die Aufgabe haben, die<br />
Instrumente zu pflegen und zu warten.<br />
Unsere Aufgabe als Instrumentenwarte<br />
Gottes ist die Instrumentenpfl ege: Die gottesdienstlichen<br />
Instrumente sollen im bestmöglichen<br />
Zustand sein, geputzt, gestimmt,<br />
bereit für den Konzertauftritt. Noch ein<br />
wenig weitergeführt: Wer den gottesdienstlichen<br />
Instrumentenpark der Heiligen Geistes<br />
wartet, der hat die Aufgabe, bisweilen<br />
alte Instrumente auszurangieren und neue<br />
anzuschaffen. Die Instrumente sollen sinnvoll<br />
zusammenpassen, ein wohlklingendes<br />
Orchester ergeben. Ein Orchester, das<br />
zur Erbauung der Gemeinde und zur Ehre<br />
Gottes spielt.<br />
16 17
Theologie des Gottesdienstes<br />
Dr. Eberhard Hahn – Studienleiter<br />
Ein Gesandter des<br />
römischen Kaisers, Plinius,<br />
trifft im Jahr 110 an<br />
der Südküste des Schwarzen<br />
Meeres auf Christen und berichtet<br />
seinem Dienstherrn, Kaiser Trajan, von<br />
seinen Erkundigungen: „Sie versammeln<br />
sich gewöhnlich an einem festgesetzten<br />
Tag vor Sonnenaufgang und singen<br />
Christus als ihrem Gott im Wechsel Lob;<br />
und verpfl ichten sich mit einem Eid,<br />
nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen,<br />
sondern gerade zur Unterlassung von<br />
Diebstahl, Raub, Ehebruch, Treulosigkeit<br />
und Unterschlagung von anvertrautem<br />
Gut. Danach sei es bei ihnen Brauch gewesen,<br />
auseinanderzugehen und später<br />
wieder zusammenzukommen, um ein<br />
Mahl einzunehmen, allerdings ein ganz<br />
gewöhnliches und unschuldiges.“<br />
Das war für den Römer unübersehbar:<br />
Schon früh am Morgen kommen die<br />
Christen zusammen; mit Liedern preisen<br />
sie Christus als Gott; sie feiern miteinander<br />
das (Herren-)Mahl und wollen ein<br />
unanstößiges Leben führen.<br />
Plinius hat wesentliche Merkmale des<br />
christlichen Gottesdienstes entdeckt. Was<br />
er allerdings nicht wissen konnte: Das ist<br />
nur die eine Seite von Gottesdienst. Denn<br />
„Gottes-Dienst“ meint nicht nur unseren<br />
Dienst für Gott, sondern eben auch den<br />
Dienst Gottes an uns. Dabei kann es<br />
von der Heiligen Schrift her überhaupt<br />
keinen Zweifel geben: Das Entscheidende<br />
am christlichen Gottesdienst liegt in<br />
dem Wunder, dass Gott uns Menschen<br />
darin dient. Der allmächtige Gott lässt<br />
sich herab, um sich uns sündigen und<br />
schwachen Menschen gnädig zuzuwenden.<br />
Wo sich eine Gemeinde diesen<br />
Dienst gefallen lässt, wird sie befähigt,<br />
nun auch ihrerseits Gott zu dienen: Sie<br />
lobt ihn, sie hört auf seine Weisung, sie<br />
erbittet seine Hilfe. Dieser Dienst setzt sich<br />
über die gemeinsame Feier hinaus im<br />
Alltag fort. Die Begegnung mit Gott und<br />
seinem Heil gibt offene Augen, mutige<br />
Herzen, bereitwillige Beine und Hände,<br />
um anderen Menschen beizustehen.<br />
Dabei ist die richtige Reihenfolge von entscheidender<br />
Bedeutung: Am Anfang steht<br />
nicht die Aufgabe, sondern die Gabe:<br />
Gott beschenkt uns mit seiner Nähe, mit<br />
seiner Vergebung, mit seinem Geist. Wir<br />
pressen unser Lob nicht gezwungen aus<br />
uns heraus, sondern wir spiegeln lediglich<br />
seine Güte wider. Wir quälen uns nicht<br />
mit letzter Kraft zur Erfüllung des Liebesgebotes,<br />
sondern wir sind Kanäle der<br />
Liebe Gottes. Wo der Gottesdienst nicht<br />
im Zentrum der Gemeinde und des persönlichen<br />
Christenlebens steht, dort regiert<br />
bald Gesetzlichkeit, Krampf oder Zwang.<br />
Alles kommt darauf an, dass die Prioritäten<br />
richtig gesetzt werden.<br />
1. Gott dient uns.<br />
Der Gottesdienst hängt nicht an bestimmten<br />
Zeiten (z.B. Sonntagmorgen<br />
9.30 Uhr) oder an festgesetzten Orten (z.B.<br />
dem Kirchengebäude); Talar, Orgel oder<br />
Kanzel sind nicht grundlegend. Trotzdem<br />
spricht viel dafür, an einem vertrauten Ort<br />
und zu allgemein bekannter Stunde Gottesdienst<br />
zu halten; überkommene Formen<br />
können in jedem Fall hilfreich sein.<br />
Entscheidend jedoch ist, dass bei dieser<br />
Veranstaltung der Herr der Kirche zu Wort<br />
kommt. Nicht menschliche Vorstellungen<br />
über Gott und die Welt sind gefragt, sondern<br />
die Stimme des Guten Hirten. Zwar<br />
redet Jesus nicht sichtbar selbst. Aber die<br />
Verkündigung seines Wortes geschieht auf<br />
der Basis seiner Zusage an die Jünger:<br />
„Wer euch hört, der hört mich“ (Lk 10,16).<br />
Kein Verkündiger könnte es jemals wagen,<br />
Gottes Wort weitersagen zu wollen,<br />
wenn sein Dienst nicht von dieser Verheißung<br />
und diesem Auftrag getragen wäre.<br />
Darum aber hat jeder Prediger größte<br />
Sorge dafür zu tragen, dass er mit seinem<br />
Wort das Wort des Herrn nicht verdunkelt<br />
oder gar verfälscht. Denn durch das gepredigte<br />
Wort will Gott Heil schaffen. Dadurch<br />
sollen die großen Taten Gottes ins Gedächtnis<br />
gerufen werden: die Versöhnung<br />
mit Gott in Jesus Christus, aber auch seine<br />
Schöpfung und Erhaltung der ganzen Welt,<br />
seine Geschichte mit Israel. An Gottes<br />
Verheißungen soll erinnert werden: an die<br />
Vollendung seines Heils durch die Wiederkunft<br />
Christi; aber auch an seine fürsorgende<br />
Gegenwart im Leben der einzelnen<br />
Christen und seiner Gemeinde.<br />
Indem Gottes Wort verkündigt wird, übt<br />
es seine Wirkung aus: der Heilige Geist<br />
schließt Menschen das Herz auf, enthüllt<br />
ihnen ihre Sünde, lässt sie die Vergebung<br />
in Anspruch nehmen, vertreibt ihre Sorgen,<br />
festigt ihr Vertrauen und ihre Hoffnung.<br />
Doch es geschieht auch das Umgekehrte:<br />
Menschen verschließen sich gegenüber der<br />
Güte Gottes. Nicht nur der Glaube, auch<br />
der Unglaube ist Hinweis auf die Wirkung<br />
des Wortes Gottes.<br />
Was Gott uns zusagt und was unverrückbar<br />
gilt, das bringt uns das Abendmahl<br />
spürbar nahe: Die Erinnerung an Jesu<br />
Leiden und Sterben wird dadurch lebendig.<br />
Zugleich schenkt sich uns der erhöhte<br />
Herr mit all seinen Gaben. Er vergewissert<br />
uns, dass wir zu ihm und seiner Gemeinde<br />
gehören. Er weitet unseren Blick auf das<br />
kommende Mahl in seinem Reich.<br />
Gott dient uns: Alles kommt darauf an,<br />
dass wir im Gottesdienst diesen Dienst suchen<br />
und für uns in Anspruch nehmen. Damit<br />
kein Zweifel darüber erwachsen kann,<br />
was hier geschieht und wer der eigentliche<br />
Gastgeber ist, wird am Beginn klar gestellt:<br />
„Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen<br />
Gottes, des Vaters und des Sohnes und des<br />
Heiligen Geistes.“ Denn vielfältig sind die<br />
Möglichkeiten, Gottes Dienst an uns aus<br />
den Augen zu verlieren: manche Formen<br />
sind alt; die Sprache ist teilweise langweilig<br />
oder schwierig zu verstehen; die Mitwirkenden<br />
verhalten sich oft allzu menschlich oder<br />
gar anstößig. Dessen ungeachtet will Gott<br />
genau dies: Uns dienen. Martin Luther hat<br />
deshalb ausdrücklich betont: Gott selbst ist<br />
es, der im Gottesdienst predigt, der tauft,<br />
der die Vergebung gewährt.<br />
2. Wir dienen Gott<br />
Unser wichtigster Dienst für Gott besteht<br />
darin, dass wir uns diesen Dienst Gottes<br />
an uns gefallen lassen. Wie das gemeint<br />
ist, macht die Fußwaschung Jesu in Joh 13<br />
deutlich: Es widerspricht unserem Verständnis,<br />
dass Jesus, der Meister, seinen Jüngern<br />
die Füße waschen und damit an ihnen den<br />
Dienst eines Sklaven verrichten soll. Genau<br />
das aber ist lebensnotwendig: „Wenn ich<br />
dich nicht wasche, so hast du kein Teil an<br />
mir“ (Joh 13,8) − so muss sich Petrus von<br />
Jesus erklären lassen, was hier geschieht.<br />
Wo wir uns aus Stolz oder falsch verstandener<br />
Demut den Dienst Gottes nicht gefallen<br />
18 19
lassen, dort bleiben wir von ihm getrennt.<br />
Das Entscheidende, das er dabei an uns<br />
tut, ist das: er reinigt uns von unseren<br />
Sünden. Wir ehren den allmächtigen Gott,<br />
indem wir uns von ihm beschenken lassen.<br />
Wer in dieser Weise von Gott beschenkt<br />
ist, der gehört nicht mehr sich selbst. Gottes<br />
überwältigender Gabe an uns entspricht<br />
unsere umfassende Hingabe an ihn. Auch<br />
diese fi ndet ihren Ausdruck im Gottesdienst:<br />
Zunächst geschieht dies im Bekenntnis<br />
unserer Sünde: wir erkennen und bekennen,<br />
dass wir nicht Gottes Ehre suchen,<br />
sondern unsere eigene; dass wir unsere<br />
eigenen Wege gehen, unseren eigenen<br />
Willen durchsetzen wollen. Wir bereuen<br />
dies und wenden uns ab vom Bösen, hin<br />
zu Gott.<br />
In der Hinwendung an Gott empfangen<br />
wir seine Vergebung: Wir preisen die umfassende<br />
Barmherzigkeit und Güte unseres<br />
Herrn, die uns „täglich alle Sünden reichlich<br />
vergibt“ (Luthers Auslegung des dritten<br />
Glaubensartikels). Dieser Lobpreis fi ndet<br />
seinen Ausdruck im Lied, im Gebet, im Bekenntnis<br />
des Glaubens.<br />
Der Dienst der Gemeinde schließt außerdem<br />
Bitte und Fürbitte ein: dass das<br />
Evangelium von Jesus Christus ausgebreitet<br />
werde; dass seine Kirche gefestigt und ermutigt<br />
werde, besonders dort, wo sie von<br />
innen oder außen angegriffen oder verführt<br />
wird; dass die Christen im Glauben gestärkt<br />
werden, gerade auch dann, wenn sie<br />
in Krankheit oder Leid auf die Probe gestellt<br />
werden; dass Gott auch weiterhin seine<br />
Schöpfung gegen alle Zerstörung und alles<br />
Chaos erhalten möge, bis er dann selbst<br />
die neue Welt schafft.<br />
Dienst für Gott meint jedoch nicht nur<br />
den Blick auf die Gegenwart. Vielmehr<br />
preist die Gemeinde Gott als den allmächtigen<br />
Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit; sie<br />
betet ihn an als den Zuverlässigen, der zu<br />
seinem Wort steht und sein Werk zu einem<br />
wundervollen Abschluss bringt. Sie bittet<br />
darum, dass Jesus Christus wieder kommt<br />
und sein Reich sichtbar aufrichtet.<br />
Wir kommen her, um dich zu suchen –<br />
du hast schon lange uns gesucht.<br />
Wir hoffen sehr, dich hier zu finden –<br />
du fandest uns längst auf der Flucht.<br />
Wir sitzen hier, um dich zu loben –<br />
du schenkst uns selbst das Lied dazu.<br />
Wir haben vor, dir hier zu dienen,<br />
doch wer vor allem dient, bist du.<br />
Wir kommen, um auf dich zu hören –<br />
du machst uns erst die Ohren frei.<br />
Wir mühen uns, mit dir zu reden –<br />
du stehst noch unserm Stammeln bei.<br />
Wir möchten dir ein Opfer bringen,<br />
doch unsre Hand füllst du allein.<br />
Wir wollen unsre Zeit dir geben –<br />
du lädst zur Ewigkeit uns ein.<br />
Du dienst uns, auch wenn wir das<br />
nie ganz verstehn.<br />
Du dienst uns, du Gott,<br />
um den sich Welten drehn.<br />
Du dienst uns –<br />
wir lassen es voll Dank geschehn,<br />
und darum dienen nun auch wir<br />
mit Freuden dir.<br />
Manfred Siebald<br />
Abdruck mit freundlicher Genehmigung<br />
des Hänssler-Verlags, Holzgerlingen<br />
In diesem Gottesdienst ist die einzelne<br />
Gemeinde vor Ort keine kleine Sondergruppe.<br />
Vielmehr wird gerade hier die<br />
Verbindung zu allen anderen Gliedern am<br />
Leib Christi besonders anschaulich: Das<br />
Lob des einen Gottes verbindet Gemeinden<br />
in der ganzen Welt miteinander − über<br />
alle äußerlichen Trennungen von Raum,<br />
Sprache oder Kultur hinweg. Dass dies<br />
nicht nur „frommer Wunsch“, sondern vom<br />
Heiligen Geist gewirkte Realität ist, kann<br />
jeder erkennen, der bei Begegnungen von<br />
Christen aus verschiedenen Ländern dabei<br />
ist: Selbst wenn die meisten Sprachen der<br />
anderen unbekannt sind, ist unübersehbar,<br />
dass die gemeinsame Ausrichtung auf den<br />
einen Herrn die verbindende Grundlage<br />
aller darstellt. Hörbar wird diese Einheit<br />
beim Namen „Jesus Christus“ oder beim<br />
gemeinsamen „Halleluja“ und „Amen“.<br />
Über die weltweite Verbindung der heute<br />
lebenden Christen hinaus weitet der Gottesdienst<br />
unseren Blick für Gottes Ewigkeit,<br />
für den himmlischen Gottesdienst, der sich<br />
ohne Unterlass vor Gottes Thron vollzieht.<br />
In Hebr 12,22ff wird den Christen gesagt:<br />
„Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und<br />
zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem<br />
himmlischen Jerusalem, und zu den vielen<br />
tausend Engeln, und zu der Versammlung<br />
und Gemeinde der Erstgeborenen, die<br />
im Himmel aufgeschrieben sind.“ Durch<br />
den Heiligen Geist werden wir mit diesem<br />
ewigen Gottesdienst verbunden und haben<br />
daran jetzt schon Anteil − selbst wenn<br />
unsere Ausdrucksformen noch sehr unzulänglich<br />
sind!<br />
3. Gott dient durch uns<br />
Obwohl im Zentrum des Gottesdienstes<br />
das steht, was Gott tut, so geschieht dies<br />
doch immer durch Menschen: sie predigen,<br />
taufen, teilen das Abendmahl aus.<br />
Ebenso ist alle Antwort darauf menschliche<br />
Antwort − im Bekenntnis, Lied, Gebet.<br />
Alles kommt jedoch darauf an, dass wir<br />
nicht am Vordergründigen stehenbleiben:<br />
Gottesdienste sind keine menschlichen Veranstaltungen;<br />
vielmehr will hier Gott selbst<br />
ans Werk und zu Wort kommen. Dabei<br />
gebraucht er Menschen, aber sie sind nicht<br />
die Initiatoren. Vor allem Gottesdienst der<br />
Gemeinde steht das, was Gott durch Jesus<br />
Christus für die Welt getan hat. Dies gilt<br />
nicht nur für den Gottesdienst am Sonntag,<br />
sondern auch für den Gottesdienst<br />
im Alltag: aller Dienst − für Gott und an<br />
Menschen − erfolgt aus dem Dienst Gottes<br />
an uns heraus. Darum gebührt nicht Menschen<br />
sondern ihm das Lob für alles, was in<br />
seinem Namen geschieht.<br />
Was Plinius vor Jahrhunderten beobachtet<br />
hat: Christen, die zusammen kommen,<br />
ihren Herrn loben, von ihm Wegweisung<br />
für ihr Leben erhalten, durch sein Mahl<br />
gestärkt werden und sich jetzt „mit Herzen,<br />
Mund und Händen“ in den Dienst ihres<br />
Gottes stellen – das macht bleibend den<br />
christlichen Gottesdienst aus.<br />
Die 7 Schwaben<br />
... hatten am 14. Februar zu ihrem Examensfest geladen.<br />
Nicht alle sind gebürtig aus dem Ländle, aber für<br />
Georg Steffens wird die Wahlheimat zur bleibenden<br />
Heimat: Er ist als Nordlicht in den pfarramtlichen Dienst<br />
der Württembergischen Kirche (Königsbronn) getreten.<br />
Zusammen mit ihm hat zum 1. März Markus Eißler<br />
(Weilheim/Teck) mit dem Vikariat begonnen. Karsten<br />
Beekmann wird die zweite Ausbildungsphase erst in<br />
einem halben Jahr antreten und in der Zwischenzeit<br />
als Tutor im ABH den Anfängerkonvent begleiten. Ihr<br />
Referendariat beginnen Karin Steinhilber und Alexandra<br />
Mannhardt. Als Dipl.Theol. kehrt Marika Schäfer in<br />
den Schuldienst zurück: an die Deutsche Schule in Neu<br />
Delhi/Indien. Juliane Simon, Diplomsozialpädagogin, ist<br />
bereits mitten im Missionspraktikum in Tansania.<br />
Vor dem Hintergrund einer zunehmend individualistischen<br />
Gesellschaft ist ein Blick auf den Familienstand<br />
unserer Abgänger nicht uninteressant: Vier unserer<br />
Examinierten sind verheiratet: Eißlers erwarten in diesen<br />
Tagen ihr drittes Kind. Die drei anderen haben ihren<br />
Partner fürs Leben im ABH kennengelernt.<br />
20 21
SchnupperTage<br />
22<br />
Wie begründen wir den biblischen Kanon<br />
Was macht eigentlich die Bibel zur Bibel Was<br />
für ein Prinzip steckt hinter der Sammlung der<br />
neutestamentlichen Schriften und warum können<br />
wir sie heute noch als Grundlage unseres<br />
Glaubens nehmen Darüber sprach in einem<br />
<strong>Haus</strong>vortrag der Dekan der Evangelisch-Theologischen<br />
Fakultät Tübingen Prof. Dr. Eilert Herms<br />
am 15. Januar.<br />
Von der Person zur Persönlichkeit<br />
Zum fünften Mal fand Mitte Februar das „Pastoral-<br />
und Personality-Training³ im ABH statt.<br />
Mittlerweile ist diese Persönlichkeitsschulung eine<br />
feste Institution des <strong>Bengel</strong>hauses geworden. In<br />
einer kleinen Gruppe werden die Herausforderungen<br />
des Pfarramts in den Blick genommen,<br />
heikle Themen und heiße Eisen angefasst und<br />
elementare Lebens- und Verhaltensregeln behandelt.<br />
Die Chance für Schüler<br />
der Oberstufe:<br />
Schnuppertage am<br />
1. und 2. <strong>Juni</strong> <strong>2004</strong><br />
im ABH<br />
für alle, die sich für ein<br />
Theologiestudium<br />
interessieren!<br />
Weitere Infos über das ABH im Internet<br />
unter: www.bengelhaus.de.<br />
Für Übernachtung ist gesorgt (Schlafsack<br />
und Iso-Matte bitte mitbringen).<br />
Die Kosten für Unterbringung und Verpfl<br />
egung übernimmt das ABH.<br />
Theologischer Austausch<br />
Der Februar und März sind für Theologen Konferenzmonate.<br />
Hier fi nden zahlreiche Tagungen<br />
für Theologen evangelikaler Ausbildungsstätten<br />
statt. So tagten z.B. die Facharbeitsgruppe Altes<br />
Testament in Hattingen und die FAG Neues Testament<br />
in Marburg (Bibelschule Tabor). Im ABH<br />
tagten die „Systematiker³ (Dozenten für Dogmatik<br />
und Ethik) und der Doktorandenkreis des<br />
AfeT (Arbeitskreis für evangelikale Theologie).<br />
Neben Vorträgen zu speziellen Forschungsthemen<br />
steht der Austausch über Literatur und theologische<br />
Entwicklungen im Vordergrund.<br />
Dienstag, 1. <strong>Juni</strong> <strong>2004</strong><br />
im ABH<br />
Bis 17.30 Uhr Anreise<br />
„Theologiestudium“ – was ist das<br />
eigentlich<br />
Ein Gesprächs- und Informationsabend<br />
rund um Theologie,<br />
Berufung und ABH<br />
Mittwoch, 2. <strong>Juni</strong> <strong>2004</strong><br />
Besuch von Vorlesungen an der<br />
Universität<br />
Rundgang durch Tübingen<br />
14.30 Uhr Abreise<br />
IHR SEID UNSERE GÄSTE!<br />
Anmeldungen ab sofort und bis<br />
spätestens 22. Mai <strong>2004</strong> an:<br />
A L B R E C H T- B E N G E L - H A U S<br />
L U D W I G - K R A P F - S T R A S S E 5<br />
7 2 0 7 2 T Ü B I N G E N<br />
T E L ( 0 7 0 7 1 ) 7 0 0 5 0<br />
F A X ( 0 7 0 7 1 ) 7 0 0 5 4 0<br />
I N F O @ B E N G E L H A U S . D E<br />
W W W. B E N G E L H A U S . D E<br />
HERZLICHE EINLADUNG ZUM<br />
THEOLOGISCHEN TAG<br />
SAMSTAG 8. MAI 2OO4<br />
WER OHNE SÜNDE IST ...<br />
FÜR DIE GEMEINDE<br />
9.30 Uhr Begrüßung und 1. Hauptreferat:<br />
„Gott, sei mir gnädig ...“<br />
Sünde und Vergebung nach Psalm 51<br />
(Hartmut Schmid)<br />
11.15 Uhr Seminare<br />
„Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein!“<br />
Schuld, Buße und Vergebung aus neutestamentlicher Sicht<br />
(Volker Gäckle)<br />
„Sobald das Geld im Kasten klingt ...“<br />
Verhängnisvolle Missverständnisse von Schuld und Sünde in der<br />
Theologiegeschichte (Joachim Kummer)<br />
„Wir sind alle kleine Sünderlein ...“<br />
Der (post)moderne Mensch und die Sünde (Rolf Hille)<br />
„Siehe, ich bin als Sünder geboren ...“<br />
Erbsünde – gibt‘s das wirklich (Eberhard Hahn)<br />
12.30 Uhr Mittagessen – Sie sind unsere Gäste<br />
13.30 Uhr 2. Hauptreferat:<br />
„Ich glaube die Vergebung der Sünden ...“ –<br />
Von Erkenntnis, Bekenntnis und Vergebung der<br />
Sünde (Eberhard Hahn)<br />
14.15 Uhr Was Sie schon immer mal wissen wollten! –<br />
Fragerunde mit den Lehrern des <strong>Bengel</strong>hauses<br />
15.00 Uhr Wort auf den Weg<br />
15.15 Uhr Ende<br />
A L B R E C H T - B E N G E L - H A U S<br />
T Ü B I N G E N<br />
L U D W I G - K R A P F - S T R A S S E 5<br />
7 2 0 7 2 T Ü B I N G E N<br />
T E L ( 0 7 0 7 1 ) 7 0 0 5 0<br />
W W W. B E N G E L H A U S . D E
Postvertriebsstück<br />
10403<br />
<strong>Albrecht</strong>-<strong>Bengel</strong>-<strong>Haus</strong><br />
Ludwig-Krapf-Str. 5<br />
72072 Tübingen<br />
Entgelt bezahlt<br />
Der Kreis schliesst sich...<br />
Christian Schwark mit Familie<br />
Pfarrer in Niederbiel (Wetzlar)<br />
Meine Zeit als “<strong>Bengel</strong>” ist nun schon über<br />
10 Jahre her. Aber immer noch profi tiere ich<br />
von den Erfahrungen, die ich im <strong>Bengel</strong>haus<br />
gemacht habe. Als Student wurde mir gerade<br />
durch die Beschäftigung mit bibelkritischen<br />
Ansätzen deutlich, dass ich der Bibel vertrauen<br />
möchte. Das war für mich auch ein<br />
Neuanfang mit Jesus. Es war mir damals eine<br />
große Hilfe, dass ich im <strong>Bengel</strong>haus Menschen<br />
gefunden haben, die mir Antworten<br />
auf meine Fragen gegeben haben. Was ich<br />
damals gelernt habe, prägt mich bis heute.<br />
Nach dem Studium konnte ich als Vikar und<br />
Pastor im Hilfsdienst bei Pfarrer Jürgen Blunck<br />
in Essen-Burgaltendorf (“Jesus-lebt-Kirche”)<br />
vieles über missionarischen Gemeindeaufbau<br />
lernen. In dieser Zeit hat Gott meiner Frau<br />
und mir zwei wunderbare Kinder geschenkt.<br />
Seit 1996 bin ich Pfarrer der Evangelischen<br />
Kirchengemeinde Niederbiel (bei Wetzlar). In<br />
der Gemeindearbeit sind neue Gottesdienste<br />
ein Schwerpunkt. Wir machen die Erfahrung,<br />
dass sich viele Menschen durch traditionelle<br />
Formen nicht mehr ansprechen lassen.<br />
Als Kirche haben wir zwei Möglichkeiten:<br />
Entweder beklagen wir, dass die Menschen<br />
heute nicht mehr kommen wollen. Oder wir<br />
gehen auf die Menschen zu. Z.B. durch neue<br />
Gottesdienstformen. Wohlgemerkt: neue<br />
Formen, nicht ein neues Evangelium. Unser<br />
Ziel ist, dass Menschen Jesus kennen lernen<br />
und mit ihm leben. Wir haben z.B. besondere<br />
Gottesdienste für junge Familien und das<br />
“Mittelalter”. Manchmal veranstalten wir Gottesdienste,<br />
die wir gemeinsam mit Vereinen<br />
vorbereiten. Die fi nden dann woanders statt,<br />
z.B. im Feuerwehr-Gerätehaus.<br />
Solche besonderen Gottesdienste sind oft ein<br />
besonderer “Glaubens-Test”. Da sitzt man in einer<br />
ganz kleinen Runde zusammen und denkt: Was<br />
kann daraus schon werden Sollen wir es nicht<br />
lieber lassen Aber wenn wir es im Vertrauen<br />
auf Gott riskieren, merken wir immer wieder: Er<br />
macht Großes aus unseren kleinen Anfängen. Wir<br />
staunen über die Gaben, die er schenkt. Gerade<br />
bei Leuten, denen man nicht so viel zutraut, kann<br />
man da viel erleben.<br />
Vor drei Jahren habe ich mich entschlossen,<br />
über das Thema “Gottesdienste für Kirchendistanzierte”<br />
zu promovieren. Ungewöhnlich für einen<br />
Pfarrer in einer ländlich geprägten Gemeinde,<br />
aber ich empfi nde das als Weg Gottes. In der Arbeit<br />
untersuche ich verschiedene Gottesdienstmodelle.<br />
Das gibt mir auch für die Gemeindearbeit<br />
viele gute Anregungen. Ich erlebe es als reizvolle<br />
Ergänzung, sich sowohl praktisch als auch theologisch<br />
mit dem Thema “Gottesdienst” zu beschäf-<br />
tigen. Im Wintersemester 2003/<strong>2004</strong> konnte ich<br />
während eines Studiensemsters im <strong>Bengel</strong>-<br />
haus wohnen. Auch diese<br />
Zeit war wieder sehr<br />
bereichernd für<br />
mich. So schließt<br />
sich der Kreis...